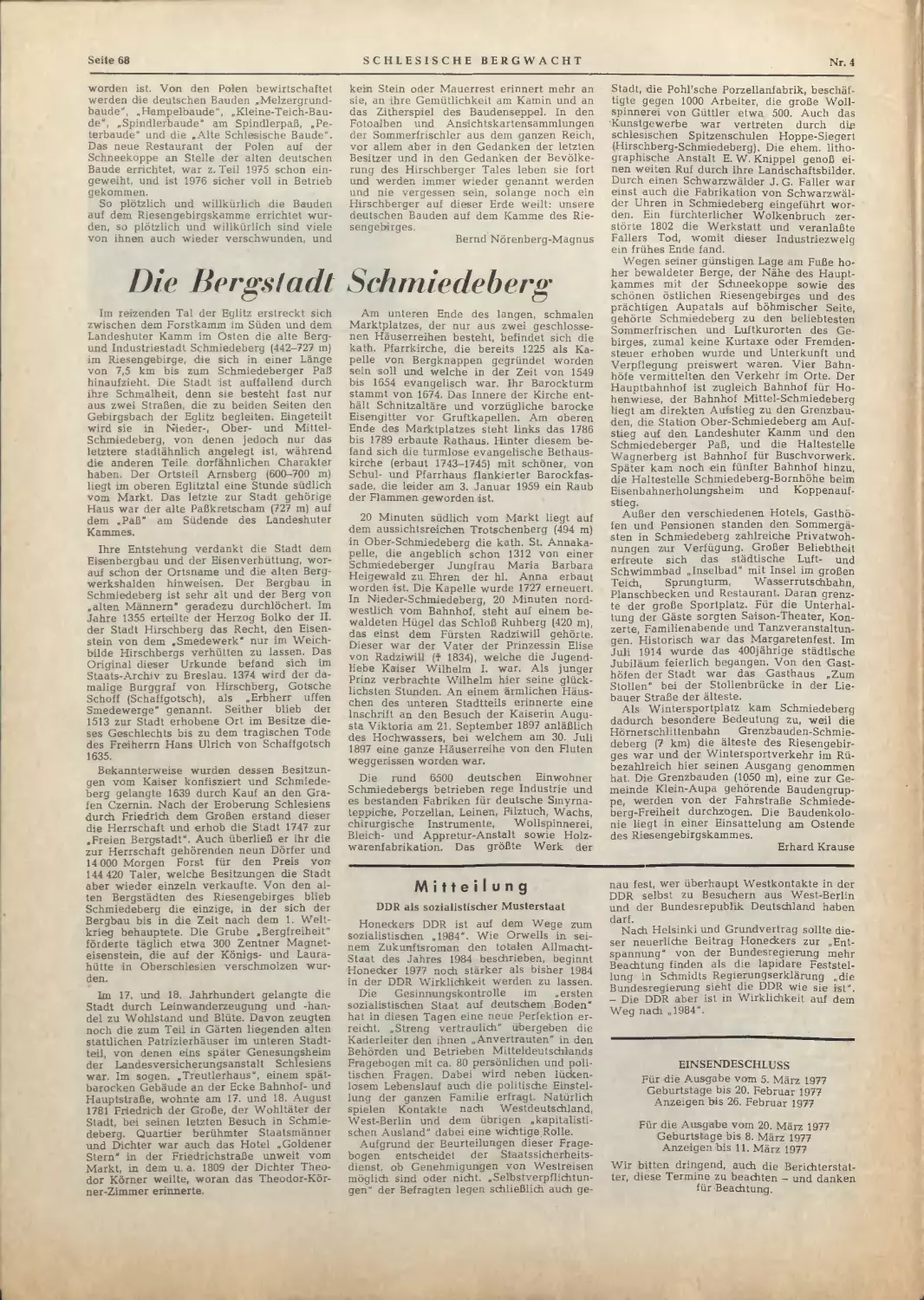Текст
Seite 68
SCHLESISCHE BERGWACHT
,
Nr.4
worden ist. Von den Polen bewirtschaftet
werden die deutschen Bauden .Melzergrund
baude", .Hampelbaude", "Kleine-Teich-Bau
de", .Spindlerbaude" am Spindlerpaß, .Pe
terbaude" und die .Alte Schlesische Baude".
Das neue Restaurant der Polen auf der
Schneekoppe an Stelle der alten deutschen
Baude errichtet, war z. Teil 1975 schon ein
geweiht, und ist 1976 sicher voll in Betrieb
gekommen.
So plötzlich und willkürlich die Bauden
auf dem Riesengebirgskamme errichtet wur
den, so plötzlich und willkürlich sind viele
von ihnen auch wieder verschwunden, und
kein Stein oder Mauerrest erinnert mehr an
sie, an ihre Gemütlichkeit am Kamin und an
das Zitherspiel des BaudenseppeI. In den
Fotoalben und Ansichtskartensammlungen
der Sommerfrischler aus dem ganzen Reich,
vor allem aber in den Gedanken der letzten
Besitzer und in den Gedanken der Bevölke
rung des Hirschberger Tales leben sie fort
und werden immer wieder genannt werden
und nie vergessen sein, solange noch ein
Hirschberger auf dieser Erde weilt: unsere
deutschen Bauden auf dem Kamme des Rie
sengebirges.
Bernd Nörenberg-Magnus
Die Hergstüd! Schmiedeberg
Im reizenden Tal der Eglitz erstreckt sich
zwischen dem Forstkamm im Süden und dem
Landeshuter Kamm im Osten die alte Berg
und Industriestadt Schmiedeberg (442-727 m)
im Riesengebirge, die sich in einer Länge
von 7,5 km bis zum Schmiedeberger Paß
hinaufzieht. Die Stadt "ist auffallend durch
ihre Schmalheit, denn sie besteht fast nur
aus zwei Straßen, die zu beiden Seiten den
Gebirgsbach der Eglitz begleiten. Eingeteilt
wird sie in Nieder-, Ober- und Mittel
Schmiedeberg, von denen jedoch nur das
letztere stadtähnlich angelegt ist, während
die anderen Teile dorfähnlichen Charakter
haben. Der Ortsteil Arnsberg (600-700 m)
liegt im oberen Eglitztal eine Stunde südlich
vom Markt. Das letzte zur Stadt gehörige
Haus war der alte Paßkretscham (727 m) auf
dem .Paß" am Südende des Landeshuter
Kammes.
Ihre Entstehung verdankt die Stadt dem
Eisenbergbau und der Eisenverhüttung, wor
auf schon der Ortsname und die alten Berg
werkshalden hinweisen. Der Bergbau in
Schmiedeberg ist sehr alt und der Berg von
.alten Männern" geradezu durchlöchert. Im
Jahre 1355 erteilte der Herzog Bolko der lI.
der Stadt Hirschberg das Recht, den Eisen
stein von dem .Smedewerk· nur im Weich
bilde Hirschbergs verhütten zu lassen. Das
Original dieser Urkunde befand sich im
Staats-Archiv zu Breslau. 1374 wird der da
malige Burggraf von Hirschberg, Gotsche
Schoff (Schaffgotsch), als .Erbherr uffen
Smedewerge" genannt. Seither blieb der
1513 zur Stadt erhobene Ort im Besitze die
ses Geschlechts bis zu dem tragischen Tode
des Freiherrn Hans Ulrich von Schaffgotsch
1635.
Bekannterweise wurden dessen Besitzun
gen vom Kaiser konfisziert und Schmiede
berg gelangte 1639 durch Kauf an den Gra
fen Czernin. Nach der Eroberung Schlesiens
durch Friedrich dem Großen erstand dieser
die Herrschaft und erhob die Stadt 1747 zur
.Freien Bergstadt". Auch überließ er ihr die
zur Herrschaft gehörenden neun Dörfer und
14000 Morgen Forst für den Preis von
144420 Taler, welche Besitzungen die Stadt
aber wieder einzeln verkaufte. Von den al
ten Bergstädten des Riesengebirges blieb
Schmiedeberg die einzige, in der sich der
Bergbau bis in die Zeit nach dem 1. Welt
krieg behauptete. Die Grube .Bergfreiheit"
förderte täglich etwa 300 Zentner Magnet
eisenstein, die auf der Königs- und Laura
hütte in Oberschlesien verschmolzen wur
den.
Im 17. und 18. Jahrhundert gelangte die
Stadt durch Leinwanderzeugung und -han
del zu Wohlstand und Blüte. Davon zeugten
noch die zum Teil in Gärten liegenden alten
stattlichen Patrizierhäuser im unteren Stadt
teil, von denen eins später Genesungsheim
der Landesversicherungsanstalt Schlesiens
war. Im sogen .• Treutlerhaus" , einem spät
barocken Gebäude an der Ecke Bahnhof- und
Hauptstraße, wohnte am 17. und 18. August
1781 Friedrich der Große, der W ohltä ter der
Stadt, bei seinen letzten Besuch in Sehrnie
deberg. Quartier berühmter Staatsmänner
und Dichter war auch das Hotel .Goldener
Stern" in der Friedrichstraße unweit vom
Markt, in dem u. a. 1809 der Dichter Theo
dor Körner weilte, woran das Theodor-Kör
ner-Zimmer erinnerte.
Am unteren Ende des langen, schmalen
Marktplatzes, der nur aus zwei geschlosse
nen Häuserreihen besteht, befindet sich die
kath. Pfarrkirche, die bereits 1225 als Ka
pelle von Bergknappen gegründet worden
sein soll und welche in der Zeit von 1549
bis 1654 evangelisch war. Ihr Barockturm
stammt von 1674. Das Innere der Kirche ent
hält Schnitzaltäre und vorzügliche barocke
Eisengitter vor Gruftkapellen. Am oberen
Ende des Marktplatzes steht links das 1786
bis 1789 erbaute Rathaus. Hinter diesem be
fand sich die turmlose evangelische Bethaus
kirche (erbaut 1743-1745) mit schöner, von
Schul- und Pfarrhaus flankierter Barockfas
sade, die leider am 3. Januar 1959 ein Raub
der Flammen geworden Ist.
20 Minuten südlich vom Markt liegt auf
dem aussichtsreichen Trotschenberg (494 m)
in Ober-Schrniedeberg die kath. St. Annaka
pelle, die angeblich schon 1312 von einer
Schmiedeberger Jungfrau Maria Barbara
Heigewald zu Ehren der h1. Anna erbaut
worden ist. Die Kapelle wurde 1727 erneuert.
In Nieder-Schmiedeberg, 20 Minuten nord
westlich vom Bahnhof, steht auf einem be
waldeten Hügel das Schloß Ruhberg (420 m).
das einst dem Fürsten Radziwill gehörte.
Dieser war der Vater der Prinzessin Elise
von Radziwill (t 1834). welche die Jugend
liebe Kaiser Wilhelm 1. war. Als junger
Prinz verbrachte Wilhelm hier seine glück
lichsten Stunden. An einem ärmlichen Häus
chen des unteren Stadtteils erinnerte eine
Inschrift an den Besuch der Kaiserin Augu
sta Viktoria am 21. September 1897 anläßlich
des Hochwassers, bei welchem am 30. Juli
1897 eine ganze Häuserreihe von den Fluten
weggerissen worden war.
Die rund 6500 deutschen Einwohner
Schmiedebergs betrieben rege Industrie und
es bestanden Fabriken für deutsche Smyrna
teppiche, Porzellan, Leinen, Filztuch, Wachs,
chirurgische Instrumente, Wollspinnerei,
Bleich- und Appretur-Anstalt sowie Holz
warenfabrikation. Das größte Werk der
Stadt, die Pohl'sche Porzellanfabrik, beschäf
tigte gegen 1000 Arbeiter, die große Woll
spinnerei von Güttler etwa 500. Auch das
"Kunstgewerbe war vertreten durch die
schlesischen Spitzenschulen Hoppe-Siegert
(Hirschberg-Schmiedeberg). Die ehern. litho
graphische Anstalt E. W. Knippel genoß ei
nen weiten Ruf durch ihre Landschaftsbilder.
Durch einen Schwarzwälder J. G. Faller war
einst auch die Fabrikation von Schwarzwäl
der Uhren in Schmiedeberg eingeführt wor
den. Ein fürchterlicher Wolkenbruch zer
störte 1802 die Werkstatt und veranlaßte
Fallers Tod, womit dieser Industriezweig
ein frühes Ende fand.
Wegen seiner günstigen Lage am Fuße ho
her bewaldeter Berge, der Nähe des Haupt
kammes mit der Schneekoppe sowie des
schönen östlichen Riesengebirges und des
prächtigen Aupatals auf böhmischer Seite,
gehörte Schmiedeberg zu den beliebtesten
Sommerfrischen und Luftkurorten des Ge
birges, zumal keine Kurtaxe oder Fremden
steuer erhoben wurde und Unterkunft und
Verpflegung preiswert waren. Vier Bahn
höfe vermittelten den Verkehr im Orte. Der
Hauptbahnhof ist zugleich Bahnhof für Ho
henwiese, der Bahnhof Mittel-Schmiedeberg
liegt am direkten Aufstieg zu den Grenzbau
den, die Station Ober-Schmiedeberg am Auf
stieg auf den Landeshüter Kamm und den
Schmiedeberger Paß, und die Haltestelle
Wagnerberg ist Bahnhof für Buschvorwerk.
Später kam noch ein fünfter Bahnhof hinzu,
die Haltestelle Schmiedeberg-Bornhöhe beim
Eisenbahnerholungsheim und Koppenauf
stieg.
Außer den verschiedenen Hotels, Gasthö
fen und Pensionen standen den Sommergä
sten in Schmiedeberg zahlreiche Privatwoh
nungen zur Verfügung. Großer Beliebtheit
erfreute sich das städtische Luft- und
Schwimmbad "Inselbad" mit Insel im großen
Teich, Sprungturm, WasserrutSchbahn,
Planschbecken und Restaurant. Daran grenz
te der große Sportplatz. Für die Unterhal
tung der Gäste sorgten Saison-Theater, Kon
zerte, Familienabende und Tanzveranstaltun
gen. Historisch war das Margaretenfest. Im
Juli 1914 wurde das 400jährige städtische
Jubiläum feierlich begangen. Von den Gast
höfen der Stadt war das Gasthaus "Zum
Stollen" bei der Stollenbrücke in der Lie
bauer Straße der älteste.
Als Wintersportplatz kam Schmiedeberg
dadurch besondere Bedeutung zu, weil die
Hörnerschlittenbahn Grenzbauden-Schmie
deberg (7 km) die älteste des Riesengebir
ges war und der Wintersportverkehr im Rü
bezahlreich hier seinen Ausgang genommen
hat. Die Grenzbauden (1050 m], eine zur Ge
meinde Klein-Aupa gehörende Baudengrup
pe, werden von der Fahrstraße Schmiede
berg-Freiheit durchzogen. Die Baudenkolo
nie liegt in einer Einsattelung am Ostende
des Riesengebirgskammes.
Erhard Krause
Mitteilung
DDR als sozialistischer Musterstaat
Honeckers DDR ist auf dem Wege zum
sozialistischen ,,1984". Wie Orwells in sei
nem Zukunftsroman den totalen Allmacht
Staat des Jahres 1984 beschrieben, beginnt
Honecker 1977 noch stärker als bisher 1984
in der DDR Wirklichkeit werden zu lassen.
Die Gesinnungskontrolle im "ersten
sozialistischen Staat auf deutschem Boden"
hat in diesen Tagen eine neue Perfektion er
reicht. "Streng vertraulich" übergeben die
Kaderleiter den ihnen "Anvertrauten" in den
Behörden und Betrieben Mitteldeutschlands
Fragebogen mit ca. 80 persönlichen und poli
tischen Fragen. Dabei wird neben lücken
losem Lebenslauf auch die politische Einstel
lung der ganzen Familie erfragt. Natürlich
spielen Kontakte nach Westdeutschland,
West-Berlin und dem übrigen "kapitalisti
schen Ausland" dabei eine wichtigeRolle.
Aufgrund der Beurteilungen dieser Frage
bogen entscheidet der Staatssicherheits
dienst, ob Genehmigungen von Westreisen
möglich sind oder nicht. "Selbstverpflichtun
gen" der Befragten legen schließlich auch ge-
nau fest, wer überhaupt Westkontakte in der
DDR selbst zu Besuchern aus West-Berlin
und der Bundesrepublik Deutschland haben
darf.
Nach Helsinki und Grundvertrag sollte die
ser neuerliche Beitrag Honeckers zur "Ent
spannung" von der Bundesregierung mehr
Beachtung finden als die lapidare Feststel
lung in Schmidts Regierungserklärung "die
Bundesregierung sieht die DDR wie sie ist".
- Die DDR aber ist in Wirklichkeit auf dem
Weg nach ,,1984".
EINSENDESCHL lJSS
Für die Ausgabe vom 5. März 1977
Geburtstage bis 20. Februar 1977
Anzeigen bis 26. Februar 1977
Für die Ausgabe vom 20. März 1977
Geburtstage bis 8. März 1977
Anzeigen bis 11. März 1977
Wir bitten dringend, auch die Berichterstat
ter, diese Termine zu beachten - und danken
für Beacntunq .