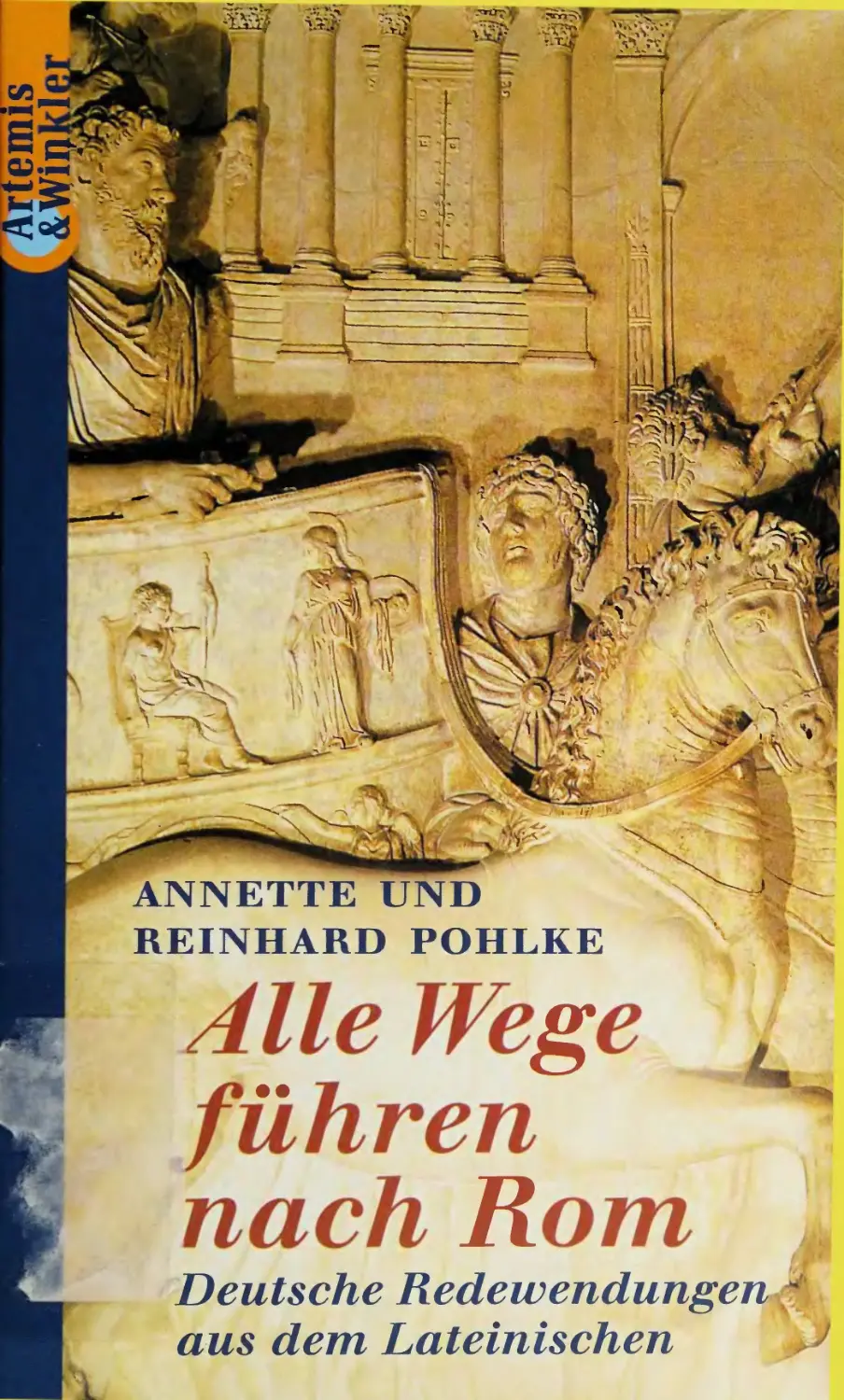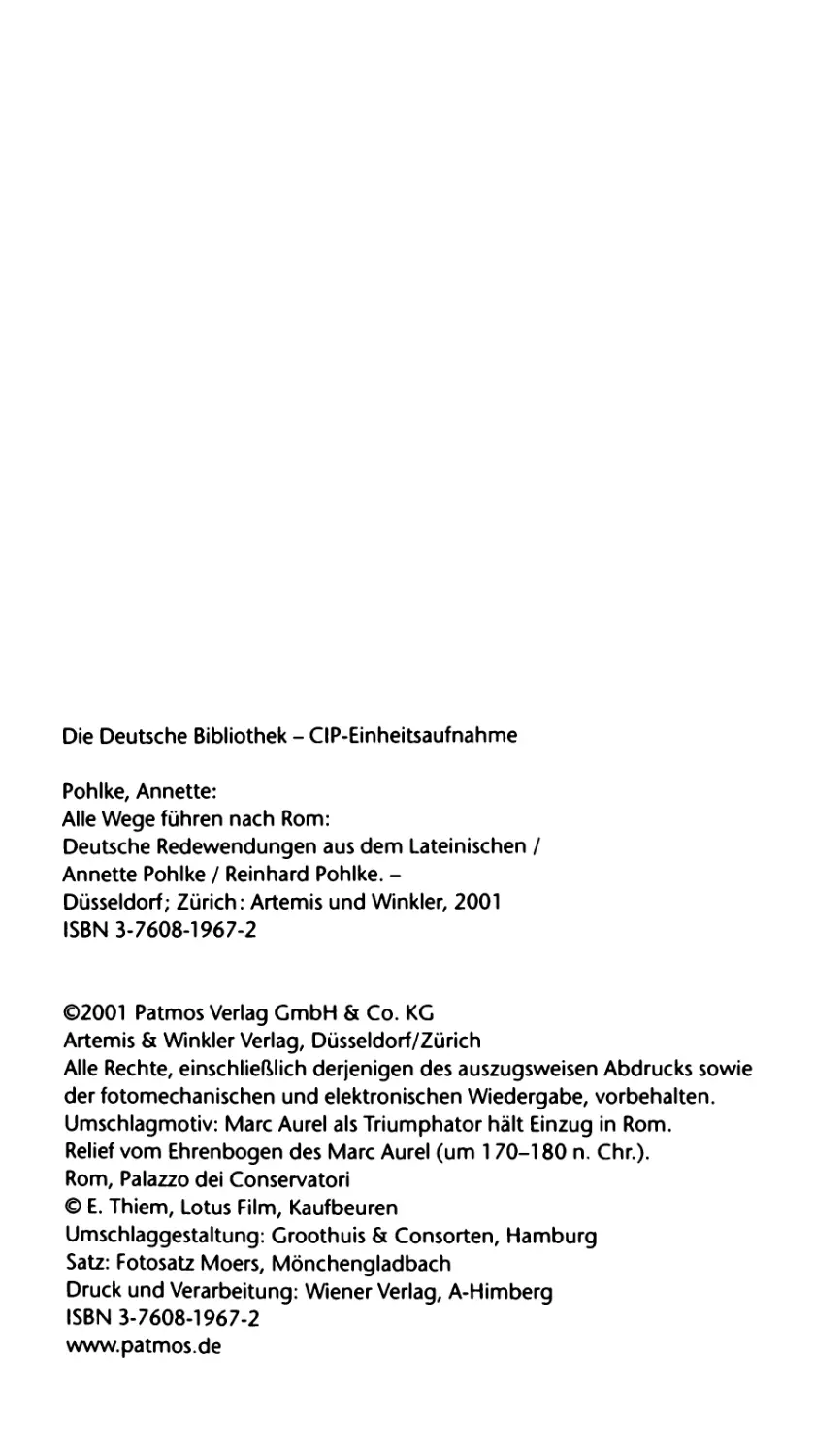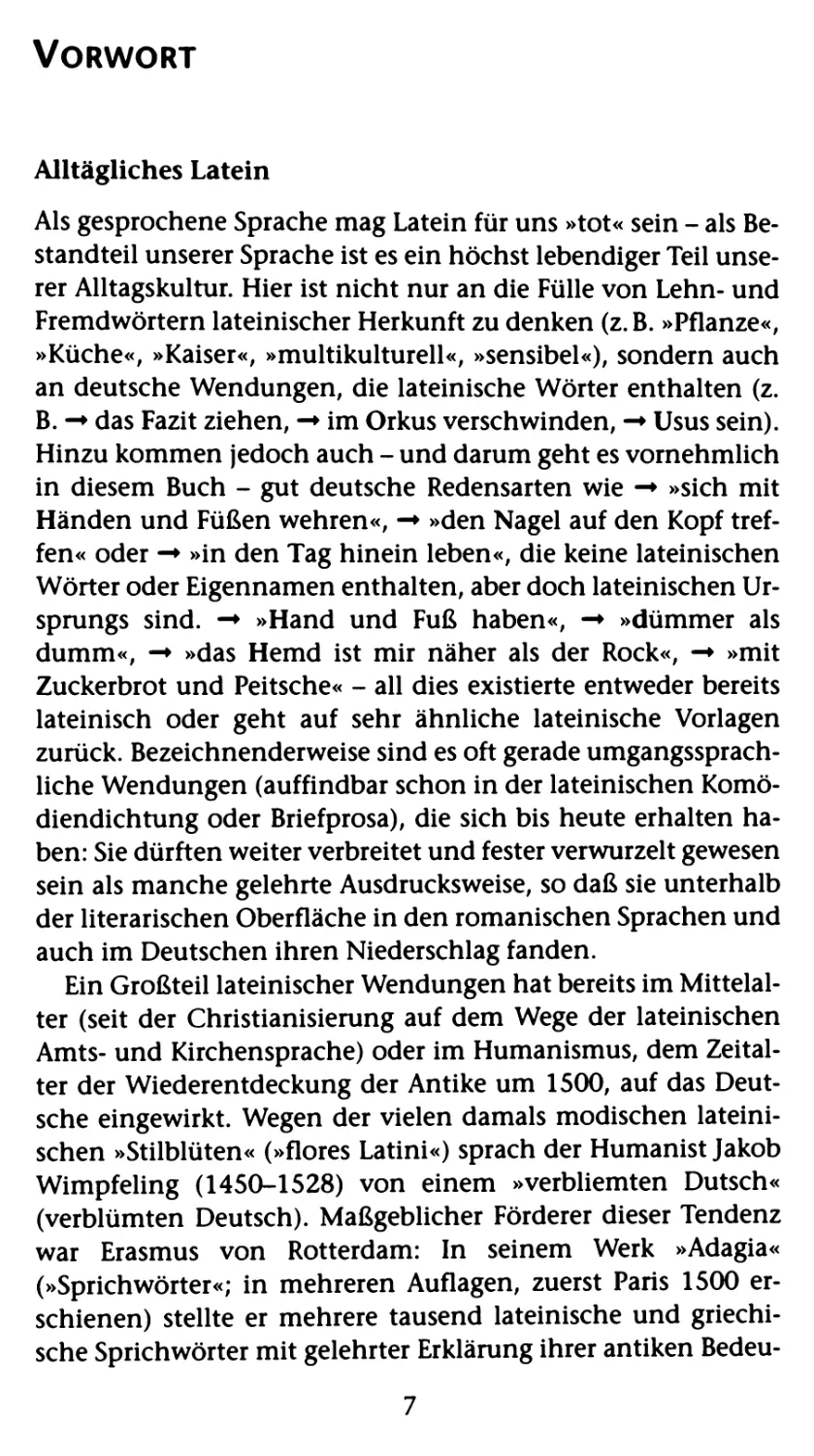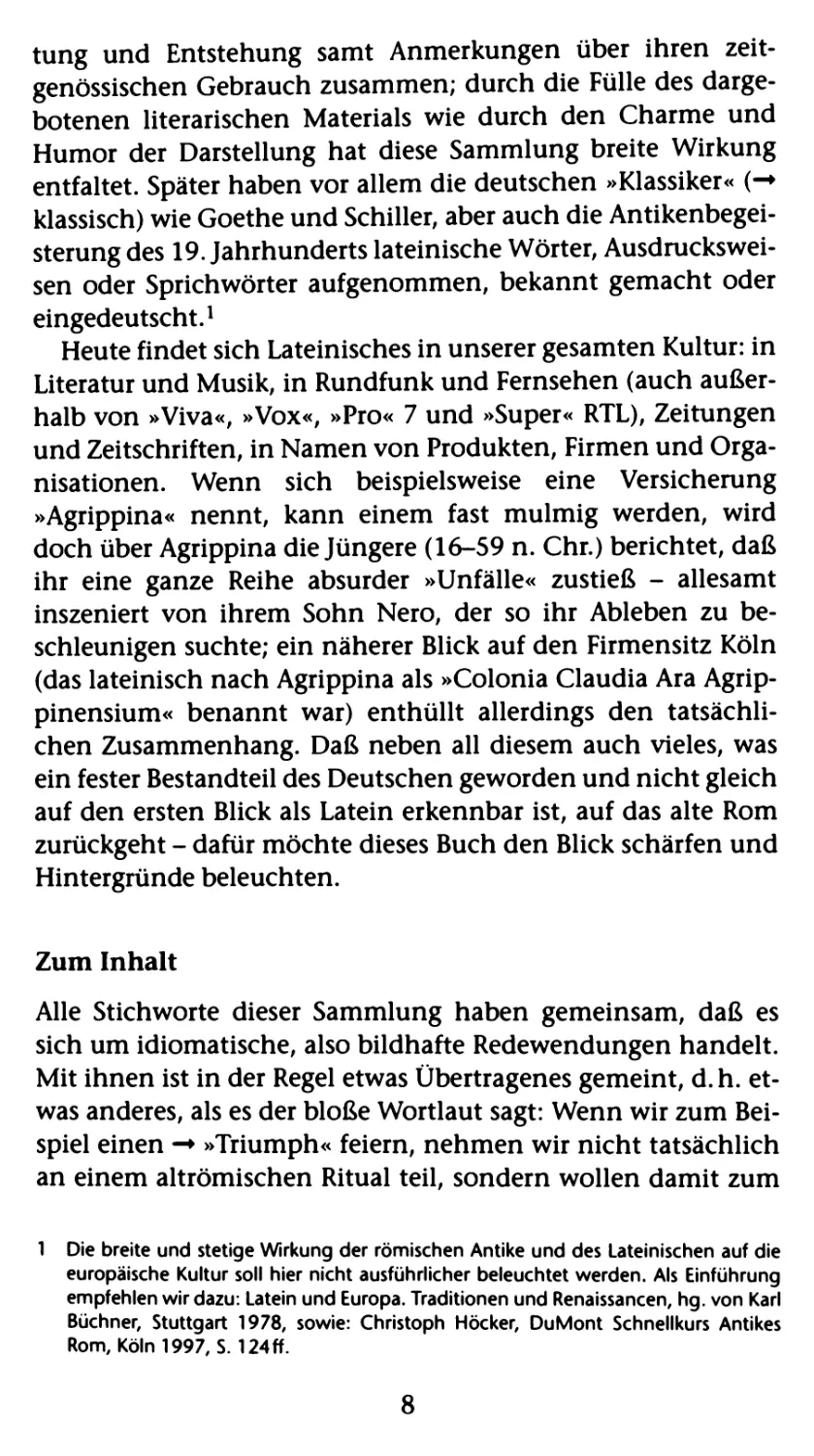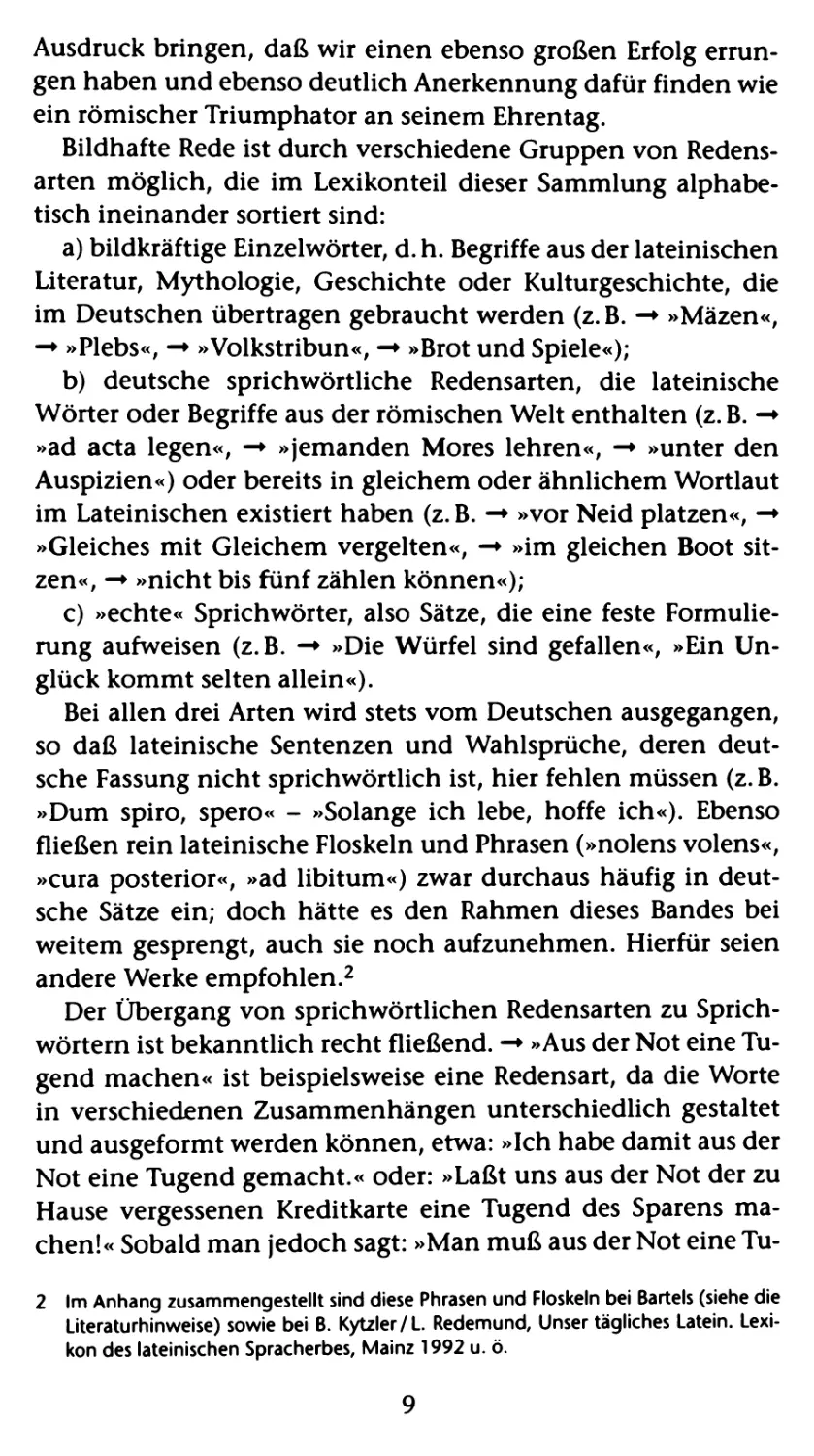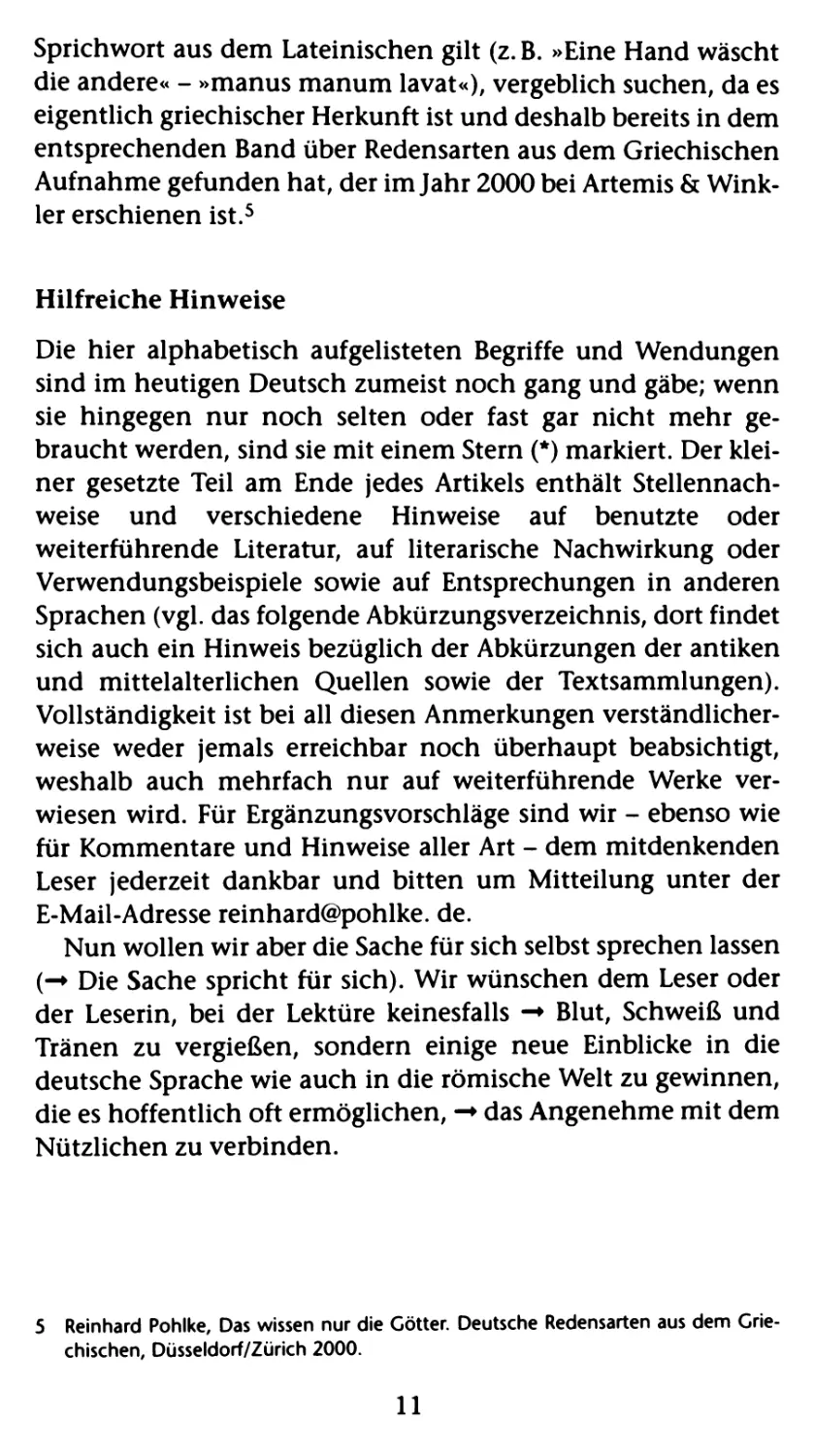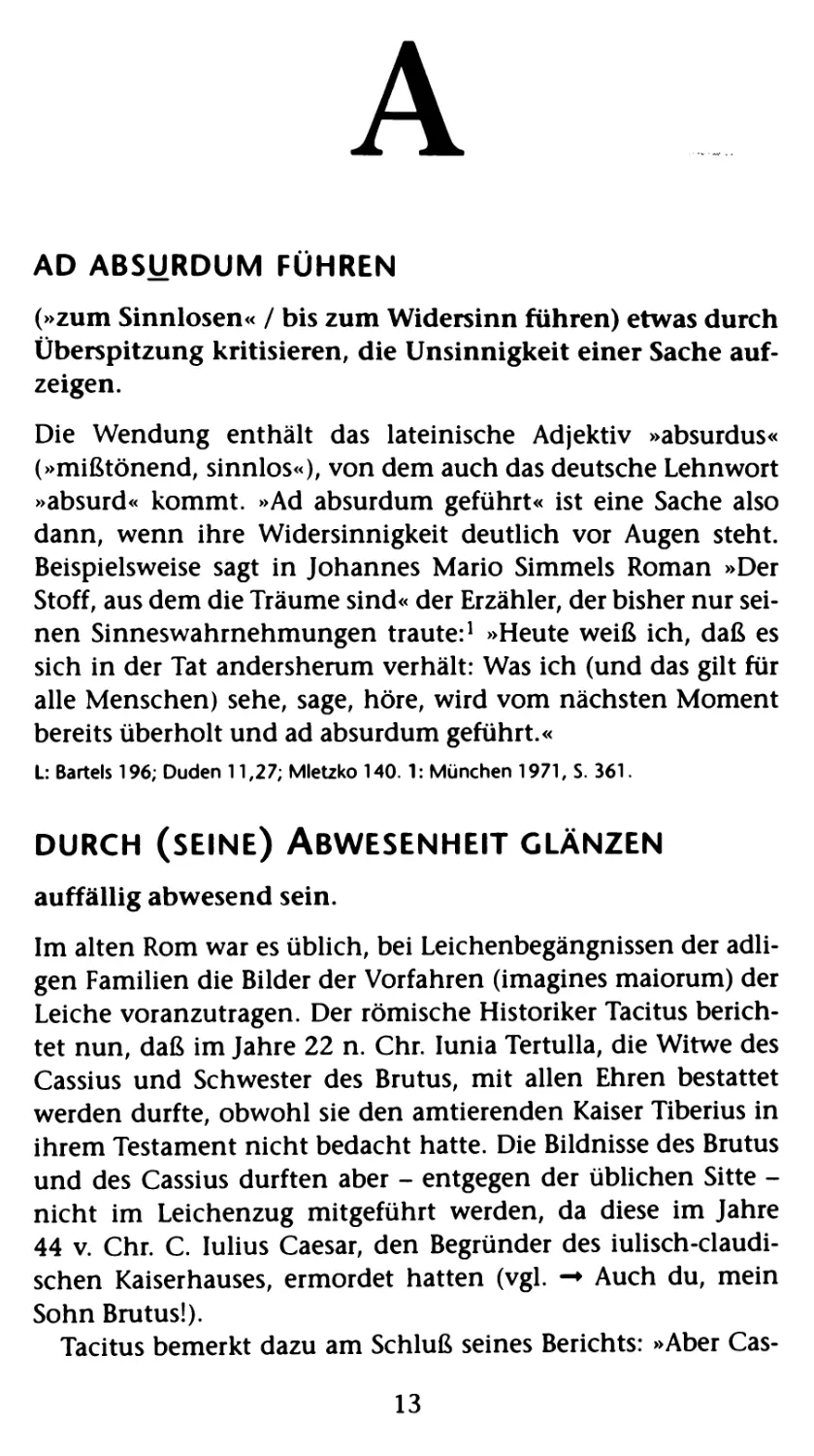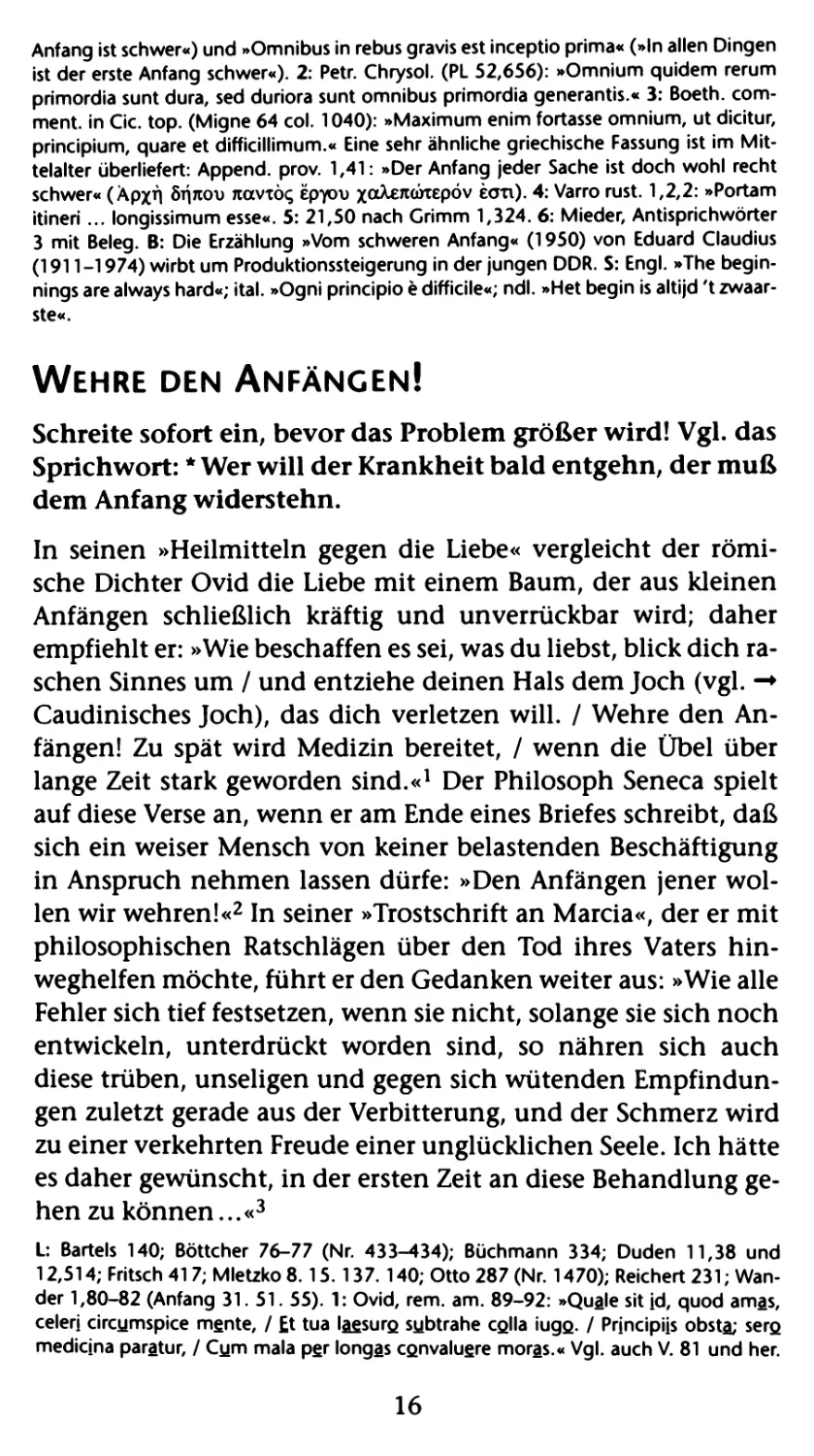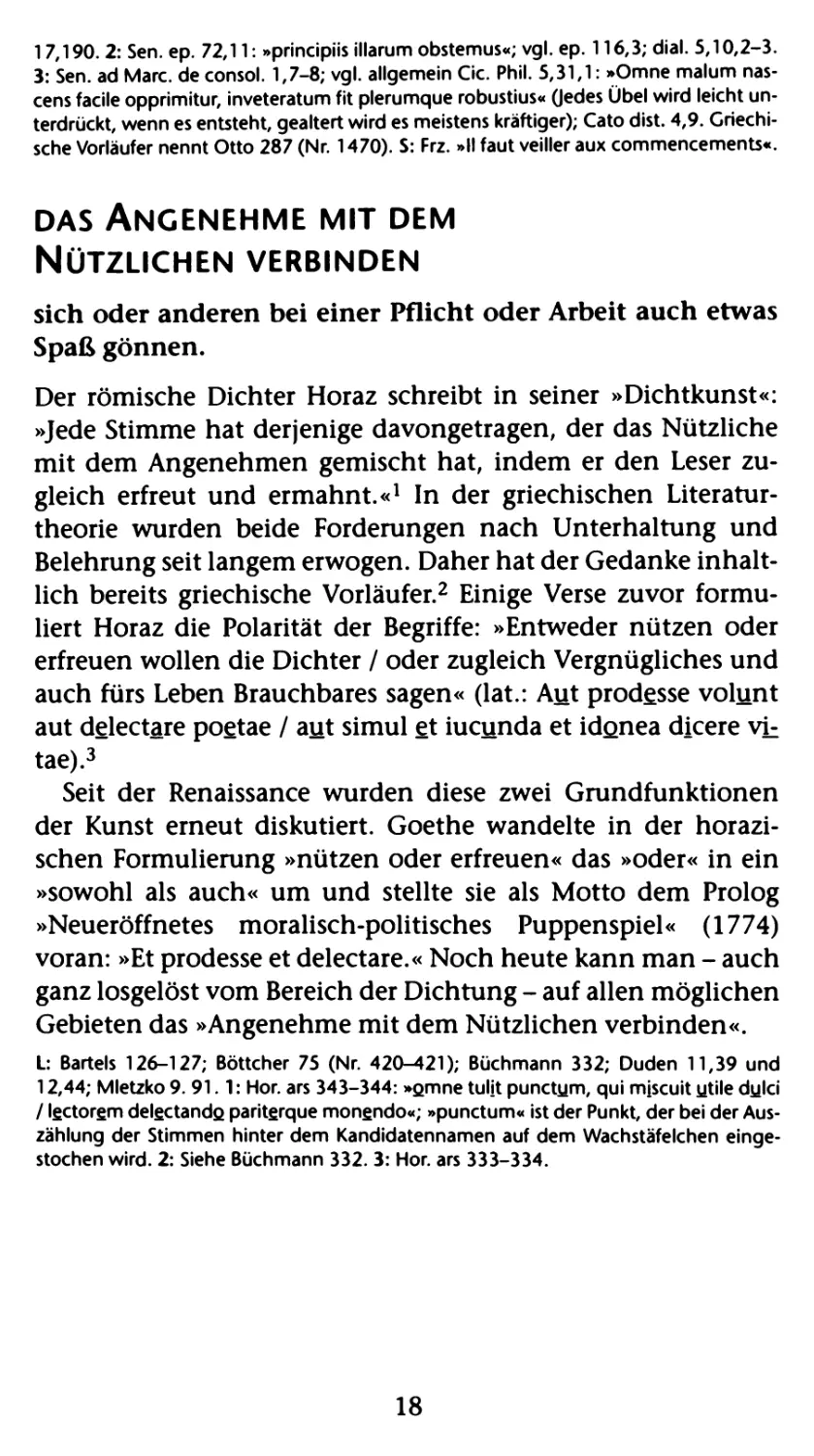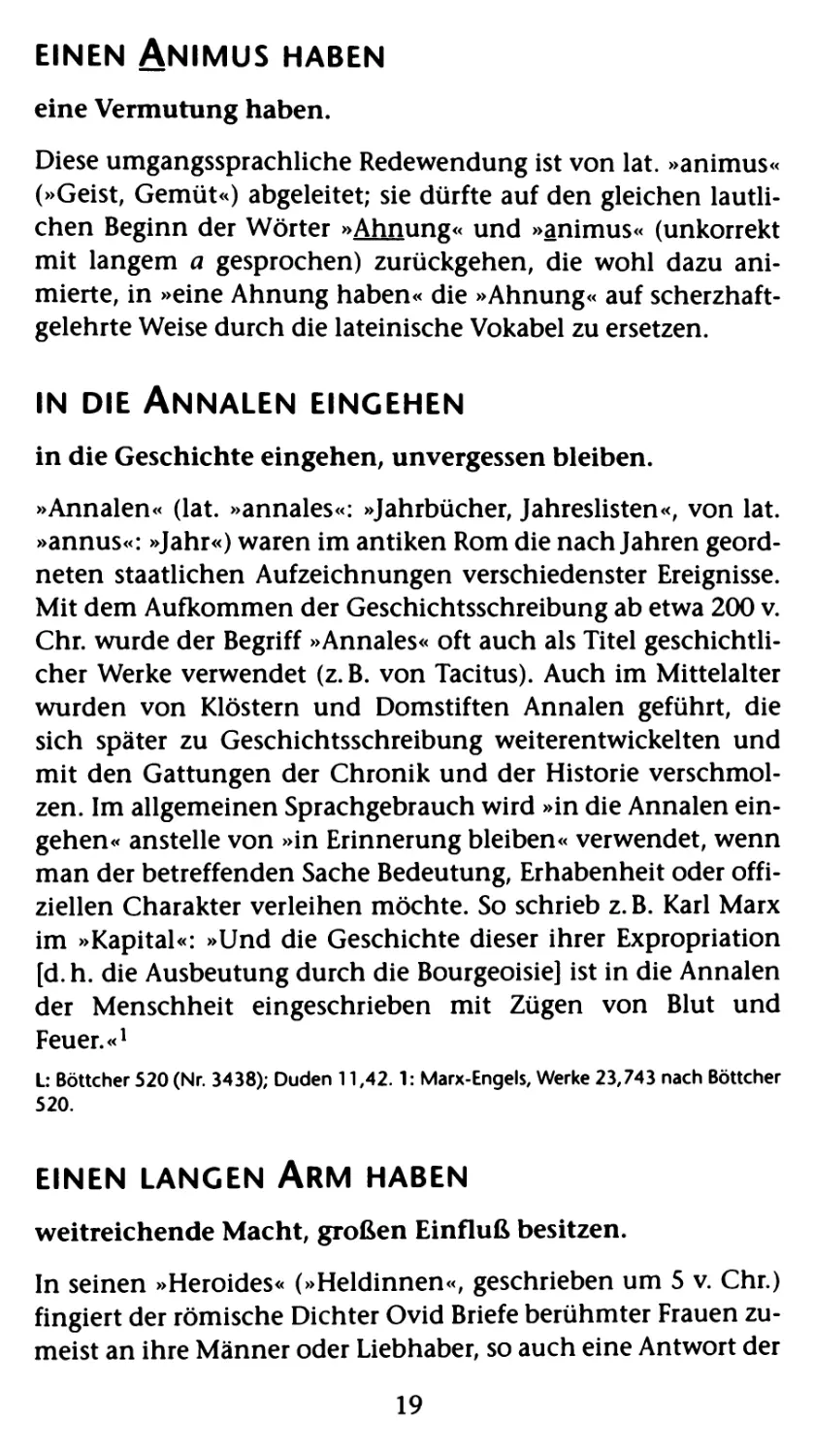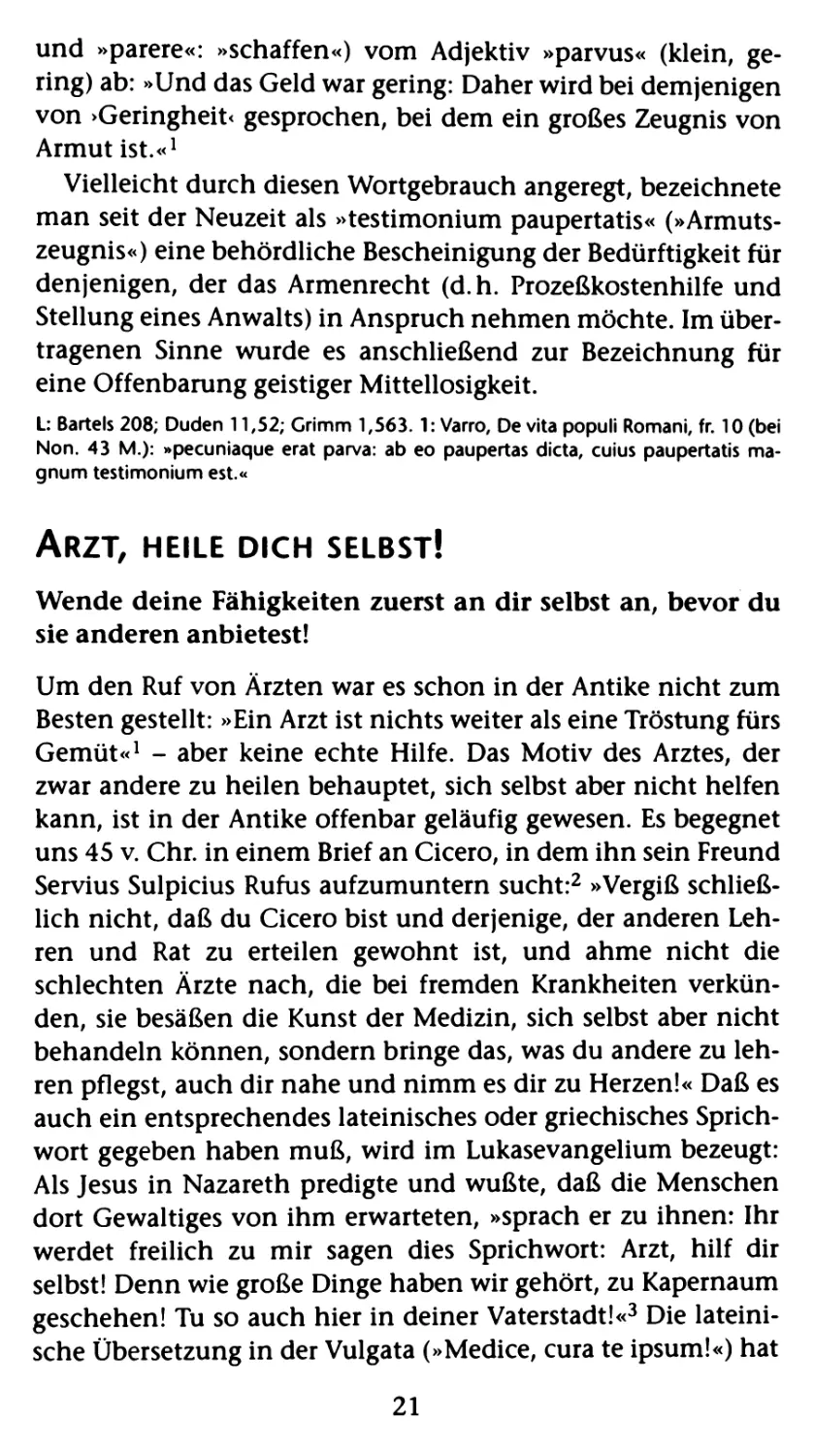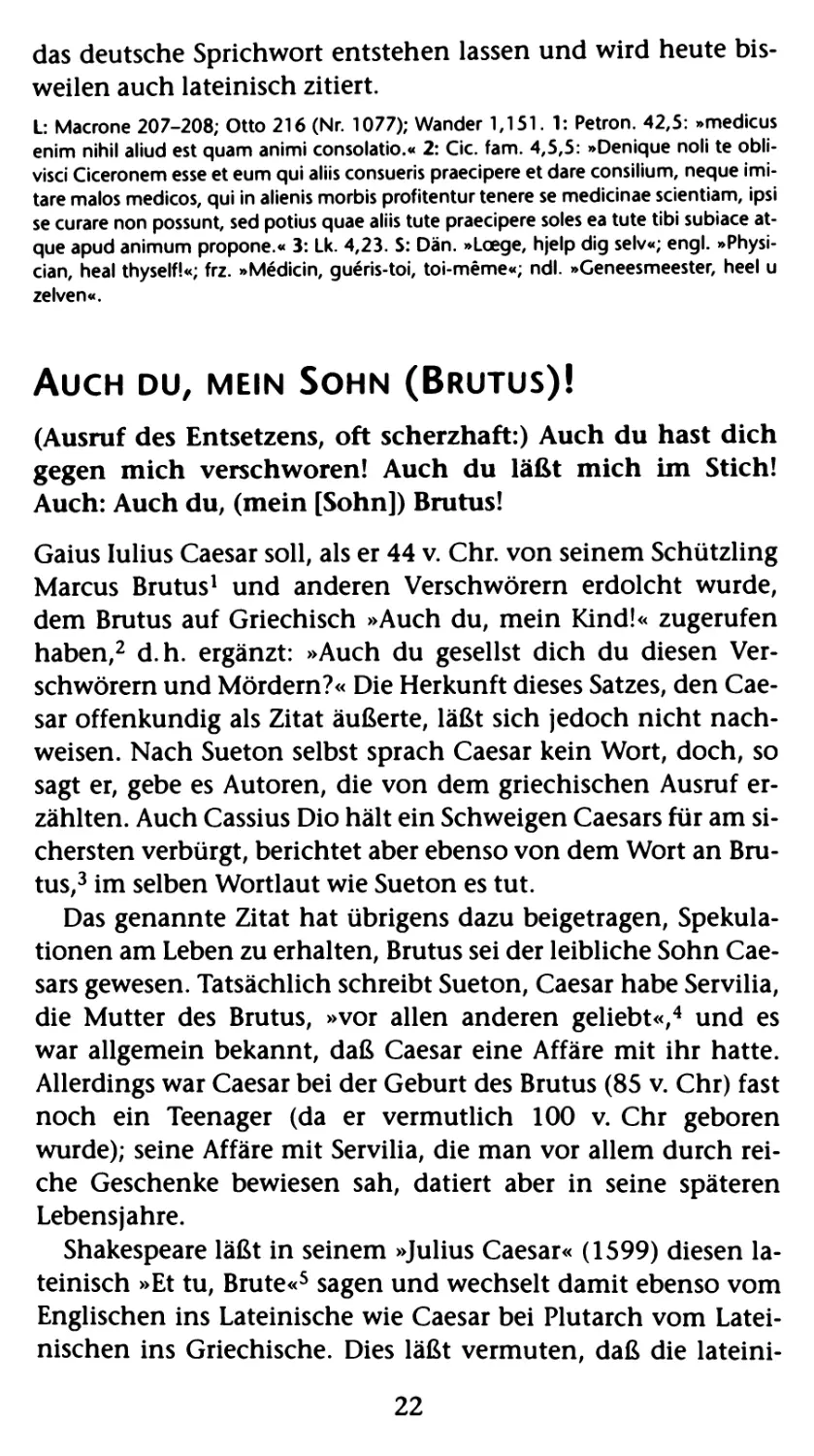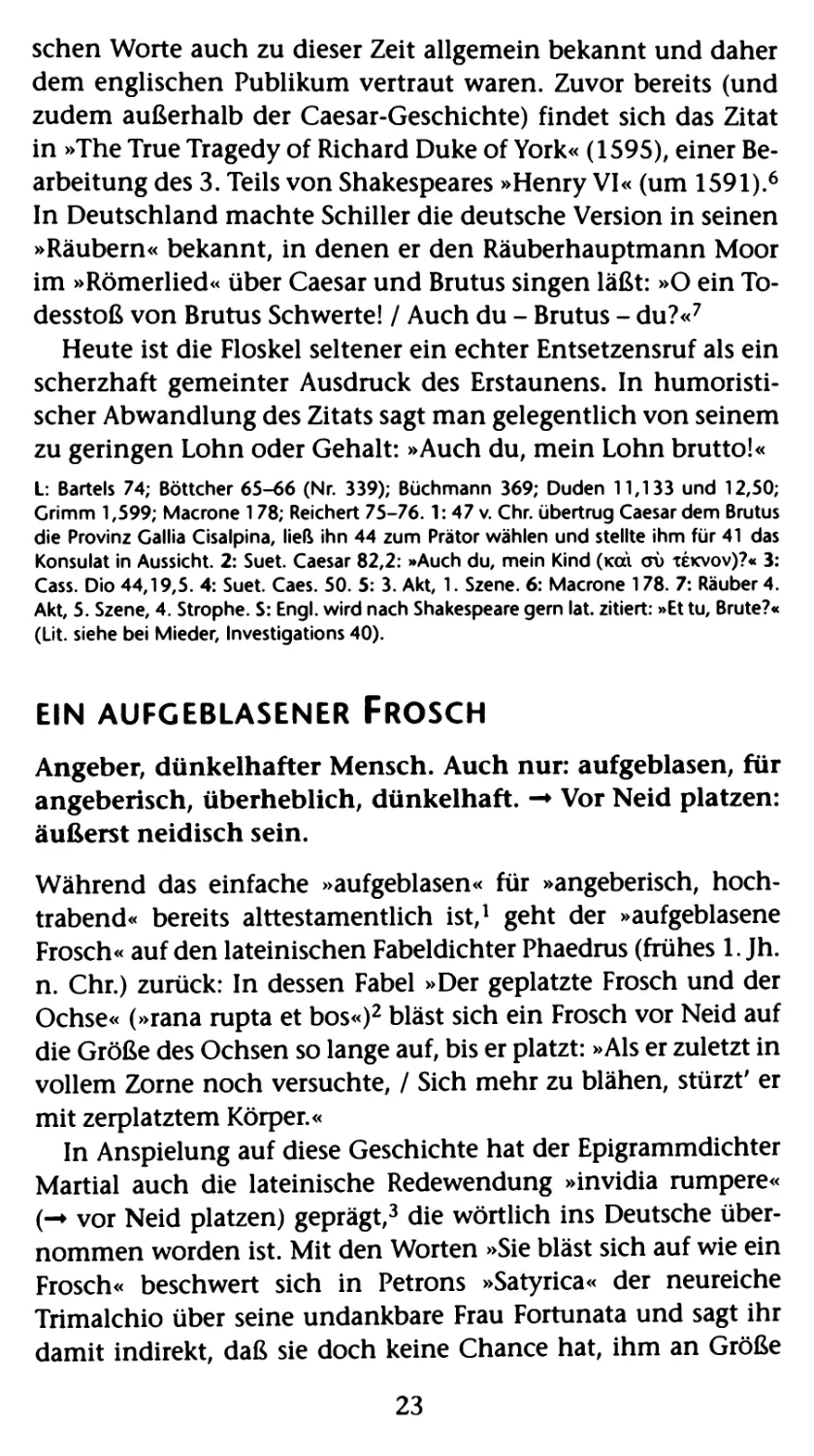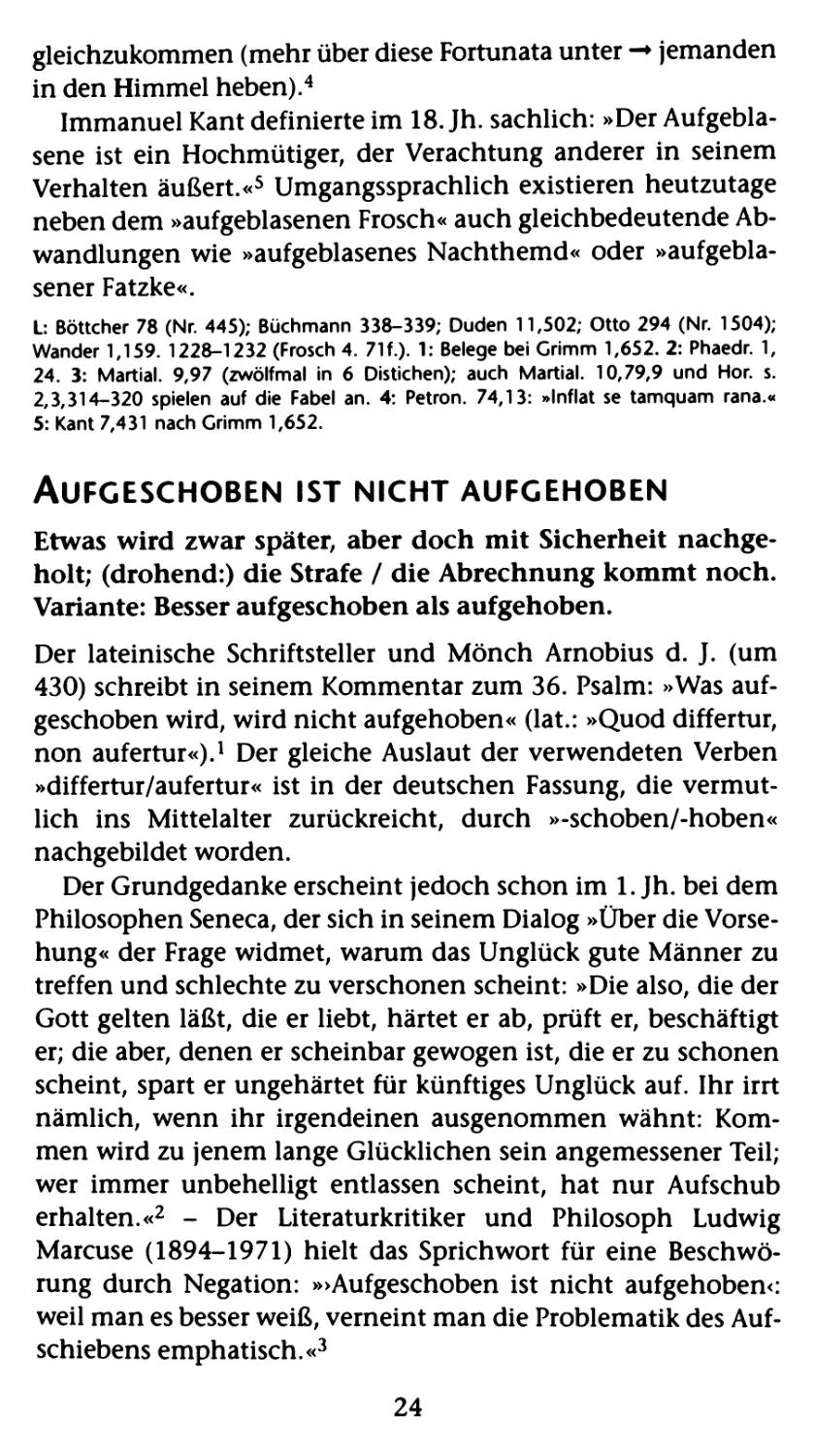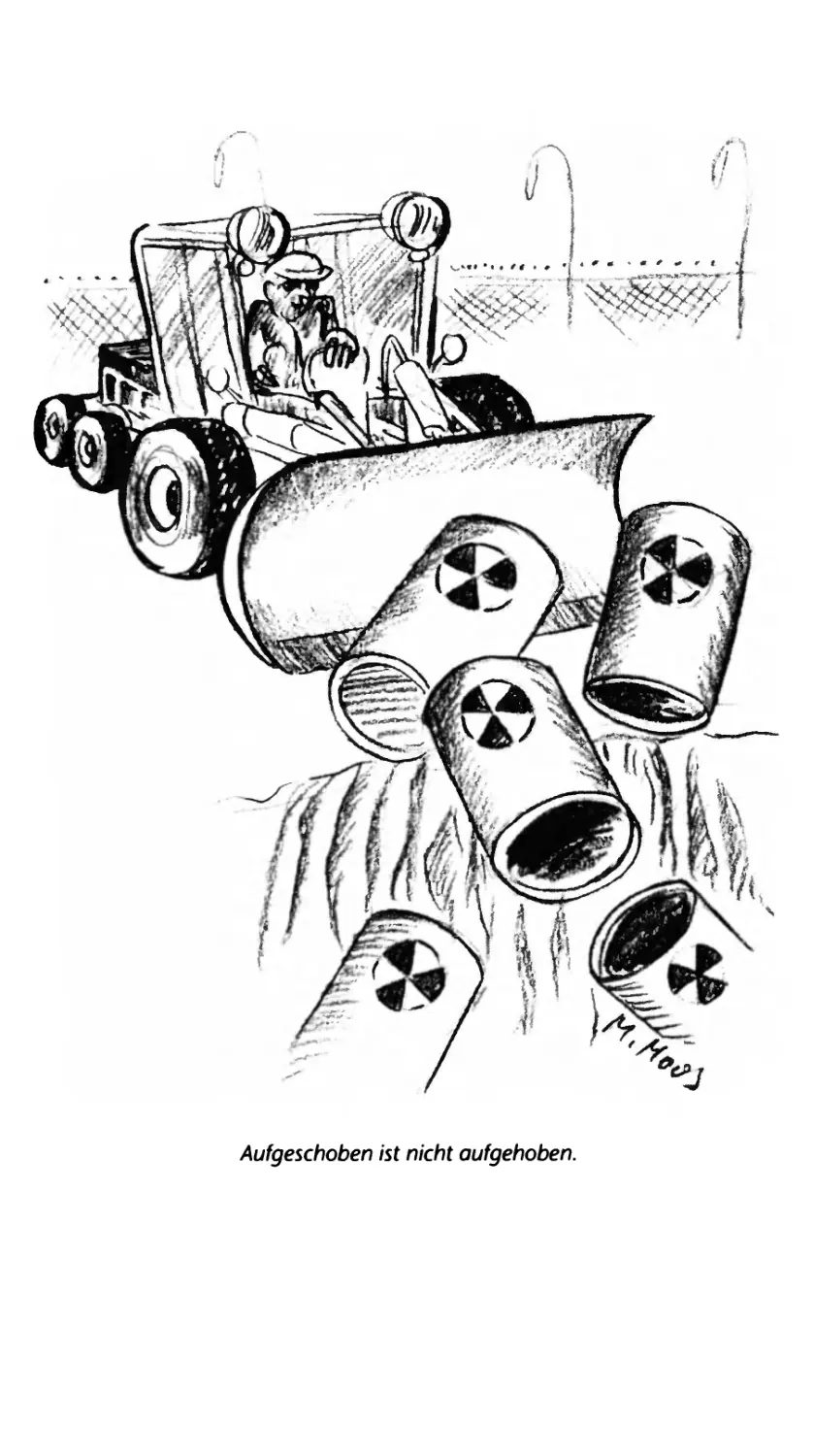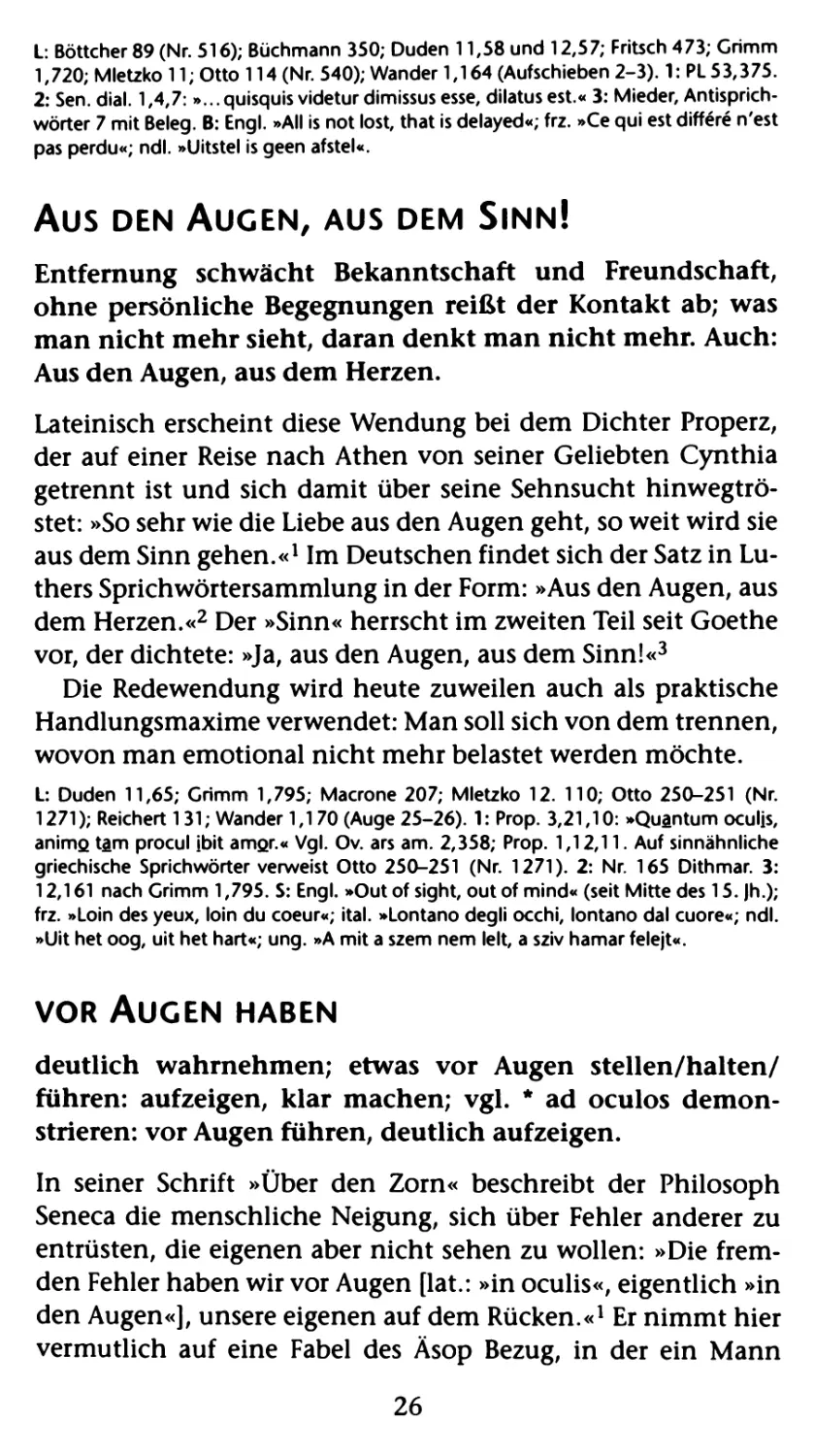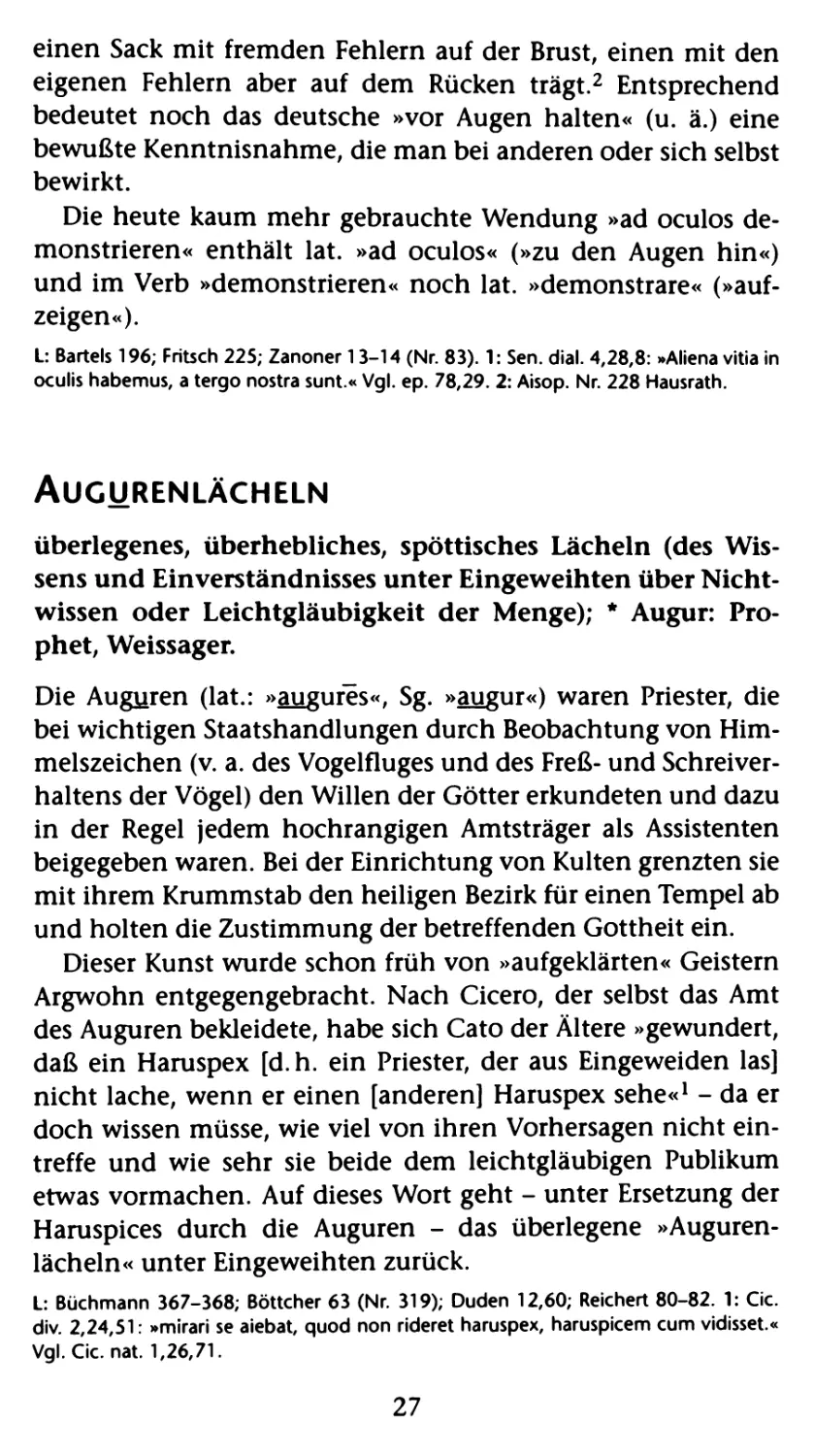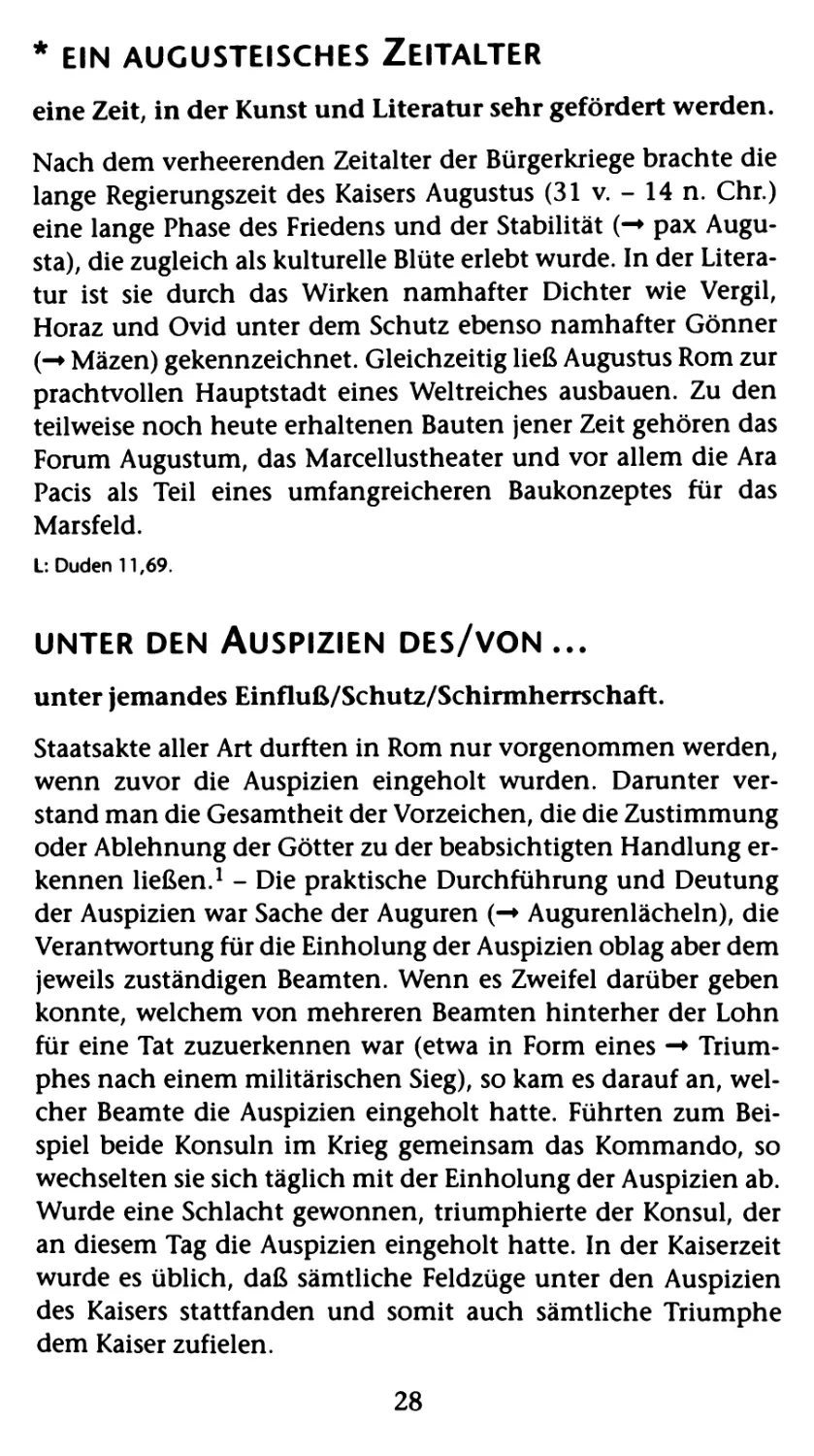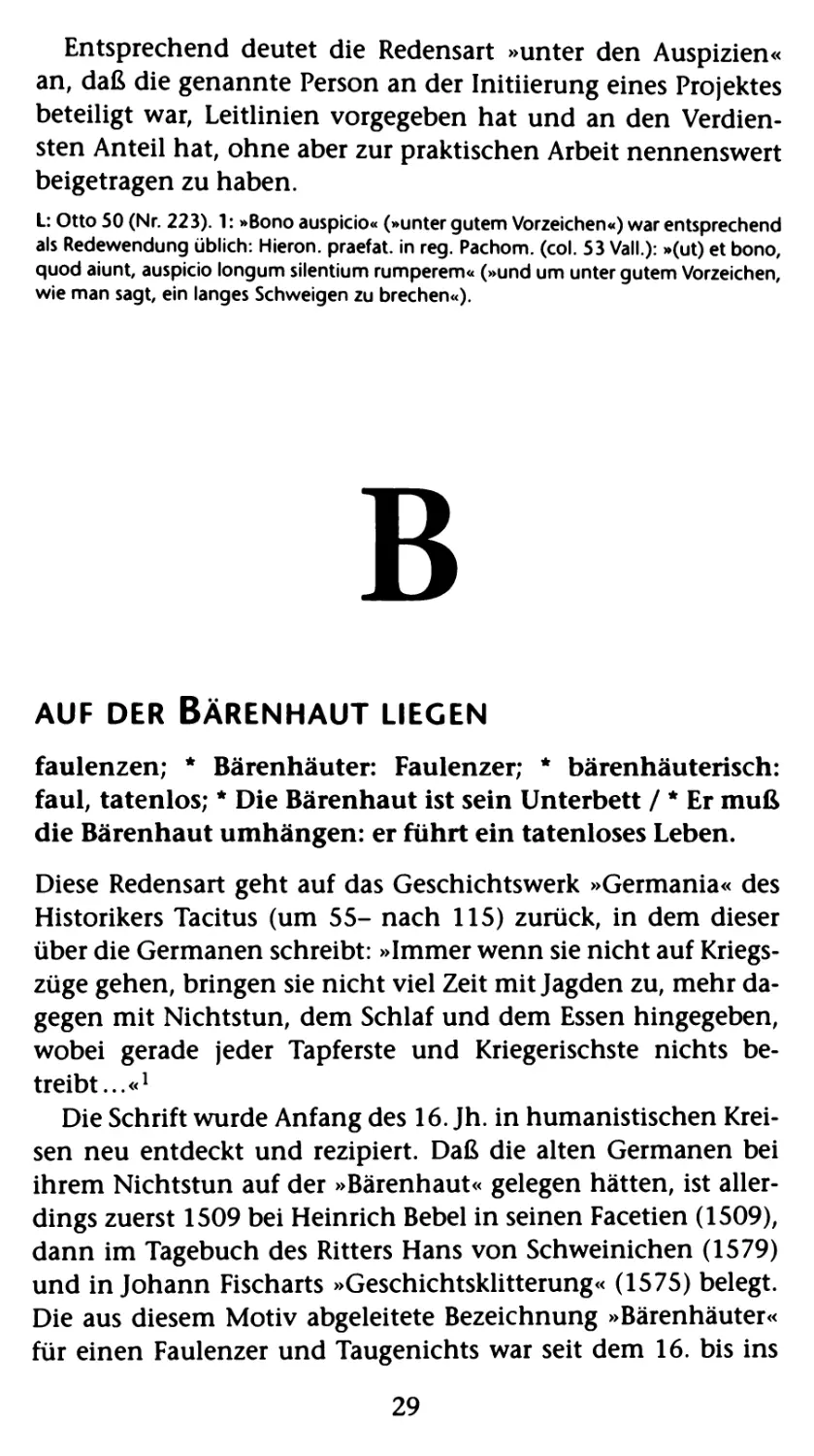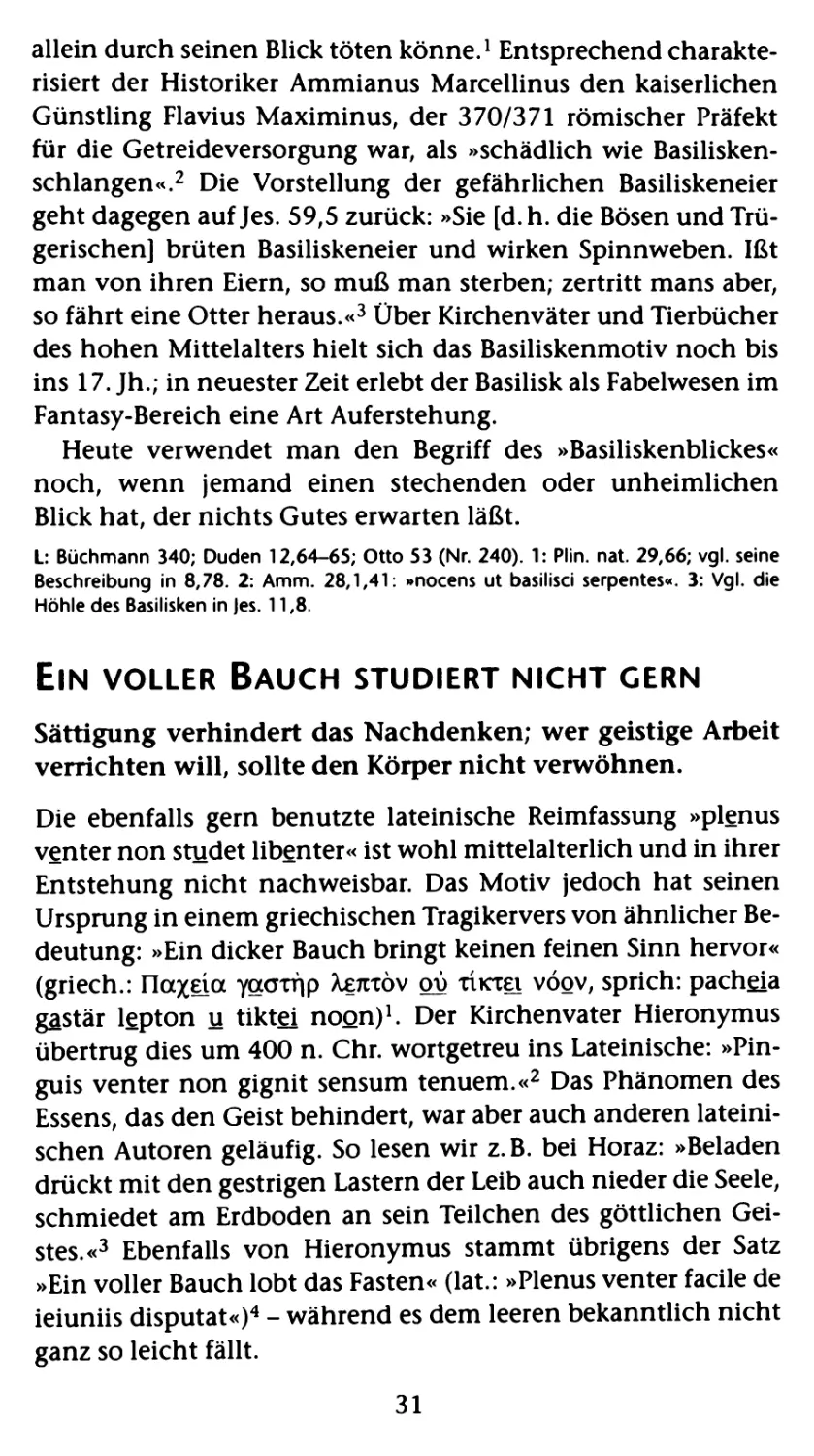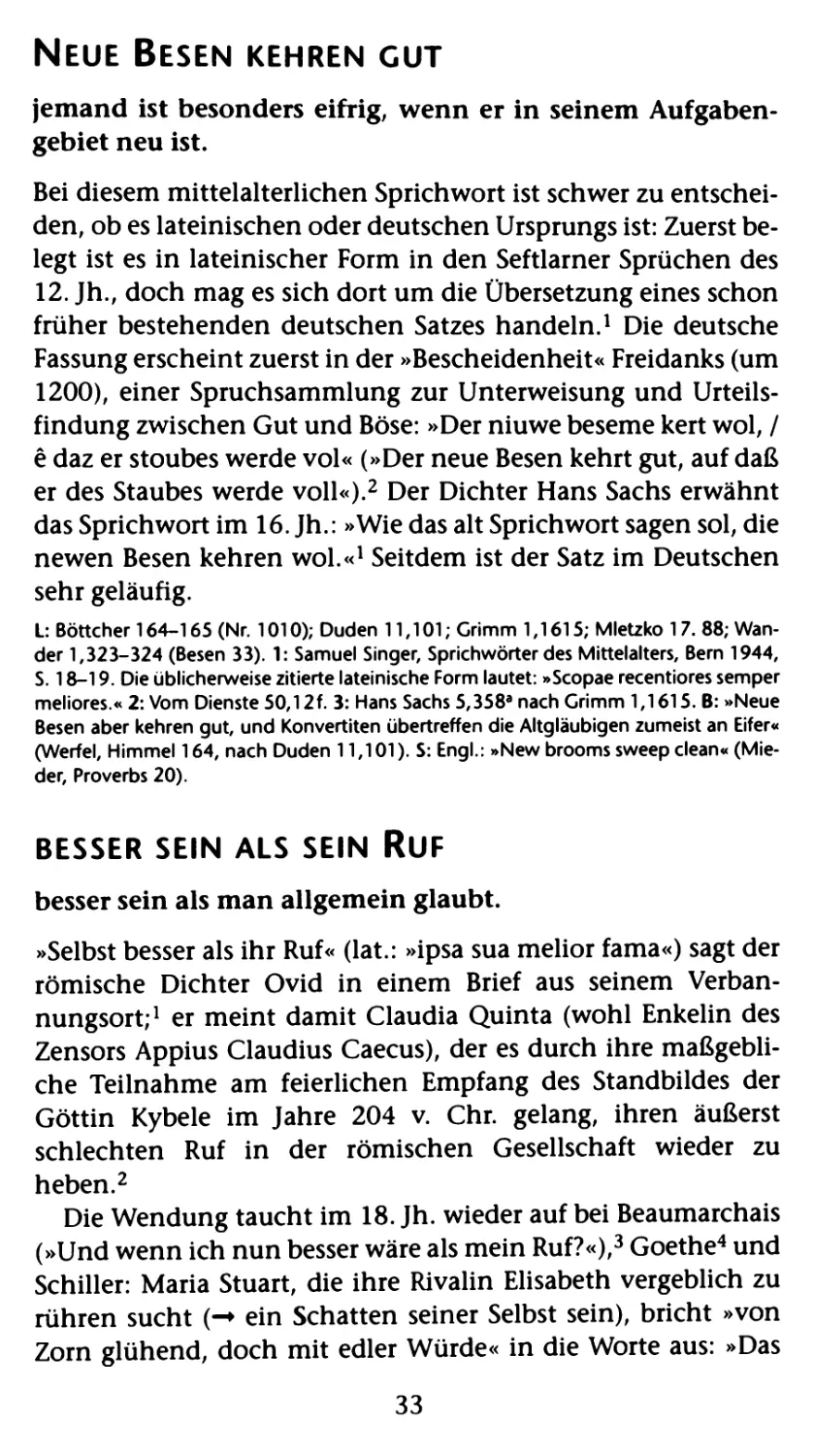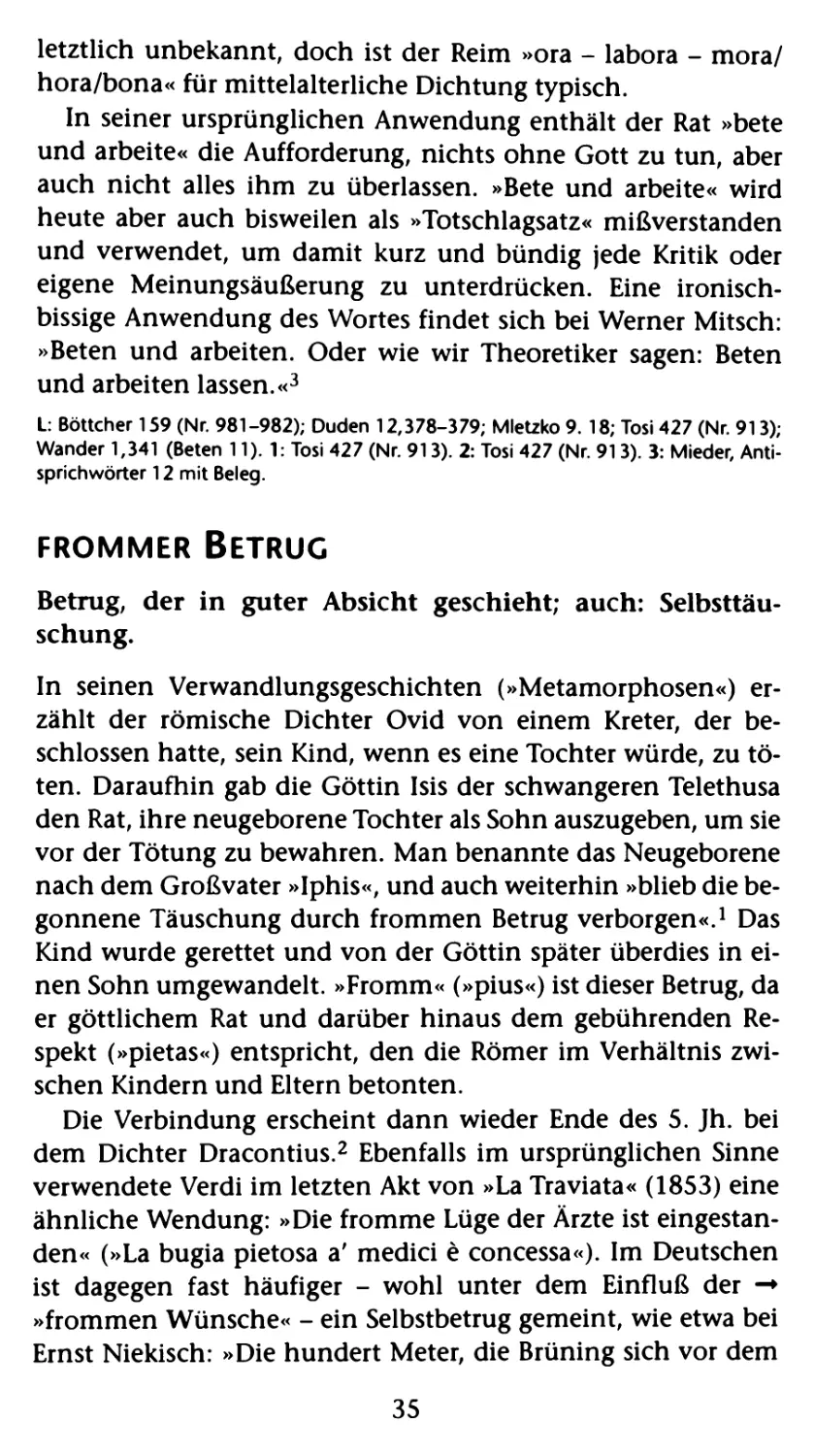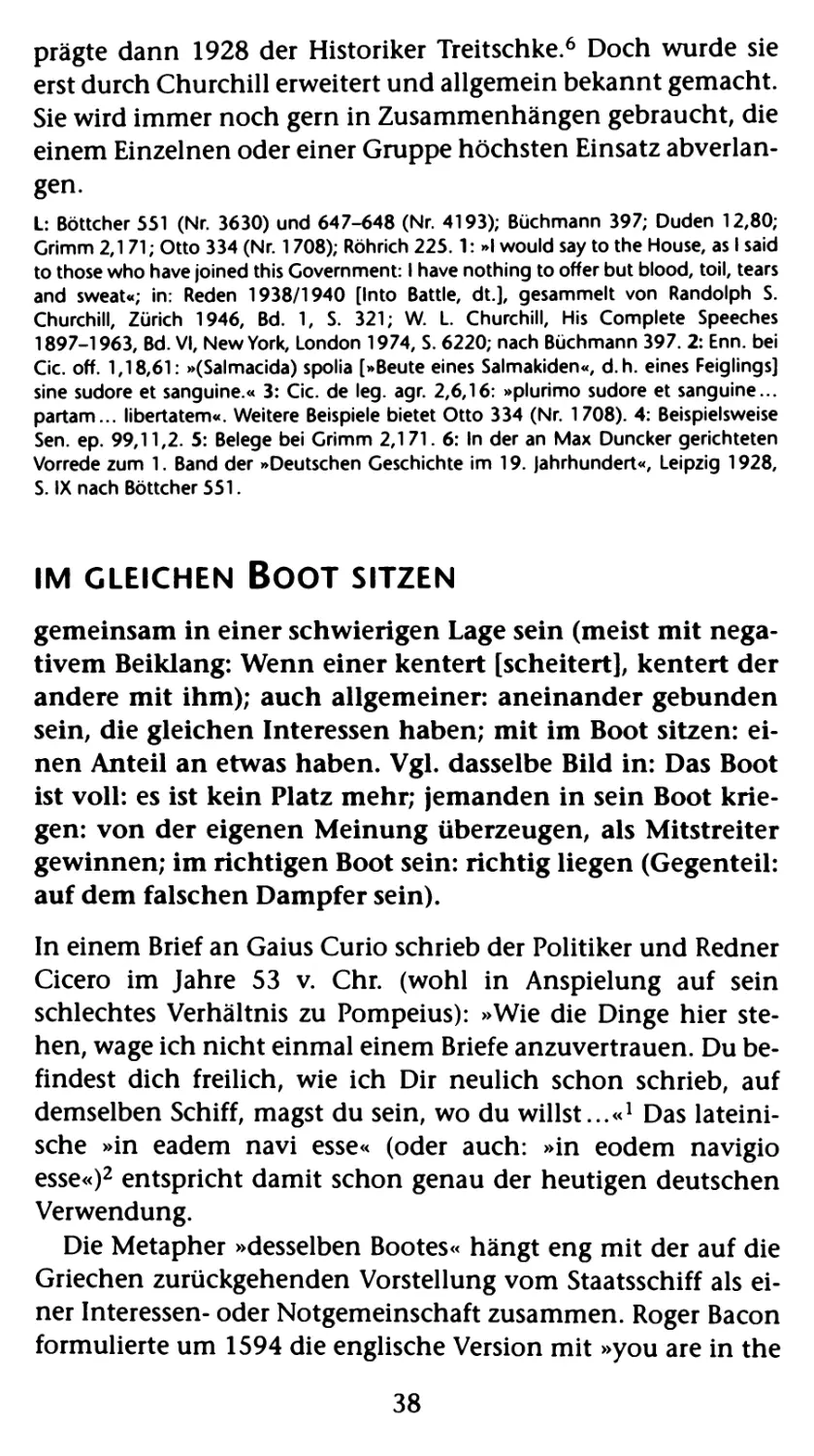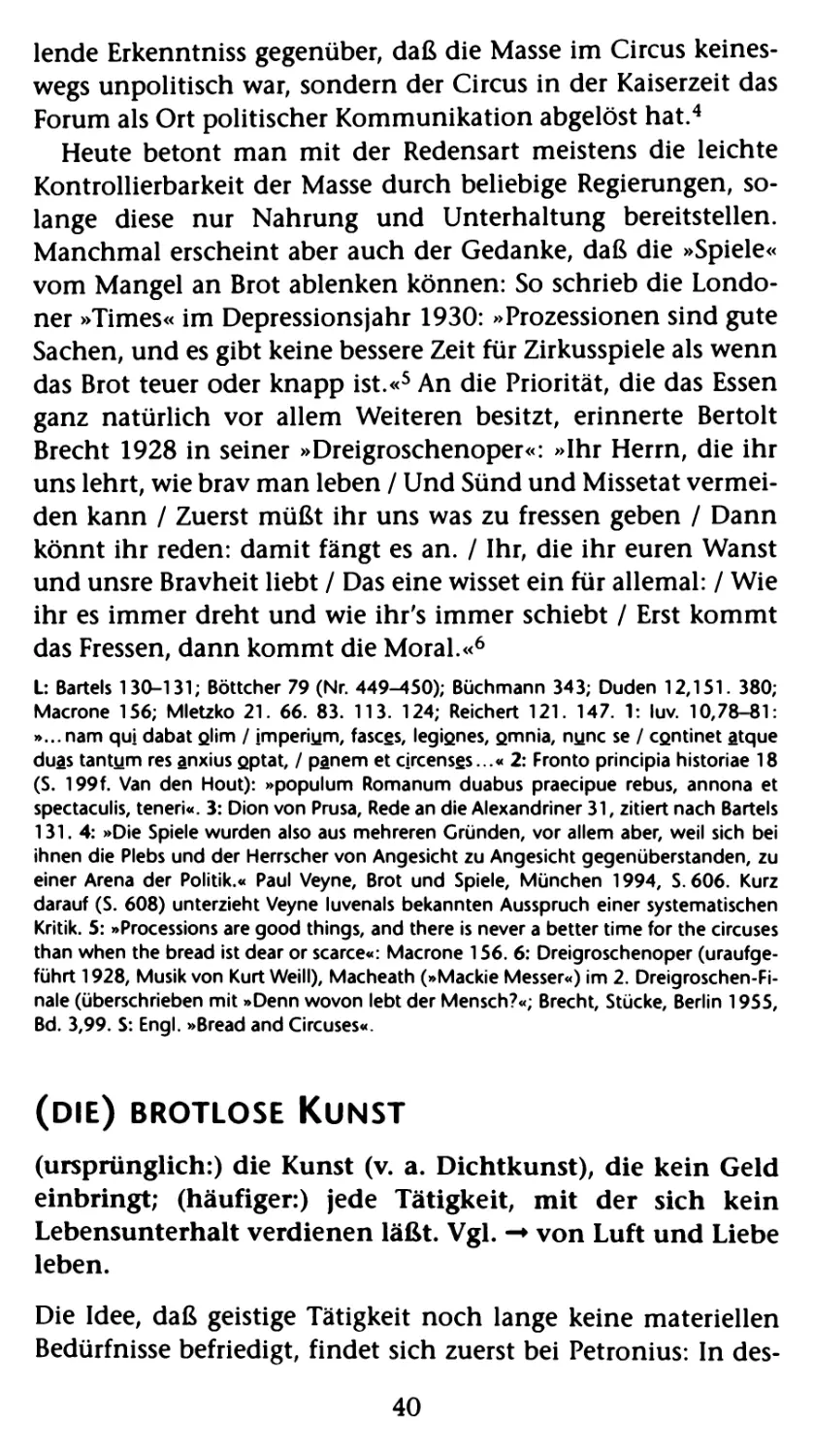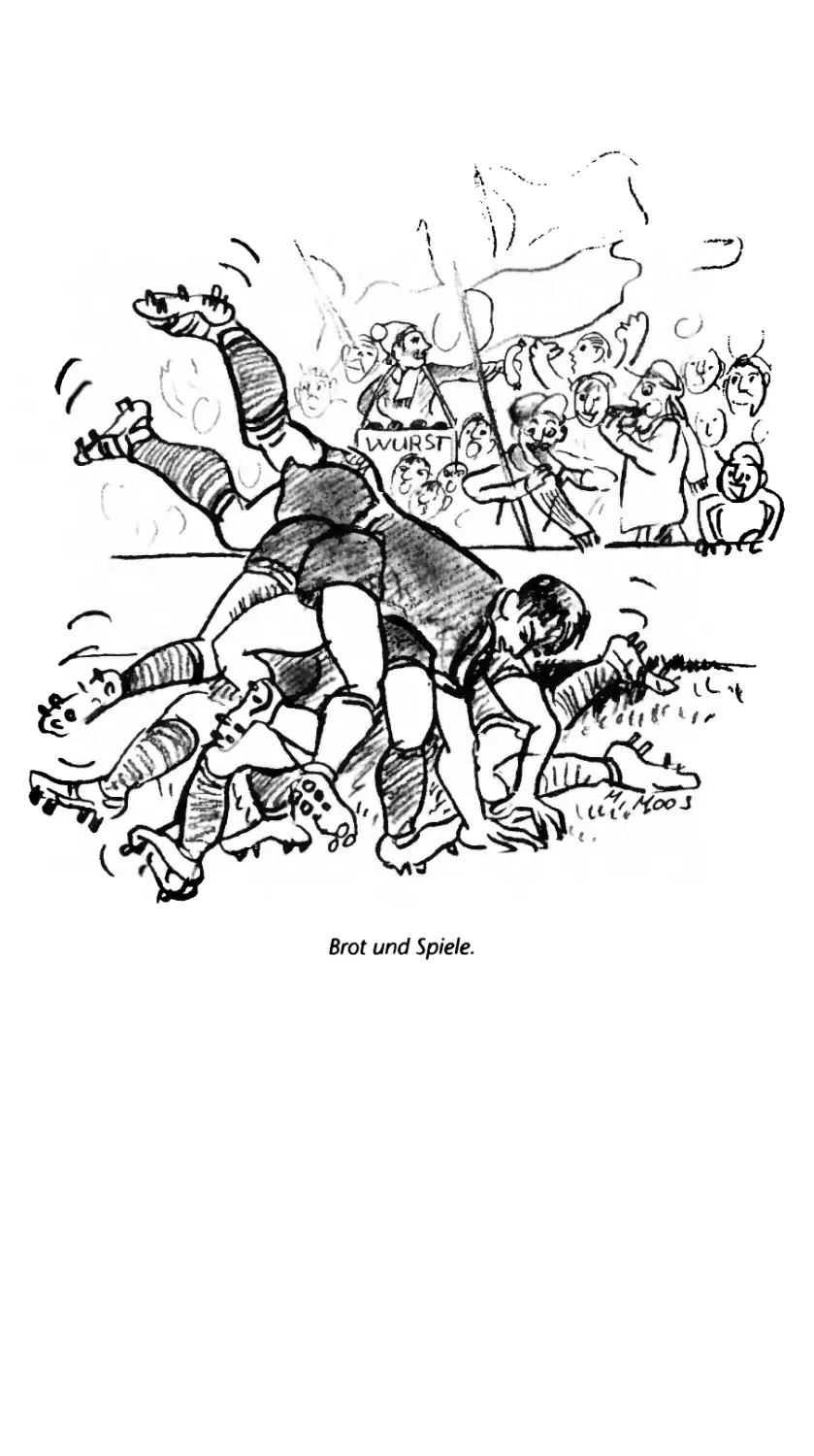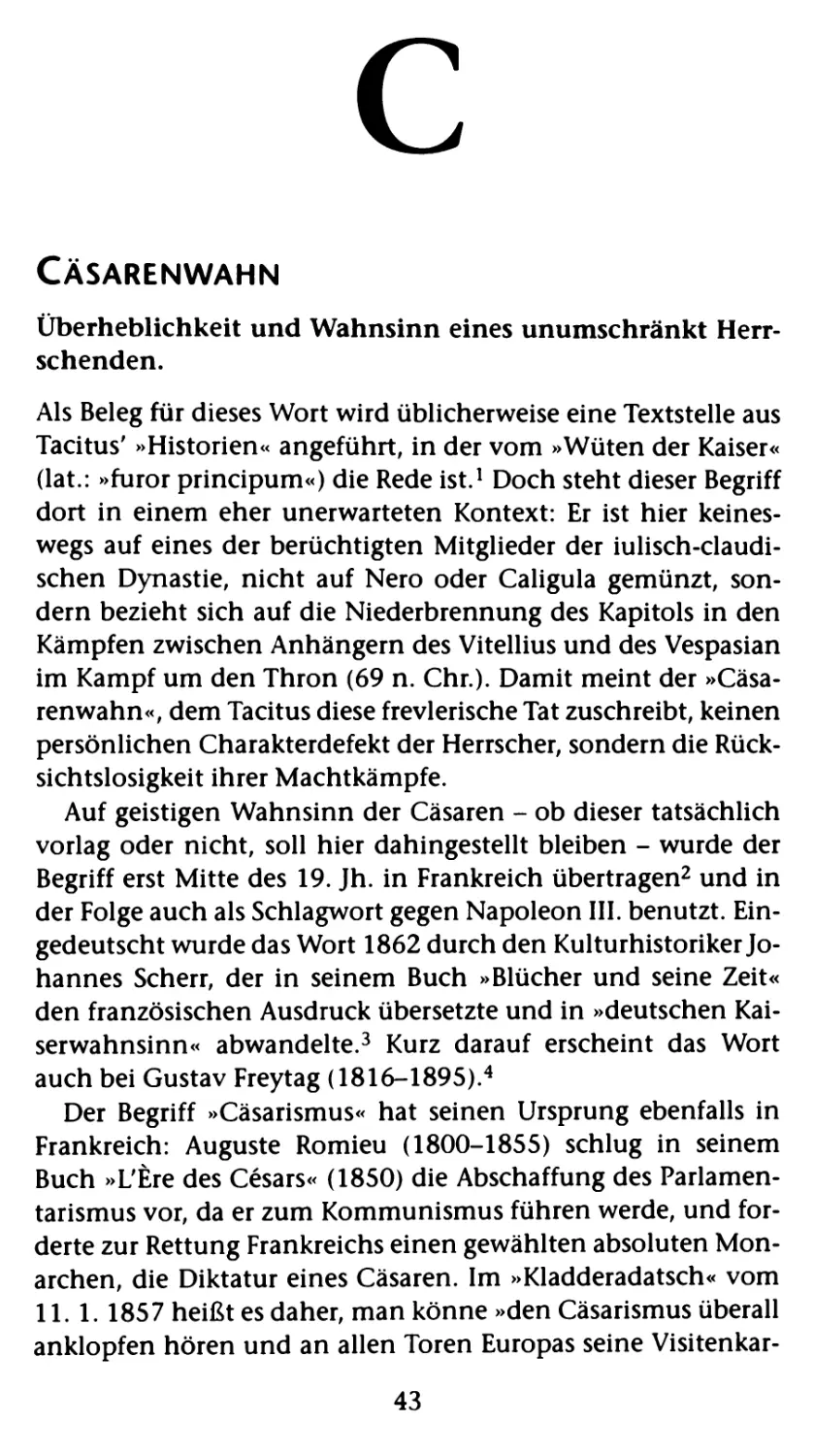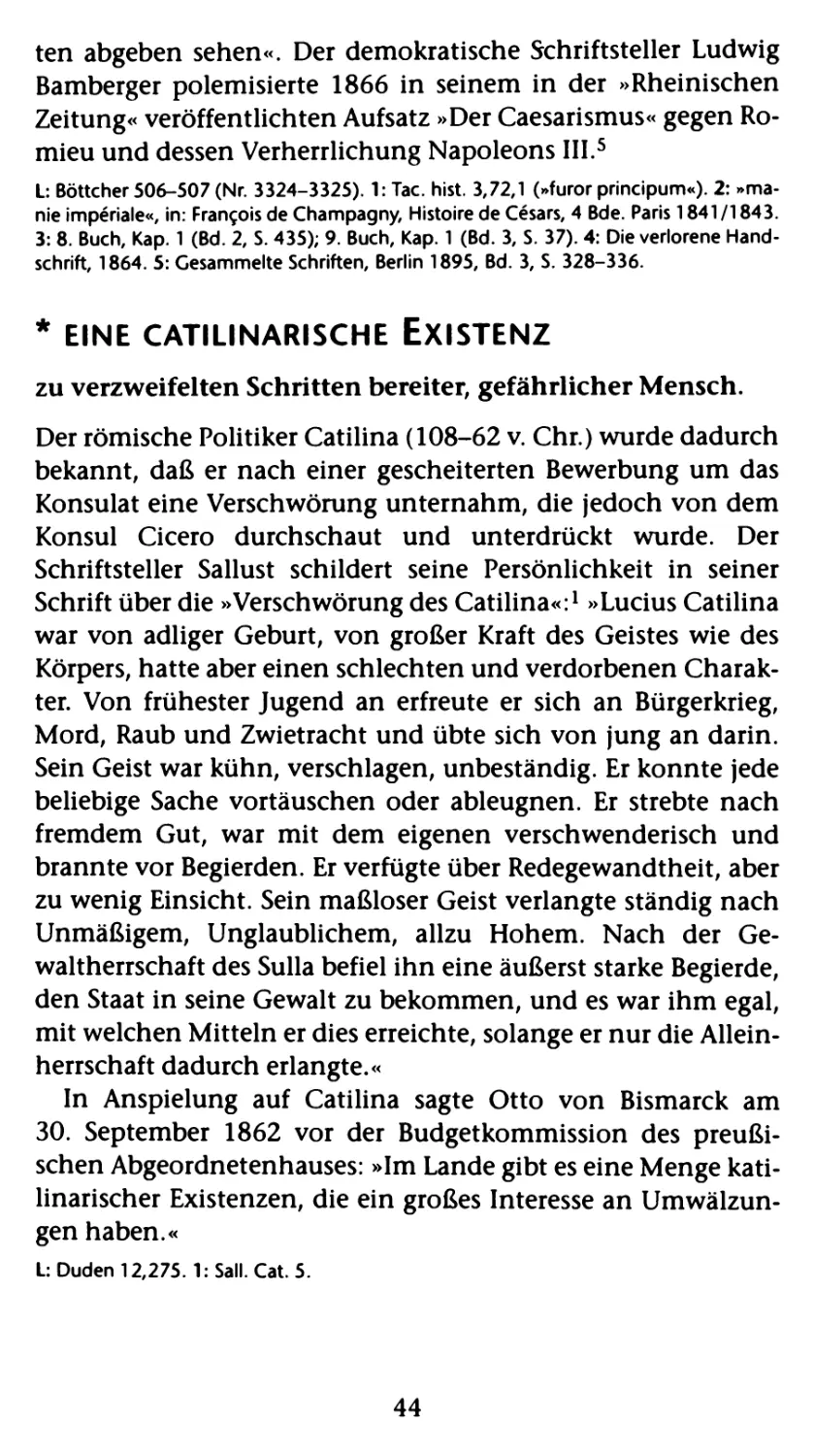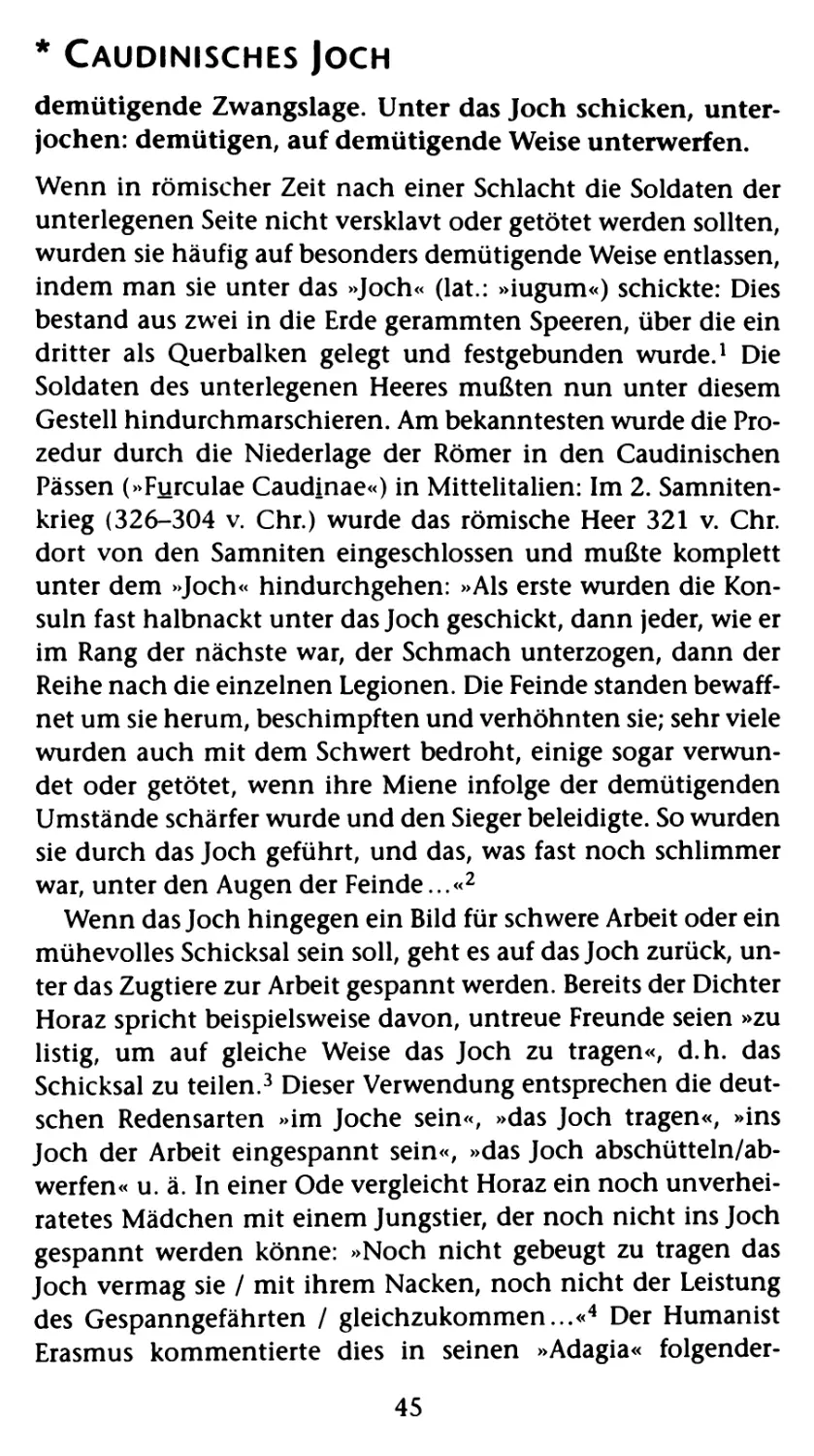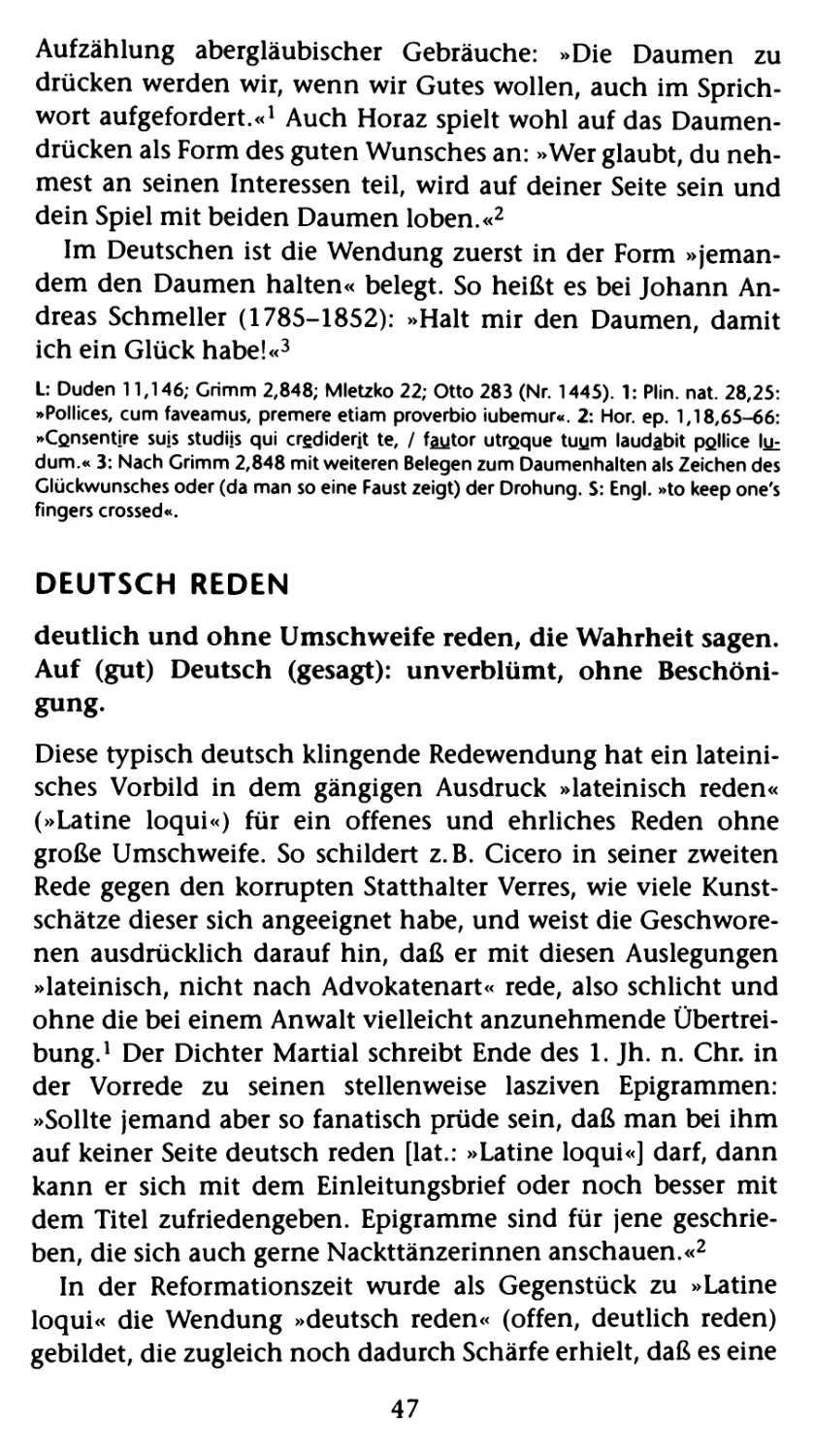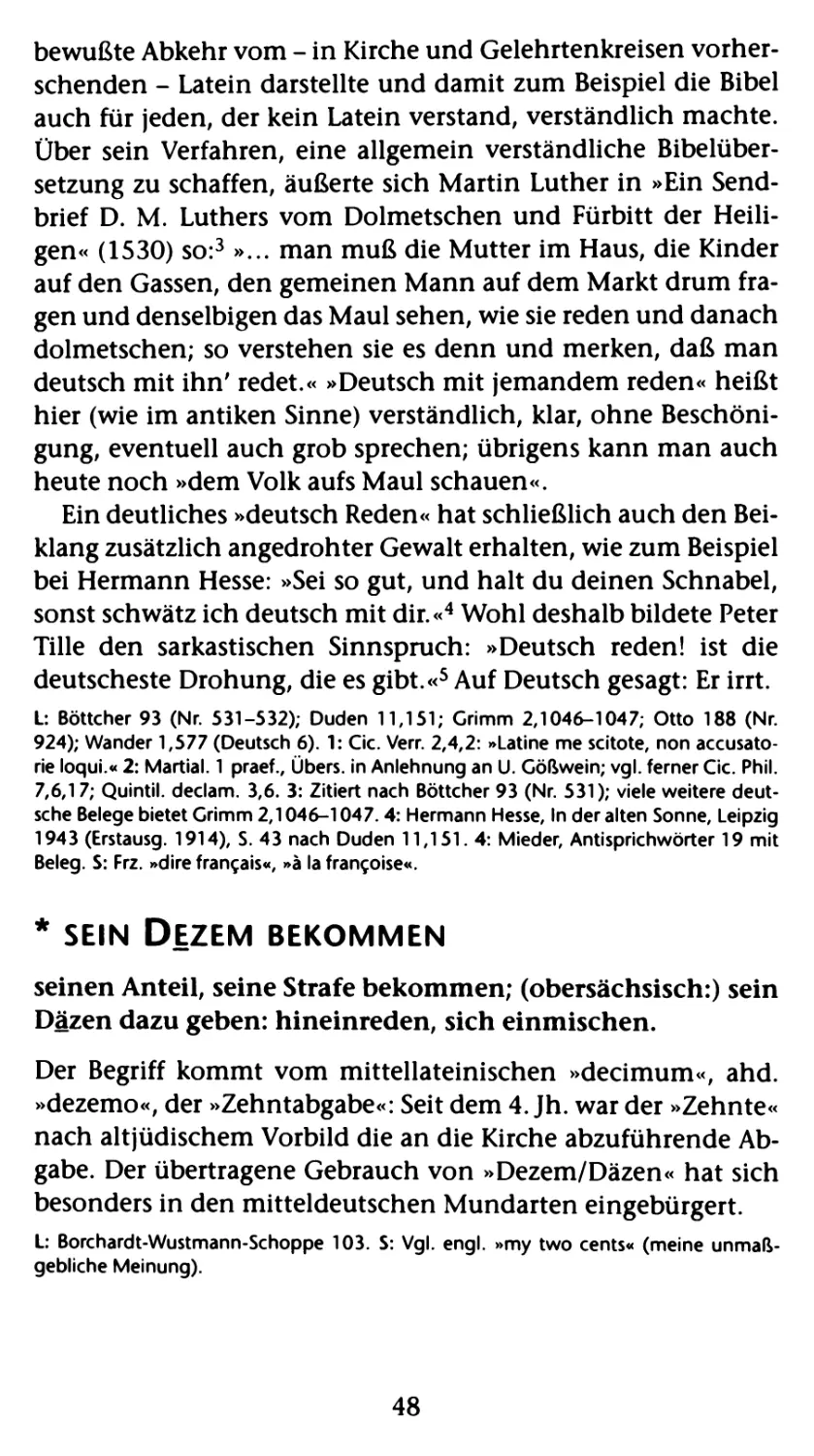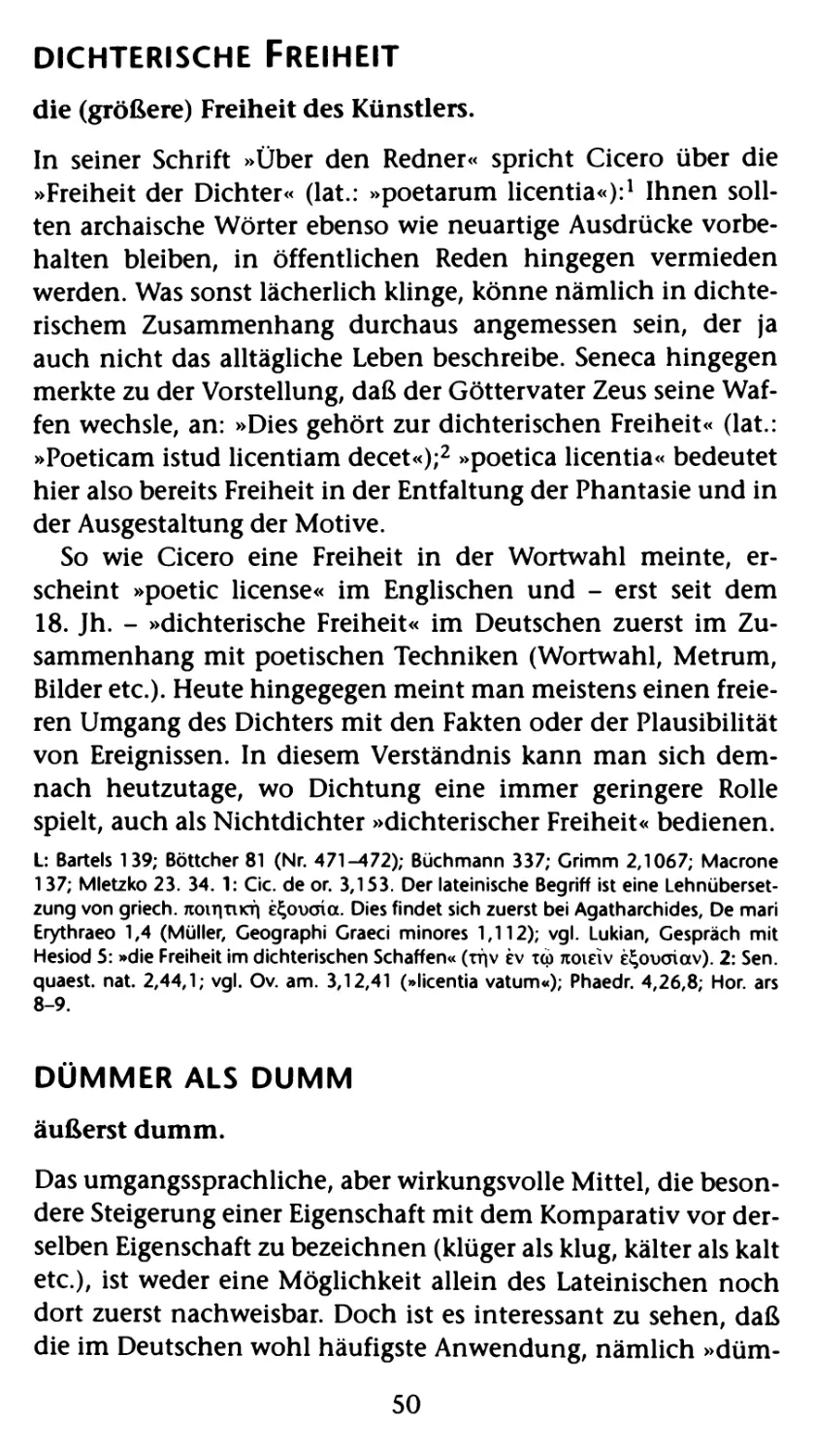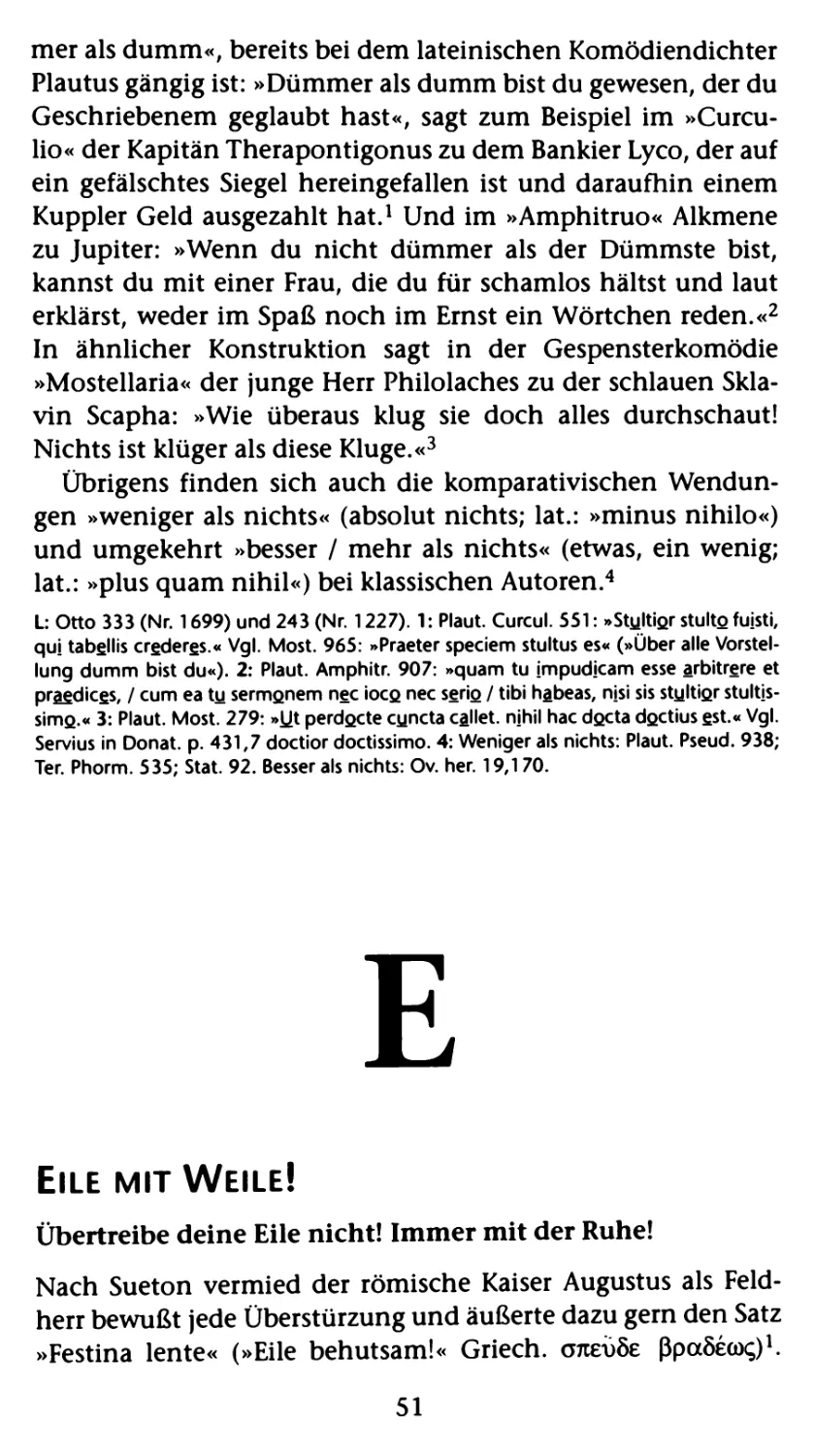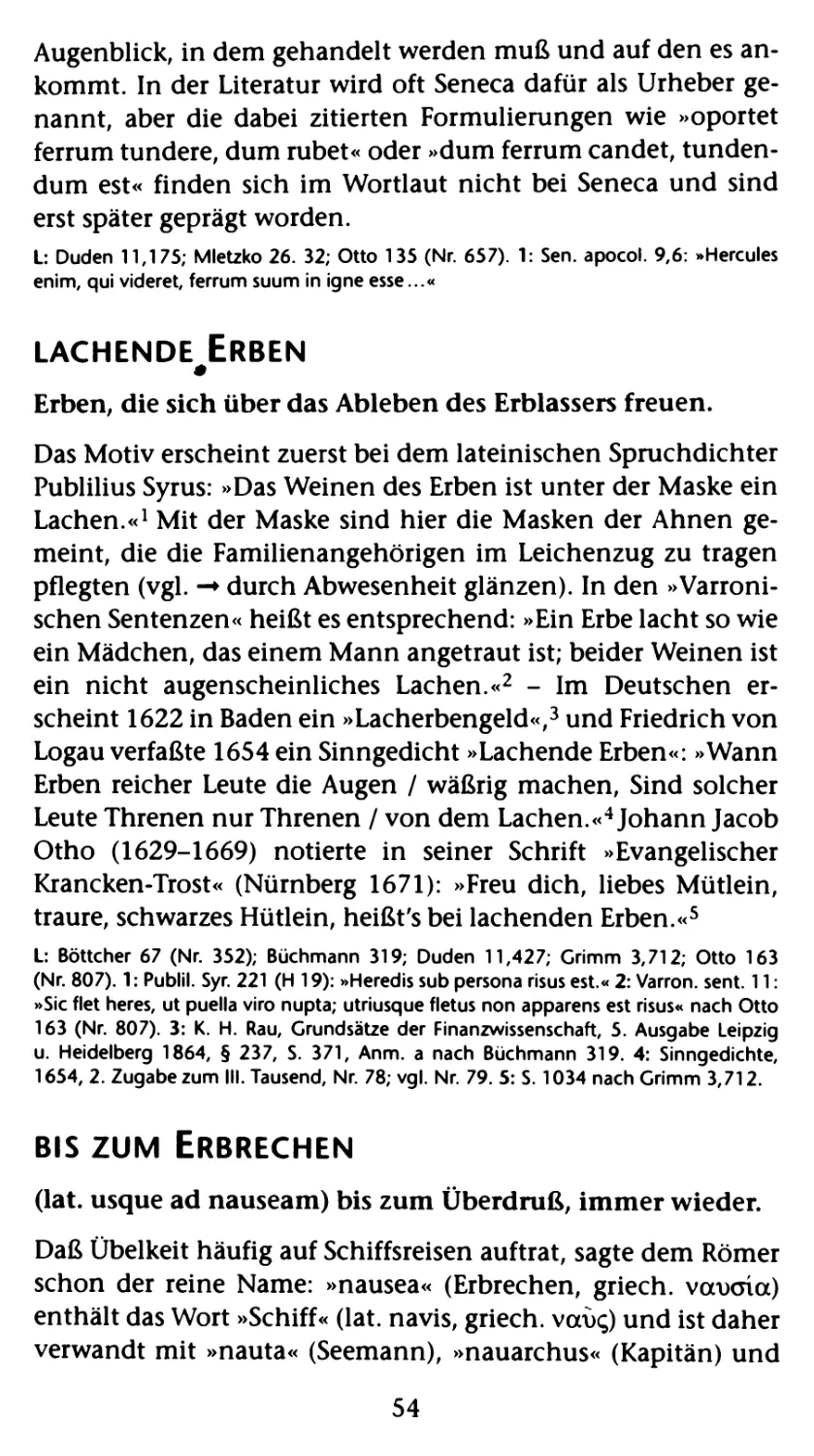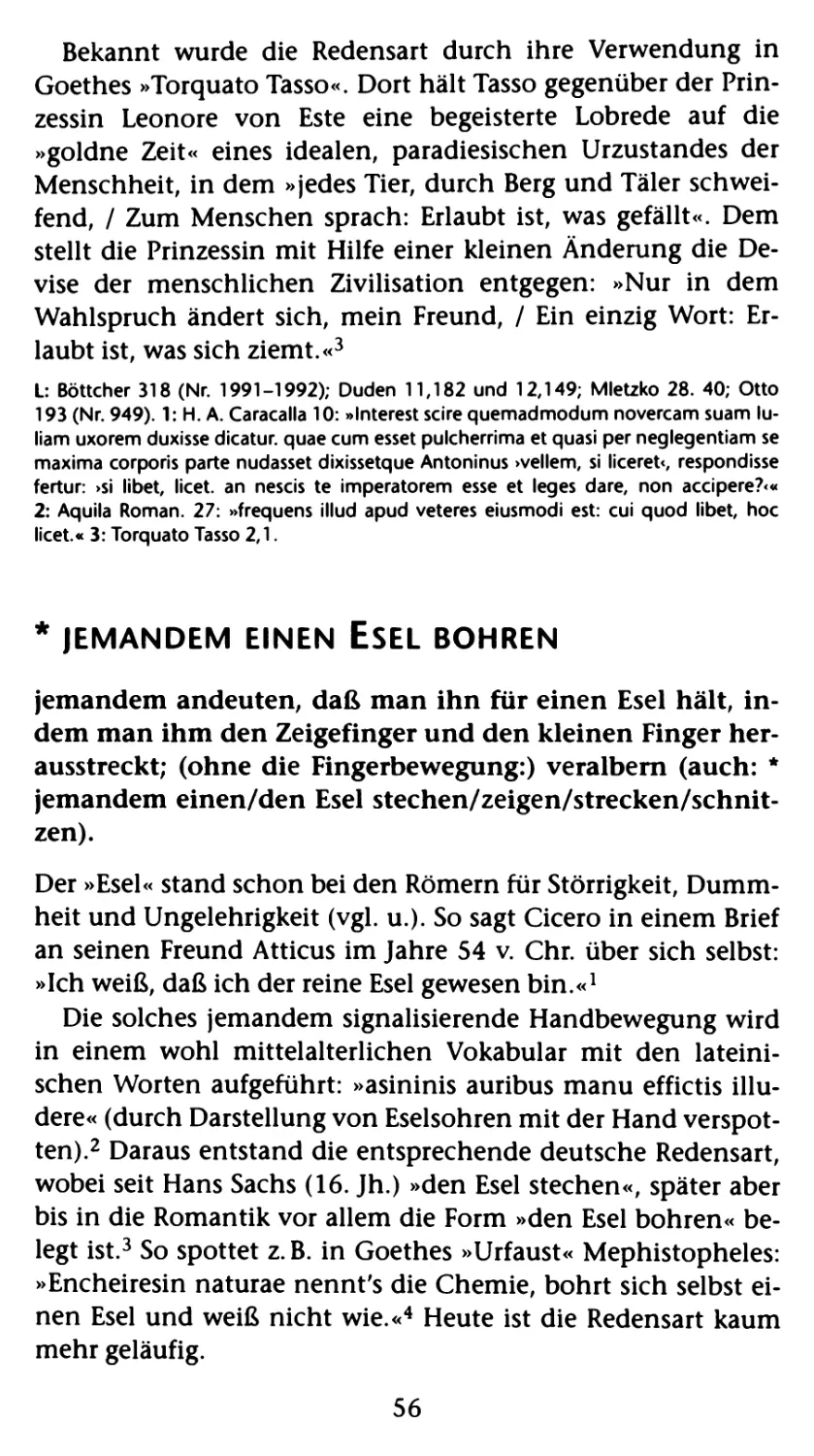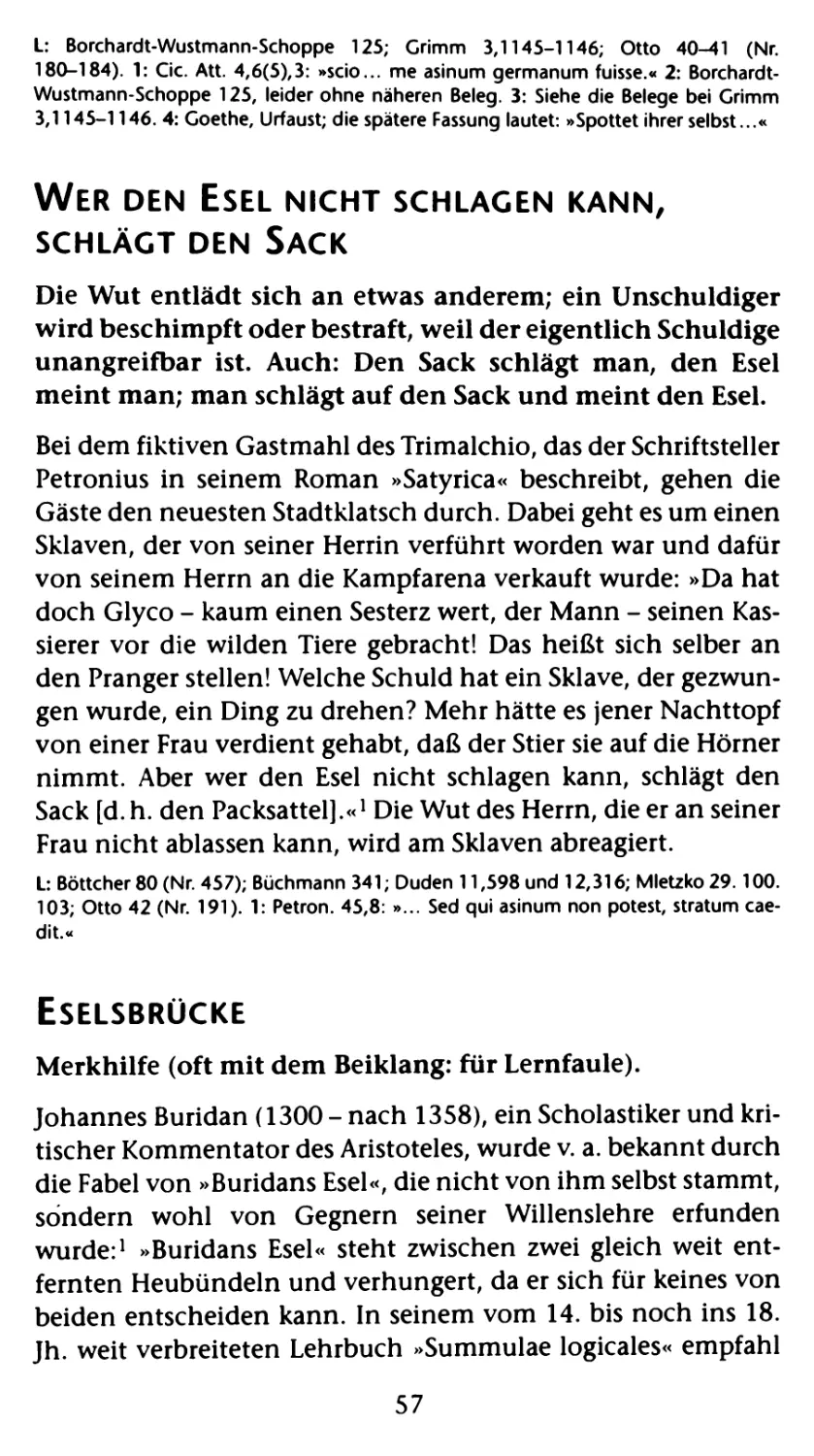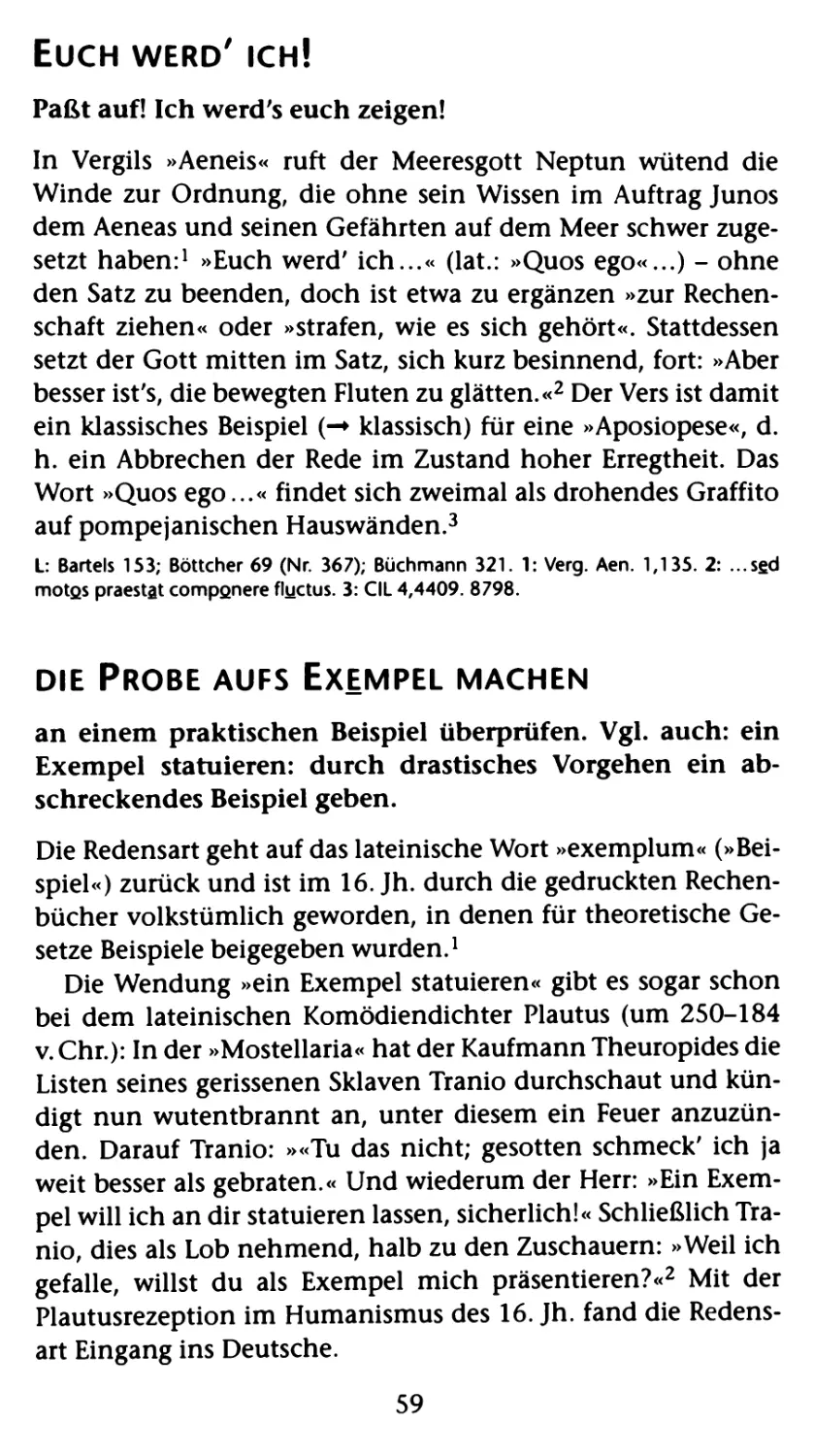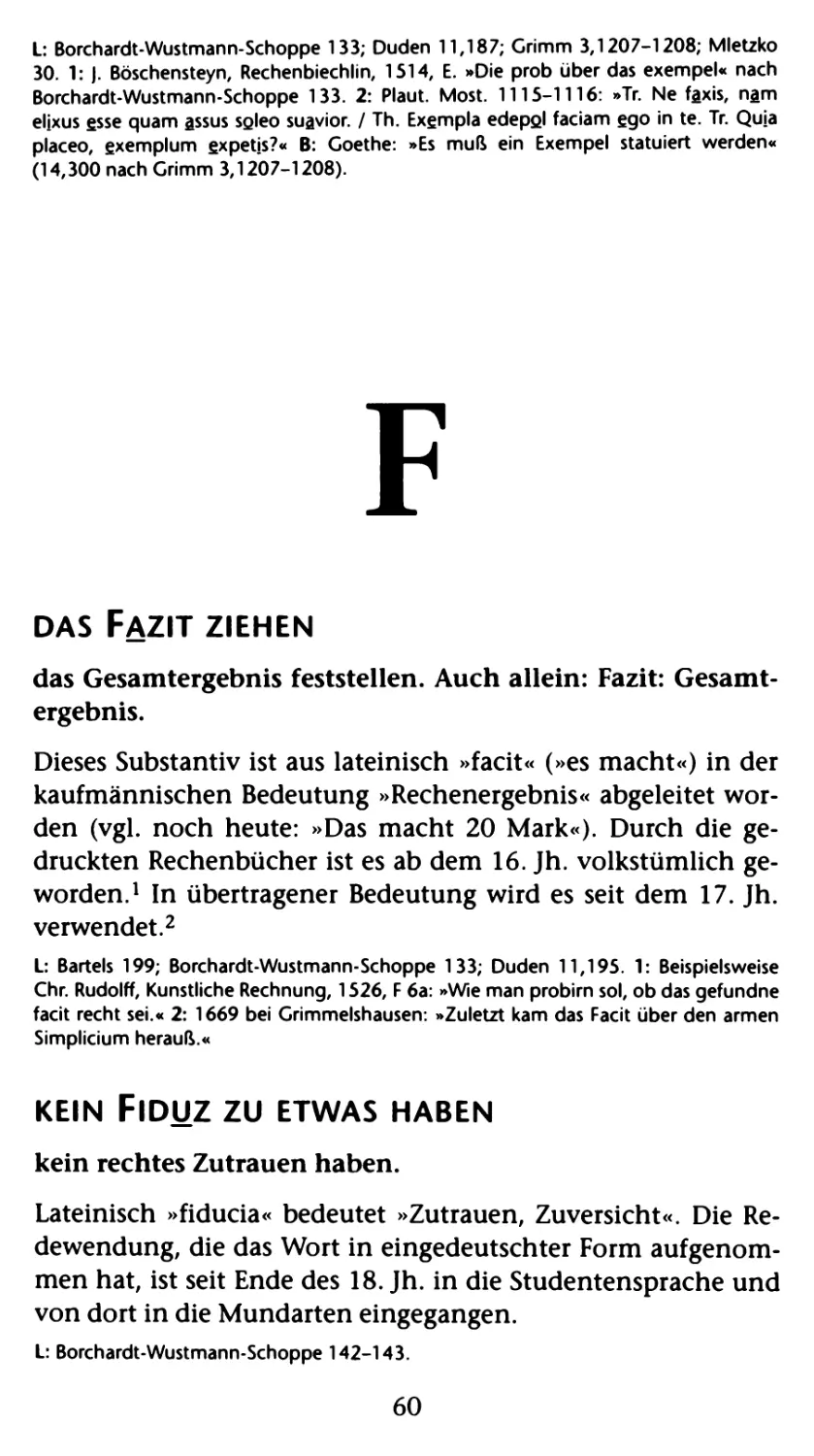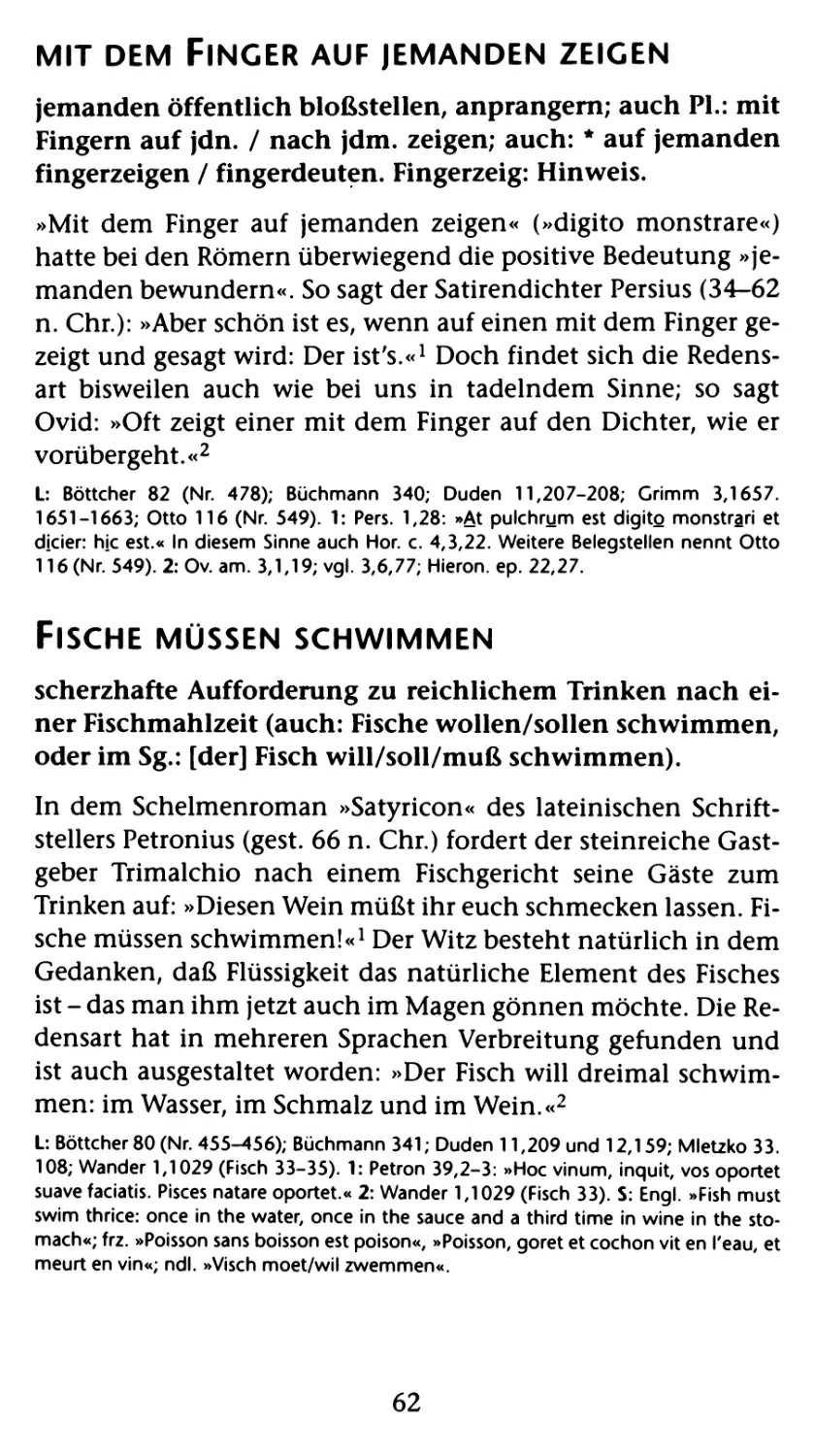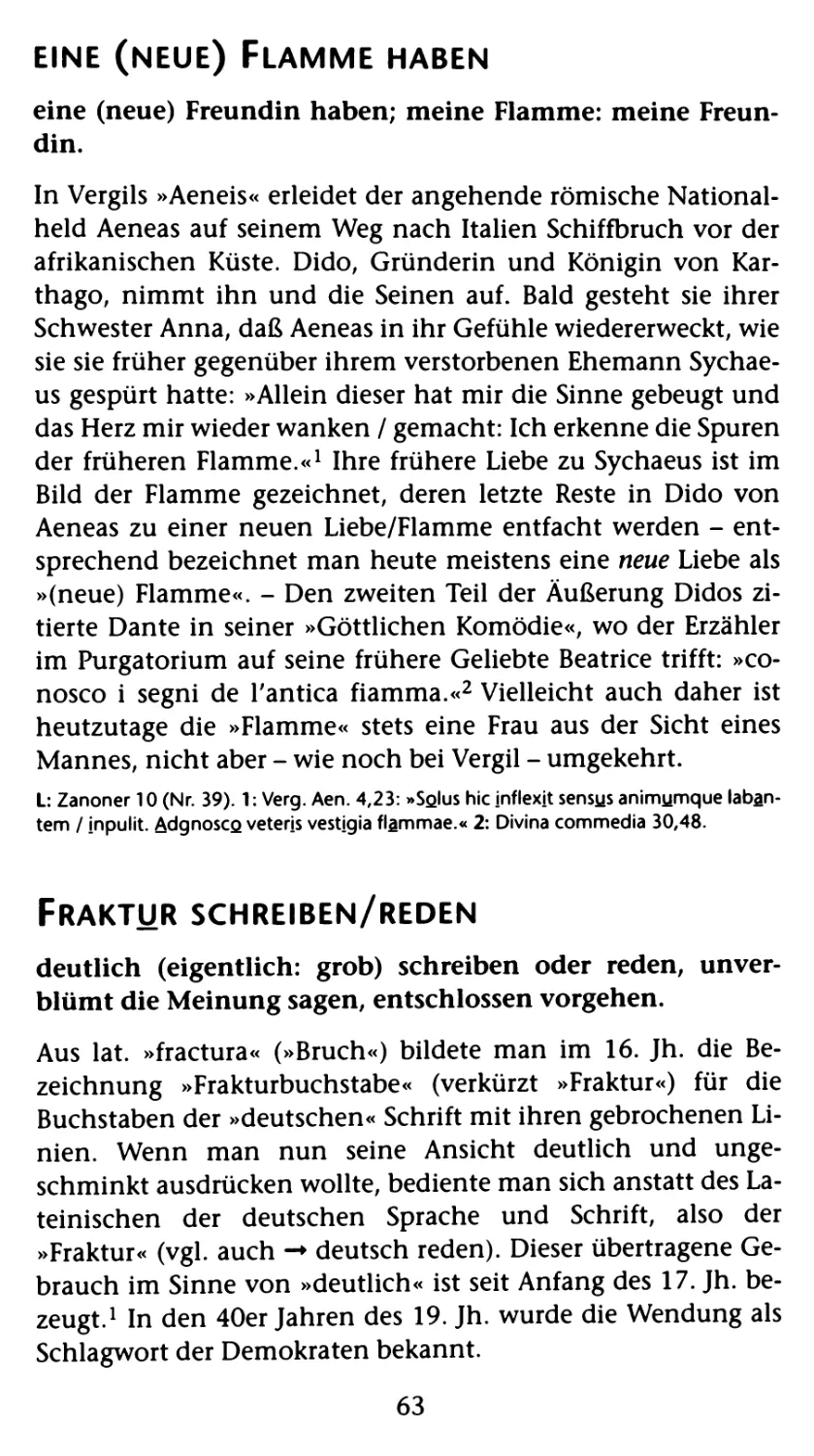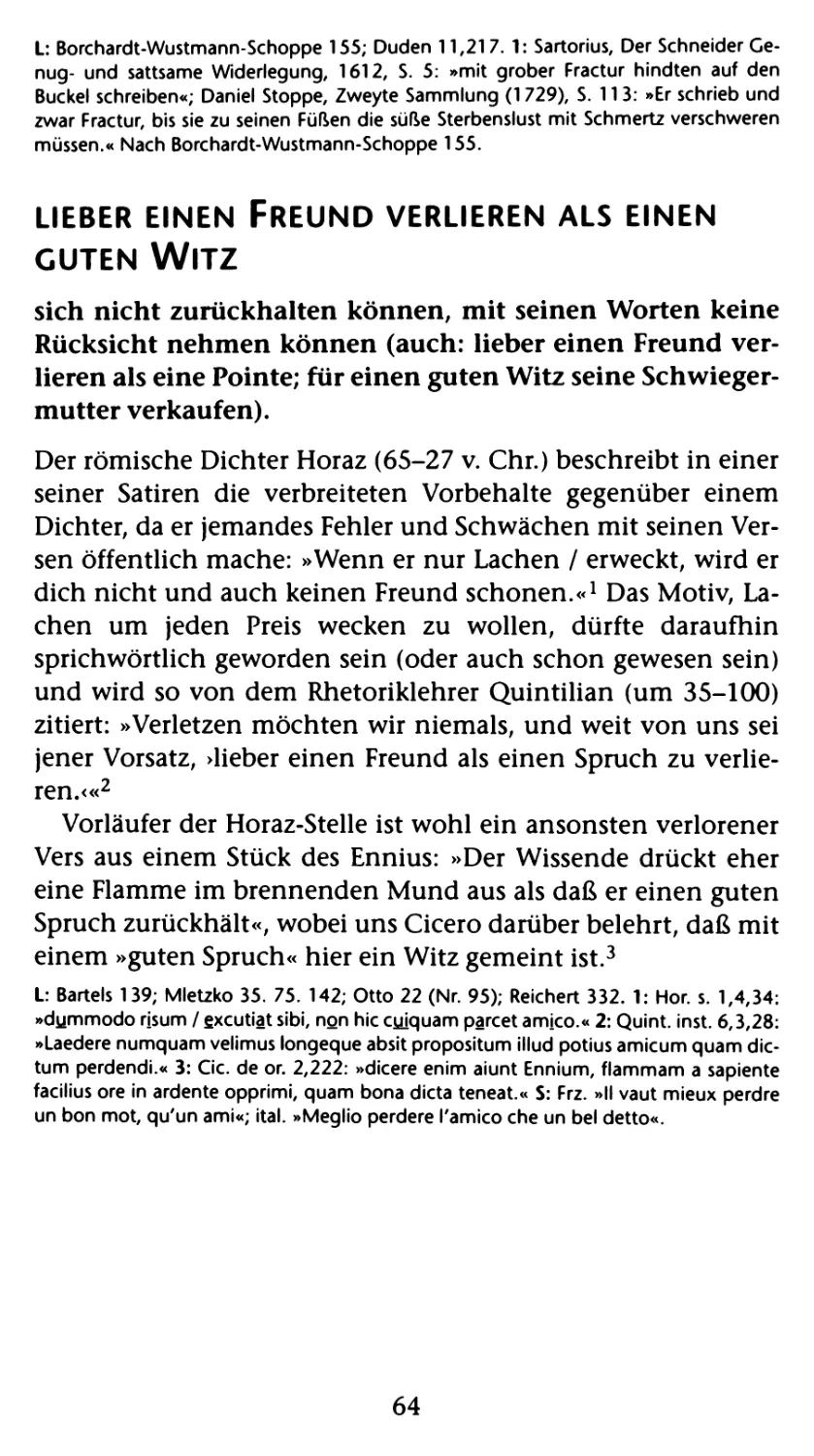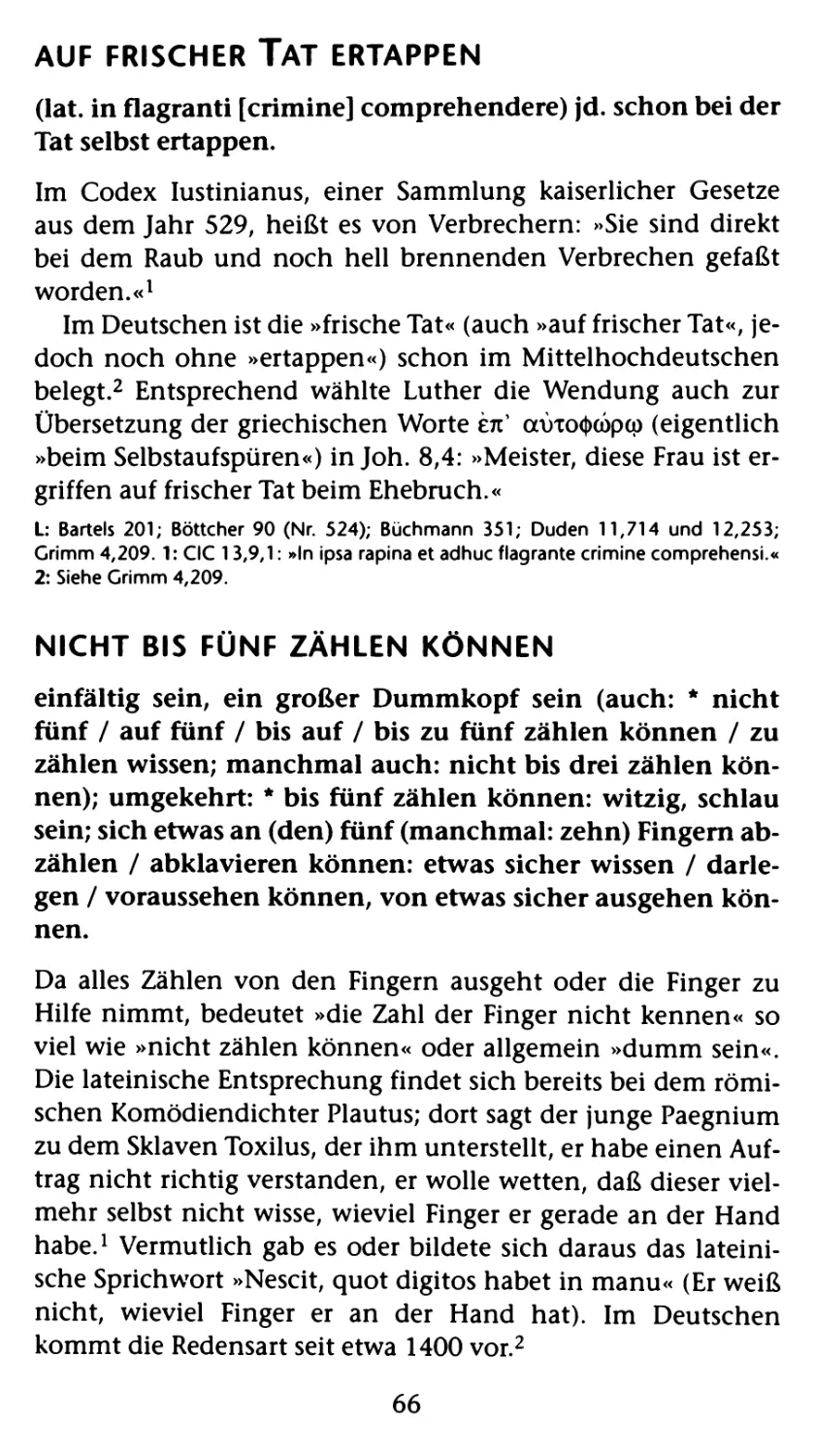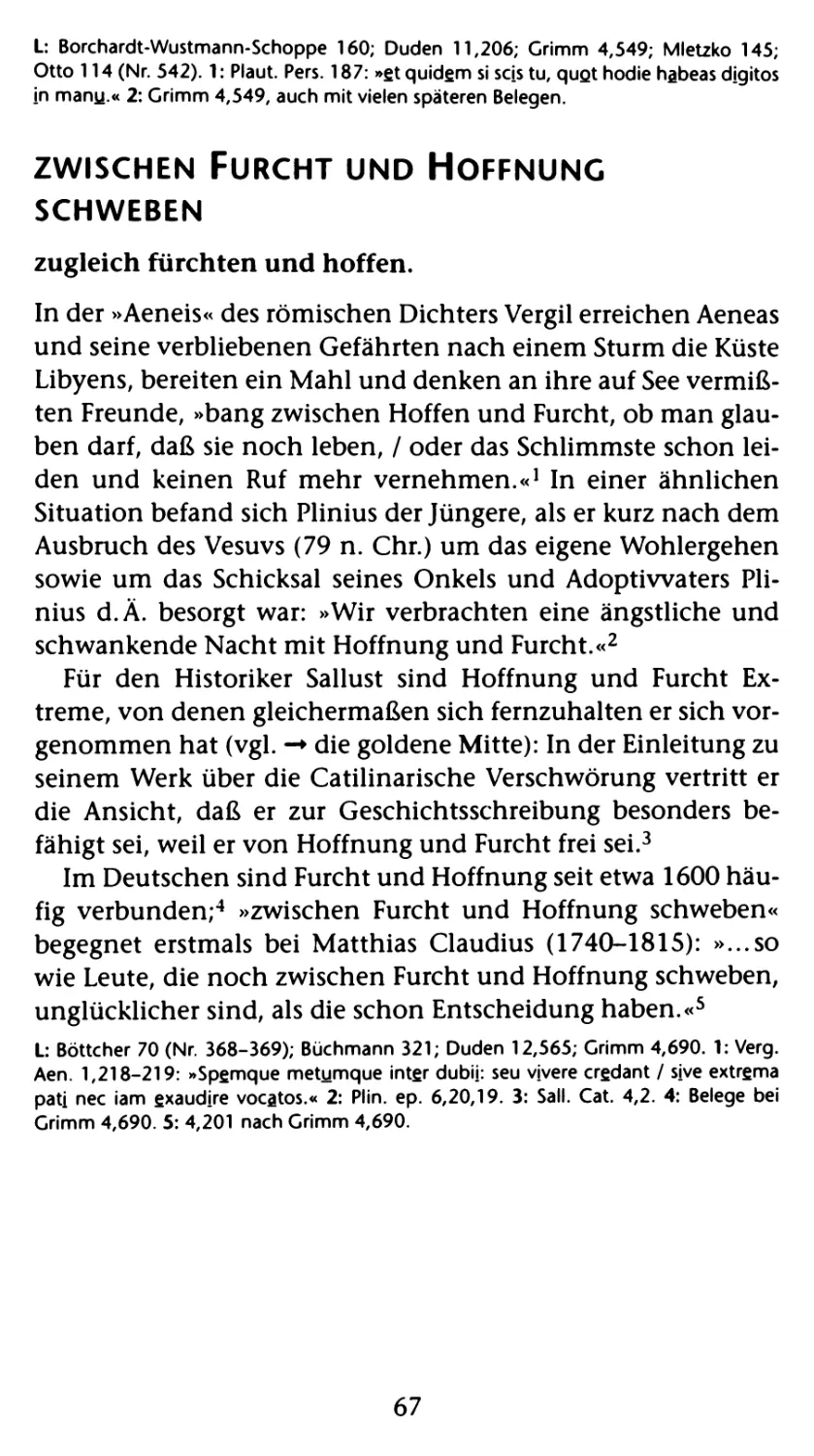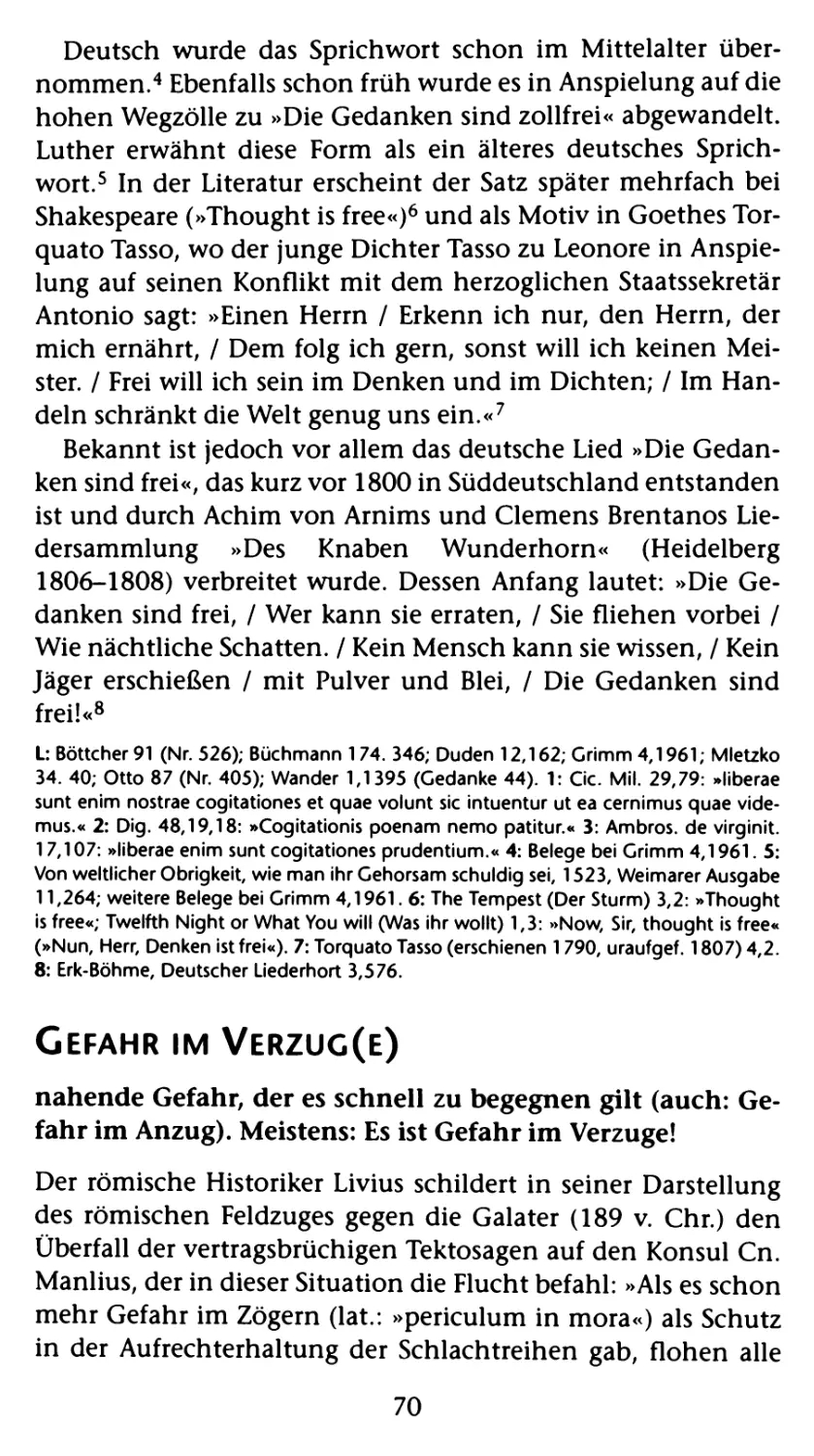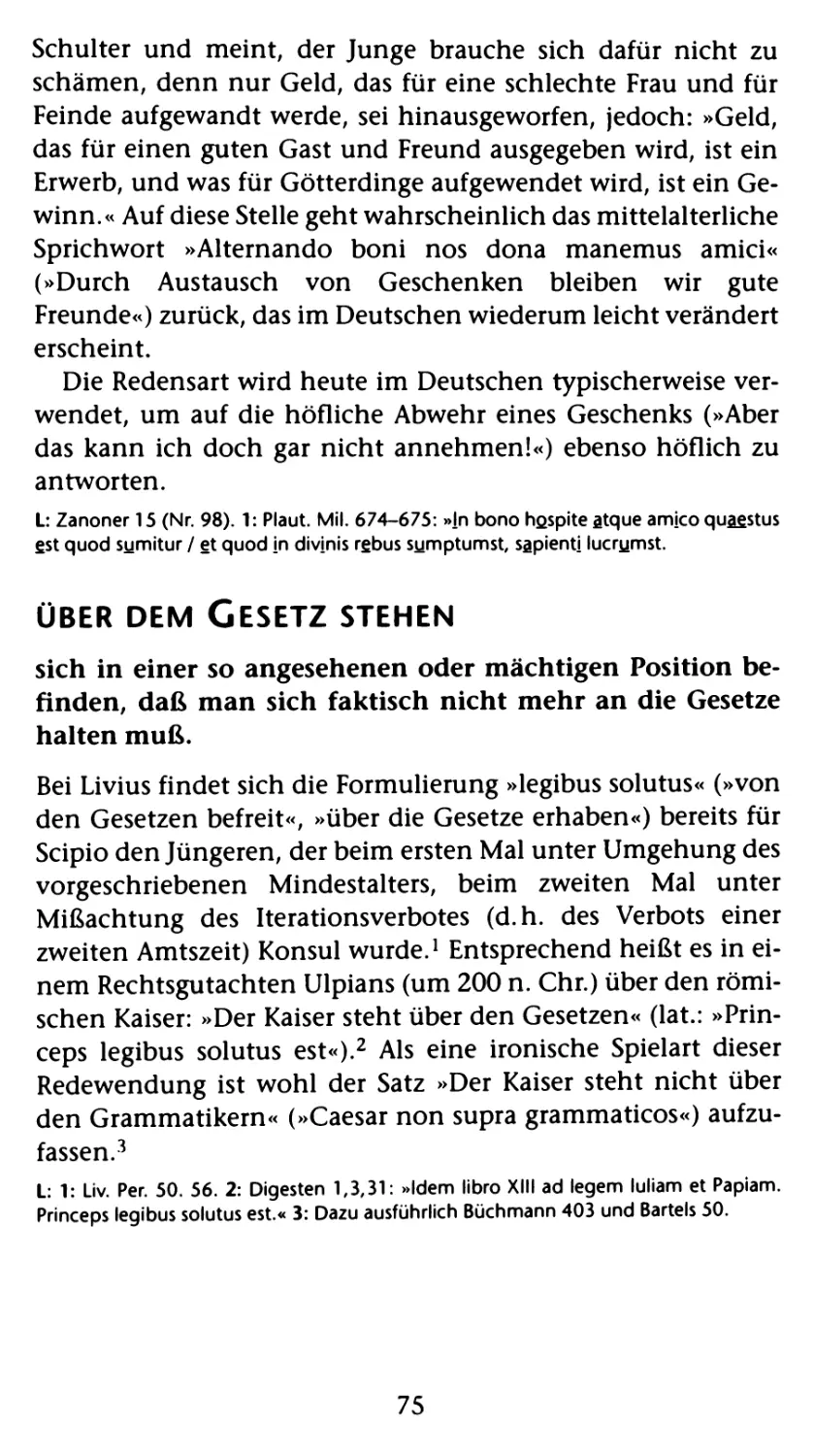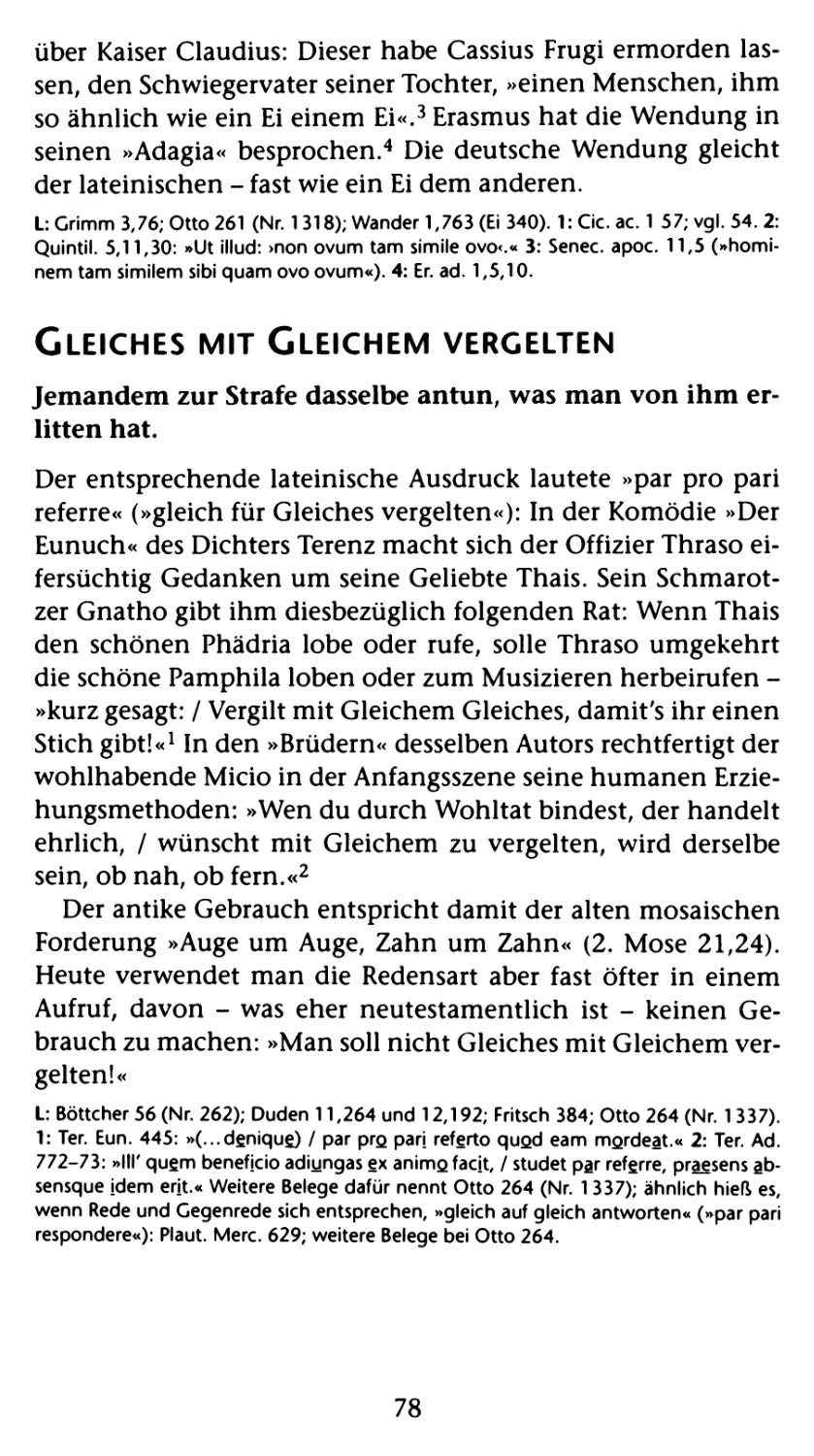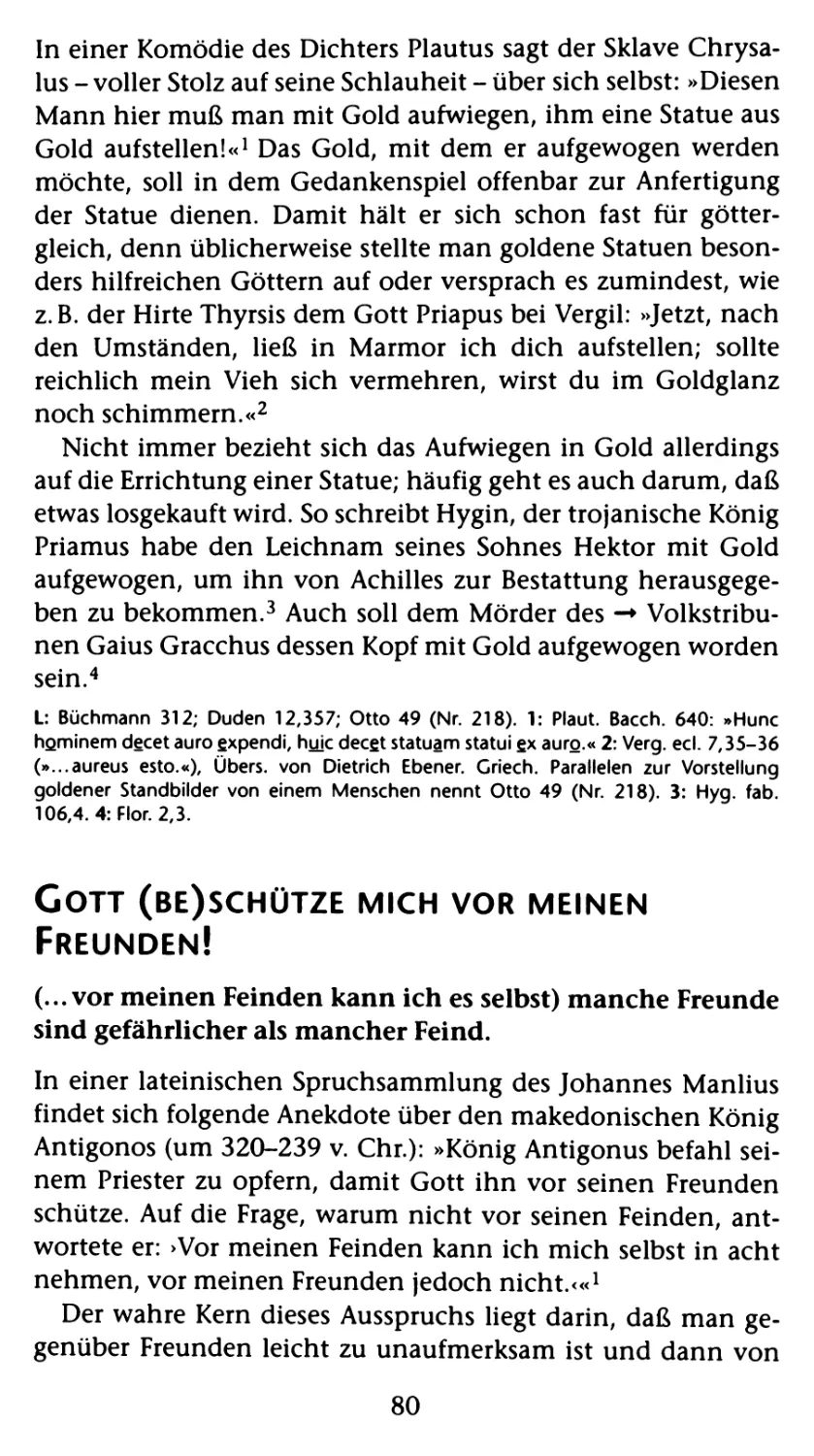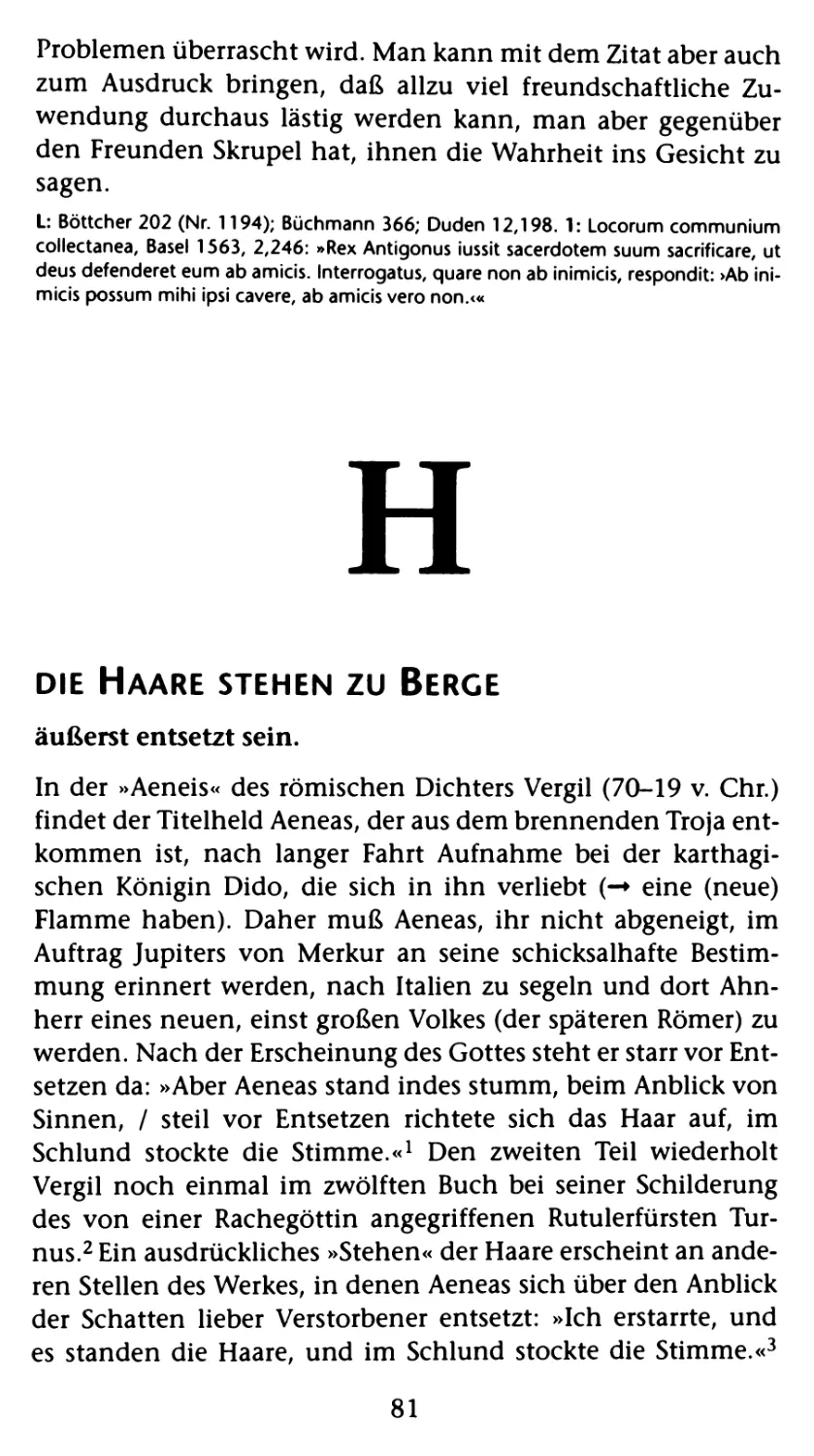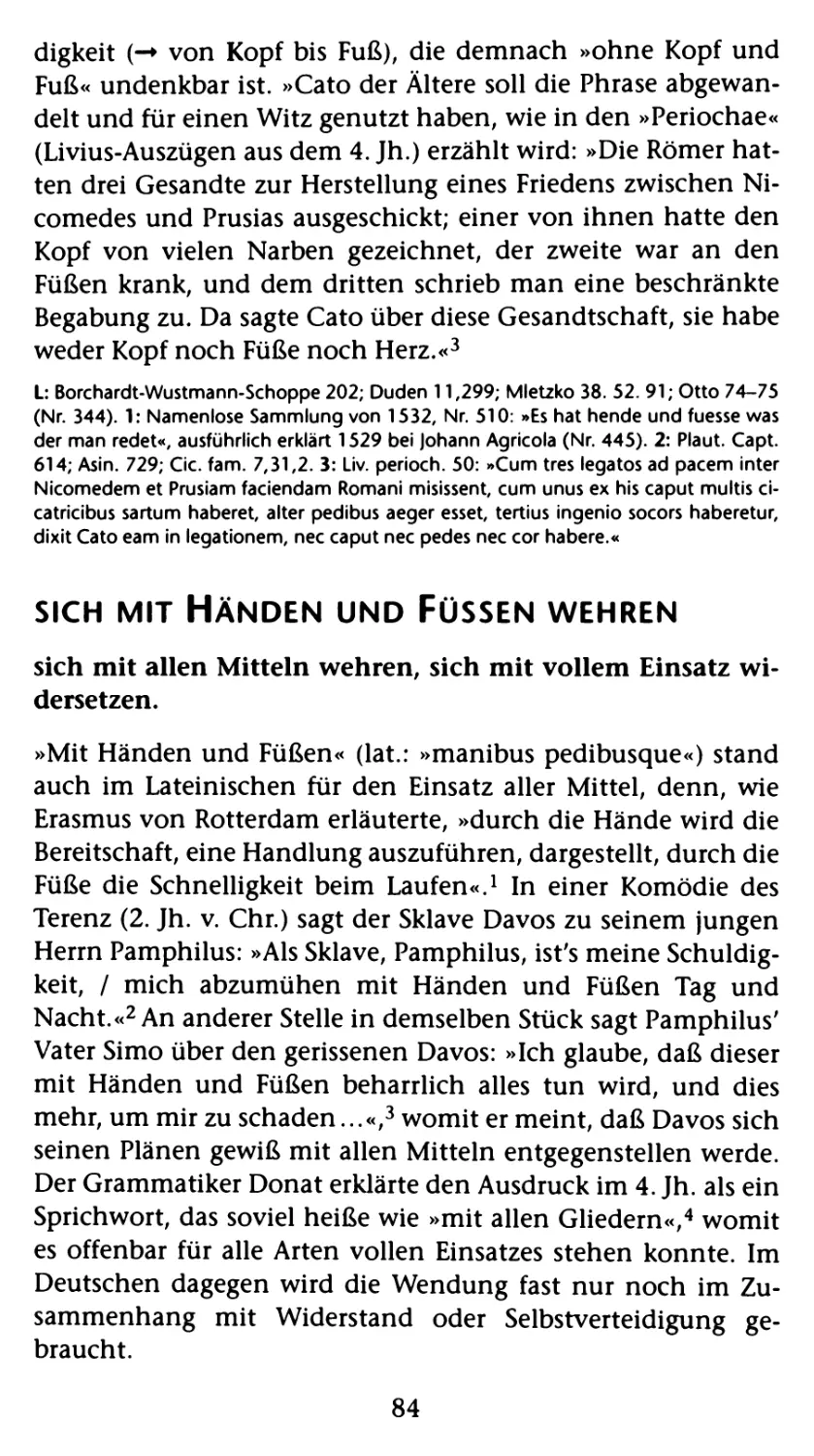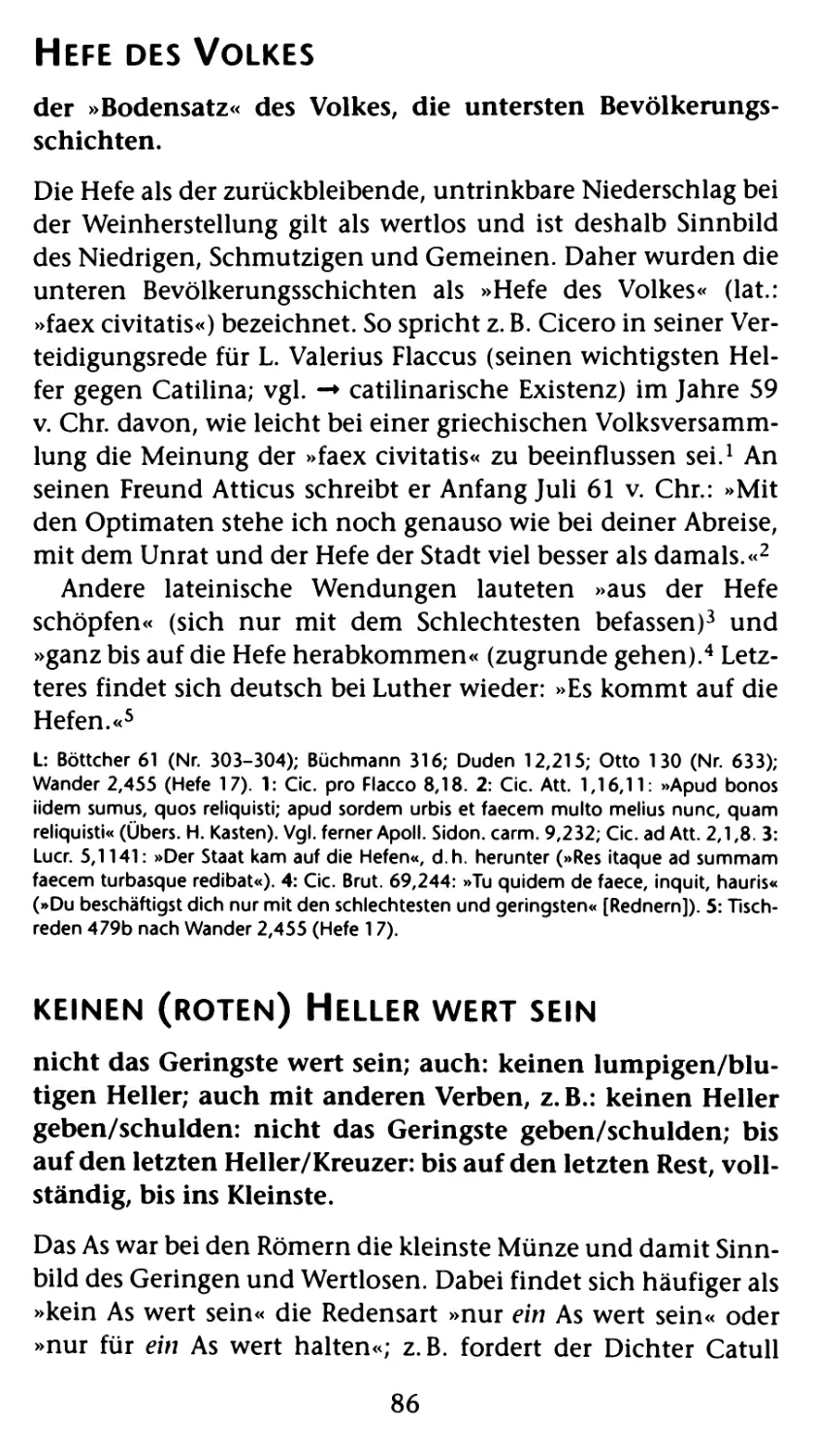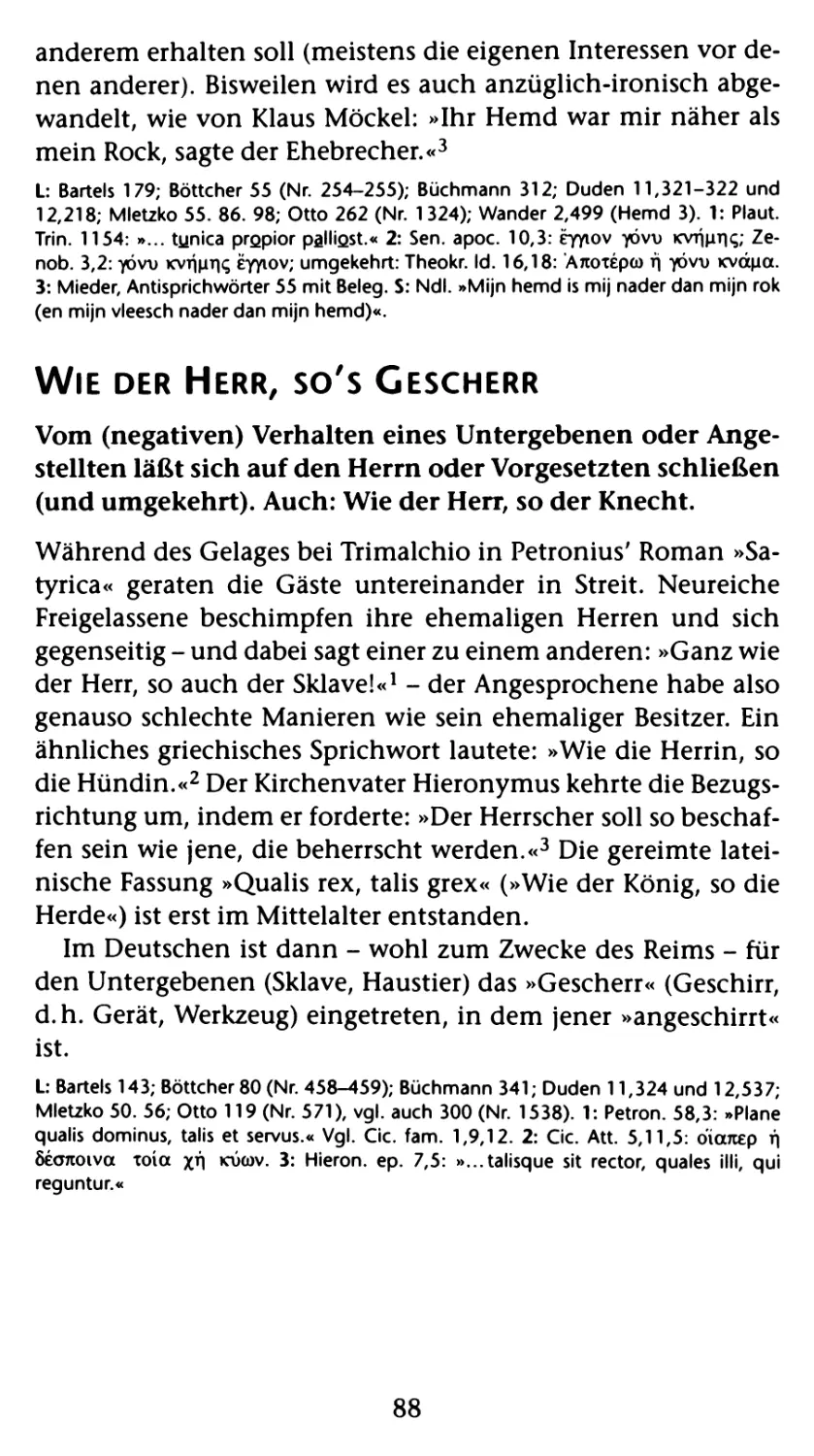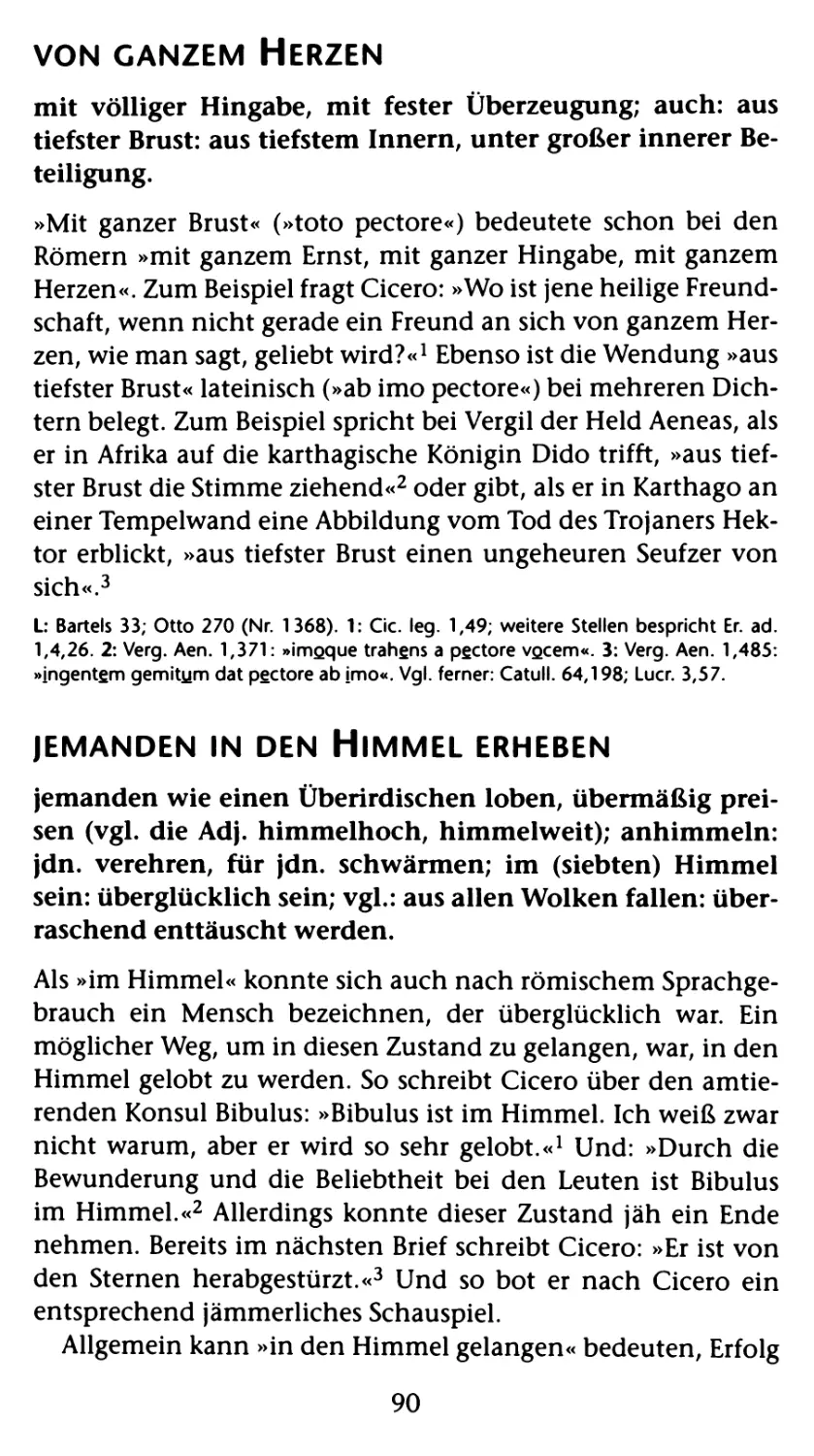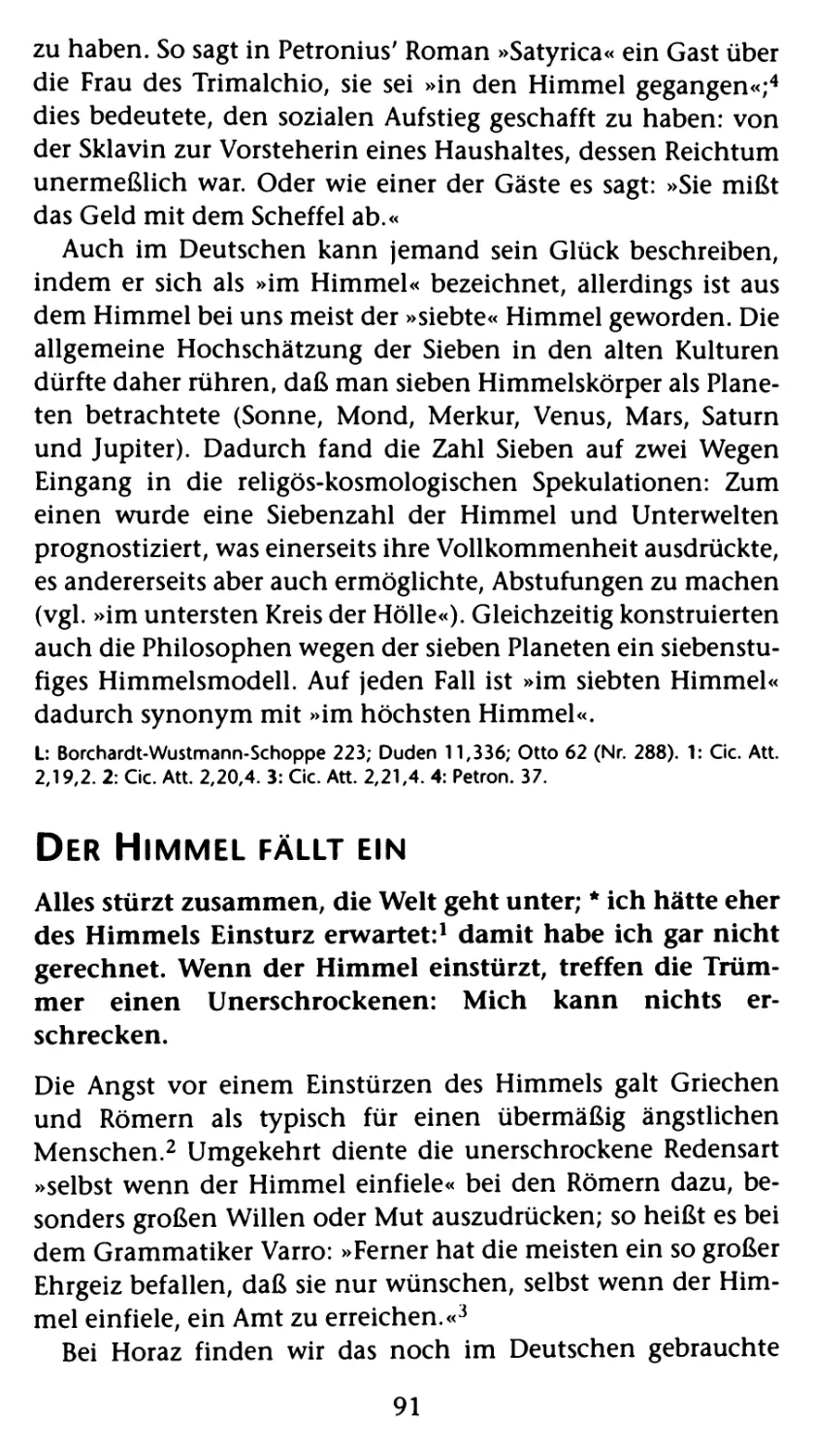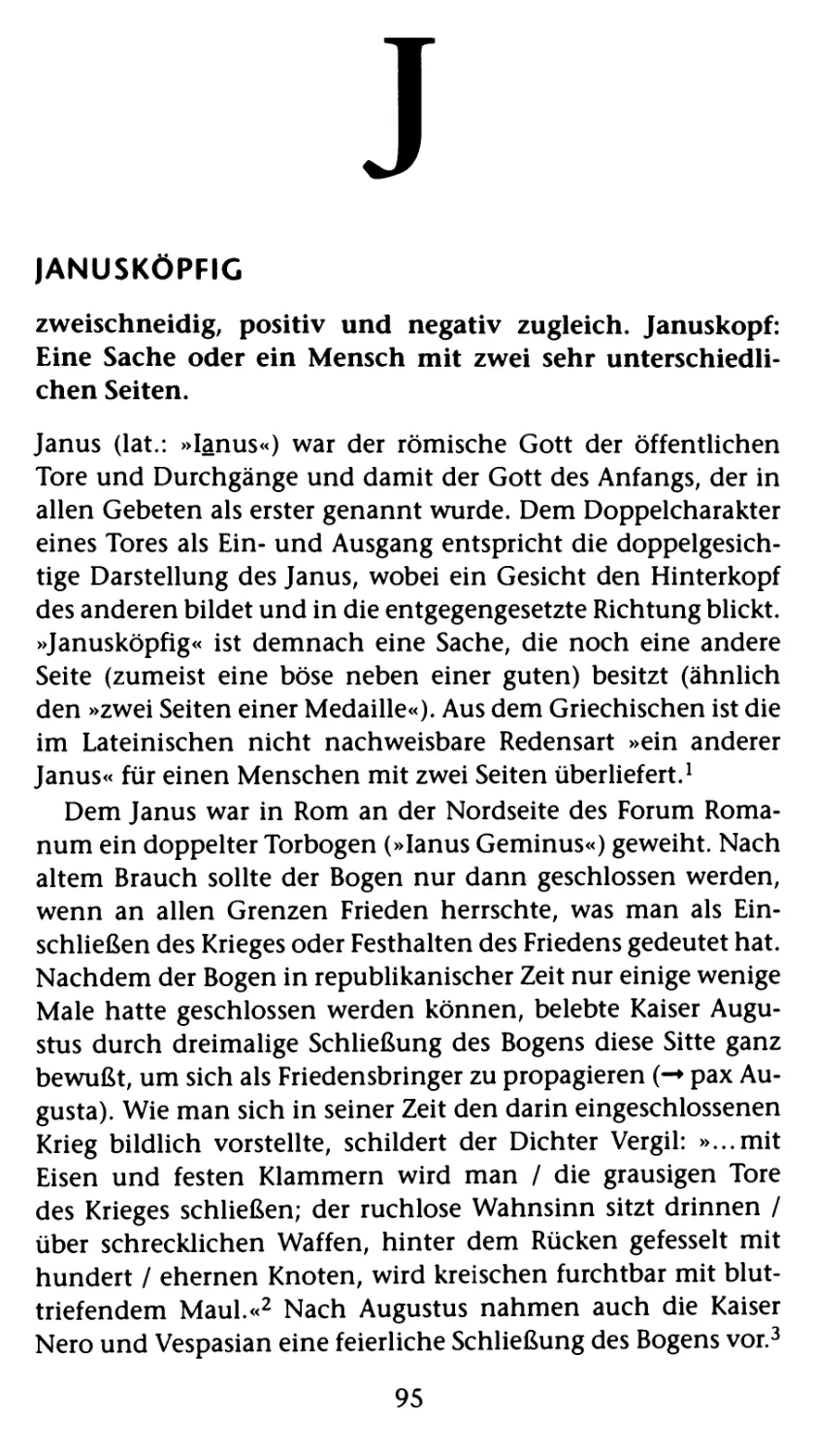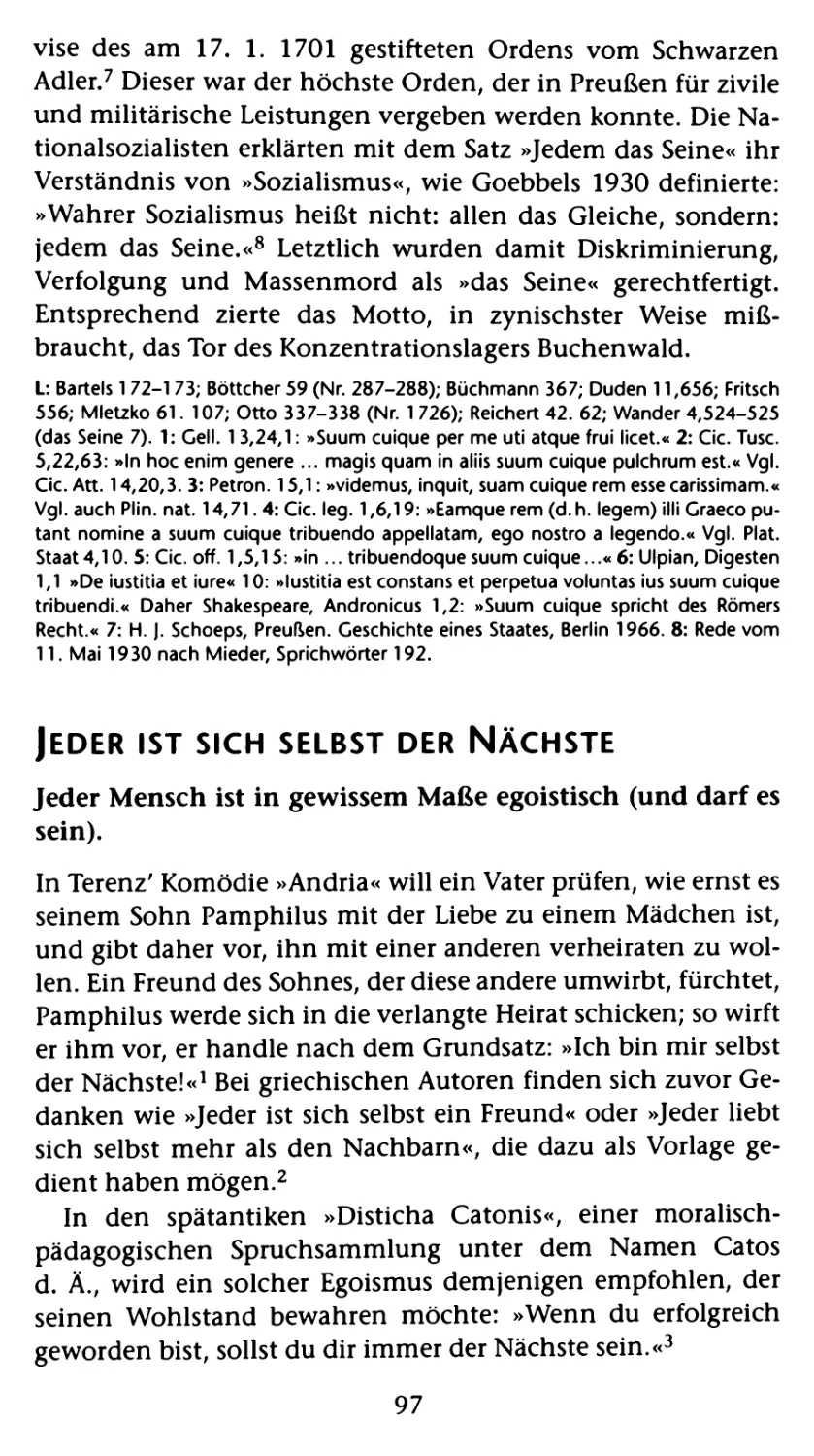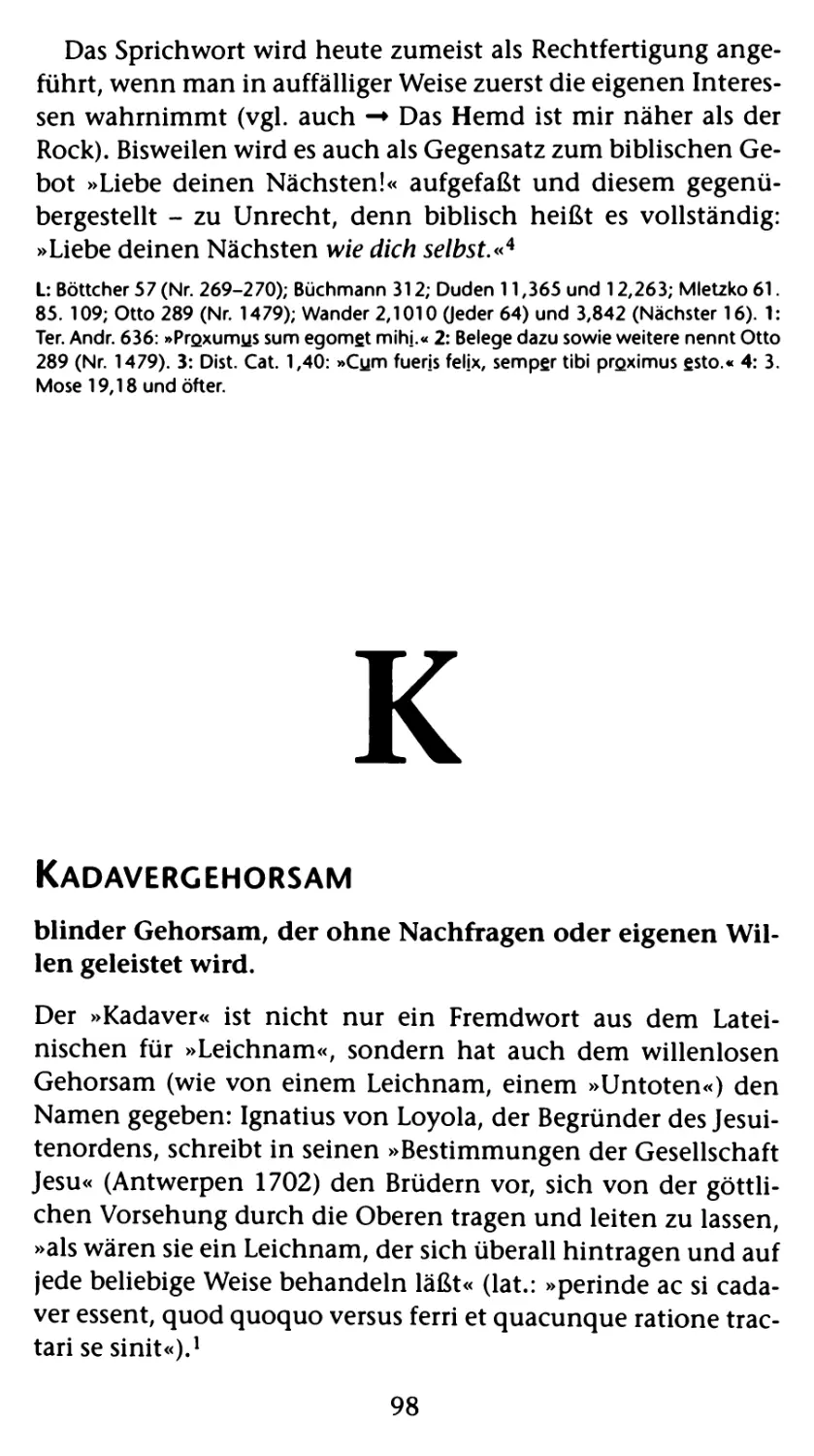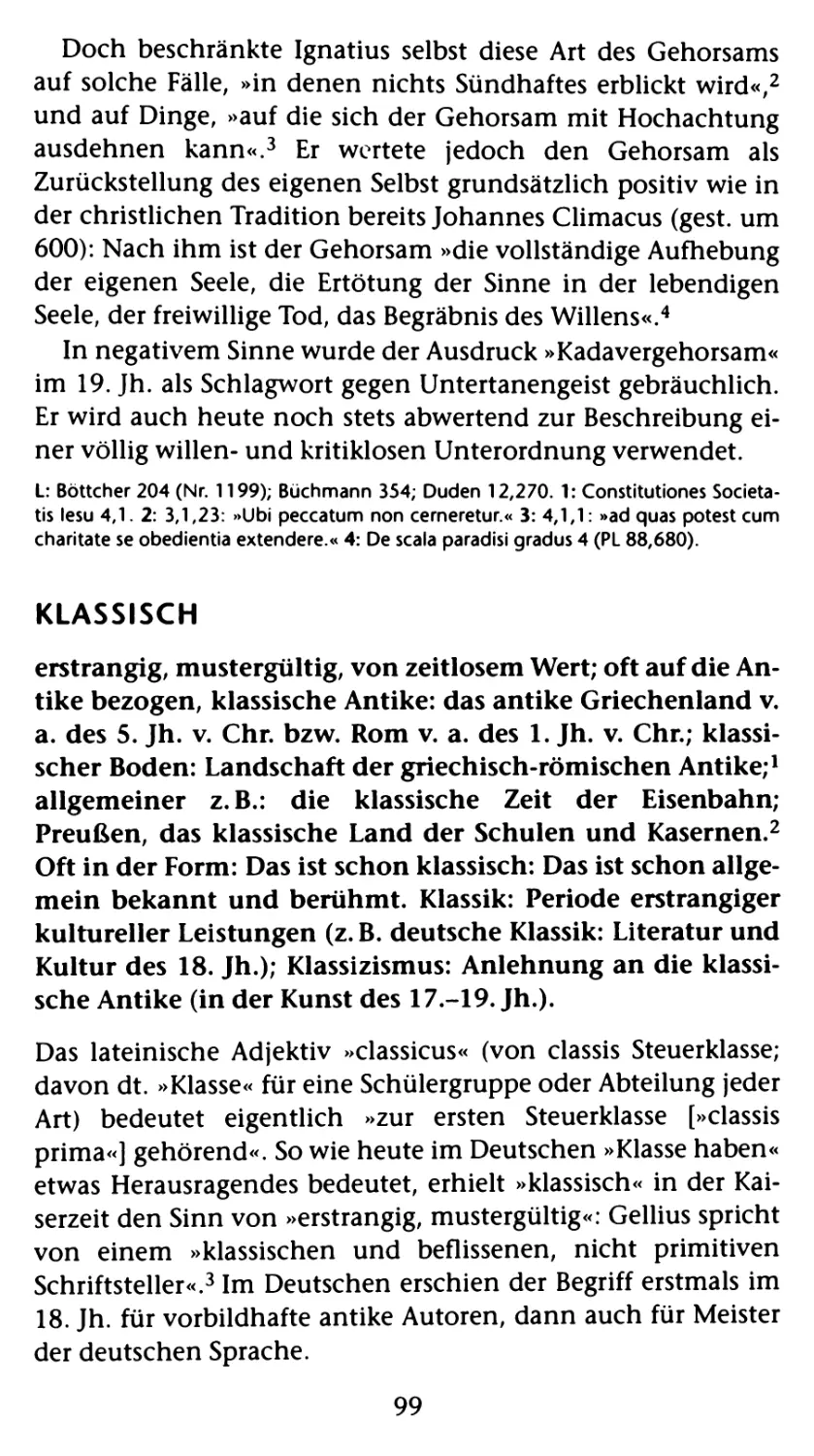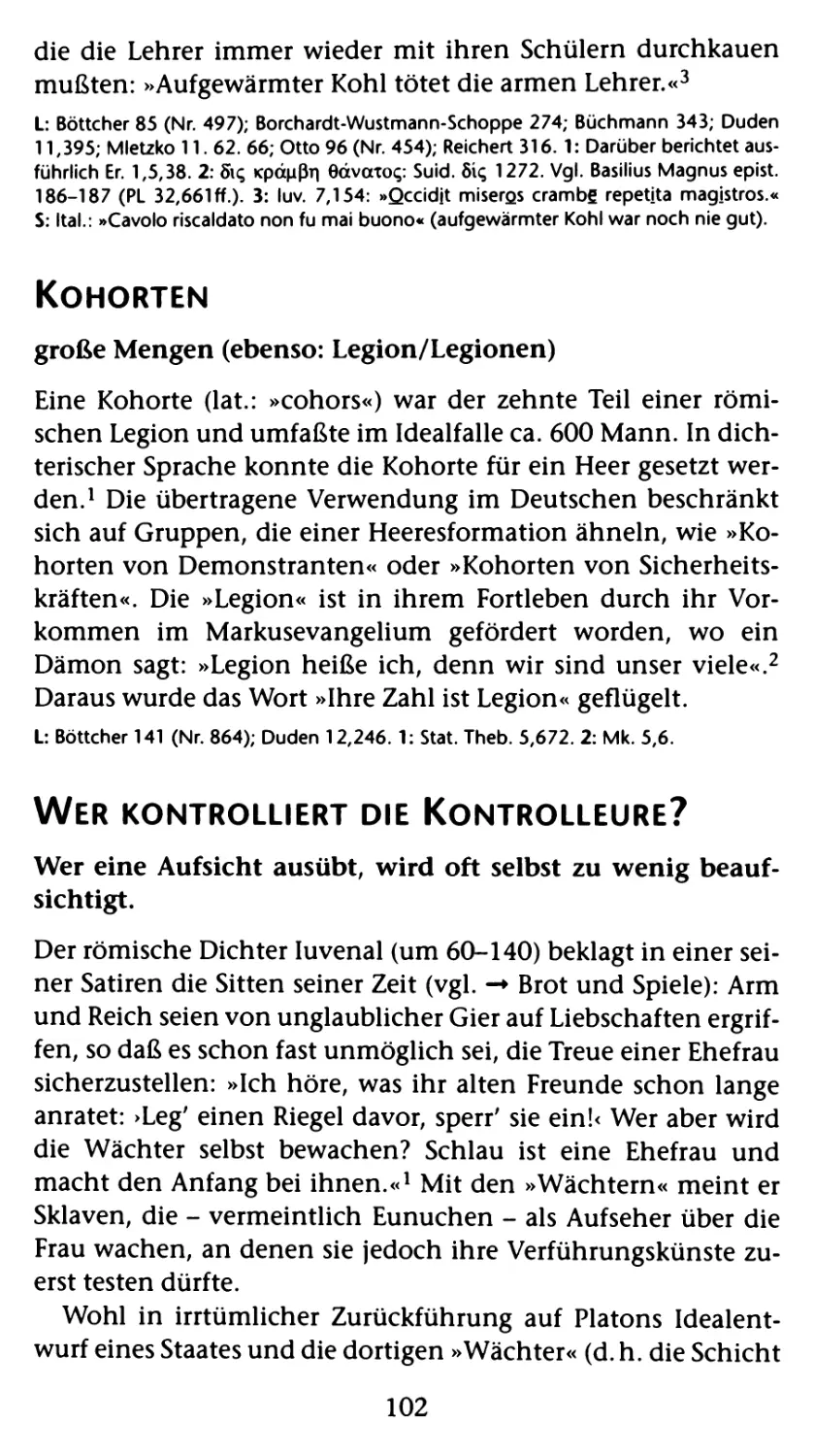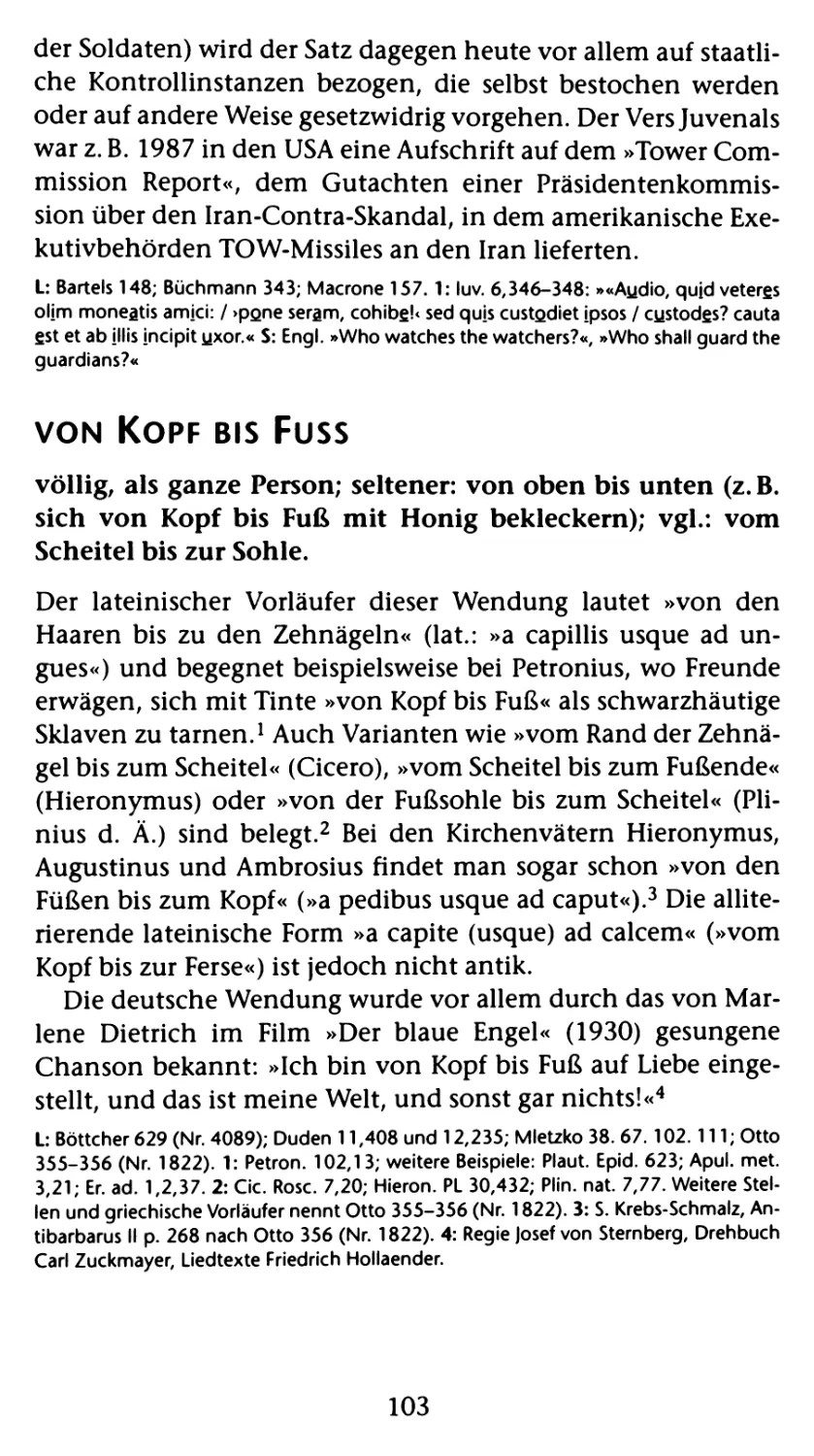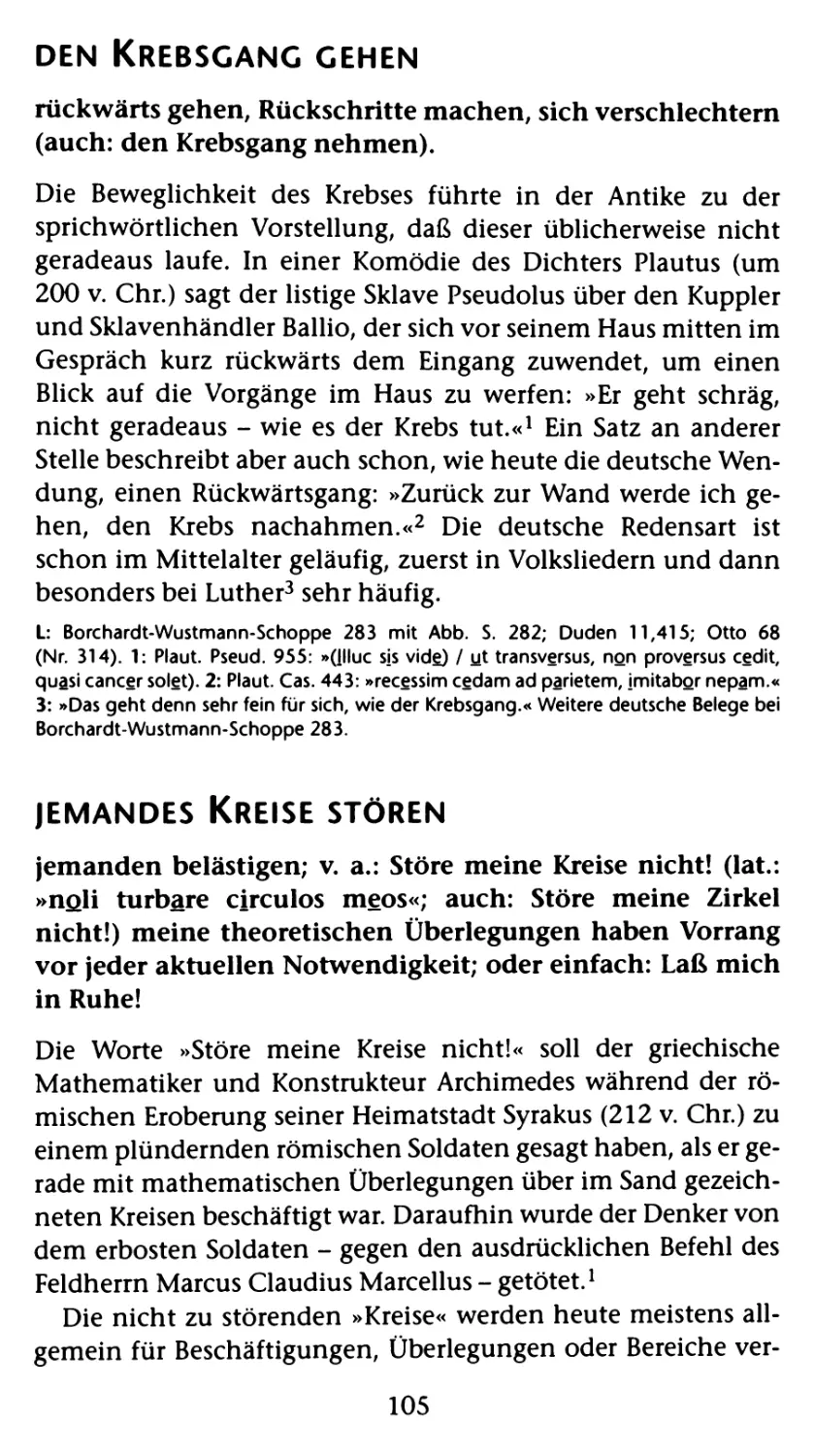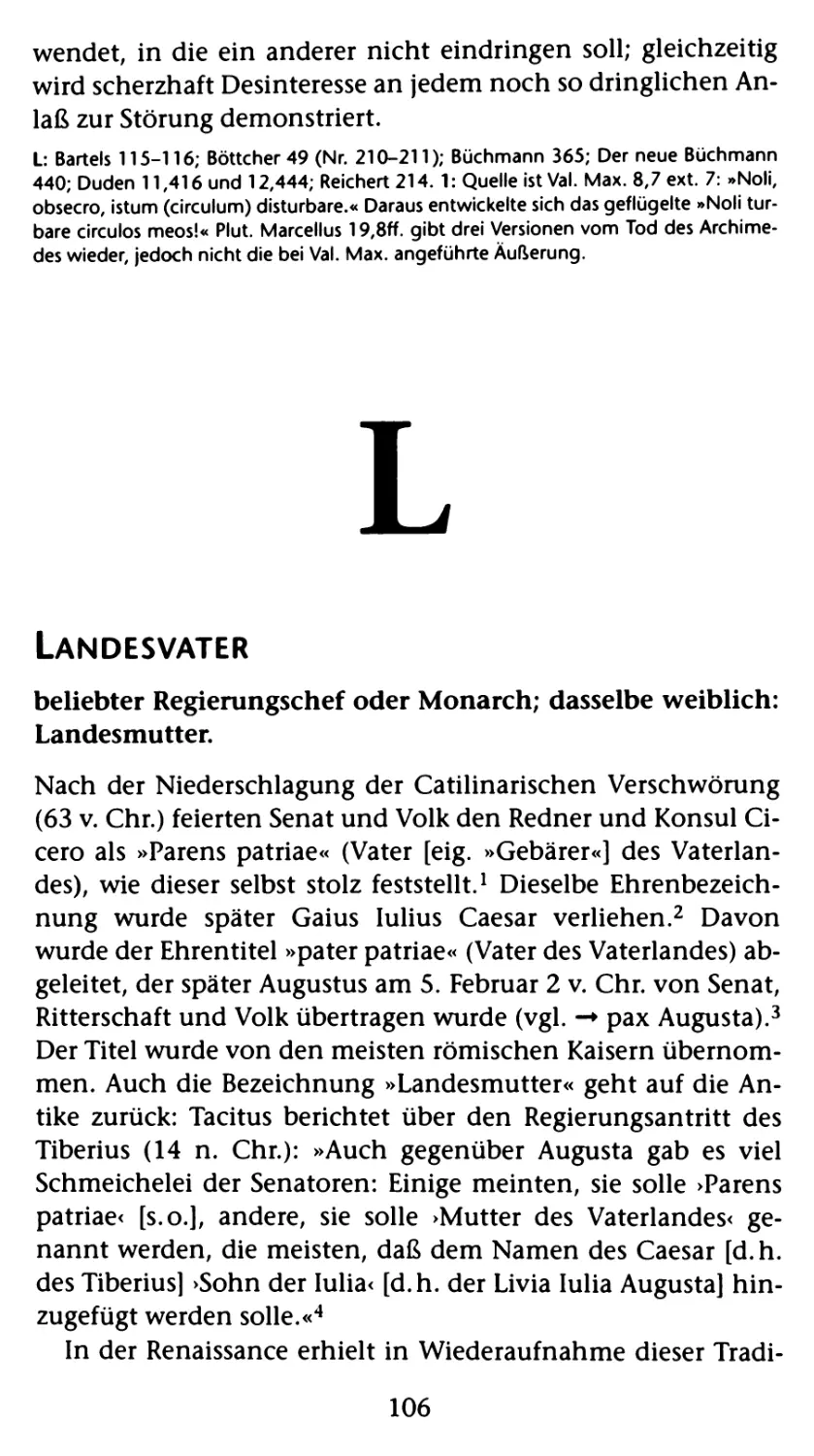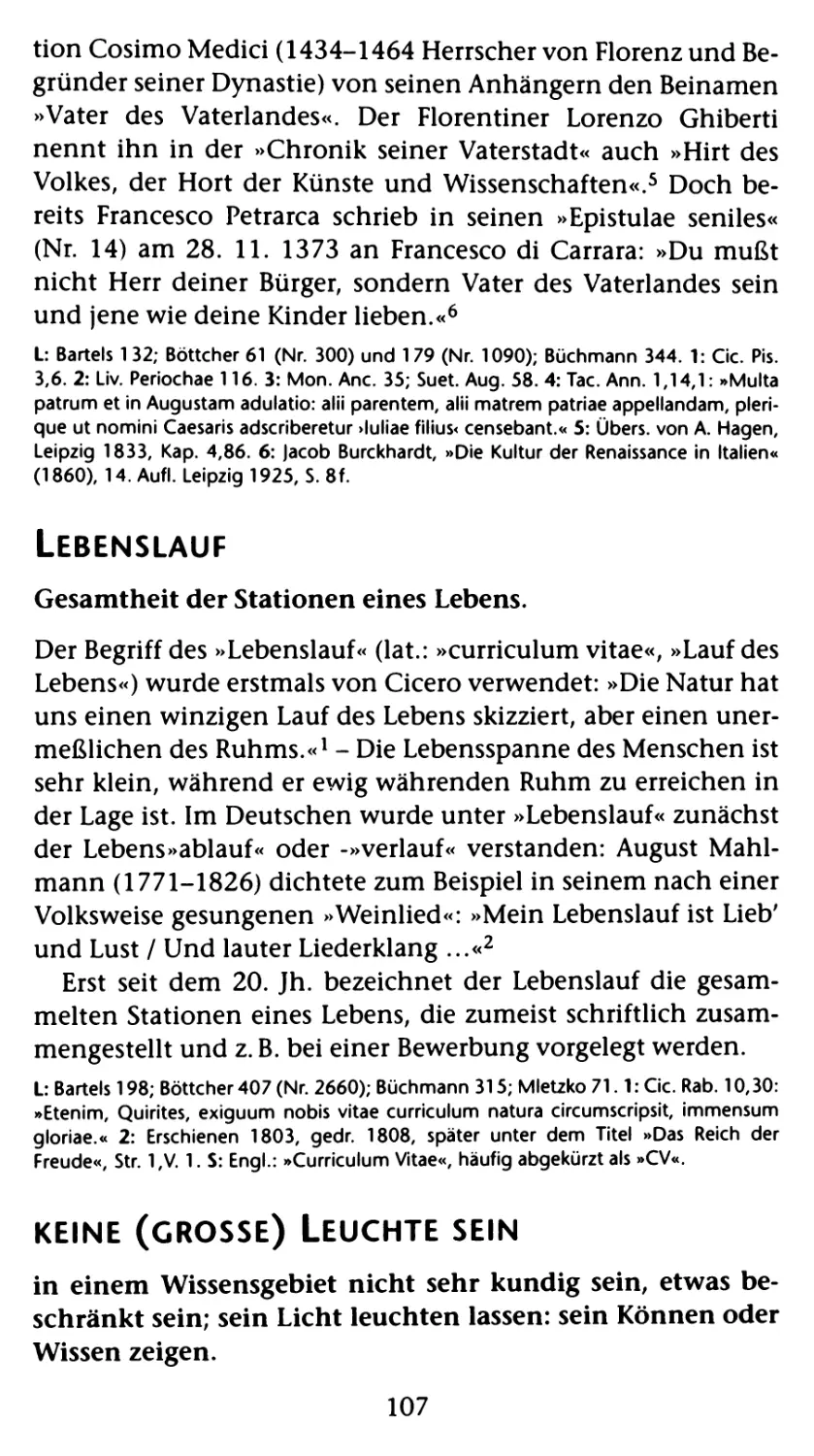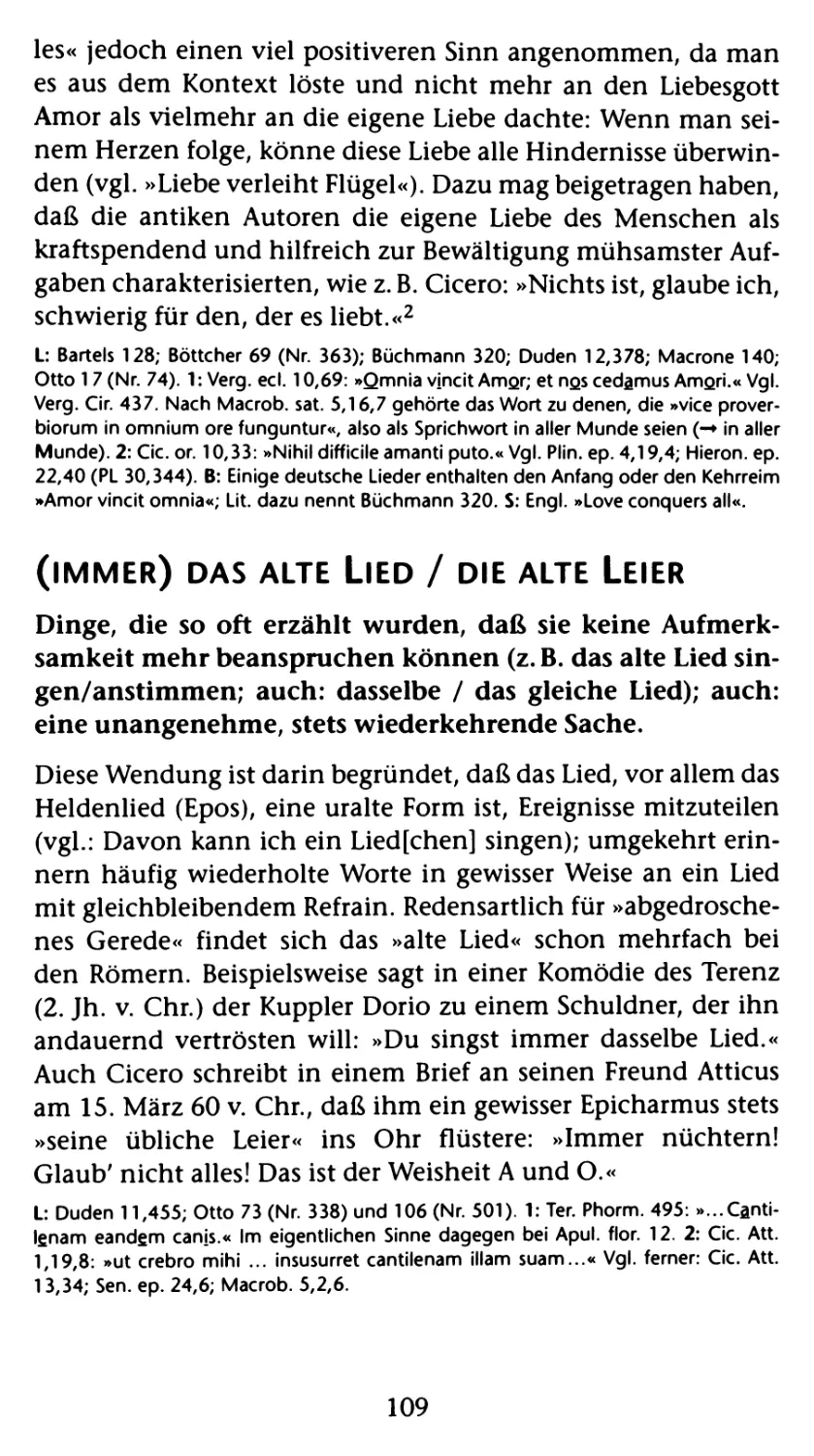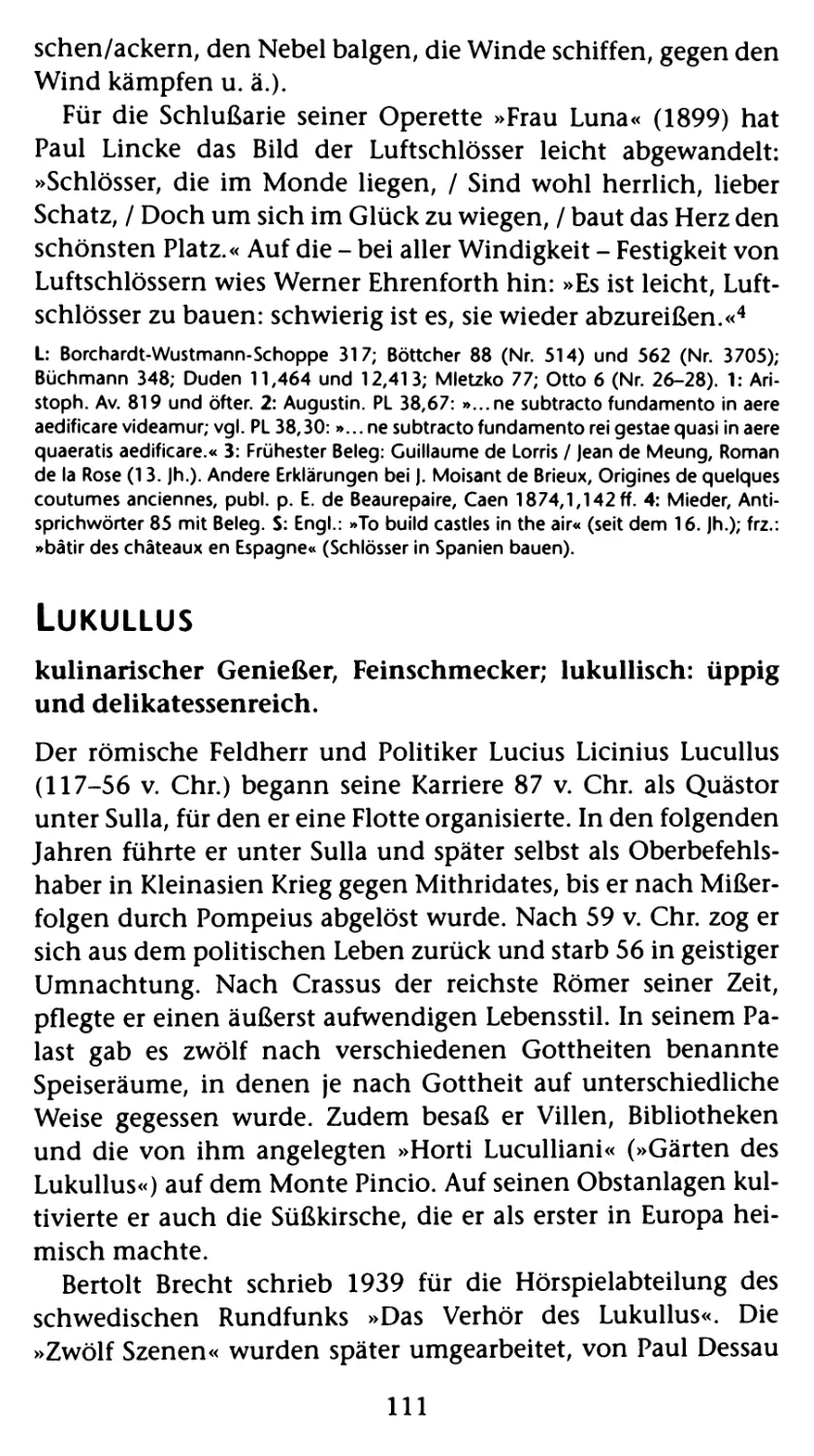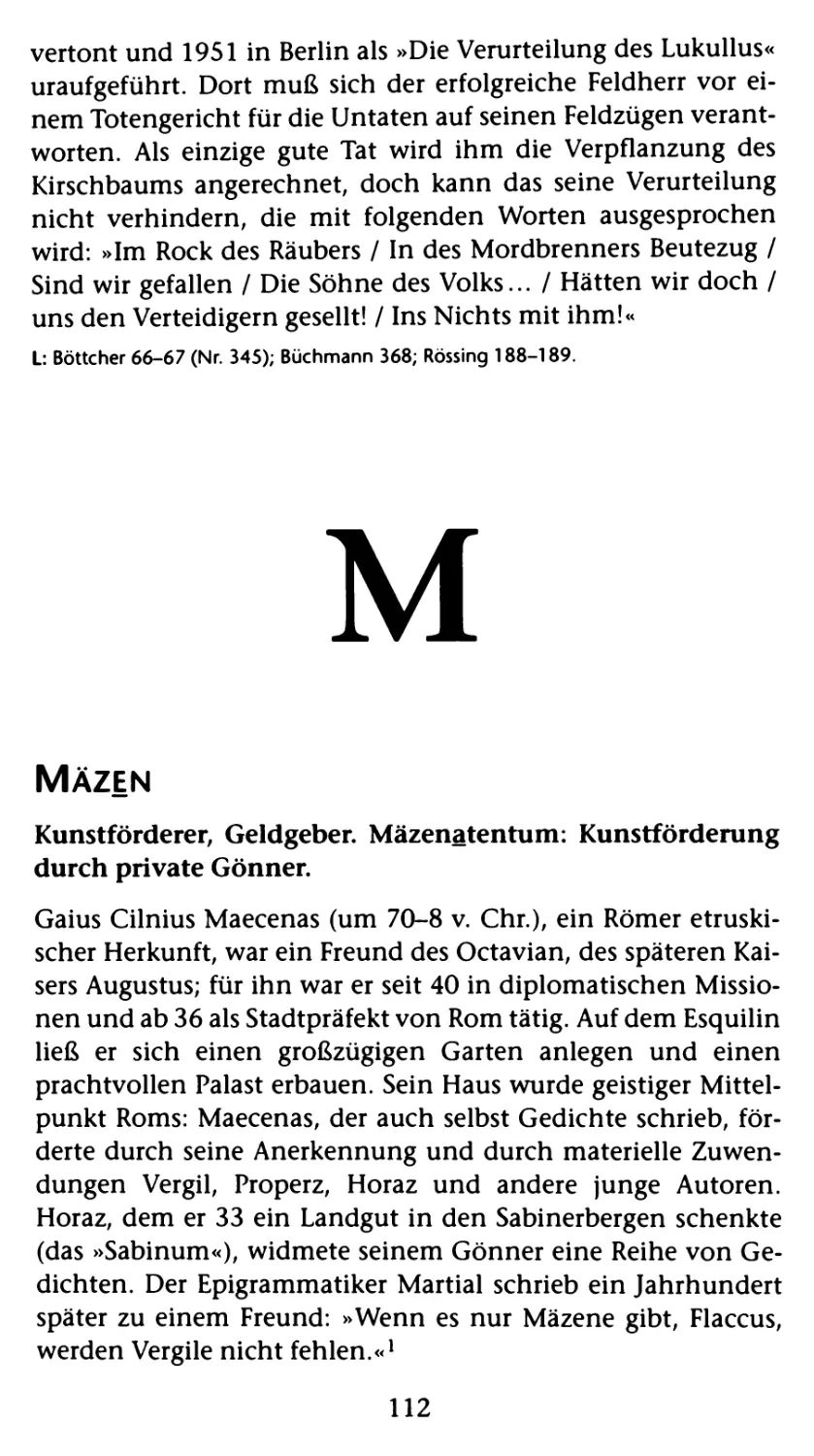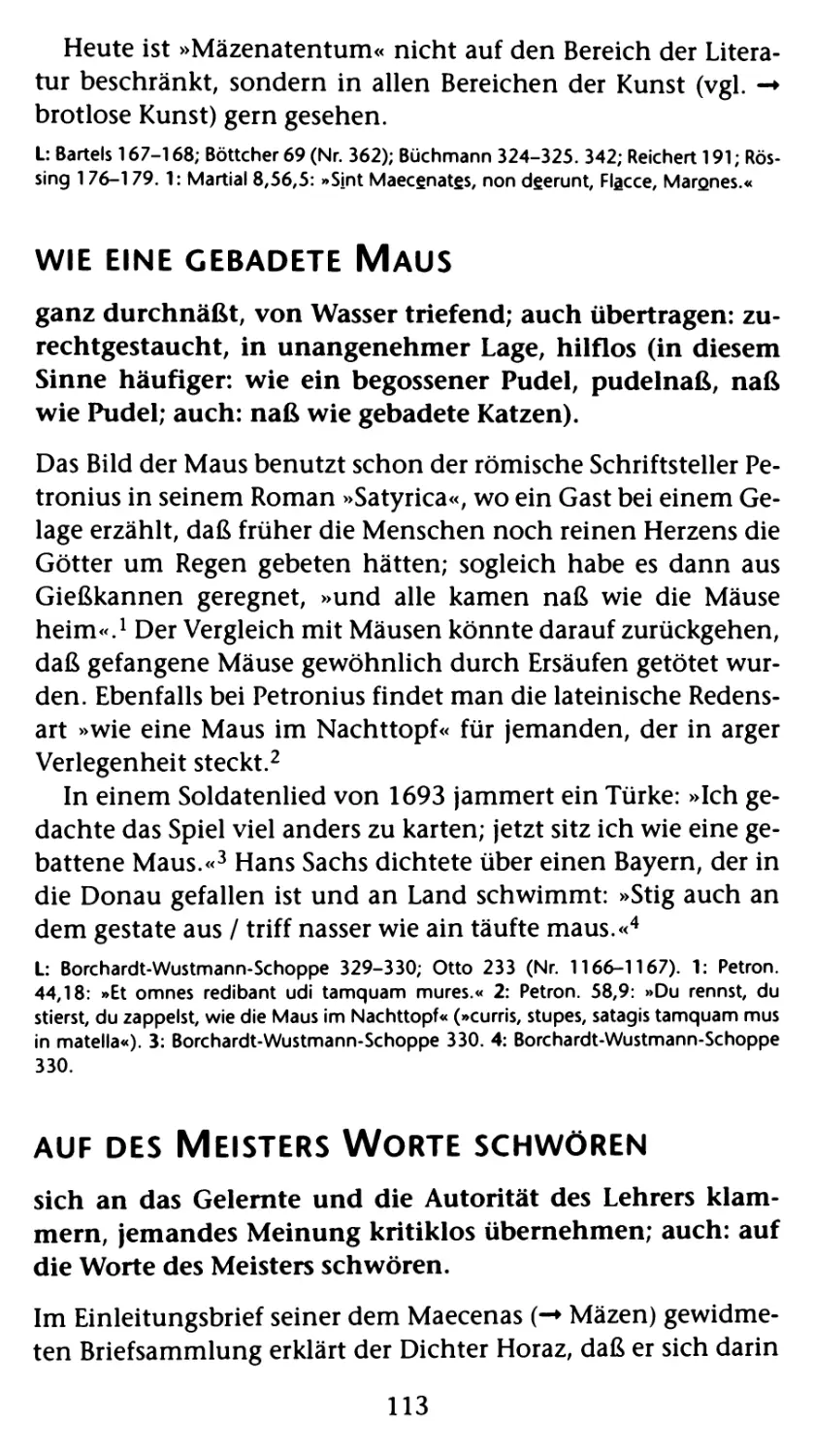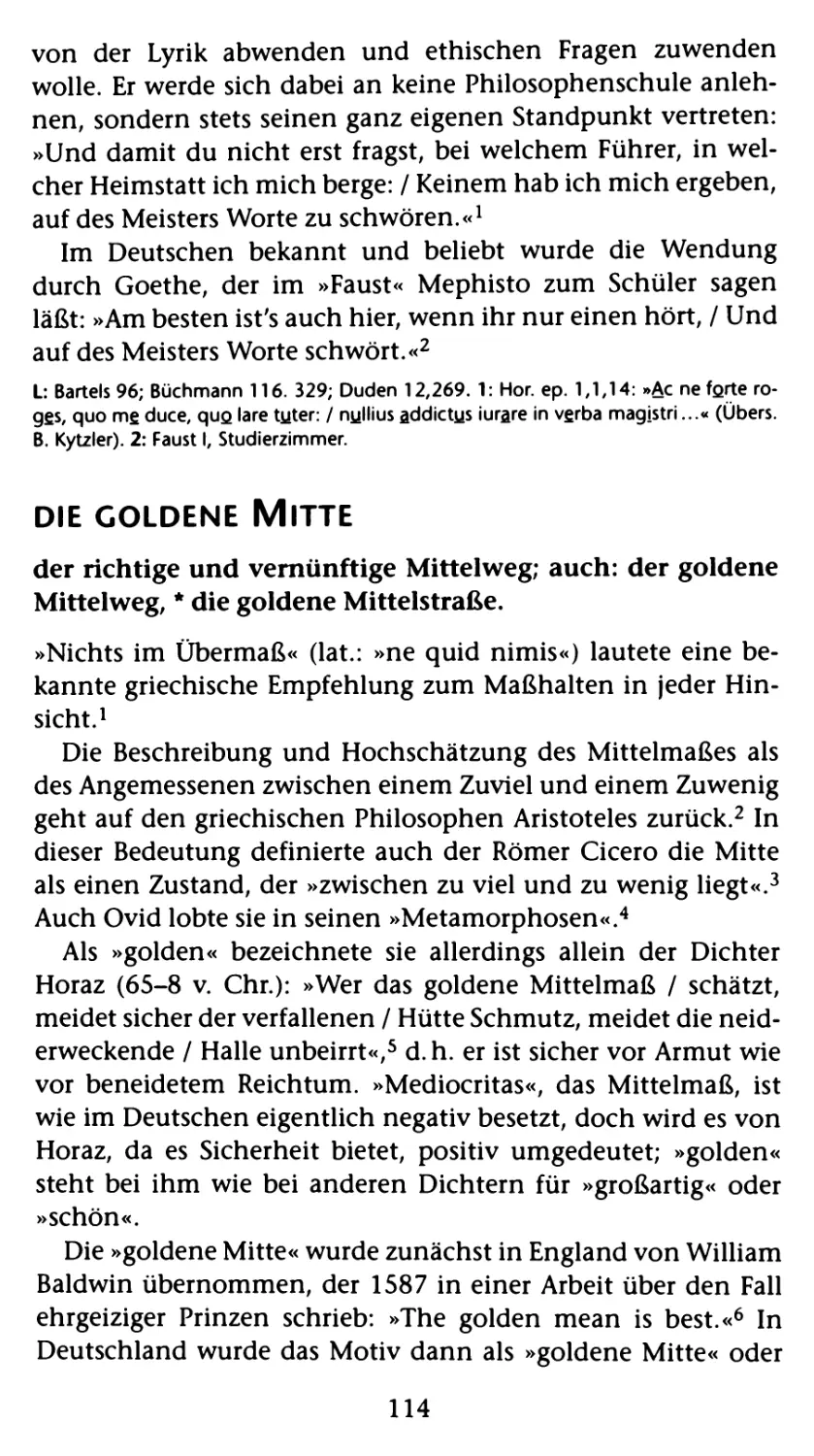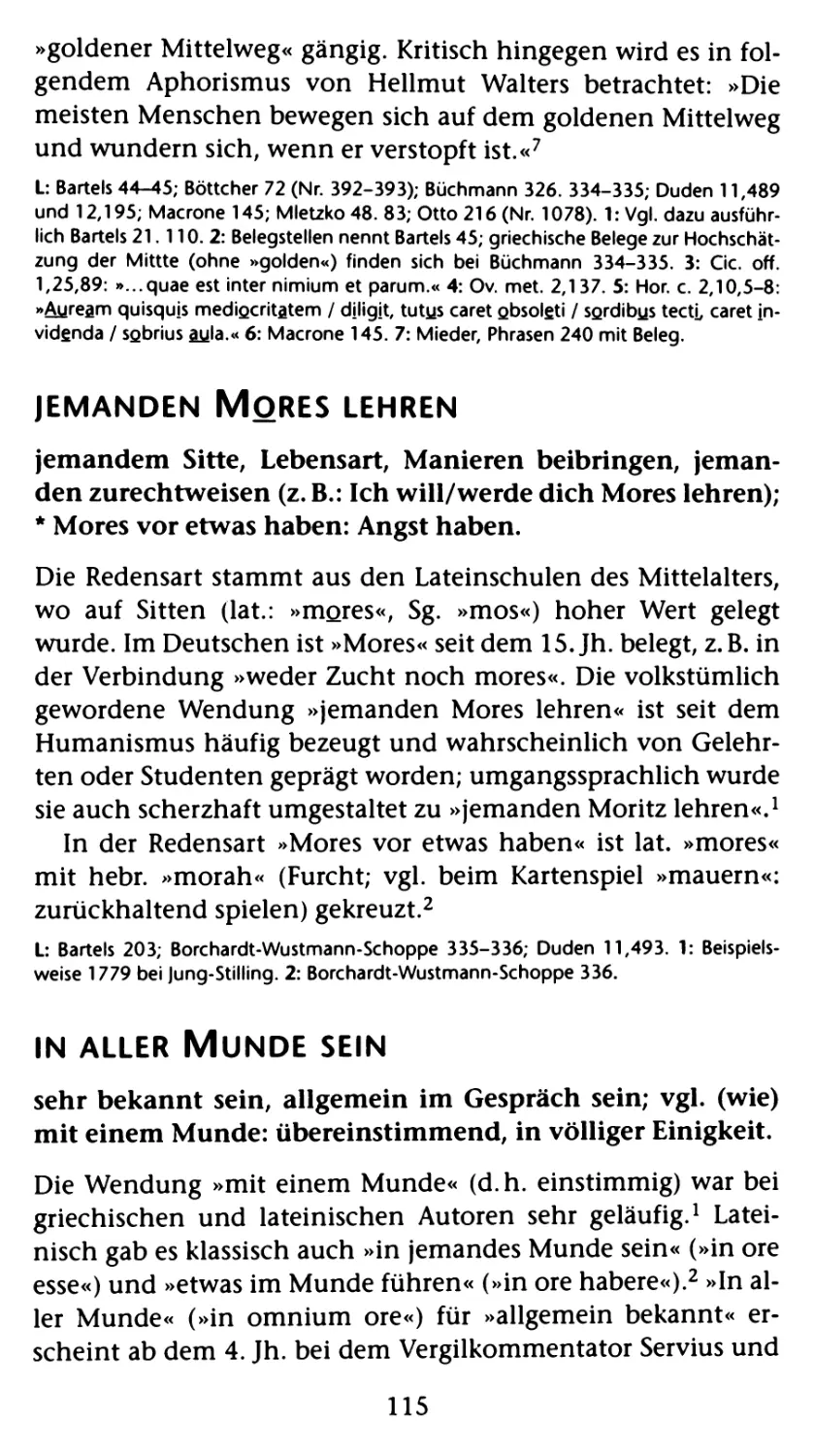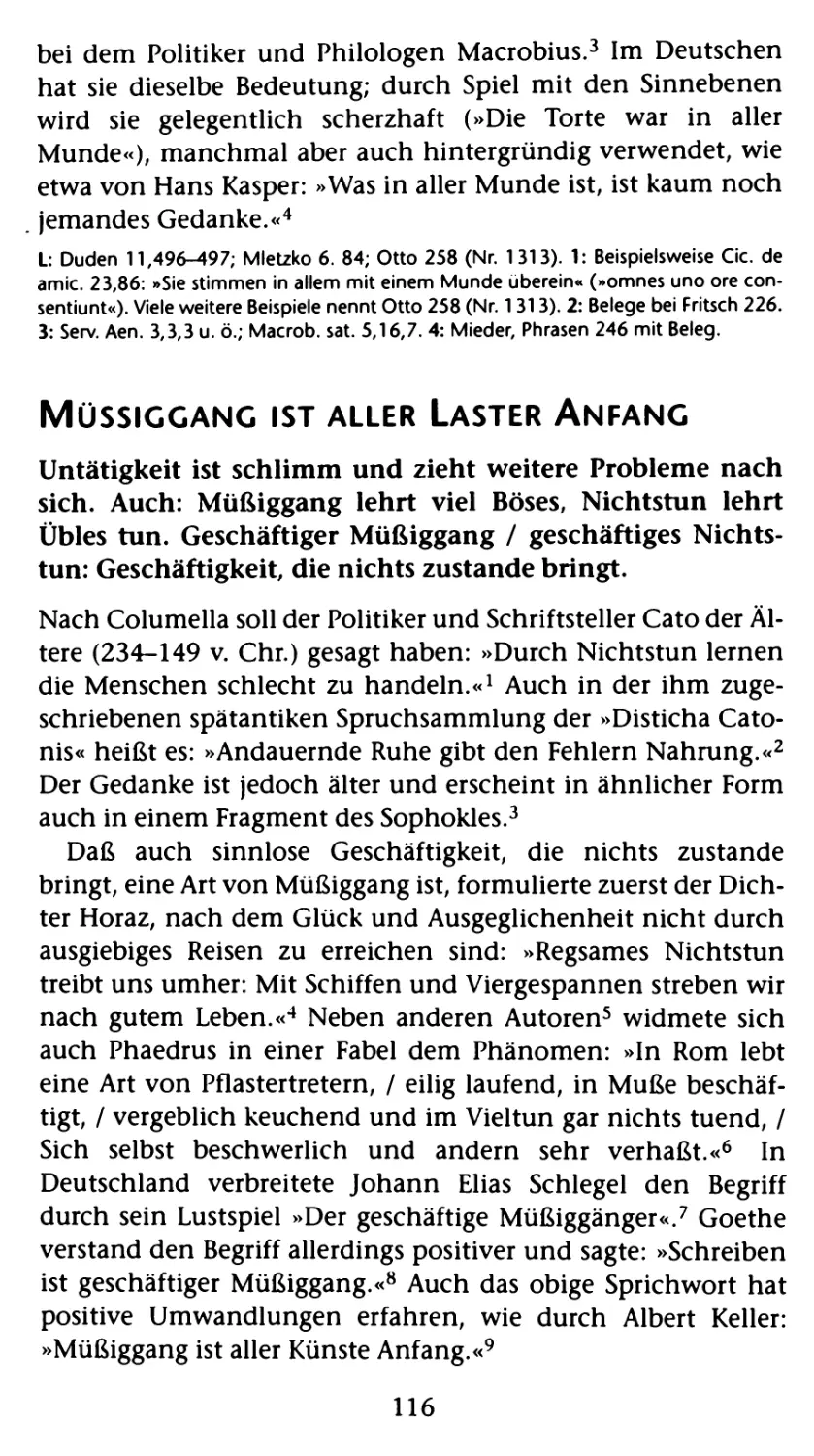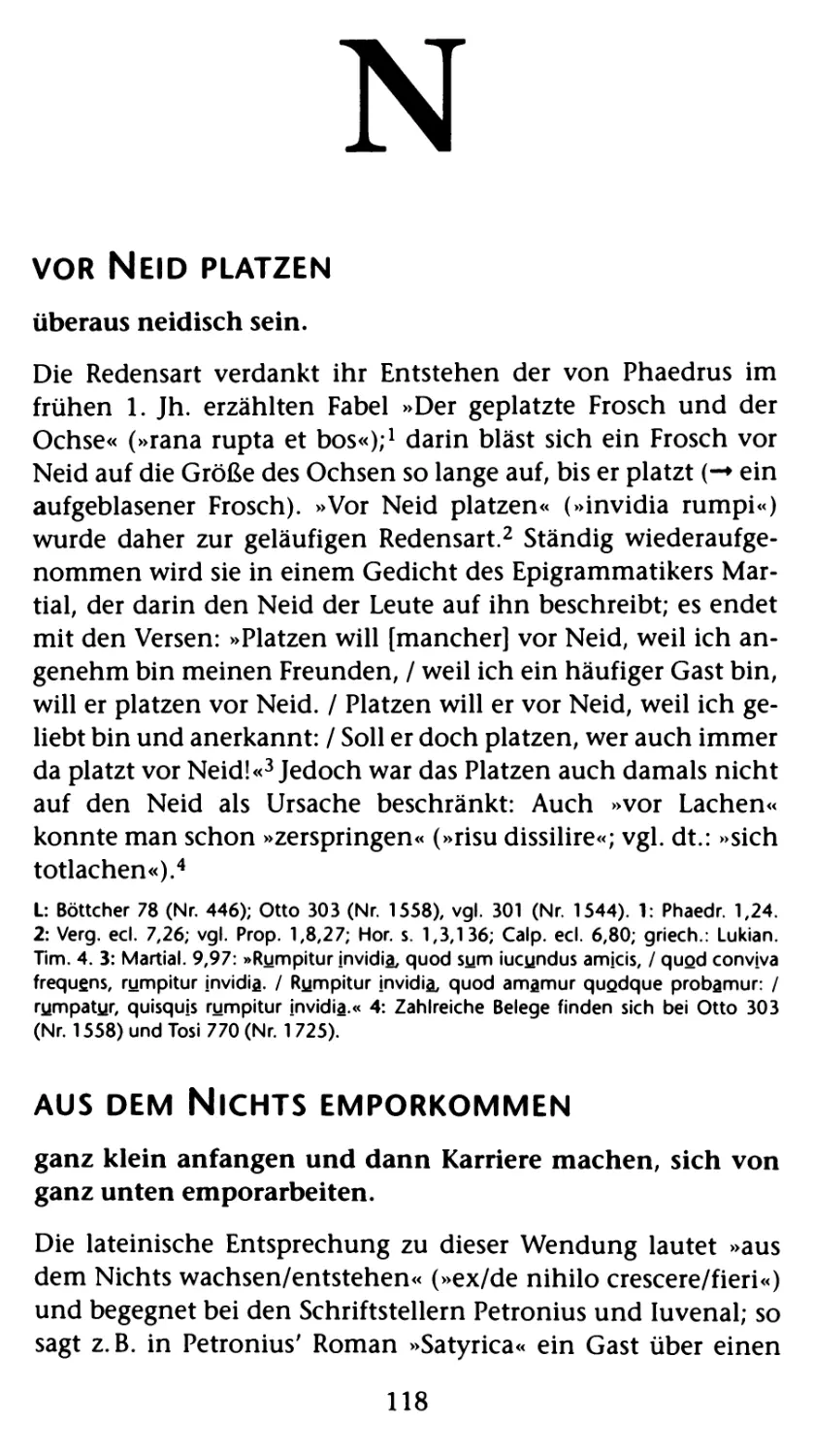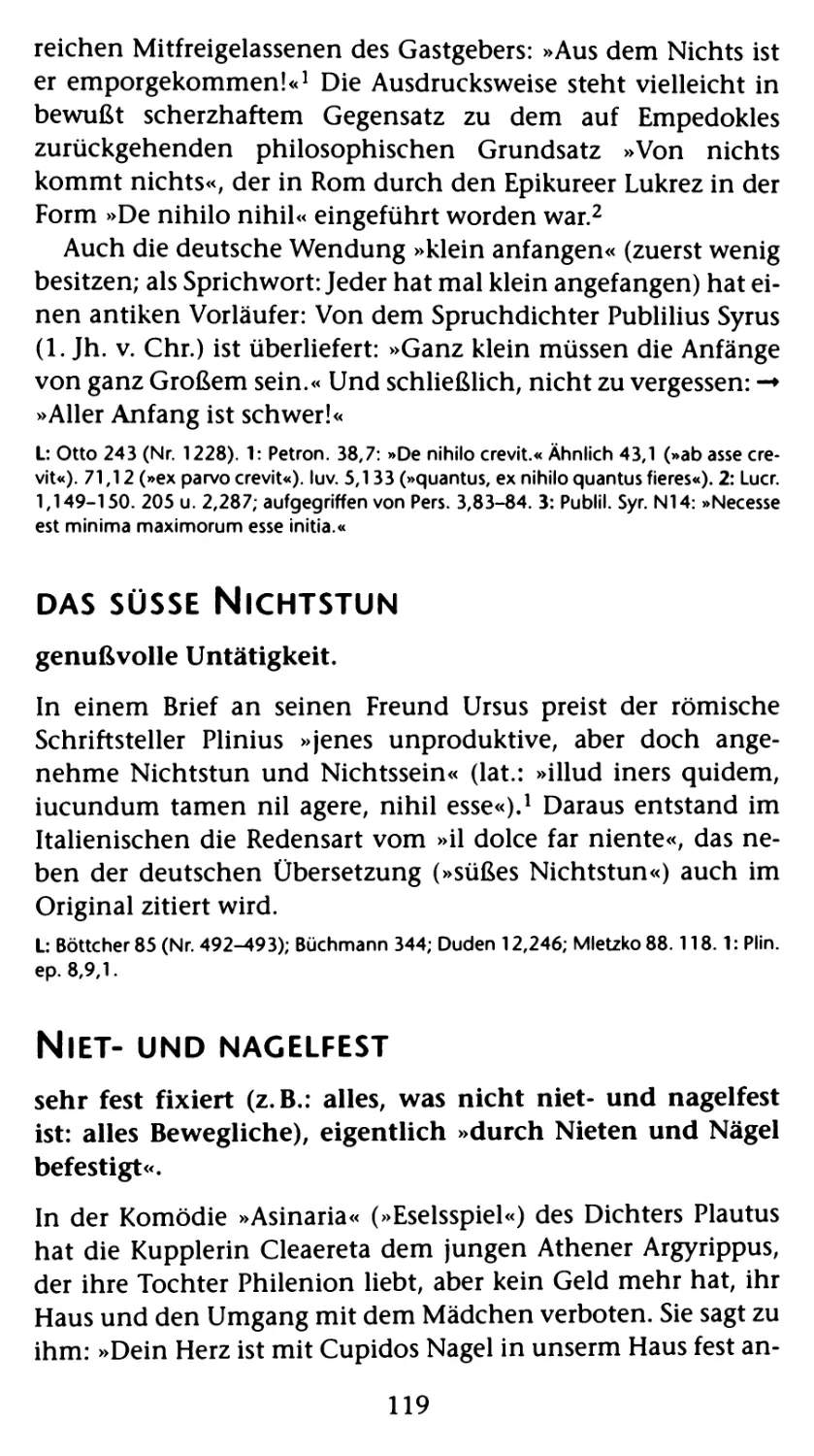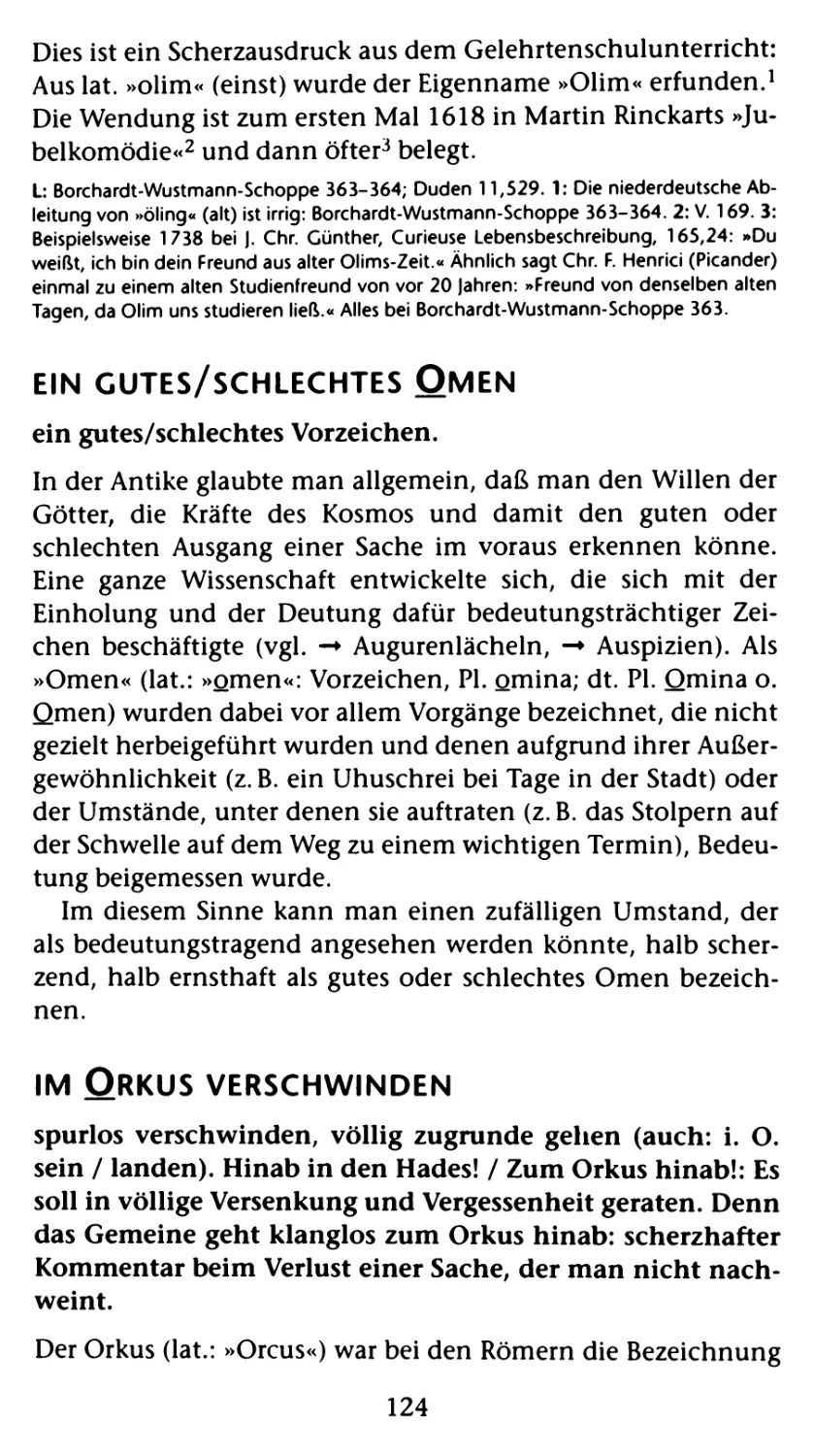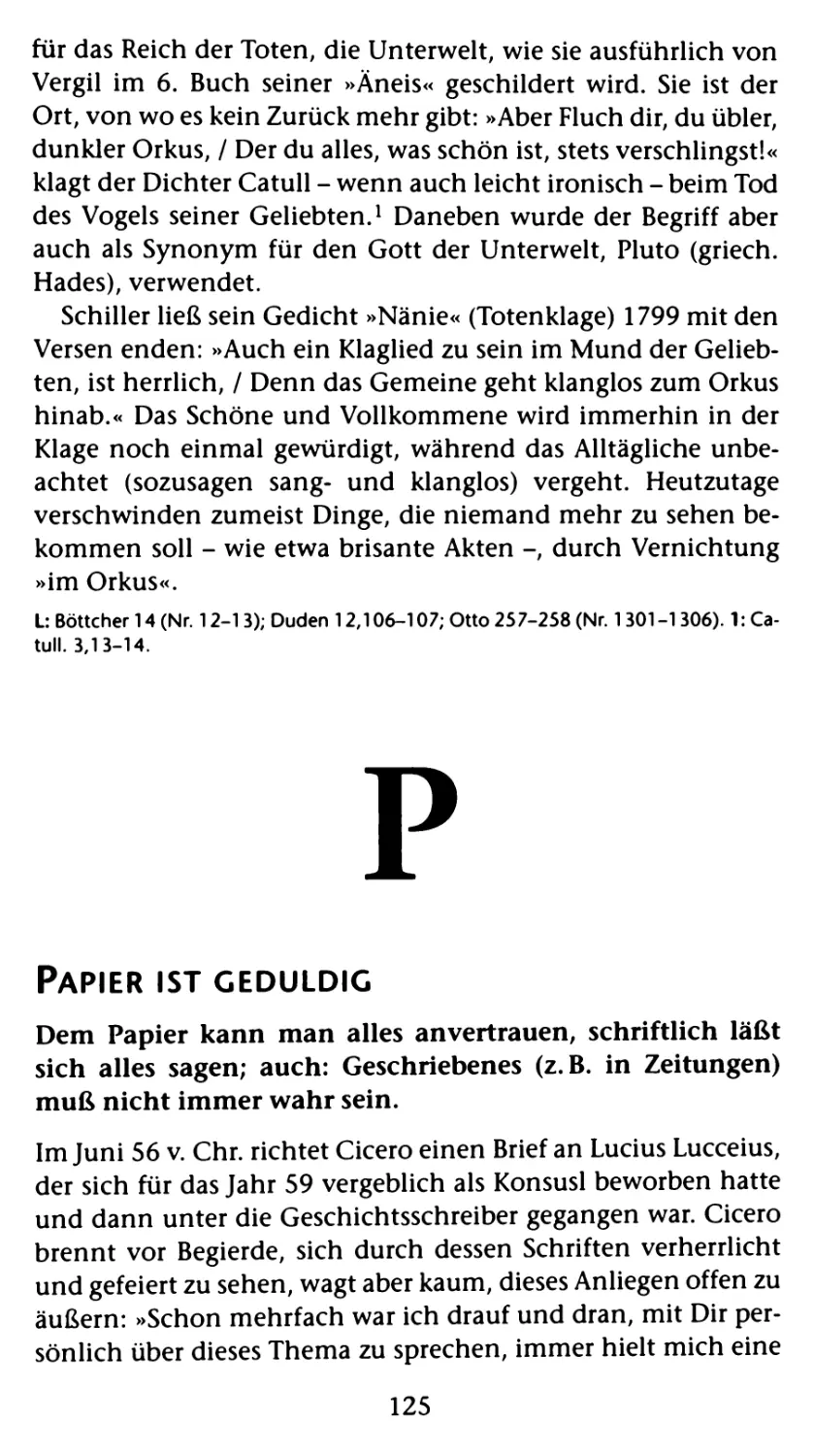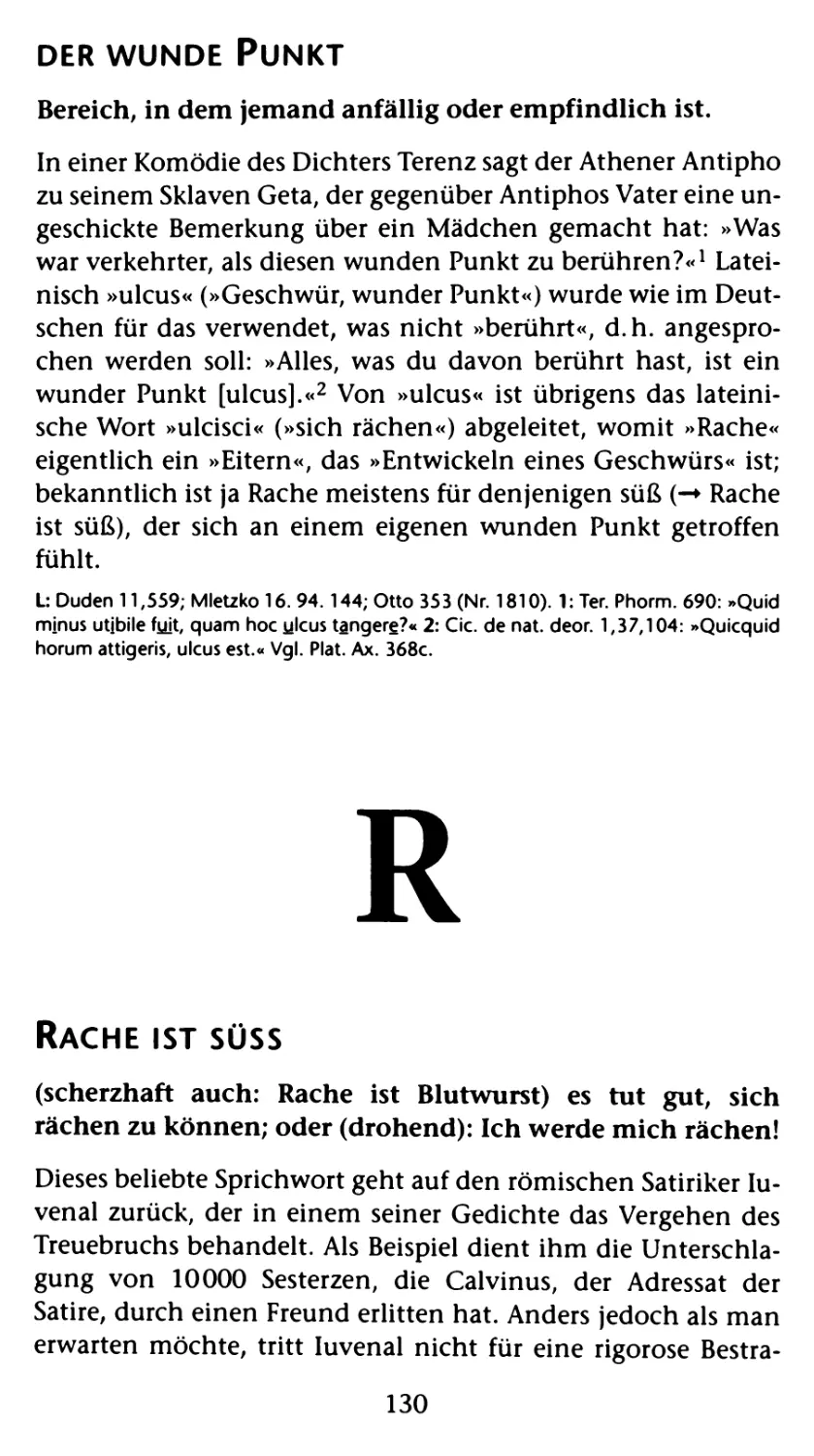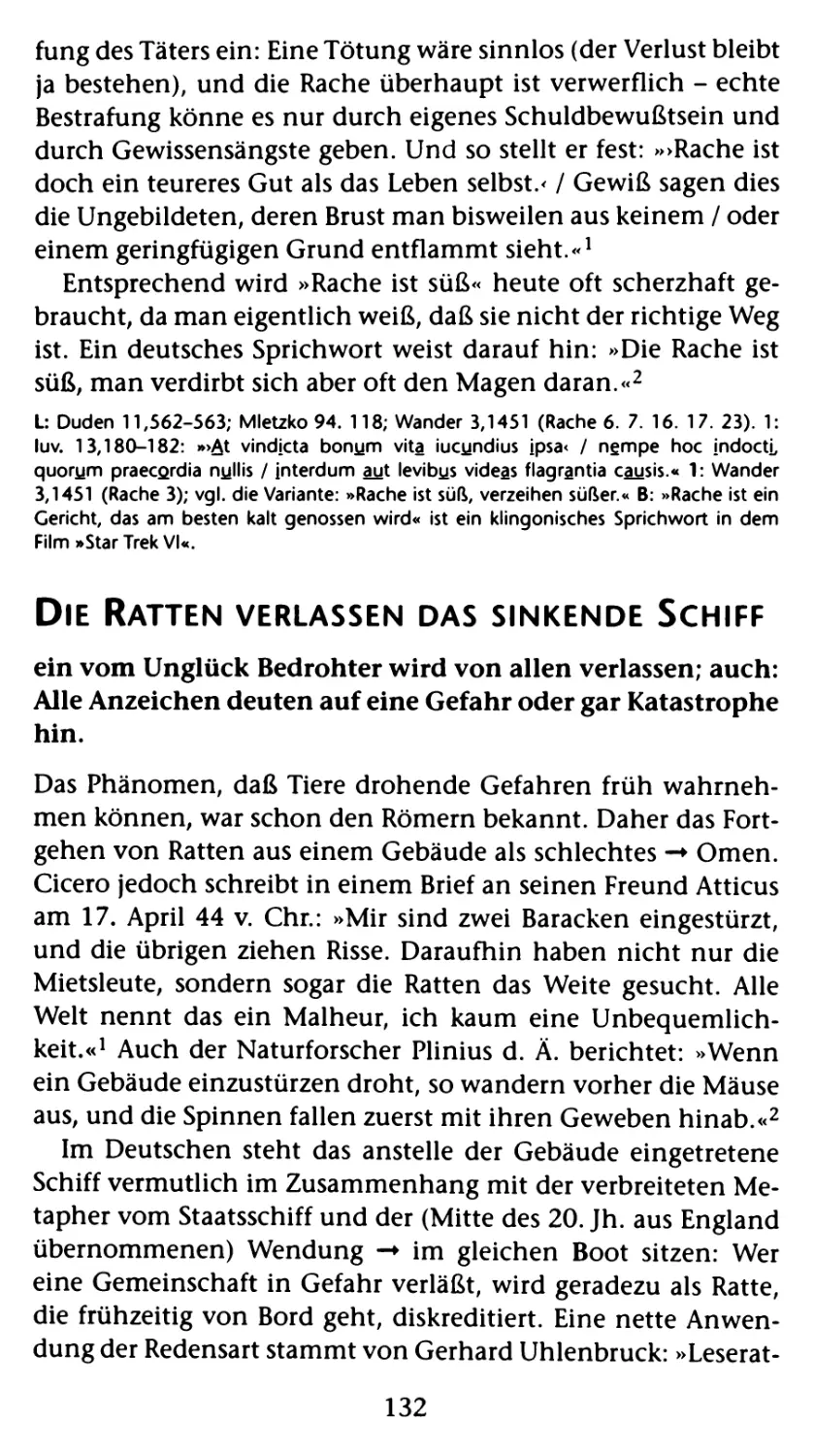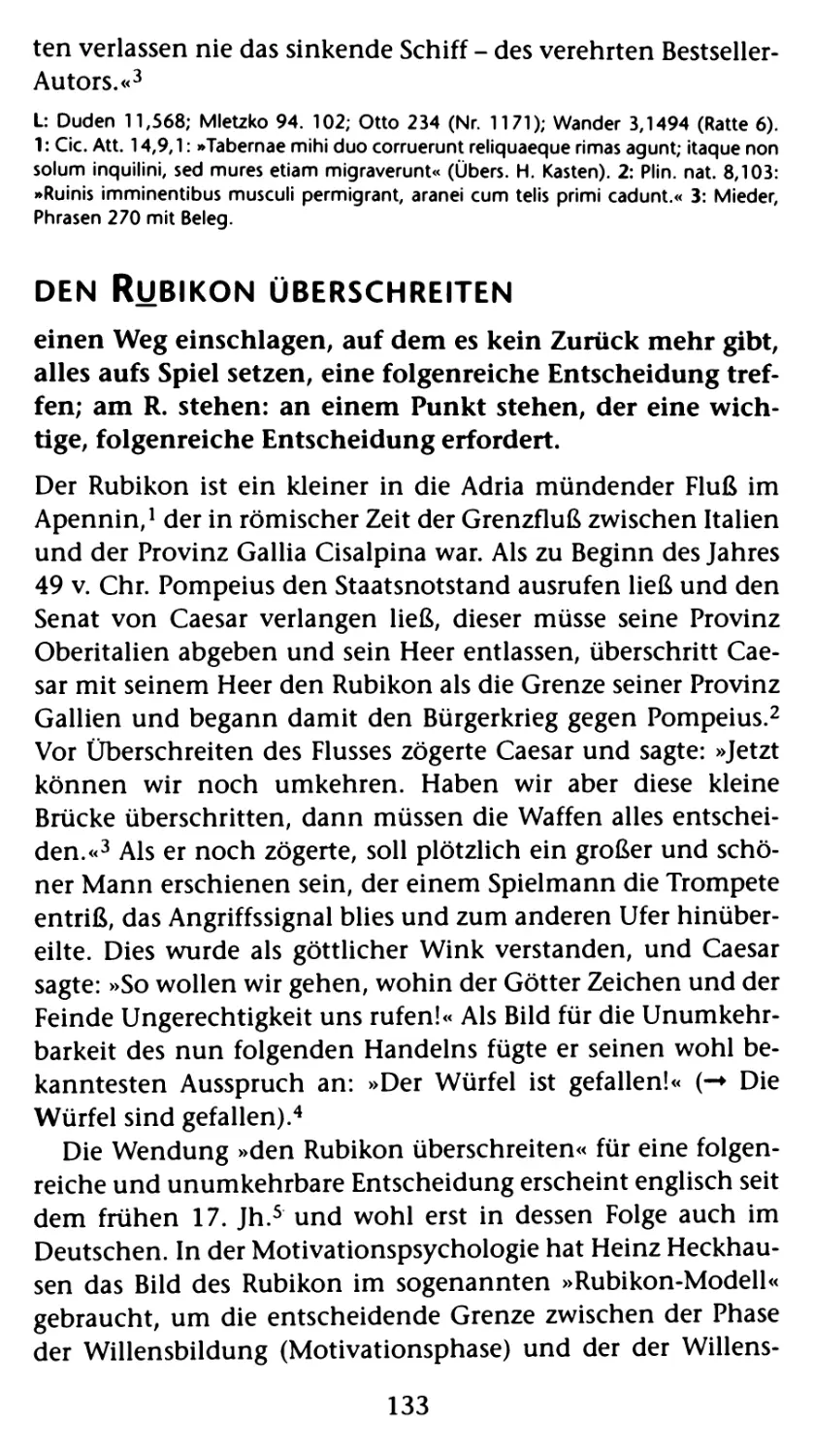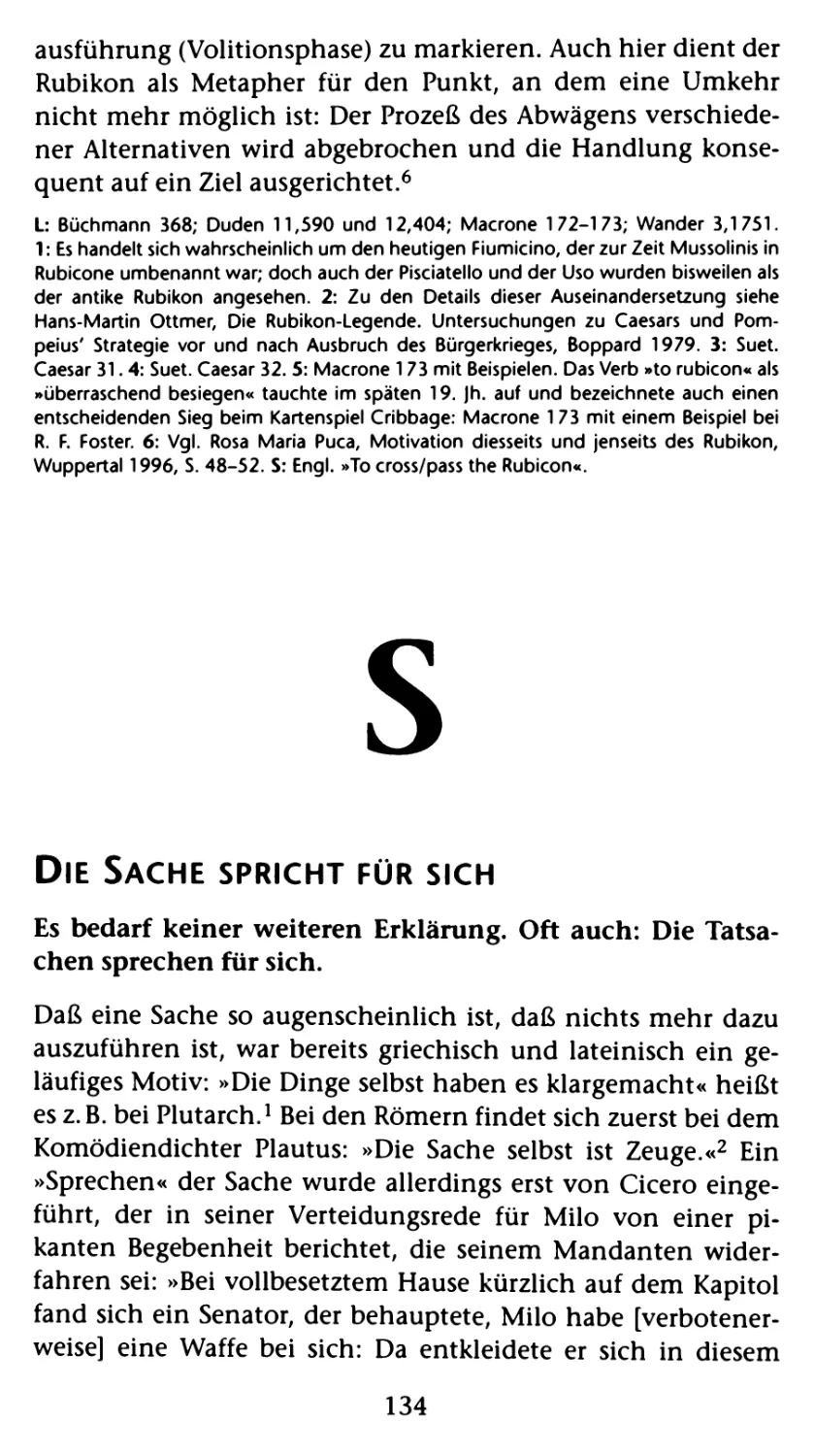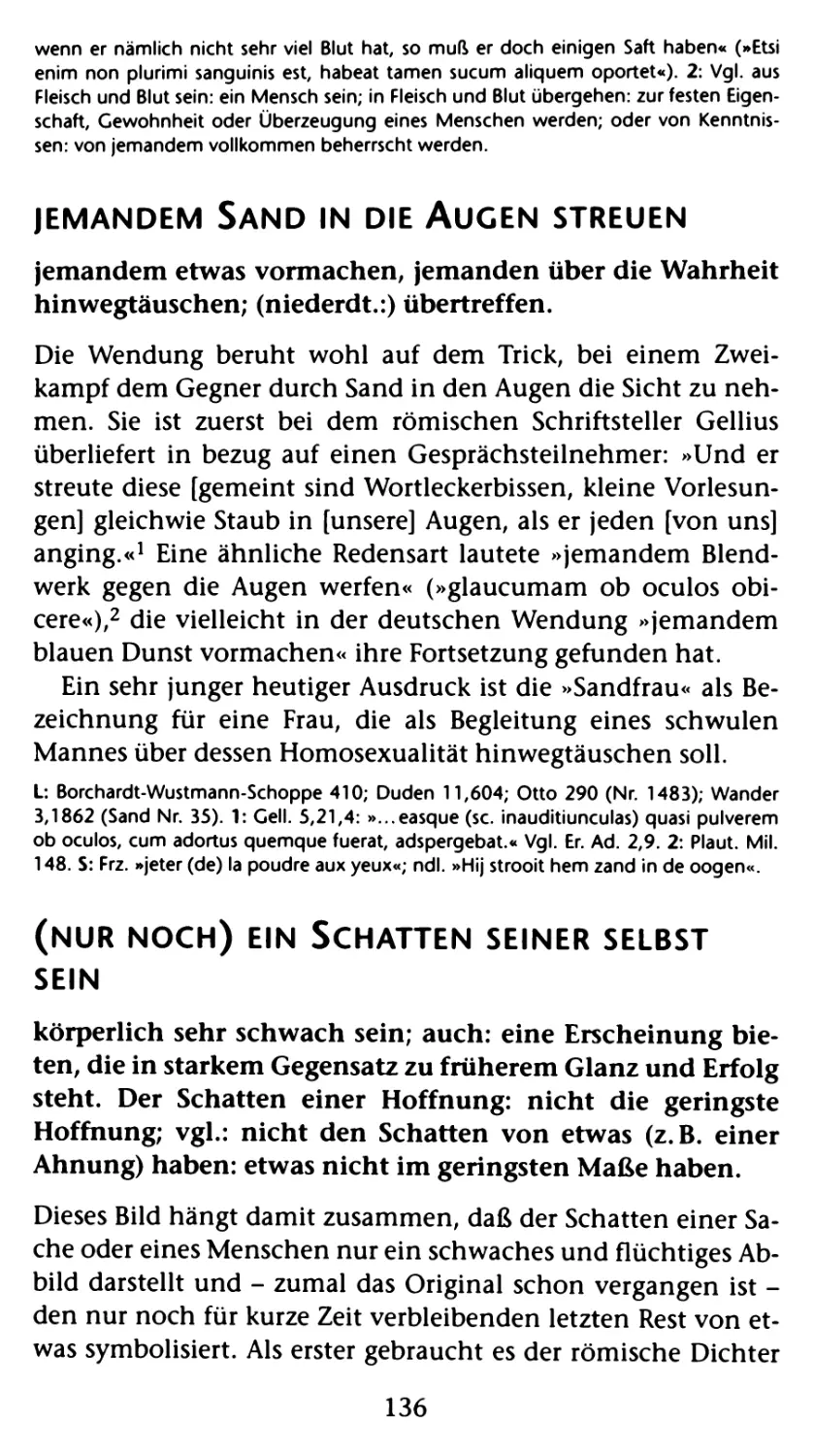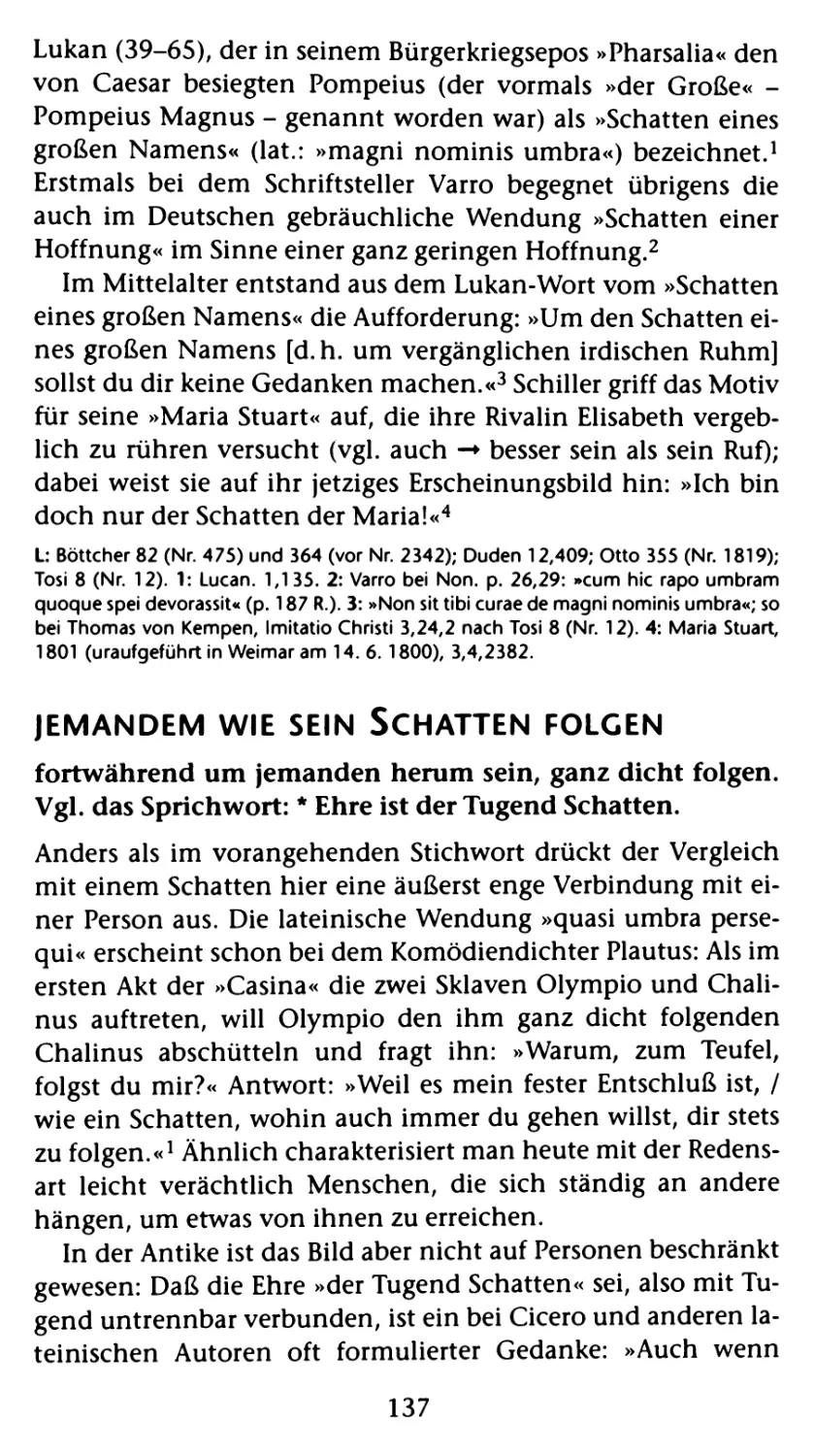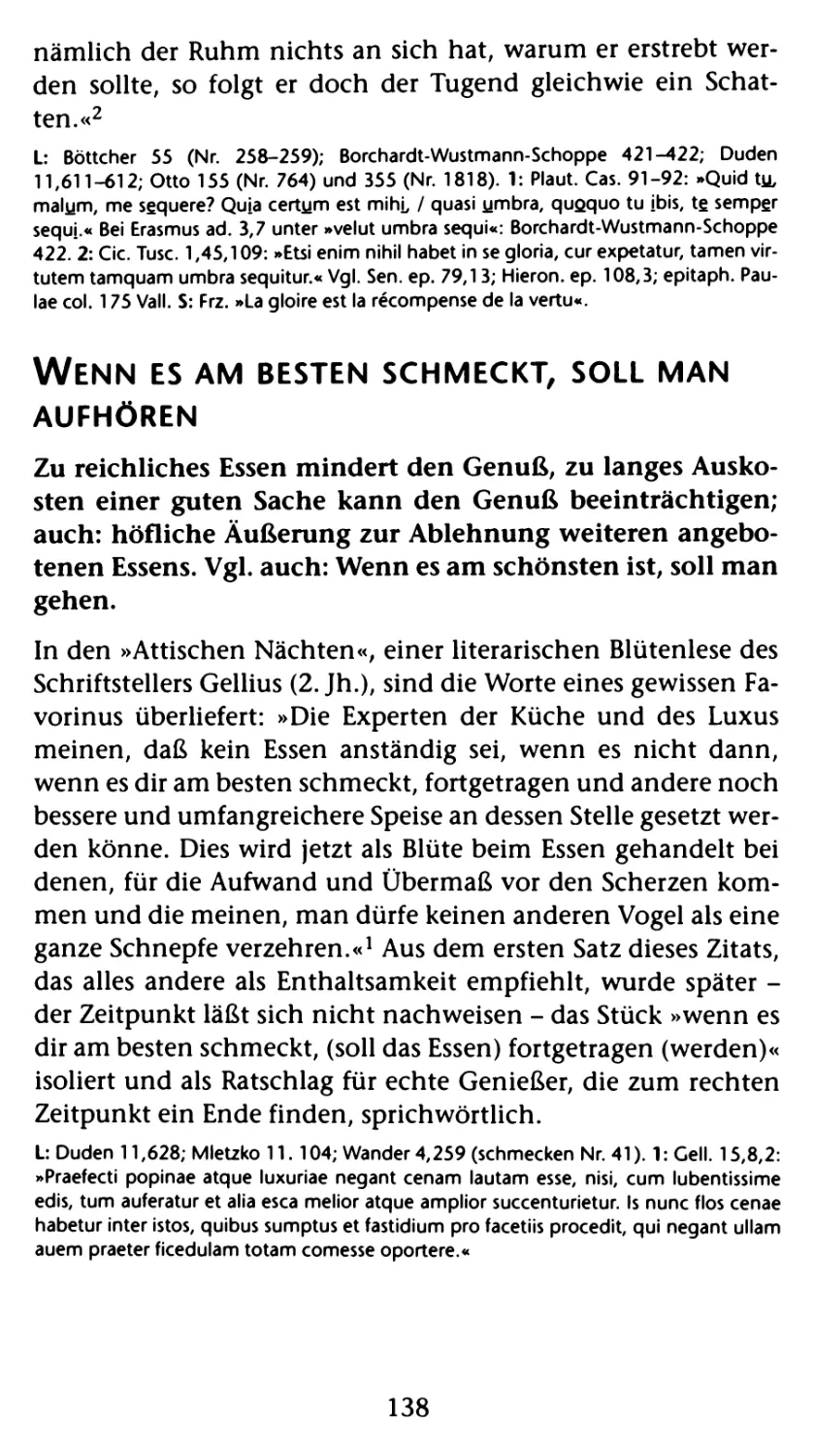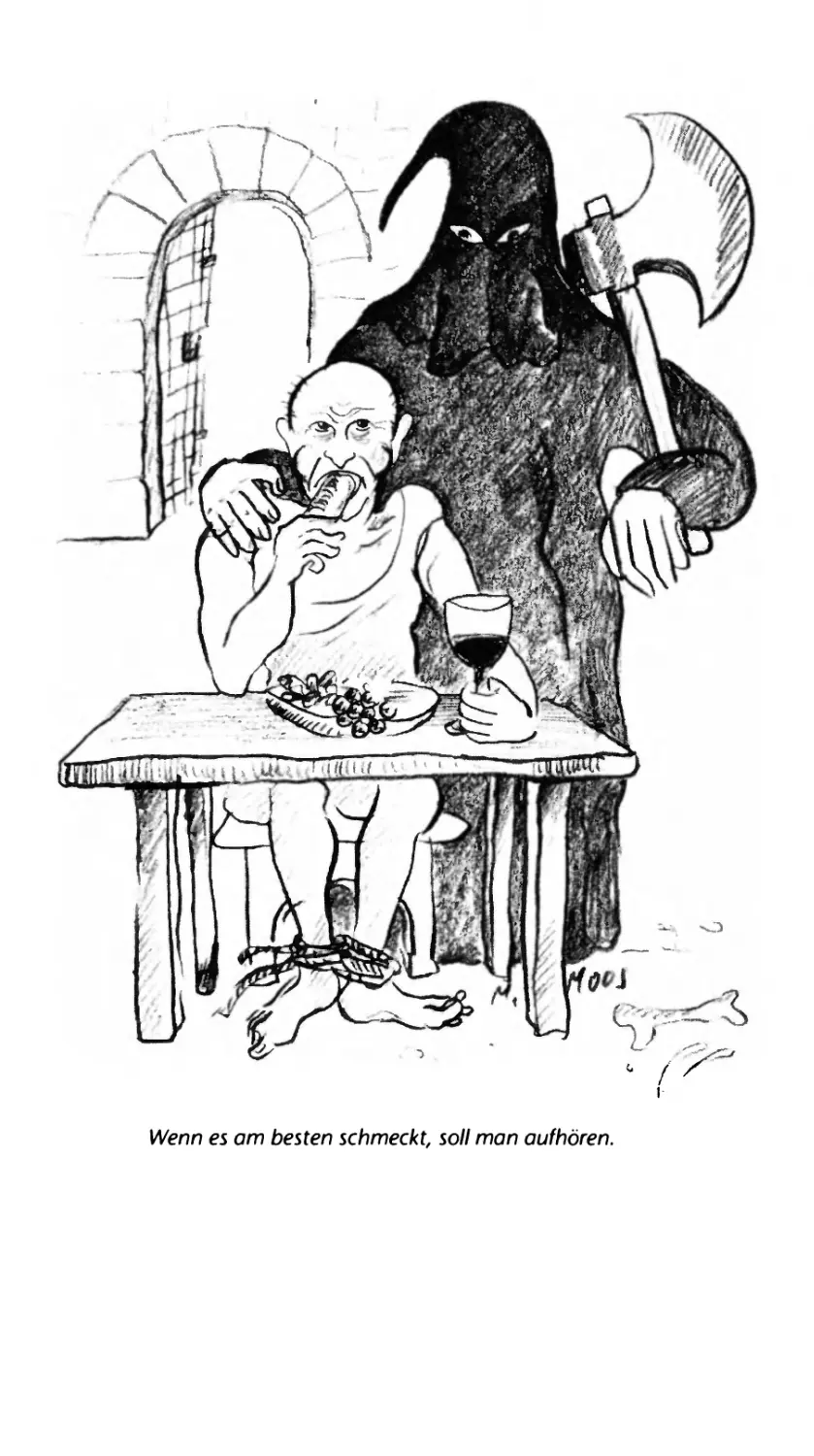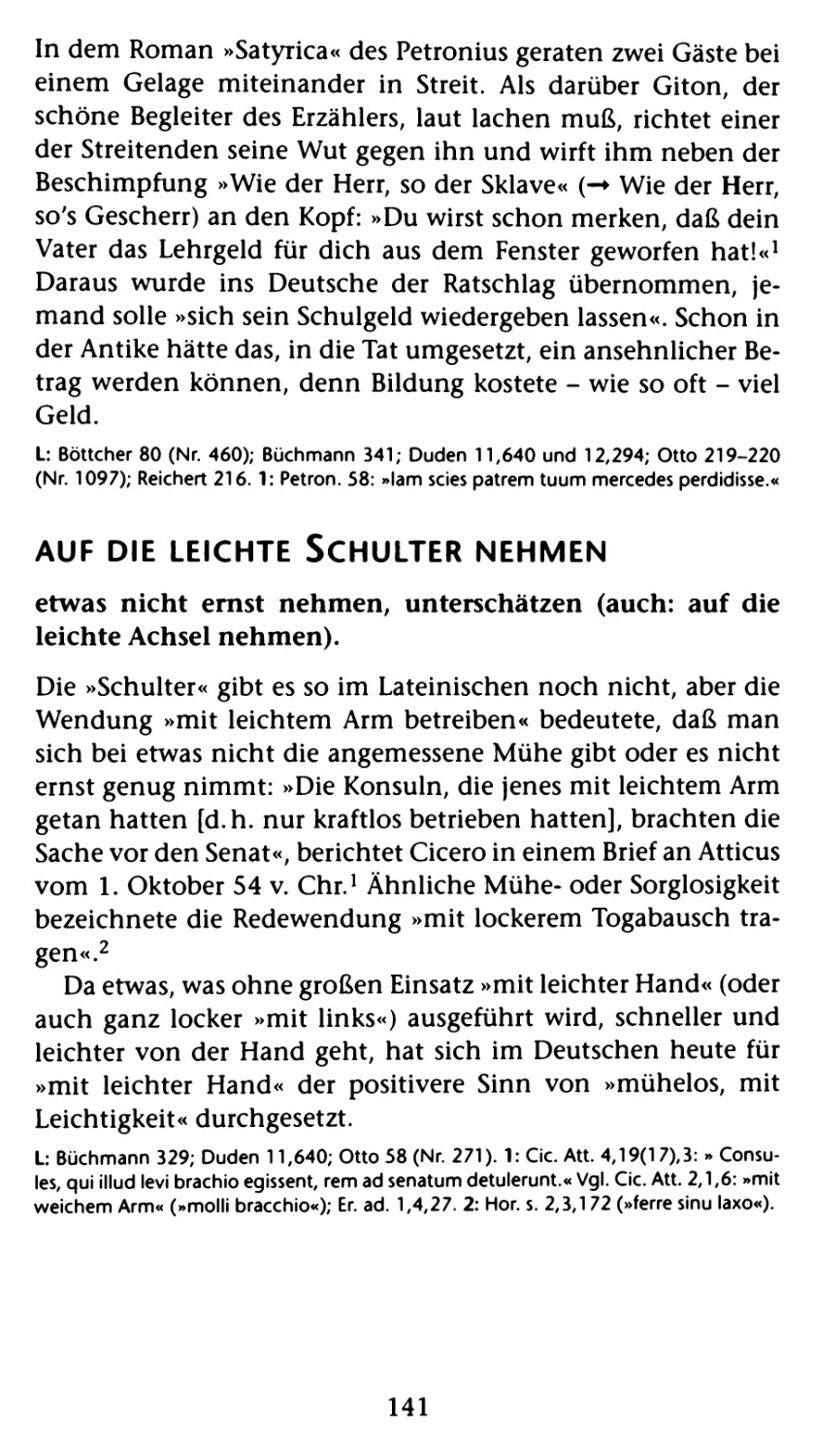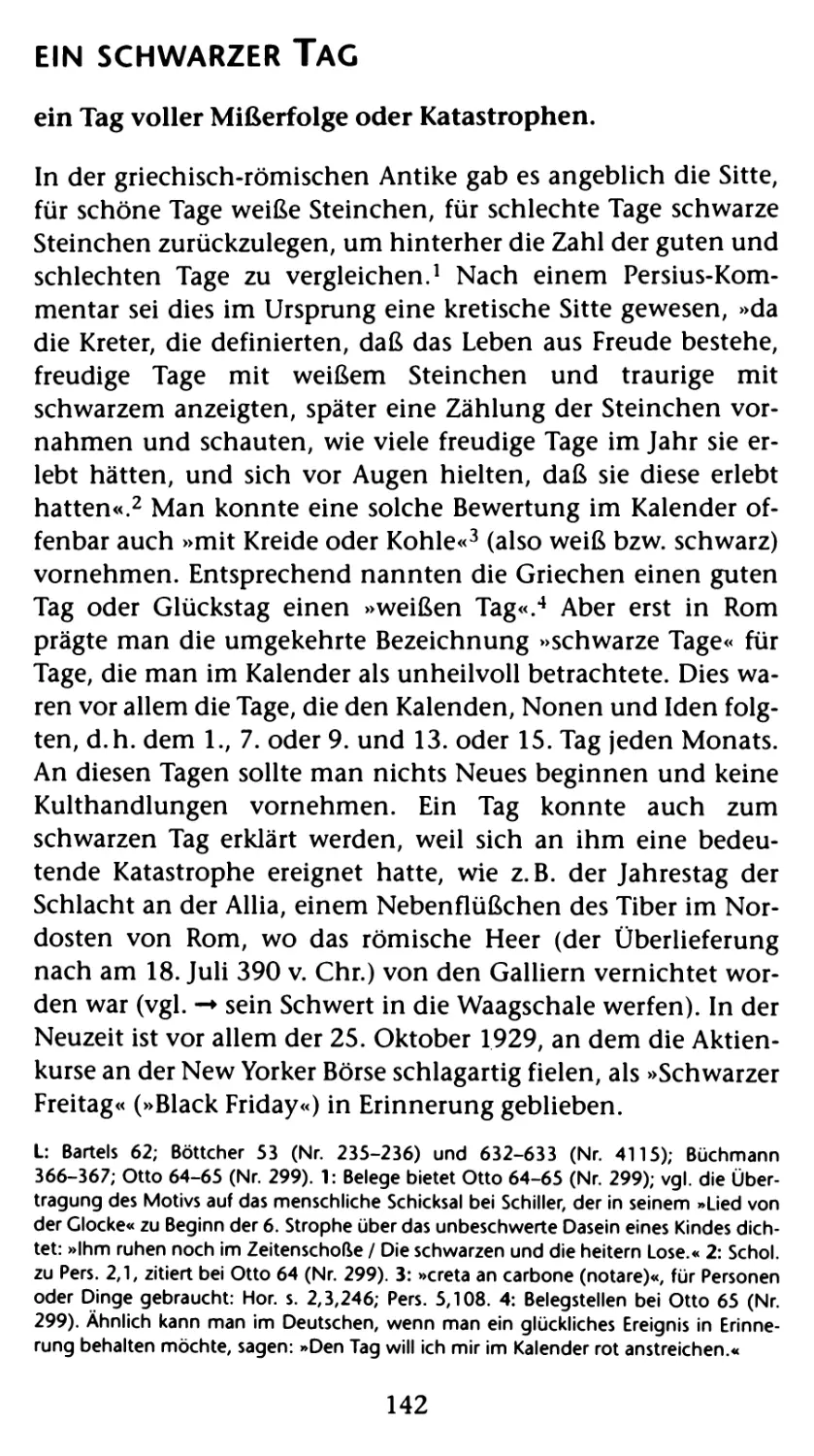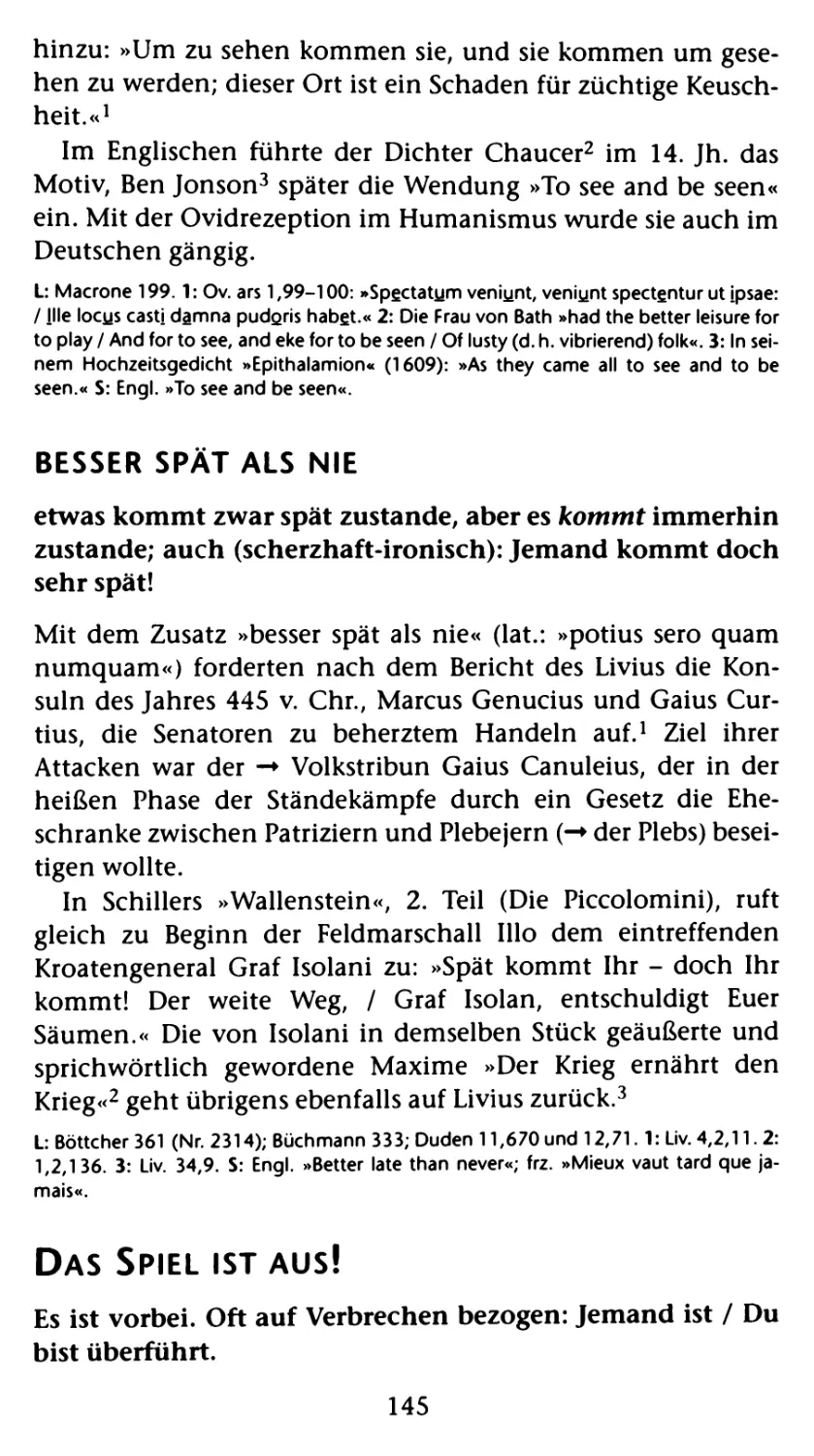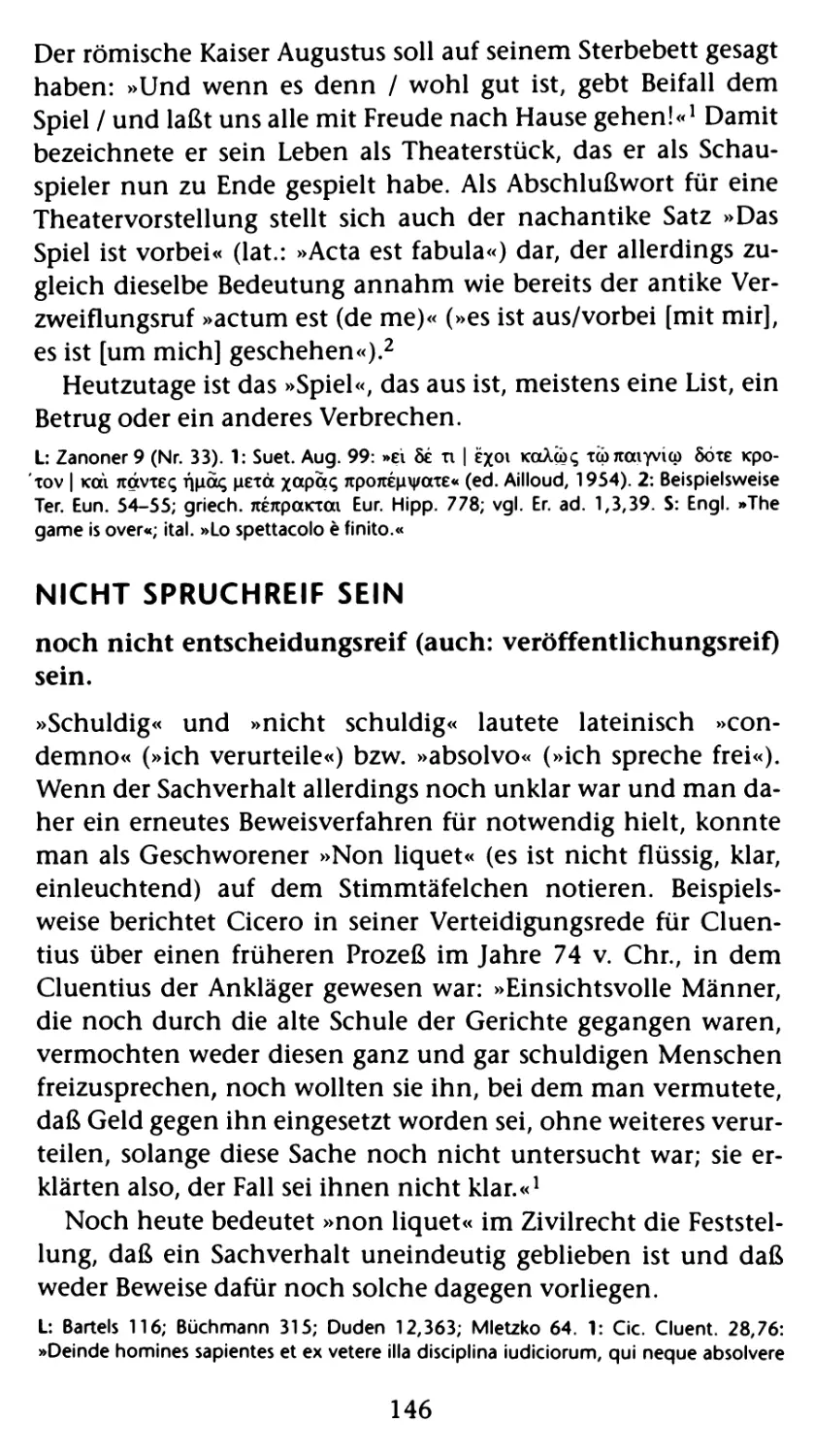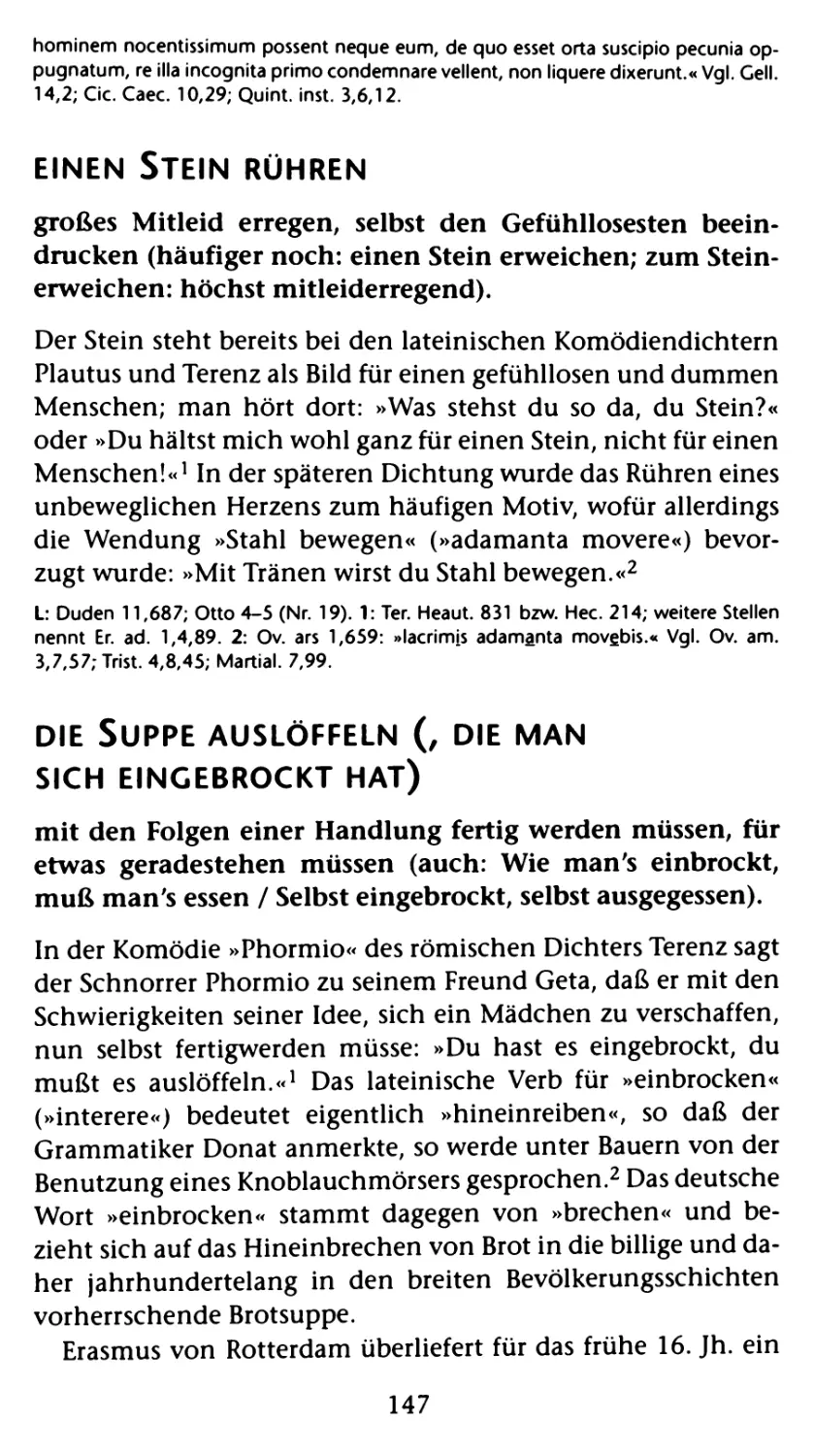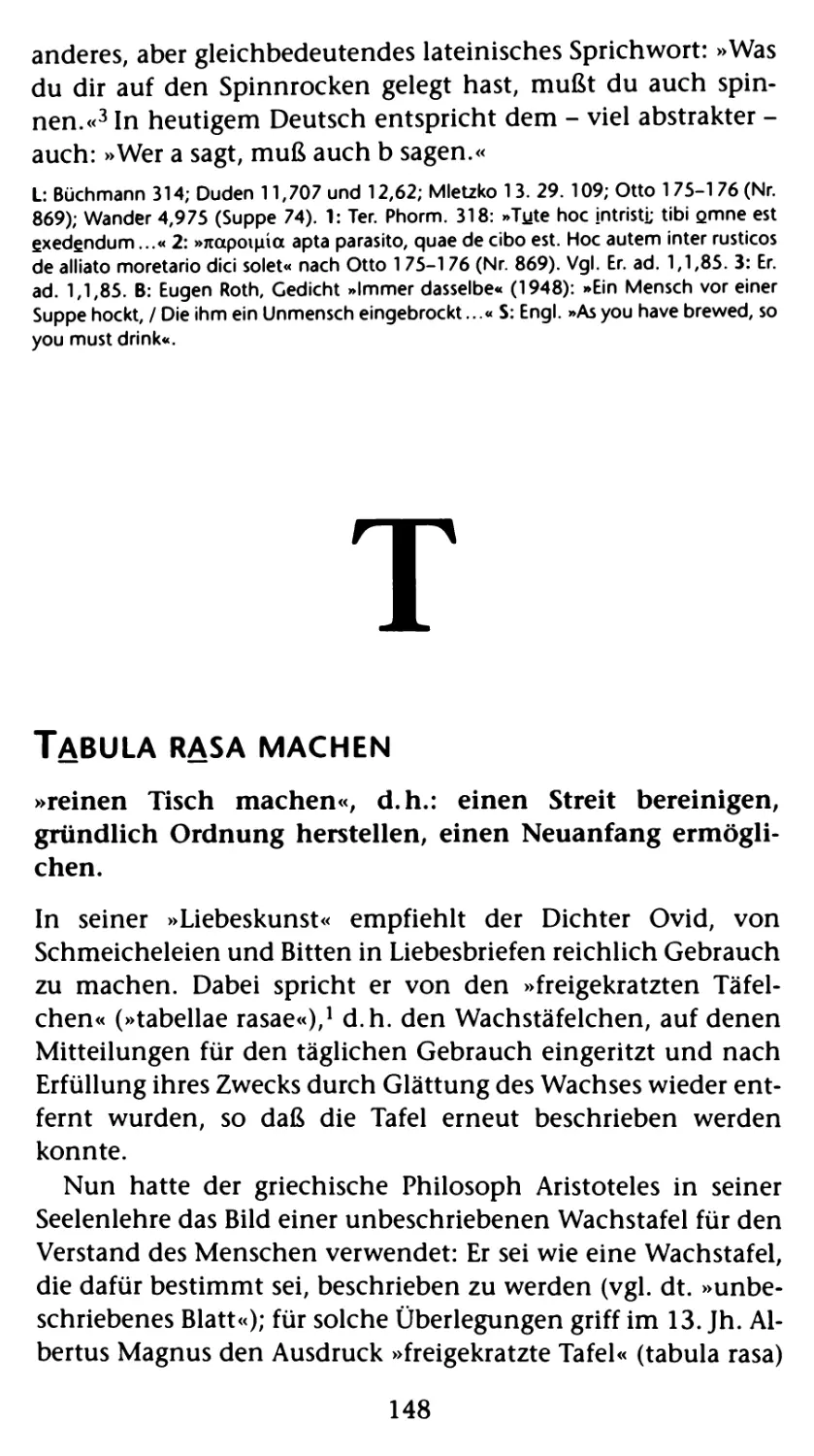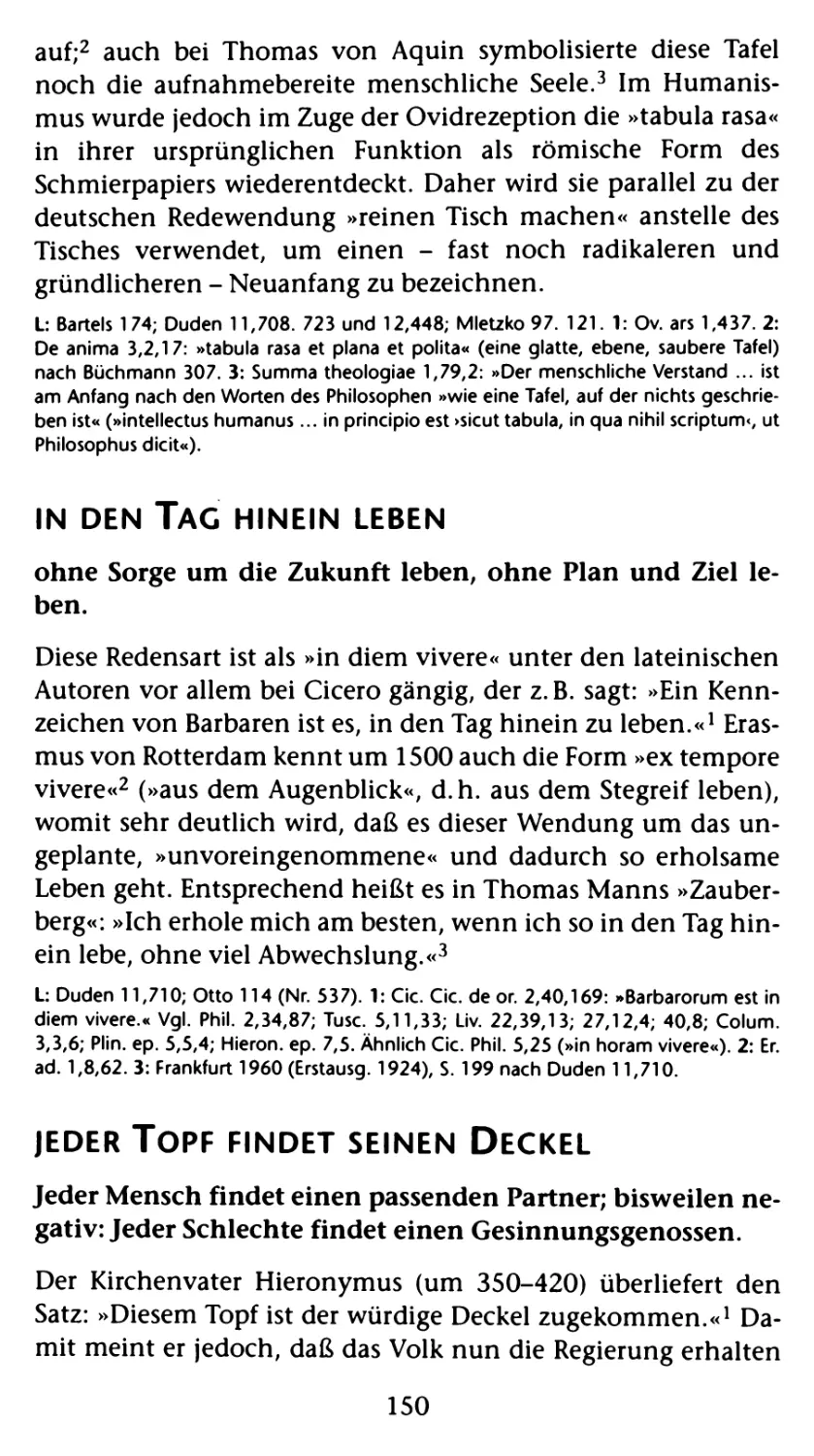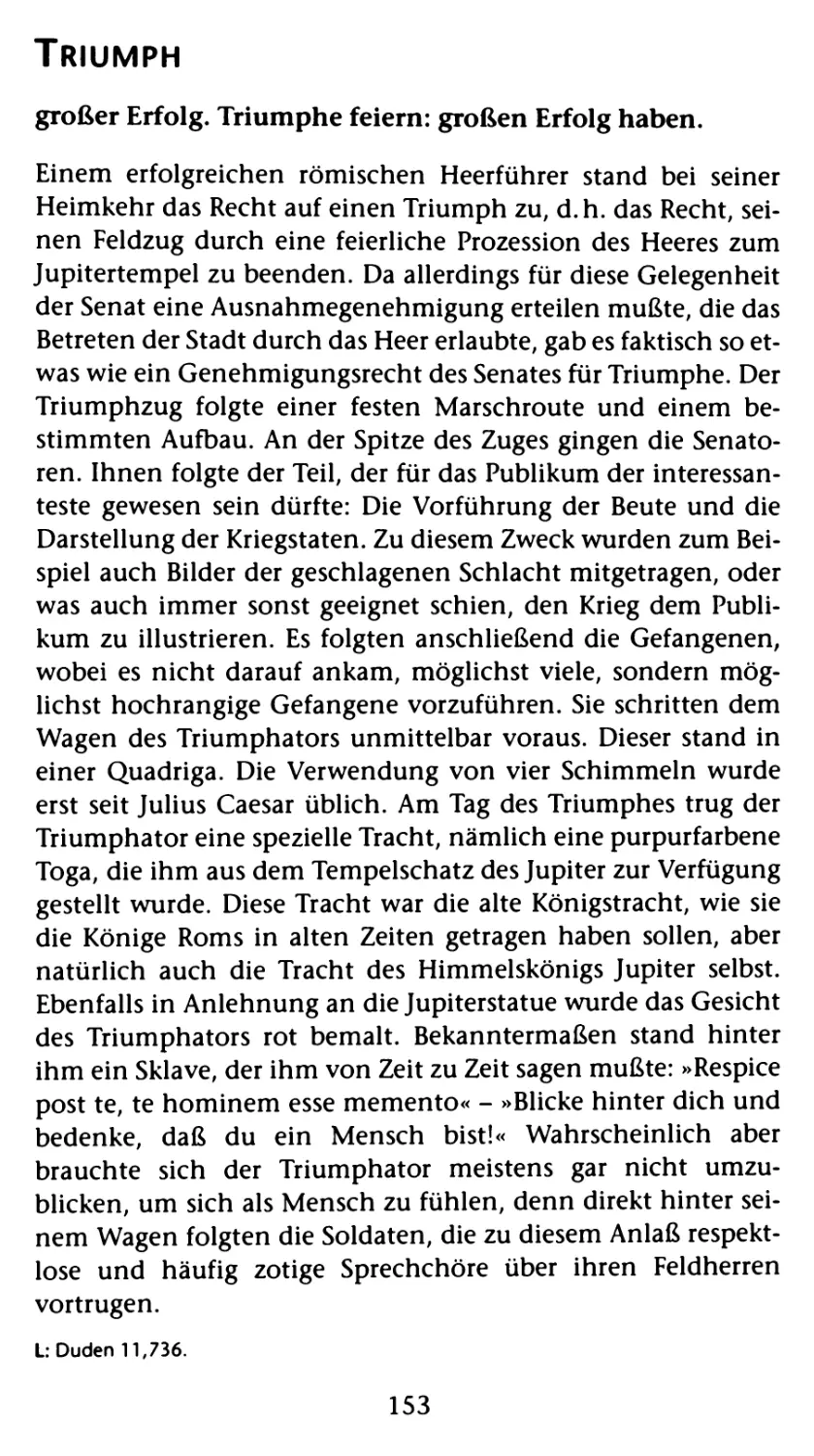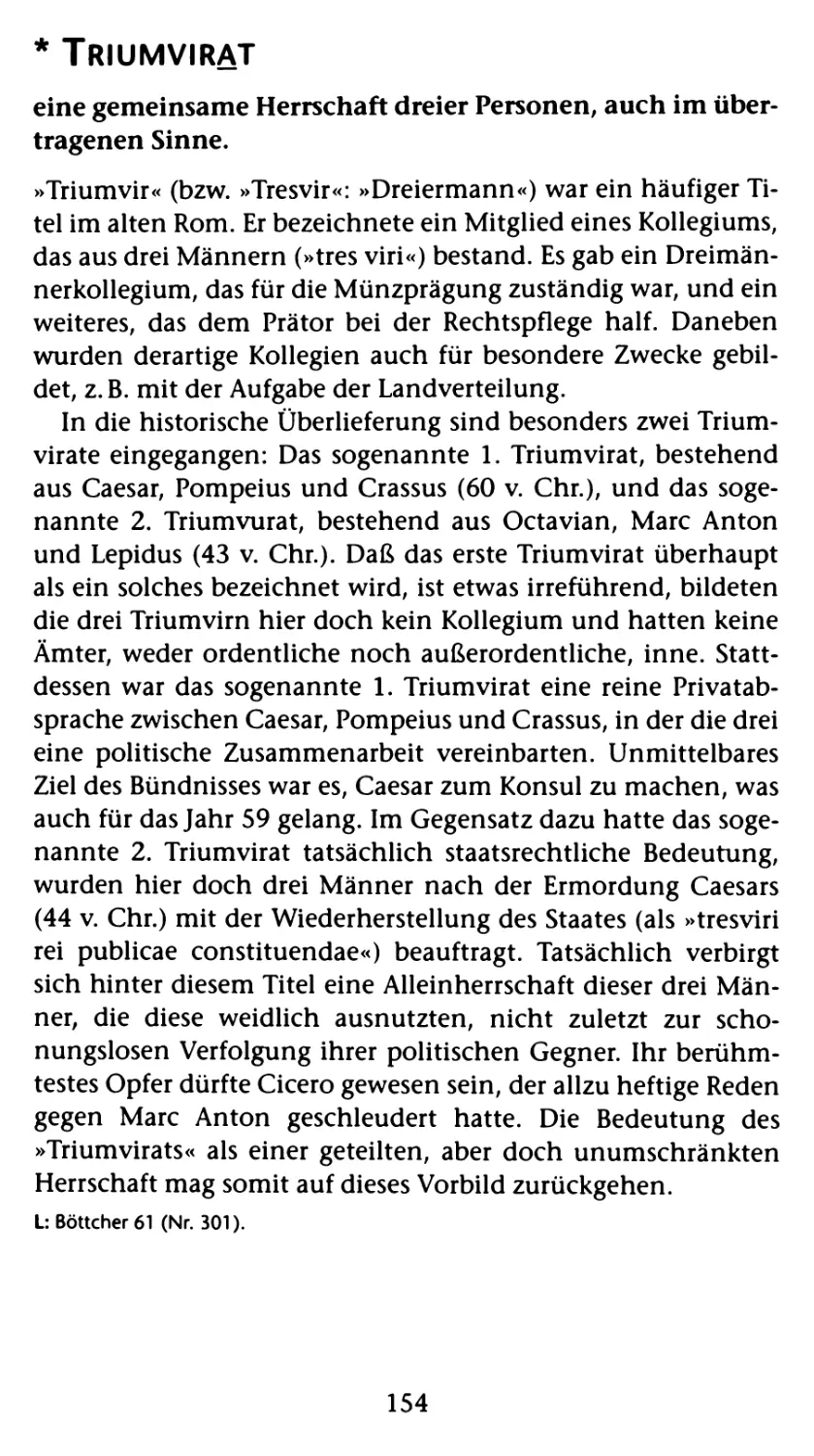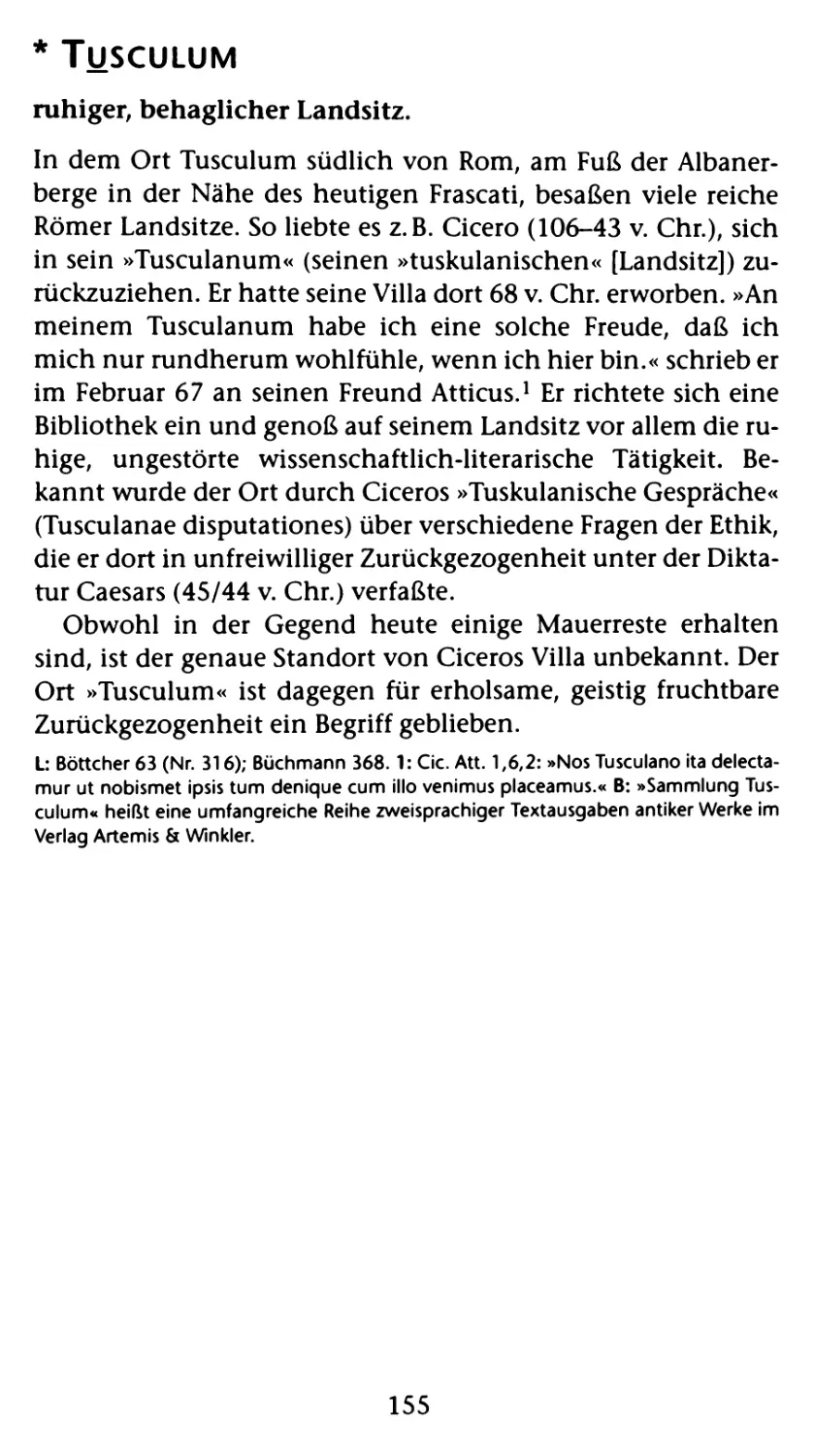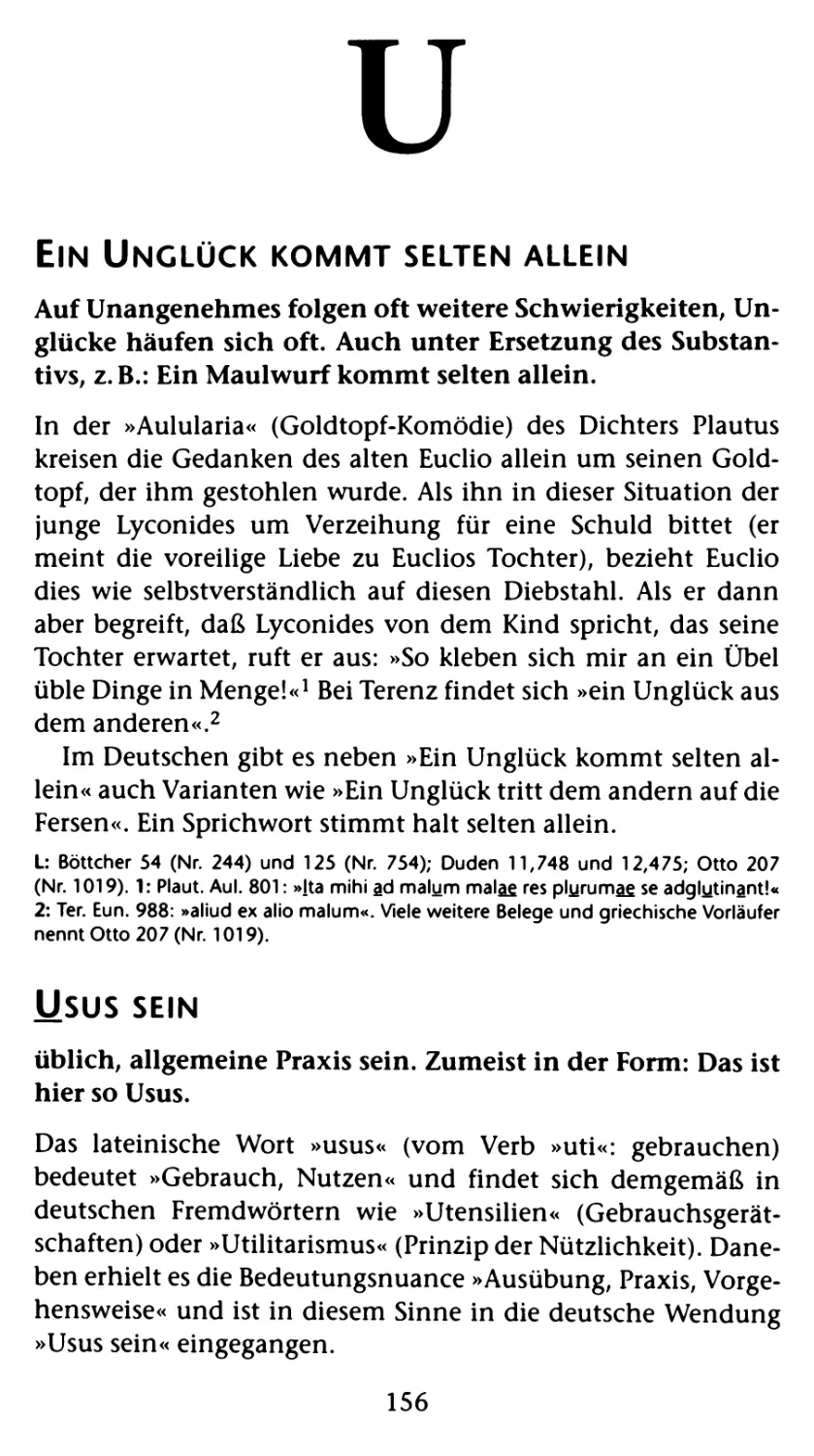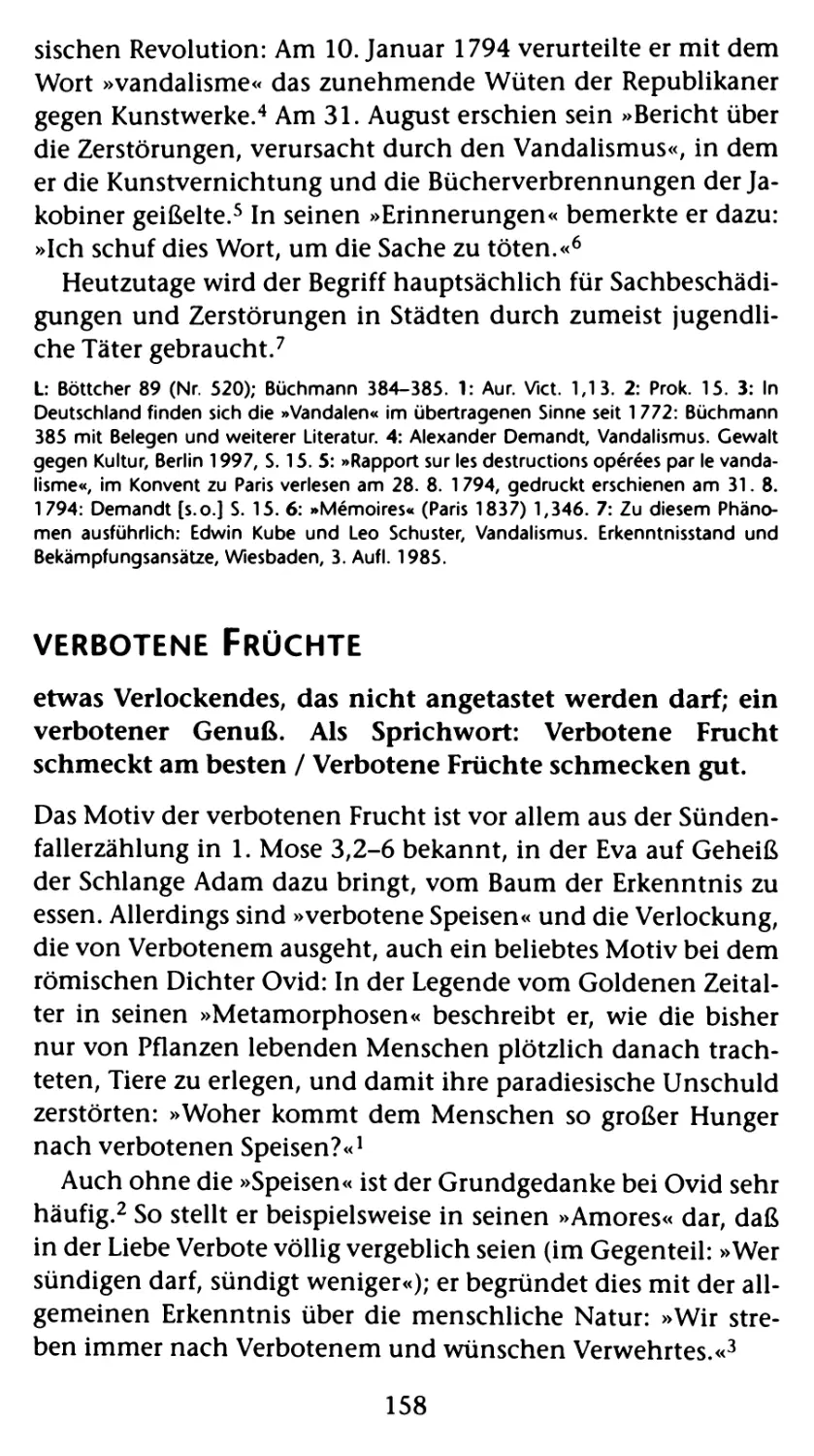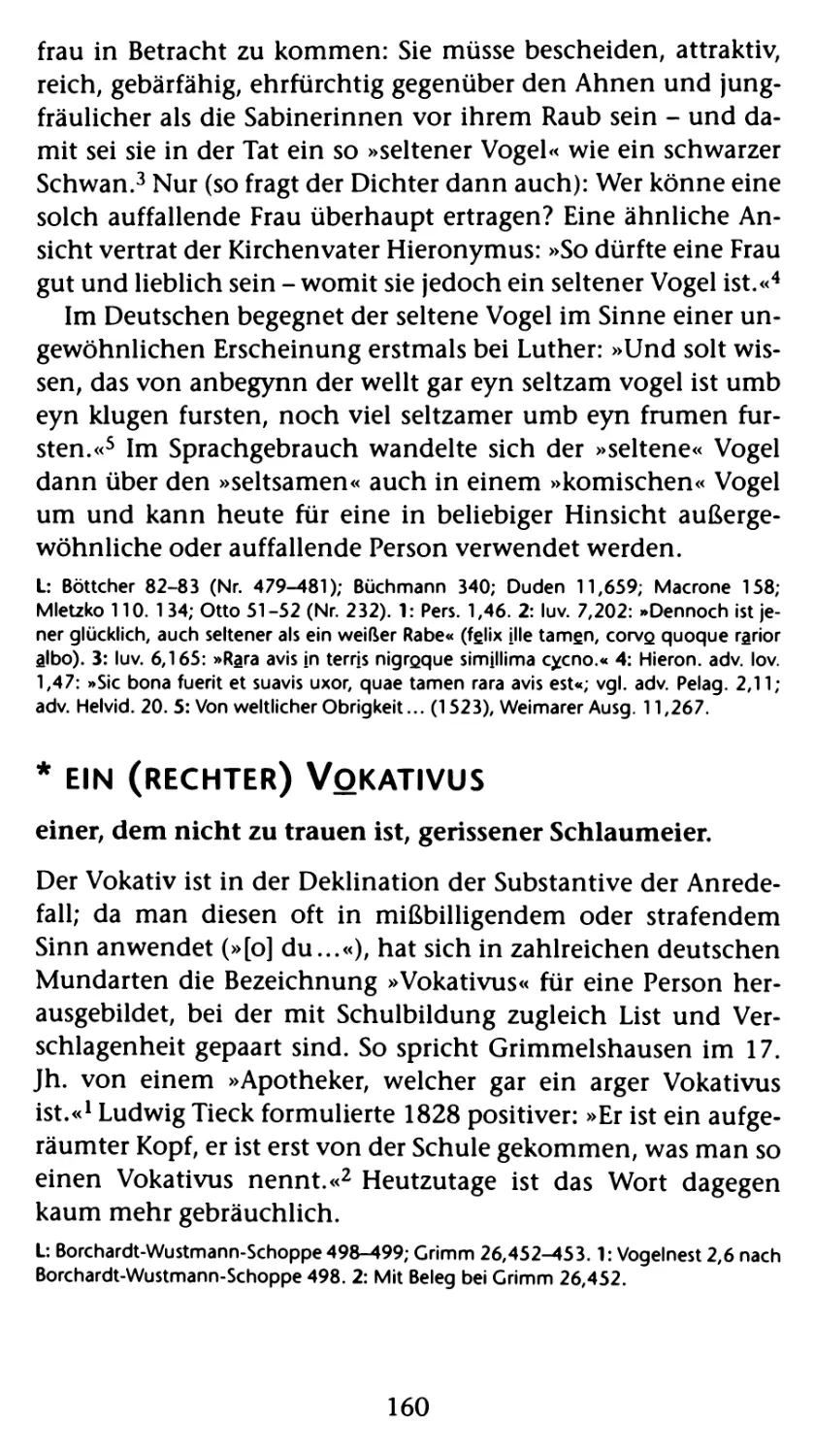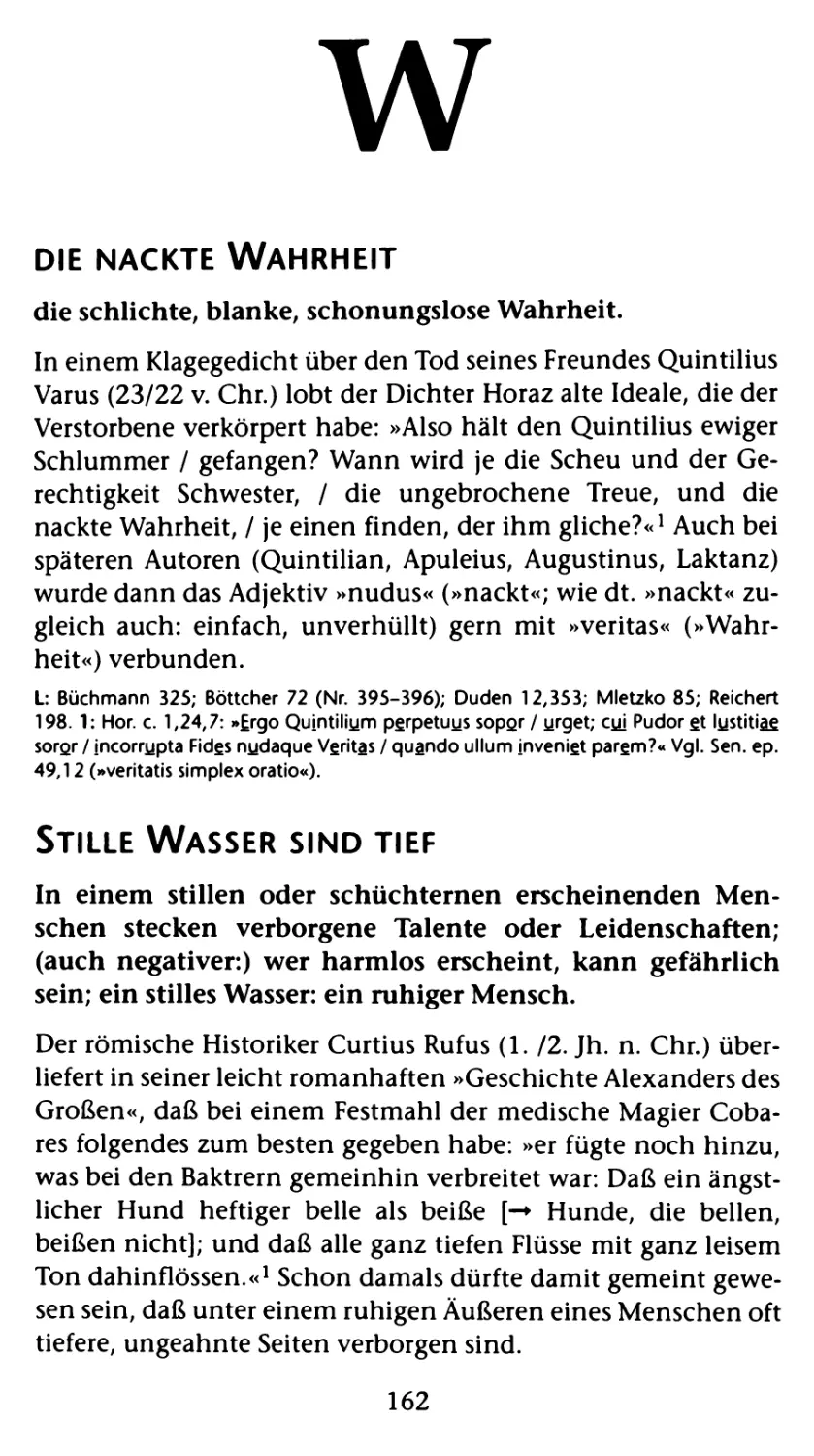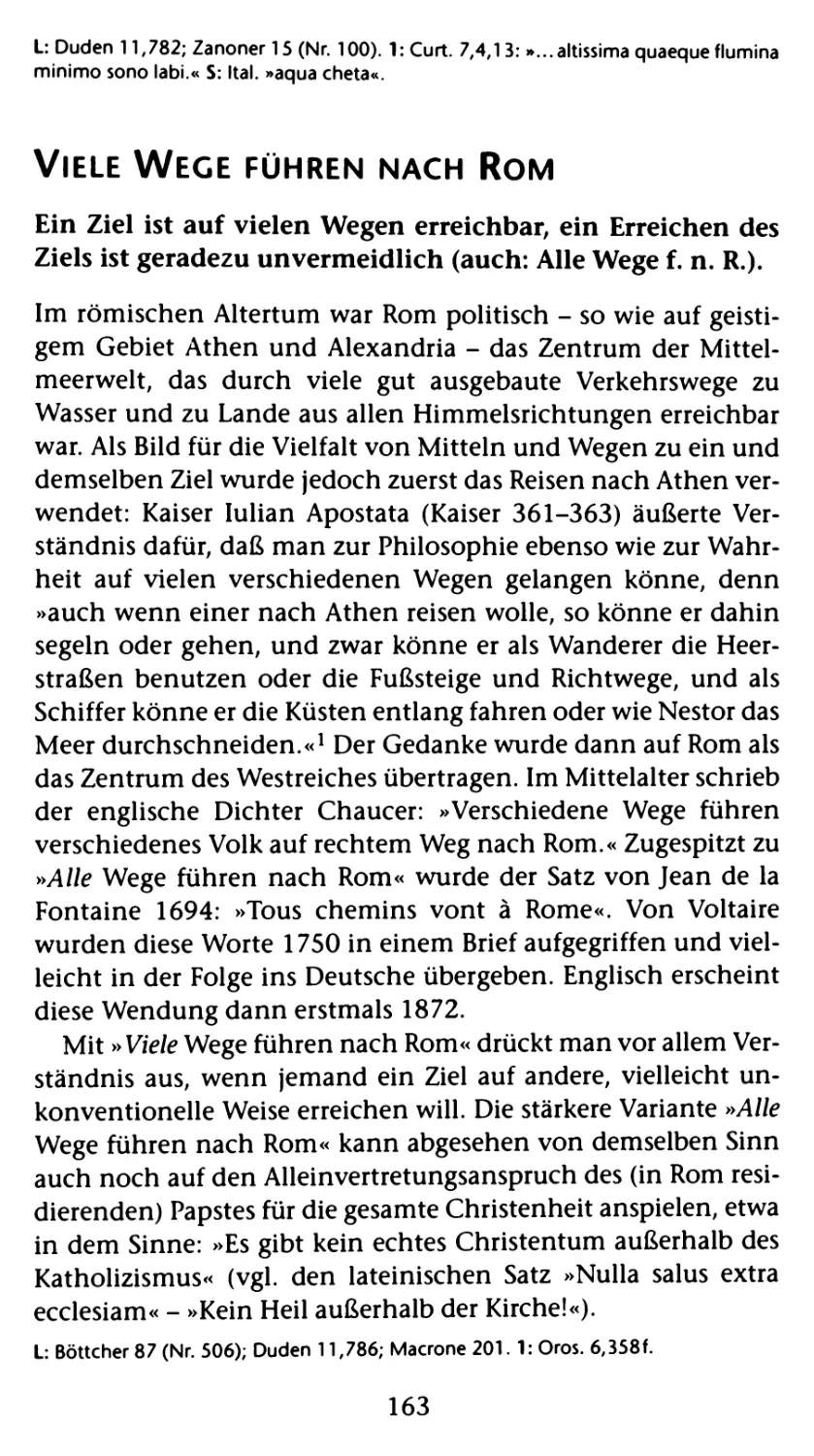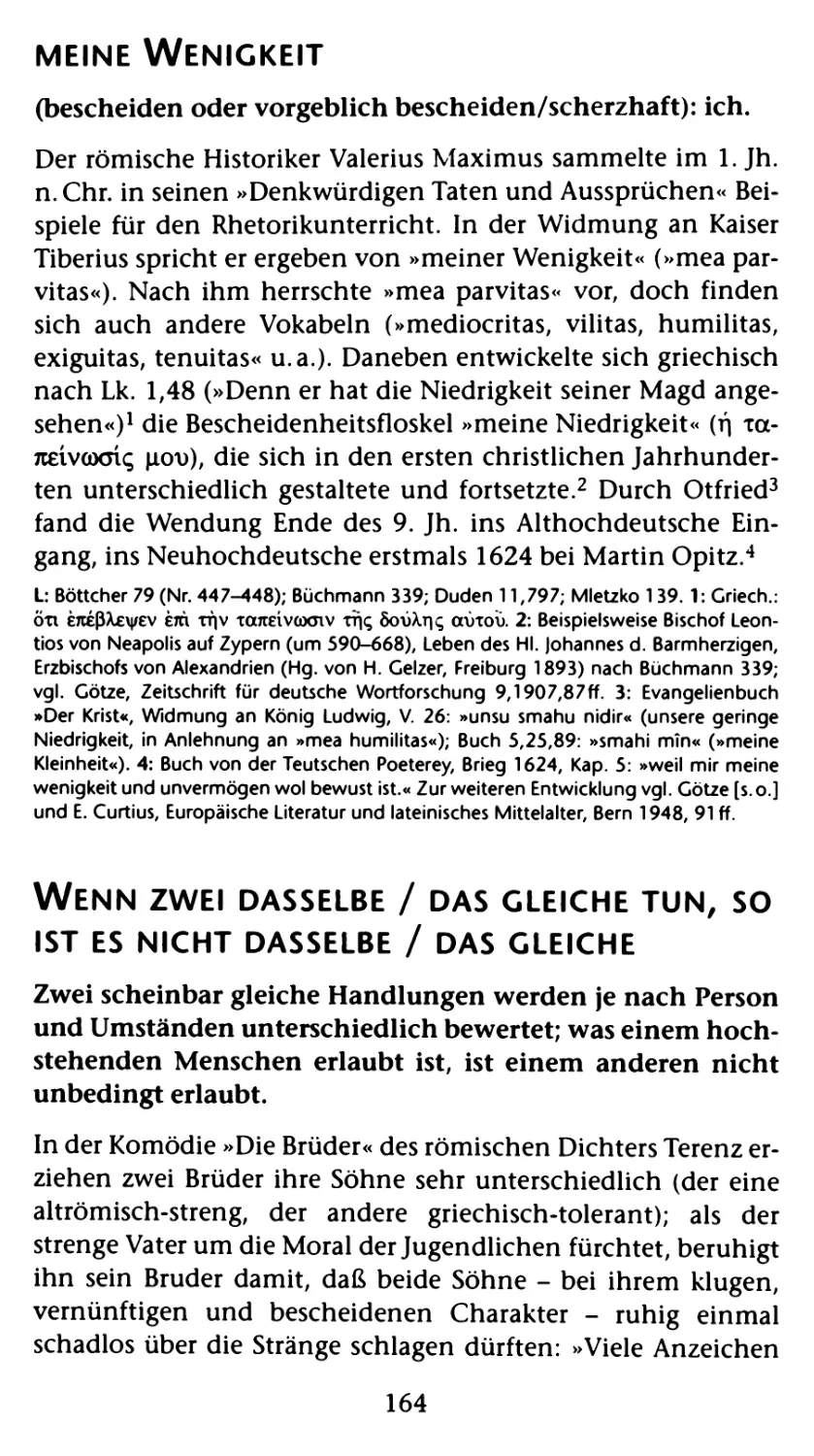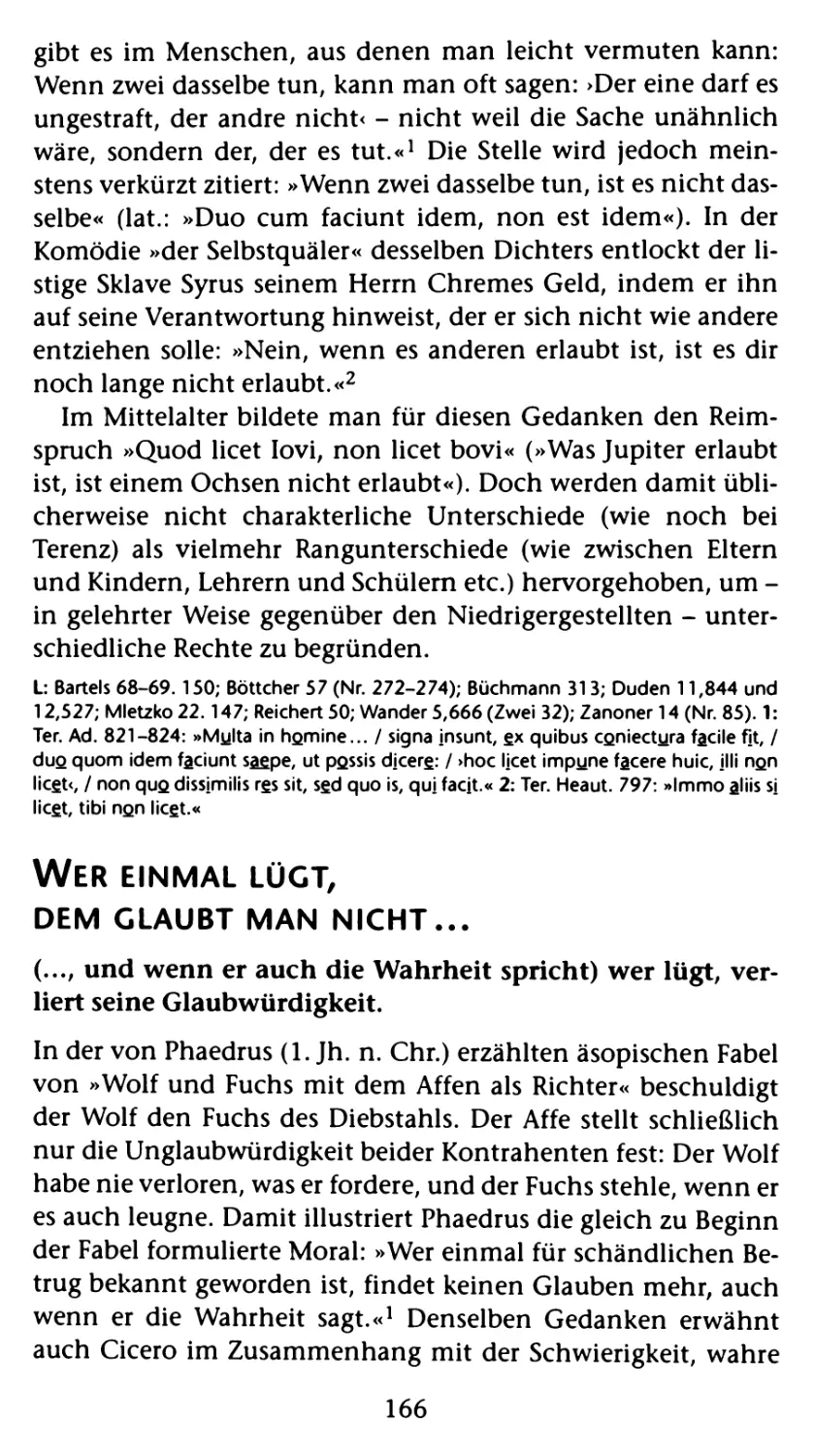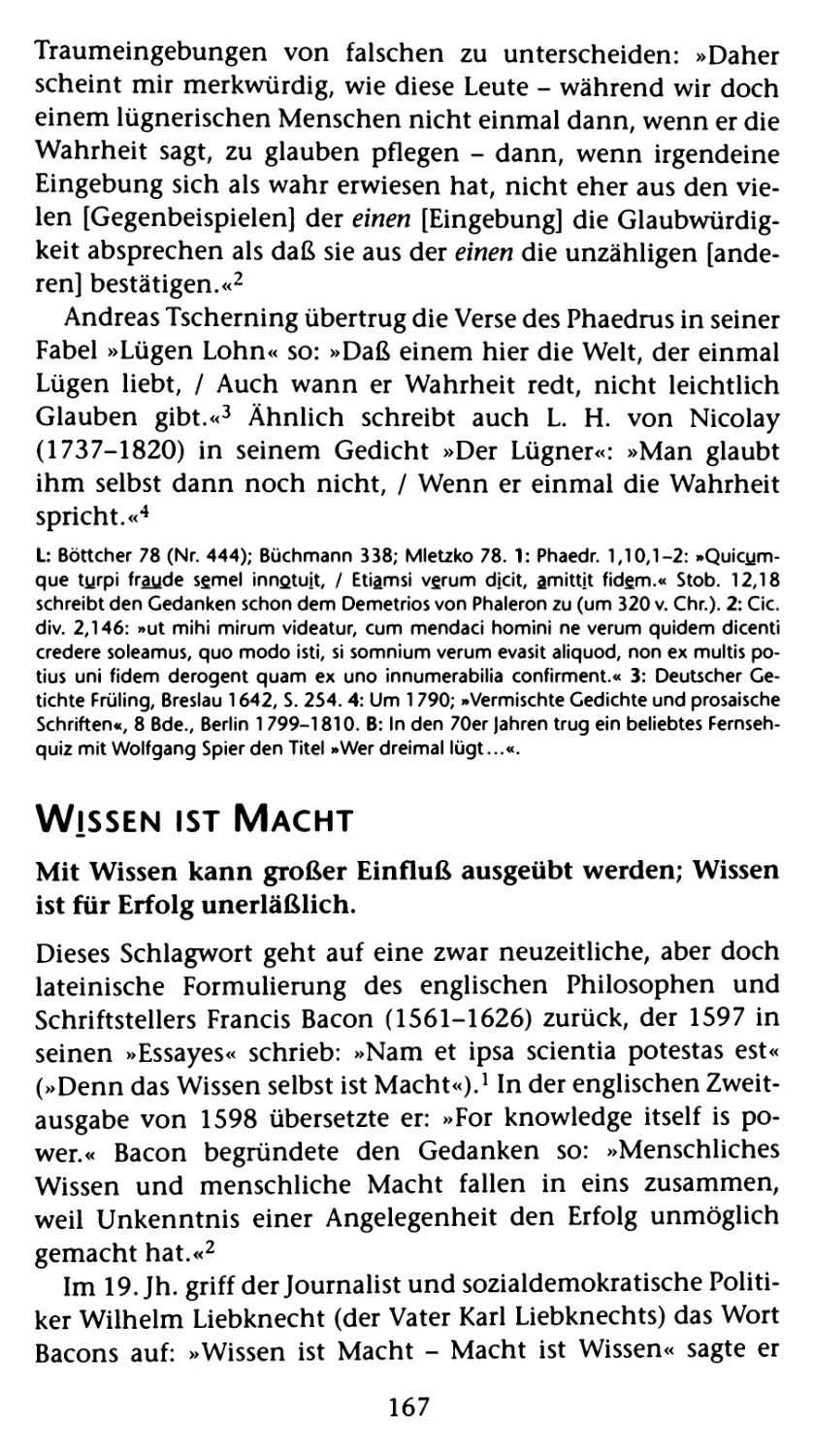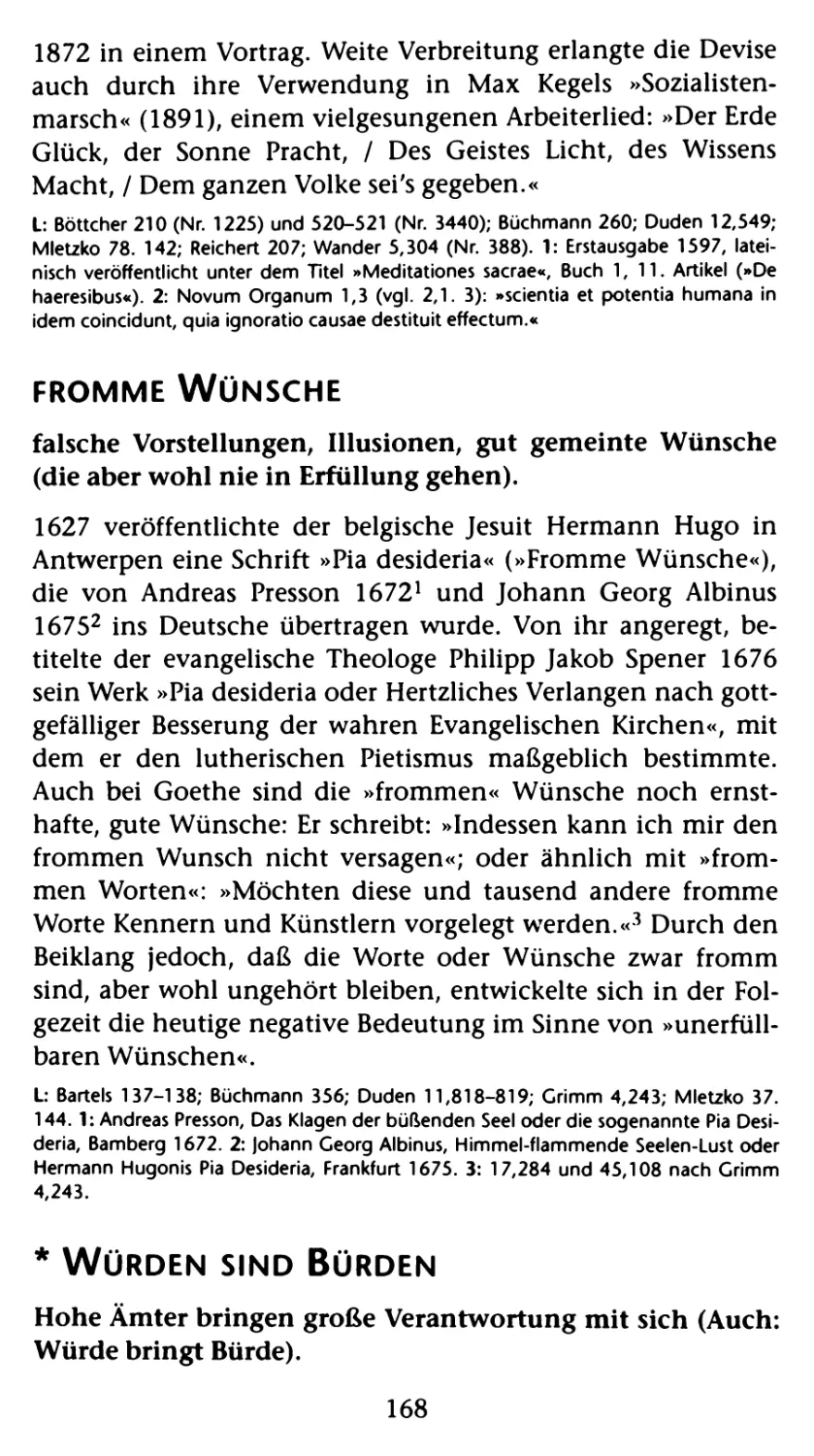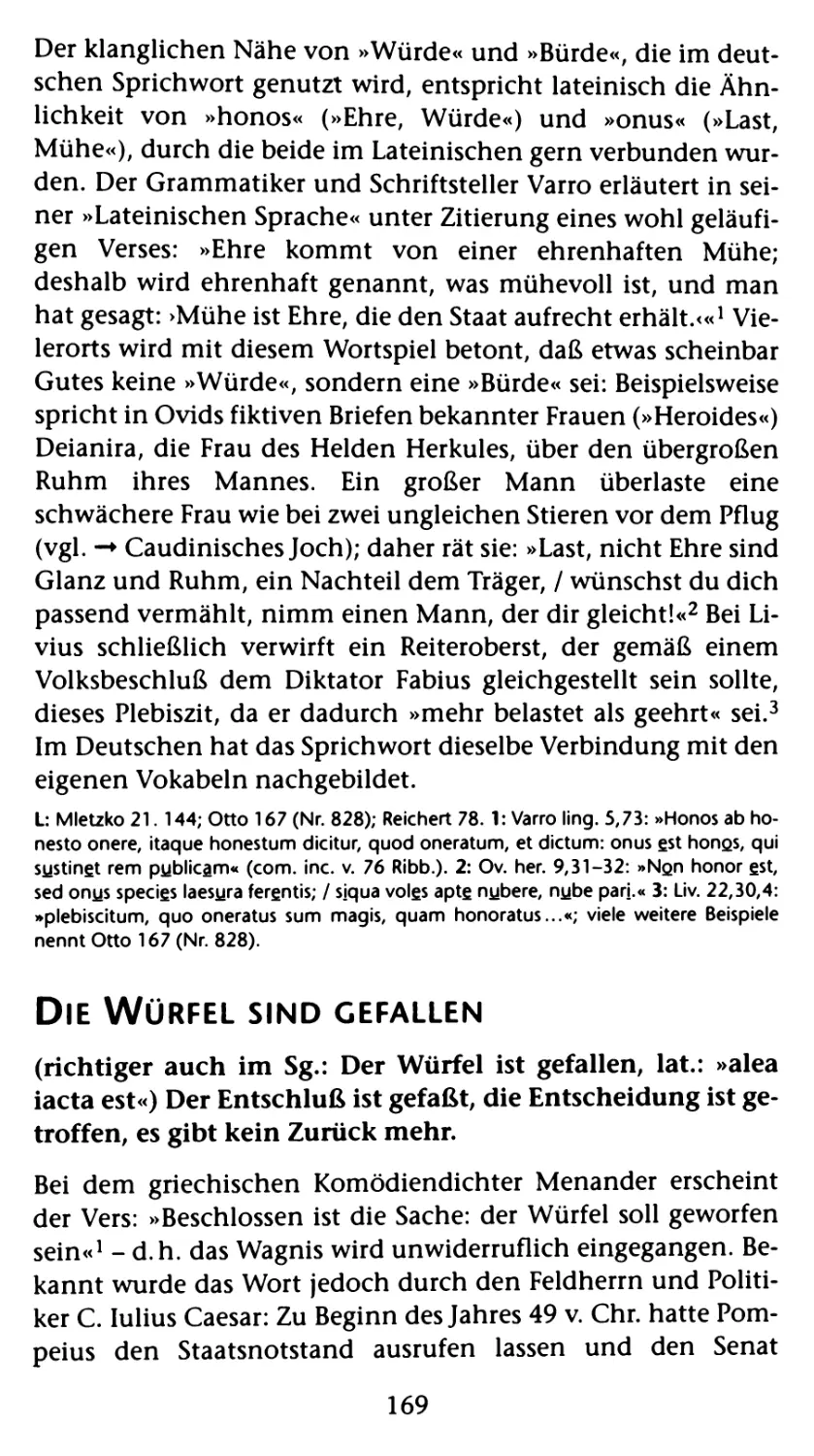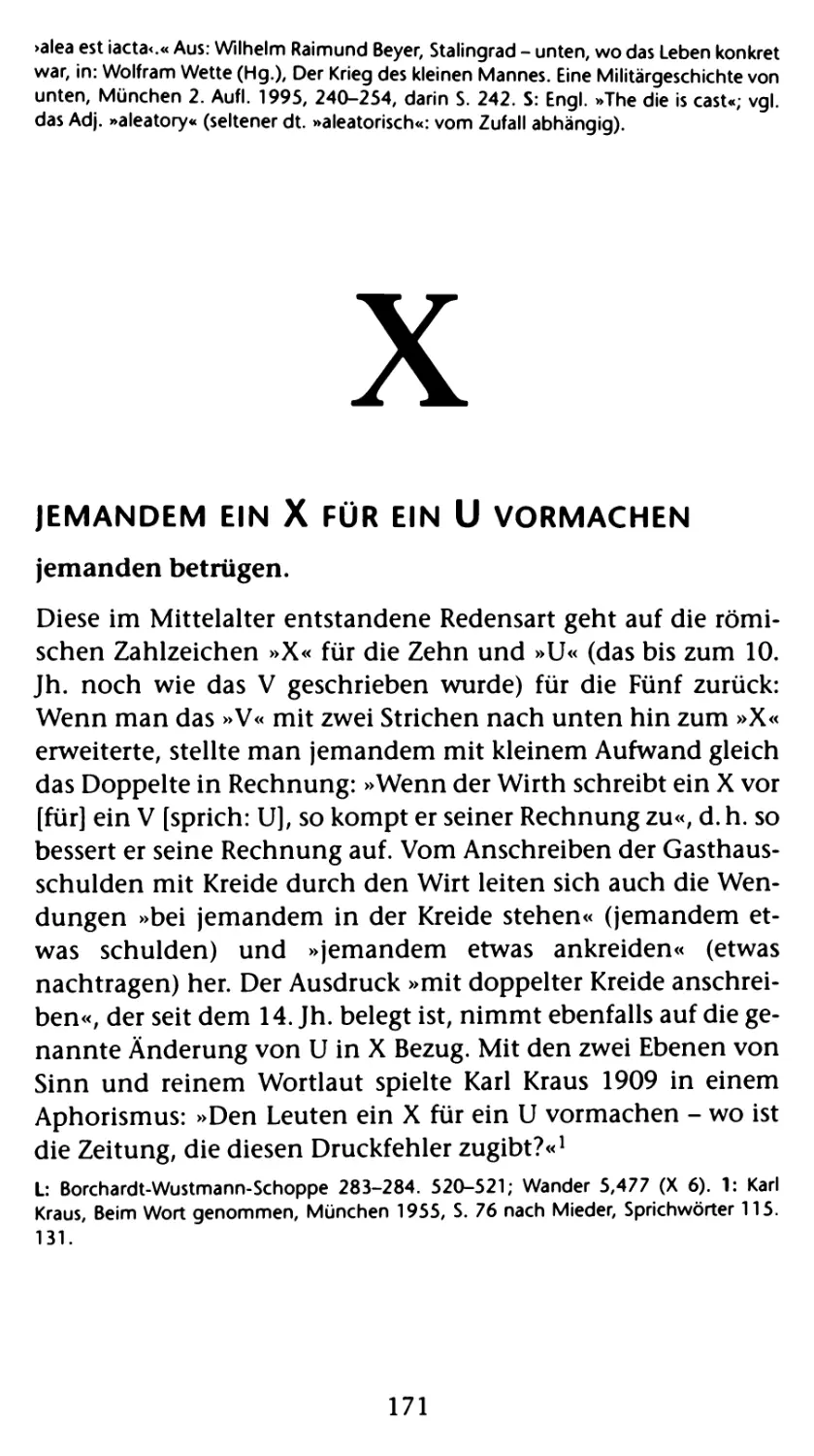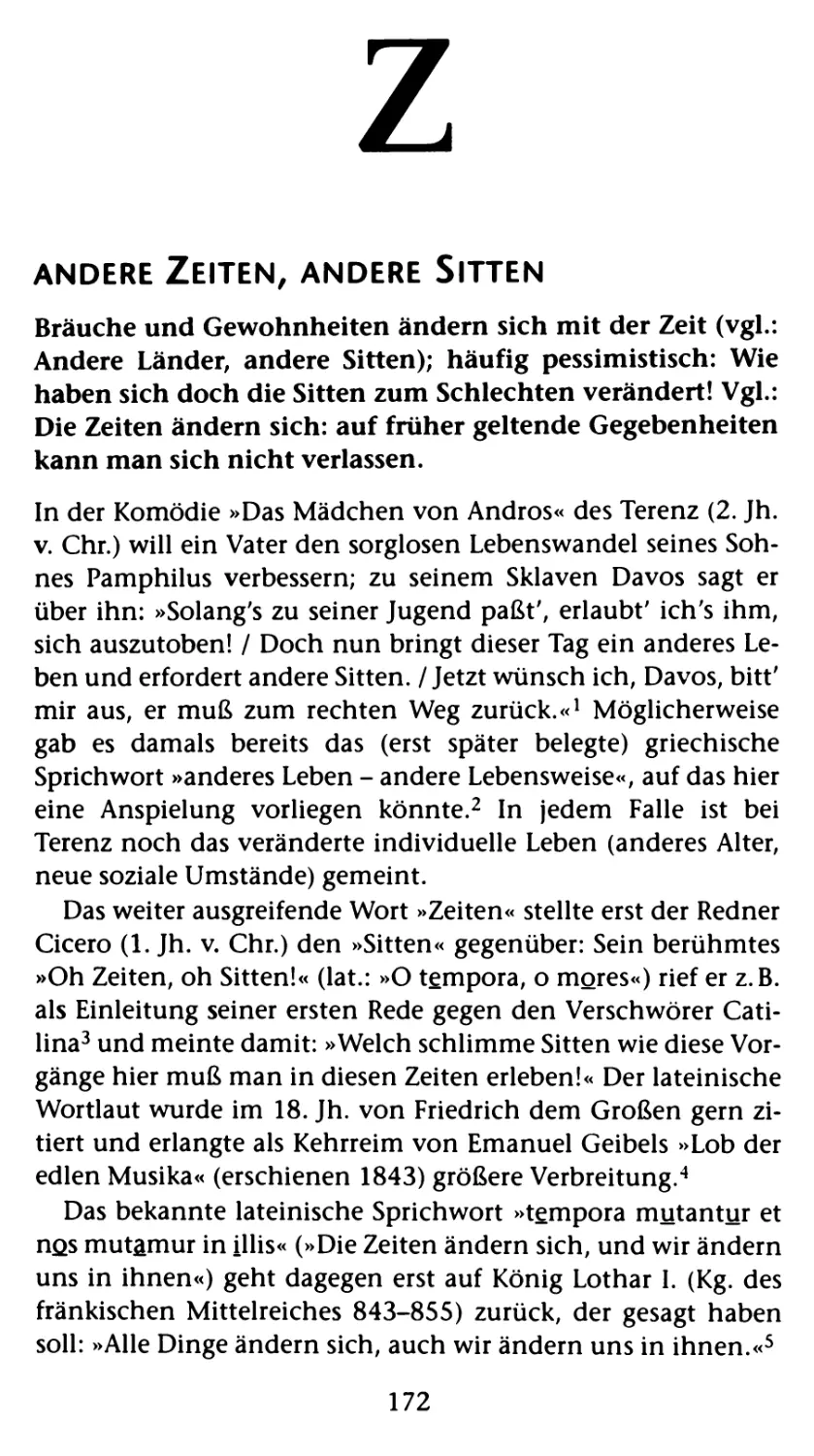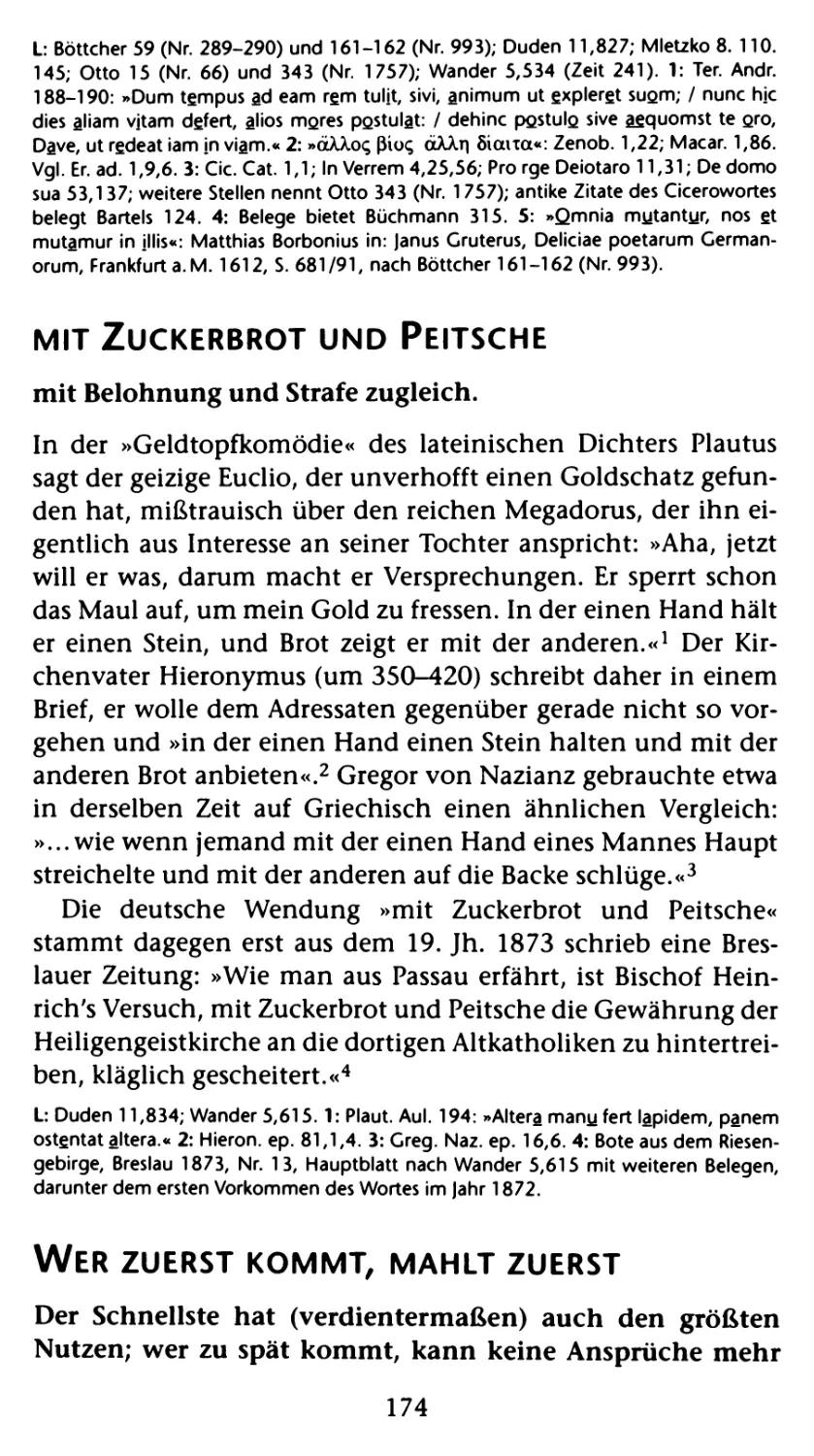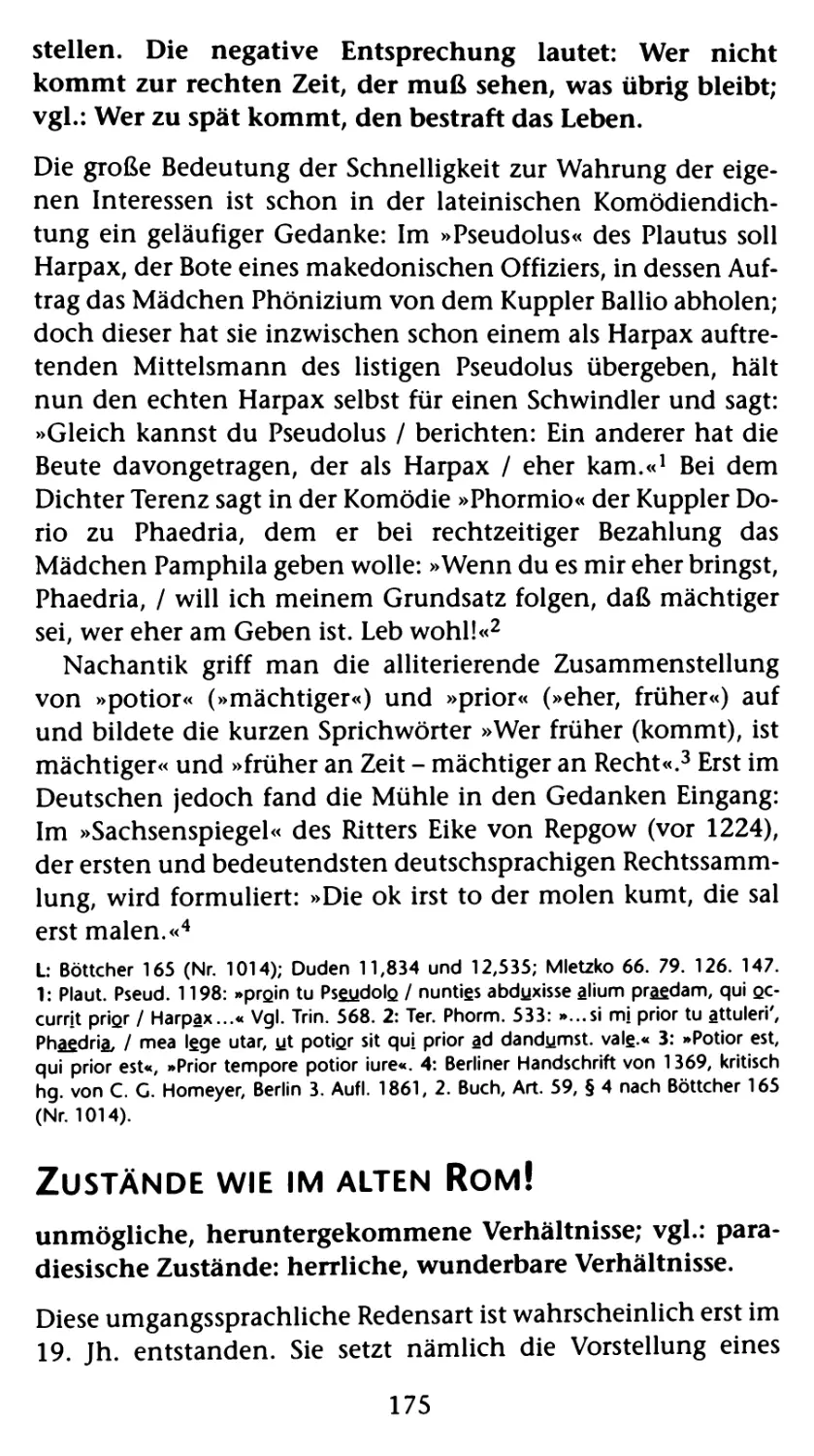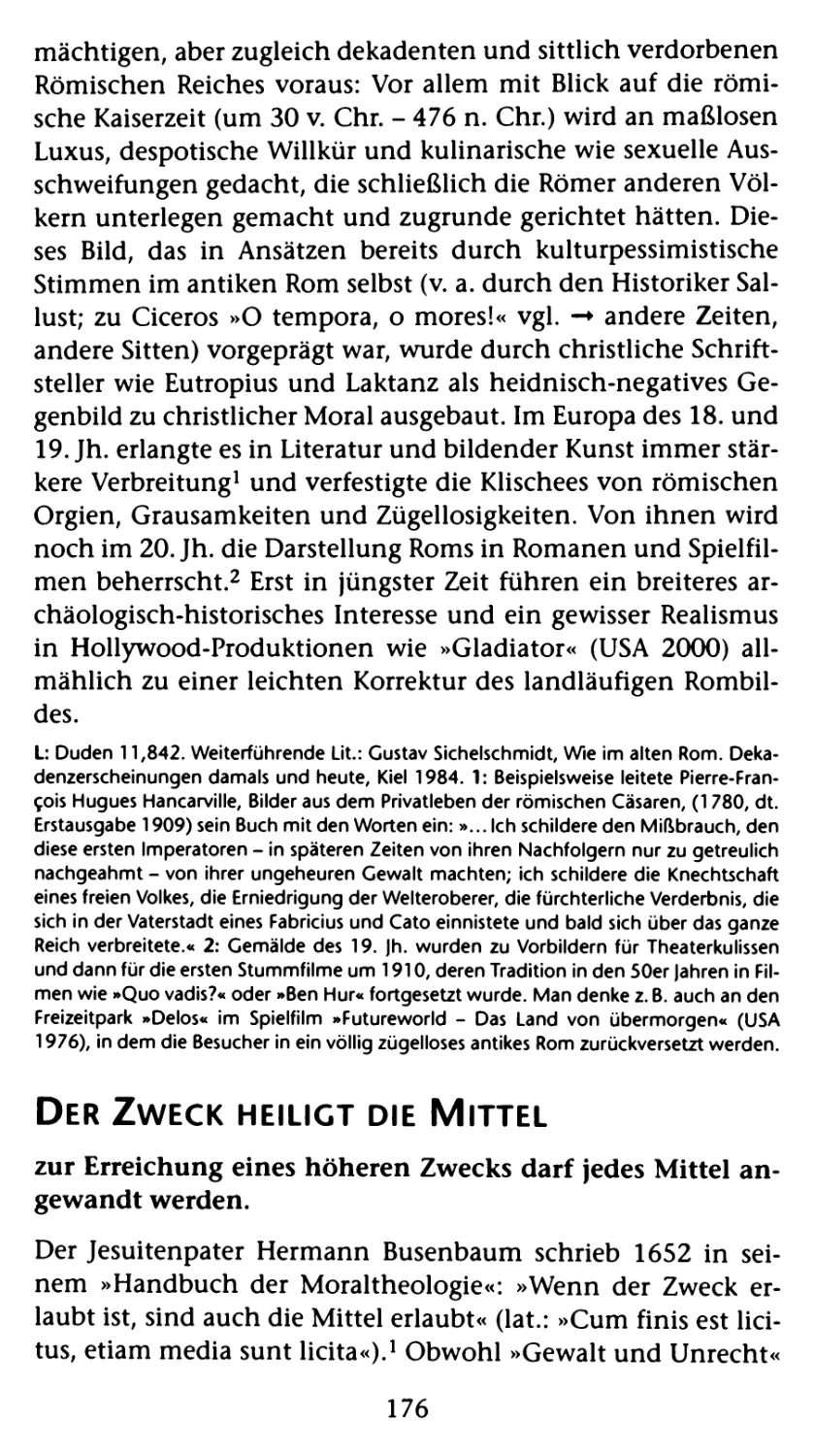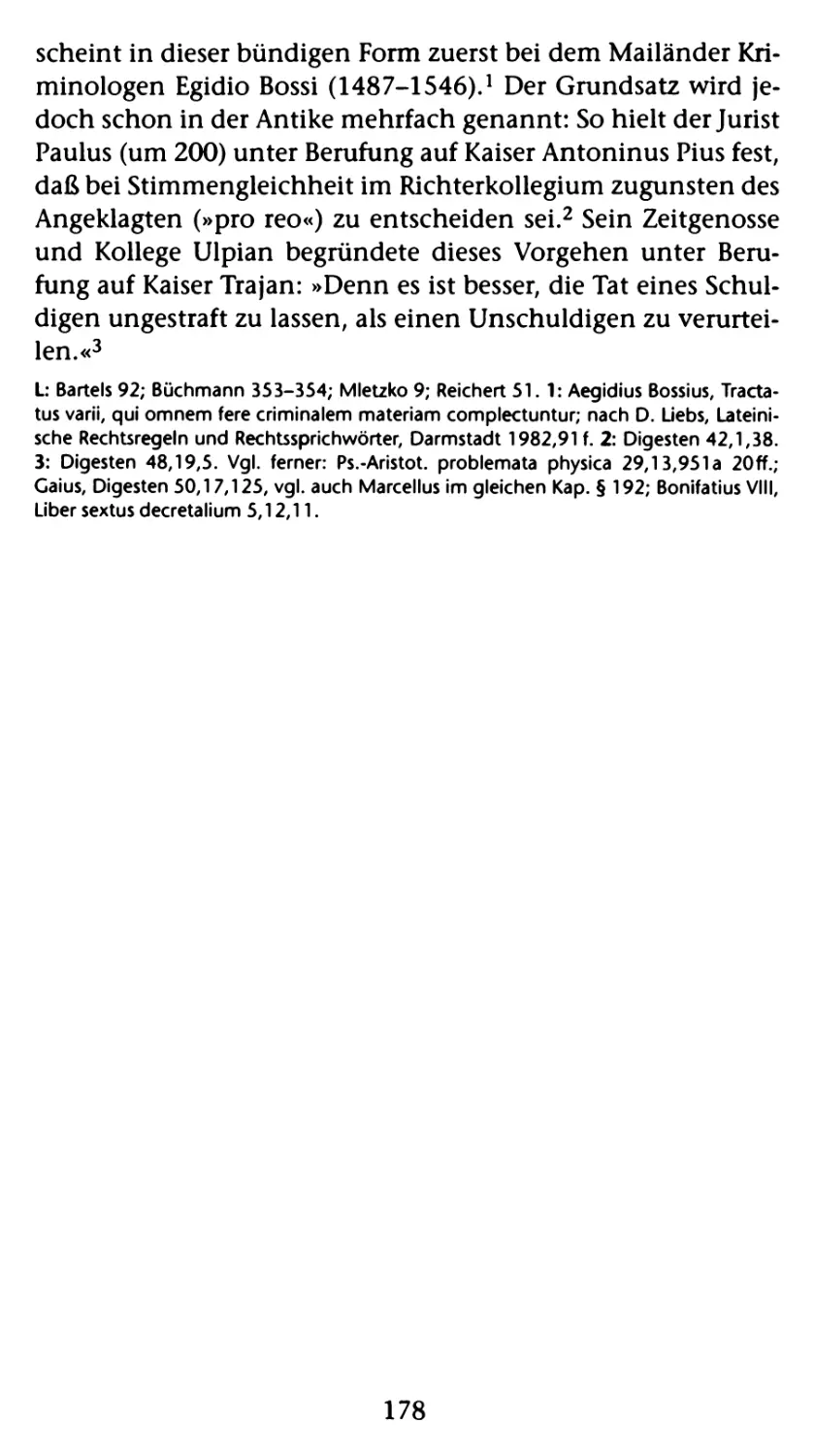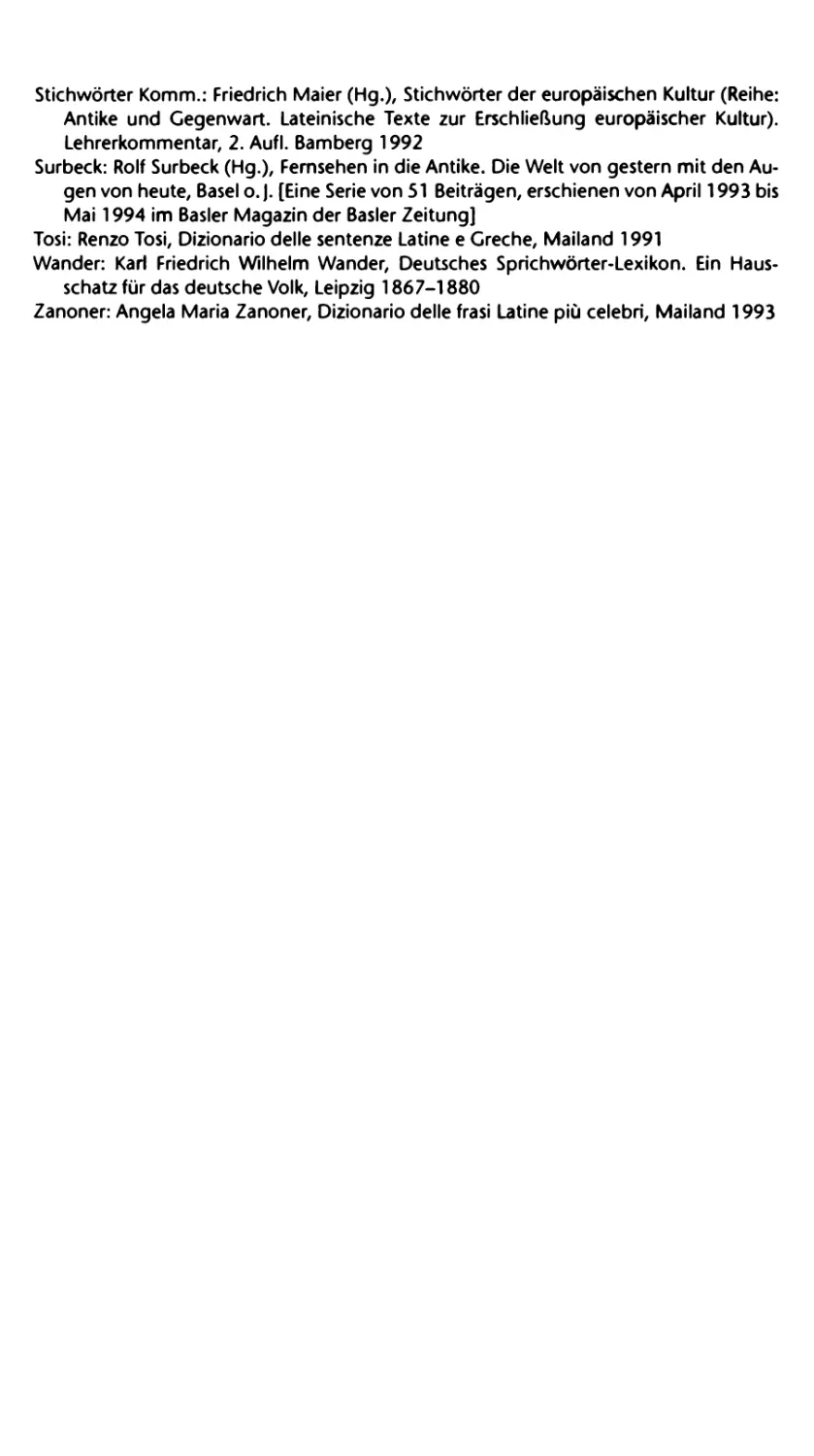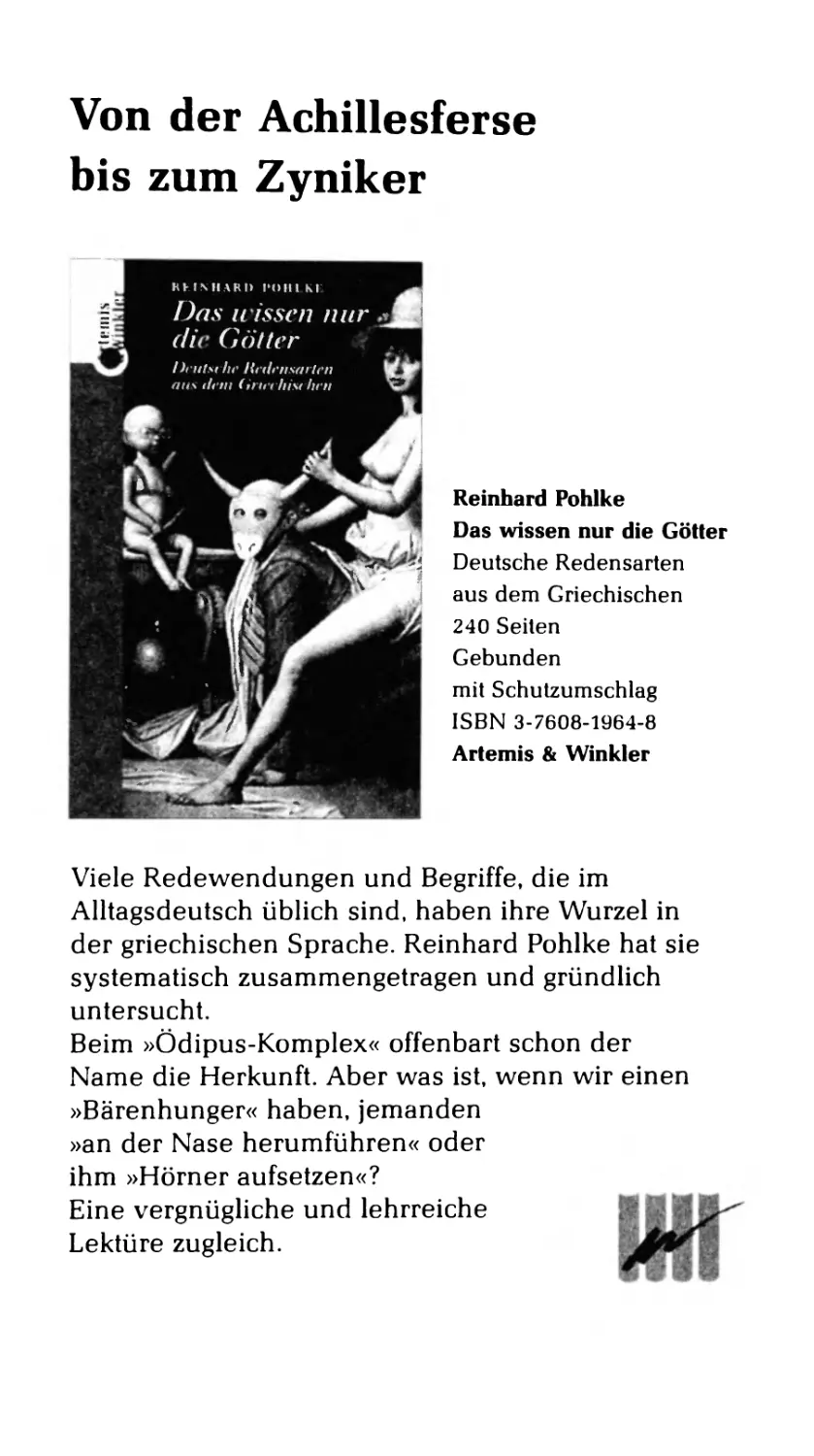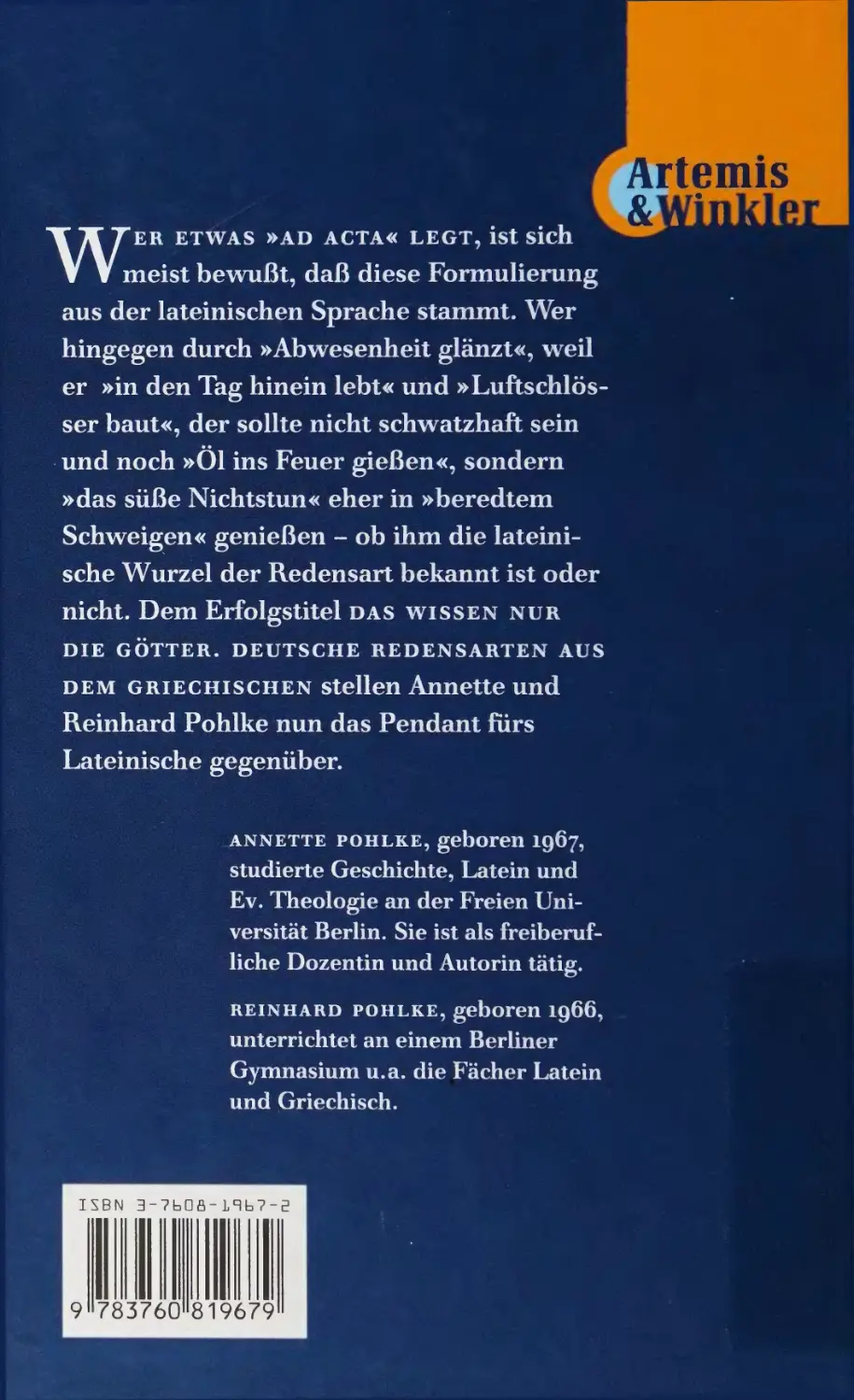Автор: PohikeAnnette Pohike Reinhard
Теги: deutsche sprache wörterbuch wortschatz
ISBN: 3-7608-1967-2
Год: 2001
Текст
CA.
>
•Lt
y
LI
3v *
JV
\
:• ^\>
\i-^\
N
; 'A
t a
i
\
V
■$*%
■^■v
.'S
. t i,- *-
Y*
ANNETTE UND
REINHARD POHLKE
g
R
Deutsche Redewendungen
aus dem Lateinischen
Alle Wege führen nach Rom
Annette und Reinhard Pohlke
Alle Wege
führen nach rom
Deutsche Redewendungen
aus dem Lateinischen
Mit 15 Illustrationen von Margarete Moos
Artemis & Winkler
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Pohlke, Annette:
Alle Wege führen nach Rom:
Deutsche Redewendungen aus dem Lateinischen /
Annette Pohlke / Reinhard Pohlke. -
Düsseldorf; Zürich: Artemis und Winkler, 2001
ISBN 3-7608-1967-2
©2001 Patmos Verlag GmbH & Co. KG
Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf/Zürich
Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks sowie
der fotomechanischen und elektronischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlagmotiv: Marc Aurel als Triumphator hält Einzug in Rom.
Relief vom Ehrenbogen des Marc Aurel (um 1 70-180 n. Chr.).
Rom, Palazzo dei Conservatori
© E. Thiem, Lotus Film, Kaufbeuren
Umschlaggestaltung: Groothuis & Consorten, Hamburg
Satz: Fotosatz Moers, Mönchengladbach
Druck und Verarbeitung: Wiener Verlag, A-Himberg
ISBN 3-7608-1967-2
www.patmos.de
Inhalt
Vorwort 7
Abkürzungsverzeichnis 12
Lexikonteil • von »ad absurdum führen« bis
»Im Zweifel für den Angeklagten« 13
Literaturhinweise 179
Vorwort
Alltägliches Latein
Als gesprochene Sprache mag Latein für uns »tot« sein - als
Bestandteil unserer Sprache ist es ein höchst lebendiger Teil
unserer Alltagskultur. Hier ist nicht nur an die Fülle von Lehn- und
Fremdwörtern lateinischer Herkunft zu denken (z.B. »Pflanze«,
»Küche«, »Kaiser«, »multikulturell«, »sensibel«), sondern auch
an deutsche Wendungen, die lateinische Wörter enthalten (z.
B. -> das Fazit ziehen, -> im Orkus verschwinden, -> Usus sein).
Hinzu kommen jedoch auch - und darum geht es vornehmlich
in diesem Buch - gut deutsche Redensarten wie -> »sich mit
Händen und Füßen wehren«, -> »den Nagel auf den Kopf
treffen« oder -> »in den Tag hinein leben«, die keine lateinischen
Wörter oder Eigennamen enthalten, aber doch lateinischen
Ursprungs sind. -> »Hand und Fuß haben«, -> »dümmer als
dumm«, -> »das Hemd ist mir näher als der Rock«, -> »mit
Zuckerbrot und Peitsche« - all dies existierte entweder bereits
lateinisch oder geht auf sehr ähnliche lateinische Vorlagen
zurück. Bezeichnenderweise sind es oft gerade
umgangssprachliche Wendungen (auffindbar schon in der lateinischen
Komödiendichtung oder Briefprosa), die sich bis heute erhalten
haben: Sie dürften weiter verbreitet und fester verwurzelt gewesen
sein als manche gelehrte Ausdrucksweise, so daß sie unterhalb
der literarischen Oberfläche in den romanischen Sprachen und
auch im Deutschen ihren Niederschlag fanden.
Ein Großteil lateinischer Wendungen hat bereits im
Mittelalter (seit der Christianisierung auf dem Wege der lateinischen
Amts- und Kirchensprache) oder im Humanismus, dem
Zeitalter der Wiederentdeckung der Antike um 1500, auf das
Deutsche eingewirkt. Wegen der vielen damals modischen
lateinischen »Stilblüten« (»flores Latini«) sprach der Humanist Jakob
Wimpfeling (1450-1528) von einem »verbliemten Dutsch«
(verblümten Deutsch). Maßgeblicher Förderer dieser Tendenz
war Erasmus von Rotterdam: In seinem Werk »Adagia«
(»Sprichwörter«; in mehreren Auflagen, zuerst Paris 1500
erschienen) stellte er mehrere tausend lateinische und
griechische Sprichwörter mit gelehrter Erklärung ihrer antiken Bedeu-
7
tung und Entstehung samt Anmerkungen über ihren
zeitgenössischen Gebrauch zusammen; durch die Fülle des
dargebotenen literarischen Materials wie durch den Charme und
Humor der Darstellung hat diese Sammlung breite Wirkung
entfaltet. Später haben vor allem die deutschen »Klassiker« (->
klassisch) wie Goethe und Schiller, aber auch die
Antikenbegeisterung des 19. Jahrhunderts lateinische Wörter, Ausdrucks
weisen oder Sprichwörter aufgenommen, bekannt gemacht oder
eingedeutscht.1
Heute findet sich Lateinisches in unserer gesamten Kultur: in
Literatur und Musik, in Rundfunk und Fernsehen (auch
außerhalb von »Viva«, »Vox«, »Pro« 7 und »Super« RTL), Zeitungen
und Zeitschriften, in Namen von Produkten, Firmen und
Organisationen. Wenn sich beispielsweise eine Versicherung
»Agrippina« nennt, kann einem fast mulmig werden, wird
doch über Agrippina die Jüngere (16-59 n. Chr.) berichtet, daß
ihr eine ganze Reihe absurder »Unfälle« zustieß - allesamt
inszeniert von ihrem Sohn Nero, der so ihr Ableben zu
beschleunigen suchte; ein näherer Blick auf den Firmensitz Köln
(das lateinisch nach Agrippina als »Colonia Claudia Ära Agrip-
pinensium« benannt war) enthüllt allerdings den
tatsächlichen Zusammenhang. Daß neben all diesem auch vieles, was
ein fester Bestandteil des Deutschen geworden und nicht gleich
auf den ersten Blick als Latein erkennbar ist, auf das alte Rom
zurückgeht - dafür möchte dieses Buch den Blick schärfen und
Hintergründe beleuchten.
Zum Inhalt
Alle Stichworte dieser Sammlung haben gemeinsam, daß es
sich um idiomatische, also bildhafte Redewendungen handelt.
Mit ihnen ist in der Regel etwas Übertragenes gemeint, d.h.
etwas anderes, als es der bloße Wortlaut sagt: Wenn wir zum
Beispiel einen -> »Triumph« feiern, nehmen wir nicht tatsächlich
an einem altrömischen Ritual teil, sondern wollen damit zum
1 Die breite und stetige Wirkung der römischen Antike und des Lateinischen auf die
europäische Kultur soll hier nicht ausführlicher beleuchtet werden. Als Einführung
empfehlen wir dazu: Latein und Europa. Traditionen und Renaissancen, hg. von Karl
Büchner, Stuttgart 1978, sowie: Christoph Höcker, DuMont Schnellkurs Antikes
Rom, Köln 1997, S. 124 ff.
8
Ausdruck bringen, daß wir einen ebenso großen Erfolg
errungen haben und ebenso deutlich Anerkennung dafür finden wie
ein römischer Triumphator an seinem Ehrentag.
Bildhafte Rede ist durch verschiedene Gruppen von
Redensarten möglich, die im Lexikonteil dieser Sammlung
alphabetisch ineinander sortiert sind:
a) bildkräftige Einzelwörter, d. h. Begriffe aus der lateinischen
Literatur, Mythologie, Geschichte oder Kulturgeschichte, die
im Deutschen übertragen gebraucht werden (z. B. -> »Mäzen«,
-> »Plebs«, -> »Volkstribun«, -> »Brot und Spiele«);
b) deutsche sprichwörtliche Redensarten, die lateinische
Wörter oder Begriffe aus der römischen Welt enthalten (z. B. ->
»ad acta legen«, -> »jemanden Mores lehren«, -> »unter den
Auspizien«) oder bereits in gleichem oder ähnlichem Wortlaut
im Lateinischen existiert haben (z. B. -> »vor Neid platzen«, ->
»Gleiches mit Gleichem vergelten«, -> »im gleichen Boot
sitzen«, -> »nicht bis fünf zählen können«);
c) »echte« Sprichwörter, also Sätze, die eine feste
Formulierung aufweisen (z. B. -> »Die Würfel sind gefallen«, »Ein
Unglück kommt selten allein«).
Bei allen drei Arten wird stets vom Deutschen ausgegangen,
so daß lateinische Sentenzen und Wahlsprüche, deren
deutsche Fassung nicht sprichwörtlich ist, hier fehlen müssen (z. B.
»Dum Spiro, spero« - »Solange ich lebe, hoffe ich«). Ebenso
fließen rein lateinische Floskeln und Phrasen (»nolens volens«,
»cura posterior«, »ad libitum«) zwar durchaus häufig in
deutsche Sätze ein; doch hätte es den Rahmen dieses Bandes bei
weitem gesprengt, auch sie noch aufzunehmen. Hierfür seien
andere Werke empfohlen.2
Der Übergang von sprichwörtlichen Redensarten zu
Sprichwörtern ist bekanntlich recht fließend. -> »Aus der Not eine
Tugend machen« ist beispielsweise eine Redensart, da die Worte
in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedlich gestaltet
und ausgeformt werden können, etwa: »Ich habe damit aus der
Not eine Tugend gemacht.« oder: »Laßt uns aus der Not der zu
Hause vergessenen Kreditkarte eine Tugend des Sparens
machen!« Sobald man jedoch sagt: »Man muß aus der Not eine Tu-
2 Im Anhang zusammengestellt sind diese Phrasen und Floskeln bei Bartels (siehe die
Literaturhinweise) sowie bei B. Kytzler/L. Redemund, Unser tägliches Latein.
Lexikon des lateinischen Spracherbes, Mainz 1992 u. ö.
9
gend machen!«, liegt ein Sprichwort vor, da man nun eine
allgemeingültige Erfahrung und Einsicht ausspricht. Die dann
gewählte Formulierung ist erstarrt und kann nicht nach Belieben
verändert werden. Formeln und Ausrufe wie -> »Euch werd'
ich...« oder -> »Das Spiel ist aus!« sind zwar ebenfalls starr, aber
wiederum eng in unterschiedliche Zusammenhänge
eingebettet und damit als Redensarten anzusehen.
Auch das Zitat an passender Stelle (z.B. »Ich kam, sah und
siegte«, »Teile und herrsche!«) ist eine Art der übertragenen
Rede, da mit der Zitierung eine bestimmte Botschaft an den
Gesprächspartner verbunden ist. Doch da Zitate kaum zur
alltäglichen Art zu reden gehören, soll auf sie hier bewußt verzichtet
werden und nur auf die gängigen Zitatenlexika verwiesen
werden.3 Allerdings sind auch Aussprüche in dem Falle
aufgenommen worden, daß sie im Deutschen nicht mehr als Zitat
empfunden werden und damit wieder zu einer Redensart oder
einem Sprichwort geworden sind (z. B. -> »Das sieht sogar ein
Blinder!«, -> »Die Würfel sind gefallen«, -> »Die Gedanken sind
frei«, -> »Das Hemd ist mir näher als der Rock«).4 Sehr häufig
ergab sich das Problem, daß nicht alles, was lateinisch und
deutsch überliefert ist (z. B. »dum ferrum candet, tundendum
est« - »Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist«),
auch der Herkunft nach tatsächlich eine lateinische Redensart
ist. Da Latein bis vor gut 100 Jahren eine häufig genutzte
Sprache und darüber hinaus ein hochgeschätztes Bildungsgut war,
wurde auch eine ganze Reihe deutscher Sprichwörter früher
oder später ins Lateinische übersetzt und fand so ihren Weg in
verschiedene Spruchsammlungen. Aus dieser besonderen
Stellung des Lateinischen erklärt sich auch der bemerkenswerte
Umstand, daß lateinische Redewendungen sogar in
umgangssprachliche Redewendungen Eingang gefunden haben (z. B. ->
»intus haben«, -» »Tabula rasa machen«).
Schließlich wird man manches, was gemeinhin als deutsches
3 Karl Bayer, Expressis verbis. Lateinische Zitate für alle Lebenslagen,
Zürich/Düsseldorf 1 996; Hubertus Kudla (Hg.)/ Lexikon der lateinischen Zitate. 3500 Originale
mit Übersetzungen und Belegstellen, München 1999.
4 Zur Entstehung einer sprichwörtlichen Redensart (oder eines Sprichworts) aus
einem Zitat sagt Röhrich 1,29 treffend: »Ein Zitat wird dann zu einer Redensart, wenn
es anonym, verfügbar geworden ist, wenn eben nicht mehr >zitiert< wird. In dem
Augenblick, wo bei einem Zitat der literarische Urheber vergessen wird, ist der
Schritt zur Redensart schon getan.«
10
Sprichwort aus dem Lateinischen gilt (z. B. »Eine Hand wäscht
die andere« - »manus manum lavat«), vergeblich suchen, da es
eigentlich griechischer Herkunft ist und deshalb bereits in dem
entsprechenden Band über Redensarten aus dem Griechischen
Aufnahme gefunden hat, der im Jahr 2000 bei Artemis &
Winkler erschienen ist.5
Hilfreiche Hinweise
Die hier alphabetisch aufgelisteten Begriffe und Wendungen
sind im heutigen Deutsch zumeist noch gang und gäbe; wenn
sie hingegen nur noch selten oder fast gar nicht mehr
gebraucht werden, sind sie mit einem Stern (*) markiert. Der
kleiner gesetzte Teil am Ende jedes Artikels enthält
Stellennachweise und verschiedene Hinweise auf benutzte oder
weiterführende Literatur, auf literarische Nachwirkung oder
Verwendungsbeispiele sowie auf Entsprechungen in anderen
Sprachen (vgl. das folgende AbkürzungsVerzeichnis, dort findet
sich auch ein Hinweis bezüglich der Abkürzungen der antiken
und mittelalterlichen Quellen sowie der Textsammlungen).
Vollständigkeit ist bei all diesen Anmerkungen
verständlicherweise weder jemals erreichbar noch überhaupt beabsichtigt,
weshalb auch mehrfach nur auf weiterführende Werke
verwiesen wird. Für Ergänzungsvorschläge sind wir - ebenso wie
für Kommentare und Hinweise aller Art - dem mitdenkenden
Leser jederzeit dankbar und bitten um Mitteilung unter der
E-Mail-Adresse reinhard@pohlke. de.
Nun wollen wir aber die Sache für sich selbst sprechen lassen
(-> Die Sache spricht für sich). Wir wünschen dem Leser oder
der Leserin, bei der Lektüre keinesfalls -> Blut, Schweiß und
Tränen zu vergießen, sondern einige neue Einblicke in die
deutsche Sprache wie auch in die römische Welt zu gewinnen,
die es hoffentlich oft ermöglichen, -> das Angenehme mit dem
Nützlichen zu verbinden.
5 Reinhard Pohlke, Das wissen nur die Götter. Deutsche Redensarten aus dem
Griechischen, Düsseldorf/Zürich 2000.
11
Abkürzungsverzeichnis
Zum Anmerkungsapparat
L Nachweise in der neuzeitlichen Literatur zu den sprachlichen Ausführungen des
Stichworts; daneben ggf. spezielle historische, religionsgeschichtliche,
kunstgeschichtliche etc. Literatur zu den verwendeten antiken Motiven
1,2... Nachweise zu einzelnen Details der Ausführungen
B Ausgewählte Textbeispiele für die Verwendung des Wortes oder der Wendung
in der Literatur; daneben Beispiele für die Rezeption eines Motivs in der
Literaturgeschichte, d. h. Nennung von Dramen, Gedichten, Opern etc.
S Entsprechungen in anderen Sprachen
Sonstige Abkürzungen
*
a
ä
Abb.
Adj.
ahd.
altind.
Bez.
dän.
dass.
ders.
dt.
ed.
Einl.
engl.
Fr.
frz.
griech.
hebr.
ital.
Kap.
lat.
wenig oder fast nicht mehr in
Gebrauch
lang ausgesprochener Vokal
(z. B. hier langes a)
betonter Vokal (z. B. Gany-
med)
Abbildung(en)
Adjektiv (Eigenschaftswort)
althochdeutsch
altindisch
Bezeichnung
dänisch
dasselbe
derselbe
deutsch
[editus =] herausgegeben
von...
Einleitung
englisch
Fragment(e)
französisch
griechisch
hebräisch
italienisch
Kapitel
lateinisch
Lit.
mhd.
ndl.
0.
o.g.
o.j-
o.O.
o.Z.
PI.
Pt.
Schol.
sg-
S. 0.
sog.
Sp.
Subst.
s.v.
Taf.
u.
u. ö.
V.
v. a.
Z.
Literatur
mittelhochdeutsch
niederländisch
oder
oben genannt
ohne Jahr
ohne Ort
ohne Zählung
Plural (Mehrzahl)
Partizip (Mittelwort)
Scholien (antike
Textkommentare)
Singular (Einzahl)
siehe oben
sogenannt
Spalte(n)
Substantiv (Hauptwort)
[sub voce] unter dem
Stichwort ...
Tafel(n)
und
und öfter
Vers(e)
vor allem
Zeile(n)
Antike Autoren und ihre Werke werden in der allgemein üblichen Weise abgekürzt zitiert,
desgleichen Sammelwerke und Lexika (vgl. die Verzeichnisse im Kleinen Pauly, Bd. 1).
12
A
AD ABSURDUM FÜHREN
(»zum Sinnlosen« / bis zum Widersinn führen) etwas durch
Überspitzung kritisieren, die Unsinnigkeit einer Sache
aufzeigen.
Die Wendung enthält das lateinische Adjektiv »absurdus«
(»mißtönend, sinnlos«), von dem auch das deutsche Lehnwort
»absurd« kommt. »Ad absurdum geführt« ist eine Sache also
dann, wenn ihre Widersinnigkeit deutlich vor Augen steht.
Beispielsweise sagt in Johannes Mario Simmeis Roman »Der
Stoff, aus dem die Träume sind« der Erzähler, der bisher nur
seinen Sinneswahrnehmungen traute:1 »Heute weiß ich, daß es
sich in der Tat andersherum verhält: Was ich (und das gilt für
alle Menschen) sehe, sage, höre, wird vom nächsten Moment
bereits überholt und ad absurdum geführt.«
L: Bartels 196; Duden 11,27; Mletzko 140. 1: München 1971, S. 361.
durch (seine) Abwesenheit glänzen
auffällig abwesend sein.
Im alten Rom war es üblich, bei Leichenbegängnissen der
adligen Familien die Bilder der Vorfahren (imagines maiorum) der
Leiche voranzutragen. Der römische Historiker Tacitus
berichtet nun, daß im Jahre 22 n. Chr. Iunia Tertulla, die Witwe des
Cassius und Schwester des Brutus, mit allen Ehren bestattet
werden durfte, obwohl sie den amtierenden Kaiser Tiberius in
ihrem Testament nicht bedacht hatte. Die Bildnisse des Brutus
und des Cassius durften aber - entgegen der üblichen Sitte -
nicht im Leichenzug mitgeführt werden, da diese im Jahre
44 v. Chr. C. Iulius Caesar, den Begründer des iulisch-claudi-
schen Kaiserhauses, ermordet hatten (vgl. -> Auch du, mein
Sohn Brutus!).
Tacitus bemerkt dazu am Schluß seines Berichts: »Aber Cas-
13
sius und Brutus leuchteten gerade dadurch hervor, daß ihre
Bildnisse nicht zu sehen waren.«1
Der französische Revolutionsdichter Marie-Joseph de Che-
nier (1764-1811) hat diese Stelle in seiner Tragödie »Tibere«
(1819) so wiedergegeben:2 »Brutus et Cassius brillaient par leur
absence«. Von dort ist die Wendung ins Deutsche eingegangen.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 24; Böttcher 340-341 (Nr. 2141-2142); Duden
11,25 und 12,135; Macrone 180-181. 1: Tac. Ann. 3,76: »Sed praefulgebant Cassius
atque Brutus eo ipso quod effigies eorum non visebantur.« 2: 1,1. S: Engl. »Conspi-
cuous by his absence« (zuerst durch Lord john Russell 1859: Macrone 180); frz. »briller
par son absence«.
AD ACTA LEGEN
auf etwas nicht mehr eingehen, etwas nicht weiter
bearbeiten, als erledigt betrachten. Das Gegenteil davon ist
(amtlich:) * von einer Sache Akt nehmen: von etwas Kenntnis
nehmen. Vgl.: Darüber sind die Akten noch nicht
geschlossen: die Sache läuft noch.
Die Wendung stammt aus der lateinischen Amtssprache: Wenn
eine Behörde sich auf ein Gesuch oder anderes Schreiben nicht
einließ und es nicht berücksichtigte, erhielt es den Vermerk
»ad acta«, d.h. »zu den Akten«. Die »Akte« (lat. »actum«:
»Verhandeltes«) enthält alles in einer Sache bereits Angefallene.
Die übertragene Redensart »ad acta legen« erscheint seit der
2. Hälfte des 18. Jh. - Die zu allen Zeiten große Bedeutung der
»Akten« wird auch durch ein nachantikes Sprichwort erhellt:
»Was nicht in den Akten ist, ist auch nicht auf der Welt« (lat.:
»Quod non est in actis, non est in mundo«).1
L: Bartels 196; Borchardt-Wustmann-Schoppe 26; Duden 11,27. 1: Reichert 51.
Altweibergeschwätz
albernes Gerede (auch: Altweibergewäsch); * altweibisch:
albern, kindisch.
Offenbar gaben schon die Römer so wenig auf Geschichten, die
von alten Frauen erzählt werden, daß sie auch bei ihnen für
Unglaubhaftes sprichwörtlich wurden: So spricht Cicero in be-
zug auf sagenhafte Taten der göttlichen Zwillingsbrüder Kastor
und Pollux von »altweiberhaften Geschichtchen« (»fabellae
14
aniles«),1 womit er soviel meint wie »Märchen« oder
»erfundene Geschichten ohne Wahrheitsgehalt«. Auch Apuleius
verwendet denselben Ausdruck im Sinne von
»Lügengeschichten«.2 Im Deutschen erscheint das Adjektiv »altweibisch« seit
dem 16. Jh., doch verwendet man heute nur noch das später
unter Einbindung des »Geschwätzes« gebildete Substantiv.3
L: Grimm 1,275; Otto 28 (Nr. 121). 1: Cic. nat. 3,5,12. 2: Apul. apol. 25: »per nescio
quas anilis fabulas«; weitere Beispiele nennt Otto 28 (Nr. 121). 3: Belege bei Grimm
1,275.
aller Anfang ist schwer
Alle Dinge fallen zu Beginn schwer, bald darauf aber
leichter.
Der lateinische Satz »Omne initium difficile« (»Aller Anfang ist
schwierig«)1 ist nicht antik und wohl nur eine Latinisierung des
gleichlautenden deutschen Sprichworts. Doch begegnet der
Grundsatz in ähnlicher Formulierung schon in der Spätantike:
Der Hl. Petrus Chrysologus, Erzbischof von Ravenna im 5. Jh.,
schreibt zu Beginn einer Rede von der jungfräulichen Geburt
der Maria: »Von allen Dingen zwar sind die Anfänge hart, aber
härter als alles sind die Anfänge einer Gebärenden.«2 Hier
scheint der Gedanke bereits als Sprichwort im Hintergrund zu
stehen, was von dem Philosophen und Politiker Boethius um
500 noch deutlicher gesagt wird: »Denn das Größte vielleicht
von allem ist, wie man sagt, der Anfang, und daher auch das
Schwierigste.«3
Eine ältere gleichbedeutende Redensart wird von dem
Grammatiker Varro im 1. Jh. überliefert: »Die Tür ist beim Weg das
Schwierigste«, d.h. das Losgehen.4
Goethe stellte die Gültigkeit des im Deutschen früh
eingebürgerten Satzes in Frage und deutete an, daß es viel
schwieriger sein kann, etwas fortzuführen und zu beenden als zu
beginnen: »Aller Anfang ist schwer, das mag in einem gewissen Sinne
wahr sein, allgemeiner aber kann man sagen, aller Anfang ist
leicht.«5 Eine jüngere und noch hintergründigere Variante
stammt von Fred Reinke: »Aller Anfang ist nur dann schwer,
wenn man ihn sich zu leicht macht.«6
L: Fritsch 369; Grimm 1,324; Mletzko 8. 107; Otto 287 (Nr. 1472); Wander 1,80
(Anfang 1-8). 1: Wander 1,80 nennt auch die Varianten »Omne principium grave« (»Aller
15
Anfang ist schwer«) und »Omnibus in rebus gravis est inceptio prima« (»In allen Dingen
ist der erste Anfang schwer«). 2: Petr. Chrysol. (PL 52,656): »Omnium quidem rerum
primordia sunt dura, sed duriora sunt omnibus primordia generantis.« 3: Boeth. com-
ment. in Cic. top. (Migne 64 col. 1040): »Maximum enim fortasse omnium, ut dicitur,
principium, quare et difficillimum.« Eine sehr ähnliche griechische Fassung ist im
Mittelalter überliefert: Append. prov. 1,41: »Der Anfang jeder Sache ist doch wohl recht
schwer« (Äpxil 6t\ko\j naviöc, epyov xateJWikepöv eoii). 4: Varro rust. 1,2,2: »Portam
itineri... longissimum esse«. 5: 21,50 nach Grimm 1,324. 6: Mieder, Antisprichwörter
3 mit Beleg. B: Die Erzählung »Vom schweren Anfang« (1950) von Eduard Claudius
(1911-1974) wirbt um Produktionssteigerung in der jungen DDR. S: Engl. »The begin-
nings are always hard«; ital. »Ogni principio e difficile«; ndl. »Het begin is altijd 't zwaar-
ste«.
Wehre den Anfängen!
Schreite sofort ein, bevor das Problem größer wird! Vgl. das
Sprichwort: * Wer will der Krankheit bald entgehn, der muß
dem Anfang widerstehn.
In seinen »Heilmitteln gegen die Liebe« vergleicht der
römische Dichter Ovid die Liebe mit einem Baum, der aus kleinen
Anfängen schließlich kräftig und unverrückbar wird; daher
empfiehlt er: »Wie beschaffen es sei, was du liebst, blick dich
raschen Sinnes um / und entziehe deinen Hals dem Joch (vgl. ->
Caudinisches Joch), das dich verletzen will. / Wehre den
Anfängen! Zu spät wird Medizin bereitet, / wenn die Übel über
lange Zeit stark geworden sind.«1 Der Philosoph Seneca spielt
auf diese Verse an, wenn er am Ende eines Briefes schreibt, daß
sich ein weiser Mensch von keiner belastenden Beschäftigung
in Anspruch nehmen lassen dürfe: »Den Anfängen jener
wollen wir wehren!«2 In seiner »Trostschrift an Marcia«, der er mit
philosophischen Ratschlägen über den Tod ihres Vaters
hinweghelfen möchte, führt er den Gedanken weiter aus: »Wie alle
Fehler sich tief festsetzen, wenn sie nicht, solange sie sich noch
entwickeln, unterdrückt worden sind, so nähren sich auch
diese trüben, unseligen und gegen sich wütenden
Empfindungen zuletzt gerade aus der Verbitterung, und der Schmerz wird
zu einer verkehrten Freude einer unglücklichen Seele. Ich hätte
es daher gewünscht, in der ersten Zeit an diese Behandlung
gehen zu können...«3
L: Bartels 140; Böttcher 76-77 (Nr. 433-434); Büchmann 334; Duden 11,38 und
12,514; Fritsch 41 7; Mletzko 8.15. 137. 140; Otto 287 (Nr. 1470); Reichert 231;
Wander 1,80-82 (Anfang 31. 51. 55). 1: Ovid, rem. am. 89-92: »Quäle sit id, quod amas,
celeri circymspice mgnte, / £t tua lassuro. sybtrahe cojla iugQ. / Principüs obsta; serQ
mediana paratur, / Cum mala per longas CQnvalue/e moras.« Vgl. auch V. 81 und her.
16
Aller Anfang ist schwer.
17,190. 2: Sen. ep. 72,11: »principiis illarum obstemus«; vgl. ep. 116,3; dial. 5,10,2-3.
3: Sen. ad Marc, de consol. 1,7-8; vgl. allgemein Cic. Phil. 5,31,1: »Omne malum nas-
cens facile opprimitur, inveteratum fit plerumque robustius« (Jedes Übel wird leicht
unterdrückt, wenn es entsteht, gealtert wird es meistens kräftiger); Cato dist. 4,9.
Griechische Vorläufer nennt Otto 287 (Nr. 1470). S: Frz. »II faut veiller aux commencements«.
das Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden
sich oder anderen bei einer Pflicht oder Arbeit auch etwas
Spaß gönnen.
Der römische Dichter Horaz schreibt in seiner »Dichtkunst«:
»Jede Stimme hat derjenige davongetragen, der das Nützliche
mit dem Angenehmen gemischt hat, indem er den Leser
zugleich erfreut und ermahnt.«1 In der griechischen
Literaturtheorie wurden beide Forderungen nach Unterhaltung und
Belehrung seit langem erwogen. Daher hat der Gedanke
inhaltlich bereits griechische Vorläufer.2 Einige Verse zuvor
formuliert Horaz die Polarität der Begriffe: »Entweder nützen oder
erfreuen wollen die Dichter / oder zugleich Vergnügliches und
auch fürs Leben Brauchbares sagen« (lat.: Aut prodesse volunt
aut delectare pogtae / aut simul £t iucunda et idQnea dicere v^
tae).3
Seit der Renaissance wurden diese zwei Grundfunktionen
der Kunst erneut diskutiert. Goethe wandelte in der horazi-
schen Formulierung »nützen oder erfreuen« das »oder« in ein
»sowohl als auch« um und stellte sie als Motto dem Prolog
»Neueröffnetes moralisch-politisches Puppenspiel« (1774)
voran: »Et prodesse et delectare.« Noch heute kann man - auch
ganz losgelöst vom Bereich der Dichtung - auf allen möglichen
Gebieten das »Angenehme mit dem Nützlichen verbinden«.
L: Bartels 126-127; Böttcher 75 (Nr. 420-^21); Büchmann 332; Duden 11,39 und
12,44; Mletzko 9. 91.1: Hör. ars 343-344: »Qmne tuHt punctum, qui miscuit utile dulci
/ Igctorgm delgctandQ parite/que mongndo«; »punctum« ist der Punkt, der bei der
Auszählung der Stimmen hinter dem Kandidatennamen auf dem Wachstäfelchen
eingestochen wird. 2: Siehe Büchmann 332. 3: Hör. ars 333-334.
18
einen Animus haben
eine Vermutung haben.
Diese umgangssprachliche Redewendung ist von lat. »animus«
(»Geist, Gemüt«) abgeleitet; sie dürfte auf den gleichen
lautlichen Beginn der Wörter »Ahnung« und »animus« (unkorrekt
mit langem a gesprochen) zurückgehen, die wohl dazu
animierte, in »eine Ahnung haben« die »Ahnung« auf
scherzhaftgelehrte Weise durch die lateinische Vokabel zu ersetzen.
in die Annalen eingehen
in die Geschichte eingehen, unvergessen bleiben.
»Annalen« (lat. »annales«: »Jahrbücher, Jahreslisten«, von lat.
»annus«: »Jahr«) waren im antiken Rom die nach Jahren
geordneten staatlichen Aufzeichnungen verschiedenster Ereignisse.
Mit dem Aufkommen der Geschichtsschreibung ab etwa 200 v.
Chr. wurde der Begriff »Annales« oft auch als Titel
geschichtlicher Werke verwendet (z.B. von Tacitus). Auch im Mittelalter
wurden von Klöstern und Domstiften Annalen geführt, die
sich später zu Geschichtsschreibung weiterentwickelten und
mit den Gattungen der Chronik und der Historie
verschmolzen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird »in die Annalen
eingehen« anstelle von »in Erinnerung bleiben« verwendet, wenn
man der betreffenden Sache Bedeutung, Erhabenheit oder
offiziellen Charakter verleihen möchte. So schrieb z. B. Karl Marx
im »Kapital«: »Und die Geschichte dieser ihrer Expropriation
[d. h. die Ausbeutung durch die Bourgeoisie] ist in die Annalen
der Menschheit eingeschrieben mit Zügen von Blut und
Feuer.«1
L: Böttcher 520 (Nr. 3438); Duden 11,42.1: Marx-Engels, Werke 23,743 nach Böttcher
520.
EINEN LANGEN ARM HABEN
weitreichende Macht, großen Einfluß besitzen.
In seinen »Heroides« (»Heldinnen«, geschrieben um 5 v. Chr.)
fingiert der römische Dichter Ovid Briefe berühmter Frauen
zumeist an ihre Männer oder Liebhaber, so auch eine Antwort der
19
schönen Helena an den Königssohn Paris, der sie nach Troja
entführen will. Darin warnt sie ihn vor ihrem Ehemann, dem
spartanischen König Menelaos: »Jener hat zwar die Segel
gesetzt mit günstigem Wind nach Kreta, / du aber glaube daher
nicht, daß alles erlaubt sei! / Mein Mann ist in der Weise
abwesend, daß er mich auch abwesend noch bewacht - / oder weißt
du nicht, daß Könige lange Arme haben?«1 Die Wendung war
zu Ovids Zeit vielleicht schon sprichwörtlich, möglicherweise
sogar im Griechischen, wo sie jedoch erst im Mittelalter als
Sprichwort belegt ist.2 In Rom verwendet noch der Philosoph
Seneca das Motiv in einem Brief, in dem er die
Unangreifbarkeit der Seele beschreibt, die - von der Philosophie geschützt -
jedem Schicksal standhalten könne: »Nicht hat, wie wir
meinen, das Schicksal lange Arme: Niemanden überwältigt es,
wenn er sich nicht an es klammert.«3 Erasmus von Rotterdam
überliefert in seiner Sprichwörtersammlung »Adagia«, daß es
geläufig sei zu sagen: »Vor Königen muß man sich hüten, da sie
sehr lange Arme haben.« »Kein Wunder«, erläutert er, »da sie
durch ihre Leute, derer sie sich anstelle ihrer Arme bedienen,
auch weit Verstreute niederschlagen können.«4
Heute kann »einen langen Arm haben« auf Mächtige und
Einflußreiche jeder Art bezogen werden. So läßt Max von der
Grün in seinem Roman »Stellenweise Glatteis« einen
Angestellten zu dem Erzähler Maiwald sagen, als dieser sich gegen seine
fristlose Kündigung durch die Betriebsleitung auflehnt: »Laß
das doch, du ziehst nur den Kürzeren, ich kenn das, die haben
einen langen Arm.«5
L: Böttcher 77 (Nr. 435); Büchmann 334; Duden 12,292; Grimm 1,553; Otto 210 (Nr.
1037); Wander 1,128 (Arm 8.12.14. 29. 34). 1: Ov. her. 17,163-166; V. 166 lautet lat:
»An nescis longas rggibus esse manys?« 2: Apost. 11,7a; vgl. bereits im 3. Jh. Herod.
8,440. 3: Sen. ep. 82,5: »Non habet, ut putamus, Fortuna longas manus: neminem
occupat, nisi haerentem sibi.« 4: Er. ad. 1,2,3: »Nimirum, quod per suos, quibus bra-
chiorum vice utuntur, possint etiam procul dissitos affligere.« 5: Max von der Grün,
Stellenweise Glatteis, Darmstadt 1973, Sonderausgabe 1986, S. 307-308.
Armutszeugnis
Erweis mangelnder Fähigkeit; Blöße; v. a.: ein A. für jdn.
sein, sich ein A. ausstellen; auch * Armutsschein.
Der römische Gelehrte Varro leitete im 1. Jh. v. Chr. den Begriff
»paupertas« (»Armut«; etymologisch von »paucus«: »wenig«
20
und »parere«: »schaffen«) vom Adjektiv »parvus« (klein,
gering) ab: »Und das Geld war gering: Daher wird bei demjenigen
von >Geringheit< gesprochen, bei dem ein großes Zeugnis von
Armut ist.«1
Vielleicht durch diesen Wortgebrauch angeregt, bezeichnete
man seit der Neuzeit als »testimonium paupertatis«
(»Armutszeugnis«) eine behördliche Bescheinigung der Bedürftigkeit für
denjenigen, der das Armenrecht (d.h. Prozeßkostenhilfe und
Stellung eines Anwalts) in Anspruch nehmen möchte. Im
übertragenen Sinne wurde es anschließend zur Bezeichnung für
eine Offenbarung geistiger Mittellosigkeit.
L: Bartels 208; Duden 11,52; Grimm 1,563. 1: Varro, De vita populi Romani, fr. 10 (bei
Non. 43 M.): »pecuniaque erat parva: ab eo paupertas dicta, cuius paupertatis ma-
gnum testimonium est.«
Arzt, heile dich selbst!
Wende deine Fähigkeiten zuerst an dir selbst an, bevor du
sie anderen anbietest!
Um den Ruf von Ärzten war es schon in der Antike nicht zum
Besten gestellt: »Ein Arzt ist nichts weiter als eine Tröstung fürs
Gemüt«1 - aber keine echte Hilfe. Das Motiv des Arztes, der
zwar andere zu heilen behauptet, sich selbst aber nicht helfen
kann, ist in der Antike offenbar geläufig gewesen. Es begegnet
uns 45 v. Chr. in einem Brief an Cicero, in dem ihn sein Freund
Servius Sulpicius Rufus aufzumuntern sucht:2 »Vergiß
schließlich nicht, daß du Cicero bist und derjenige, der anderen
Lehren und Rat zu erteilen gewohnt ist, und ahme nicht die
schlechten Ärzte nach, die bei fremden Krankheiten
verkünden, sie besäßen die Kunst der Medizin, sich selbst aber nicht
behandeln können, sondern bringe das, was du andere zu
lehren pflegst, auch dir nahe und nimm es dir zu Herzen!« Daß es
auch ein entsprechendes lateinisches oder griechisches
Sprichwort gegeben haben muß, wird im Lukasevangelium bezeugt:
Als Jesus in Nazareth predigte und wußte, daß die Menschen
dort Gewaltiges von ihm erwarteten, »sprach er zu ihnen: Ihr
werdet freilich zu mir sagen dies Sprichwort: Arzt, hilf dir
selbst! Denn wie große Dinge haben wir gehört, zu Kapernaum
geschehen! Tu so auch hier in deiner Vaterstadt!«3 Die
lateinische Übersetzung in der Vulgata (»Medice, cura te ipsum!«) hat
21
das deutsche Sprichwort entstehen lassen und wird heute
bisweilen auch lateinisch zitiert.
L: Macrone 207-208; Otto 216 (Nr. 1077); Wander 1,151. 1: Petron. 42,5: »medicus
enim nihil aliud est quam animi consolatio.« 2: Cic. fam. 4,5,5: »Denique noli te obli-
visci Ciceronem esse et eum qui aliis consueris praecipere et dare consilium, neque imi-
tare malos medicos, qui in alienis morbis profitentur tenere se medicinae scientiam, ipsi
se curare non possunt, sed potius quae aliis tute praecipere soles ea tute tibi subiace at-
que apud animum propone.« 3: Lk. 4,23. S: Dan. »Loege, hjelp dig selv«; engl. »Physi-
cian, heal thyselfU; frz. »Mediän, gueris-toi, toi-meme«; ndl. »Geneesmeester, heel u
zelven«.
Auch du, mein Sohn (Brutus)!
(Ausruf des Entsetzens, oft scherzhaft:) Auch du hast dich
gegen mich verschworen! Auch du läßt mich im Stich!
Auch: Auch du, (mein [Sohn]) Brutus!
Gaius Iulius Caesar soll, als er 44 v. Chr. von seinem Schützling
Marcus Brutus1 und anderen Verschwörern erdolcht wurde,
dem Brutus auf Griechisch »Auch du, mein Kind!« zugerufen
haben,2 d.h. ergänzt: »Auch du gesellst dich du diesen
Verschwörern und Mördern?« Die Herkunft dieses Satzes, den
Caesar offenkundig als Zitat äußerte, läßt sich jedoch nicht
nachweisen. Nach Sueton selbst sprach Caesar kein Wort, doch, so
sagt er, gebe es Autoren, die von dem griechischen Ausruf
erzählten. Auch Cassius Dio hält ein Schweigen Caesars für am
sichersten verbürgt, berichtet aber ebenso von dem Wort an
Brutus,3 im selben Wortlaut wie Sueton es tut.
Das genannte Zitat hat übrigens dazu beigetragen,
Spekulationen am Leben zu erhalten, Brutus sei der leibliche Sohn
Caesars gewesen. Tatsächlich schreibt Sueton, Caesar habe Servilia,
die Mutter des Brutus, »vor allen anderen geliebt«,4 und es
war allgemein bekannt, daß Caesar eine Affäre mit ihr hatte.
Allerdings war Caesar bei der Geburt des Brutus (85 v. Chr) fast
noch ein Teenager (da er vermutlich 100 v. Chr geboren
wurde); seine Affäre mit Servilia, die man vor allem durch
reiche Geschenke bewiesen sah, datiert aber in seine späteren
Lebensjahre.
Shakespeare läßt in seinem »Julius Caesar« (1599) diesen
lateinisch »Et tu, Brüte«5 sagen und wechselt damit ebenso vom
Englischen ins Lateinische wie Caesar bei Plutarch vom
Lateinischen ins Griechische. Dies läßt vermuten, daß die lateini-
22
sehen Worte auch zu dieser Zeit allgemein bekannt und daher
dem englischen Publikum vertraut waren. Zuvor bereits (und
zudem außerhalb der Caesar-Geschichte) findet sich das Zitat
in »The True Tragedy of Richard Duke of York« (1595), einer
Bearbeitung des 3. Teils von Shakespeares »Henry VI« (um 1591).6
In Deutschland machte Schiller die deutsche Version in seinen
»Räubern« bekannt, in denen er den Räuberhauptmann Moor
im »Römerlied« über Caesar und Brutus singen läßt: »O ein
Todesstoß von Brutus Schwerte! / Auch du - Brutus - du?«7
Heute ist die Floskel seltener ein echter Entsetzensruf als ein
scherzhaft gemeinter Ausdruck des Erstaunens. In
humoristischer Abwandlung des Zitats sagt man gelegentlich von seinem
zu geringen Lohn oder Gehalt: »Auch du, mein Lohn brutto!«
L: Bartels 74; Böttcher 65-66 (Nr. 339); Büchmann 369; Duden 11,133 und 12,50;
Grimm 1,599; Macrone 178; Reichert 75-76.1: 47 v. Chr. übertrug Caesar dem Brutus
die Provinz Callia Cisalpina, ließ ihn 44 zum Prätor wählen und stellte ihm für 41 das
Konsulat in Aussicht. 2: Suet. Caesar 82,2: »Auch du, mein Kind (Kai a\) tekvov)?« 3:
Cass. Dio 44,19,5. 4: Suet. Caes. 50. 5: 3. Akt, 1. Szene. 6: Macrone 178. 7: Räuber 4.
Akt, 5. Szene, 4. Strophe. S: Engl, wird nach Shakespeare gern lat. zitiert: »Et tu, Brüte?«
(üt. siehe bei Mieder, Investigations 40).
EIN AUFGEBLASENER FROSCH
Angeber, dünkelhafter Mensch. Auch nur: aufgeblasen, für
angeberisch, überheblich, dünkelhaft. -♦ Vor Neid platzen:
äußerst neidisch sein.
Während das einfache »aufgeblasen« für »angeberisch,
hochtrabend« bereits alttestamentlich ist,1 geht der »aufgeblasene
Frosch« auf den lateinischen Fabeldichter Phaedrus (frühes 1. Jh.
n. Chr.) zurück: In dessen Fabel »Der geplatzte Frosch und der
Ochse« (»rana rupta et bos«)2 bläst sich ein Frosch vor Neid auf
die Größe des Ochsen so lange auf, bis er platzt: »Als er zuletzt in
vollem Zorne noch versuchte, / Sich mehr zu blähen, stürzt' er
mit zerplatztem Körper.«
In Anspielung auf diese Geschichte hat der Epigrammdichter
Martial auch die lateinische Redewendung »invidia rumpere«
(-* vor Neid platzen) geprägt,3 die wörtlich ins Deutsche
übernommen worden ist. Mit den Worten »Sie bläst sich auf wie ein
Frosch« beschwert sich in Petrons »Satyrica« der neureiche
Trimalchio über seine undankbare Frau Fortunata und sagt ihr
damit indirekt, daß sie doch keine Chance hat, ihm an Größe
23
gleichzukommen (mehr über diese Fortunata unter -> jemanden
in den Himmel heben).4
Immanuel Kant definierte im 18. Jh. sachlich: »Der
Aufgeblasene ist ein Hochmütiger, der Verachtung anderer in seinem
Verhalten äußert.«5 Umgangssprachlich existieren heutzutage
neben dem »aufgeblasenen Frosch« auch gleichbedeutende
Abwandlungen wie »aufgeblasenes Nachthemd« oder
»aufgeblasener Fatzke«.
L: Böttcher 78 (Nr. 445); Büchmann 338-339; Duden 11,502; Otto 294 (Nr. 1504);
Wander 1,159. 1228-1232 (Frosch 4. 71f.). 1: Belege bei Grimm 1,652. 2: Phaedr. 1,
24. 3: Martial. 9,97 (zwölfmal in 6 Distichen); auch Martial. 10,79,9 und Hör. s.
2,3,314-320 spielen auf die Fabel an. 4: Petron. 74,13: »Inflat se tamquam rana.«
5: Kant 7,431 nach Grimm 1,652.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Etwas wird zwar später, aber doch mit Sicherheit
nachgeholt; (drohend:) die Strafe / die Abrechnung kommt noch.
Variante: Besser aufgeschoben als aufgehoben.
Der lateinische Schriftsteller und Mönch Arnobius d. J. (um
430) schreibt in seinem Kommentar zum 36. Psalm: »Was
aufgeschoben wird, wird nicht aufgehoben« (lat.: »Quod differtur,
non aufertur«).1 Der gleiche Auslaut der verwendeten Verben
»differtur/aufertur« ist in der deutschen Fassung, die
vermutlich ins Mittelalter zurückreicht, durch »-schoben/-hoben«
nachgebildet worden.
Der Grundgedanke erscheint jedoch schon im 1. Jh. bei dem
Philosophen Seneca, der sich in seinem Dialog Ȇber die
Vorsehung« der Frage widmet, warum das Unglück gute Männer zu
treffen und schlechte zu verschonen scheint: »Die also, die der
Gott gelten läßt, die er liebt, härtet er ab, prüft er, beschäftigt
er; die aber, denen er scheinbar gewogen ist, die er zu schonen
scheint, spart er ungehärtet für künftiges Unglück auf. Ihr irrt
nämlich, wenn ihr irgendeinen ausgenommen wähnt:
Kommen wird zu jenem lange Glücklichen sein angemessener Teil;
wer immer unbehelligt entlassen scheint, hat nur Aufschub
erhalten.«2 - Der Literaturkritiker und Philosoph Ludwig
Marcuse (1894-1971) hielt das Sprichwort für eine
Beschwörung durch Negation: »aufgeschoben ist nicht aufgehobene
weil man es besser weiß, verneint man die Problematik des
Aufschiebens emphatisch.«3
24
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
L: Böttcher 89 (Nr. 516); Büchmann 350; Duden 11,58 und 12,57; Fritsch 473; Grimm
1,720; Mletzko 11; Otto 114 (Nr. 540); Wander 1,164 (Aufschieben 2-3). 1: PL53,375.
2: Sen. dial. 1,4,7: »...quisquisvideturdimissusesse, dilatusest.« 3: Mieder, Antisprich-
wörter 7 mit Beleg. B: Engl. »All is not lost, that is delayed«; frz. »Ce qui est differe n'est
pas perdu«; ndl. »Uitstel is geen afstel«.
Aus den Augen, aus dem Sinn!
Entfernung schwächt Bekanntschaft und Freundschaft,
ohne persönliche Begegnungen reißt der Kontakt ab; was
man nicht mehr sieht, daran denkt man nicht mehr. Auch:
Aus den Augen, aus dem Herzen.
Lateinisch erscheint diese Wendung bei dem Dichter Properz,
der auf einer Reise nach Athen von seiner Geliebten Cynthia
getrennt ist und sich damit über seine Sehnsucht
hinwegtröstet: »So sehr wie die Liebe aus den Augen geht, so weit wird sie
aus dem Sinn gehen.«1 Im Deutschen findet sich der Satz in
Luthers Sprichwörtersammlung in der Form: »Aus den Augen, aus
dem Herzen.«2 Der »Sinn« herrscht im zweiten Teil seit Goethe
vor, der dichtete: »Ja, aus den Augen, aus dem Sinn!«3
Die Redewendung wird heute zuweilen auch als praktische
Handlungsmaxime verwendet: Man soll sich von dem trennen,
wovon man emotional nicht mehr belastet werden möchte.
L: Duden 11,65; Grimm 1,795; Macrone 207; Mletzko 12. 110; Otto 250-251 (Nr.
1271); Reichert 131; Wander 1,170 (Auge 25-26). 1: Prop. 3,21,10: »Quantum oculis,
animQ tarn procul ibit amo/.« Vgl. Ov. ars am. 2,358; Prop. 1,12,11. Auf sinnähnliche
griechische Sprichwörter verweist Otto 250-251 (Nr. 1271). 2: Nr. 165 Dithmar. 3:
12,161 nach Grimm 1,795. S: Engl. »Out of sight, out of mind« (seit Mitte des 15. Jh.);
frz. »Loin des yeux, loin du coeur«; ital. »Lontano degli occhi, lontano dal cuore«; ndl.
»Uit het oog, uit het hart«; ung. »A mit a szem nem lelt, a sziv hamar felejt«.
vor Augen haben
deutlich wahrnehmen; etwas vor Augen stellen/halten/
führen: aufzeigen, klar machen; vgl. * ad oculos
demonstrieren: vor Augen führen, deutlich aufzeigen.
In seiner Schrift »Über den Zorn« beschreibt der Philosoph
Seneca die menschliche Neigung, sich über Fehler anderer zu
entrüsten, die eigenen aber nicht sehen zu wollen: »Die
fremden Fehler haben wir vor Augen [lat.: »in oculis«, eigentlich »in
den Augen«], unsere eigenen auf dem Rücken.«1 Er nimmt hier
vermutlich auf eine Fabel des Äsop Bezug, in der ein Mann
26
einen Sack mit fremden Fehlern auf der Brust, einen mit den
eigenen Fehlern aber auf dem Rücken trägt.2 Entsprechend
bedeutet noch das deutsche »vor Augen halten« (u. ä.) eine
bewußte Kenntnisnahme, die man bei anderen oder sich selbst
bewirkt.
Die heute kaum mehr gebrauchte Wendung »ad oculos
demonstrieren« enthält lat. »ad oculos« (»zu den Augen hin«)
und im Verb »demonstrieren« noch lat. »demonstrare«
(»aufzeigen«).
L: Bartels 196; Fritsch 225; Zanoner 1 3-14 (Nr. 83). 1: Sen. dial. 4,28,8: »Aliena vitia in
oculis habemus, a tergo nostra sunt.« Vgl. ep. 78,29. 2: Aisop. Nr. 228 Hausrath.
Augurenlächeln
überlegenes, überhebliches, spöttisches Lächeln (des
Wissens und Einverständnisses unter Eingeweihten über
Nichtwissen oder Leichtgläubigkeit der Menge); * Augur:
Prophet, Weissager.
Die Auguren (lat.: »augures«, Sg. »augur«) waren Priester, die
bei wichtigen Staatshandlungen durch Beobachtung von
Himmelszeichen (v. a. des Vogelfluges und des Freß- und
Schreiverhaltens der Vögel) den Willen der Götter erkundeten und dazu
in der Regel jedem hochrangigen Amtsträger als Assistenten
beigegeben waren. Bei der Einrichtung von Kulten grenzten sie
mit ihrem Krummstab den heiligen Bezirk für einen Tempel ab
und holten die Zustimmung der betreffenden Gottheit ein.
Dieser Kunst wurde schon früh von »aufgeklärten« Geistern
Argwohn entgegengebracht. Nach Cicero, der selbst das Amt
des Auguren bekleidete, habe sich Cato der Ältere »gewundert,
daß ein Haruspex [d.h. ein Priester, der aus Eingeweiden las]
nicht lache, wenn er einen [anderen] Haruspex sehe«1 - da er
doch wissen müsse, wie viel von ihren Vorhersagen nicht
eintreffe und wie sehr sie beide dem leichtgläubigen Publikum
etwas vormachen. Auf dieses Wort geht - unter Ersetzung der
Haruspices durch die Auguren - das überlegene
»Augurenlächeln« unter Eingeweihten zurück.
L: Büchmann 367-368; Böttcher 63 (Nr. 319); Duden 12,60; Reichert 80-82. 1: Cic.
div. 2,24,51: »mirari se aiebat, quod non rideret haruspex, haruspicem cum vidisset.«
Vgl. Cic. nat. 1,26,71.
27
* EIN AUGUSTEISCHES ZEITALTER
eine Zeit, in der Kunst und Literatur sehr gefördert werden.
Nach dem verheerenden Zeitalter der Bürgerkriege brachte die
lange Regierungszeit des Kaisers Augustus (31 v. - 14 n. Chr.)
eine lange Phase des Friedens und der Stabilität (-> pax Augu-
sta), die zugleich als kulturelle Blüte erlebt wurde. In der
Literatur ist sie durch das Wirken namhafter Dichter wie Vergil,
Horaz und Ovid unter dem Schutz ebenso namhafter Gönner
(-> Mäzen) gekennzeichnet. Gleichzeitig ließ Augustus Rom zur
prachtvollen Hauptstadt eines Weltreiches ausbauen. Zu den
teilweise noch heute erhaltenen Bauten jener Zeit gehören das
Forum Augustum, das Marcellustheater und vor allem die Ära
Pacis als Teil eines umfangreicheren Baukonzeptes für das
Marsfeld.
L: Duden 11,69.
UNTER DEN AUSPIZIEN DES/VON ...
unter jemandes Einfluß/Schutz/Schirmherrschaft.
Staatsakte aller Art durften in Rom nur vorgenommen werden,
wenn zuvor die Auspizien eingeholt wurden. Darunter
verstand man die Gesamtheit der Vorzeichen, die die Zustimmung
oder Ablehnung der Götter zu der beabsichtigten Handlung
erkennen ließen.1 - Die praktische Durchführung und Deutung
der Auspizien war Sache der Auguren (-» Augurenlächeln), die
Verantwortung für die Einholung der Auspizien oblag aber dem
jeweils zuständigen Beamten. Wenn es Zweifel darüber geben
konnte, welchem von mehreren Beamten hinterher der Lohn
für eine Tat zuzuerkennen war (etwa in Form eines -♦
Triumphes nach einem militärischen Sieg), so kam es darauf an,
welcher Beamte die Auspizien eingeholt hatte. Führten zum
Beispiel beide Konsuln im Krieg gemeinsam das Kommando, so
wechselten sie sich täglich mit der Einholung der Auspizien ab.
Wurde eine Schlacht gewonnen, triumphierte der Konsul, der
an diesem Tag die Auspizien eingeholt hatte. In der Kaiserzeit
wurde es üblich, daß sämtliche Feldzüge unter den Auspizien
des Kaisers stattfanden und somit auch sämtliche Triumphe
dem Kaiser zufielen.
28
Entsprechend deutet die Redensart »unter den Auspizien«
an, daß die genannte Person an der Initiierung eines Projektes
beteiligt war, Leitlinien vorgegeben hat und an den
Verdiensten Anteil hat, ohne aber zur praktischen Arbeit nennenswert
beigetragen zu haben.
L: Otto 50 (Nr. 223). 1: »Bono auspicio« (»unter gutem Vorzeichen«) war entsprechend
als Redewendung üblich: Hieron. praefat. in reg. Pachom. (col. 53 Vall.): »(ut) et bono,
quod aiunt, auspicio longum silentium rumperem« (»und um unter gutem Vorzeichen,
wie man sagt, ein langes Schweigen zu brechen«).
B
auf der Bärenhaut liegen
faulenzen; * Bärenhäuter: Faulenzer; * bärenhäuterisch:
faul, tatenlos; * Die Bärenhaut ist sein Unterbett / * Er muß
die Bärenhaut umhängen: er führt ein tatenloses Leben.
Diese Redensart geht auf das Geschichtswerk »Germania« des
Historikers Tacitus (um 55- nach 115) zurück, in dem dieser
über die Germanen schreibt: »Immer wenn sie nicht auf
Kriegszüge gehen, bringen sie nicht viel Zeit mit Jagden zu, mehr
dagegen mit Nichtstun, dem Schlaf und dem Essen hingegeben,
wobei gerade jeder Tapferste und Kriegerischste nichts
betreibt...«1
Die Schrift wurde Anfang des 16. Jh. in humanistischen
Kreisen neu entdeckt und rezipiert. Daß die alten Germanen bei
ihrem Nichtstun auf der »Bärenhaut« gelegen hätten, ist
allerdings zuerst 1509 bei Heinrich Bebel in seinen Facetien (1509),
dann im Tagebuch des Ritters Hans von Schweinichen (1579)
und in Johann Fischarts »Geschichtsklitterung« (1575) belegt.
Die aus diesem Motiv abgeleitete Bezeichnung »Bärenhäuter«
für einen Faulenzer und Taugenichts war seit dem 16. bis ins
29
18. Jh. sehr gebräuchlich.2 Zum Beispiel sagt Basko in Goethes
Schauspiel »Claudine von Villa Bella«: »Ich, der ich sonst
herumschwärme den ganzen Tag und plane wie ein Raubvogel,
muß heut den ganzen Nachmittag hier auf der Bärenhaut
liegen.«3 Bei den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm ist der
Titelheld des Märchens »Der Bärenhäuter« (Nr. 101) ein armer
Soldat, der selbst in der Hölle nicht zu gebrauchen ist und
fortgeschickt wird.
Zur weiteren Verbreitung hat im 19. Jh. das Studentenlied von
»Tacitus und den alten Deutschen« beigetragen, das Wilhelm
Ruer 1872 für die Bierzeitung der Leipziger Burschenschaft Dres-
densia schrieb4 und in dem es heißt: »An einem Sommerabend, /
Im Schatten des heiligen Hains, / Da lagen auf Bärenhäuten / Zu
beiden Ufern des Rheins / Verschiedene alte Germanen /... / Sie
liegen auf Bärenhäuten / Und trinken immer noch eins.«
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 52; Böttcher 393 (Nr. 2548); Duden 11,84 und
12,53; Grimm 1,1128; Röhrich 1,148-149. 1:Tac. Germ. 15: »Quotiens bella non ine-
unt, non multum venatibus, plus per otium transigunt, dediti somno ciboque, fortissi-
mus quisque ac bellicosissimus nihil agens...« 2: Vgl. die Belege bei Grimm 1,1128. 3:
Goethe 38,137 WA. B: August von Kotzebue, »Bäbbel oder aus zwei Übeln das kleinste.
Historische Posse in Einem Akt« (Werkausgabe Stuttgart 1822), Bd. 7,51 (Seine Frau
Suse zu dem Zollvisitator Bäbbel, der sie als seine Frau gerade verleugnet hat): »Na du
Bärenhäuter! Sind wir endlich allein, daß ich meine Wuth an dir auslassen kann!« Sim-
plicissimus 1,256; 2,81: »auf der faulen Bärenhaut liegen«; Scherzhaft jean Paul, Titan
1,43: »...ebenso sind unsere Statuen keine müßigen Staatsbürger auf der Bärenhaut.«
Weiteres findet sich ausführlich bei Röhrich 1,148-149. 4: In: Fliegende Blätter Nr.
56,1872.
Basiliskenblick
vernichtender, stechender, tötender Blick. Basiliskeneier
ausbrüten: sich Böses ausdenken, Schlimmes im Schilde
führen; Basiliskenei: Geschenk, das in böser Absicht
gegeben wird.
Der Basilisk (lat.: »basiliscus«) ist ein fabelhaftes Mischwesen
aus Schlange, Drache und Hahn mit giftigem Atem, das von
einer Schlange oder Kröte aus einem Hühnerei ausgebrütet
wird. Üblicherweise wird er als Hahn mit einem
Schlangenschwanz dargestellt, wie sich dies zuerst im Alten Orient
findet. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere berichtet im
1. Jh. n. Chr. in seiner »Naturgeschichte«, daß der Basilisk, von
einer Kröte aus einem Hühnerei ausgebrütet, einen Menschen
30
allein durch seinen Blick töten könne.1 Entsprechend
charakterisiert der Historiker Ammianus Marcellinus den kaiserlichen
Günstling Flavius Maximinus, der 370/371 römischer Präfekt
für die Getreideversorgung war, als »schädlich wie
Basiliskenschlangen«.2 Die Vorstellung der gefährlichen Basiliskeneier
geht dagegen auf Jes. 59,5 zurück: »Sie [d. h. die Bösen und
Trügerischen] brüten Basiliskeneier und wirken Spinnweben. Ißt
man von ihren Eiern, so muß man sterben; zertritt mans aber,
so fährt eine Otter heraus.«3 Über Kirchenväter und Tierbücher
des hohen Mittelalters hielt sich das Basiliskenmotiv noch bis
ins 17. Jh.; in neuester Zeit erlebt der Basilisk als Fabelwesen im
Fantasy-Bereich eine Art Auferstehung.
Heute verwendet man den Begriff des »Basiliskenblickes«
noch, wenn jemand einen stechenden oder unheimlichen
Blick hat, der nichts Gutes erwarten läßt.
L: Büchmann 340; Duden 12,64-65; Otto 53 (Nr. 240). 1: Plin. nat. 29,66; vgl. seine
Beschreibung in 8,78. 2: Amm. 28,1,41: »nocens ut basilisci serpentes«. 3: Vgl. die
Höhle des Basilisken in jes. 11,8.
Ein voller Bauch studiert nicht gern
Sättigung verhindert das Nachdenken; wer geistige Arbeit
verrichten will, sollte den Körper nicht verwöhnen.
Die ebenfalls gern benutzte lateinische Reimfassung »plenus
venter non studet libenter« ist wohl mittelalterlich und in ihrer
Entstehung nicht nachweisbar. Das Motiv jedoch hat seinen
Ursprung in einem griechischen Tragikervers von ähnlicher
Bedeutung: »Ein dicker Bauch bringt keinen feinen Sinn hervor«
(griech.: riaxeia yaotfip tenxöv ay xiKiei vöov, sprich: pachgia
gastär lgpton u tiktei noQn)1. Der Kirchenvater Hieronymus
übertrug dies um 400 n. Chr. wortgetreu ins Lateinische:
»Pinguis venter non gignit sensum tenuem.«2 Das Phänomen des
Essens, das den Geist behindert, war aber auch anderen
lateinischen Autoren geläufig. So lesen wir z. B. bei Horaz: »Beladen
drückt mit den gestrigen Lastern der Leib auch nieder die Seele,
schmiedet am Erdboden an sein Teilchen des göttlichen
Geistes.«3 Ebenfalls von Hieronymus stammt übrigens der Satz
»Ein voller Bauch lobt das Fasten« (lat.: »Plenus venter facile de
ieiuniis disputat«)4 - während es dem leeren bekanntlich nicht
ganz so leicht fällt.
31
L: Bartels 138-139; Duden 11,86; Fritsch 404; Mletzko 14. 31. 76. 117. 134; Otto
363-364 (Nr. 1860-1861). 1: Ohne Herkunftsangabe bei Galen, Utrum medicinae sit
an gymnastices hygieine 5,878 Kühn; nach Otto 363 (Nr. 1860) geht dies auf ein
Sprichwort zurück, vgl. Apost. 5,22A ( CPC 2,337). 2: Hör. s. 2,2,76-78; vgl. Sen. ep.
15,3. 3: Hieron. ep. 52,11: »Auf schöne Weise sagt man bei den Griechen - und ich
weiß nicht, ob es bei uns angemessen klingt -: >Ein fetter Bauch bringt keinen feinen
Sinn hervor.<« (»pulchre dicitur apud Graecos et nescio an apud nos aeque resonet:
>Pinguis venter non gignit sensum tenuenv«); vgl. Schol. Pers. 1,56. 4: Hieron. ep. 58,2
nach Otto 364 (Nr. 1861).
über den Berg sein
das Schlimmste hinter sich haben, eine Krise überstanden
haben.
Der Berg oder Hügel wurde schon von den Römern als Sinnbild
für eine Mühe oder Schwierigkeit verwendet. »Mitten auf der
Anhöhe« zu schwitzen oder sich abzumühen waren
Wendungen für eine noch lange nicht überwundene Anstrengung.1 Der
Philosoph Seneca kritisiert in einem Brief den angestrengten
Eifer bei Unwichtigem, zollt aber dem um Ehrenhaftes
Bemühten solchen Respekt, daß er zu ihm sagt: »Steh auf, hol Atem
und überwinde diese Anhöhe (d. h. diese Schwierigkeit) in
einem einzigen Atemzug, wenn du kannst!«2 Der Dichter Silius
Italicus spricht mit demselben Bild Ende des 1. Jh. n. Chr. von
der »Tugend, die vor der Anhöhe unerschrocken ist«.3
Im Deutschen begegnet in diesem Sinne ein ȟber den Berg
kommen« oder »über den Berg sein« zuerst bei Luther: »Wir
bleiben dennoch leider allzu faul und laß und sind noch nicht
mit jenen 99 Gerechten4 so fern über den Berg kommen, als sie
sich lassen dünken.«5 Da bei der Mühe an eine eilige Flucht
gedacht werden kann, entstand die ebenfalls seit Luther belegte
Redewendung »über alle Berge sein« oder »über Berg und Zaun
sein« im Sinne von »entkommen sein«.6
L: Duden 11,99; Grimm 1,1505; Mletzko 16 mit falscher Zitierung Senecas; Otto 86
(Nr. 399). 1: Ov. her. 20,41: »Tausend Tücken sind übrig, wir schwitzen noch ganz
unten auf der Anhöhe« (»Mille doli restant, cIi'vq sudamus in imo«); Petron. 47,8: »Und
wir wußten bis dahin noch nicht, daß wir uns bei den (Tafel)freuden erst, wie man sagt,
mitten auf der Anhöhe mühten« (»nee adhuc sciebamus nos in medio lautitiarum, ut ai-
unt, clivo laborare«). 2: Sen. ep. 31,4: »clivum istum uno, si potes, spiritu exsupera.« 3:
Sil. Ital. 4,604: »virtus interrita clivo«. 4: Nach Lk. 15,7 diejenigen, die glücklicherweise
keine Umkehr nötig haben und über die im Himmel weniger Freude sein wird als über
einen einzigen bekehrten Sünder. 5: Luther 4,435a nach Grimm 1,1505; vgl. 5,90a.
6: Diverse Belege von Luther bis Goethe bei Grimm 1,1505.
32
Neue Besen kehren gut
jemand ist besonders eifrig, wenn er in seinem
Aufgabengebiet neu ist.
Bei diesem mittelalterlichen Sprichwort ist schwer zu
entscheiden, ob es lateinischen oder deutschen Ursprungs ist: Zuerst
belegt ist es in lateinischer Form in den Seftlarner Sprüchen des
12. Jh., doch mag es sich dort um die Übersetzung eines schon
früher bestehenden deutschen Satzes handeln.1 Die deutsche
Fassung erscheint zuerst in der »Bescheidenheit« Freidanks (um
1200), einer Spruchsammlung zur Unterweisung und Urteils-
findung zwischen Gut und Böse: »Der niuwe beseme kert wol, /
e daz er stoubes werde vol« (»Der neue Besen kehrt gut, auf daß
er des Staubes werde voll«).2 Der Dichter Hans Sachs erwähnt
das Sprichwort im 16. Jh.: »Wie das alt Sprichwort sagen sol, die
newen Besen kehren wol.«1 Seitdem ist der Satz im Deutschen
sehr geläufig.
L: Böttcher 164-165 (Nr. 1010); Duden 11,101; Grimm 1,1615; Mletzko 17. 88;
Wander 1,323-324 (Besen 33). 1: Samuel Singer, Sprichwörter des Mittelalters, Bern 1944,
S. 18-19. Die üblicherweise zitierte lateinische Form lautet: »Scopae recentiores semper
meliores.« 2: Vom Dienste 50,12f. 3: Hans Sachs 5,358a nach Grimm 1,1615. B: »Neue
Besen aber kehren gut, und Konvertiten übertreffen die Altgläubigen zumeist an Eifer«
(Werfel, Himmel 164, nach Duden 11,101). S: Engl.: »New brooms sweep clean«
(Mieder, Proverbs 20).
BESSER SEIN ALS SEIN RUF
besser sein als man allgemein glaubt.
»Selbst besser als ihr Ruf« (lat.: »ipsa sua melior fama«) sagt der
römische Dichter Ovid in einem Brief aus seinem
Verbannungsort;1 er meint damit Claudia Quinta (wohl Enkelin des
Zensors Appius Claudius Caecus), der es durch ihre
maßgebliche Teilnahme am feierlichen Empfang des Standbildes der
Göttin Kybele im Jahre 204 v. Chr. gelang, ihren äußerst
schlechten Ruf in der römischen Gesellschaft wieder zu
heben.2
Die Wendung taucht im 18. Jh. wieder auf bei Beaumarchais
(»Und wenn ich nun besser wäre als mein Ruf?«),3 Goethe4 und
Schiller: Maria Stuart, die ihre Rivalin Elisabeth vergeblich zu
rühren sucht (-> ein Schatten seiner Selbst sein), bricht »von
Zorn glühend, doch mit edler Würde« in die Worte aus: »Das
33
Ärgste weiß die Welt von mir, und ich / Kann sagen, ich bin
besser als mein Ruf.«5
L: Böttcher 364 (Nr. 2342); Büchmann 336; Duden 12,70-71; Grimm 1,1645 Nr. 3. 1:
Ov. ex Pont. 1,2,141. 2: RE 3,2,2899 Nr. 435; Liv. 29,14,12. 3: Hochzeit des Figaro,
1784, 3, 5: »Et si je vaux mieux quelle?« 4: »Dichtung und Wahrheit«, Ende von Buch 7.
5: Maria Stuart (1801; uraufgeführt Weimar 14.6.1800), 4,4 V. 2425-2426.
Bete und arbeite!
(lat. Qra et labgra!) Sei gottesfürchtig und tu deine Arbeit!
Diese Aufforderung wird üblicherweise auf den Mönch
Benedikt von Nursia (480 - nach 543) zurückgeführt, der um 530
das Kloster Monte Cassino gründete, mit dem
Benediktinerorden eine Neuorganisation des Mönchswesens schuf und so die
Grundlage zu dessen Blüte bis ins hohe Mittelalter legte. In
seiner »Regel« (Regula Benedicti) verpflichtete er die Mönche zu
Seßhaftigkeit in einem Kloster, Verzicht auf Eigentum,
Keuschheit, Gehorsam und Arbeit. Die körperliche Arbeit wird hier als
Mittel zur Erlösung und als sittliche Rechtfertigung von
Eigentum positiv bewertet. Zugleich setzte Benedikt durch die
Einführung des Arbeitsgebotes das westliche Mönchtum vom
bereits bestehenden östlichen Mönchtum ab, das eine derart
strenge Regelung der Lebensführung nicht kannte und damit
häufig den Vorwurf auf sich zog, die Mönche seien eigentlich
nur Nichtstuer und Faulpelze. Besonders in der
Geschichtsschreibung ist das Motto daher zum Symbol des gesamten
westlichen Mönchtums geworden.1 Sehr schnell gewann in
den Benediktinerklöstern die geistige neben und zum Teil auch
statt der körperlichen Arbeit große Bedeutung, so daß die
Benediktiner - und in ihrem Gefolge nahezu alle Mönchsorden -
durch wissenschaftliche Betätigung große Wirkung in der
europäischen Kultur ausübten.
Der Satz »Ora et labora!« kommt in der Benediktinerregel
allerdings weder wörtlich noch sinngemäß vor, so daß es sich
dabei um eine einprägsame Schöpfung aus weit späterer Zeit
handeln dürfte. Komplett lautet das Motto: »Ora et labora! Deus
adest sine mora« (»Bete und arbeite! Gott hilft ohne Unterlaß«)
oder im zweiten Teil variiert zu »Nam mors venit omni hora«
(»Denn der Tod kommt in jeder Stunde«) oder »Dabit Deus om-
nia bona« (»Gott wird geben alle Güter«).2 Die Herkunft ist
34
letztlich unbekannt, doch ist der Reim »ora - labora - mora/
hora/bona« für mittelalterliche Dichtung typisch.
In seiner ursprünglichen Anwendung enthält der Rat »bete
und arbeite« die Aufforderung, nichts ohne Gott zu tun, aber
auch nicht alles ihm zu überlassen. »Bete und arbeite« wird
heute aber auch bisweilen als »Totschlagsatz« mißverstanden
und verwendet, um damit kurz und bündig jede Kritik oder
eigene Meinungsäußerung zu unterdrücken. Eine
ironischbissige Anwendung des Wortes findet sich bei Werner Mitsch:
»Beten und arbeiten. Oder wie wir Theoretiker sagen: Beten
und arbeiten lassen.«3
L: Böttcher 159 (Nr. 981 -982); Duden 12,378-379; Mletzko 9. 18; Tosi 427 (Nr. 913);
Wander 1,341 (Beten 11). 1: Tosi 427 (Nr. 913). 2: Tosi 427 (Nr. 913). 3: Mieder, Anti-
sprichwörter 12 mit Beleg.
frommer Betrug
Betrug, der in guter Absicht geschieht; auch:
Selbsttäuschung.
In seinen Verwandlungsgeschichten (»Metamorphosen«)
erzählt der römische Dichter Ovid von einem Kreter, der
beschlossen hatte, sein Kind, wenn es eine Tochter würde, zu
töten. Daraufhin gab die Göttin Isis der schwangeren Telethusa
den Rat, ihre neugeborene Tochter als Sohn auszugeben, um sie
vor der Tötung zu bewahren. Man benannte das Neugeborene
nach dem Großvater »Iphis«, und auch weiterhin »blieb die
begonnene Täuschung durch frommen Betrug verborgen«.1 Das
Kind wurde gerettet und von der Göttin später überdies in
einen Sohn umgewandelt. »Fromm« (»pius«) ist dieser Betrug, da
er göttlichem Rat und darüber hinaus dem gebührenden
Respekt (»pietas«) entspricht, den die Römer im Verhältnis
zwischen Kindern und Eltern betonten.
Die Verbindung erscheint dann wieder Ende des 5. Jh. bei
dem Dichter Dracontius.2 Ebenfalls im ursprünglichen Sinne
verwendete Verdi im letzten Akt von »La Traviata« (1853) eine
ähnliche Wendung: »Die fromme Lüge der Ärzte ist
eingestanden« (»La bugia pietosa a' medici e concessa«). Im Deutschen
ist dagegen fast häufiger - wohl unter dem Einfluß der ->
»frommen Wünsche« - ein Selbstbetrug gemeint, wie etwa bei
Ernst Niekisch: »Die hundert Meter, die Brüning sich vor dem
35
Ziel der Tributbefreiung glaubte, waren entweder ein frommer
Betrug oder eine lächerliche Phantasterei.«3
L: Bartels 138; Böttcher 77 (Nr. 437-438); Büchmann 335; Duden 11,106 und 12,167;
Mletzko 18. 37; Tosi 114 (Nr. 246). 1: Ov. met. 9,711: »jnde incgpta pia mendacia
fraude latgbant.« Der Zusammenhang erscheint Ende des 5. jh. 2: Orestis tragoedia 12.
3: Gewagtes Leben, Köln 1958, S. 197 nach Duden 11,106.
BIENENFLEISS
unaufhörlicher Fleiß.
Der »Fleiß« der Bienen war schon den Römern ein Begriff. Der
Dichter Horaz vergleicht sich in einem seiner Gedichte mit
einer rastlosen Biene: »Ich aber, nach Art und Weise einer Biene
vom Matinus [einem Berg in Süditalien], die angenehmen
Thymian mit sehr viel Mühe sammelt, um den Hain und die Ufer
des feuchten Tibur herum, bilde bescheiden arbeitsreiche
Gedichte.«1 Auch Seneca meint: »Die Bienen müssen wir
nachahmen«, jedoch weniger wegen ihres bloßen Fleißes, sondern
weil sie »umherfliegen und die zur Honiggewinnung
geeigneten Blüten aussaugen und dann, was sie eingebracht haben,
ordnen, auf die Waben verteilen und, wie unser Vergil sagt,
flüssigen Honig anhäufen und mit süßem Nektar füllen die
Zellen« - ebenso solle man als Schriftsteller nicht in der Lektüre
anderer Werke nachlassen, sondern aus ihnen schöpfen und
sich zu eigener Produktion anregen lassen; die Worte »Die
Bienen nachahmen« kennzeichnet Seneca dabei in einem
Nebensatz bereits damals als sprichwörtliche Wendung.2
L: Grimm 1,1818; Otto 30 (Nr. 128); Reichert 92.1: Hör. carm. 4,2,27-32: »...egoapis
Matinae / mo/e modQque, / grata carpentis thyma per labo/em / plu.rimy.rn, circa ne-
mus uvidique / Tiburis ripas opergsa parvos / carmina fingo.« 2: Sen. ep. 84,3: »Apes,
ut aiunt, debemus imitari, [»Die Bienen müssen wir, wie man sagt, nachahmen«] quae
vagantur et flores ad mel faciendum idoneos carpunt, deinde quicquid attulere, dis-
ponunt ac per favos digerunt et, ut Vergilius noster ait, >liqugntia mejla / stipant et dulcj
diste/idunt ngctare cellas<.«
Das sieht sogar ein Blinder!
Etwas ist ganz offenkundig oder eindeutig
(umgangssprachlich auch: Das sieht doch ein Blinder [mit
Krückstock]).
Livius schildert in seinem Geschichtswerk »Ab urbe condita«
36
(»Von der Stadtgründung an«) die lebhaften Verhandlungen
zwischen Philipp V. von Makedonien und den auf römischer
Seite kämpfenden Ätolern während des 2. Makedonischen
Krieges (200-197 v. Chr.). Philipp habe dabei auf den heftigen
Einwurf, es komme nicht auf Worte, sondern auf Sieg oder
Niederlage an, zustimmend angemerkt: »Das ist sogar einem
Blinden offenkundig«1 - womit er in sarkastischer Weise auf das
Augenleiden des Atolischen Bundeshauptmanns anspielte. Die
Wendung hat griechische Vorbilder und begegnet später auch
bei anderen lateinischen Autoren.2
L: Böttcher 76 (Nr. 429); Duden 11,11 7; Mletzko 19. 109; Otto 60 (Nr. 276). 1: Liv.
32,34,3: »Apparet id quidem ... etiam caeco.« 2: Quint. inst. 12,7,9; Boeth. consol.
phil. 3,9. Griech. Vorlagen nennt Otto 60 (Nr. 276).
Blut, Schweiss und Tränen vergiessen
sich mit Kampf, Anstrengungen und auch mit
schmerzlichen Verlusten für etwas einsetzen.
Der britische Premierminister Winston Churchill (1874-1965)
sagte am 13. Mai 1940, drei Tage nach dem deutschen
Einmarsch in Belgien, in seiner Antrittsrede vor dem Unterhaus:
»Ich möchte dem Haus sagen, wie ich zu den Mitgliedern dieser
Regierung gesagt habe: Ich habe nichts zu bieten als Blut,
Mühe, Tränen und Schweiß.«1 Diese Schlagworte wurden in der
deutschen Zitierung meistens zu »Blut, Schweiß und Tränen«
verkürzt und als Redensart für das Durchstehen äußerster
Gefahr oder Anstrengung gebräuchlich. Allerdings wird hier auf
weit ältere Begriffsverbindungen zurückgegriffen: »Blut und
Schweiß« findet sich bereits häufig bei lateinischen Autoren:
Der Dichter Ennius z. B. spricht in einem Vers von »Beute ohne
Schweiß und Blut«2 oder Cicero von einer »mit sehr viel
Schweiß und Blut erworbenen Freiheit«;3 die »Tränen«
begegnen ebenfalls im Zusammenhang mit Anstrengungen, werden
aber mehr noch durch Ängste und Befürchtungen
hervorgerufen.4 Offenbar dienten all diese Körperflüssigkeiten dazu, die
äußerste Anforderung an den Menschen in einer
Krisensituation zu illustrieren - insbesondere das Blut, in das die Tränen
oder Schweißperlen geradezu übergehen. Entsprechend gibt es
auch im Deutschen schon früh die Wendungen »Blut weinen«
und »Blut schwitzen«.5 Die Verbindung »Blut und Tränen«
37
prägte dann 1928 der Historiker Treitschke.6 Doch wurde sie
erst durch Churchill erweitert und allgemein bekannt gemacht.
Sie wird immer noch gern in Zusammenhängen gebraucht, die
einem Einzelnen oder einer Gruppe höchsten Einsatz
abverlangen.
L: Böttcher 551 (Nr. 3630) und 647-648 (Nr. 4193); Büchmann 397; Duden 12,80;
Grimm 2,1 71; Otto 334 (Nr. 1708); Röhrich 225.1: »I would say to the House, as I said
to those who have joined this Government: I have nothing to offer but blood, toil, tears
and sweat«; in: Reden 1938/1940 [Into Battle, dt.], gesammelt von Randolph S.
Churchill, Zürich 1946, Bd. 1, S. 321; W. L Churchill, His Complete Speeches
1897-1963, Bd. VI, New York, London 1974, S. 6220; nach Büchmann 397. 2: Enn. bei
Cic. off. 1,18,61: »(Salmacida) spolia [»Beute eines Salmakiden«, d.h. eines Feiglings]
sine sudore et sanguine.« 3: Cic. de leg. agr. 2,6,16: »plurimo sudore et sanguine...
partam... libertatem«. Weitere Beispiele bietet Otto 334 (Nr. 1708). 4: Beispielsweise
Sen. ep. 99,11,2. 5: Belege bei Grimm 2,171. 6: In der an Max Duncker gerichteten
Vorrede zum 1. Band der »Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert«, Leipzig 1928,
S. IX nach Böttcher 551.
IM GLEICHEN BOOT SITZEN
gemeinsam in einer schwierigen Lage sein (meist mit
negativem Beiklang: Wenn einer kentert [scheitert], kentert der
andere mit ihm); auch allgemeiner: aneinander gebunden
sein, die gleichen Interessen haben; mit im Boot sitzen:
einen Anteil an etwas haben. Vgl. dasselbe Bild in: Das Boot
ist voll: es ist kein Platz mehr; jemanden in sein Boot
kriegen: von der eigenen Meinung überzeugen, als Mitstreiter
gewinnen; im richtigen Boot sein: richtig liegen (Gegenteil:
auf dem falschen Dampfer sein).
In einem Brief an Gaius Curio schrieb der Politiker und Redner
Cicero im Jahre 53 v. Chr. (wohl in Anspielung auf sein
schlechtes Verhältnis zu Pompeius): »Wie die Dinge hier
stehen, wage ich nicht einmal einem Briefe anzuvertrauen. Du
befindest dich freilich, wie ich Dir neulich schon schrieb, auf
demselben Schiff, magst du sein, wo du willst...«1 Das
lateinische »in eadem navi esse« (oder auch: »in eodem navigio
esse«)2 entspricht damit schon genau der heutigen deutschen
Verwendung.
Die Metapher »desselben Bootes« hängt eng mit der auf die
Griechen zurückgehenden Vorstellung vom Staatsschiff als
einer Interessen- oder Notgemeinschaft zusammen. Roger Bacon
formulierte um 1594 die englische Version mit »you are in the
38
same shippe« und später »We're in the same boat«, woraufhin
»dasselbe Schiff« ganz verdrängt wurde. Die französische
Version »etre dans le meme bateau« erscheint seit im 20. Jh., die
deutsche Entsprechung erst nach dem 2. Weltkrieg. Sie wird
gern abgewandelt oder ironisiert, wie etwa auf folgende Weise:
»Wir sitzen alle in einem Boot, sagen die Politiker, wenn sie ans
Ruder wollen.«3
L: Duden 11,124; Grimm 2,237-238; Macrone 132; Mletzko 20; Otto 239 (Nr. 1206);
Röhrich 1,240-242. 1: Cic. fam. 2,5,1: »etsi ubicumque es, ut scripsi ad te ante, in ea-
dem es navi...« 2: Liv. 44,22,25: »qui in eodem velut navigio participes sunt periculi.«
3: Röhrich 1,241. B: Verschiedene Gedichte, Aphorismen und Karikaturen bietet
Röhrich 1,241-242. S: Engl, »to be (all) in the same boat« (Lit. dazu bietet Mieder, Investi-
gations 31); frz. »etre dans le meme bateau«.
Brot und Spiele
Speisung und Unterhaltung.
Nach dem Satiriker Iuvenal (1. Jh. n. Chr.) forderte das
römische Volk stets nur »panem et circenses« - Brot und Spiele. Der
Dichter klagt: »Das (Volk), das einst den Oberbefehl, die
Rutenbündel, die Legionen, alles verlieh, hält sich jetzt zurück und
wünscht sich ängstlich nur noch diese beiden Dinge: Brot und
Wagenrennen.«1 Kritisiert wird aber nicht nur das Volk, das
sich von seiner Regierung alles gefallen läßt, wenn es nur
gespeist und unterhalten wird, sondern auch die Amtsträger, die
nur noch auf den Applaus der Masse schauen. Kostenlose
Getreideausgabe (»annona«) und Wagenrennen waren seit der
späten Republik übliche Mittel, sich bei der Masse der
Bevölkerung beliebt zu machen; da Italien sich nicht selbst versorgen
konnte, mußte aus Sizilien und Afrika stets zusätzliches
Getreide importiert werden, das in großen Speichern in Ostia und
Puteoli gelagert wurde. Kaiser Trajan sagte später, das römische
Volk werde »vor allem durch zwei Dinge gebannt: die
Getreideversorgung und die Schauspiele.«2 Ähnliche Kritik findet sich
aber schon früher für die Bevölkerung Alexandrias: »Aber was
soll einer zu der großen Masse der Alexandriner sagen, denen
man einzig und allein viel Brot hinwerfen muß und das
Schauspiel von Wagenrennen, da sie ja sonst an nichts Interesse
haben.«3
Dieser Einschätzung der Rolle der Circusspiele im
kaiserzeitlichen Rom steht allerdings die sich inzwischen dazu gesel-
39
lende Erkenntniss gegenüber, daß die Masse im Circus
keineswegs unpolitisch war, sondern der Circus in der Kaiserzeit das
Forum als Ort politischer Kommunikation abgelöst hat.4
Heute betont man mit der Redensart meistens die leichte
Kontrollierbarkeit der Masse durch beliebige Regierungen,
solange diese nur Nahrung und Unterhaltung bereitstellen.
Manchmal erscheint aber auch der Gedanke, daß die »Spiele«
vom Mangel an Brot ablenken können: So schrieb die
Londoner »Times« im Depressionsjahr 1930: »Prozessionen sind gute
Sachen, und es gibt keine bessere Zeit für Zirkusspiele als wenn
das Brot teuer oder knapp ist.«5 An die Priorität, die das Essen
ganz natürlich vor allem Weiteren besitzt, erinnerte Bertolt
Brecht 1928 in seiner »Dreigroschenoper«: »Ihr Herrn, die ihr
uns lehrt, wie brav man leben / Und Sund und Missetat
vermeiden kann / Zuerst müßt ihr uns was zu fressen geben / Dann
könnt ihr reden: damit fängt es an. / Ihr, die ihr euren Wanst
und unsre Bravheit liebt / Das eine wisset ein für allemal: / Wie
ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt / Erst kommt
das Fressen, dann kommt die Moral.«6
L: Bartels 130-131; Böttcher 79 (Nr. 449-450); Büchmann 343; Duden 12,151. 380;
Macrone 156; Mletzko 21. 66. 83. 113. 124; Reichert 121. 147. 1: luv. 10,78-81:
»...nam qui dabat ojim / Imperium, fasces, legiQnes, Qmnia, nunc se / CQntinet atque
duas tantum res anxius Qptat, / panem et circensgs...« 2: Fronto principia historiae 18
(S. 199f. Van den Hout): »populum Romanum duabus praecipue rebus, annona et
spectaculis, teneri«. 3: Dion von Prusa, Rede an die Alexandriner 31, zitiert nach Bartels
131. 4: »Die Spiele wurden also aus mehreren Gründen, vor allem aber, weil sich bei
ihnen die Plebs und der Herrscher von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, zu
einer Arena der Politik.« Paul Veyne, Brot und Spiele, München 1994, S. 606. Kurz
darauf (S. 608) unterzieht Veyne luvenals bekannten Ausspruch einer systematischen
Kritik. 5: »Processions are good things, and there is never a better time for the circuses
than when the bread ist dear or scarce«: Macrone 156. 6: Dreigroschenoper
(uraufgeführt 1928, Musik von Kurt Weill), Macheath (»Mackie Messer«) im 2.
Dreigroschen-Finale (überschrieben mit »Denn wovon lebt der Mensch?«; Brecht, Stücke, Berlin 1955,
Bd. 3,99. S: Engl. »Bread and Circuses«.
(die) brotlose Kunst
(ursprünglich:) die Kunst (v. a. Dichtkunst), die kein Geld
einbringt; (häufiger:) jede Tätigkeit, mit der sich kein
Lebensunterhalt verdienen läßt. Vgl. -> von Luft und Liebe
leben.
Die Idee, daß geistige Tätigkeit noch lange keine materiellen
Bedürfnisse befriedigt, findet sich zuerst bei Petronius: In des-
40
Brot und Spiele.
sen Roman »Satyrica« trifft der Erzähler auf einen ärmlichen
Dichter, der zu ihm sagt: »Ich bin ein Dichter und, wie ich
hoffe, nicht von ganz niedriger Begabung [...]. >Warum<, fragst
du, >bist du dann so schlecht gekleidet?* Genau deswegen. Die
Liebe zum Geistigen hat noch nie jemanden reich gemacht.«1
Im 12. Jh. begegnet der letzte Satz bei Johann von Salisbury
wieder.2 Das Mittelalter bildete für den Gedanken das
lateinische Sprichwort »Litterae (oder: carmina) non dant panem«:
Schriftstellerei (auch: Dichtung) gibt kein Brot. In der
Redewendung von der »brotlosen Kunst« ist dies erhalten.
L: Tosi 817 (Nr. 1834); Zanoner 18 (Nr. 135). 1: Petron. 83,8-9: »...amor ingenii
neminem umquam divitem fecit.« 2: Policraticus 7,15, PL 199,673a.
Der Buckel juckt jemanden
Jemand benimmt sich so übermütig, daß er bald Prügel
bekommen wird.
Nach altem Volksglauben ist das Jucken eines Körperteils die
Vorankündigung eines dies betreffenden Ereignisses (vgl.
ähnlich »es juckt mir in den Fingern [etwas zu tun]«). So sagt schon
bei dem römischen Dichter Plautus im »Miles gloriosus« der
Sklave Sceledrus: »Derganze Rücken juckt«, d.h.: Ich ahne, daß
ich Prügel bekommen werde.1 Vom Gesicht (in das man ja auch
geschlagen werden kann) gebraucht Plautus entsprechende
Wendungen (»Die Zähne jucken« und »die Kinnbacken oder
Zähne jucken«).2 Im Deutschen erscheint die Wendung - mit
dem »Buckel« anstelle des Rückens - bei Luther und Ludwig
Uhland.3 Auch Goethe fragt: »Juckt euch der Buckel wieder?«4
Heute wird noch häufiger, aber in gleicher Bedeutung
»jemanden juckt das Fell« gebraucht.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 92; Duden 11,134. 199; Grimm 2,485; Otto 121
(Nr. 581). 1: Plaut, mil. gl. 397: »dorsus totus prurit«; vgl. Pers. 31: »Schon jucken die
Schultern« (»iam scapulae pruriunt«). 2: Amphitr. 295: »dentes pruriunt«; Poen. 1315:
»malae aut dentes pruriunt«. 3: Ludwig Uhland, Volkslieder 249,4: »Tut dich der buckel
jucken, so lain dich her an mich!« (so der rauflustige Bauer nach Borchardt-Wustmann-
Schoppe 92). 4: Goethe 8,242 nach Grimm 2,485.
42
c
Cäsarenwahn
Überheblichkeit und Wahnsinn eines unumschränkt
Herrschenden.
Als Beleg für dieses Wort wird üblicherweise eine Textstelle aus
Tacitus' »Historien« angeführt, in der vom »Wüten der Kaiser«
(lat.: »furor principum«) die Rede ist.1 Doch steht dieser Begriff
dort in einem eher unerwarteten Kontext: Er ist hier
keineswegs auf eines der berüchtigten Mitglieder der iulisch-claudi-
schen Dynastie, nicht auf Nero oder Caligula gemünzt,
sondern bezieht sich auf die Niederbrennung des Kapitols in den
Kämpfen zwischen Anhängern des Vitellius und des Vespasian
im Kampf um den Thron (69 n. Chr.). Damit meint der
»Cäsarenwahn«, dem Tacitus diese frevlerische Tat zuschreibt, keinen
persönlichen Charakterdefekt der Herrscher, sondern die
Rücksichtslosigkeit ihrer Machtkämpfe.
Auf geistigen Wahnsinn der Cäsaren - ob dieser tatsächlich
vorlag oder nicht, soll hier dahingestellt bleiben - wurde der
Begriff erst Mitte des 19. Jh. in Frankreich übertragen2 und in
der Folge auch als Schlagwort gegen Napoleon III. benutzt.
Eingedeutscht wurde das Wort 1862 durch den Kulturhistoriker
Johannes Scherr, der in seinem Buch »Blücher und seine Zeit«
den französischen Ausdruck übersetzte und in »deutschen
Kaiserwahnsinn« abwandelte.3 Kurz darauf erscheint das Wort
auch bei Gustav Freytag (1816-1895).4
Der Begriff »Cäsarismus« hat seinen Ursprung ebenfalls in
Frankreich: Auguste Romieu (1800-1855) schlug in seinem
Buch »L'Ere des Cesars« (1850) die Abschaffung des
Parlamentarismus vor, da er zum Kommunismus führen werde, und
forderte zur Rettung Frankreichs einen gewählten absoluten
Monarchen, die Diktatur eines Cäsaren. Im »Kladderadatsch« vom
11. 1. 1857 heißt es daher, man könne »den Cäsarismus überall
anklopfen hören und an allen Toren Europas seine Visitenkar-
43
ten abgeben sehen«. Der demokratische Schriftsteller Ludwig
Bamberger polemisierte 1866 in seinem in der »Rheinischen
Zeitung« veröffentlichten Aufsatz »Der Caesarismus« gegen Ro-
mieu und dessen Verherrlichung Napoleons III.5
L: Böttcher 506-507 (Nr. 3324-3325). 1: Tac. hist. 3,72,1 (»furor principum«). 2: »ma-
nle imperiale«, in: Francois de Champagny, Histoire de Cesars, 4 Bde. Paris 1841 /1843.
3: 8. Buch, Kap. 1 (Bd. 2, S. 435); 9. Buch, Kap. 1 (Bd. 3, S. 37). 4: Die verlorene
Handschrift, 1864. 5: Gesammelte Schriften, Berlin 1895, Bd. 3, S. 328-336.
* EINE CATILINARISCHE EXISTENZ
zu verzweifelten Schritten bereiter, gefährlicher Mensch.
Der römische Politiker Catilina (108-62 v. Chr.) wurde dadurch
bekannt, daß er nach einer gescheiterten Bewerbung um das
Konsulat eine Verschwörung unternahm, die jedoch von dem
Konsul Cicero durchschaut und unterdrückt wurde. Der
Schriftsteller Sallust schildert seine Persönlichkeit in seiner
Schrift über die »Verschwörung des Catilina«:1 »Lucius Catilina
war von adliger Geburt, von großer Kraft des Geistes wie des
Körpers, hatte aber einen schlechten und verdorbenen
Charakter. Von frühester Jugend an erfreute er sich an Bürgerkrieg,
Mord, Raub und Zwietracht und übte sich von jung an darin.
Sein Geist war kühn, verschlagen, unbeständig. Er konnte jede
beliebige Sache vortäuschen oder ableugnen. Er strebte nach
fremdem Gut, war mit dem eigenen verschwenderisch und
brannte vor Begierden. Er verfügte über Redegewandtheit, aber
zu wenig Einsicht. Sein maßloser Geist verlangte ständig nach
Unmäßigem, Unglaublichem, allzu Hohem. Nach der
Gewaltherrschaft des Sulla befiel ihn eine äußerst starke Begierde,
den Staat in seine Gewalt zu bekommen, und es war ihm egal,
mit welchen Mitteln er dies erreichte, solange er nur die
Alleinherrschaft dadurch erlangte.«
In Anspielung auf Catilina sagte Otto von Bismarck am
30. September 1862 vor der Budgetkommission des
preußischen Abgeordnetenhauses: »Im Lande gibt es eine Menge kati-
linarischer Existenzen, die ein großes Interesse an
Umwälzungen haben.«
L: Duden 12,275.1: Sali. Cat. 5.
44
* Caudinisches Joch
demütigende Zwangslage. Unter das Joch schicken,
unterjochen: demütigen, auf demütigende Weise unterwerfen.
Wenn in römischer Zeit nach einer Schlacht die Soldaten der
unterlegenen Seite nicht versklavt oder getötet werden sollten,
wurden sie häufig auf besonders demütigende Weise entlassen,
indem man sie unter das »Joch« (lat.: »iugum«) schickte: Dies
bestand aus zwei in die Erde gerammten Speeren, über die ein
dritter als Querbalken gelegt und festgebunden wurde.1 Die
Soldaten des unterlegenen Heeres mußten nun unter diesem
Gestell hindurchmarschieren. Am bekanntesten wurde die
Prozedur durch die Niederlage der Römer in den Caudinischen
Pässen (»Furculae Caudinae«) in Mittelitalien: Im 2. Samniten-
krieg (326-304 v. Chr.) wurde das römische Heer 321 v. Chr.
dort von den Samniten eingeschlossen und mußte komplett
unter dem »Joch« hindurchgehen: »Als erste wurden die
Konsuln fast halbnackt unter das Joch geschickt, dann jeder, wie er
im Rang der nächste war, der Schmach unterzogen, dann der
Reihe nach die einzelnen Legionen. Die Feinde standen
bewaffnet um sie herum, beschimpften und verhöhnten sie; sehr viele
wurden auch mit dem Schwert bedroht, einige sogar
verwundet oder getötet, wenn ihre Miene infolge der demütigenden
Umstände schärfer wurde und den Sieger beleidigte. So wurden
sie durch das Joch geführt, und das, was fast noch schlimmer
war, unter den Augen der Feinde ...«2
Wenn das Joch hingegen ein Bild für schwere Arbeit oder ein
mühevolles Schicksal sein soll, geht es auf das Joch zurück,
unter das Zugtiere zur Arbeit gespannt werden. Bereits der Dichter
Horaz spricht beispielsweise davon, untreue Freunde seien »zu
listig, um auf gleiche Weise das Joch zu tragen«, d.h. das
Schicksal zu teilen.3 Dieser Verwendung entsprechen die
deutschen Redensarten »im Joche sein«, »das Joch tragen«, »ins
Joch der Arbeit eingespannt sein«, »das Joch
abschütteln/abwerfen« u. ä. In einer Ode vergleicht Horaz ein noch
unverheiratetes Mädchen mit einem Jungstier, der noch nicht ins Joch
gespannt werden könne: »Noch nicht gebeugt zu tragen das
Joch vermag sie / mit ihrem Nacken, noch nicht der Leistung
des Gespanngefährten / gleichzukommen...«4 Der Humanist
Erasmus kommentierte dies in seinen »Adagia« folgender-
45
maßen: »Denn auch das Zusammenkommen zweier Menschen
auf gleicher Stufe ist eine mühevolle Aufgabe, gleichwie unter
einem Joch. Daher heißt es auch >coniugium< [>Zusammen-
jochung<].«5 Lateinisch »coniugium« ist - die Ehe.
L: Böttcher 138 (Nr. 839); Büchmann 367; Duden 12,275; Otto 1 78 (Nr 876). 1: Liv.
3,28,11. 2: Liv. 9,6,1-3. 3: Hör. carm. 1,35,28: »Ferre iugum pariter dolosi«; vgl. Plin.
ep. 3,9,8 »cum uterque pari iugo... pro causa niteretur« (»weil wir beide ... für die
Sache unter demselben Joch standen, d.h. am gleichen Strang zogen); Sen. ep. 109,16
über die wahren Freunde: »Egregium opus pari iugo ducet« (»das hervorragende Werk
wird sie unter gleichem Joch führen«, d.h. sie einträchtig sein lassen). Im Griechischen
hatten ähnliche Wendungen den Sinn von »an demselben Strang ziehen«: Otto 178
(Nr. 876). Vgl. Matth. 11,30: »Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.«
4: Hör. carm. 2,5,1-3: »Nondym subacta ferre iugum valgt / cervice, nQndum munia
CQnpans / aequa/e...« (Übers, nach B. Kytzler). 5: Er. ad. 1,2,71: »Nam et coitus
duorum ex aequo negocium est, itidem ut in iugo. Unde dictum etiam coniugium.«
S: Engl. »To pass under the yoke«.
D
die Daumen drücken
jemandem Glück und Erfolg wünschen, in Gedanken bei
jemandem sein und ihm beistehen (auch im Sg.: jdm. / für
jdn. den Daumen drücken/halten).
Auf den Daumen als wichtigen und von den anderen
unterschiedenen Finger sind mancherlei alte Vorstellungen,
Gebräuche und Redensarten bezogen. Das Einschlagen des Daumens
zwischen die übrigen vier Finger ist wohl im Ursprung eine
Abwehrgeste gegen böse Geister (man vergleiche den
Aberglauben, daß das Einknicken des Daumens im Schlaf Alpträume
verhindere) und wurde dann zu einem Ausdruck der besorgten,
wohlwollenden Anteilnahme. Bei den Römern wurde die Sitte
des Daumendrückens - wie bei uns - nicht nur praktisch geübt,
sondern offenbar auch bereits redensartlich verwendet: So
schreibt der römische Naturforscher Plinius der Ältere in einer
46
Aufzählung abergläubischer Gebräuche: »Die Daumen zu
drücken werden wir, wenn wir Gutes wollen, auch im
Sprichwort aufgefordert.«1 Auch Horaz spielt wohl auf das
Daumendrücken als Form des guten Wunsches an: »Wer glaubt, du
nehmest an seinen Interessen teil, wird auf deiner Seite sein und
dein Spiel mit beiden Daumen loben.«2
Im Deutschen ist die Wendung zuerst in der Form
»jemandem den Daumen halten« belegt. So heißt es bei Johann
Andreas Schmeller (1785-1852): »Halt mir den Daumen, damit
ich ein Glück habe!«3
L: Duden 11,146; Grimm 2,848; Mletzko 22; Otto 283 (Nr. 1445). 1: Plin. nat. 28,25:
»Pollices, cum faveamus, premere etiam proverbio iubemur«. 2: Hör. ep. 1,18,65-66:
»CQnsentire suis studiis qui crgdiderit te, / fajitor utrgque tuym laudabit pgjlice kt
dum.« 3: Nach Grimm 2,848 mit weiteren Belegen zum Daumenhalten als Zeichen des
Glückwunsches oder (da man so eine Faust zeigt) der Drohung. S: Engl, »to keep one's
fingers crossed«.
DEUTSCH REDEN
deutlich und ohne Umschweife reden, die Wahrheit sagen.
Auf (gut) Deutsch (gesagt): unverblümt, ohne
Beschönigung.
Diese typisch deutsch klingende Redewendung hat ein
lateinisches Vorbild in dem gängigen Ausdruck »lateinisch reden«
(»Latine loqui«) für ein offenes und ehrliches Reden ohne
große Umschweife. So schildert z. B. Cicero in seiner zweiten
Rede gegen den korrupten Statthalter Verres, wie viele
Kunstschätze dieser sich angeeignet habe, und weist die
Geschworenen ausdrücklich darauf hin, daß er mit diesen Auslegungen
»lateinisch, nicht nach Advokatenart« rede, also schlicht und
ohne die bei einem Anwalt vielleicht anzunehmende
Übertreibung.1 Der Dichter Martial schreibt Ende des 1. Jh. n. Chr. in
der Vorrede zu seinen stellenweise lasziven Epigrammen:
»Sollte jemand aber so fanatisch prüde sein, daß man bei ihm
auf keiner Seite deutsch reden [lat.: »Latine loqui«] darf, dann
kann er sich mit dem Einleitungsbrief oder noch besser mit
dem Titel zufriedengeben. Epigramme sind für jene
geschrieben, die sich auch gerne Nackttänzerinnen anschauen.«2
In der Reformationszeit wurde als Gegenstück zu »Latine
loqui« die Wendung »deutsch reden« (offen, deutlich reden)
gebildet, die zugleich noch dadurch Schärfe erhielt, daß es eine
47
bewußte Abkehr vom - in Kirche und Gelehrtenkreisen
vorhersehenden - Latein darstellte und damit zum Beispiel die Bibel
auch für jeden, der kein Latein verstand, verständlich machte.
Über sein Verfahren, eine allgemein verständliche
Bibelübersetzung zu schaffen, äußerte sich Martin Luther in »Ein
Sendbrief D. M. Luthers vom Dolmetschen und Fürbitt der
Heiligen« (1530) so:3 »... man muß die Mutter im Haus, die Kinder
auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum
fragen und denselbigen das Maul sehen, wie sie reden und danach
dolmetschen; so verstehen sie es denn und merken, daß man
deutsch mit ihn' redet.« »Deutsch mit jemandem reden« heißt
hier (wie im antiken Sinne) verständlich, klar, ohne
Beschönigung, eventuell auch grob sprechen; übrigens kann man auch
heute noch »dem Volk aufs Maul schauen«.
Ein deutliches »deutsch Reden« hat schließlich auch den
Beiklang zusätzlich angedrohter Gewalt erhalten, wie zum Beispiel
bei Hermann Hesse: »Sei so gut, und halt du deinen Schnabel,
sonst schwätz ich deutsch mit dir.«4 Wohl deshalb bildete Peter
Tille den sarkastischen Sinnspruch: »Deutsch reden! ist die
deutscheste Drohung, die es gibt.«5 Auf Deutsch gesagt: Er irrt.
L: Böttcher 93 (Nr. 531-532); Duden 11,151; Grimm 2,1046-1047; Otto 188 (Nr.
924); Wander 1,577 (Deutsch 6). 1: Cic. Verr. 2,4,2: »Latine me scitote, non aecusato-
rie loqui.« 2: Martial. 1 praef., Übers, in Anlehnung an U. Cößwein; vgl. ferner Cic. Phil.
7,6,17; Quintil. declam. 3,6. 3: Zitiert nach Böttcher 93 (Nr. 531); viele weitere
deutsche Belege bietet Grimm 2,1046-1047.4: Hermann Hesse, In der alten Sonne, Leipzig
1943 (Erstausg. 1914), S. 43 nach Duden 11,151. 4: Mieder, Antisprichwörter 19 mit
Beleg. S: Frz. »dire francais«, »ä la franeoise«.
* SEIN DEZEM BEKOMMEN
seinen Anteil, seine Strafe bekommen; (obersächsisch:) sein
Däzen dazu geben: hineinreden, sich einmischen.
Der Begriff kommt vom mittellateinischen »deeimum«, ahd.
»dezemo«, der »Zehntabgabe«: Seit dem 4. Jh. war der »Zehnte«
nach altjüdischem Vorbild die an die Kirche abzuführende
Abgabe. Der übertragene Gebrauch von »Dezem/Däzen« hat sich
besonders in den mitteldeutschen Mundarten eingebürgert.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 103. S: Vgl. engl, »my two cents« (meine
unmaßgebliche Meinung).
48
# „o^
... a
Dichterische Freiheit.
DICHTERISCHE FREIHEIT
die (größere) Freiheit des Künstlers.
In seiner Schrift »Über den Redner« spricht Cicero über die
»Freiheit der Dichter« (lat.: »poetarum licentia«):1 Ihnen
sollten archaische Wörter ebenso wie neuartige Ausdrücke
vorbehalten bleiben, in öffentlichen Reden hingegen vermieden
werden. Was sonst lächerlich klinge, könne nämlich in
dichterischem Zusammenhang durchaus angemessen sein, der ja
auch nicht das alltägliche Leben beschreibe. Seneca hingegen
merkte zu der Vorstellung, daß der Göttervater Zeus seine
Waffen wechsle, an: »Dies gehört zur dichterischen Freiheit« (lat.:
»Poeticam istud licentiam decet«);2 »poetica licentia« bedeutet
hier also bereits Freiheit in der Entfaltung der Phantasie und in
der Ausgestaltung der Motive.
So wie Cicero eine Freiheit in der Wortwahl meinte,
erscheint »poetic license« im Englischen und - erst seit dem
18. Jh. - »dichterische Freiheit« im Deutschen zuerst im
Zusammenhang mit poetischen Techniken (Wortwahl, Metrum,
Bilder etc.). Heute hingegegen meint man meistens einen
freieren Umgang des Dichters mit den Fakten oder der Plausibilität
von Ereignissen. In diesem Verständnis kann man sich
demnach heutzutage, wo Dichtung eine immer geringere Rolle
spielt, auch als Nichtdichter »dichterischer Freiheit« bedienen.
L: Bartels 139; Böttcher 81 (Nr. 471-472); Büchmann 337; Grimm 2,1067; Macrone
137; Mletzko 23. 34. 1: Cic. de or. 3,153. Der lateinische Begriff ist eine
Lehnübersetzung von griech. 7ioit|tikti e^ovoia. Dies findet sich zuerst bei Agatharchides, De mari
Erythraeo 1,4 (Müller, Ceographi Craeci minores 1,112); vgl. Lukian, Gespräch mit
Hesiod 5: »die Freiheit im dichterischen Schaffen« (xr\v ev tco tioieiv e^oDoiav). 2: Sen.
quaest. nat. 2,44,1; vgl. Ov. am. 3,12,41 (»licentia vatum«); Phaedr. 4,26,8; Hör. ars
8-9.
DÜMMER ALS DUMM
äußerst dumm.
Das umgangssprachliche, aber wirkungsvolle Mittel, die
besondere Steigerung einer Eigenschaft mit dem Komparativ vor
derselben Eigenschaft zu bezeichnen (klüger als klug, kälter als kalt
etc.), ist weder eine Möglichkeit allein des Lateinischen noch
dort zuerst nachweisbar. Doch ist es interessant zu sehen, daß
die im Deutschen wohl häufigste Anwendung, nämlich »düm-
50
mer als dumm«, bereits bei dem lateinischen Komödiendichter
Plautus gängig ist: »Dümmer als dumm bist du gewesen, der du
Geschriebenem geglaubt hast«, sagt zum Beispiel im »Curcu-
lio« der Kapitän Therapontigonus zu dem Bankier Lyco, der auf
ein gefälschtes Siegel hereingefallen ist und daraufhin einem
Kuppler Geld ausgezahlt hat.1 Und im »Amphitruo« Alkmene
zu Jupiter: »Wenn du nicht dümmer als der Dümmste bist,
kannst du mit einer Frau, die du für schamlos hältst und laut
erklärst, weder im Spaß noch im Ernst ein Wörtchen reden.«2
In ähnlicher Konstruktion sagt in der Gespensterkomödie
»Mostellaria« der junge Herr Philolaches zu der schlauen
Sklavin Scapha: »Wie überaus klug sie doch alles durchschaut!
Nichts ist klüger als diese Kluge.«3
Übrigens finden sich auch die komparativischen
Wendungen »weniger als nichts« (absolut nichts; lat.: »minus nihilo«)
und umgekehrt »besser / mehr als nichts« (etwas, ein wenig;
lat.: »plus quam nihil«) bei klassischen Autoren.4
L: Otto 333 (Nr. 1699) und 243 (Nr. 1227). 1: Plaut. Curcul. 551: »Stujtißr stulto fuisti,
qui tabejlis crgdergs.« Vgl. Most. 965: »Praeter speciem stultus es« (»Über alle
Vorstellung dumm bist du«). 2: Plaut. Amphitr. 907: »quam tu impudjcam esse arbitrere et
pra^dicgs, / cum ea tu sermQnem nee iocQ nee serio / tibi habeas, nisi sis stujtio/ stultis-
simQ.« 3: Plaut. Most. 279: »yt perdQCte eyneta callet. njhil hac dQCta dgetius est.« Vgl.
Servius in Donat. p. 431,7 doctior doctissimo. 4: Weniger als nichts: Plaut. Pseud. 938;
Ter. Phorm. 535; Stat. 92. Besser als nichts: Ov. her. 19,170.
E
Eile mit Weile!
Übertreibe deine Eile nicht! Immer mit der Ruhe!
Nach Sueton vermied der römische Kaiser Augustus als
Feldherr bewußt jede Überstürzung und äußerte dazu gern den Satz
»Festina lente« (»Eile behutsam!« Griech. o7iet>8e ßpotSeox;)1.
51
Außer dieser Maxime habe Augustus auch gern einen
entsprechenden Vers des Euripides (»Vorsicht ziemt dem Heeresleiter
mehr als toller Wagemut«)2 und eine sinnverwandte
lateinische Sentenz Catos des Älteren zitiert: »Schnell genug
geschieht, was gut genug geschieht« (»Sat celeriter fieri, quidquid
fiat satis bene«). Das lateinische »festina lente« ließ Augustus
auch auf seine Münzen prägen.
Die paradoxe Zusammenstellung der zwei Begriffe findet
sich im Mittelalter bei dem englischen Dichter Chaucer
wieder.3 Das Original wurde in England zuerst von Thomas Lodge
1590 zitiert und in seiner englischen Fassung (»Make haste
slowly«) später zum sich reimenden »Haste makes waste« (»Eile
macht Verschwendung«) umgeformt. In Deutschland machte
Goethe das Wort populär, indem er es in »Hermann und
Dorothea« zitierte: »Eile mit Weile! Das war selbst Kaiser Augustus'
Devise.«4
L: Bartels 79; Böttcher 68 (Nr. 358-359); Büchmann 369-70; Duden 11,1 71; Grimm
3,107; Macrone 1 79; Mletzko 26. 42.1 37; Reichert 31 7.1: Suet. Augustus 25,4. 2: Eur.
Phoen. 599. 3: Troilus and Criseyde (um 1374): »He hasteth well that wisely can abide.«
4: In: Polyhymnia 82. S: Engl. »Make haste slowly«, »Haste makes waste«.
EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN
Alle halten zusammen und stehen füreinander ein.
In Vergib Epos »Aeneis« verheißt der Meeresgott Neptun, den
Venus um Hilfe für eine glückliche Fahrt ihres Sohnes Aeneas
nach Italien gebeten hat, daß dieser und seine Gefährten alle
bis auf einen das Land erreichen würden: »Einen nur wirst du
vermissen; ihn verschlingt die Tiefe des Meeres: Ein Haupt wird
für viele gegeben werden.«1 Später wird dementsprechend der
Steuermann Palinurus vom Gott in die Fluten geworfen,
während alle anderen unversehrt bleiben.2 Danach zitieren wir
»einer für viele« (auch lat.: »unus pro multis«) für das Einstehen
oder gar eine Opferung eines Einzelnen für die Gemeinschaft.
»Einer für alle, alle für einen« sagt in Louis Angelys Posse
»Fest der Handwerker« (1828) der Meister zu seinem Gesellen
und beschreibt damit das enge Verhältnis zwischen dem
Einzelnen und der Gruppe. Bei Alexandre Dumas' »Musketieren«
mit ihrem Wahlspruch »Tous pour un, un pour tous« (»Alle für
einen, einer für alle«) steht das solidarische Eintreten aller für-
52
einander im Vordergrund.3 Der nationalsozialistischen
Propaganda diente der Satz »Einer für alle, alle für einen« dagegen als
Losung, mit der die Fixierung aller auf einen einzigen
herausgehobenen Führer bestärkt werden sollte.
L: Böttcher 70 (Nr. 375-377); Büchmann 323; Duden 12,141. 1: Verg. Aen.
5,814-815: »Unus erit tantum, amissym quem gyrgite quae/es; / Unum prc» multis da-
bityr caput...« Zu demselben Motiv in christlichem Kontext vgl. Joh. 11,50. 2: V.
857-860. 3: A. Dumas d. Ä., Les trois mousquetaires (1844), Kap. 9.
noch ein Eisen im Feuer haben
noch andere Möglichkeiten haben (auch: Zwei/mehrere E.
i. F. h.); vgl.: Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß
ist: Man muß die Gelegenheit nutzen.
Beim Schmieden sind immer mehrere Eisen in der
Feuerschüssel, damit der Schmied ohne Unterbrechung arbeiten kann.
Wer also wie ein Schmied »mehrere Eisen im Feuer hat«, hat im
Leben die nötigen Ausweichmöglichkeiten und
Alternativoptionen (vgl. zu dem Bild des Schmiedens auch -> Jeder ist
seines Glückes Schmied).
Sowohl die Redensart »noch ein Eisen im Feuer haben« als
auch »man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist«
stehen vermutlich mit einer Stelle aus Senecas »Apocolocyntosis«
(der »Verkürbissung« des Kaisers Claudius) in Zusammenhang.
In dieser Satire wird geschildert, wie nach dem Tod des
Claudius im Rat der Götter darüber verhandelt wird, ob man ihn -
wie auch die vorangehenden römischen Herrscher - unter die
Götter aufzunehmen habe. Berechtigte Zweifel regen sich
angesichts einiger unrühmlicher Seiten des Verstorbenen, so daß
der Gott Janus (-* janusköpfig) einen grundsätzlichen
Ausschluß Sterblicher von der Vergöttlichung beantragt. Da
bekommt es der Held Herkules, der ja auch selbst einmal sterblich
war, mit der Angst zu tun, und beginnt, gegen den Antrag zu
werben: »Weil Herkules nämlich sah, daß jetzt sein Eisen im
Feuer war, lief er hin und her und sagte: >Du wirst mir doch
nicht übel wollen? Hier geht es doch um meine Sache. Wenn
du mal etwas willst, werde ich es dir vergelten: Eine Hand
wäscht die andere.*«1 Hier hat das »Eisen im Feuer« also eher
die Bedeutung unserer Redewendung »man muß das Eisen
schmieden, solange es heiß ist«: Es ist eine Metapher für den
53
Augenblick, in dem gehandelt werden muß und auf den es
ankommt. In der Literatur wird oft Seneca dafür als Urheber
genannt, aber die dabei zitierten Formulierungen wie »oportet
ferrum tundere, dum rubet« oder »dum ferrum candet, tunden-
dum est« finden sich im Wortlaut nicht bei Seneca und sind
erst später geprägt worden.
L: Duden 11,175; Mletzko 26. 32; Otto 135 (Nr. 657). 1: Sen. apocol. 9,6: »Hercules
enim, qui videret, ferrum suum in igne esse...«
LACHENDE ERBEN
Erben, die sich über das Ableben des Erblassers freuen.
Das Motiv erscheint zuerst bei dem lateinischen Spruchdichter
Publilius Syrus: »Das Weinen des Erben ist unter der Maske ein
Lachen.«1 Mit der Maske sind hier die Masken der Ahnen
gemeint, die die Familienangehörigen im Leichenzug zu tragen
pflegten (vgl. -> durch Abwesenheit glänzen). In den »Varroni-
schen Sentenzen« heißt es entsprechend: »Ein Erbe lacht so wie
ein Mädchen, das einem Mann angetraut ist; beider Weinen ist
ein nicht augenscheinliches Lachen.«2 - Im Deutschen
erscheint 1622 in Baden ein »Lacherbengeld«,3 und Friedrich von
Logau verfaßte 1654 ein Sinngedicht »Lachende Erben«: »Wann
Erben reicher Leute die Augen / wäßrig machen, Sind solcher
Leute Threnen nur Threnen / von dem Lachen.«4 Johann Jacob
Otho (1629-1669) notierte in seiner Schrift »Evangelischer
Krancken-Trost« (Nürnberg 1671): »Freu dich, liebes Mütlein,
traure, schwarzes Hütlein, heißt's bei lachenden Erben.«5
L: Böttcher 67 (Nr. 352); Büchmann 319; Duden 11,427; Grimm 3,712; Otto 163
(Nr. 807). 1: Publil. Syr. 221 (H 19): »Heredis sub persona risus est.« 2: Varron. sent. 11:
»Sic flet heres, ut puella viro nupta; utriusque fletus non apparens est risus« nach Otto
163 (Nr. 807). 3: K. H. Rau, Grundsätze der Finanzwissenschaft, 5. Ausgabe Leipzig
u. Heidelberg 1864, § 237, S. 371, Anm. a nach Büchmann 319. 4: Sinngedichte,
1654, 2. Zugabe zum III. Tausend, Nr. 78; vgl. Nr. 79. 5: S. 1034 nach Grimm 3,712.
bis zum Erbrechen
(lat. usque ad nauseam) bis zum Überdruß, immer wieder.
Daß Übelkeit häufig auf Schiffsreisen auftrat, sagte dem Römer
schon der reine Name: »nausea« (Erbrechen, griech. vouxria)
enthält das Wort »Schiff« (lat. navis, griech. vavc,) und ist daher
verwandt mit »nauta« (Seemann), »nauarchus« (Kapitän) und
54
»naufragium« (Schiffbruch). Übelkeit konnte den Römer aber
auch befallen, wenn er etwas auf Grund der ständigen
Wiederholung nicht mehr ertragen konnte und eigentlich nur noch
»zum Kotzen« fand. So beschwert sich der Dichter Martial, daß
ein Bekannter ihn durch die minutiöse Aufzählung seiner
Geschäftsgänge quält, und fordert, dafür wenigstens bezahlt zu
werden: »Jetzt mußt du etwas aufzählen, damit ich es weiter
ertragen kann: / Lindere meine tägliche Übelkeit durch Geld. /
Umsonst anhören, Afer, kann ich es mir nicht mehr.«1
Auch besondere Geschmacklosigkeit konnte metaphorische
Seekrankheit auslösen, so etwa wenn in der Satire des Petron
der Gastgeber Trimalchio seinen Gästen das eigene Begräbnis
handgreiflich vorführt (einschließlich Musiker und
Totengesang) und sie schließlich auffordert mitzumachen: »Stellt euch
vor, ich sei tot. Sagt etwas Schönes!« Der Erzähler stellt seinem
Bericht den notwendigen Kommentar gleich voran: »Die Sache
kam bis zum äußersten Erbrechen.«2 Die Kurzform »bis zum
Erbrechen« ist im Deutschen übernommen worden.
L: Bartels 196; Duden 11,180; Mletzko 27. 1: Martial. 4,37,9: »Numerus oportet
aliquid, yt pati possim: / Cotidianam rgfice nayseam nummis. / Audjre gratis, Afer, jsta
nQn possym.« 2: Petron. 78,5: »Ibat res ad summam nauseam.«
Erlaubt ist, was gefällt
Was zwar Normen verletzt, aber bei vielen Gefallen findet,
soll oder kann nicht untersagt werden.
In der »Historia Augusta«, einer Sammlung von
Kaisergeschichten aus dem 4. Jh., wird folgende legendenhafte Anekdote über
Kaiser Antoninus (bekannt als Caracalla) erzählt: »Es ist
interessant zu wissen, wie er seine Stiefmutter Iulia zur Frau
genommen haben soll: Weil diese sehr schön war und wie aus
Versehen den größten Teil ihres Körpers entblößt hatte, sagte
Antoninus: >Ich würde schon wollen, wenn es erlaubt wäre.< Da
soll sie geantwortet haben: >Wenn es gefällt, ist es erlaubt. Oder
weißt du nicht, daß du der Kaiser bist und die Gesetze gibst
anstatt sie entgegenzunehmen?<« - woraufhin er sie tatsächlich
geheiratet haben soll.1 Der Ausspruch geht wahrscheinlich auf
ein älteres Sprichwort zurück, da schon im 3. Jh. der Rhetor
Aquila Romanus überliefert, es gebe »bei den Alten häufig jenes
Wort: >Wem etwas gefällt, dem ist dies erlaubte«2
55
Bekannt wurde die Redensart durch ihre Verwendung in
Goethes »Torquato Tasso«. Dort hält Tasso gegenüber der
Prinzessin Leonore von Este eine begeisterte Lobrede auf die
»goldne Zeit« eines idealen, paradiesischen Urzustandes der
Menschheit, in dem »jedes Tier, durch Berg und Täler
schweifend, / Zum Menschen sprach: Erlaubt ist, was gefällt«. Dem
stellt die Prinzessin mit Hilfe einer kleinen Änderung die
Devise der menschlichen Zivilisation entgegen: »Nur in dem
Wahlspruch ändert sich, mein Freund, / Ein einzig Wort:
Erlaubt ist, was sich ziemt.«3
L: Böttcher 318 (Nr. 1991-1992); Duden 11,182 und 12,149; Mletzko 28. 40; Otto
193 (Nr. 949). 1: H. A. Caracalla 10: »Interest scire quemadmodum novercam suam lu-
liam uxorem duxisse dicatur. quae cum esset pulcherrima et quasi per neglegentiam se
maxima corporis parte nudasset dixissetque Antoninus >vellem, si liceret<, respondisse
fertur: >si libet, licet, an nescis te imperatorem esse et leges dare, non accipere?<«
2: Aquila Roman. 27: »frequens illud apud veteres eiusmodi est: cui quod übet, hoc
licet.« 3: Torquato Tasso 2,1.
* JEMANDEM EINEN ESEL BOHREN
jemandem andeuten, daß man ihn für einen Esel hält,
indem man ihm den Zeigefinger und den kleinen Finger
herausstreckt; (ohne die Fingerbewegung:) veralbern (auch: *
jemandem einen/den Esel
stechen/zeigen/strecken/schnitzen).
Der »Esel« stand schon bei den Römern für Störrigkeit,
Dummheit und Ungelehrigkeit (vgl. u.). So sagt Cicero in einem Brief
an seinen Freund Atticus im Jahre 54 v. Chr. über sich selbst:
»Ich weiß, daß ich der reine Esel gewesen bin.«1
Die solches jemandem signalisierende Handbewegung wird
in einem wohl mittelalterlichen Vokabular mit den
lateinischen Worten aufgeführt: »asininis auribus manu effictis illu-
dere« (durch Darstellung von Eselsohren mit der Hand
verspotten).2 Daraus entstand die entsprechende deutsche Redensart,
wobei seit Hans Sachs (16. Jh.) »den Esel stechen«, später aber
bis in die Romantik vor allem die Form »den Esel bohren«
belegt ist.3 So spottet z.B. in Goethes »Urfaust« Mephistopheles:
»Encheiresin naturae nennt's die Chemie, bohrt sich selbst
einen Esel und weiß nicht wie.«4 Heute ist die Redensart kaum
mehr geläufig.
56
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 125; Grimm 3,1145-1146; Otto 40-41 (Nr.
180-184). 1: Cic. AU. 4,6(5X3: »scio... me asinum germanum fuisse.« 2: Borchardt-
Wustmann-Schoppe 125, leider ohne näheren Beleg. 3: Siehe die Belege bei Grimm
3,1145-1146. 4: Goethe, Urfaust; die spätere Fassung lautet: »Spottet ihrer selbst...«
Wer den Esel nicht schlagen kann,
schlägt den sack
Die Wut entlädt sich an etwas anderem; ein Unschuldiger
wird beschimpft oder bestraft, weil der eigentlich Schuldige
unangreifbar ist. Auch: Den Sack schlägt man, den Esel
meint man; man schlägt auf den Sack und meint den Esel.
Bei dem fiktiven Gastmahl des Trimalchio, das der Schriftsteller
Petronius in seinem Roman »Satyrica« beschreibt, gehen die
Gäste den neuesten Stadtklatsch durch. Dabei geht es um einen
Sklaven, der von seiner Herrin verführt worden war und dafür
von seinem Herrn an die Kampfarena verkauft wurde: »Da hat
doch Glyco - kaum einen Sesterz wert, der Mann - seinen
Kassierer vor die wilden Tiere gebracht! Das heißt sich selber an
den Pranger stellen! Welche Schuld hat ein Sklave, der
gezwungen wurde, ein Ding zu drehen? Mehr hätte es jener Nachttopf
von einer Frau verdient gehabt, daß der Stier sie auf die Hörner
nimmt. Aber wer den Esel nicht schlagen kann, schlägt den
Sack [d. h. den Packsattel].«1 Die Wut des Herrn, die er an seiner
Frau nicht ablassen kann, wird am Sklaven abreagiert.
L: Böttcher 80 (Nr. 457); Büchmann 341; Duden 11,598 und 12,316; Mletzko 29.100.
103; Otto 42 (Nr. 191). 1: Petron. 45,8: »... Sed qui asinum non potest, Stratum cae-
dit.«
Eselsbrücke
Merkhilfe (oft mit dem Beiklang: für Lernfaule).
Johannes Buridan (1300 - nach 1358), ein Scholastiker und
kritischer Kommentator des Aristoteles, wurde v. a. bekannt durch
die Fabel von »Buridans Esel«, die nicht von ihm selbst stammt,
sondern wohl von Gegnern seiner Willenslehre erfunden
wurde:1 »Buridans Esel« steht zwischen zwei gleich weit
entfernten Heubündeln und verhungert, da er sich für keines von
beiden entscheiden kann. In seinem vom 14. bis noch ins 18.
Jh. weit verbreiteten Lehrbuch »Summulae logicales« empfahl
57
er sehr simple Regeln für die Anwendung der aristotelischen
Logik. Aufgrund der Spottfabel jedoch wurde diese Schrift
»asini pons« (»Brücke des Esels«, d. h. Brücke Buridans, des »asi-
nus Buridanus«) genannt. Daraufhin wurde der Begriff
»Eselsbrücke« auf jedes mögliche Einprägen schwieriger Sachverhalte
mittels einfacher äußerlicher Merkmale angewendet. Ein
einfaches Beispiel dafür ist etwa die Methode, sich die Form des
ab- oder zunehmenden Mondes mit Hilfe der Form der
Buchstaben a (in Schreibschrift mit der Rundung c beginnend) bzw.
z (in alter deutscher Schreibschrift mit umgekehrter Rundung
beginnend) zu merken.
L: Böttcher 172 (Nr. 1047-1048); Duden 12,103; Grimm 3,1151; MIetzko 29. 1: Der
Grundgedanke steht bei Aristoteles, De caelo 2,13, und wurde von Buridan in seinem
Kommentar am Beispiel des Hundes aufgegriffen, den man in einen Esel umwandelte.
B: Eine Lexikonreihe des Klett-Verlages (Stuttgart) trägt den Titel »Pons«. S: Frz.: »le
pont aux änes«.
ICH ESSE / MAN ISST, UM ZU LEBEN
(oft fortgesetzt: ...nicht aber lebe ich / lebt man, um zu
essen) das Essen ist Mittel zum Zwecke des Lebens, nicht
aber selbst Lebenszweck. Als Sprichwort: Wir leben nicht,
um zu essen, sondern wir essen, um zu leben; man ißt, um
zu leben, aber man lebt nicht, um zu essen.
Dieser weise Gedanke wird von Gellius (2. Jh. n. Chr.) dem
griechischen Philosophen Sokrates zugeschrieben, der sich damit
von denen habe abgrenzen wollen, die im Essen ihren einzigen
Daseinszweck sähen.1 Der Satz wurde aber vor allem bei
lateinischen Autoren als geflügeltes Wort gebraucht, so z. B. von dem
Rhetoriker Quintilian: »Nicht um zu essen lebe ich, sondern
um zu leben esse ich.«2 Im Deutschen wird das Wortspiel
häufiger noch auf die Arbeit angewendet, die dem Leben dienen
muß (und nicht umgekehrt): »Wir arbeiten, um zu leben, nicht
leben wir, um zu arbeiten.«
L: Duden 12,547; MIetzko 29. 99. 106; Wander 1,893 (Essen 113). 1: Cell. 19,2,7:
»Socrates quidem dicebat multos homines propterea velle vivere, ut ederent et bibe-
rent, se bibere atque esse, ut viveret« (Macrob. 2,8,16); Plut. de aud. poet. 4; Diog.
Laert. 2,34; Athen. 4, 158 F. 2: Quint. inst. 9,3,85: »Non ut edam, vivo; sed ut vivam
edo«; ebenso Isid. orig. 2,21,13.
58
Euch werd' ich!
Paßt auf! Ich werd's euch zeigen!
In Vergils »Aeneis« ruft der Meeresgott Neptun wütend die
Winde zur Ordnung, die ohne sein Wissen im Auftrag Junos
dem Aeneas und seinen Gefährten auf dem Meer schwer
zugesetzt haben:1 »Euch werd' ich...« (lat.: »Quos ego«...) - ohne
den Satz zu beenden, doch ist etwa zu ergänzen »zur
Rechenschaft ziehen« oder »strafen, wie es sich gehört«. Stattdessen
setzt der Gott mitten im Satz, sich kurz besinnend, fort: »Aber
besser ist's, die bewegten Fluten zu glätten.«2 Der Vers ist damit
ein klassisches Beispiel (-* klassisch) für eine »Aposiopese«, d.
h. ein Abbrechen der Rede im Zustand hoher Erregtheit. Das
Wort »Quos ego...« findet sich zweimal als drohendes Graffito
auf pompejanischen Hauswänden.3
L: Bartels 153; Böttcher 69 (Nr. 367); Büchmann 321. 1: Verg. Aen. 1,135. 2: ...sgd
motQS praestat compQnere fluctus. 3: CIL 4,4409. 8798.
die Probe aufs Exempel machen
an einem praktischen Beispiel überprüfen. Vgl. auch: ein
Exempel statuieren: durch drastisches Vorgehen ein
abschreckendes Beispiel geben.
Die Redensart geht auf das lateinische Wort »exemplum«
(»Beispiel«) zurück und ist im 16. Jh. durch die gedruckten
Rechenbücher volkstümlich geworden, in denen für theoretische
Gesetze Beispiele beigegeben wurden.1
Die Wendung »ein Exempel statuieren« gibt es sogar schon
bei dem lateinischen Komödiendichter Plautus (um 250-184
v. Chr.): In der »Mostellaria« hat der Kaufmann Theuropides die
Listen seines gerissenen Sklaven Tranio durchschaut und
kündigt nun wutentbrannt an, unter diesem ein Feuer
anzuzünden. Darauf Tranio: »«Tu das nicht; gesotten schmeck' ich ja
weit besser als gebraten.« Und wiederum der Herr: »Ein
Exempel will ich an dir statuieren lassen, sicherlich!« Schließlich
Tranio, dies als Lob nehmend, halb zu den Zuschauern: »Weil ich
gefalle, willst du als Exempel mich präsentieren?«2 Mit der
Plautusrezeption im Humanismus des 16. Jh. fand die
Redensart Eingang ins Deutsche.
59
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 133; Duden 11,187; Grimm 3,1207-1208; MIetzko
30. 1: j. Böschensteyn, Rechenbiechlin, 1514, E. »Die prob über das exempel« nach
Borchardt-Wustmann-Schoppe 133. 2: Plaut. Most. 1115-1116: »Tr. Ne faxis, nam
elixus esse quam assus spjeo suavior. / Th. Exempla edepoj faciam ego in te. Tr. Quja
placeo, gxemplum gxpetjs?« B: Goethe: »Es muß ein Exempel statuiert werden«
(14,300 nach Grimm 3,1207-1208).
F
das Fazit ziehen
das Gesamtergebnis feststellen. Auch allein: Fazit:
Gesamtergebnis.
Dieses Substantiv ist aus lateinisch »facit« (»es macht«) in der
kaufmännischen Bedeutung »Rechenergebnis« abgeleitet
worden (vgl. noch heute: »Das macht 20 Mark«). Durch die
gedruckten Rechenbücher ist es ab dem 16. Jh. volkstümlich
geworden.1 In übertragener Bedeutung wird es seit dem 17. Jh.
verwendet.2
L: Bartels 199; Borchardt-Wustmann-Schoppe 133; Duden 11,195. 1: Beispielsweise
Chr. Rudolff, Kunstliche Rechnung, 1526, F 6a: »Wie man probirn sol, ob das gefundne
facit recht sei.« 2: 1669 bei Grimmeishausen: »Zuletzt kam das Facit über den armen
Simplicium herauß.«
KEIN FlDUZ ZU ETWAS HABEN
kein rechtes Zutrauen haben.
Lateinisch »fiducia« bedeutet »Zutrauen, Zuversicht«. Die
Redewendung, die das Wort in eingedeutschter Form
aufgenommen hat, ist seit Ende des 18. Jh. in die Studentensprache und
von dort in die Mundarten eingegangen.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 142-143.
60
f/'^
Mit dem Finger auf jemanden zeigen.
mit dem Finger auf jemanden zeigen
jemanden öffentlich bloßstellen, anprangern; auch PL: mit
Fingern auf jdn. / nach jdm. zeigen; auch: * auf jemanden
fingerzeigen / fingerdeuten. Fingerzeig: Hinweis.
»Mit dem Finger auf jemanden zeigen« (»digito monstrare«)
hatte bei den Römern überwiegend die positive Bedeutung
»jemanden bewundern«. So sagt der Satirendichter Persius (34-62
n. Chr.): »Aber schön ist es, wenn auf einen mit dem Finger
gezeigt und gesagt wird: Der ist's.«1 Doch findet sich die
Redensart bisweilen auch wie bei uns in tadelndem Sinne; so sagt
Ovid: »Oft zeigt einer mit dem Finger auf den Dichter, wie er
vorübergeht.«2
L: Böttcher 82 (Nr. 478); Büchmann 340; Duden 11,207-208; Grimm 3,1657.
1651-1663; Otto 116 (Nr. 549). 1: Pers. 1,28: »At pulchrum est digito monstrari et
dicier: hie est.« In diesem Sinne auch Hor. c. 4,3,22. Weitere Belegstellen nennt Otto
116 (Nr. 549). 2: Ov. am. 3,1,19; vgl. 3,6,77; Hieron. ep. 22,27.
Fische müssen schwimmen
scherzhafte Aufforderung zu reichlichem Trinken nach
einer Fischmahlzeit (auch: Fische wollen/sollen schwimmen,
oder im Sg.: [der] Fisch will/soll/muß schwimmen).
In dem Schelmenroman »Satyricon« des lateinischen
Schriftstellers Petronius (gest. 66 n. Chr.) fordert der steinreiche
Gastgeber Trimalchio nach einem Fischgericht seine Gäste zum
Trinken auf: »Diesen Wein müßt ihr euch schmecken lassen.
Fische müssen schwimmen!«1 Der Witz besteht natürlich in dem
Gedanken, daß Flüssigkeit das natürliche Element des Fisches
ist - das man ihm jetzt auch im Magen gönnen möchte. Die
Redensart hat in mehreren Sprachen Verbreitung gefunden und
ist auch ausgestaltet worden: »Der Fisch will dreimal
schwimmen: im Wasser, im Schmalz und im Wein.«2
L: Böttcher 80 (Nr. 455-456); Büchmann 341; Duden 11,209 und 12,159; Mletzko 33.
108; Wander 1,1029 (Fisch 33-35). 1: Petron 39,2-3: »Hoc vinum, inquit, vos oportet
suave faciatis. Pisces natare oportet.« 2: Wander 1,1029 (Fisch 33). S: Engl. »Fish must
swim thrice: once in the water, once in the sauce and a third time in wine in the sto-
mach«; frz. »Poisson sans boisson est poison«, »Poisson, goret et cochon vit en l'eau, et
meurt en vin«; ndl. »Visch moet/wil zwemmen«.
62
eine (neue) Flamme haben
eine (neue) Freundin haben; meine Flamme: meine
Freundin.
In Vergib »Aeneis« erleidet der angehende römische
Nationalheld Aeneas auf seinem Weg nach Italien Schiffbruch vor der
afrikanischen Küste. Dido, Gründerin und Königin von
Karthago, nimmt ihn und die Seinen auf. Bald gesteht sie ihrer
Schwester Anna, daß Aeneas in ihr Gefühle wiedererweckt, wie
sie sie früher gegenüber ihrem verstorbenen Ehemann Sychae-
us gespürt hatte: »Allein dieser hat mir die Sinne gebeugt und
das Herz mir wieder wanken / gemacht: Ich erkenne die Spuren
der früheren Flamme.«1 Ihre frühere Liebe zu Sychaeus ist im
Bild der Flamme gezeichnet, deren letzte Reste in Dido von
Aeneas zu einer neuen Liebe/Flamme entfacht werden -
entsprechend bezeichnet man heute meistens eine neue Liebe als
»(neue) Flamme«. - Den zweiten Teil der Äußerung Didos
zitierte Dante in seiner »Göttlichen Komödie«, wo der Erzähler
im Purgatorium auf seine frühere Geliebte Beatrice trifft: »co-
nosco i segni de l'antica fiamma.«2 Vielleicht auch daher ist
heutzutage die »Flamme« stets eine Frau aus der Sicht eines
Mannes, nicht aber - wie noch bei Vergil - umgekehrt.
L: Zanoner 10 (Nr. 39). 1: Verg. Aen. 4,23: »SqIus hie inflexit sensys animymque
latentem / inpulit. AdgnoscQ veteris vestigia flajnmae.« 2: Divina commedia 30,48.
Fraktur schreiben/reden
deutlich (eigentlich: grob) schreiben oder reden,
unverblümt die Meinung sagen, entschlossen vorgehen.
Aus lat. »fractura« (»Bruch«) bildete man im 16. Jh. die
Bezeichnung »Frakturbuchstabe« (verkürzt »Fraktur«) für die
Buchstaben der »deutschen« Schrift mit ihren gebrochenen
Linien. Wenn man nun seine Ansicht deutlich und
ungeschminkt ausdrücken wollte, bediente man sich anstatt des
Lateinischen der deutschen Sprache und Schrift, also der
»Fraktur« (vgl. auch -♦ deutsch reden). Dieser übertragene
Gebrauch im Sinne von »deutlich« ist seit Anfang des 17. Jh.
bezeugt.1 In den 40er Jahren des 19. Jh. wurde die Wendung als
Schlagwort der Demokraten bekannt.
63
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 155; Duden 11,217. 1: Sartorius, Der Schneider
Genug- und sattsame Widerlegung, 1612, S. 5: »mit grober Fractur hindten auf den
Buckel schreiben«; Daniel Stoppe, Zweyte Sammlung (1729), S. 113: »Er schrieb und
zwar Fractur, bis sie zu seinen Füßen die süße Sterbenslust mit Schmertz verschweren
müssen.« Nach Borchardt-Wustmann-Schoppe 155.
lieber einen freund verlieren als einen
guten Witz
sich nicht zurückhalten können, mit seinen Worten keine
Rücksicht nehmen können (auch: lieber einen Freund
verlieren als eine Pointe; für einen guten Witz seine
Schwiegermutter verkaufen).
Der römische Dichter Horaz (65-27 v. Chr.) beschreibt in einer
seiner Satiren die verbreiteten Vorbehalte gegenüber einem
Dichter, da er jemandes Fehler und Schwächen mit seinen
Versen öffentlich mache: »Wenn er nur Lachen / erweckt, wird er
dich nicht und auch keinen Freund schonen.«1 Das Motiv,
Lachen um jeden Preis wecken zu wollen, dürfte daraufhin
sprichwörtlich geworden sein (oder auch schon gewesen sein)
und wird so von dem Rhetoriklehrer Quintilian (um 35-100)
zitiert: »Verletzen möchten wir niemals, und weit von uns sei
jener Vorsatz, >lieber einen Freund als einen Spruch zu
verlieren^«2
Vorläufer der Horaz-Stelle ist wohl ein ansonsten verlorener
Vers aus einem Stück des Ennius: »Der Wissende drückt eher
eine Flamme im brennenden Mund aus als daß er einen guten
Spruch zurückhält«, wobei uns Cicero darüber belehrt, daß mit
einem »guten Spruch« hier ein Witz gemeint ist.3
L: Bartels 139; Mletzko 35. 75. 142; Otto 22 (Nr. 95); Reichert 332. 1: Hor. s. 1,4,34:
»dymmodo risum / gxcutiat sibi, non hie cyjquam parcet amjco.« 2: Quint. inst. 6,3,28:
»Laedere numquam velimus longeque absit propositum illud potius amicum quam
dictum perdendi.« 3: Cic. de or. 2,222: »dicere enim aiunt Ennium, flammam a sapiente
facilius ore in ardente opprimi, quam bona dicta teneat.« S: Frz. »II vaut mieux perdre
un bon mot, qu'un ami«; ital. »Meglio perdere l'amico che un bei detto«.
64
Den (wahren) Freund erkennt man in der
Not
Wer noch in der Not ein Freund bleibt, ist ein echter Freund.
Vgl. das Sprichwort: * Glück macht Freunde, Unglück prüft
sie. Auch in Weiterentwicklung: Freunde in der Not gehen
hundert/tausend auf ein Lot (d.h. sie sind extrem selten).
In seiner Schrift »Laelius über die Freundschaft« beschreibt
Cicero (106-43 v. Chr.), wie Macht und Erfolg oder auch
Unglück eine Freundschaft gefährden können. In diesem
Zusammenhang zitiert er den Dichter Ennius mit den Worten: »Ein
sicherer Freund wird in unsicherer Lage erkannt« (lat.: »Amicus
certus in re incerta cemitur«).1 Dieser Satz wiederum geht
vielleicht auf die Tragödie »Hekabe« des Euripides zurück, in der es
heißt: »Im Unglück nämlich sind die guten Freunde am
offensichtlichsten.«2 In Rom begegnet der Gedanke auch schon um
200 v. Chr. bei dem Dichter Plautus: »Nichts bewirkt, wer den
Mißtrauischen nur mit Worten tröstet; derjenige ist ein Freund,
der in einer unsicheren Lage mit der Tat hilft, wo eine Tat
gebraucht wird.«3 Auch späteren lateinischen Autoren ist das
Motiv geläufig4.
Die englische Fassung »A friend in need is a friend indeed«
wurde im späten 17. Jh. sprichwörtlich, die deutsche wohl
kaum früher; noch älter ist jedoch das Sprichwort: »Reht freunt
erkennt man in der not, ir gen wol hundert uuf ein 16t.«5
L: Bartels 39; Böttcher 64 (Nr. 321-323); Büchmann 312; Duden 11,220; Macrone
133; Mletzko 35. 89. 127; Otto 21-22 (Nr. 92); Reichert 139; Wander 1,1174 (Freund
58). 1: Cic. Lael. 17 (64). 2: Eur. Hec. 1226-1227: »Ev xotq icaicot<; yctp 670601
oa^eoxaxoi | 0iXoi. Vgl. Eur. Or. 454: »Den Titel, aber nicht die Wirkung haben die
Freunde, die nicht in Unglücksfällen Freunde sind« ( Ovo|ia yap epyov 8' oi>k exoxjoiv
01 0iXoi | Oi MH *i ioiio\ <yo\L$opa\<; övxeq 0iA.oi). 3: Plaut. Epid. 112-113: »Nihil agit
qui diffidgntem ve/bis sojaty/ suis; / Is gst amicus, qui in re dubia rg iuvat, ubi rg est
opus.« 4: Publil. Syr. A 41; Petron. 61,9. 5: Wander 1,1174 (Freund 58). S: Engl. »A
friend in need is a friend indeed, / he will help thee in thy need«; frz. »Au besoin Ton
connait l'ami«, »L'adversite et les perils demontrent les vrais amis«; ital. »La miseria
discopre l'amistä«.
65
AUF FRISCHER TAT ERTAPPEN
(lat. in flagranti [crimine] comprehendere) jd. schon bei der
Tat selbst ertappen.
Im Codex Iustinianus, einer Sammlung kaiserlicher Gesetze
aus dem Jahr 529, heißt es von Verbrechern: »Sie sind direkt
bei dem Raub und noch hell brennenden Verbrechen gefaßt
worden.«1
Im Deutschen ist die »frische Tat« (auch »auf frischer Tat«,
jedoch noch ohne »ertappen«) schon im Mittelhochdeutschen
belegt.2 Entsprechend wählte Luther die Wendung auch zur
Übersetzung der griechischen Worte erc' otireo<t>a>pa) (eigentlich
»beim Selbstaufspüren«) in Joh. 8,4: »Meister, diese Frau ist
ergriffen auf frischer Tat beim Ehebruch.«
L: Bartels 201; Böttcher 90 (Nr. 524); Büchmann 351; Duden 11,714 und 12,253;
Grimm 4,209.1: CIC 13,9,1: »In ipsa rapina et adhuc flagrante crimine comprehensi.«
2: Siehe Grimm 4,209.
NICHT BIS FÜNF ZÄHLEN KÖNNEN
einfältig sein, ein großer Dummkopf sein (auch: * nicht
fünf / auf fünf / bis auf / bis zu fünf zählen können / zu
zählen wissen; manchmal auch: nicht bis drei zählen
können); umgekehrt: * bis fünf zählen können: witzig, schlau
sein; sich etwas an (den) fünf (manchmal: zehn) Fingern
abzählen / abklavieren können: etwas sicher wissen /
darlegen / voraussehen können, von etwas sicher ausgehen
können.
Da alles Zählen von den Fingern ausgeht oder die Finger zu
Hilfe nimmt, bedeutet »die Zahl der Finger nicht kennen« so
viel wie »nicht zählen können« oder allgemein »dumm sein«.
Die lateinische Entsprechung findet sich bereits bei dem
römischen Komödiendichter Plautus; dort sagt der junge Paegnium
zu dem Sklaven Toxilus, der ihm unterstellt, er habe einen
Auftrag nicht richtig verstanden, er wolle wetten, daß dieser
vielmehr selbst nicht wisse, wieviel Finger er gerade an der Hand
habe.1 Vermutlich gab es oder bildete sich daraus das
lateinische Sprichwort »Nescit, quot digitos habet in manu« (Er weiß
nicht, wieviel Finger er an der Hand hat). Im Deutschen
kommt die Redensart seit etwa 1400 vor.2
66
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 160; Duden 11,206; Grimm 4,549; Mletzko 145;
Otto 114 (Nr. 542). 1: Plaut. Pers. 187: »gt quidgm si sds tu, quQt hodie habeas digitos
in manu.« 2: Grimm 4,549, auch mit vielen späteren Belegen.
zwischen Furcht und Hoffnung
schweben
zugleich fürchten und hoffen.
In der »Aeneis« des römischen Dichters Vergil erreichen Aeneas
und seine verbliebenen Gefährten nach einem Sturm die Küste
Libyens, bereiten ein Mahl und denken an ihre auf See
vermißten Freunde, »bang zwischen Hoffen und Furcht, ob man
glauben darf, daß sie noch leben, / oder das Schlimmste schon
leiden und keinen Ruf mehr vernehmen.«1 In einer ähnlichen
Situation befand sich Plinius der Jüngere, als er kurz nach dem
Ausbruch des Vesuvs (79 n. Chr.) um das eigene Wohlergehen
sowie um das Schicksal seines Onkels und Adoptivvaters
Plinius d.Ä. besorgt war: »Wir verbrachten eine ängstliche und
schwankende Nacht mit Hoffnung und Furcht.«2
Für den Historiker Sallust sind Hoffnung und Furcht
Extreme, von denen gleichermaßen sich fernzuhalten er sich
vorgenommen hat (vgl. -♦ die goldene Mitte): In der Einleitung zu
seinem Werk über die Catilinarische Verschwörung vertritt er
die Ansicht, daß er zur Geschichtsschreibung besonders
befähigt sei, weil er von Hoffnung und Furcht frei sei.3
Im Deutschen sind Furcht und Hoffnung seit etwa 1600
häufig verbunden;4 »zwischen Furcht und Hoffnung schweben«
begegnet erstmals bei Matthias Claudius (1740-1815): »...so
wie Leute, die noch zwischen Furcht und Hoffnung schweben,
unglücklicher sind, als die schon Entscheidung haben.«5
L: Böttcher 70 (Nr 368-369); Büchmann 321; Duden 12,565; Grimm 4,690. 1: Verg.
Aen. 1,218-219: »Spgmque metumque inte/ dubij: seu vjvere crgdant / sjve extrgma
pati nee iam gxaudire vocatos.« 2: Plin. ep. 6,20,19. 3: Sali. Cat. 4,2. 4: Belege bei
Grimm 4,690. 5: 4,201 nach Grimm 4,690.
67
G
einem geschenkten gaul sieht man nicht
ins Maul
etwas Geschenktes sollte man nicht kritisieren, da Fehler an
ihm keinen Verlust bedeuten.
Beim Pferdehandel dient der Blick in das Maul eines Pferdes der
Beurteilung von Alter und Gesundheitszustand des Tieres. Als
Bild benutzt dies bereits der Kirchenvater Hieronymus (um
350-420) in der Einleitung seines Kommentars zum Ephe-
serbrief: »Prüfe nicht, wie es ein volkstümliches Sprichwort
sagt, die Zähne eines geschenkten Gauls!«1 Demnach war das
Wort zu Hieronymus' Zeit allgemein geläufig. Sinngleich, aber
ohne den Gaul und erst im Mittelalter belegt, ist das
griechische Sprichwort: »Was auch immer dir jemand als Geschenk
gibt-lobe es!«2
L: Böttcher (Nr. 508); Büchmann 348; Duden 11,233 und 12,184; Grimm 4,1570;
Mletzko 38. 80; Otto 125 (Nr. 607). 1: Hieron. comment. in Ephes. praef. (PL 26,469):
»Noli, ut vulgare proverbium est, equi dentes inspicere donati.« 2: Zenob. 3,42: 8<d pov
8' öti 5cp xiq £aiv£i. B: Bei Goethe sagt Mephistopheles zu Faust: »Margretlein zog ein
schiefes Maul [über ihr geschenkten Schmuck], ist halt, dacht sie, ein geschenkter
Gaul« (Faust I, 2827-2828). - Die Memoiren der Schauspielerin Hildegard Knef tragen
den Titel »Der geschenkte Gaul«. S: Engl.: »Don't look a gift horse in the mouth«
(Mieder, Proverbs 20).
die Gedanken sind frei
Die eigene Meinung kann einem nicht genommen werden.
Cicero schreibt in seiner Rede für Milo: »Unsere Gedanken sind
nämlich frei, und sie betrachten, was sie wollen, genauso wie
wir wahrnehmen, was wir ansehen.«1 Als Rechtsgrundsatz wird
später von dem Juristen Ulpian (um 200) überliefert: »Für einen
Gedanken erhält niemand Strafe.«2 Ähnlich wie Cicero
schreibt der Kirchenvater Ambrosius im 4. Jh.: »Frei sind die
Gedanken der Vernünftigen.«3
68
V*
^v
Einem geschenkten Coul sieht man nicht ins Maul.
Deutsch wurde das Sprichwort schon im Mittelalter
übernommen.4 Ebenfalls schon früh wurde es in Anspielung auf die
hohen Wegzölle zu »Die Gedanken sind zollfrei« abgewandelt.
Luther erwähnt diese Form als ein älteres deutsches
Sprichwort.5 In der Literatur erscheint der Satz später mehrfach bei
Shakespeare (»Thought is free«)6 und als Motiv in Goethes
Torquato Tasso, wo der junge Dichter Tasso zu Leonore in
Anspielung auf seinen Konflikt mit dem herzoglichen Staatssekretär
Antonio sagt: »Einen Herrn / Erkenn ich nur, den Herrn, der
mich ernährt, / Dem folg ich gern, sonst will ich keinen
Meister. / Frei will ich sein im Denken und im Dichten; / Im
Handeln schränkt die Welt genug uns ein.«7
Bekannt ist jedoch vor allem das deutsche Lied »Die
Gedanken sind frei«, das kurz vor 1800 in Süddeutschland entstanden
ist und durch Achim von Arnims und Clemens Brentanos
Liedersammlung »Des Knaben Wunderhom« (Heidelberg
1806-1808) verbreitet wurde. Dessen Anfang lautet: »Die
Gedanken sind frei, / Wer kann sie erraten, / Sie fliehen vorbei /
Wie nächtliche Schatten. / Kein Mensch kann sie wissen, / Kein
Jäger erschießen / mit Pulver und Blei, / Die Gedanken sind
frei!«8
L: Böttcher 91 (Nr. 526); Büchmann 1 74. 346; Duden 12,162; Grimm 4,1961; Mletzko
34. 40; Otto 87 (Nr. 405); Wander 1,1395 (Gedanke 44). 1: Cic. Mil. 29,79: »liberae
sunt enim nostrae cogitationes et quae volunt sie intuentur ut ea cernimus quae vide-
mus.« 2: Dig. 48,19,18: »Cogitationis poenam nemo patitur.« 3: Ambros. de virginit.
17,107: »liberae enim sunt cogitationes prudentium.« 4: Belege bei Grimm 4,1961. 5:
Von weltlicher Obrigkeit, wie man ihr Gehorsam schuldig sei, 1523, Weimarer Ausgabe
11,264; weitere Belege bei Grimm 4,1961. 6: The Tempest (Der Sturm) 3,2: »Thought
is free«; Twelfth Night or What You will (Was ihr wollt) 1,3: »Now, Sir, thought is free«
(»Nun, Herr, Denken ist frei«). 7: Torquato Tasso (erschienen 1790, uraufgef. 1807) 4,2.
8: Erk-Böhme, Deutscher Liederhort 3,576.
Gefahr im Verzuc(e)
nahende Gefahr, der es schnell zu begegnen gilt (auch:
Gefahr im Anzug). Meistens: Es ist Gefahr im Verzuge!
Der römische Historiker Livius schildert in seiner Darstellung
des römischen Feldzuges gegen die Galater (189 v. Chr.) den
Überfall der Vertragsbrüchigen Tektosagen auf den Konsul Cn.
Manlius, der in dieser Situation die Flucht befahl: »Als es schon
mehr Gefahr im Zögern (lat.: »periculum in mora«) als Schutz
in der Aufrechterhaltung der Schlachtreihen gab, flohen alle
70
*
WC
f IclOSgD *~ K^tA
Gefahr im Verzug.
weithin auseinander.«1 Die »Verzögerung« (»mora«) wurde im
Deutschen seit dem 17. Jh. mit »Verzug« wiedergegeben und
auf verschiendenste Weise mit »Gefahr« zusammengestellt
(»Gefahr im/ beim /aus dem /auf dem Verzuge«, »Verzug bringt
Gefahr« u.a.).2 Mitte des 19. Jh. trat die »Verzögerung«
gegenüber dem Drohen der Gefahr zurück, so daß die Wendung
allmählich dieselbe Bedeutung annahm wie das aufkommende
»Gefahr im Anzug« (d.h. im Heranziehen),3 das sich auch
heute noch findet. Das lateinische Original verwendete der
preußische Kriegsminister Albrecht von Roon am 18.
September 1862 in seinem Telegramm an den Gesandten Otto von Bis-
marck in Paris (der eine Woche später Ministerpräsident und
Außenminister sein sollte), daß er sofort nach Berlin abreisen
solle: »Periculum in mora. Depechez-vous!«4
L: Bartels 204; Böttcher 76 (Nr. 430-431); Büchmann 333; Duden 11,766-767 und
12,162-163; Grimm 25,2672-2673; Mletzko40. 132. 1: Liv. 38,25,13: »Cum iam plus
in mora periculi quam in ordinibus conservandis praesidii esset, omnes passim in fugam
effusi sunt.« 2: Ausführlich Grimm 25,2672-2673. 3: Belege bei Grimm 25,2673. 4: Bis-
marck, Gedanken und Erinnerungen Kap. 11 (Neuausgabe Stuttgart 1928, S. 245).
Geld stinkt nicht!
Dem Geld merkt man nicht an, woher es stammt; Geld ist
Geld - auch aus zweifelhafter Quelle.
Der römische Kaiser Vespasian (69-79), der der Sohn eines
Steuereintreibers war, konsolidierte durch Sparsamkeit und
Ordnung des Steuerwesens den unter Nero
zusammengebrochenen römischen Staatshaushalt. Er führte auf öffentliche
Toiletten eine »Urinsteuer« (»urinae vectigal«) ein, woran heute
im übrigen noch die französische Bezeichnung »Vespasiennes«
erinnert.1 Als sein Sohn und späterer Nachfolger Titus ihn
deswegen tadelte, soll Vespasian ein so eingenommenes Geldstück
genommen und Titus gefragt haben, ob es denn röche; als
dieser verneinte, sagte Vespasian: »Und dennoch ist es aus Urin.«2
Der dafür gern genannte Satz »(Pecunia) non ölet« findet
sich bereits bei Cicero,3 wurde aber erst durch Vespasians
Äußerung bekannt. Wer aus dem suetonischen Bericht die
Kurzfassung »Non ölet« gebildet hat, ist nicht nachvollziehbar. Das
Wort kann heutzutage auf jeden Gewinn aus anrüchiger Quelle
bezogen werden. Werner Mitsch formulierte treffend: »Geld
stinkt nicht. Aber bisweilen die Art, wie es verdient wird.«4
72
L: Bartels 116-117; Böttcher 83 (Nr. 483-484); Büchmann 370; Duden 11,246 und
12,180; Grimm 5,2903; Macrone 184; Mletzko 42. 115; Reichert 147; Wander 1,1789
(Geld 84). 1: Dabei handelte es sich um eine den Walkern und Gerbern auferlegte
Steuer für die gewerbliche Nutzung des Urins aus den öffentlichen Toiletten. 2: Suet.
Vespasian 23,3; Cass. Dio 66,14,5. 3: Cic. or. 45,154. 4: Mieder, Antisprichwörter 38
mit Beleg. S: Engl. »Money doesn't smell«; vgl. amerikanisch in Anspielung auf
Dollarnoten: »It's green, isn't it?«.
Gelegenheit macht Diebe
eine gute Gelegenheit begünstigt den Diebstahl, (oder
allgemeiner:) viele Dinge werden aus der Gelegenheit heraus
getan. Gelegenheitsdieb: jemand, der nur bei Gelegenheit
(»gelegentlich«) zum Dieb wird.
Der Historiker Livius beschreibt in seinem Geschichtswerk, wie
es der karthagische Feldherr Hannibal im Jahr 218 v. Chr.
unternahm, die Alpen zu überqueren. Nachdem er sein Heer kurz
vor den Bergen in einer Rede darauf vorbereitet hatte, »begann
das Heer vorzurücken, wobei nicht einmal die Feinde etwas
außer kleinen Diebstählen bei Gelegenheit unternahmen.«1
Vielleicht von dieser Formulierung angeregt, schrieb 1598 der
englische Philosoph und Schriftsteller Francis Bacon
(1561-1626) in einem Brief an den Earl of Essex: »Opportunity
makes a thief« (»Gelegenheit macht einen Dieb«). Von dort ist
der Satz unter Verwendung des Plurals »Diebe« ins Deutsche
eingegangen.2 Eine inhaltliche Zuspitzung findet sich bei
Goethe, in dessen »Buch Suleika« Hatems Liebeswerbung um
Suleika mit den Worten beginnt: »Nicht Gelegenheit macht
Diebe, / Sie ist selbst der größte Dieb; / Denn sie stahl den Rest
der Liebe, / Die mir noch im Herzen blieb.«3 Heute wird der Satz
nicht nur auf Diebstahl, sondern auf alles bezogen, was sich
durch eine günstige Gelegenheit ergeben hat. Dies nutzt und
belegt ein humorvoller Aphorismus von Werner Sprenger:
»Gelegenheit macht Diebe - aber auch Kinder und Leser.«4
L: Böttcher 210 (Nr. 1227-1228); Grimm 5,2948. 2951; Mletzko 23. 42. 1: Liv.
21,35,10: »procedere inde agmen coepit iam nihil ne hostibus quidem praeter parva
furta per occasionem temptantibus.« 2: Belege siehe bei Grimm 5,2948. 2951. 3:
Westöstlicher Divan, 1819, Buch Suleika. 4: Mieder, Antisprichwörter 40 mit Beleg.
73
Darüber sind sich die Gelehrten noch
nicht einig
Das ist noch nicht entschieden, noch unklar. Auch in der
Form: Darüber streiten (sich) die Gelehrten.
Der römische Dichter Horaz schreibt in seiner »Dichtkunst«,
daß man über das Versmaß der in Elegien verwendeten
Distichen (Zweizeiler) nicht wisse, wer es zuerst verwendet habe:
»Die Grammatiker streiten darüber, und noch immer liegt der
Fall vor dem Richter.«1 Durch wen und zu welchem Zeitpunkt
der Satz in die deutsche Alltagssprache Eingang gefunden hat,
ist nicht nachweisbar.
L: Bartels 36; Büchmann 331; Duden 12,97.1: Hor. ars 78: »Grgmmatici certant, et ad-
hyc sub iydice lis est.«
Gemeinplatz
(auch: Allgemeinplatz) allgemein bekannter Ausdruck; (oft
negativ:) nichtssagende Redensart.
Der lateinische Begriff »locus communis« (»allgemeiner Platz«,
griech. »xonoq« [topos]; vgl. dt. gleichbedeutend »Topos«)
bezeichnete seit der Antike anerkannte Begriffe oder übliche Ge-
sichts«punkte« in der Rede, was vor allem durch Aristoteles
und Cicero ausgearbeitet wurde. Der Reformator Philipp Me-
lanchthon nutzte diese Bezeichnung 1521 als Titel seiner
methodischen Darstellung der evangelischen Glaubenslehre
(»Loci communes«). 1770 übersetzte Christoph Martin
Wieland den lateinischen Ausdruck als »Gemeinplatz« ins
Deutsche.
L: Bartels 202.
Kleine Geschenke erhalten die
Freundschaft
Zur Freundschaft gehört ab und zu ein Geben und Nehmen.
In der Komödie »Der angeberische Soldat« des Dichters Plautus
hilft der alte Ephesier Periplectomenus dem jungen Athener
Pleusicles mit Geld für ein Mädchen aus. Er klopft ihm auf die
74
Schulter und meint, der Junge brauche sich dafür nicht zu
schämen, denn nur Geld, das für eine schlechte Frau und für
Feinde aufgewandt werde, sei hinausgeworfen, jedoch: »Geld,
das für einen guten Gast und Freund ausgegeben wird, ist ein
Erwerb, und was für Götterdinge aufgewendet wird, ist ein
Gewinn.« Auf diese Stelle geht wahrscheinlich das mittelalterliche
Sprichwort »Altemando boni nos dona manemus amici«
(»Durch Austausch von Geschenken bleiben wir gute
Freunde«) zurück, das im Deutschen wiederum leicht verändert
erscheint.
Die Redensart wird heute im Deutschen typischerweise
verwendet, um auf die höfliche Abwehr eines Geschenks (»Aber
das kann ich doch gar nicht annehmen!«) ebenso höflich zu
antworten.
L: Zanoner 15 (Nr. 98). 1: Plaut. Mil. 674-675: »in bono hßspite atque amko quafistus
gst quod sumitur / et quod in divjnis rgbus sumptumst, sapienti lucrumst.
über dem Gesetz stehen
sich in einer so angesehenen oder mächtigen Position
befinden, daß man sich faktisch nicht mehr an die Gesetze
halten muß.
Bei Livius findet sich die Formulierung »legibus solutus« (»von
den Gesetzen befreit«, »über die Gesetze erhaben«) bereits für
Scipio den Jüngeren, der beim ersten Mal unter Umgehung des
vorgeschriebenen Mindestalters, beim zweiten Mal unter
Mißachtung des Iterationsverbotes (d.h. des Verbots einer
zweiten Amtszeit) Konsul wurde.1 Entsprechend heißt es in
einem Rechtsgutachten Ulpians (um 200 n. Chr.) über den
römischen Kaiser: »Der Kaiser steht über den Gesetzen« (lat.: »Prin-
ceps legibus solutus est«).2 Als eine ironische Spielart dieser
Redewendung ist wohl der Satz »Der Kaiser steht nicht über
den Grammatikern« (»Caesar non supra grammaticos«)
aufzufassen.3
L: 1: Liv. Per. 50. 56. 2: Digesten 1,3,31: »Idem libro XIII ad legem luliam et Papiam.
Princeps legibus solutus est.« 3: Dazu ausführlich Büchmann 403 und Bartels 50.
75
Wie gewonnen, so zerronnen!
Was man gewinnt, kann man ebenso leicht und schnell
wieder verlieren. Ähnlich: Übel gewonnen, übel zerronnen;
vgl.: Unrecht Gut gedeiht nicht.
Die effektreiche Gegenüberstellung von »gewinnen« und
»zerrinnen« hat ihre Vorläufer in lateinischen Sätzen: Von dem
Dichter Naevius stammt die Sentenz Ȇbel Erworbenes
entgleitet übel« (lat.: »Male parta male dilabuntur«),1 die in der
lateinischen Literatur vielfach zitiert und abgewandelt wurde.2
Beispielsweise läßt der Historiker Livius einen Redner vor dem
Senat sagen, daß die Samniten, die die Römer bei den Caudini-
schen Pässen geschlagen hatten und das römische Heer unter
das Joch geschickt hatten (-♦ Caudinisches Joch), ihren »übel
erworbenen Sieg übel verspielten«, da sie in dieser Situation
keinen Friedensvertrag angestrebt hätten.3
Im Deutschen begegnet die Wendung zuerst 1512 in der
»Narrenbeschwörung« des Franziskanermönchs Thomas
Murner: »Wie gewunnen, so verthon, / Wie es kompt, so wieder
gon.«4 Die vielfach variierte und mundartlich weit verbreitete
Wendung hat im Deutschen allerdings keinen Beiklang eines
unrechten Erwerbs. Dieser Aspekt tritt nur in dem
benachbarten Sprichwort »Unrecht Gut gedeiht nicht« hervor, das jedoch
auf die Sprüche Salomos zurückzuführen ist.5
L: Böttcher 56 (Nr. 263-264); Büchmann 311; Grimm 6,5977 und 7,6727-6729;
Mletzko 39. 51.128; Otto 206 (Nr. 1013). 1: Naevius nach Paulus Diaconus v. 54 Ribb.
2: Plaut. Poen. 844: »Male partum male disperit.« »Übel gewonnen, übel zerronnen.«
Cic. Phil. 2,65: »Sed ut est apud poetam nescioquem: male parta male dilabuntur«; vgl.
Liv. 9,34,2: »male parta, male gesta, male retenta imperia«; weitere Hinweise gibt Otto
206 (Nr. 1013). 3: Liv. 9,9,11: »illi male partam victoriam male perdiderunt.« 4: Nr.
80,101 nach Grimm 7,6728. 5: Spr. 10,2: »Unrecht Gut hilft nicht; aber Gerechtigkeit
errettet vom Tode.« S: Engl. »Lightly won, lightly gone«.
Sich gleichen wie ein Ei dem anderen
völlig gleich sein.
Bereits Cicero erwähnt, es gebe eine sprichwörtliche
»Ähnlichkeit von Eiern untereinander«.1 Wahrscheinlich meinte er den
Satz »Kein Ei ist einem Ei so ähnlich«, den man nach dem
Rhetoriklehrer Quintilian sagen konnte, wenn zwei Dinge sich
völlig gleichen.2 Seneca verwendete den Vergleich in seiner Satire
76
Sich gleichen wie ein Ei dem anderen.
über Kaiser Claudius: Dieser habe Cassius Frugi ermorden
lassen, den Schwiegervater seiner Tochter, »einen Menschen, ihm
so ähnlich wie ein Ei einem Ei«.3 Erasmus hat die Wendung in
seinen »Adagia« besprochen.4 Die deutsche Wendung gleicht
der lateinischen - fast wie ein Ei dem anderen.
L: Grimm 3,76; Otto 261 (Nr. 1 318); Wander 1,763 (Ei 340). 1: Cic. ac. 1 57; vgl. 54. 2:
Quintil. 5,11,30: »Ut illud: >non ovum tarn simile ovo<.« 3: Senec. apoc. 11,5 (»homi-
nem tarn similem sibi quam ovo ovum«). 4: Er. ad. 1,5,10.
Gleiches mit Gleichem vergelten
Jemandem zur Strafe dasselbe antun, was man von ihm
erlitten hat.
Der entsprechende lateinische Ausdruck lautete »par pro pari
referre« (»gleich für Gleiches vergelten«): In der Komödie »Der
Eunuch« des Dichters Terenz macht sich der Offizier Thraso
eifersüchtig Gedanken um seine Geliebte Thais. Sein
Schmarotzer Gnatho gibt ihm diesbezüglich folgenden Rat: Wenn Thais
den schönen Phädria lobe oder rufe, solle Thraso umgekehrt
die schöne Pamphila loben oder zum Musizieren herbeirufen -
»kurz gesagt: / Vergilt mit Gleichem Gleiches, damit's ihr einen
Stich gibt!«1 In den »Brüdern« desselben Autors rechtfertigt der
wohlhabende Micio in der Anfangsszene seine humanen
Erziehungsmethoden: »Wen du durch Wohltat bindest, der handelt
ehrlich, / wünscht mit Gleichem zu vergelten, wird derselbe
sein, ob nah, ob fern.«2
Der antike Gebrauch entspricht damit der alten mosaischen
Forderung »Auge um Auge, Zahn um Zahn« (2. Mose 21,24).
Heute verwendet man die Redensart aber fast öfter in einem
Aufruf, davon - was eher neutestamentlich ist - keinen
Gebrauch zu machen: »Man soll nicht Gleiches mit Gleichem
vergelten!«
L: Böttcher 56 (Nr. 262); Duden 11,264 und 12,192; Fritsch 384; Otto 264 (Nr. 1 337).
1: Ter. Eun. 445: »(...dgniqug) / par pro. pari referto quo_d eam mo_rdeat.« 2: Ter. Ad.
772-73: »III' quem benefjcio adiungas ex animo. fadt, / studet par refgrre, praesens ab-
sensque idem ent.« Weitere Belege dafür nennt Otto 264 (Nr. 1337); ähnlich hieß es,
wenn Rede und Gegenrede sich entsprechen, »gleich auf gleich antworten« (»par pari
respondere«): Plaut. Merc. 629; weitere Belege bei Otto 264.
78
Glück und Glas, wie leicht bricht das
Glück ist vergänglich (auch: ... wie bald bricht das). Vgl.
auch -► Wie gewonnen, so zerronnen.
Dieses Sprichwort stammt von dem Spruchdichter Publilius Sy-
rus, einem Freigelassenen aus Antiochia (1. Jh. v. Chr.): »Das
Glück ist aus Glas: Dann wenn es glänzt, zerbricht es auch«
(lat.: »Fortuna vitrea est: tum, cum splendet, frangitur«).
L: Böttcher 67 (Nr. 351); Büchmann 320; Duden 11,266; MIetzko 20; Otto 142
(Nr. 696). 1:Publil. Syr. F24.
Jeder ist seines Glückes Schmied
Jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich.
Der römische Politiker Appius Claudius Caecus (um 300
v. Chr.), der früheste bekannte lateinische Schriftsteller,
formulierte in seinen »Sentenzen«, einer Spruchsammlung im alten
Versmaß des Saturniers, die Maxime: »Jeder ist der Schmied
seines Glücks.«1
Der in dieser Form bis ins Deutsche gelangte Grundsatz
wurde schon in der Antike gern zitiert oder sinngemäß
aufgegriffen,2 stellte er doch ein gewisses programmatisches
Gegengewicht zum verbreiteten Motiv des launischen,
unberechenbaren Glückes dar (vgl. -» Glück und Glas, wie leicht bricht
das); dessen Personifizierung, die Glücksgöttin Fortuna,
verliert, wenn der Mensch seine Gestaltungsfreiheit wahrnimmt,
die Allmacht über sein Leben: »Gegenüber dem [eigenen]
Lebenswandel hat das Schicksal (fortuna) kein Recht.«3
L: Böttcher 52 (Nr. 230); Büchmann 311; Duden 11,629; MIetzko 48. 61. 104; Otto
143-144 (Nr. 701). 1: Ps.-Sall. de rep. 1,1,2: »...quod in carminibus Appius ait, fabrum
esse suae quemque fortunae.« 2: Plaut. Trin. 363; Cic. parad. 5,1,34; Nep. Att. 11,6;
19,1. 3: Sen. ep. 36,6: »In mores fortuna ius non habet.« Vgl. Ter. Ad. 399; Non. p.
526,24. B: Gottfried Keller benannte eine Novelle aus dem Zyklus »Die Leute von Seld-
wyla« (1856-1874) »Der Schmied seines Glückes«.
mit Gold aufwiegen
(bei Sachen:) das Kostbarste für etwas geben, teuer
bezahlen; (bei Personen:) jemanden fürstlich belohnen; nicht mit
Gold aufzuwiegen sein: unersetzlich sein.
79
In einer Komödie des Dichters Plautus sagt der Sklave Chrysa-
lus - voller Stolz auf seine Schlauheit - über sich selbst: »Diesen
Mann hier muß man mit Gold aufwiegen, ihm eine Statue aus
Gold aufstellen!«1 Das Gold, mit dem er aufgewogen werden
möchte, soll in dem Gedankenspiel offenbar zur Anfertigung
der Statue dienen. Damit hält er sich schon fast für
göttergleich, denn üblicherweise stellte man goldene Statuen
besonders hilfreichen Göttern auf oder versprach es zumindest, wie
z.B. der Hirte Thyrsis dem Gott Priapus bei Vergil: »Jetzt, nach
den Umständen, ließ in Marmor ich dich aufstellen; sollte
reichlich mein Vieh sich vermehren, wirst du im Goldglanz
noch schimmern.«2
Nicht immer bezieht sich das Aufwiegen in Gold allerdings
auf die Errichtung einer Statue; häufig geht es auch darum, daß
etwas losgekauft wird. So schreibt Hygin, der trojanische König
Priamus habe den Leichnam seines Sohnes Hektor mit Gold
aufgewogen, um ihn von Achilles zur Bestattung
herausgegeben zu bekommen.3 Auch soll dem Mörder des -♦
Volkstribunen Gaius Gracchus dessen Kopf mit Gold aufgewogen worden
sein.4
L: Büchmann 312; Duden 12,357; Otto 49 (Nr. 218). 1: Plaut. Bacch. 640: »Hunc
ho_minem decet auro gxpendi, hyjc decgt statuam statui gx auro.« 2: Verg. ecl. 7,35-36
(»...aureus esto.«), Übers, von Dietrich Ebener. Griech. Parallelen zur Vorstellung
goldener Standbilder von einem Menschen nennt Otto 49 (Nr. 218). 3: Hyg. fab.
106,4. 4: Flor. 2,3.
Gott (be)schütze mich vor meinen
Freunden!
(...vor meinen Feinden kann ich es selbst) manche Freunde
sind gefährlicher als mancher Feind.
In einer lateinischen Spruchsammlung des Johannes Manlius
findet sich folgende Anekdote über den makedonischen König
Antigonos (um 320-239 v. Chr.): »König Antigonus befahl
seinem Priester zu opfern, damit Gott ihn vor seinen Freunden
schütze. Auf die Frage, warum nicht vor seinen Feinden,
antwortete er: >Vor meinen Feinden kann ich mich selbst in acht
nehmen, vor meinen Freunden jedoch nichts«1
Der wahre Kern dieses Ausspruchs liegt darin, daß man
gegenüber Freunden leicht zu unaufmerksam ist und dann von
80
Problemen überrascht wird. Man kann mit dem Zitat aber auch
zum Ausdruck bringen, daß allzu viel freundschaftliche
Zuwendung durchaus lästig werden kann, man aber gegenüber
den Freunden Skrupel hat, ihnen die Wahrheit ins Gesicht zu
sagen.
L: Böttcher 202 (Nr. 1194); Büchmann 366; Duden 12,198. 1: Locorum communium
collectanea, Basel 1563, 2,246: »Rex Antigonus iussit sacerdotem suum sacrificare, ut
deus defenderet eum ab amicis. Interrogatus, quare non ab inimicis, respondit: >Ab ini-
micis possum mihi ipsi cavere, ab amicis vero non.<«
H
die Haare stehen zu Berge
äußerst entsetzt sein.
In der »Aeneis« des römischen Dichters Vergil (70-19 v. Chr.)
findet der Titelheld Aeneas, der aus dem brennenden Troja
entkommen ist, nach langer Fahrt Aufnahme bei der
karthagischen Königin Dido, die sich in ihn verliebt (-♦ eine (neue)
Flamme haben). Daher muß Aeneas, ihr nicht abgeneigt, im
Auftrag Jupiters von Merkur an seine schicksalhafte
Bestimmung erinnert werden, nach Italien zu segeln und dort
Ahnherr eines neuen, einst großen Volkes (der späteren Römer) zu
werden. Nach der Erscheinung des Gottes steht er starr vor
Entsetzen da: »Aber Aeneas stand indes stumm, beim Anblick von
Sinnen, / steil vor Entsetzen richtete sich das Haar auf, im
Schlund stockte die Stimme.«1 Den zweiten Teil wiederholt
Vergil noch einmal im zwölften Buch bei seiner Schilderung
des von einer Rachegöttin angegriffenen Rutulerfürsten
Turnus.2 Ein ausdrückliches »Stehen« der Haare erscheint an
anderen Stellen des Werkes, in denen Aeneas sich über den Anblick
der Schatten lieber Verstorbener entsetzt: »Ich erstarrte, und
es standen die Haare, und im Schlund stockte die Stimme.«3
81
In der deutschen Fassung ist die Redensart um die Worte »zu
Berge« (nach oben) erweitert worden.
L: Büchmann 322; Grimm 1,1505; Mletzko 51. 1: Verg. Aen. 4,279-280: »At vero
Agneas adspgctu obmytuit amens / adrectafique horro_re comae £t vox fajjcibus
hafisit.« 2: Verg. Aen. 12,868. 3: Verg. Aen. 2,774; 3,48.
*den Habicht über die Hühner setzen
den Ungeeignetsten mit einer Aufgabe betrauen (wie »den
Bock zum Gärtner machen«). Auch: Den Habicht zum
Taubenwächter machen. Als Sprichwort: Wo man den Habicht
über die Hühner setzt, da ist ihr Tod gewiß.
Diese Wendung erscheint ähnlich schon bei dem römischen
Dichter Ovid, der in seiner »Liebeskunst« den Liebenden davor
warnt, die Geliebte allein in der Obhut eines Freundes
zurückzulassen: »Du vertraust, Wahnsinniger, dem Habicht die
furchtsamen Tauben an?«1
Ein ähnliches Bild, nämlich »Wölfe bei den Schafen als
Wächter lassen«, begegnet bereits bei dem Komödiendichter
Plautus; in dessen »Pseudolus« beschwert sich der
Sklavenhändler Ballio über seine nichtsnutzigen Aufseher, die nur
rauben, stehlen, fressen und saufen wollen: »Eher könnte man die
Schafe Wölfen anvertrauen als die dem Haus zu Hütern
geben.«2
Im Deutschen ist seit dem 16. Jh. auch »den Bock zum
Gärtner machen (oder: setzen)« gebräuchlich (als Sprichwort: Man
soll den Bock nicht zum Gärtner machen),3 was sich
inzwischen gegenüber dem römischen Habicht durchgesetzt hat.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 11; Böttcher 56 (Nr. 60); Mletzko 19; Wander 2,245
(Habicht 20. 23). 1: Ov. ars 2,363: »Accipitri timidas credis, furiose, columbas?«
2: Plaut. Pseud. 140-141: »(Hoc / est eorum opus), ...ut mavelis lupQS apud ovis
Nnquerg, / Quam ho_s domi custQdes.« Vgl. Ter. Eun. 832 (»dem Wolf das Schaf
anvertrauen«). 3: Gerlingius (1649) kennt auch »dem Wolf die Schafe befehlen« und »der
Katze den Käse befehlen«: Borchardt-Wustmann-Schoppe 11. S: Engl, »to give the wolf
the wether to keep«; frz. »donner la brebis ä garder au loup«.
die Hand ins Feuer legen
für jemanden bürgen, von etwas fest überzeugt sein, etwas
unerschütterlich versichern (auch: sich für
jemanden/etwas die Hand abschlagen/abhacken lassen; vgl.: die rechte
Hand für etwas geben).
82
Unter den Großtaten aus Roms ruhmreicher Vergangenheit
berichtet der Historiker Livius vom Heldenmut des jungen Gaius
Mucius.1 Nachdem die Römer (der Überlieferung nach im Jahre
510 v. Chr.) ihren etruskischen Stadtkönig Tarquinius Superbus
abgesetzt hatten, soll dieser seinen Freund und Kollegen Por-
senna, König von Clusium (heute: Chiusi) zu Hilfe gerufen
haben. Als die Römer nun belagert wurden und zu unterliegen
drohten, unternahm Mucius einen Attentatsversuch gegen
Porsenna. Als dieser mißlang und ihn Porsenna durch
Androhung der Folter dazu zwingen wollte, seine Hintermänner zu
verraten, hielt Mucius seine rechte Hand in ein zufällig dort
brennendes Altarfeuer, um damit zu beweisen, wie gleichgültig
ihm Schmerz sei. Porsenna war davon tief beeindruckt und ließ
ihn gehen. Allein dies legt nahe, die Geschichte in das Reich
der Sage zu verbannen. Es dürfte sich vielmehr um eine
ätiologische Legende handeln, die die Herkunft des Familiennamens
»Scaevola« (»der Linkshänder«) erhellen sollte.
Zugleich aber ist daraus die Redewendung »seine Hand für
etwas/jemanden ins Feuer legen« entstanden, die heute die
feste Überzeugung von einer Sache oder das unerschütterliche
Vertrauen auf einen Menschen zum Ausdruck bringt. Werner
Mitsch verband dies 1980 treffend mit einer benachbarten
Redensart: »Für jemanden, der sich andauernd die Finger
verbrennt, sollte man nicht die Hand ins Feuer legen.«2
L: Böttcher 52 (Nr. 231) und 160-161 (Nr. 988); Duden 11,299-300. 1: Liv. 2, 12.
2: Mieder, Phrasen 87 mit Beleg.
Hand und Fuss haben
gut durchdacht sein, vernünftig begründet sein; ohne Hand
und Fuß: unvernünftig, unseriös.
Hände und Füße als Zeichen für vollständig vorhandene
Tatkraft und Bewegungsfähigkeit eines Menschen werden in
dieser Wendung auf Gegenstände, Maschinen, Pläne, Gedanken
und Weiteres übertragen, um ihre Funktionsfähigkeit oder
Sinnhaftigkeit zu bezeichnen. Im Deutschen erscheint die
Wendung ab dem 16. Jh.1 Im römischen Altertum lautete der
entsprechende Ausdruck »[es erscheinen] weder Kopf noch
Fuß« (Plautus) bzw. »weder Kopf noch Füße« (Cicero).2 Die
Verbindung von Kopf und Fuß war zugleich Sinnbild der Vollstän-
83
digkeit (-♦ von Kopf bis Fuß), die demnach »ohne Kopf und
Fuß« undenkbar ist. »Cato der Ältere soll die Phrase
abgewandelt und für einen Witz genutzt haben, wie in den »Periochae«
(Livius-Auszügen aus dem 4. Jh.) erzählt wird: »Die Römer
hatten drei Gesandte zur Herstellung eines Friedens zwischen Ni-
comedes und Prusias ausgeschickt; einer von ihnen hatte den
Kopf von vielen Narben gezeichnet, der zweite war an den
Füßen krank, und dem dritten schrieb man eine beschränkte
Begabung zu. Da sagte Cato über diese Gesandtschaft, sie habe
weder Kopf noch Füße noch Herz.«3
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 202; Duden 11,299; Mletzko 38. 52. 91; Otto 74-75
(Nr. 344). 1: Namenlose Sammlung von 1532, Nr. 510: »Es hat hende und fuesse was
der man redet«, ausführlich erklärt 1529 bei Johann Agricola (Nr. 445). 2: Plaut. Capt.
614; Asin. 729; Cic. fam. 7,31,2. 3: Liv. perioch. 50: »Cum tres legatos ad pacem inter
Nicomedem et Prusiam faciendam Romani misissent, cum unus ex his caput multis ci-
catricibus sartum haberet, alter pedibus aeger esset, tertius ingenio socors haberetur,
dixit Cato eam in legationem, nee caput nee pedes nee cor habere.«
sich mit Händen und Füssen wehren
sich mit allen Mitteln wehren, sich mit vollem Einsatz
widersetzen.
»Mit Händen und Füßen« (lat.: »manibus pedibusque«) stand
auch im Lateinischen für den Einsatz aller Mittel, denn, wie
Erasmus von Rotterdam erläuterte, »durch die Hände wird die
Bereitschaft, eine Handlung auszuführen, dargestellt, durch die
Füße die Schnelligkeit beim Laufen«.1 In einer Komödie des
Terenz (2. Jh. v. Chr.) sagt der Sklave Davos zu seinem jungen
Herrn Pamphilus: »Als Sklave, Pamphilus, ist's meine
Schuldigkeit, / mich abzumühen mit Händen und Füßen Tag und
Nacht.«2 An anderer Stelle in demselben Stück sagt Pamphilus'
Vater Simo über den gerissenen Davos: »Ich glaube, daß dieser
mit Händen und Füßen beharrlich alles tun wird, und dies
mehr, um mir zu schaden ...«,3 womit er meint, daß Davos sich
seinen Plänen gewiß mit allen Mitteln entgegenstellen werde.
Der Grammatiker Donat erklärte den Ausdruck im 4. Jh. als ein
Sprichwort, das soviel heiße wie »mit allen Gliedern«,4 womit
es offenbar für alle Arten vollen Einsatzes stehen konnte. Im
Deutschen dagegen wird die Wendung fast nur noch im
Zusammenhang mit Widerstand oder Selbstverteidigung
gebraucht.
84
L: Mletzko 38. 52. 1 37; Otto 210 (Nr. 1034). 1: Er. ad. 1,4,15. 2: Ter. Andr. 675-676:
»Ego, Pamphile, ho_c tibi pro. servitio dgbeo. / cona/i ma/iibu' pgdibu' no_ctesque £t
difis.« 3: Ter. Andr. 161: »quem ego crgdo manibu' pgdibu'que Qbnixe o_mnia / fac-
ty/um...« 4: »proverbiale i. e. omnibus membris« nach Otto 210 (Nr. 1034).
an Haupt und Gliedern
völlig, in jeder Hinsicht. Zumeist in Verbindung mit dem
Begriff der Reform: Die Kirche an Haupt und Gliedern
reformieren, Reform/Erneuerung an Haupt und Gliedern.
Der Kirchenvater Augustinus überliefert in seiner
Psalmenauslegung anläßlich von Ps. 30,5 (»Singt und spielt dem Herrn, ihr
seine Frommen...«) ein »altes und wahres Sprichwort: >Wo der
Kopf (ist), (sind) auch die übrigen Glieder^«1 Damit nimmt er
auf das neutestamentliche Bild von der Gemeinde als einem
Leib mit vielen unterschiedlichen Gliedern (den Gläubigen)
und mit Christus als Haupt Bezug.2 Da der Kopf, Christus,
auferstanden sei, dürften auch die Glieder, d.h. die Gläubigen, auf
das ewige Leben hoffen und daher, wie der Psalm empfiehlt,
fröhlich singen und spielen. Das von Augustinus hier
angeführte lateinische Sprichwort muß aber nicht unbedingt
christlichen Ursprungs sein; es könnte auch allgemein auf die
notwendige enge Verbindung von Führenden und
Ausführenden in einer Gemeinschaft hinweisen.
Daß man meistens von einer »Erneuerung (oder Reform) an
Haupt und Gliedern« spricht, geht auf eine Eingabe mit
Verbesserungsvorschlägen zurück, die der jüngere Guilelmus Duran-
dus, Bischof von Mende, für das von Clemens V. einberufene
Konzil von Vienne (1311) schrieb; dort heißt es: »Es scheint in
Erwägung gezogen werden zu müssen, daß es sehr nützlich und
notwendig sein würde, vor allem das, was in der Kirche Gottes
verbesserungs- und reformbedürftig ist, zu verbessern und zu
reformieren an Haupt und Gliedern.«3
L: Duden 11,314 und 12,42. 396; Otto 75 (Nr. 345). 1: Augustin. PL 36,223: »prover-
bium est antiquum et verum: ubi caput, et cetera membra.« 2: 1. Kor. 12,20-22; Eph.
1,22; 4,15. 3: Rubrica 1,2,3: »Videretur deliberandum, perquam utile fore et necessa-
rium quod ante omnia corrigerentur et reformarentur illa quae sunt in ecclesia Dei cor-
rigenda et reformanda, tarn in capite quam in membris« (zitiert nach Duden 12,42).
85
Hefe des Volkes
der »Bodensatz« des Volkes, die untersten
Bevölkerungsschichten.
Die Hefe als der zurückbleibende, untrinkbare Niederschlag bei
der Weinherstellung gilt als wertlos und ist deshalb Sinnbild
des Niedrigen, Schmutzigen und Gemeinen. Daher wurden die
unteren Bevölkerungsschichten als »Hefe des Volkes« (lat.:
»faex civitatis«) bezeichnet. So spricht z. B. Cicero in seiner
Verteidigungsrede für L. Valerius Flaccus (seinen wichtigsten
Helfer gegen Catilina; vgl. -♦ catilinarische Existenz) im Jahre 59
v. Chr. davon, wie leicht bei einer griechischen
Volksversammlung die Meinung der »faex civitatis« zu beeinflussen sei.1 An
seinen Freund Atticus schreibt er Anfang Juli 61 v. Chr.: »Mit
den Optimaten stehe ich noch genauso wie bei deiner Abreise,
mit dem Unrat und der Hefe der Stadt viel besser als damals.«2
Andere lateinische Wendungen lauteten »aus der Hefe
schöpfen« (sich nur mit dem Schlechtesten befassen)3 und
»ganz bis auf die Hefe herabkommen« (zugrunde gehen).4
Letzteres findet sich deutsch bei Luther wieder: »Es kommt auf die
Hefen.«5
L: Böttcher 61 (Nr. 303-304); Büchmann 316; Duden 12,215; Otto 130 (Nr. 633);
Wander 2,455 (Hefe 17). 1: Gc. pro Flacco 8,18. 2: Cic. Att. 1,16,11: »Apud bonos
iidem sumus, quos reliquisti; apud sordem urbis et faecem multo melius nunc, quam
reliquisti« (Übers. H. Kasten). Vgl. ferner Apoll. Sidon. carm. 9,232; Cic. ad Att. 2,1,8. 3:
Lucr. 5,1141: »Der Staat kam auf die Hefen«, d.h. herunter (»Res itaque ad summam
faecem turbasque redibat«). 4: Cic. Brut. 69,244: »Tu quidem de faece, inquit, hauris«
(»Du beschäftigst dich nur mit den schlechtesten und geringsten« [Rednern]). 5:
Tischreden 479b nach Wander 2,455 (Hefe 1 7).
KEINEN (ROTEN) HELLER WERT SEIN
nicht das Geringste wert sein; auch: keinen
lumpigen/blutigen Heller; auch mit anderen Verben, z.B.: keinen Heller
geben/schulden: nicht das Geringste geben/schulden; bis
auf den letzten Heller/Kreuzer: bis auf den letzten Rest,
vollständig, bis ins Kleinste.
Das As war bei den Römern die kleinste Münze und damit
Sinnbild des Geringen und Wertlosen. Dabei findet sich häufiger als
»kein As wert sein« die Redensart »nur ein As wert sein« oder
»nur für ein As wert halten«; z.B. fordert der Dichter Catull
86
seine Geliebte auf, auf alles Gerede der allzu verbohrten Alten
»nur ein As zu geben« - also eben nichts.1 Eine Person, die nur
ein As (also fast nichts) wert war, konnte man als »assarius« (As-
stück) bezeichnen,2 fast so, wie wir jemanden zum »falschen
Fuffziger« erklären können. »Ad assem« (»bis auf ein As«)
bedeutete »bis auf den letzten Rest« (entsprechend dem
deutschen »bis auf den letzten Kreuzer«)3 oder »bis in die kleinste
Einzelheit« (entsprechend deutsch »auf Heller und Pfennig«).4
Der »Heller« trägt seinen Namen nach der Stadt Schwäbisch
Hall, wo der »Haller pfenninc« seit dem 12. Jh. geprägt wurde,
und erscheint wie der »Deut« und der »Dreier« gern in
Redensarten, die einen geringen Wert oder kleinen Rest bezeichnen.
»Rot« (manchmal auch »blutig«) wird er von der Farbe des
Kupfers her genannt. Der »letzte Heller« ist im Deutschen vor allem
durch die Übersetzung von Matth. 5,26 geläufig.5
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 220; Böttcher 135 (Nr. 811); Büchmann 38; Duden
11,321; Otto 39 (Nr. 175-1 76); Wander 1,154 f. mit weiteren Belegen und Varianten.
1: Catull. 5,3: »... unius aestimemus assis«; vgl. 42,13. Diverse weitere Beispiele nennt
Otto 39 (Nr. 175). 2: Sen. apoc. 11,2. 3: Hör. ep. 2,2,27; s. 1,1,43. 4: Plin. ep. 1,15,1;
Apoll. Sidon. ep. 3,3,9. 5: »Wahrlich, ich sage dir: Du wirst nicht von dannen
herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlest.«
Das Hemd ist mir näher als der Rock
Man muß Prioritäten setzen.
Im »Dreigroschenstück« des lateinischen Dichters Plautus
rechtfertigt sich der junge Lysiteles mit diesen Worten dafür,
daß er zuerst seinen künftigen Schwiegervater Charmides und
erst dann dessen Freund Callicles begrüßt: »Auch du sei
gegrüßt, Callicles; doch dieser kommt für mich zuerst: Das Hemd
ist näher als der Rock.«1 Mit dem »Hemd« ist hier die Tunika,
das römische Untergewand, gemeint, während der »Rock« das
Pallium, ein beliebtes rechteckiges Obergewand, ist und damit
dem Körper ferner steht als die Tunika.
Im Griechischen gab es mit entsprechendem Sinn bereits das
auch in Rom gern zitierte Sprichwort »Das Knie ist mir näher
als das Schienbein« und vielleicht auch umgekehrt »Das
Schienbein ist weiter weg als das Knie«.2
Im Deutschen wurde das Sprichwort zuerst in der Form »Das
hembd liegt eim näher dann der rock« eingeführt und kann als
Begründung für alles verwendet werden, was den Vorrang vor
87
anderem erhalten soll (meistens die eigenen Interessen vor
denen anderer). Bisweilen wird es auch anzüglich-ironisch
abgewandelt, wie von Klaus Möckel: »Ihr Hemd war mir näher als
mein Rock, sagte der Ehebrecher.«3
L: Bartels 179; Böttcher 55 (Nr. 254-255); Büchmann 312; Duden 11,321-322 und
12,218; MIetzko 55. 86. 98; Otto 262 (Nr. 1 324); Wander 2,499 (Hemd 3). 1: Plaut.
Trin. 1154: »... tynica prQpior paJIiQSt.« 2: Sen. apoc. 10,3: eyyiov -yovv Kv%r|<;; Ze-
nob. 3,2: -yöVu kvtiiitk eY/10^' umgekehrt: Theokr. Id. 16,18: Ärcoxepü) r\ -yöVu Kvd(ia.
3: Mieder, Antisprichwörter 55 mit Beleg. S: Ndl. »Mijn hemd is mij nader dan mijn rok
(en mijn vleesch nader dan mijn hemd)«.
Wie der Herr, so's Gescherr
Vom (negativen) Verhalten eines Untergebenen oder
Angestellten läßt sich auf den Herrn oder Vorgesetzten schließen
(und umgekehrt). Auch: Wie der Herr, so der Knecht.
Während des Gelages bei Trimalchio in Petronius' Roman »Sa-
tyrica« geraten die Gäste untereinander in Streit. Neureiche
Freigelassene beschimpfen ihre ehemaligen Herren und sich
gegenseitig - und dabei sagt einer zu einem anderen: »Ganz wie
der Herr, so auch der Sklave!«1 - der Angesprochene habe also
genauso schlechte Manieren wie sein ehemaliger Besitzer. Ein
ähnliches griechisches Sprichwort lautete: »Wie die Herrin, so
die Hündin.«2 Der Kirchenvater Hieronymus kehrte die
Bezugsrichtung um, indem er forderte: »Der Herrscher soll so
beschaffen sein wie jene, die beherrscht werden.«3 Die gereimte
lateinische Fassung »Qualis rex, talis grex« (»Wie der König, so die
Herde«) ist erst im Mittelalter entstanden.
Im Deutschen ist dann - wohl zum Zwecke des Reims - für
den Untergebenen (Sklave, Haustier) das »Gescherr« (Geschirr,
d.h. Gerät, Werkzeug) eingetreten, in dem jener »angeschirrt«
ist.
L: Bartels 143; Böttcher 80 (Nr. 458-459); Büchmann 341; Duden 11,324 und 12,537;
MIetzko 50. 56; Otto 119 (Nr. 571), vgl. auch 300 (Nr. 1538). 1: Petron. 58,3: »Plane
qualis dominus, talis et servus.« Vgl. Cic. fam. 1,9,12. 2: Cic. Att. 5,11,5: oiarap T|
Öearcoiva xoia xr\ kuüjv. 3: Hieron. ep. 7,5: »...talisque sit rector, quales illi, qui
reguntur.«
88
*>
Von ganzem Herzen.
VON GANZEM HERZEN
mit völliger Hingabe, mit fester Überzeugung; auch: aus
tiefster Brust: aus tiefstem Innern, unter großer innerer
Beteiligung.
»Mit ganzer Brust« (»toto pectore«) bedeutete schon bei den
Römern »mit ganzem Ernst, mit ganzer Hingabe, mit ganzem
Herzen«. Zum Beispiel fragt Cicero: »Wo ist jene heilige
Freundschaft, wenn nicht gerade ein Freund an sich von ganzem
Herzen, wie man sagt, geliebt wird?«1 Ebenso ist die Wendung »aus
tiefster Brust« lateinisch (»ab imo pectore«) bei mehreren
Dichtern belegt. Zum Beispiel spricht bei Vergil der Held Aeneas, als
er in Afrika auf die karthagische Königin Dido trifft, »aus
tiefster Brust die Stimme ziehend«2 oder gibt, als er in Karthago an
einer Tempelwand eine Abbildung vom Tod des Trojaners Hek-
tor erblickt, »aus tiefster Brust einen ungeheuren Seufzer von
sich«.3
L: Bartels 33; Otto 270 (Nr. 1368). 1: Cic. leg. 1,49; weitere Stellen bespricht Er. ad.
1,4,26. 2: Verg. Aen. 1,371: »imo_que trahe/is a pgctore vc»cem«. 3: Verg. Aen. 1,485:
»ingentgm gemitym dat pectore ab imo«. Vgl. ferner: Catull. 64,198; Lucr. 3,57.
JEMANDEN IN DEN HlMMEL ERHEBEN
jemanden wie einen Überirdischen loben, übermäßig
preisen (vgl. die Adj. himmelhoch, himmelweit); anhimmeln:
jdn. verehren, für jdn. schwärmen; im (siebten) Himmel
sein: überglücklich sein; vgl.: aus allen Wolken fallen:
überraschend enttäuscht werden.
Als »im Himmel« konnte sich auch nach römischem
Sprachgebrauch ein Mensch bezeichnen, der überglücklich war. Ein
möglicher Weg, um in diesen Zustand zu gelangen, war, in den
Himmel gelobt zu werden. So schreibt Cicero über den
amtierenden Konsul Bibulus: »Bibulus ist im Himmel. Ich weiß zwar
nicht warum, aber er wird so sehr gelobt.«1 Und: »Durch die
Bewunderung und die Beliebtheit bei den Leuten ist Bibulus
im Himmel.«2 Allerdings konnte dieser Zustand jäh ein Ende
nehmen. Bereits im nächsten Brief schreibt Cicero: »Er ist von
den Sternen herabgestürzt.«3 Und so bot er nach Cicero ein
entsprechend jämmerliches Schauspiel.
Allgemein kann »in den Himmel gelangen« bedeuten, Erfolg
90
zu haben. So sagt in Petronius' Roman »Satyrica« ein Gast über
die Frau des Trimalchio, sie sei »in den Himmel gegangen«;4
dies bedeutete, den sozialen Aufstieg geschafft zu haben: von
der Sklavin zur Vorsteherin eines Haushaltes, dessen Reichtum
unermeßlich war. Oder wie einer der Gäste es sagt: »Sie mißt
das Geld mit dem Scheffel ab.«
Auch im Deutschen kann jemand sein Glück beschreiben,
indem er sich als »im Himmel« bezeichnet, allerdings ist aus
dem Himmel bei uns meist der »siebte« Himmel geworden. Die
allgemeine Hochschätzung der Sieben in den alten Kulturen
dürfte daher rühren, daß man sieben Himmelskörper als
Planeten betrachtete (Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Saturn
und Jupiter). Dadurch fand die Zahl Sieben auf zwei Wegen
Eingang in die religös-kosmologischen Spekulationen: Zum
einen wurde eine Siebenzahl der Himmel und Unterwelten
prognostiziert, was einerseits ihre Vollkommenheit ausdrückte,
es andererseits aber auch ermöglichte, Abstufungen zu machen
(vgl. »im untersten Kreis der Hölle«). Gleichzeitig konstruierten
auch die Philosophen wegen der sieben Planeten ein
siebenstufiges Himmelsmodell. Auf jeden Fall ist »im siebten Himmel«
dadurch synonym mit »im höchsten Himmel«.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 223; Duden 11,336; Otto 62 (Nr. 288). 1: Cic. Att.
2,19,2. 2: Cic. Att. 2,20,4. 3: Cic. Att. 2,21,4. 4: Petron. 37.
Der Himmel fällt ein
Alles stürzt zusammen, die Welt geht unter; * ich hätte eher
des Himmels Einsturz erwartet:1 damit habe ich gar nicht
gerechnet. Wenn der Himmel einstürzt, treffen die
Trümmer einen Unerschrockenen: Mich kann nichts
erschrecken.
Die Angst vor einem Einstürzen des Himmels galt Griechen
und Römern als typisch für einen übermäßig ängstlichen
Menschen.2 Umgekehrt diente die unerschrockene Redensart
»selbst wenn der Himmel einfiele« bei den Römern dazu,
besonders großen Willen oder Mut auszudrücken; so heißt es bei
dem Grammatiker Varro: »Ferner hat die meisten ein so großer
Ehrgeiz befallen, daß sie nur wünschen, selbst wenn der
Himmel einfiele, ein Amt zu erreichen.«3
Bei Horaz finden wir das noch im Deutschen gebrauchte
91
Wort: »Wenn die Welt zerborsten zusammenfiele, / einen
Unerschrockenen werden treffen die Trümmer.«4 In einem
anderen deutschen Sprichwort wird dem Einfallen des Himmels
scherzhaft etwas Gutes abgewonnen: »Wenn der Himmel
einfiele, wären alle Spatzen gefangen.«
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 223; Otto 61-62 (Nr. 286). 1: Ältere Form: »Ich hette
mich ehe des hymelfalls versehen«: Joh. Agricola Nr. 436 u.a. nach
Borchardt-Wustmann-Schoppe 223. 2: Theogn. 869; Ter. Heaut. 719. 3: Varro bei Non. p. 499,24:
»Tanta porro invasit cupiditas honorum plerisque, ut vel caelum ruere, modo magistra-
tum adipiscantur, exoptent.« Vgl. Sen. nat. quaest. 6,32,4; Probus zu Verg. ecl. 7,31.
4: Hor. c. 3,3,7: »Si fractus {Habetur Qrbis, / impavidym ferie/it ruinae.«
JEMANDEM DIE HÖRNER ZEIGEN
kräftig entgegentreten, sich kräftig zur Wehr setzen (auch
aggressiver: auf die Hörner nehmen). Vgl.: jemandem die
Stirn bieten.
Da Tiere mit Hörnern diese zum Kampf benutzen, sind die
Hörner seit jeher Zeichen von Mut, Kraft und Kampfbereitschaft.
Zum Beispiel sagt der Dichter Horaz zu einer Schale guten
Weins: »Du bringst Hoffnung zurück den ängstlichen Seelen /
und verleihst Kräfte und Hörner dem Armen ...«1 Die Redensart
»jemandem die Hörner zuwenden« (»cornua obvertere alicui«)
findet sich zuerst bei Plautus und später bei Horaz und Apu-
leius.2 Im Deutschen begegnet sie mehrfach bei Luther und ist
dadurch geläufig geworden.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 231; Duden 11,350; Otto 93-94 (Nr. 439-440).
1: Hor. c. 3,21,17-18: »Tu spgm redycis mentibus anxns / virjsque et addis co_rnua
pauperi.« Weitere Stellen nennt Otto 94 (Nr. 440). 2: Plaut. Pseud. 1021; Hor. epod.
6,12; Apul. apol. 81.
Hunde, die bellen, beissen nicht
Wer laut schimpft, tut gewöhnlich nichts Schlimmeres; wer
viel Lärm macht, ist gewöhnlich harmlos. Auch: Bange
Hunde bellen viel; bellende Hunde beißen nicht.
Von Varro wird ein Satz des Dichters Ennius (239-169 v. Chr.)
überliefert: »Ein Hund ohne Zähne bellt.«1 Das bedeutet
natürlich umgekehrt, daß ein bellender Hund keine Zähne hat - und
damit wohl ungefährlich ist. Dem deutschen Sprichwort etwas
näher kommt eine zweite Quelle: In der »Geschichte Alexan-
92
ders des Großen« des Curtius Rufus (1. /2. Jh. n. Chr.) erscheint
bei einem Gastmahl Alexanders ein medischer Magier
namens Cobares, der eine Reihe von Spruchweisheiten aufzählt.
Daraufhin »fügte er noch hinzu, was bei den Baktrem
gemeinhin verbreitet war: Daß ein ängstlicher Hund heftiger belle als
beiße.«2
Anschließend habe Cobares übrigens das Sprichwort
vorgetragen, »daß alle ganz tiefen Flüsse mit ganz leisem Ton
dahinflössen« (-♦ Stille Wasser sind tief).
L: Duden 11,354; Mletzko 16. 60; Otto 70 (Nr. 321). 1: Ennius bei Varro 1.1. 7,32: »Ca-
nis sine dentibus latrat« (p. 76 Vahl. n. 410 Baehr). 2: Curt. 7,4,13: »Adicit deinde,
quod apud Bactrianos vulgo usurpabant, canem timidum vehementius latrare quam
mordere...« Vgl. lul. Valer. 1,43,55.
Achtung vor dem Hund!
Vorsicht, bissiger Hund!
Diese Aufschrift (lat.: »Cave canem!«) war häufig am Tor oder
auf der Schwelle römischer Villen angebracht. In Pompeji
wurden im Eingangsbereich mehrerer Häuser entsprechende
Mosaiken mitsamt dem Bild eines Hundes gefunden. Auch der
Schriftsteller Petronius überliefert diese Sitte in seinem Roman
»Satyrica«, in dem der Erzähler das pomphafte Haus eines
Gastgebers beschreibt: »Im übrigen wäre ich selber, während ich
alles bestaunte, fast hintüber gefallen und hätte mir die Beine
gebrochen. Denn links vom Eingang war unfern der Portierloge
ein riesiger Kettenhund an die Wand gemalt, und darüber
stand in Großbuchstaben: >CAVE CANEM<«1
L: Böttcher 80 (Nr. 453-454); Duden 12,88. 1: Petron. 29,1.
93
I
auf den Index setzen
auf eine Verbotsliste setzen, vor der Öffentlichkeit
versperren, verbieten.
Erstmals 1559 unter Papst Paul IV wurde vom Vatikan die
Sammlung »Index librorum prohibitorum« herausgegeben, ein
»Anzeiger« (lat.: »index«) ausdrücklich verbotener Bücher.
Bedeutend waren die Ausgaben von 1564 (tridentinischer Index,
durch Pius IV) und 1900 (Benedikts III.). Mit der Zeit wurden
alle unliebsamen, d.h. antikatholischen, antireligiösen,
antipäpstlichen, Irrlehren und Aberglauben verbreitenden Bücher
(sogar der Urtext oder alte katholische Übersetzungen der Bibel)
und Autoren (z. B. Voltaire, Lessing, Heine) in die Verzeichnisse
aufgenommen. Insgesamt gab es 40 päpstliche Indizes, die
letzte Ausgabe erschien 1948. 1966 wurde der Index außer
Kraft gesetzt.1
L: Böttcher 201-202 (Nr. 1190); Büchmann 373. 1: Erlasse der Glaubenskongregation
vom 14. 6. und 15. 11. 1966 mit Wirkung vom 29. 3. 1967.
iNTUS HABEN
verinnerlicht haben, geistig beherrschen, können.
Das lateinische Wort »intus« bedeutet »innen, im Innern« und
wird in der antiken Literatur auch gern beim Menschen
angewandt, in dessen »Innern« (d.h. in seinem Herzen, in seiner
Seele) etwas vorgeht oder dessen Inneres man gut kennt. So
sagt z.B. der Satiriker Persius: »Ich kenne dich von innen und
außen« (d.h. vollständig).1
Das deutsche »etwas intus haben« ist eine
umgangssprachliche Wendung, deren Entstehung vermutlich in das 19. Jh.
zurückgeht.
L: Otto 104 (Nr. 492). 1: Pers. 3,30: »ego te intus et in cute novi.« Zitiert von Hieron.
ep. 58,7 und adv. Rufin. 2,16.
94
J
JANUSKÖPFIC
zweischneidig, positiv und negativ zugleich. Januskopf:
Eine Sache oder ein Mensch mit zwei sehr
unterschiedlichen Seiten.
Janus (lat.: »Ianus«) war der römische Gott der öffentlichen
Tore und Durchgänge und damit der Gott des Anfangs, der in
allen Gebeten als erster genannt wurde. Dem Doppelcharakter
eines Tores als Ein- und Ausgang entspricht die
doppelgesichtige Darstellung des Janus, wobei ein Gesicht den Hinterkopf
des anderen bildet und in die entgegengesetzte Richtung blickt.
»Janusköpfig« ist demnach eine Sache, die noch eine andere
Seite (zumeist eine böse neben einer guten) besitzt (ähnlich
den »zwei Seiten einer Medaille«). Aus dem Griechischen ist die
im Lateinischen nicht nachweisbare Redensart »ein anderer
Janus« für einen Menschen mit zwei Seiten überliefert.1
Dem Janus war in Rom an der Nordseite des Forum Roma-
num ein doppelter Torbogen (»Ianus Geminus«) geweiht. Nach
altem Brauch sollte der Bogen nur dann geschlossen werden,
wenn an allen Grenzen Frieden herrschte, was man als
Einschließen des Krieges oder Festhalten des Friedens gedeutet hat.
Nachdem der Bogen in republikanischer Zeit nur einige wenige
Male hatte geschlossen werden können, belebte Kaiser
Augustus durch dreimalige Schließung des Bogens diese Sitte ganz
bewußt, um sich als Friedensbringer zu propagieren (-♦ pax Au-
gusta). Wie man sich in seiner Zeit den darin eingeschlossenen
Krieg bildlich vorstellte, schildert der Dichter Vergil: »...mit
Eisen und festen Klammern wird man / die grausigen Tore
des Krieges schließen; der ruchlose Wahnsinn sitzt drinnen /
über schrecklichen Waffen, hinter dem Rücken gefesselt mit
hundert / ehernen Knoten, wird kreischen furchtbar mit
bluttriefendem Maul.«2 Nach Augustus nahmen auch die Kaiser
Nero und Vespasian eine feierliche Schließung des Bogens vor.3
95
L: Otto 170 (Nr. 841). Ausführlich zur Rezeption: Stichwörter 78-82 u. Komm.
124-129.1: Apost. 8,98: »Ein anderer Janus: (Das sagt man) von den Zweigesichtigen;
denn von der Art ist Janus.« ( lavvo<; dAAoq im xcöv SiTcpoaümcov. xoioutoq ydp o
" Iavvoq). Vgl. Pers. 1,58, Athen. 15,692 D. Das Sprichwort dürfte aber auf ein
lateinisches Vorbild zurückgehen. 2: Verg. Aen. 1,293-296: »...dirae ferro fit compagibus
artis / claydenty/ Belli portaej Furor impius intus / safiva sedgns super arma et cgntum
vinctus agnis / pQSt tergym nodis fremet hQrridus o_re crugnto.« 3: Details und Belege
zum ganzen Stichwort bietet Der Kleine Pauly 2,1311-1314.
Jedem das Seine!
(auch lat.: »suum cuique«) Jeder soll bekommen, was er
verdient / soll tun, was er mag oder kann. Vgl. die
Sprichwörter: Jedem Narren gefällt seine Kappe; jedem gefällt das
Seine.
Nach Gellius geht diese Forderung auf den Politiker und
Schriftsteller Cato den Älteren (234-149 v.Chr.) zurück, der
sagte: »Von mir aus ist es jedem erlaubt, das Seine zu
gebrauchen oder zu genießen.«1 Dieses Wort hat nun zum einen in
dem toleranten Sinne von »Jedem gefalle ruhig das Seine«
fortgewirkt. Cicero schreibt über das tragische Theater: »Denn
in diesem Genre gilt mehr als in anderen jedem das Seine
als schön.«2 Noch allgemeiner findet dieser Sinn sich bei Petro-
nius im 1. Jh.: »Wir sehen, daß jedem seine Sache am liebsten
ist.«3
Zum anderen griff Cicero die Worte Catos als kurze
Formulierung für den von Piaton geprägten Gedanken auf, daß jedem
das Seine, das ihm Gebührende und Zukommende,
zuzuteilen sei: »Und jene [d.h. die großen griechischen Gelehrten]
meinen, daß jene Sache [das Gesetz, griech. vö|io<;, abgeleitet
von ve^co (zuteilen)] mit der griechischen Bezeichnung nach
dem Jedem das Seine zuteilen< benannt sei, während ich
meine, daß sie im Lateinischen [lex: Gesetz] von >auswählen<
[legere] kommt.«4 Gerechtigkeit bestehe in der
Aufrechterhaltung der menschlichen Gesellschaft, im »Zuteilen des Seinigen
an jeden«5 sowie in der Verläßlichkeit von Verträgen. Später
wurde der politische Grundsatz zur Rechtsregel: »Gerechtigkeit
ist der beständige und dauerhafte Wille, jedem sein Recht
zuzuteilen.«6
Friedrich I. von Preußen (1688-1713) hatte »suum cuique«
als persönlichen Wahlspruch und verwendete ihn erstmals
1677 als Kronprinz auf einer Schaumünze; dann wurde es De-
96
vise des am 17. 1. 1701 gestifteten Ordens vom Schwarzen
Adler.7 Dieser war der höchste Orden, der in Preußen für zivile
und militärische Leistungen vergeben werden konnte. Die
Nationalsozialisten erklärten mit dem Satz »Jedem das Seine« ihr
Verständnis von »Sozialismus«, wie Goebbels 1930 definierte:
»Wahrer Sozialismus heißt nicht: allen das Gleiche, sondern:
jedem das Seine.«8 Letztlich wurden damit Diskriminierung,
Verfolgung und Massenmord als »das Seine« gerechtfertigt.
Entsprechend zierte das Motto, in zynischster Weise
mißbraucht, das Tor des Konzentrationslagers Buchenwald.
L: Bartels 1 72-1 73; Böttcher 59 (Nr. 287-288); Büchmann 367; Duden 11,656; Fritsch
556; Mletzko 61. 107; Otto 337-338 (Nr. 1 726); Reichert 42. 62; Wander 4,524-525
(das Seine 7). 1: Gell. 1 3,24,1: »Suum cuique per me uti atque frui licet.« 2: Cic. Tusc.
5,22,63: »In hoc enim genere ... magis quam in aliis suum cuique pulchrum est.« Vgl.
Cic. Att. 14,20,3. 3: Petron. 15,1: »videmus, inquit, suam cuique rem esse carissimam.«
Vgl. auch Plin. nat. 14,71. 4: Cic. leg. 1,6,19: »Eamque rem (d.h. legem) illi Graeco pu-
tant nomine a suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a legende« Vgl. Plat.
Staat 4,10. 5: Cic. off. 1,5,15: »in ... tribuendoque suum cuique...« 6: Ulpian, Digesten
1,1 »De iustitia et iure« 10: »lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique
tribuendi.« Daher Shakespeare, Andronicus 1,2: »Suum cuique spricht des Römers
Recht.« 7: H. j. Schoeps, Preußen. Geschichte eines Staates, Berlin 1966. 8: Rede vom
11. Mai 1930 nach Mieder, Sprichwörter 192.
Jeder ist sich selbst der Nächste
Jeder Mensch ist in gewissem Maße egoistisch (und darf es
sein).
In Terenz' Komödie »Andria« will ein Vater prüfen, wie ernst es
seinem Sohn Pamphilus mit der Liebe zu einem Mädchen ist,
und gibt daher vor, ihn mit einer anderen verheiraten zu
wollen. Ein Freund des Sohnes, der diese andere umwirbt, fürchtet,
Pamphilus werde sich in die verlangte Heirat schicken; so wirft
er ihm vor, er handle nach dem Grundsatz: »Ich bin mir selbst
der Nächste!«1 Bei griechischen Autoren finden sich zuvor
Gedanken wie »Jeder ist sich selbst ein Freund« oder »Jeder liebt
sich selbst mehr als den Nachbarn«, die dazu als Vorlage
gedient haben mögen.2
In den spätantiken »Disticha Catonis«, einer
moralischpädagogischen Spruchsammlung unter dem Namen Catos
d. Ä., wird ein solcher Egoismus demjenigen empfohlen, der
seinen Wohlstand bewahren möchte: »Wenn du erfolgreich
geworden bist, sollst du dir immer der Nächste sein.«3
97
Das Sprichwort wird heute zumeist als Rechtfertigung
angeführt, wenn man in auffälliger Weise zuerst die eigenen
Interessen wahrnimmt (vgl. auch -► Das Hemd ist mir näher als der
Rock). Bisweilen wird es auch als Gegensatz zum biblischen
Gebot »Liebe deinen Nächsten!« aufgefaßt und diesem
gegenübergestellt - zu Unrecht, denn biblisch heißt es vollständig:
»Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«4
L: Böttcher 57 (Nr. 269-270); Büchmann 312; Duden 11,365 und 12,263; Mletzko 61.
85. 109; Otto 289 (Nr. 1479); Wander 2,1010 (Jeder 64) und 3,842 (Nächster 16). 1:
Ter. Andr. 636: »Pro_xumys sum egomgt mihi.« 2: Belege dazu sowie weitere nennt Otto
289 (Nr. 1479). 3: Dist. Cat. 1,40: »Cum fuerjs feljx, sempe/ tibi pro_ximus gsto.« 4: 3.
Mose 19,18 und öfter.
K
Kadavergehorsam
blinder Gehorsam, der ohne Nachfragen oder eigenen
Willen geleistet wird.
Der »Kadaver« ist nicht nur ein Fremdwort aus dem
Lateinischen für »Leichnam«, sondern hat auch dem willenlosen
Gehorsam (wie von einem Leichnam, einem »Untoten«) den
Namen gegeben: Ignatius von Loyola, der Begründer des
Jesuitenordens, schreibt in seinen »Bestimmungen der Gesellschaft
Jesu« (Antwerpen 1702) den Brüdern vor, sich von der
göttlichen Vorsehung durch die Oberen tragen und leiten zu lassen,
»als wären sie ein Leichnam, der sich überall hintragen und auf
jede beliebige Weise behandeln läßt« (lat.: »perinde ac si cada-
ver essent, quod quoquo versus ferri et quacunque ratione trac-
tari sesinit«).1
98
Doch beschränkte Ignatius selbst diese Art des Gehorsams
auf solche Fälle, »in denen nichts Sündhaftes erblickt wird«,2
und auf Dinge, »auf die sich der Gehorsam mit Hochachtung
ausdehnen kann«.3 Er wertete jedoch den Gehorsam als
Zurückstellung des eigenen Selbst grundsätzlich positiv wie in
der christlichen Tradition bereits Johannes Climacus (gest. um
600): Nach ihm ist der Gehorsam »die vollständige Aufhebung
der eigenen Seele, die Ertötung der Sinne in der lebendigen
Seele, der freiwillige Tod, das Begräbnis des Willens«.4
In negativem Sinne wurde der Ausdruck »Kadavergehorsam«
im 19. Jh. als Schlagwort gegen Untertanengeist gebräuchlich.
Er wird auch heute noch stets abwertend zur Beschreibung
einer völlig willen- und kritiklosen Unterordnung verwendet.
L: Böttcher 204 (Nr. 1199); Büchmann 354; Duden 12,270. 1: Constitutiones Societa-
tis lesu 4,1. 2: 3,1,23: »Ubi peccatum non cerneretur.« 3: 4,1,1: »ad quas potest cum
charitate se obedientia extendere.« 4: De scala paradisi gradus 4 (PL 88,680).
KLASSISCH
erstrangig, mustergültig, von zeitlosem Wert; oft auf die
Antike bezogen, klassische Antike: das antike Griechenland v.
a. des 5. Jh. v. Chr. bzw. Rom v. a. des 1. Jh. v. Chr.;
klassischer Boden: Landschaft der griechisch-römischen Antike;1
allgemeiner z.B.: die klassische Zeit der Eisenbahn;
Preußen, das klassische Land der Schulen und Kasernen.2
Oft in der Form: Das ist schon klassisch: Das ist schon
allgemein bekannt und berühmt. Klassik: Periode erstrangiger
kultureller Leistungen (z. B. deutsche Klassik: Literatur und
Kultur des 18. Jh.); Klassizismus: Anlehnung an die
klassische Antike (in der Kunst des 17.-19. Jh.).
Das lateinische Adjektiv »classicus« (von classis Steuerklasse;
davon dt. »Klasse« für eine Schülergruppe oder Abteilung jeder
Art) bedeutet eigentlich »zur ersten Steuerklasse [»classis
prima«] gehörend«. So wie heute im Deutschen »Klasse haben«
etwas Herausragendes bedeutet, erhielt »klassisch« in der
Kaiserzeit den Sinn von »erstrangig, mustergültig«: Gellius spricht
von einem »klassischen und beflissenen, nicht primitiven
Schriftsteller«.3 Im Deutschen erschien der Begriff erstmals im
18. Jh. für vorbildhafte antike Autoren, dann auch für Meister
der deutschen Sprache.
99
Der Satz »Das ist klassisch!« wurde durch Johann Nepomuk
Nestroy (1801-1862) gefördert, in dessen Posse »Einen Jux will
er sich machen« (1842) der Hausknecht Melchior gern das
Wort »klassisch« gebraucht; »klassisch« nennt er einen Kaffee,
das Aussehen oder Verhalten einer Person und schließlich
sogar eine Situation: »Ja, das ist klassisch!«4
L: Böttcher 86 (Nr. 501) und 474 (Nr. 3111); Büchmann 345. 1: Details dazu bietet
Duden 12,279. 2: Dieses Wort wurde von Johann jacoby (Heinrich Simon, 2. Aufl.
1865, 110) Victor Cousin zugeschrieben: Böttcher 525 (Nr. 3462). 3: Gell. 19,8,15:
»classicus assiduusque scriptor, non proletarius.« 4:1,6.
Kleider machen Leute
auf Äußeres wird stets (zu) großer Wert gelegt, gute Kleider
bestimmen das Ansehen.
Der bisweilen zitierte lateinische Satz »vestis virum reddit«
(»Die Kleidung macht zum Mann«) ist zwar nicht antik, doch
wird der Grundgedanke bereits von dem Rhetoriklehrer Quinti-
lian (1. Jh. n. Chr.) geäußert und auf ein (im Original nicht
erhaltenes) griechisches Wort zurückgeführt: »Auch eine
anständige und beeindruckende Kleidung verleiht den Menschen, wie
es in einem griechischen Vers bezeugt ist, Autorität.«1 Warnend
fügt er hinzu: »Aber eine weibische und luxuriöse schmückt
nicht den Körper, sondern enthüllt die Gesinnung.«2
Im Deutschen erscheint das Sprichwort in den
»Sinngedichten« von Friedrich von Logau (1604-1655): »Kleider machen
Leute; trifft es richtig ein, / Werdet ihr, ihr Schneider, Gottes
Pfuscher sein.«3 Allgemeine Bekanntheit fand das Wort aber
erst durch Gottfried Kellers (1819-1890) gleichnamige Novelle
aus dem Zyklus »Die Leute von Seldwyla« (1873).
Ein anderes deutsches Sprichwort beleuchtet kritisch
denjenigen, der in den Kleidern steckt: »Die Kutte macht noch
keinen Mönch.« Daß es auf Äußerlichkeiten letztlich nicht
ankommt, brachte auch der römische Philosoph Seneca sehr
deutlich zum Ausdruck: »So wie derjenige töricht ist, der, wenn
er ein Pferd kaufen will, nicht es selbst, sondern seinen Sattel
und seine Zügel inspiziert, so überaus töricht ist derjenige, der
einen Menschen entweder nach seiner Kleidung beurteilt oder
nach der Situation, die uns nach Art eines Kleidungsstücks
umgibt.«4
100
L: Böttcher 243 (Nr. 1496); Duden 11,388 und 12,279; Mletzko 64. 74; Otto 100 (Nr.
476); Reichert 83; Wander 2,1 377 (Kleid 140) und 2,1 738 (Kutte 1). 1: Quint. inst. 8,
pr. 20: »Et cultus concessus atque magnificus addit hominibus, ut Graeco versu testa-
tum est, auctoritatem.« 2: »...at muliebris et luxuriosus non corpus exornat, sed dete-
git mentem.« 3: Deutscher Sinn-Gedichte Drey Tausend (1654) 3. Tausend, 5. Hundert
Nr. 35 (»Kleider«). 4: Sen. ep. 47,16: »Quemadmodum stultus est, qui equum emptu-
rus non ipsum inspicit, sed Stratum eius ac frenos, sie stultissimus est, qui hominem aut
ex veste aut ex condicione, quae vestis modo nobis circumdata est.«
Auf einen groben Klotz gehört ein
grober Keil
unhöfliche Behandlung mit Gleichem erwidern.
Dieser Satz aus der Holzhackersprache wird schon von
Hieronymus (um 350-420) als ein »im Volk verbreitetes
Sprichwort« überliefert: »Für einen üblen Baumstumpf muß ein übler
Keil gesucht werden«, d. h., für grobe Zuhörer sind grobe Worte
erforderlich.
Von Goethe, der für seine »Knittelverssprüche« auch mehr
oder weniger bekannte Sprichwörter bearbeitete und dafür
zahlreiche Sammlungen des 16.-18. Jh. benutzte, wurde
geläufig: »Im neuen Jahre Glück und Heil; / Auf Weh und Wunden
gute Salbe! / Auf groben Klotz ein grober Keil! / Auf einen
Schelmen anderthalbe!«1
L: Böttcher 412 (Nr. 2688); Mletzko 50. 63; Otto 102 (Nr. 480); Wander 2,1405-1406
(Klotz 1). 1: Hieron. ep. 69,5. 2: Abteilung »Sprichwörtlich«, Nr. 4. B: »Auf diesen
groben Klotz setzte der SPD-Sozialexperte Professor Schellenberg einen ähnlich groben
Keil«: DIE ZEIT 52, 1971, S. 19, Sp. 4.
AUFGEWÄRMTER KOHL
alte Geschichte, abgedroschenes Zeug. Alten Kohl
aufwärmen: eine alte Geschichte erneut ins Gespräch bringen. Vgl.
in gleicher Bedeutung: kalter Kaffee.
Der Meerkohl (lat.: crambe, -es; griech. Kpd|ißr|) wurde von
Griechen und Römern als Feind des Weinstocks angesehen und
als Mittel gegen Trunkenheit gegessen.1 Wiederholt vorgesetzt
galt er jedoch als widerliche Speise, so daß ein griechisches
Sprichwort sagte: »Zweimal hintereinander Kohl ist der Tod!«2
Der römische Satiriker Iuvenal übertrug die Wendung auf
»geistigen Kohl«, d.h. auf abgegriffene Gedanken und öde Worte,
101
die die Lehrer immer wieder mit ihren Schülern durchkauen
mußten: »Aufgewärmter Kohl tötet die armen Lehrer.«3
L: Böttcher 85 (Nr. 497); Borchardt-Wustmann-Schoppe 274; Büchmann 343; Duden
11,395; Mletzko 11. 62. 66; Otto 96 (Nr. 454); Reichert 316. 1: Darüber berichtet
ausführlich Er. 1,5,38. 2: 5iq Kpänßri edvaxoq: Suid. 8iq 1272. Vgl. Basilius Magnus epist.
186-187 (PL 32,661ff.). 3: luv. 7,154: »Qccidit misero_s crambg repetita magistros.«
S: Ital.: »Cavolo riscaldato non fu mai buono« (aufgewärmter Kohl war noch nie gut).
Kohorten
große Mengen (ebenso: Legion/Legionen)
Eine Kohorte (lat.: »cohors«) war der zehnte Teil einer
römischen Legion und umfaßte im Idealfalle ca. 600 Mann. In
dichterischer Sprache konnte die Kohorte für ein Heer gesetzt
werden.1 Die übertragene Verwendung im Deutschen beschränkt
sich auf Gruppen, die einer Heeresformation ähneln, wie
»Kohorten von Demonstranten« oder »Kohorten von
Sicherheitskräften«. Die »Legion« ist in ihrem Fortleben durch ihr
Vorkommen im Markusevangelium gefördert worden, wo ein
Dämon sagt: »Legion heiße ich, denn wir sind unser viele«.2
Daraus wurde das Wort »Ihre Zahl ist Legion« geflügelt.
L: Böttcher 141 (Nr. 864); Duden 12,246. 1: Stat. Theb. 5,672. 2: Mk. 5,6.
Wer kontrolliert die Kontrolleure?
Wer eine Aufsicht ausübt, wird oft selbst zu wenig
beaufsichtigt.
Der römische Dichter Iuvenal (um 60-140) beklagt in einer
seiner Satiren die Sitten seiner Zeit (vgl. -♦ Brot und Spiele): Arm
und Reich seien von unglaublicher Gier auf Liebschaften
ergriffen, so daß es schon fast unmöglich sei, die Treue einer Ehefrau
sicherzustellen: »Ich höre, was ihr alten Freunde schon lange
anratet: >Leg' einen Riegel davor, sperr' sie ein!< Wer aber wird
die Wächter selbst bewachen? Schlau ist eine Ehefrau und
macht den Anfang bei ihnen.«1 Mit den »Wächtern« meint er
Sklaven, die - vermeintlich Eunuchen - als Aufseher über die
Frau wachen, an denen sie jedoch ihre Verführungskünste
zuerst testen dürfte.
Wohl in irrtümlicher Zurückführung auf Piatons
Idealentwurf eines Staates und die dortigen »Wächter« (d. h. die Schicht
102
der Soldaten) wird der Satz dagegen heute vor allem auf
staatliche Kontrollinstanzen bezogen, die selbst bestochen werden
oder auf andere Weise gesetzwidrig vorgehen. Der Vers Juvenals
war z. B. 1987 in den USA eine Aufschrift auf dem »Tower Com-
mission Report«, dem Gutachten einer
Präsidentenkommission über den Iran-Contra-Skandal, in dem amerikanische
Exekutivbehörden TOW-Missiles an den Iran lieferten.
L: Bartels 148; Büchmann 343; Macrone 157.1: luv. 6,346-348: »«Audio, quid vetergs
olim moneatis amici: / >po_ne seram, cohibej* sed quis custQdiet ipsos / custodgs? cauta
gst et ab illis incipit yxor.« S: Engl. »Who watches the watchers?«, »Who shall guard the
guardians?«
von Kopf bis Fuss
völlig, als ganze Person; seltener: von oben bis unten (z. B.
sich von Kopf bis Fuß mit Honig bekleckern); vgl.: vom
Scheitel bis zur Sohle.
Der lateinischer Vorläufer dieser Wendung lautet »von den
Haaren bis zu den Zehnägeln« (lat.: »a capillis usque ad un-
gues«) und begegnet beispielsweise bei Petronius, wo Freunde
erwägen, sich mit Tinte »von Kopf bis Fuß« als schwarzhäutige
Sklaven zu tarnen.1 Auch Varianten wie »vom Rand der
Zehnägel bis zum Scheitel« (Cicero), »vom Scheitel bis zum Fußende«
(Hieronymus) oder »von der Fußsohle bis zum Scheitel« (Pli-
nius d. Ä.) sind belegt.2 Bei den Kirchenvätern Hieronymus,
Augustinus und Ambrosius findet man sogar schon »von den
Füßen bis zum Kopf« (»a pedibus usque ad caput«).3 Die
alliterierende lateinische Form »a capite (usque) ad calcem« (»vom
Kopf bis zur Ferse«) ist jedoch nicht antik.
Die deutsche Wendung wurde vor allem durch das von
Marlene Dietrich im Film »Der blaue Engel« (1930) gesungene
Chanson bekannt: »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt, und das ist meine Welt, und sonst gar nichts!«4
L: Böttcher 629 (Nr. 4089); Duden 11,408 und 12,235; Mletzko 38. 67. 102.111; Otto
355-356 (Nr. 1822). 1: Petron. 102,13; weitere Beispiele: Plaut. Epid. 623; Apul. met.
3,21; Er. ad. 1,2,37. 2: Cic. Rose. 7,20; Hieron. PL 30,432; Plin. nat. 7,77. Weitere
Stellen und griechische Vorläufer nennt Otto 355-356 (Nr. 1822). 3: S. Krebs-Schmalz, An-
tibarbarus II p. 268 nach Otto 356 (Nr. 1822). 4: Regie Josef von Sternberg, Drehbuch
Carl Zuckmayer, Liedtexte Friedrich Hollaender.
103
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge
aus
Gleichartige oder Gleichgesinnte schaden einander nicht.
Krähen können sehr scharf sehen und sind äußerst vorsichtig,
weshalb es großer Schlauheit bedarf, sie zu täuschen. Wohl
deshalb gab es bei den Römern für »überaus schlau sein, alle
betrügen« die Redensart »den Krähen die Augen aushacken« (lat.:
»comicum oculos configere«); z.B. sagt Cicero in einer Rede:
»Man fand einen Schreiber, Gnaeus Flavius, der die Augen von
Krähen aushacken konnte...«1 Um 400 n. Chr. verwendet der
Philologe Macrobius in seinen »Saturnalia«, in denen er alte
Bildungsgüter wiederbeleben möchte, für einen Streit unter
Gelehrten den Vergleich, »wie wenn eine Krähe einer Krähe die
Augen aushackte«.2 Daraus läßt sich vermuten, daß es zu dieser
Zeit bereits den Gedanken gab, eine Krähe solle üblicherweise
einer anderen nicht die Augen aushacken. Entsprechend heißt
es in der »Geschichte der Franken« des Gregor von Tours (um
540-594): »An dir erfüllt sich das Sprichwort, daß ein Rabe dem
andern das Auge nicht aushackt.«3 Eine mittelalterliche
Variante lautete später: »Ein Geistlicher belegt einen Geistlichen
nicht mit dem Zehnten« (»Clericus clericum non decimat«).4
Heute bringt jemand mit dem Sprichwort zum Ausdruck,
daß er sich mit einem Gleichgestellten lieber vertragen als
bekriegen möchte. Daß es sich dabei meistens - entsprechend
dem schlechten Ruf von Krähen - um ein »Gentlemen
Agreement« unter Ganoven handelt, wird auch in einer scherzhaften
Abwandlung von Werner Ehrenforth deutlich: »Eine Krähe
hackt der anderen nicht die Augen aus, sagte der Fabrikbesitzer
und schluckte seinen Konkurrenten unversehrt.«5
L: Böttcher 89 (Nr. 51 7); Mletzko 13. 67; Otto 93 (Nr. 435-436). 1: Cic. Mur. 11,25:
»Inventus est scriba quidam, Cn. Flavius, qui comicum oculos confixerit...« Weitere
Belege in diesem Sinne bei Otto 93 (Nr. 435) und Er. ad. 1,3,75. 2: Macr. Sat. 7,5,2: »...
tamquam cornix cornici oculos effodiat (zitiert: Cornix cornici numquam oculos
effodiat.)« 3: Historiarum Francorum libri 5,18, p. 211 Kr: »Impletur in te proverbium
illud, quod corvus oculum corvi non eruit.« 4: Bonifaz VIII., Dekretalen nach Mletzko
67. 5: Mieder, AntiSprichwörter 74 mit Beleg.
104
den Krebsgang gehen
rückwärts gehen, Rückschritte machen, sich verschlechtern
(auch: den Krebsgang nehmen).
Die Beweglichkeit des Krebses führte in der Antike zu der
sprichwörtlichen Vorstellung, daß dieser üblicherweise nicht
geradeaus laufe. In einer Komödie des Dichters Plautus (um
200 v. Chr.) sagt der listige Sklave Pseudolus über den Kuppler
und Sklavenhändler Ballio, der sich vor seinem Haus mitten im
Gespräch kurz rückwärts dem Eingang zuwendet, um einen
Blick auf die Vorgänge im Haus zu werfen: »Er geht schräg,
nicht geradeaus - wie es der Krebs tut.«1 Ein Satz an anderer
Stelle beschreibt aber auch schon, wie heute die deutsche
Wendung, einen Rückwärtsgang: »Zurück zur Wand werde ich
gehen, den Krebs nachahmen.«2 Die deutsche Redensart ist
schon im Mittelalter geläufig, zuerst in Volksliedern und dann
besonders bei Luther3 sehr häufig.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 283 mit Abb. S. 282; Duden 11,415; Otto 68
(Nr. 314). 1: Plaut. Pseud. 955: »(Mluc sjs videj / ut transversus, non proversus cedit,
quasi Cancer solet). 2: Plaut. Cas. 443: »recessim cedam ad parietem, imitabor nepam.«
3: »Das geht denn sehr fein für sich, wie der Krebsgang.« Weitere deutsche Belege bei
Borchardt-Wustmann-Schoppe 283.
jemandes Kreise stören
jemanden belästigen; v. a.: Störe meine Kreise nicht! (lat:
»nQli turbare circulos meos«; auch: Störe meine Zirkel
nicht!) meine theoretischen Überlegungen haben Vorrang
vor jeder aktuellen Notwendigkeit; oder einfach: Laß mich
in Ruhe!
Die Worte »Störe meine Kreise nicht!« soll der griechische
Mathematiker und Konstrukteur Archimedes während der
römischen Eroberung seiner Heimatstadt Syrakus (212 v. Chr.) zu
einem plündernden römischen Soldaten gesagt haben, als er
gerade mit mathematischen Überlegungen über im Sand
gezeichneten Kreisen beschäftigt war. Daraufhin wurde der Denker von
dem erbosten Soldaten - gegen den ausdrücklichen Befehl des
Feldherrn Marcus Claudius Marcellus - getötet.1
Die nicht zu störenden »Kreise« werden heute meistens
allgemein für Beschäftigungen, Überlegungen oder Bereiche ver-
105
wendet, in die ein anderer nicht eindringen soll; gleichzeitig
wird scherzhaft Desinteresse an jedem noch so dringlichen
Anlaß zur Störung demonstriert.
L: Bartels 115-116; Böttcher 49 (Nr. 210-211); Büchmann 365; Der neue Büchmann
440; Duden 11,416 und 12,444; Reichert 214. 1: Quelle ist Val. Max. 8,7 ext. 7: »Noli,
obsecro, istum (circulum) disturbare.« Daraus entwickelte sich das geflügelte »Noli tur-
bare circulos meos!« Plut. Marcellus 19,8ff. gibt drei Versionen vom Tod des Archime-
des wieder, jedoch nicht die bei Val. Max. angeführte Äußerung.
L
Landesvater
beliebter Regierungschef oder Monarch; dasselbe weiblich:
Landesmutter.
Nach der Niederschlagung der Catilinarischen Verschwörung
(63 v. Chr.) feierten Senat und Volk den Redner und Konsul
Cicero als »Parens patriae« (Vater [eig. »Gebärer«] des
Vaterlandes), wie dieser selbst stolz feststellt.1 Dieselbe
Ehrenbezeichnung wurde später Gaius Iulius Caesar verliehen.2 Davon
wurde der Ehrentitel »pater patriae« (Vater des Vaterlandes)
abgeleitet, der später Augustus am 5. Februar 2 v. Chr. von Senat,
Ritterschaft und Volk übertragen wurde (vgl. -♦ pax Augusta).3
Der Titel wurde von den meisten römischen Kaisern
übernommen. Auch die Bezeichnung »Landesmutter« geht auf die
Antike zurück: Tacitus berichtet über den Regierungsantritt des
Tiberius (14 n. Chr.): »Auch gegenüber Augusta gab es viel
Schmeichelei der Senatoren: Einige meinten, sie solle >Parens
patriae< [s.o.], andere, sie solle Mutter des Vaterlandes<
genannt werden, die meisten, daß dem Namen des Caesar [d.h.
des Tiberius] >Sohn der Iulia< [d.h. der Livia Iulia Augusta]
hinzugefügt werden solle.«4
In der Renaissance erhielt in Wiederaufnahme dieser Tradi-
106
tion Cosimo Medici (1434-1464 Herrscher von Florenz und
Begründer seiner Dynastie) von seinen Anhängern den Beinamen
»Vater des Vaterlandes«. Der Florentiner Lorenzo Ghiberti
nennt ihn in der »Chronik seiner Vaterstadt« auch »Hirt des
Volkes, der Hort der Künste und Wissenschaften«.5 Doch
bereits Francesco Petrarca schrieb in seinen »Epistulae seniles«
(Nr. 14) am 28. 11. 1373 an Francesco di Carrara: »Du mußt
nicht Herr deiner Bürger, sondern Vater des Vaterlandes sein
und jene wie deine Kinder lieben.«6
L: Bartels 1 32; Böttcher 61 (Nr. 300) und 1 79 (Nr. 1090); Büchmann 344. 1: Cic. Pis.
3,6. 2: Liv. Periochae 116. 3: Mon. Anc. 35; Suet. Aug. 58. 4: Tac. Ann. 1,14,1: »Multa
patrum et in Augustam adulatio: alii parentem, alii matrem patriae appellandam, pleri-
que ut nomini Caesaris adscriberetur >luliae filius< censebant.« 5: Übers, von A. Hagen,
Leipzig 1833, Kap. 4,86. 6: Jacob Burckhardt, »Die Kultur der Renaissance in Italien«
(1860), 14. Aufl. Leipzig 1925, S. 8f.
Lebenslauf
Gesamtheit der Stationen eines Lebens.
Der Begriff des »Lebenslauf« (lat.: »curriculum vitae«, »Lauf des
Lebens«) wurde erstmals von Cicero verwendet: »Die Natur hat
uns einen winzigen Lauf des Lebens skizziert, aber einen
unermeßlichen des Ruhms.«1 - Die Lebensspanne des Menschen ist
sehr klein, während er ewig währenden Ruhm zu erreichen in
der Lage ist. Im Deutschen wurde unter »Lebenslauf« zunächst
der Lebens»ablauf« oder -»verlauf« verstanden: August
Mahlmann (1771-1826) dichtete zum Beispiel in seinem nach einer
Volksweise gesungenen »Weinlied«: »Mein Lebenslauf ist Lieb'
und Lust / Und lauter Liederklang ...«2
Erst seit dem 20. Jh. bezeichnet der Lebenslauf die
gesammelten Stationen eines Lebens, die zumeist schriftlich
zusammengestellt und z. B. bei einer Bewerbung vorgelegt werden.
L: Bartels 198; Böttcher 407 (Nr. 2660); Büchmann 315; Mletzko 71.1: Cic. Rab. 10,30:
»Etenim, Quirites, exiguum nobis vitae curriculum natura circumscripsit, immensum
gloriae.« 2: Erschienen 1803, gedr. 1808, später unter dem Titel »Das Reich der
Freude«, Str. 1,V. 1. S: Engl.: »Curriculum Vitae«, häufig abgekürzt als »CV«.
KEINE (CROSSE) LEUCHTE SEIN
in einem Wissensgebiet nicht sehr kundig sein, etwas
beschränkt sein; sein Licht leuchten lassen: sein Können oder
Wissen zeigen.
107
Das Licht oder die Leuchte steht hier für die geistige
Ausstrahlung oder Fähigkeit eines Menschen. Schon bei den Römern
bezeichnete der Wissenschaftler Plinius d. Ä. (23-79 n. Chr.)
den Schriftsteller und Politiker Cicero als eine »zweite Leuchte
der Wissenschaft«, d.h. als zweitgrößten Denker nach dem alle
überragenden Dichter Homer.1
Größere Wirkung hat das Bild jedoch durch das neutesta-
mentliche Wort »Ihr seid das Licht der Welt« (Mt. 5,14; lat.:
»vos estis lux mundi«) entfaltet, mit dem allerdings
ursprünglich mehr eine Ausstrahlung des Glaubens als des Intellekts
gemeint ist. In Anlehnung an dieses Wort haben sich die
Ehrenbezeichnungen »lumen mundi« (»Licht der Welt«) für einen
klugen Menschen, »lumen ecclesiae« (»Licht der Kirche«) für
den Kirchenvater Augustinus sowie das »Kirchenlicht« zuerst
für Luther (vgl: »er ist kein großes Kirchenlicht« in der
Bedeutung: Er ist nicht besonders helle) und andere Wittenberger
Theologen entwickelt.2 Die Aufforderung, »sein Licht leuchten
zu lassen« dürfte sich auch an Matth. 5,15 (»Man soll sein Licht
nicht unter den Scheffel stellen«) anlehnen.
L: Böttcher 84 (Nr. 487) und 134 (Nr. 807-809); Büchmann 339; Duden 11,451.1: Plin.
nat. 17,5,38: »lux doctrinarum altera.« 2: Böttcher 134 (Nr. 807-808).
Liebe überwindet alles
Mit Liebe ist alles möglich. Bisweilen als Trost über
unangenehme Arbeit: Lust und Liebe zum Dinge macht alle Arbeit
geringe.
In seiner zehnten und letzten Ekloge singt Vergil über die
unglückliche Liebe seines Freundes Gallus, des Schöpfers der
lateinischen Liebeselegie, den er dazu in eine arkadische
Hirtenlandschaft versetzt. Dort fordert der Gott Pan Gallus auf, über
den Verlust seiner untreuen Geliebten Lycoris nicht länger zu
jammern, denn: »Um solches kümmert sich Amor nicht.«
Schließlich sieht Gallus die Vergeblichkeit seines Klagens ein
und resümiert: »Amor besiegt alles; und ich will mich Amor
geschlagen geben.«1 Der launische Liebesgott vereitelt unbe-
zwinglich all unsere Versuche, eine verlorene Liebe
wiederzugewinnen. Entsprechend bedeutet engl. »Love conquers all«
noch heute im vergilischen Sinne »Gib es auf!«
Im Deutschen hat das geflügelte Wort »Liebe überwindet al-
108
les« jedoch einen viel positiveren Sinn angenommen, da man
es aus dem Kontext löste und nicht mehr an den Liebesgott
Amor als vielmehr an die eigene Liebe dachte: Wenn man
seinem Herzen folge, könne diese Liebe alle Hindernisse
überwinden (vgl. »Liebe verleiht Flügel«). Dazu mag beigetragen haben,
daß die antiken Autoren die eigene Liebe des Menschen als
kraftspendend und hilfreich zur Bewältigung mühsamster
Aufgaben charakterisierten, wie z. B. Cicero: »Nichts ist, glaube ich,
schwierig für den, der es liebt.«2
L: Bartels 128; Böttcher 69 (Nr. 363); Büchmann 320; Duden 12,378; Macrone 140;
Otto 1 7 (Nr. 74). 1: Verg. ecl. 10,69: »Qmnia vincit Amo_r; et no_s cedamus Amo_ri.« Vgl.
Verg. Cir. 437. Nach Macrob. sat. 5,16,7 gehörte das Wort zu denen, die »vice prover-
biorum in omnium ore funguntur«, also als Sprichwort in aller Munde seien (-> in aller
Munde). 2: Cic. or. 10,33: »Nihil difficile amanti puto.« Vgl. Plin. ep. 4,19,4; Hieron. ep.
22,40 (PL 30,344). B: Einige deutsche Lieder enthalten den Anfang oder den Kehrreim
»Amor vincit omnia«; Lit. dazu nennt Büchmann 320. S: Engl. »Love conquers all«.
(immer) das alte Lied / die alte Leier
Dinge, die so oft erzählt wurden, daß sie keine
Aufmerksamkeit mehr beanspruchen können (z. B. das alte Lied
singen/anstimmen; auch: dasselbe / das gleiche Lied); auch:
eine unangenehme, stets wiederkehrende Sache.
Diese Wendung ist darin begründet, daß das Lied, vor allem das
Heldenlied (Epos), eine uralte Form ist, Ereignisse mitzuteilen
(vgl.: Davon kann ich ein Lied[chen] singen); umgekehrt
erinnern häufig wiederholte Worte in gewisser Weise an ein Lied
mit gleichbleibendem Refrain. Redensartlich für
»abgedroschenes Gerede« findet sich das »alte Lied« schon mehrfach bei
den Römern. Beispielsweise sagt in einer Komödie des Terenz
(2. Jh. v. Chr.) der Kuppler Dorio zu einem Schuldner, der ihn
andauernd vertrösten will: »Du singst immer dasselbe Lied.«
Auch Cicero schreibt in einem Brief an seinen Freund Atticus
am 15. März 60 v. Chr., daß ihm ein gewisser Epicharmus stets
»seine übliche Leier« ins Ohr flüstere: »Immer nüchtern!
Glaub' nicht alles! Das ist der Weisheit A und O.«
L: Duden 11,455; Otto 73 (Nr. 338) und 106 (Nr. 501). 1: Ter. Phorm. 495: »...Canti-
Ignam eandgm canis.« Im eigentlichen Sinne dagegen bei Apul. flor. 12. 2: Cic. Att.
1,19,8: »ut crebro mihi ... insusurret cantilenam illam suam...« Vgl. ferner: Cic. Att.
13,34; Sen. ep. 24,6; Macrob. 5,2,6.
109
von Luft und Liebe leben
mit dem Geringsten auskommen können; oft negativ: mit
sehr wenigem auskommen müssen. Als Sprichwort: Von
Luft und Liebe kann man nicht leben.
In der Gesetzessammlung des Kaisers Iustinian (527-565) heißt
es, man solle es nicht tolerieren, wenn ein junger Mann den
geringsten Aufwand für sein Leben verschmähe, »wie wenn er
von der Luft lebte«.1 Das Motiv knüpft vielleicht an den
Glauben an, daß sich Zikaden allein von Tau oder von Luft
ernährten.2 Im Deutschen ist alliterierend die »Liebe« hinzugetreten,
womöglich weil sie Verliebte dazu verführt, sich über die
materiellen Lebensgrundlagen weniger Gedanken zu machen als
z.B. ihre Eltern.
L: Otto 365 (Nr. 1865). 1: Cod. lust. 5,20,2 nach Otto 365 (Nr. 1865). 2: Otto 365
(Nr. 1865) mit Belegen.
Luftschlösser bauen
überzogene Erwartungen hegen, unrealistische Pläne
schmieden.
Das Motiv eines Bauwerks in den Lüften stammt aus der
Komödie »Die Vögel« des Dichters Aristophanes, in der die Vögel in
den Lüften eine große Stadt, das im Deutschen sprichwörtlich
gewordene »Wolkenkuckucksheim« (Ne^eXoKOKKuyia),1
gründen; schließlich scheitert das Unternehmen daran, daß auch
dort schädliche Charaktere, denen man zu entkommen hoffte,
auftauchen. In Anspielung auf diese Geschichte formulierte der
Kirchenvater Augustinus in seinen Predigten: »..., damit wir
nicht den Eindruck machen, ohne Grundlage in der Luft zu
bauen [lat.: >in aere aedificare<].«2
Die »Schlösser« in der deutschen Entsprechung gehen auf
die französische Wendung »chäteaux en Espagne« zurück; sie
stammt wahrscheinlich aus der Zeit, als Schlösser im maurisch
beherrschten Spanien für einen Franzosen völlig wertlos
waren.3 »Ein Schloß in den Lufft bawen« ist bei Sebastian Franck
(1541), das »Luftschloß« seit dem 17. Jh. belegt. Darüber
hinaus erscheint die Luft als Sinnbild des Vergeblichen in
einer Fülle weiterer deutscher Redensarten (in der Luft fi-
110
sehen/ackern, den Nebel balgen, die Winde schiffen, gegen den
Wind kämpfen u. ä.).
Für die Schlußarie seiner Operette »Frau Luna« (1899) hat
Paul Lincke das Bild der Luftschlösser leicht abgewandelt:
»Schlösser, die im Monde liegen, / Sind wohl herrlich, lieber
Schatz, / Doch um sich im Glück zu wiegen, / baut das Herz den
schönsten Platz.« Auf die - bei aller Windigkeit - Festigkeit von
Luftschlössern wies Werner Ehrenforth hin: »Es ist leicht,
Luftschlösser zu bauen: schwierig ist es, sie wieder abzureißen.«4
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 317; Böttcher 88 (Nr. 514) und 562 (Nr. 3705);
Büchmann 348; Duden 11,464 und 12,413; Mletzko 77; Otto 6 (Nr. 26-28). 1: Ari-
stoph. Av. 819 und öfter. 2: Augustin. PL 38,67: »...ne subtracto fundamento in aere
aedificare videamur; vgl. PL 38,30: »... ne subtracto fundamento rei gestae quasi in aere
quaeratis aedificare.« 3: Frühester Beleg: Guillaume de Lorris / Jean de Meung, Roman
de la Rose (13. Jh.). Andere Erklärungen bei J. Moisant de Brieux, Origines de quelques
coutumes anciennes, publ. p. E. de Beaurepaire, Caen 1874,1,142 ff. 4: Mieder, Anti-
sprichwörter 85 mit Beleg. S: Engl.: »To build Castles in the air« (seit dem 16. Jh.); frz.:
»bätir des chäteaux en Espagne« (Schlösser in Spanien bauen).
Lukullus
kulinarischer Genießer, Feinschmecker; lukullisch: üppig
und delikatessenreich.
Der römische Feldherr und Politiker Lucius Licinius Lucullus
(117-56 v. Chr.) begann seine Karriere 87 v. Chr. als Quästor
unter Sulla, für den er eine Flotte organisierte. In den folgenden
Jahren führte er unter Sulla und später selbst als
Oberbefehlshaber in Kleinasien Krieg gegen Mithridates, bis er nach
Mißerfolgen durch Pompeius abgelöst wurde. Nach 59 v. Chr. zog er
sich aus dem politischen Leben zurück und starb 56 in geistiger
Umnachtung. Nach Crassus der reichste Römer seiner Zeit,
pflegte er einen äußerst aufwendigen Lebensstil. In seinem
Palast gab es zwölf nach verschiedenen Gottheiten benannte
Speiseräume, in denen je nach Gottheit auf unterschiedliche
Weise gegessen wurde. Zudem besaß er Villen, Bibliotheken
und die von ihm angelegten »Horti Luculliani« (»Gärten des
Lukullus«) auf dem Monte Pincio. Auf seinen Obstanlagen
kultivierte er auch die Süßkirsche, die er als erster in Europa
heimisch machte.
Bertolt Brecht schrieb 1939 für die Hörspielabteilung des
schwedischen Rundfunks »Das Verhör des Lukullus«. Die
»Zwölf Szenen« wurden später umgearbeitet, von Paul Dessau
111
vertont und 1951 in Berlin als »Die Verurteilung des Lukullus«
uraufgeführt. Dort muß sich der erfolgreiche Feldherr vor
einem Totengericht für die Untaten auf seinen Feldzügen
verantworten. Als einzige gute Tat wird ihm die Verpflanzung des
Kirschbaums angerechnet, doch kann das seine Verurteilung
nicht verhindern, die mit folgenden Worten ausgesprochen
wird: »Im Rock des Räubers / In des Mordbrenners Beutezug /
Sind wir gefallen / Die Söhne des Volks... / Hätten wir doch /
uns den Verteidigern gesellt! / Ins Nichts mit ihm!«
L: Böttcher 66-67 (Nr. 345); Büchmann 368; Rössing 188-189.
M
Mäzen
Kunstförderer, Geldgeber. Mäzenatentum: Kunstförderung
durch private Gönner.
Gaius Cilnius Maecenas (um 70-8 v. Chr.), ein Römer etruski-
scher Herkunft, war ein Freund des Octavian, des späteren
Kaisers Augustus; für ihn war er seit 40 in diplomatischen
Missionen und ab 36 als Stadtpräfekt von Rom tätig. Auf dem Esquilin
ließ er sich einen großzügigen Garten anlegen und einen
prachtvollen Palast erbauen. Sein Haus wurde geistiger
Mittelpunkt Roms: Maecenas, der auch selbst Gedichte schrieb,
förderte durch seine Anerkennung und durch materielle
Zuwendungen Vergil, Properz, Horaz und andere junge Autoren.
Horaz, dem er 33 ein Landgut in den Sabinerbergen schenkte
(das »Sabinum«), widmete seinem Gönner eine Reihe von
Gedichten. Der Epigrammatiker Martial schrieb ein Jahrhundert
später zu einem Freund: »Wenn es nur Mäzene gibt, Flaccus,
werden Vergile nicht fehlen.«1
112
Heute ist »Mäzenatentum« nicht auf den Bereich der
Literatur beschränkt, sondern in allen Bereichen der Kunst (vgl. -♦
brotlose Kunst) gern gesehen.
L: Bartels 167-168; Böttcher 69 (Nr. 362); Büchmann 324-325. 342; Reichert 191; Rös-
sing 176-179.1: Martial 8,56,5: »Sint Maecgnatgs, non dgerunt, Flacce, Marcmes.«
WIE EINE GEBADETE MAUS
ganz durchnäßt, von Wasser triefend; auch übertragen:
zurechtgestaucht, in unangenehmer Lage, hilflos (in diesem
Sinne häufiger: wie ein begossener Pudel, pudelnaß, naß
wie Pudel; auch: naß wie gebadete Katzen).
Das Bild der Maus benutzt schon der römische Schriftsteller Pe-
tronius in seinem Roman »Satyrica«, wo ein Gast bei einem
Gelage erzählt, daß früher die Menschen noch reinen Herzens die
Götter um Regen gebeten hätten; sogleich habe es dann aus
Gießkannen geregnet, »und alle kamen naß wie die Mäuse
heim«.1 Der Vergleich mit Mäusen könnte darauf zurückgehen,
daß gefangene Mäuse gewöhnlich durch Ersäufen getötet
wurden. Ebenfalls bei Petronius findet man die lateinische
Redensart »wie eine Maus im Nachttopf« für jemanden, der in arger
Verlegenheit steckt.2
In einem Soldatenlied von 1693 jammert ein Türke: »Ich
gedachte das Spiel viel anders zu karten; jetzt sitz ich wie eine ge-
battene Maus.«3 Hans Sachs dichtete über einen Bayern, der in
die Donau gefallen ist und an Land schwimmt: »Stig auch an
dem gestate aus / triff nasser wie ain taufte maus.«4
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 329-330; Otto 233 (Nr. 1166-1167). 1: Petron.
44,18: »Et omnes redibant udi tamquam mures.« 2: Petron. 58,9: »Du rennst, du
stierst, du zappelst, wie die Maus im Nachttopf« (»curris, stupes, satagis tamquam mus
in matella«). 3: Borchardt-Wustmann-Schoppe 330. 4: Borchardt-Wustmann-Schoppe
330.
auf des Meisters Worte schwören
sich an das Gelernte und die Autorität des Lehrers
klammern, jemandes Meinung kritiklos übernehmen; auch: auf
die Worte des Meisters schwören.
Im Einleitungsbrief seiner dem Maecenas (-♦ Mäzen)
gewidmeten Briefsammlung erklärt der Dichter Horaz, daß er sich darin
113
von der Lyrik abwenden und ethischen Fragen zuwenden
wolle. Er werde sich dabei an keine Philosophenschule
anlehnen, sondern stets seinen ganz eigenen Standpunkt vertreten:
»Und damit du nicht erst fragst, bei welchem Führer, in
welcher Heimstatt ich mich berge: / Keinem hab ich mich ergeben,
auf des Meisters Worte zu schwören.«1
Im Deutschen bekannt und beliebt wurde die Wendung
durch Goethe, der im »Faust« Mephisto zum Schüler sagen
läßt: »Am besten ist's auch hier, wenn ihr nur einen hört, / Und
auf des Meisters Worte schwört.«2
L: Bartels 96; Büchmann 116. 329; Duden 12,269. 1: Hör. ep. 1,1,14: »Ac ne fQrte ro-
ggs, quo mg duce, quo. lare tuter: / nullius addictys iura/e in ve/ba magistri...« (Übers.
B. Kytzler). 2: Faust I, Studierzimmer.
DIE GOLDENE MlTTE
der richtige und vernünftige Mittelweg; auch: der goldene
Mittelweg, * die goldene Mittelstraße.
»Nichts im Übermaß« (lat.: »ne quid nimis«) lautete eine
bekannte griechische Empfehlung zum Maßhalten in jeder
Hinsicht.1
Die Beschreibung und Hochschätzung des Mittelmaßes als
des Angemessenen zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig
geht auf den griechischen Philosophen Aristoteles zurück.2 In
dieser Bedeutung definierte auch der Römer Cicero die Mitte
als einen Zustand, der »zwischen zu viel und zu wenig liegt«.3
Auch Ovid lobte sie in seinen »Metamorphosen«.4
Als »golden« bezeichnete sie allerdings allein der Dichter
Horaz (65-8 v. Chr.): »Wer das goldene Mittelmaß / schätzt,
meidet sicher der verfallenen / Hütte Schmutz, meidet die
neiderweckende / Halle unbeirrt«,5 d.h. er ist sicher vor Armut wie
vor beneidetem Reichtum. »Mediocritas«, das Mittelmaß, ist
wie im Deutschen eigentlich negativ besetzt, doch wird es von
Horaz, da es Sicherheit bietet, positiv umgedeutet; »golden«
steht bei ihm wie bei anderen Dichtern für »großartig« oder
»schön«.
Die »goldene Mitte« wurde zunächst in England von William
Baldwin übernommen, der 1587 in einer Arbeit über den Fall
ehrgeiziger Prinzen schrieb: »The golden mean is best.«6 In
Deutschland wurde das Motiv dann als »goldene Mitte« oder
114
»goldener Mittelweg« gängig. Kritisch hingegen wird es in
folgendem Aphorismus von Hellmut Walters betrachtet: »Die
meisten Menschen bewegen sich auf dem goldenen Mittelweg
und wundern sich, wenn er verstopft ist.«7
L: Bartels 44-45; Böttcher 72 (Nr. 392-393); Büchmann 326. 334-335; Duden 11,489
und 12,195; Macrone 145; Mletzko 48. 83; Otto 216 (Nr. 1078). 1: Vgl. dazu
ausführlich Bartels 21.110. 2: Belegstellen nennt Bartels 45; griechische Belege zur
Hochschätzung der Mittte (ohne »golden«) finden sich bei Büchmann 334-335. 3: Cic. off.
1,25,89: »...quae est inter nimium et parum.« 4: Ov. met. 2,137. 5: Hor. c. 2,10,5-8:
»Auream quisquis mediQcritatem / diligit, tutys caret Qbsolgti / sg/dibys tecti, caret in-
vidgnda / sg.brius ajjla.« 6: Macrone 145. 7: Mieder, Phrasen 240 mit Beleg.
JEMANDEN MORES LEHREN
jemandem Sitte, Lebensart, Manieren beibringen,
jemanden zurechtweisen (z. B.: Ich will/werde dich Mores lehren);
* Mores vor etwas haben: Angst haben.
Die Redensart stammt aus den Lateinschulen des Mittelalters,
wo auf Sitten (lat.: »mores«, Sg. »mos«) hoher Wert gelegt
wurde. Im Deutschen ist »Mores« seit dem 15. Jh. belegt, z.B. in
der Verbindung »weder Zucht noch mores«. Die volkstümlich
gewordene Wendung »jemanden Mores lehren« ist seit dem
Humanismus häufig bezeugt und wahrscheinlich von
Gelehrten oder Studenten geprägt worden; umgangssprachlich wurde
sie auch scherzhaft umgestaltet zu »jemanden Moritz lehren«.1
In der Redensart »Mores vor etwas haben« ist lat. »mores«
mit hebr. »morah« (Furcht; vgl. beim Kartenspiel »mauern«:
zurückhaltend spielen) gekreuzt.2
L: Bartels 203; Borchardt-Wustmann-Schoppe 335-336; Duden 11,493. 1:
Beispielsweise 1779 bei Jung-Stilling. 2: Borchardt-Wustmann-Schoppe 336.
in aller Munde sein
sehr bekannt sein, allgemein im Gespräch sein; vgl. (wie)
mit einem Munde: übereinstimmend, in völliger Einigkeit.
Die Wendung »mit einem Munde« (d.h. einstimmig) war bei
griechischen und lateinischen Autoren sehr geläufig.1
Lateinisch gab es klassisch auch »in jemandes Munde sein« (»in ore
esse«) und »etwas im Munde führen« (»in ore habere«).2 »In
aller Munde« (»in omnium ore«) für »allgemein bekannt«
erscheint ab dem 4. Jh. bei dem Vergilkommentator Servius und
115
bei dem Politiker und Philologen Macrobius.3 Im Deutschen
hat sie dieselbe Bedeutung; durch Spiel mit den Sinnebenen
wird sie gelegentlich scherzhaft (»Die Torte war in aller
Munde«), manchmal aber auch hintergründig verwendet, wie
etwa von Hans Kasper: »Was in aller Munde ist, ist kaum noch
jemandes Gedanke.«4
L: Duden 11,496-497; Mletzko 6. 84; Otto 258 (Nr. 1313). 1: Beispielsweise Cic. de
amic. 23,86: »Sie stimmen in allem mit einem Munde überein« (»omnes uno ore con-
sentiunt«). Viele weitere Beispiele nennt Otto 258 (Nr. 1313). 2: Belege bei Fritsch 226.
3: Serv. Aen. 3,3,3 u. ö.; Macrob. sat. 5,16,7. 4: Mieder, Phrasen 246 mit Beleg.
MÜSSICCANC IST ALLER LASTER ANFANG
Untätigkeit ist schlimm und zieht weitere Probleme nach
sich. Auch: Müßiggang lehrt viel Böses, Nichtstun lehrt
Übles tun. Geschäftiger Müßiggang / geschäftiges
Nichtstun: Geschäftigkeit, die nichts zustande bringt.
Nach Columella soll der Politiker und Schriftsteller Cato der
Ältere (234-149 v. Chr.) gesagt haben: »Durch Nichtstun lernen
die Menschen schlecht zu handeln.«1 Auch in der ihm
zugeschriebenen spätantiken Spruchsammlung der »Disticha Cato-
nis« heißt es: »Andauernde Ruhe gibt den Fehlern Nahrung.«2
Der Gedanke ist jedoch älter und erscheint in ähnlicher Form
auch in einem Fragment des Sophokles.3
Daß auch sinnlose Geschäftigkeit, die nichts zustande
bringt, eine Art von Müßiggang ist, formulierte zuerst der
Dichter Horaz, nach dem Glück und Ausgeglichenheit nicht durch
ausgiebiges Reisen zu erreichen sind: »Regsames Nichtstun
treibt uns umher: Mit Schiffen und Viergespannen streben wir
nach gutem Leben.«4 Neben anderen Autoren5 widmete sich
auch Phaedrus in einer Fabel dem Phänomen: »In Rom lebt
eine Art von Pflastertretern, / eilig laufend, in Muße
beschäftigt, / vergeblich keuchend und im Vieltun gar nichts tuend, /
Sich selbst beschwerlich und andern sehr verhaßt.«6 In
Deutschland verbreitete Johann Elias Schlegel den Begriff
durch sein Lustspiel »Der geschäftige Müßiggänger«.7 Goethe
verstand den Begriff allerdings positiver und sagte: »Schreiben
ist geschäftiger Müßiggang.«8 Auch das obige Sprichwort hat
positive Umwandlungen erfahren, wie durch Albert Keller:
»Müßiggang ist aller Künste Anfang.«9
116
L: Böttcher 74 (Nr. 410-411); Büchmann 330-331; Duden 11,499; Mletzko 8. 70. 84;
Otto 9 (Nr. 41). 1: Colum. 11,1,26: »Nam illud verum est M. Catonis oraculum«
(»Denn wahr ist jener Ausspruch des M. Cato«): »Nihil agendo homines male agere dis-
cunt.« 2: Cato dist. 1,2: »Nam diuturna quies vitiis alimenta ministrat.« 3: Soph. fr.
287N.: »Denn planlose Muße gebiert nichts Gutes« (tiictei Y&p ov>8ev eaGköv eiicaia
axokr\). 4: Hor. ep. 1,11,28-29: »strgnua ngs exe/cet ingrtia: navibus atque / quadrigis
petimus bene vjvere. 5: Sen. tr. an. 12 (»inquieta inertia«); brev. vit. 10,12,2; 12,5 (»de-
sidiosa occupatio«); vgl. ähnlich schon Aristoph. Ran. 1498 (SiaTpißfj dpyoq). 6:
Phaedrus 2,5,2: »... occupata in otio...« 7: Gottscheds »Deutsche Schaubühne« Bd. 4,
Leipzig 1 743. 8: Urgötz sowie Götz von Berlichingen 4,5. 9: Mieder, AntiSprichwörter
96 mit Beleg.
ETWAS MIT DER MUTTERMILCH EINGESAUGT/
EINGESOGEN HABEN
etwas so sehr verinnerlicht haben, als hätte man es schon
immer gewußt oder gekonnt.
Vor der »Muttermilch« kam bei den Römern die
»Ammenmilch«: Cicero schreibt in den »Tuskulanischen Gesprächen«,
daß die Menschen, sobald sie das Licht der Welt erblickt
hätten, die Fehlbarkeit »beinahe mit der Milch der Amme
eingesaugt zu haben scheinen«.1 Sie haben sie demnach von Geburt
an verinnerlicht und können sie daher auch nur sehr schwer
wieder loswerden. Dasselbe Bild verwendete unter Einführung
der Mutter der Kirchenvater Augustinus (354-430). Da seine
Mutter eine Christin war, konnte er sagen: »Den Namen des
Heilands hatte mein Herz bereits in der Milch meiner Mutter
vorausgetrunken.«2 Während im Humanismus lateinisch noch
die Fassung »mit der Ammenmilch« gängig war,3 ist im
Deutschen die »Muttermilch« aufgenommen worden und
sprichwörtlich geworden.
L: Böttcher 88 (Nr. 513); Büchmann 349; Duden 11,500 und 12,336; Otto 183
(Nr. 900). 1: Cic. Tusc. 3,2: »...ut paene cum lacte nutricis errorem suxisse videamur.«
Vgl. Prudent. c. Symmach. 1,201: »puerorum infantia primo Errorem cum lacte bibit.«
Vgl. Quint. inst. 1,1,21: »a lacte cunisque«. 2: Augustin. Conf. 3,4 (PL 32,686):
»Nomen Salvatoris mei ... in ipso adhuc lacte matris cor meum praebiberat.« 3: Er.
ad. 1,7,54.
117
N
vor Neid platzen
überaus neidisch sein.
Die Redensart verdankt ihr Entstehen der von Phaedrus im
frühen 1. Jh. erzählten Fabel »Der geplatzte Frosch und der
Ochse« (»rana rupta et bos«);1 darin bläst sich ein Frosch vor
Neid auf die Größe des Ochsen so lange auf, bis er platzt (-♦ ein
aufgeblasener Frosch). »Vor Neid platzen« (»invidia rumpi«)
wurde daher zur geläufigen Redensart.2 Ständig
wiederaufgenommen wird sie in einem Gedicht des Epigrammatikers Mar-
tial, der darin den Neid der Leute auf ihn beschreibt; es endet
mit den Versen: »Platzen will [mancher] vor Neid, weil ich
angenehm bin meinen Freunden, / weil ich ein häufiger Gast bin,
will er platzen vor Neid. / Platzen will er vor Neid, weil ich
geliebt bin und anerkannt: / Soll er doch platzen, wer auch immer
da platzt vor Neid!«3 Jedoch war das Platzen auch damals nicht
auf den Neid als Ursache beschränkt: Auch »vor Lachen«
konnte man schon »zerspringen« (»risu dissilire«; vgl. dt.: »sich
totlachen«).4
L: Böttcher 78 (Nr. 446); Otto 303 (Nr. 1558), vgl. 301 (Nr. 1544). 1: Phaedr. 1,24.
2: Verg. ed. 7,26; vgl. Prop. 1,8,27; Hör. s. 1,3,136; Calp. ecl. 6,80; griech.: Lukian.
Tim. 4. 3: Martial. 9,97: »Rumpitur invidia, quod sum iucyndus amkis, / quod conviva
freque/is, rumpitur invidia. / Rumpitur invidia, quod amamur quQdque probamur: /
rympaty/, quisquis rumpitur invidia« 4: Zahlreiche Belege finden sich bei Otto 303
(Nr. 1558) und Tosi 770 (Nr. 1 725).
aus dem Nichts emporkommen
ganz klein anfangen und dann Karriere machen, sich von
ganz unten emporarbeiten.
Die lateinische Entsprechung zu dieser Wendung lautet »aus
dem Nichts wachsen/entstehen« (»ex/de nihilo crescere/fieri«)
und begegnet bei den Schriftstellern Petronius und luvenal; so
sagt z.B. in Petronius' Roman »Satyrica« ein Gast über einen
118
reichen Mitfreigelassenen des Gastgebers: »Aus dem Nichts ist
er emporgekommen!«1 Die Ausdrucksweise steht vielleicht in
bewußt scherzhaftem Gegensatz zu dem auf Empedokles
zurückgehenden philosophischen Grundsatz »Von nichts
kommt nichts«, der in Rom durch den Epikureer Lukrez in der
Form »De nihilo nihil« eingeführt worden war.2
Auch die deutsche Wendung »klein anfangen« (zuerst wenig
besitzen; als Sprichwort: Jeder hat mal klein angefangen) hat
einen antiken Vorläufer: Von dem Spruchdichter Publilius Syrus
(1. Jh. v. Chr.) ist überliefert: »Ganz klein müssen die Anfänge
von ganz Großem sein.« Und schließlich, nicht zu vergessen: -♦
»Aller Anfang ist schwer!«
L: Otto 243 (Nr. 1228). 1: Petron. 38,7: »De nihilo crevit.« Ähnlich 43,1 (»ab asse cre-
vit«). 71,12 (»ex parvo crevit«). luv. 5,133 (»quantus, ex nihilo quantus fieres«). 2: Lucr.
1,149-150. 205 u. 2,287; aufgegriffen von Pers. 3,83-84. 3: Publik Syr. N14: »Necesse
est minima maximorum esse initia.«
das süsse Nichtstun
genußvolle Untätigkeit.
In einem Brief an seinen Freund Ursus preist der römische
Schriftsteller Plinius »jenes unproduktive, aber doch
angenehme Nichtstun und Nichtssein« (lat.: »illud iners quidem,
iucundum tarnen nil agere, nihil esse«).1 Daraus entstand im
Italienischen die Redensart vom »il dolce far niente«, das
neben der deutschen Übersetzung (»süßes Nichtstun«) auch im
Original zitiert wird.
L: Böttcher 85 (Nr. 492-493); Büchmann 344; Duden 12,246; Mletzko 88.118.1: Plin.
ep. 8,9,1.
Niet- und nagelfest
sehr fest fixiert (z.B.: alles, was nicht niet- und nagelfest
ist: alles Bewegliche), eigentlich »durch Nieten und Nägel
befestigt«.
In der Komödie »Asinaria« (»Eselsspiel«) des Dichters Plautus
hat die Kupplerin Cleaereta dem jungen Athener Argyrippus,
der ihre Tochter Philenion liebt, aber kein Geld mehr hat, ihr
Haus und den Umgang mit dem Mädchen verboten. Sie sagt zu
ihm: »Dein Herz ist mit Cupidos Nagel in unserm Haus fest an-
119
geheftet; greife nach den Rudern schnell und nach den Segeln,
dann mach dich auf und davon...«1 Die Wendung »mit dem
Nagel befestigt« (»clavo fixus«; »figere«: »anheften, befestigen«,
vgl. »Fix«stern) begegnet auch bei anderen lateinischen
Autoren; z. B. sagt der reiche Gastgeber Trimalchio bei Petron zu
seiner Frau: »Du kennst mich: Was ich einmal beschlossen habe,
ist mit einem Reißnagel befestigt«, d.h. unverrückbar.2
Im Deutschen ist das Bild im Zeitalter der industriellen
Revolution um den Metallbolzen, den »Niet« (umgangssprachlich
»Niete«), erweitert worden.
L: Duden 11,517; Otto 85 (Nr. 395). 1: Plaut. Asin. 156-157: »Fixus hie apud nos gst
animys tuys clavQ Cupidinjs. / rgmigig. velgque quantum pQteris fgstina et fugg.« 2:
Petron. 75,7: »Nosti me: quod semel destinavi, clavo tabulari fixum est.« Ferner: Cic. Verr.
5,22,53; Arnob. adv. nat. 2,43.
aus der Not eine Tugend machen
aus einer Notlage das Beste machen, eine schlimme Lage
geschickt ausnutzen; oft als Sprichwort: Man muß aus der Not
eine Tugend machen.
Die Redensart ist lateinisch als »de necessitate virtutem facere«
zuerst bei dem Kirchenvater Hieronymus belegt. In einem
Trostbrief an die gerade verwitwete Furia spricht er ihr zu, sich
auf keine neue Bindung einzulassen: »Ergreife bitte die
Gelegenheit und mache aus der Not eine Tugend!«1 Doch schon der
Rhetoriklehrer Quintilian verwendete eine ähnliche
Formulierung: »Wir wollen lieber aus dem Ende ein Heilmittel, aus der
Not einen Trost machen.«2 Die englischen und französischen
Fassungen (»to make a virtue of necessity« bzw. »faire de neces-
site vertu«) nutzen die direkt aus dem Lateinischen
hervorgegangenen Substantive. Die deutsche Fassung ist seit dem 16. Jh.
nachzuweisen.3 Bisweilen wird sie erweitert oder ironisch
abgewandelt, wie etwa von Gerhard Uhlenbruck: »Aus der Notlüge
macht man heute eine Tugend.«4
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 355; Böttcher 87-88 (Nr. 507); Büchmann 348;
Duden 11,519 und 12,60-61; Macrone 206; Mletzko 89. 124; Otto 241 (Nr. 1217);
Wander 3,1050 (Noth 1 30). 1: Hieron. ep. 54,6 (PL 22,552): »Arripe, quaeso, occasio-
nem et fac de necessitate virtutem.« Vgl. Hieron. in Rufin. 3,2 (PL 23,479): »Ich bin dir
dankbar, daß du aus der Not eine Tugend machst« (»habeo gratiam, quod facis de
necessitate virtutem«); man beachte die unterschiedlichen Nuancen: Bei der ersten
Stelle ist die Wendung positiv als Rat, bei der zweiten leicht abwertend gemeint (du
machst ja nur a. d. N. e. T.). In ersterem Sinne vgl. auch Hieron. Comment. Bern.
120
p. 138,2. 2: Quint. decl. 4,10: »Faciamus potius de fine remedium, de necessitate sola-
tium.« 3: Zimmerische Chronik 3, S. 230: »Darumb mußten sie user der not eine tugent
machen.« Ferner Fritz von Stolberg an F. H. jacobi (jacobis Briefwechsel Bd. 2, S. 151):
»Sie hatten aus der Noth Tugend gemacht...« Borchardt-Wustmann-Schoppe 355.
4: Mieder, AntiSprichwörter 98 mit Beleg. S: Engl. »To make a virtue of necessitiy«
(zuerst in Chaucers »Troilus and Criseyde«, um 1374); frz. »faire de necessite vertu«.
Not kennt kein Gebot
In der Not darf gegen Regeln und Verbote verstoßen
werden.
In der Fassung »Die Notwendigkeit kennt keine Feiertage«
findet sich bei Palladius (de agri cultura 1,6,7) die leicht
nachvollziehbare Einsicht, daß notwendige Arbeiten in der
Landwirtschaft auch am Feiertag nicht unterbleiben können. Daß in der
deutschen Ausprägung der Begriff »Gebot« Eingang gefunden
hat, liegt zum einen sicher an dem eingängigen Reim von
»Not« und »Gebot«; zum anderen dürfte hier aber auch die
Bibel eingewirkt haben, die von ähnlichen Konflikten zwischen
bäuerlicher Lebenswelt und Gebot der Feiertagsheiligung zu
berichten weiß. Am bekanntesten ist sicher die Episode, in der
Jesus und seine Jünger für das Ausraufen von Ähren am Sabbat
getadelt werden (Markus 2,23-28).
Fast im Sinne unseres Sprichworts »Der Mensch denkt und
Gott lenkt« legt Curtius Rufus Alexander dem Großen die Er-
kentnis in den Mund, daß auch im Krieg alles Planen und
Überlegen gegenüber der Notwendigkeit zurückstehen muß: »Der
Zeitpunkt, zu dem ich kämpfen mußte, war für den Feind
günstiger als für mich, aber die Notwendigkeit steht über der
Überlegung, ganz besonders im Krieg, wo es uns selten möglich ist,
uns den Zeitpunkt auszusuchen.«1
Der Spruchdichter Publilius Syrus machte daraus eine
allgemeine Formulierung: »Die Notwenigkeit gibt das Gesetz, nicht
beugt sie sich ihm«;2 er hat aber noch mehr Weisheiten über
die Findigkeit der Not parat, wie: »Der Not ist jedes
Wurfgeschoß nützlich.«3
L: Mletzko 39. 90; Otto 241 (Nr. 1215); Tosi 426 (Nr. 910). 1: Curt. 7,7,10. 2: Publik
Syr. N 23 3: Publik Syr. N 28.
121
Not lehrt beten
in der Not besinnen sich die Menschen auf Gott und bitten
ihn um Hilfe.
Bei dem Historiker Livius mahnt der römische Diktator Camil-
lus 390 v. Chr. seine Mitbürger, nicht in das von Rom eroberte
Veji überzusiedeln und damit die heimischen Götter im Stich
zu lassen; ihnen allein aber habe man es zu verdanken, auch
die kürzlich erlittene Niederlage und Besetzung durch die
Gallier überstanden zu haben (-♦ sein Schwert in die Waagschale
werfen): »So wurden wir besiegt, besetzt und losgekauft und
von Göttern und Menschen so sehr gestraft, daß wir dem
Erdkreis als warnendes Beispiel dienen. Unser Unglück hat uns
dann wieder an die religiösen Verpflichtungen erinnert.«1
Adalbert von Chamisso verwendete das daraus entstandene
Sprichwort als Kehrreim seines Gedichts »Das Gebet einer
Witwe«, worin eine alte Frau für ihren unbarmherzigen Herrn
betet, da die Verfluchung ihrer früheren Herrn ihr nur Not
gebracht hat. Heute jedoch ist damit fast immer Kritik an dem
Betenden verbunden, da ihn nur die Not - nicht innere
Überzeugung - zum Beten bringt.
L: Mletzko 18. 90; Duden 12,364; Wander 3,1054-1055 (Noth 228). 1: Liv. 5,51,8-9:
»...adversae deinde res admonuerunt religionum.«
harte Notwendigkeit
die unangenehme, aber nicht zu ändernde Notwendigkeit.
Vgl.: der Not gehorchen, Erfordernissen Rechnung tragen.
Die »harte« Notwendigkeit geht auf das Motiv der »grausigen
Notwendigkeit« (»dira necessitas«) bei dem Dichter Horaz
zurück:1 Gegen sie, d.h. gegen Tod und Angst, können
Reichtum und Luxusgüter nichts ausrichten. Daß an der
Notwendigkeit kein Weg vorbei führt, weiß auch der lateinische
Spruchdichter Publilius Syrus: »Wenn du der Not nicht gibst, was sie
fordert, nimmt sie es sich«;2 und: »Der Weise verweigert der
Notwendigkeit nichts.«3 Die Römer kannten daher auch bereits
die sprachliche Wendung »der Not gehorchen« (»necessitati
parere«). So heißt es bei dem Historiker Livius: »Es soll der Not
gehorcht werden, die nicht einmal die Götter überwinden.«4
122
L: Bartels 63; Böttcher 73 (Nr. 402-403); Büchmann 327; MIetzko 41. 89; Otto
240-241 (Nr. 1214). 1: Hör. c. 3,24,6. 2: Publil. Syr. N 33. 3: Publil. Syr. N 52. 4: Liv.
9,4,16; vgl. Cic. off. 2,21,74.
O
Öl ins Feuer giessen
ein Übel noch schlimmer machen, einen Streit noch
verschärfen, die Leidenschaften weiter anheizen (auch: Öl in
die Flammen gießen); aber: * Öl auf die Wogen gießen: die
Leidenschaften besänftigen.
Die Redensart »oleum addere Camino« (»Öl in den Kamin
hinzugeben«; in gleicher Bedeutung wie im Deutschen)
verwendete bereits im 1. Jh. v. Chr. der Dichter Horaz.1 Nach dem
Zeugnis des griechischen Neuplatonikers Porphyrios gab es im
3. Jh. das »verbreitete Sprichwort: Öl ins Feuer«.2 Das deutsche
»Öl ins Feuer gießen« ist seit dem 16. Jh. belegt.3
Die Tatsache, daß eine Wasserfläche durch Öl geglättet wird
(daher das deutsche »Öl auf die Wogen gießen«), war ebenfalls
schon im Altertum bekannt.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 362; Böttcher 71 (Nr. 388-389); Büchmann 329;
Duden 11,529; MIetzko 32. 92; Otto 253 (Nr. 1283). 1: Hör. s. 2,3,321: »»oleum adde
Camino« (»Gib Öl in den Kamin«). 2: »Et usus est vulgari proverbio: oleum in incen-
dium« nach Otto 253 (Nr. 1283), bei dem sich weitere Beispiele finden. 3: Namenlose
Sammlung von 1532: »Laß den Hund schlaffen, schüt nit Öhl ins fewr, rieht keinen ha-
der an, erzürne keinen bösen.« Borchardt-Wustmann-Schoppe 362.
zu Olims Zeiten
(scherzhaft) vor langer Zeit (auch: aus Olims Zeiten: aus
lange zurückliegender Zeit).
123
Dies ist ein Scherzausdruck aus dem Gelehrtenschulunterricht:
Aus lat. »olim« (einst) wurde der Eigenname »Olim« erfunden.1
Die Wendung ist zum ersten Mal 1618 in Martin Rinckarts
»Jubelkomödie«2 und dann öfter3 belegt.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 363-364; Duden 11,529. 1: Die niederdeutsche
Ableitung von »öling« (alt) ist irrig: Borchardt-Wustmann-Schoppe 363-364. 2: V. 169. 3:
Beispielsweise 1738 bei j. Chr. Günther, Curieuse Lebensbeschreibung, 165,24: »Du
weißt, ich bin dein Freund aus alter Olims-Zeit.« Ähnlich sagt Chr. F. Henrici (Picander)
einmal zu einem alten Studienfreund von vor 20 Jahren: »Freund von denselben alten
Tagen, da Olim uns studieren ließ.« Alles bei Borchardt-Wustmann-Schoppe 363.
ein gutes/schlechtes Omen
ein gutes/schlechtes Vorzeichen.
In der Antike glaubte man allgemein, daß man den Willen der
Götter, die Kräfte des Kosmos und damit den guten oder
schlechten Ausgang einer Sache im voraus erkennen könne.
Eine ganze Wissenschaft entwickelte sich, die sich mit der
Einholung und der Deutung dafür bedeutungsträchtiger
Zeichen beschäftigte (vgl. -♦ Augurenlächeln, -» Auspizien). Als
»Omen« (lat.: »omen«: Vorzeichen, PI. omina; dt. PI. Omina o.
Qmen) wurden dabei vor allem Vorgänge bezeichnet, die nicht
gezielt herbeigeführt wurden und denen aufgrund ihrer
Außergewöhnlichkeit (z. B. ein Uhuschrei bei Tage in der Stadt) oder
der Umstände, unter denen sie auftraten (z. B. das Stolpern auf
der Schwelle auf dem Weg zu einem wichtigen Termin),
Bedeutung beigemessen wurde.
Im diesem Sinne kann man einen zufälligen Umstand, der
als bedeutungstragend angesehen werden könnte, halb
scherzend, halb ernsthaft als gutes oder schlechtes Omen
bezeichnen.
im Orkus verschwinden
spurlos verschwinden, völlig zugrunde gehen (auch: i. O.
sein / landen). Hinab in den Hades! / Zum Orkus hinab!: Es
soll in völlige Versenkung und Vergessenheit geraten. Denn
das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab: scherzhafter
Kommentar beim Verlust einer Sache, der man nicht
nachweint.
Der Orkus (lat.: »Orcus«) war bei den Römern die Bezeichnung
124
für das Reich der Toten, die Unterwelt, wie sie ausführlich von
Vergil im 6. Buch seiner »Äneis« geschildert wird. Sie ist der
Ort, von wo es kein Zurück mehr gibt: »Aber Fluch dir, du übler,
dunkler Orkus, / Der du alles, was schön ist, stets verschlingst!«
klagt der Dichter Catull - wenn auch leicht ironisch - beim Tod
des Vogels seiner Geliebten.1 Daneben wurde der Begriff aber
auch als Synonym für den Gott der Unterwelt, Pluto (griech.
Hades), verwendet.
Schiller ließ sein Gedicht »Nänie« (Totenklage) 1799 mit den
Versen enden: »Auch ein Klaglied zu sein im Mund der
Geliebten, ist herrlich, / Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus
hinab.« Das Schöne und Vollkommene wird immerhin in der
Klage noch einmal gewürdigt, während das Alltägliche
unbeachtet (sozusagen sang- und klanglos) vergeht. Heutzutage
verschwinden zumeist Dinge, die niemand mehr zu sehen
bekommen soll - wie etwa brisante Akten -, durch Vernichtung
»im Orkus«.
L: Böttcher 14 (Nr. 12-1 3); Duden 12,106-107; Otto 257-258 (Nr. 1 301 -1 306). 1:
Catull. 3,13-14.
P
Papier ist geduldig
Dem Papier kann man alles anvertrauen, schriftlich läßt
sich alles sagen; auch: Geschriebenes (z.B. in Zeitungen)
muß nicht immer wahr sein.
Im Juni 56 v. Chr. richtet Cicero einen Brief an Lucius Lucceius,
der sich für das Jahr 59 vergeblich als Konsusi beworben hatte
und dann unter die Geschichtsschreiber gegangen war. Cicero
brennt vor Begierde, sich durch dessen Schriften verherrlicht
und gefeiert zu sehen, wagt aber kaum, dieses Anliegen offen zu
äußern: »Schon mehrfach war ich drauf und dran, mit Dir
persönlich über dieses Thema zu sprechen, immer hielt mich eine
125
beinahe etwas bäurische Befangenheit zurück; aber jetzt, wo
ich Dir nicht gegenübersitze, wage ich mich schon kecker
damit heraus: Ein Brief [hier lat. »Charta«: »Papier, Buch«] wird ja
nicht rot«1 (schämt sich nicht). Das Motiv wurde um 400 von
dem Kirchenvater Ambrosius aufgegriffen (»Ein Buch wird
nämlich nicht rot«)2 und später im Deutschen in leichter
Veränderung übernommen.
L: Böttcher 64 (Nr. 327-329); Duden 11,534; Mletzko 40. 92; Otto 125 (Nr. 602);
Wander 3,1174 (Papier 4). 1: Cic. fam. 5,12,1: »Coram me tecum eadem haec agere
saepe conantem deterruit pudor quidam paene subrusticus, quae nunc expromam ab-
sens audacius; epistula enim non erubescit« (Übers. H. Kasten). 2: Ambros. de virg.
1,1,1: »über enim non erubescit.« Vgl. Hist. Apoll, reg. Tyr. p. 24,12 Riese.
* »Pater, peccavi« sagen
um Verzeihung bitten, eine Schuld eingestehen.
Lateinisch »Pater, peccavi« bedeutet »Vater, ich habe
gesündigt« und stammt aus dem neutestamentlichen Gleichnis vom
verlorenen Sohn, wo der »verlorene« Sohn nach seiner
Rückkehr den Vater mit diesen Worten um Vergebung bittet.1 Der
Satz ist zur Beichtformel und zu einem liturgischen Element im
Zusammenhang mit Buße und Umkehr geworden. So lautet
»Vater, ich habe gesündigt vor dir« der Antwortgesang beim
ersten Bußgottesdienst.2
L: Böttcher 144 (Nr. 889); Duden 11,538 und 12,381. 1: Lk. 15,11-32; darin V. 18 und
21 Vulgata. 2: Cotteslob Nr. 56,3; Thema: Das große Gebot.
PAX AUCUSTA
eine glanzvolle Friedenszeit durch eine Vormacht, einen
Herrscher etc. (auch unter Ersetzung des Adjektivs, z. B.: Pax
Americana).
Nach der schrecklichen Zeit der Bürgerkriege des 1. Jh. v. Chr.
war der Friede, der durch die lange Alleinherrschaft des Au-
gustus geschaffen wurde, eine dringend herbeigesehnte
Segnung. Augustus nutzte dies, um den Frieden zum
hervorstechenden Merkmal seiner Herrschaft zu machen. In seinem
Tatenbericht rühmt er sich, daß während seiner Regierungszeit
der Janustempel (-♦ janusköpfig) zum Zeichen des Friedens
häufiger geschlossen war als jemals zuvor in der römischen Ge-
126
schichte. Im Jahre 10 v. Chr. wurde der Kult der Friedensgöttin
Pax (lat.: »pax«: »Friede«) eingeführt; bei der Neugestaltung des
Marsfeldes ließ Augustus dort einen Altar des Friedens (ara Pa-
cis) errichten.
Der Begriff »pax Augusta« taucht erstmals bei dem Historiker
Velleius Paterculus auf: »Ausgebreitet in die Gegenden des
Ostens und Westens, und was auch immer von Norden und
Süden begrenzt wird, hält der kaiserliche Frieden [pax Augusta] in
allen Winkeln der Erde die Furcht vor Räuberei fern.«1 Diese
Worte sind nun nicht auf Kaiser Augustus, sondern auf seinen
Adoptivsohn und Nachfolger Tiberius (Kaiser 14-37 n. Chr.)
gemünzt, unter dem Paterculus seine militärische Karriere
durchlief. Sie dürften aber um so besser illustrieren, welche
Vorzüge man damals allgemein im Kaisertum sehen konnte;
bei Paterculus zumindest ist von -♦ Cäsarenwahn noch keine
Rede.
1: Vell. Pat. 2,126,3.
ETWAS IN PETTO HABEN
etwas planen, etwas vorbereitet haben; bisweilen auch: eine
Fähigkeit besitzen, etwas intellektuell beherrschen.
Der Ausdruck »in petto« ist die italienische Übersetzung von
lateinisch »in pectore« (»in der Brust«). Das, was man in der Brust
hat, als Metapher für das, was man denkt, findet sich bereits bei
Sallust (86-34 v. Chr.): »Der Ehrgeiz zwang viele, das eine in der
Brust verschlossen, das andere offen auf der Zunge zu tragen.«1
Ein ähnlicher Gegensatz zwischen heimlich Gedachtem und
öffentlich Ausgesprochenem liegt auch in der päpstlichen
Formel vor, die vermutlich noch stärker zur Entstehung der
Redensart beigetragen hat: Der Papst behält seit dem 15. Jh.
bisweilen die Namen der in einem geheimen
Kardinalskonsistorium bestimmten Kardinäle noch bis zu einer öffentlichen
Sitzung für sich, indem er sagt: »Andere behalten wir vorläufig in
unserer Brust [in pectore], um sie nach unserem Gutdünken zu
irgendeiner Zeit bekanntzugeben.«2
L: Bartels 201; Büchmann 373; Duden 11,540. 1: Sali. Cat. 10. 2: »Alios In pectore
reservamus arbitrio nostro quandocumque declarandos.«
127
der Plebs
(von lat. plebs: die Plebs, d.h. die nichtpatrizische
Bevölkerung) Pöbel; plebejisch: von niederer Herkunft, gewöhnlich.
Die römische Bevölkerung zerfiel in zwei Gruppen: Patrizier
und Plebejer. Die Patrizier waren die Mitglieder jener Familien,
die bei Einrichtung der Republik (nach der Tradition 510 v.
Chr.) zur staatstragenden Schicht gehörten, und stellten damit
so etwas wie einen Geburtsadel dar. Alle römischen Bürger, die
nicht einer dieser Familien angehörten, waren automatisch
Plebejer. In der frühen Republik war die Bekleidung der
Staatsund Priesterämter und die Ausübung anderer wichtiger
staatlicher Funktionen wie die Rechtssprechung auf die Patrizier
beschränkt. Die sich daraus ergebenden Spannungen zwischen
Patriziern und Plebejern führten zu den Ständekämpfen, in
denen sich die Plebejer die politische Gleichberechtigung mit den
Patriziern erkämpften und zur Vertretung ihrer Interessen die
Institution des Volkstribunats (-♦ Volkstribun) hervorbrachten.
Damit war auch für plebejische Familien der Weg frei zu
sozialem und politischem Aufstieg. Die Familien, denen es
gelang, in die politische Führungsschicht aufzusteigen, bildeten
zusammen mit den Patriziern einen neuen Amtsadel, die Nobi-
lität, in der die plebejischen Mitglieder den patrizischen weder
an Einfluß noch an Vermögen nachstanden. Anders als im
Deutschen ist in Rom die Bezeichnung »Plebs« und
»plebejisch« also weder abwertend, noch stellt sie eine soziale Katego-
risierung dar. Es ist zu beachten, daß der Pöbelhaufen im
Deutschen »der Plebs« (Maskulinum) ist, die Bevölkerungsgruppe
im antiken Rom dagegen mit dem aus dem Lateinischen
übernommenen Geschlecht korrekt als »die Plebs« (Femininum)
bezeichnet werden muß.
Daß mit der Entstehung der Nobilität die Aufteilung in
Patrizier und Plebejer nicht außer Gebrauch und in Vergessenheit
geriet, lag nicht nur an dem großen Traditionsbewußtsein der
Römer, sondern auch an der Tatsache, daß es nunmehr bestimmte
Funktionen gab, die lediglich den Plebejern vorbehalten waren:
Nur Plebejer durften das Amt des plebejischen Ädilen oder des
-♦ Volkstribuns ausüben, nur Plebejer hatten Stimmrecht in der
Volksversammlung der Plebs (concilium plebis), deren
Beschlüsse seit 287 v. Chr. immerhin Gesetzeskraft hatten.
128
das Prä haben
(auch: das Prag haben) den Vorrang/Vorzug haben (auch:
ein Prä/Prae haben); (mundartl.:) immer das Pree haben
wollen: sich vordrängen, die erste Geige spielen wollen;
seltener auch: das Prä/Prae behalten/erhalten/lassen.
Hier liegt ein alter Kartenspielerausdruck vor; der auf lateinisch
»prae« (»vor«) zurückgeht. Er ist seit Ausgang des 16. Jh. sehr
häufig bezeugt.1 Über die Studentensprache ist die Wendung
bis in die Umgangssprache und die Mundarten gedrungen. In
übertragener Bedeutung wird die Wendung seit dem 17. Jh.
verwendet.2
L: Bartels 205; Borchardt-Wustmann-Schoppe 387-388; Duden 11,554.1: Auch in der
Verbindung »das Prä und den Vorzug haben«, was wohl dem heutigen Ausdruck »in
der Vorhand sein« entspricht: Borchardt-Wustmann-Schoppe 387. 2:
Borchardt-Wustmann-Schoppe 388 mit folgenden Beispielen: F. W. v. Ditfurth, Volkslieder des
Dreißigjährigen Krieges Nr. 56 (»...das Prae von allen Völkern...«); ein Lied von 1656 (»...sie
hat das prae am Zürcher See...«); Grimmeishausen, Simplicissimus 1,425: »Ein jeder
hoffte, seiner Gattung Soldaten das prae zu erhalten.«
* PRO DOMO REDEN
in eigener Sache sprechen; auch lat. oratio pro domo: Rede
zum eigenen Nutzen.
In seiner Rede »pro domo« (»Für sein Haus«; oder: »De domo
suo ad pontifices«, d.h. »Über sein Haus gegenüber den Pon-
tifices«) trat Cicero 57 v. Chr. für sich selbst ein: Nachdem er
im Jahre 58 wegen angeblich ungesetzlicher Hinrichtung der
Anführer der Catilinarischen Verschwörung verbannt worden
war; war sein Haus am Nordosthang des Palatin, eines der
schönsten in Rom; der Staatskasse zugefallen, über einen
Strohmann in die Hände seines Erzrivalen P. Clodius Pulcher
gefallen und teilweise abgerissen worden, teilweise der Göttin Liber-
tas geweiht worden. In seiner Rede wollte Cicero nun von dem
Kollegium der Oberpriester die Rückgabe seines Hauses
erreichen. »Pro domo« bezeichnet seitdem ein Reden zum eigenen
Vorteil oder zur Rechtfertigung seiner selbst.
L: Bartels 140-141; Böttcher 61-62 (Nr. 305); Büchmann 316; Duden 11,556 und
12,389; Reichert 44. B: Die Kaffeefirma Dallmayr verwendet als Markennamen »Dall-
mayr Pro Domo«.
129
DER WUNDE PUNKT
Bereich, in dem jemand anfällig oder empfindlich ist.
In einer Komödie des Dichters Terenz sagt der Athener Antipho
zu seinem Sklaven Geta; der gegenüber Antiphos Vater eine
ungeschickte Bemerkung über ein Mädchen gemacht hat: »Was
war verkehrter, als diesen wunden Punkt zu berühren?«1
Lateinisch »ulcus« (»Geschwür, wunder Punkt«) wurde wie im
Deutschen für das verwendet, was nicht »berührt«, d.h.
angesprochen werden soll: »Alles, was du davon berührt hast, ist ein
wunder Punkt [ulcus].«2 Von »ulcus« ist übrigens das
lateinische Wort »ulcisci« (»sich rächen«) abgeleitet, womit »Rache«
eigentlich ein »Eitern«, das »Entwickeln eines Geschwürs« ist;
bekanntlich ist ja Rache meistens für denjenigen süß (-♦ Rache
ist süß), der sich an einem eigenen wunden Punkt getroffen
fühlt.
L: Duden 11,559; Mletzko 16. 94.144; Otto 353 (Nr. 1810). 1: Ter. Phorm. 690: »Quid
minus utibile fyjt, quam hoc ylcus tangere?« 2: Cic. de nat. deor. 1,37,104: »Quicquid
horum attigeris, ulcus est.« Vgl. Plat. Ax. 368c.
R
Rache ist süss
(scherzhaft auch: Rache ist Blutwurst) es tut gut, sich
rächen zu können; oder (drohend): Ich werde mich rächen!
Dieses beliebte Sprichwort geht auf den römischen Satiriker Iu-
venal zurück, der in einem seiner Gedichte das Vergehen des
Treuebruchs behandelt. Als Beispiel dient ihm die
Unterschlagung von 10000 Sesterzen, die Calvinus, der Adressat der
Satire, durch einen Freund erlitten hat. Anders jedoch als man
erwarten möchte, tritt Iuvenal nicht für eine rigorose Bestra-
130
•-% 9»r-
z-- =u.
1;
^rfl
Js
^
**■*
Die Rotten verlassen dos sinkende Schiff.
fung des Täters ein: Eine Tötung wäre sinnlos (der Verlust bleibt
ja bestehen), und die Rache überhaupt ist verwerflich - echte
Bestrafung könne es nur durch eigenes Schuldbewußtsein und
durch Gewissensängste geben. Und so stellt er fest: >»Rache ist
doch ein teureres Gut als das Leben selbst.< I Gewiß sagen dies
die Ungebildeten, deren Brust man bisweilen aus keinem / oder
einem geringfügigen Grund entflammt sieht.«1
Entsprechend wird »Rache ist süß« heute oft scherzhaft
gebraucht, da man eigentlich weiß, daß sie nicht der richtige Weg
ist. Ein deutsches Sprichwort weist darauf hin: »Die Rache ist
süß, man verdirbt sich aber oft den Magen daran.«2
L: Duden 11,562-563; Mletzko 94. 118; Wander 3,1451 (Rache 6. 7. 16. 17. 23). 1:
luv. 13,180-182: »>£t vindkta bonym vita iucyndius ipsa< / ngmpe hoc indoctL
quorym praecßrdia nyllis / interdum aut levibys videas flagrgntia causis.« 1: Wander
3,1451 (Rache 3); vgl. die Variante: »Rache ist süß, verzeihen süßer.« B: »Rache ist ein
Gericht, das am besten kalt genossen wird« ist ein klingonisches Sprichwort in dem
Film »Star Trek VI«.
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff
ein vom Unglück Bedrohter wird von allen verlassen; auch:
Alle Anzeichen deuten auf eine Gefahr oder gar Katastrophe
hin.
Das Phänomen, daß Tiere drohende Gefahren früh
wahrnehmen können, war schon den Römern bekannt. Daher das
Fortgehen von Ratten aus einem Gebäude als schlechtes -♦ Omen.
Cicero jedoch schreibt in einem Brief an seinen Freund Atticus
am 17. April 44 v. Chr.: »Mir sind zwei Baracken eingestürzt,
und die übrigen ziehen Risse. Daraufhin haben nicht nur die
Mietsleute, sondern sogar die Ratten das Weite gesucht. Alle
Welt nennt das ein Malheur, ich kaum eine
Unbequemlichkeit.«1 Auch der Naturforscher Plinius d. Ä. berichtet: »Wenn
ein Gebäude einzustürzen droht, so wandern vorher die Mäuse
aus, und die Spinnen fallen zuerst mit ihren Geweben hinab.«2
Im Deutschen steht das anstelle der Gebäude eingetretene
Schiff vermutlich im Zusammenhang mit der verbreiteten
Metapher vom Staatsschiff und der (Mitte des 20. Jh. aus England
übernommenen) Wendung -♦ im gleichen Boot sitzen: Wer
eine Gemeinschaft in Gefahr verläßt, wird geradezu als Ratte,
die frühzeitig von Bord geht, diskreditiert. Eine nette
Anwendung der Redensart stammt von Gerhard Uhlenbruck: »Leserat-
132
ten verlassen nie das sinkende Schiff - des verehrten Bestseller-
Autors.«3
L: Duden 11,568; Mletzko 94. 102; Otto 234 (Nr. 1171); Wander 3,1494 (Ratte 6).
1: Cic. Att. 14,9,1: »Tabernae mihi duo corruerunt reliquaeque rimas agunt; itaque non
solum inquilini, sed mures etiam migraverunt« (Übers. H. Kasten). 2: Plin. nat. 8,103:
»Ruinis imminentibus musculi permigrant, aranei cum telis primi cadunt.« 3: Mieder,
Phrasen 270 mit Beleg.
den Rubikon überschreiten
einen Weg einschlagen, auf dem es kein Zurück mehr gibt,
alles aufs Spiel setzen, eine folgenreiche Entscheidung
treffen; am R. stehen: an einem Punkt stehen, der eine
wichtige, folgenreiche Entscheidung erfordert.
Der Rubikon ist ein kleiner in die Adria mündender Fluß im
Apennin,1 der in römischer Zeit der Grenzfluß zwischen Italien
und der Provinz Gallia Cisalpina war. Als zu Beginn des Jahres
49 v. Chr. Pompeius den Staatsnotstand ausrufen ließ und den
Senat von Caesar verlangen ließ, dieser müsse seine Provinz
Oberitalien abgeben und sein Heer entlassen, überschritt
Caesar mit seinem Heer den Rubikon als die Grenze seiner Provinz
Gallien und begann damit den Bürgerkrieg gegen Pompeius.2
Vor Überschreiten des Flusses zögerte Caesar und sagte: »Jetzt
können wir noch umkehren. Haben wir aber diese kleine
Brücke überschritten, dann müssen die Waffen alles
entscheiden.«3 Als er noch zögerte, soll plötzlich ein großer und
schöner Mann erschienen sein, der einem Spielmann die Trompete
entriß, das Angriffssignal blies und zum anderen Ufer
hinübereilte. Dies wurde als göttlicher Wink verstanden, und Caesar
sagte: »So wollen wir gehen, wohin der Götter Zeichen und der
Feinde Ungerechtigkeit uns rufen!« Als Bild für die
Unumkehrbarkeit des nun folgenden Handelns fügte er seinen wohl
bekanntesten Ausspruch an: »Der Würfel ist gefallen!« (-♦ Die
Würfel sind gefallen).4
Die Wendung »den Rubikon überschreiten« für eine
folgenreiche und unumkehrbare Entscheidung erscheint englisch seit
dem frühen 17. Jh.5 und wohl erst in dessen Folge auch im
Deutschen. In der Motivationspsychologie hat Heinz
Heckhausen das Bild des Rubikon im sogenannten »Rubikon-Modell«
gebraucht, um die entscheidende Grenze zwischen der Phase
der Willensbildung (Motivationsphase) und der der Willens-
133
ausführung (Volitionsphase) zu markieren. Auch hier dient der
Rubikon als Metapher für den Punkt, an dem eine Umkehr
nicht mehr möglich ist: Der Prozeß des Abwägens
verschiedener Alternativen wird abgebrochen und die Handlung
konsequent auf ein Ziel ausgerichtet.6
L: Büchmann 368; Duden 11,590 und 12,404; Macrone 172-173; Wander 3,1751.
1: Es handelt sich wahrscheinlich um den heutigen Fiumicino, der zur Zeit Mussolinis in
Rubicone umbenannt war; doch auch der Pisciatello und der Uso wurden bisweilen als
der antike Rubikon angesehen. 2: Zu den Details dieser Auseinandersetzung siehe
Hans-Martin Ottmer, Die Rubikon-Legende. Untersuchungen zu Caesars und Pom-
peius' Strategie vor und nach Ausbruch des Bürgerkrieges, Boppard 1979. 3: Suet.
Caesar 31.4: Suet. Caesar 32. 5: Macrone 173 mit Beispielen. Das Verb »to rubicon« als
»überraschend besiegen« tauchte im späten 19. jh. auf und bezeichnete auch einen
entscheidenden Sieg beim Kartenspiel Cribbage: Macrone 173 mit einem Beispiel bei
R. F. Foster. 6: Vgl. Rosa Maria Puca, Motivation diesseits und jenseits des Rubikon,
Wuppertal 1996, S. 48-52. S: Engl. »To cross/pass the Rubicon«.
S
Die Sache spricht für sich
Es bedarf keiner weiteren Erklärung. Oft auch: Die
Tatsachen sprechen für sich.
Daß eine Sache so augenscheinlich ist, daß nichts mehr dazu
auszuführen ist, war bereits griechisch und lateinisch ein
geläufiges Motiv: »Die Dinge selbst haben es klargemacht« heißt
es z. B. bei Plutarch.1 Bei den Römern findet sich zuerst bei dem
Komödiendichter Plautus: »Die Sache selbst ist Zeuge.«2 Ein
»Sprechen« der Sache wurde allerdings erst von Cicero
eingeführt, der in seiner Verteidungsrede für Milo von einer
pikanten Begebenheit berichtet, die seinem Mandanten
widerfahren sei: »Bei vollbesetztem Hause kürzlich auf dem Kapitol
fand sich ein Senator, der behauptete, Milo habe
[verbotenerweise] eine Waffe bei sich: Da entkleidete er sich in diesem
134
hochheiligen Gebäude (da ja der [gute] Lebenswandel eines
solchen Bürgers und Mannes nicht genug Glauben erweckte),
so daß - während er selbst schwieg - die Sache für sich selbst
sprach.«3
In einer Fabel des Phaedrus wird dies noch zu einem
»Schreien« gesteigert: Als ein Hirt versehentlich einem Schaf
ein Hörn abbricht und bittet, es möge ihn nicht an den Herrn
verraten, sagt das Schaf: »Obwohl ich empörend verletzt
worden bin, will ich doch schweigen; aber die Sache selbst wird
hinausschreien, was du angestellt hast.«4
L: Mletzko 99. 113. 119; Otto 297 (Nr. 1522). 1: Plut. Pomp. 23: eÖTiXüxre 6* a\>xd xd
itpäYnaxa. Weitere griech. Belege bietet Otto 297 (Nr. 1522). 2: Plaut. Aul. 421: »res
ipsa t£St(is) est.« Ähnliche Stellen bei Plautus und Terenz nennt Otto 297 (Nr. 1522). 3:
Cic. Mil. 24,66: »Frequentissimo senatu nuper in Capitolio Senator inventus est qui Mi-
lonem cum telo esse diceret: nudavit se in sanctissimo templo, quoniam vita talis et ci-
vis et viri fidem non faciebat, ut eo tacente res ipsa loqueretur.« Vgl. Sen. benef. 2,11,6.
4: Phaedr. append. 24,5: »...sed rgs clamabit ipsa, quid deliquens.«
ohne Saft und Kraft
kraftlos, schwunglos, fade; auch: saft- und kraftlos.
Der »Saft« (lat.: »sucus«) ist schon seit den Römern eine
Umschreibung für Blut und damit Sinnbild von Frische und
Lebenskraft. Er wurde oft alliterierend mit »sanguis« (»Blut«)
verbunden: So schreibt beispielsweise Cicero nach seinem
verlorenen Prozeß gegen Gabinius Ende Oktober 54 v. Chr. an
seinen Freund Atticus: »Ach, mein lieber Pomponius, nicht nur
allen Saft und alles Blut [>omnem sucum et sanguinem<] haben
wir verloren, selbst die Farbe und das frühere Gesicht des
Staates ist dahin! Es gibt kein Gemeinwesen mehr, an dem ich mich
freuen, mit dem ich mich trösten könnte.«1
Im Deutschen wurde jedoch wegen des gleichen
Wortauslautes die Verbindung »Saft und Kraft« bevorzugt. Eine ähnliche
Verbindung, die ein und dieselbe Sache mit zwei Begriffen
umschreibt, ist die verbreitete Zwillingsformel »Fleisch und Blut«,
die den Körper des Menschen im Ganzen oder in seiner
Leiblichkeit beschreibt.2
1: Cic. Att. 4,20(18),2: »Amisimus omnem non modo sucum et sanguinem, sed etiam
colorem et speciem pristinam civitatis, nulla est res publica, quae delectet, in qua ad-
quiescam.« Vgl. Brut. 9,36. »Und jenes war, wie ich meine, unverdorbener Saft und
unverdorbenes Blut der Redner bis auf die heutige Zeit« (»et, ut opinio mea fert, sucus ille
et sanguis incorruptus usque ad hanc aetatem oratorum fuit«). Cic. de or. 23,76: »Auch
135
wenn er nämlich nicht sehr viel Blut hat, so muß er doch einigen Saft haben« (»Etsi
enim non plurimi sanguinis est, habeat tarnen sucum aliquem oportet«). 2: Vgl. aus
Fleisch und Blut sein: ein Mensch sein; in Fleisch und Blut übergehen: zur festen
Eigenschaft, Gewohnheit oder Überzeugung eines Menschen werden; oder von
Kenntnissen: von jemandem vollkommen beherrscht werden.
JEMANDEM SAND IN DIE AUGEN STREUEN
jemandem etwas vormachen, jemanden über die Wahrheit
hinwegtäuschen; (niederdt.:) übertreffen.
Die Wendung beruht wohl auf dem Trick, bei einem
Zweikampf dem Gegner durch Sand in den Augen die Sicht zu
nehmen. Sie ist zuerst bei dem römischen Schriftsteller Gellius
überliefert in bezug auf einen Gesprächsteilnehmer: »Und er
streute diese [gemeint sind Wortleckerbissen, kleine
Vorlesungen] gleichwie Staub in [unsere] Augen, als er jeden [von uns]
anging.«1 Eine ähnliche Redensart lautete »jemandem
Blendwerk gegen die Augen werfen« (»glaucumam ob oculos obi-
cere«),2 die vielleicht in der deutschen Wendung »jemandem
blauen Dunst vormachen« ihre Fortsetzung gefunden hat.
Ein sehr junger heutiger Ausdruck ist die »Sandfrau« als
Bezeichnung für eine Frau, die als Begleitung eines schwulen
Mannes über dessen Homosexualität hinwegtäuschen soll.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 410; Duden 11,604; Otto 290 (Nr. 1483); Wander
3,1862 (Sand Nr. 35). 1: Gell. 5,21,4: »...easque (sc. inauditiunculas) quasi pulverem
ob oculos, cum adortus quemque fuerat, adspergebat.« Vgl. Er. Ad. 2,9. 2: Plaut. MM.
148. S: Frz. »jeter (de) la poudre aux yeux«; ndl. »Hij stroolt hem zand in de oogen«.
(nur noch) ein Schatten seiner selbst
sein
körperlich sehr schwach sein; auch: eine Erscheinung
bieten, die in starkem Gegensatz zu früherem Glanz und Erfolg
steht. Der Schatten einer Hoffnung: nicht die geringste
Hoffnung; vgl.: nicht den Schatten von etwas (z.B. einer
Ahnung) haben: etwas nicht im geringsten Maße haben.
Dieses Bild hängt damit zusammen, daß der Schatten einer
Sache oder eines Menschen nur ein schwaches und flüchtiges
Abbild darstellt und - zumal das Original schon vergangen ist -
den nur noch für kurze Zeit verbleibenden letzten Rest von
etwas symbolisiert. Als erster gebraucht es der römische Dichter
136
Lukan (39-65), der in seinem Bürgerkriegsepos »Pharsalia« den
von Caesar besiegten Pompeius (der vormals »der Große« -
Pompeius Magnus - genannt worden war) als »Schatten eines
großen Namens« (lat.: »magni nominis umbra«) bezeichnet.1
Erstmals bei dem Schriftsteller Varro begegnet übrigens die
auch im Deutschen gebräuchliche Wendung »Schatten einer
Hoffnung« im Sinne einer ganz geringen Hoffnung.2
Im Mittelalter entstand aus dem Lukan-Wort vom »Schatten
eines großen Namens« die Aufforderung: »Um den Schatten
eines großen Namens [d.h. um vergänglichen irdischen Ruhm]
sollst du dir keine Gedanken machen.«3 Schiller griff das Motiv
für seine »Maria Stuart« auf, die ihre Rivalin Elisabeth
vergeblich zu rühren versucht (vgl. auch -♦ besser sein als sein Ruf);
dabei weist sie auf ihr jetziges Erscheinungsbild hin: »Ich bin
doch nur der Schatten der Maria!«4
L: Böttcher 82 (Nr. 475) und 364 (vor Nr. 2342); Duden 12,409; Otto 355 (Nr. 1819);
Tosi 8 (Nr. 12). 1: Lucan. 1,1 35. 2: Varro bei Non. p. 26,29: »cum hie rapo umbram
quoque spei devorassit« (p. 187 R.). 3: »Non sit tibi curae de magni nominis umbra«; so
bei Thomas von Kempen, Imitatio Christi 3,24,2 nach Tosi 8 (Nr. 12). 4: Maria Stuart,
1801 (uraufgeführt in Weimar am 14. 6.1800), 3,4,2382.
JEMANDEM WIE SEIN SCHATTEN FOLGEN
fortwährend um jemanden herum sein, ganz dicht folgen.
Vgl. das Sprichwort: * Ehre ist der Tugend Schatten.
Anders als im vorangehenden Stichwort drückt der Vergleich
mit einem Schatten hier eine äußerst enge Verbindung mit
einer Person aus. Die lateinische Wendung »quasi umbra perse-
qui« erscheint schon bei dem Komödiendichter Plautus: Als im
ersten Akt der »Casina« die zwei Sklaven Olympio und Chali-
nus auftreten, will Olympio den ihm ganz dicht folgenden
Chalinus abschütteln und fragt ihn: »Warum, zum Teufel,
folgst du mir?« Antwort: »Weil es mein fester Entschluß ist, /
wie ein Schatten, wohin auch immer du gehen willst, dir stets
zu folgen.«1 Ähnlich charakterisiert man heute mit der
Redensart leicht verächtlich Menschen, die sich ständig an andere
hängen, um etwas von ihnen zu erreichen.
In der Antike ist das Bild aber nicht auf Personen beschränkt
gewesen: Daß die Ehre »der Tugend Schatten« sei, also mit
Tugend untrennbar verbunden, ist ein bei Cicero und anderen
lateinischen Autoren oft formulierter Gedanke: »Auch wenn
137
nämlich der Ruhm nichts an sich hat, warum er erstrebt
werden sollte, so folgt er doch der Tugend gleichwie ein
Schatten.«2
L: Böttcher 55 (Nr. 258-259); Borchardt-Wustmann-Schoppe 421-422; Duden
11,611-612; Otto 155 (Nr. 764) und 355 (Nr. 1818). 1: Plaut. Cas. 91-92: »Quid ty,
malym, me sgquere? Quia certym est mihi / quasi ymbra, quöquo tu ibis, tg sempgr
sequi.« Bei Erasmus ad. 3,7 unter »velut umbra sequi«: Borchardt-Wustmann-Schoppe
422. 2: Cic. Tusc. 1,45,109: »Etsi enim nihil habet in segloria, cur expetatur, tarnen vir-
tutem tamquam umbra sequitur.« Vgl. Sen. ep. 79,13; Hieron. ep. 108,3; epitaph. Pau-
lae col. 175 Vall. S: Frz. »La gloire est la recompense de la vertu«.
Wenn es am besten schmeckt, soll man
aufhören
Zu reichliches Essen mindert den Genuß, zu langes
Auskosten einer guten Sache kann den Genuß beeinträchtigen;
auch: höfliche Äußerung zur Ablehnung weiteren
angebotenen Essens. Vgl. auch: Wenn es am schönsten ist, soll man
gehen.
In den »Attischen Nächten«, einer literarischen Blütenlese des
Schriftstellers Gellius (2. Jh.), sind die Worte eines gewissen Fa-
vorinus überliefert: »Die Experten der Küche und des Luxus
meinen, daß kein Essen anständig sei, wenn es nicht dann,
wenn es dir am besten schmeckt, fortgetragen und andere noch
bessere und umfangreichere Speise an dessen Stelle gesetzt
werden könne. Dies wird jetzt als Blüte beim Essen gehandelt bei
denen, für die Aufwand und Übermaß vor den Scherzen
kommen und die meinen, man dürfe keinen anderen Vogel als eine
ganze Schnepfe verzehren.«1 Aus dem ersten Satz dieses Zitats,
das alles andere als Enthaltsamkeit empfiehlt, wurde später -
der Zeitpunkt läßt sich nicht nachweisen - das Stück »wenn es
dir am besten schmeckt, (soll das Essen) fortgetragen (werden)«
isoliert und als Ratschlag für echte Genießer, die zum rechten
Zeitpunkt ein Ende finden, sprichwörtlich.
L: Duden 11,628; Mletzko 11. 104; Wander 4,259 (schmecken Nr. 41). 1: Cell. 15,8,2:
»Praefectl poplnae atque luxuriae negant cenam lautam esse, nlsl, cum lubentissime
edls, tum auferatur et alia esca mellor atque amplior succenturietur. Is nunc flos cenae
habetur inter istos, quibus sumptus et fastidium pro facetiis procedit, qui negant ullam
auem praeter ficedulam totam comesse oportere.«
138
\
r^^V
,.^>
'/
M
' /
-%
I
.iniPgJ|-.Vvv.>.-a> '■■«'•'»^ '^^
/ 1
^:IFV*
Wenn es om besten schmeckt, soll man aufhören.
Wer gut schmert, der gut fährt
Bestechung ist unverzichtbar, um voranzukommen (auch
hochdt: Wer gut schmiert, d. g. f.); oder allgemeiner: wer
weiterkommen will, muß etwas investieren.
Der Schriftsteller Petronius singt in seinem Schelmenroman
»Satyrica« ein ironisches Loblieb auf das Geld, mit dem alles
viel besser gelinge: »Jeder der Geld hat, der segelt mit sicherem
Wind.«1 Das gleichbedeutende deutsche Sprichwort »Gold
geht durch alle Türen« findet sich lateinisch bereits bei Apu-
leius (»Mit Gold pflegen auch Stahltüren durchbrochen zu
werden«),2 geht aber noch weiter auf griechische Vorbilder
zurück.3 Bekannt war in diesem Zusammenhang der Ausspruch
Philipps II. von Makedonien, der gesagt haben soll, daß »alle
Festungen erobert werden könnten, an die nur ein mit Gold be-
ladener Esel herankommen könne«.4 Ein späteres Sprichwort
drückte es so aus: »Wenn das Gold spricht, ist jedes Reden
hinfällig« (lat.: »auro loquente omnis sermo inanis est«).
Die deutsche Fassung »Wer gut schmert, der gut fährt« ist seit
dem Mittelalter in einer Fülle von Varianten belegt; aus dem
Schmieren von Wagenrädern entstanden (mit dem Sinn: Wer
gut schmiert, d.h. sich gut um den Wagen kümmert, fährt
schneller), wurde sie dann auf das »Schmieren« mit
Bestechungsgeld übertragen. Ohne jedoch wohl an Bestechung zu
denken, hat die Deutsche Bundesbahn 1984 den Satz zu einem
Werbeslogan umgestaltet: »Wie man fährt, so spart man.«5
L: Büchmann 341; Duden 11,629; Fritsch 48; Otto 50 (Nr. 222) und 247 (Nr. 1252);
Reichert 145; Wander 4,276-278 (v. a. Nr. 23). 1: Petron. 1 37: »Qujsquis habgt num-
mo_s, secyra navigat aj^ra.« 2: Apul. met. 9,18: »cum ... auro soleant adamantinae
etiam perfringi fores.« 3: Men. monost. 538: »Gold öffnet alles, sogar die Türen des
Hades« (xpvaoc, 6' dvoiYEi icdvxa k' ouSod n\)\a$. 4: Cic. Att. 1,16,122: »omnia castella
expugnari posse, in quae modo asellus onustus auro posset ascendere«; vgl. Hör. c.
3,16,13. 5: Juni 1984, Lübecker Hauptbahnhof; nach Mieder, AntiSprichwörter 116.
sich sein Schulgeld wiedergeben lassen
KÖNNEN
nichts gelernt haben, unbefriedigende Leistungen zeigen
(z.B.: Du kannst dir dein Schulgeld wiedergeben lassen!
Auch: Sich sein Lehrgeld wiedergeben/zurückgeben lassen;
auch mit »sollen«).
140
In dem Roman »Satyrica« des Petronius geraten zwei Gäste bei
einem Gelage miteinander in Streit. Als darüber Giton; der
schöne Begleiter des Erzählers, laut lachen muß; richtet einer
der Streitenden seine Wut gegen ihn und wirft ihm neben der
Beschimpfung »Wie der Herr, so der Sklave« (-♦ Wie der Herr,
so's Gescherr) an den Kopf: »Du wirst schon merken, daß dein
Vater das Lehrgeld für dich aus dem Fenster geworfen hat!«1
Daraus wurde ins Deutsche der Ratschlag übernommen,
jemand solle »sich sein Schulgeld wiedergeben lassen«. Schon in
der Antike hätte das, in die Tat umgesetzt, ein ansehnlicher
Betrag werden können, denn Bildung kostete - wie so oft - viel
Geld.
L: Böttcher 80 (Nr. 460); Büchmann 341; Duden 11,640 und 12,294; Otto 219-220
(Nr. 1097); Reichert 216.1: Petron. 58: »lam scies patrem tuum mercedes perdidisse.«
AUF DIE LEICHTE SCHULTER NEHMEN
etwas nicht ernst nehmen, unterschätzen (auch: auf die
leichte Achsel nehmen).
Die »Schulter« gibt es so im Lateinischen noch nicht, aber die
Wendung »mit leichtem Arm betreiben« bedeutete, daß man
sich bei etwas nicht die angemessene Mühe gibt oder es nicht
ernst genug nimmt: »Die Konsuln, die jenes mit leichtem Arm
getan hatten [d.h. nur kraftlos betrieben hatten], brachten die
Sache vor den Senat«, berichtet Cicero in einem Brief an Atticus
vom 1. Oktober 54 v. Chr.1 Ähnliche Mühe- oder Sorglosigkeit
bezeichnete die Redewendung »mit lockerem Togabausch
tragen«.2
Da etwas, was ohne großen Einsatz »mit leichter Hand« (oder
auch ganz locker »mit links«) ausgeführt wird, schneller und
leichter von der Hand geht, hat sich im Deutschen heute für
»mit leichter Hand« der positivere Sinn von »mühelos, mit
Leichtigkeit« durchgesetzt.
L: Büchmann 329; Duden 11,640; Otto 58 (Nr. 271). 1: Cic. AU. 4,19(17),3: » Consu-
les, qui illud levi brachio egissent, rem ad senatum detulerunt.« Vgl. Cic. Att. 2,1,6: »mit
weichem Arm« (»molli bracchio«); Er. ad. 1,4,27. 2: Hör. s. 2,3,172 (»ferre sinu laxo«).
141
EIN SCHWARZER TAG
ein Tag voller Mißerfolge oder Katastrophen.
In der griechisch-römischen Antike gab es angeblich die Sitte,
für schöne Tage weiße Steinchen, für schlechte Tage schwarze
Steinchen zurückzulegen, um hinterher die Zahl der guten und
schlechten Tage zu vergleichen.1 Nach einem Persius-Kom-
mentar sei dies im Ursprung eine kretische Sitte gewesen, »da
die Kreter, die definierten, daß das Leben aus Freude bestehe,
freudige Tage mit weißem Steinchen und traurige mit
schwarzem anzeigten, später eine Zählung der Steinchen
vornahmen und schauten, wie viele freudige Tage im Jahr sie
erlebt hätten, und sich vor Augen hielten, daß sie diese erlebt
hatten«.2 Man konnte eine solche Bewertung im Kalender
offenbar auch »mit Kreide oder Kohle«3 (also weiß bzw. schwarz)
vornehmen. Entsprechend nannten die Griechen einen guten
Tag oder Glückstag einen »weißen Tag«.4 Aber erst in Rom
prägte man die umgekehrte Bezeichnung »schwarze Tage« für
Tage, die man im Kalender als unheilvoll betrachtete. Dies
waren vor allem die Tage, die den Kaienden, Nonen und Iden
folgten, d.h. dem 1., 7. oder 9. und 13. oder 15. Tag jeden Monats.
An diesen Tagen sollte man nichts Neues beginnen und keine
Kulthandlungen vornehmen. Ein Tag konnte auch zum
schwarzen Tag erklärt werden, weil sich an ihm eine
bedeutende Katastrophe ereignet hatte, wie z.B. der Jahrestag der
Schlacht an der Allia, einem Nebenflüßchen des Tiber im
Nordosten von Rom, wo das römische Heer (der Überlieferung
nach am 18. Juli 390 v. Chr.) von den Galliern vernichtet
worden war (vgl. -♦ sein Schwert in die Waagschale werfen). In der
Neuzeit ist vor allem der 25. Oktober 1929, an dem die
Aktienkurse an der New Yorker Börse schlagartig fielen, als »Schwarzer
Freitag« (»Black Friday«) in Erinnerung geblieben.
L: Bartels 62; Böttcher 53 (Nr. 235-236) und 632-633 (Nr. 4115); Büchmann
366-367; Otto 64-65 (Nr. 299). 1: Belege bietet Otto 64-65 (Nr. 299); vgl. die
Übertragung des Motivs auf das menschliche Schicksal bei Schiller, der in seinem »Lied von
der Glocke« zu Beginn der 6. Strophe über das unbeschwerte Dasein eines Kindes
dichtet: »Ihm ruhen noch im Zeitenschoße / Die schwarzen und die heitern Lose.« 2: Schol.
zu Pers. 2,1, zitiert bei Otto 64 (Nr. 299). 3: »creta an carbone (notare)«, für Personen
oder Dinge gebraucht: Hör. s. 2,3,246; Pers. 5,108. 4: Belegstellen bei Otto 65 (Nr.
299). Ähnlich kann man im Deutschen, wenn man ein glückliches Ereignis in
Erinnerung behalten möchte, sagen: »Den Tag will ich mir im Kalender rot anstreichen.«
142
BEREDTES SCHWEIGEN
ein aussagekräftiges Schweigen; ein Schweigen, das als
solches einiges über das Verschwiegene verrät. Als Sprichwort:
Mit Schweigen kann man viel sagen. Vgl. auch: Dazu sage
ich jetzt nichts; keine Antwort ist auch eine Antwort.
In seiner ersten Rede gegen den Verschwörer Catilina lehnt der
Konsul und Redner Cicero eine Debatte des Senats über den
Fall ab, vielmehr fordert er Catilina mit deutlichen Worten auf,
ins Exil zu gehen. Dabei deutet er das Schweigen der Senatoren
als stillschweigendes Einverständnis: »Was dich aber betrifft,
Catilina: Indem sie ruhig bleiben, heißen sie es gut, indem sie
es zulassen, beschließen sie es, und indem sie schweigen,
schreien sie.«1 Das Motiv findet sich in verschiedenen
Abwandlungen noch in anderen Werken Ciceros und bei anderen
lateinischen Autoren.2
Die bekannte Rechtsregel »Wer schweigt, scheint
zuzustimmen« (lat.: »Qui tacet, consentire videtur«) begegnet erst im
13. Jh. in den Dekretalen des Papstes Bonifaz VIII.3 In den
Digesten des Kaisers Iustinian (533) wurde vorsichtiger
formuliert: »Wer schweigt, stimmt nicht in jedem Falle zu; aber es ist
doch auch wahr, daß er nicht leugnet.«4
L: Bartels 58-59; Böttcher 61 (Nr. 299); Büchmann 316; Duden 12,91. 392; Otto 339
(Nr. 1733-1734); Tosi 11-12 (Nr. 20-21). 1: Cic. Cat. 1,8,21: »De te autem, Catilina,
cum quiescunt, probant, cum patiuntur, decernunt, cum tacent, clamant...« 2: Vgl. die
Belege bei Otto 339 (Nr. 1733), der auch griechische Vorlagen nennt. 3: Bonifaz VIII.,
Über sextus decretalium 5,12,43. Vgl. Tosi 12 (Nr. 21) mit weiteren Belegen. 4: Dig.
50,17,142: »Qui tacet non utique fatetur: sed tarnen verum est eum non negare.«
tiefes Schweigen
ein völliges, dauerhaftes Schweigen.
Nachem in Vergils »Aeneis« der trojanische Held Aeneas La-
tium erreicht hat, erregt die ihm übelgesonnene Göttin Juno
Krieg mit den italischen Stämmen. In einer
Götterversammlung bittet Venus für ihren Sohn Aeneas und dessen Sohn As-
kanius. Da beginnt Juno eine erbitterte Gegenrede mit den
Worten: »Was zwingst du mich, [mein] tiefes Schweigen / zu
brechen und vernarbten Schmerz durch Worte zu entblößen?«1
»Tief« ist auch heute noch meistens ein Schweigen, dessen
Aufhebung vom Schweigenden nicht gewünscht ist.
143
L: Böttcher 70-71 (Nr. 380-381); Büchmann 324; MIetzko 107. 120. 1: Verg. Aen.
10,63-64: »Quid me alta silgntia cegis / rympere et Qbductym verbis volgare dolßz
rem?«
sein Schwert in die Waagschale werfen
etwas mit militärischer Macht erzwingen, Willkür mit
militärischer Überlegenheit rechtfertigen; häufig auch nur:
etwas durch eigenes Zutun durchsetzen; auch unter
Ersetzung des »Schwertes« durch beliebige andere Substantive,
z. B.: seinen politischen Einfluß in die W. w.: etwas ins Spiel
bringen, etwas geltend machen (und dadurch den
Ausschlag geben).
Der Sage nach nahmen im Jahre 390 v. Chr. nach der Schlacht
an der Allia (vgl. -♦ schwarzer Tag) die Gallier Rom ein und
forderten 1000 Pfund Gold als Lösegeld für den Abzug aus der
Stadt.1 Als sich der römische Offizier Quintus Sulpicius über die
dafür verwendeten falschen Gewichte der Gallier beklagte, soll
der Gallierkönig Brennus (so nennt ihn Livius als erster) auch
noch sein Schwert in die Waagschale geworfen haben; mit
dieser Geste erhöhte er nicht nur die Menge des zu zahlenden
Goldes, sondern wies auch unübersehbar auf die Möglichkeit des
Siegers hin, Gewalt anzuwenden.
Darüber hinaus soll der König das für die Römer
schmachvolle Wort »Wehe den Besiegten!« (lat.: »Vae victis!«) gerufen
haben, das in der Antike bald darauf sprichwörtlich wurde;2
dies kann man auch heute noch deutsch oder lateinisch
zitieren, um auf das völlige Ausgeliefertsein eines Unterlegenen
hinzuweisen.
L: Bartels 185; Böttcher 52 (Nr. 232-234); Büchmann 366; Duden 12,423. 480;
MIetzko 1 37. 1: Die Geschichte wird erzählt von Liv. 5,48,9. 2: Flor. 1,1 3,1 7; Fest, de
verb. sign. S. 372 Müller; Plut. Cam. 28,6. Zitiert bei Plaut. Pseud. 1317.
SEHEN UND GESEHEN WERDEN
sich bewußt sehen lassen, um sich auf dem Laufenden zu
halten und das eigene Image zu pflegen.
Der römische Dichter Ovid vergleicht in seiner »Liebeskunst«
die Frauen, die in großen Schwärmen im Theater oder bei
Zirkusspielen zu sehen sind, mit Bienen und Ameisen und fügt
144
hinzu: »Um zu sehen kommen sie, und sie kommen um
gesehen zu werden; dieser Ort ist ein Schaden für züchtige
Keuschheit.«1
Im Englischen führte der Dichter Chaucer2 im 14. Jh. das
Motiv, Ben Jonson3 später die Wendung »To see and be seen«
ein. Mit der Ovidrezeption im Humanismus wurde sie auch im
Deutschen gängig.
L: Macrone 199.1: Ov. ars 1,99-100: »Spgctatym veniynt, veniynt spectgntur ut ipsae:
/ jlle locus casti damna pudQris habet.« 2: Die Frau von Bath »had the better leisure for
to play / And for to see, and eke for to be seen / Of lusty (d. h. vibrierend) folk«. 3: In
seinem Hochzeitsgedicht »Epithalamion« (1609): »As they came all to see and to be
seen.« S: Engl. »To see and be seen«.
BESSER SPÄT ALS NIE
etwas kommt zwar spät zustande, aber es kommt immerhin
zustande; auch (scherzhaft-ironisch): Jemand kommt doch
sehr spät!
Mit dem Zusatz »besser spät als nie« (lat.: »potius sero quam
numquam«) forderten nach dem Bericht des Livius die
Konsuln des Jahres 445 v. Chr.; Marcus Genucius und Gaius Cur-
tius; die Senatoren zu beherztem Handeln auf.1 Ziel ihrer
Attacken war der -♦ Volkstribun Gaius Canuleius, der in der
heißen Phase der Ständekämpfe durch ein Gesetz die
Eheschranke zwischen Patriziern und Plebejern (-* der Plebs)
beseitigen wollte.
In Schillers »Wallenstein«, 2. Teil (Die Piccolomini), ruft
gleich zu Beginn der Feldmarschall Illo dem eintreffenden
Kroatengeneral Graf Isolani zu: »Spät kommt Ihr - doch Ihr
kommt! Der weite Weg, / Graf Isolan, entschuldigt Euer
Säumen.« Die von Isolani in demselben Stück geäußerte und
sprichwörtlich gewordene Maxime »Der Krieg ernährt den
Krieg«2 geht übrigens ebenfalls auf Livius zurück.3
L: Böttcher 361 (Nr. 2314); Büchmann 333; Duden 11,670 und 12,71.1: Liv. 4,2,11. 2:
1,2,136. 3: Liv. 34,9. S: Engl. »Better late than never«; frz. »Mieux vaut tard que ja-
mais«.
Das Spiel ist aus!
Es ist vorbei. Oft auf Verbrechen bezogen: Jemand ist / Du
bist überführt.
145
Der römische Kaiser Augustus soll auf seinem Sterbebett gesagt
haben: »Und wenn es denn / wohl gut ist, gebt Beifall dem
Spiel / und laßt uns alle mit Freude nach Hause gehen!«1 Damit
bezeichnete er sein Leben als Theaterstück, das er als
Schauspieler nun zu Ende gespielt habe. Als Abschlußwort für eine
Theatervorstellung stellt sich auch der nachantike Satz »Das
Spiel ist vorbei« (lat.: »Acta est fabula«) dar, der allerdings
zugleich dieselbe Bedeutung annahm wie bereits der antike
Verzweiflungsruf »actum est (de me)« (»es ist aus/vorbei [mit mir],
es ist [um mich] geschehen«).2
Heutzutage ist das »Spiel«, das aus ist, meistens eine List, ein
Betrug oder ein anderes Verbrechen.
L: Zanoner9 (Nr. 33). 1: Suet. Aug. 99: »ei Se n | ex01 KoXcoq tu) Kaiyviü) Öoie Kpo-
xov | Kai Trgvxeq niiäc; M^ä xaP<*c, Kpcme|ivaTe« (ed. Ailloud, 1954). 2: Beispielsweise
Ter. Eun. 54-55; griech. KenpaKrai Eur. Hipp. 778; vgl. Er. ad. 1,3,39. S: Engl. »The
game is over«; ital. »Lo spettacolo e finito.«
NICHT SPRUCHREIF SEIN
noch nicht entscheidungsreif (auch: veröffentlichungsreif)
sein.
»Schuldig« und »nicht schuldig« lautete lateinisch »con-
demno« (»ich verurteile«) bzw. »absolvo« (»ich spreche frei«).
Wenn der Sachverhalt allerdings noch unklar war und man
daher ein erneutes Beweisverfahren für notwendig hielt, konnte
man als Geschworener »Non liquet« (es ist nicht flüssig, klar,
einleuchtend) auf dem Stimmtäfelchen notieren.
Beispielsweise berichtet Cicero in seiner Verteidigungsrede für Cluen-
tius über einen früheren Prozeß im Jahre 74 v. Chr., in dem
Cluentius der Ankläger gewesen war: »Einsichtsvolle Männer,
die noch durch die alte Schule der Gerichte gegangen waren,
vermochten weder diesen ganz und gar schuldigen Menschen
freizusprechen, noch wollten sie ihn, bei dem man vermutete,
daß Geld gegen ihn eingesetzt worden sei, ohne weiteres
verurteilen, solange diese Sache noch nicht untersucht war; sie
erklärten also, der Fall sei ihnen nicht klar.«1
Noch heute bedeutet »non liquet« im Zivilrecht die
Feststellung, daß ein Sachverhalt uneindeutig geblieben ist und daß
weder Beweise dafür noch solche dagegen vorliegen.
L: Bartels 116; Büchmann 315; Duden 12,363; Mletzko 64. 1: Cic. Cluent. 28,76:
»Deinde homines sapientes et ex vetere illa disciplina iudiciorum, qui neque absolvere
146
hominem nocentissimum possent neque eum, de quo esset orta suscipio pecunia op-
pugnatum, re illa incognita primo condemnare vellent, non liquere dixerunt.« Vgl. Cell.
14,2; Clc. Caec. 10,29; Qulnt. inst. 3,6,12.
einen Stein rühren
großes Mitleid erregen, selbst den Gefühllosesten
beeindrucken (häufiger noch: einen Stein erweichen; zum
Steinerweichen: höchst mitleiderregend).
Der Stein steht bereits bei den lateinischen Komödiendichtern
Plautus und Terenz als Bild für einen gefühllosen und dummen
Menschen; man hört dort: »Was stehst du so da; du Stein?«
oder »Du hältst mich wohl ganz für einen Stein, nicht für einen
Menschen!«1 In der späteren Dichtung wurde das Rühren eines
unbeweglichen Herzens zum häufigen Motiv, wofür allerdings
die Wendung »Stahl bewegen« (»adamanta movere«)
bevorzugt wurde: »Mit Tränen wirst du Stahl bewegen.«2
L: Duden 11,687; Otto 4-5 (Nr. 19). 1: Ter. Heaut. 831 bzw. Hec. 214; weitere Stellen
nennt Er. ad. 1,4,89. 2: Ov. ars 1,659: »lacrlmls adamanta movgbis.« Vgl. Ov. am.
3,7,57; Trist. 4,8,45; Martial. 7,99.
die Suppe auslöffeln (, die man
sich eingebrockt hat)
mit den Folgen einer Handlung fertig werden müssen, für
etwas geradestehen müssen (auch: Wie man's einbrockt,
muß man's essen / Selbst eingebrockt, selbst ausgegessen).
In der Komödie »Phormio« des römischen Dichters Terenz sagt
der Schnorrer Phormio zu seinem Freund Geta, daß er mit den
Schwierigkeiten seiner Idee, sich ein Mädchen zu verschaffen,
nun selbst fertigwerden müsse: »Du hast es eingebrockt, du
mußt es auslöffeln.«1 Das lateinische Verb für »einbrocken«
(»interere«) bedeutet eigentlich »hineinreiben«, so daß der
Grammatiker Donat anmerkte, so werde unter Bauern von der
Benutzung eines Knoblauchmörsers gesprochen.2 Das deutsche
Wort »einbrocken« stammt dagegen von »brechen« und
bezieht sich auf das Hineinbrechen von Brot in die billige und
daher jahrhundertelang in den breiten Bevölkerungsschichten
vorherrschende Brotsuppe.
Erasmus von Rotterdam überliefert für das frühe 16. Jh. ein
147
anderes, aber gleichbedeutendes lateinisches Sprichwort: »Was
du dir auf den Spinnrocken gelegt hast, mußt du auch
spinnen.«3 In heutigem Deutsch entspricht dem - viel abstrakter -
auch: »Wer a sagt, muß auch b sagen.«
L: Büchmann 314; Duden 11,707 und 12,62; Mletzko 1 3. 29. 109; Otto 1 75-1 76 (Nr.
869); Wander 4,975 (Suppe 74). 1: Ter. Phorm. 318: »Tute hoc intrlstj; tibi o_mne est
gxedgndum...« 2: »napoiiiia apta parasito, quae de cibo est. Hoc autem inter rusticos
de alliato moretario dici solet« nach Otto 1 75-176 (Nr. 869). Vgl. Er. ad. 1,1,85. 3: Er.
ad. 1,1,85. B: Eugen Roth, Gedicht »Immer dasselbe« (1948): »Ein Mensch vor einer
Suppe hockt, / Die ihm ein Unmensch eingebrockt...« S: Engl. »Asyou have brewed, so
you mustdrink«.
T
Tabula rasa machen
»reinen Tisch machen«, d.h.: einen Streit bereinigen,
gründlich Ordnung herstellen, einen Neuanfang
ermöglichen.
In seiner »Liebeskunst« empfiehlt der Dichter Ovid; von
Schmeicheleien und Bitten in Liebesbriefen reichlich Gebrauch
zu machen. Dabei spricht er von den »freigekratzten
Täfelchen« (»tabellae rasae«),1 d.h. den Wachstäfelchen, auf denen
Mitteilungen für den täglichen Gebrauch eingeritzt und nach
Erfüllung ihres Zwecks durch Glättung des Wachses wieder
entfernt wurden, so daß die Tafel erneut beschrieben werden
konnte.
Nun hatte der griechische Philosoph Aristoteles in seiner
Seelenlehre das Bild einer unbeschriebenen Wachstafel für den
Verstand des Menschen verwendet: Er sei wie eine Wachstafel,
die dafür bestimmt sei, beschrieben zu werden (vgl. dt.
»unbeschriebenes Blatt«); für solche Überlegungen griff im 13. Jh.
Albertus Magnus den Ausdruck »freigekratzte Tafel« (tabula rasa)
148
£ % #
Tobulo roso machen.
auf;2 auch bei Thomas von Aquin symbolisierte diese Tafel
noch die aufnahmebereite menschliche Seele.3 Im
Humanismus wurde jedoch im Zuge der Ovidrezeption die »tabula rasa«
in ihrer ursprünglichen Funktion als römische Form des
Schmierpapiers wiederentdeckt. Daher wird sie parallel zu der
deutschen Redewendung »reinen Tisch machen« anstelle des
Tisches verwendet, um einen - fast noch radikaleren und
gründlicheren - Neuanfang zu bezeichnen.
L: Bartels 174; Duden 11,708. 723 und 12,448; Mletzko 97. 121. 1: Ov. ars 1,437. 2:
De anima 3,2,17: »tabula rasa et plana et polita« (eine glatte, ebene, saubere Tafel)
nach Büchmann 307. 3: Summa theologiae 1,79,2: »Der menschliche Verstand ... ist
am Anfang nach den Worten des Philosophen »wie eine Tafel, auf der nichts
geschrieben ist« (»intellectus humanus... in principio est >sicut tabula, in qua nihil scriptum«, ut
Philosophus dicit«).
in den Tag hinein leben
ohne Sorge um die Zukunft leben, ohne Plan und Ziel
leben.
Diese Redensart ist als »in diem vivere« unter den lateinischen
Autoren vor allem bei Cicero gängig, der z. B. sagt: »Ein
Kennzeichen von Barbaren ist es, in den Tag hinein zu leben.«1 Eras-
mus von Rotterdam kennt um 1500 auch die Form »ex tempore
vivere«2 (»aus dem Augenblick«, d.h. aus dem Stegreif leben),
womit sehr deutlich wird, daß es dieser Wendung um das un-
geplante, »unvoreingenommene« und dadurch so erholsame
Leben geht. Entsprechend heißt es in Thomas Manns
»Zauberberg«: »Ich erhole mich am besten, wenn ich so in den Tag
hinein lebe, ohne viel Abwechslung.«3
L: Duden 11,710; Otto 114 (Nr. 537). 1: Cic. Cic. de or. 2,40,169: »Barbarorum est in
diem vivere.« Vgl. Phil. 2,34,87; Tusc. 5,11,33; Liv. 22,39,13; 27,12,4; 40,8; Colum.
3,3,6; Plin. ep. 5,5,4; Hieron. ep. 7,5. Ähnlich Cic. Phil. 5,25 (»in horam vivere«). 2: Er.
ad. 1,8,62. 3: Frankfurt 1960 (Erstausg. 1924), S. 199 nach Duden 11,710.
jeder Topf findet seinen Deckel
Jeder Mensch findet einen passenden Partner; bisweilen
negativ: Jeder Schlechte findet einen Gesinnungsgenossen.
Der Kirchenvater Hieronymus (um 350-420) überliefert den
Satz: »Diesem Topf ist der würdige Deckel zugekommen.«1
Damit meint er jedoch, daß das Volk nun die Regierung erhalten
150
jeder Topf findet seinen Deckel.
habe, die seiner würdig sei, die zu ihm passe. Im gleichen Sinne
sagt er an anderer Stelle kritisch: »Und sofort fand der Topf
seinen Deckel, und dreckige Spuren vermischten die reinste
Quelle römischen Glaubens mit Kot.«2 Das Sprichwort, das
nach einer Bemerkung des Hieronymus im Volk sehr verbreitet
war, geht wahrscheinlich auf die griechische Vorlage »Die
Schüssel fand den Deckel« (griech. eupev r\ Xonac, tö 7Uü|ia)
zurück, die aber nur als Titel einer Satire Varros (1. Jh. v. Chr.)
bekannt ist. Während der Satz in seiner italienischen Form den
antiken Sinn behalten hat, wurde er im Deutschen positiv auf
zwei Partner, die so zueinander passen, wie wenn sie
füreinander bestimmt sind, umgedeutet. Für die ursprüngliche
Aussage des Sprichworts sagt man nunmehr nüchtern-sachlich:
»Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient.«
L: Mletzko 22. 33. 122; Otto 267-268 (Nr. 1355); Zanoner 9 (Nr. 25). 1: Hieron. ep.
7,5. 2: Hieron. ep. 127,9. Vgl. adv. Rufin. 3,24. S: Ital. »Questa petola trova il suo degno
coperchio«.
ein Tribunal abhalten
richten. Vor ein Tribunal bringen: vor ein Gericht bringen.
Als »Tribunal« (lat.: »tribunal«) bezeichnete man ursprünglich
einen erhöhten Sitzplatz (vgl. »Tribüne«), besonders den, den
ein Beamter oder Feldherr während seiner Amtshandlungen
einnahm. So verstand man mit der Zeit unter »tribunal« einen
Amtssitz. Zur Bedeutung »Gericht« kam es dann, weil der
Beamte, der besonders häufig in der Öffentlichkeit auf seinem
Tribunal zu sehen war, der dem Gerichtswesen vorstehende Prätor
war.
Besonders häufig wurde der Begriff des Tribunals später für
Sondergerichte verwendet (»Revolutionstribunal der
Französischen Revolution«, »Kriegsverbrechertribunal von Nürnberg«);
es kann aber auch in scherzhaft-übertragener Bedeutung jede
Aussprache bezeichnen, in der jemand mit anderen streng ins
Gericht geht, wie z.B.: »Der Schulleiter machte aus der
Dienstbesprechung ein Tribunal.«
152
Triumph
großer Erfolg. Triumphe feiern: großen Erfolg haben.
Einem erfolgreichen römischen Heerführer stand bei seiner
Heimkehr das Recht auf einen Triumph zu; d.h. das Recht,
seinen Feldzug durch eine feierliche Prozession des Heeres zum
Jupitertempel zu beenden. Da allerdings für diese Gelegenheit
der Senat eine Ausnahmegenehmigung erteilen mußte, die das
Betreten der Stadt durch das Heer erlaubte, gab es faktisch so
etwas wie ein Genehmigungsrecht des Senates für Triumphe. Der
Triumphzug folgte einer festen Marschroute und einem
bestimmten Aufbau. An der Spitze des Zuges gingen die
Senatoren. Ihnen folgte der Teil, der für das Publikum der
interessanteste gewesen sein dürfte: Die Vorführung der Beute und die
Darstellung der Kriegstaten. Zu diesem Zweck wurden zum
Beispiel auch Bilder der geschlagenen Schlacht mitgetragen, oder
was auch immer sonst geeignet schien, den Krieg dem
Publikum zu illustrieren. Es folgten anschließend die Gefangenen,
wobei es nicht darauf ankam, möglichst viele, sondern
möglichst hochrangige Gefangene vorzuführen. Sie schritten dem
Wagen des Triumphators unmittelbar voraus. Dieser stand in
einer Quadriga. Die Verwendung von vier Schimmeln wurde
erst seit Julius Caesar üblich. Am Tag des Triumphes trug der
Triumphator eine spezielle Tracht, nämlich eine purpurfarbene
Toga, die ihm aus dem Tempelschatz des Jupiter zur Verfügung
gestellt wurde. Diese Tracht war die alte Königstracht, wie sie
die Könige Roms in alten Zeiten getragen haben sollen, aber
natürlich auch die Tracht des Himmelskönigs Jupiter selbst.
Ebenfalls in Anlehnung an die Jupiterstatue wurde das Gesicht
des Triumphators rot bemalt. Bekanntermaßen stand hinter
ihm ein Sklave, der ihm von Zeit zu Zeit sagen mußte: »Respice
post te, te hominem esse memento« - »Blicke hinter dich und
bedenke, daß du ein Mensch bist!« Wahrscheinlich aber
brauchte sich der Triumphator meistens gar nicht
umzublicken, um sich als Mensch zu fühlen, denn direkt hinter
seinem Wagen folgten die Soldaten, die zu diesem Anlaß
respektlose und häufig zotige Sprechchöre über ihren Feldherren
vortrugen.
L: Duden 11,736.
153
* Triumvirat
eine gemeinsame Herrschaft dreier Personen, auch im
übertragenen Sinne.
»Triumvir« (bzw. »Tresvir«: »Dreiermann«) war ein häufiger
Titel im alten Rom. Er bezeichnete ein Mitglied eines Kollegiums,
das aus drei Männern (»tres viri«) bestand. Es gab ein
Dreimännerkollegium, das für die Münzprägung zuständig war, und ein
weiteres, das dem Prätor bei der Rechtspflege half. Daneben
wurden derartige Kollegien auch für besondere Zwecke
gebildet, z. B. mit der Aufgabe der Landverteilung.
In die historische Überlieferung sind besonders zwei
Triumvirate eingegangen: Das sogenannte 1. Triumvirat, bestehend
aus Caesar, Pompeius und Crassus (60 v. Chr.), und das
sogenannte 2. Triumvurat, bestehend aus Octavian, Marc Anton
und Lepidus (43 v. Chr.). Daß das erste Triumvirat überhaupt
als ein solches bezeichnet wird, ist etwas irreführend, bildeten
die drei Triumvirn hier doch kein Kollegium und hatten keine
Ämter, weder ordentliche noch außerordentliche, inne.
Stattdessen war das sogenannte 1. Triumvirat eine reine
Privatabsprache zwischen Caesar, Pompeius und Crassus, in der die drei
eine politische Zusammenarbeit vereinbarten. Unmittelbares
Ziel des Bündnisses war es, Caesar zum Konsul zu machen, was
auch für das Jahr 59 gelang. Im Gegensatz dazu hatte das
sogenannte 2. Triumvirat tatsächlich staatsrechtliche Bedeutung,
wurden hier doch drei Männer nach der Ermordung Caesars
(44 v. Chr.) mit der Wiederherstellung des Staates (als »tresviri
rei publicae constituendae«) beauftragt. Tatsächlich verbirgt
sich hinter diesem Titel eine Alleinherrschaft dieser drei
Männer, die diese weidlich ausnutzten, nicht zuletzt zur
schonungslosen Verfolgung ihrer politischen Gegner. Ihr
berühmtestes Opfer dürfte Cicero gewesen sein, der allzu heftige Reden
gegen Marc Anton geschleudert hatte. Die Bedeutung des
»Triumvirats« als einer geteilten, aber doch unumschränkten
Herrschaft mag somit auf dieses Vorbild zurückgehen.
L: Böttcher 61 (Nr. 301).
154
* TUSCULUM
ruhiger, behaglicher Landsitz.
In dem Ort Tusculum südlich von Rom, am Fuß der
Albanerberge in der Nähe des heutigen Frascati, besaßen viele reiche
Römer Landsitze. So liebte es z.B. Cicero (106-43 v. Chr.), sich
in sein »Tusculanum« (seinen »tuskulanischen« [Landsitz])
zurückzuziehen. Er hatte seine Villa dort 68 v. Chr. erworben. »An
meinem Tusculanum habe ich eine solche Freude, daß ich
mich nur rundherum wohlfühle, wenn ich hier bin.« schrieb er
im Februar 67 an seinen Freund Atticus.1 Er richtete sich eine
Bibliothek ein und genoß auf seinem Landsitz vor allem die
ruhige, ungestörte wissenschaftlich-literarische Tätigkeit.
Bekannt wurde der Ort durch Ciceros »Tuskulanische Gespräche«
(Tusculanae disputationes) über verschiedene Fragen der Ethik,
die er dort in unfreiwilliger Zurückgezogenheit unter der
Diktatur Caesars (45/44 v. Chr.) verfaßte.
Obwohl in der Gegend heute einige Mauerreste erhalten
sind, ist der genaue Standort von Ciceros Villa unbekannt. Der
Ort »Tusculum« ist dagegen für erholsame, geistig fruchtbare
Zurückgezogenheit ein Begriff geblieben.
L: Böttcher 63 (Nr. 316); Büchmann 368.1: Cic. Att. 1,6,2: »Nos Tusculano ita delecta-
mur ut nobismet ipsis tum denique cum illo venimus placeamus.« B: »Sammlung
Tusculum« heißt eine umfangreiche Reihe zweisprachiger Textausgaben antiker Werke im
Verlag Artemis & Winkler.
155
u
Ein Unglück kommt selten allein
Auf Unangenehmes folgen oft weitere Schwierigkeiten,
Unglücke häufen sich oft. Auch unter Ersetzung des
Substantivs, z. B.: Ein Maulwurf kommt selten allein.
In der »Aulularia« (Goldtopf-Komödie) des Dichters Plautus
kreisen die Gedanken des alten Euclio allein um seinen
Goldtopf, der ihm gestohlen wurde. Als ihn in dieser Situation der
junge Lyconides um Verzeihung für eine Schuld bittet (er
meint die voreilige Liebe zu Euclios Tochter), bezieht Euclio
dies wie selbstverständlich auf diesen Diebstahl. Als er dann
aber begreift, daß Lyconides von dem Kind spricht, das seine
Tochter erwartet, ruft er aus: »So kleben sich mir an ein Übel
üble Dinge in Menge!«1 Bei Terenz findet sich »ein Unglück aus
dem anderen«.2
Im Deutschen gibt es neben »Ein Unglück kommt selten
allein« auch Varianten wie »Ein Unglück tritt dem andern auf die
Fersen«. Ein Sprichwort stimmt halt selten allein.
L: Böttcher 54 (Nr. 244) und 125 (Nr. 754); Duden 11,748 und 12,475; Otto 207
(Nr. 1019). 1: Plaut. Aul. 801: »ita mihi §d malum malgfi res plyrumae se adglytlngnt!«
2: Ter. Eun. 988: »aliud ex alio malum«. Viele weitere Belege und griechische Vorläufer
nennt Otto 207 (Nr. 1019).
USUS SEIN
üblich; allgemeine Praxis sein. Zumeist in der Form: Das ist
hier so Usus.
Das lateinische Wort »usus« (vom Verb »uti«: gebrauchen)
bedeutet »Gebrauch, Nutzen« und findet sich demgemäß in
deutschen Fremdwörtern wie »Utensilien«
(Gebrauchsgerätschaften) oder »Utilitarismus« (Prinzip der Nützlichkeit).
Daneben erhielt es die Bedeutungsnuance »Ausübung, Praxis,
Vorgehensweise« und ist in diesem Sinne in die deutsche Wendung
»Usus sein« eingegangen.
156
V
* Valet sagen
aufgeben, verlassen.
Hierbei handelt es sich um eine Verkürzung der lateinischen
Abschiedsformel »valete« (Lebt wohl!), so daß »Valet sagen« ein
»Lebewohl sagen« zu einer Sache oder Tätigkeit bedeutet. So
heißt es beispielsweise bei Marion Gräfin Dönhoff: »Er rief
seine Zuhörer auf, dem Materialismus Valet zu sagen und sich
wichtigeren Aufgaben zuzuwenden.«1
L: Duden 11,753.1: Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer, Reinbek 1963, S. 63 nach
Duden 11,753.
Vandausmus
(auch: Wandalismus) zerstörungswütiges Verhalten,
sinnlose Verwüstung; Vandale/Wandale: brutaler,
zerstörungswütiger Mensch.
Die Vandalen waren ein ostgermanisches Volk, das in der
Völkerwanderungszeit eine bedeutende Rolle spielte. Von 429 bis
534 existierte ein eigenständiges Vandalenreich in der Gegend
des heutigen Tunesien, das außerdem die Balearen, Sardinien,
Korsika und Sizilien umfaßte.1 Berühmt als Zerstörer und
Plünderer wurden die Vandalen besonders durch die zweiwöchige
Plünderung Roms unter Geiserich (455), die von Prokop
drastisch geschildert wird.2 Im Humanismus des 16. Jh. wurde das
Bild der Germanen als Kulturzerstörer neu belebt, im
Dreißigjährigen Krieg auf die Schweden bezogen (der schwedische
König trug die »Goten und Vandalen« im Titel) und auch im
Frankreich des 18. Jh. z. B. bei Diderot und Voltaire gepflegt. An
einzelnen Stämmen wurden die Hunnen, Goten, Tataren und -
allmählich überwiegend - die Vandalen genannt.3 Den Begriff
»Vandalismus« prägte auf diesem Hintergrund Henri-Baptiste
Gregoire (1750-1831), Bischof von Blois, während der Franzö-
157
sischen Revolution: Am 10. Januar 1794 verurteilte er mit dem
Wort »vandalisme« das zunehmende Wüten der Republikaner
gegen Kunstwerke.4 Am 31. August erschien sein »Bericht über
die Zerstörungen, verursacht durch den Vandalismus«, in dem
er die Kunstvernichtung und die Bücherverbrennungen der
Jakobiner geißelte.5 In seinen »Erinnerungen« bemerkte er dazu:
»Ich schuf dies Wort, um die Sache zu töten.«6
Heutzutage wird der Begriff hauptsächlich für
Sachbeschädigungen und Zerstörungen in Städten durch zumeist
jugendliche Täter gebraucht.7
L: Böttcher 89 (Nr. 520); Büchmann 384-385. 1: Aur. Vict. 1,13. 2: Prok. 15. 3: In
Deutschland finden sich die »Vandalen« Im übertragenen Sinne seit 1 772: Büchmann
385 mit Belegen und weiterer Literatur. 4: Alexander Demandt, Vandalismus. Gewalt
gegen Kultur, Berlin 1997, S. 15. 5: »Rapport sur les destructions operees par le
vandalisme«, im Konvent zu Paris verlesen am 28. 8. 1794, gedruckt erschienen am 31. 8.
1794: Demandt [s.o.] S. 15. 6: »Memoires« (Paris 1837) 1,346. 7: Zu diesem
Phänomen ausführlich: Edwin Kube und Leo Schuster, Vandalismus. Erkenntnisstand und
Bekämpfungsansätze, Wiesbaden, 3. Aufl. 1985.
VERBOTENE FRÜCHTE
etwas Verlockendes, das nicht angetastet werden darf; ein
verbotener Genuß. Als Sprichwort: Verbotene Frucht
schmeckt am besten / Verbotene Früchte schmecken gut.
Das Motiv der verbotenen Frucht ist vor allem aus der Sünden-
fallerzählung in 1. Mose 3,2-6 bekannt, in der Eva auf Geheiß
der Schlange Adam dazu bringt, vom Baum der Erkenntnis zu
essen. Allerdings sind »verbotene Speisen« und die Verlockung,
die von Verbotenem ausgeht, auch ein beliebtes Motiv bei dem
römischen Dichter Ovid: In der Legende vom Goldenen
Zeitalter in seinen »Metamorphosen« beschreibt er, wie die bisher
nur von Pflanzen lebenden Menschen plötzlich danach
trachteten, Tiere zu erlegen, und damit ihre paradiesische Unschuld
zerstörten: »Woher kommt dem Menschen so großer Hunger
nach verbotenen Speisen?«1
Auch ohne die »Speisen« ist der Grundgedanke bei Ovid sehr
häufig.2 So stellt er beispielsweise in seinen »Amores« dar, daß
in der Liebe Verbote völlig vergeblich seien (im Gegenteil: »Wer
sündigen darf, sündigt weniger«); er begründet dies mit der
allgemeinen Erkenntnis über die menschliche Natur: »Wir
streben immer nach Verbotenem und wünschen Verwehrtes.«3
158
L: Böttcher 77 (Nr. 439) und 94 (Nr. 539); Duden 11,222; Otto 183 (Nr. 948). 1: Ov.
met. 15,1 38: »ynde famgs homini vetitorum tanta cibo_rum est?« 2: Alle Belege nennt
Otto 183 (Nr. 948). 3: Ov. am. 3,4,1 7: »Nitimur in vetitym sempe/ cupimusque ne-
gata.«
sein Veto einlegen
etwas durch sein Einspruchsrecht zum Scheitern bringen.
»Veto« (»Ich verbiete«) war die Formel, mit der der -►
Volkstribun die Amtshandlung aller anderen Amtsträger unterbinden
konnte. Dieses Recht war ursprünglich als Schutzmaßnahme
der plebejischen Bürger (-> Plebs) gegen die Willkür patrizi-
scher Amtsträger entstanden, wurde aber im Verlauf der
Ständekämpfe legalisiert und blieb ein wichtiges Instrument der
Politik.
Entsprechend versteht man heute unter dem Vetorecht das
Recht einer einzelnen Person oder Instanz, einen Beschluß
durch Einspruch aufzuheben. Anders als das moderne
Vetorecht war das Recht des Volkstribunen an das persönliche
Einschreiten desselben gebunden, so daß es bei heftigen
politischen Auseinandersetzungen nicht selten zu handgreiflichen
Auseinandersetzungen kam, in denen wiederholt auch -♦
Volkstribunen ums Leben kamen.
L: Bartels 208.
EIN SELTENER VOGEL
ein ungewöhnlicher Mensch.
Der römische Dichter Persius (34-62 n. Chr.) schreibt in einer
seiner Satiren, daß er sich freue, wenn seine Dichtung Erfolg
habe, wo er doch ein »seltener Vogel« (»rara avis«) sei, doch
habe er es nicht auf das Lob seines Publikums abgesehen.1 Mit
dem Begriff des »seltenen Vogels« spielt Persius wohl auf das
Motiv des weißen Raben (»corvus alvus«) an, der bereits den
Griechen als große Seltenheit der Natur ein Begriff war; bei
dem Satiriker luvenal (um 60-140) bezeichnete dieser einen
Menschen mit sehr seltenen, ungewöhnlichen Eigenschaften
(wie etwa dt. »ein bunter Hund«).2 Aber auch den »seltenen
Vogel« gebrauchte luvenal in diesem Sinne, als er beschrieb,
welche Voraussetzungen eine Frau mitbringen müsse, um als Ehe-
159
frau in Betracht zu kommen: Sie müsse bescheiden, attraktiv,
reich, gebärfähig, ehrfürchtig gegenüber den Ahnen und
jungfräulicher als die Sabinerinnen vor ihrem Raub sein - und
damit sei sie in der Tat ein so »seltener Vogel« wie ein schwarzer
Schwan.3 Nur (so fragt der Dichter dann auch): Wer könne eine
solch auffallende Frau überhaupt ertragen? Eine ähnliche
Ansicht vertrat der Kirchenvater Hieronymus: »So dürfte eine Frau
gut und lieblich sein - womit sie jedoch ein seltener Vogel ist.«4
Im Deutschen begegnet der seltene Vogel im Sinne einer
ungewöhnlichen Erscheinung erstmals bei Luther: »Und solt
wissen, das von anbegynn der wellt gar eyn seltzam vogel ist umb
eyn klugen fursten, noch viel seltzamer umb eyn frumen
forsten.«5 Im Sprachgebrauch wandelte sich der »seltene« Vogel
dann über den »seltsamen« auch in einem »komischen« Vogel
um und kann heute für eine in beliebiger Hinsicht
außergewöhnliche oder auffallende Person verwendet werden.
L: Böttcher 82-83 (Nr. 479-481); Büchmann 340; Duden 11,659; Macrone 158;
Mletzko 110. 1 34; Otto 51-52 (Nr. 232). 1: Pers. 1,46. 2: luv. 7,202: »Dennoch ist
jener glücklich, auch seltener als ein weißer Rabe« (fejix [He tarnen, corvQ quoque ra/ior
älbo). 3: luv. 6,165: »Rara avis in terns nigro_que simillima cycno.« 4: Hieron. adv. lov.
1,47: »Sic bona fuerit et suavis uxor, quae tarnen rara avis est«; vgl. adv. Pelag. 2,11;
adv. Helvid. 20. 5: Von weltlicher Obrigkeit... (1523), Weimarer Ausg. 11,267.
* ein (rechter) Vokativus
einer, dem nicht zu trauen ist, gerissener Schlaumeier.
Der Vokativ ist in der Deklination der Substantive der
Anredefall; da man diesen oft in mißbilligendem oder strafendem
Sinn anwendet (»[o] du...«), hat sich in zahlreichen deutschen
Mundarten die Bezeichnung »Vokativus« für eine Person
herausgebildet, bei der mit Schulbildung zugleich List und
Verschlagenheit gepaart sind. So spricht Grimmeishausen im 17.
Jh. von einem »Apotheker, welcher gar ein arger Vokativus
ist.«1 Ludwig Tieck formulierte 1828 positiver: »Er ist ein
aufgeräumter Kopf, er ist erst von der Schule gekommen, was man so
einen Vokativus nennt.«2 Heutzutage ist das Wort dagegen
kaum mehr gebräuchlich.
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 498-499; Grimm 26,452-453.1: Vogelnest 2,6 nach
Borchardt-Wustmann-Schoppe 498. 2: Mit Beleg bei Grimm 26,452.
160
Volkstribun
gefährlicher Populist, Demagoge, Vertreter der großen
Masse.
Das Anfang des 5. Jh. v. Chr. geschaffene Amt des
Volkstribunen (Sg. Volkstribun, lat.: »tribunus plebis«) stand im
republikanischen Rom außerhalb der eigentlichen
Ämterlaufbahn (Quästor - Ädil - Prätor - Konsul) und diente
ursprünglich dazu, Bürger aus dem einfachen Volk (aus der »Plebs«; vgl.
dt. maskulin -> der Plebs) vor Willkürmaßnahmen der Patrizier
zu schützen. Doch leiteten die zwei (später auf zehn
vermehrten) Volkstribunen auch die nach Stimmbezirken geordnete
Volksversammlung der Plebs (»concilium plebis«), deren
Beschlüsse (»Plebiszite«, lat.: »plebiscita«) seit 287 v. Chr. für das
gesamte Volk bindend waren; außerdem konnten sie durch ihr
Vetorecht (-* sein Veto einlegen) die Amtshandlungen der
anderen Amtsträger verhindern. Dadurch wurde das Volkstribu-
nat sowohl für die Durchsetzung von Gesetzen als auch zur
Förderung der eigenen Karriere eine wichtige Handhabe.
Negativ in die Überlieferung eingegangen sind dabei die
Volkstribunen Tiberius und Gaius Gracchus, die 133 bzw. 123-121 v. Chr.
auf diesem Wege Landreformen durchzusetzen versuchten,
und Publius Clodius, der als Volkstribun 58 v. Chr. seinen
Erzfeind Cicero heftig bekämpfte (vgl. -► pro domo reden).
Im Rom des 14. Jh. wurde der Titel von Cola di Rienzo
(1313-1354) wiederbelebt, der am 20. Mai 1347 als
»Volkstribun« den Adel der Stadt entmachtete, die Wiedereinrichtung
der römischen Republik verkündete und diverse Reformen in
Angriff nahm, bis er Ende desselben Jahres am Widerstand und
Bann des Papstes scheiterte und fliehen mußte. Heute ist die
Bezeichnung gleichbedeutend mit einem machtbesessenen
Politiker, der insbesondere durch glänzende Rhetorik das Volk
verführt und zur Unterstützung seiner eigenen Ziele veranlaßt.
L: Grimm 26,500. B: »Premier Koizumi profiliert sich als wortgewaltiger Volkstribun: In
Asien könnte seine nationalistische Pose für Ärger sorgen«: Untertitel in: Der Spiegel 18
vom 30. 4.01,5.156.
161
w
DIE NACKTE WAHRHEIT
die schlichte, blanke, schonungslose Wahrheit.
In einem Klagegedicht über den Tod seines Freundes Quintilius
Varus (23/22 v. Chr.) lobt der Dichter Horaz alte Ideale, die der
Verstorbene verkörpert habe: »Also hält den Quintilius ewiger
Schlummer / gefangen? Wann wird je die Scheu und der
Gerechtigkeit Schwester, / die ungebrochene Treue, und die
nackte Wahrheit, / je einen finden, der ihm gliche?«1 Auch bei
späteren Autoren (Quintilian, Apuleius, Augustinus, Laktanz)
wurde dann das Adjektiv »nudus« (»nackt«; wie dt. »nackt«
zugleich auch: einfach, unverhüllt) gern mit »veritas«
(»Wahrheit«) verbunden.
L: Büchmann 325; Böttcher 72 (Nr. 395-396); Duden 12,353; Mletzko 85; Reichert
198. 1: Hör. c. 1,24,7: »£rgo Quintiliym pe/petuus sopQr / yrget; cgj Pudor et lystitiae
sorg/ / incorrypta Fides nydaque Veritas / quando ullum invenigt parem?« Vgl. Sen. ep.
49,12 (»veritatis simplex oratio«).
Stille Wasser sind tief
In einem stillen oder schüchternen erscheinenden
Menschen stecken verborgene Talente oder Leidenschaften;
(auch negativer.) wer harmlos erscheint, kann gefährlich
sein; ein stilles Wasser: ein ruhiger Mensch.
Der römische Historiker Curtius Rufus (1. /2. Jh. n. Chr.)
überliefert in seiner leicht romanhaften »Geschichte Alexanders des
Großen«, daß bei einem Festmahl der medische Magier Coba-
res folgendes zum besten gegeben habe: »er fügte noch hinzu,
was bei den Baktrern gemeinhin verbreitet war: Daß ein
ängstlicher Hund heftiger belle als beiße [-♦ Hunde, die bellen,
beißen nicht]; und daß alle ganz tiefen Flüsse mit ganz leisem
Ton dahinflössen.«1 Schon damals dürfte damit gemeint
gewesen sein, daß unter einem ruhigen Äußeren eines Menschen oft
tiefere, ungeahnte Seiten verborgen sind.
162
L: Duden 11,782; Zanoner 15 (Nr. 100). 1: Curt. 7,4,13: »...altissima quaeque flumina
minimo sono labi.« S: Ital. »aqua cheta«.
Viele Wege führen nach Rom
Ein Ziel ist auf vielen Wegen erreichbar, ein Erreichen des
Ziels ist geradezu unvermeidlich (auch: Alle Wege f. n. R.).
Im römischen Altertum war Rom politisch - so wie auf
geistigem Gebiet Athen und Alexandria - das Zentrum der
Mittelmeerwelt, das durch viele gut ausgebaute Verkehrswege zu
Wasser und zu Lande aus allen Himmelsrichtungen erreichbar
war. Als Bild für die Vielfalt von Mitteln und Wegen zu ein und
demselben Ziel wurde jedoch zuerst das Reisen nach Athen
verwendet: Kaiser Iulian Apostata (Kaiser 361-363) äußerte
Verständnis dafür, daß man zur Philosophie ebenso wie zur
Wahrheit auf vielen verschiedenen Wegen gelangen könne, denn
»auch wenn einer nach Athen reisen wolle, so könne er dahin
segeln oder gehen, und zwar könne er als Wanderer die
Heerstraßen benutzen oder die Fußsteige und Richtwege, und als
Schiffer könne er die Küsten entlang fahren oder wie Nestor das
Meer durchschneiden.«1 Der Gedanke wurde dann auf Rom als
das Zentrum des Westreiches übertragen. Im Mittelalter schrieb
der englische Dichter Chaucer: »Verschiedene Wege führen
verschiedenes Volk auf rechtem Weg nach Rom.« Zugespitzt zu
»Alle Wege führen nach Rom« wurde der Satz von Jean de la
Fontaine 1694: »Tous chemins vont ä Rome«. Von Voltaire
wurden diese Worte 1750 in einem Brief aufgegriffen und
vielleicht in der Folge ins Deutsche übergeben. Englisch erscheint
diese Wendung dann erstmals 1872.
Mit » Viele Wege führen nach Rom« drückt man vor allem
Verständnis aus, wenn jemand ein Ziel auf andere, vielleicht
unkonventionelle Weise erreichen will. Die stärkere Variante »Alle
Wege führen nach Rom« kann abgesehen von demselben Sinn
auch noch auf den Alleinvertretungsanspruch des (in Rom
residierenden) Papstes für die gesamte Christenheit anspielen, etwa
in dem Sinne: »Es gibt kein echtes Christentum außerhalb des
Katholizismus« (vgl. den lateinischen Satz »Nulla salus extra
ecclesiam« - »Kein Heil außerhalb der Kirche!«).
L: Böttcher 87 (Nr. 506); Duden 11,786; Macrone 201. 1: Oros. 6,358t.
163
meine Wenigkeit
(bescheiden oder vorgeblich bescheiden/scherzhaft): ich.
Der römische Historiker Valerius Maximus sammelte im 1. Jh.
n.Chr. in seinen »Denkwürdigen Taten und Aussprüchen«
Beispiele für den Rhetorikunterricht. In der Widmung an Kaiser
Tiberius spricht er ergeben von »meiner Wenigkeit« (»mea par-
vitas«). Nach ihm herrschte »mea parvitas« vor, doch finden
sich auch andere Vokabeln (»mediocritas, vilitas, humilitas,
exiguitas, tenuitas« u.a.). Daneben entwickelte sich griechisch
nach Lk. 1,48 (»Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd
angesehen«)1 die Bescheidenheitsfloskel »meine Niedrigkeit« (r| xoc-
Tceivcooiq \iov), die sich in den ersten christlichen
Jahrhunderten unterschiedlich gestaltete und fortsetzte.2 Durch Otfried3
fand die Wendung Ende des 9. Jh. ins Althochdeutsche
Eingang, ins Neuhochdeutsche erstmals 1624 bei Martin Opitz.4
L: Böttcher 79 (Nr. 447-448); Büchmann 339; Duden 11,797; Mletzko 1 39. 1: Criech.:
cm erceßXeyev km xr\v Taneivcoaiv ttjc, öo\iA.r|<; ootou 2: Beispielsweise Bischof Leon-
tios von Neapolis auf Zypern (um 590-668), Leben des Hl. Johannes d. Barmherzigen,
Erzbischofs von Alexandrien (Hg. von H. Geizer, Freiburg 1893) nach Büchmann 339;
vgl. Götze, Zeitschrift für deutsche Wortforschung 9,1907,87ff. 3: Evangelienbuch
»Der Krist«, Widmung an König Ludwig, V. 26: »unsu smahu nidir« (unsere geringe
Niedrigkeit, in Anlehnung an »mea humilitas«); Buch 5,25,89: »smahi min« (»meine
Kleinheit«). 4: Buch von der Teutschen Poeterey, Brieg 1624, Kap. 5: »weil mir meine
Wenigkeit und Unvermögen wol bewust ist.« Zur weiteren Entwicklung vgl. Götze [s.o.]
und E. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1948, 91 ff.
Wenn zwei dasselbe / das gleiche tun, so
ist es nicht dasselbe / das gleiche
Zwei scheinbar gleiche Handlungen werden je nach Person
und Umständen unterschiedlich bewertet; was einem
hochstehenden Menschen erlaubt ist, ist einem anderen nicht
unbedingt erlaubt.
In der Komödie »Die Brüder« des römischen Dichters Terenz
erziehen zwei Brüder ihre Söhne sehr unterschiedlich (der eine
altrömisch-streng, der andere griechisch-tolerant); als der
strenge Vater um die Moral der Jugendlichen fürchtet, beruhigt
ihn sein Bruder damit, daß beide Söhne - bei ihrem klugen,
vernünftigen und bescheidenen Charakter - ruhig einmal
schadlos über die Stränge schlagen dürften: »Viele Anzeichen
164
Wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe.
gibt es im Menschen, aus denen man leicht vermuten kann:
Wenn zwei dasselbe tun, kann man oft sagen: >Der eine darf es
ungestraft, der andre nicht< - nicht weil die Sache unähnlich
wäre, sondern der, der es tut.«1 Die Stelle wird jedoch mein-
stens verkürzt zitiert: »Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht
dasselbe« (lat.: »Duo cum faciunt idem, non est idem«). In der
Komödie »der Selbstquäler« desselben Dichters entlockt der
listige Sklave Syrus seinem Herrn Chremes Geld, indem er ihn
auf seine Verantwortung hinweist, der er sich nicht wie andere
entziehen solle: »Nein, wenn es anderen erlaubt ist, ist es dir
noch lange nicht erlaubt.«2
Im Mittelalter bildete man für diesen Gedanken den
Reimspruch »Quod licet Iovi, non licet bovi« (»Was Jupiter erlaubt
ist, ist einem Ochsen nicht erlaubt«). Doch werden damit
üblicherweise nicht charakterliche Unterschiede (wie noch bei
Terenz) als vielmehr Rangunterschiede (wie zwischen Eltern
und Kindern, Lehrern und Schülern etc.) hervorgehoben, um -
in gelehrter Weise gegenüber den Niedrigergestellten -
unterschiedliche Rechte zu begründen.
L: Bartels 68-69. 150; Böttcher 57 (Nr. 272-274); Büchmann 31 3; Duden 11,844 und
12,527; Mletzko 22.147; Reichert 50; Wander 5,666 (Zwei 32); Zanoner 14 (Nr. 85). 1:
Ter. Ad. 821-824: »Mylta in nomine... / signa insunt, ex quibus CQniectyra fecile fit, /
duo quom idem faciunt safipe, ut pßssis dicerg: / >hoc licet impyne facere huic, illi no_n
lic£t<, / non quo dissimilis res sit, sgd quo is, qui facit.« 2: Ter. Heaut. 797: »Immo ajiis si
licet, tibi no_n liegt.«
Wer einmal lügt,
dem glaubt man nicht...
(..., und wenn er auch die Wahrheit spricht) wer lügt,
verliert seine Glaubwürdigkeit.
In der von Phaedrus (1. Jh. n. Chr.) erzählten äsopischen Fabel
von »Wolf und Fuchs mit dem Affen als Richter« beschuldigt
der Wolf den Fuchs des Diebstahls. Der Affe stellt schließlich
nur die Unglaubwürdigkeit beider Kontrahenten fest: Der Wolf
habe nie verloren, was er fordere, und der Fuchs stehle, wenn er
es auch leugne. Damit illustriert Phaedrus die gleich zu Beginn
der Fabel formulierte Moral: »Wer einmal für schändlichen
Betrug bekannt geworden ist, findet keinen Glauben mehr, auch
wenn er die Wahrheit sagt.«1 Denselben Gedanken erwähnt
auch Cicero im Zusammenhang mit der Schwierigkeit, wahre
166
Traumeingebungen von falschen zu unterscheiden: »Daher
scheint mir merkwürdig, wie diese Leute - während wir doch
einem lügnerischen Menschen nicht einmal dann, wenn er die
Wahrheit sagt, zu glauben pflegen - dann, wenn irgendeine
Eingebung sich als wahr erwiesen hat, nicht eher aus den
vielen [Gegenbeispielen] der einen [Eingebung] die
Glaubwürdigkeit absprechen als daß sie aus der einen die unzähligen
[anderen] bestätigen.«2
Andreas Tscherning übertrug die Verse des Phaedrus in seiner
Fabel »Lügen Lohn« so: »Daß einem hier die Welt, der einmal
Lügen liebt, / Auch wann er Wahrheit redt, nicht leichtlich
Glauben gibt.«3 Ähnlich schreibt auch L. H. von Nicolay
(1737-1820) in seinem Gedicht »Der Lügner«: »Man glaubt
ihm selbst dann noch nicht, / Wenn er einmal die Wahrheit
spricht.«4
L: Böttcher 78 (Nr. 444); Büchmann 338; Mletzko 78. 1: Phaedr. 1,10,1-2: »Quicym-
que tyrpi frayde sgrnel innQtuk, / Etiamsi verum diät, a/nittit fidgm.« Stob. 12,18
schreibt den Gedanken schon dem Demetrios von Phaleron zu (um 320 v. Chr.). 2: Cic.
div. 2,146: »ut mihi mirum videatur, cum mendaci homini ne verum quidem dicenti
credere soleamus, quo modo isti, si somnium verum evasit aliquod, non ex multis po-
tius uni fidem derogent quam ex uno innumerabilia confirment.« 3: Deutscher Ce-
tichte Früling, Breslau 1642, S. 254. 4: Um 1790; »Vermischte Gedichte und prosaische
Schriften«, 8 Bde., Berlin 1799-1810. B: In den 70er Jahren trug ein beliebtes
Fernsehquiz mit Wolfgang Spier den Titel »Wer dreimal lügt...«.
Wissen ist Macht
Mit Wissen kann großer Einfluß ausgeübt werden; Wissen
ist für Erfolg unerläßlich.
Dieses Schlagwort geht auf eine zwar neuzeitliche, aber doch
lateinische Formulierung des englischen Philosophen und
Schriftstellers Francis Bacon (1561-1626) zurück, der 1597 in
seinen »Essayes« schrieb: »Nam et ipsa scientia potestas est«
(»Denn das Wissen selbst ist Macht«).1 In der englischen
Zweitausgabe von 1598 übersetzte er: »For knowledge itself is
power.« Bacon begründete den Gedanken so: »Menschliches
Wissen und menschliche Macht fallen in eins zusammen,
weil Unkenntnis einer Angelegenheit den Erfolg unmöglich
gemacht hat.«2
Im 19. Jh. griff der Journalist und sozialdemokratische
Politiker Wilhelm Liebknecht (der Vater Karl Liebknechts) das Wort
Bacons auf: »Wissen ist Macht - Macht ist Wissen« sagte er
167
1872 in einem Vortrag. Weite Verbreitung erlangte die Devise
auch durch ihre Verwendung in Max Kegels
»Sozialistenmarsch« (1891), einem vielgesungenen Arbeiterlied: »Der Erde
Glück, der Sonne Pracht, / Des Geistes Licht, des Wissens
Macht, / Dem ganzen Volke sei's gegeben.«
L: Böttcher 210 (Nr. 1225) und 520-521 (Nr. 3440); Büchmann 260; Duden 12,549;
Mletzko 78. 142; Reichert 207; Wander 5,304 (Nr. 388). 1: Erstausgabe 1597,
lateinisch veröffentlicht unter dem Titel »Meditationes sacrae«, Buch 1,11. Artikel (»De
haeresibus«). 2: Novum Organum 1,3 (vgl. 2,1. 3): »scientia et potentia humana in
idem coincidunt, quia ignoratio causae destituit effectum.«
fromme Wünsche
falsche Vorstellungen, Illusionen, gut gemeinte Wünsche
(die aber wohl nie in Erfüllung gehen).
1627 veröffentlichte der belgische Jesuit Hermann Hugo in
Antwerpen eine Schrift »Pia desideria« (»Fromme Wünsche«),
die von Andreas Presson 16721 und Johann Georg Albinus
16752 ins Deutsche übertragen wurde. Von ihr angeregt,
betitelte der evangelische Theologe Philipp Jakob Spener 1676
sein Werk »Pia desideria oder Hertzliches Verlangen nach
gottgefälliger Besserung der wahren Evangelischen Kirchen«, mit
dem er den lutherischen Pietismus maßgeblich bestimmte.
Auch bei Goethe sind die »frommen« Wünsche noch
ernsthafte, gute Wünsche: Er schreibt: »Indessen kann ich mir den
frommen Wunsch nicht versagen«; oder ähnlich mit
»frommen Worten«: »Möchten diese und tausend andere fromme
Worte Kennern und Künstlern vorgelegt werden.«3 Durch den
Beiklang jedoch, daß die Worte oder Wünsche zwar fromm
sind, aber wohl ungehört bleiben, entwickelte sich in der
Folgezeit die heutige negative Bedeutung im Sinne von
»unerfüllbaren Wünschen«.
L: Bartels 137-138; Büchmann 356; Duden 11,818-819; Grimm 4,243; Mletzko 37.
144. 1: Andreas Presson, Das Klagen der büßenden Seel oder die sogenannte Pia
Desideria, Bamberg 1672. 2: Johann Georg Albinus, Himmel-flammende Seelen-Lust oder
Hermann Hugonis Pia Desideria, Frankfurt 1675. 3: 17,284 und 45,108 nach Grimm
4,243.
* Würden sind Bürden
Hohe Ämter bringen große Verantwortung mit sich (Auch:
Würde bringt Bürde).
168
Der klanglichen Nähe von »Würde« und »Bürde«, die im
deutschen Sprichwort genutzt wird, entspricht lateinisch die
Ähnlichkeit von »honos« (»Ehre, Würde«) und »onus« (»Last,
Mühe«), durch die beide im Lateinischen gern verbunden
wurden. Der Grammatiker und Schriftsteller Varro erläutert in
seiner »Lateinischen Sprache« unter Zitierung eines wohl
geläufigen Verses: »Ehre kommt von einer ehrenhaften Mühe;
deshalb wird ehrenhaft genannt, was mühevoll ist, und man
hat gesagt: >Mühe ist Ehre, die den Staat aufrecht erhält^«1
Vielerorts wird mit diesem Wortspiel betont, daß etwas scheinbar
Gutes keine »Würde«, sondern eine »Bürde« sei: Beispielsweise
spricht in Ovids fiktiven Briefen bekannter Frauen (»Heroides«)
Deianira, die Frau des Helden Herkules, über den übergroßen
Ruhm ihres Mannes. Ein großer Mann überlaste eine
schwächere Frau wie bei zwei ungleichen Stieren vor dem Pflug
(vgl. -♦ Caudinisches Joch); daher rät sie: »Last, nicht Ehre sind
Glanz und Ruhm, ein Nachteil dem Träger, / wünschst du dich
passend vermählt, nimm einen Mann, der dir gleicht!«2 Bei Li-
vius schließlich verwirft ein Reiteroberst, der gemäß einem
Volksbeschluß dem Diktator Fabius gleichgestellt sein sollte,
dieses Plebiszit, da er dadurch »mehr belastet als geehrt« sei.3
Im Deutschen hat das Sprichwort dieselbe Verbindung mit den
eigenen Vokabeln nachgebildet.
L: Mletzko 21. 144; Otto 167 (Nr. 828); Reichert 78. 1: Varro ling. 5,73: »Honos ab
honesta onere, itaque honestum dicitur, quod oneratum, et dictum: onus est hono_s, qui
systingt rem pyblicam« (com. ine. v. 76 Ribb.). 2: Ov. her. 9,31-32: »No_n honor est,
sed onys specigs laesyra fergntis; / siqua volgs aptg nybere, nybe pari.« 3: Liv. 22,30,4:
»plebiscitum, quo oneratus sum magis, quam honoratus...«; viele weitere Beispiele
nennt Otto 167 (Nr. 828).
Die Würfel sind gefallen
(richtiger auch im Sg.: Der Würfel ist gefallen, lat: »alea
iaeta est«) Der Entschluß ist gefaßt, die Entscheidung ist
getroffen, es gibt kein Zurück mehr.
Bei dem griechischen Komödiendichter Menander erscheint
der Vers: »Beschlossen ist die Sache: der Würfel soll geworfen
sein«1 - d.h. das Wagnis wird unwiderruflich eingegangen.
Bekannt wurde das Wort jedoch durch den Feldherrn und
Politiker C. Iulius Caesar: Zu Beginn des Jahres 49 v. Chr. hatte Pom-
peius den Staatsnotstand ausrufen lassen und den Senat
169
beschließen lassen, Caesar müsse seine Provinz Oberitalien
abgeben und sein Heer entlassen. Daraufhin überschritt dieser am
10. /11. Januar 49 v. Chr. mit seiner 13. Legion den Rubikon,
Grenzfluß seiner Provinz zum senatorisch verwalteten Italien
(-> den Rubikon überschreiten) und begann damit den (für ihn
erfolgreichen) Bürgerkrieg. Dabei soll er den zweiten Teil des
Satzes - »Der Würfel soll geworfen sein!« - auf Griechisch
zitiert haben2. Lateinisch übersetzte Sueton dies zu »Iacta alea
est!« (»Der Würfel ist geworfen«),3 was zumeist in der
Reihenfolge »alea iacta est« zitiert wird. Vielleicht dachte Caesar aber
auch an das Sophokles-Wort »Denn immer fallen gut die
Würfel des Zeus«,4 die er mit seinem Handeln nun praktisch selbst
geworfen hatte. Das Bild des Würfels bei einem Wagnis mit
ungewissem Ausgang ist in der lateinischen Literatur aber auch
sonst häufig anzutreffen.5
Im Humanismus ist »alea iacta est« von Erasmus von
Rotterdam in seiner Sprichwörtersammlung »Adagia« besprochen
worden und daraufhin ins Deutsche eingegangen.6 Im
Englischen gab der erste Sueton-Übersetzer Philemon Holland 1606
den Satz mit »the die be thrown« wieder, doch setzte sich später
»The die is cast« durch. Heutzutage wird mit dem Wort weniger
die Größe eines Wagnisses betont, dessen Ausgang noch
aussteht, sondern die Unwiderruflichkeit einer Entscheidung oder
die Unverrückbarkeit eines Ergebnisses.
L: Bartels 37-38; Borchardt-Wustmann-Schoppe 518; Böttcher 65 (Nr. 333-334) und
192 (Nr. 1139); Büchmann 85. 368-369; Duden 11,820 und 12,556; Macrone
174-175; Otto 12-13 (Nr. 55); Reichert 72-73; Röhrich 5,1747; Stichwörter 69-73 u.
Komm. 109-116; Surbeck 66-69. 1: Aus dem »Arrhephoros«: CAF 3,22, fr. 65,4.
Criech.: »AeÖQYnevqv tö icpayn' äveppi<|>6ü) Kvßoc,.« 2: Plut. Pomp. 60,4; Reg. et imp.
ap. ed Bernardakis 2,94,7 (zudem »jeder Würfel«); Plut. Caes. 32,5 erwähnt die
griechische Sprache nicht. 3: Suet. Caesar 32. Erasmus vermutete in seiner Sueton-Ausgabe
(Köln 1544) einen Fehler der Abschreiber und konjizierte wegen des griechischen
Originals »iacta esto alea« (»Der Würfel soll geworfen sein«), ohne es jedoch so in den Text
aufzunehmen. 4: Soph. fr. 895: »riei -y&p £v niircouciv oi Aiöc, icvßoi.« 5: Die Stellen
bietet Otto 13 (Nr. 55). 6: Er. ad. 1,4,32. Der Ritter und Dichter Ulrich von Hütten
(1488-1523) gebrauchte gern das gleichbedeutende deutsche Wort »Ich hab's
gewagt!«: Böttcher 92 (Nr. 1139) mit Einzelheiten. B: Ein ehemaliger Wehrmachtssoldat
erzählt, wie die Sentenz, als er mit seiner Truppe Mitte November 1942 über den Don
in den Kessel von Stalingrad einrückte, unter den Soldaten die Runde gemacht habe:
»Sagte der eine >Caesar dixit< [Caesar sagte], fuhr der andere fort >Rubiconem trans-
gressus< [nach Überschreiten des Rubikon] und der dritte ergänzte, im Ton noch ernster
und bedächtiger, >alea est iacta<. [...] Wie sich die Akzentuierung der Satzteile auch
änderte, der >Rubico< als Schicksalsdrohung kam immer wieder ins Zentrum. Leise, bei
einem kurzen Stillstand der Marschkolonne, fragte ich Schiwo: >Wessen Rubico?< Der
Oberleutnant hörte die bange Frage und übertönte sofort, jede Antwort verbauend:
170
>alea est iacta<.« Aus: Wilhelm Raimund Beyer, Stalingrad - unten, wo das Leben konkret
war, in: Wolfram Wette (Hg.), Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von
unten, München 2. Aufl. 1995, 240-254, darin S. 242. S: Engl. »The die is cast«; vgl.
das Adj. »aleatory« (seltener dt. »aleatorisch«: vom Zufall abhängig).
X
JEMANDEM EIN X FÜR EIN U VORMACHEN
jemanden betrügen.
Diese im Mittelalter entstandene Redensart geht auf die
römischen Zahlzeichen »X« für die Zehn und »U« (das bis zum 10.
Jh. noch wie das V geschrieben wurde) für die Fünf zurück:
Wenn man das »V« mit zwei Strichen nach unten hin zum »X«
erweiterte, stellte man jemandem mit kleinem Aufwand gleich
das Doppelte in Rechnung: »Wenn der Wirth schreibt ein X vor
[für] ein V [sprich: U], so kompt er seiner Rechnung zu«, d. h. so
bessert er seine Rechnung auf. Vom Anschreiben der
Gasthausschulden mit Kreide durch den Wirt leiten sich auch die
Wendungen »bei jemandem in der Kreide stehen« (jemandem
etwas schulden) und »jemandem etwas ankreiden« (etwas
nachtragen) her. Der Ausdruck »mit doppelter Kreide
anschreiben«, der seit dem 14. Jh. belegt ist, nimmt ebenfalls auf die
genannte Änderung von U in X Bezug. Mit den zwei Ebenen von
Sinn und reinem Wortlaut spielte Karl Kraus 1909 in einem
Aphorismus: »Den Leuten ein X für ein U vormachen - wo ist
die Zeitung, die diesen Druckfehler zugibt?«1
L: Borchardt-Wustmann-Schoppe 283-284. 520-521; Wander 5,477 (X 6). 1: Karl
Kraus, Beim Wort genommen, München 1955, S. 76 nach Mieder, Sprichwörter 115.
131.
171
z
andere Zeiten, andere Sitten
Bräuche und Gewohnheiten ändern sich mit der Zeit (vgl.:
Andere Länder, andere Sitten); häufig pessimistisch: Wie
haben sich doch die Sitten zum Schlechten verändert! Vgl.:
Die Zeiten ändern sich: auf früher geltende Gegebenheiten
kann man sich nicht verlassen.
In der Komödie »Das Mädchen von Andros« des Terenz (2. Jh.
v. Chr.) will ein Vater den sorglosen Lebenswandel seines
Sohnes Pamphilus verbessern; zu seinem Sklaven Davos sagt er
über ihn: »Solang's zu seiner Jugend paßt', erlaubt' ich's ihm,
sich auszutoben! / Doch nun bringt dieser Tag ein anderes
Leben und erfordert andere Sitten. /Jetzt wünsch ich, Davos, bitt'
mir aus, er muß zum rechten Weg zurück.«1 Möglicherweise
gab es damals bereits das (erst später belegte) griechische
Sprichwort »anderes Leben - andere Lebensweise«, auf das hier
eine Anspielung vorliegen könnte.2 In jedem Falle ist bei
Terenz noch das veränderte individuelle Leben (anderes Alter,
neue soziale Umstände) gemeint.
Das weiter ausgreifende Wort »Zeiten« stellte erst der Redner
Cicero (1. Jh. v. Chr.) den »Sitten« gegenüber: Sein berühmtes
»Oh Zeiten, oh Sitten!« (lat.: »O tempora, o mores«) rief er z.B.
als Einleitung seiner ersten Rede gegen den Verschwörer Cati-
lina3 und meinte damit: »Welch schlimme Sitten wie diese
Vorgänge hier muß man in diesen Zeiten erleben!« Der lateinische
Wortlaut wurde im 18. Jh. von Friedrich dem Großen gern
zitiert und erlangte als Kehrreim von Emanuel Geibels »Lob der
edlen Musika« (erschienen 1843) größere Verbreitung.4
Das bekannte lateinische Sprichwort »tempora mutantur et
nQs mutamur in Ulis« (»Die Zeiten ändern sich, und wir ändern
uns in ihnen«) geht dagegen erst auf König Lothar I. (Kg. des
fränkischen Mittelreiches 843-855) zurück, der gesagt haben
soll: »Alle Dinge ändern sich, auch wir ändern uns in ihnen.«5
172
Wer zuerst kommt, mohlt zuerst.
H-r
L: Böttcher 59 (Nr. 289-290) und 161-162 (Nr. 993); Duden 11,827; Mletzko 8. 110.
145; Otto 15 (Nr. 66) und 343 (Nr. 1757); Wander 5,534 (Zeit 241). 1: Ter. Andr.
188-190: »Dum tgmpus ad eam rgm tulit, sivl, anlmum ut gxplergt suo_m; / nunc hie
dies aliam vitam dgfert, alios mores pQStulat: / dehinc DQStulQ sive agquomst te o_ro,
Dave, ut rgdeat iam in viam.« 2: »äXkoq ßioc, äXkr\ öiaita«: Zenob. 1,22; Macar. 1,86.
Vgl. Er. ad. 1,9,6. 3: Cic. Cat. 1,1; In Verrem 4,25,56; Pro rge Deiotaro 11,31; De domo
sua 53,137; weitere Stellen nennt Otto 343 (Nr. 1757); antike Zitate des Cicerowortes
belegt Bartels 124. 4: Belege bietet Büchmann 315. 5: »Qmnia mytantyr, nos et
mutamur in illis«: Matthias Borbonius in: janus Cruterus, Deliciae poetarum German-
orum, Frankfurt a.M. 1612, S. 681/91, nach Böttcher 161-162 (Nr. 993).
mit Zuckerbrot und Peitsche
mit Belohnung und Strafe zugleich.
In der »Geldtopfkomödie« des lateinischen Dichters Plautus
sagt der geizige Euclio, der unverhofft einen Goldschatz
gefunden hat, mißtrauisch über den reichen Megadorus, der ihn
eigentlich aus Interesse an seiner Tochter anspricht: »Aha, jetzt
will er was, darum macht er Versprechungen. Er sperrt schon
das Maul auf, um mein Gold zu fressen. In der einen Hand hält
er einen Stein, und Brot zeigt er mit der anderen.«1 Der
Kirchenvater Hieronymus (um 350-420) schreibt daher in einem
Brief, er wolle dem Adressaten gegenüber gerade nicht so
vorgehen und »in der einen Hand einen Stein halten und mit der
anderen Brot anbieten«.2 Gregor von Nazianz gebrauchte etwa
in derselben Zeit auf Griechisch einen ähnlichen Vergleich:
»...wie wenn jemand mit der einen Hand eines Mannes Haupt
streichelte und mit der anderen auf die Backe schlüge.«3
Die deutsche Wendung »mit Zuckerbrot und Peitsche«
stammt dagegen erst aus dem 19. Jh. 1873 schrieb eine
Breslauer Zeitung: »Wie man aus Passau erfährt, ist Bischof
Heinriche Versuch, mit Zuckerbrot und Peitsche die Gewährung der
Heiligengeistkirche an die dortigen Altkatholiken zu
hintertreiben, kläglich gescheitert.«4
L: Duden 11,834; Wander 5,615.1: Plaut. Aul. 194: »Altera many fert lapidem, panem
ostgntat altera.« 2: Hieron. ep. 81,1,4. 3: Greg. Naz. ep. 16,6. 4: Bote aus dem
Riesengebirge, Breslau 1873, Nr. 13, Hauptblatt nach Wander 5,615 mit weiteren Belegen,
darunter dem ersten Vorkommen des Wortes im Jahr 1872.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Der Schnellste hat (verdientermaßen) auch den größten
Nutzen; wer zu spät kommt, kann keine Ansprüche mehr
174
stellen. Die negative Entsprechung lautet: Wer nicht
kommt zur rechten Zeit, der muß sehen, was übrig bleibt;
vgl.: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Die große Bedeutung der Schnelligkeit zur Wahrung der
eigenen Interessen ist schon in der lateinischen
Komödiendichtung ein geläufiger Gedanke: Im »Pseudolus« des Plautus soll
Harpax, der Bote eines makedonischen Offiziers, in dessen
Auftrag das Mädchen Phönizium von dem Kuppler Ballio abholen;
doch dieser hat sie inzwischen schon einem als Harpax
auftretenden Mittelsmann des listigen Pseudolus übergeben, hält
nun den echten Harpax selbst für einen Schwindler und sagt:
»Gleich kannst du Pseudolus / berichten: Ein anderer hat die
Beute davongetragen, der als Harpax / eher kam.«1 Bei dem
Dichter Terenz sagt in der Komödie »Phormio« der Kuppler Do-
rio zu Phaedria, dem er bei rechtzeitiger Bezahlung das
Mädchen Pamphila geben wolle: »Wenn du es mir eher bringst,
Phaedria, / will ich meinem Grundsatz folgen, daß mächtiger
sei, wer eher am Geben ist. Leb wohl!«2
Nachantik griff man die alliterierende Zusammenstellung
von »potior« (»mächtiger«) und »prior« (»eher, früher«) auf
und bildete die kurzen Sprichwörter »Wer früher (kommt), ist
mächtiger« und »früher an Zeit - mächtiger an Recht«.3 Erst im
Deutschen jedoch fand die Mühle in den Gedanken Eingang:
Im »Sachsenspiegel« des Ritters Eike von Repgow (vor 1224),
der ersten und bedeutendsten deutschsprachigen
Rechtssammlung, wird formuliert: »Die ok irst to der molen kumt, die sal
erst malen.«4
L: Böttcher 165 (Nr. 1014); Duden 11,834 und 12,535; Mletzko 66. 79. 126. 147.
1: Plaut. Pseud. 1198: »projn tu Psejy_dolo_ / nuntigs abdyxisse alium pragdam, qui qc-
currit prio_r / Harpax...« Vgl. Trin. 568. 2: Ter. Phorm. 533: »...si mi prior tu attuleri',
Phaedria, / mea lege utar, yt potio_r sit qui prior ad dandymst. valg.« 3: »Potior est,
qui prior est«, »Prior tempore potior iure«. 4: Berliner Handschrift von 1369, kritisch
hg. von C. G. Homeyer, Berlin 3. Aufl. 1861, 2. Buch, Art. 59, § 4 nach Böttcher 165
(Nr. 1014).
Zustände wie im alten Rom!
unmögliche, heruntergekommene Verhältnisse; vgl.:
paradiesische Zustände: herrliche, wunderbare Verhältnisse.
Diese umgangssprachliche Redensart ist wahrscheinlich erst im
19. Jh. entstanden. Sie setzt nämlich die Vorstellung eines
175
mächtigen, aber zugleich dekadenten und sittlich verdorbenen
Römischen Reiches voraus: Vor allem mit Blick auf die
römische Kaiserzeit (um 30 v. Chr. - 476 n. Chr.) wird an maßlosen
Luxus, despotische Willkür und kulinarische wie sexuelle
Ausschweifungen gedacht, die schließlich die Römer anderen
Völkern unterlegen gemacht und zugrunde gerichtet hätten.
Dieses Bild, das in Ansätzen bereits durch kulturpessimistische
Stimmen im antiken Rom selbst (v. a. durch den Historiker Sal-
lust; zu Ciceros »O tempora, o mores!« vgl. -♦ andere Zeiten,
andere Sitten) vorgeprägt war, wurde durch christliche
Schriftsteller wie Eutropius und Laktanz als heidnisch-negatives
Gegenbild zu christlicher Moral ausgebaut. Im Europa des 18. und
19. Jh. erlangte es in Literatur und bildender Kunst immer
stärkere Verbreitung1 und verfestigte die Klischees von römischen
Orgien, Grausamkeiten und Zügellosigkeiten. Von ihnen wird
noch im 20. Jh. die Darstellung Roms in Romanen und
Spielfilmen beherrscht.2 Erst in jüngster Zeit führen ein breiteres
archäologisch-historisches Interesse und ein gewisser Realismus
in Hollywood-Produktionen wie »Gladiator« (USA 2000)
allmählich zu einer leichten Korrektur des landläufigen
Rombildes.
L: Duden 11,842. Weiterführende Lit.: Gustav Sichelschmidt, Wie im alten Rom.
Dekadenzerscheinungen damals und heute, Kiel 1984. 1: Beispielsweise leitete Pierre-Fran-
£ois Hugues Hancarville, Bilder aus dem Privatleben der römischen Cäsaren, (1780, dt.
Erstausgabe 1909) sein Buch mit den Worten ein: »...Ich schildere den Mißbrauch, den
diese ersten Imperatoren - in späteren Zeiten von ihren Nachfolgern nur zu getreulich
nachgeahmt - von ihrer ungeheuren Gewalt machten; ich schildere die Knechtschaft
eines freien Volkes, die Erniedrigung der Welteroberer, die fürchterliche Verderbnis, die
sich in der Vaterstadt eines Fabricius und Cato einnistete und bald sich über das ganze
Reich verbreitete.« 2: Gemälde des 19. jh. wurden zu Vorbildern für Theaterkulissen
und dann für die ersten Stummfilme um 1910, deren Tradition in den 50er jähren in
Filmen wie »Quo vadis?« oder »Ben Hur« fortgesetzt wurde. Man denke z. B. auch an den
Freizeitpark »Delos« im Spielfilm »Futureworld - Das Land von übermorgen« (USA
1976), in dem die Besucher in ein völlig zügelloses antikes Rom zurückversetzt werden.
Der Zweck heiligt die Mittel
zur Erreichung eines höheren Zwecks darf jedes Mittel
angewandt werden.
Der Jesuitenpater Hermann Busenbaum schrieb 1652 in
seinem »Handbuch der Moraltheologie«: »Wenn der Zweck
erlaubt ist, sind auch die Mittel erlaubt« (lat.: »Cum finis est lici-
tus, etiam media sunt licita«).1 Obwohl »Gewalt und Unrecht«
176
anschließend ausdrücklich ausgeschlossen werden,2 gilt der
Satz oft als typischer Grundsatz jesuitischer Moral: »Der Zweck
heiligt die Mittel, sagt der Jesuit« heißt es z. B. in einem
Klosterspiegel des 19. Jh.3 Dies ist unter anderem auf Blaise Pascal
(1623-1662) zurückzuführen, der 1656 einen Jesuiten sagen
ließ: »Wir verbessern die Schlechtigkeit des Mittels durch die
Reinheit des Zwecks«.4 Bereits Thomas Hobbes (1588-1679)
hielt in seiner Schrift »Über den Bürger« für zulässig, zum
Zwecke der Selbsterhaltung jedes Mittel anzuwenden: »Weil
denn das Recht, zu einem Zweck zu streben, demjenigen nichts
hilft, dem man das Recht versagt, die nötigen Mittel
anzuwenden, so folgt daraus, daß, da jeder das Selbsterhaltungsrecht
hat, auch jeder berechtigt ist, alle Mittel anzuwenden und jede
Handlung vorzunehmen, ohne die er sich selbst nicht erhalten
kann.«5 Sinngemäß wurde die Anwendung aller möglichen
Mittel im Interesse der Staatsräson auch schon von Niccolö Ma-
chiavelli (1469-1527) vertreten.
Der inhaltlich sehr problematische Satz hat auch im
Sprichwort Widerstand erfahren: »Der Zweck heiligt die Mittel nicht«
oder auch lat. »Non sunt facienda mala, ut eveniant bona«
(»Man darf nichts Böses tun, damit Gutes geschehe«) sind im
19. Jh. als sprichwörtlich belegt.6 Im 20. Jh., das die Folgen
konsequenter Anwendung vom Zweck geheiligter Mittel
schmerzlich zu spüren bekommen hat, setzte der jüdische
Denker Martin Buber dem deutlich entgegen: »Niemals heiligt der
Zweck die Mittel, wohl aber können die Mittel den Zweck zu-
schanden machen.«7
L: Böttcher 204 (Nr. 1198); Büchmann 358; Duden 11,843 und 12,564; Mletzko 29.
83. 146; Wander 5,664. 1: Medulla theologiae moralis 4,3,7,2,3; vgl. 6,6,2,2,1,8:
»Wem der Zweck erlaubt ist, dem sind auch die Mittel erlaubt« (»Cui licitus est finis,
etiam licent media«). 2: »praecisa vi et iniuria«: Wander 5,664 (Zweck Nr. 3). 3:
Klosterspiegel in Stichwörtern, Bern 1841, 11,3 nach Wander 5,664 (Zweck Nr. 3). 4:
»Nous corrigeons le vice du moyen par la purete de la fin«: »Les provinciales, ou lettres
escrites par Louis de Montalte ä un provincial de ses amis...«, 1656, Brief 7. 5: De cive
1,8. 6: Wander 5,664 (Zweck Nr. 2). 7: Mieder, Antisprichwörter 149 mit Beleg.
Im Zweifel für den Angeklagten
Wenn eine Schuld nicht eindeutig bewiesen ist, muß der
Angeklagte freigesprochen werden.
Die auch lateinisch als »In dubio pro reo« bekannte Regel er-
177
scheint in dieser bündigen Form zuerst bei dem Mailänder
Kriminologen Egidio Bossi (1487-1546).] Der Grundsatz wird
jedoch schon in der Antike mehrfach genannt: So hielt der Jurist
Paulus (um 200) unter Berufung auf Kaiser Antoninus Pius fest,
daß bei Stimmengleichheit im Richterkollegium zugunsten des
Angeklagten (»pro reo«) zu entscheiden sei.2 Sein Zeitgenosse
und Kollege Ulpian begründete dieses Vorgehen unter
Berufung auf Kaiser Trajan: »Denn es ist besser, die Tat eines
Schuldigen ungestraft zu lassen, als einen Unschuldigen zu
verurteilen.«3
L: Bartels 92; Büchmann 353-354; Mletzko 9; Reichert 51. 1: Aegidius Bossius, Tracta-
tus varii, qui omnem fere criminalem materiam complectuntur; nach D. Liebs,
Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, Darmstadt 1982,91 f. 2: Digesten 42,1,38.
3: Digesten 48,19,5. Vgl. ferner: Ps.-Aristot. problemata physica 29,13,951a 20ff.;
Gaius, Digesten 50,17,125, vgl. auch Marcellus im gleichen Kap. § 192; Bonifatius VIII,
über sextus decretalium 5,12,11.
178
Literaturhinweise
Bartels: Klaus Bartels, Veni vidi vici. Geflügelte Worte aus dem Griechischen und
Lateinischen, München, 3. Aufl. 1997
Böttcher: Böttcher, Kurt u.a., Geflügelte Worte. Zitate, Sentenzen und Begriffe in ihrem
geschichtlichen Zusammenhang, Leipzig 1981
Borchardt-Wustmann-Schoppe: W. Borchardt/G. Wustmann/G. Schoppe, Die
sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund nach Sinn und Ursprung
erläutert, 7. Aufl. (neu bearb. von Alfred Schirmer) Leipzig 1954
Büchmann: Geflügelte Worte. Der klassische Zitatenschatz, gesammelt und erläutert
von Georg Büchmann, fortgesetzt von Walter Robert-Tornow u.a., 41., durchges.
Aufl., bearbeitet von Winfried Hofmann, Berlin 1998
Der Kleine Pauly: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, 5 Bde., München 1979
Der neue Büchmann: Der neue Büchmann. Geflügelte Worte, gesammelt und erläutert
von Georg Büchmann, fortgesetzt von Walter Robert-Tornow u.a., bearbeitet und
weitergeführt von Eberhard Urban, Niedernhausen i.Ts. 1994
Duden 11: Duden Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der
deutschen Idiomatik, bearbeitet von Günther Drosdowski und Werner Scholze-Stu-
benrecht, überarb. Nachdr. der 1. Aufl., Mannheim 1998
Duden 12: Duden Zitate und Aussprüche, bearbeitet von Werner Scholze-Stubenrecht,
Überarb. Nachdr. der 1. Aufl., Mannheim 1998
Fritsch: Andreas Fritsch, Index sententiarum ac locutionum. Handbuch lateinischer
Sätze und Redewendungen, Saarbrücken 1996
Grimm: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 33 Bde., Leipzig
1854-1971, Nachdruck München 1984
Kluge: Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin
21. Aufl. 1975
Macrone: Michael Macrone, It's Greek to Me! Brush up your classics, New York 1991
Mieder, Antisprichwörter: Wolfgang Mieder, AntiSprichwörter. Band III, Wiesbaden
1989
Mieder, Investigations: Wolfgang Mieder, Investigations of Proverbs, Proverbial
Expressions, Quotations und Cliches, Bern 1984
Mieder, Phrasen: Wolfgang Mieder, Phrasen verdreschen. Antiredensarten aus Literatur
und Medien, Wiesbaden 1999
Mieder, Proverbs: Wolfgang Mieder, American Proverbs. A Study of Texts and Contexts,
New York 1989
Mieder, Sprichwörter: Wolfgang Mieder, Deutsche Sprichwörter in Literatur, Politik,
Presse und Werbung, Hamburg 1983
Mletzko: Manfred Mletzko, Variatio delectat, Bamberg 1998
Otto: August Otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer,
Leipzig 1890 (Nachdruck Hildesheim 1962)
Otto, Nachträge: Reinhard Haussier (Hg.), Nachträge zu A. Otto, Sprichwörter und
sprichwörtliche Redensarten der Römer, Darmstadt 1968
RE: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung
Stuttgart 1894ff. [Band, Halbband, Spalte]
Reichert: Heinrich G. Reichert, Unvergängliche lateinische Spruchweisheit. Urban und
human, Wiesbaden 4. Aufl. 2000
Röhrich: Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, 5 Bde., Freiburg i. Br.
1994
Rössing: Roger Rössing, Wie der Hering zu Bismarcks Namen kam. Unbekannte
Geschichten zu bekannten Begriffen, Frechen, 7. Aufl. 1998
Stichwörter: Friedrich Maier (Hg.), Stichwörter der europäischen Kultur (Reihe: Antike
und Gegenwart. Lateinische Texte zur Erschließung europäischer Kultur), mit
Lehrerkommentar (Komm.), 2. Aufl. Bamberg 1992
179
Stichwörter Komm.: Friedrich Maier (Hg.), Stichwörter der europäischen Kultur (Reihe:
Antike und Gegenwart. Lateinische Texte zur Erschließung europäischer Kultur).
Lehrerkommentar, 2. Aufl. Bamberg 1992
Surbeck: Rolf Surbeck (Hg.), Fernsehen in die Antike. Die Welt von gestern mit den
Augen von heute, Basel o. j. [Eine Serie von 51 Beiträgen, erschienen von April 1993 bis
Mai 1994 im Basler Magazin der Basler Zeitung]
Tosi: Renzo Tosi, Dizionario delle sentenze Latine e Greche, Mailand 1991
Wander: Karl Friedrich Wilhelm Wander, Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein
Hausschatz für das deutsche Volk, Leipzig 1867-1880
Zanoner: Angela Maria Zanoner, Dizionario delle frasi Latine piü celebri, Mailand 1993
Von der Achillesferse
bis zum Zyniker
KU Ml ARD |>o III Kl
Das uisscn nur * ,
di Götter , .
Drutst In' Hrtlcnsartrn
aut tlt'in (irtrt hist lim
*
. /
T*
1
S'. i
Reinhard Pohlke
Das wissen nur die Götter
Deutsche Redensarten
aus dem Griechischen
240 Seilen
Gebunden
mit Schutzumschlag
ISBN 3-7608-1964-8
Artemis & Winkler
Viele Redewendungen und Begriffe, die im
Alltagsdeutsch üblich sind, haben ihre Wurzel in
der griechischen Sprache. Reinhard Pohlke hat sie
systematisch zusammengetragen und gründlich
untersucht.
Beim »Ödipus-Komplex« offenbart schon der
Name die Herkunft. Aber was ist, wenn wir einen
»Bärenhunger« haben, jemanden
»an der Nase herumführen« oder
ihm »Hörner aufsetzen«?
Eine vergnügliche und lehrreiche
Lektüre zugleich.
WrER ETWAS »AD ACTA« LEGT, ist sich
meist bewußt, daß diese Formulierung
aus der lateinischen Sprache stammt. Wer
hingegen durch »Abwesenheit glänzt«, weil
er »in den Tag hinein lebt« und
»Luftschlösser baut«, der sollte nicht schwatzhaft sein
und noch »Ol ins Feuer gießen«, sondern
»das süße Nichtstun« eher in »beredtem
Schweigen« genießen - ob ihm die
lateinische Wurzel der Redensart bekannt ist oder
nicht. Dem Erfolgstitel das wissen nur
DIE GÖTTER. DEUTSCHE REDENSARTEN AUS
dem griechischen stellen Annette und
Reinhard Pohlke nun das Pendant fürs
Lateinische gegenüber.
Artemis
Annette pohlke, geboren 1967,
studierte Geschichte, Latein und
Ev. Theologie an der Freien
Universität Berlin. Sie ist als
freiberufliche Dozentin und Autorin tätig.
Reinhard pohlke, geboren 1966,
unterrichtet an einem Berliner
Gymnasium u.a. die Fächer Latein
und Griechisch.
ISBN 3-7bDö-lSb?-E
783760n819679