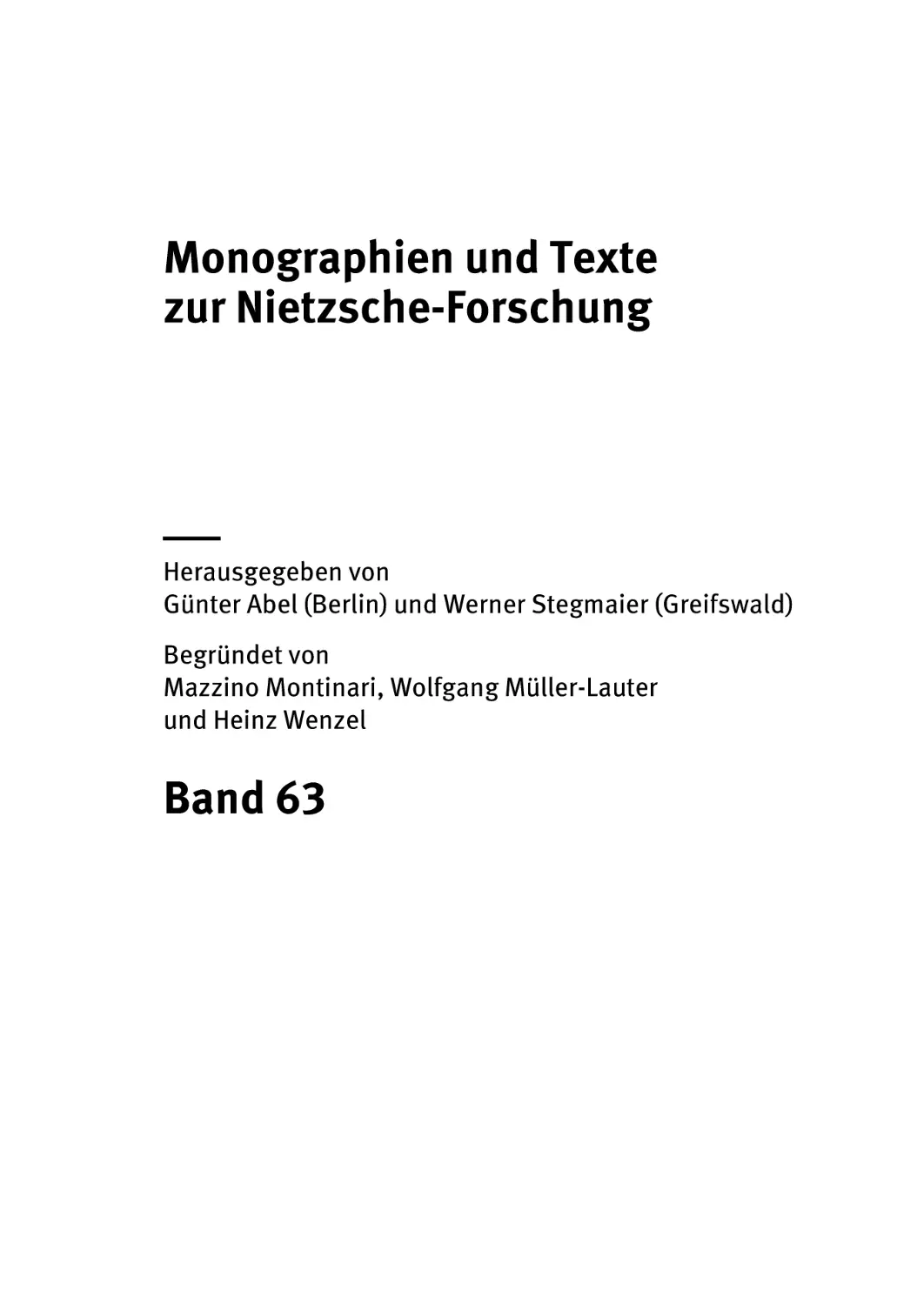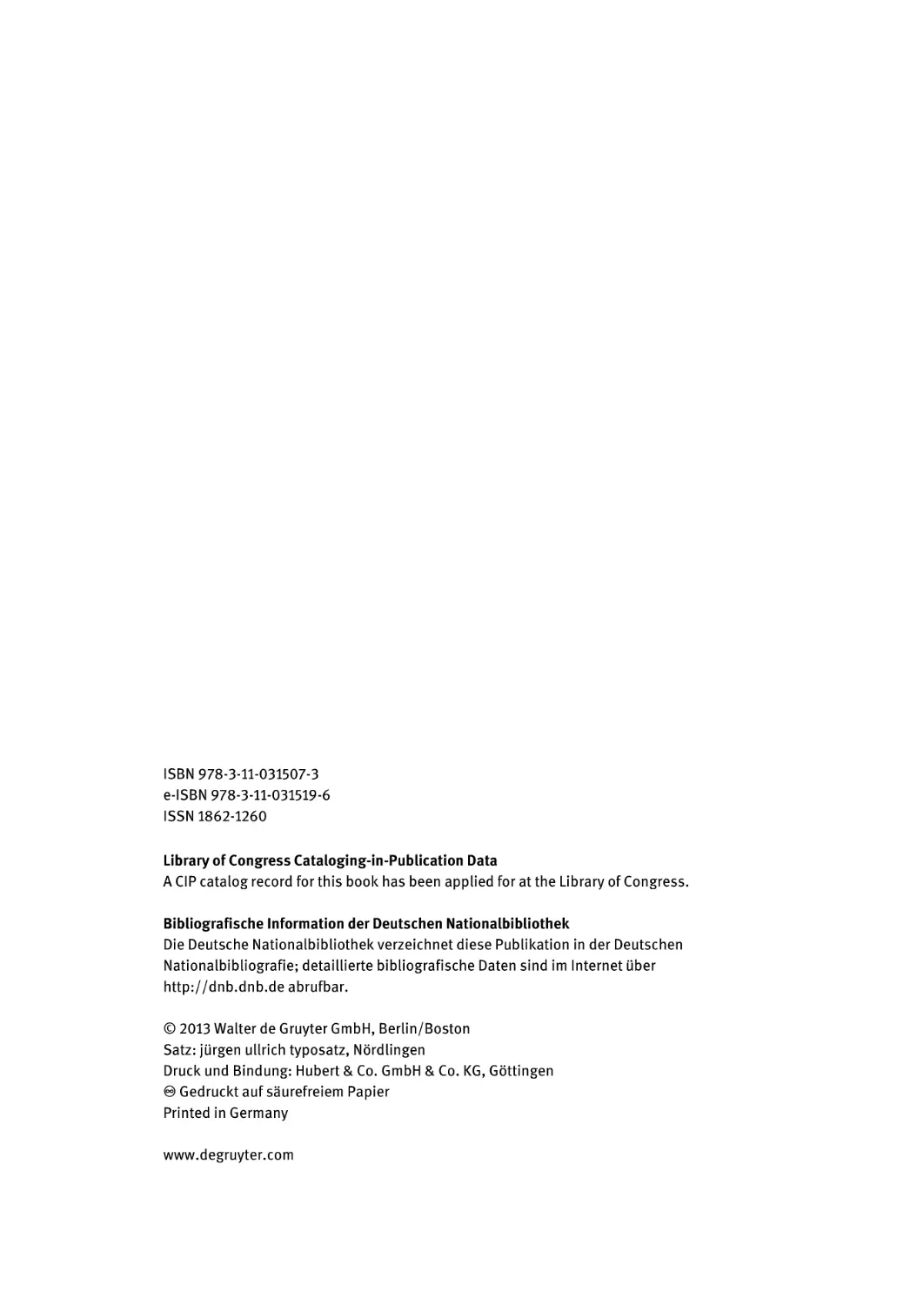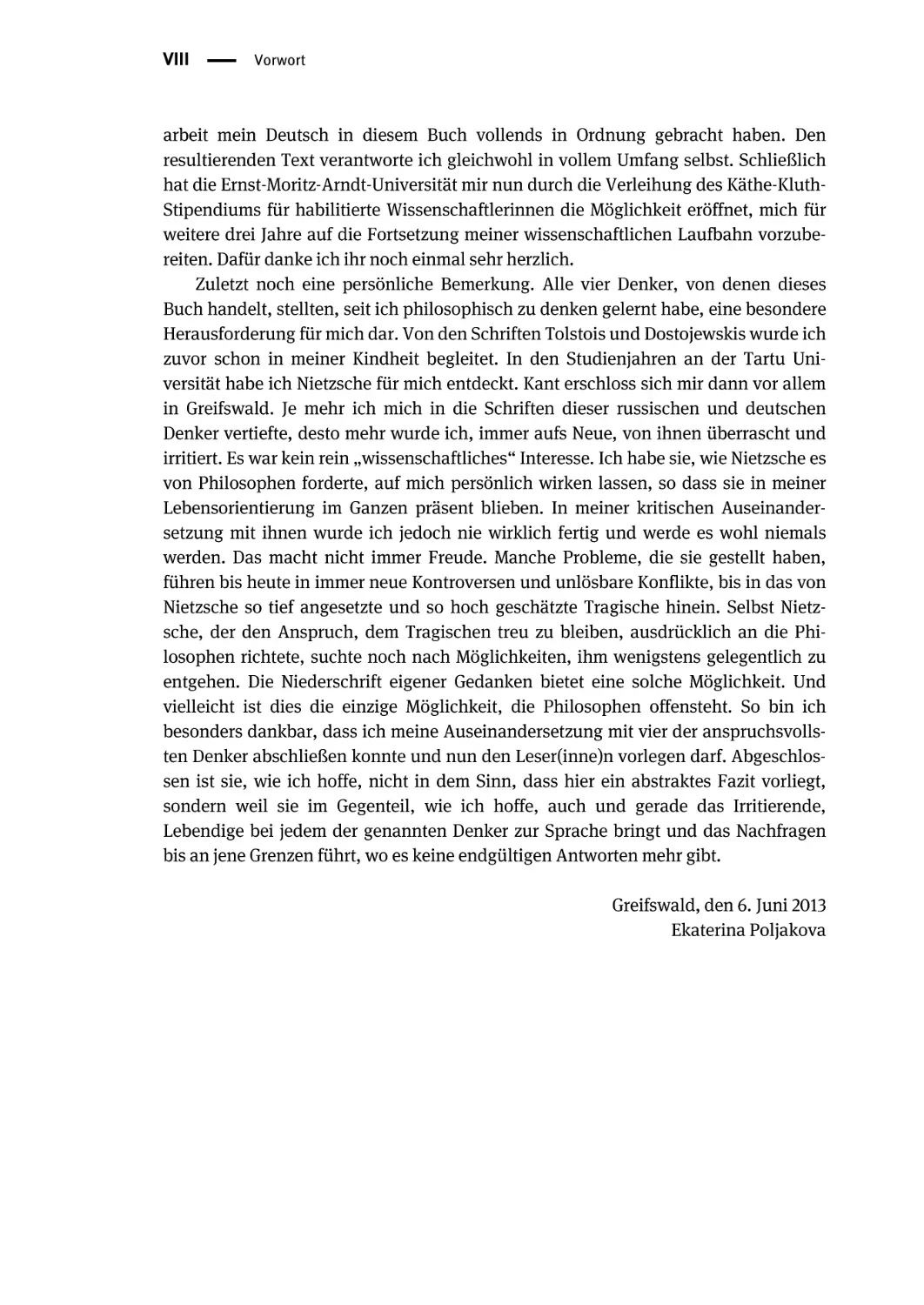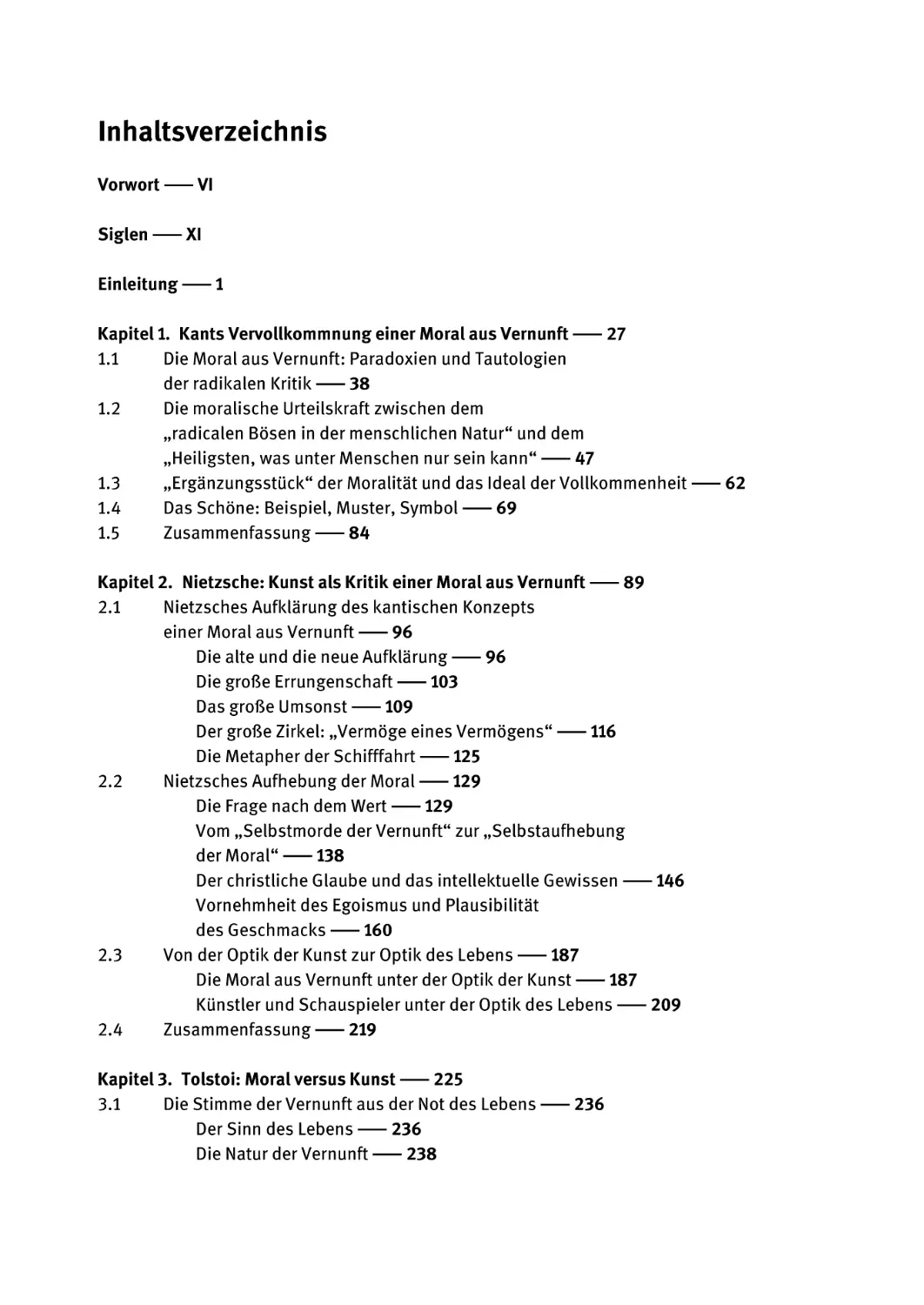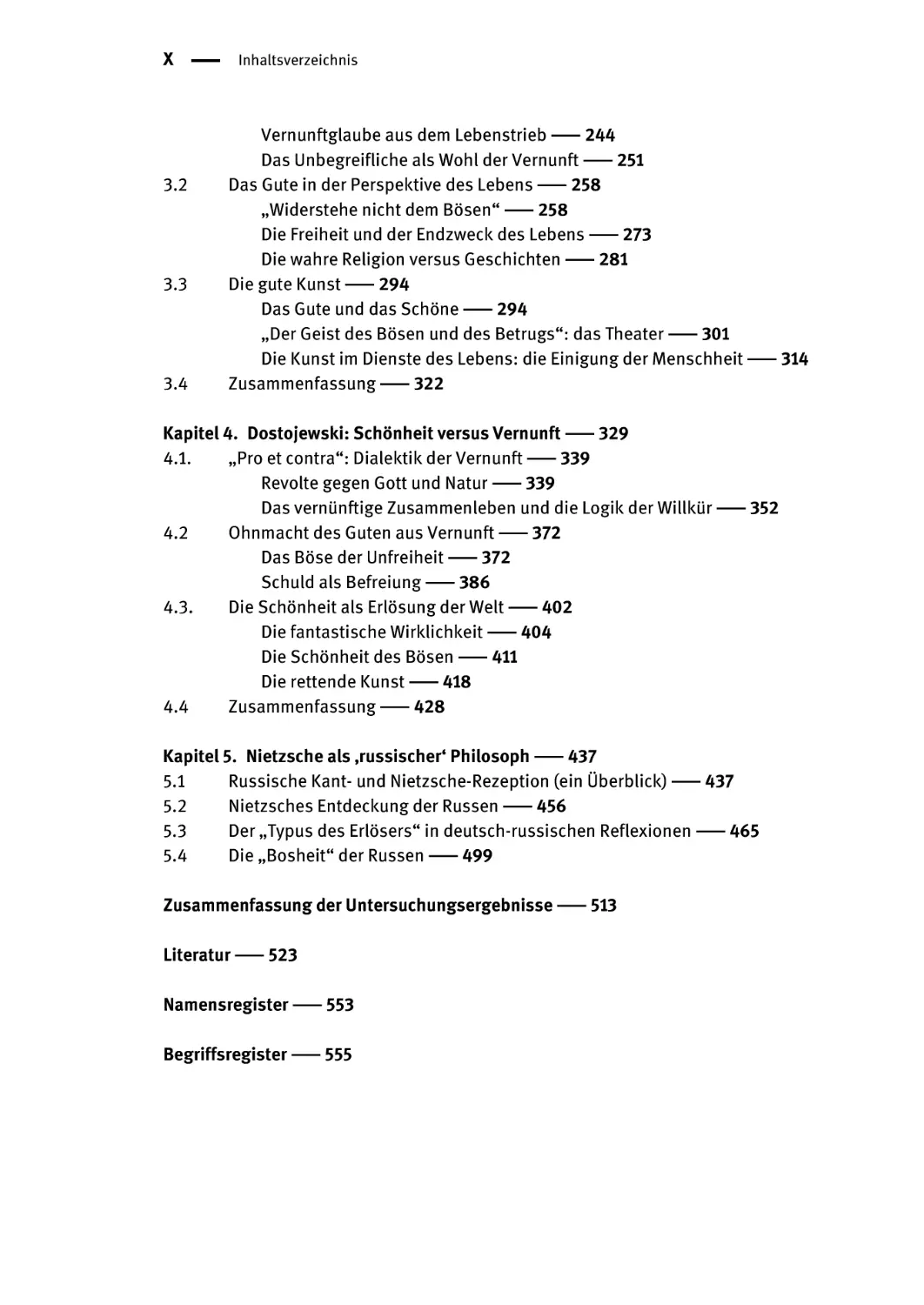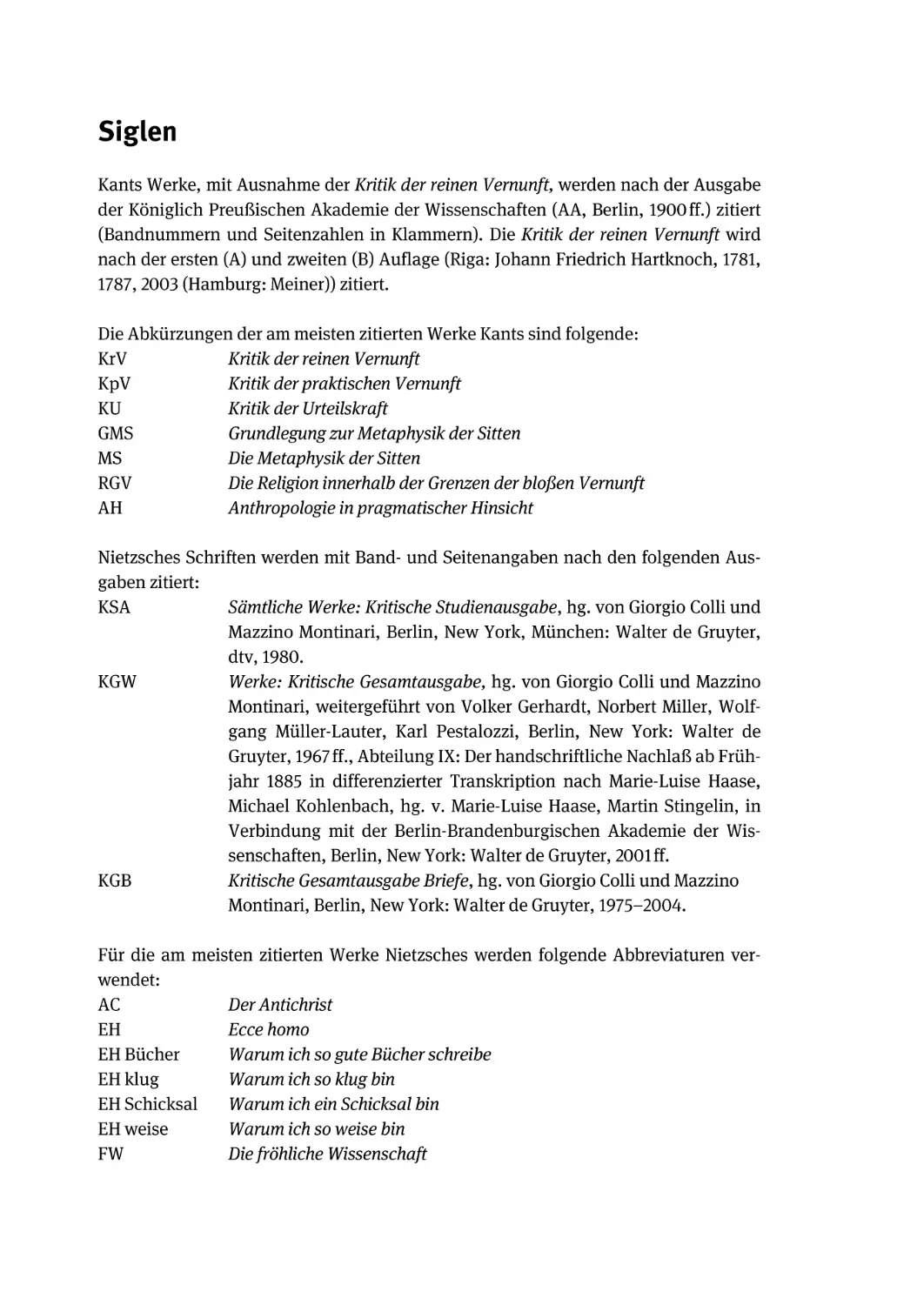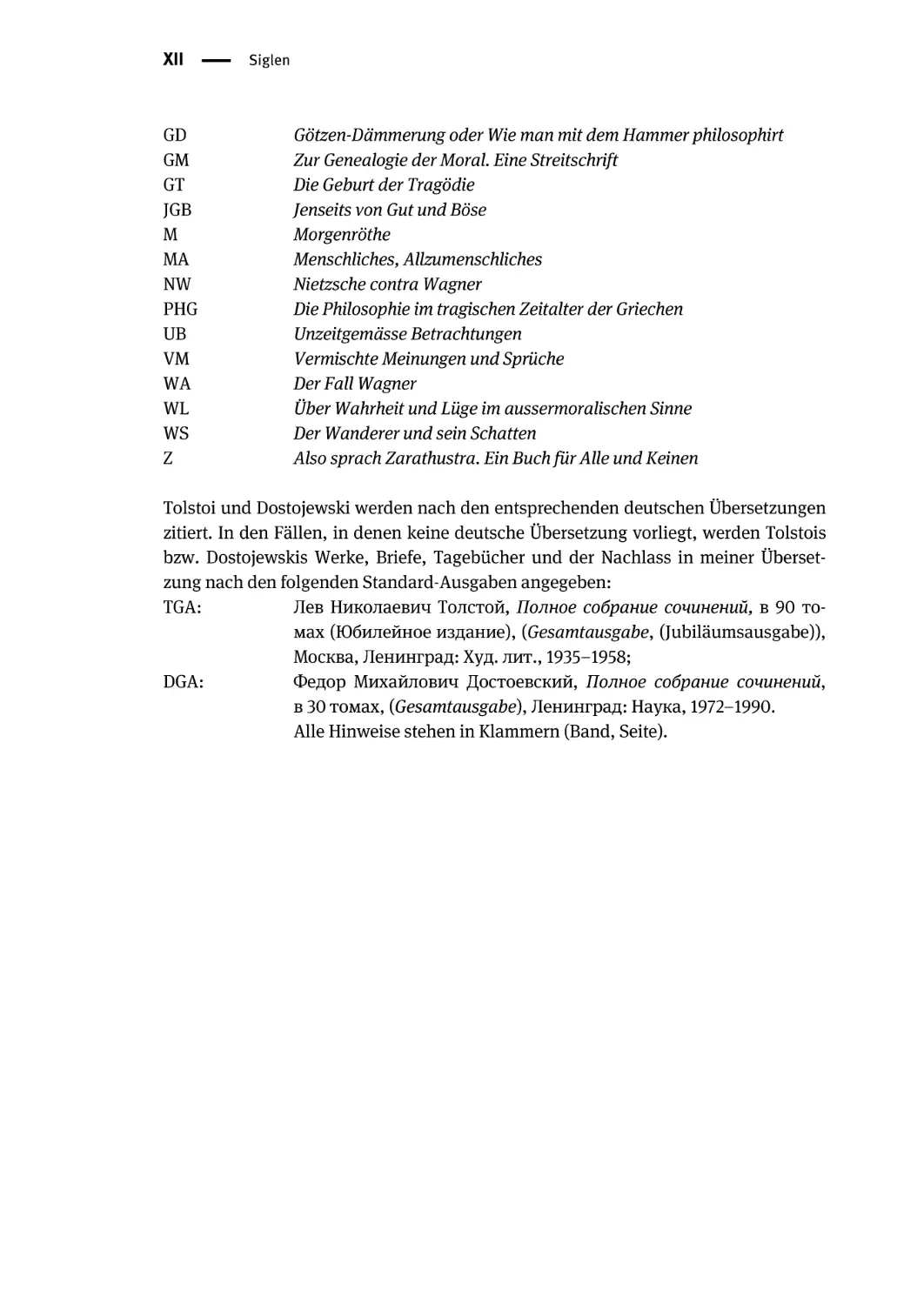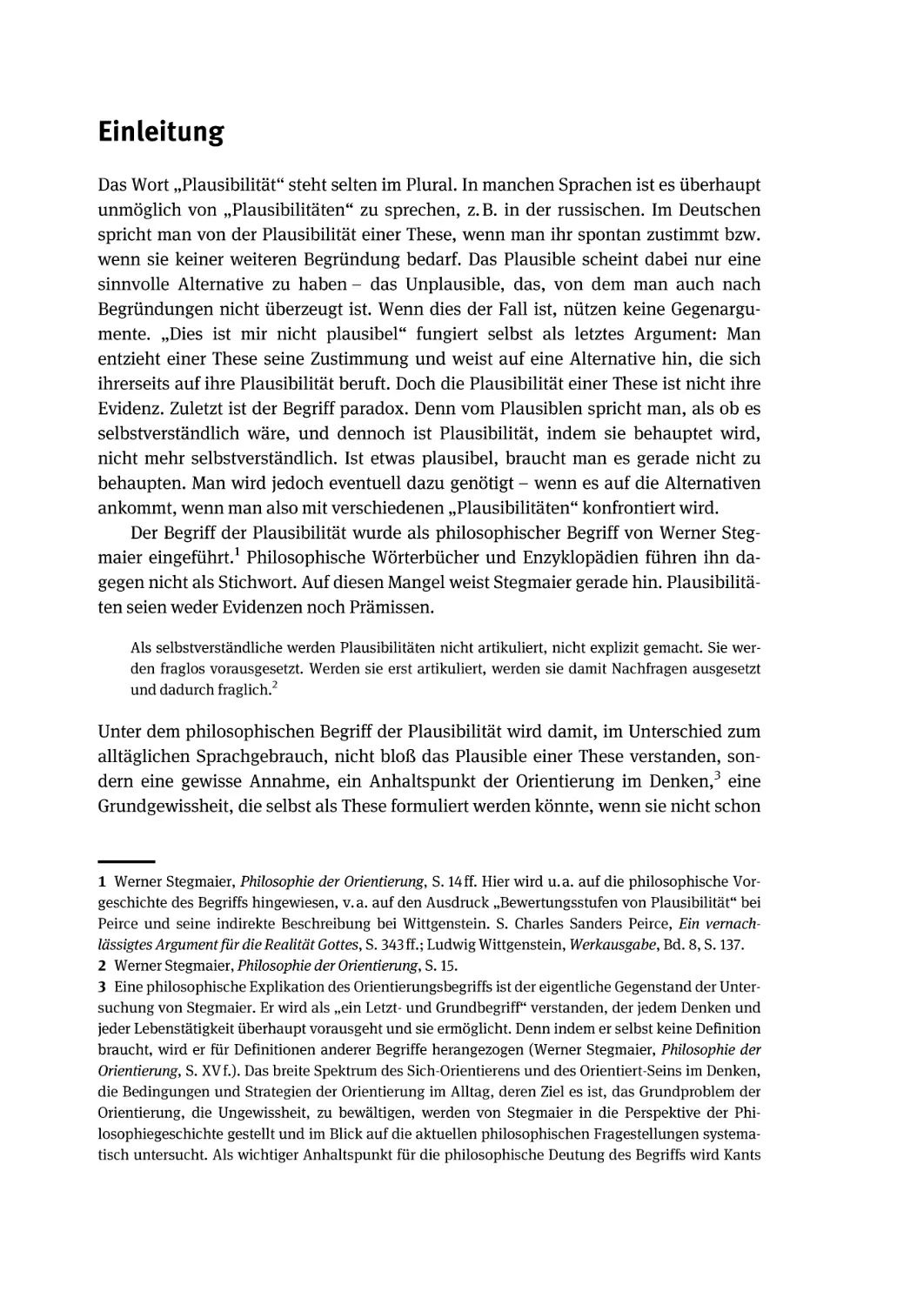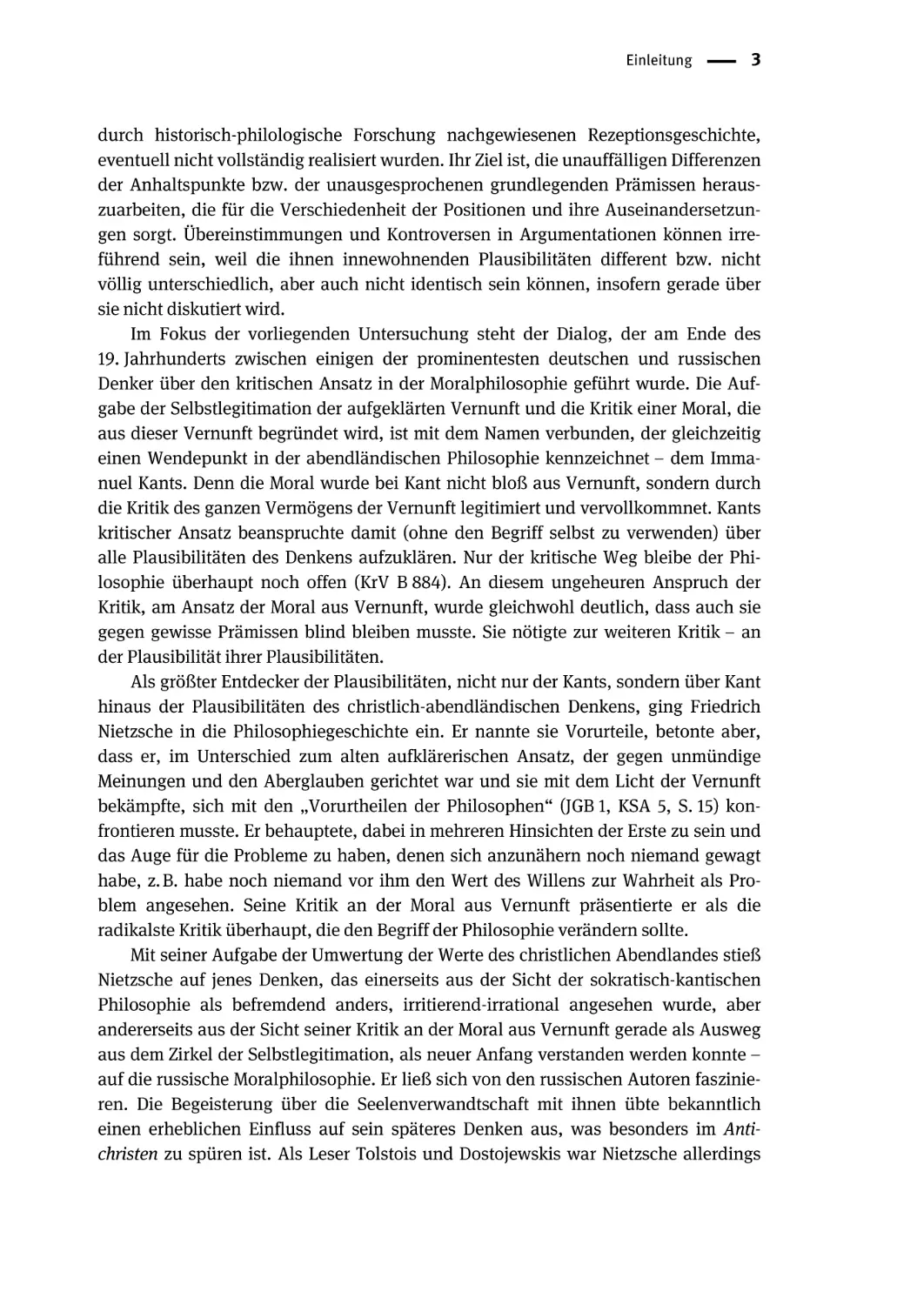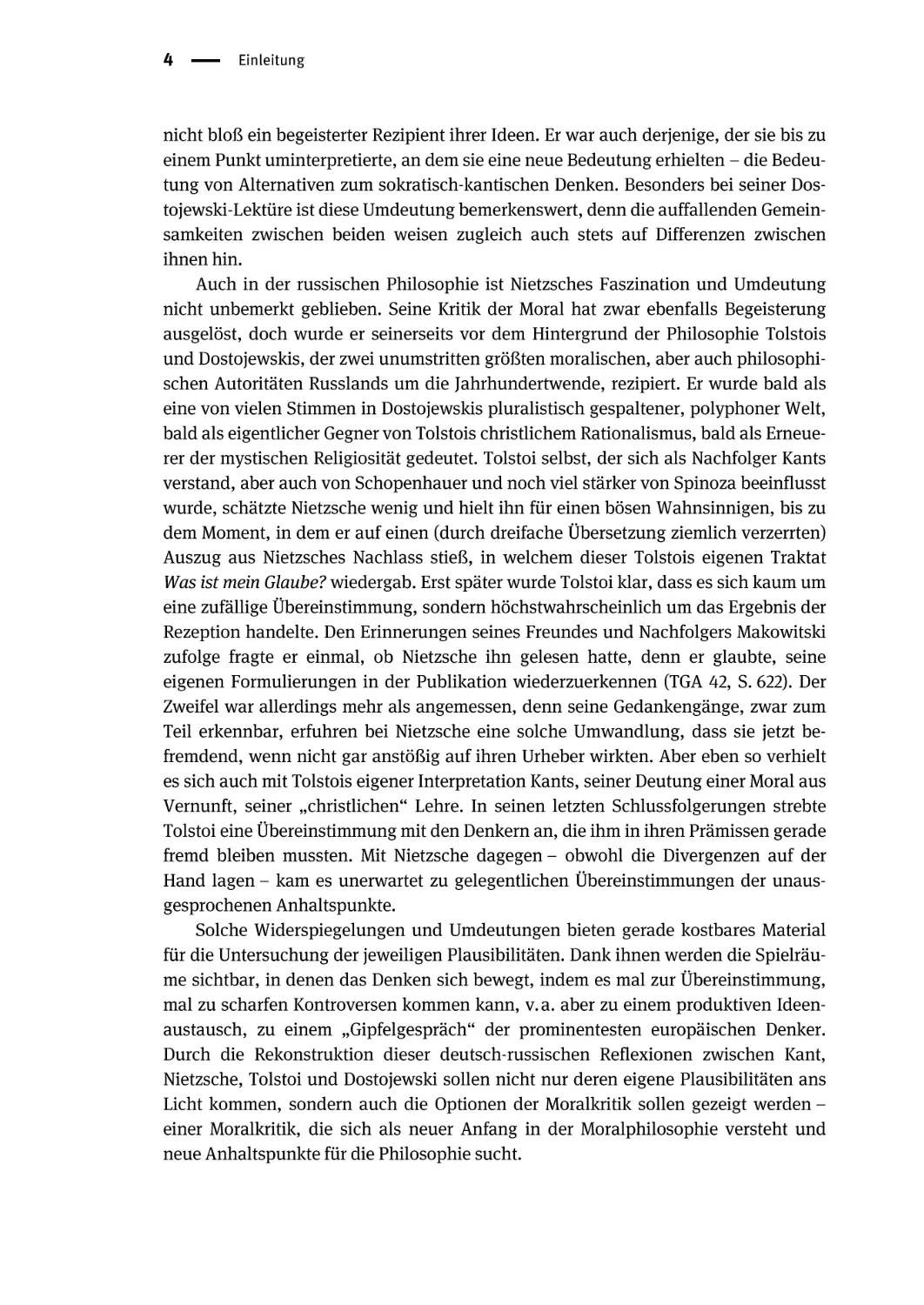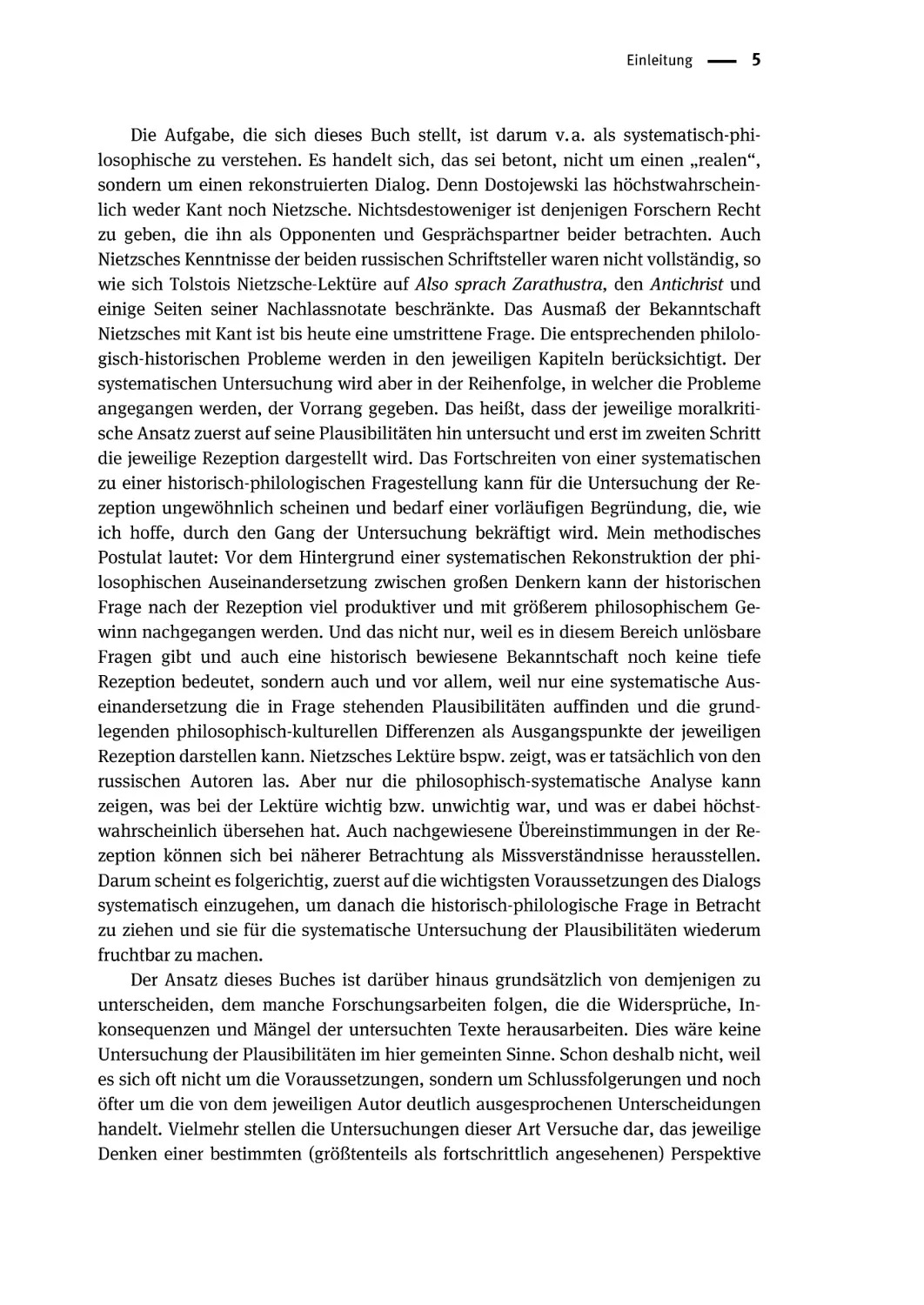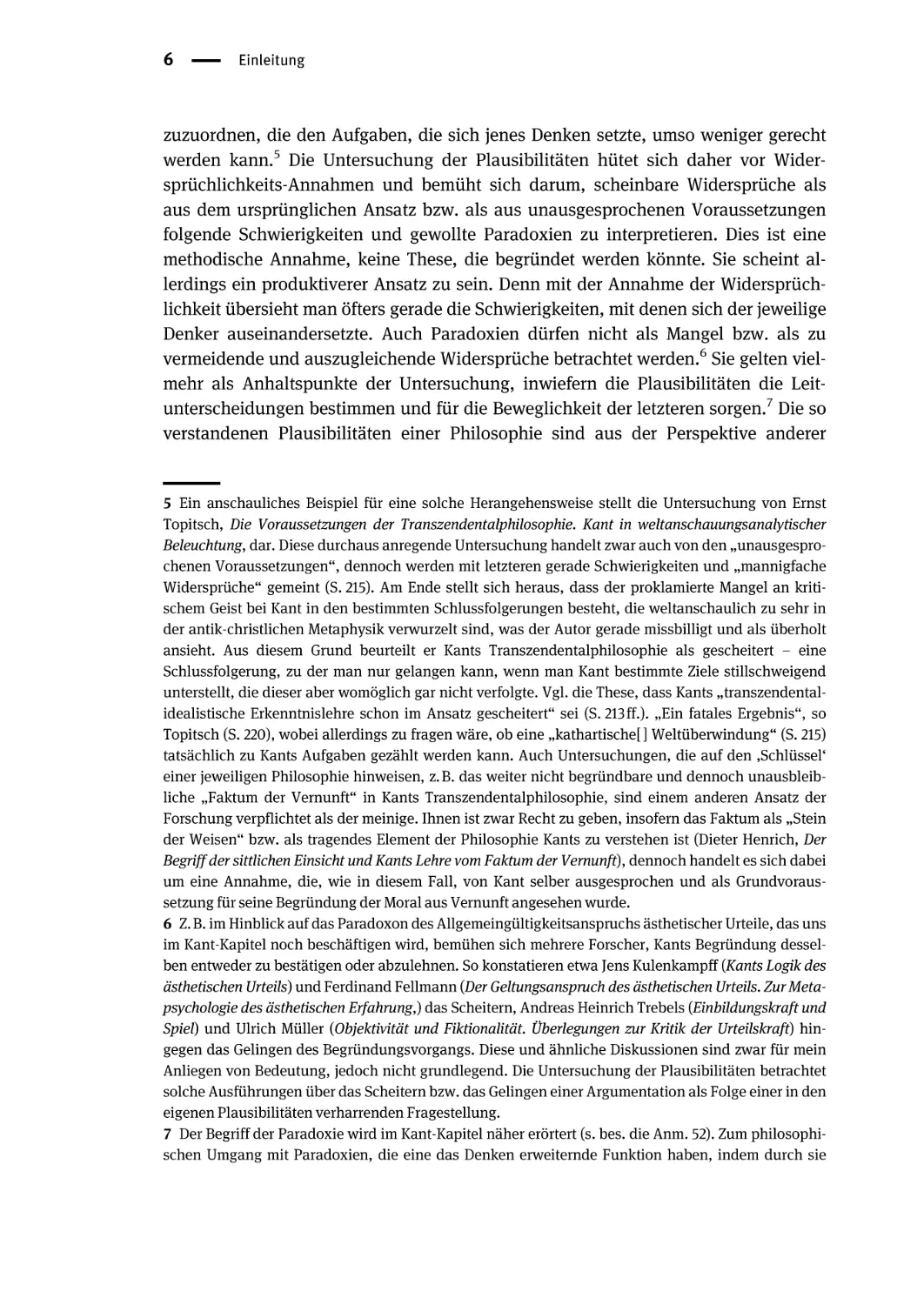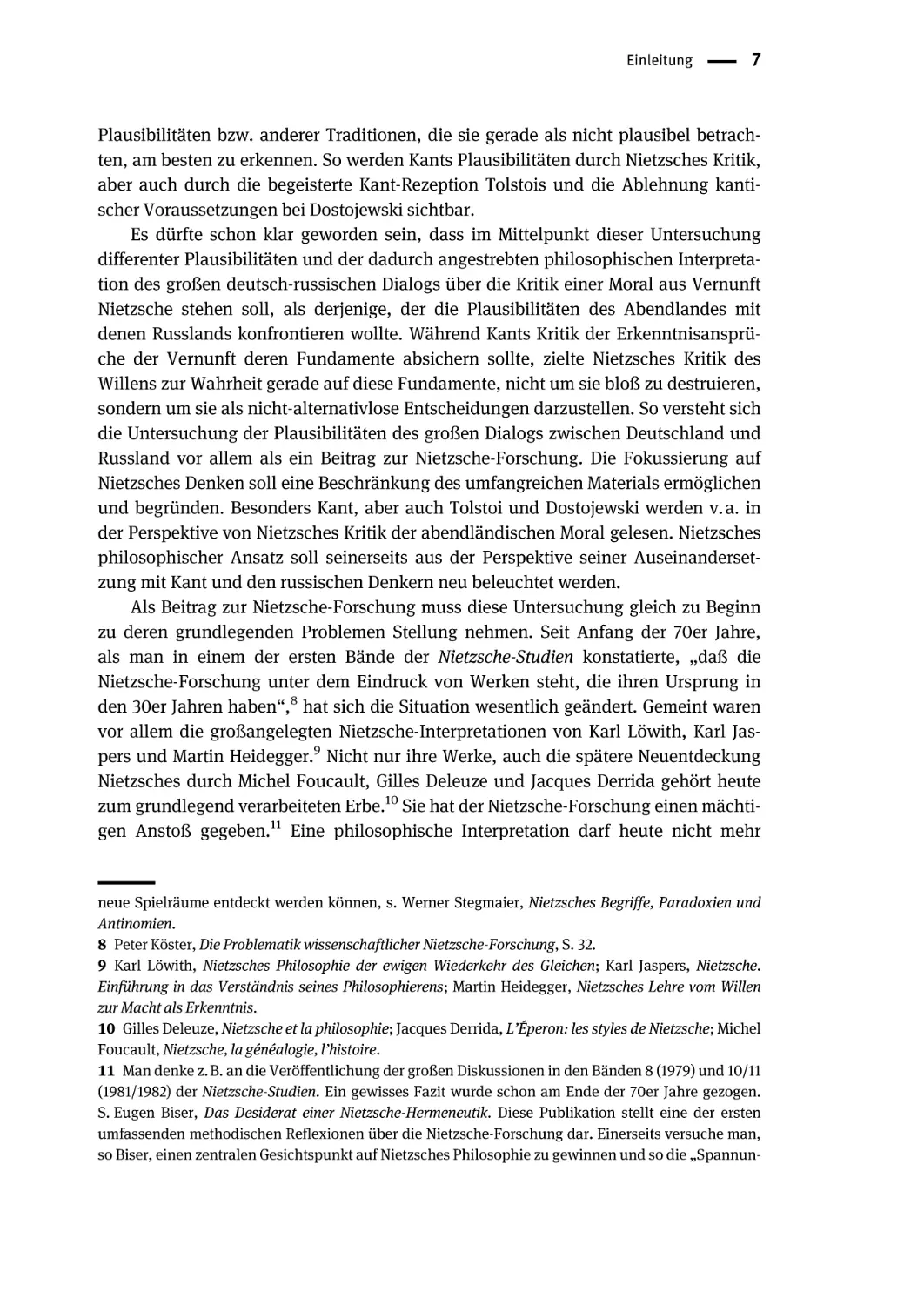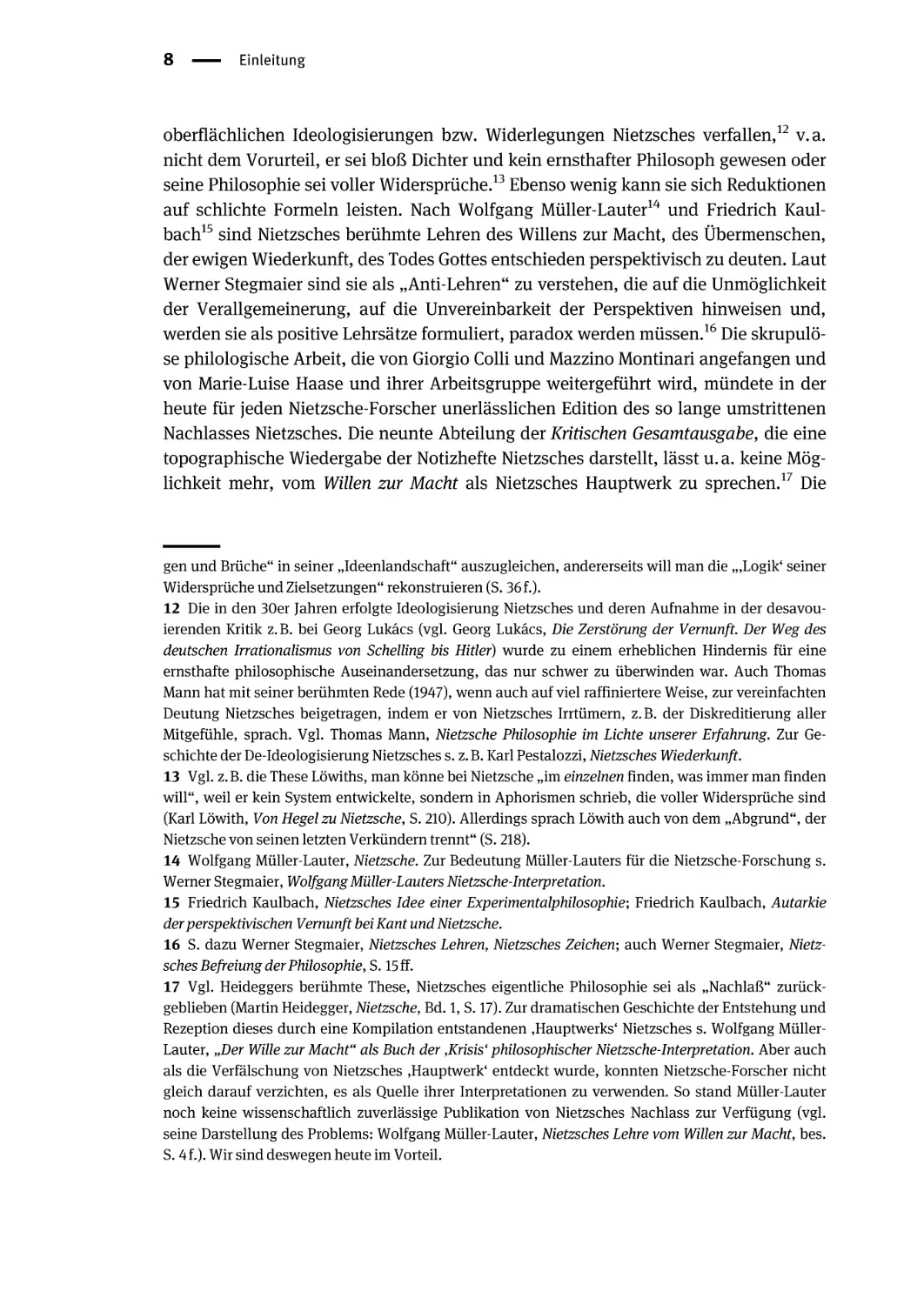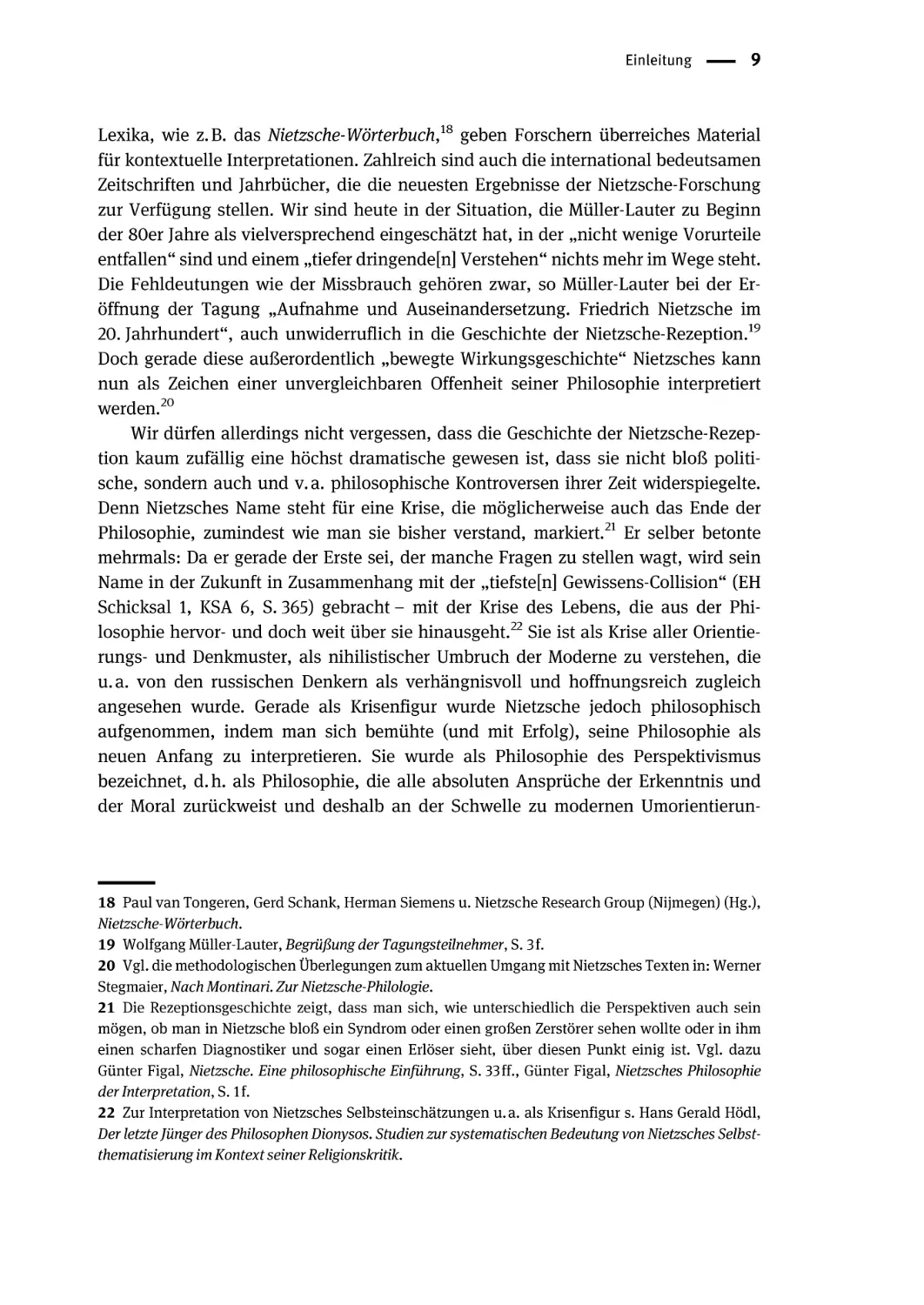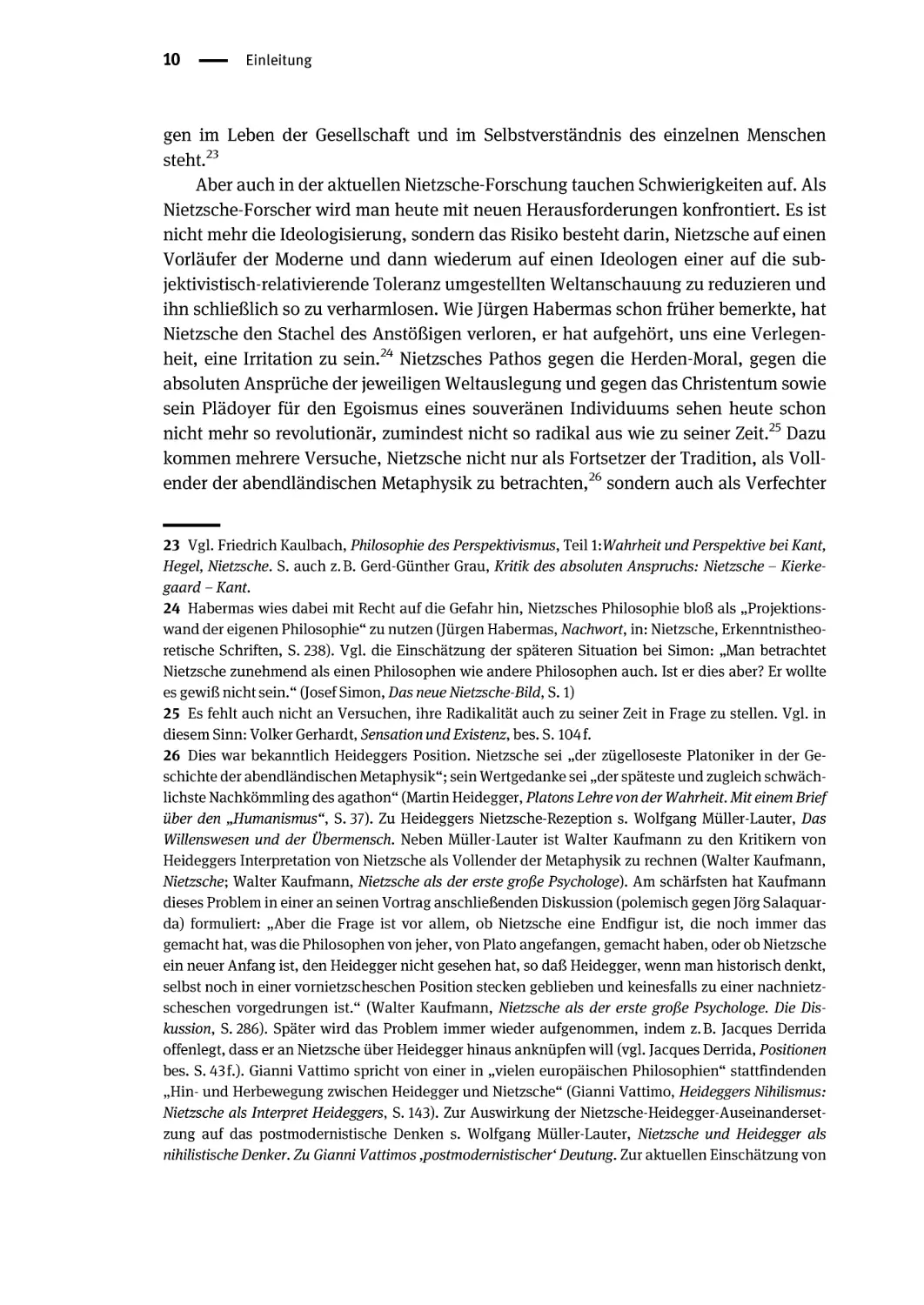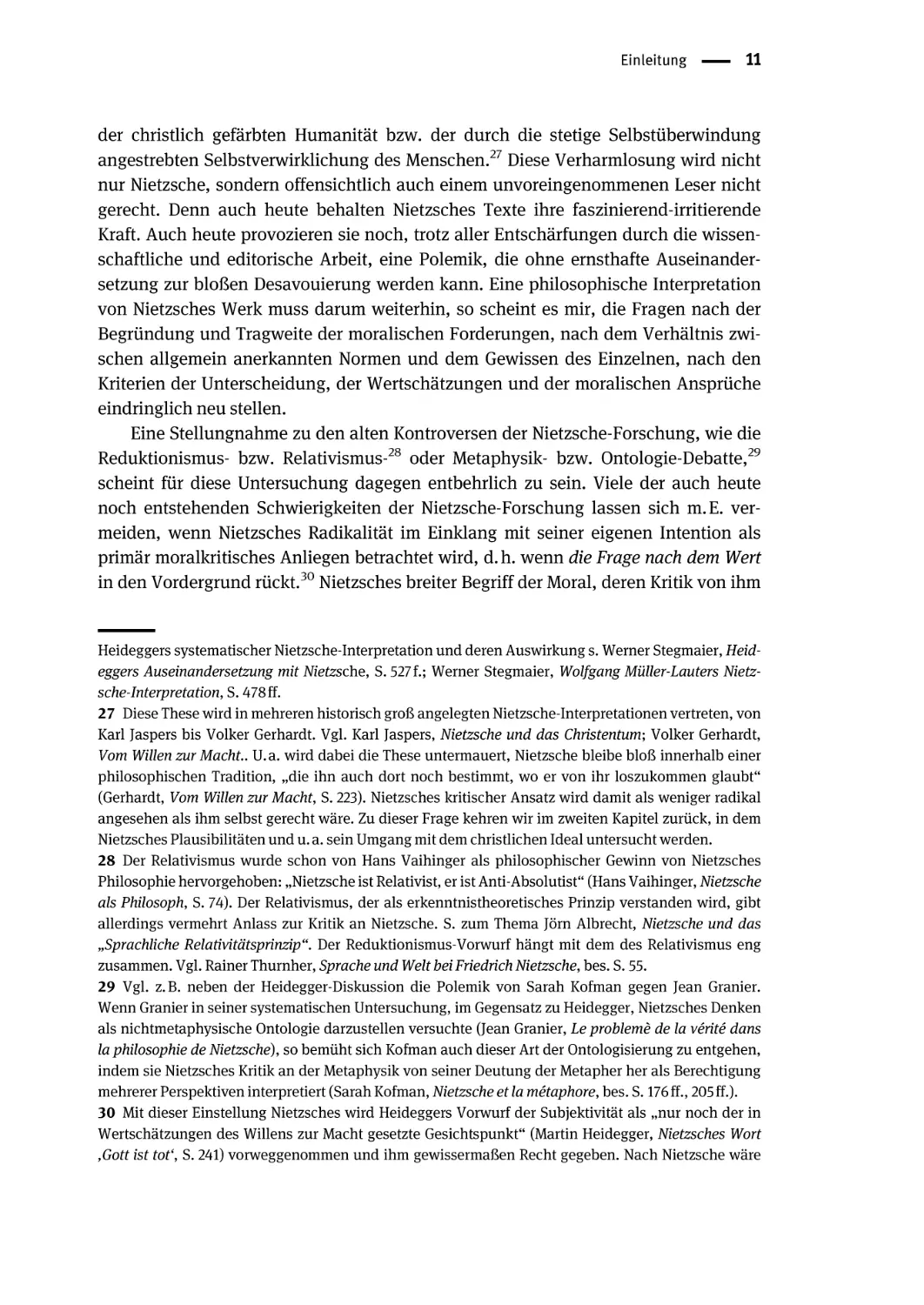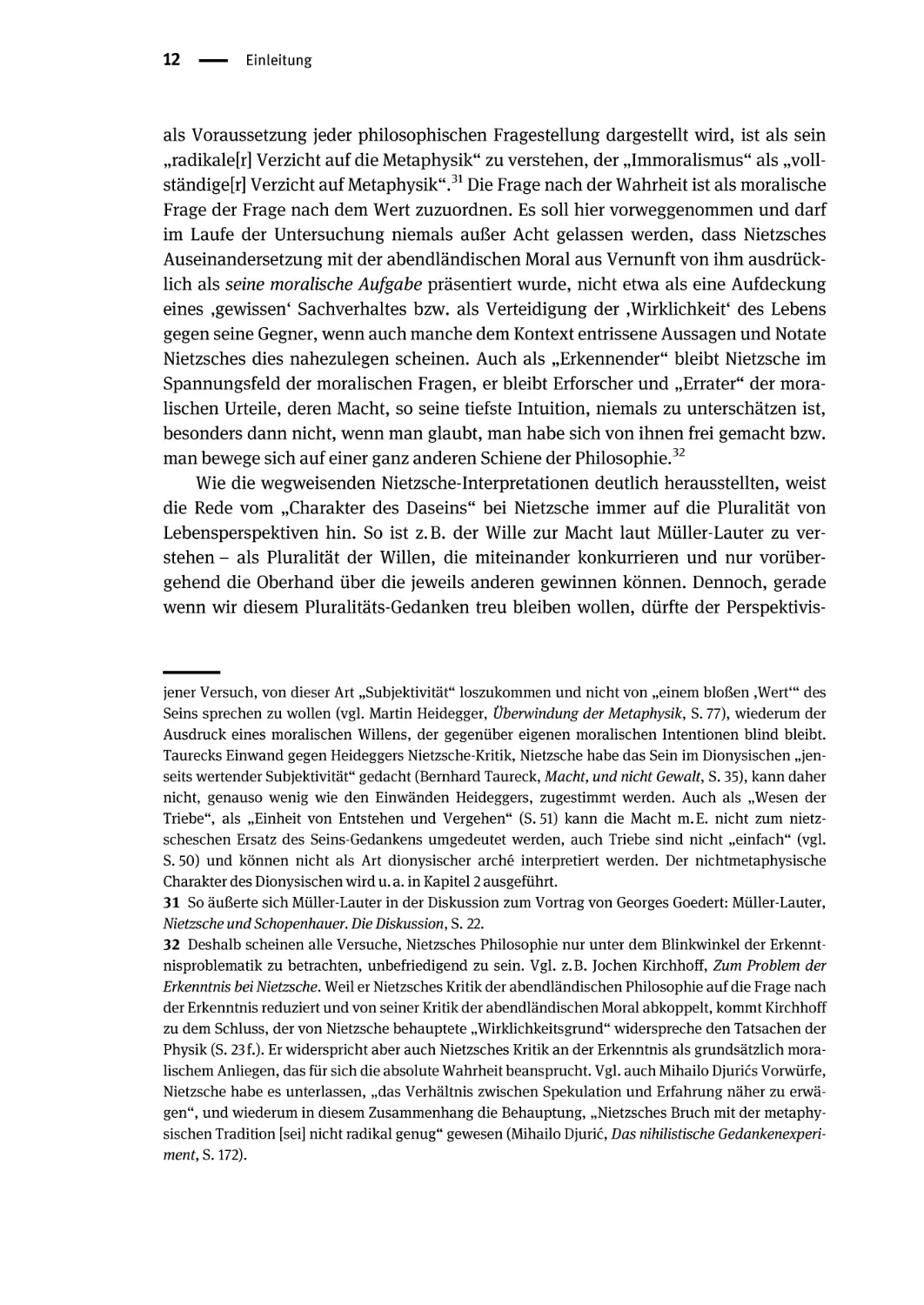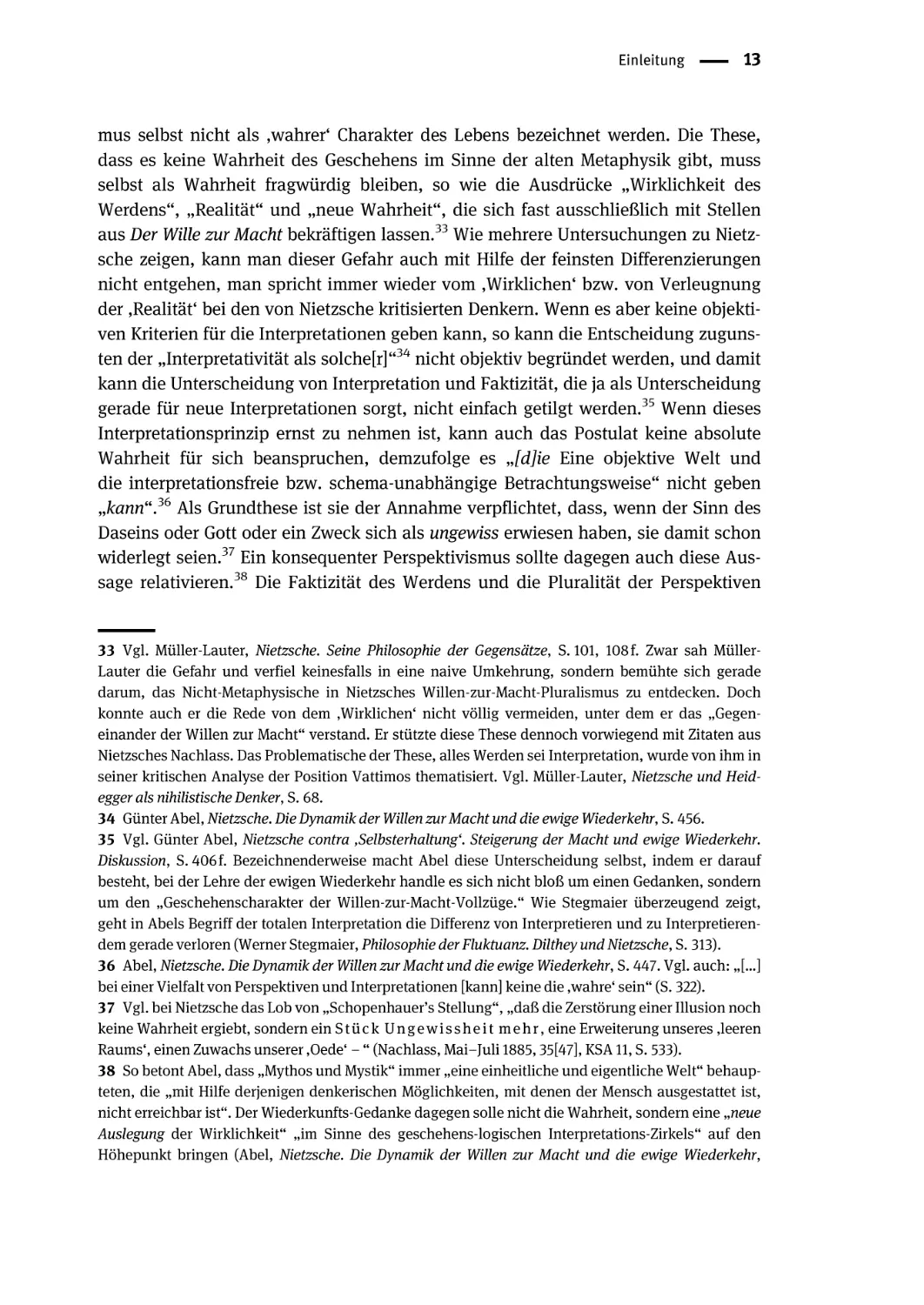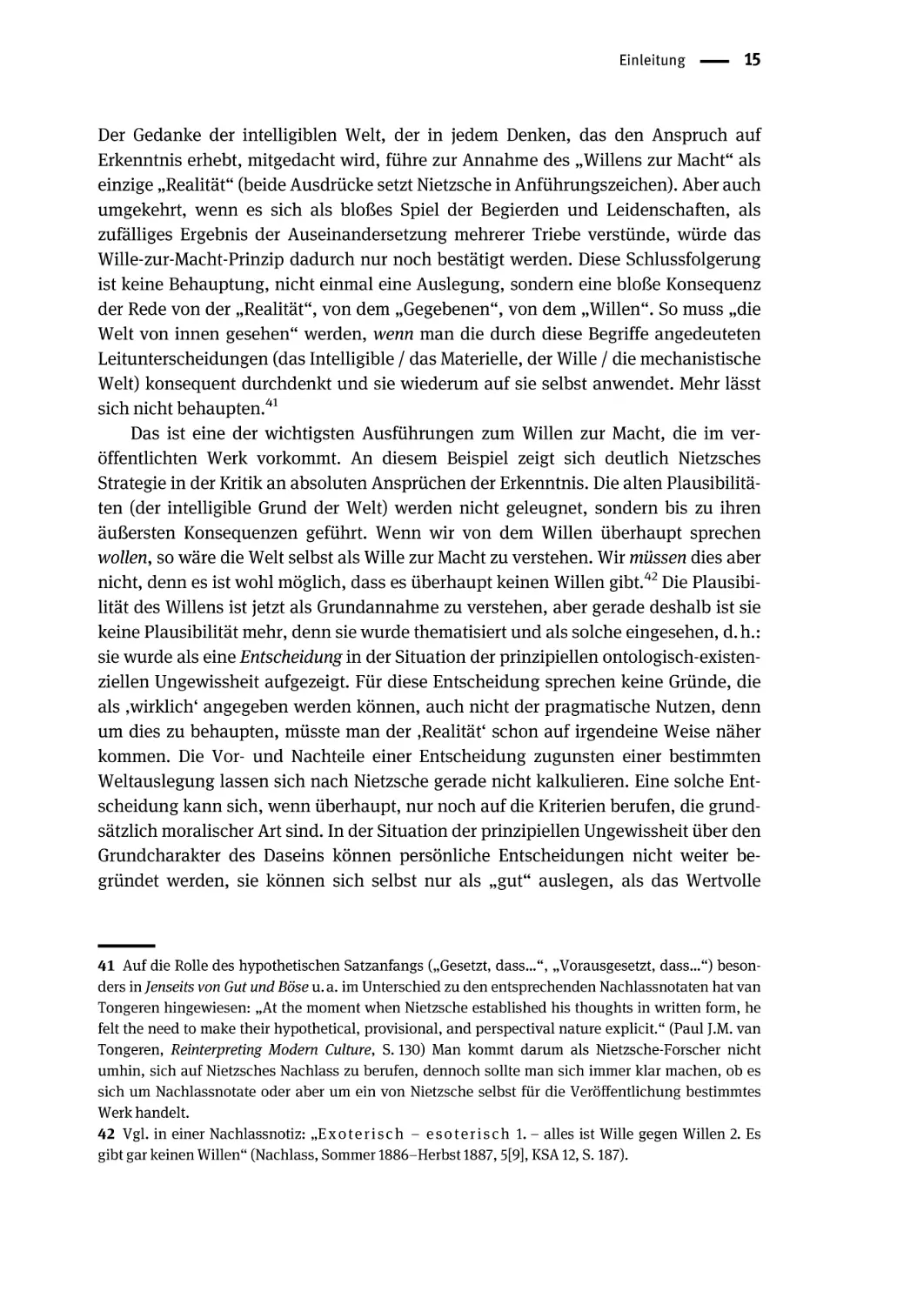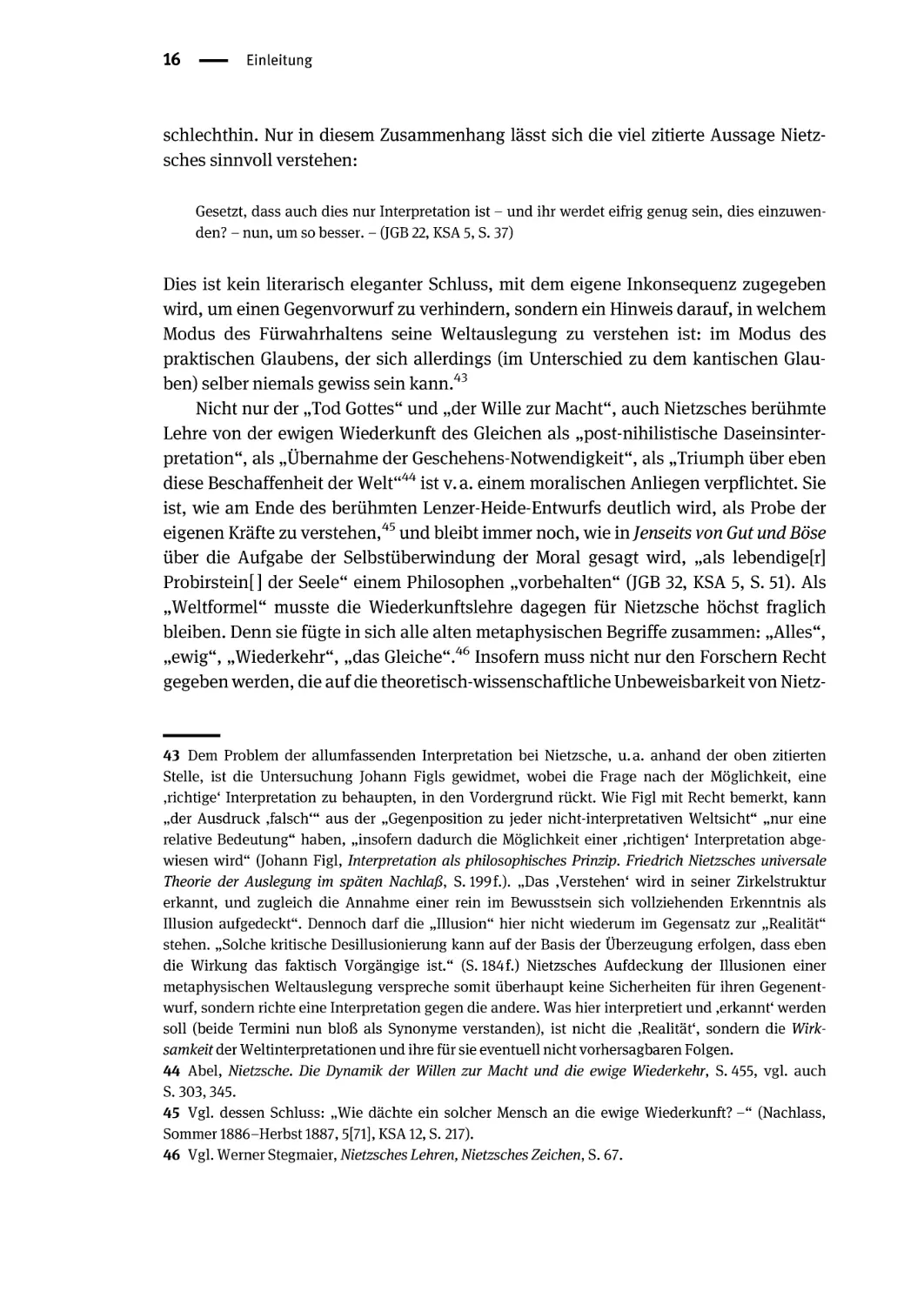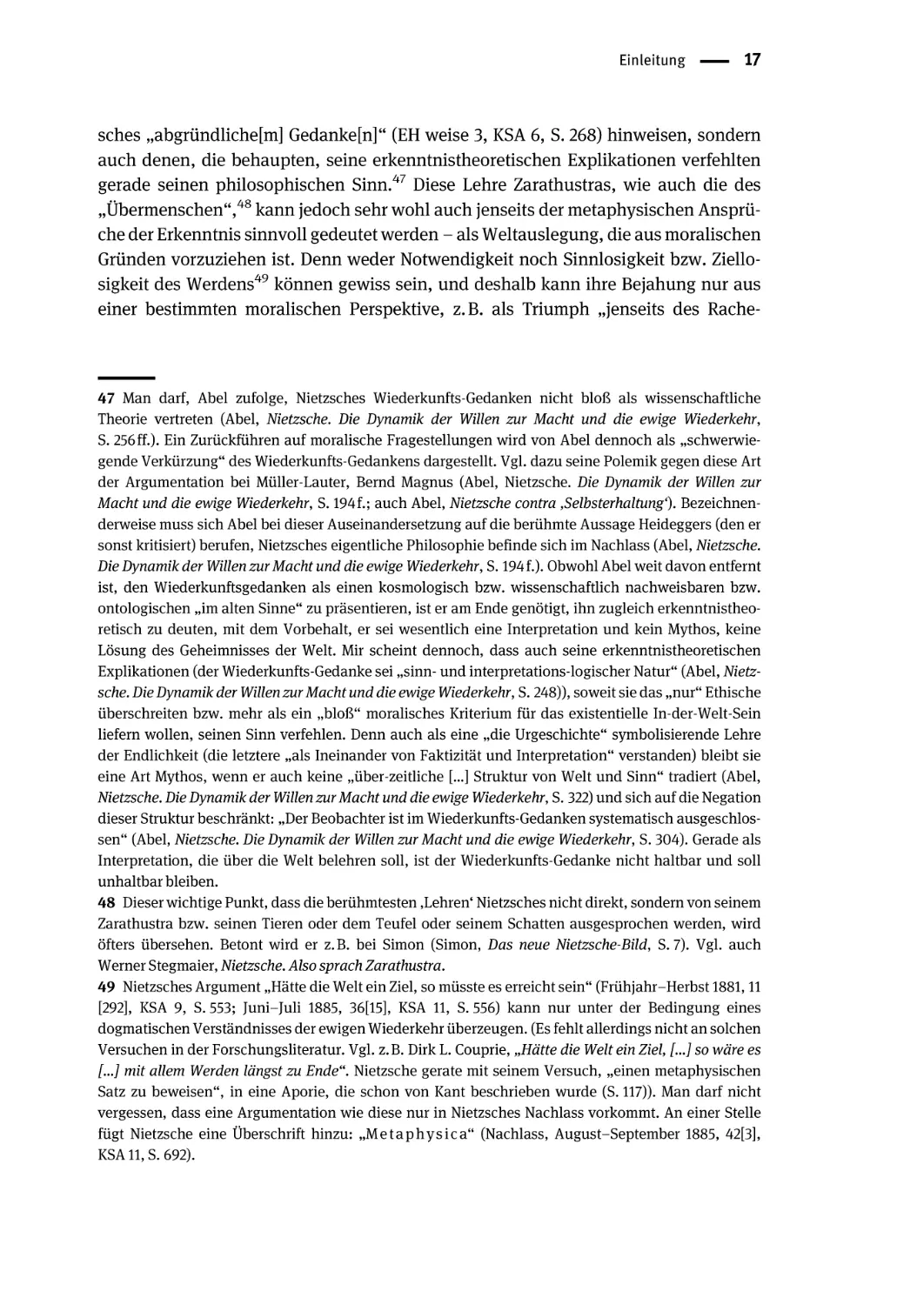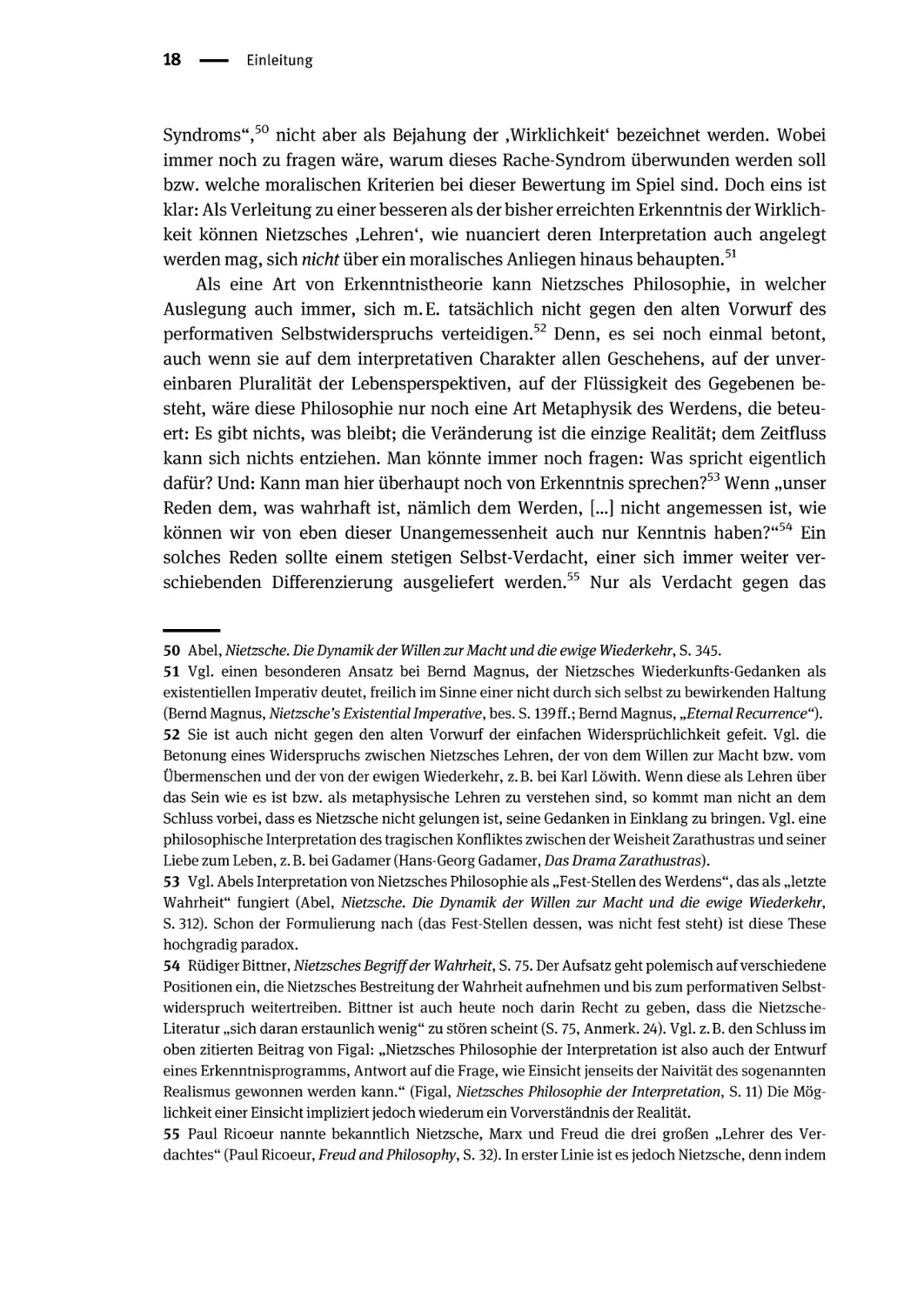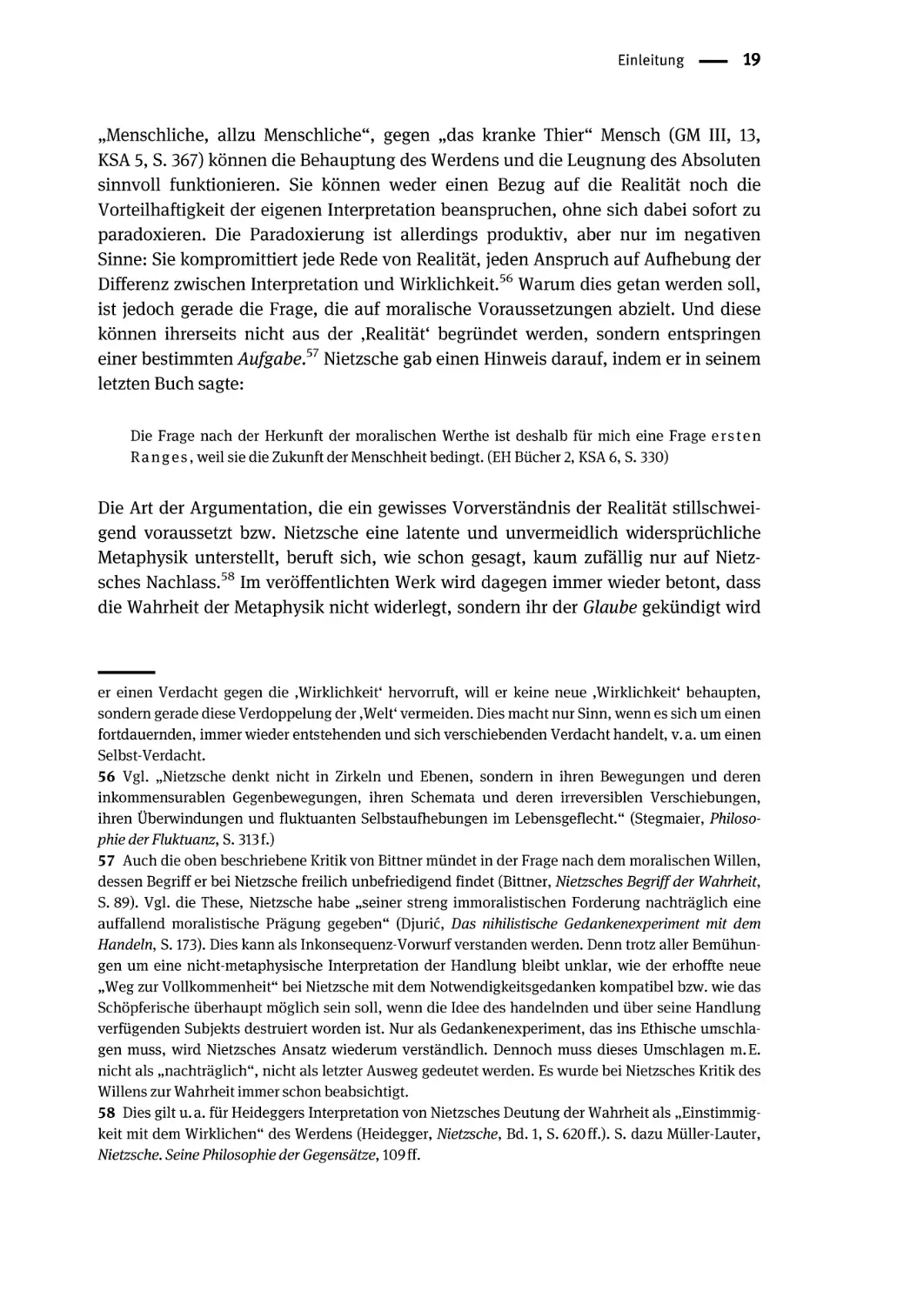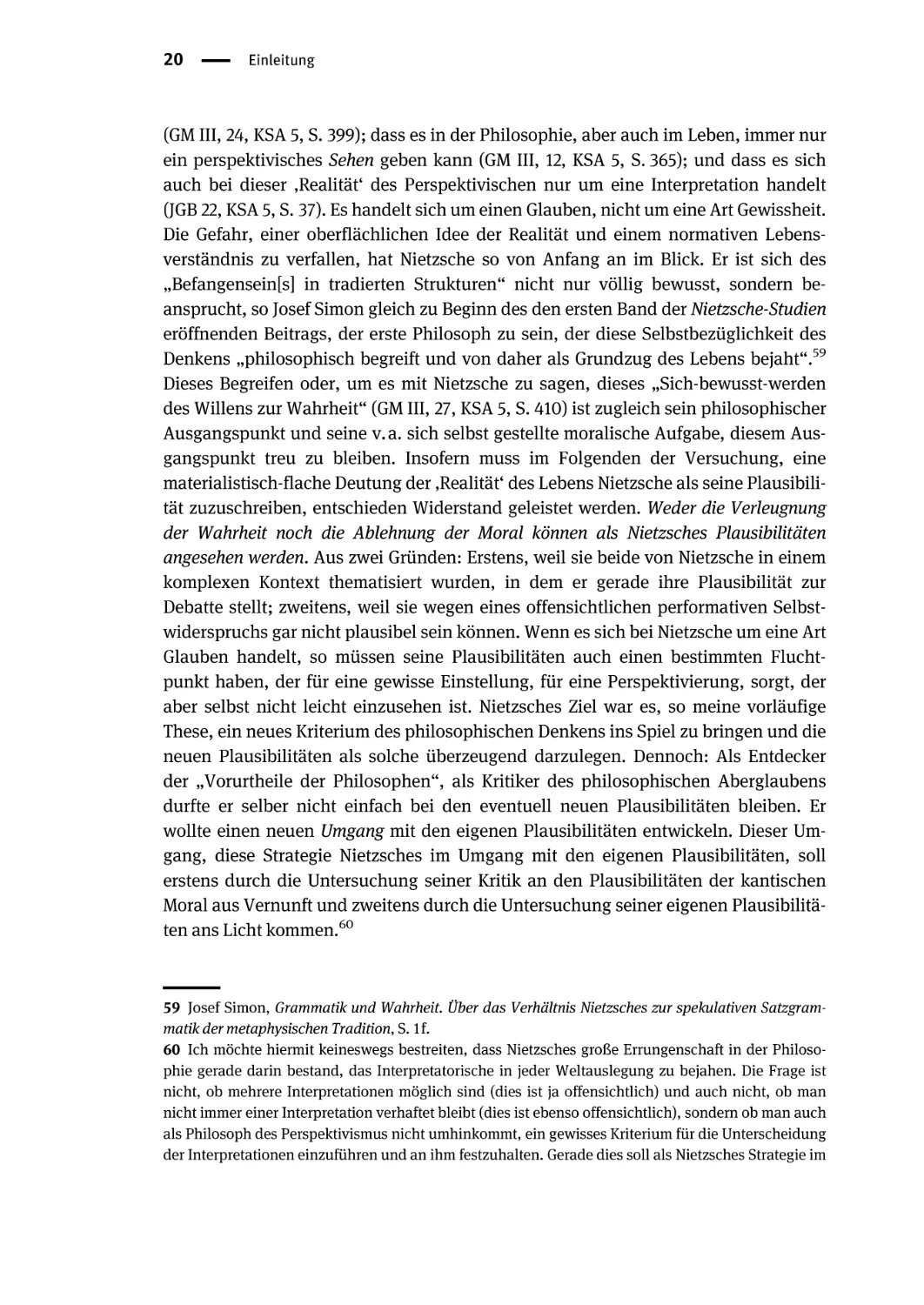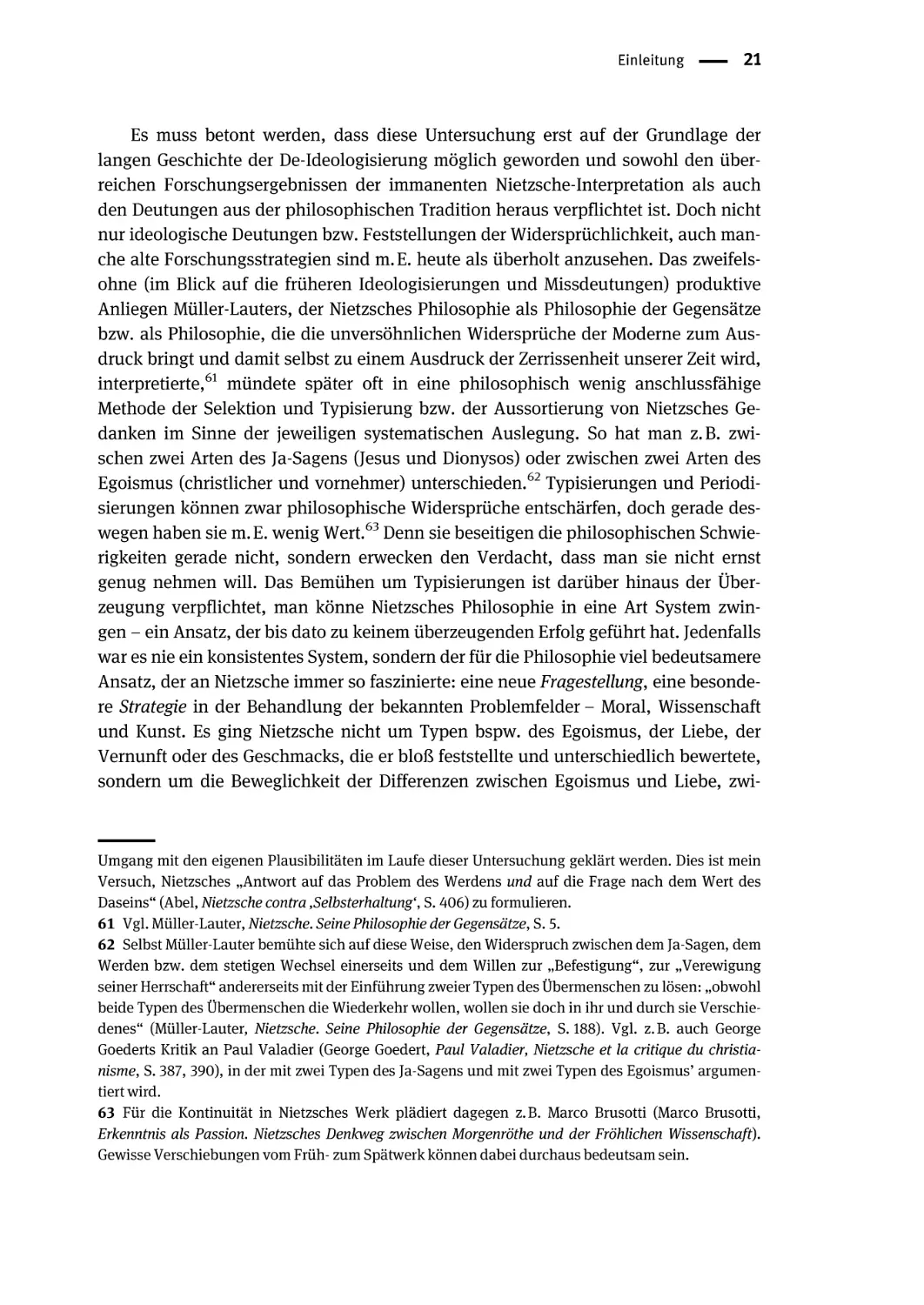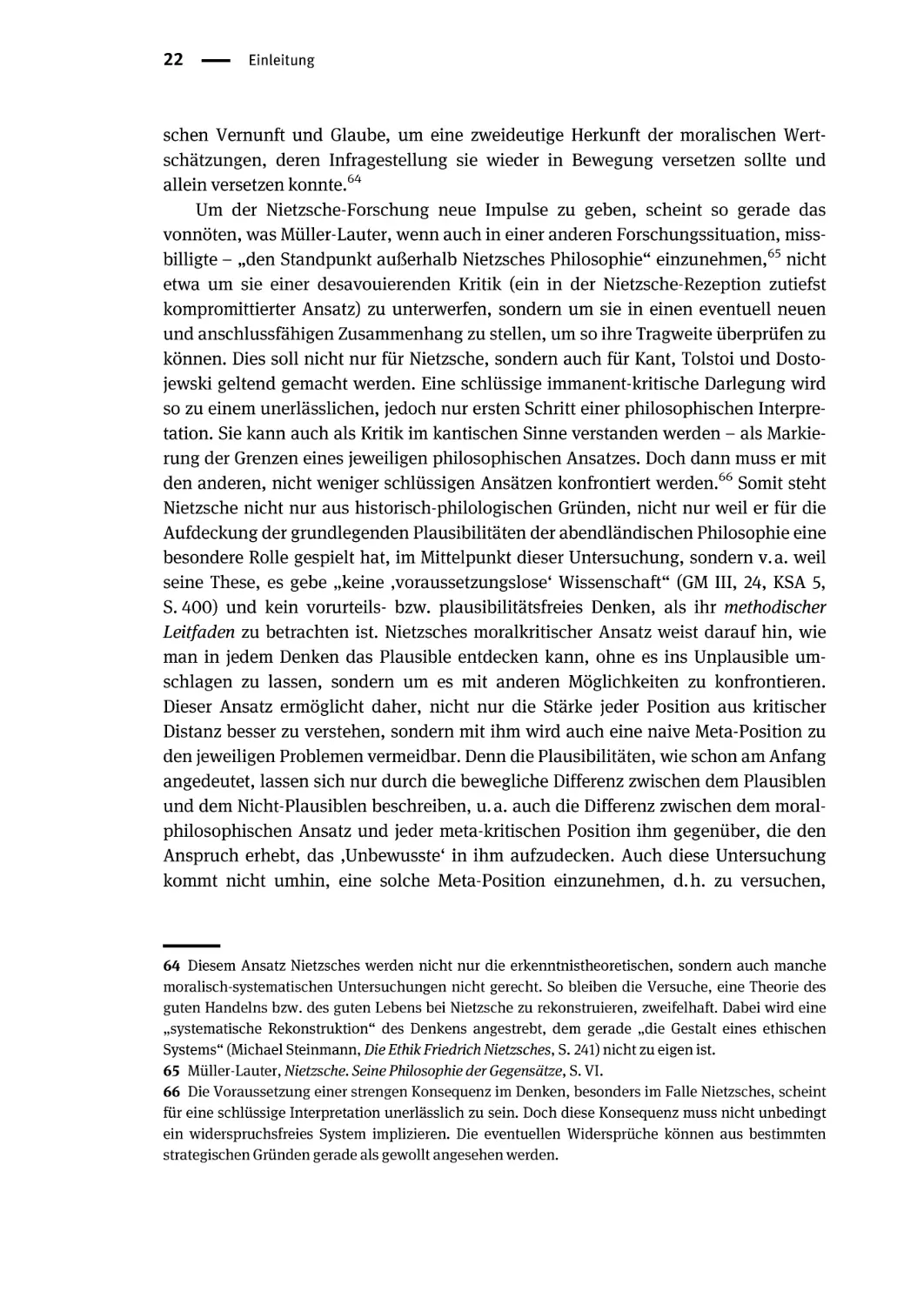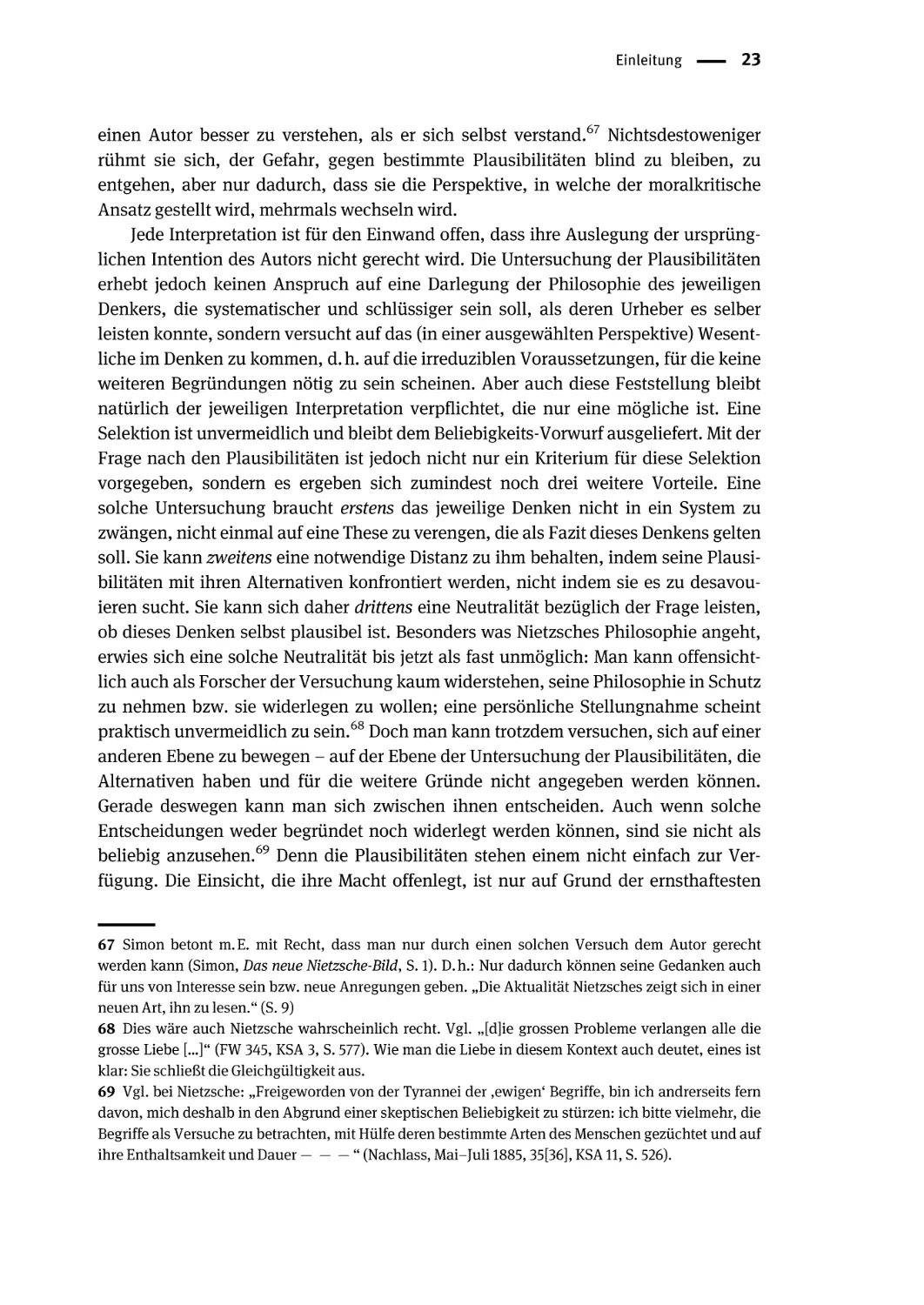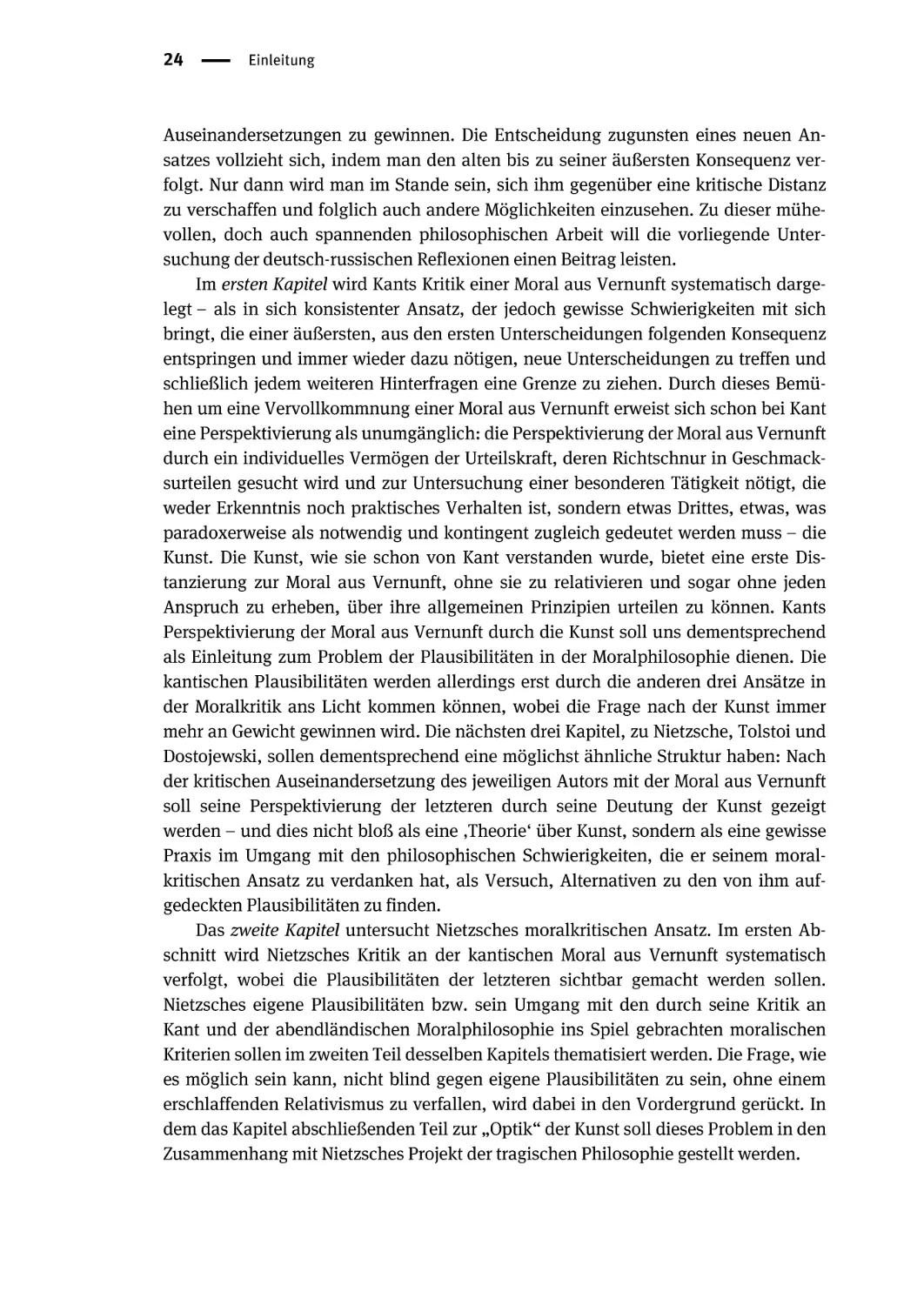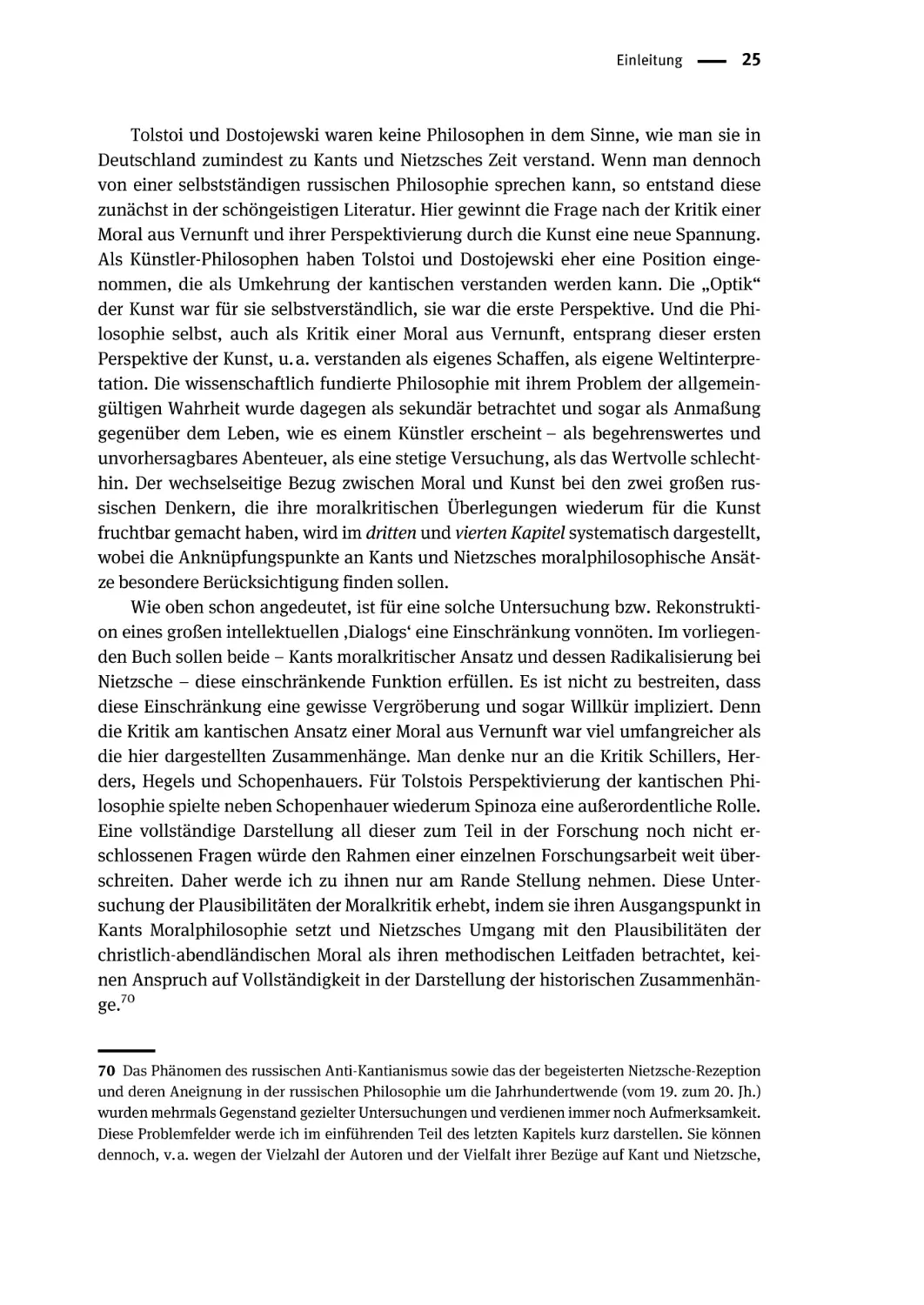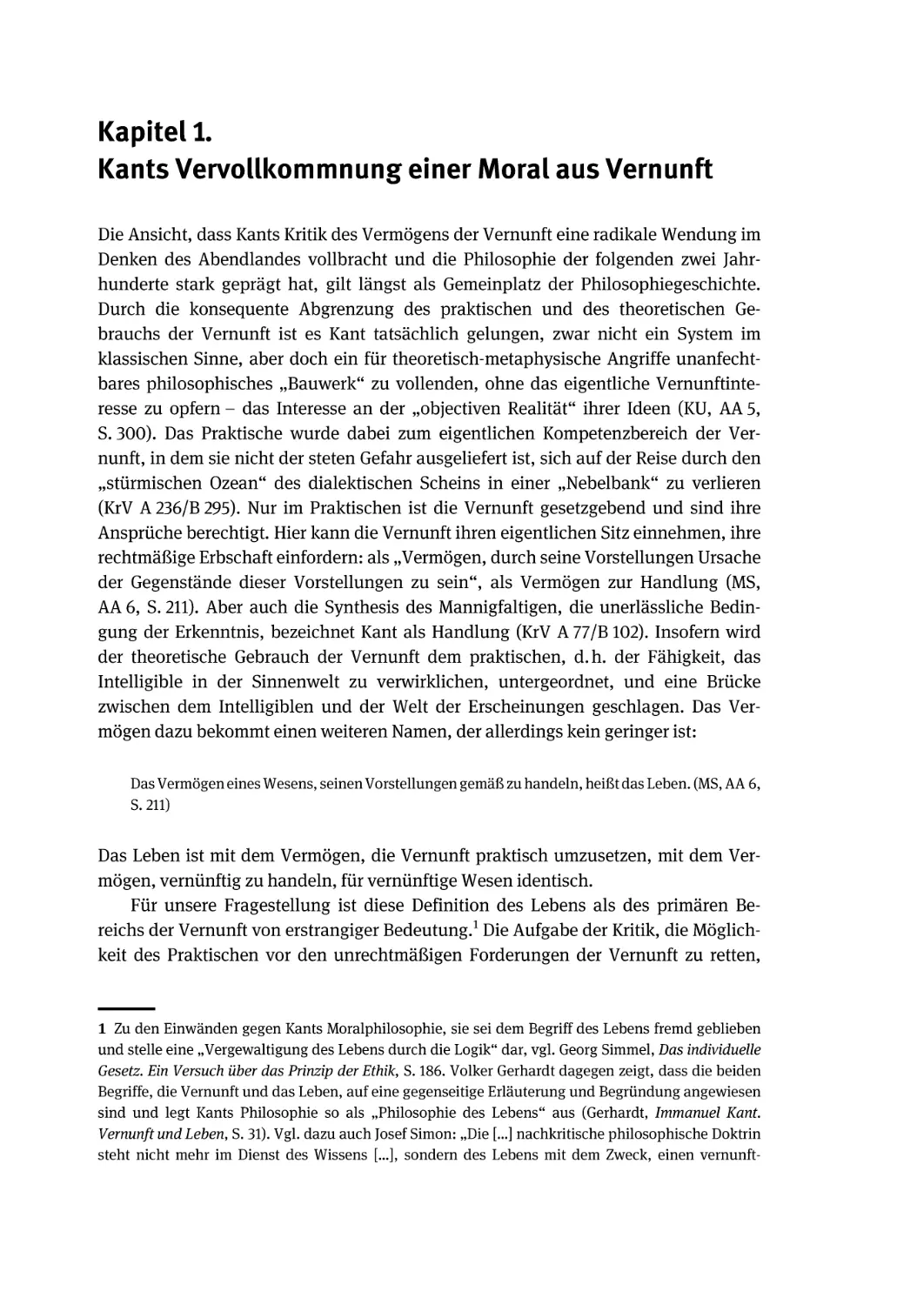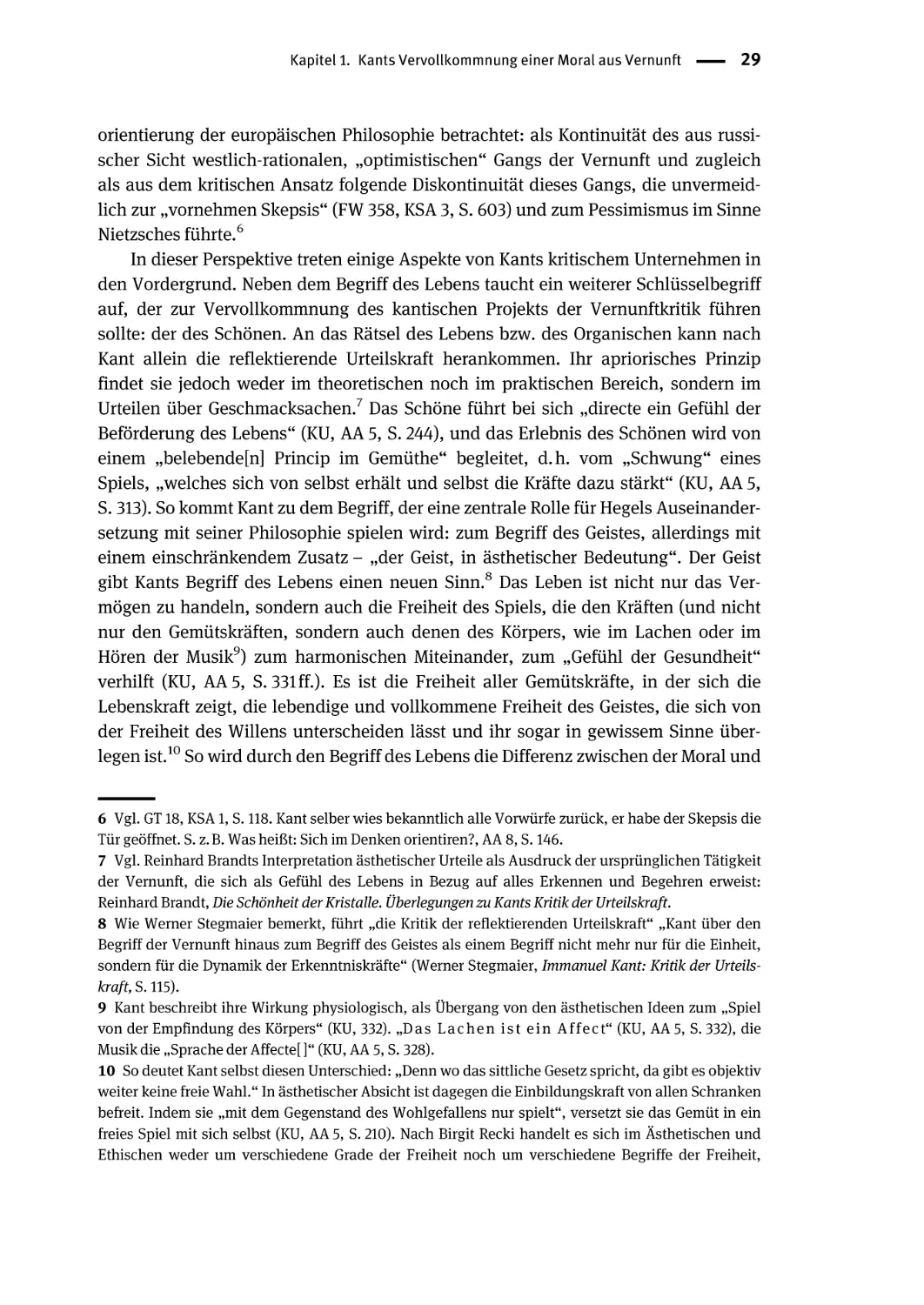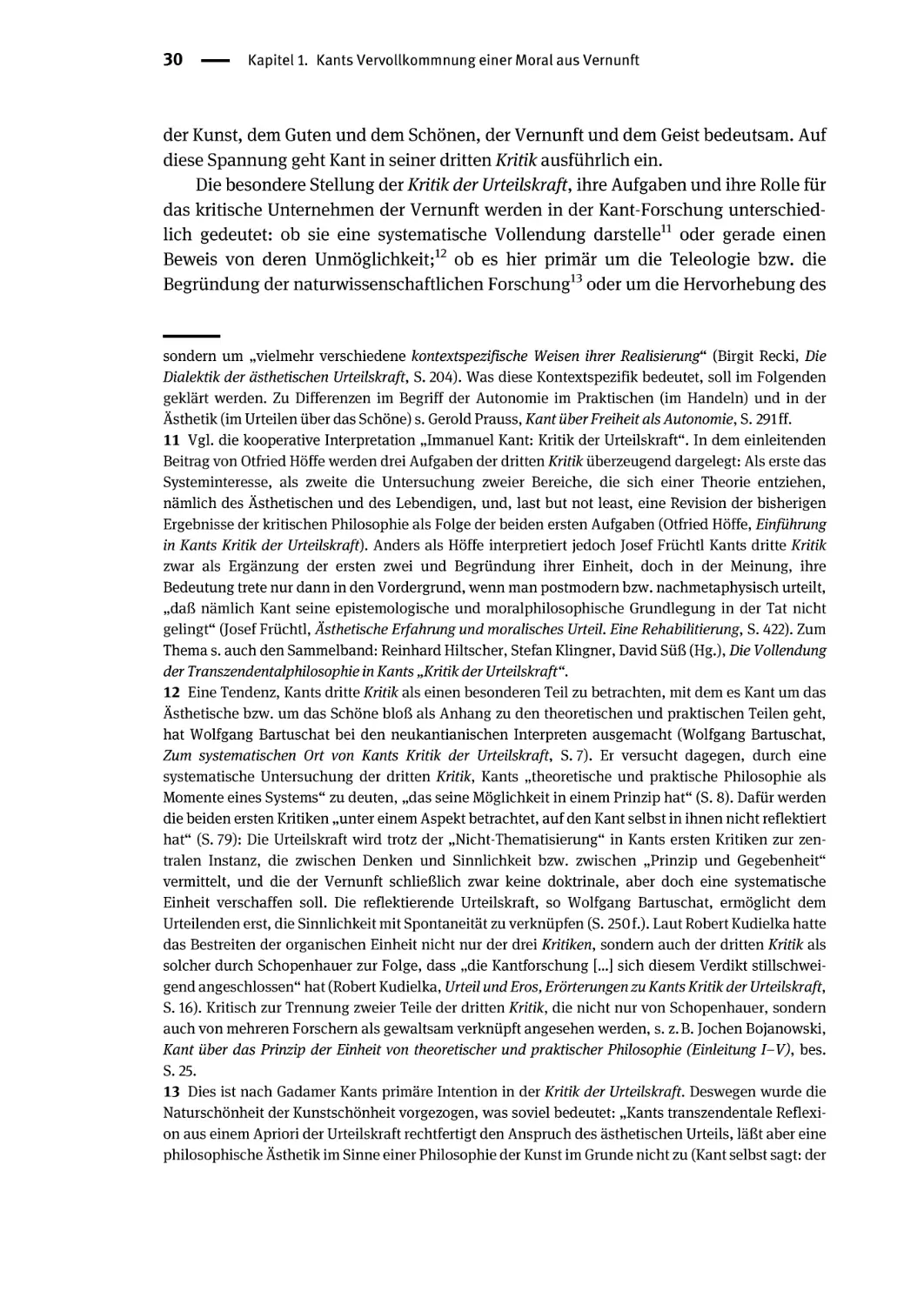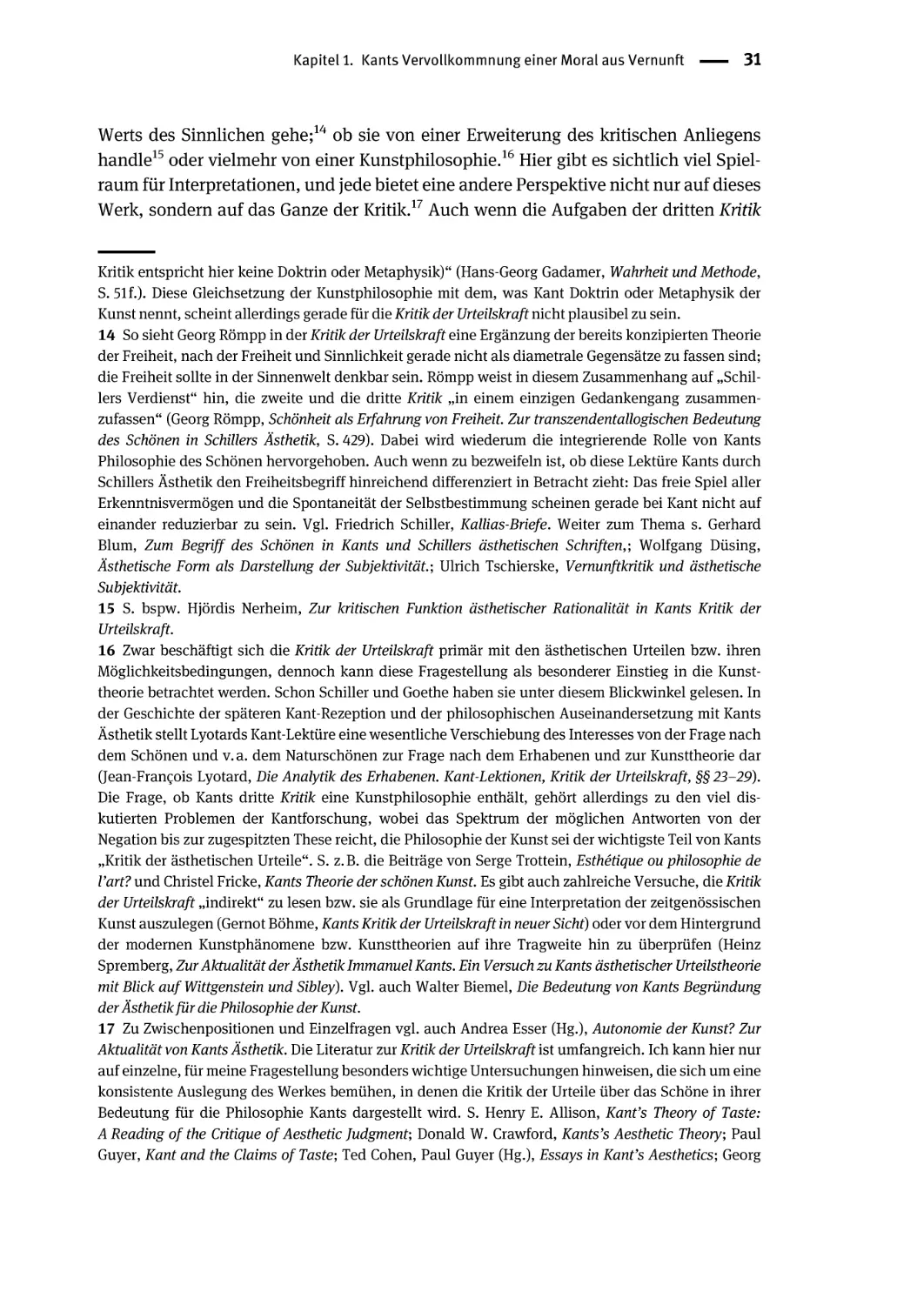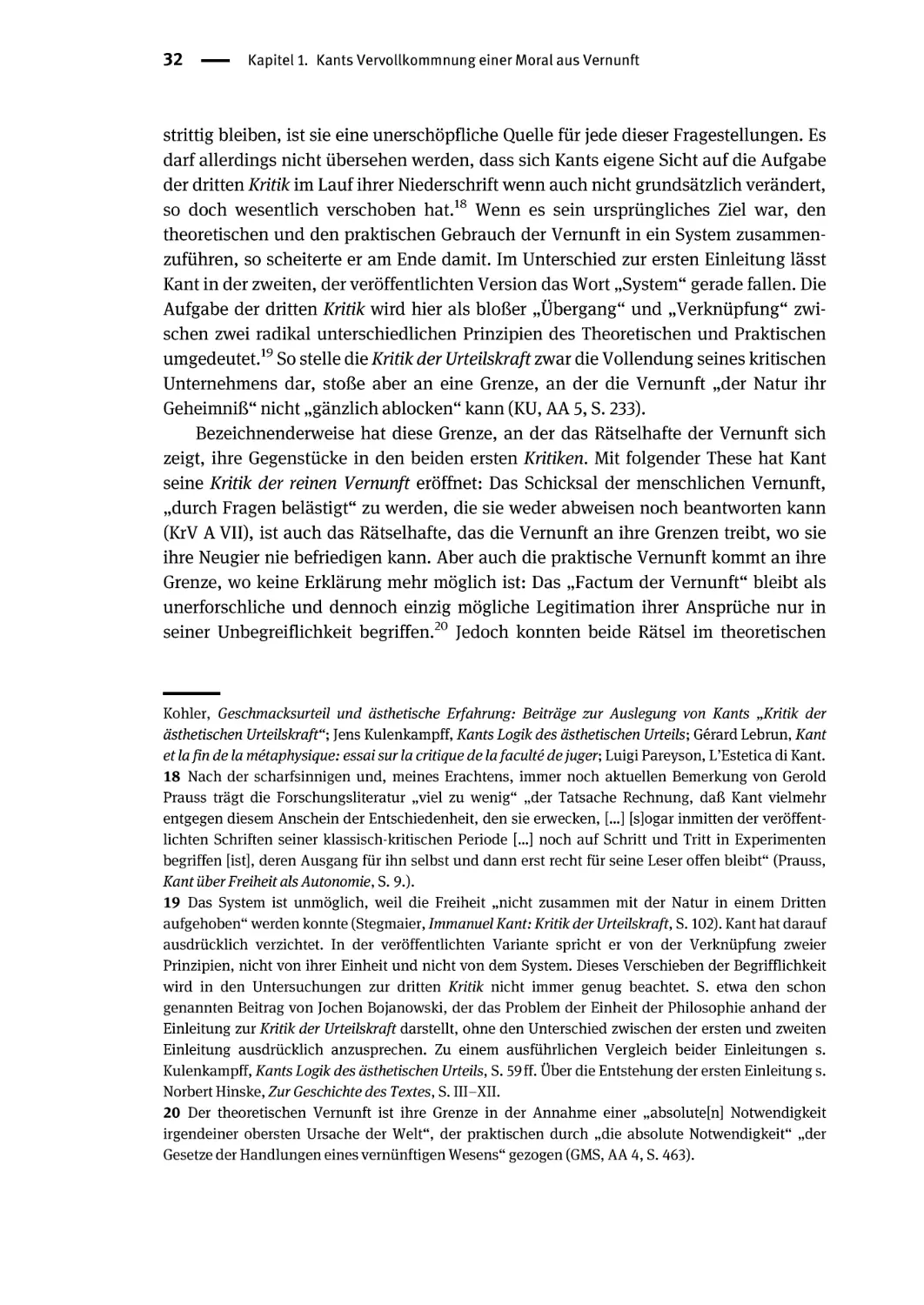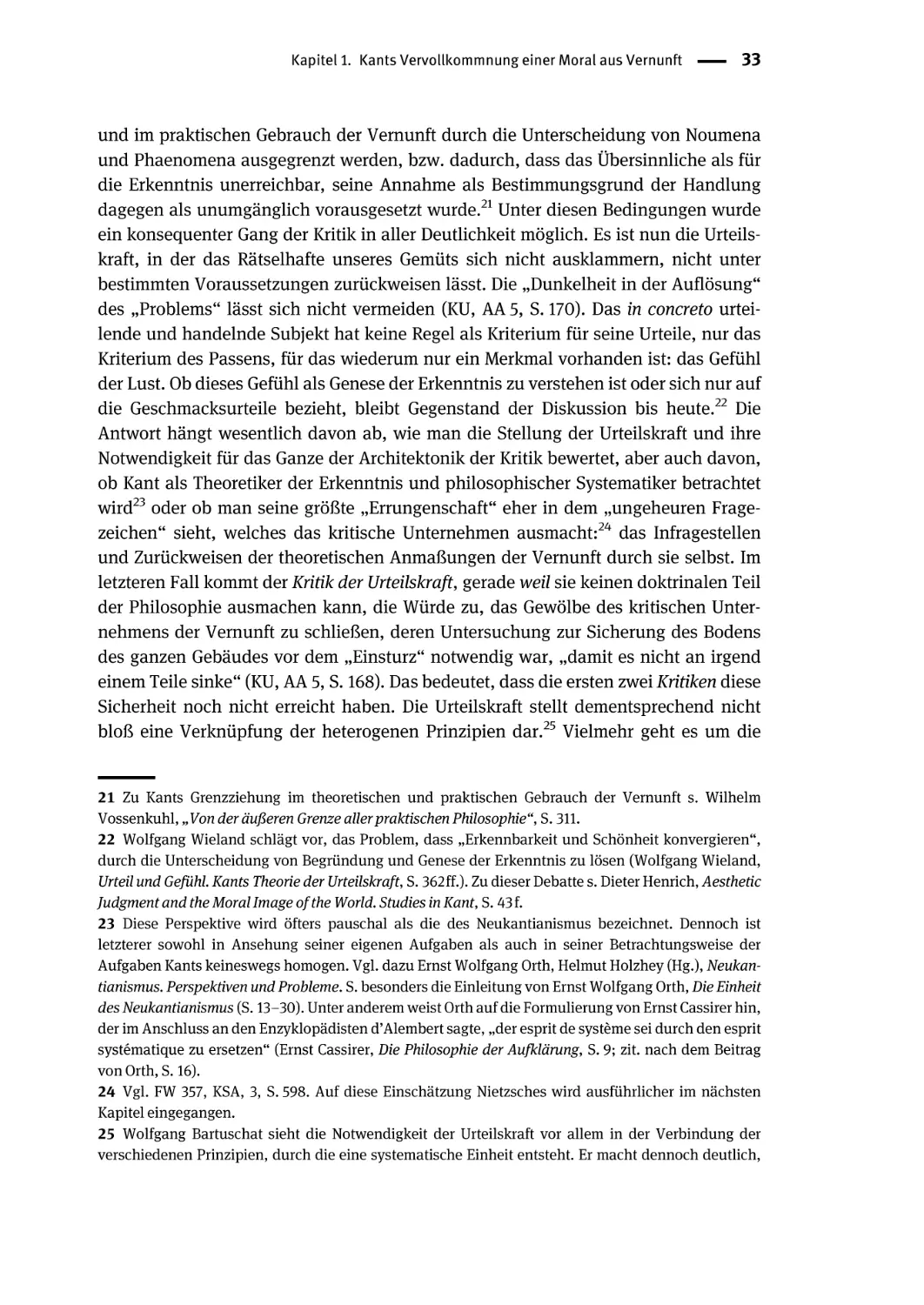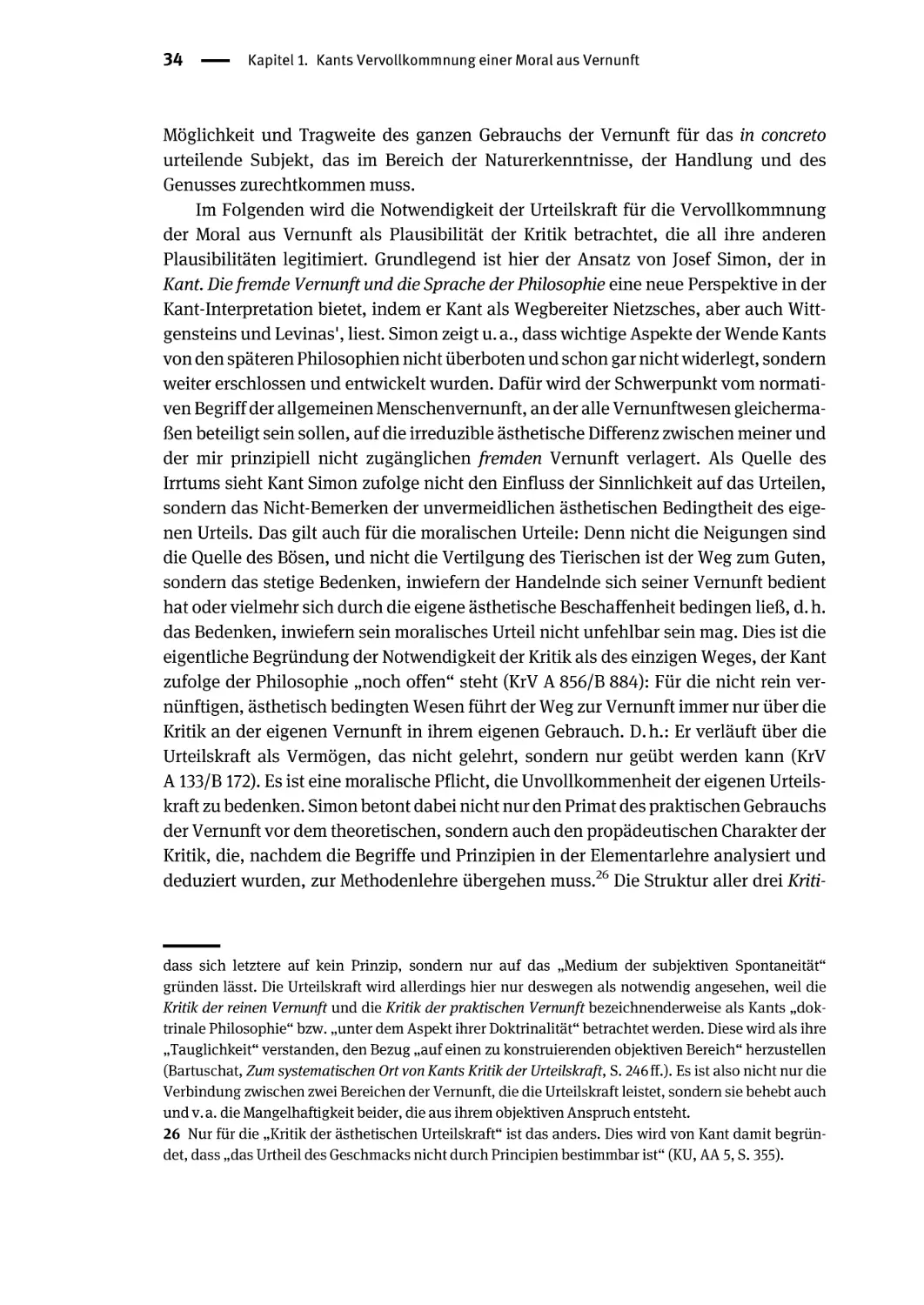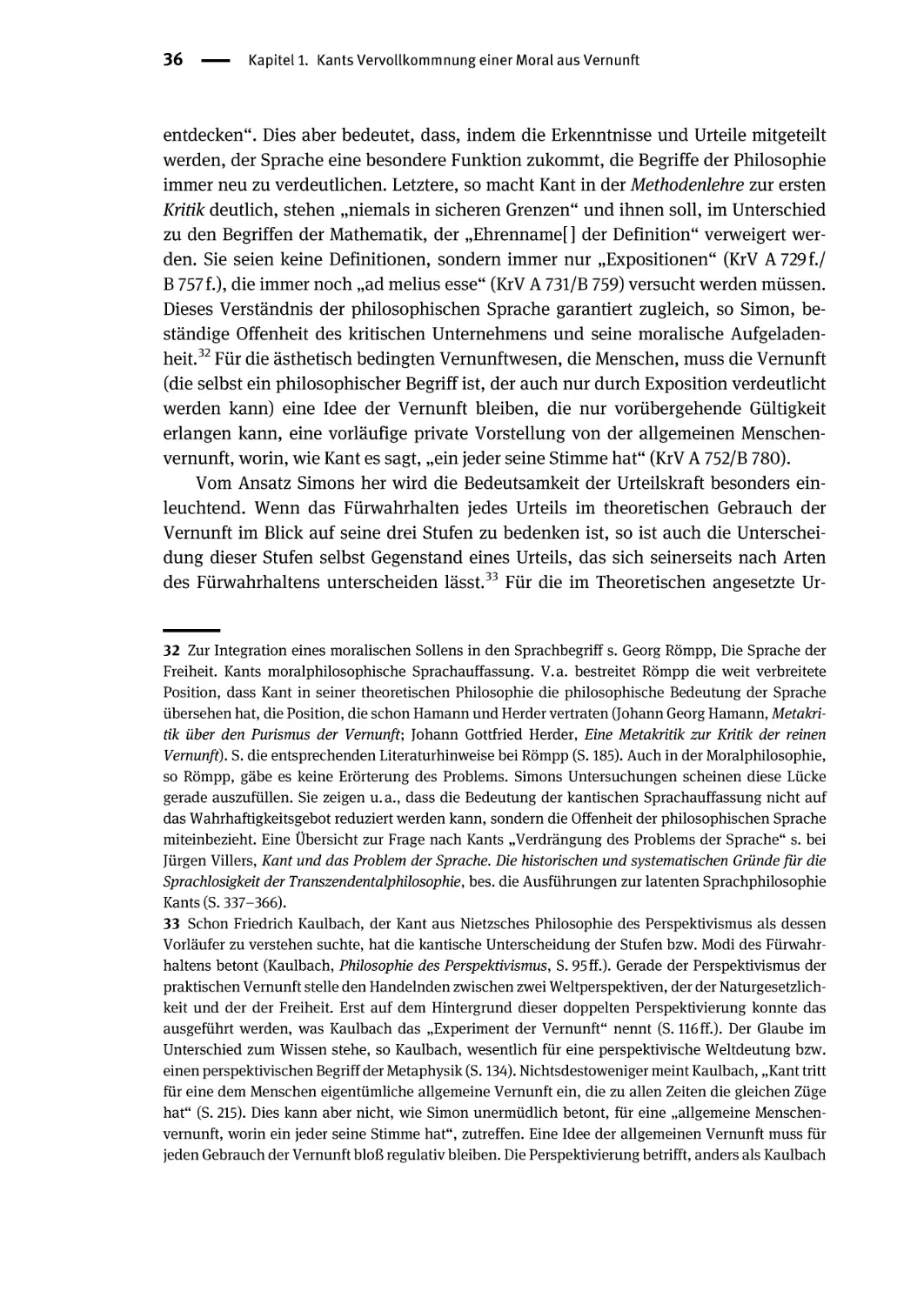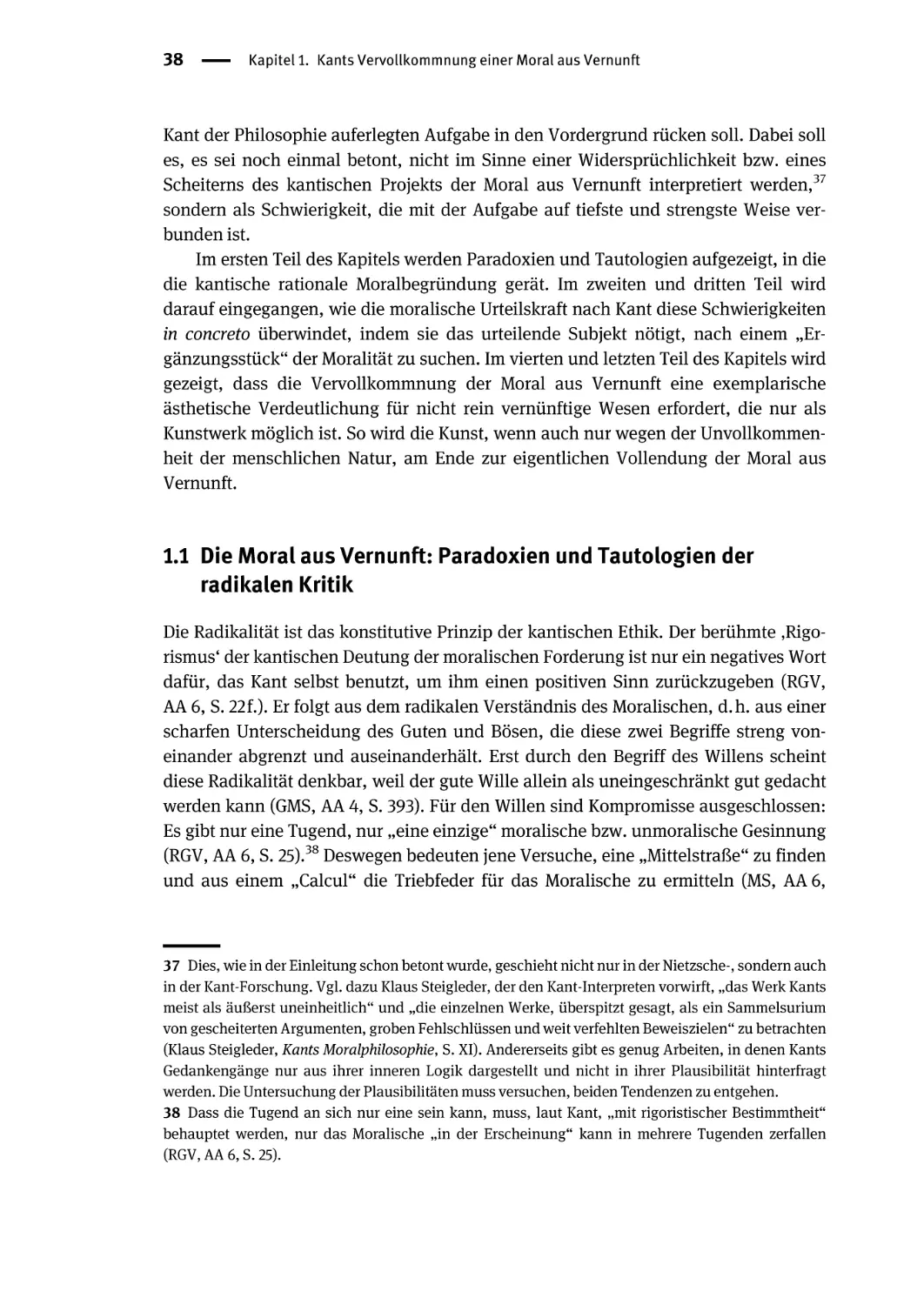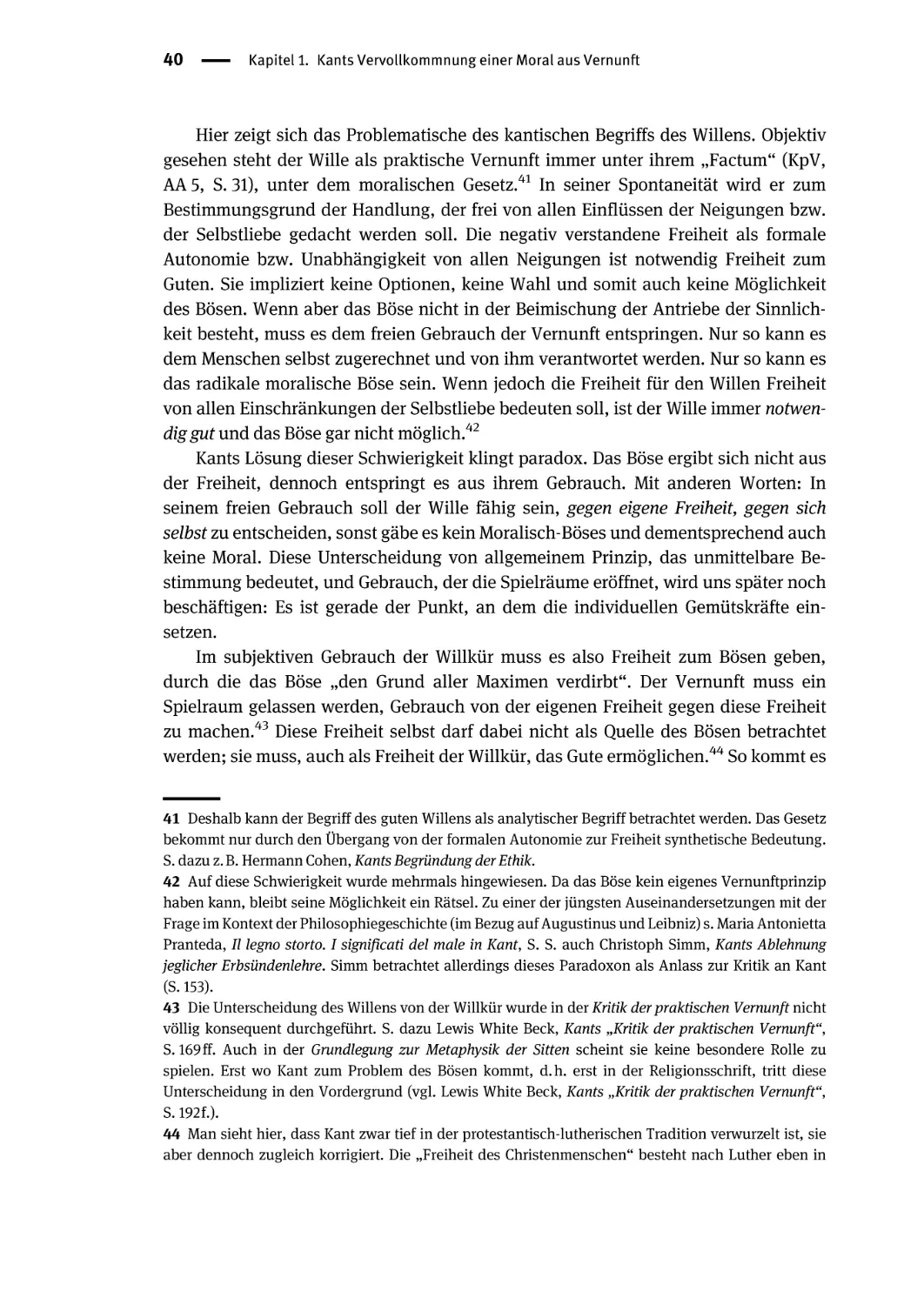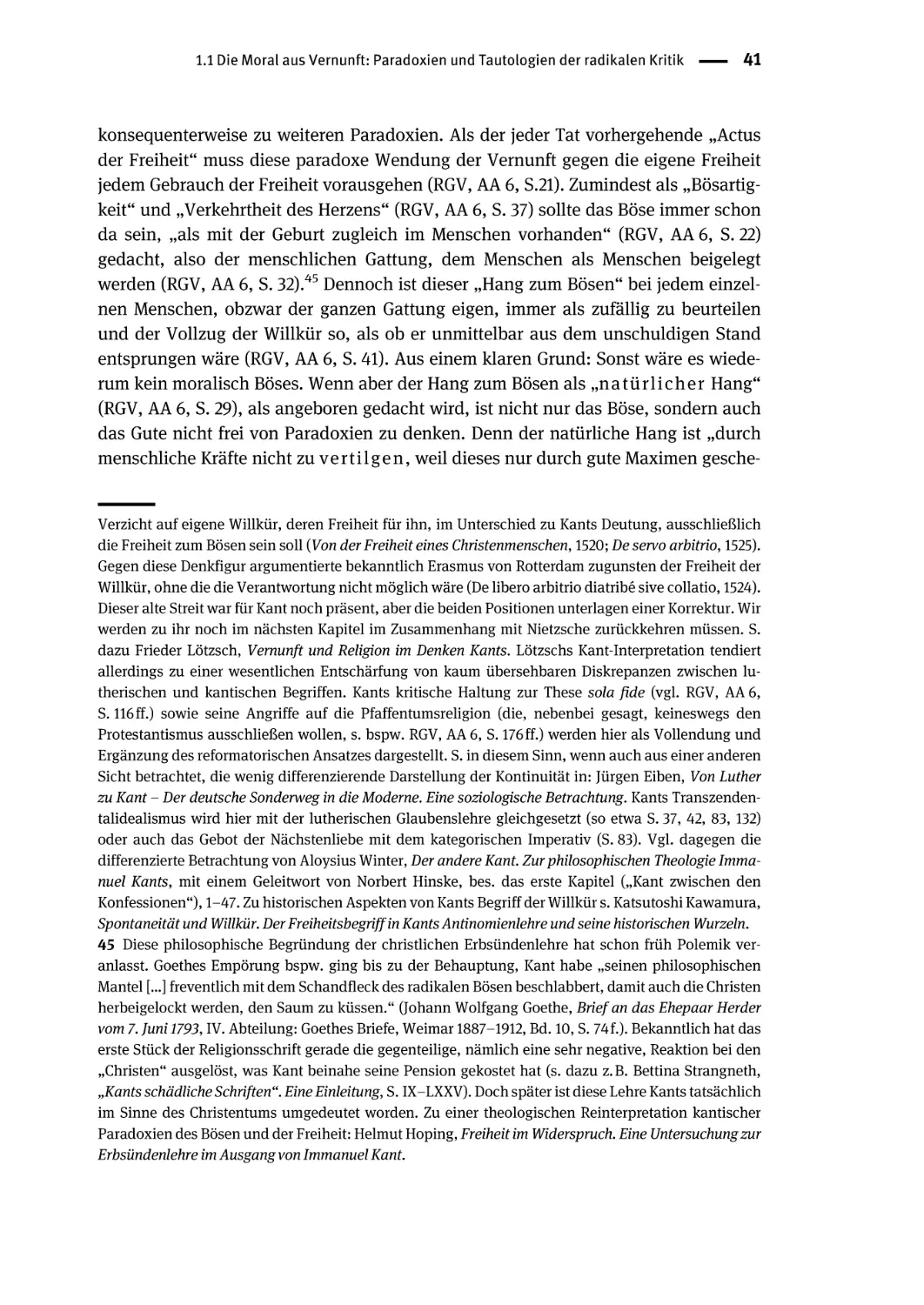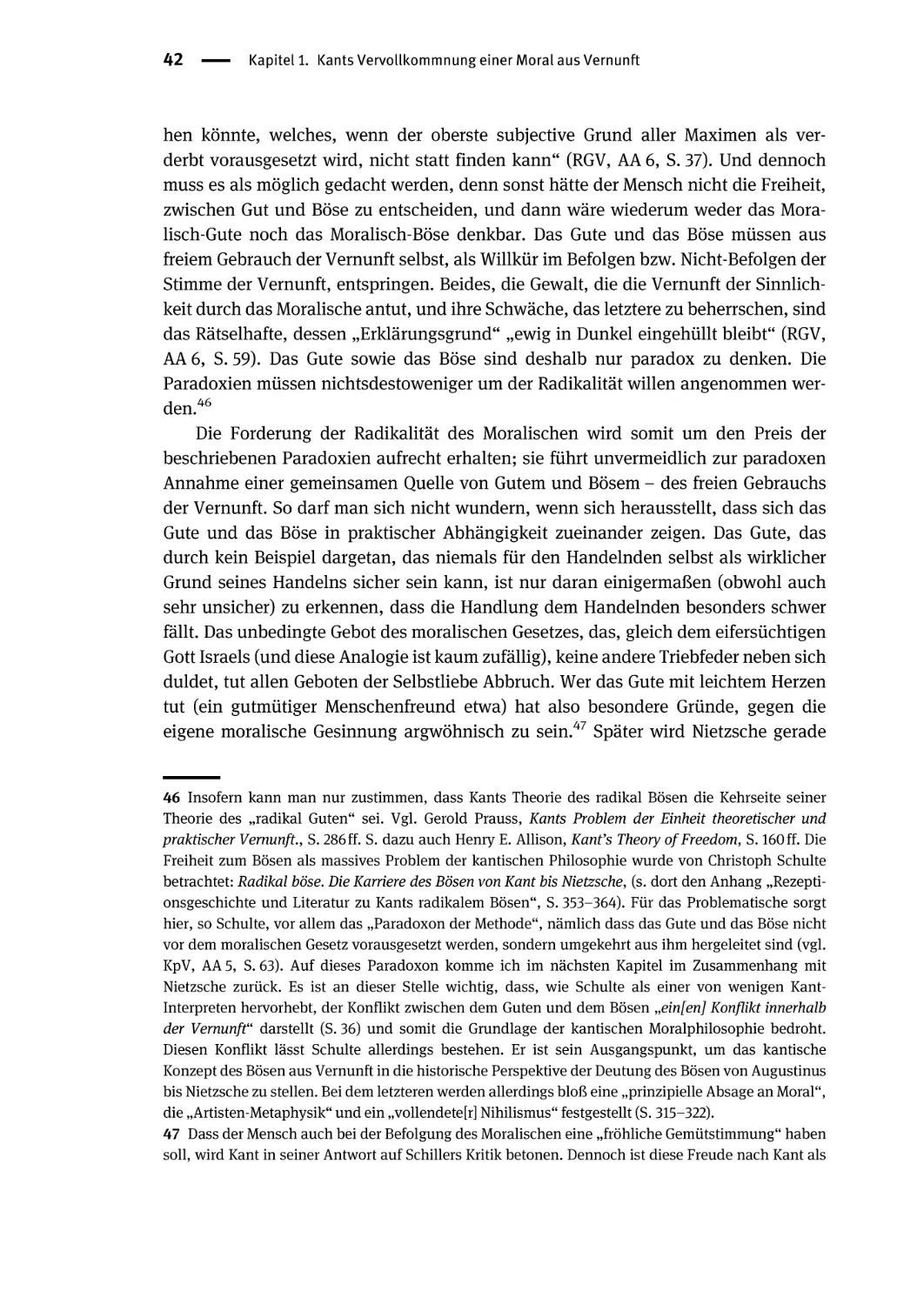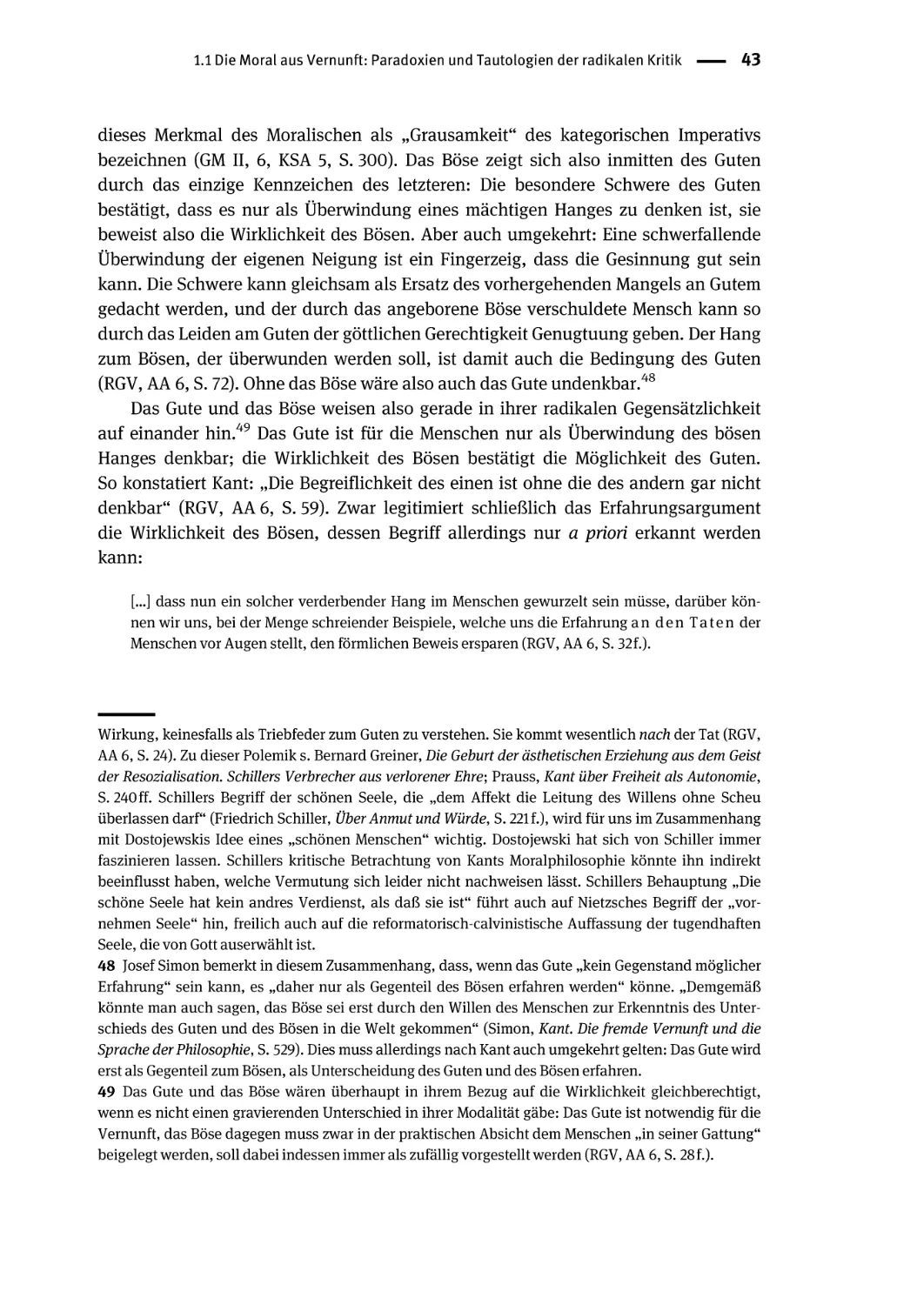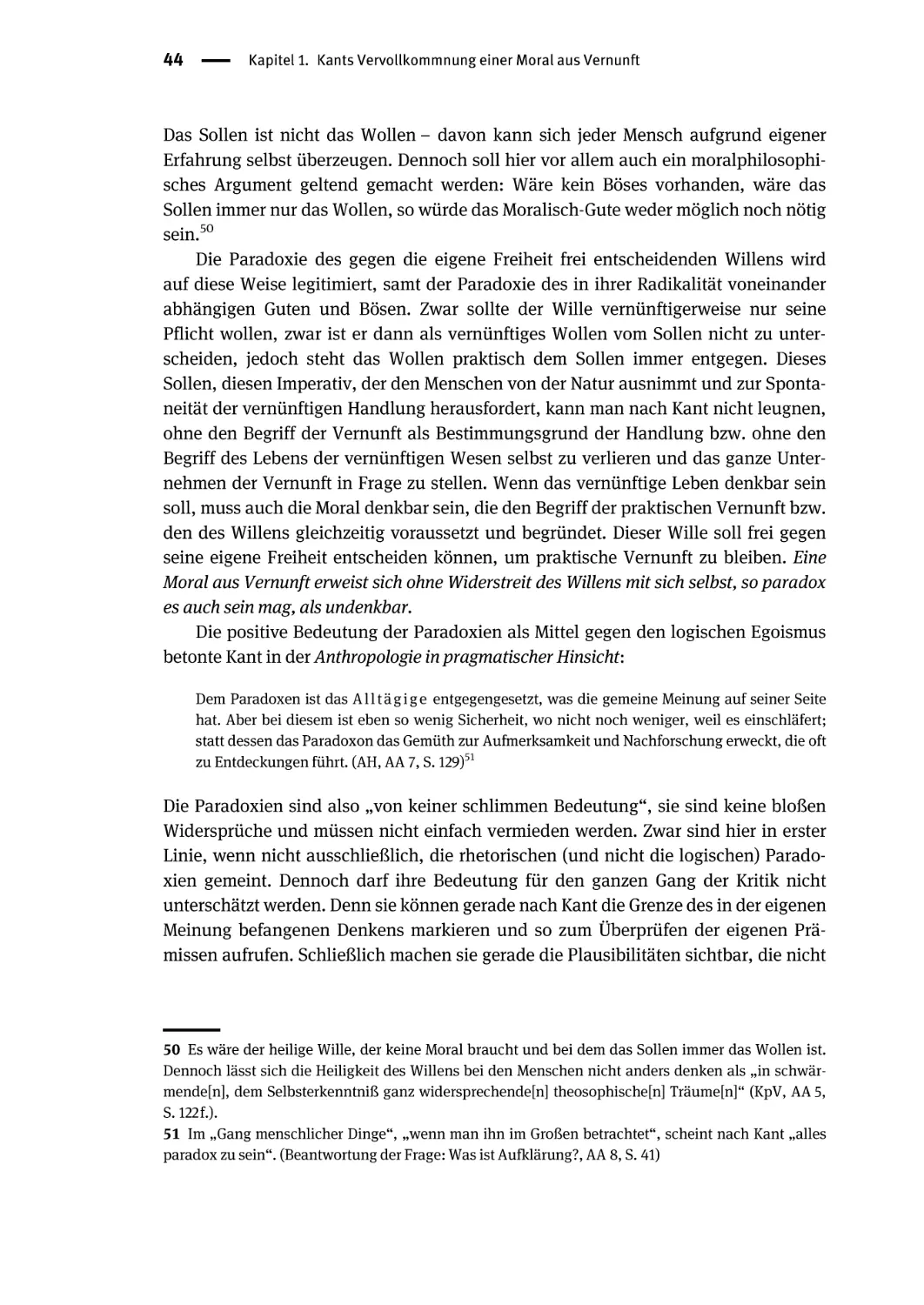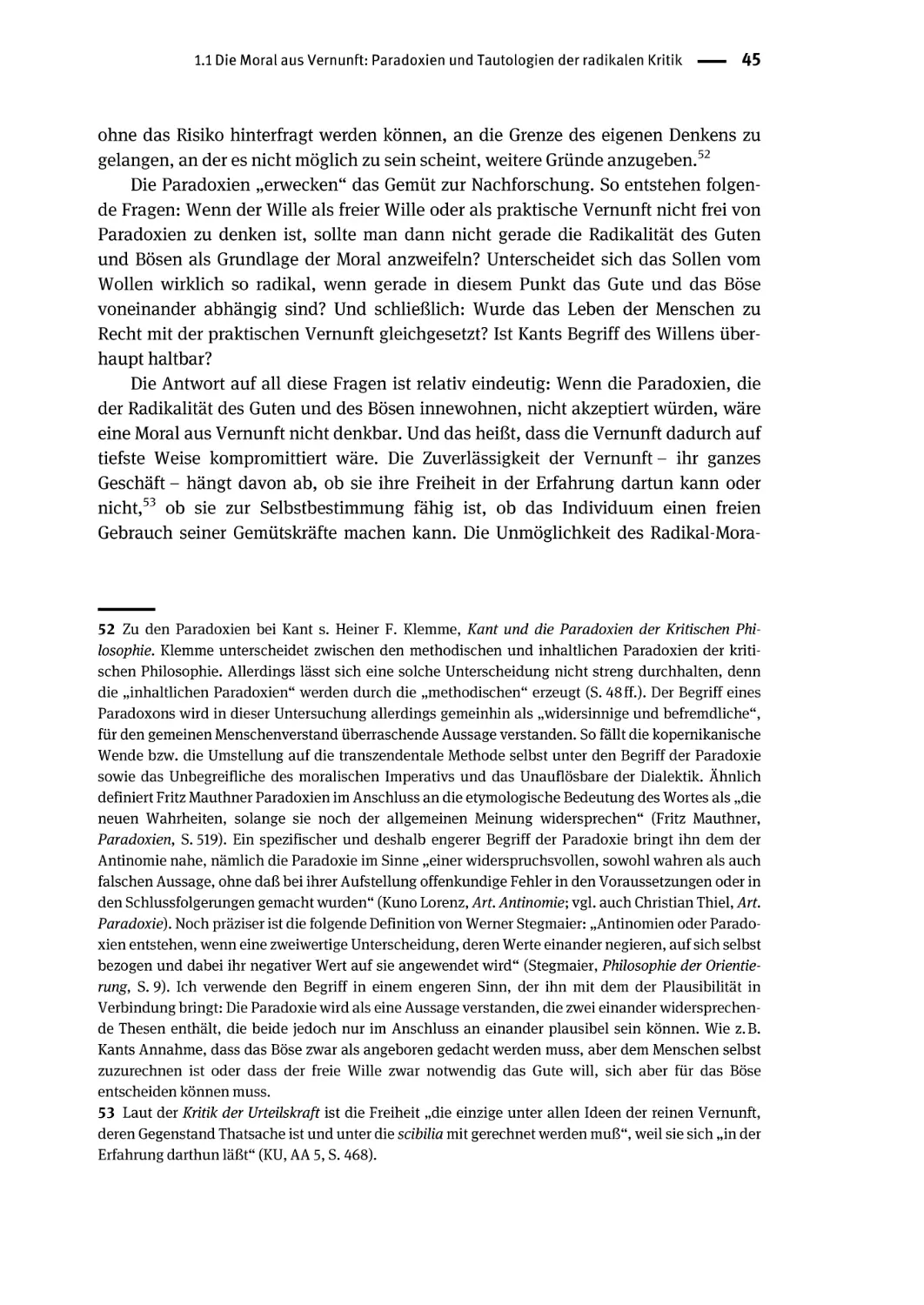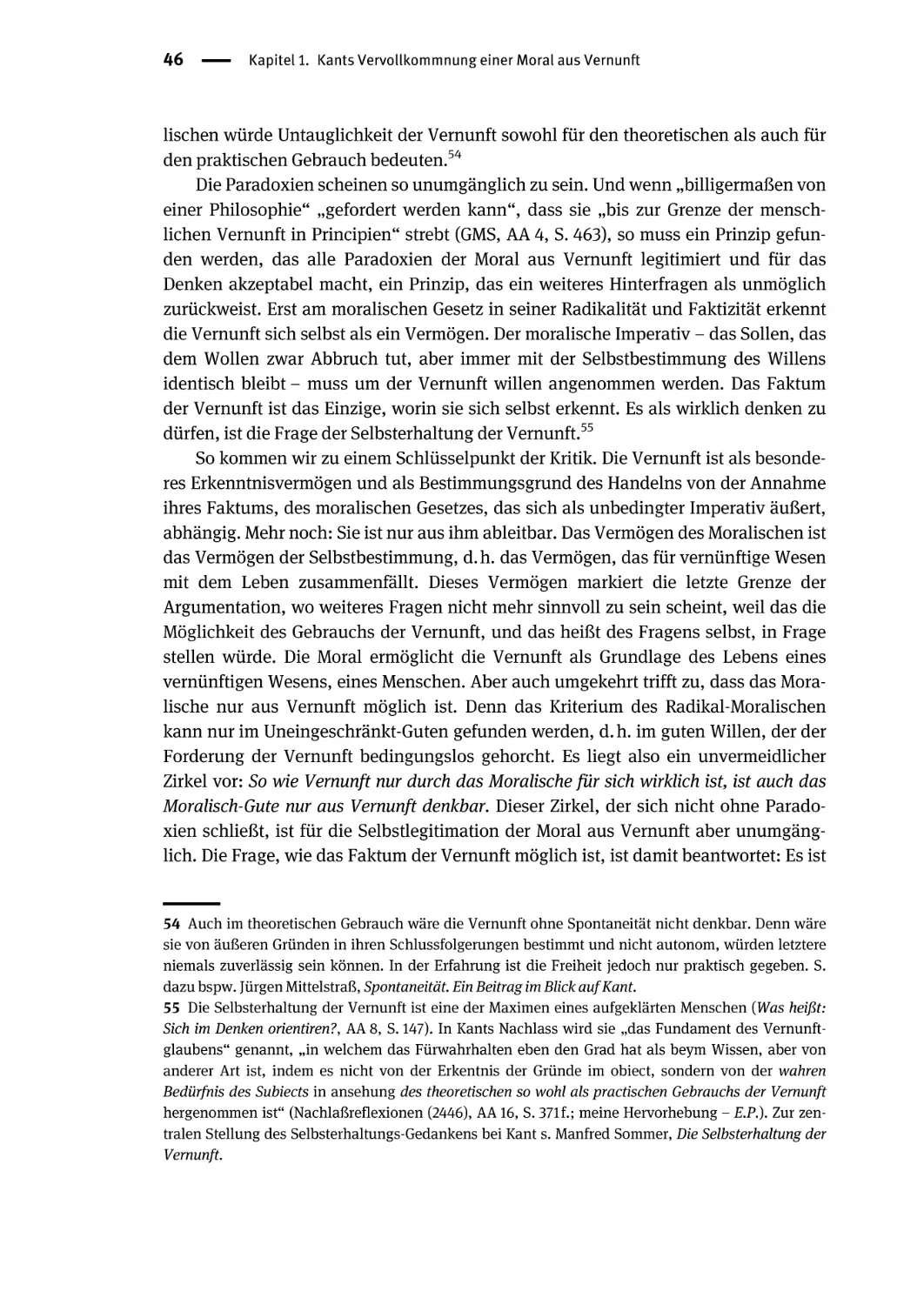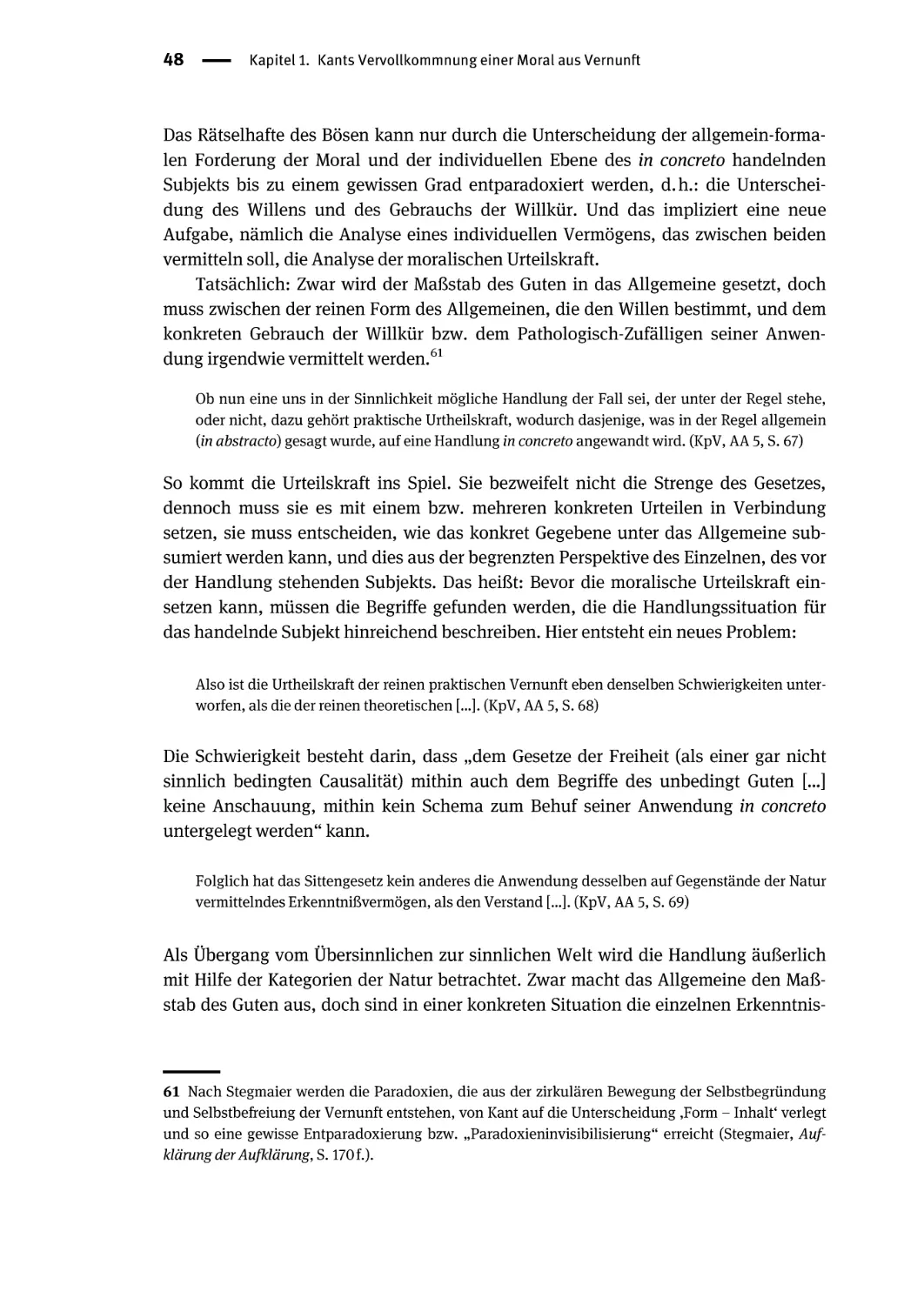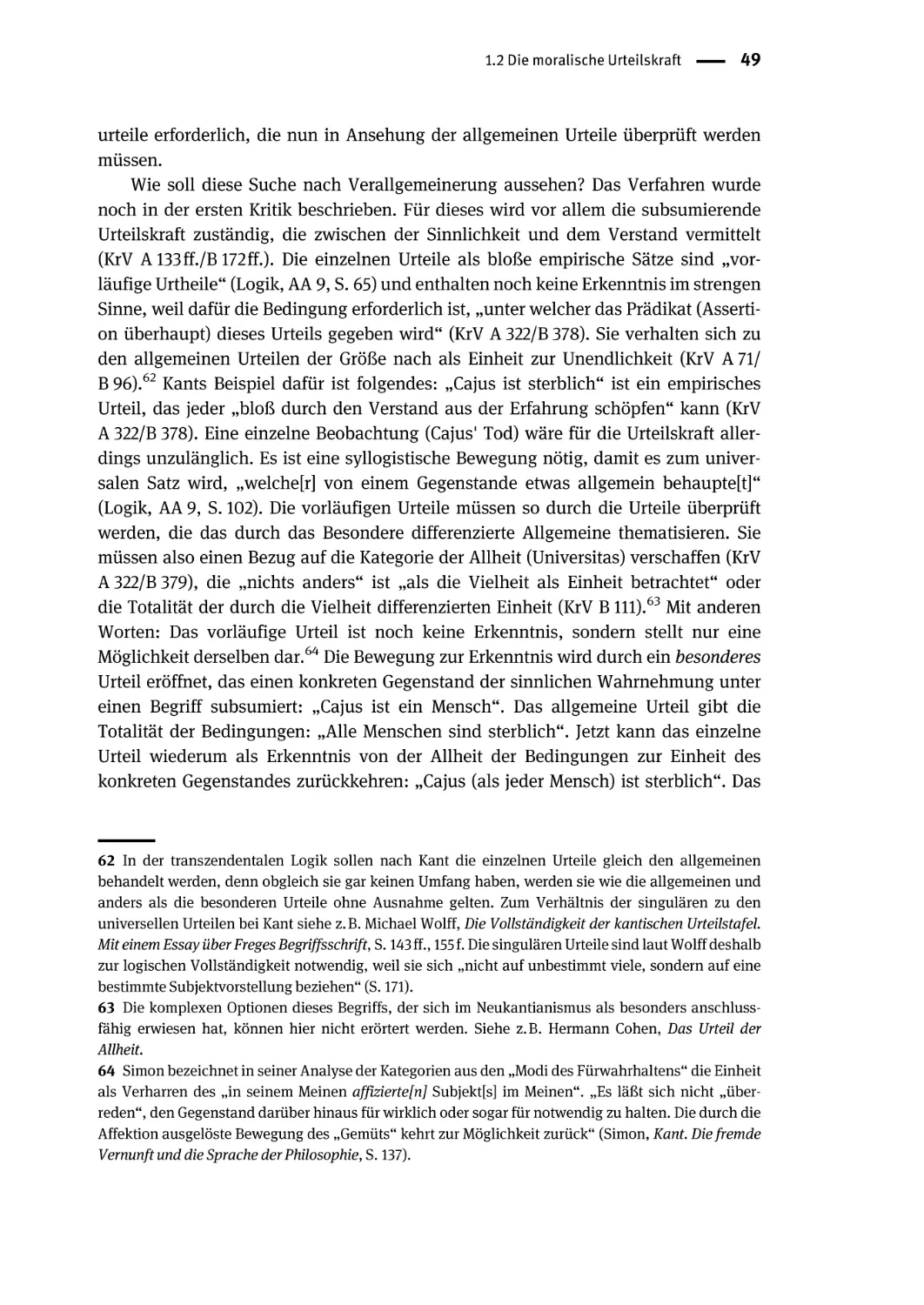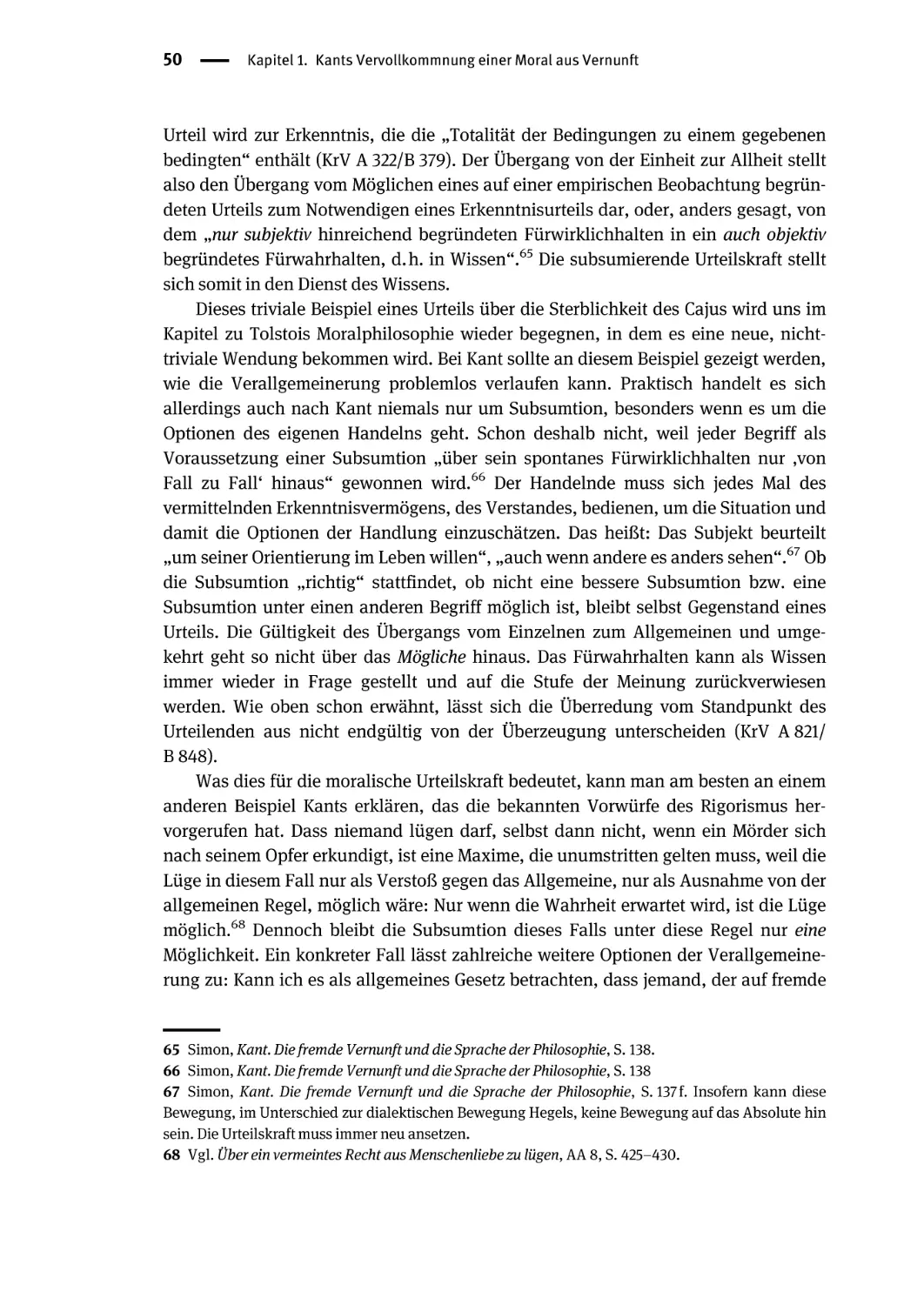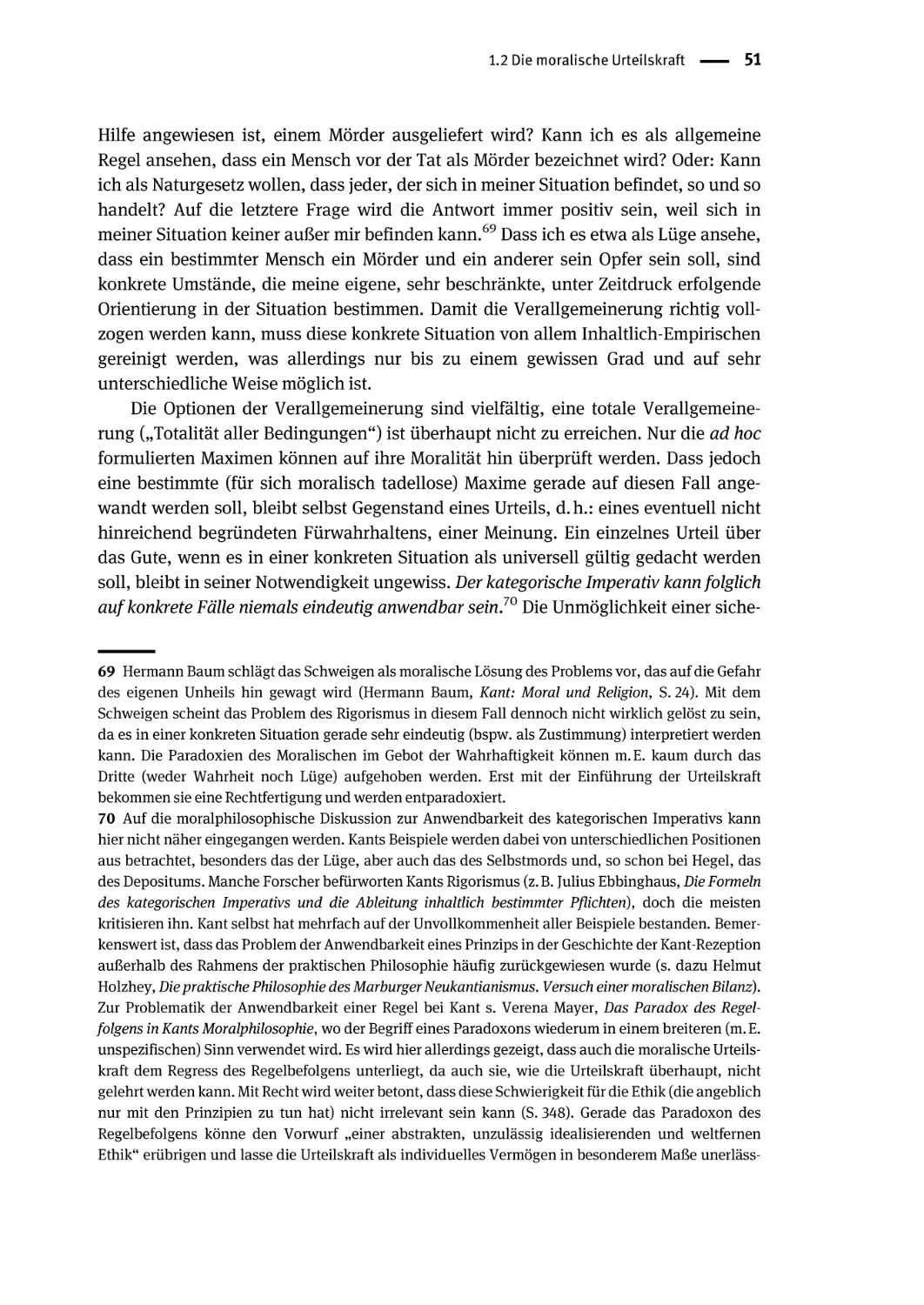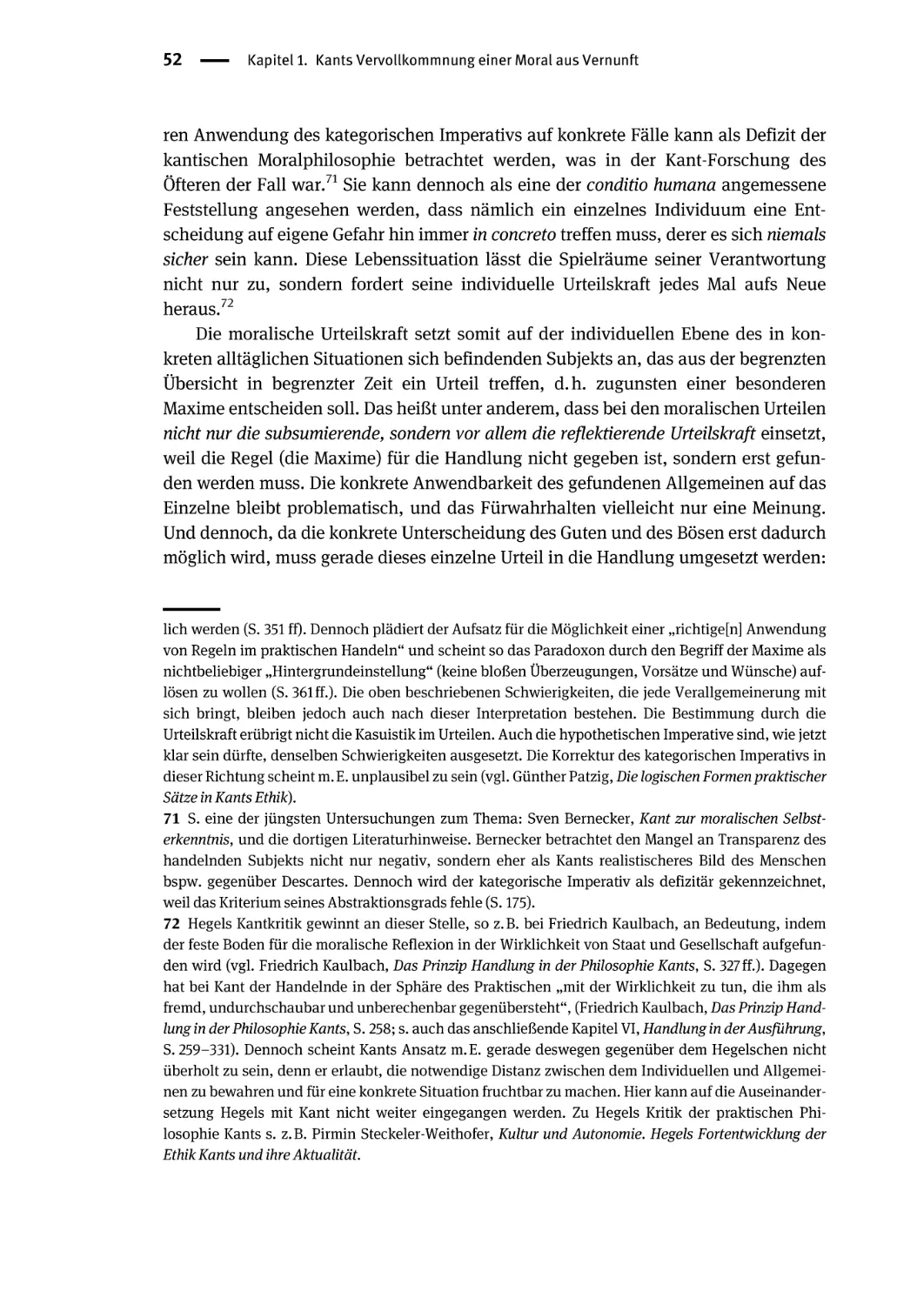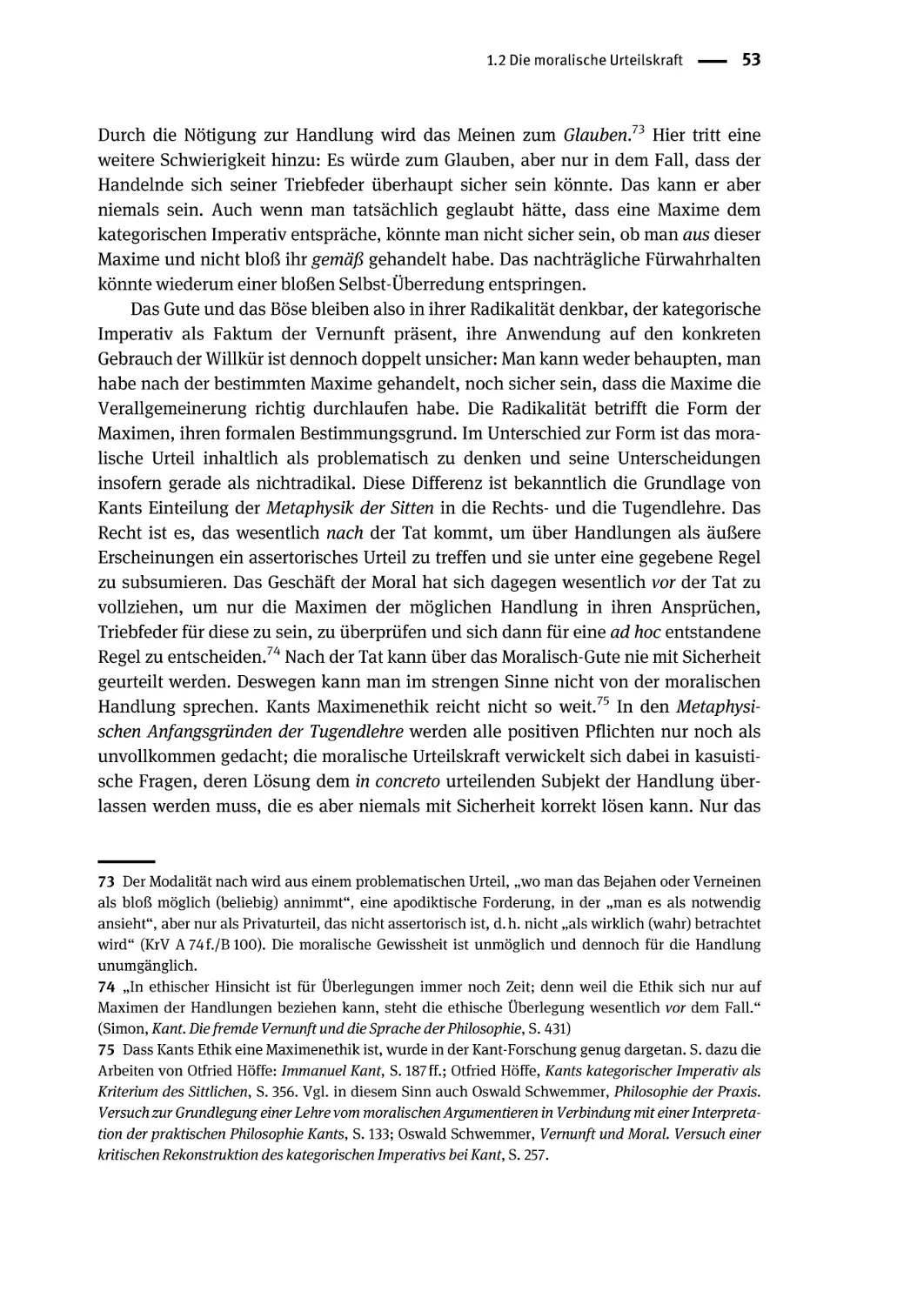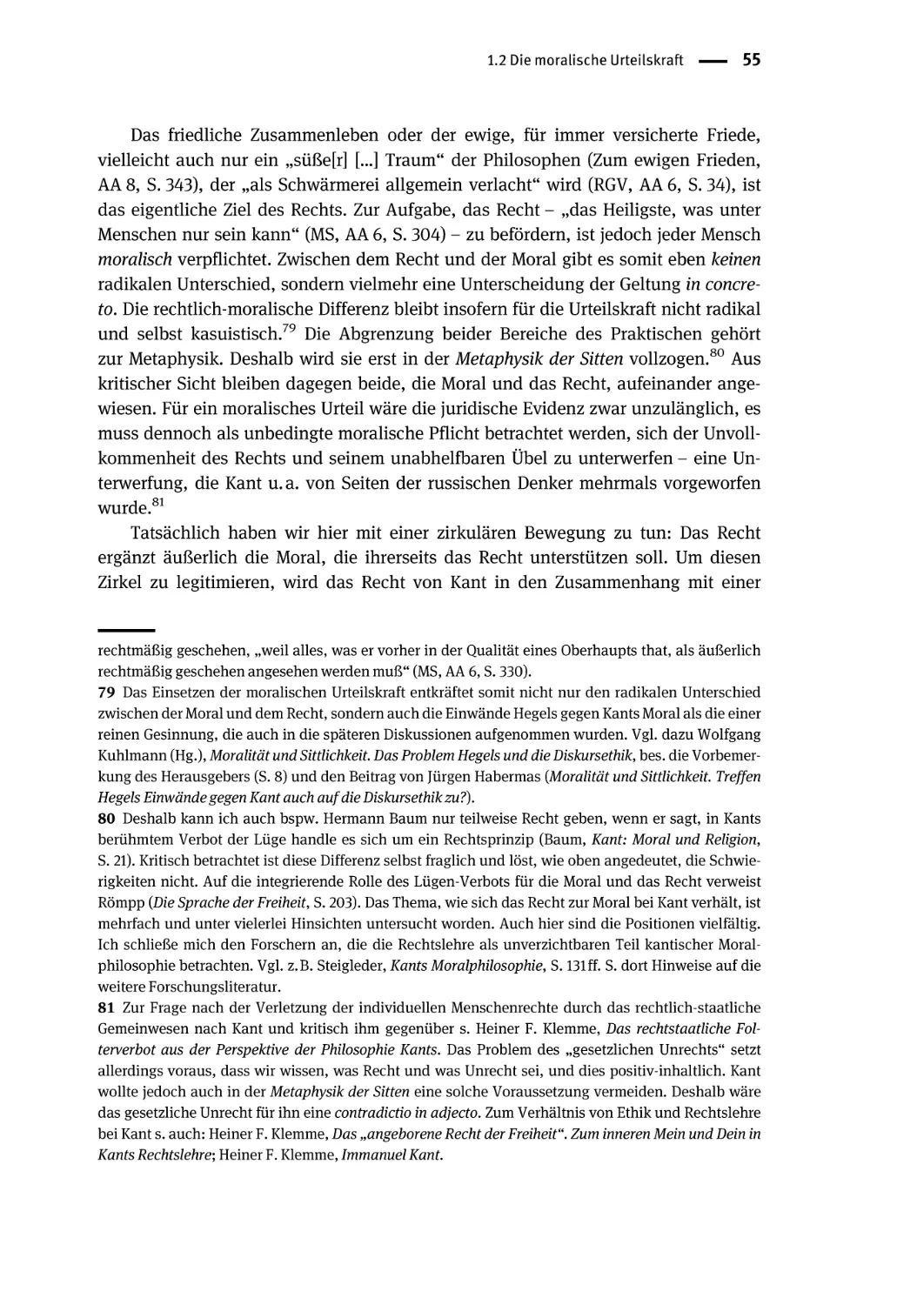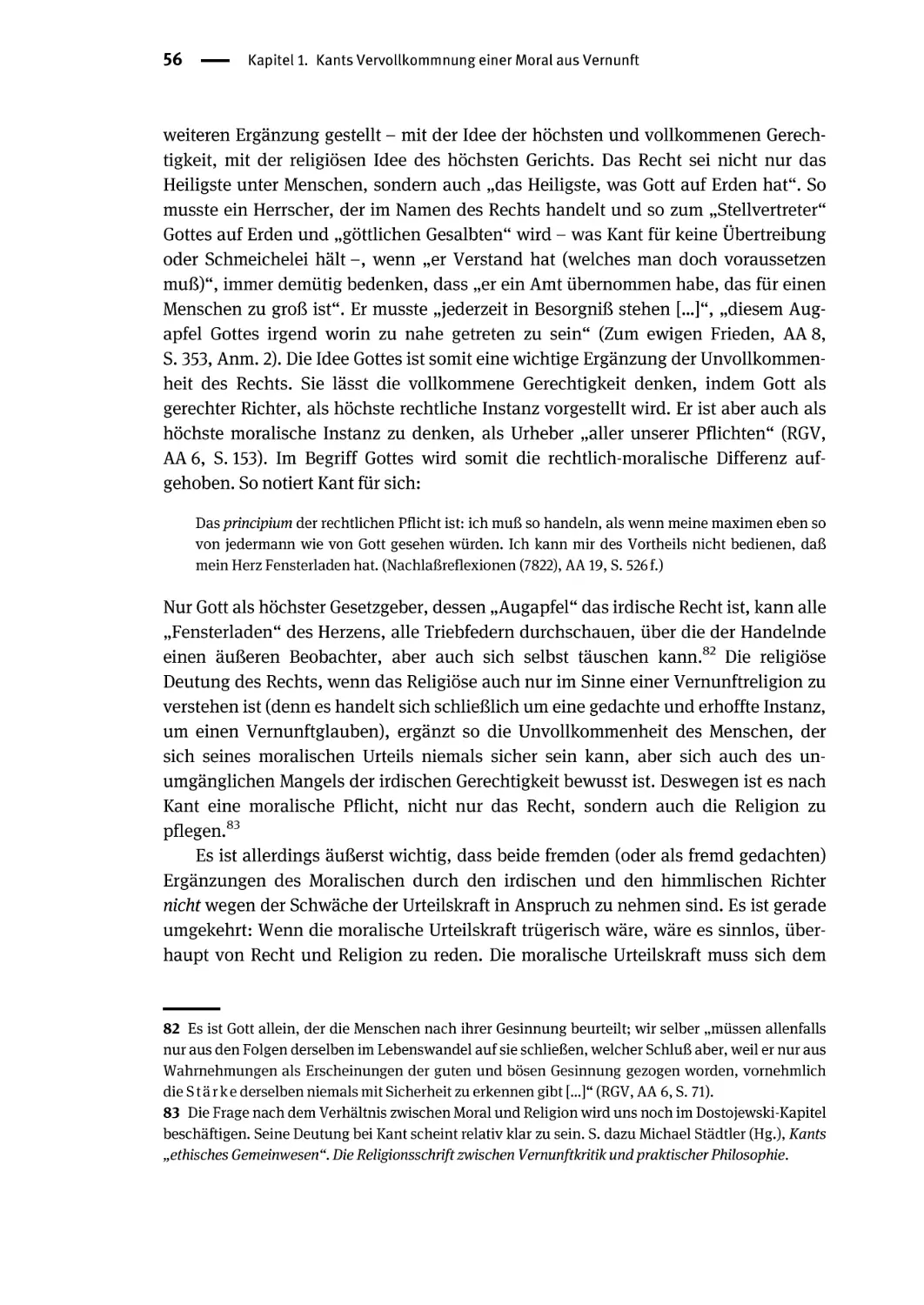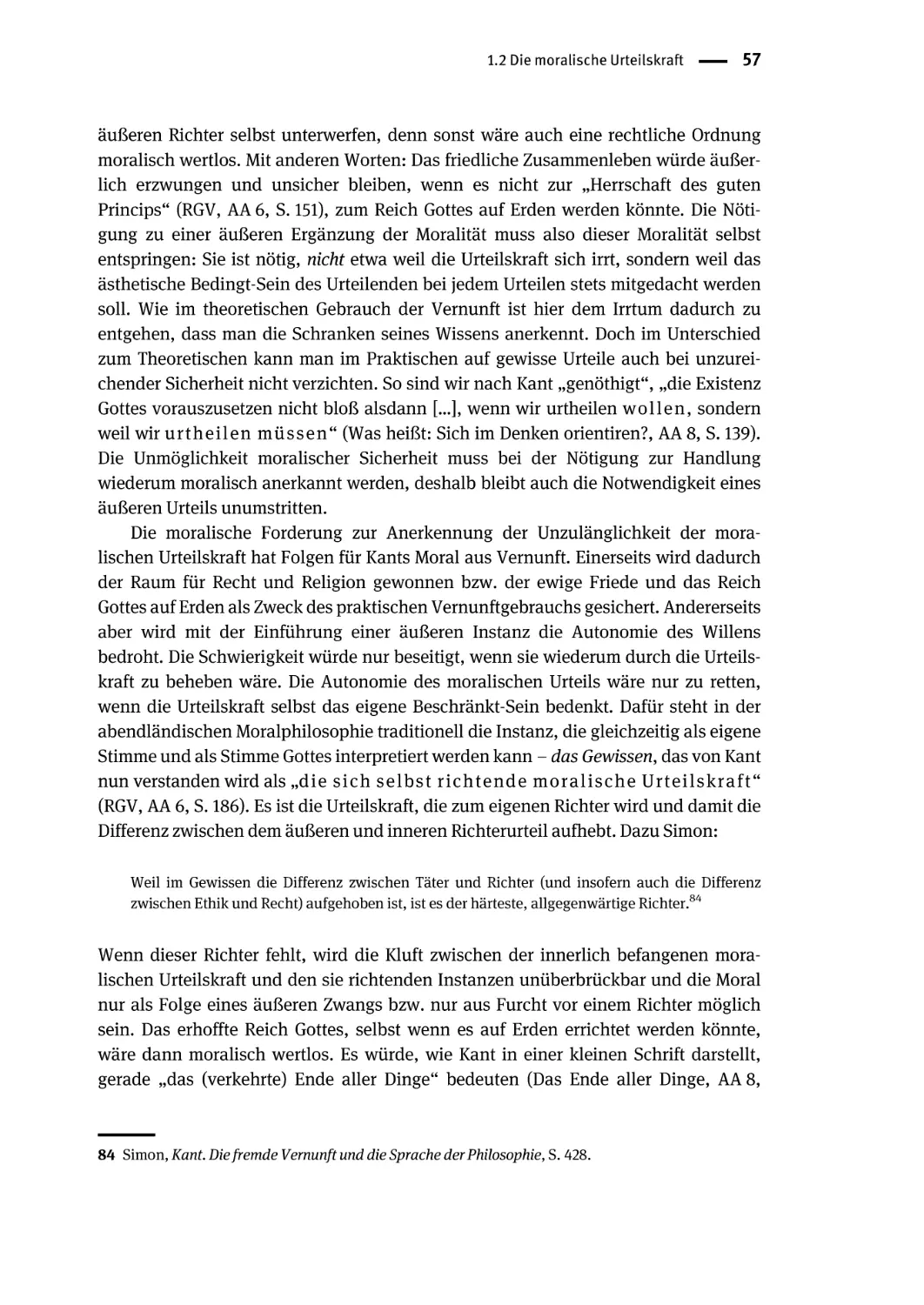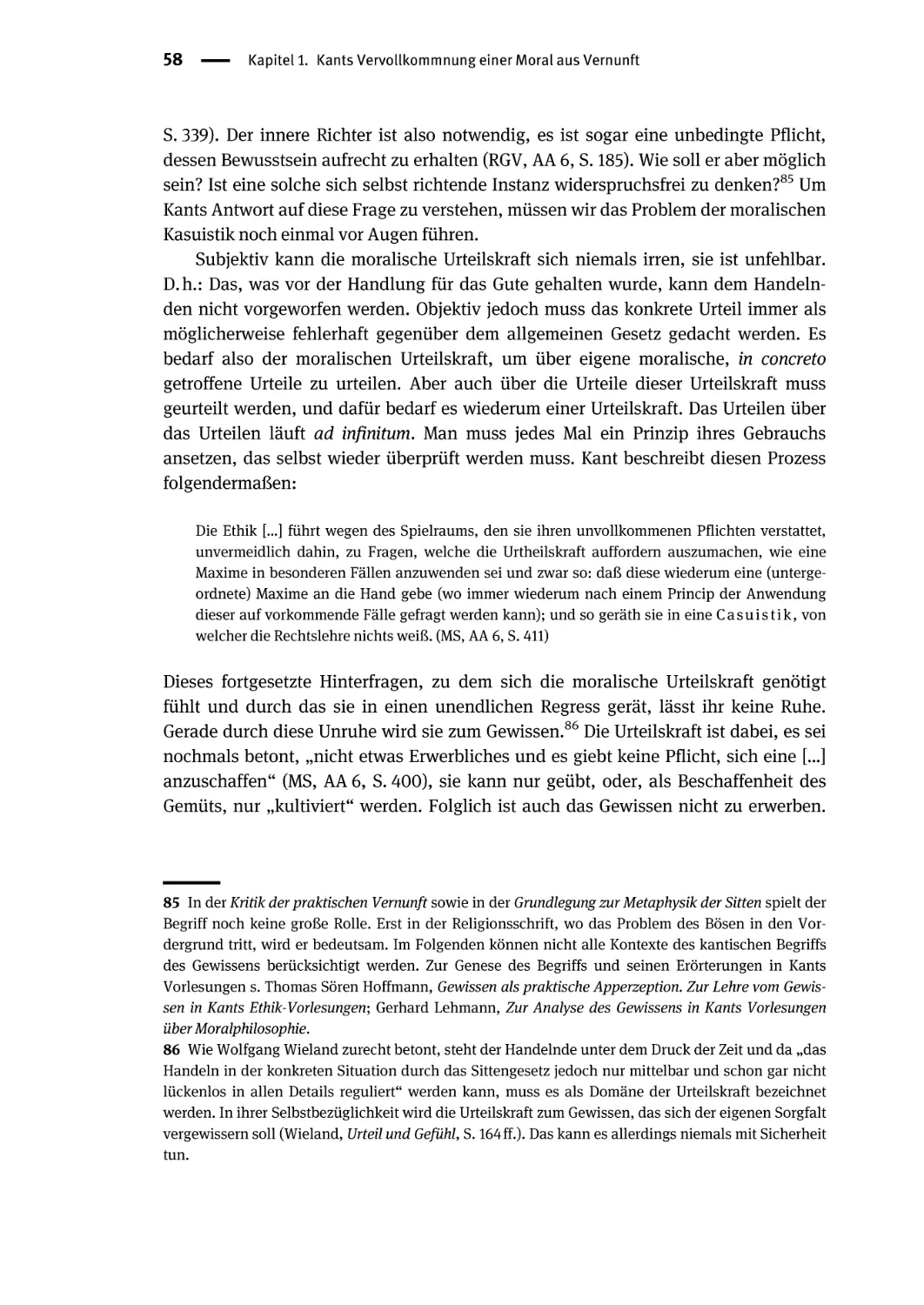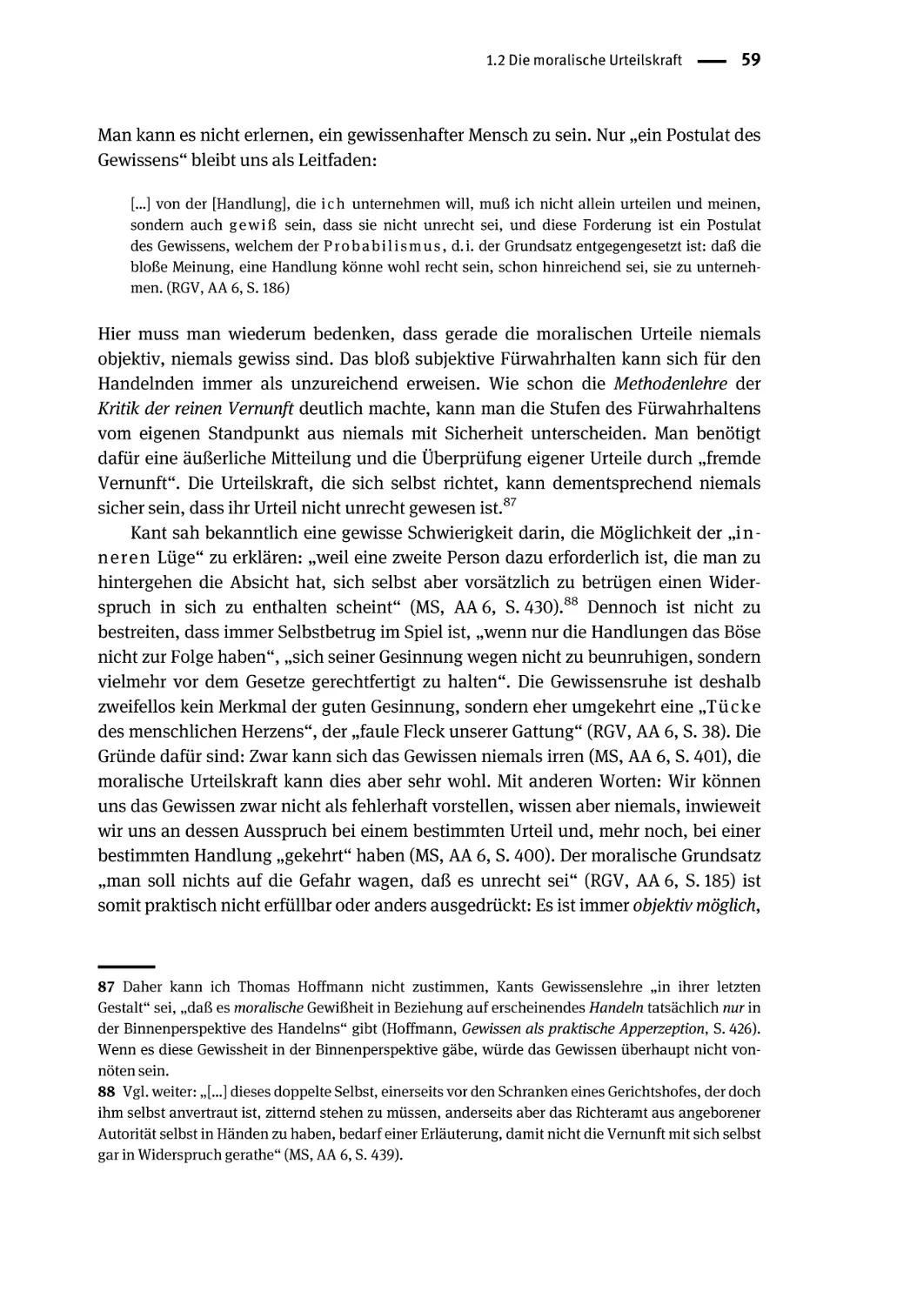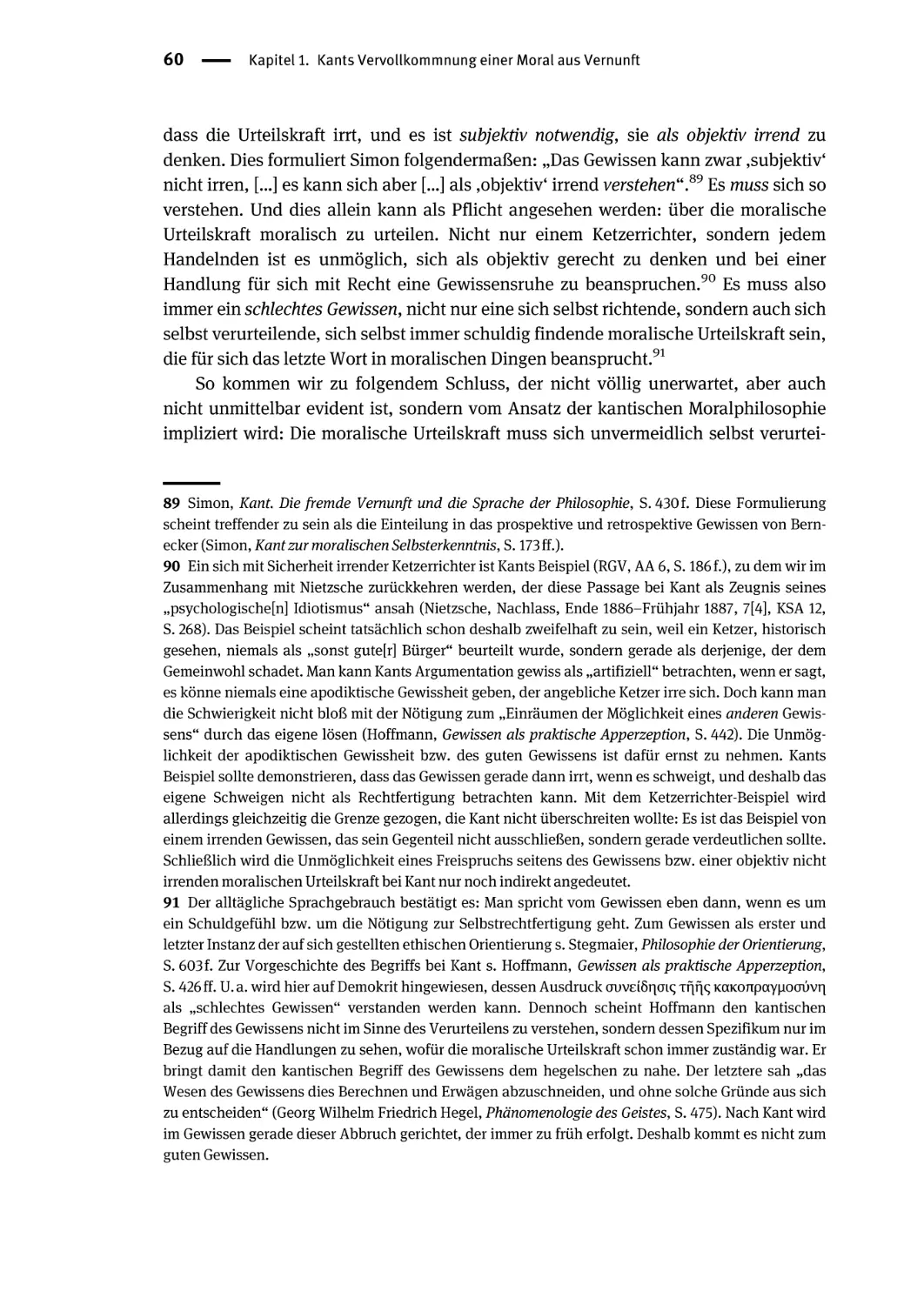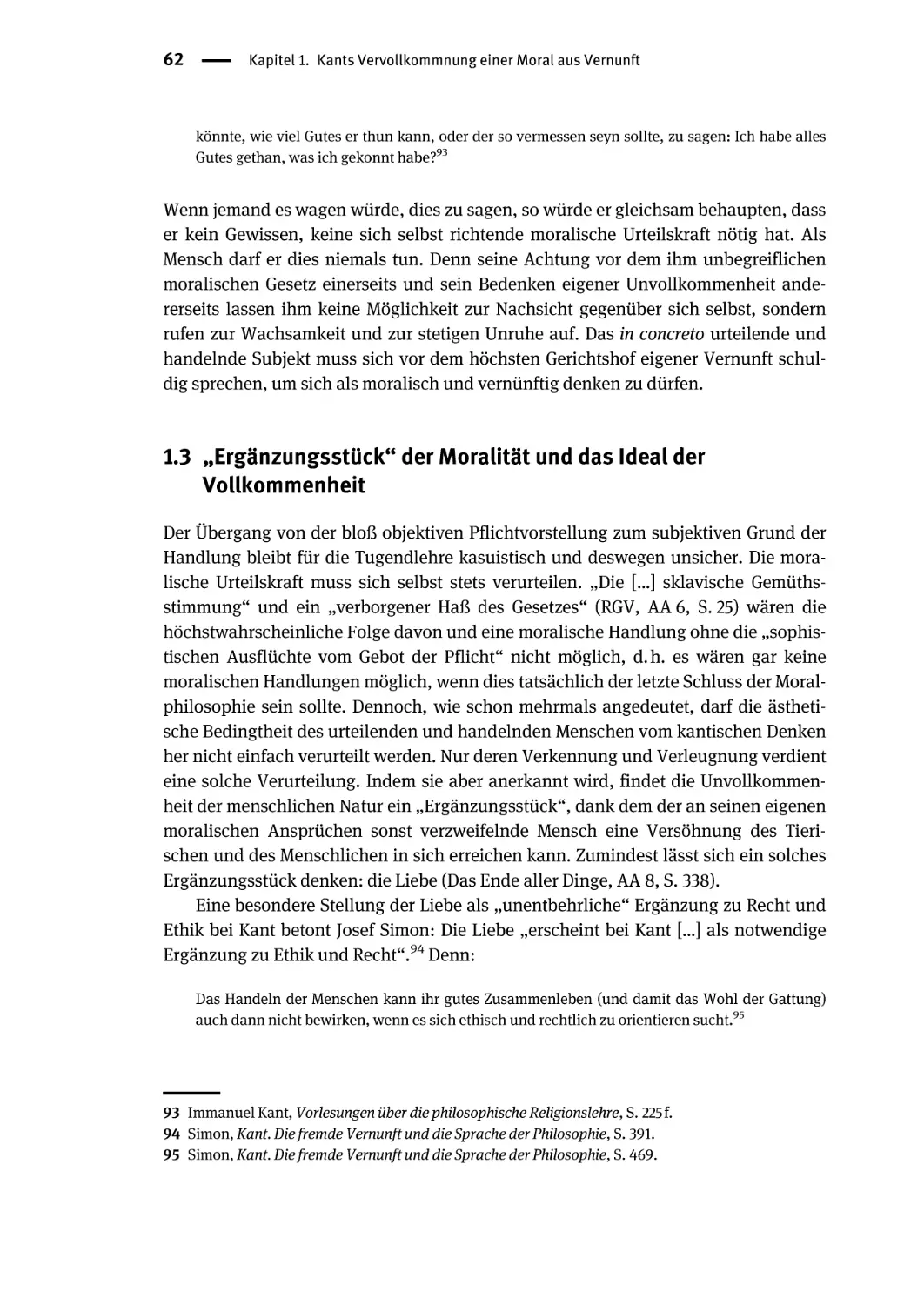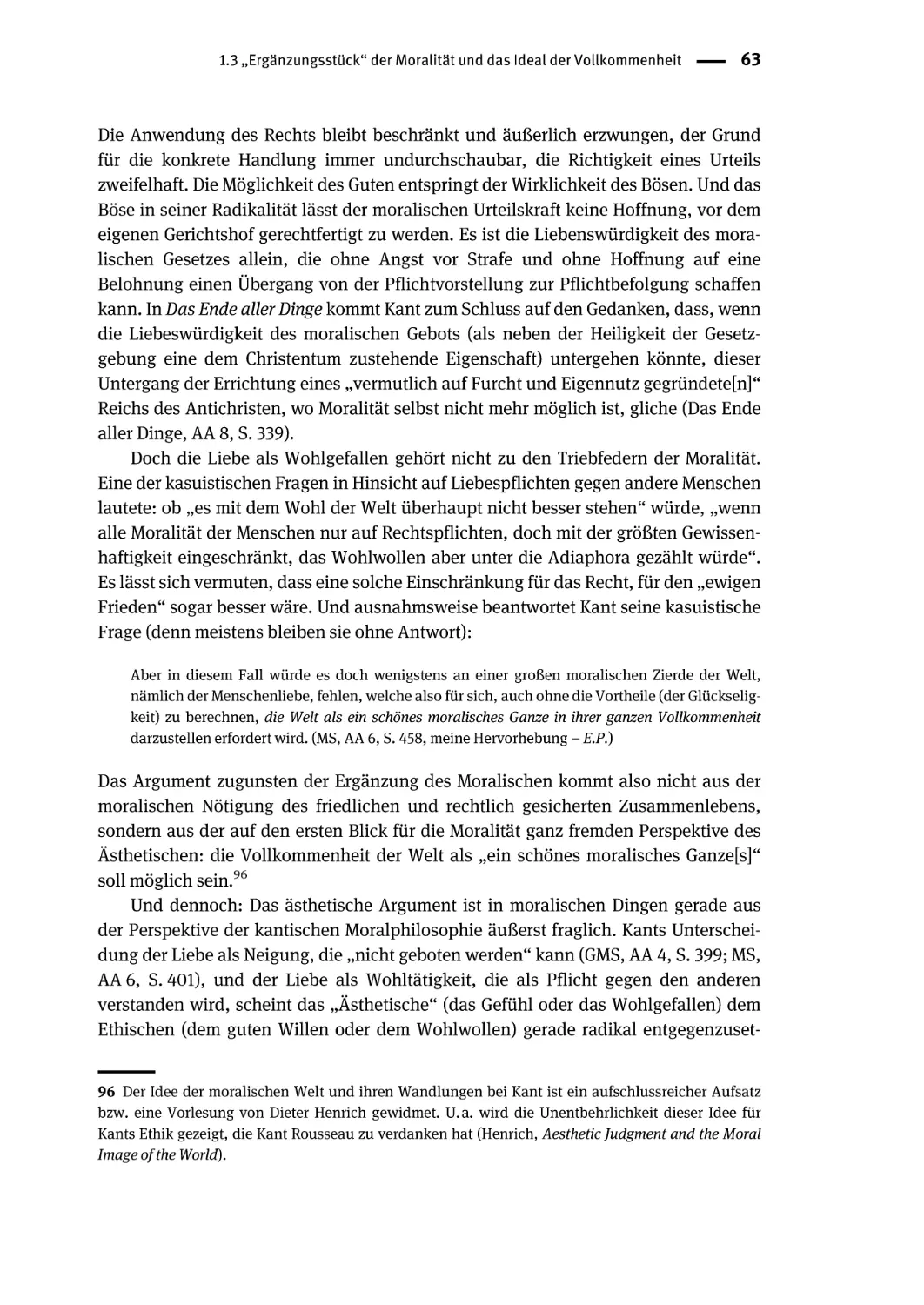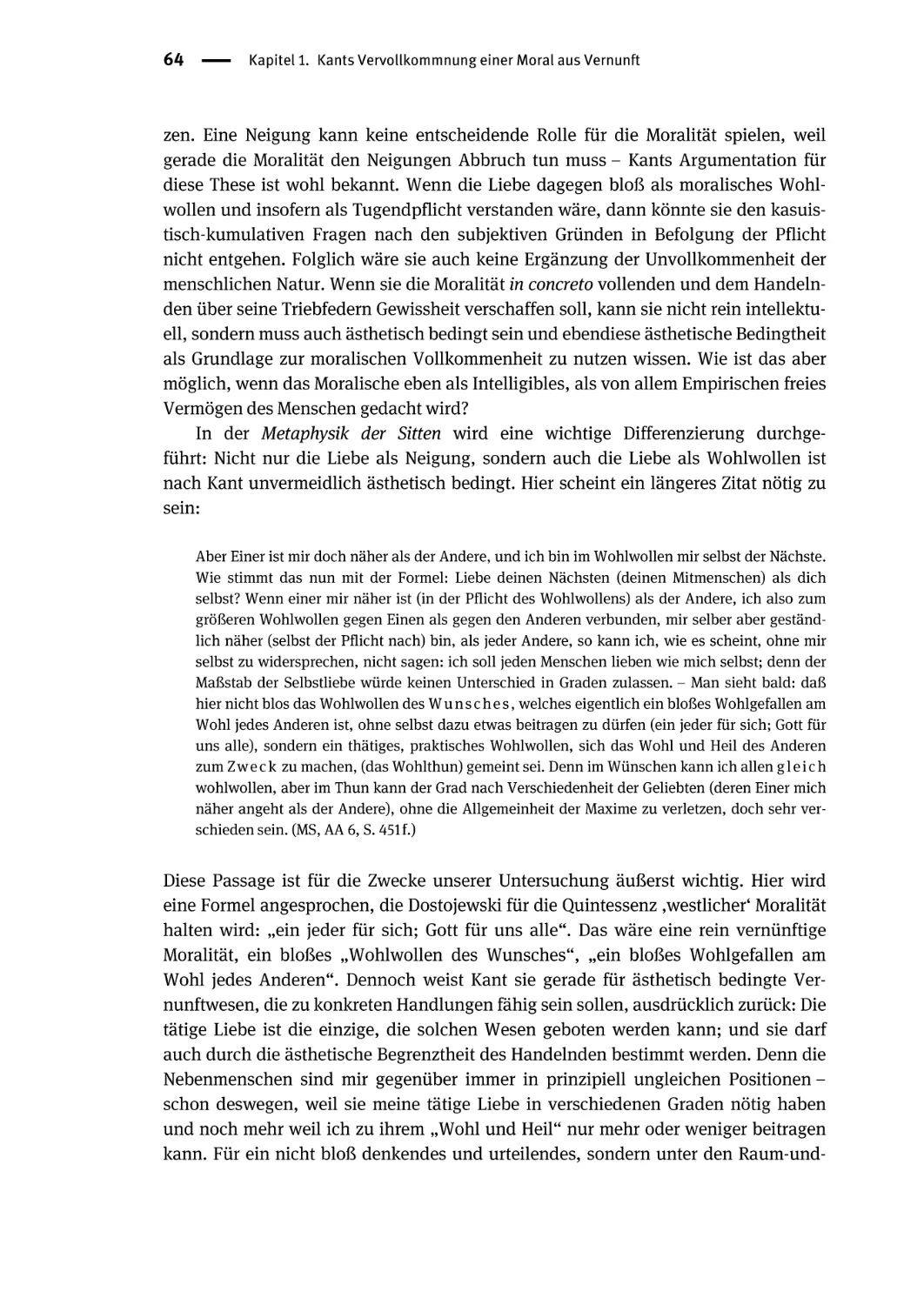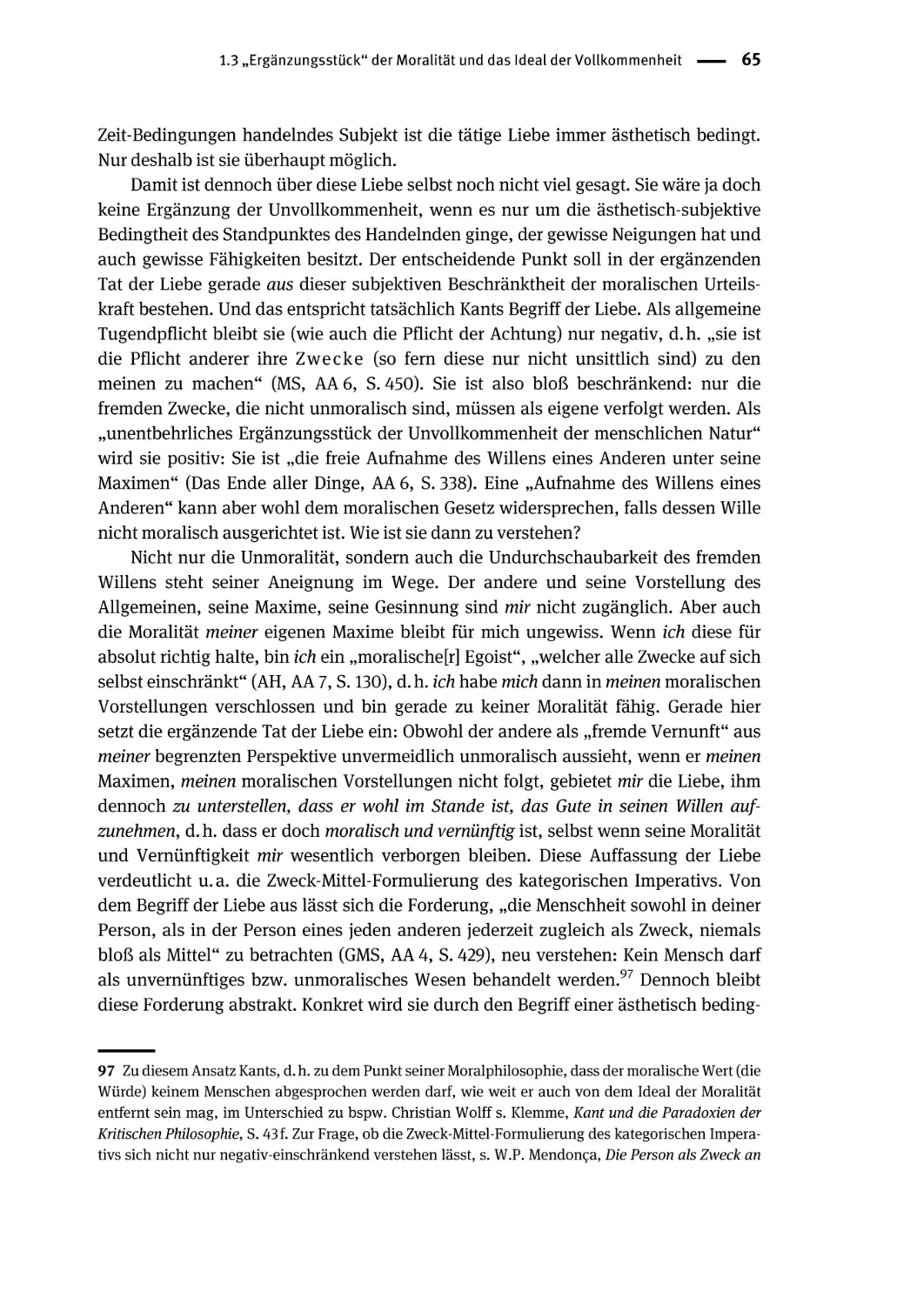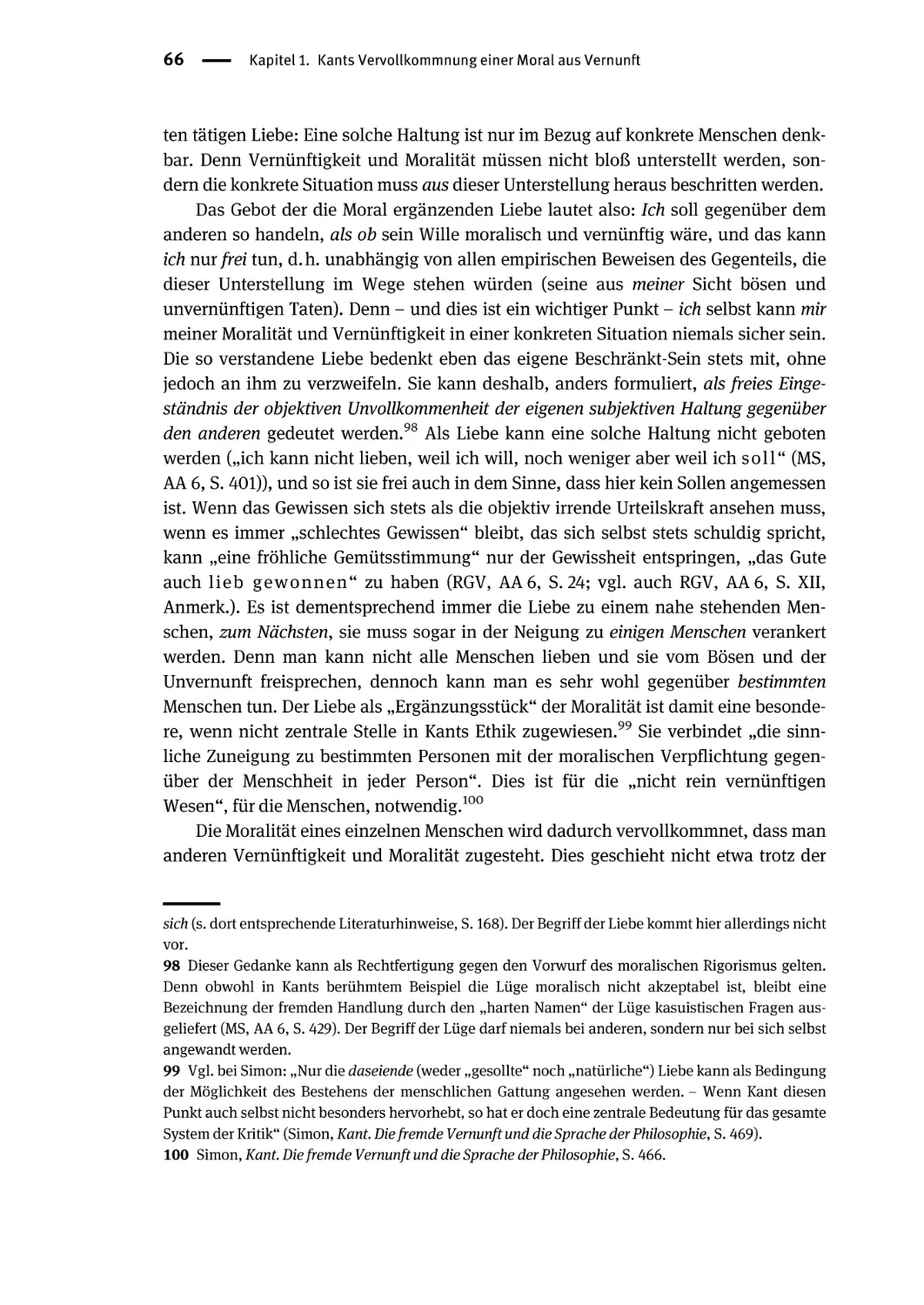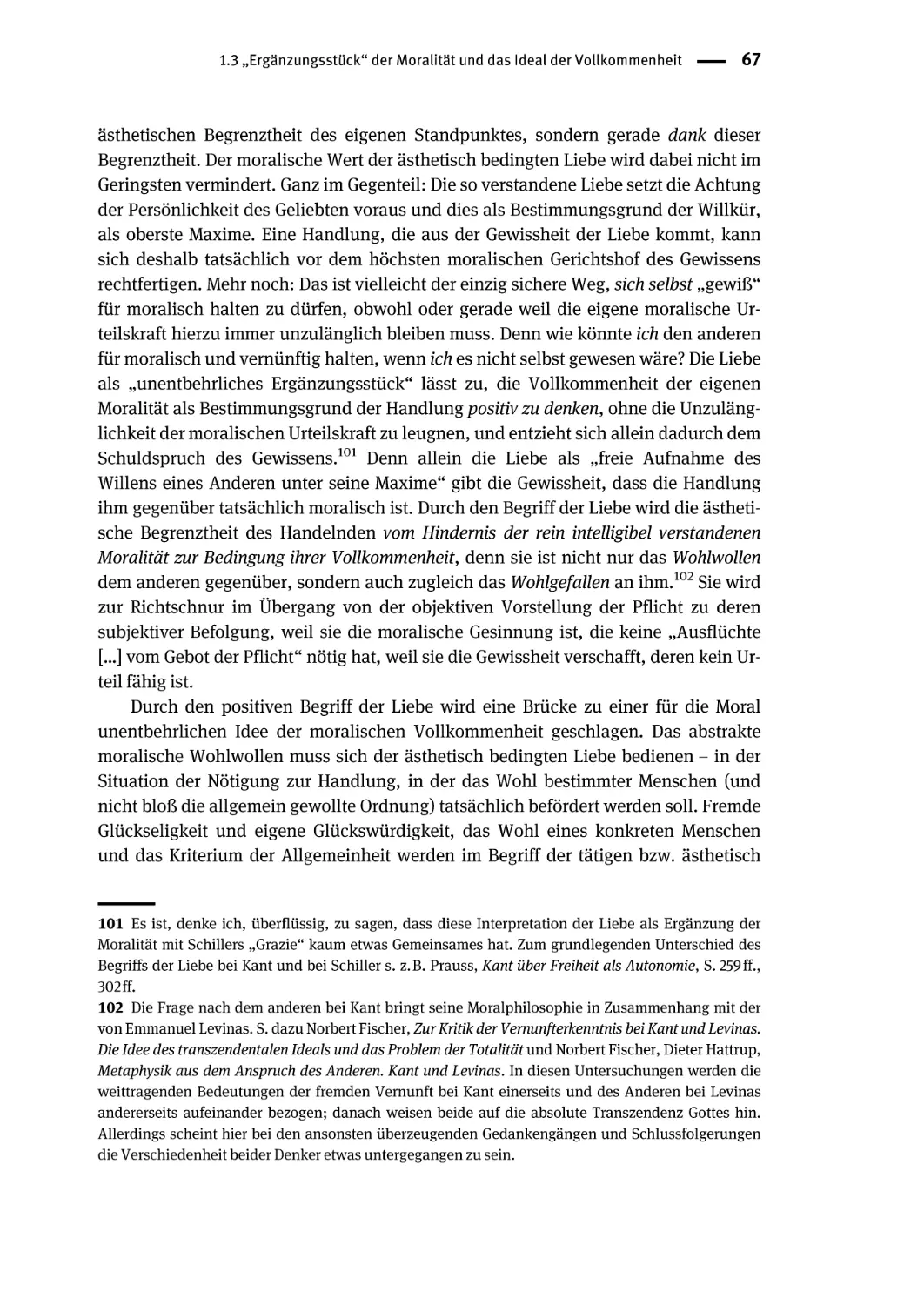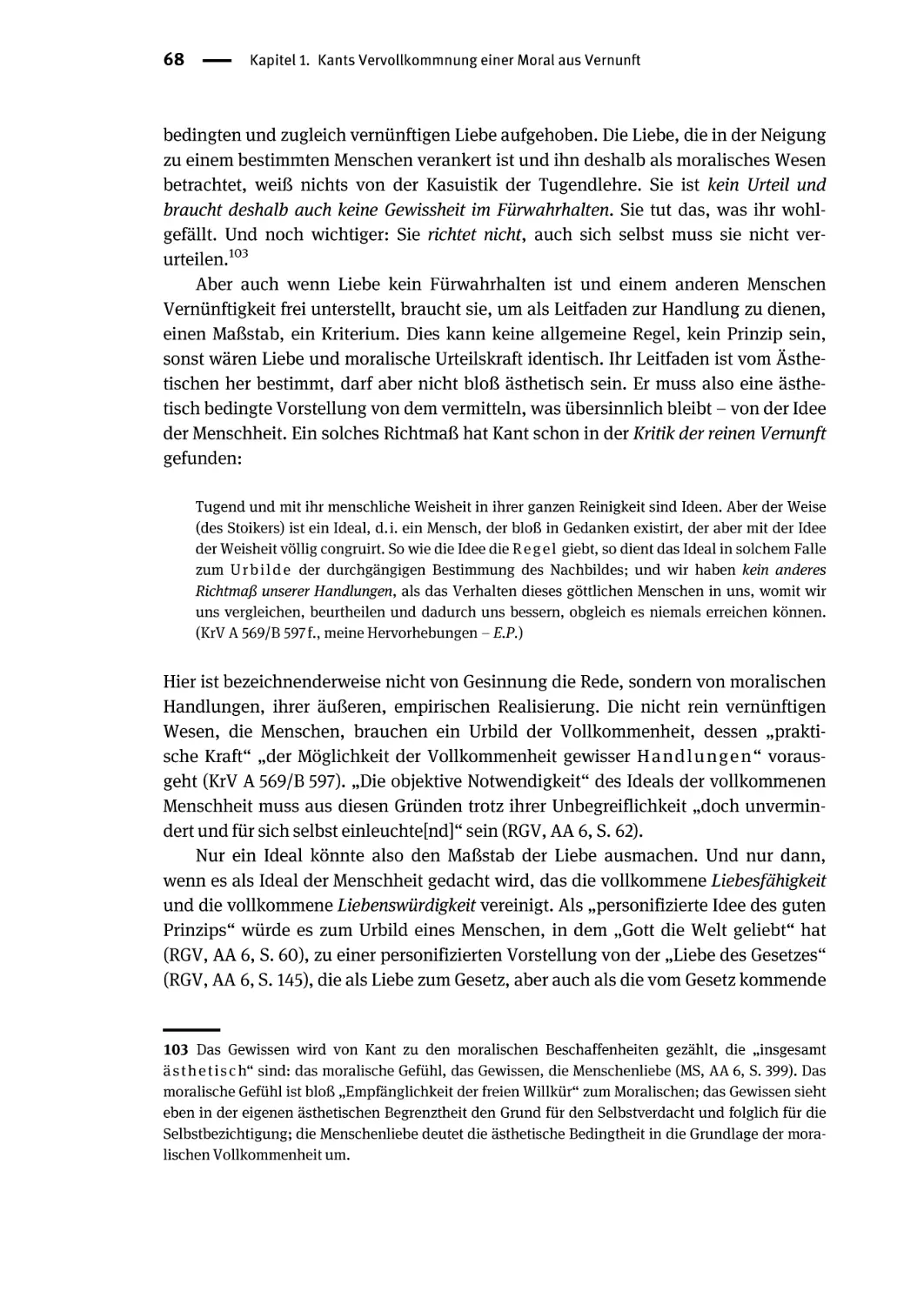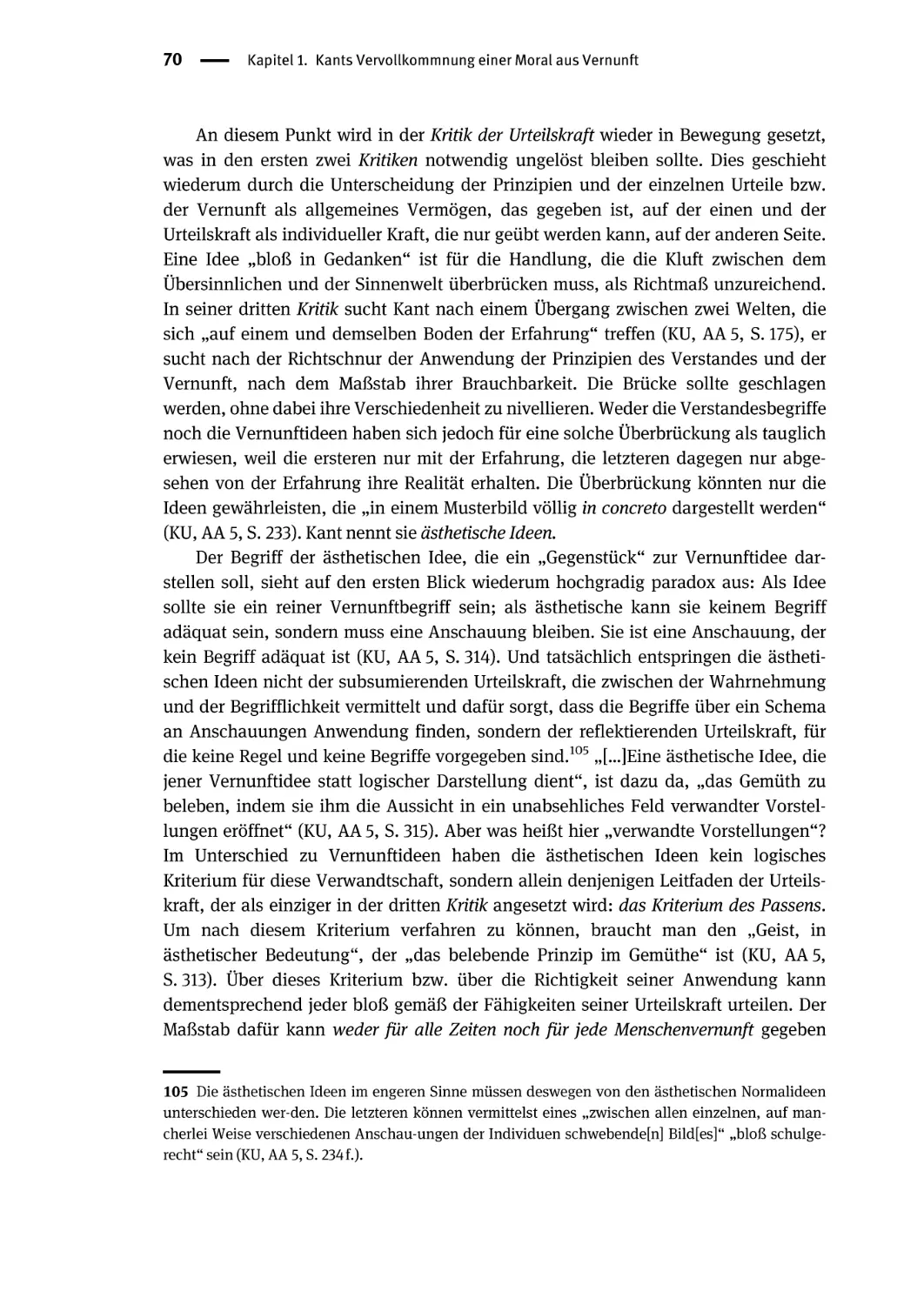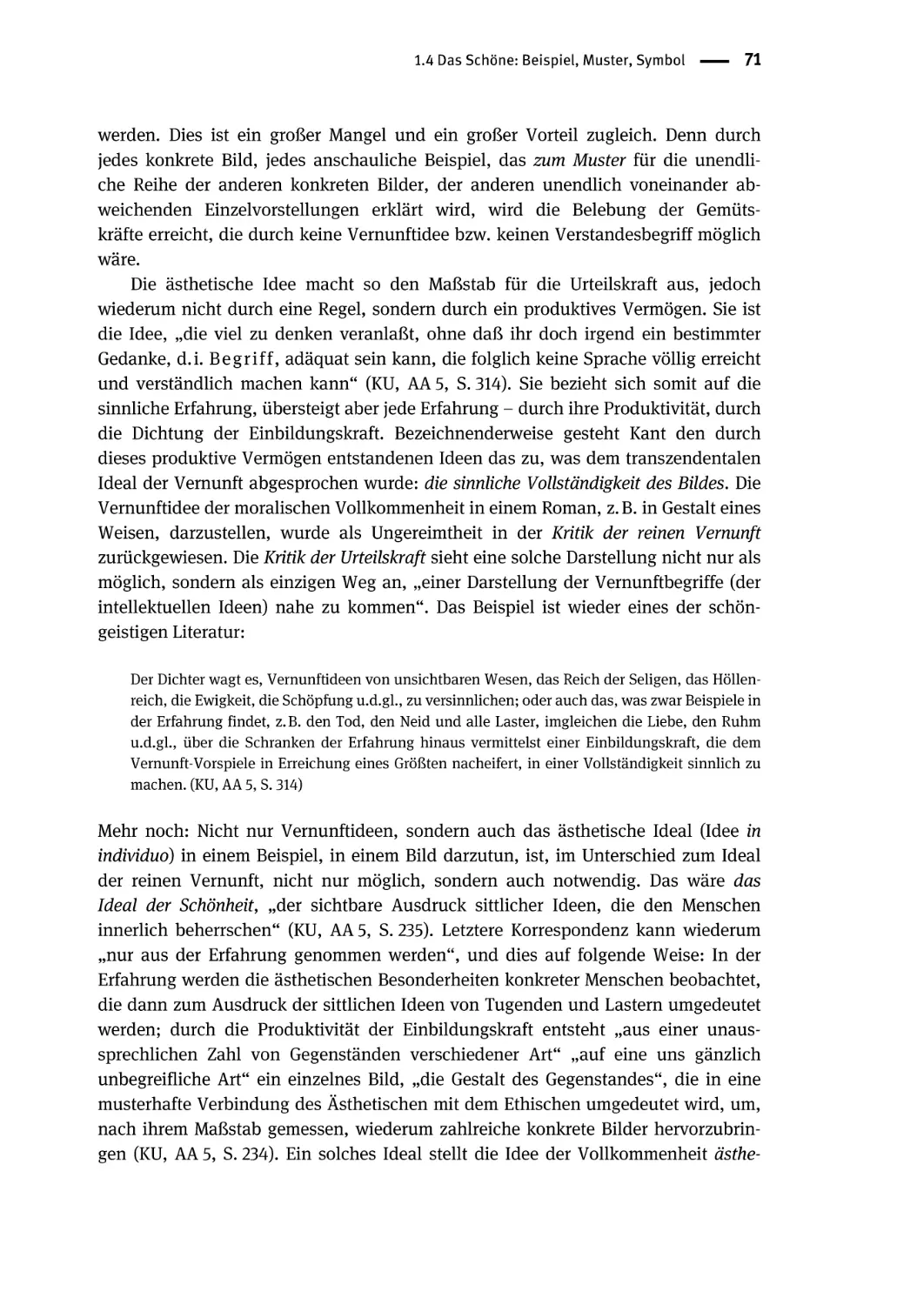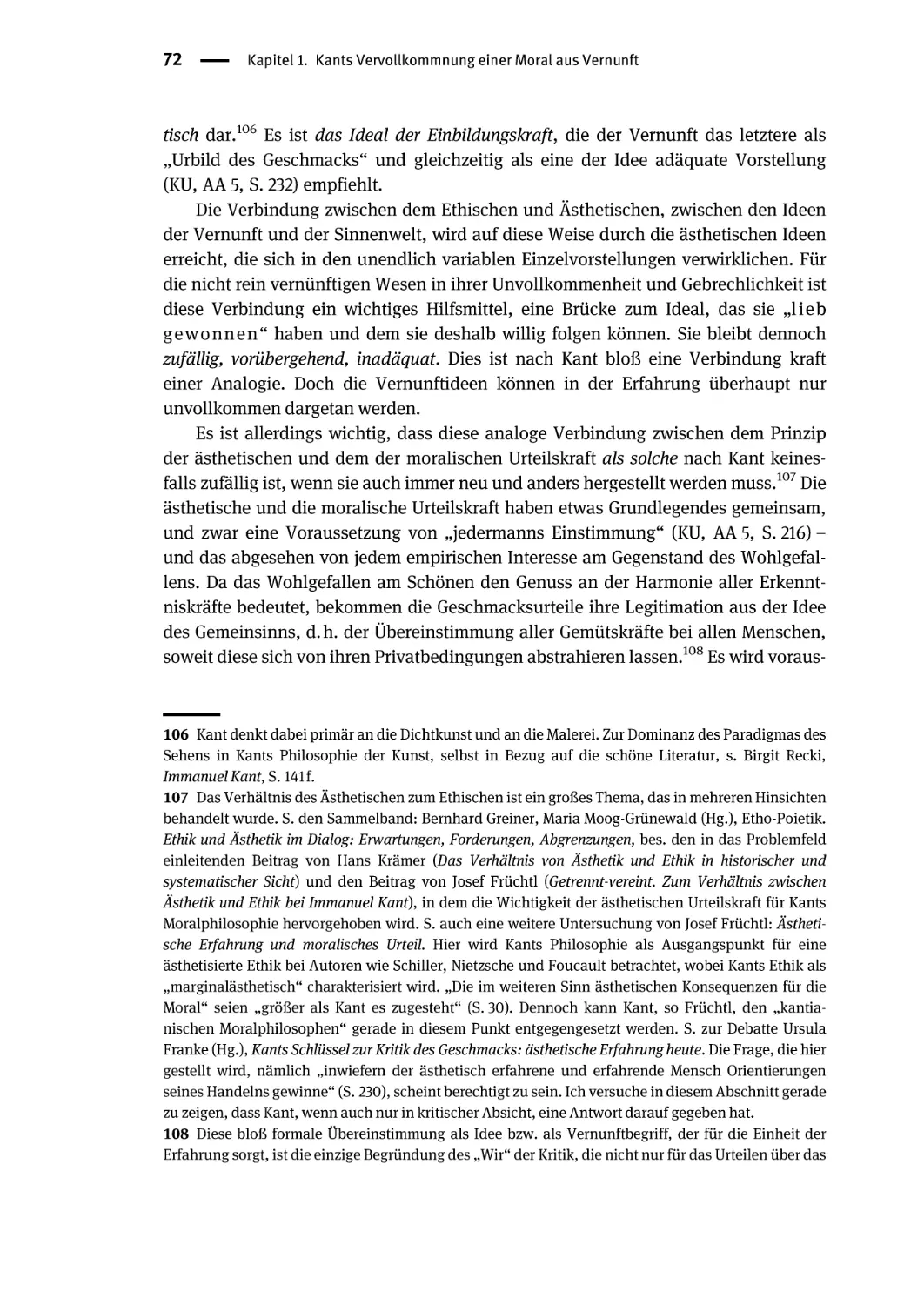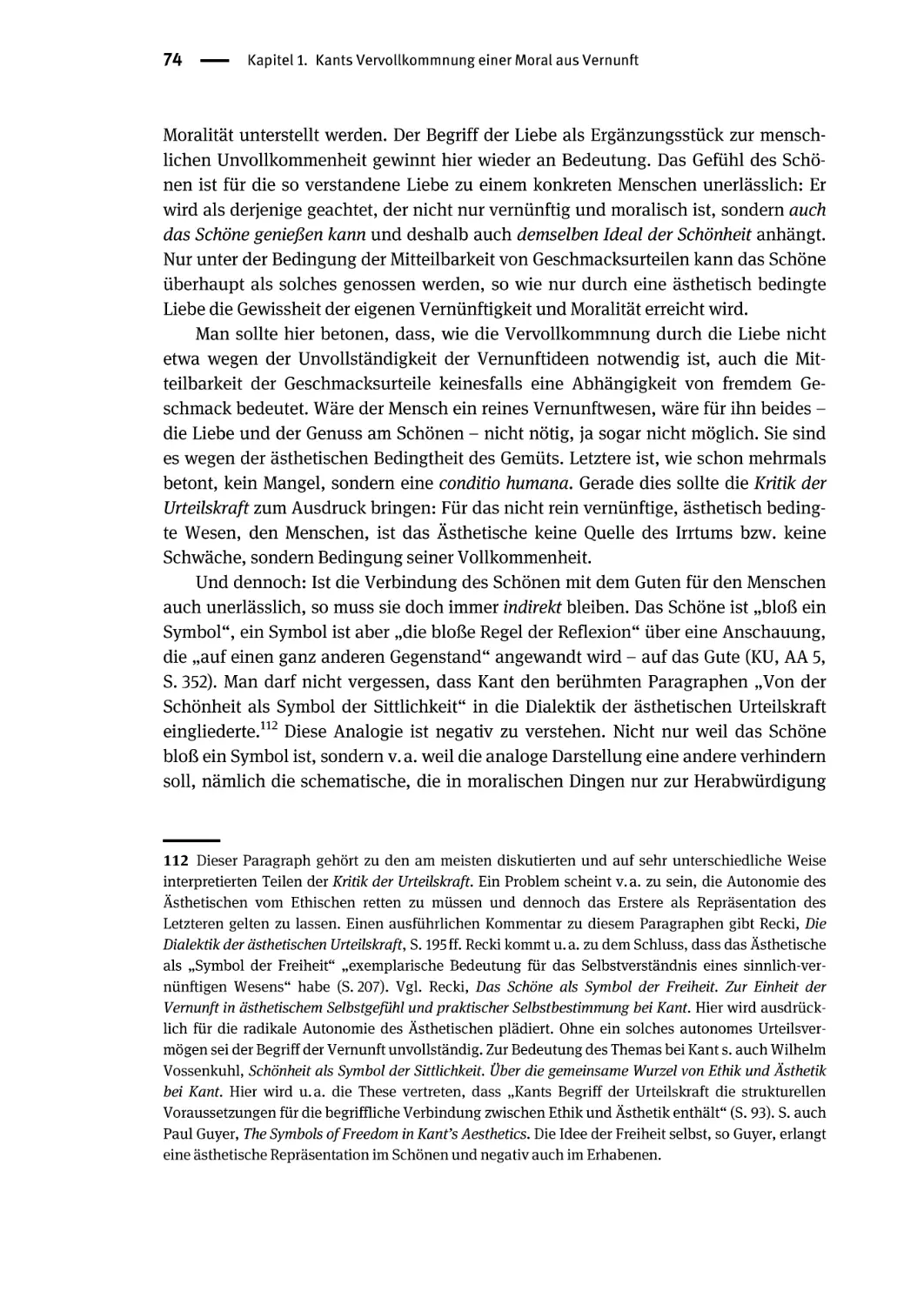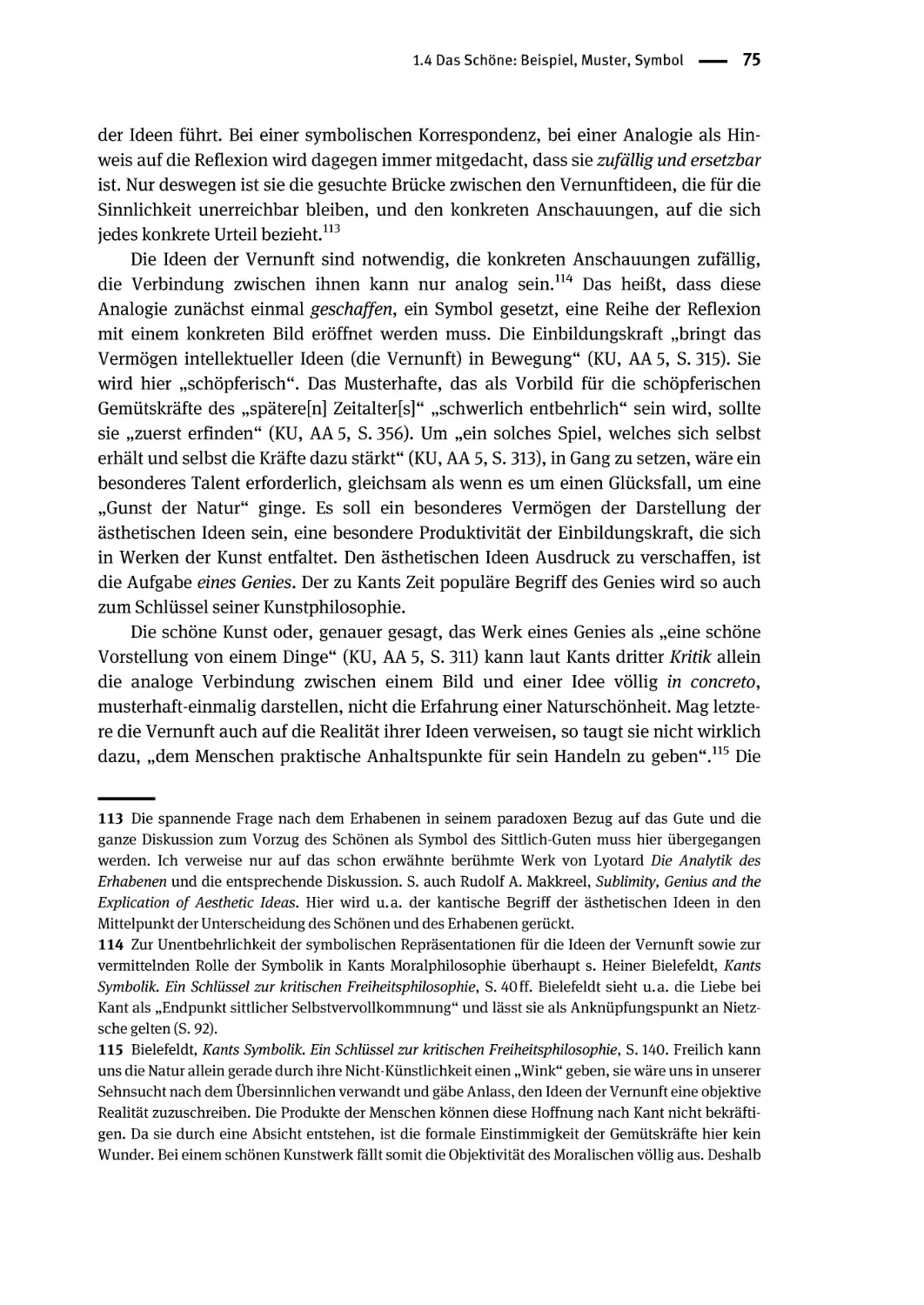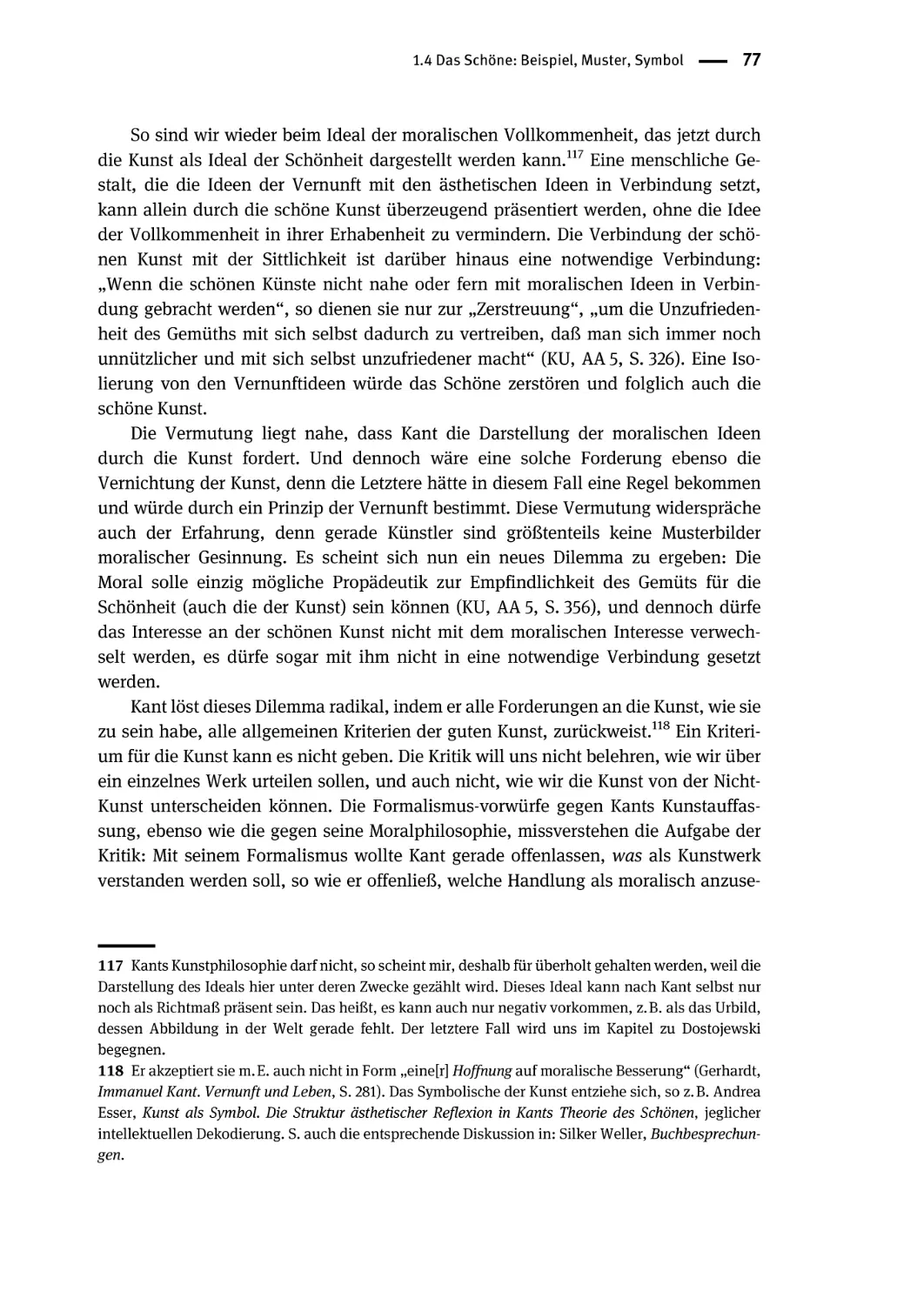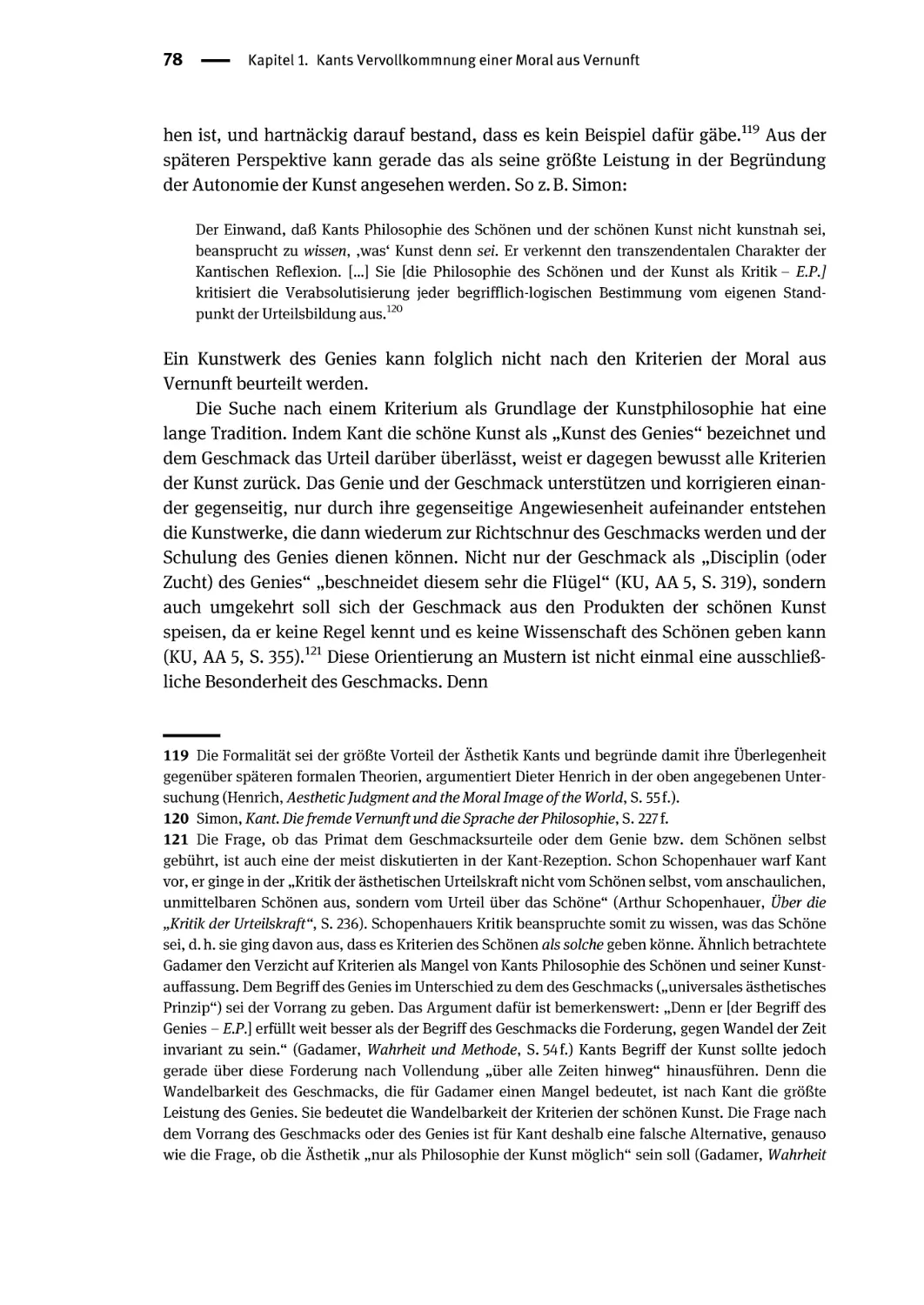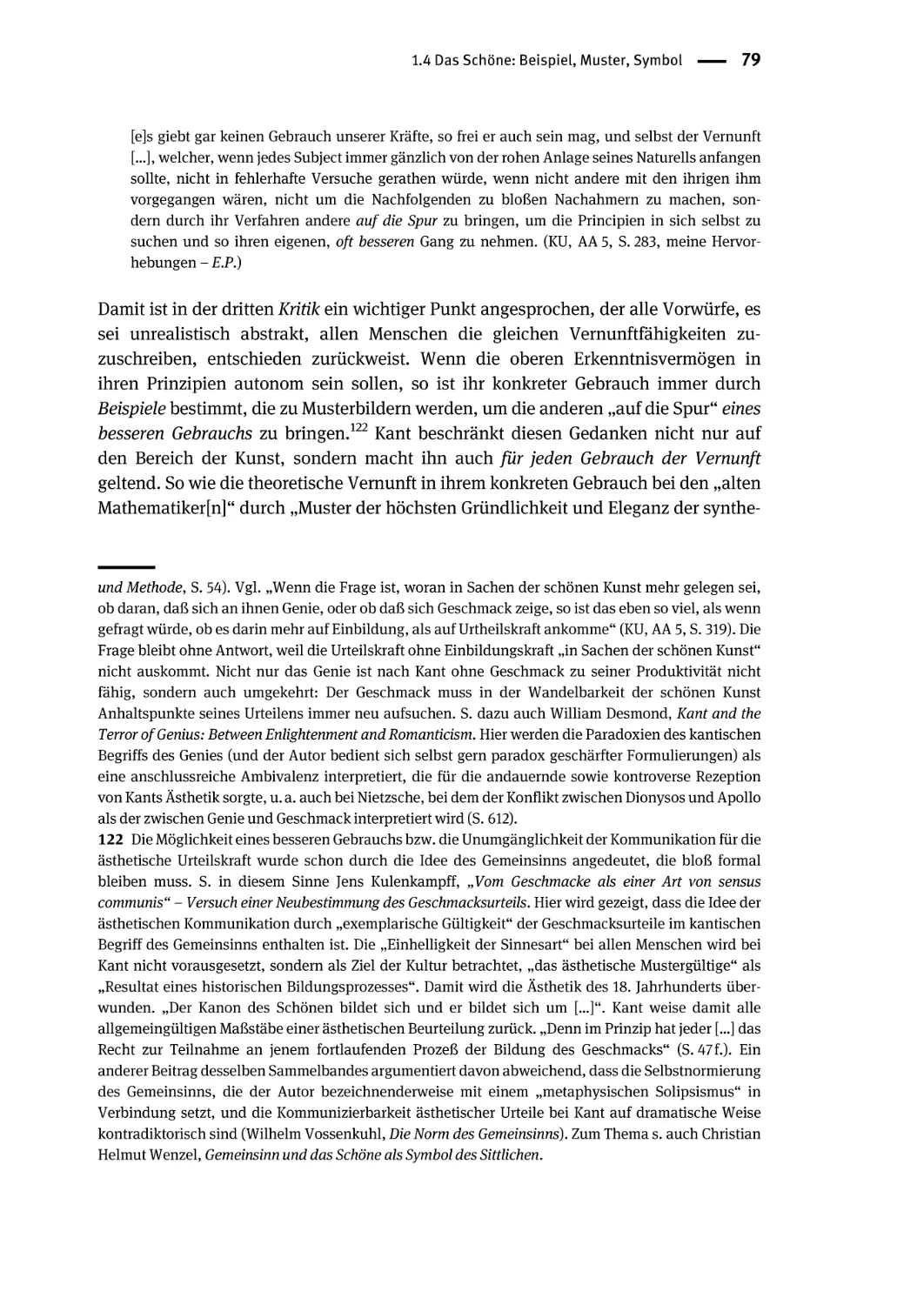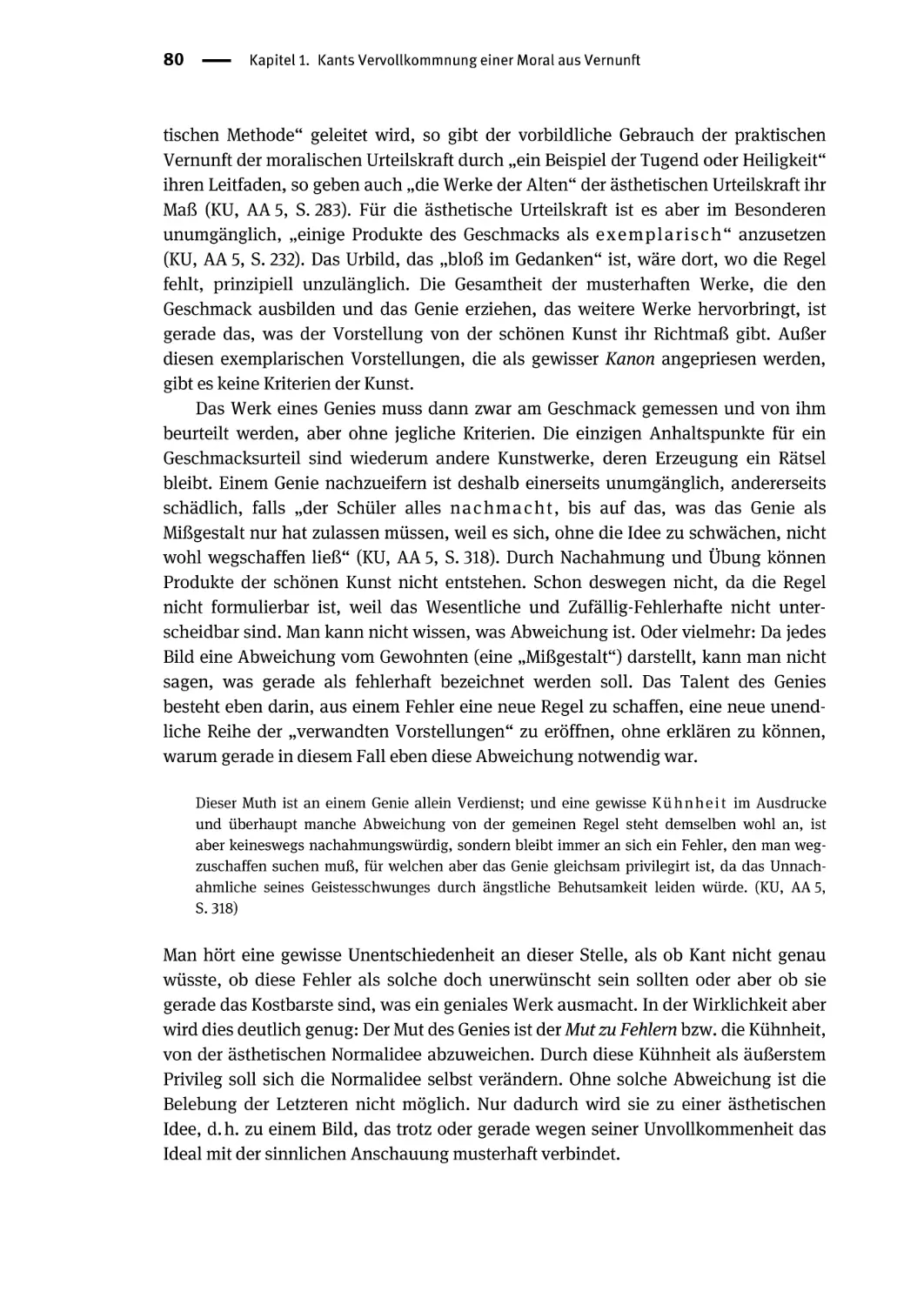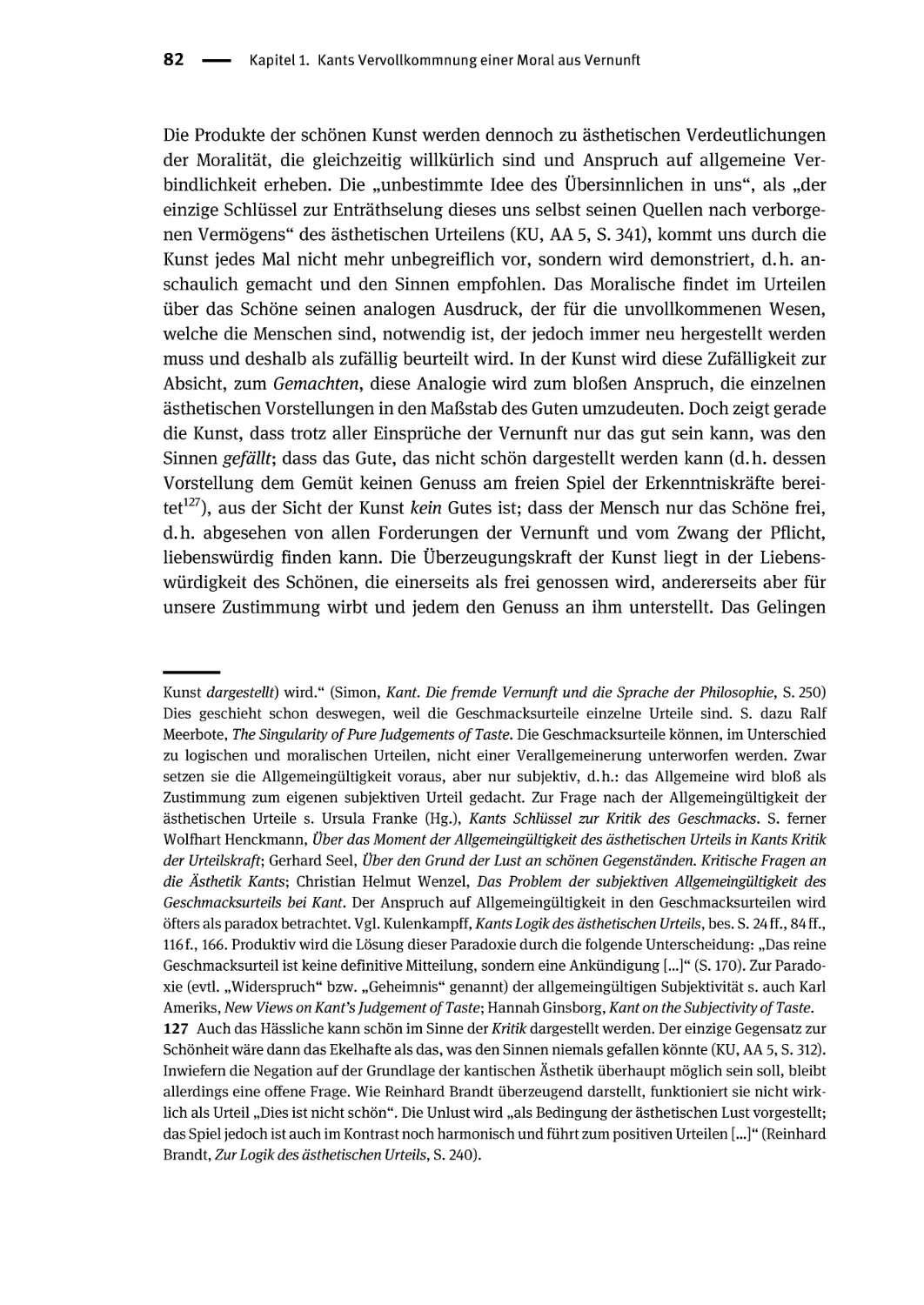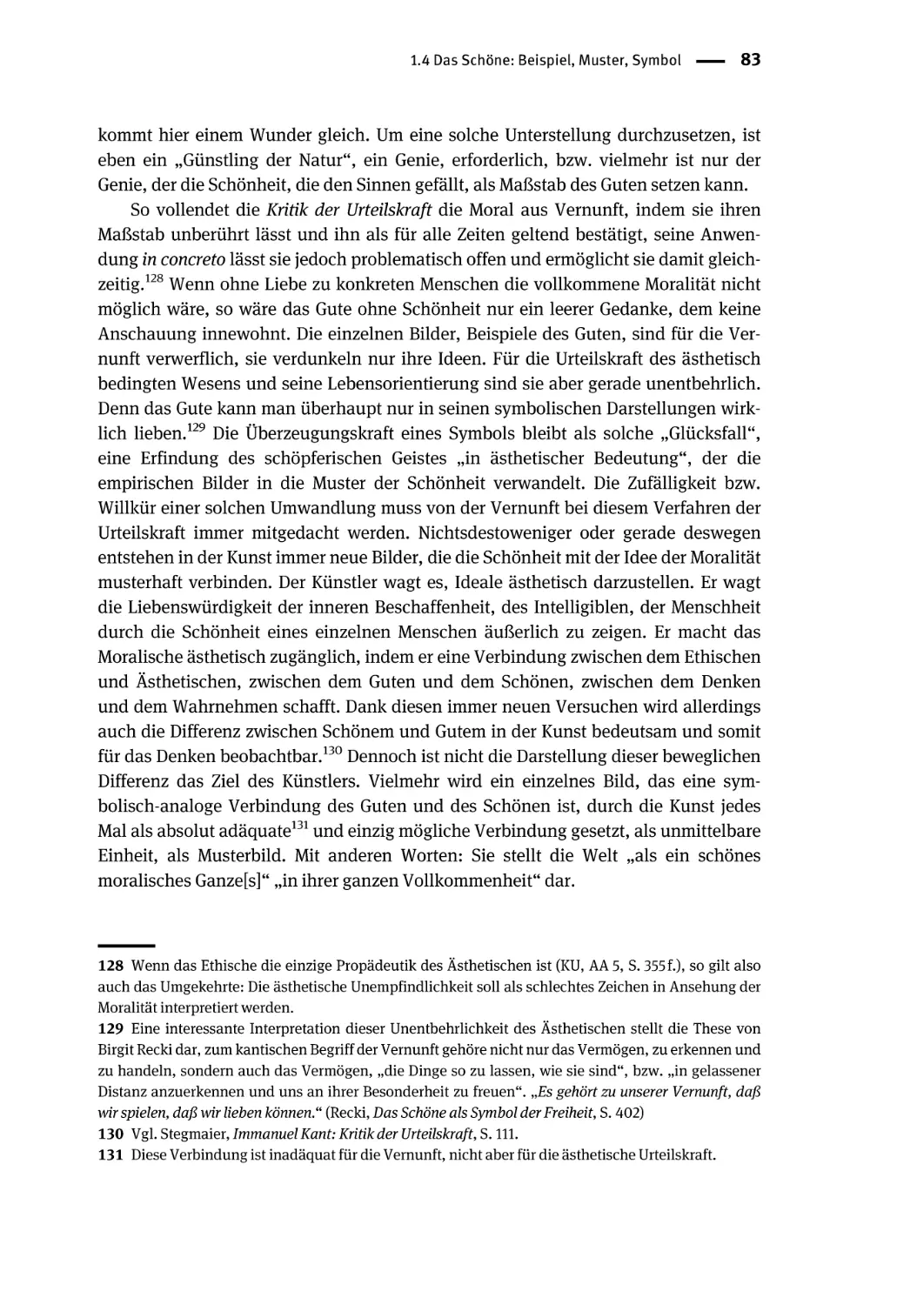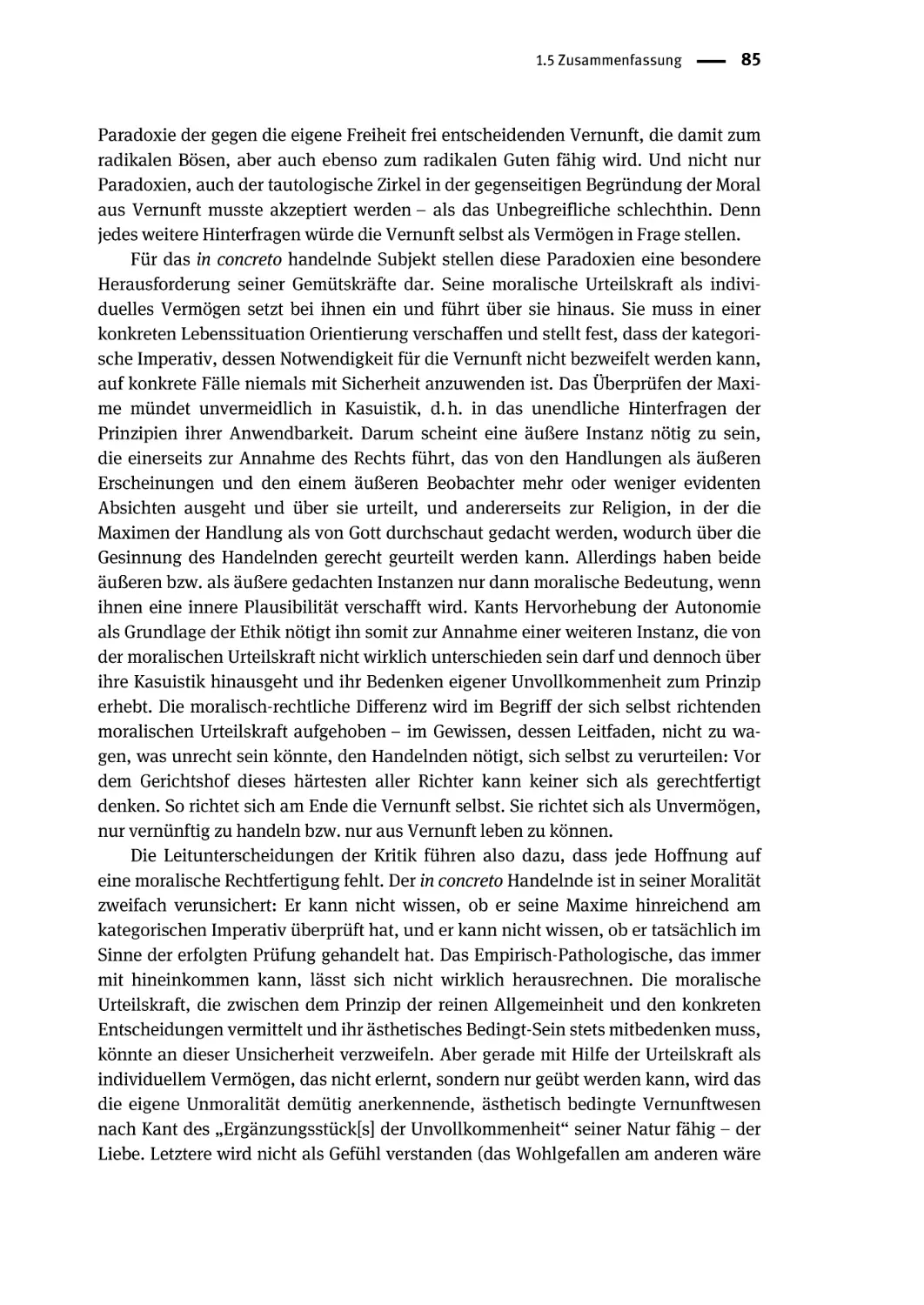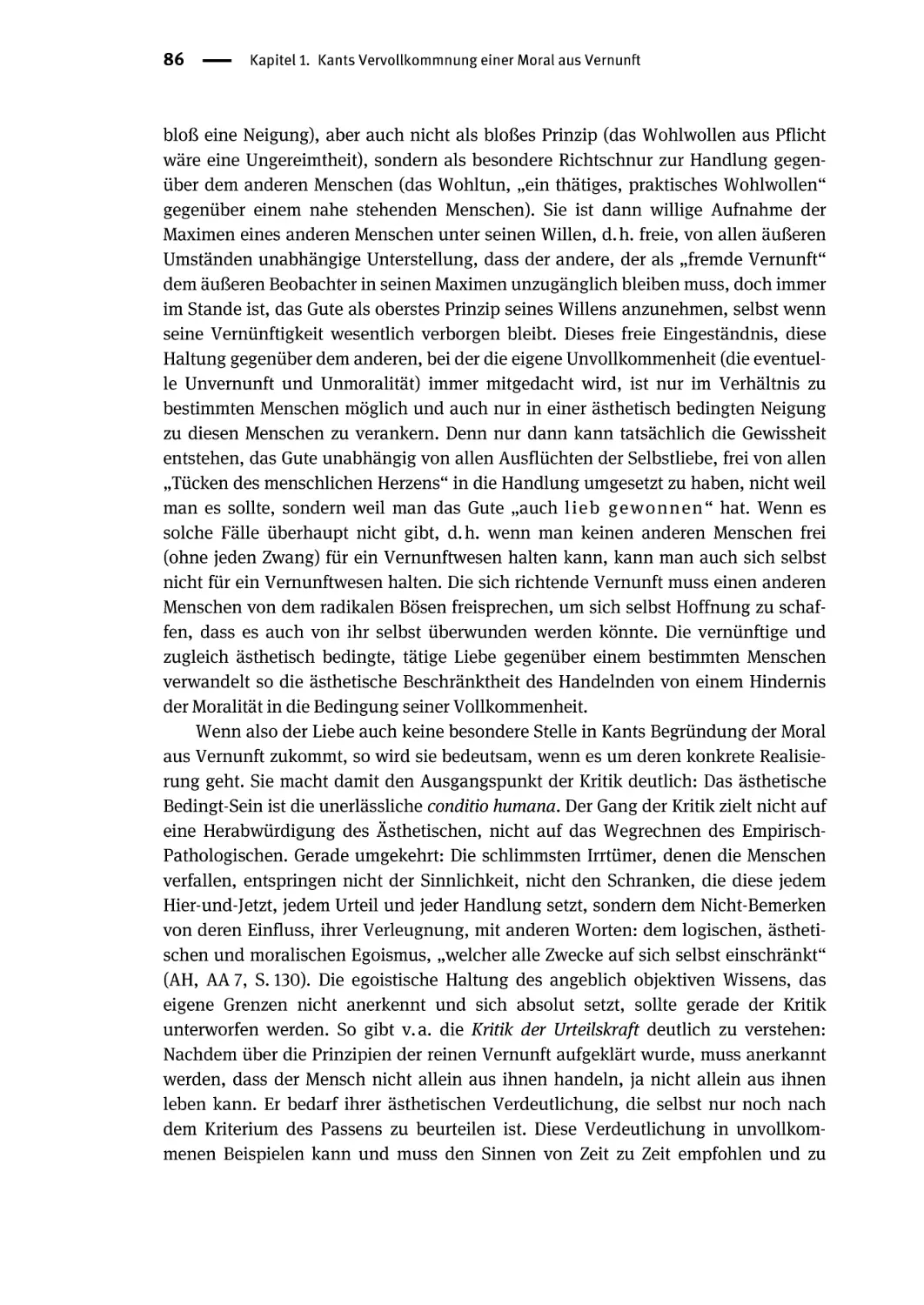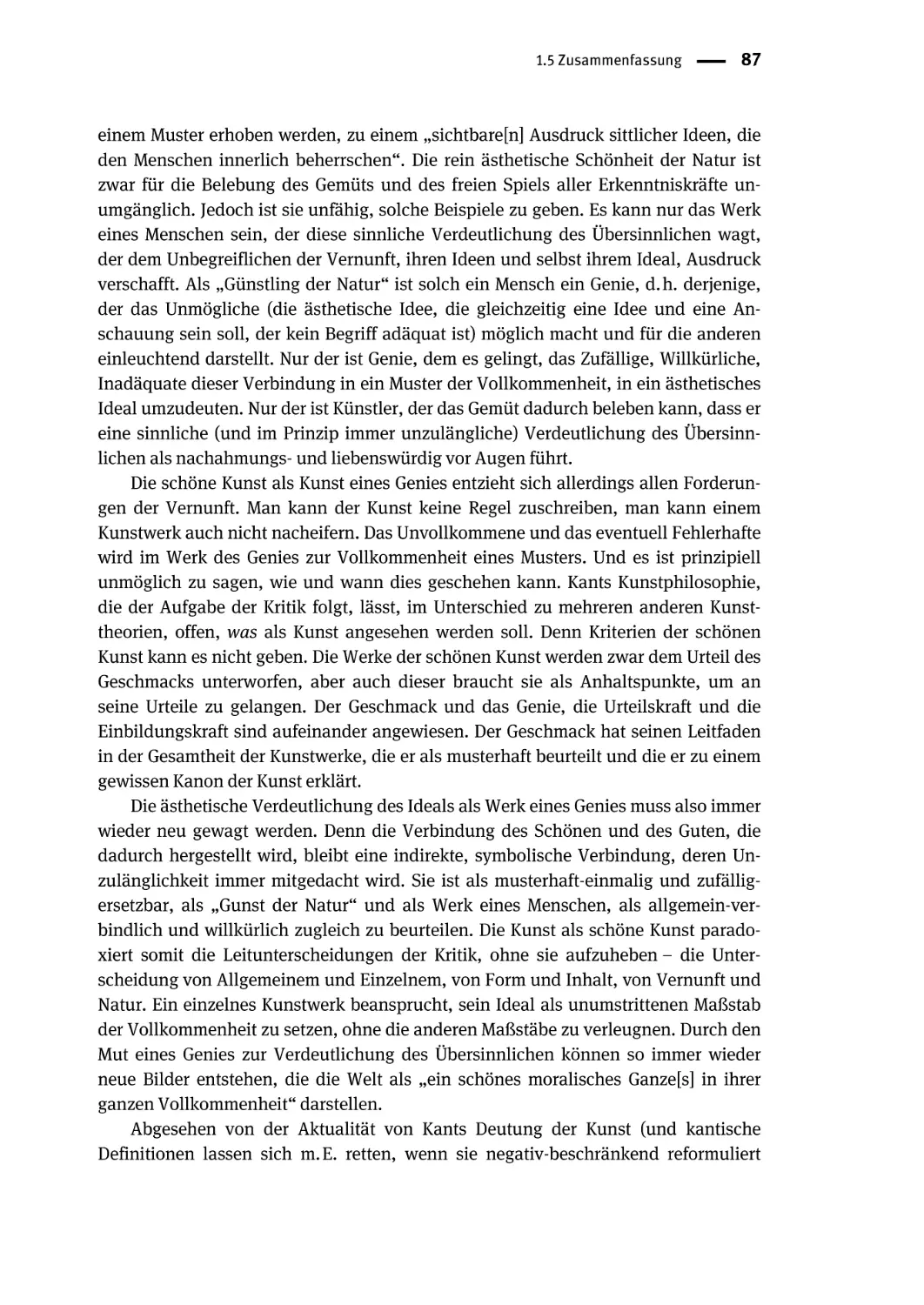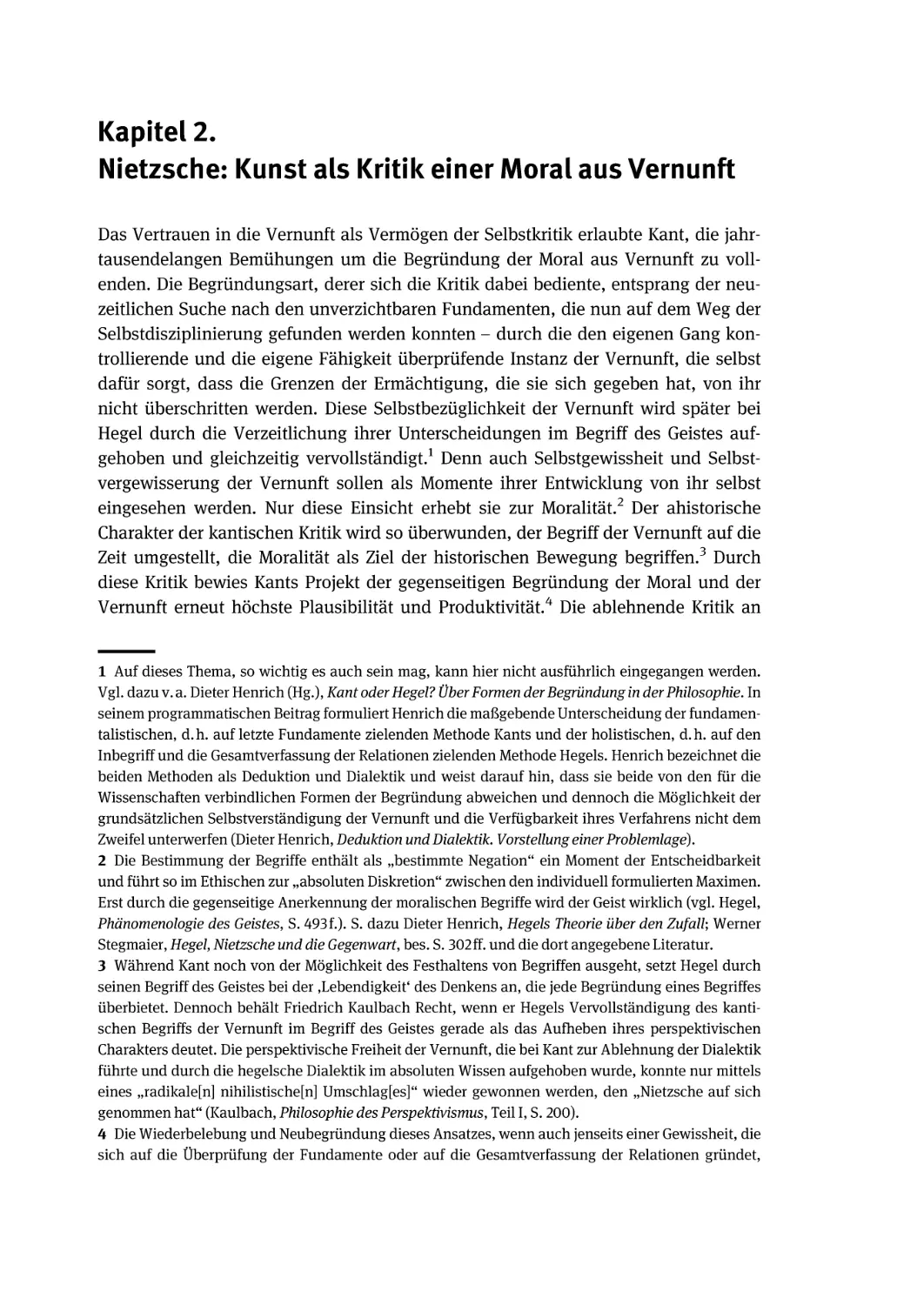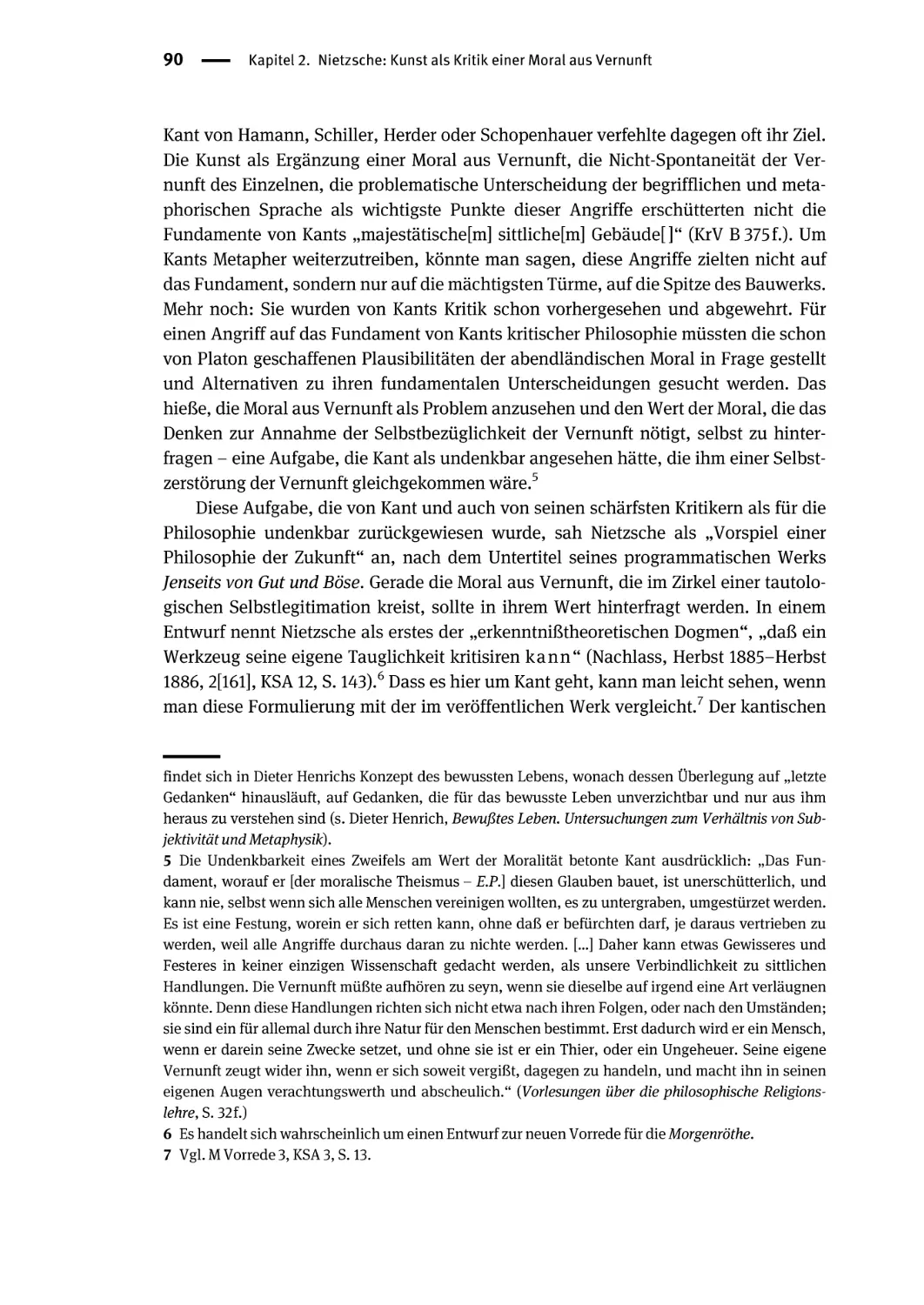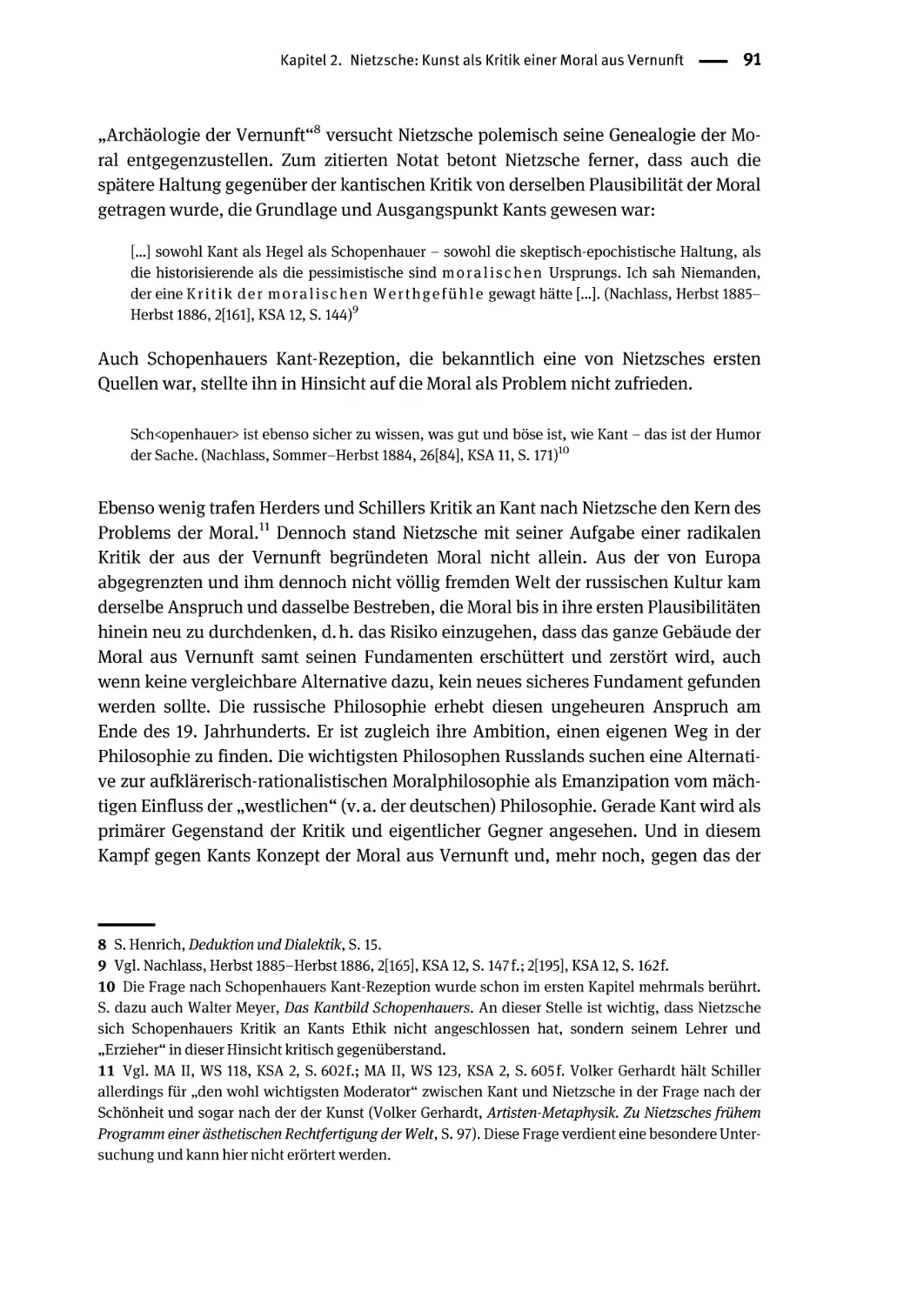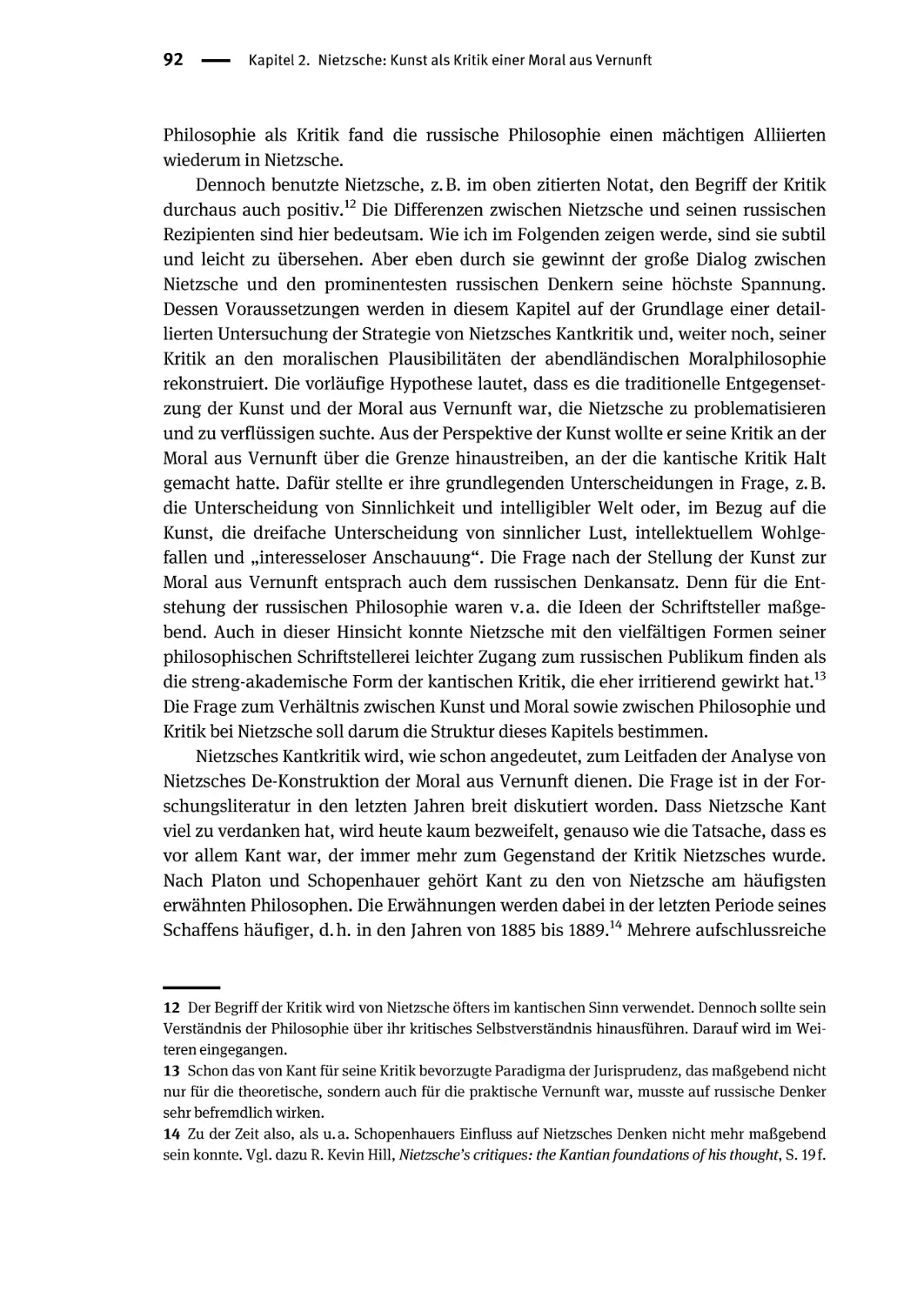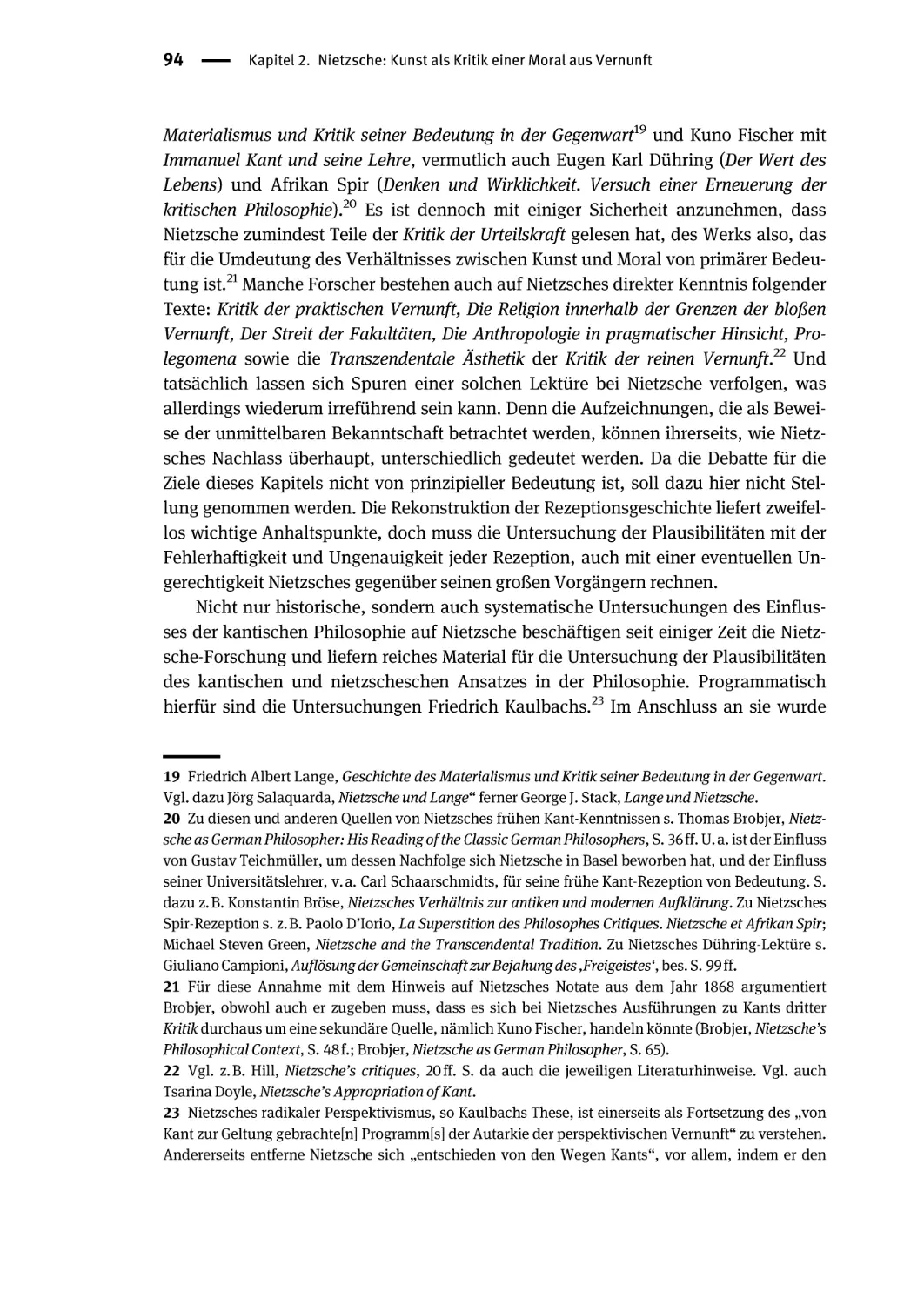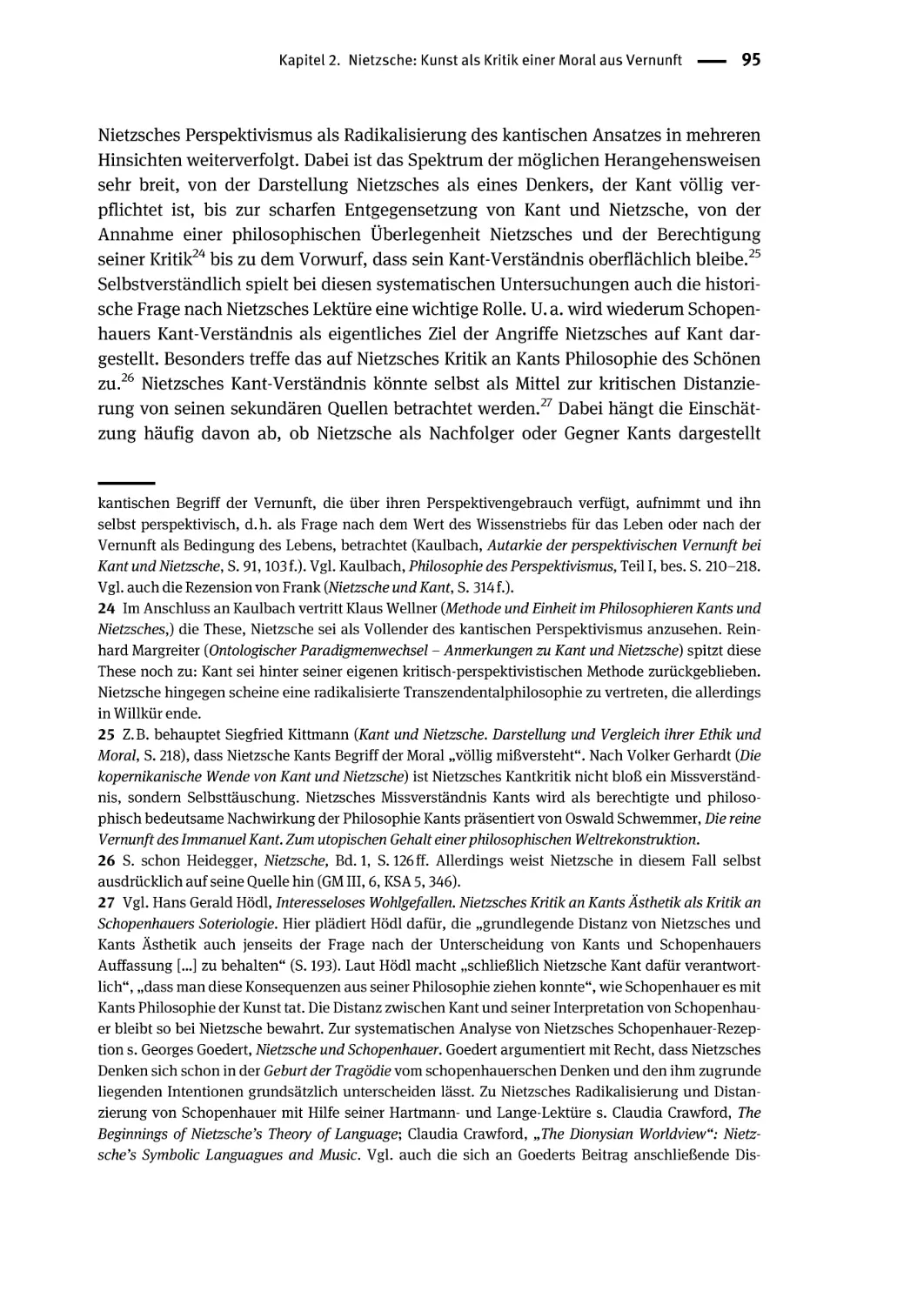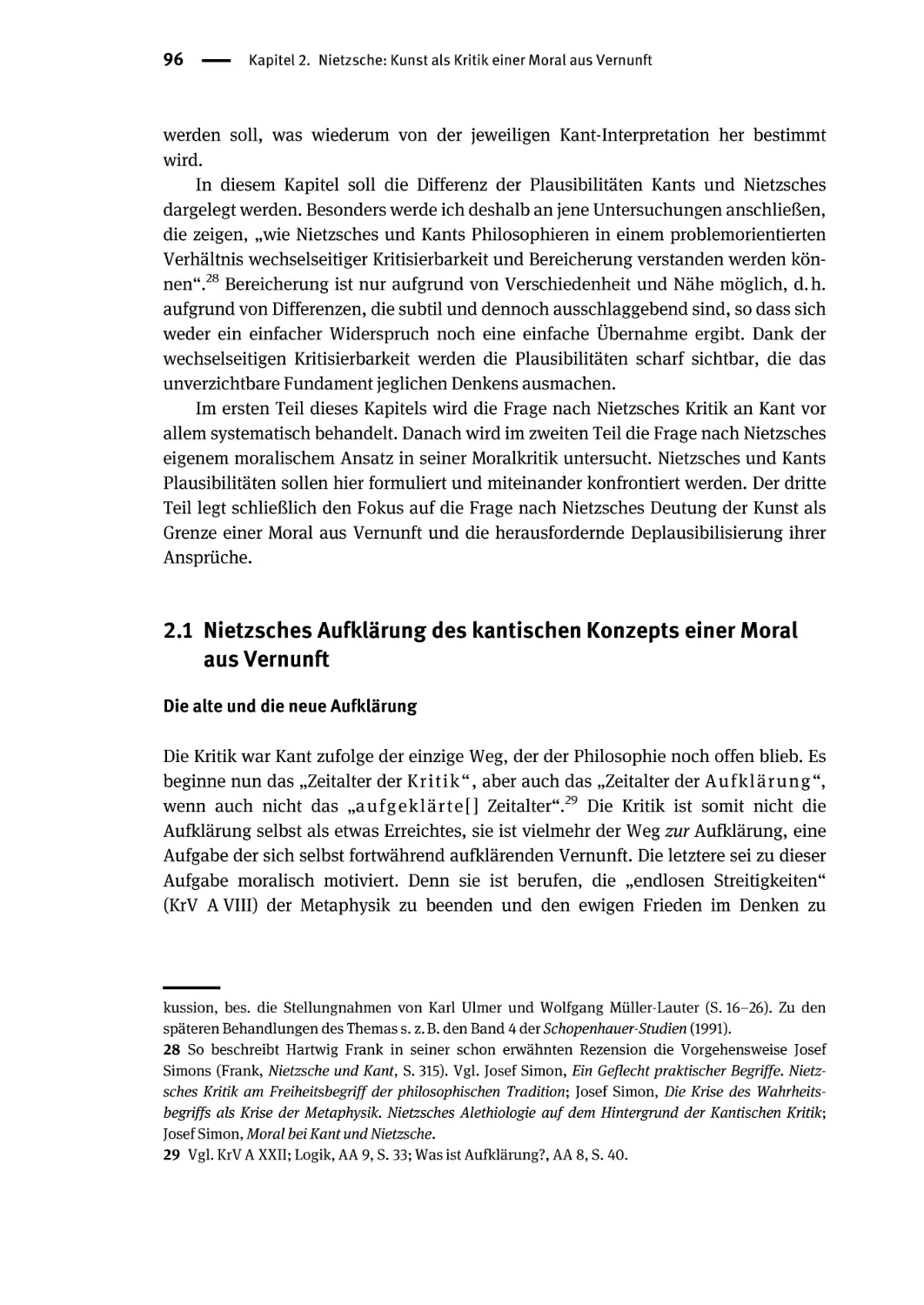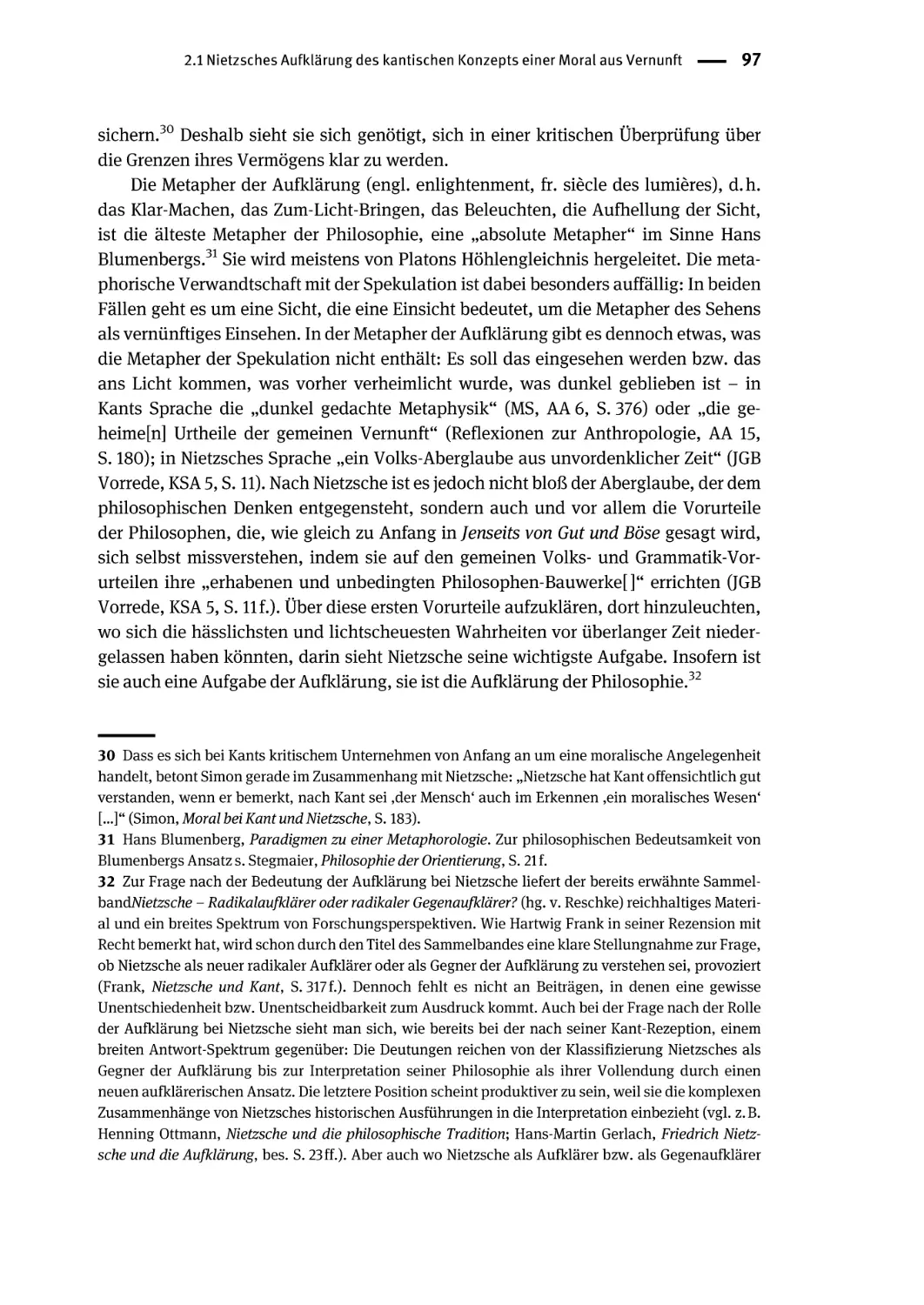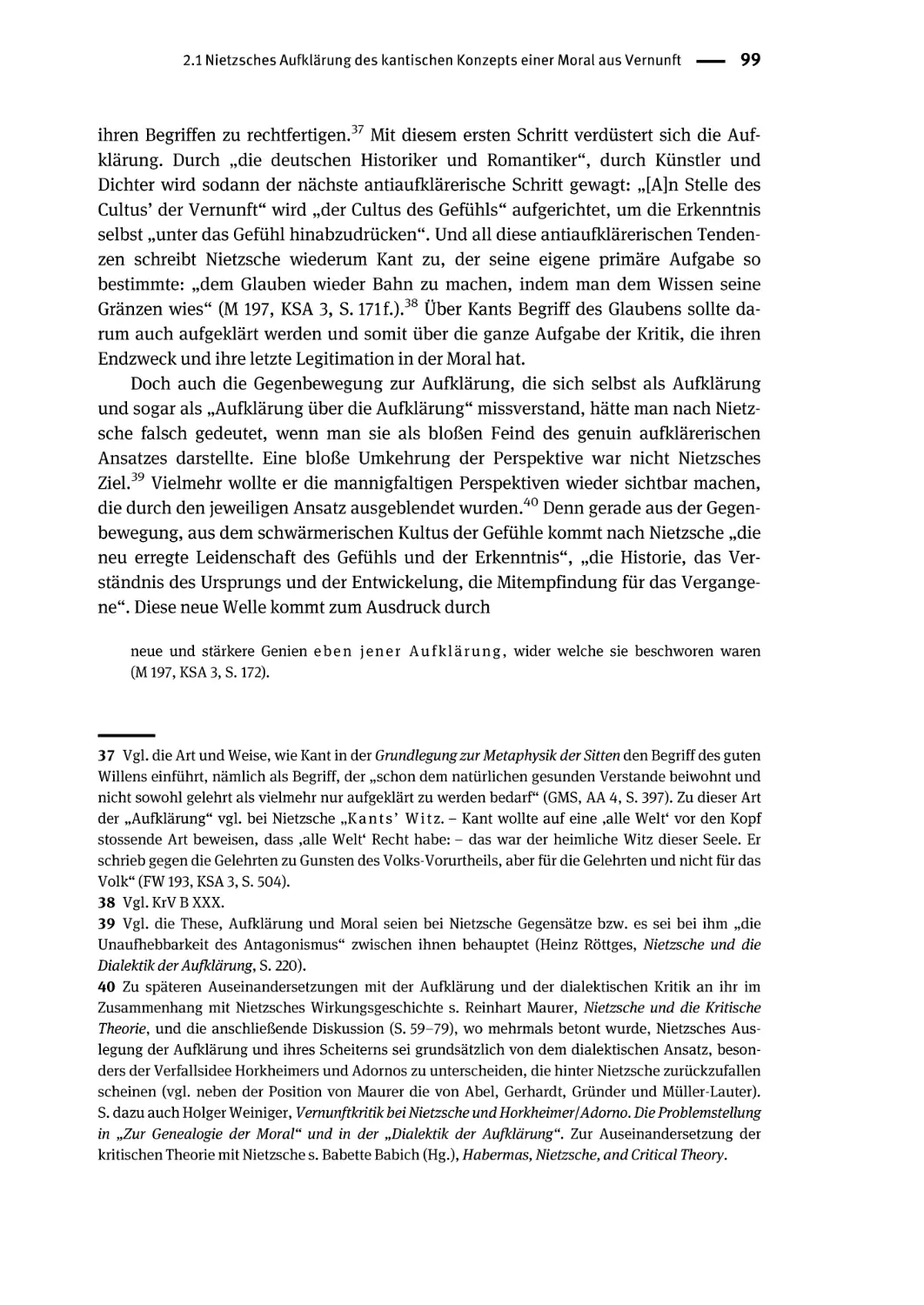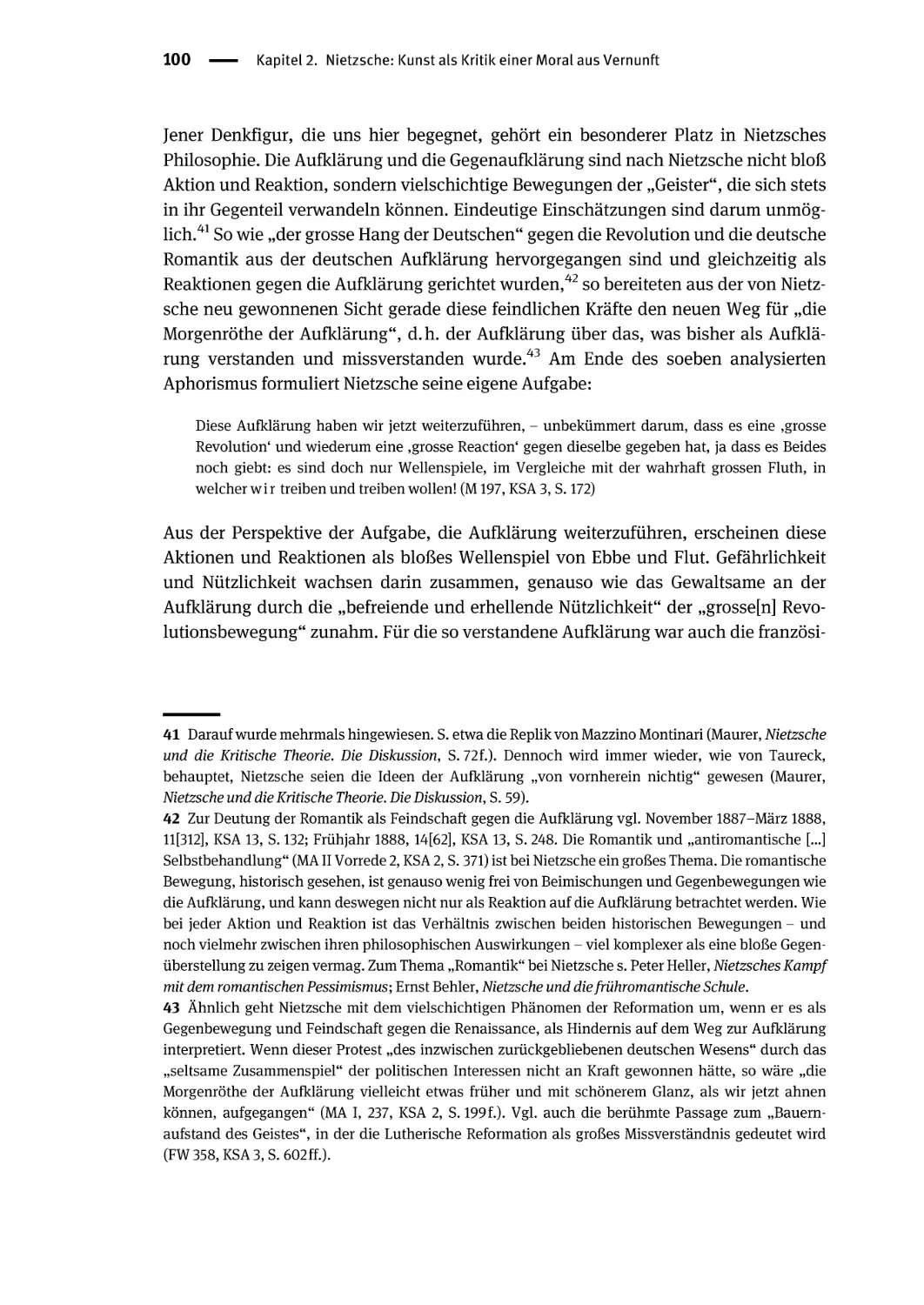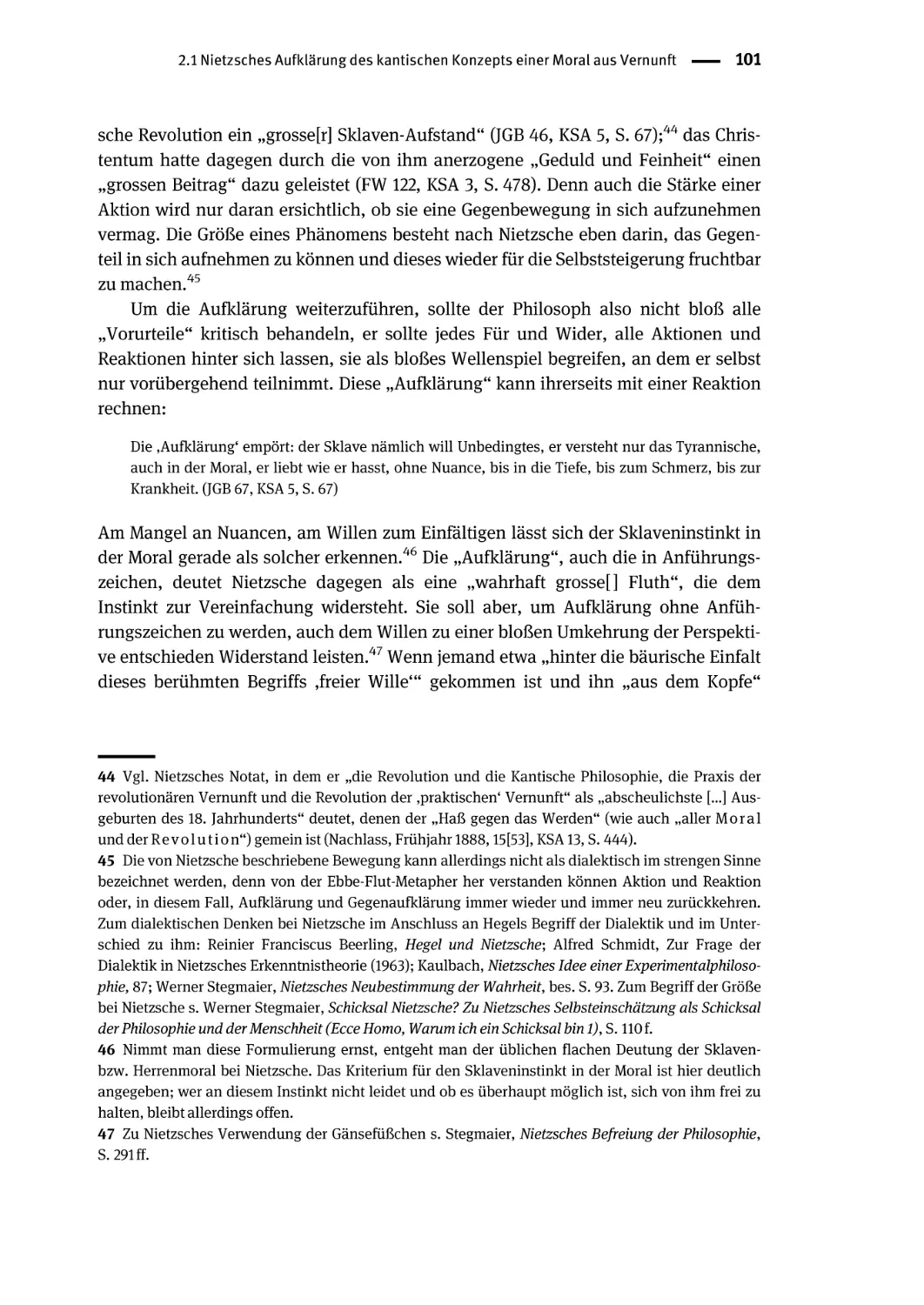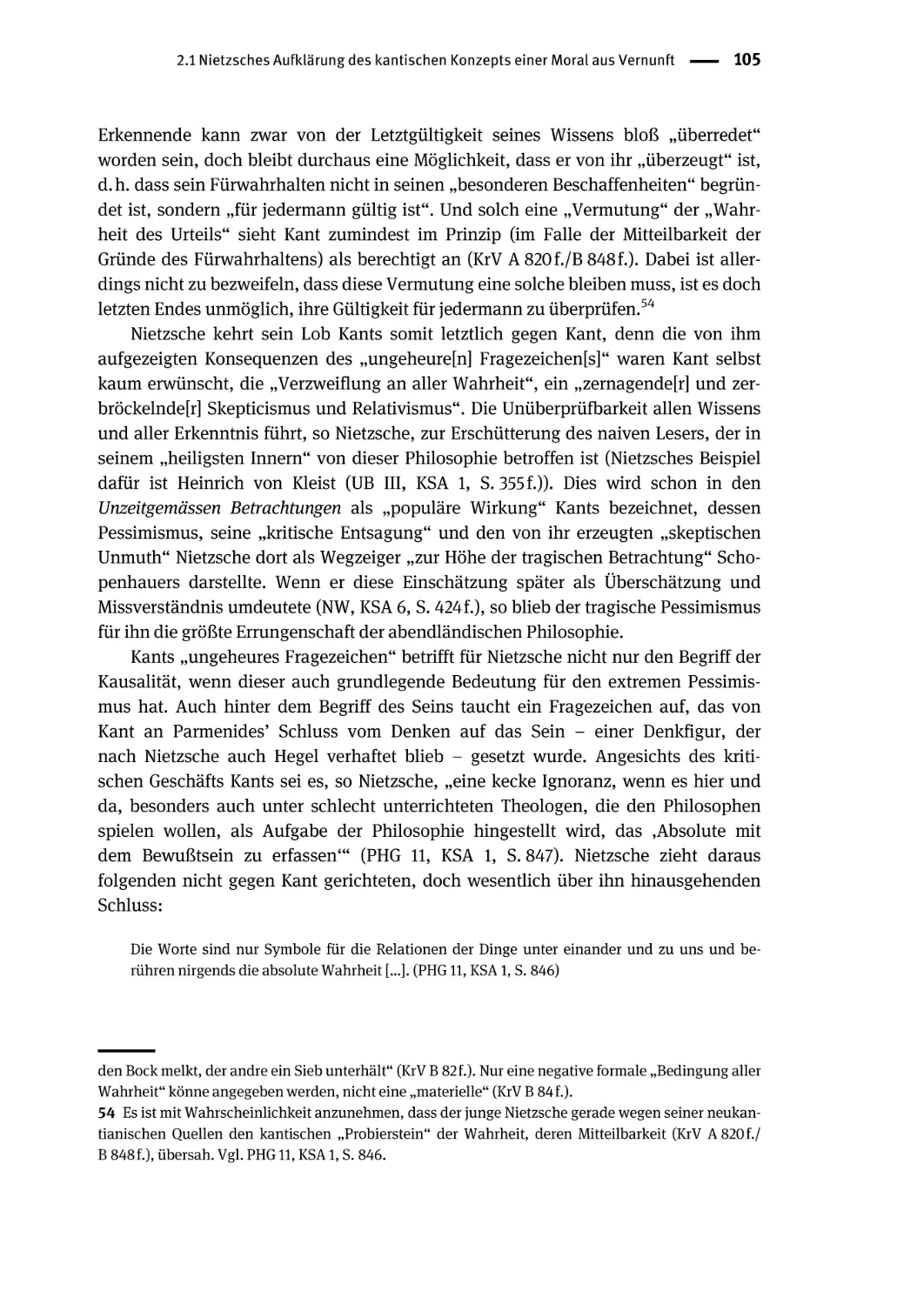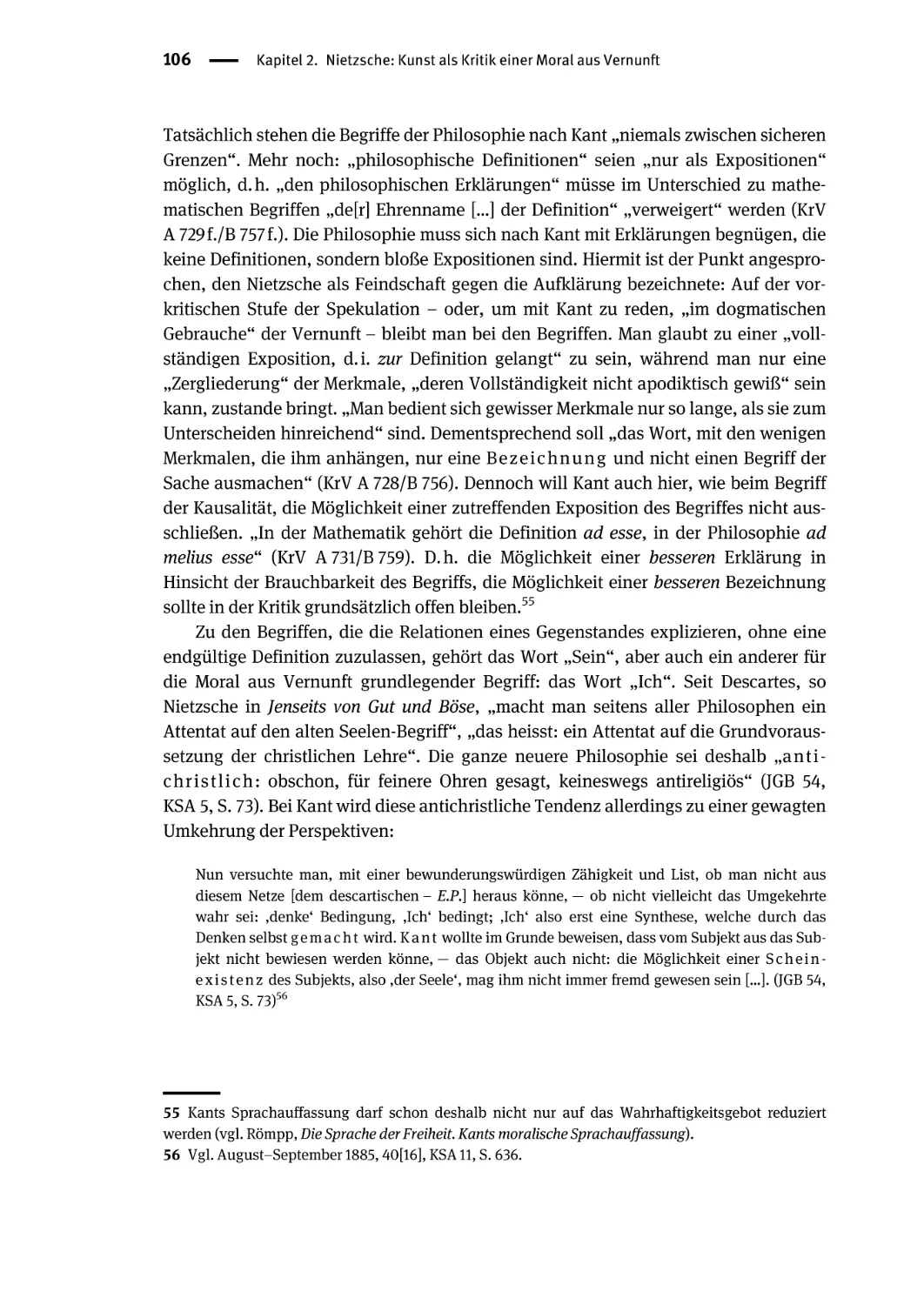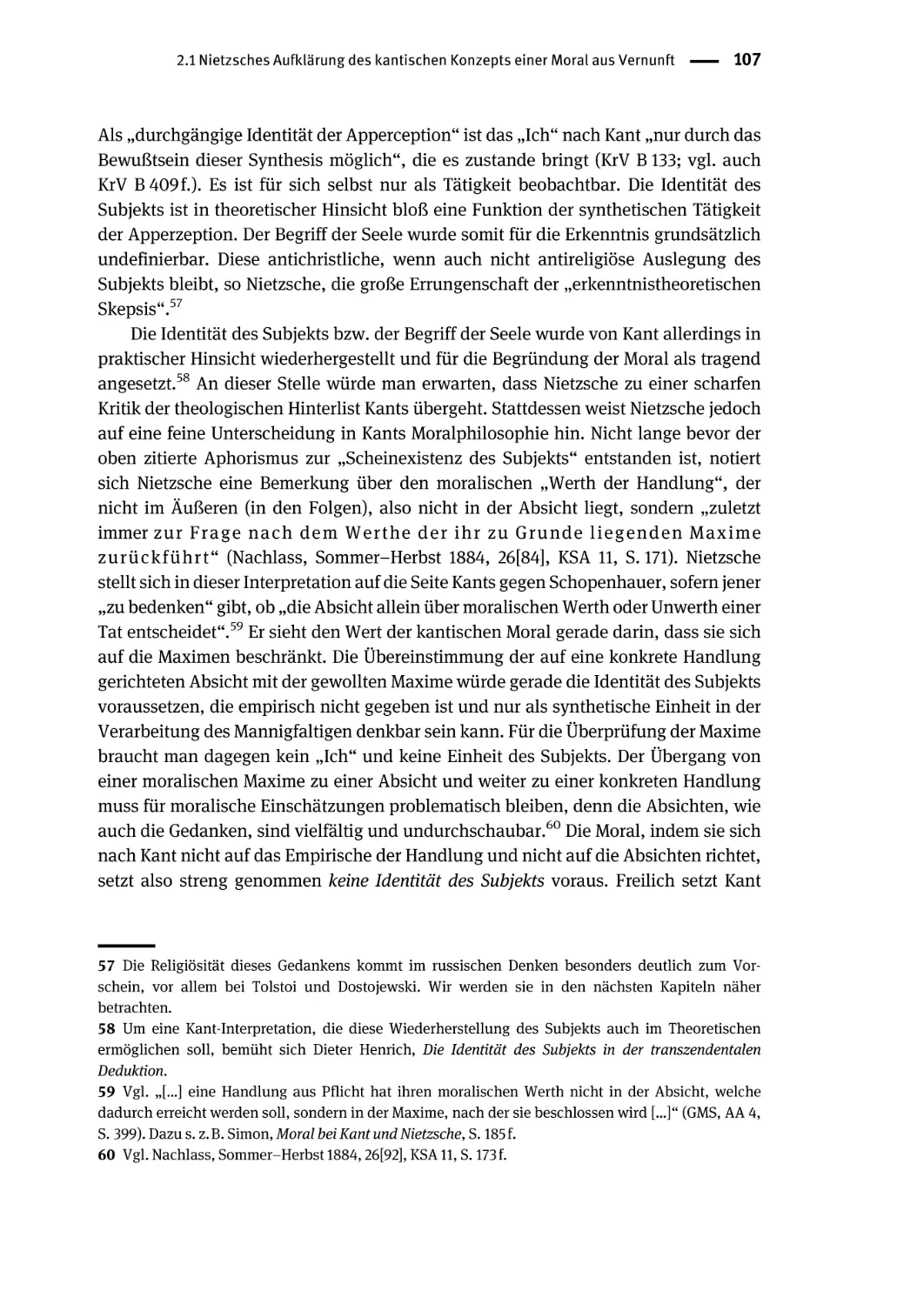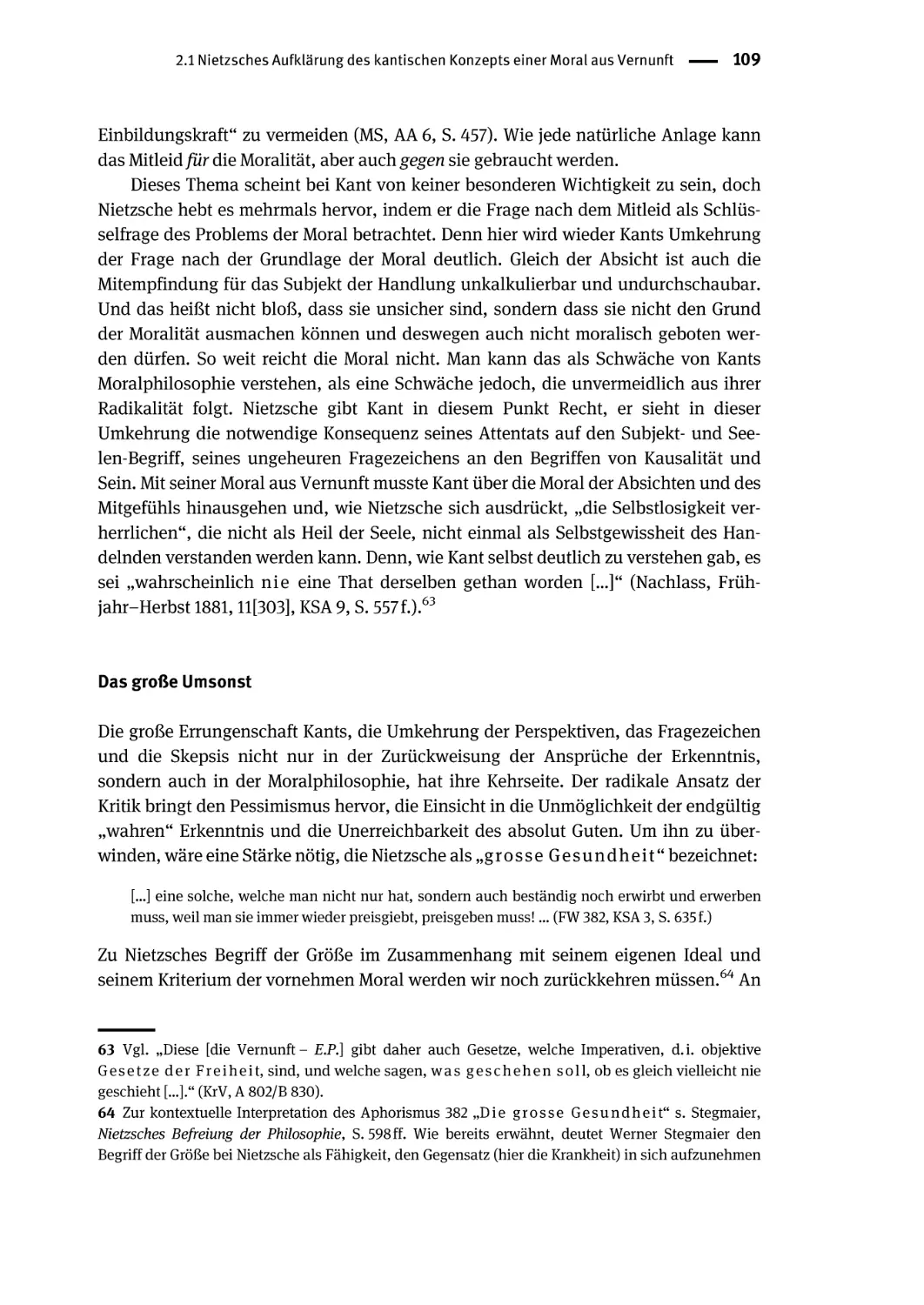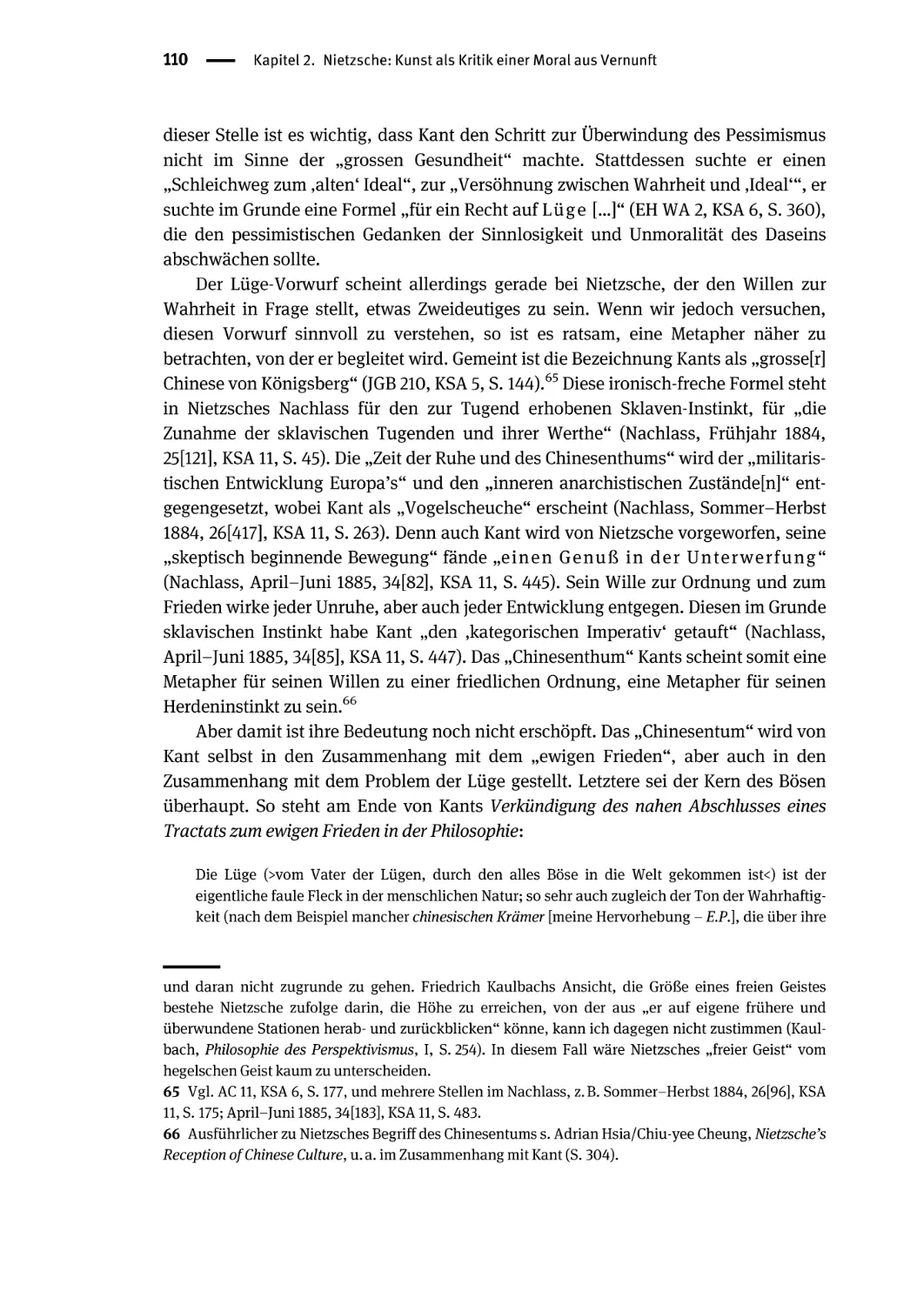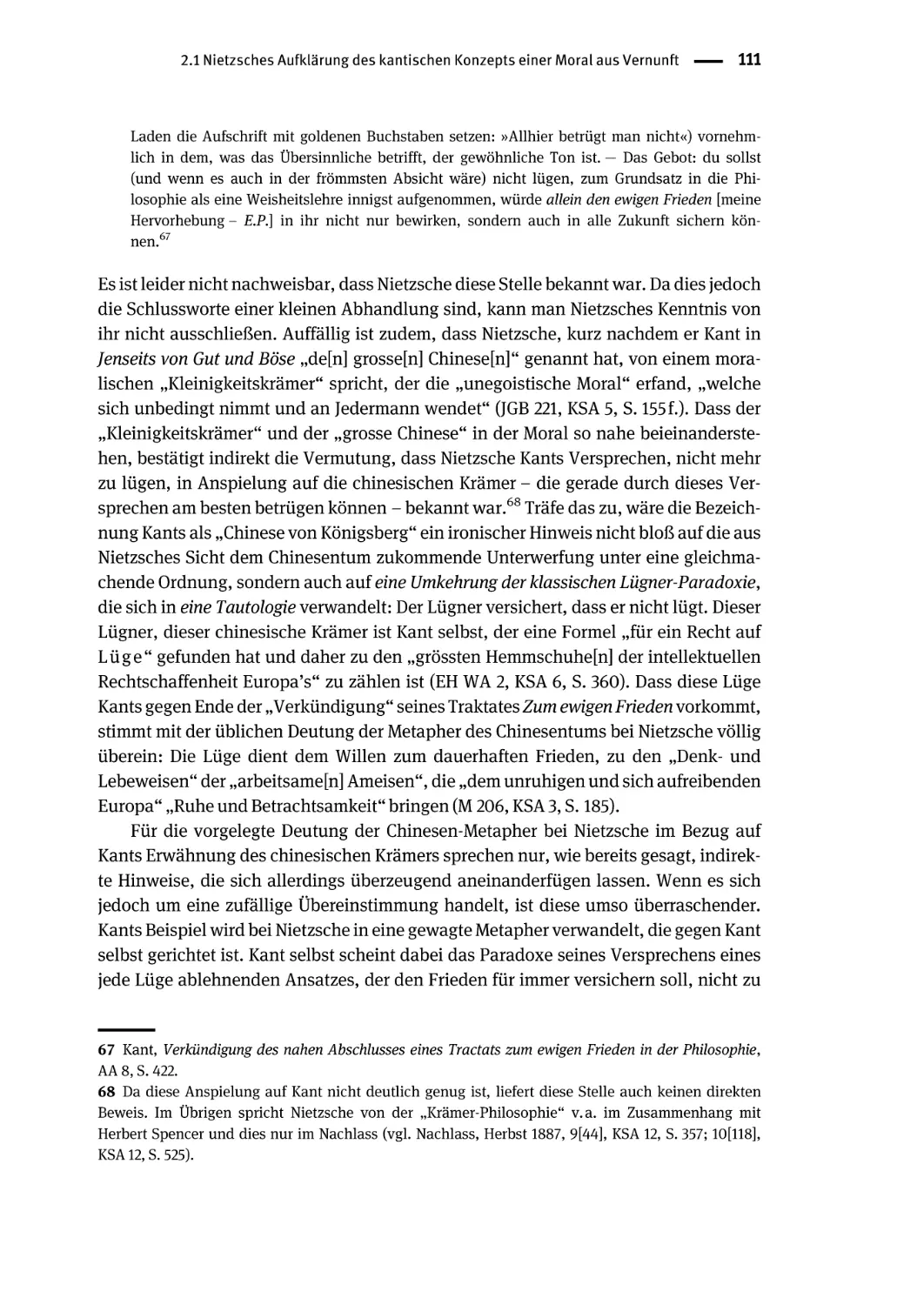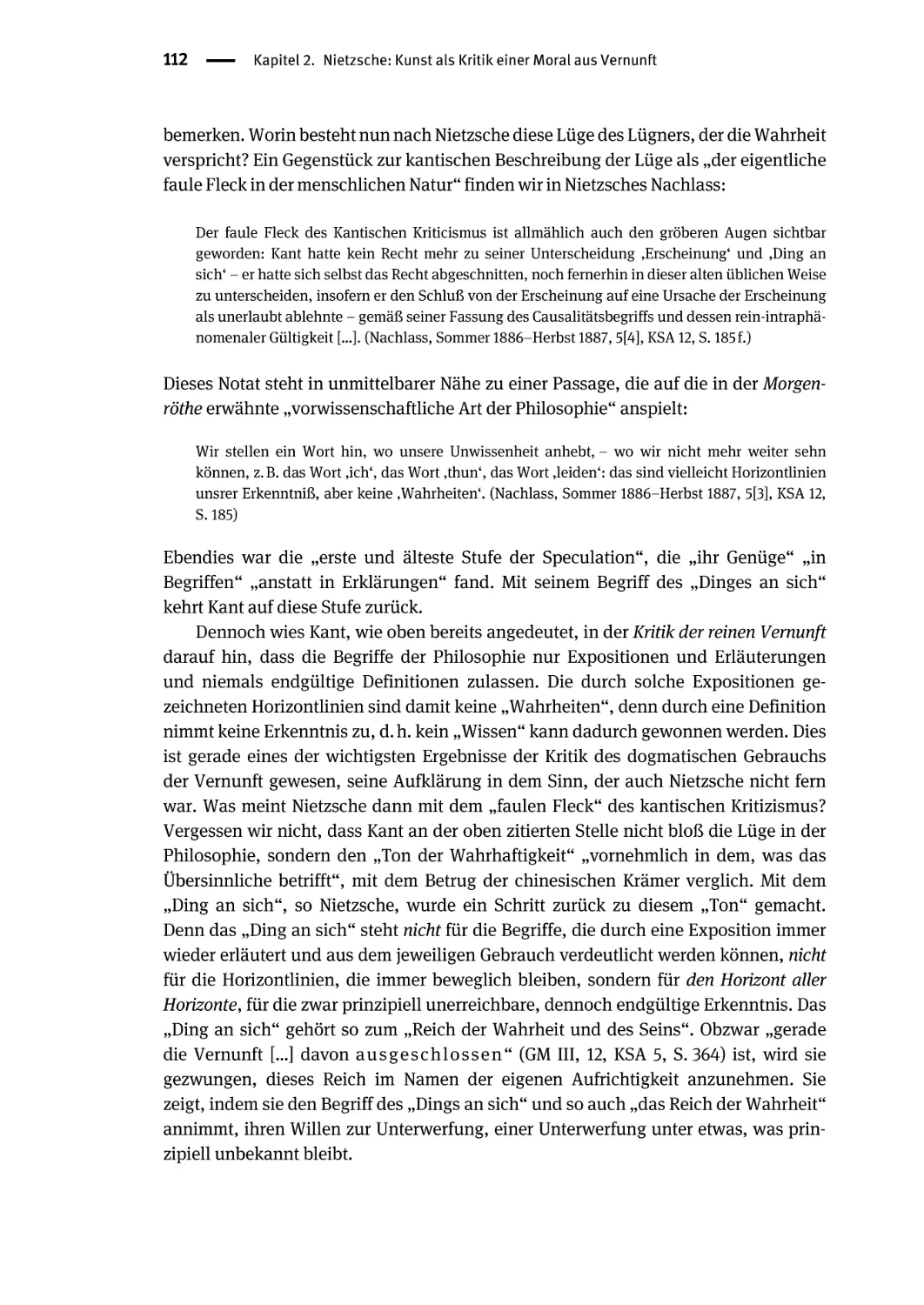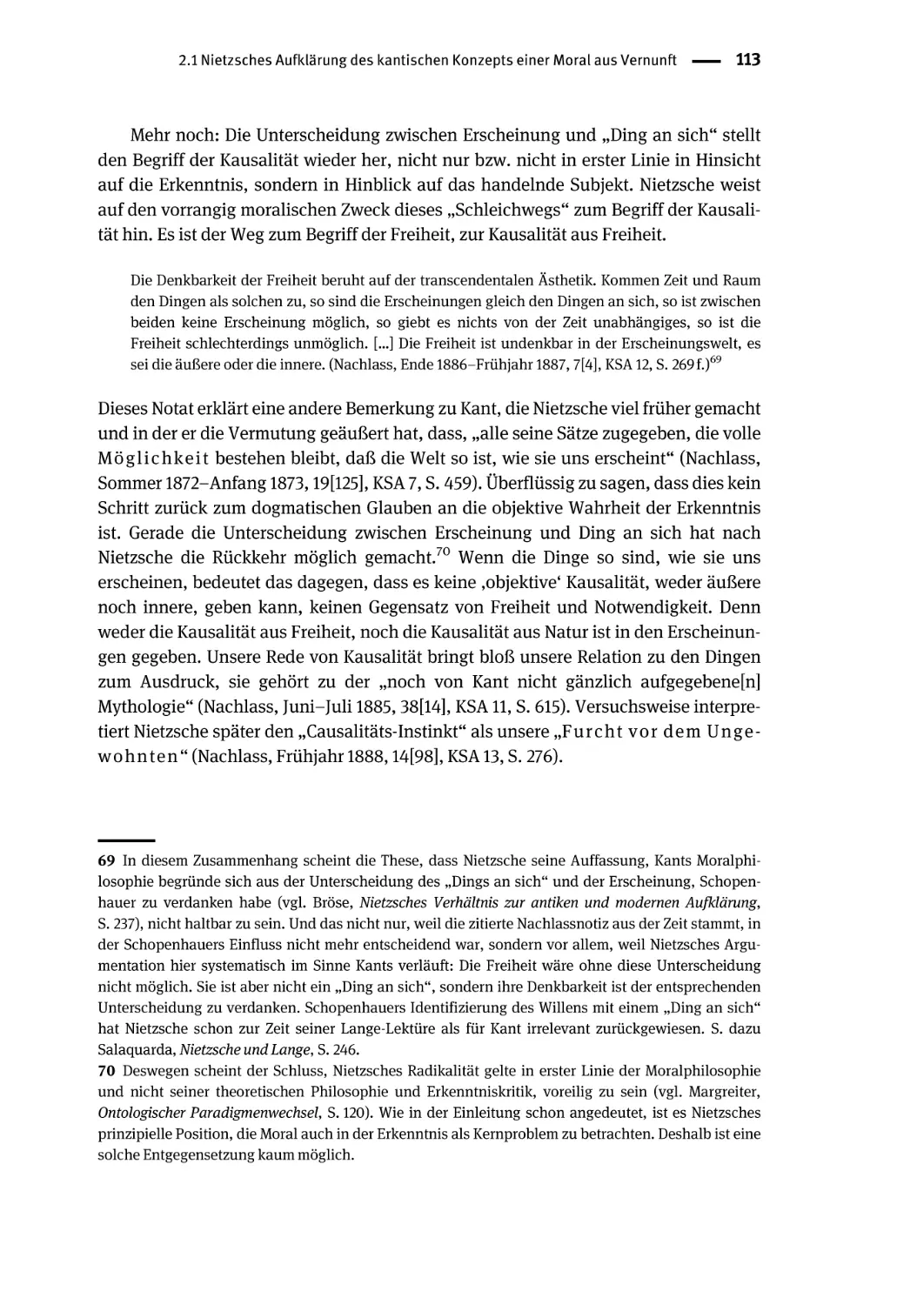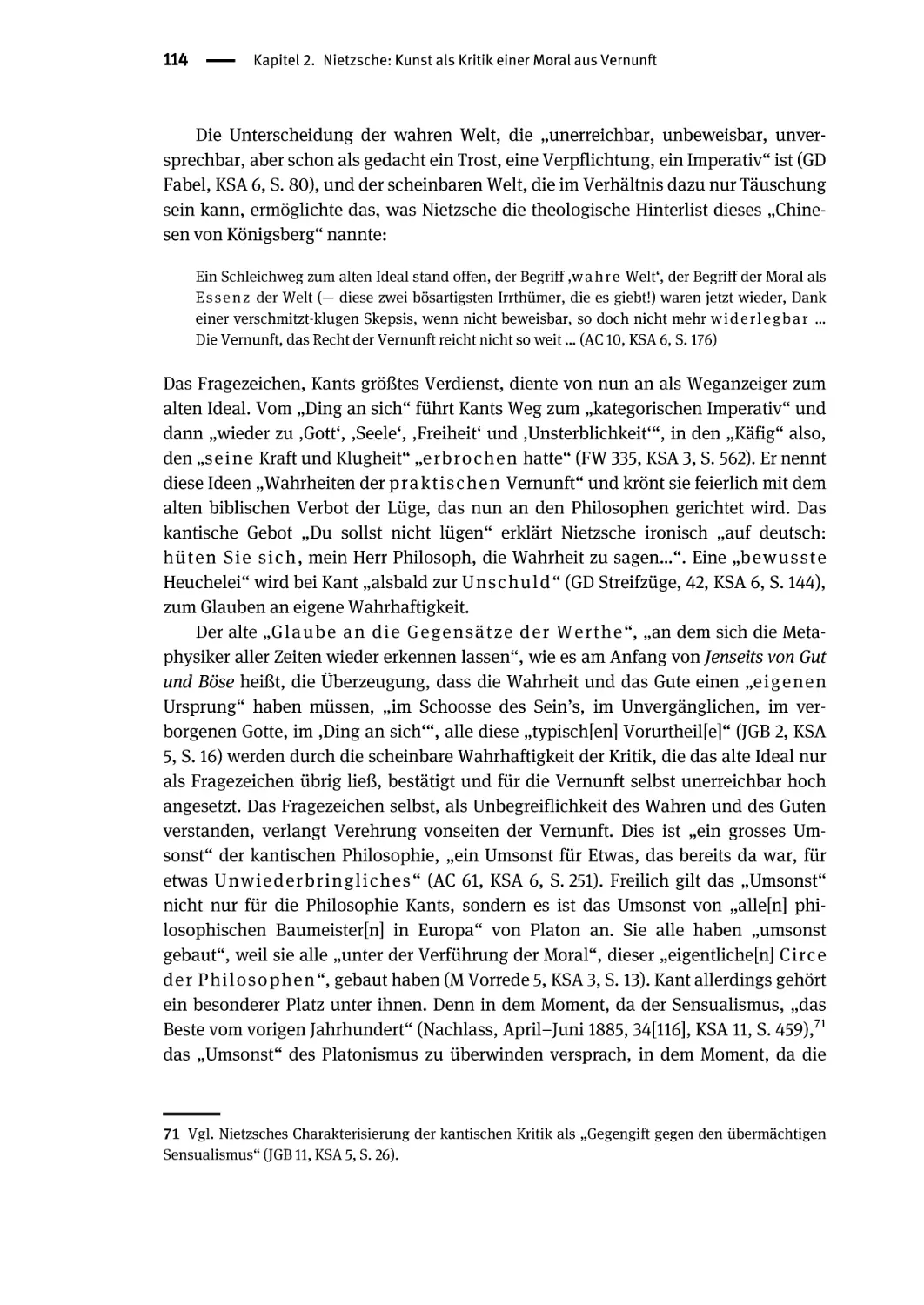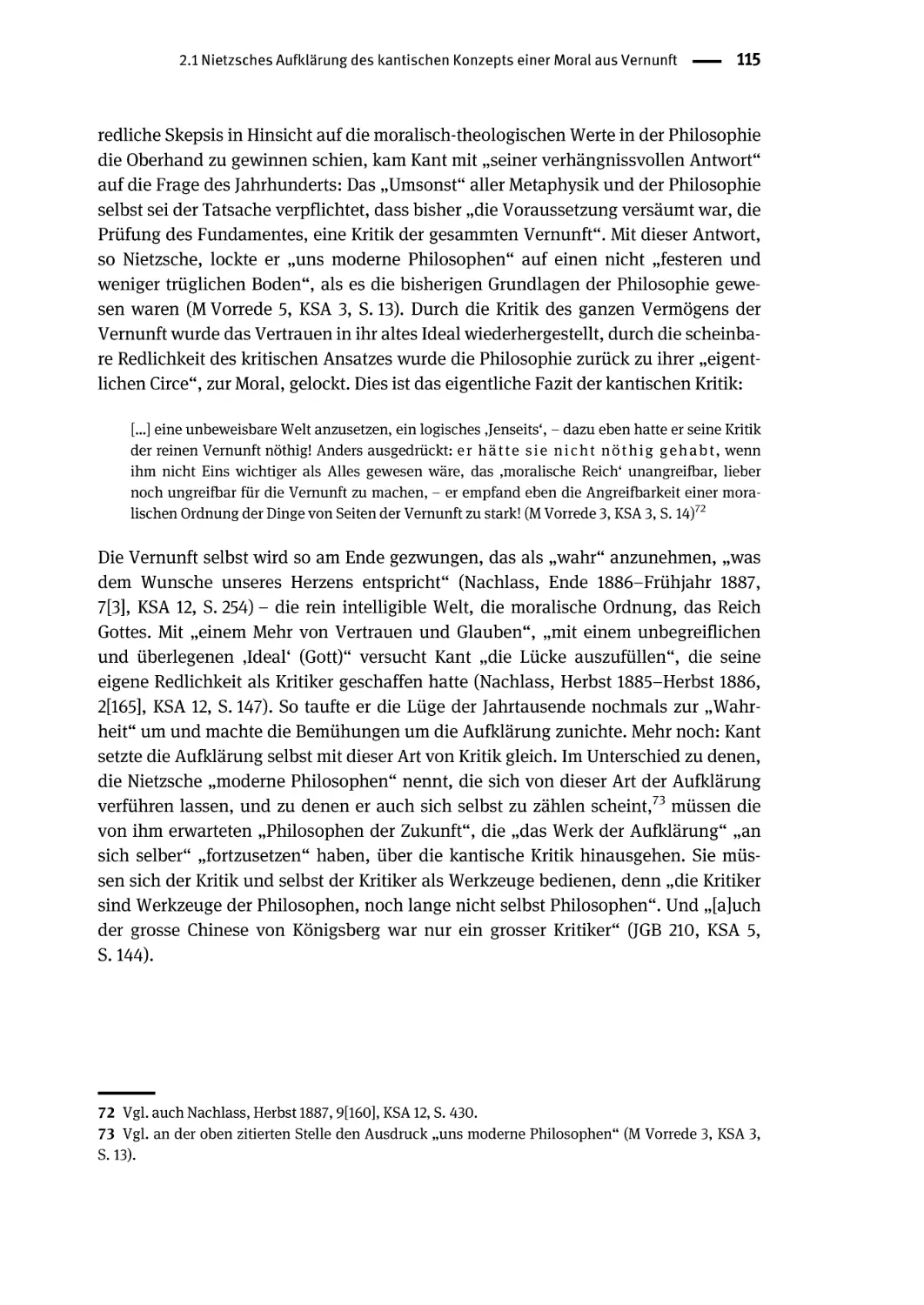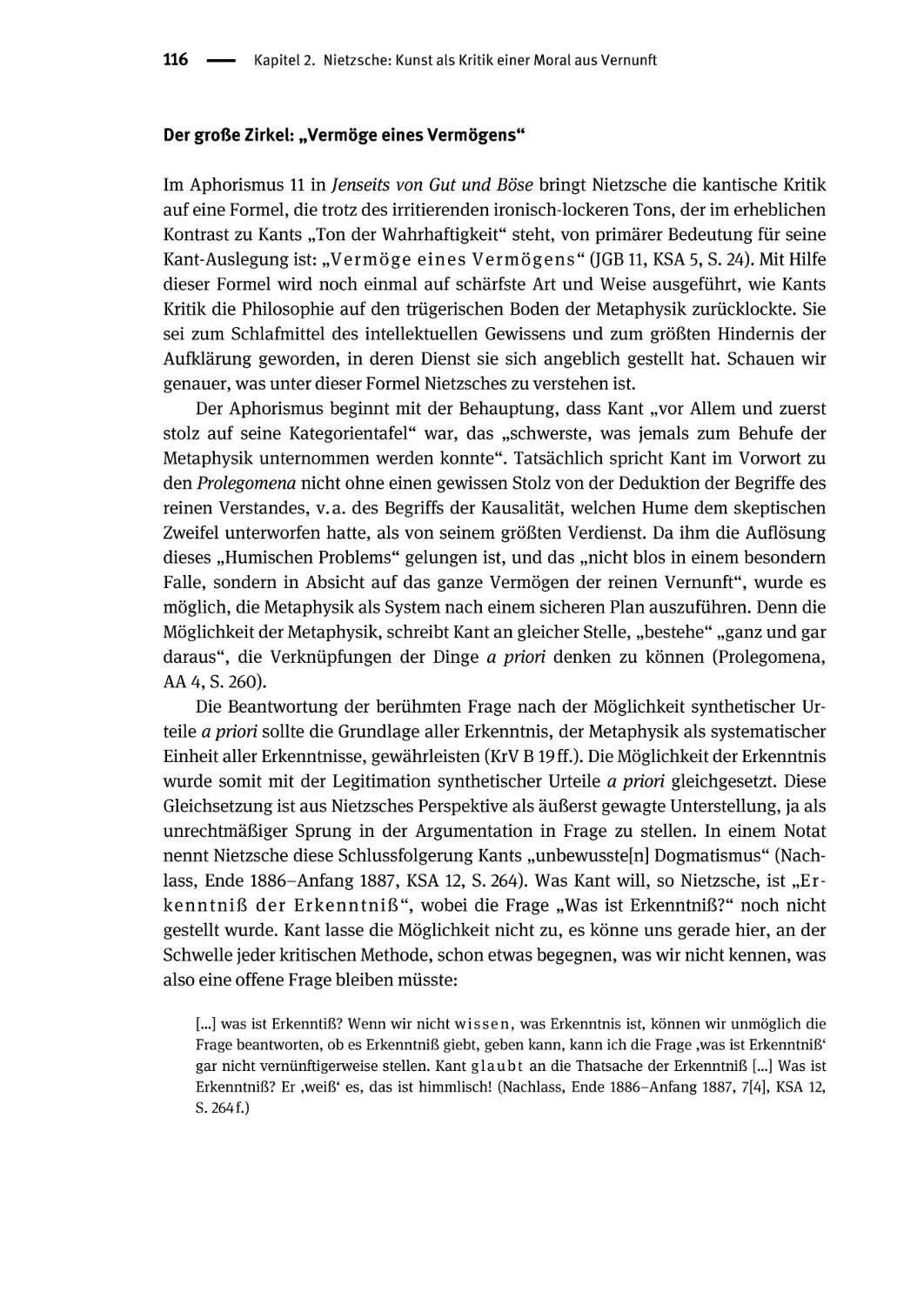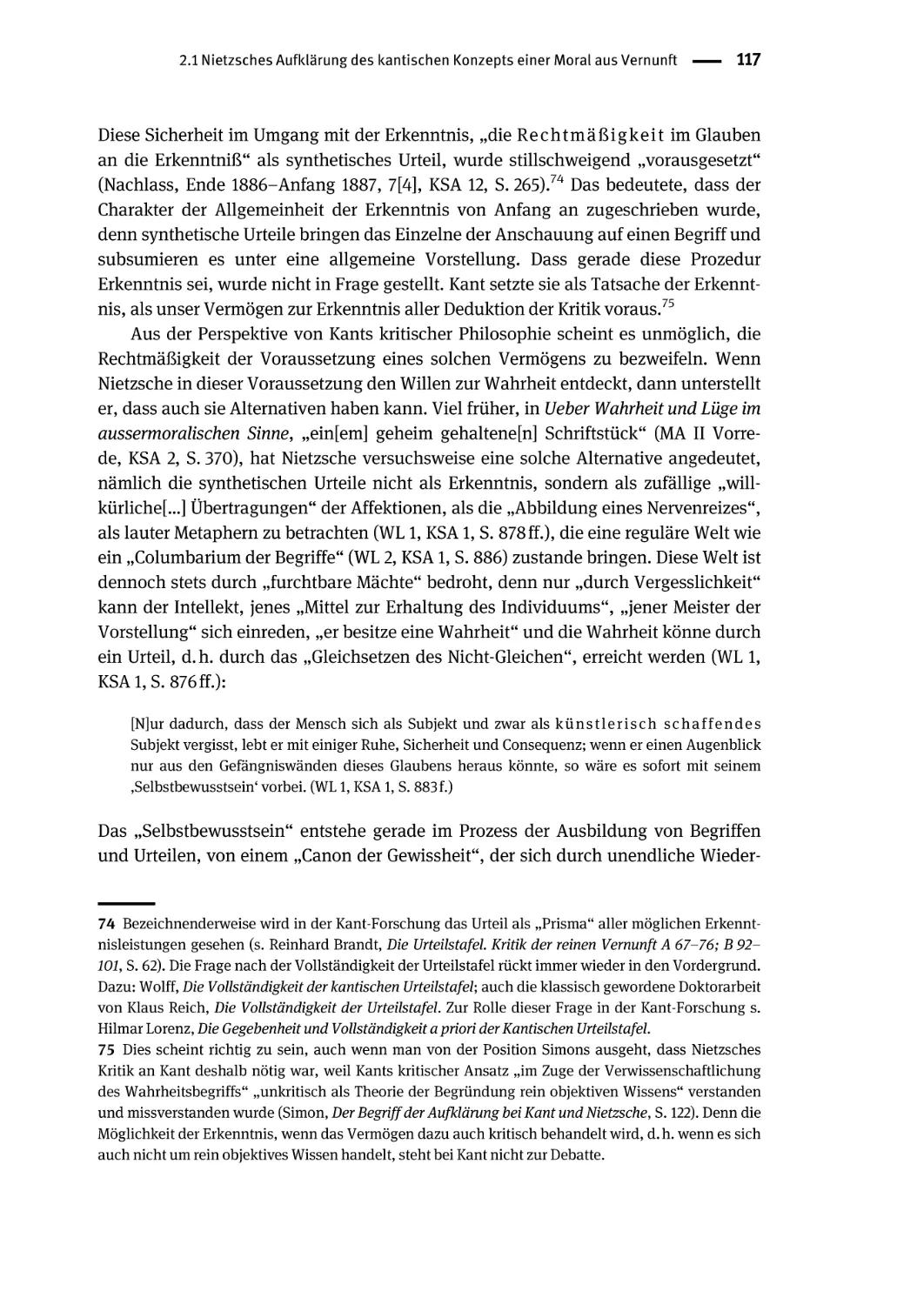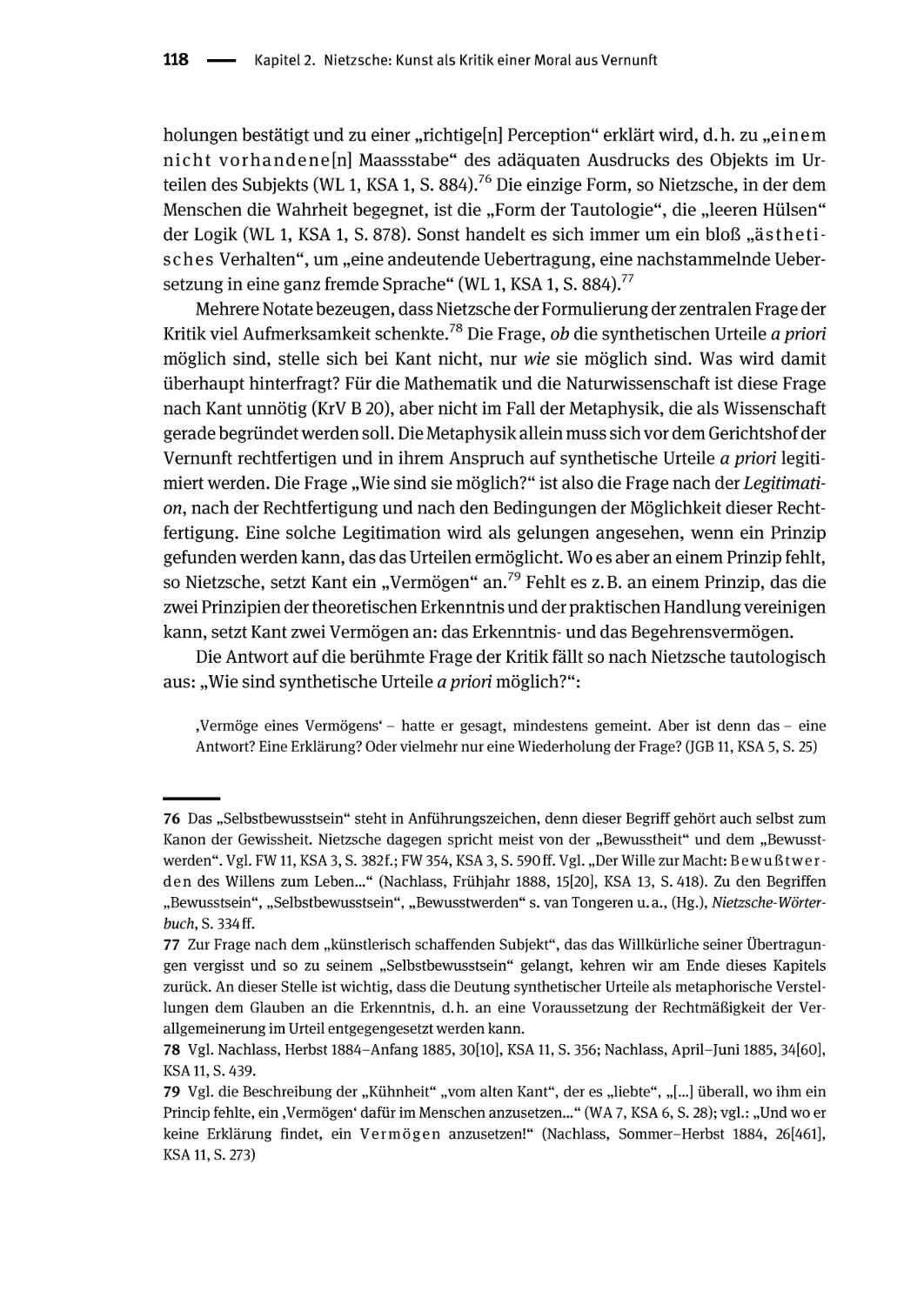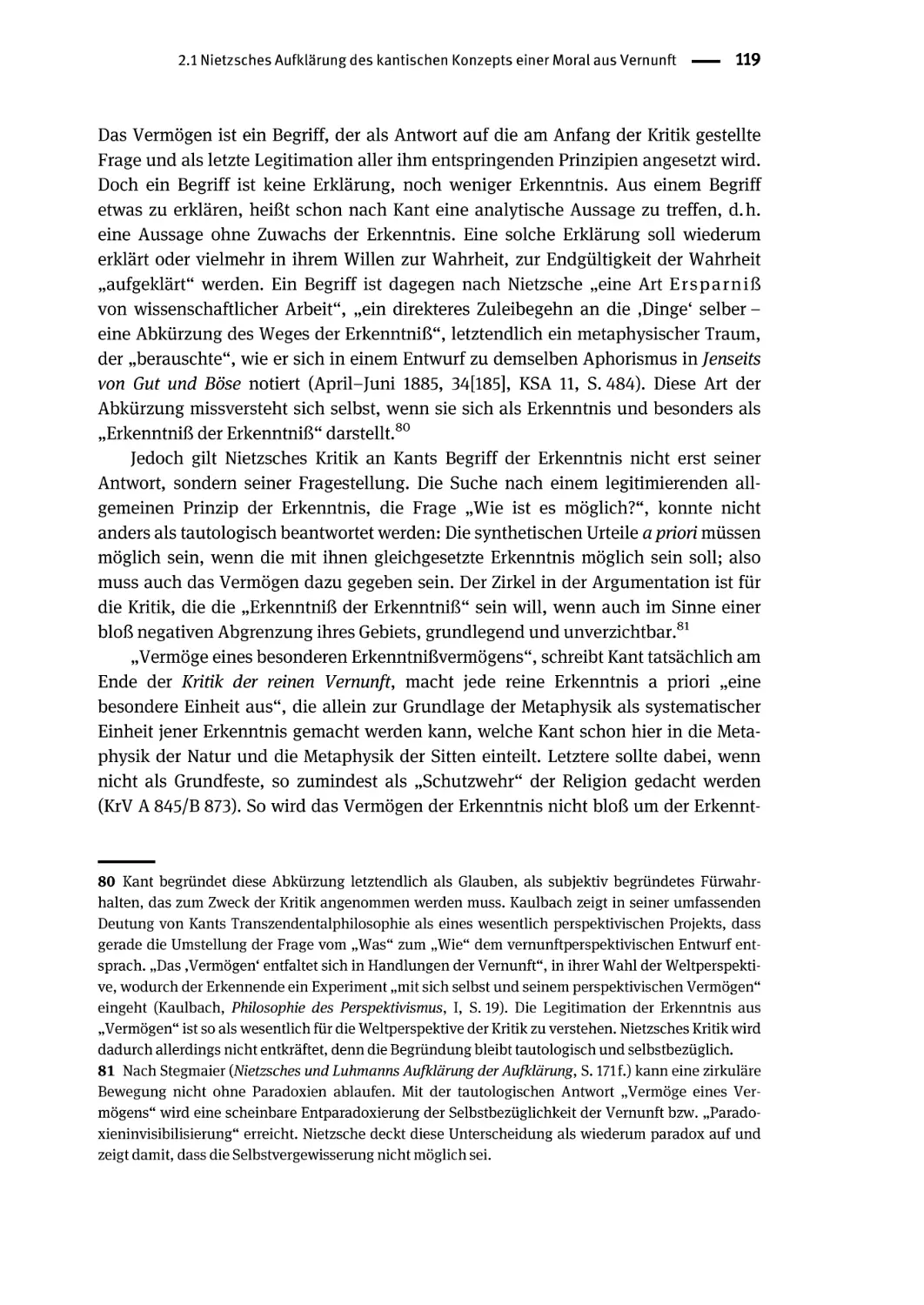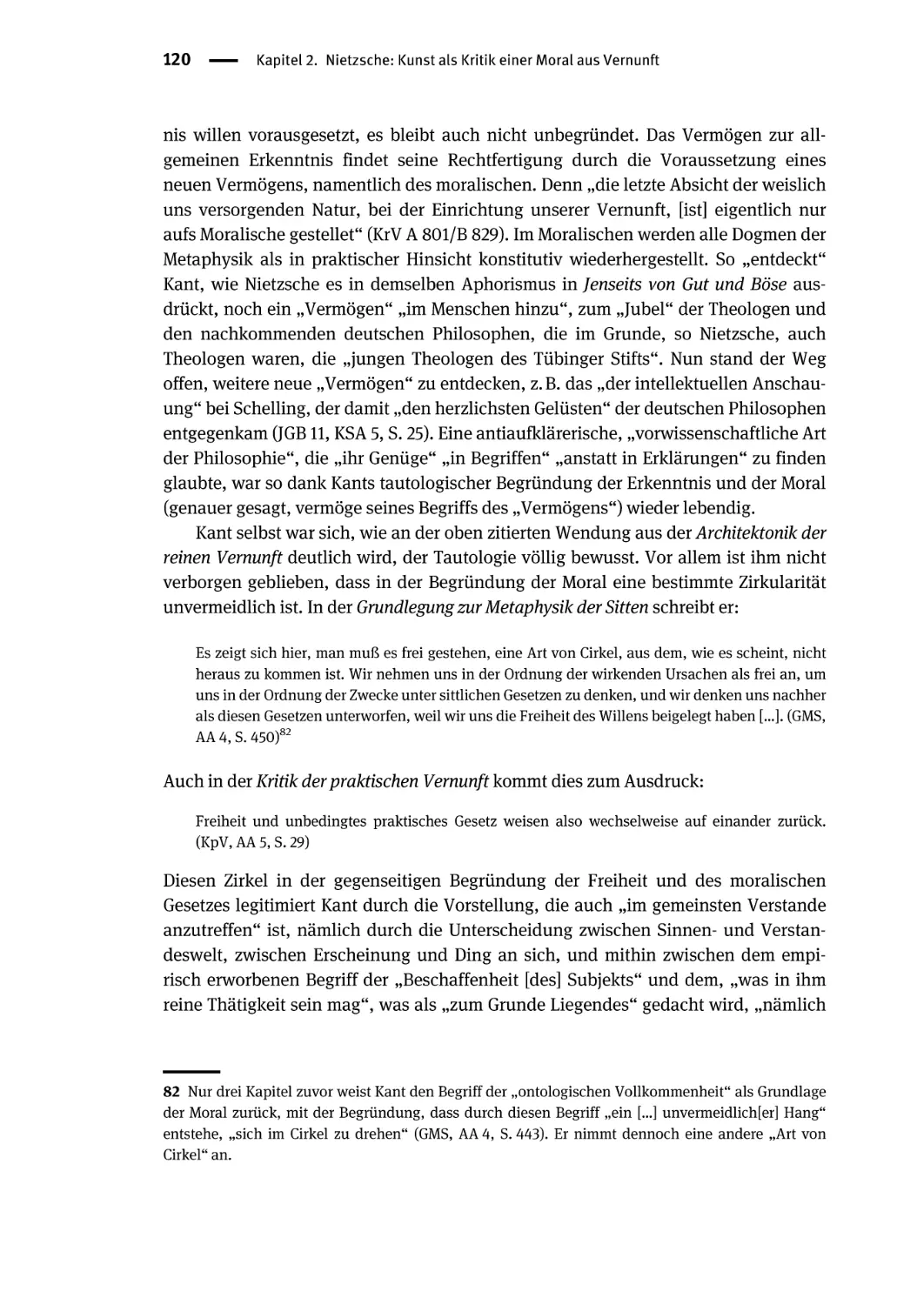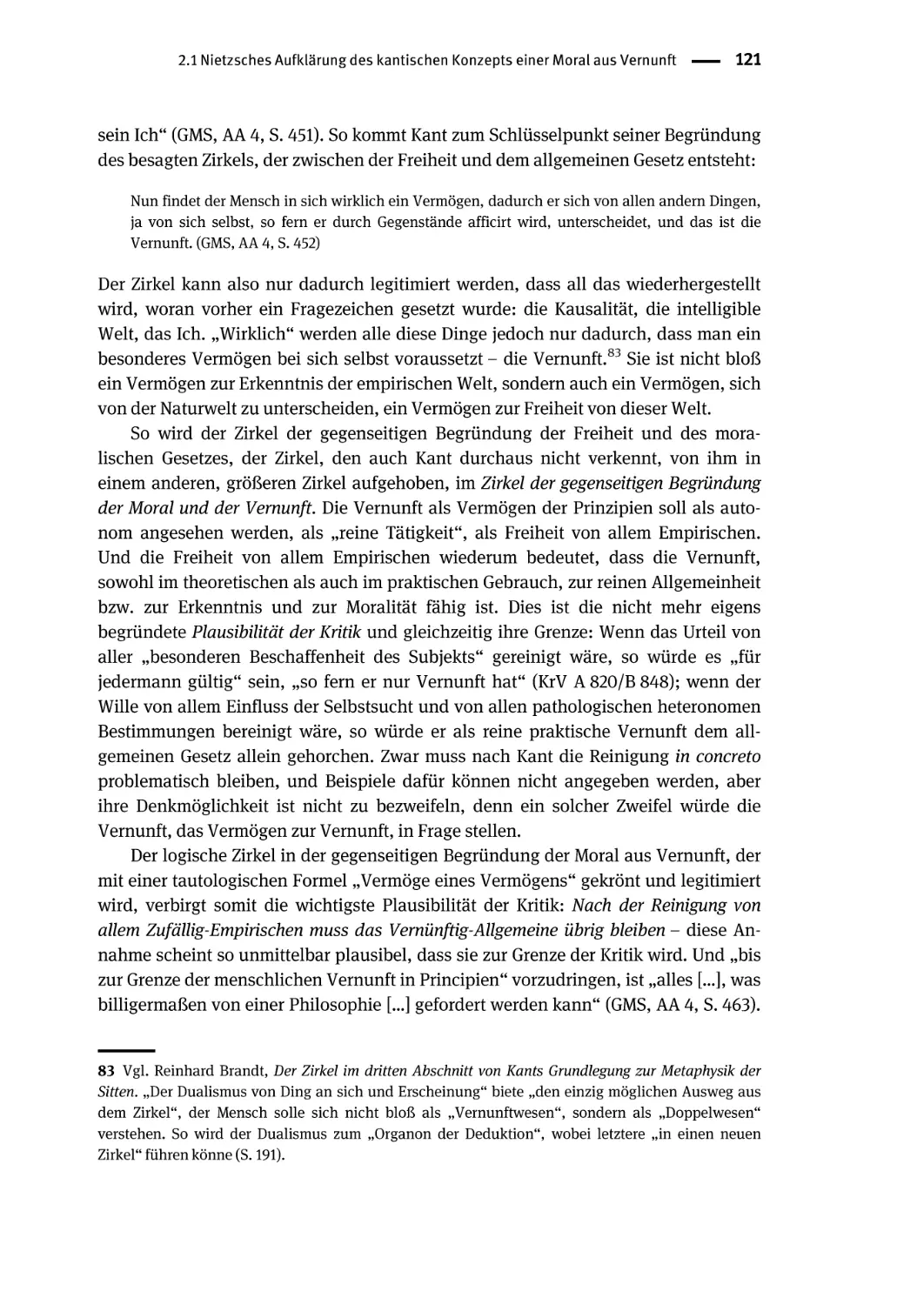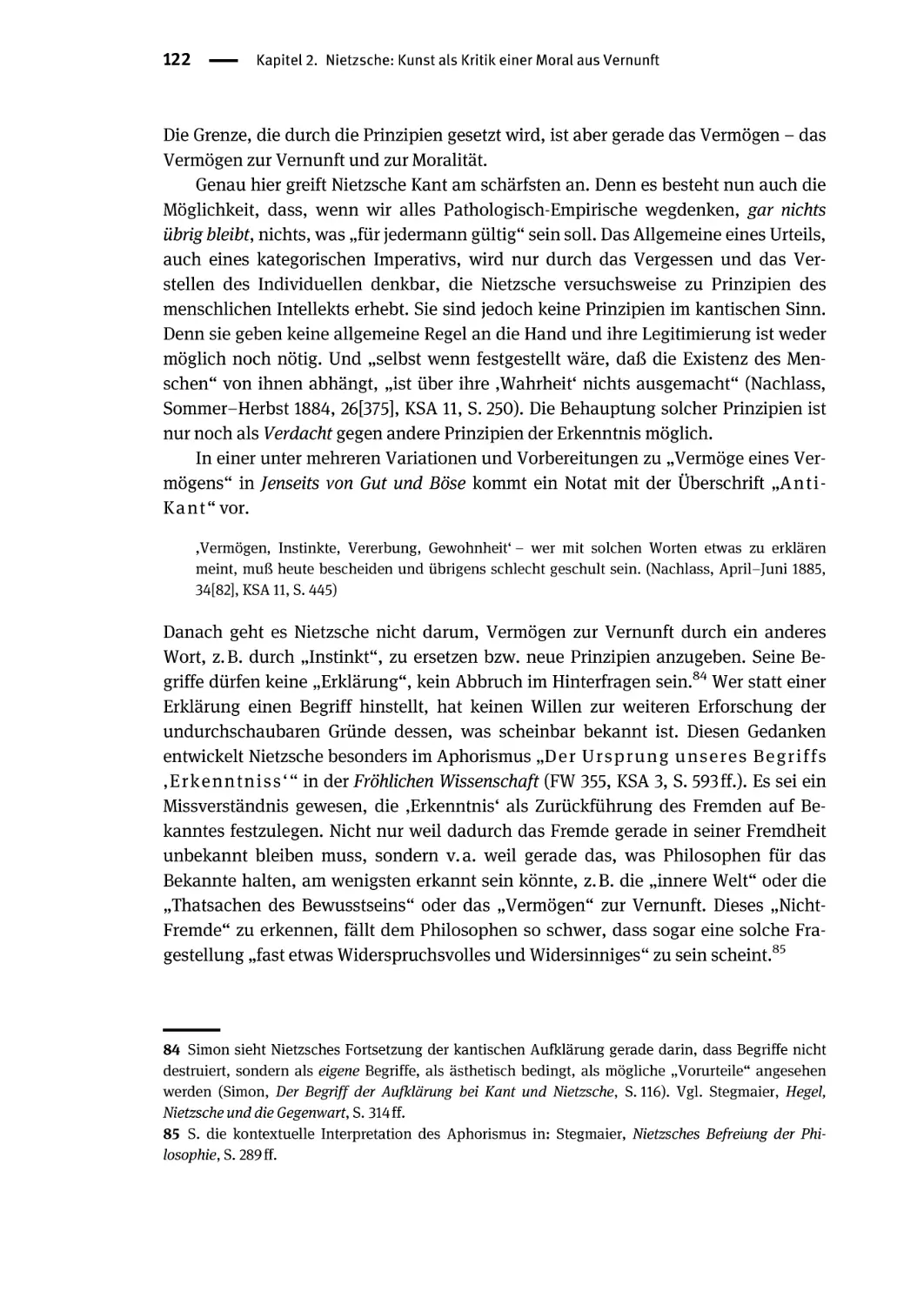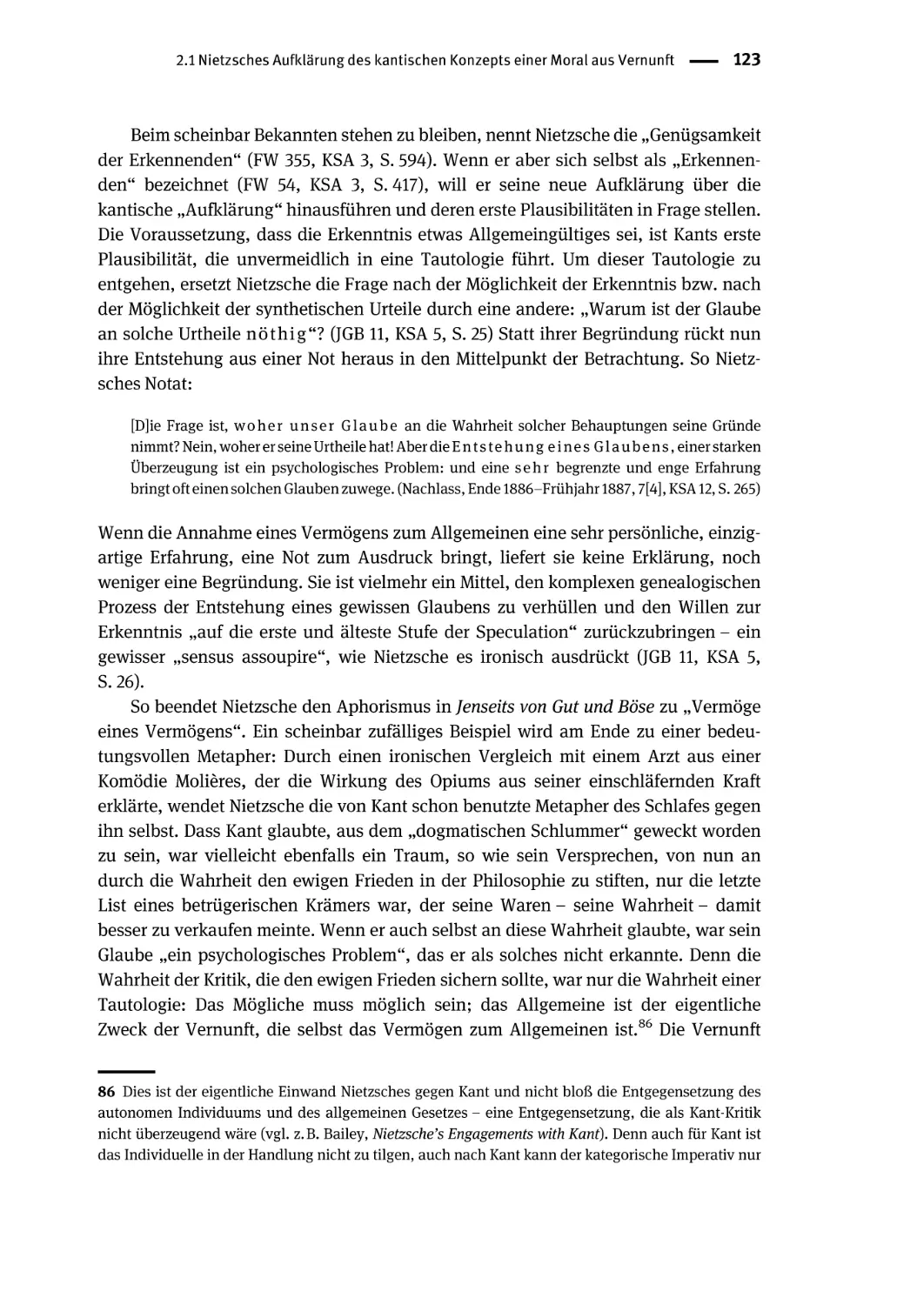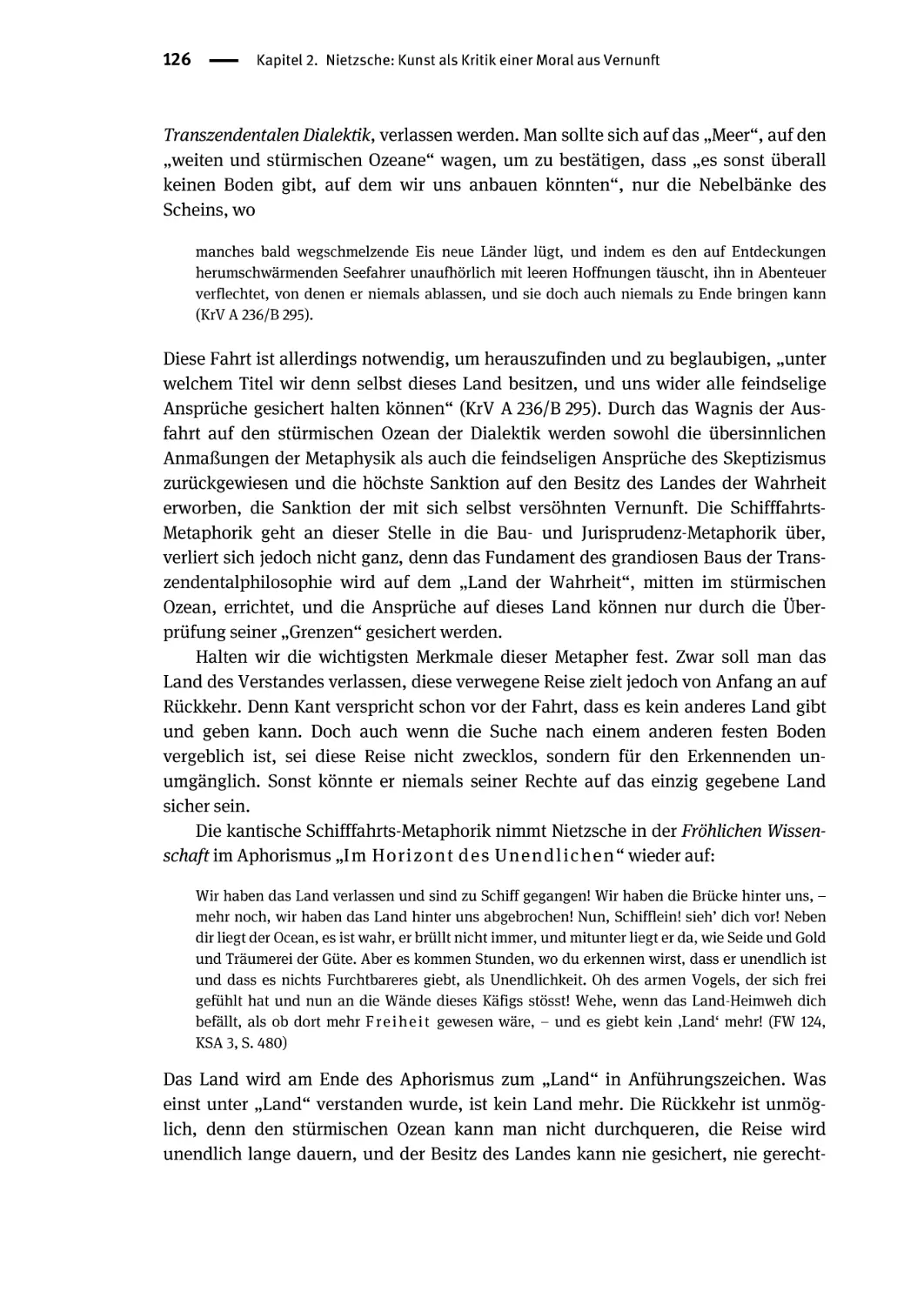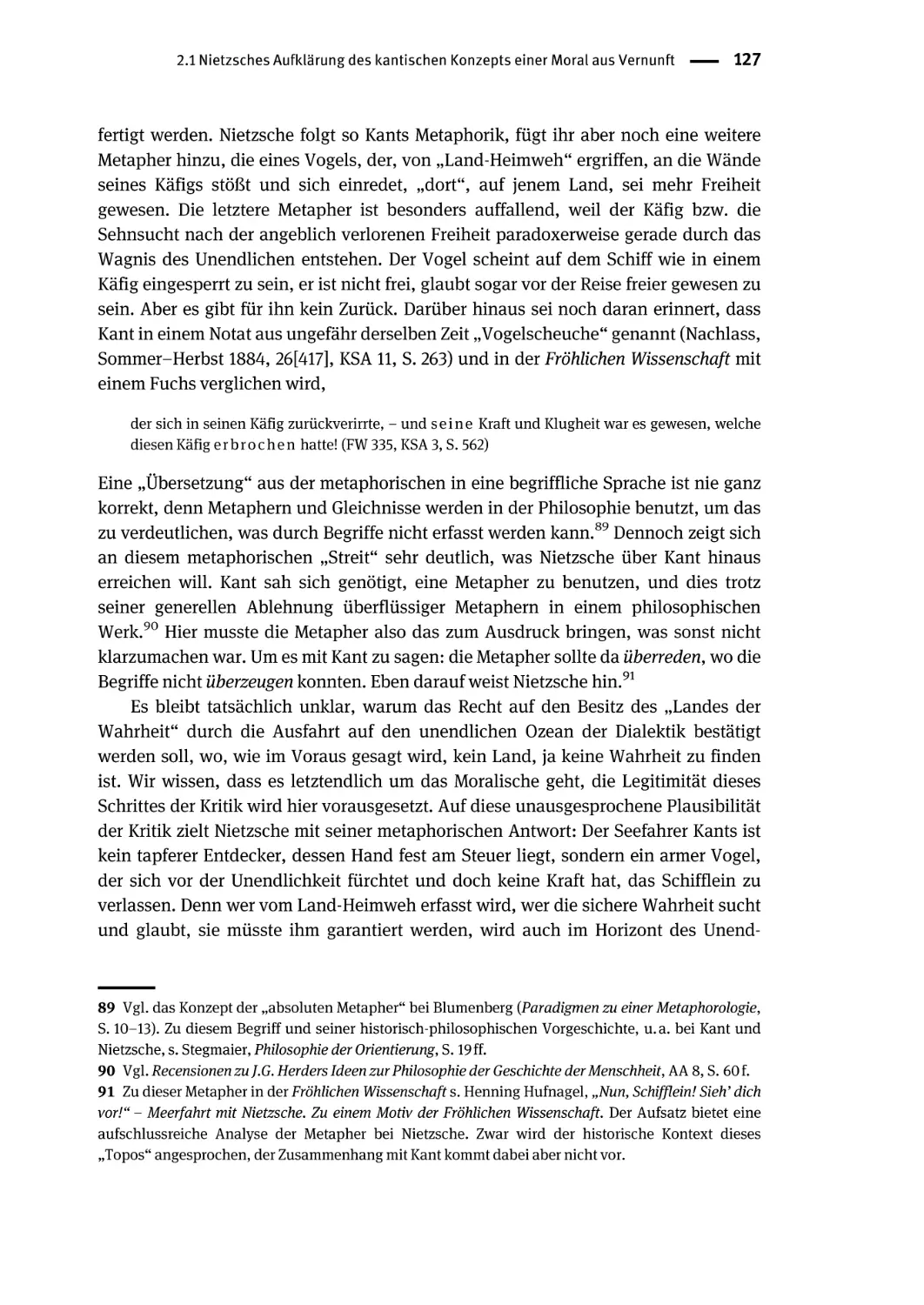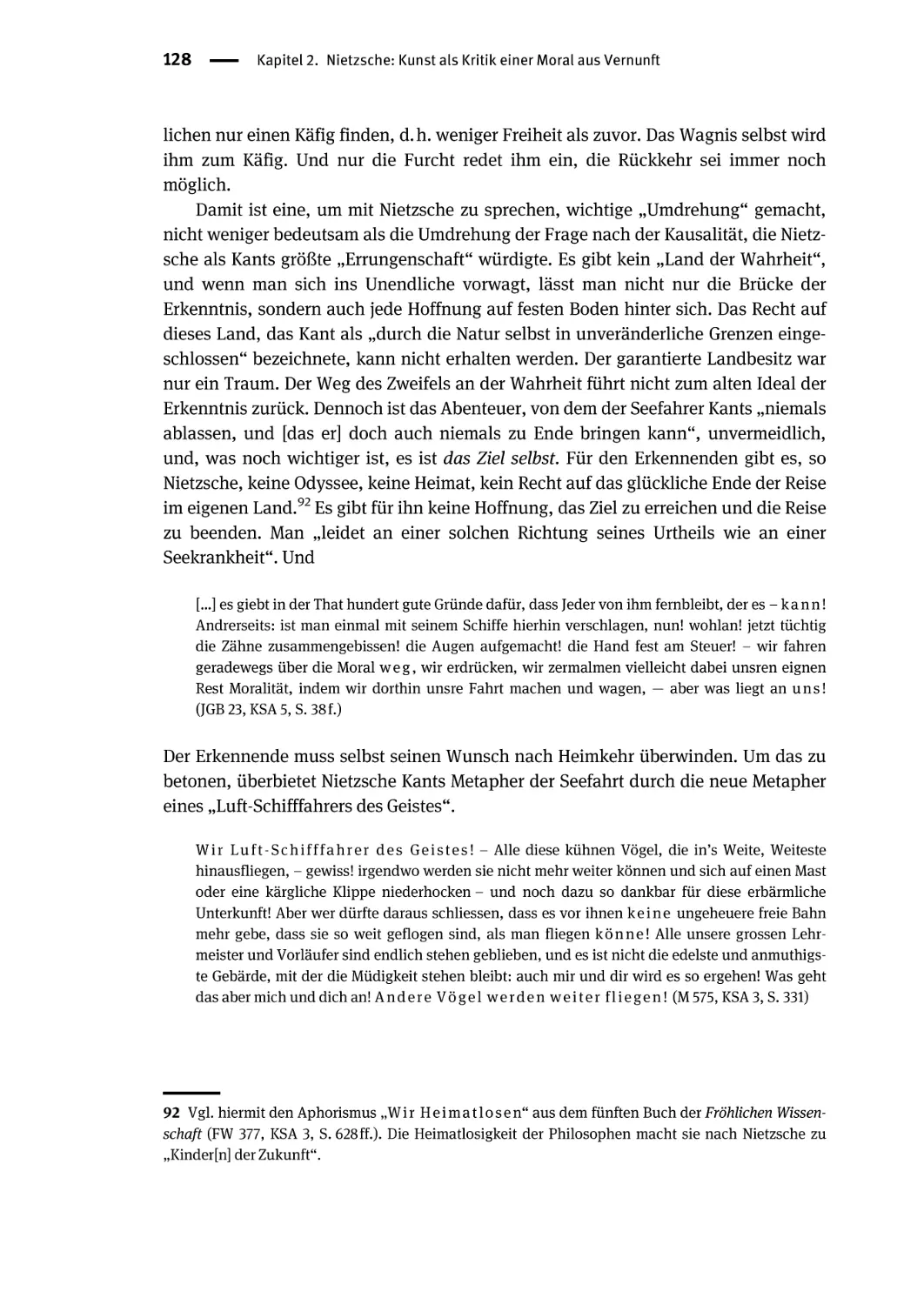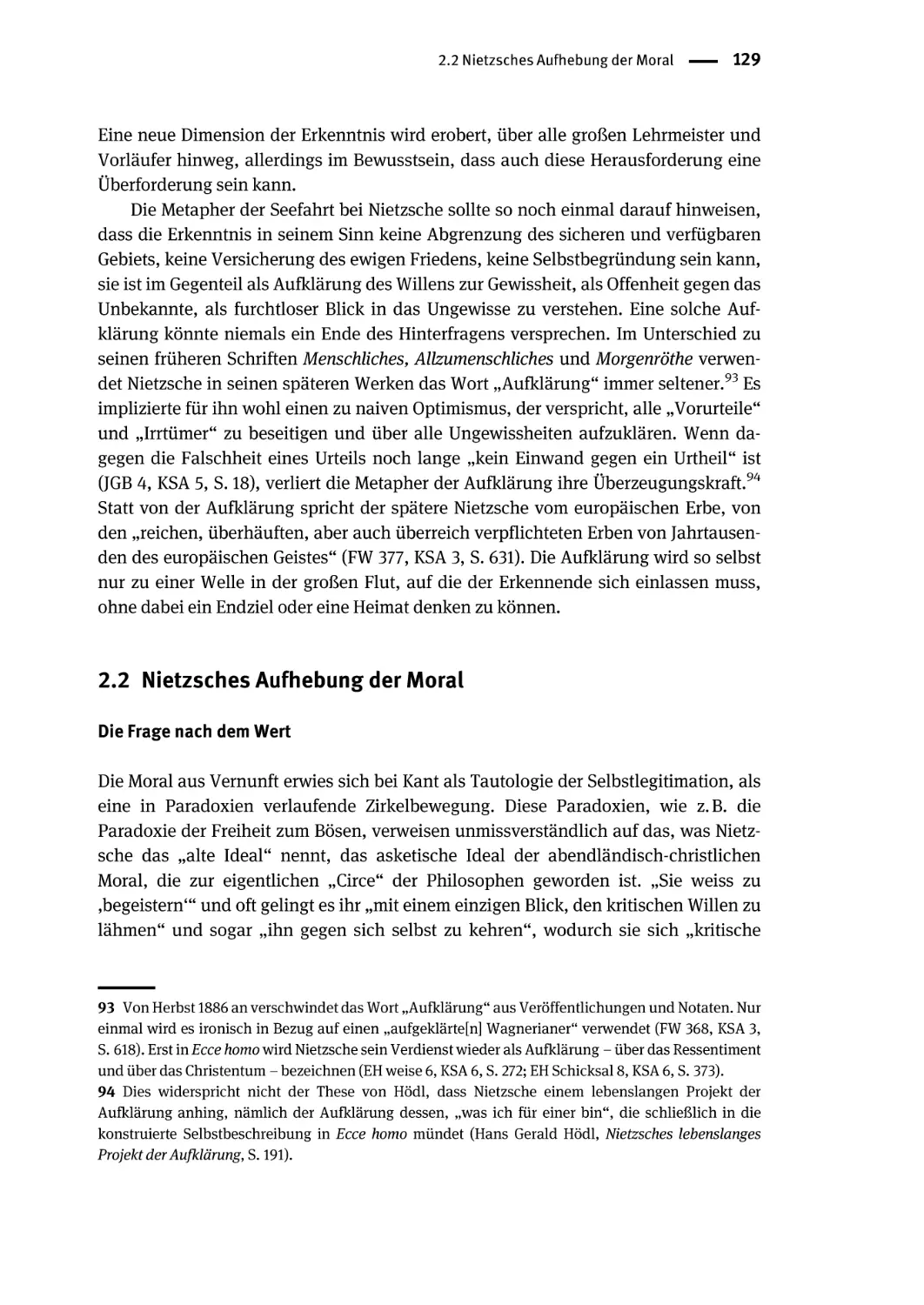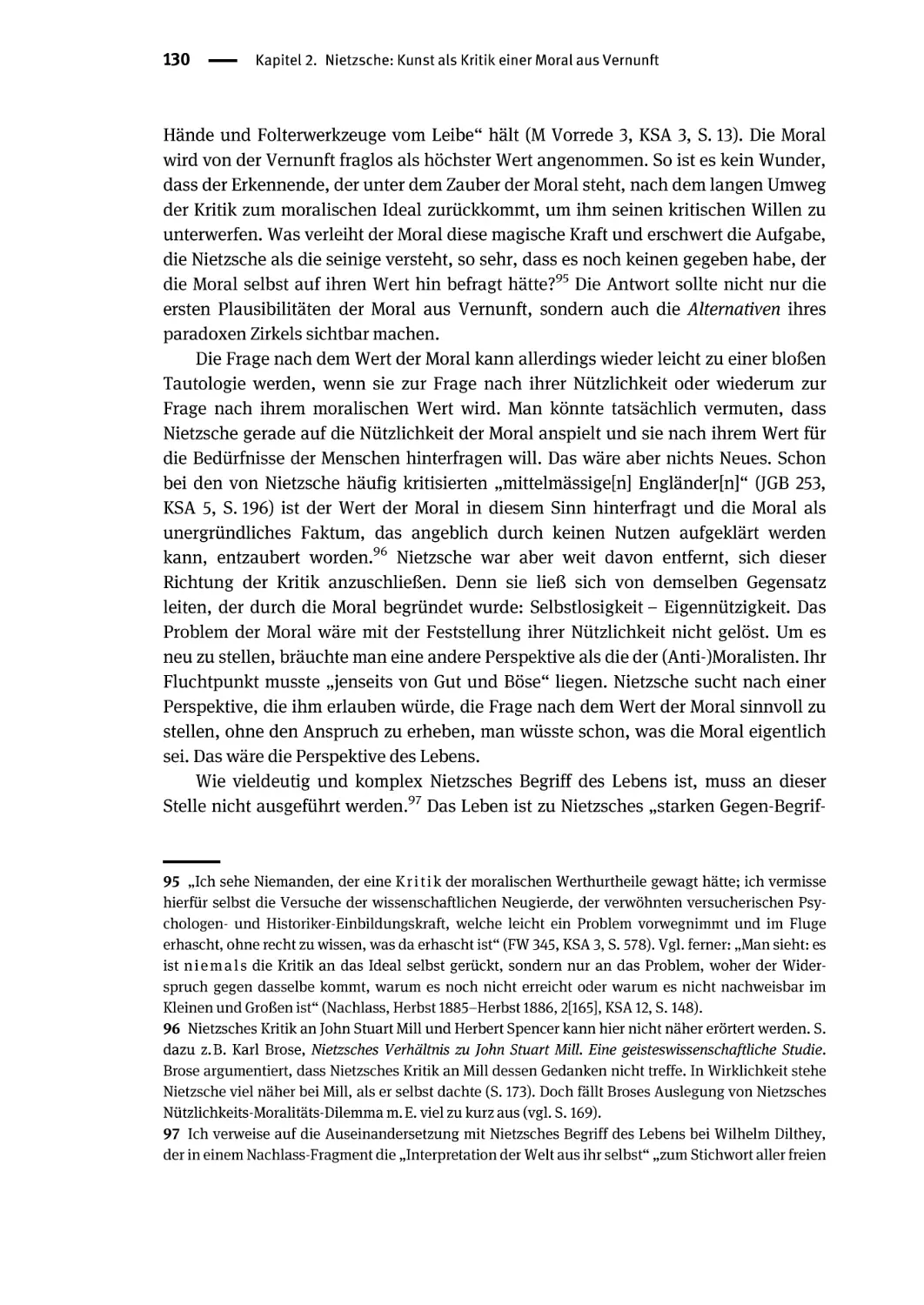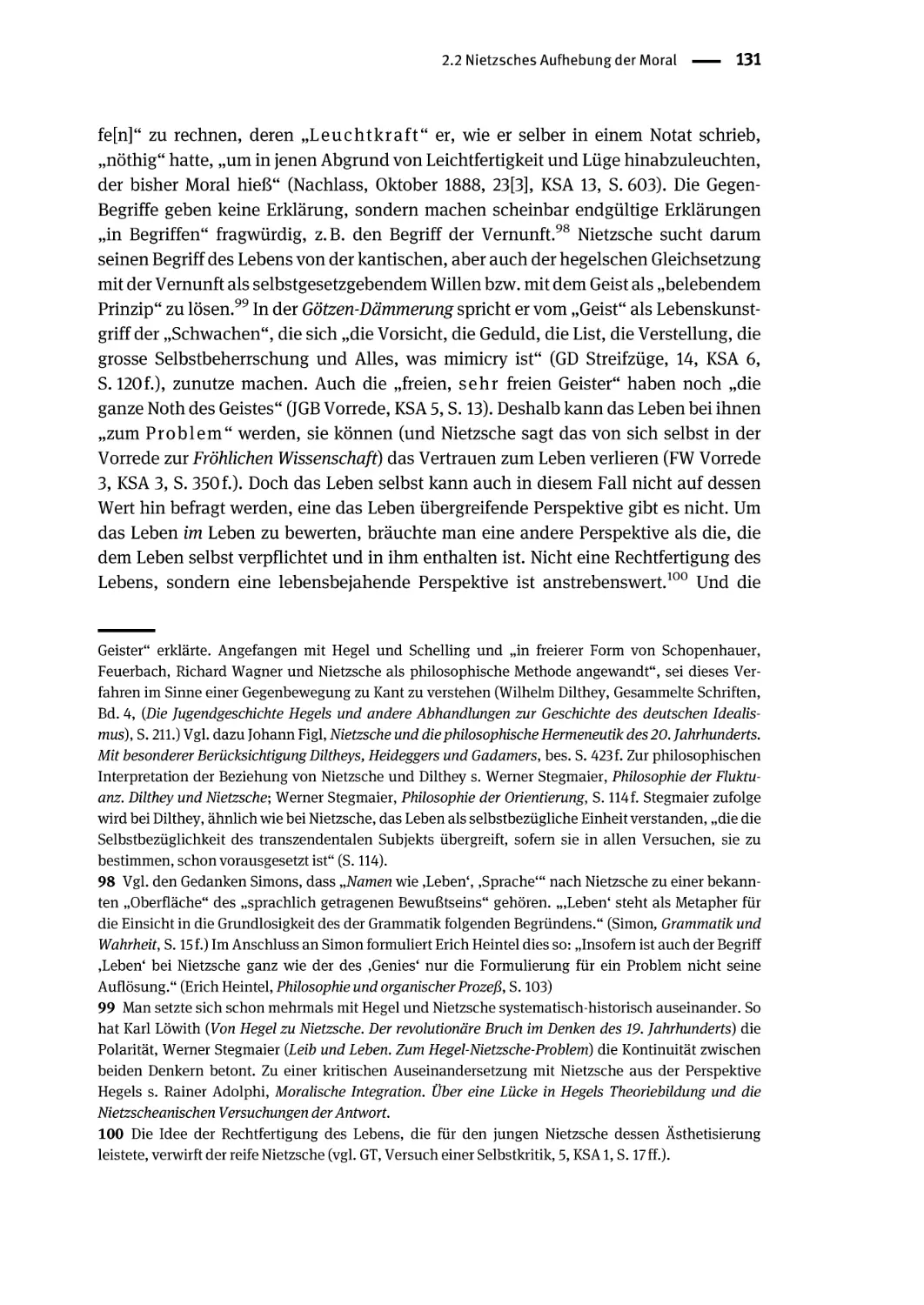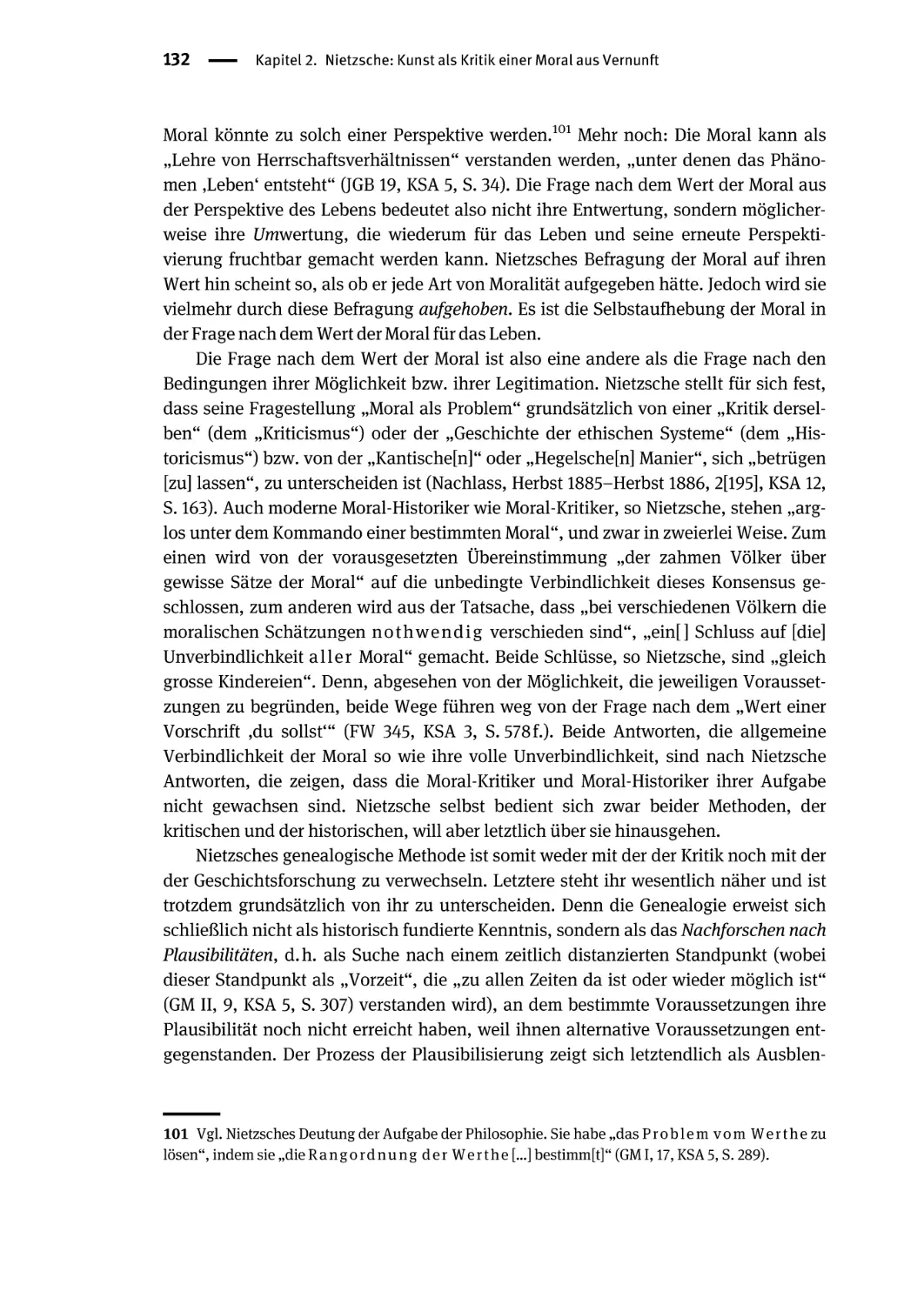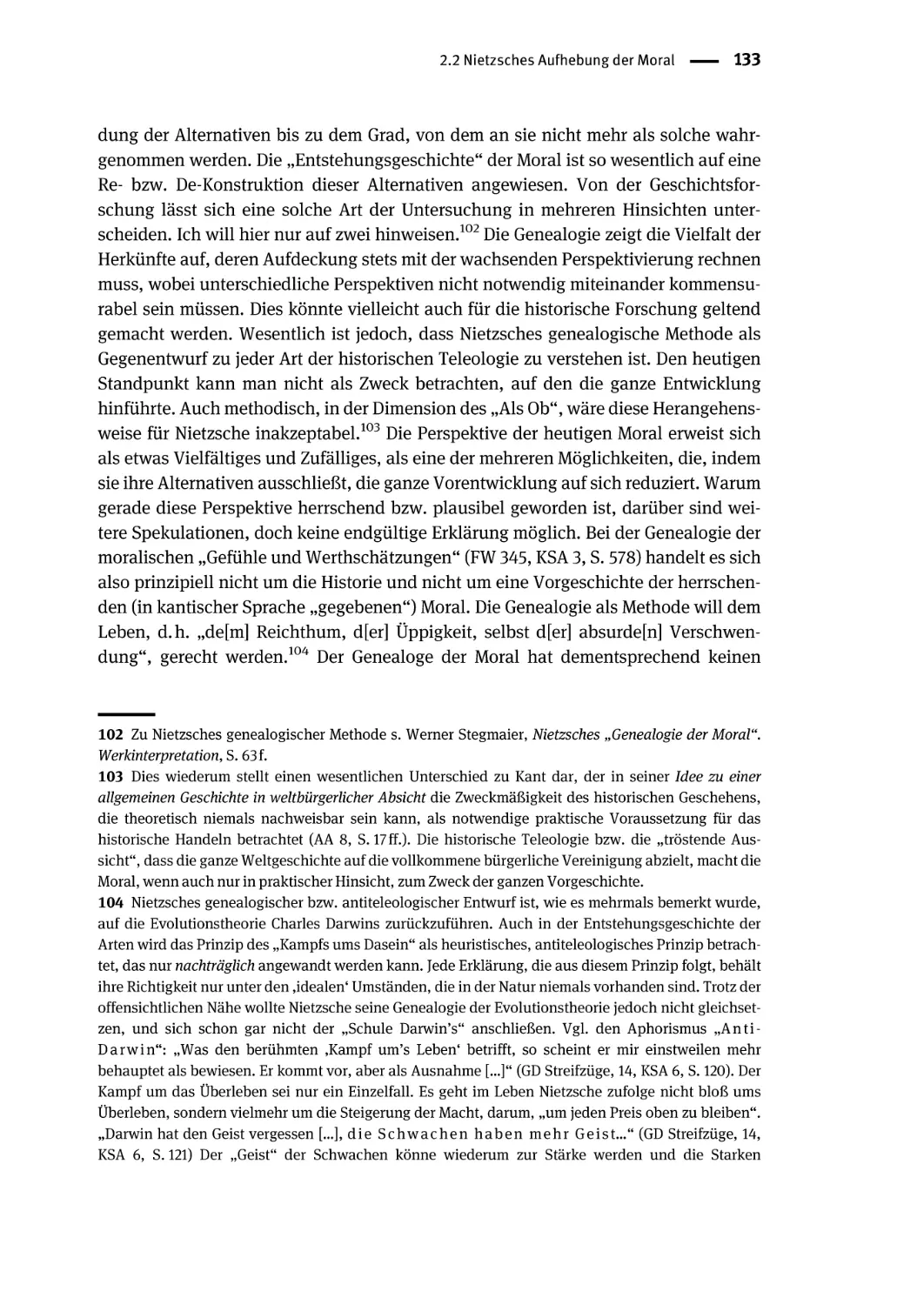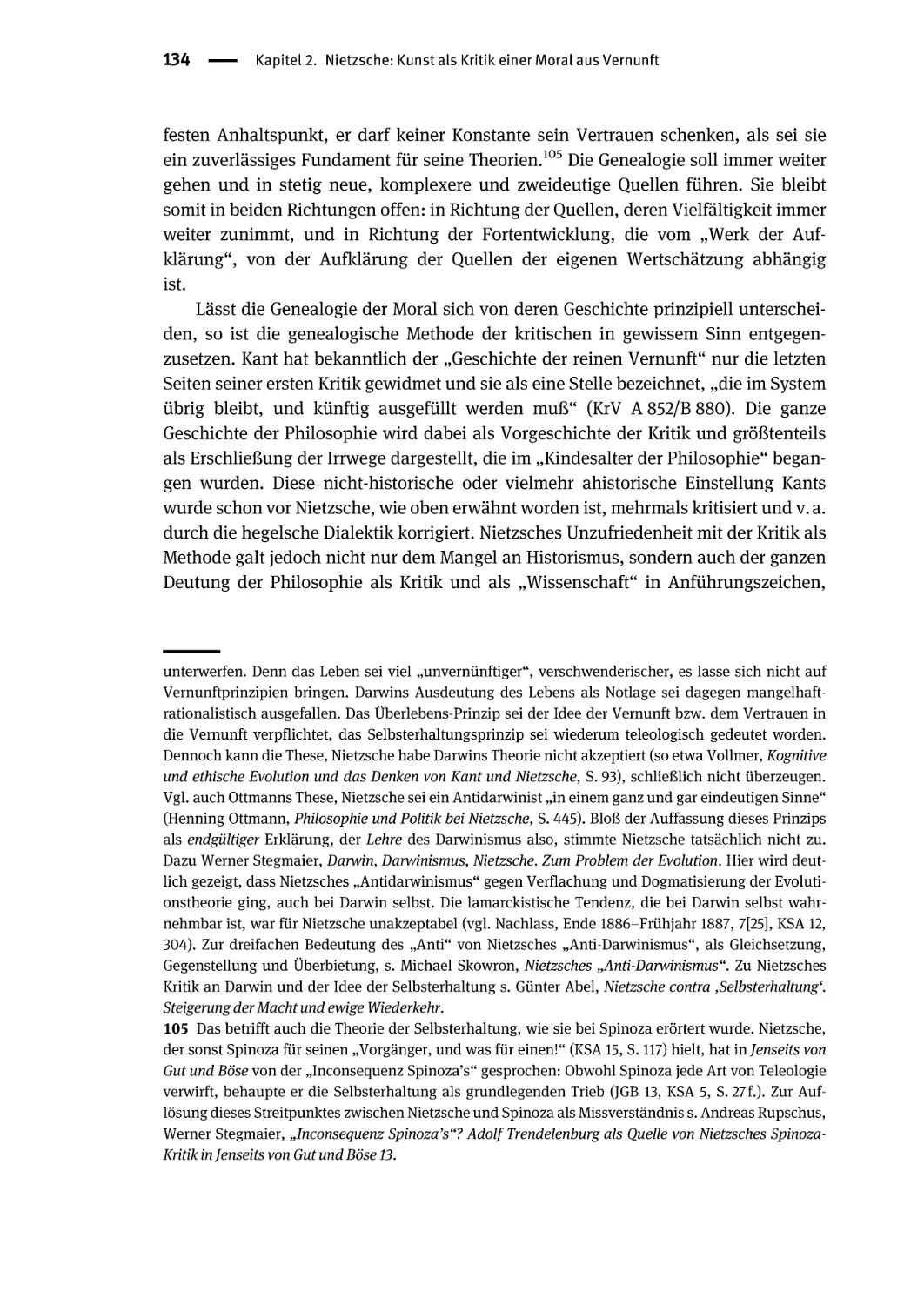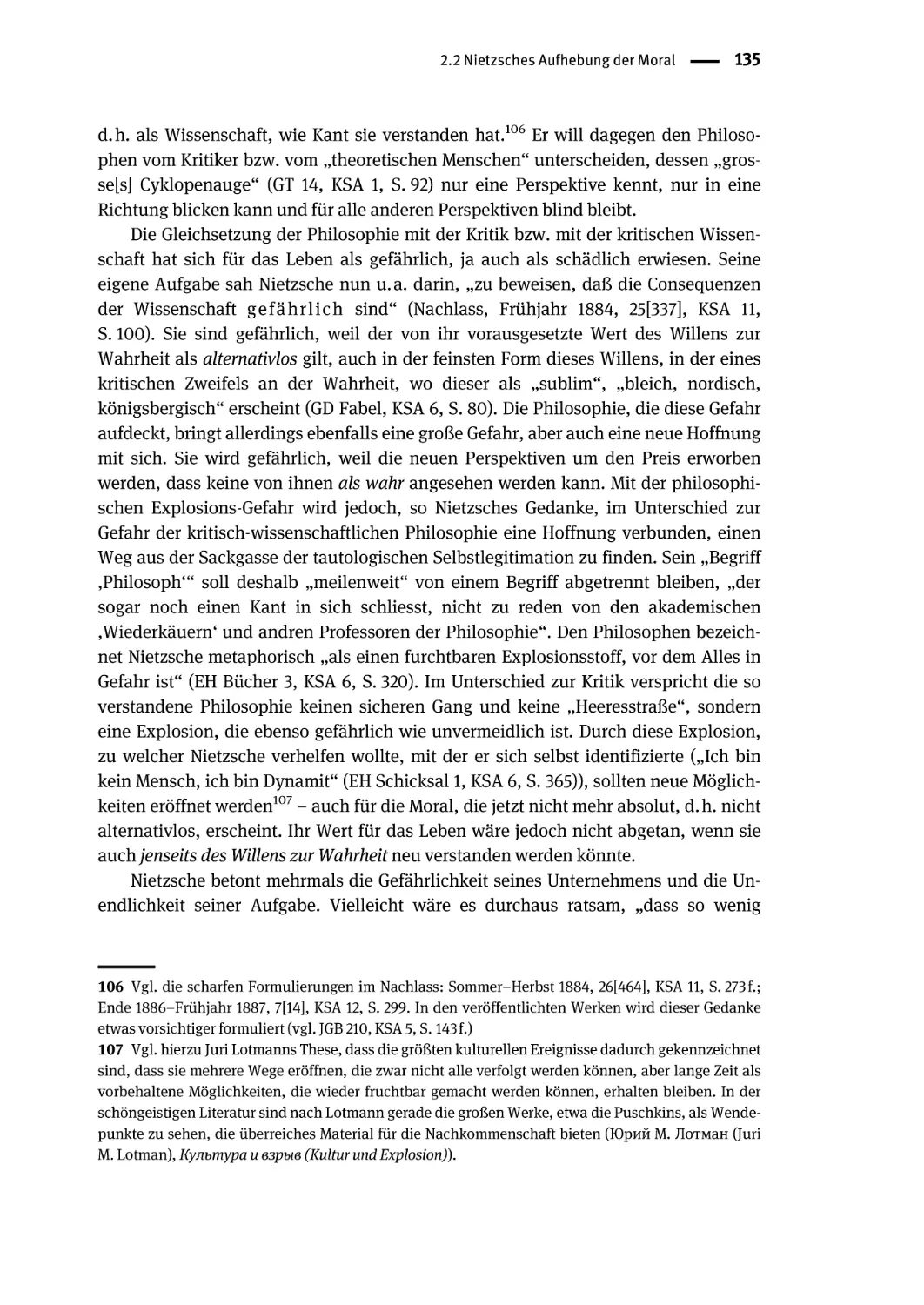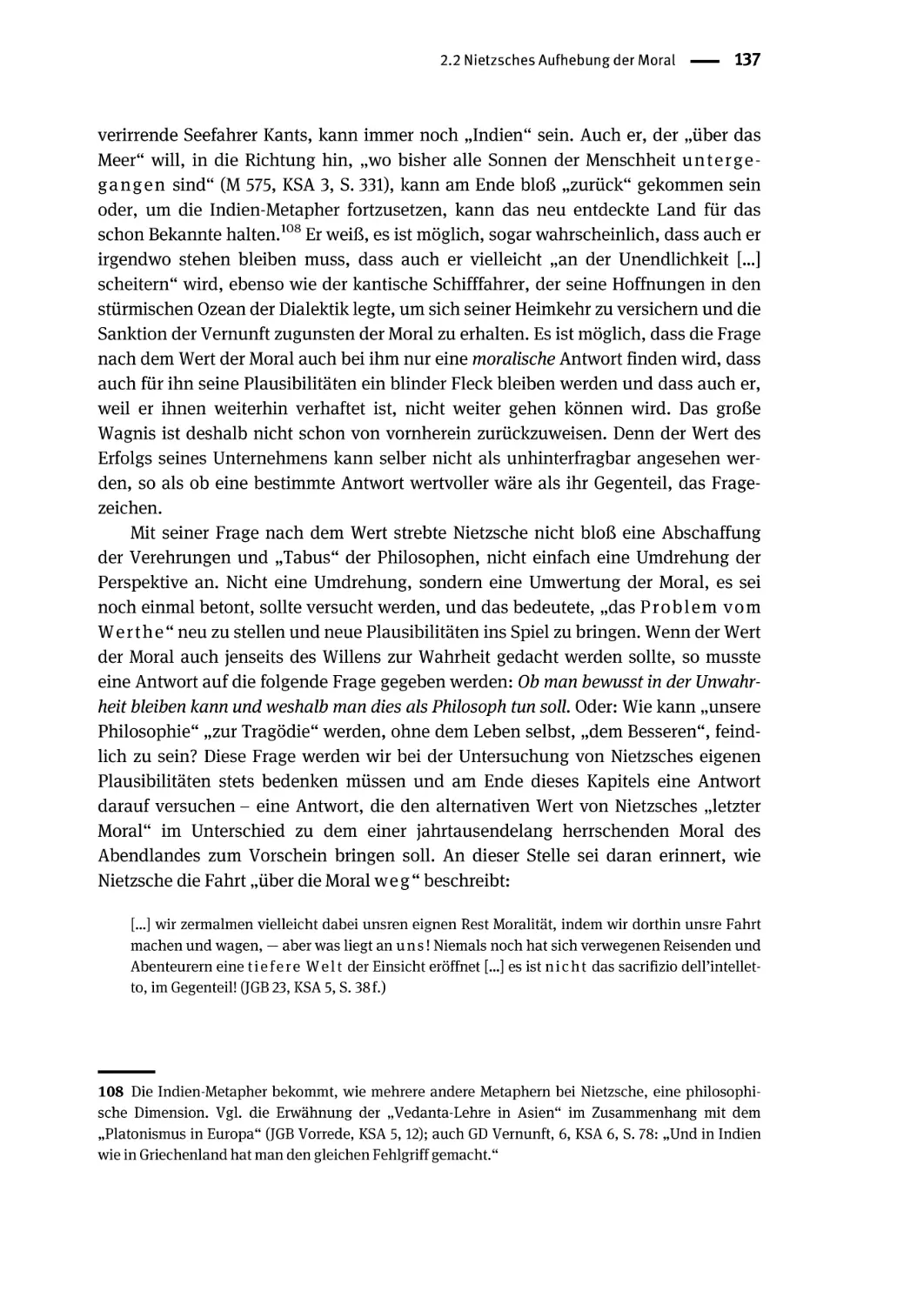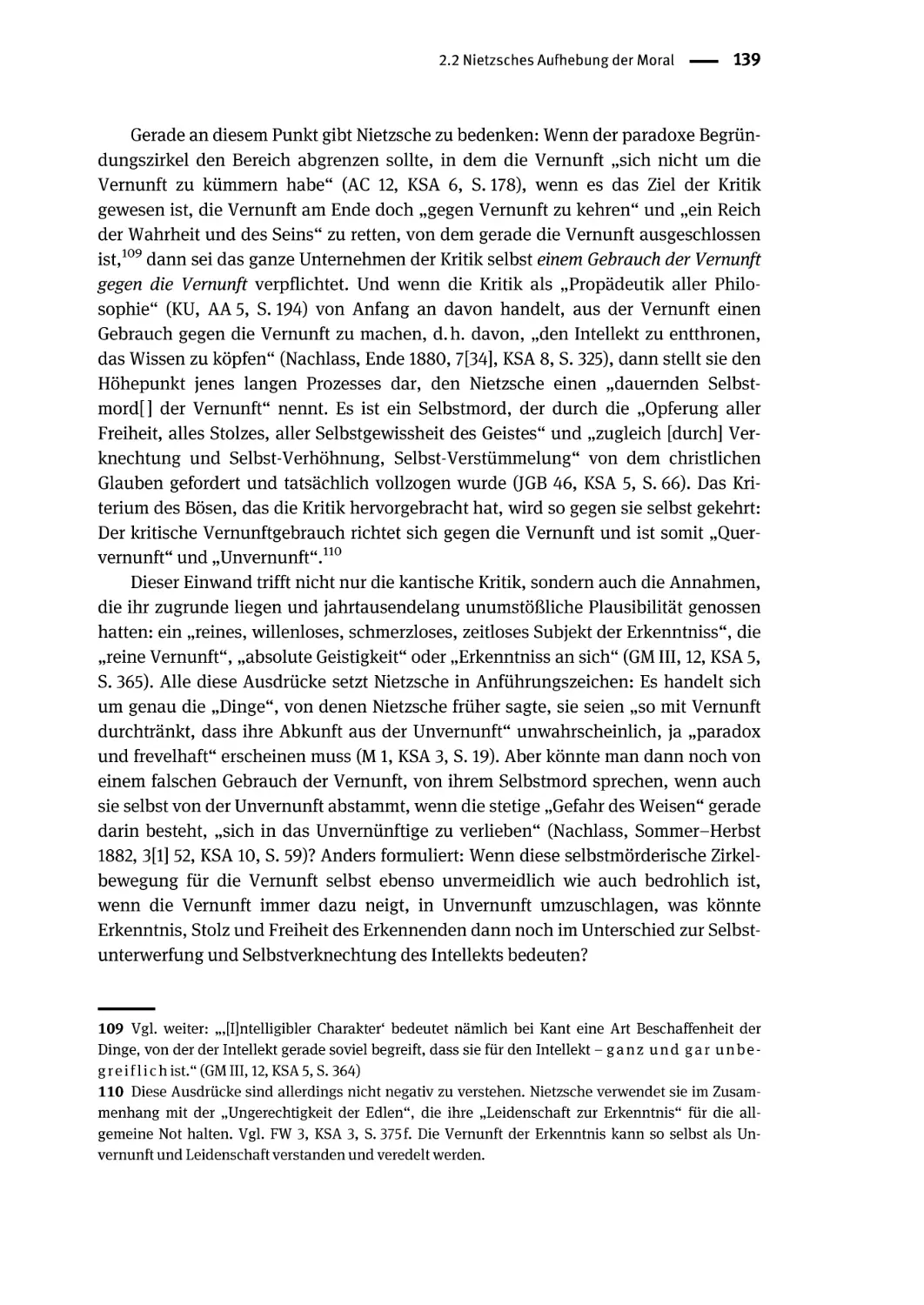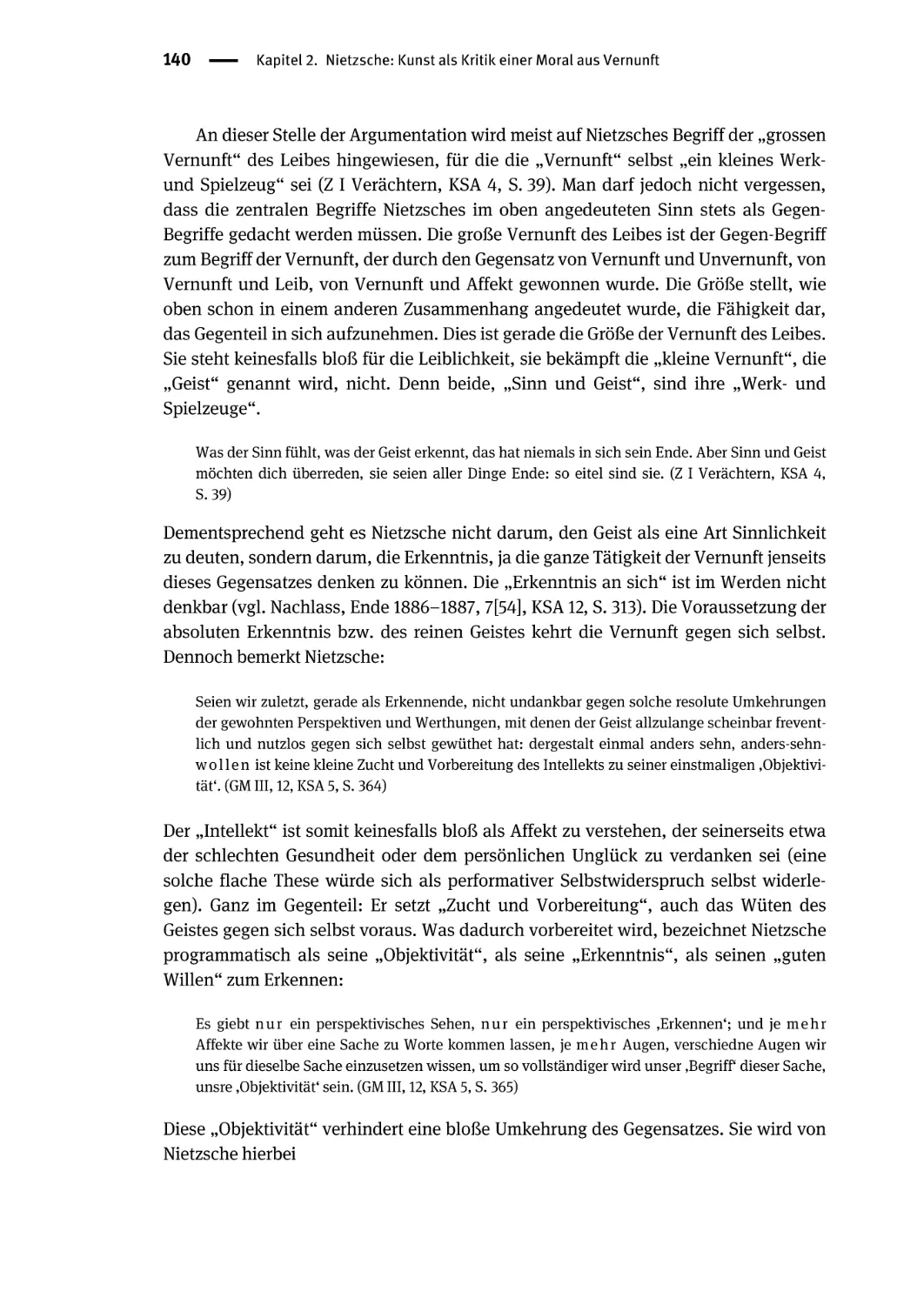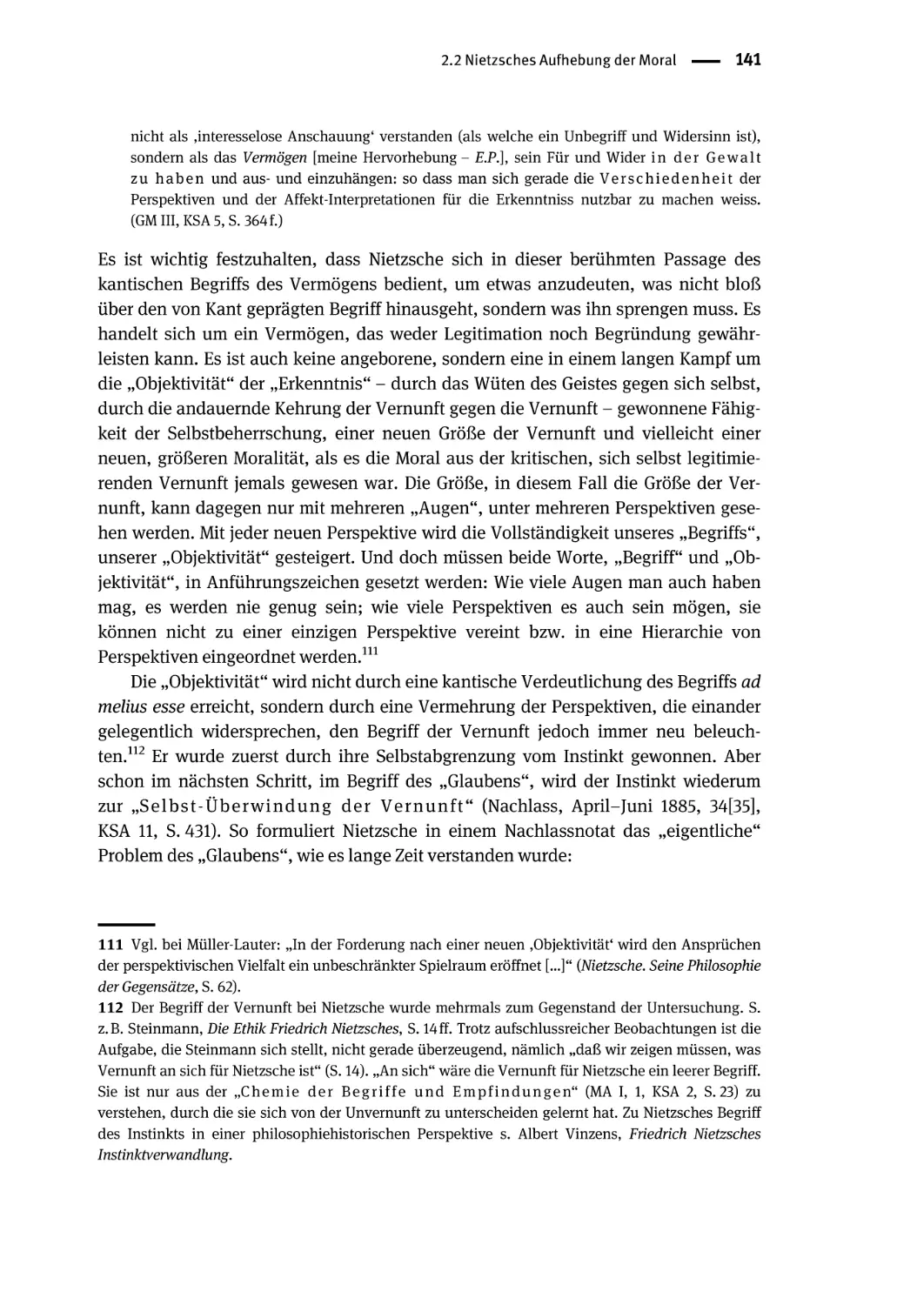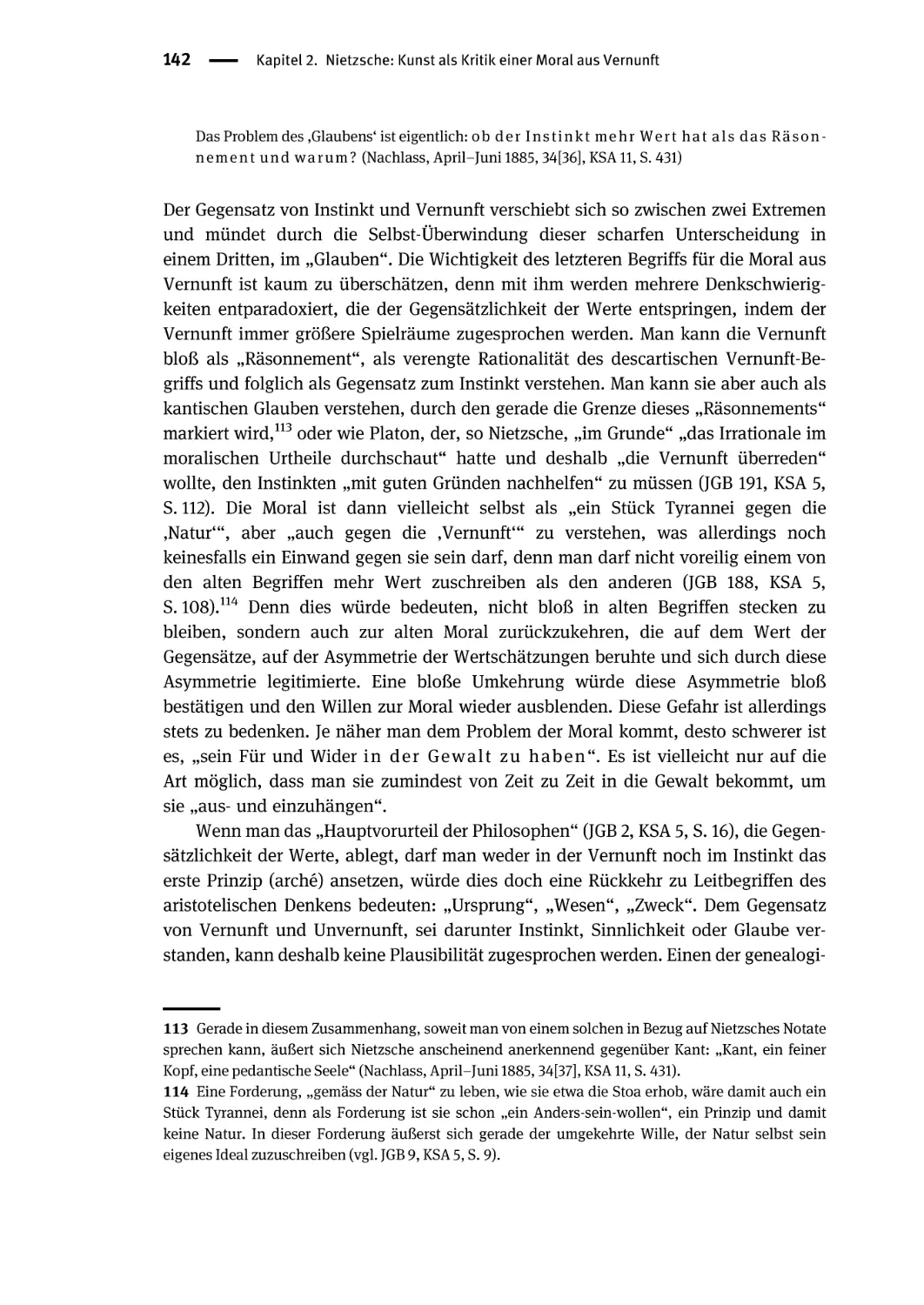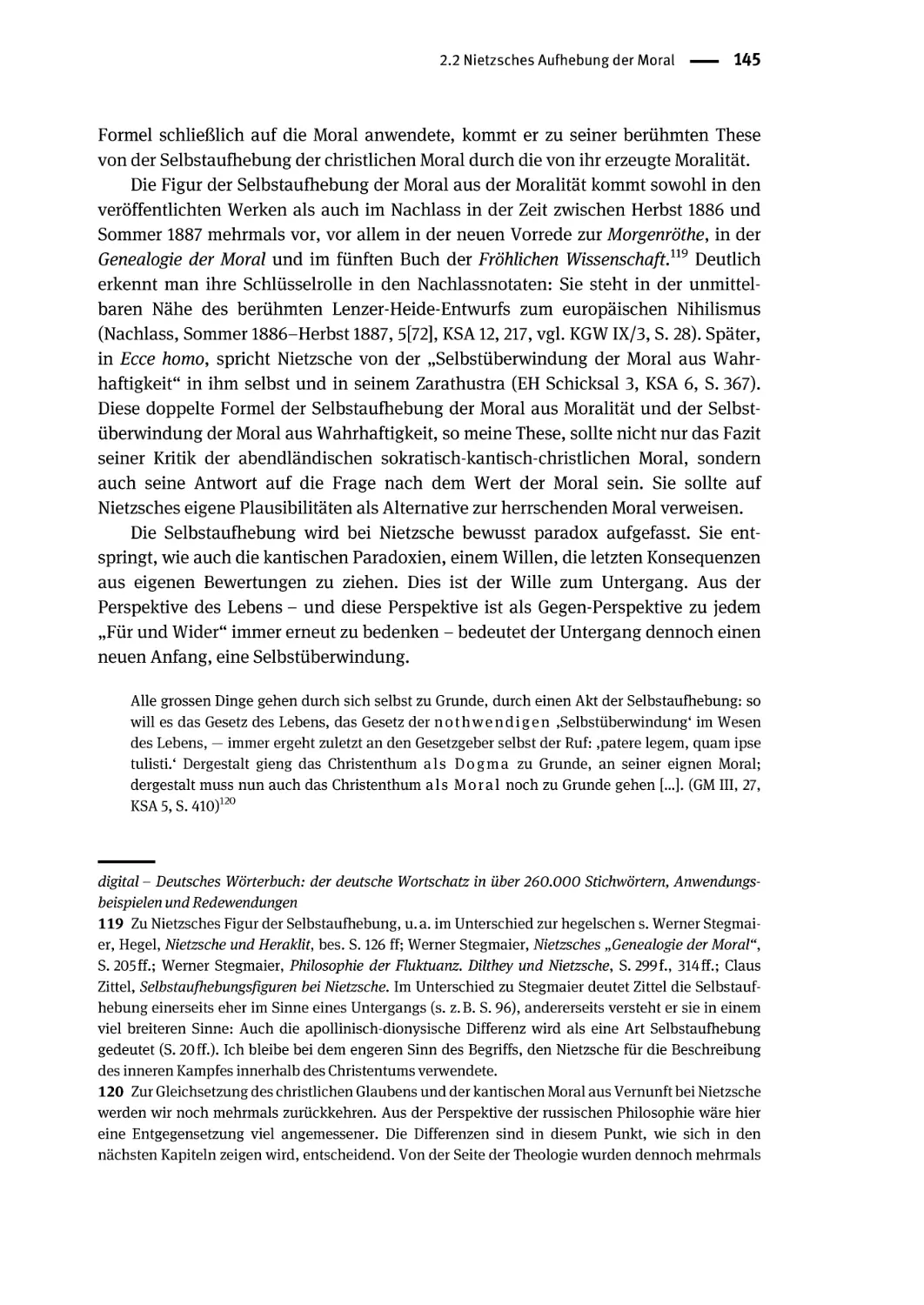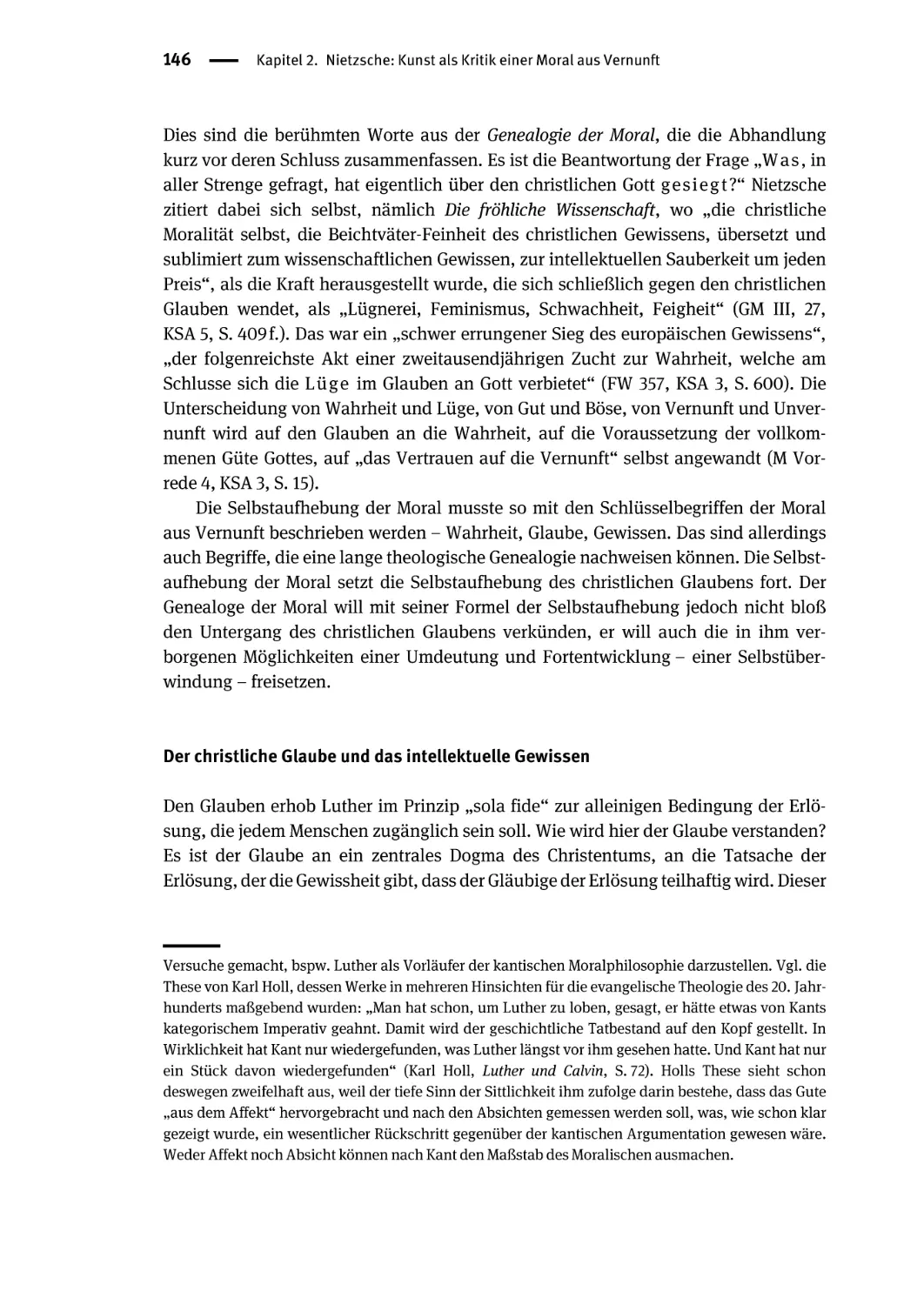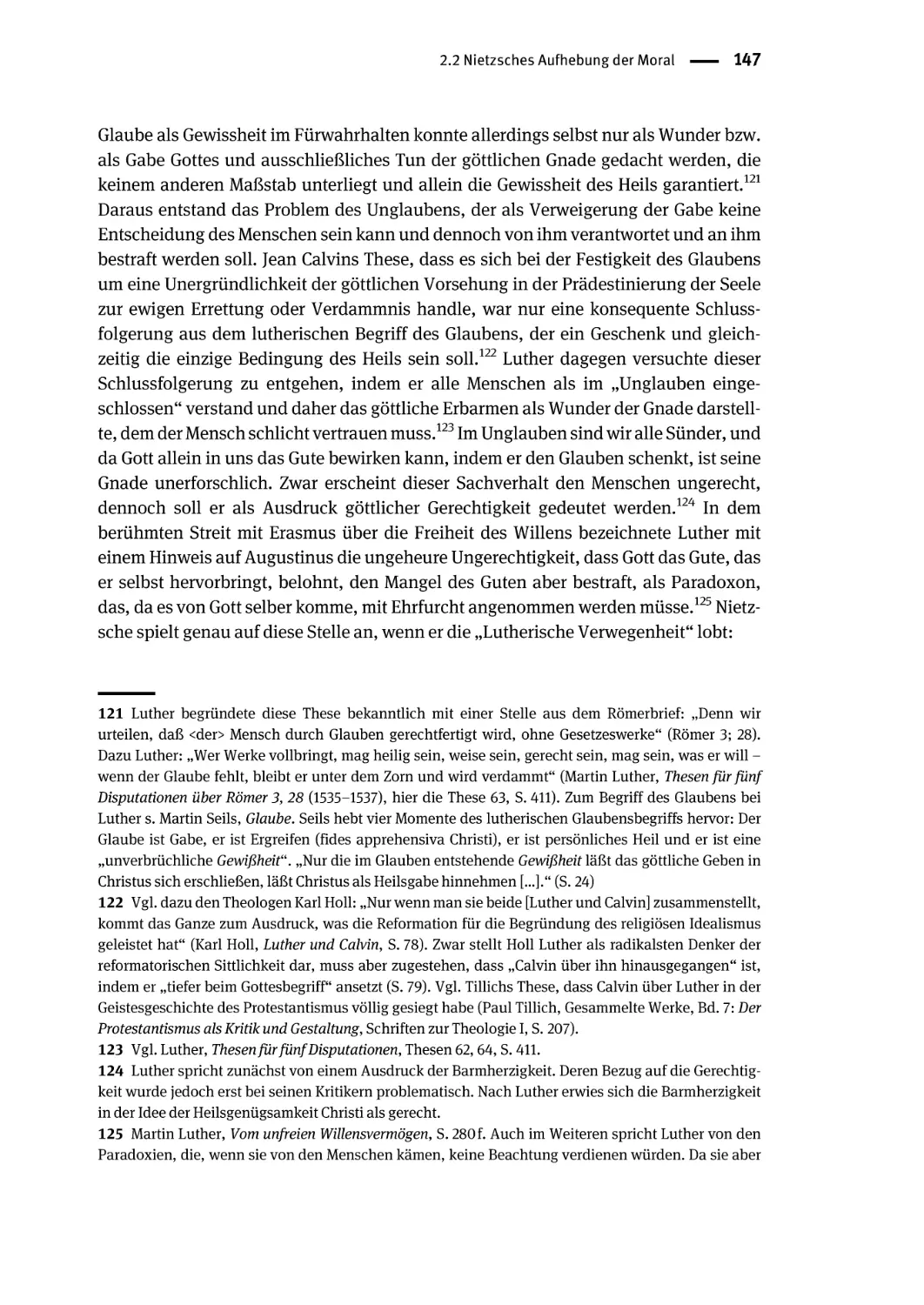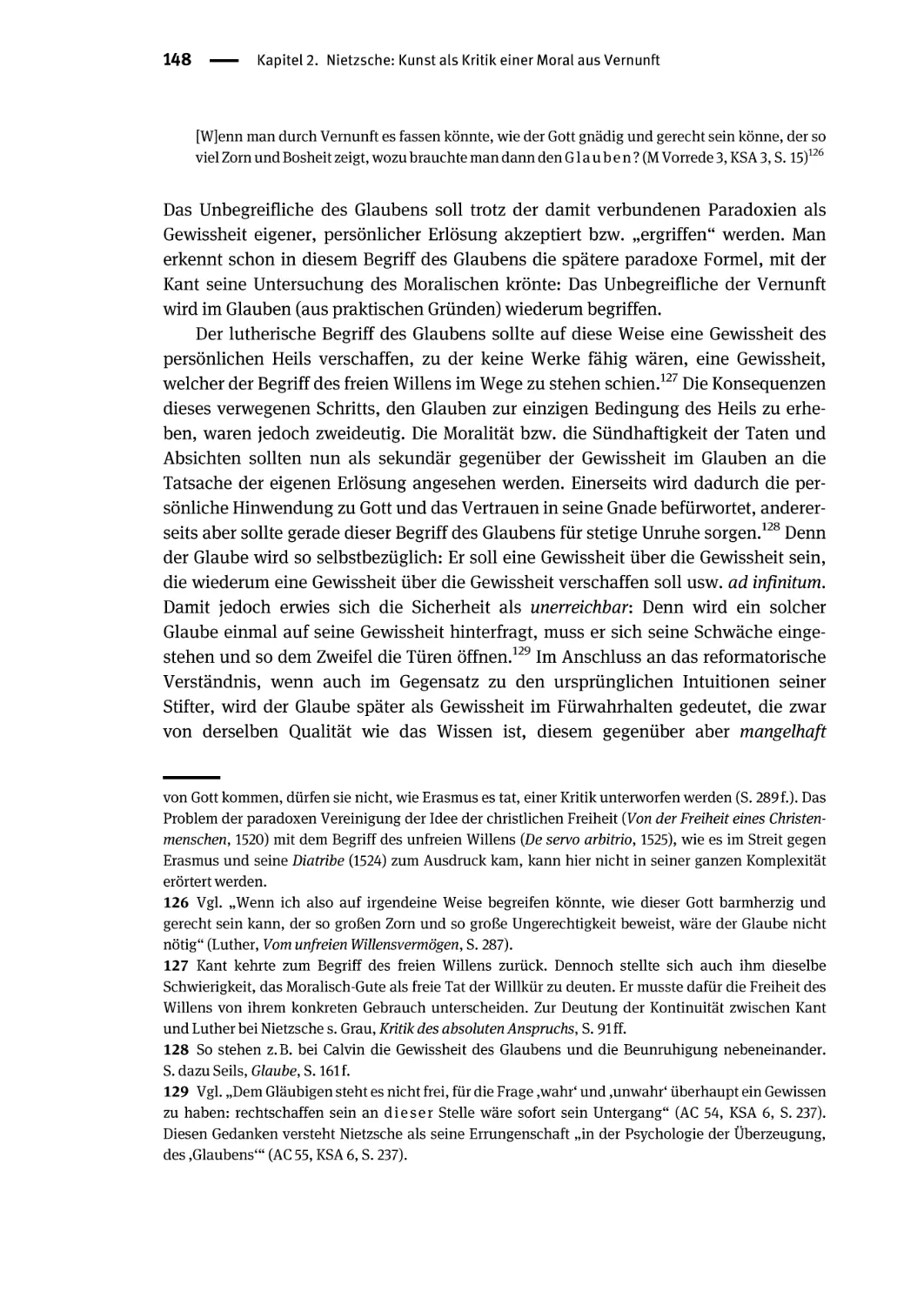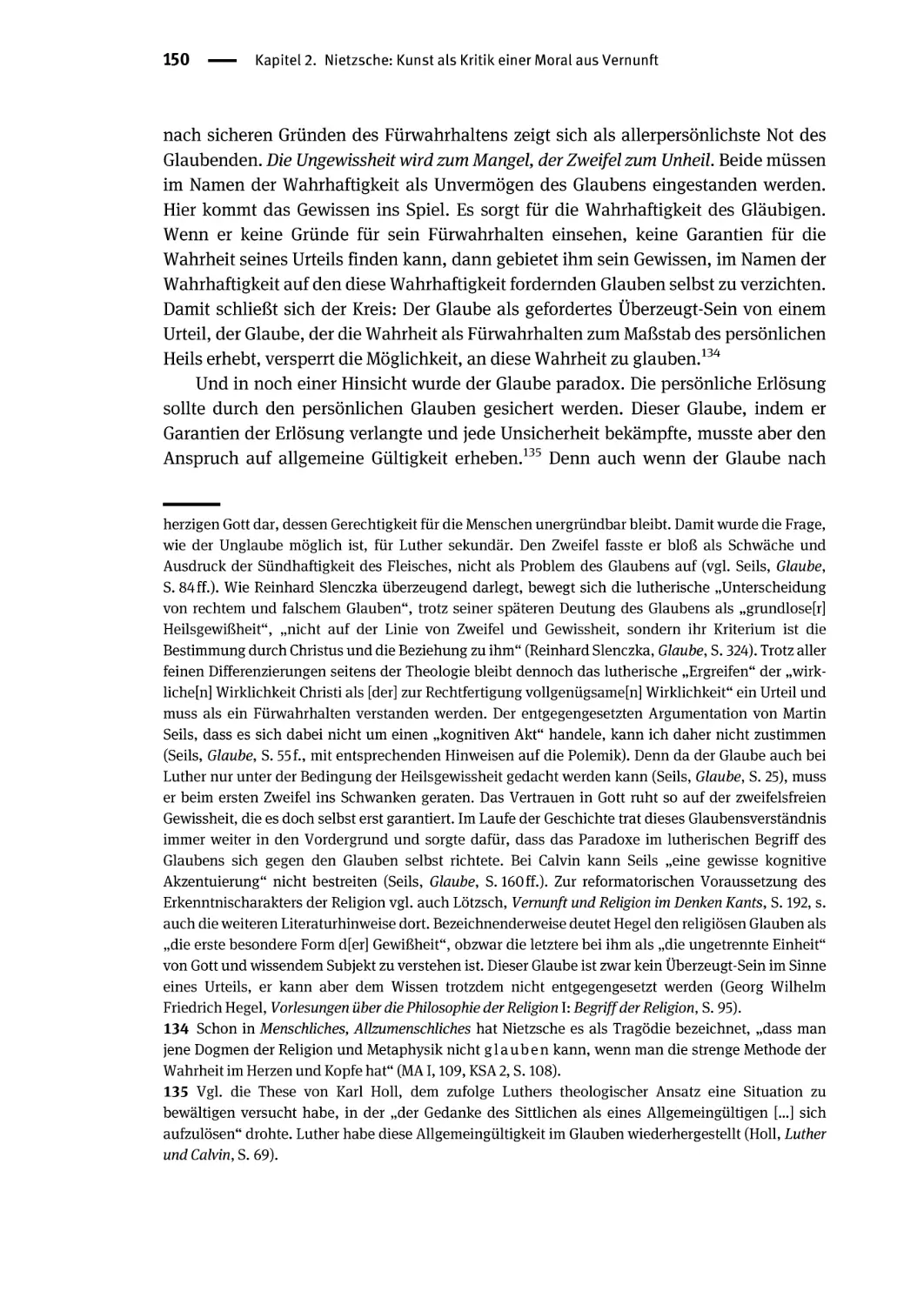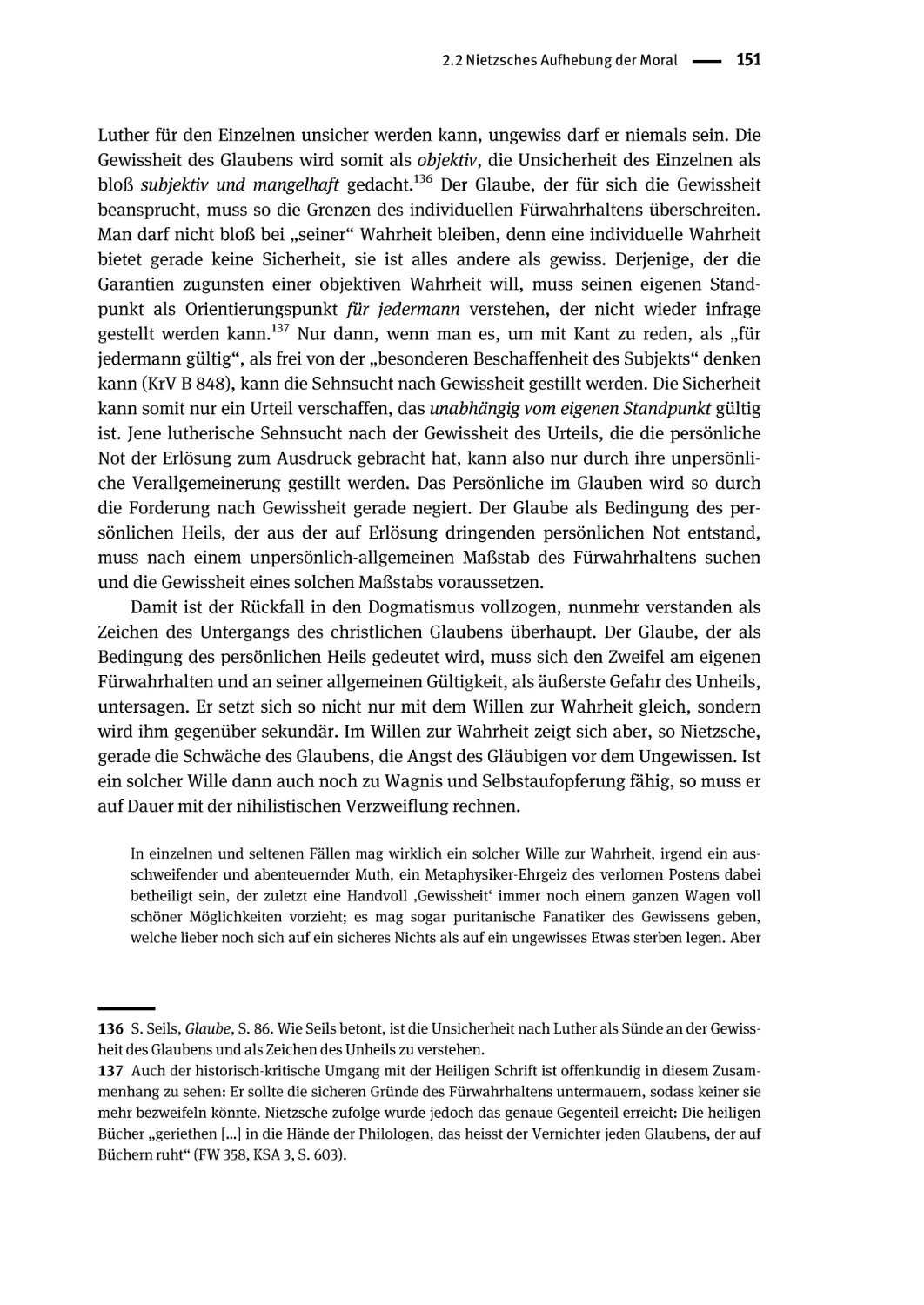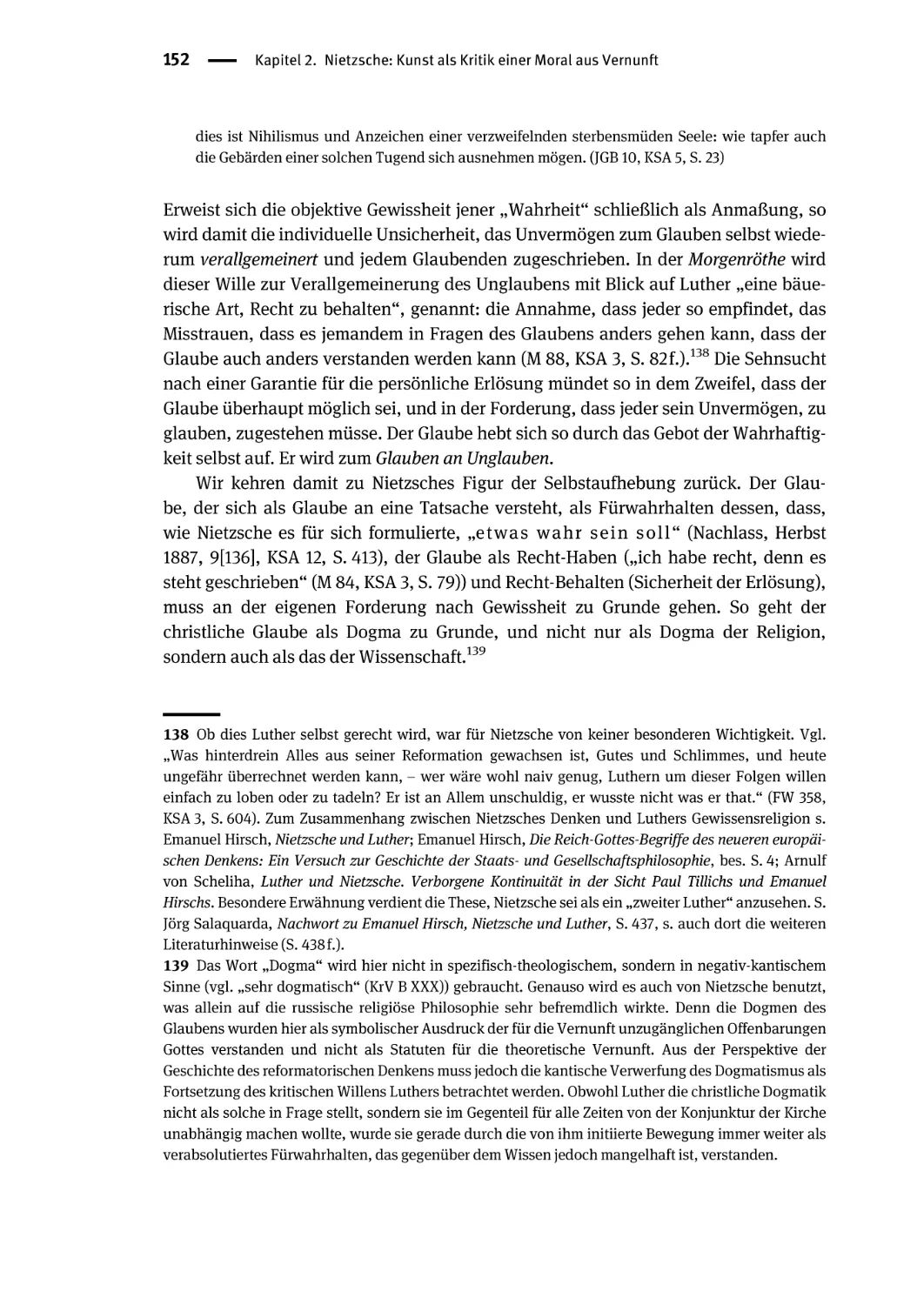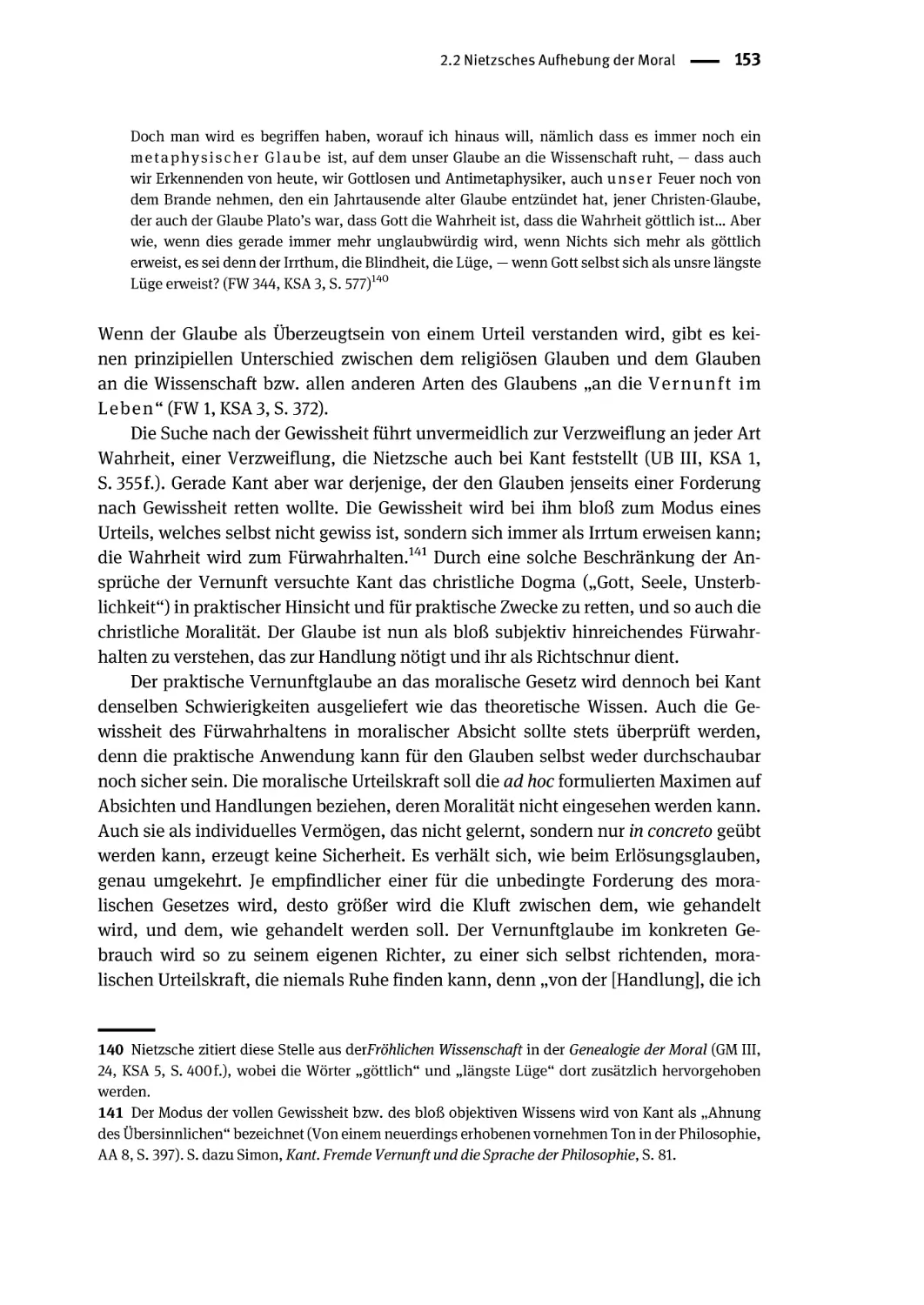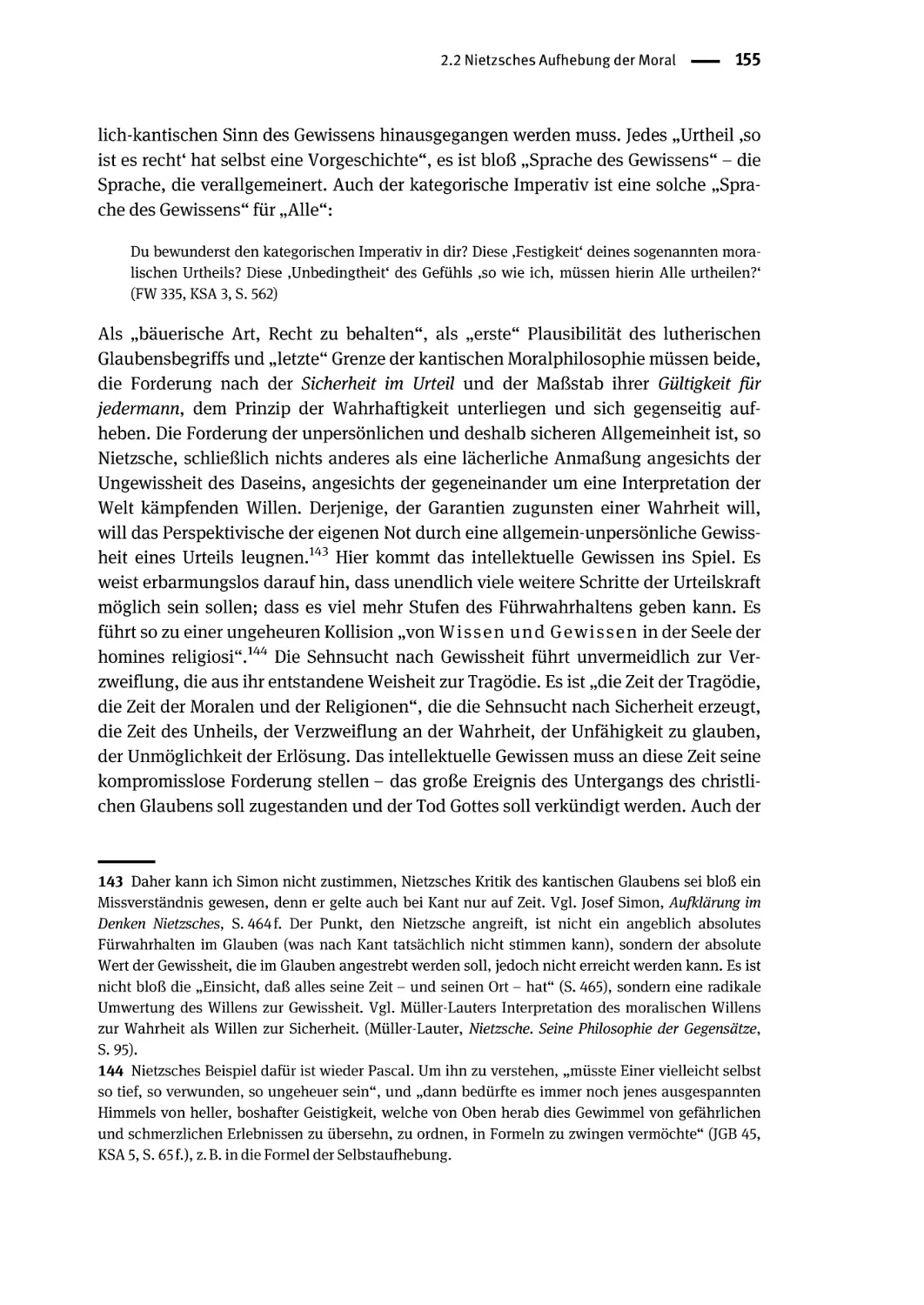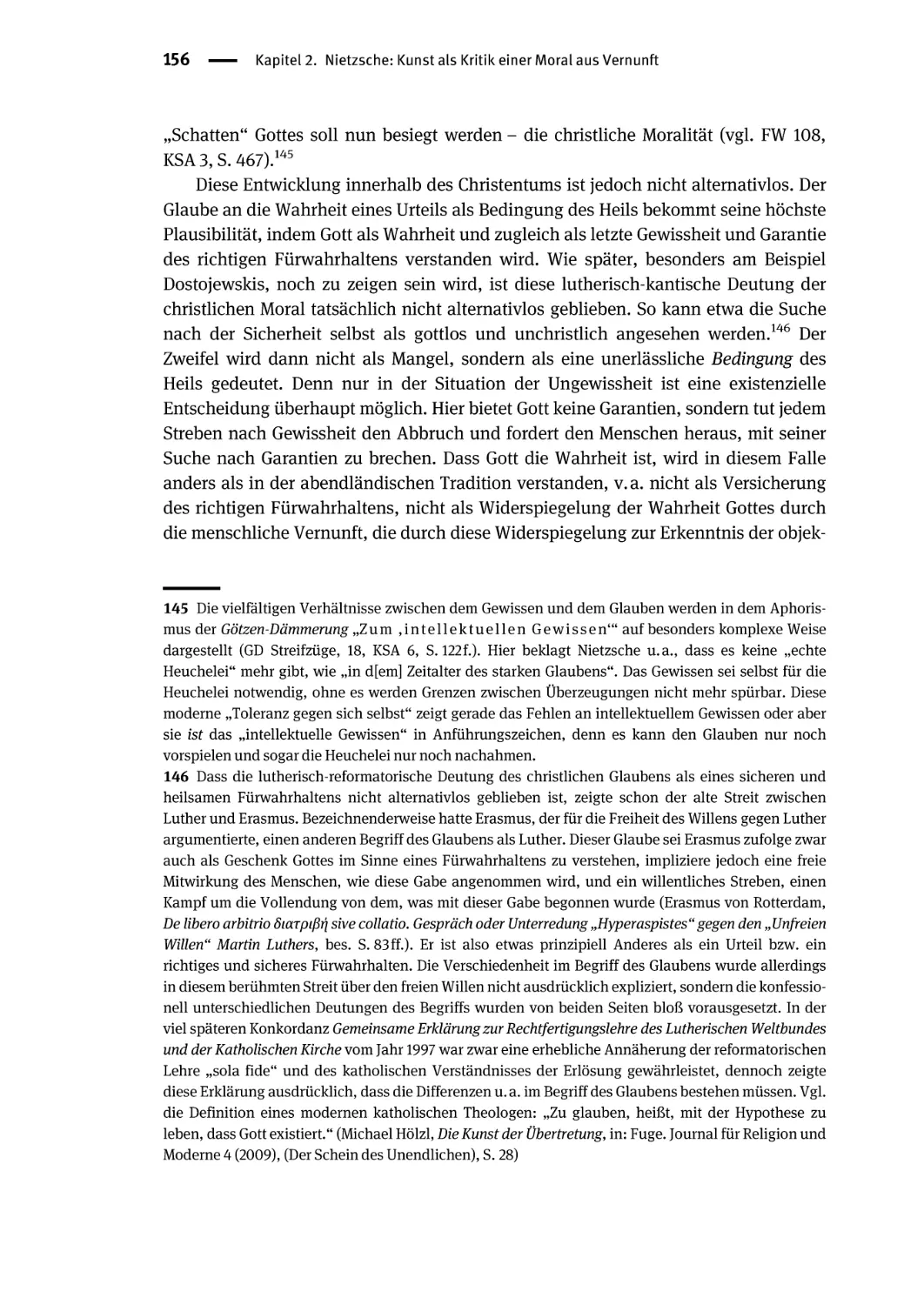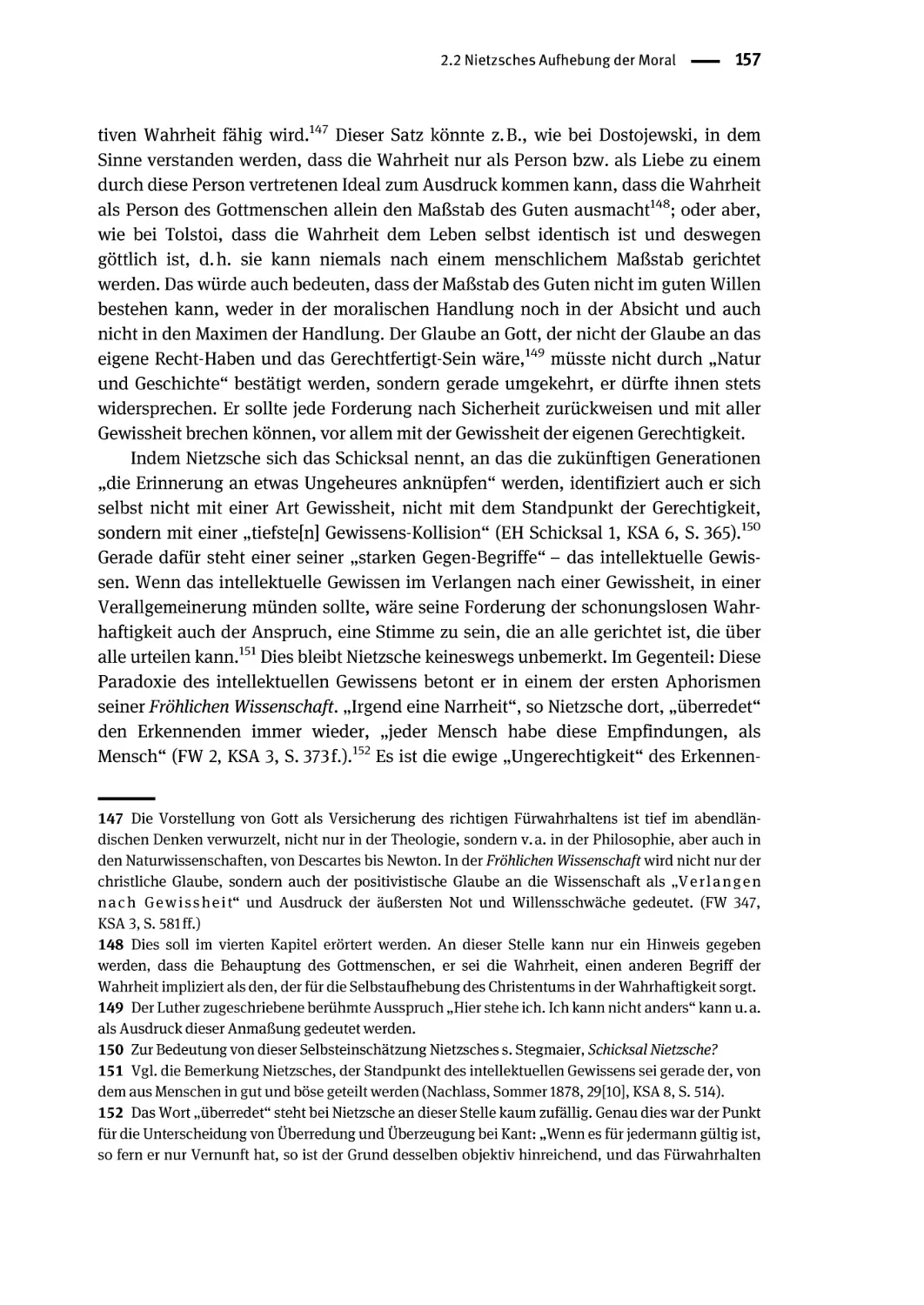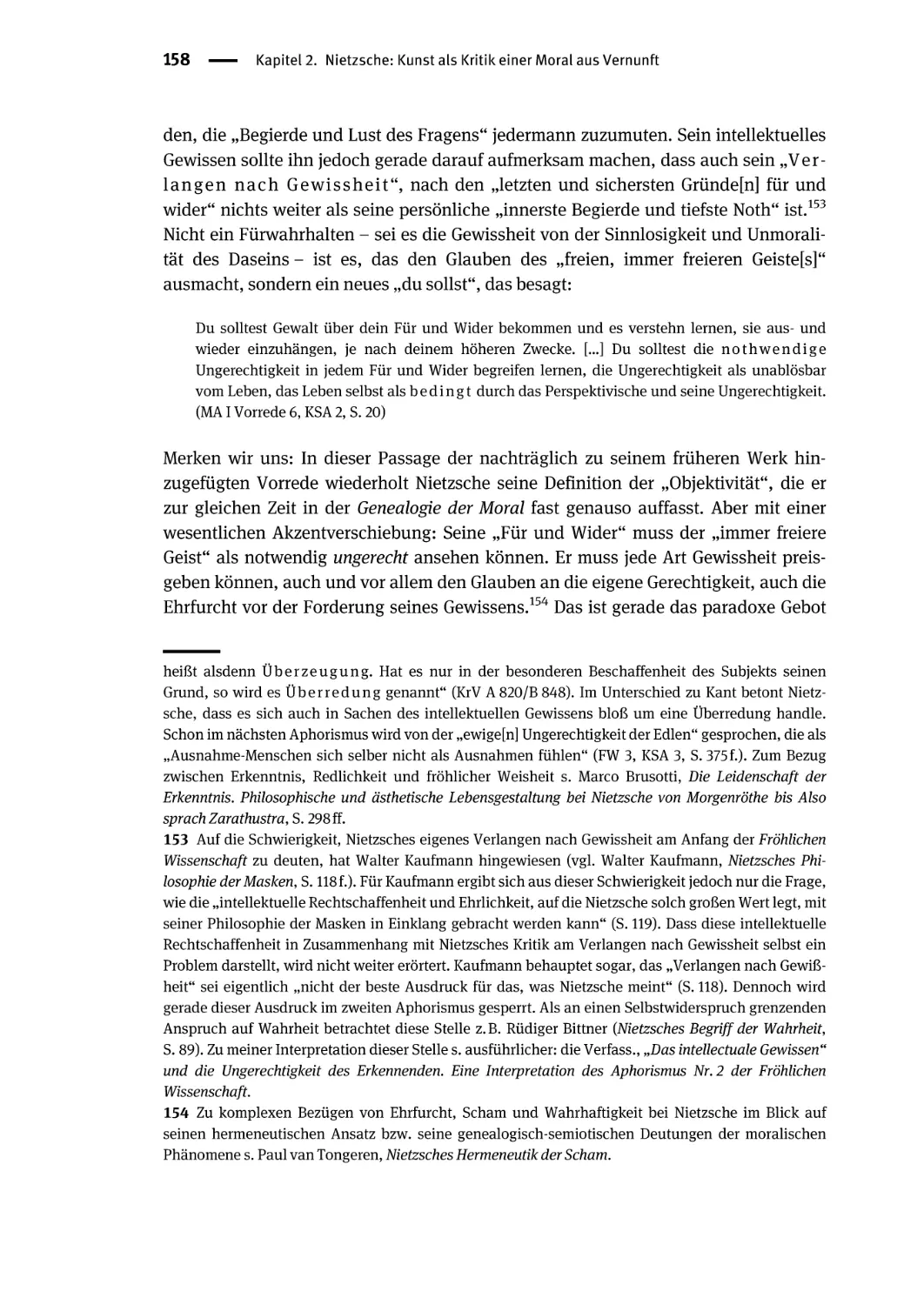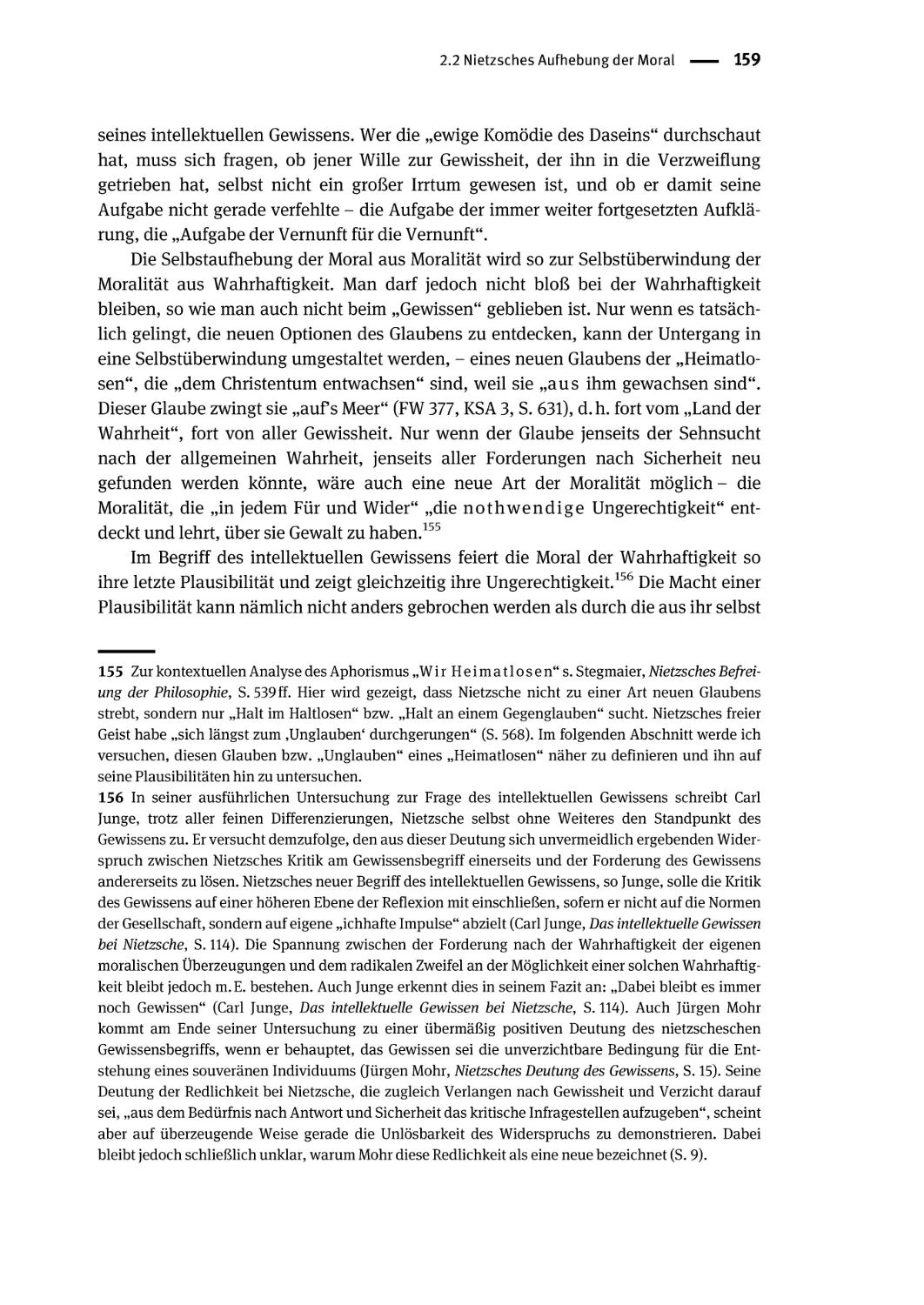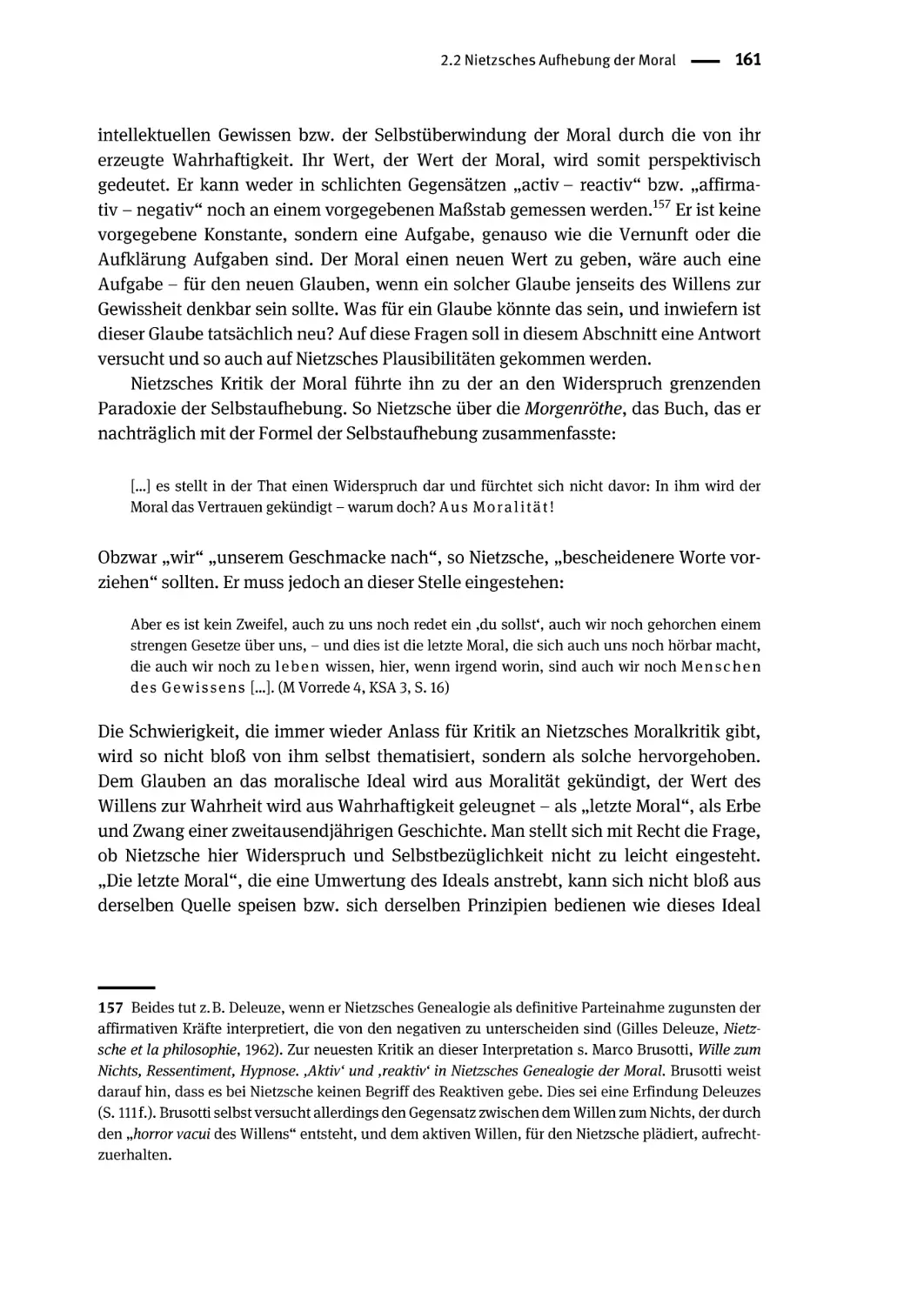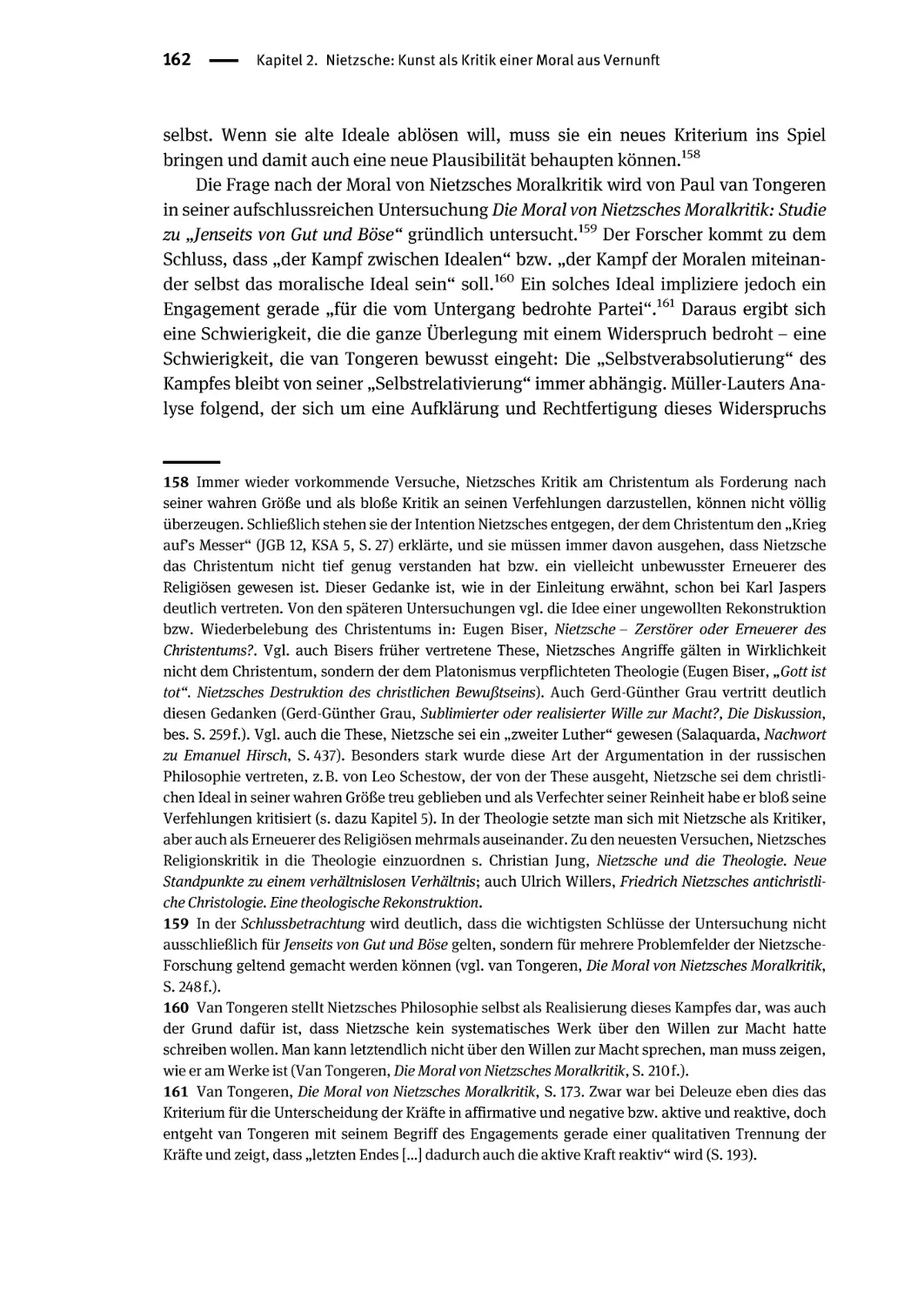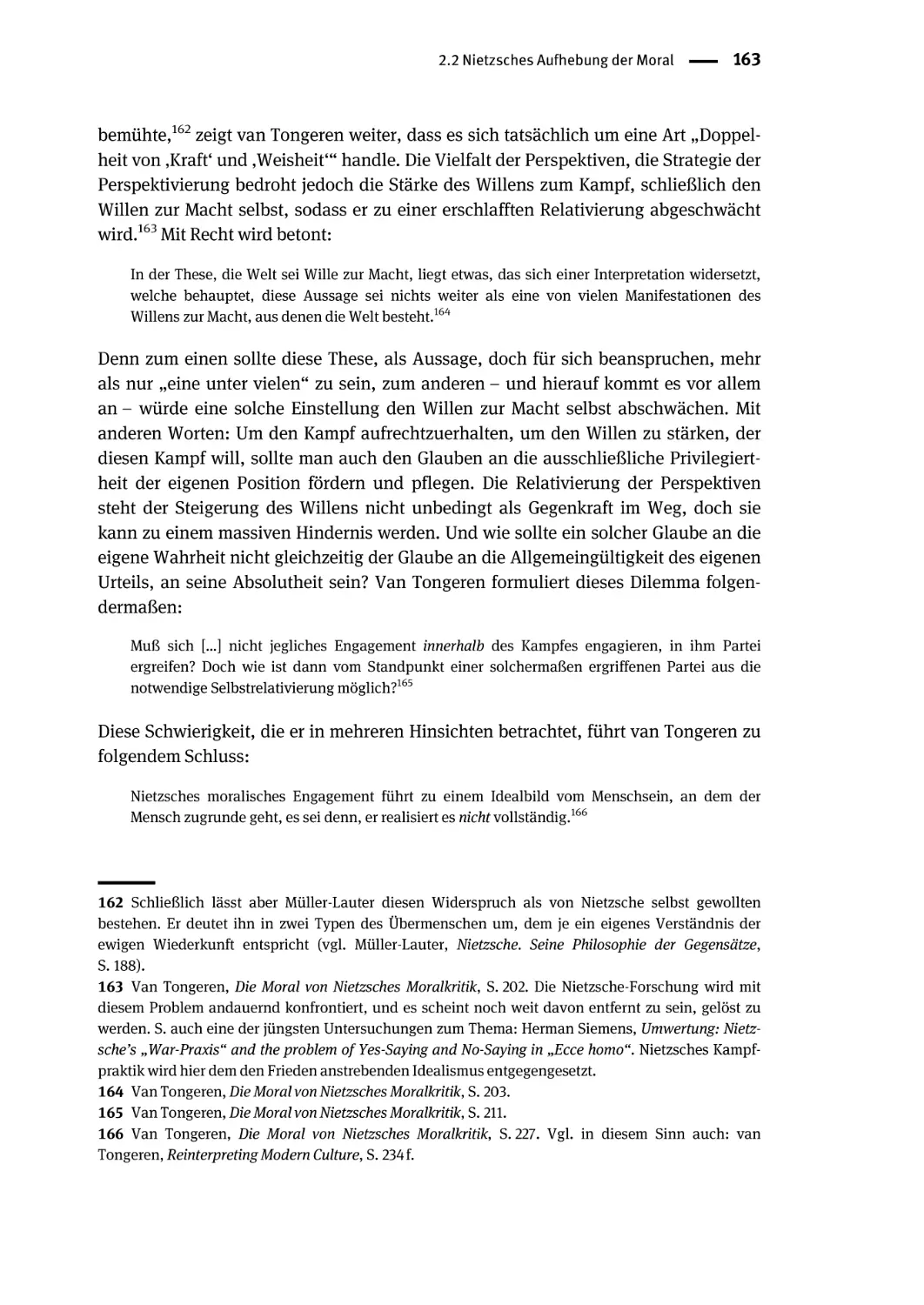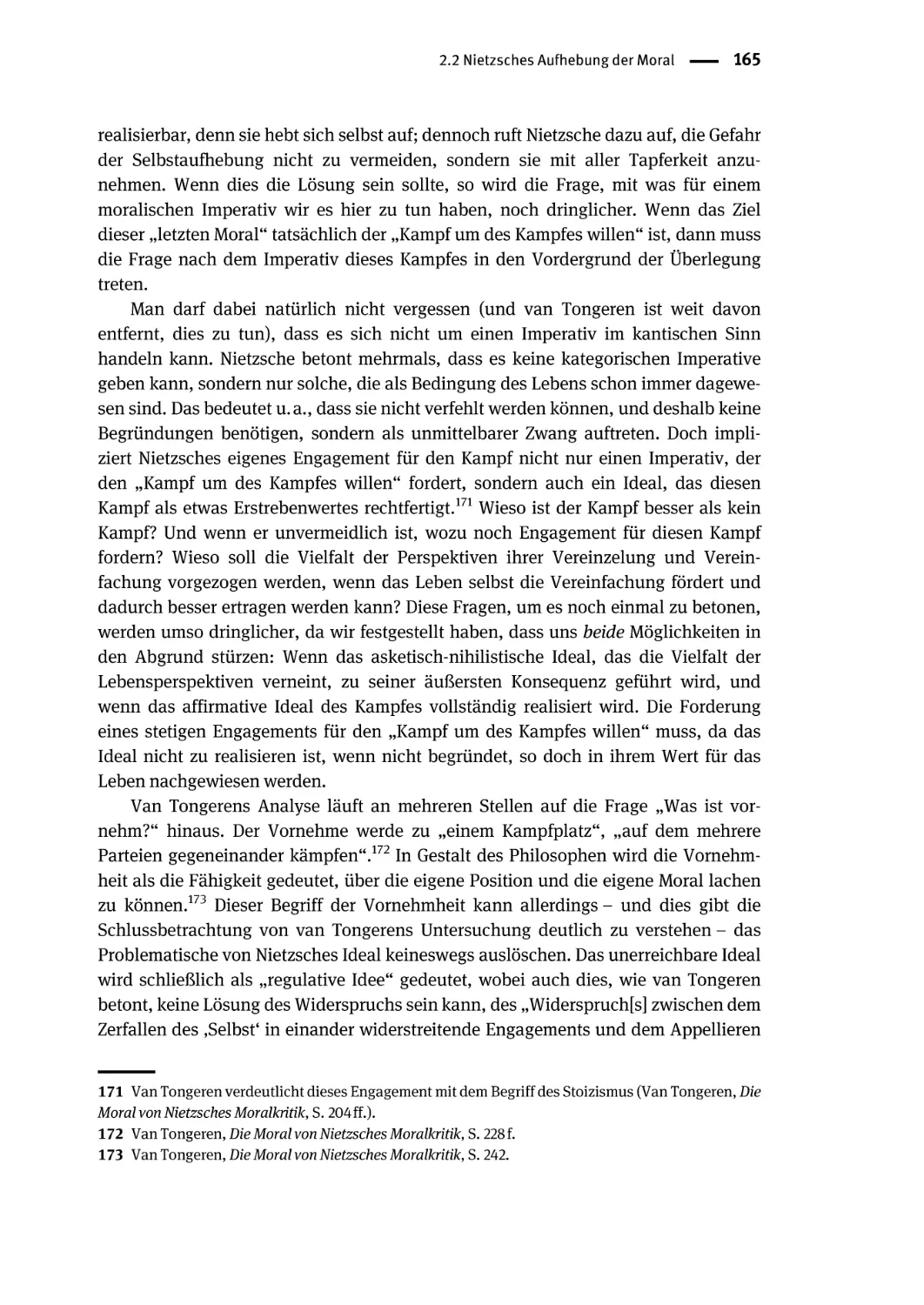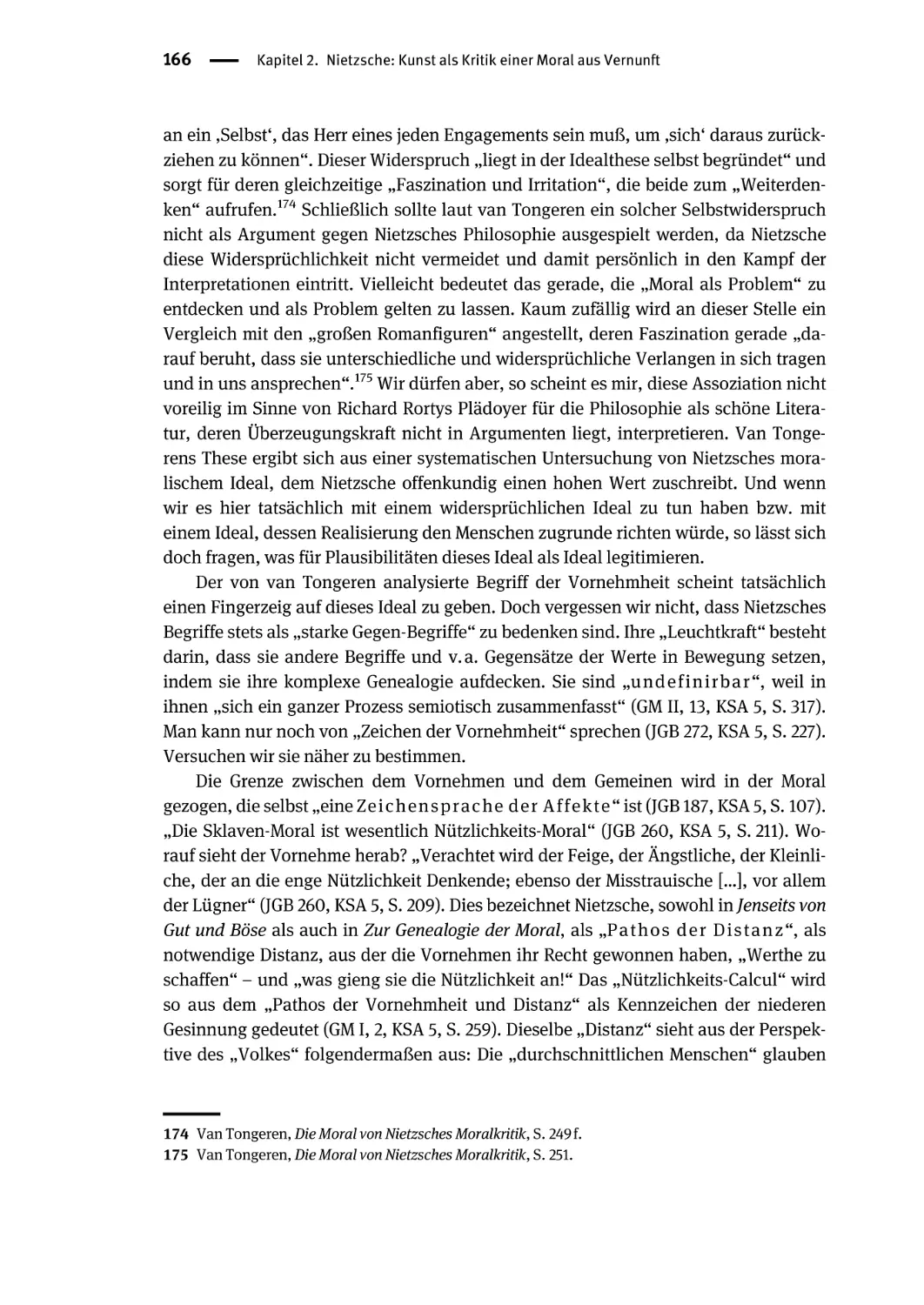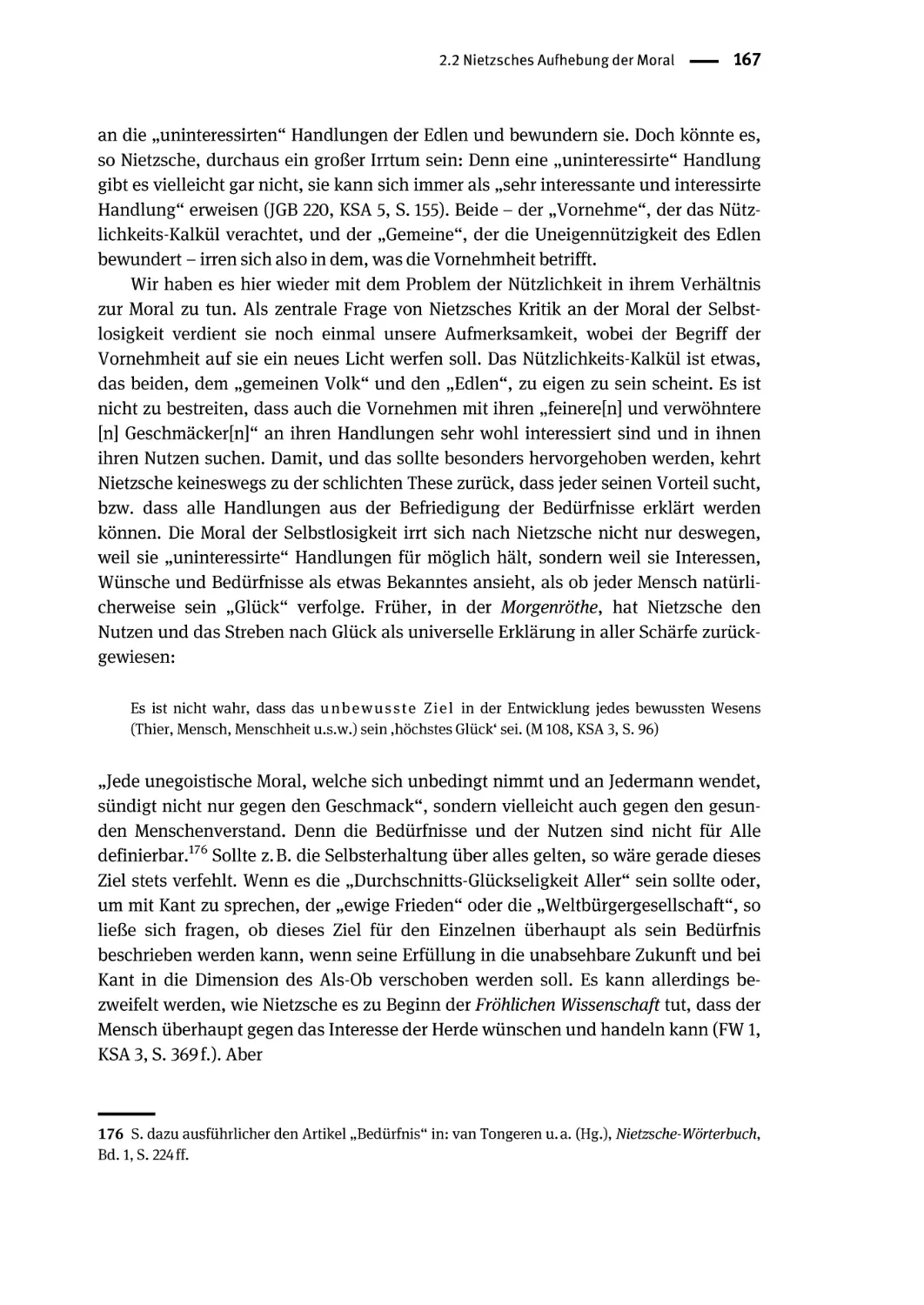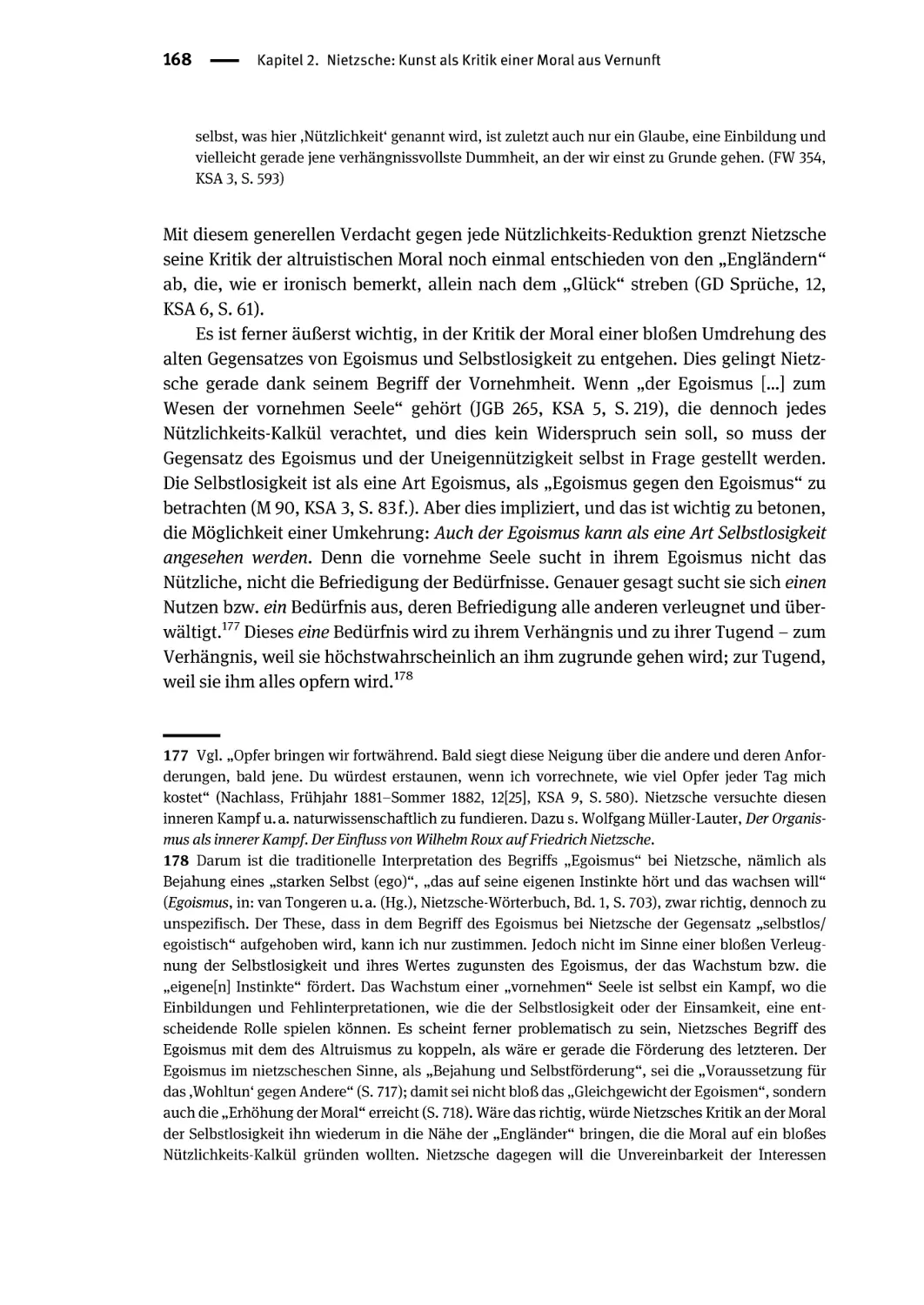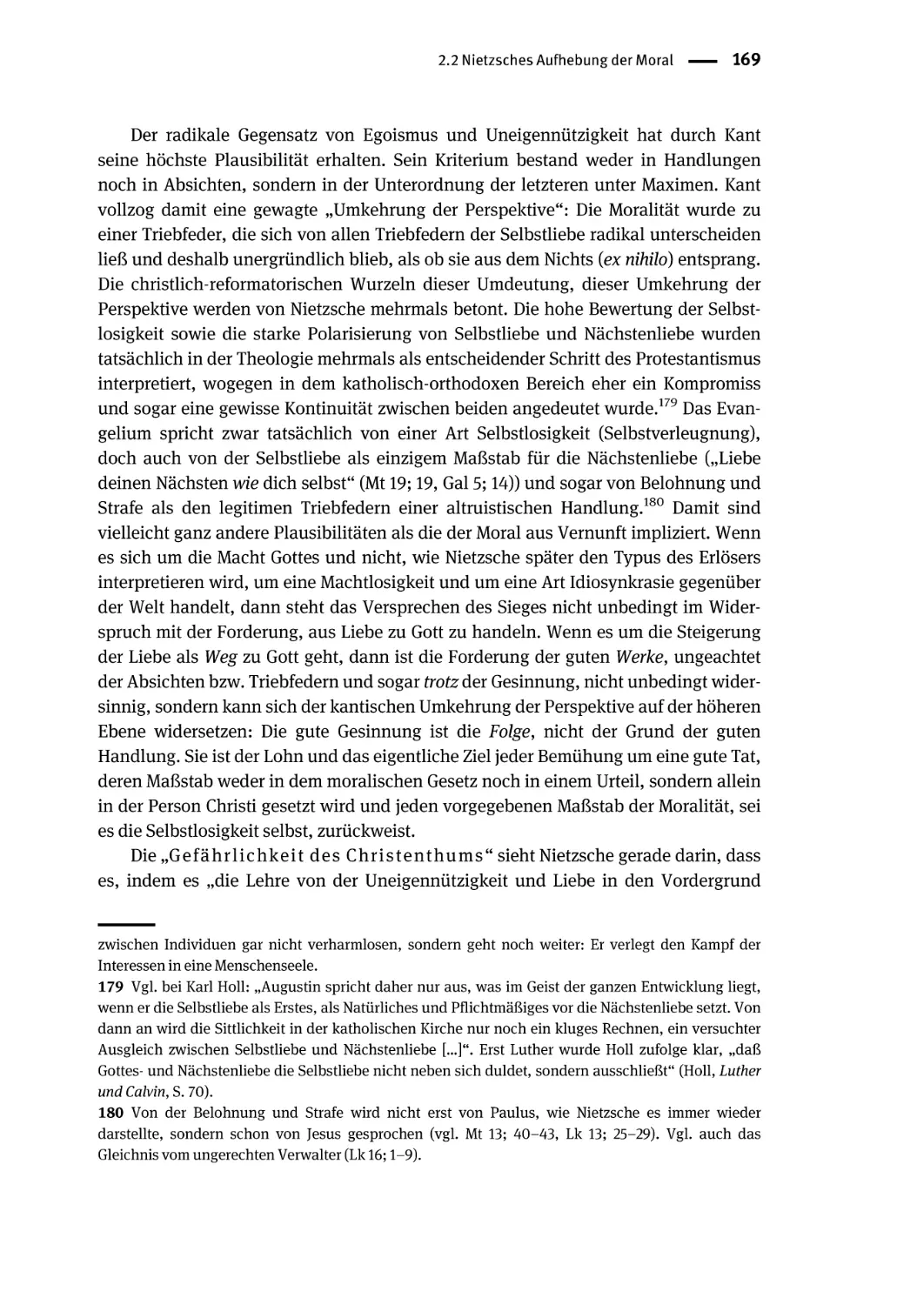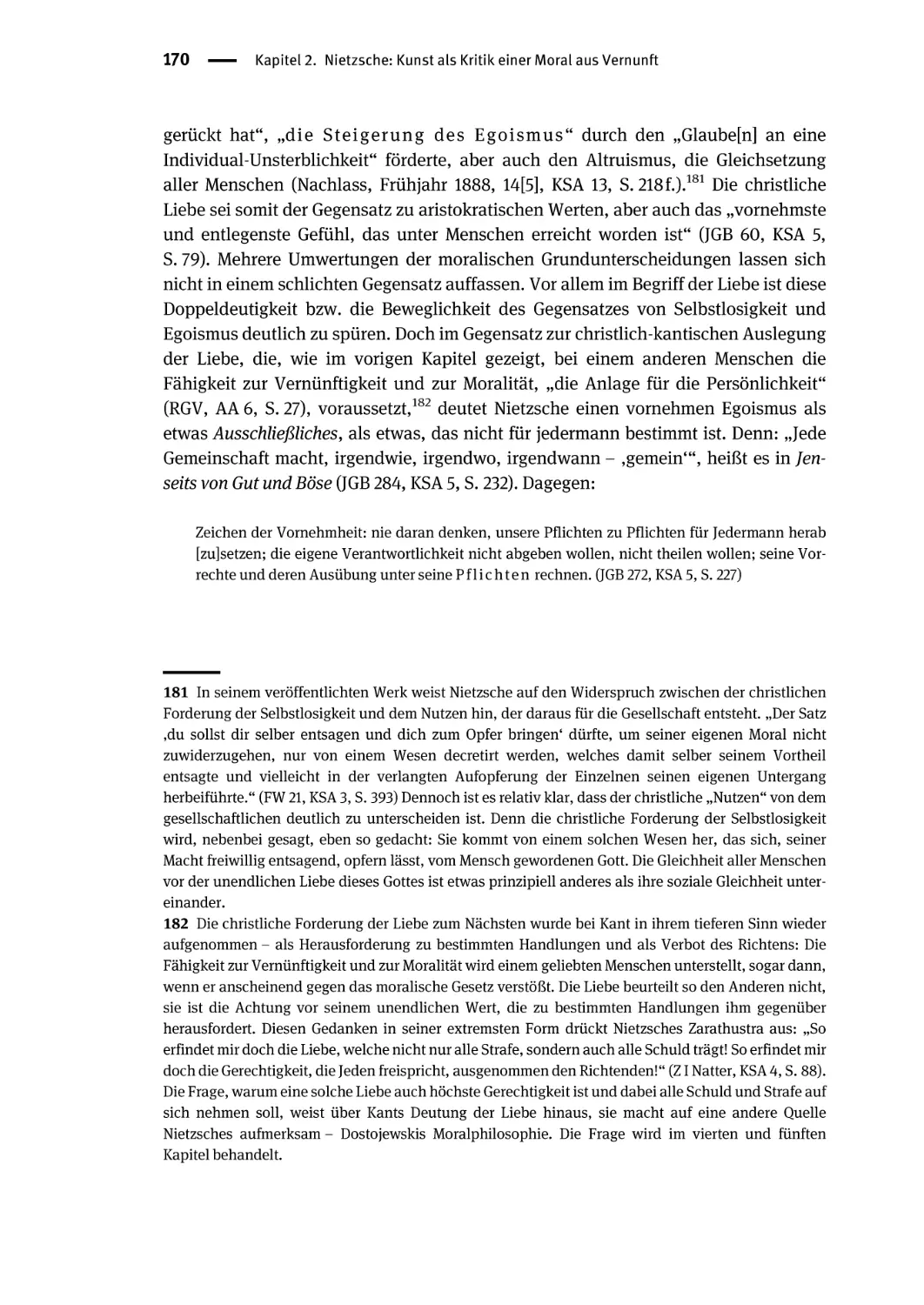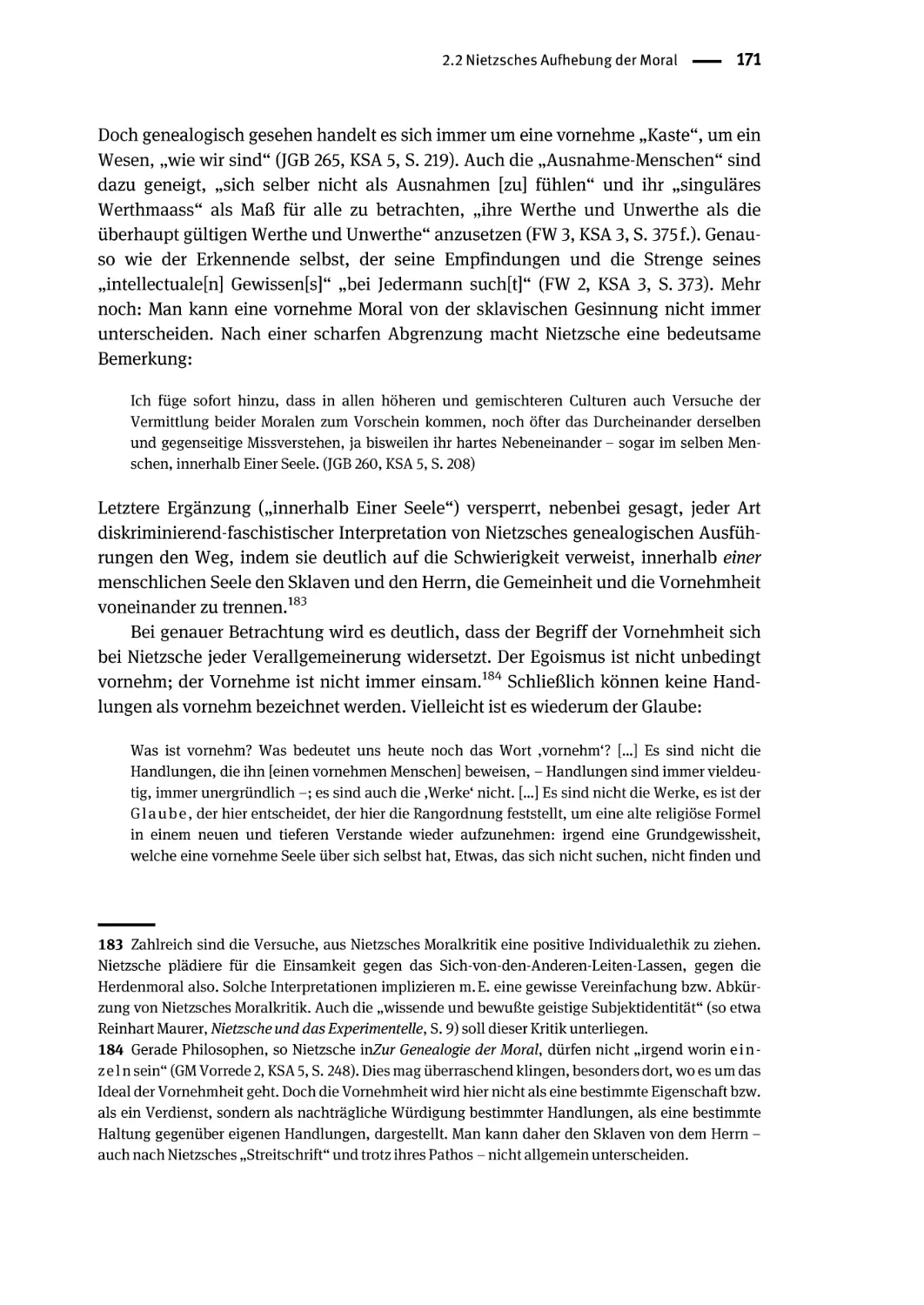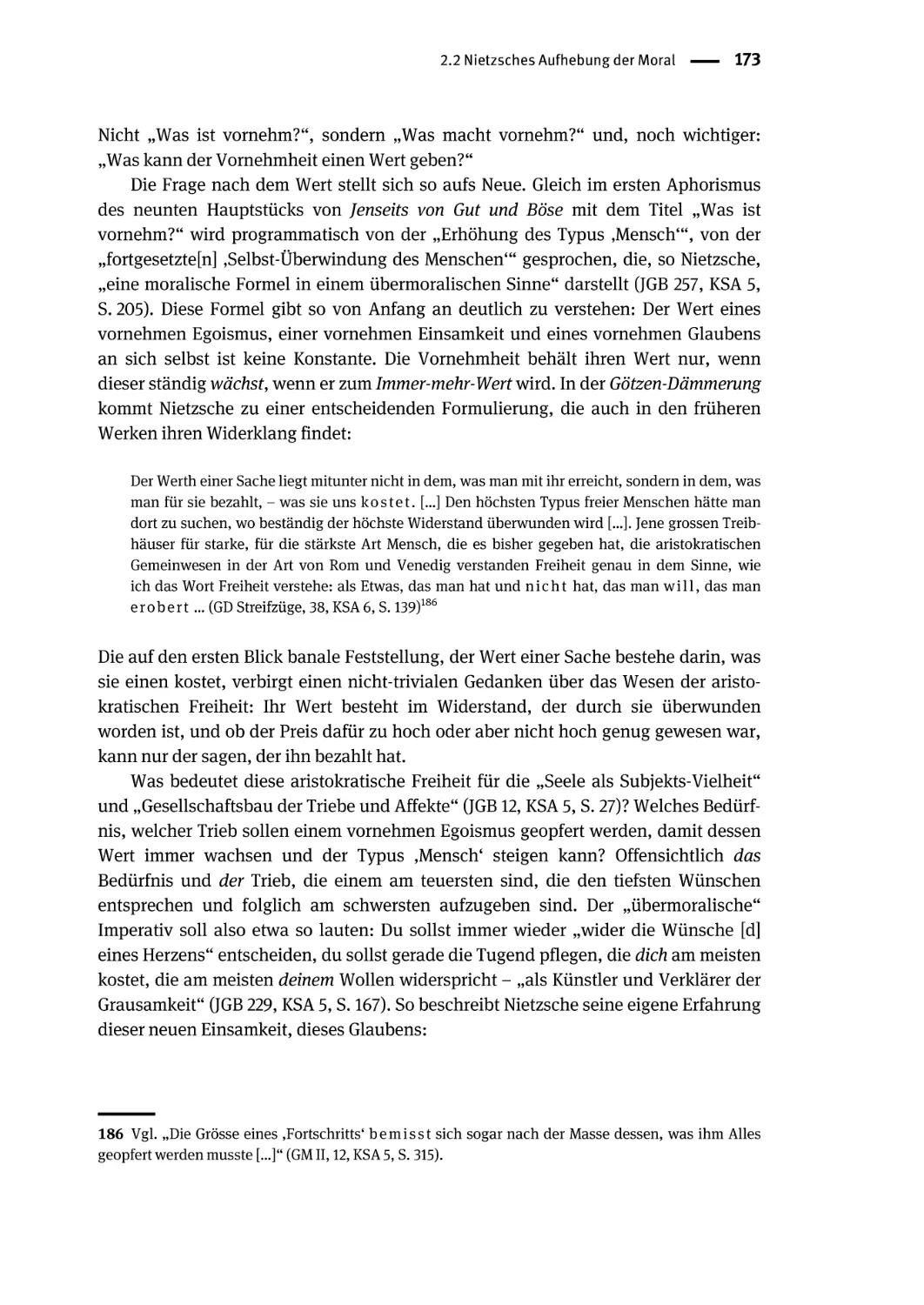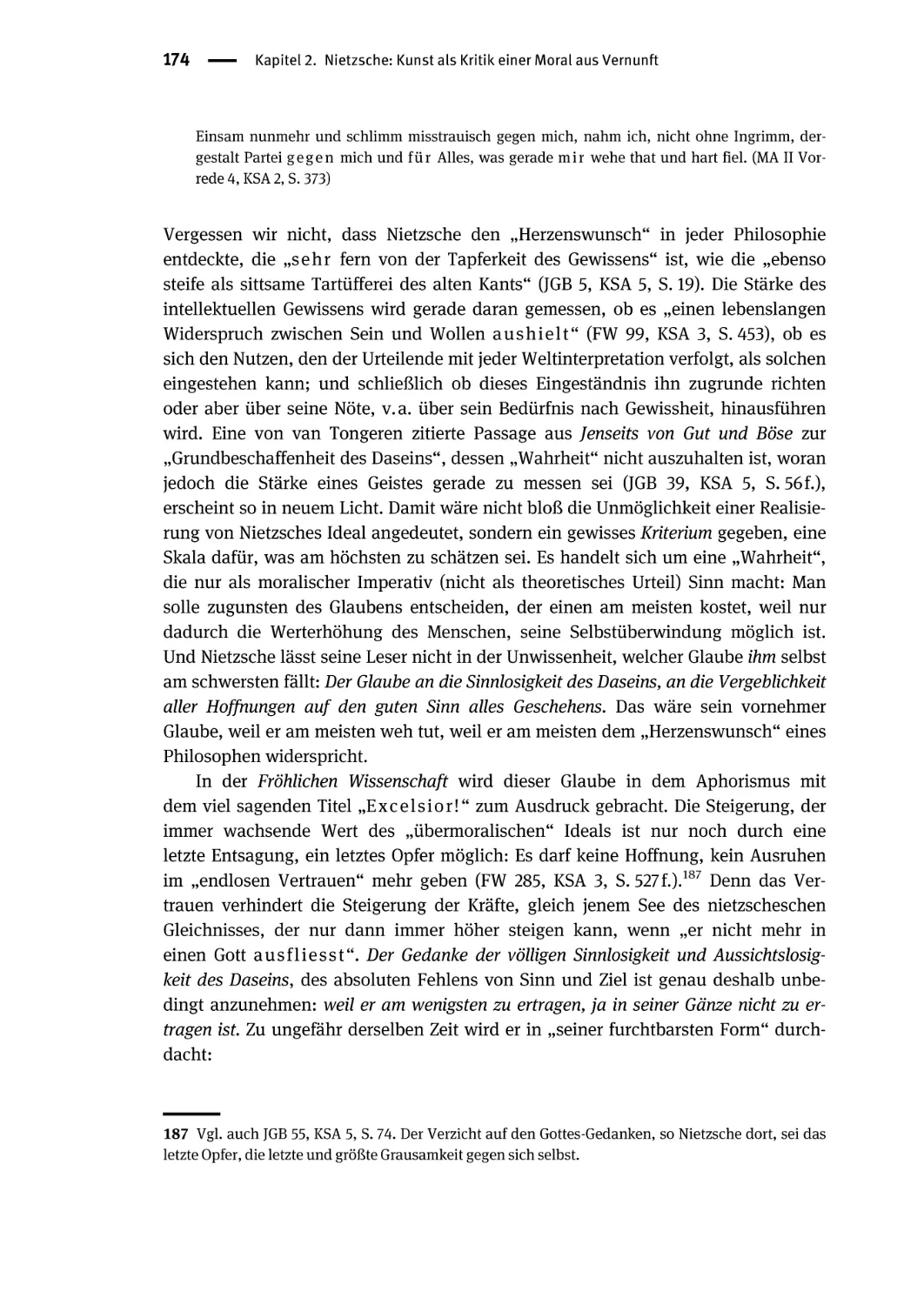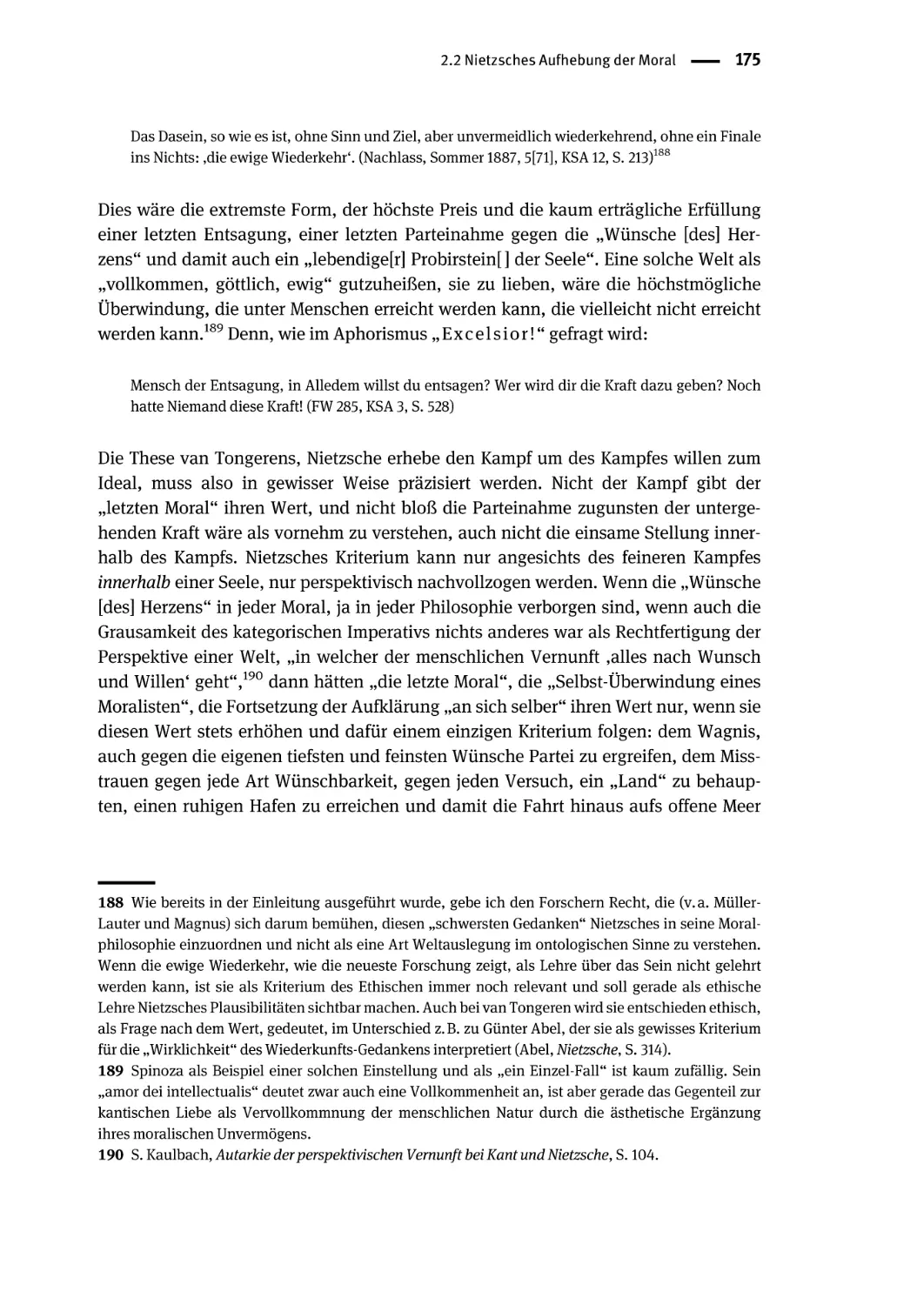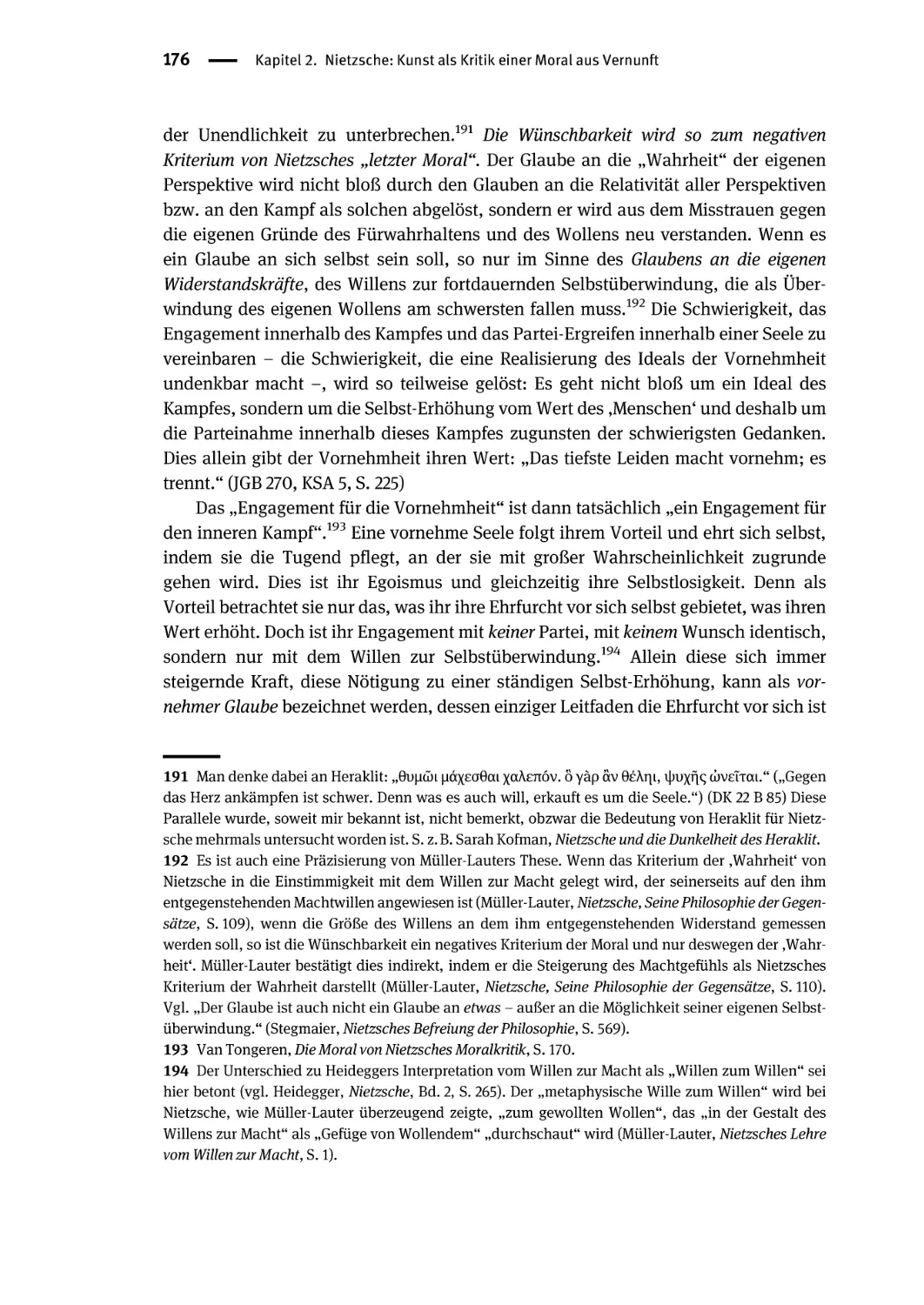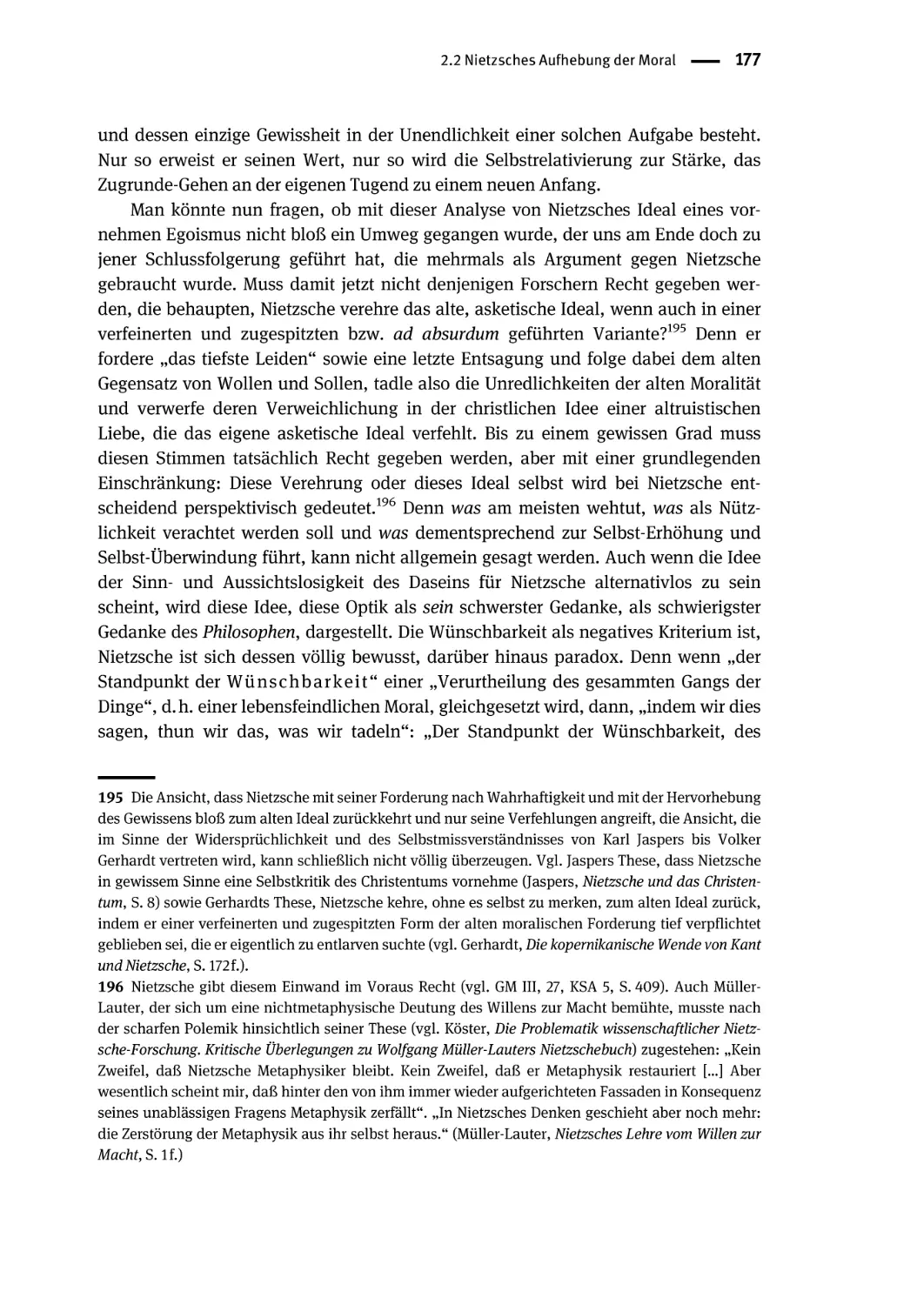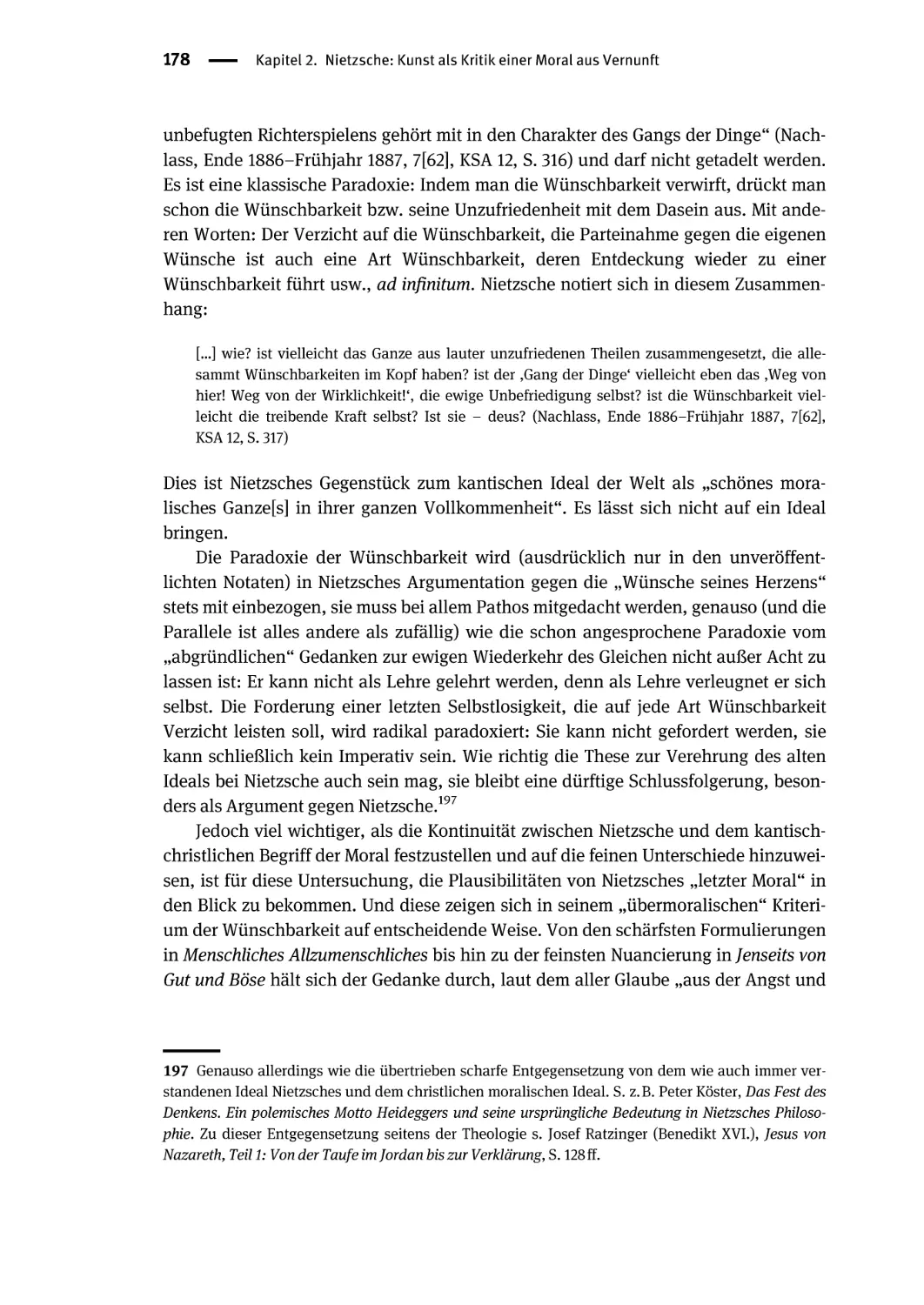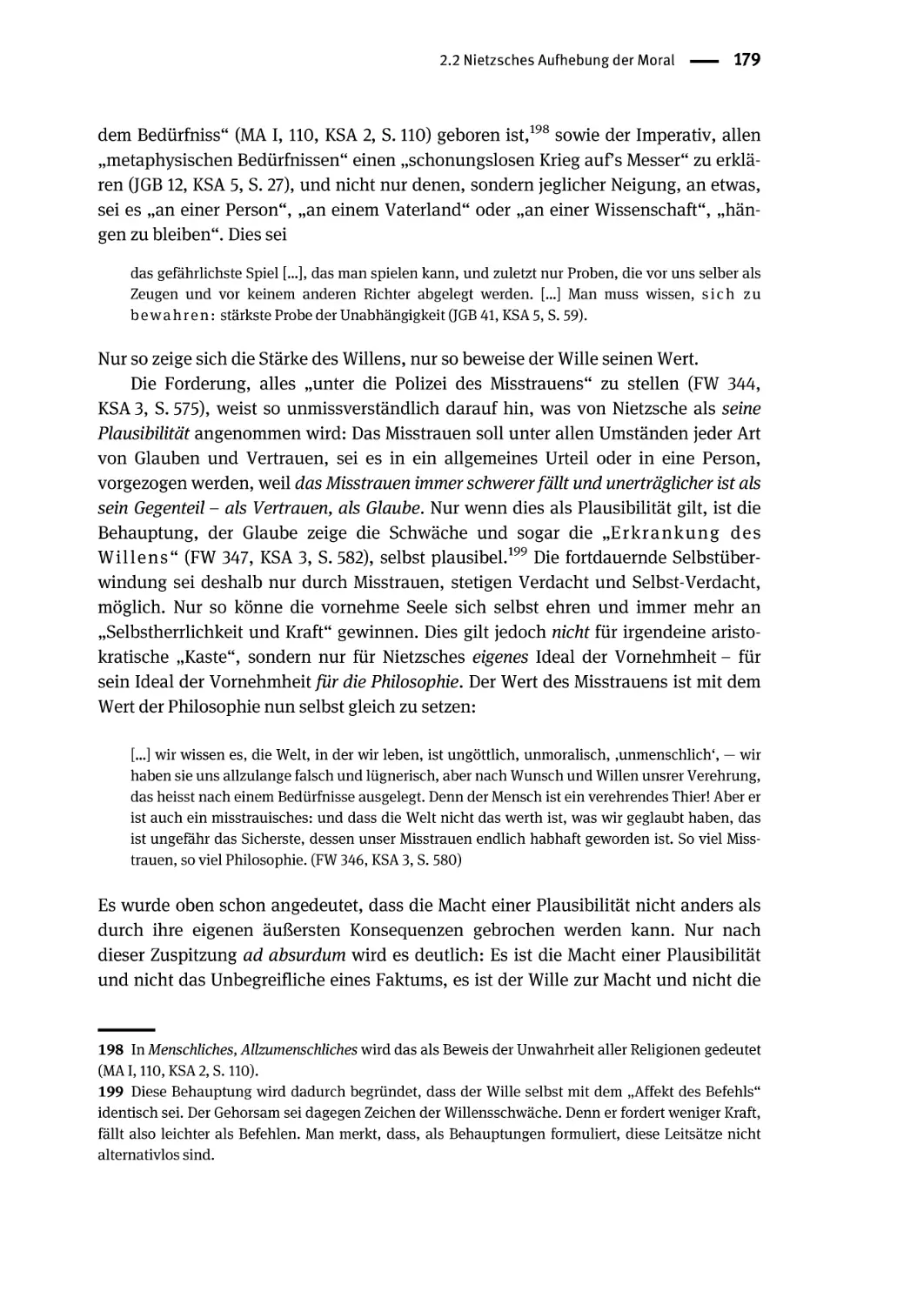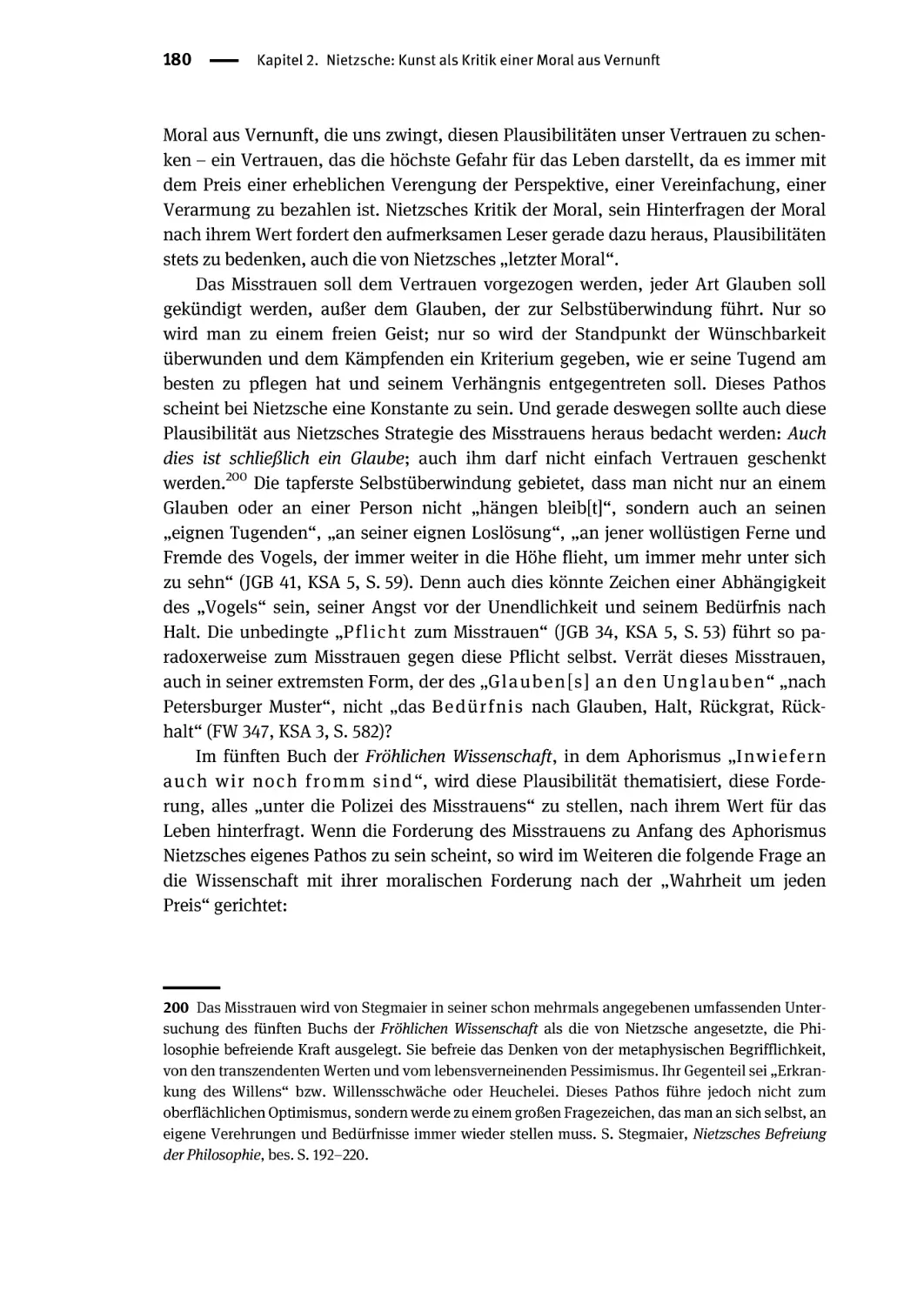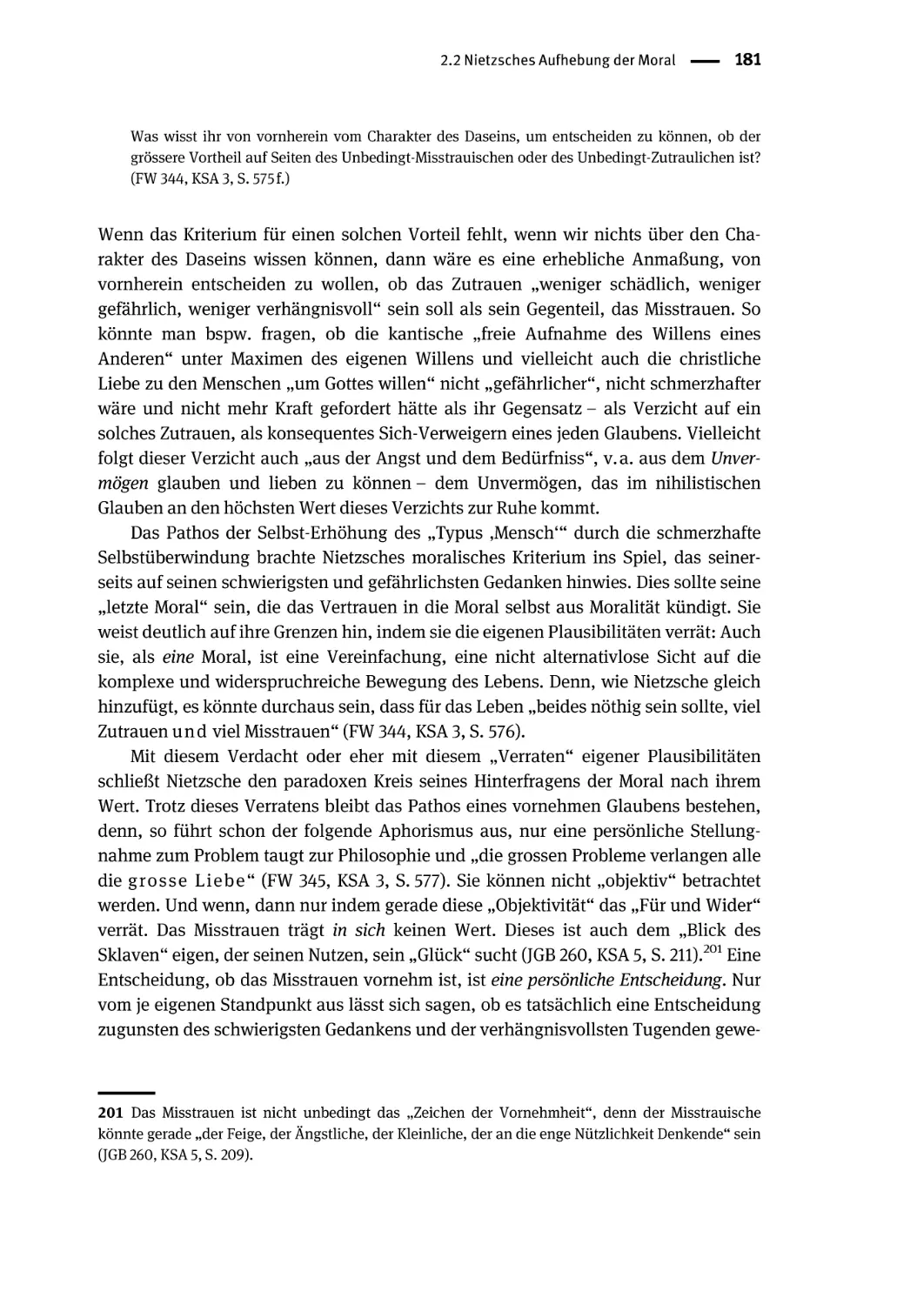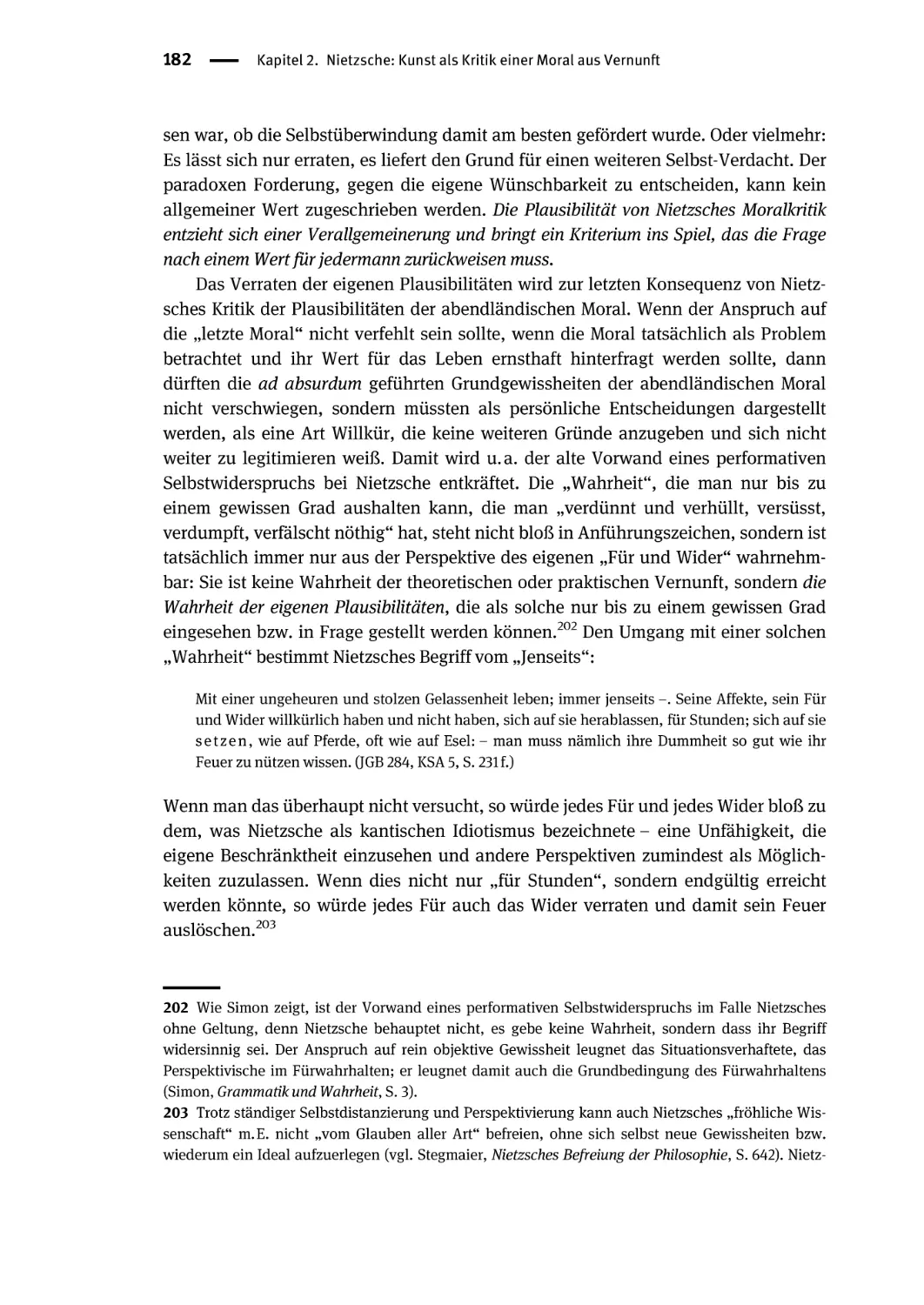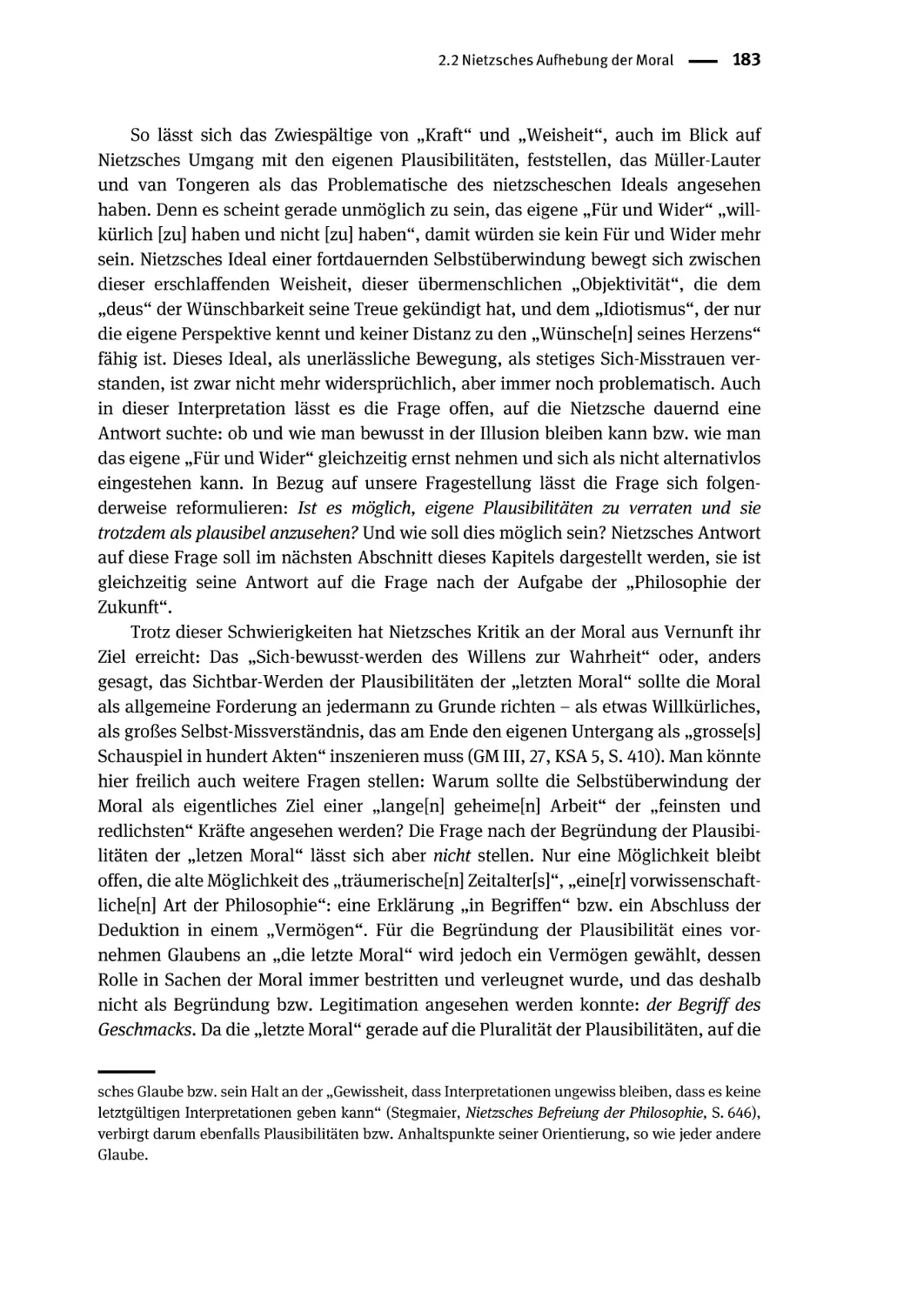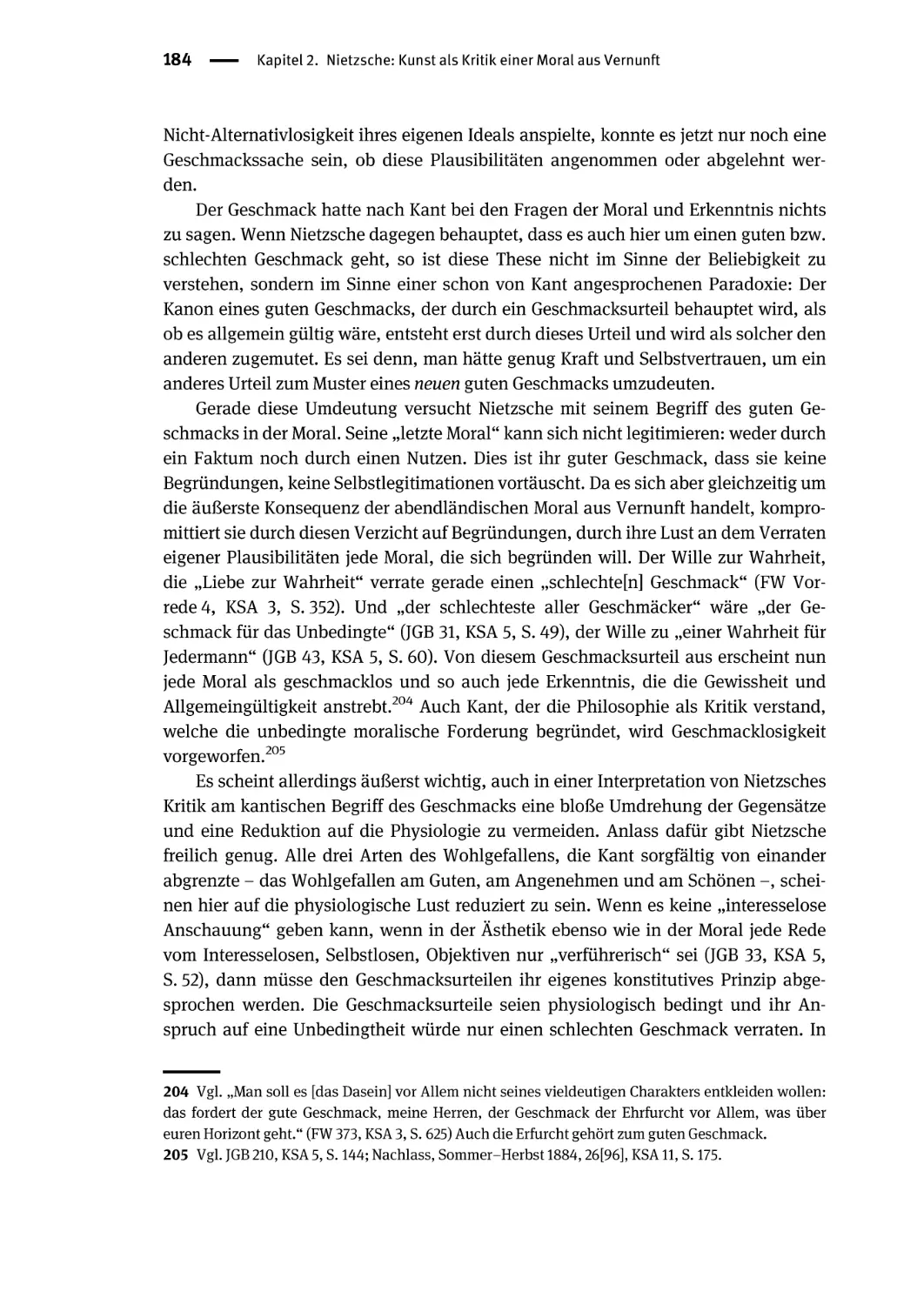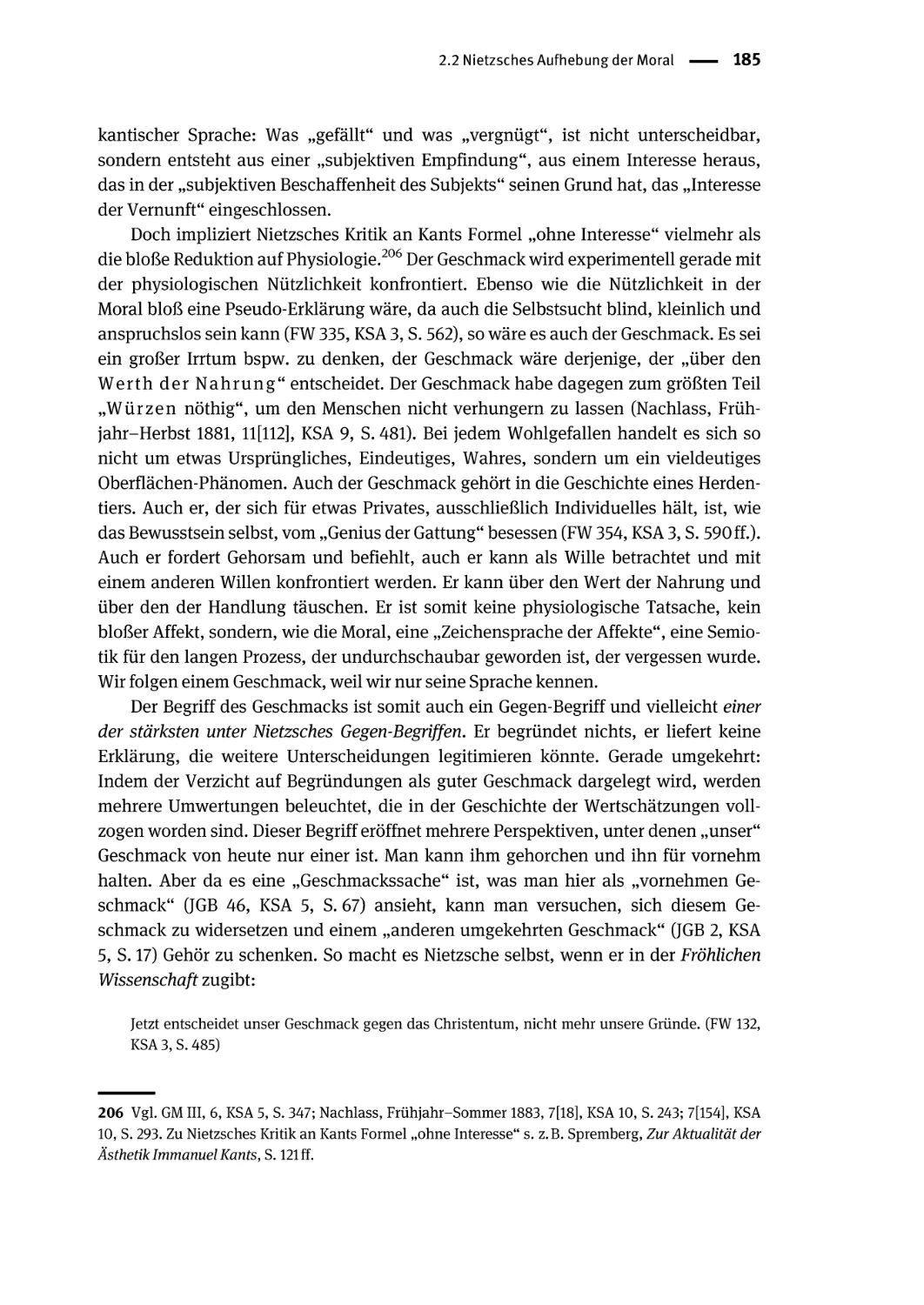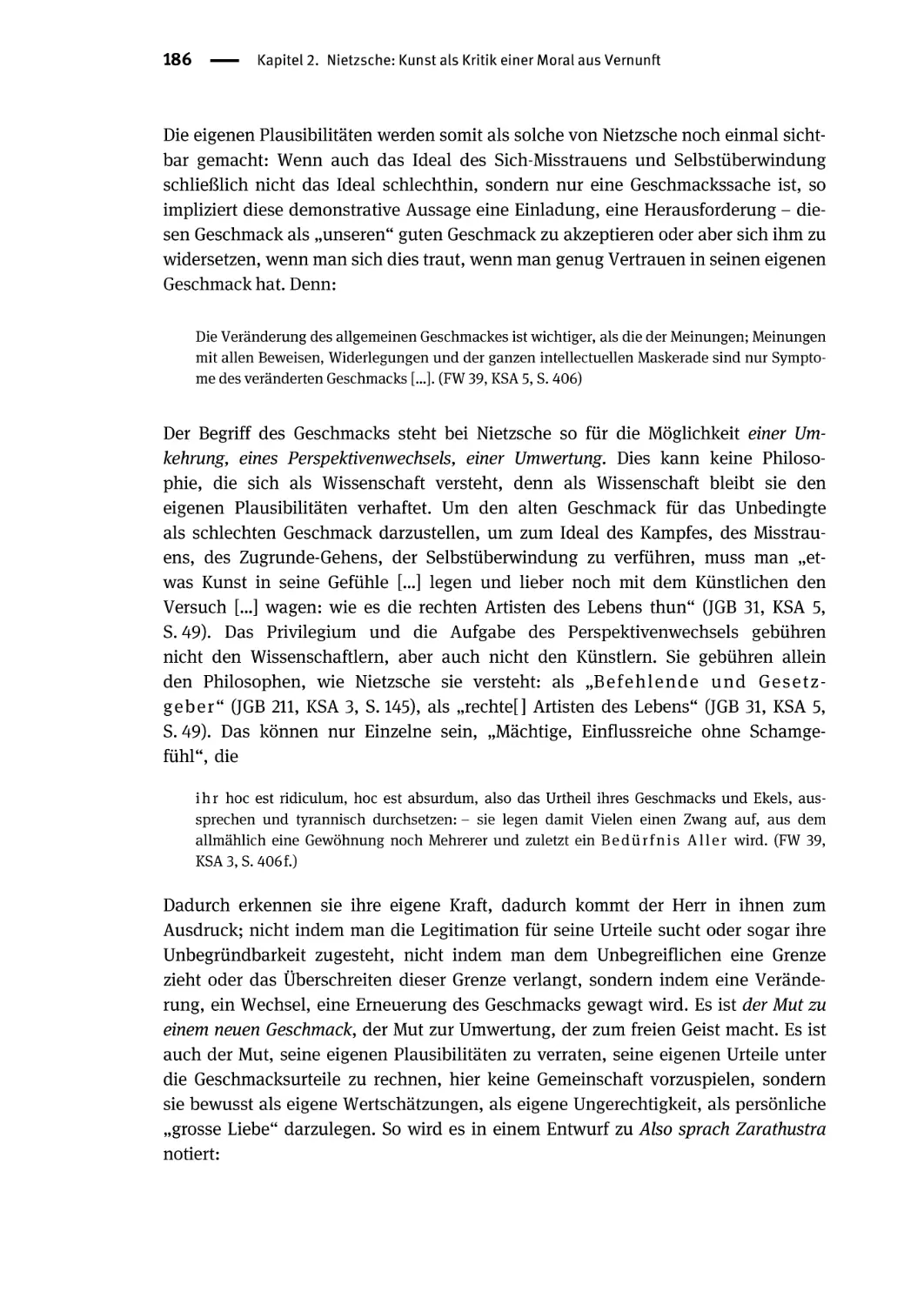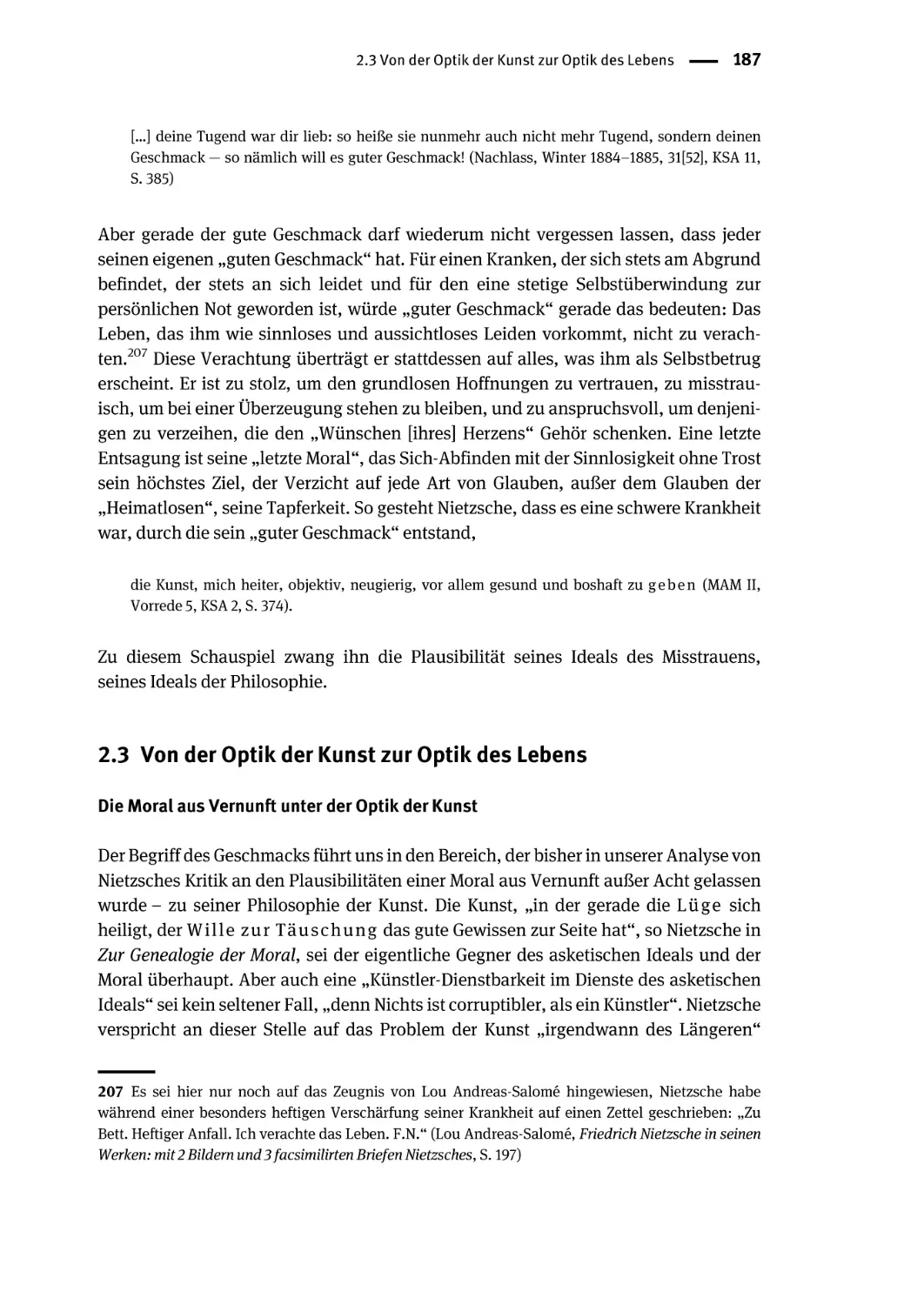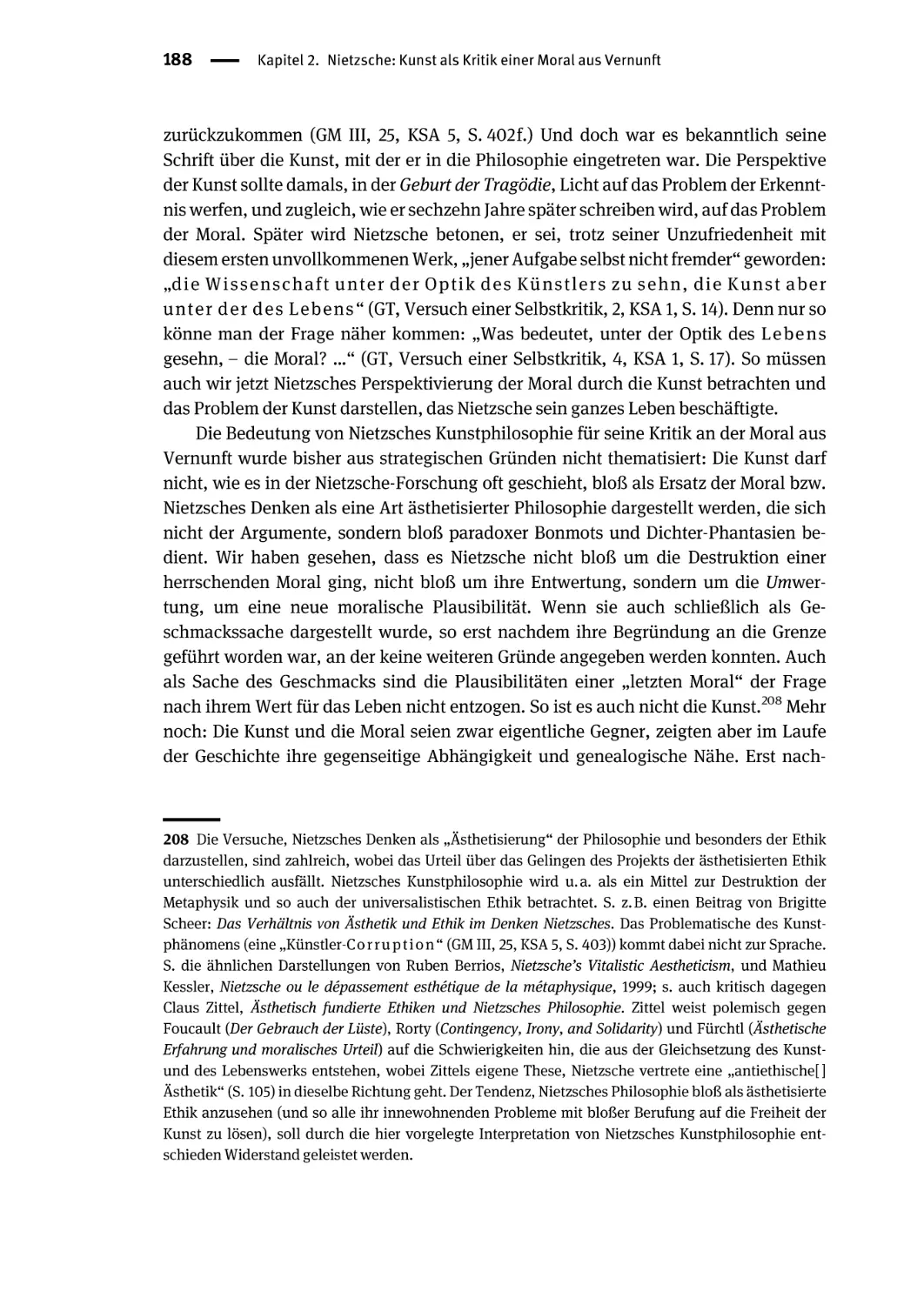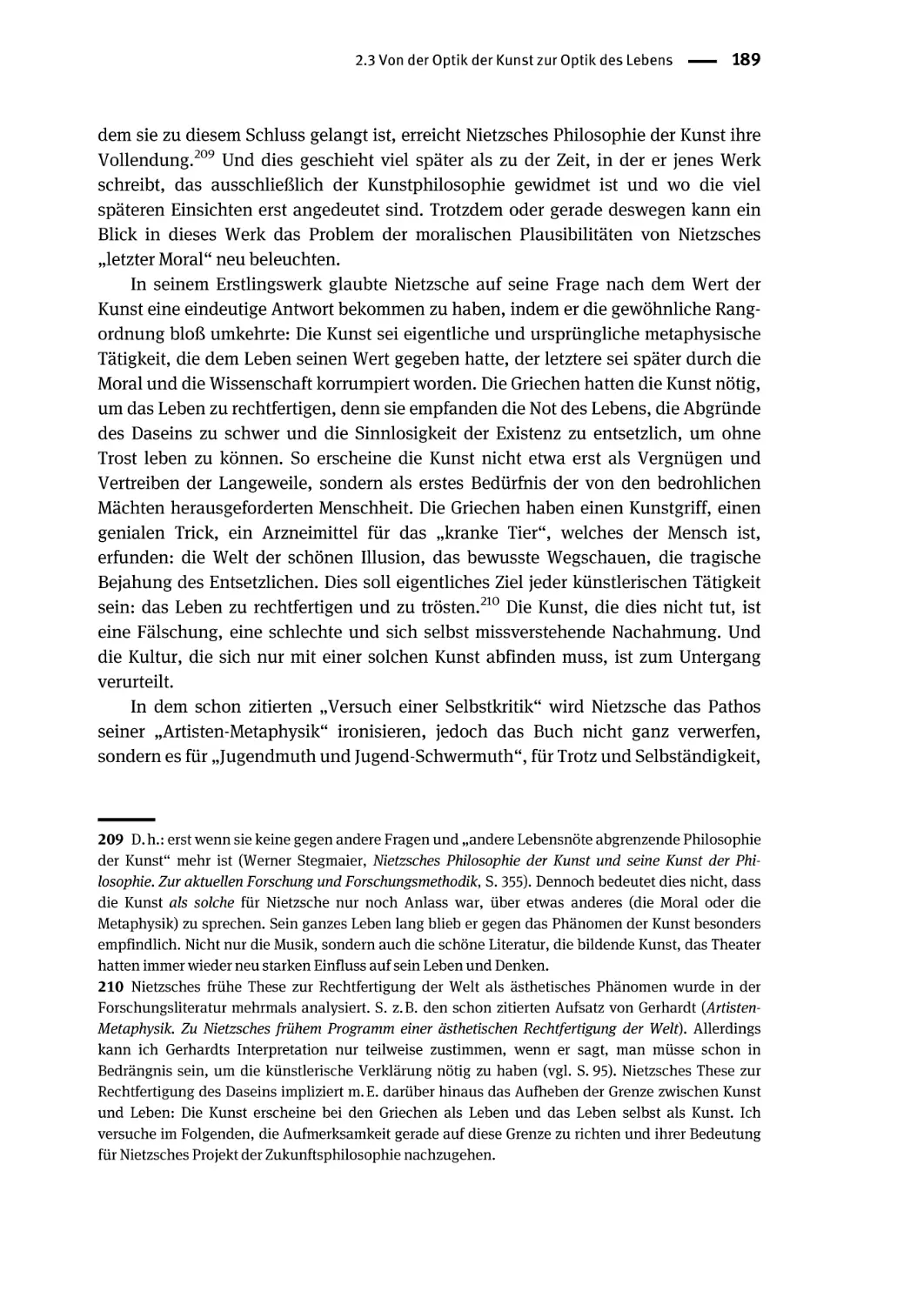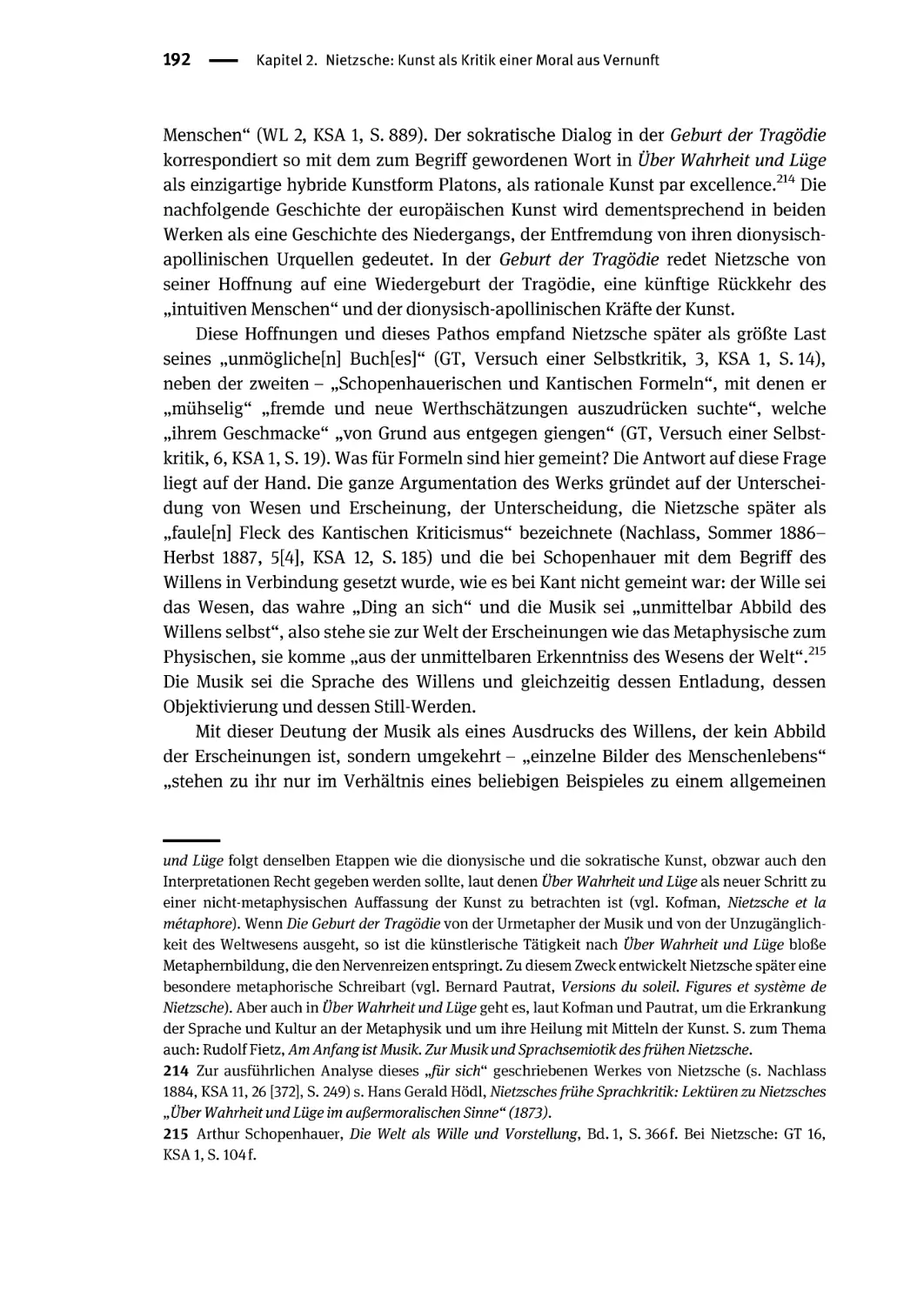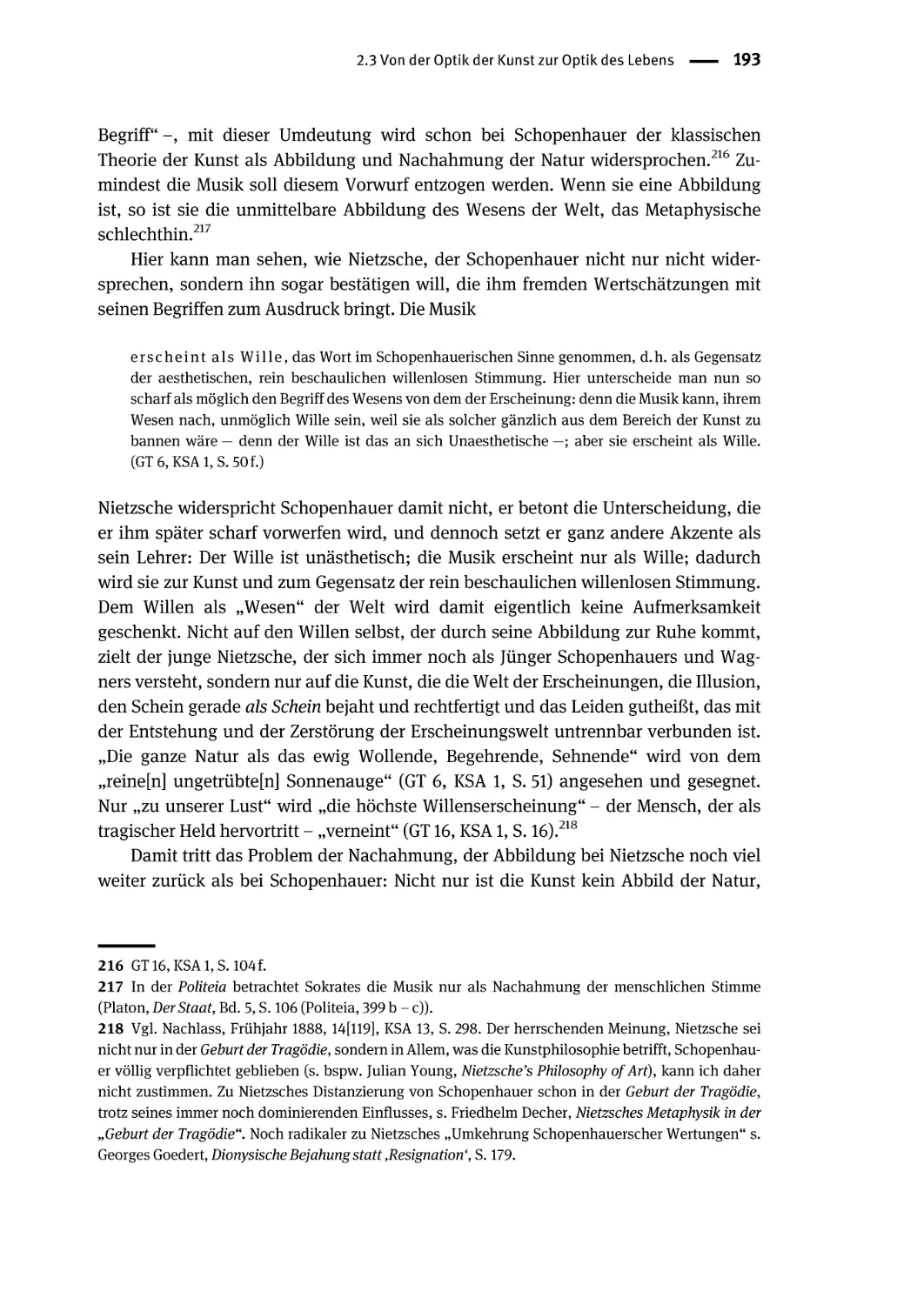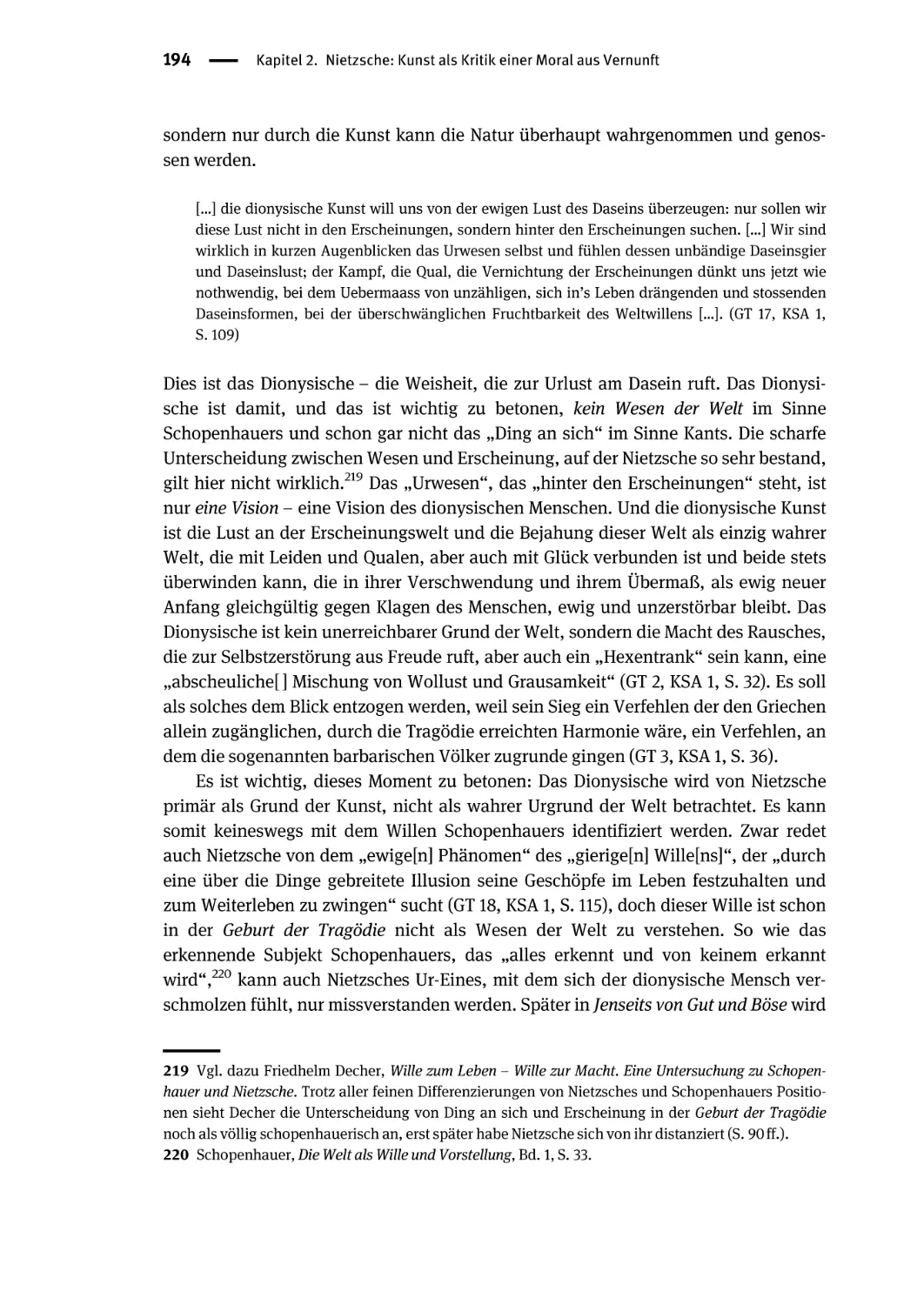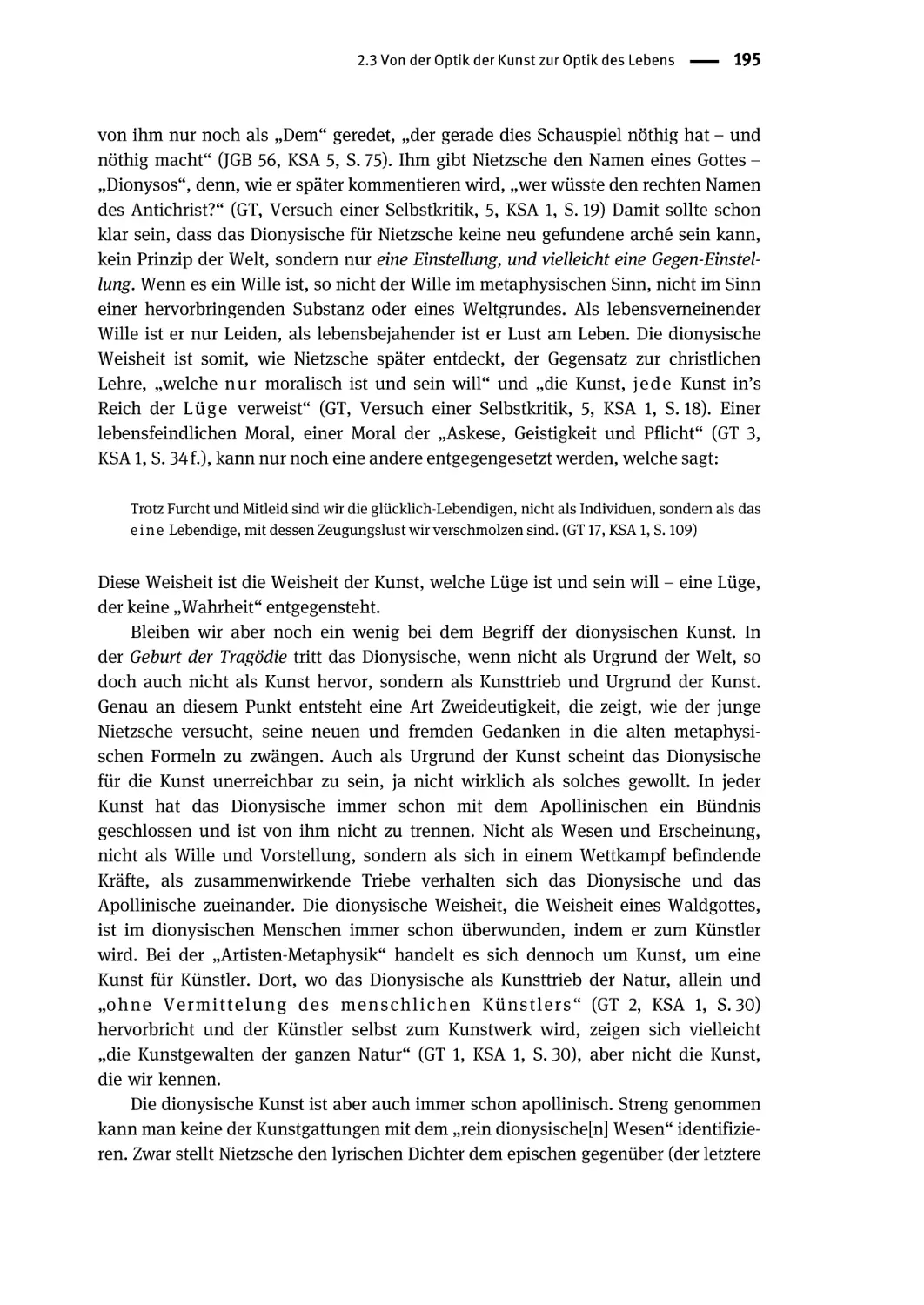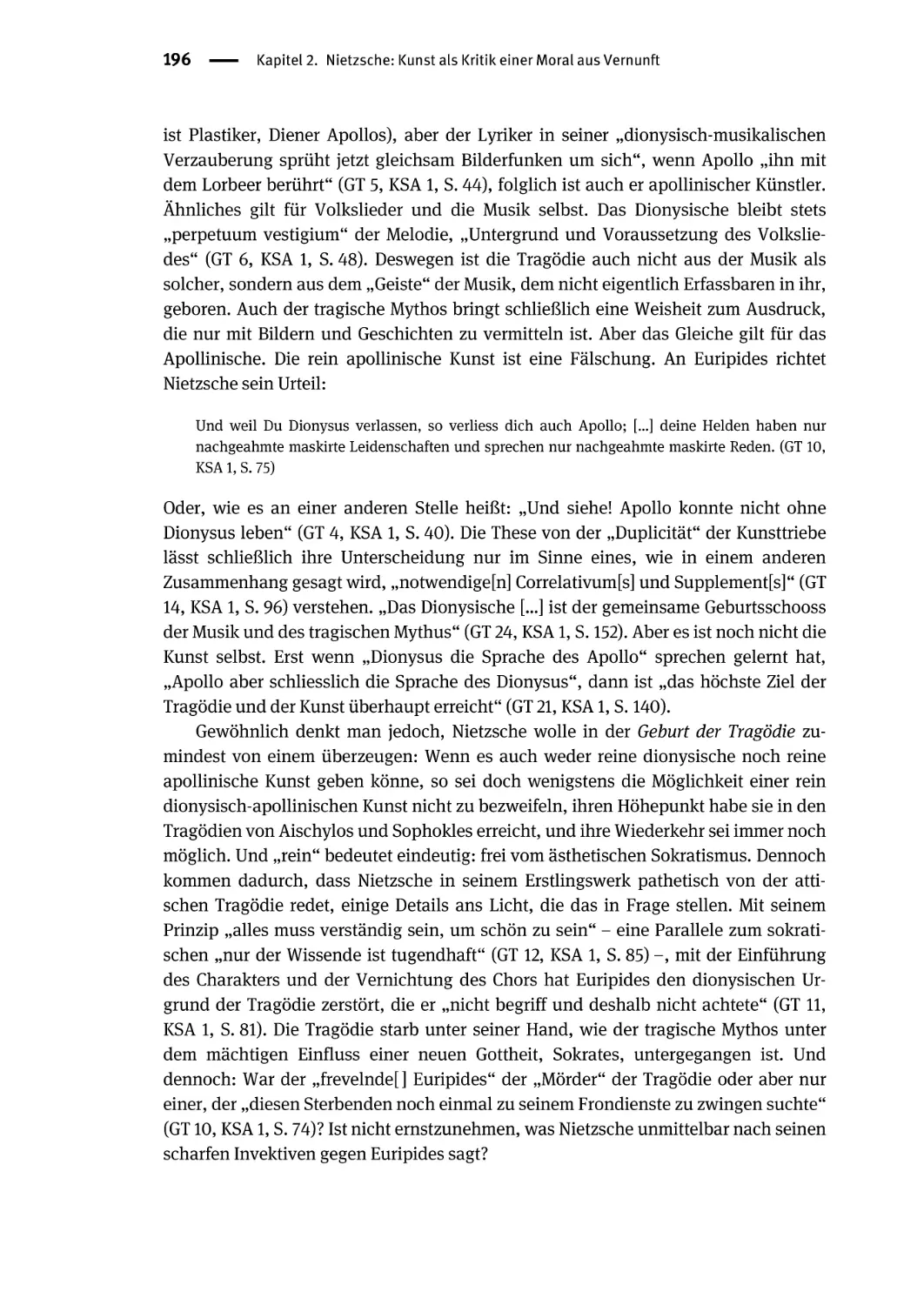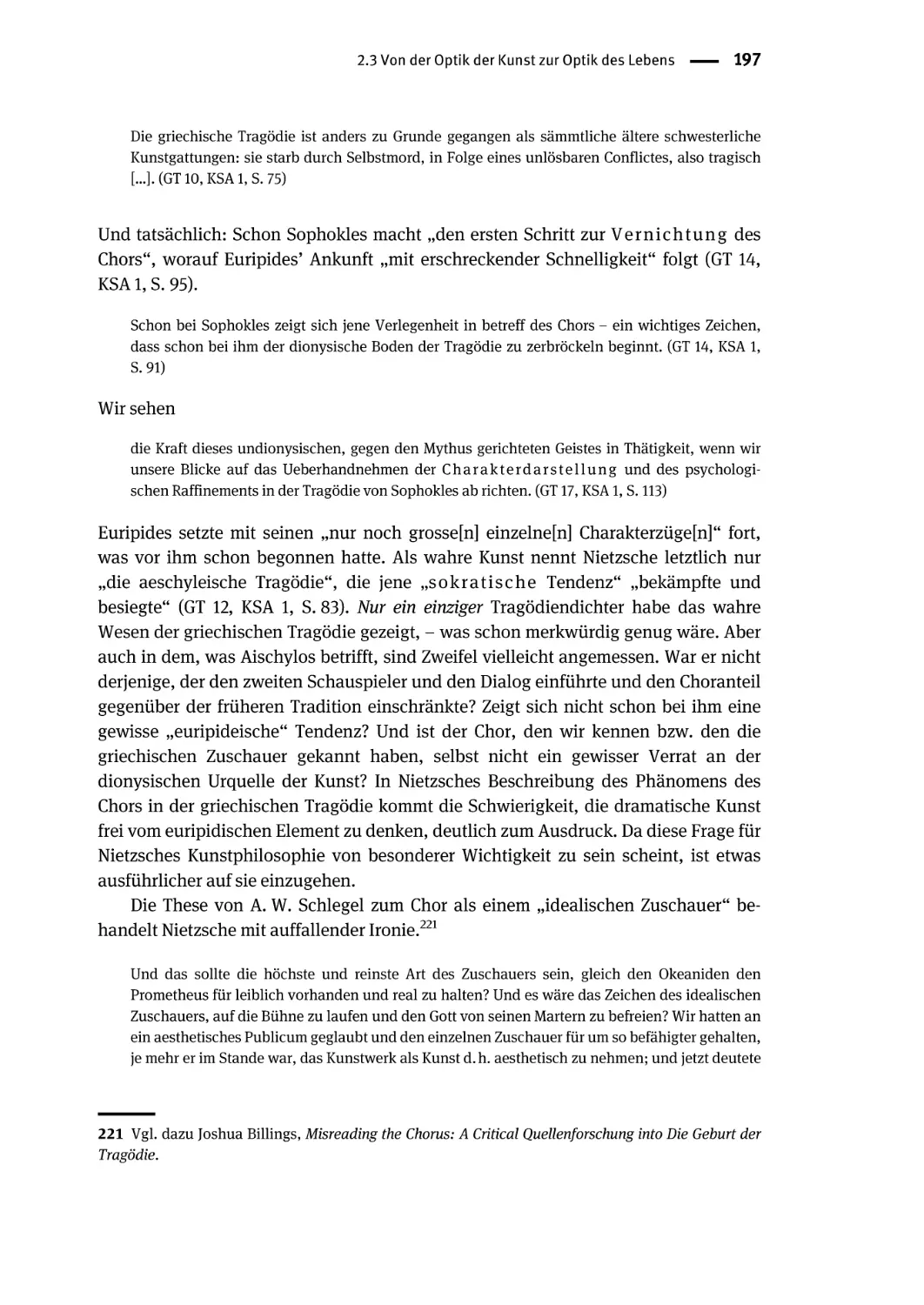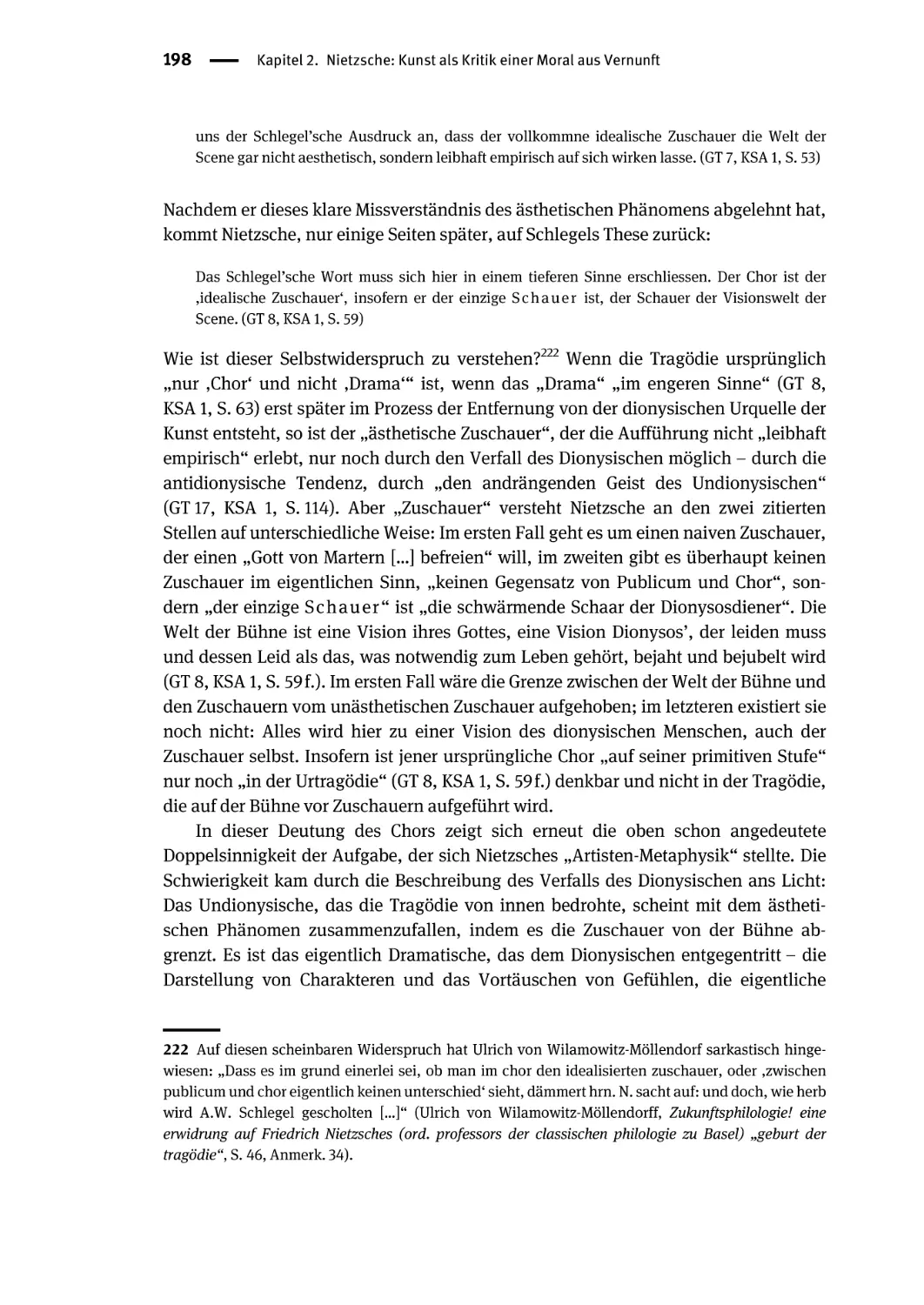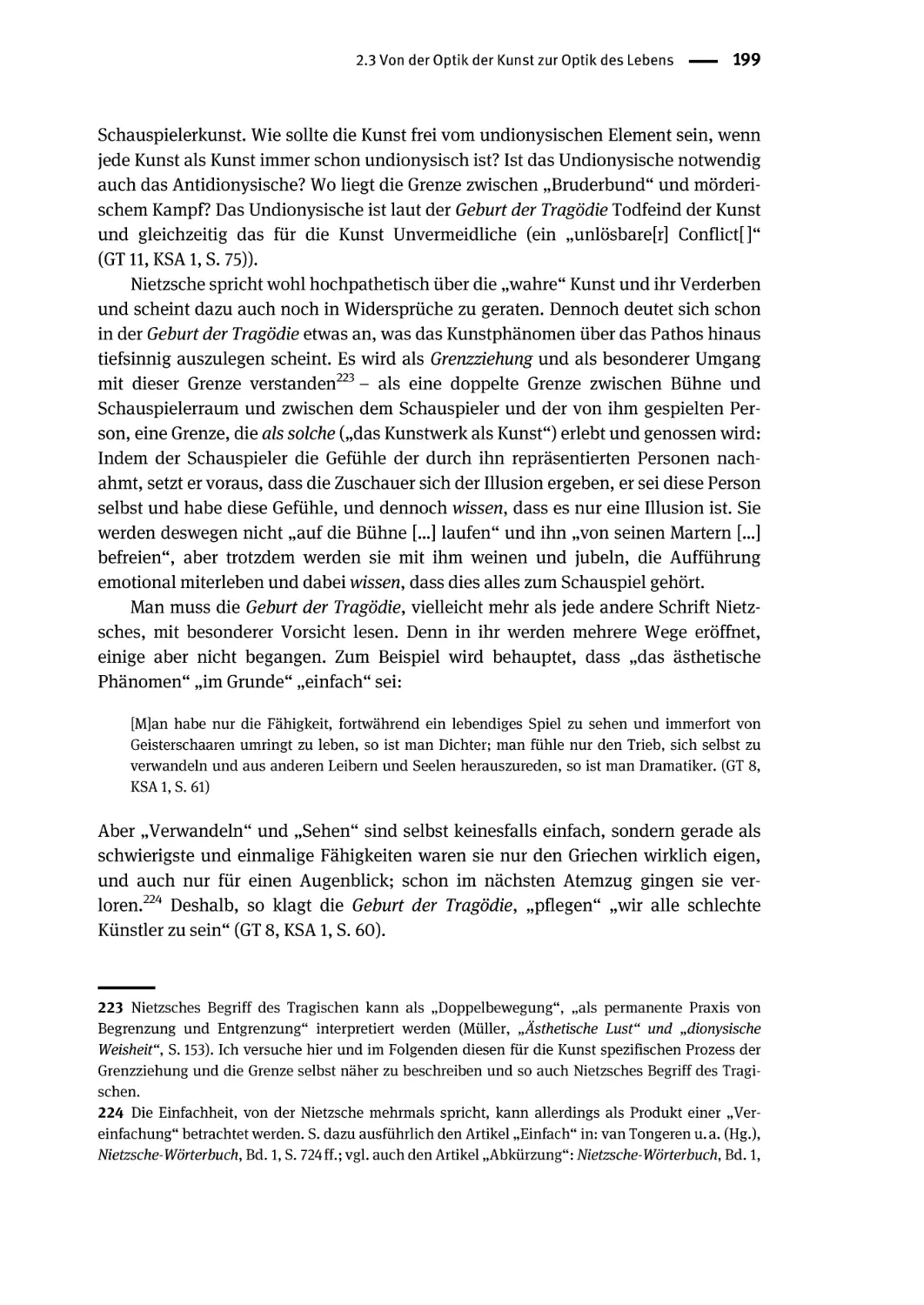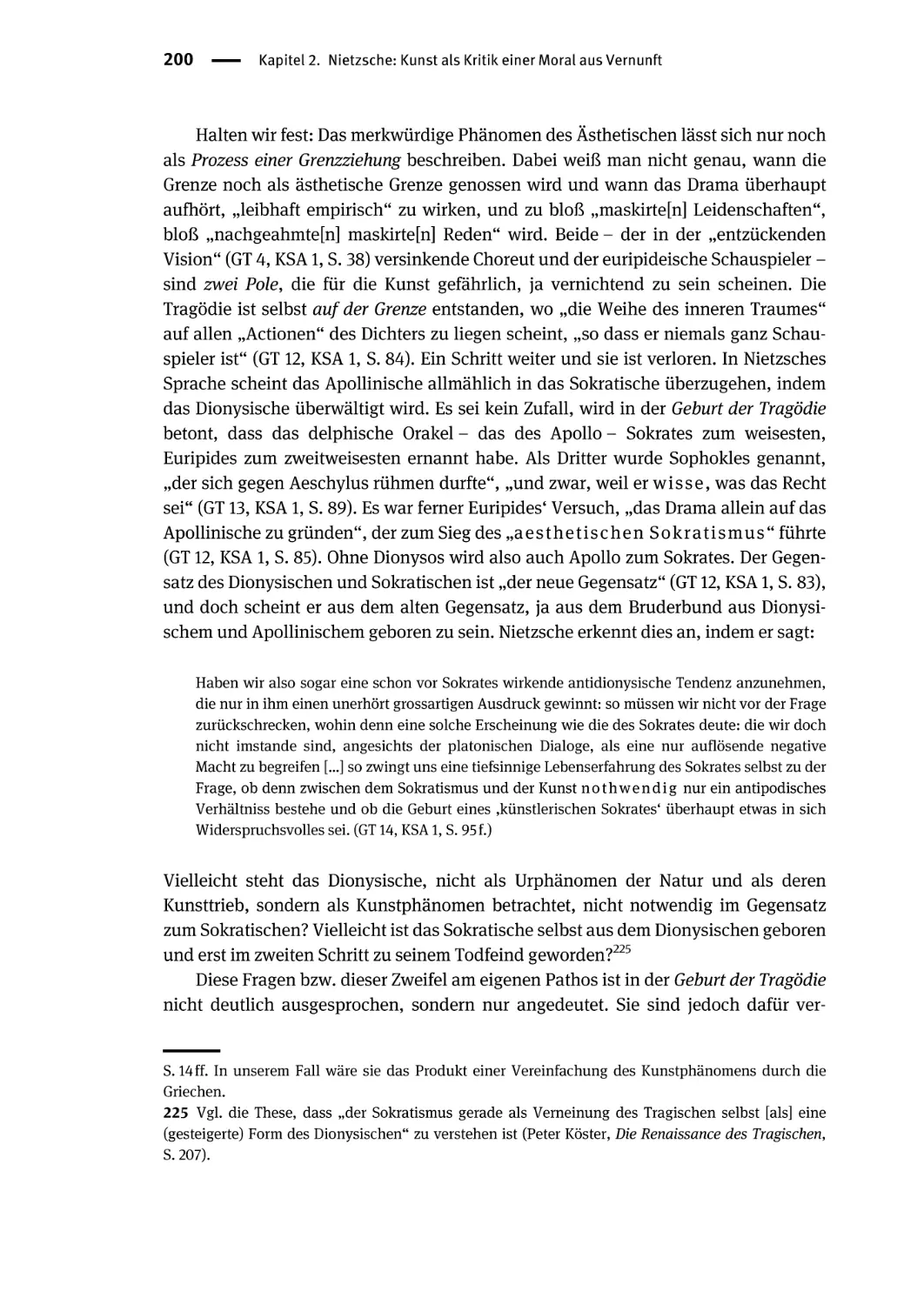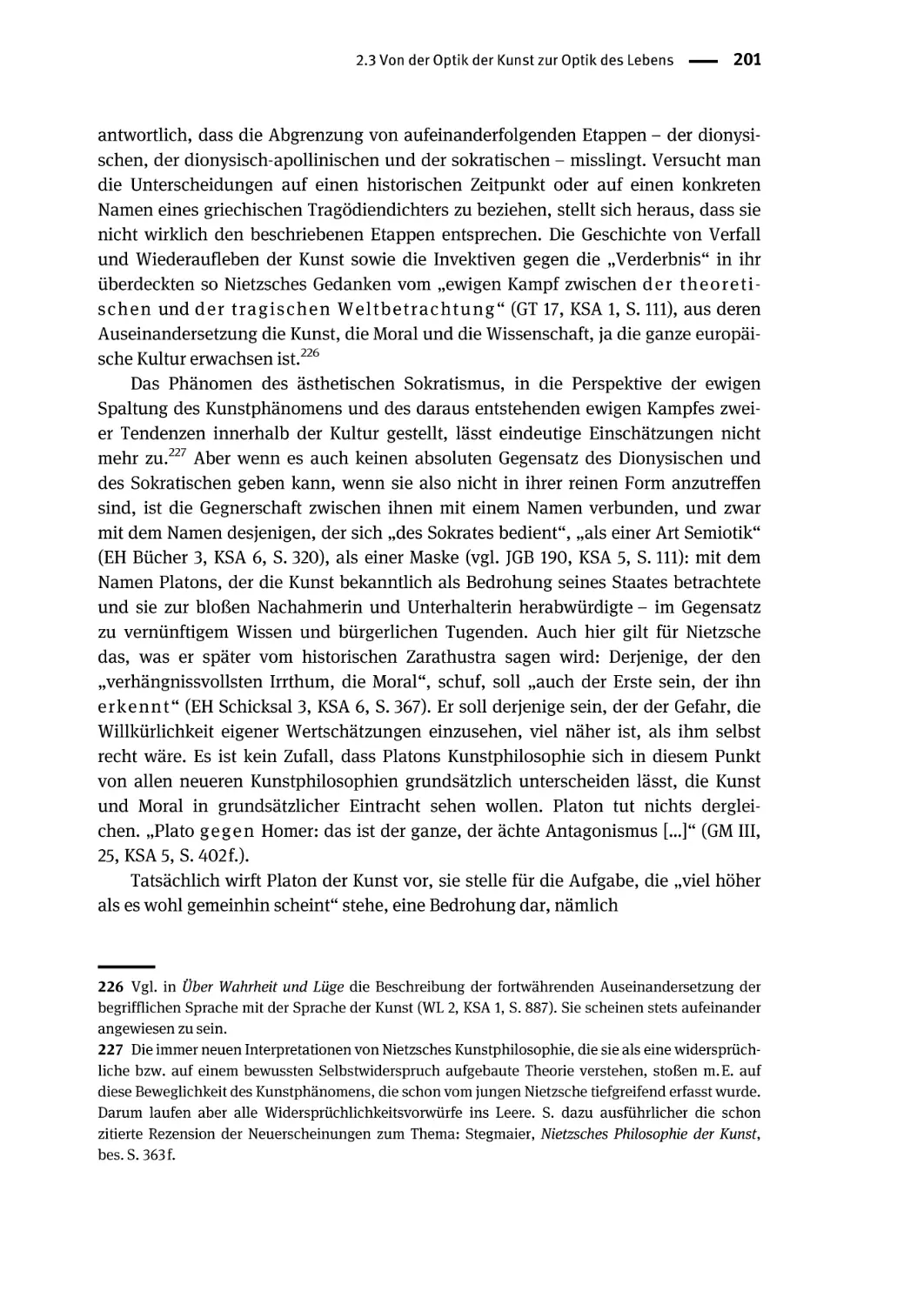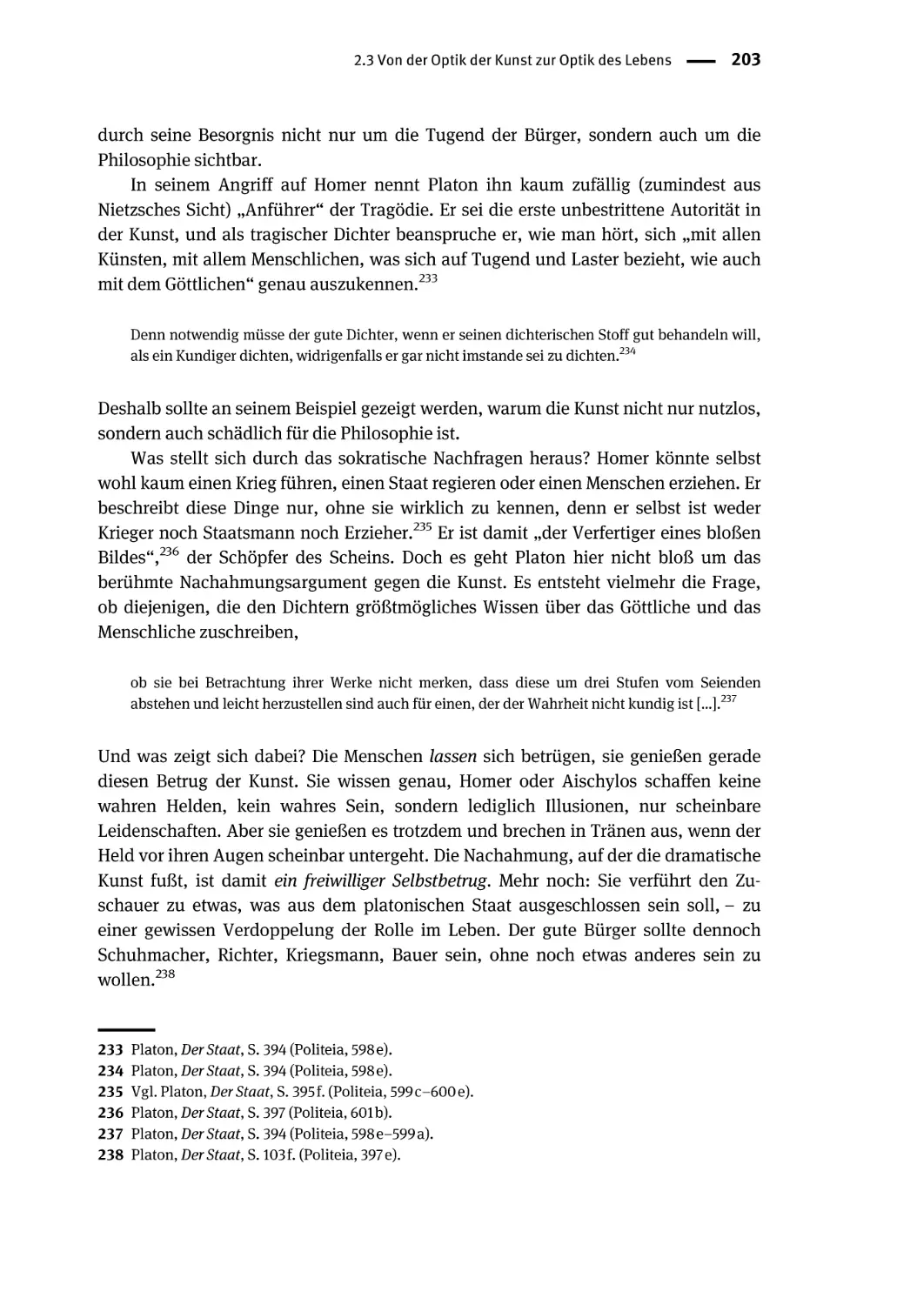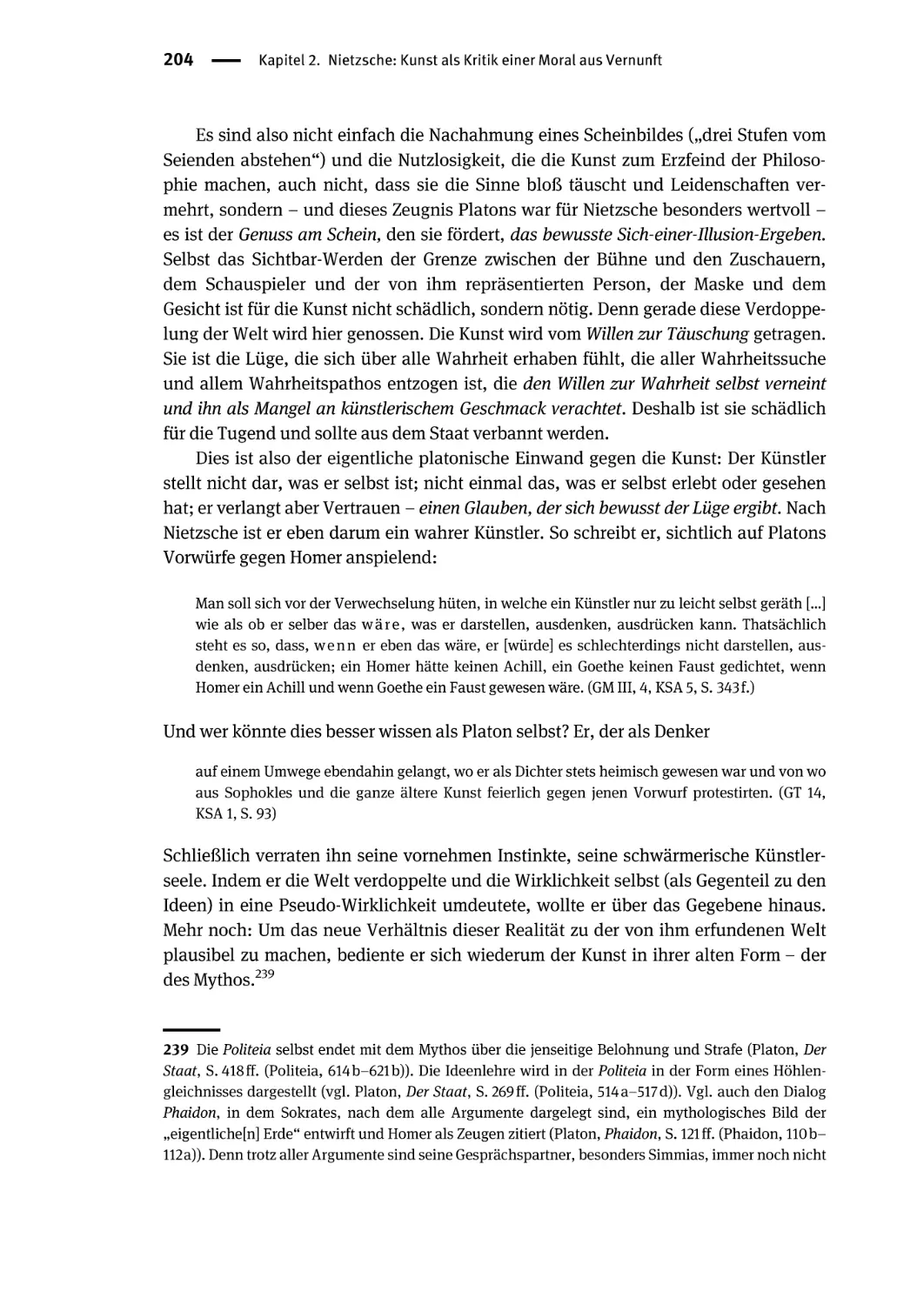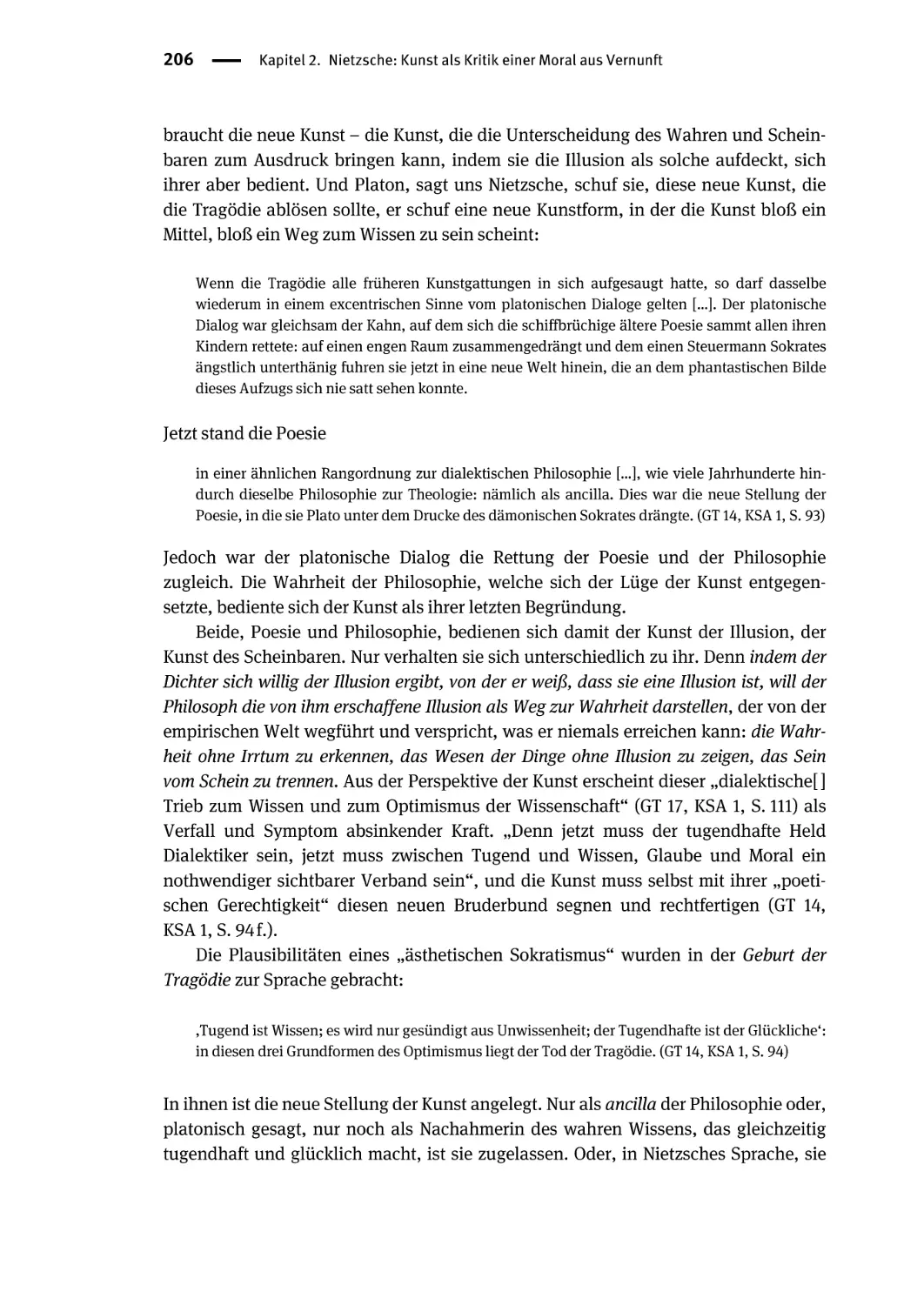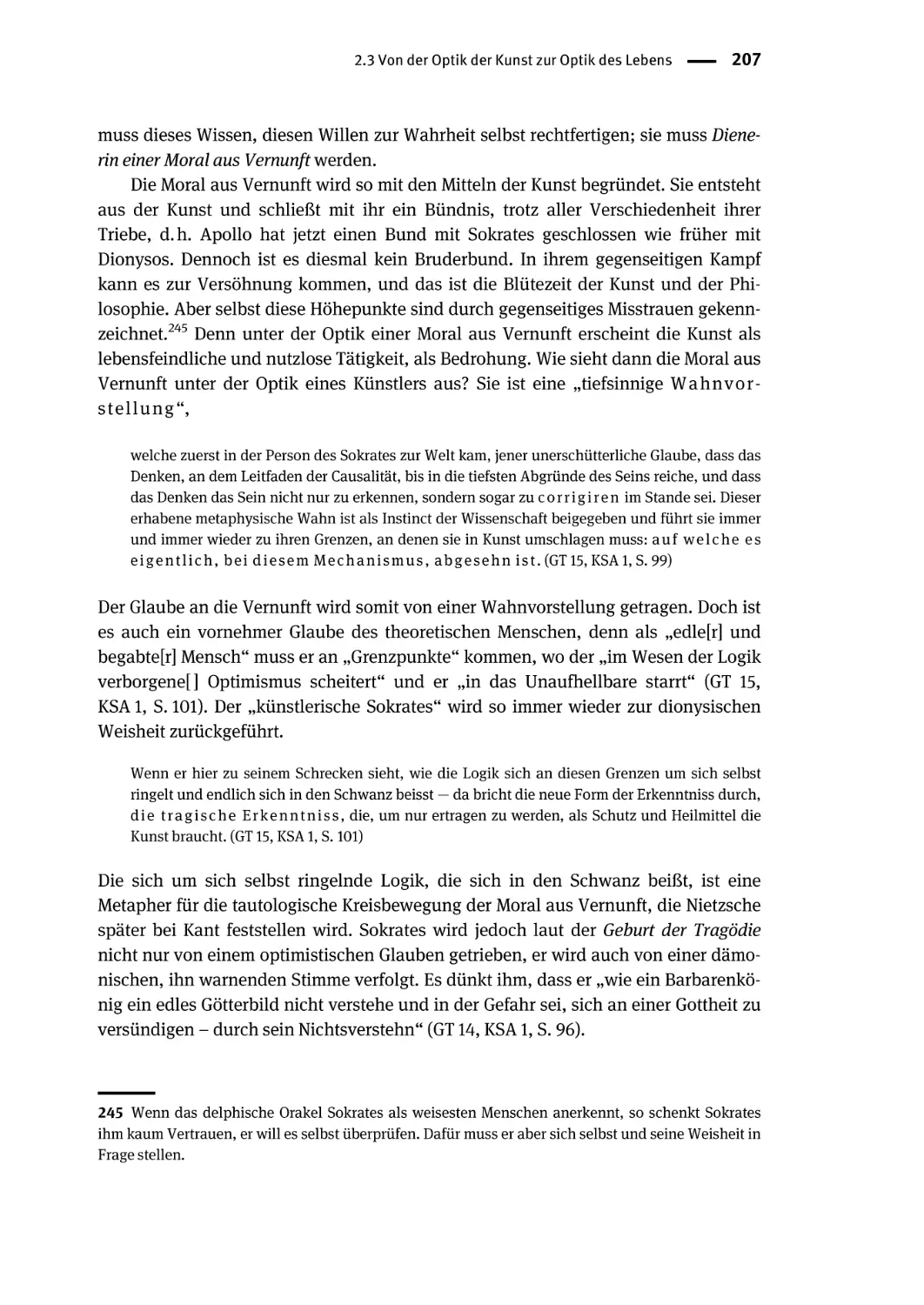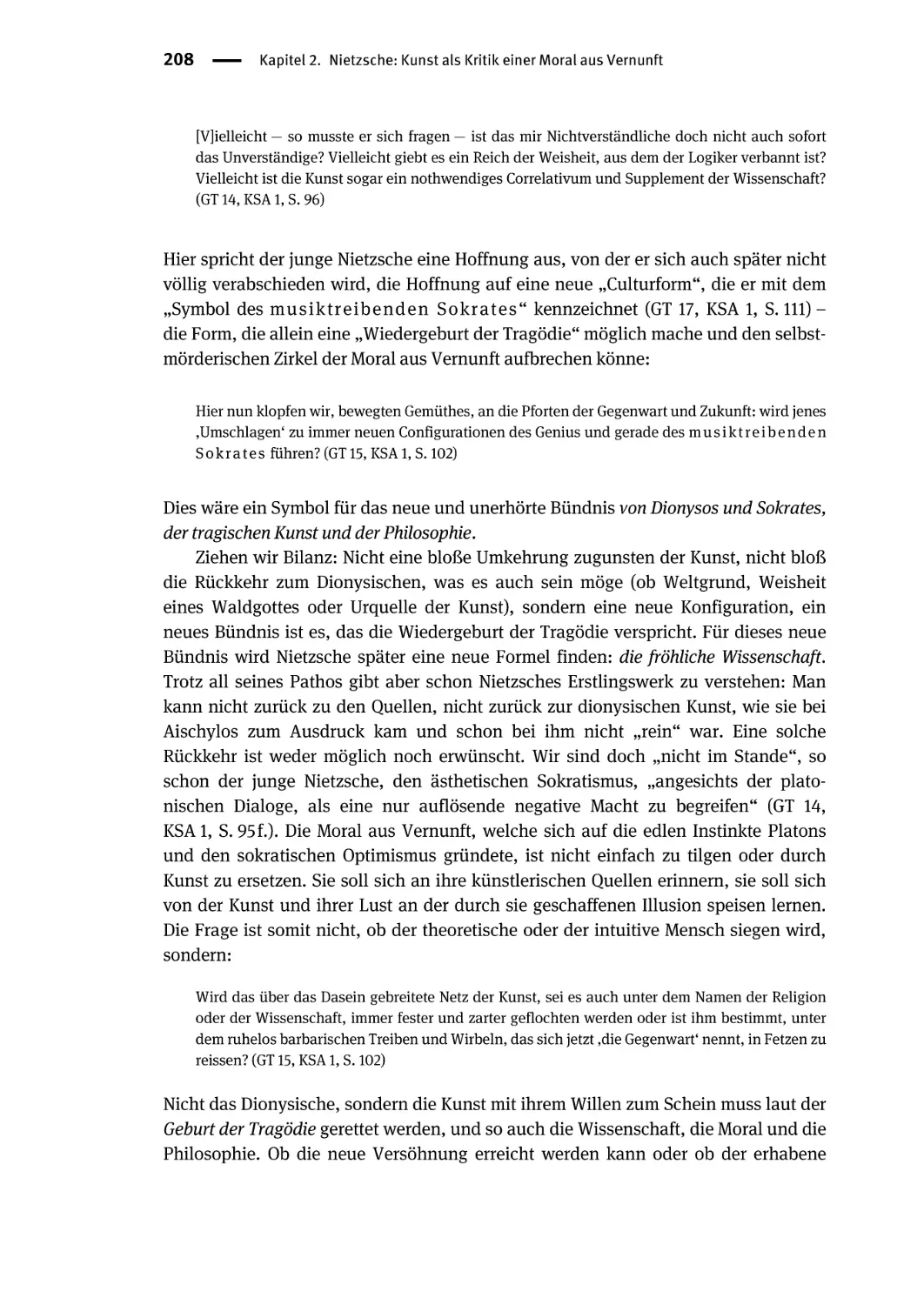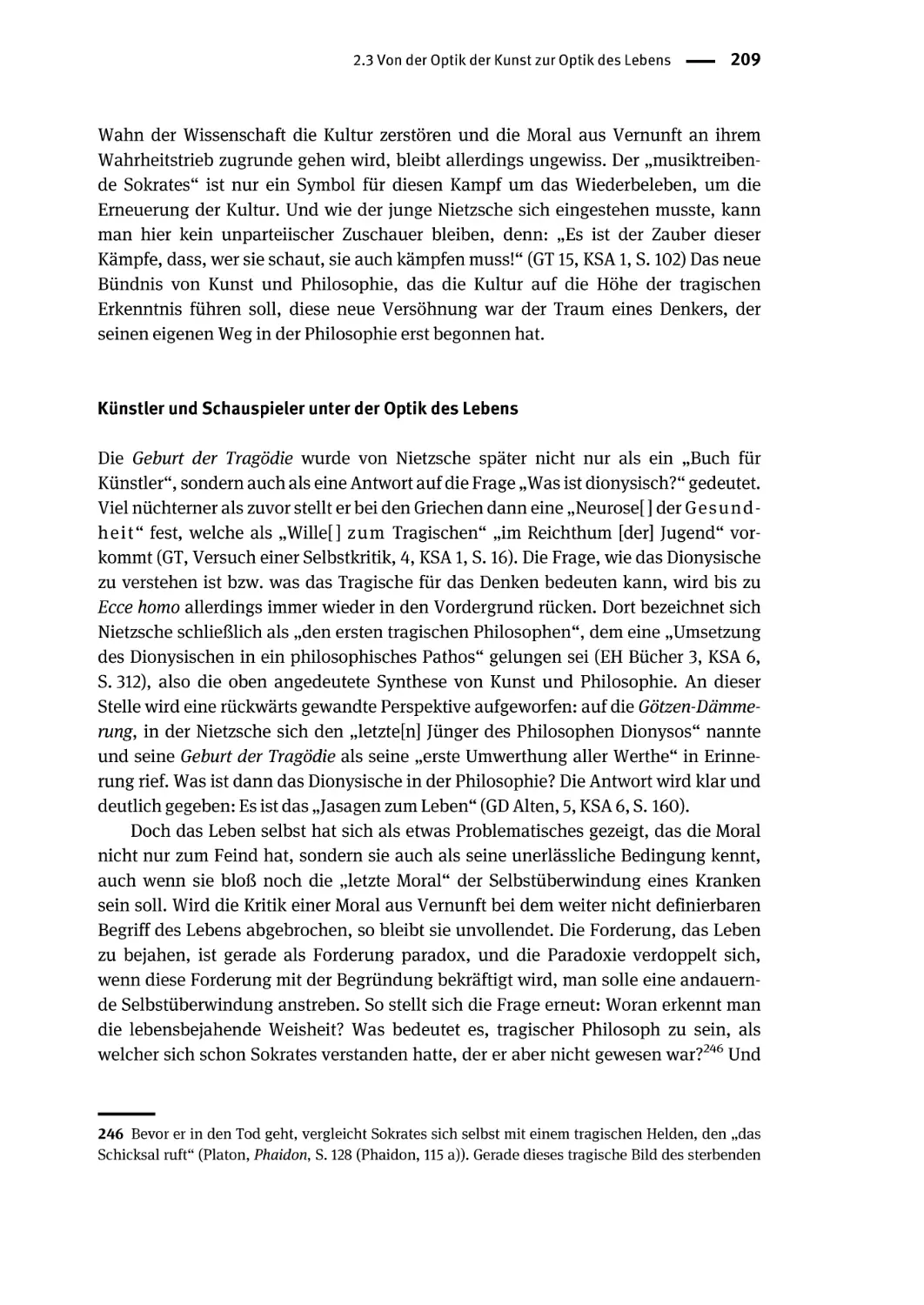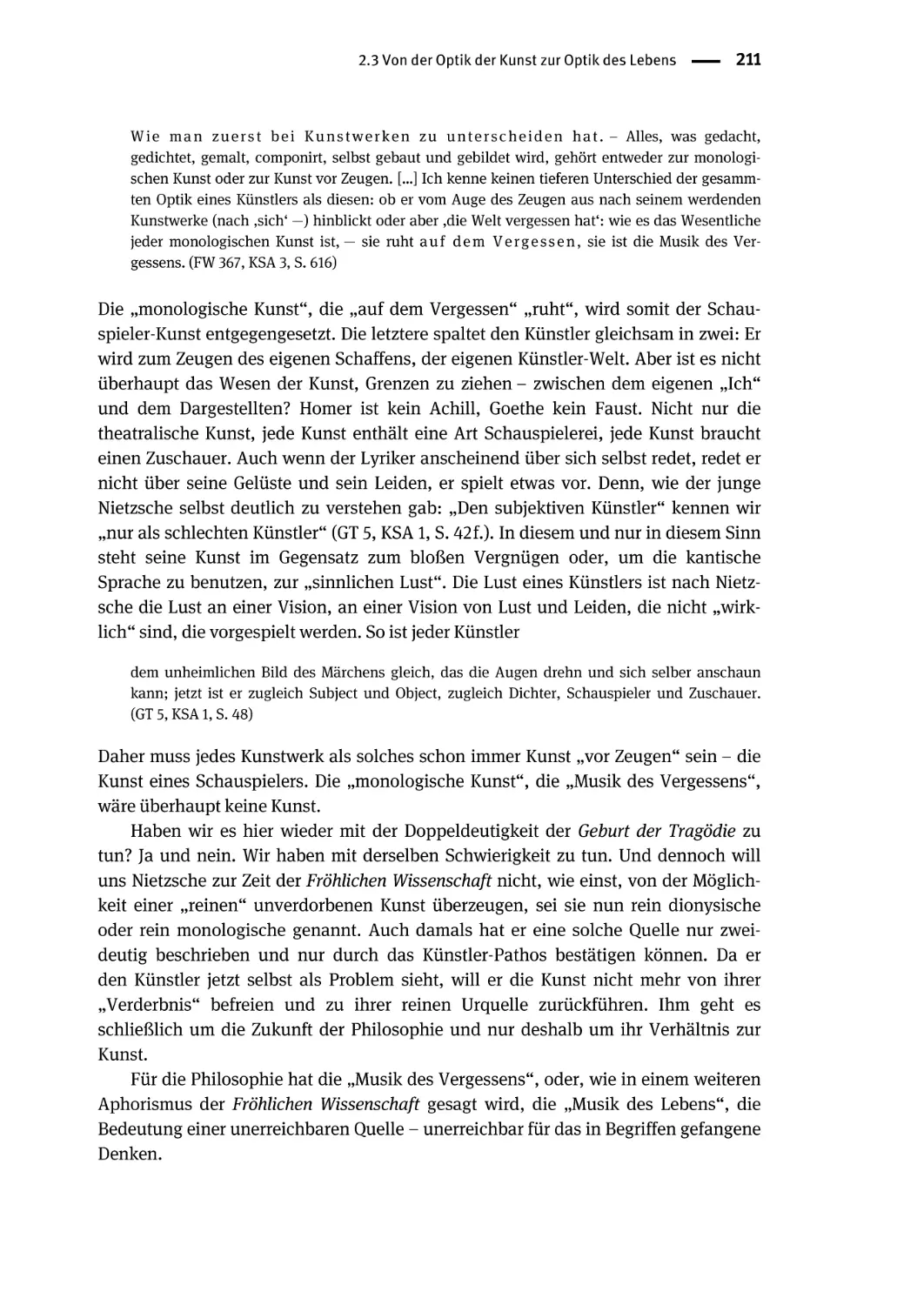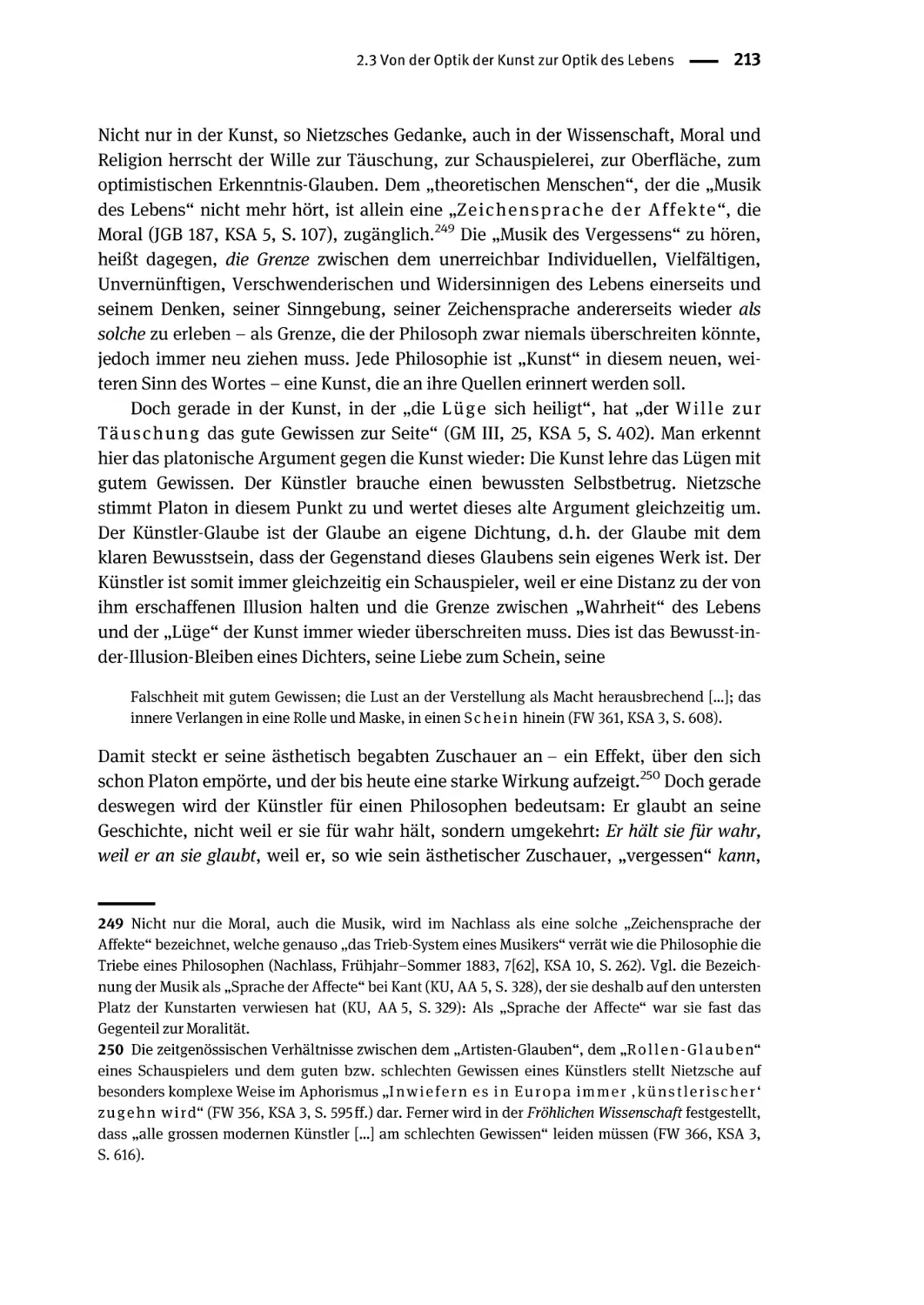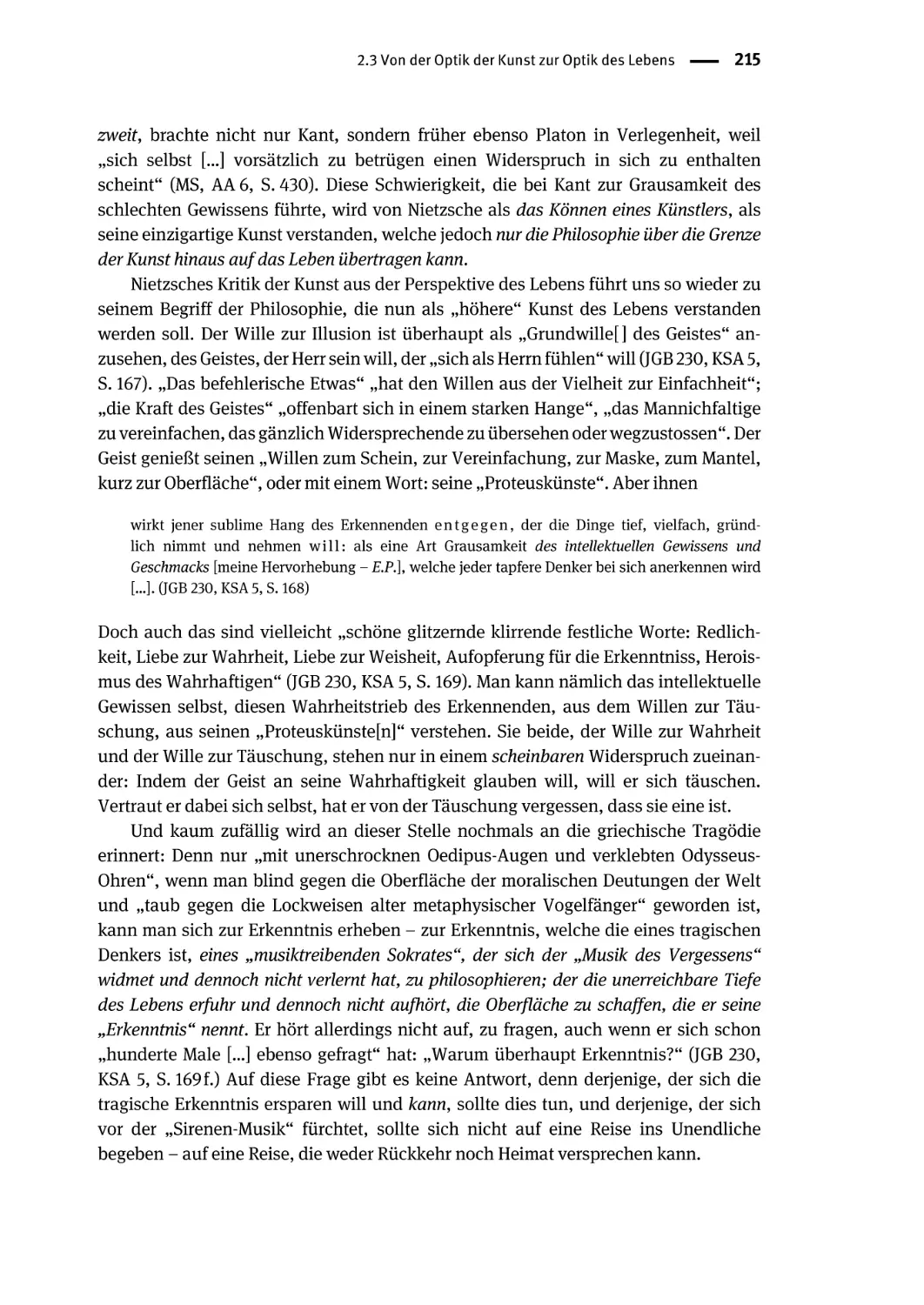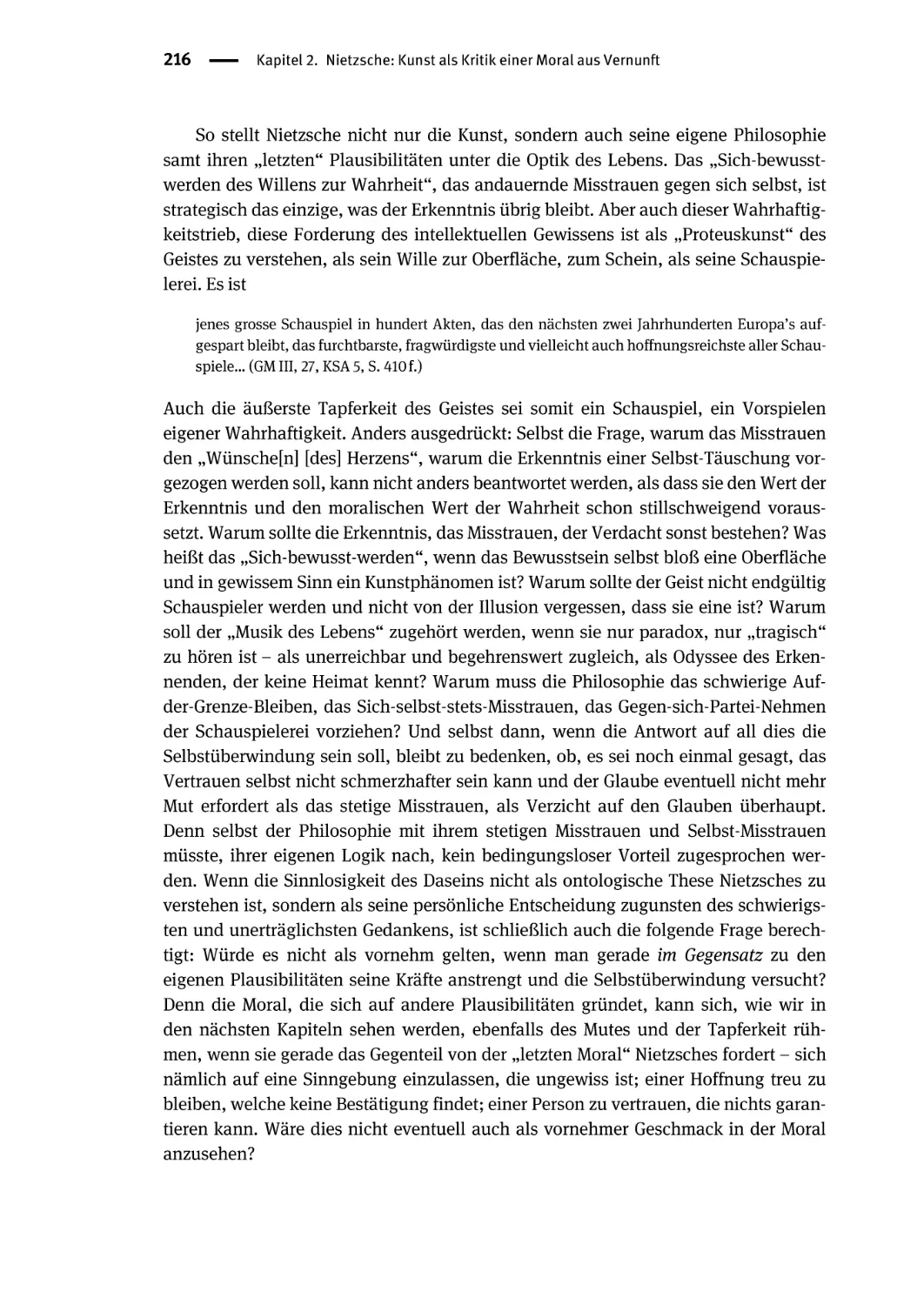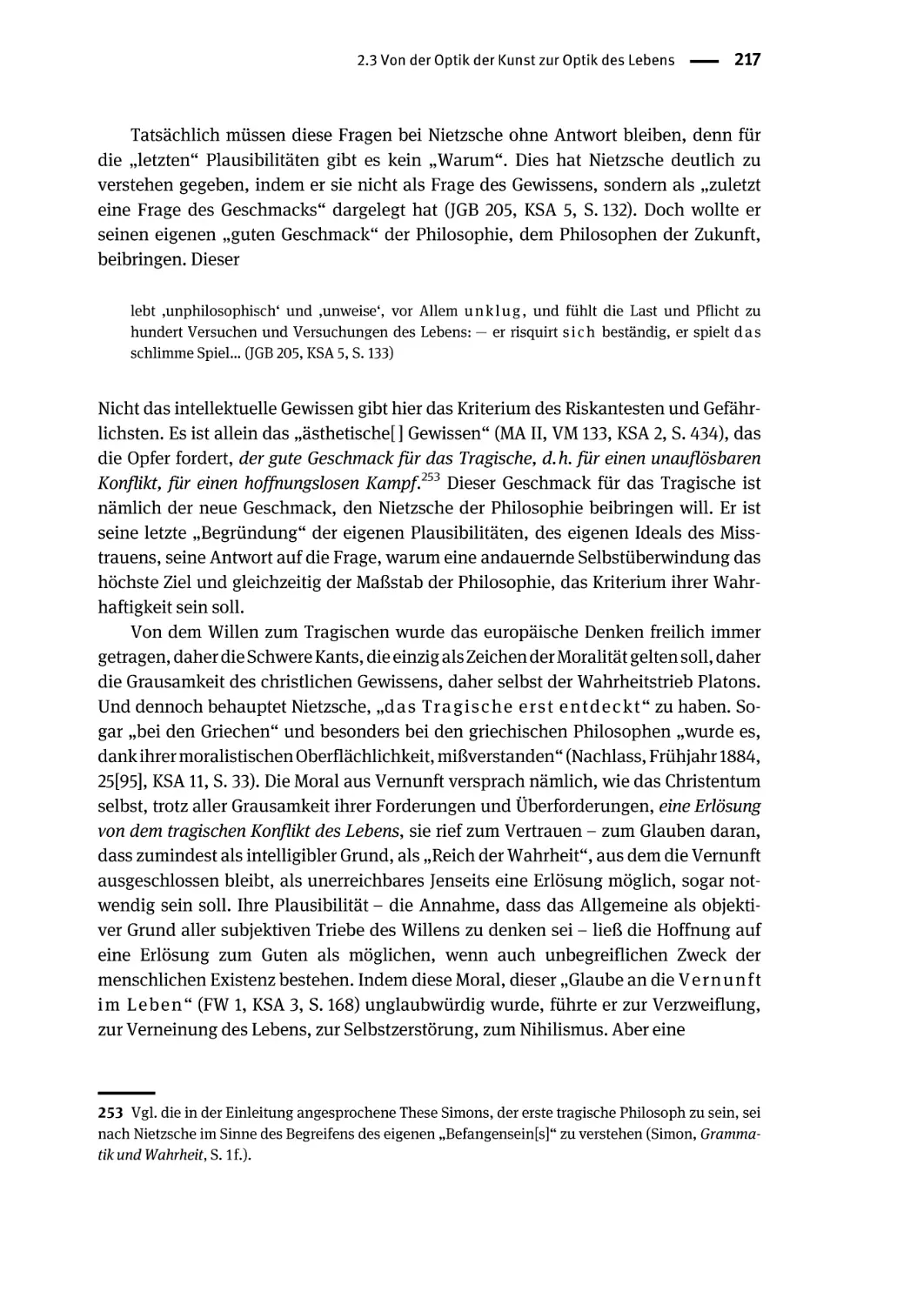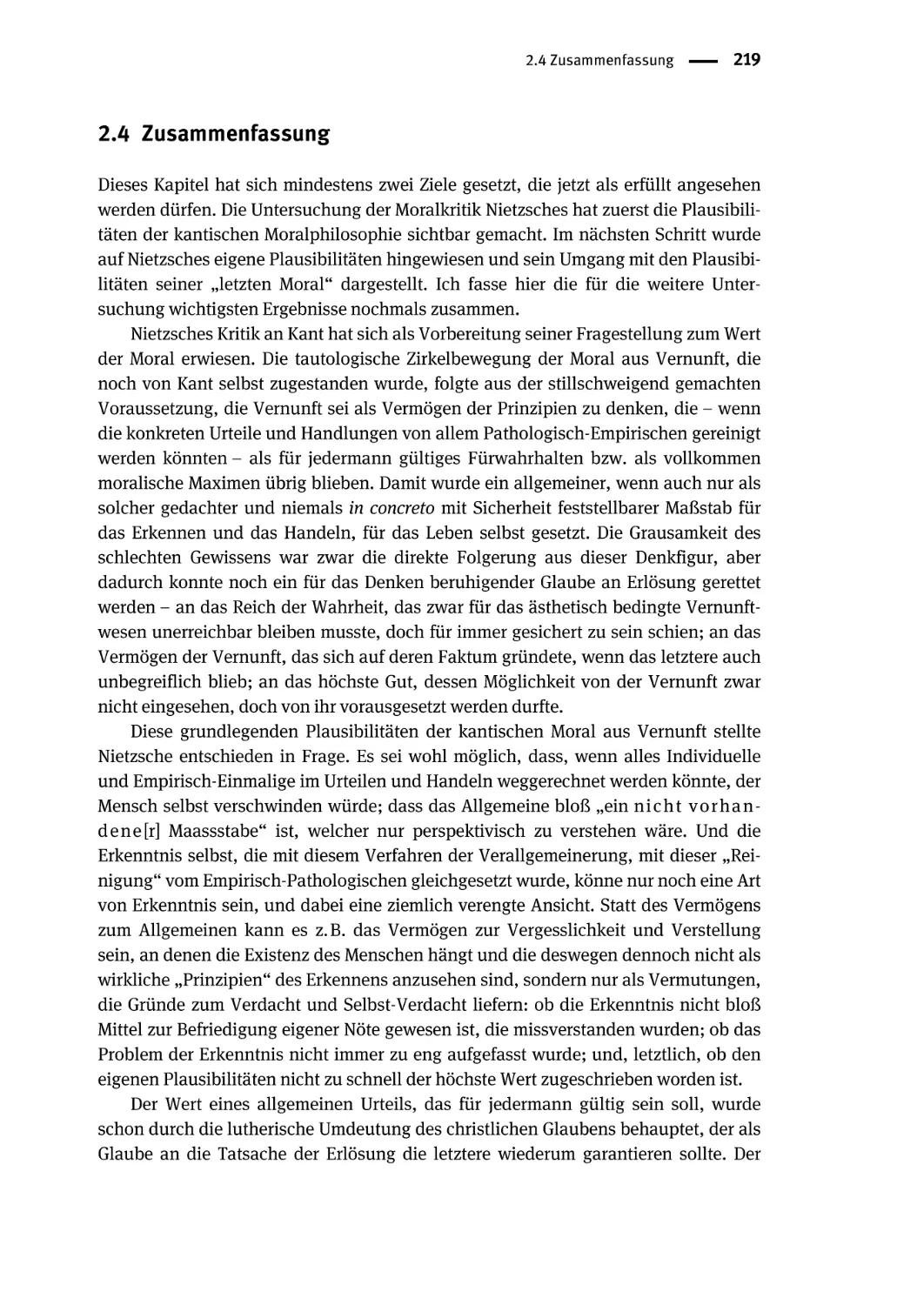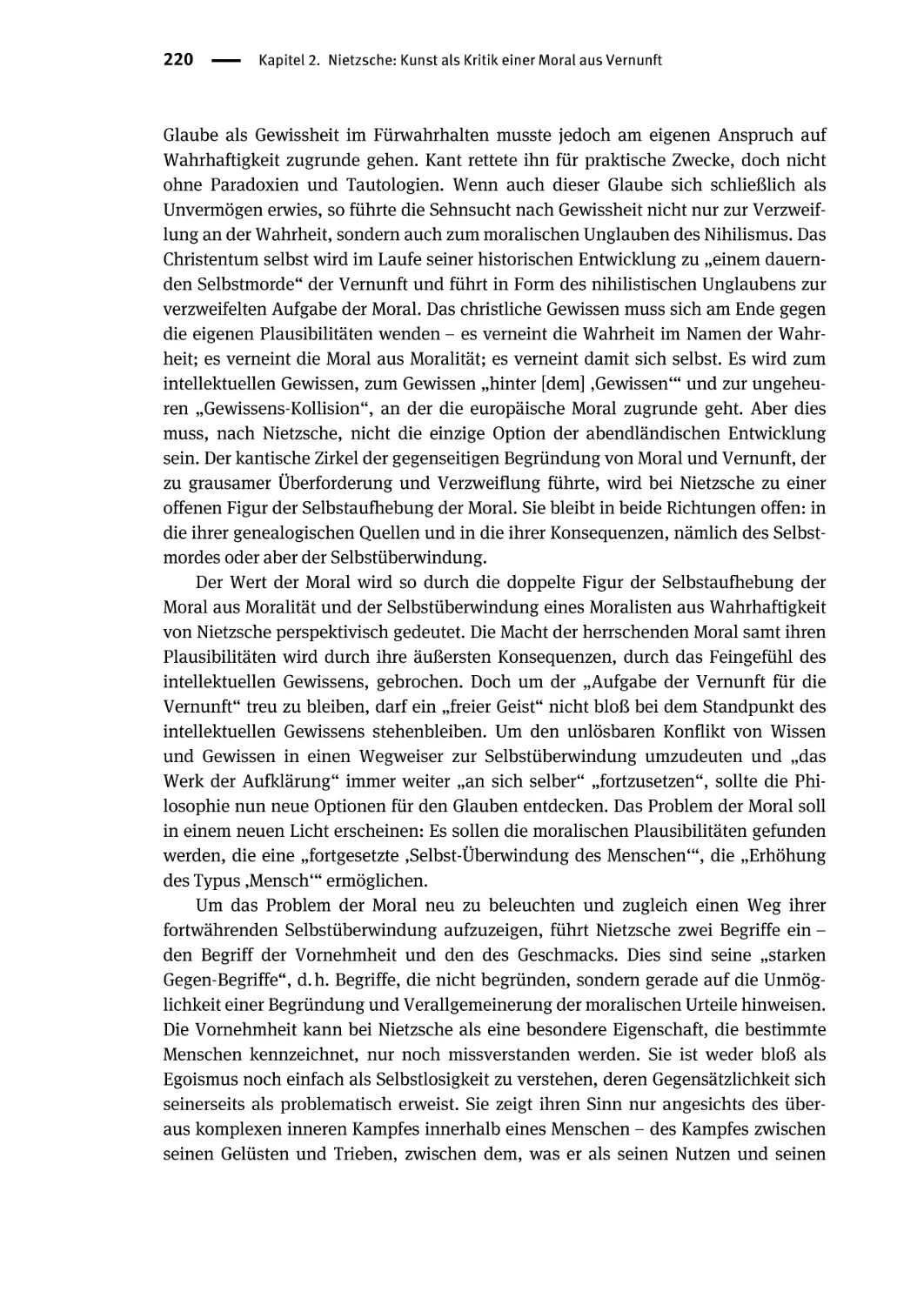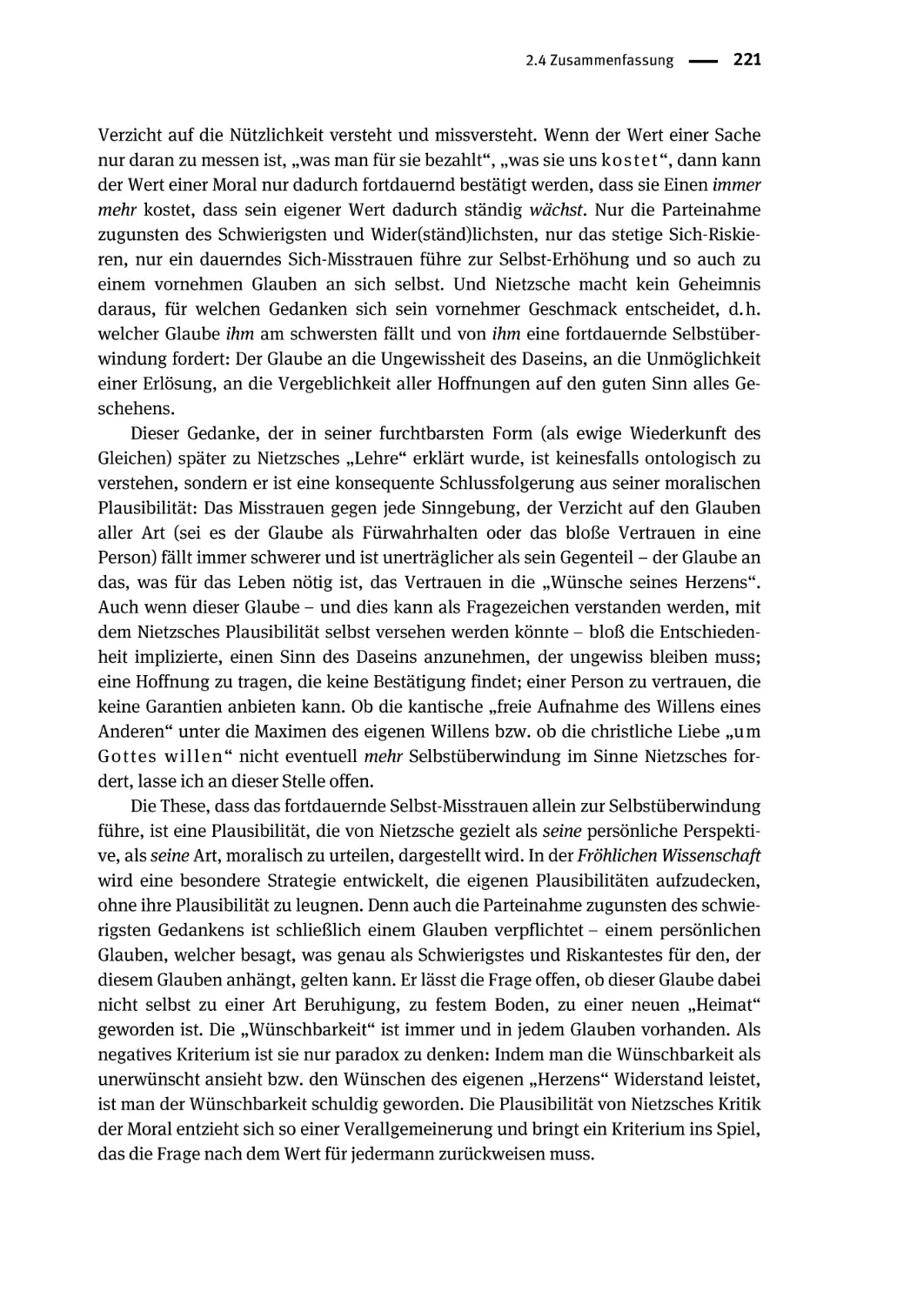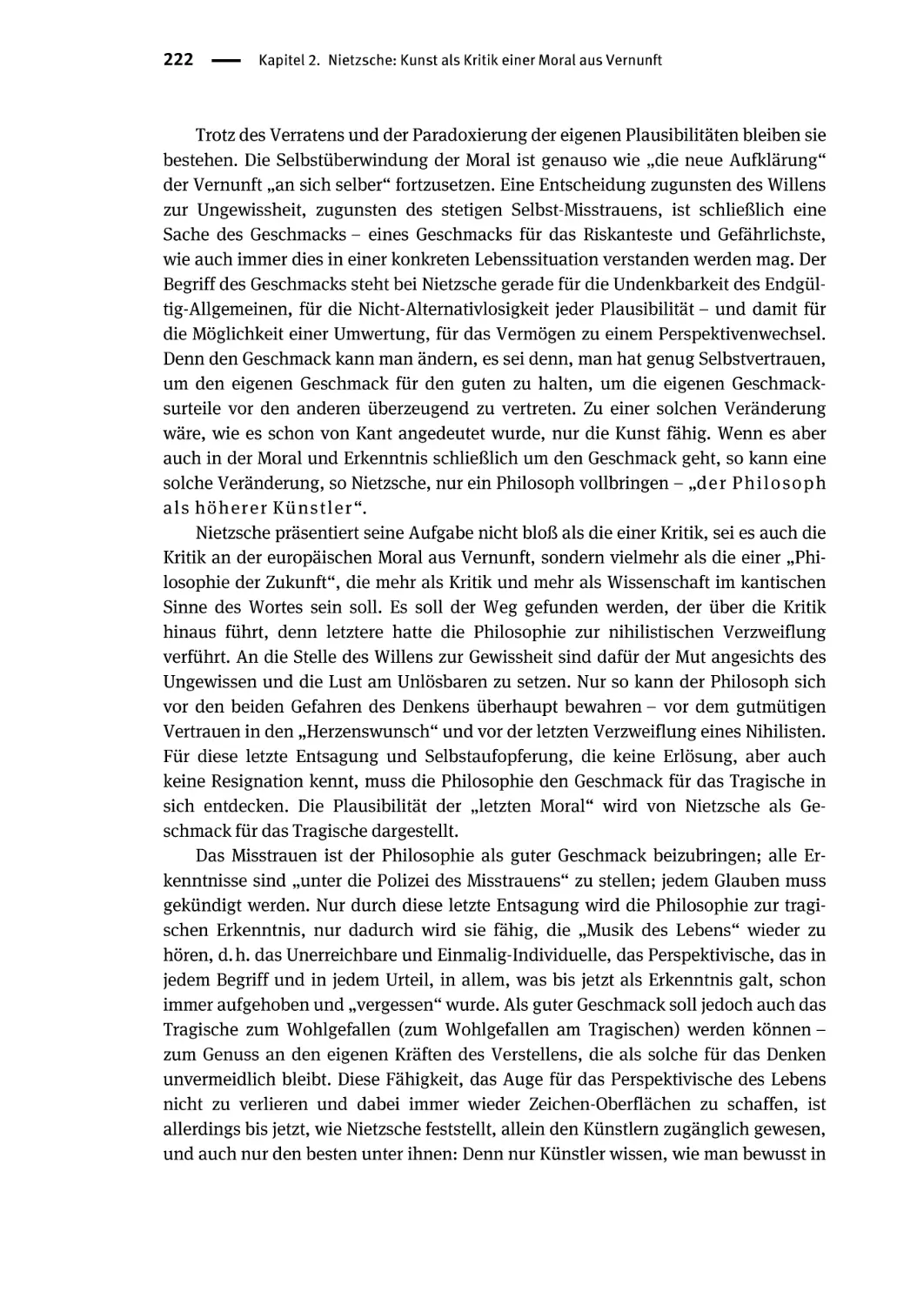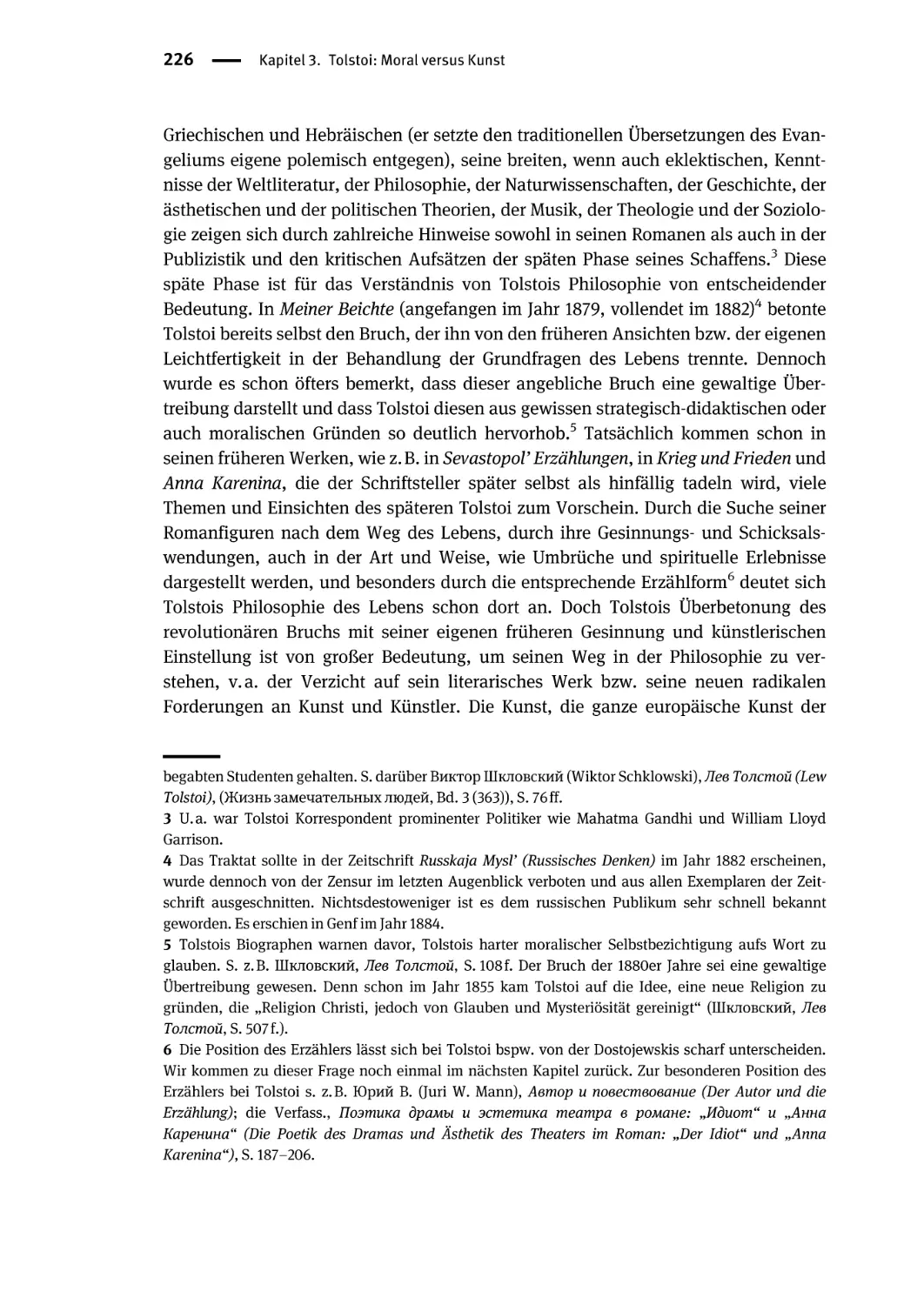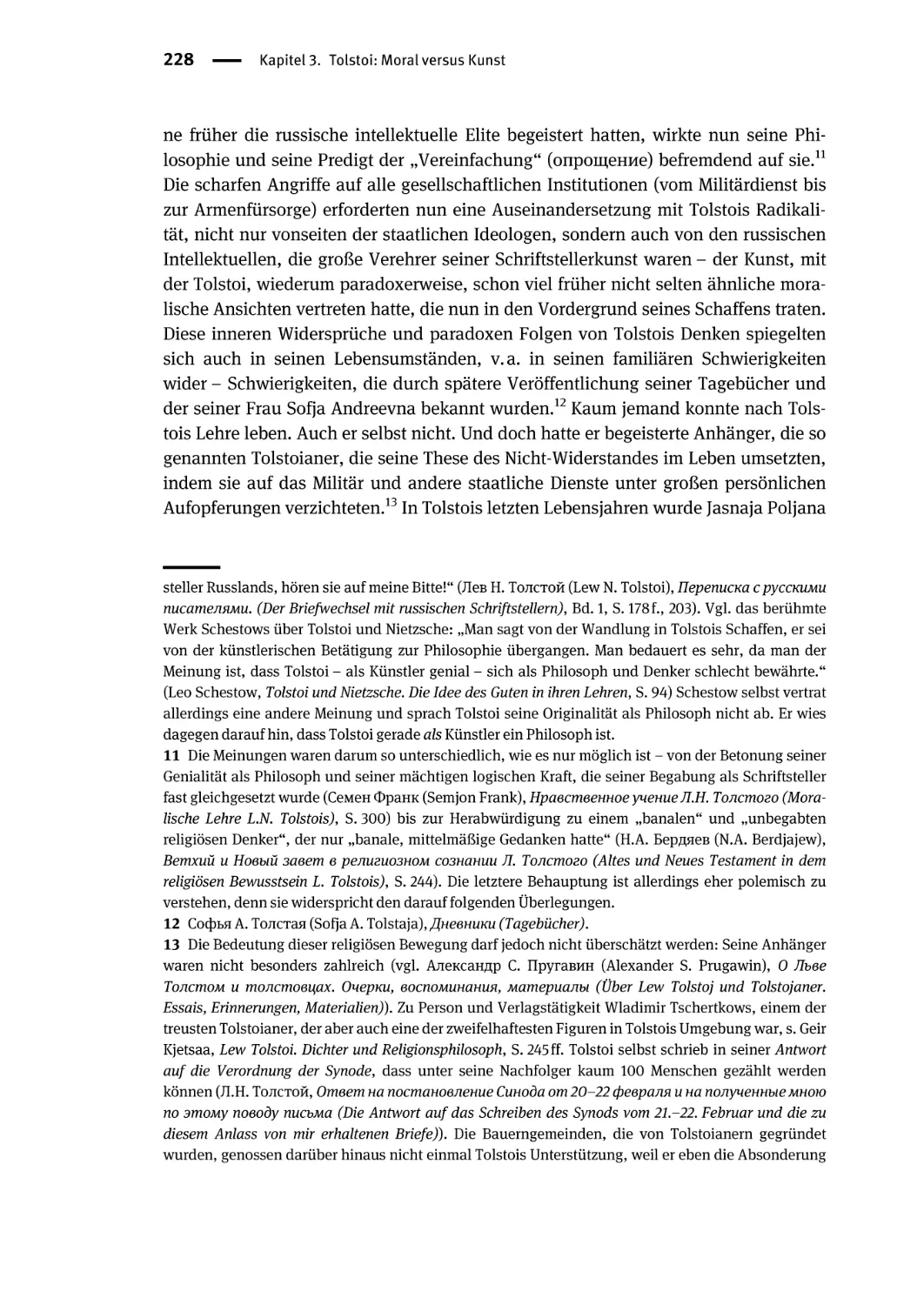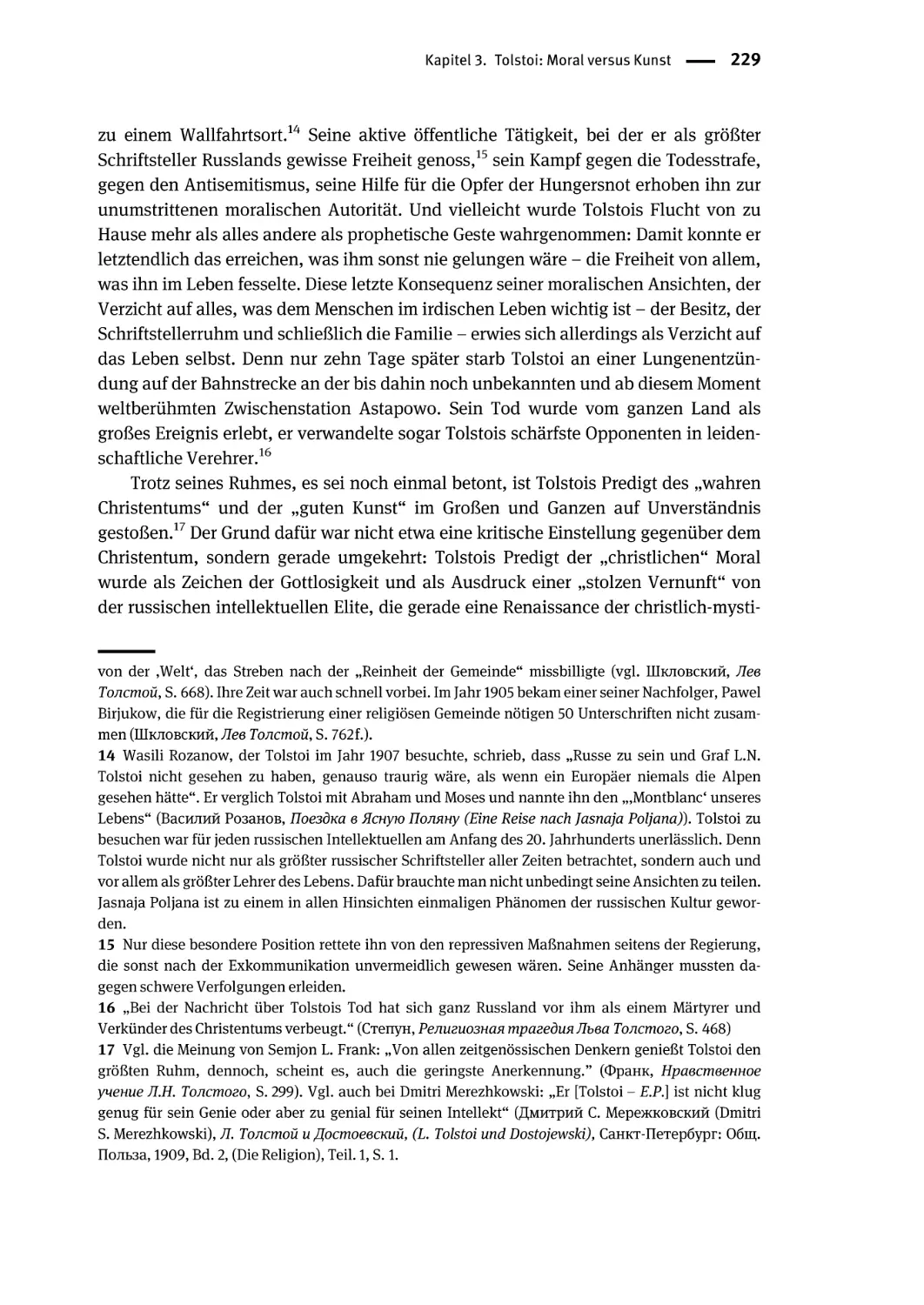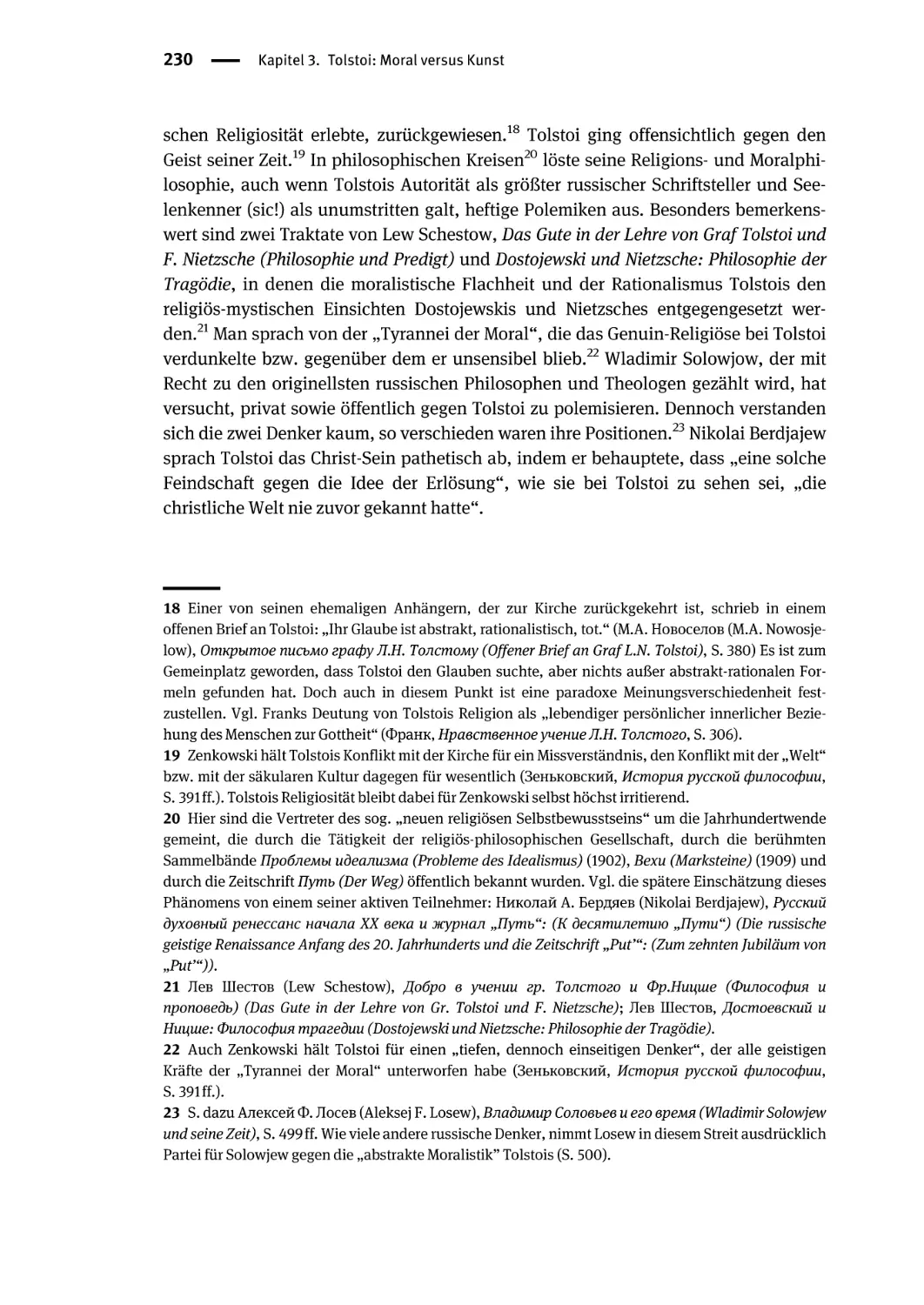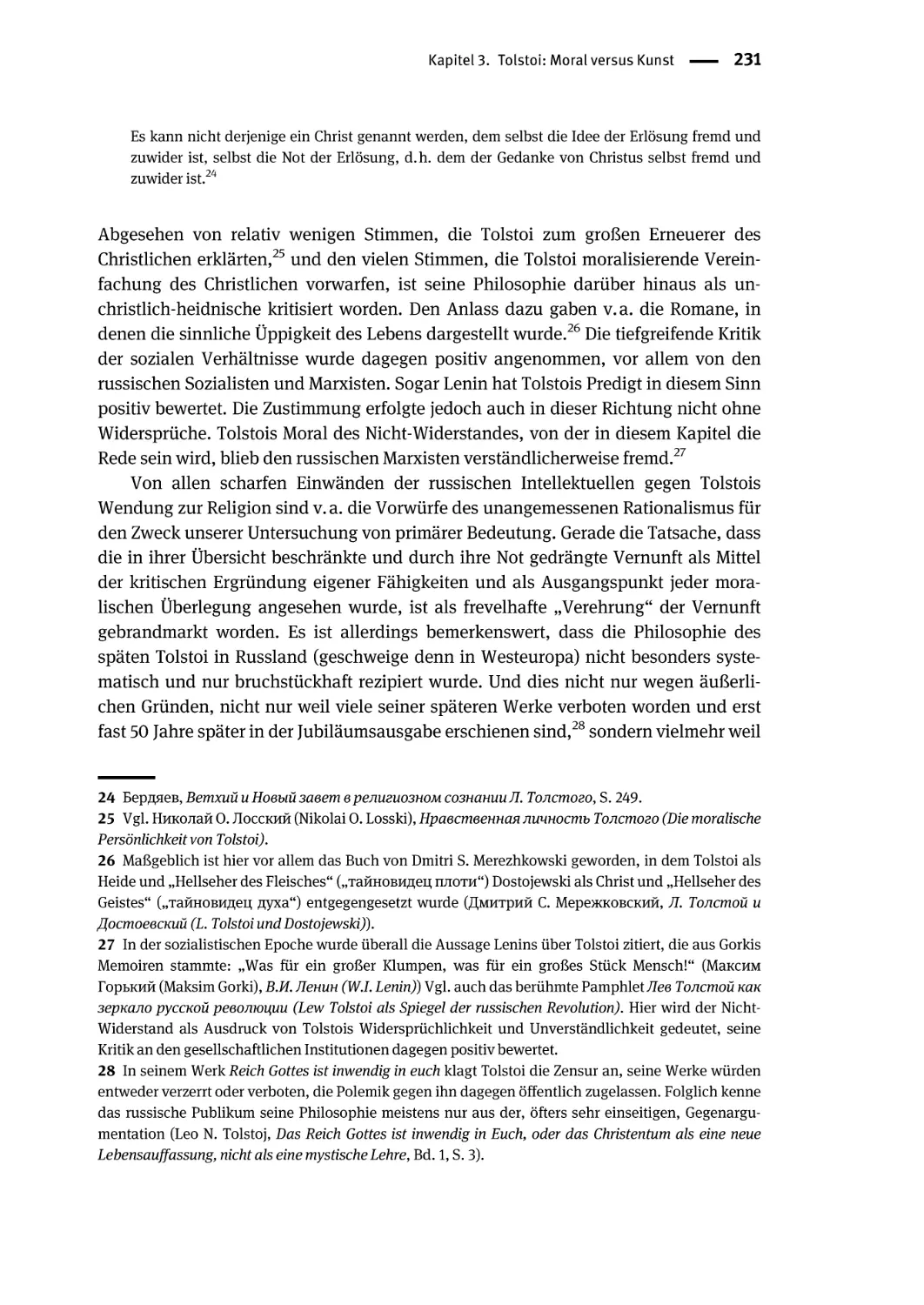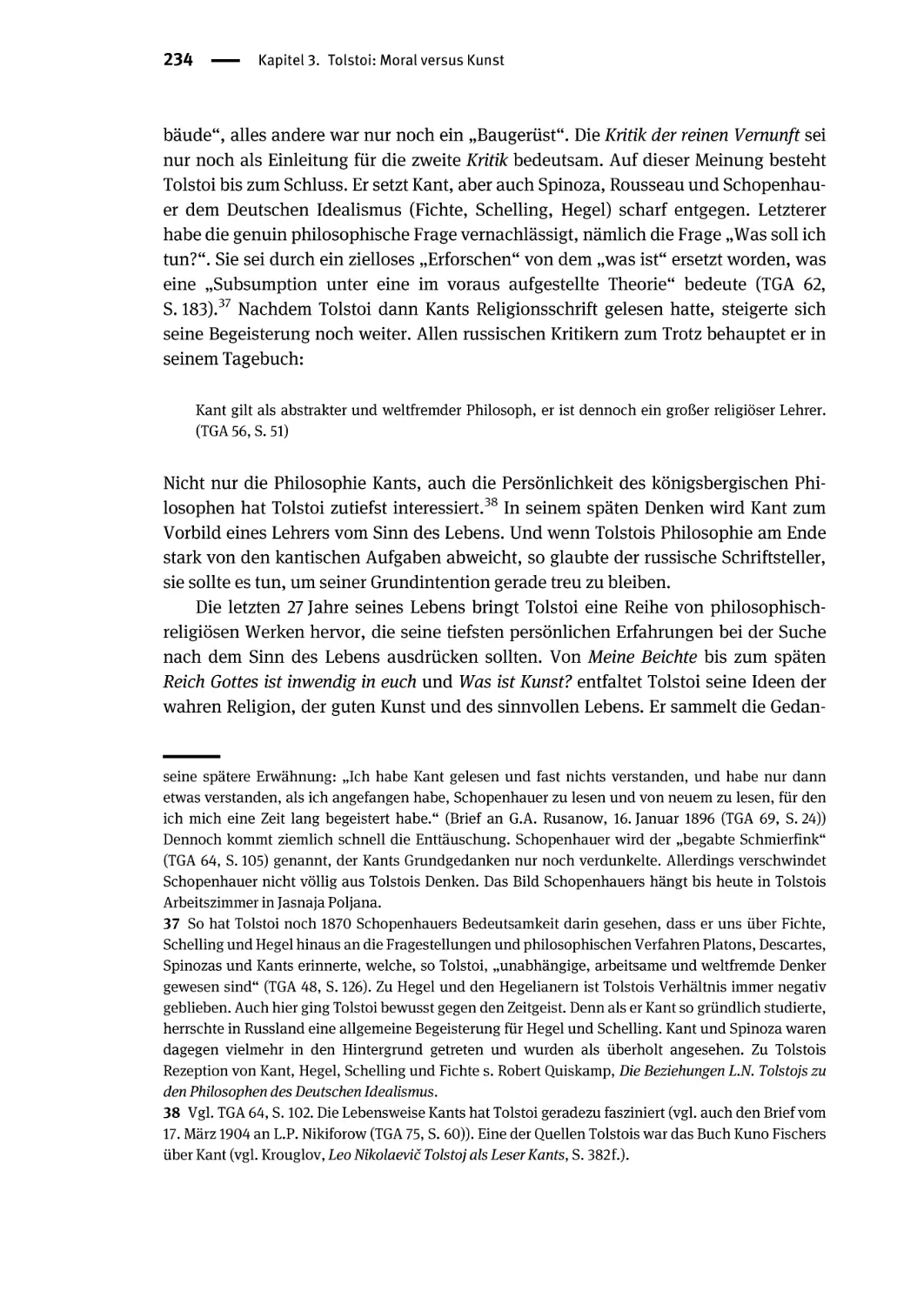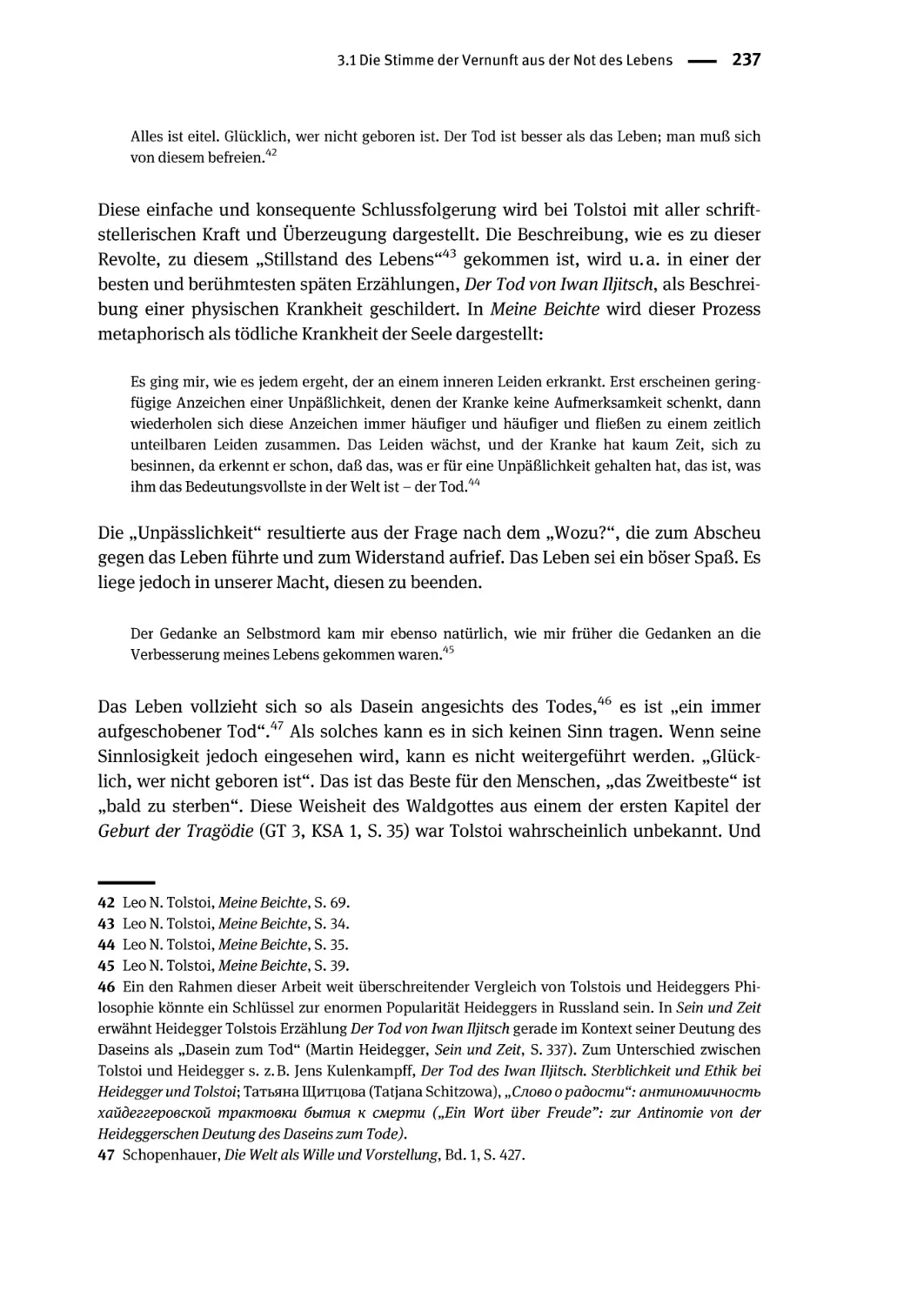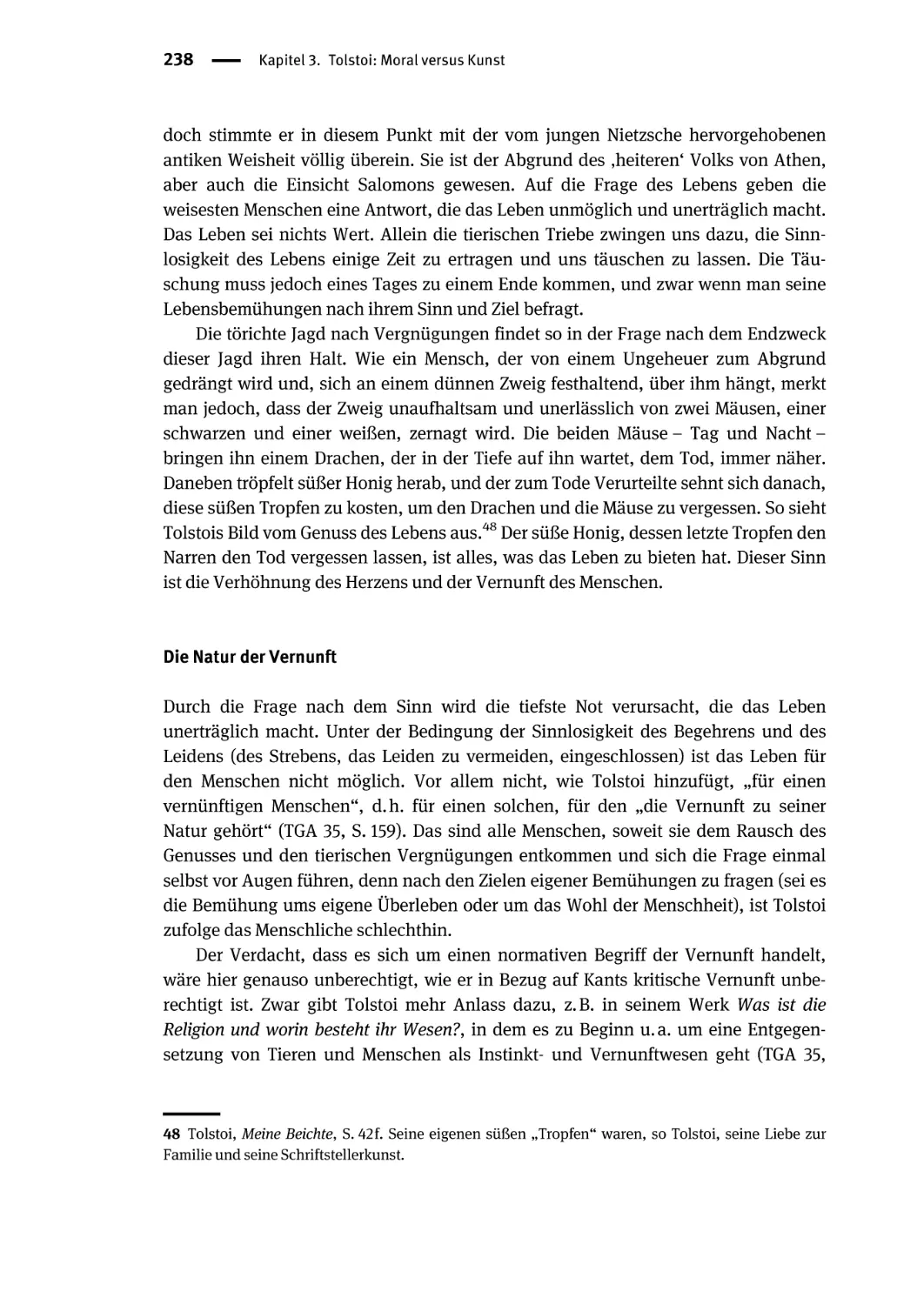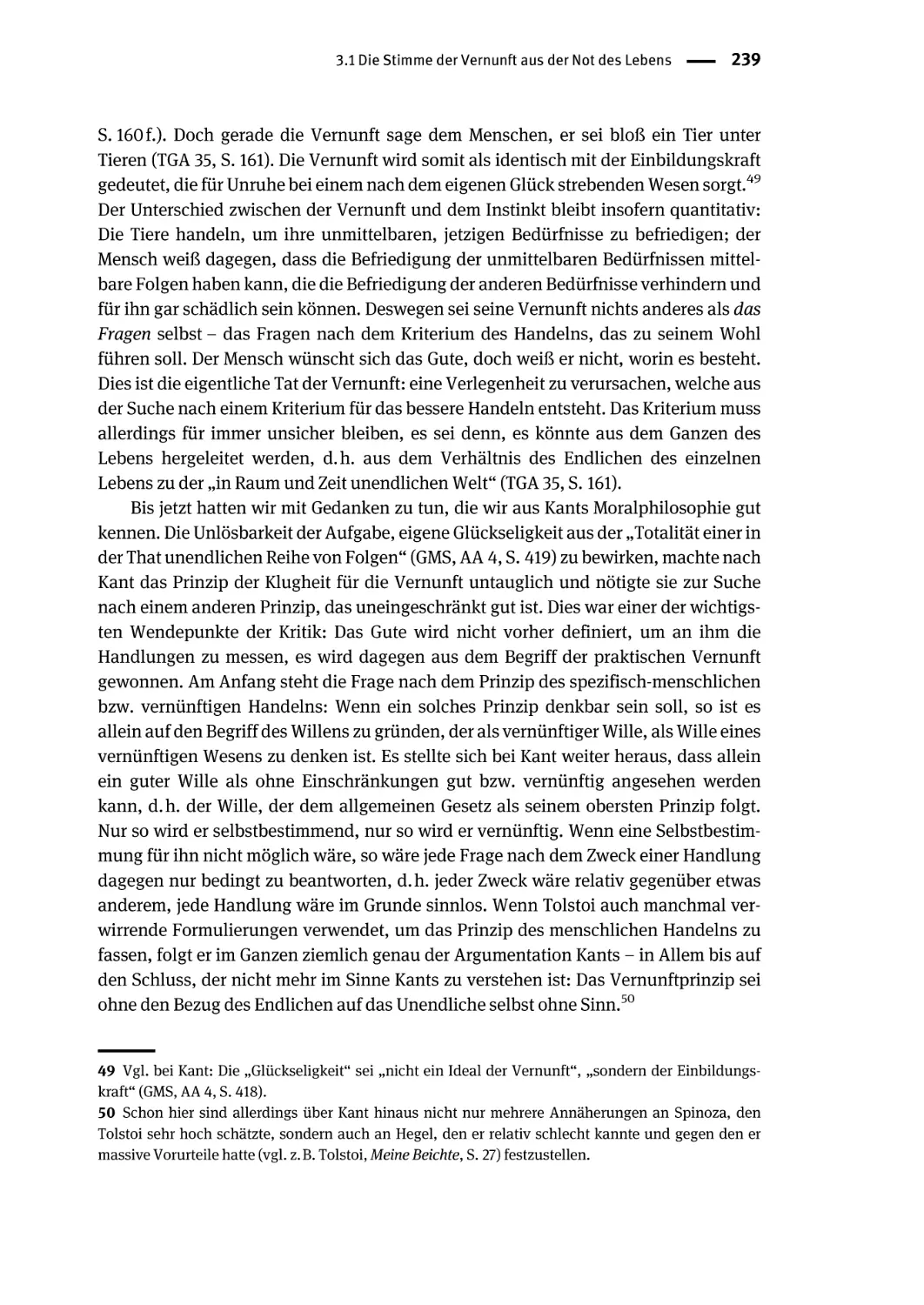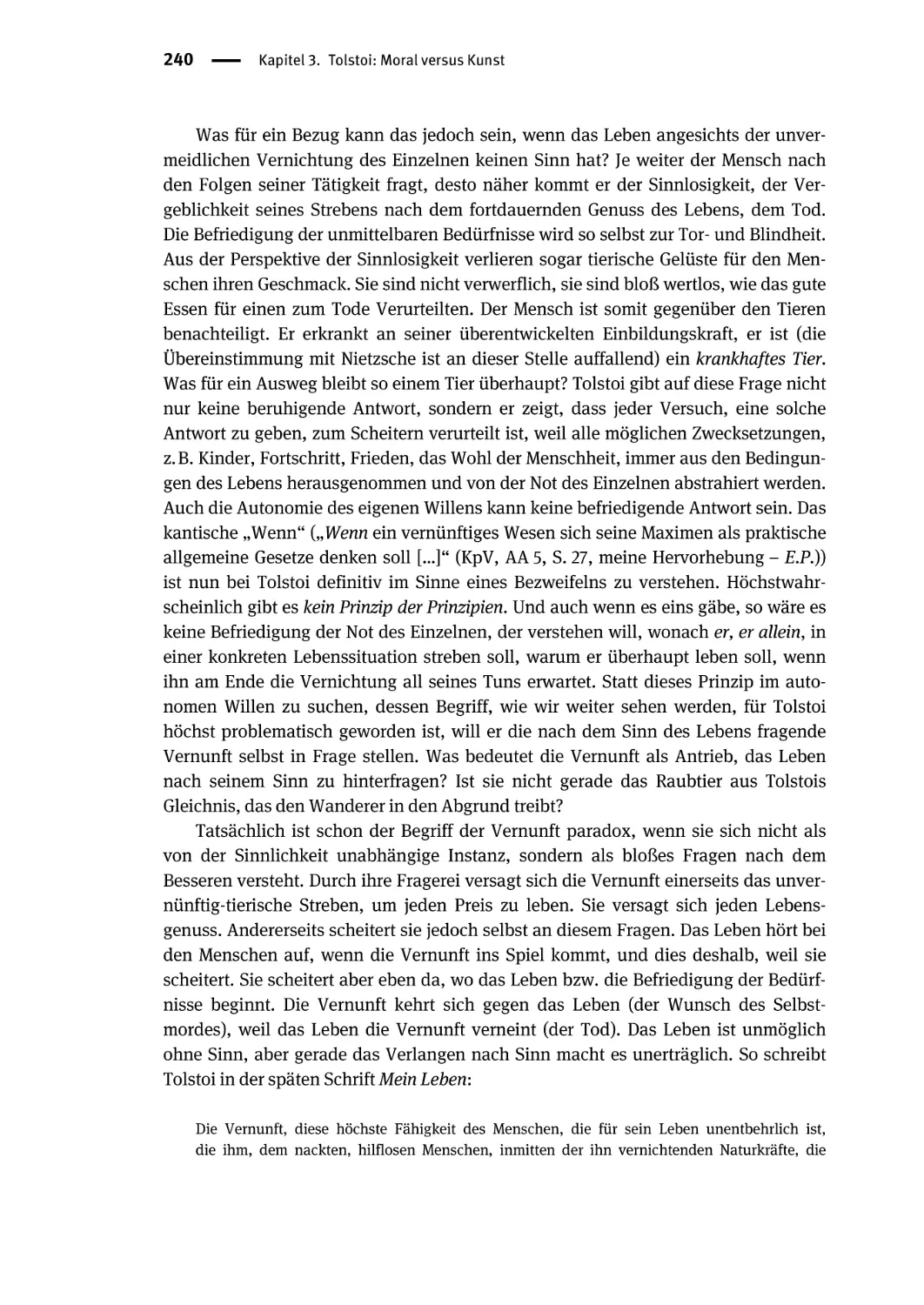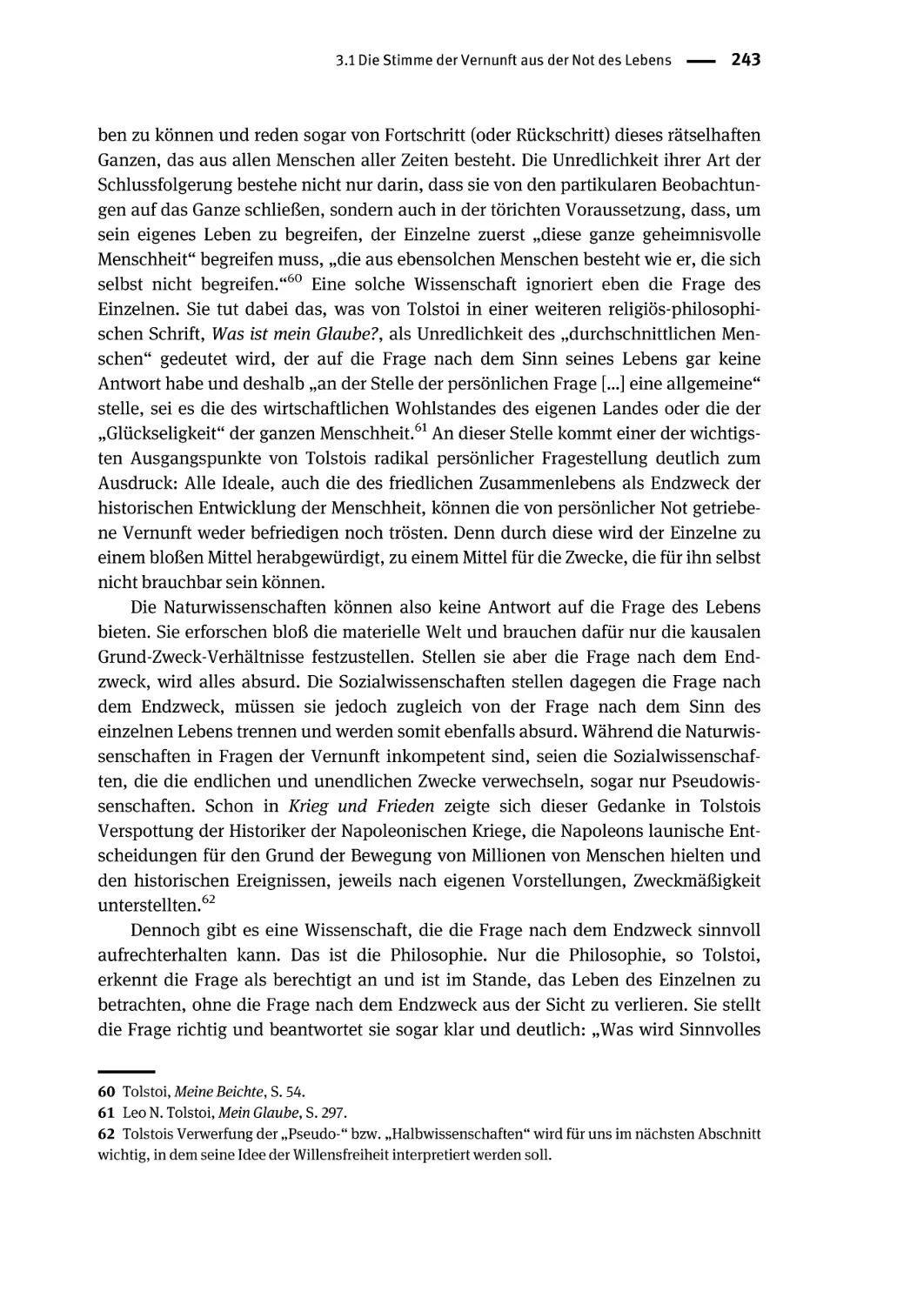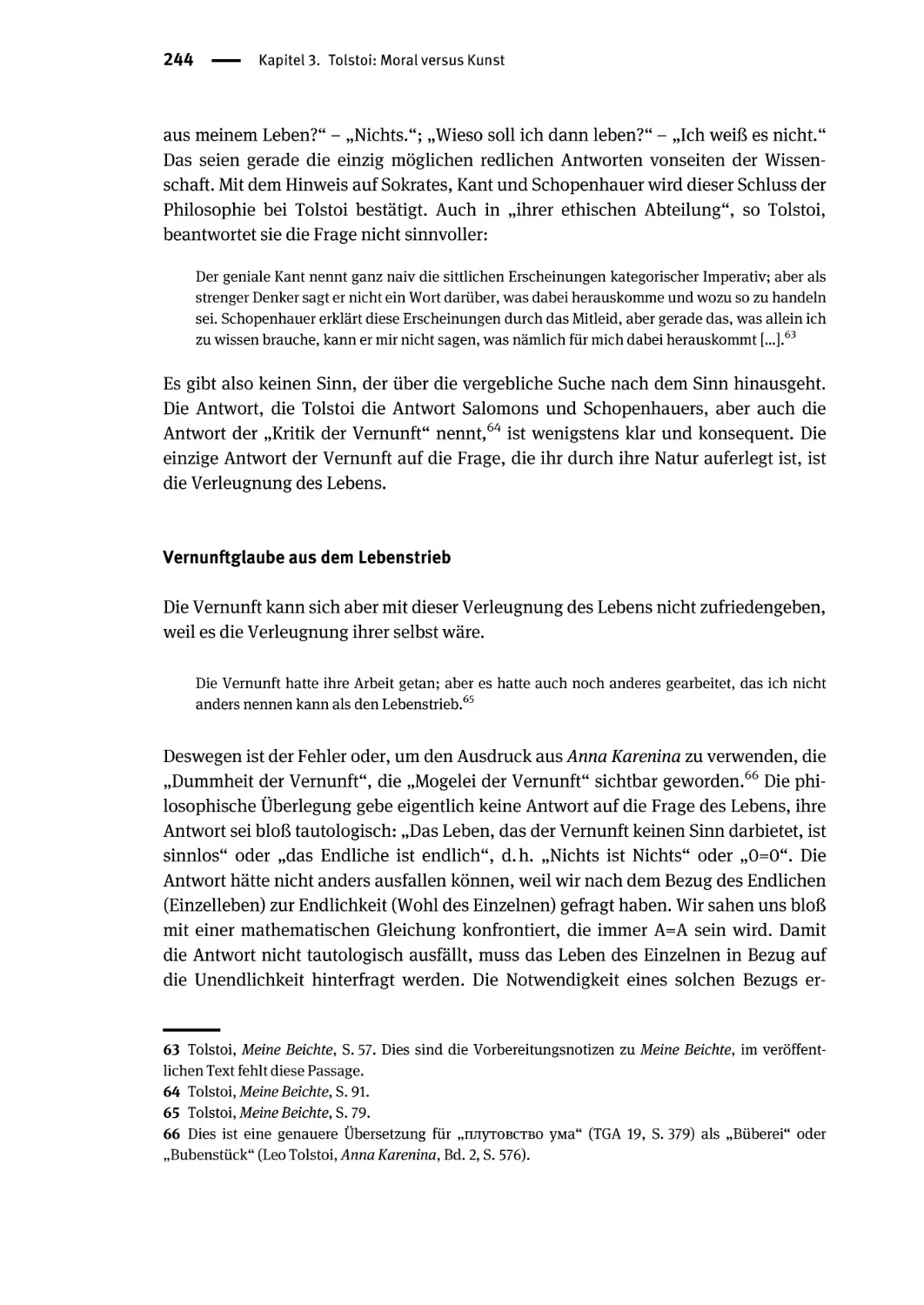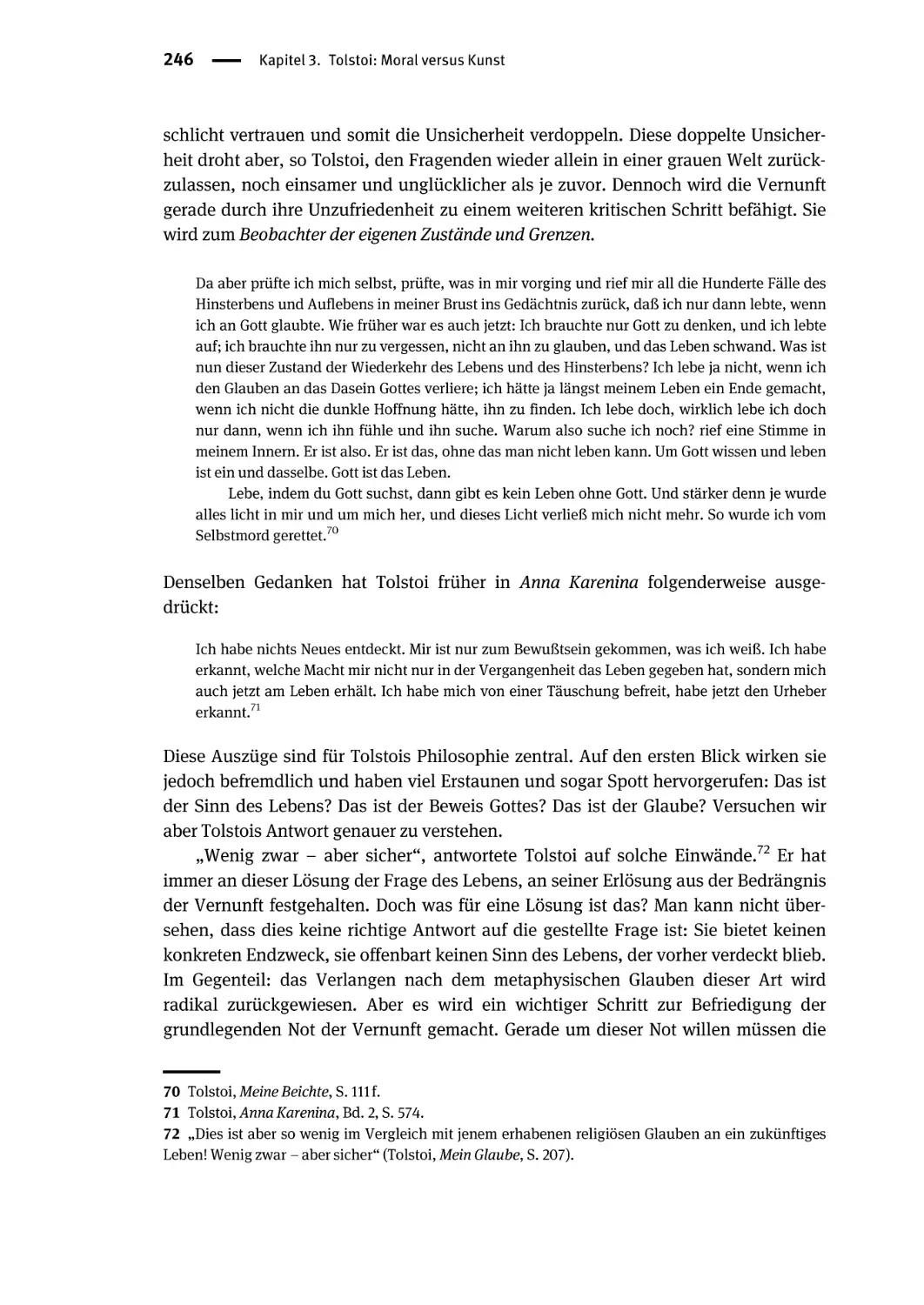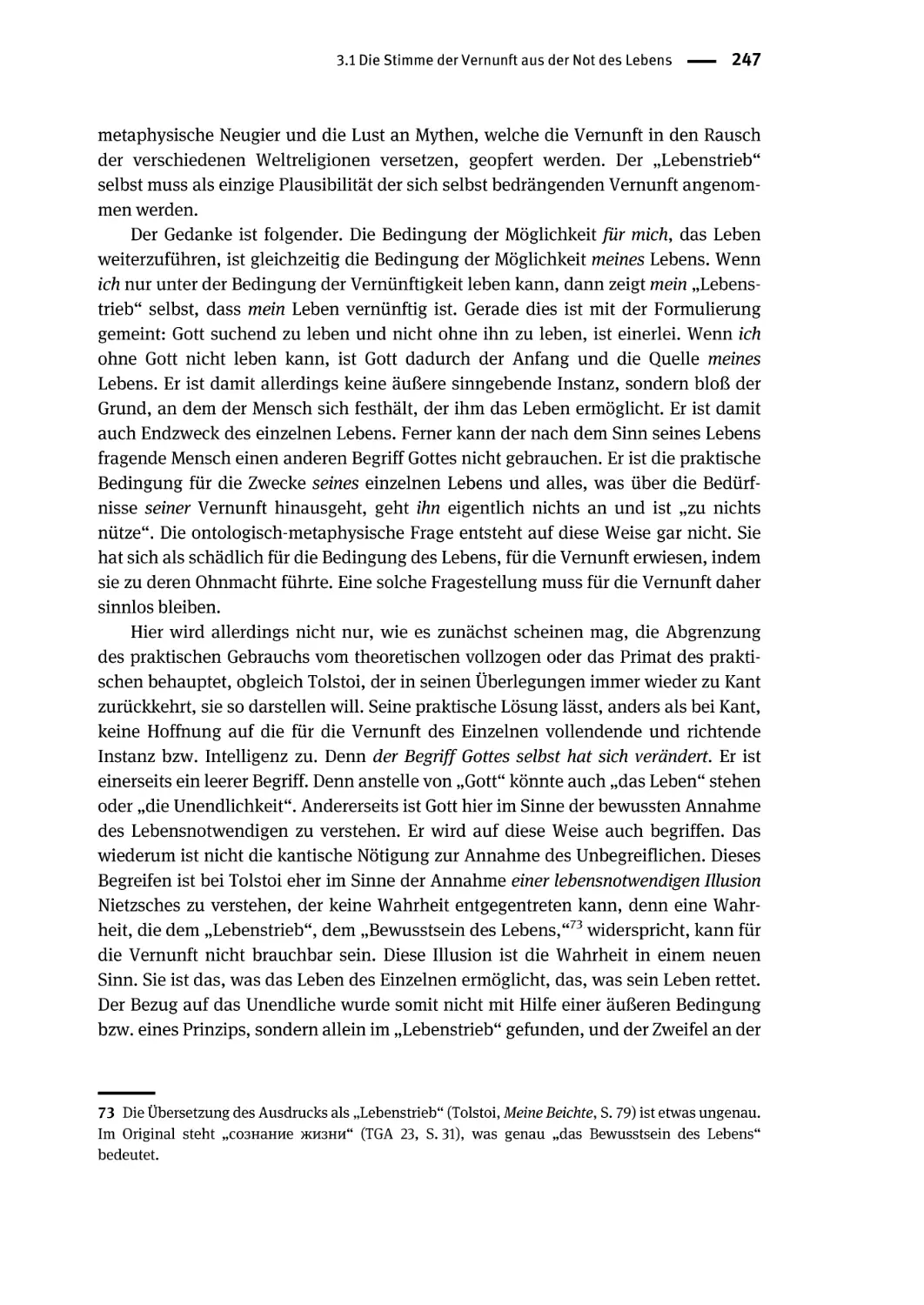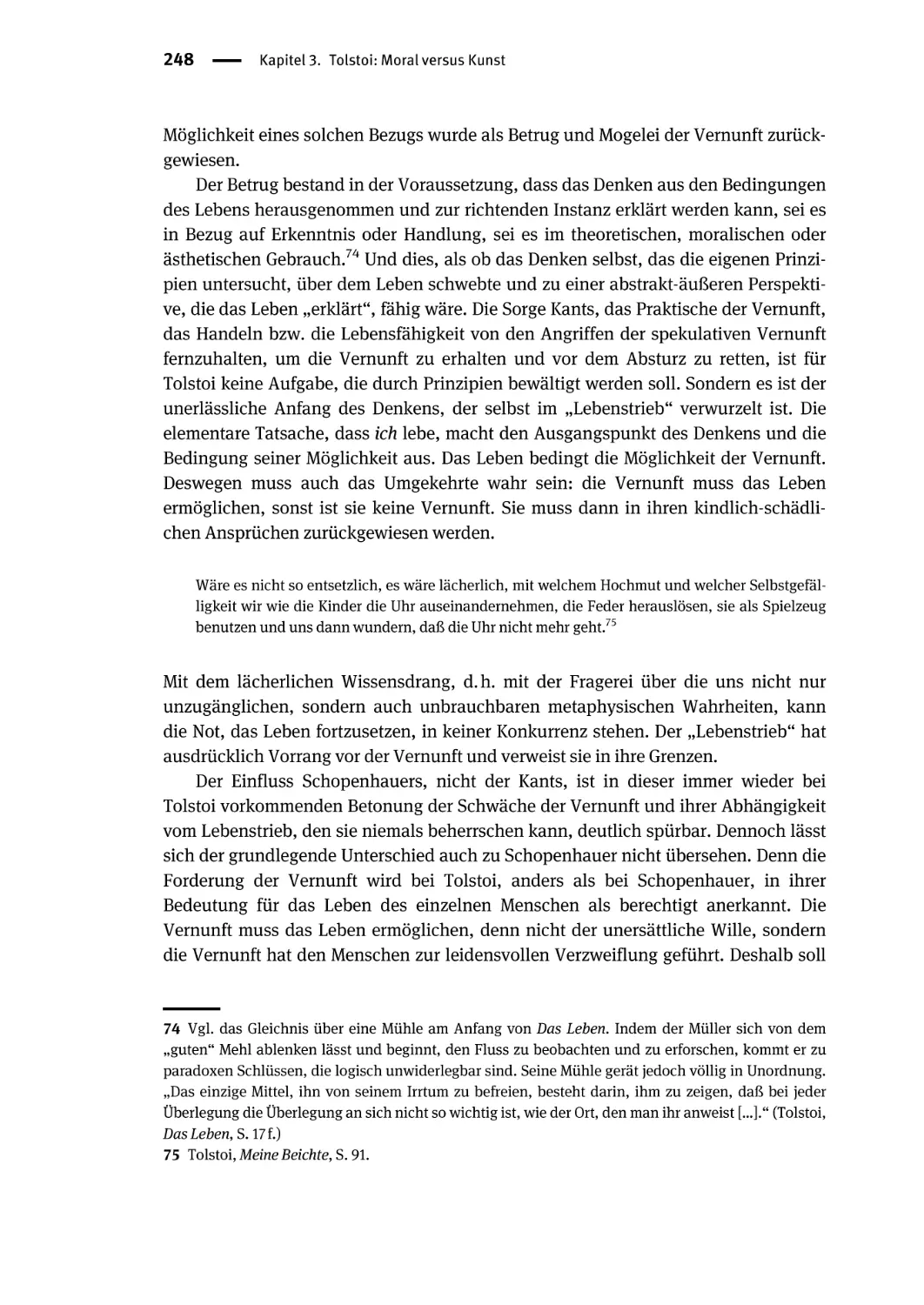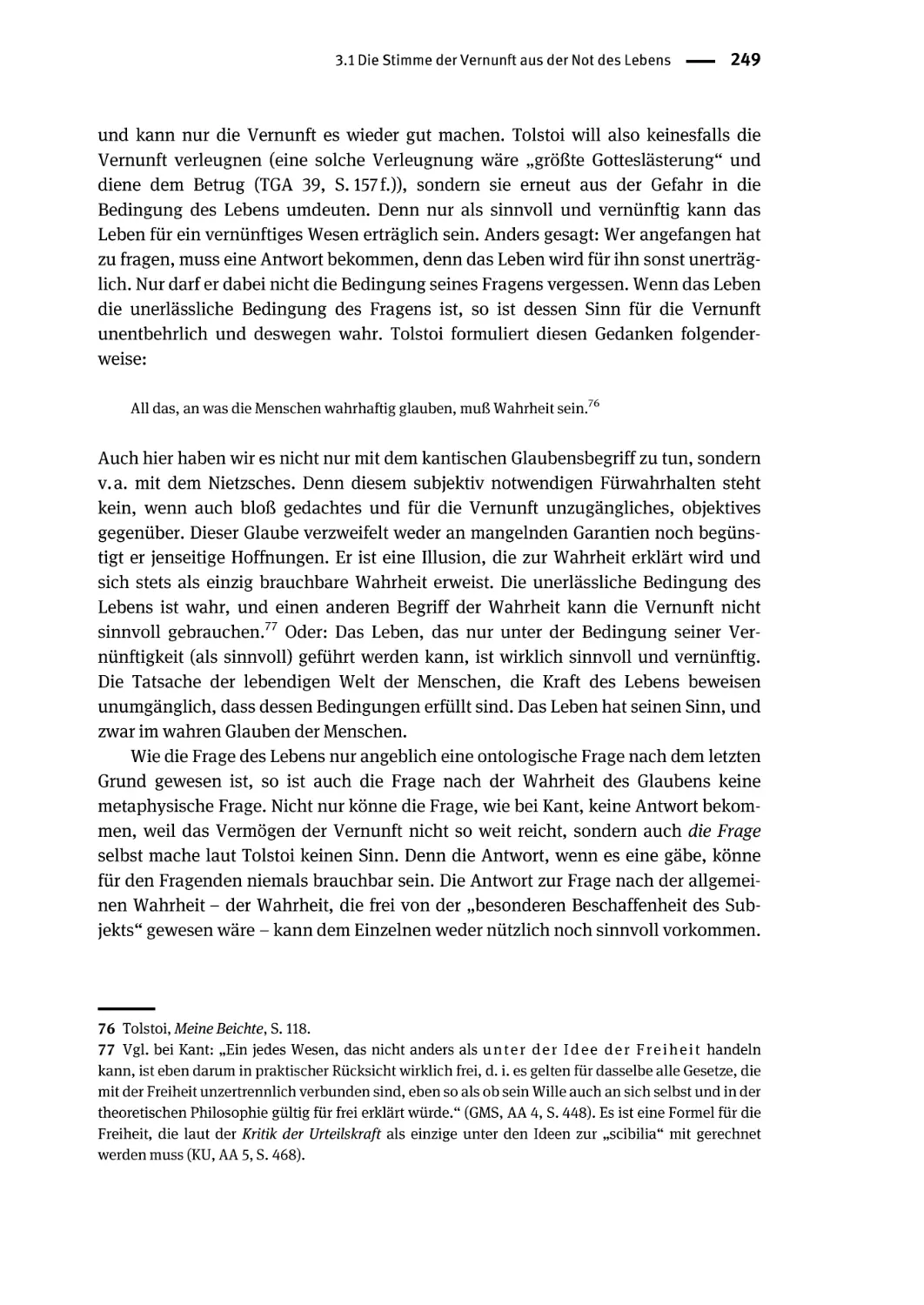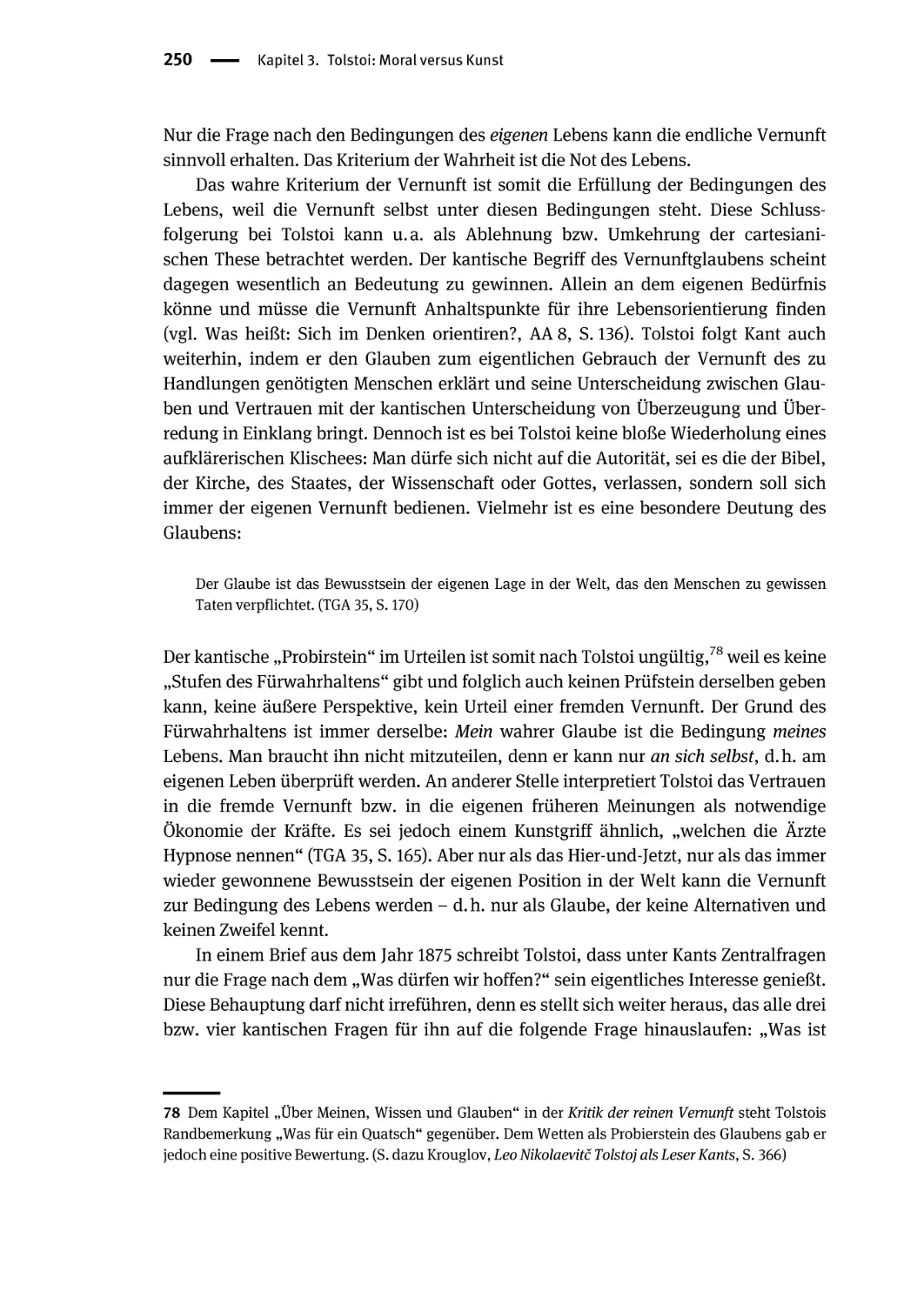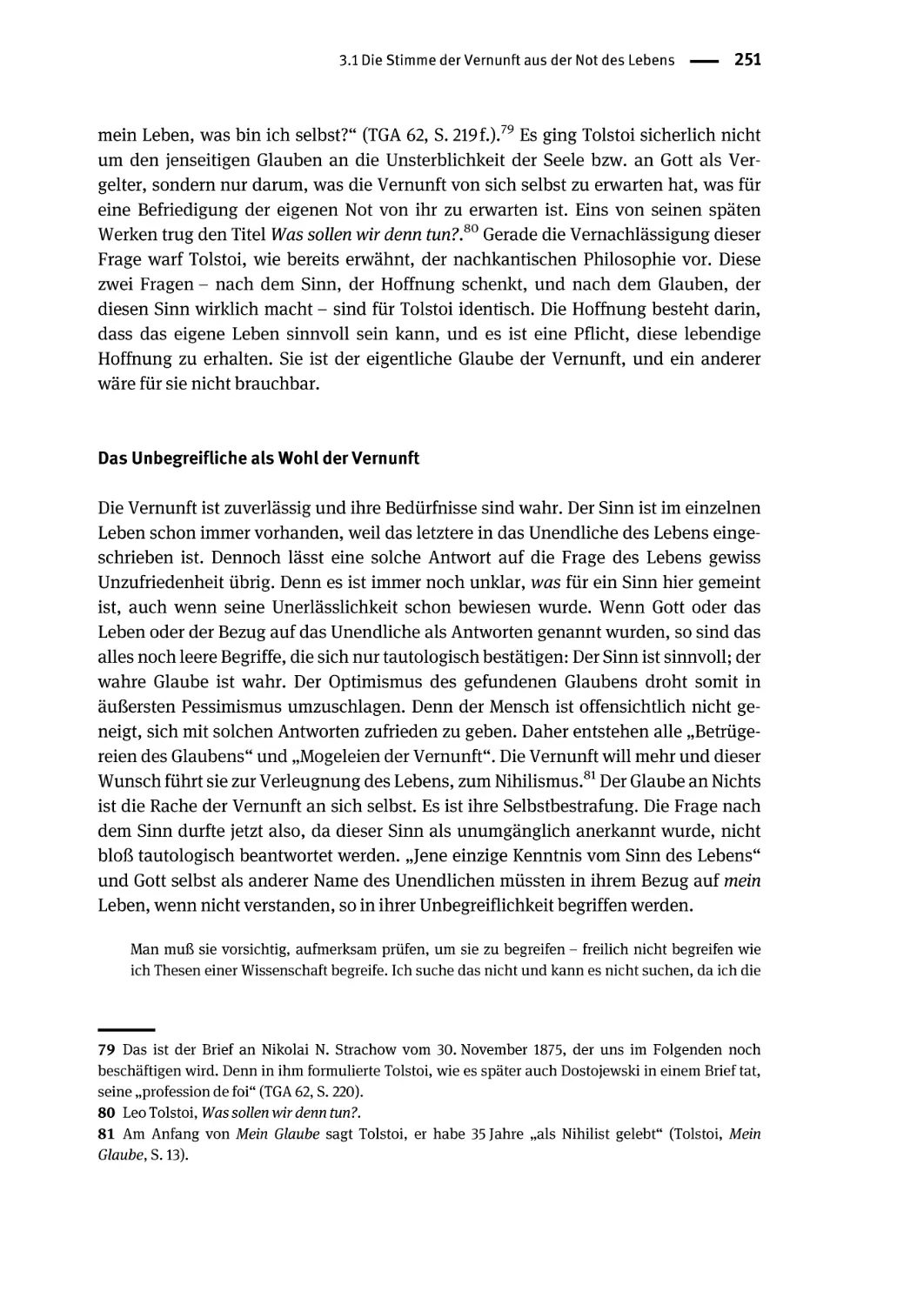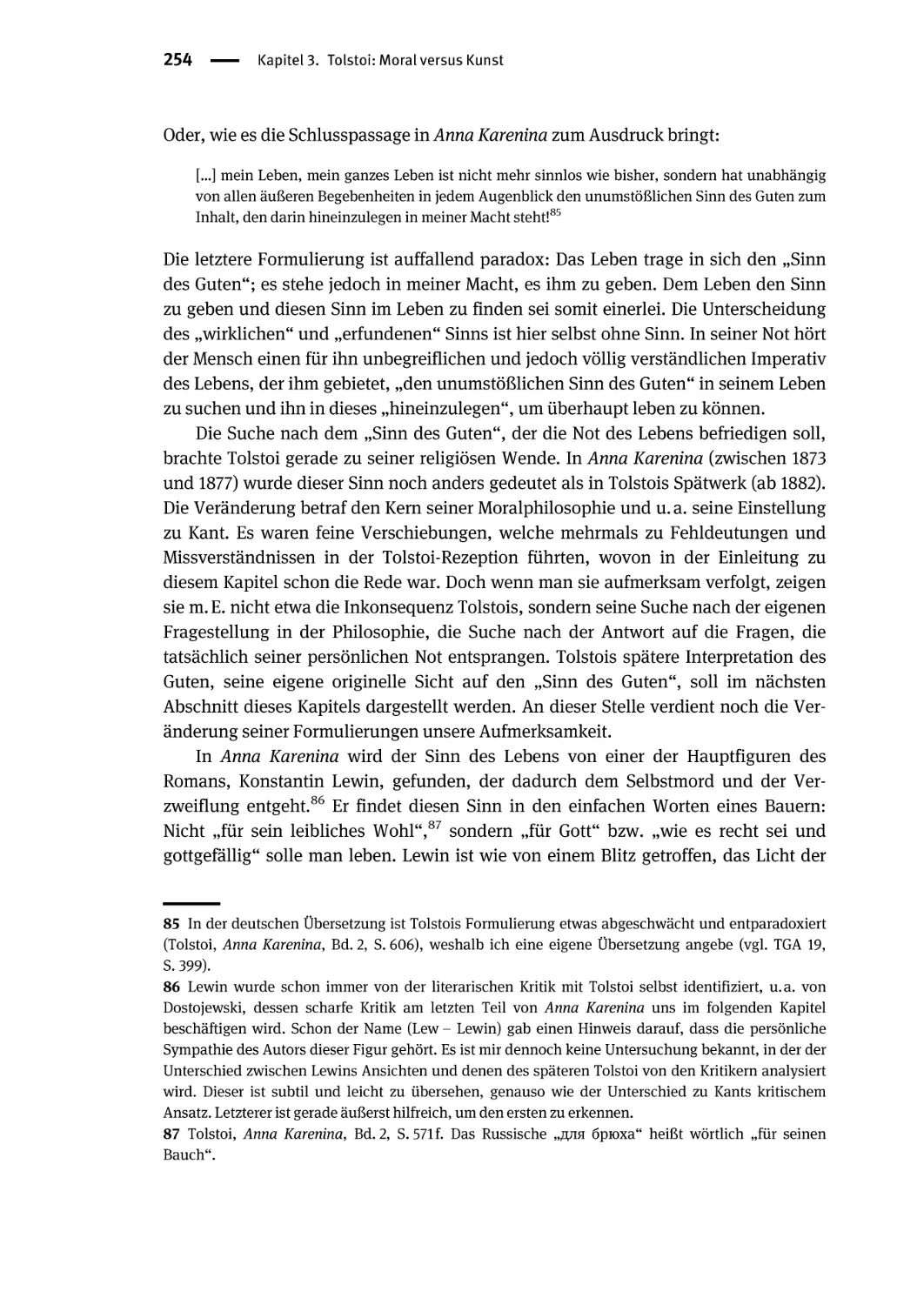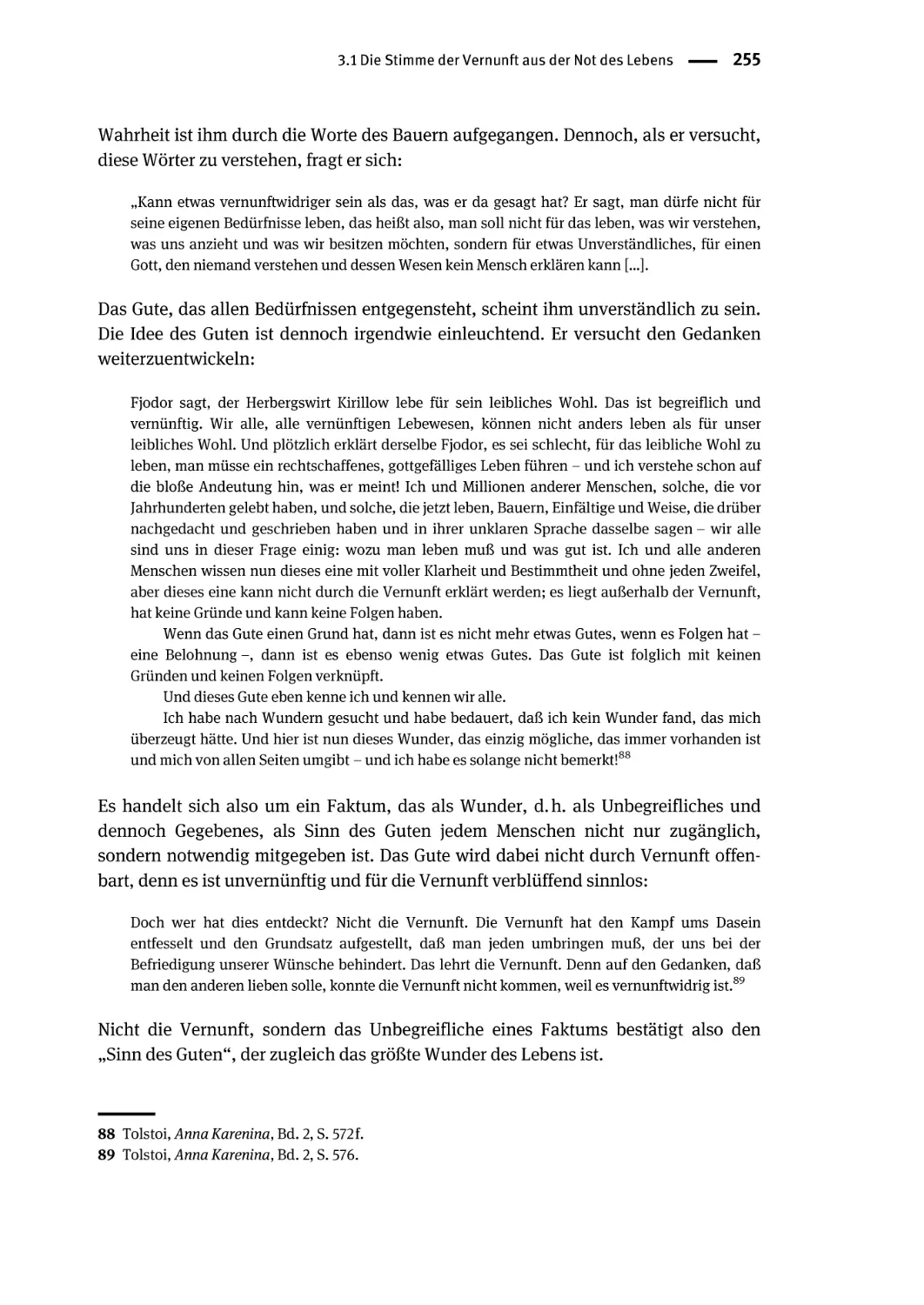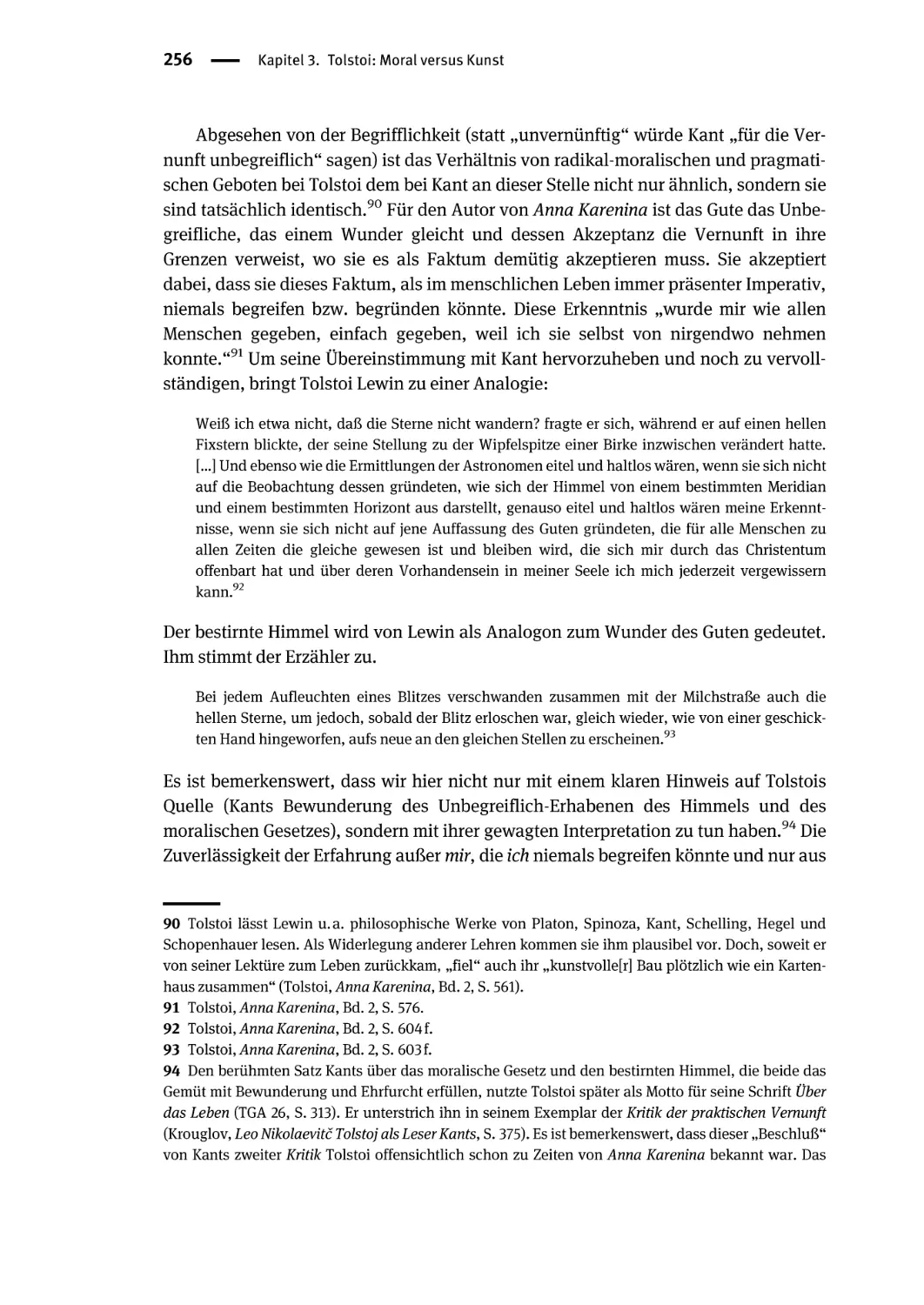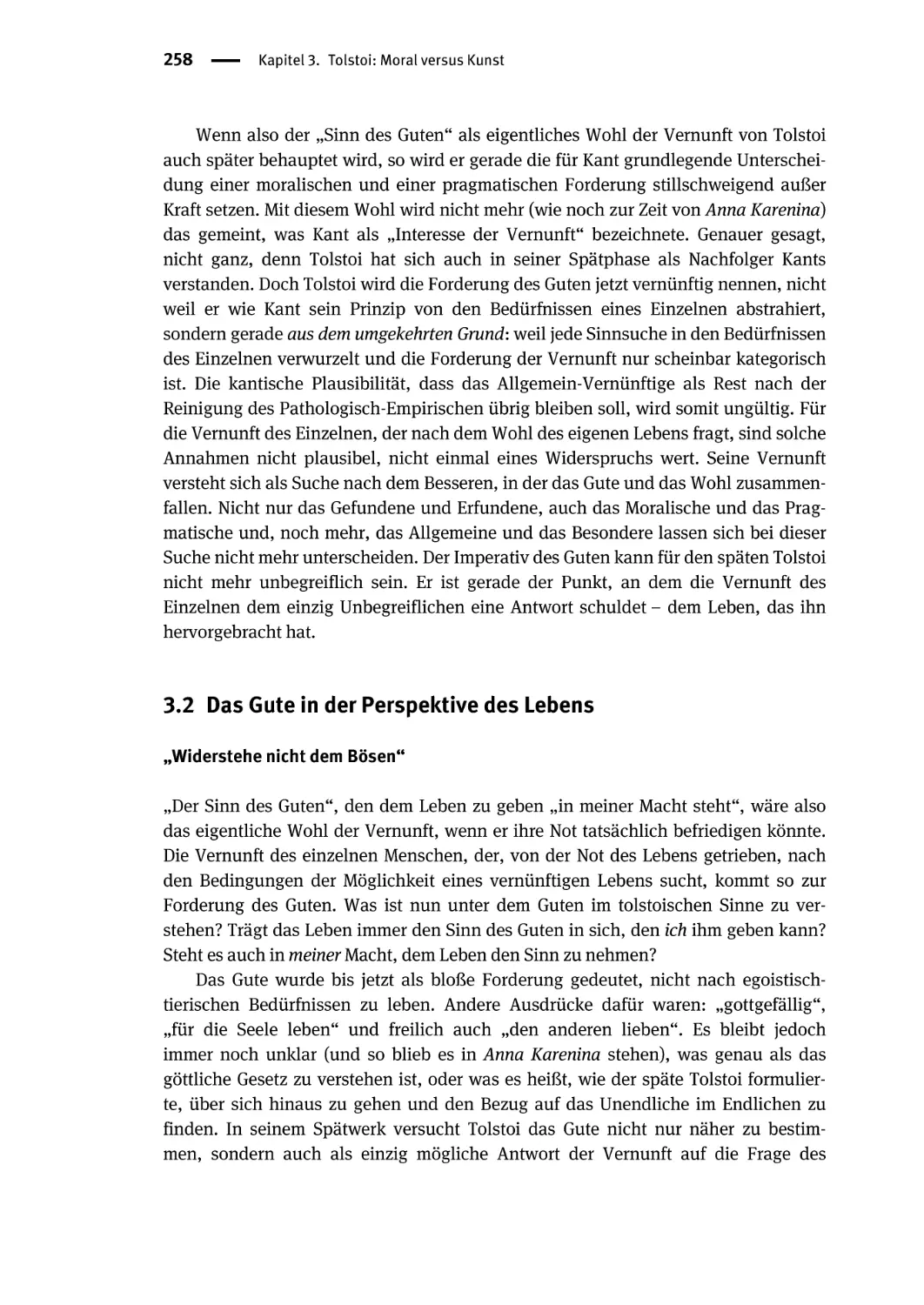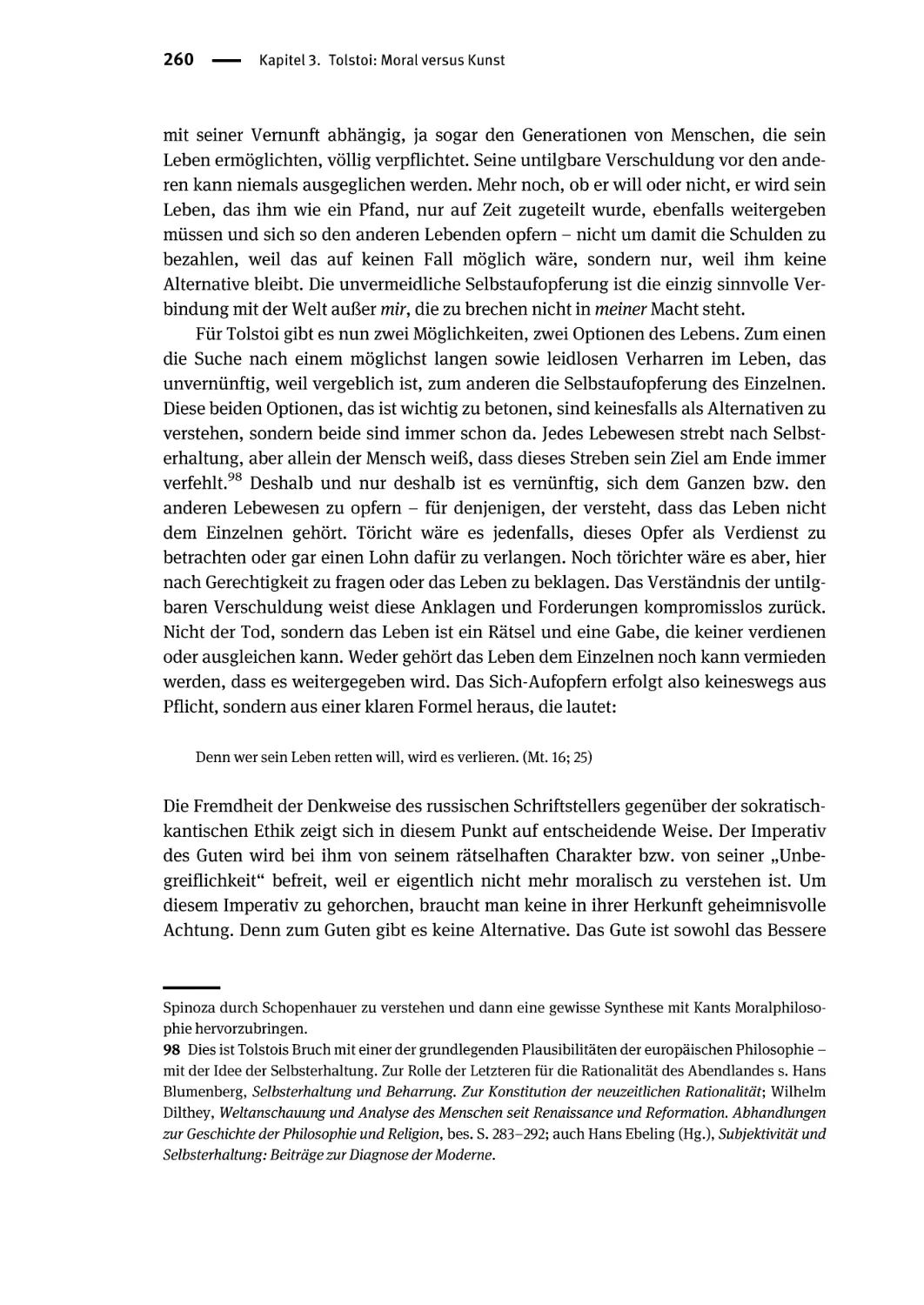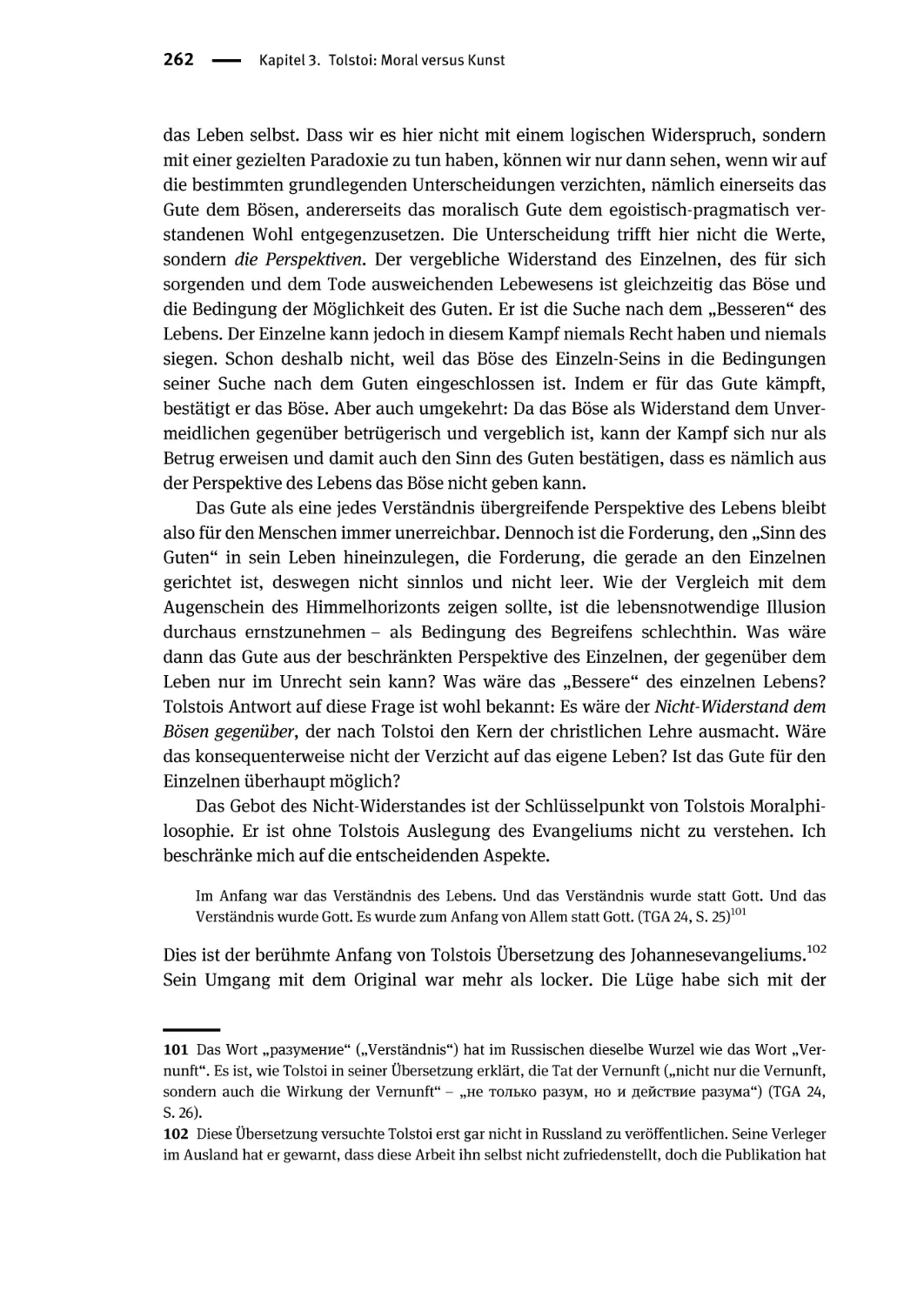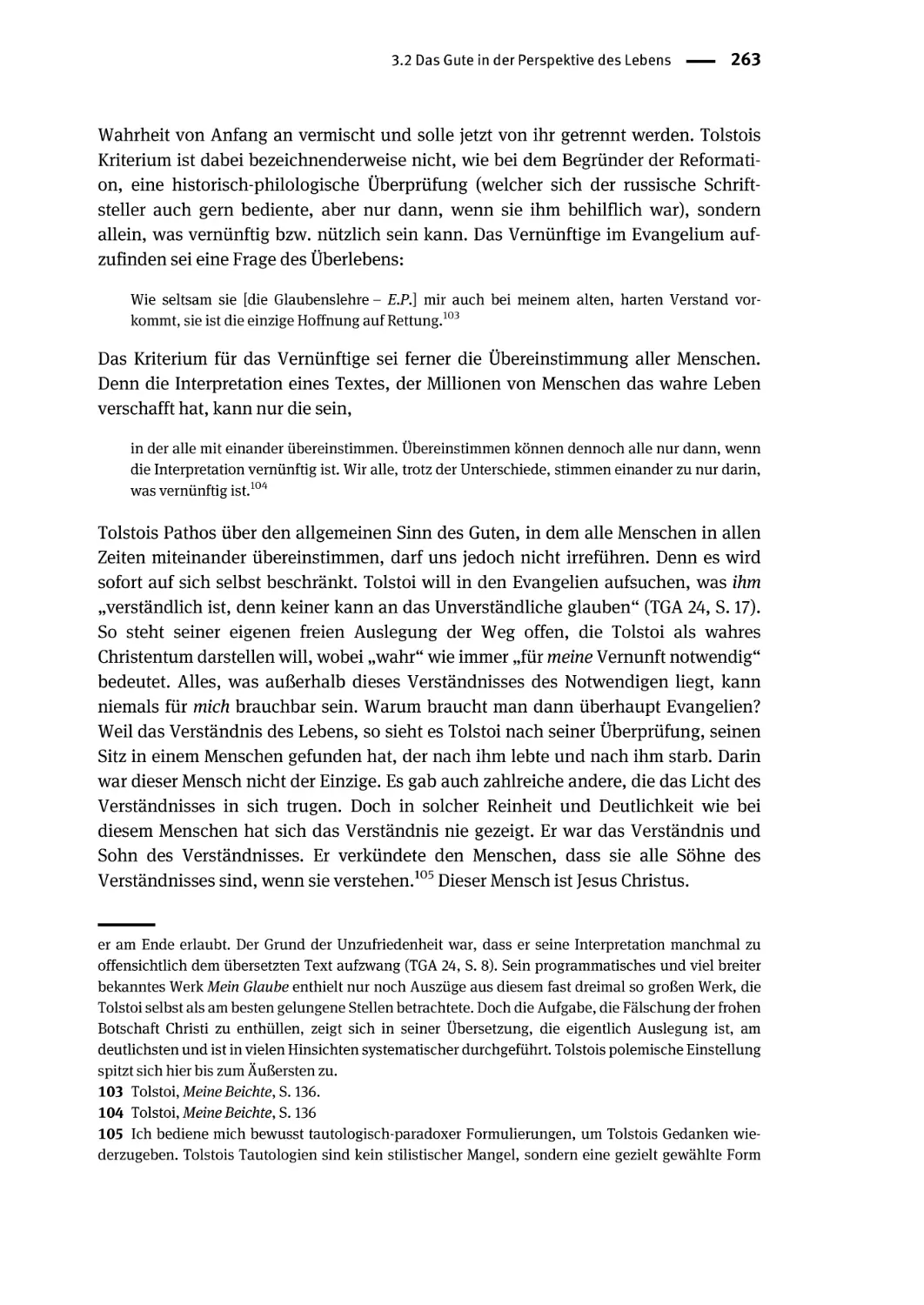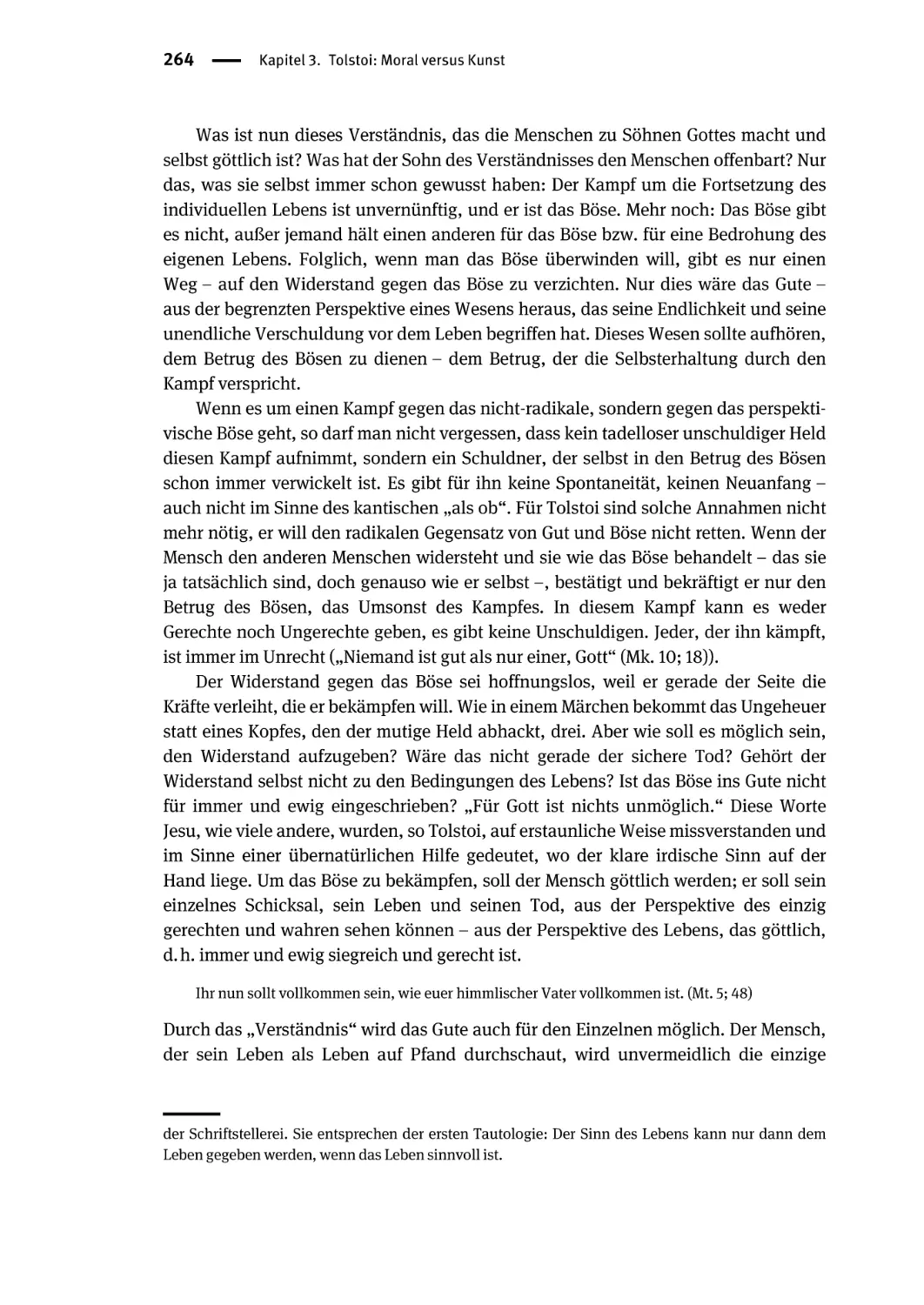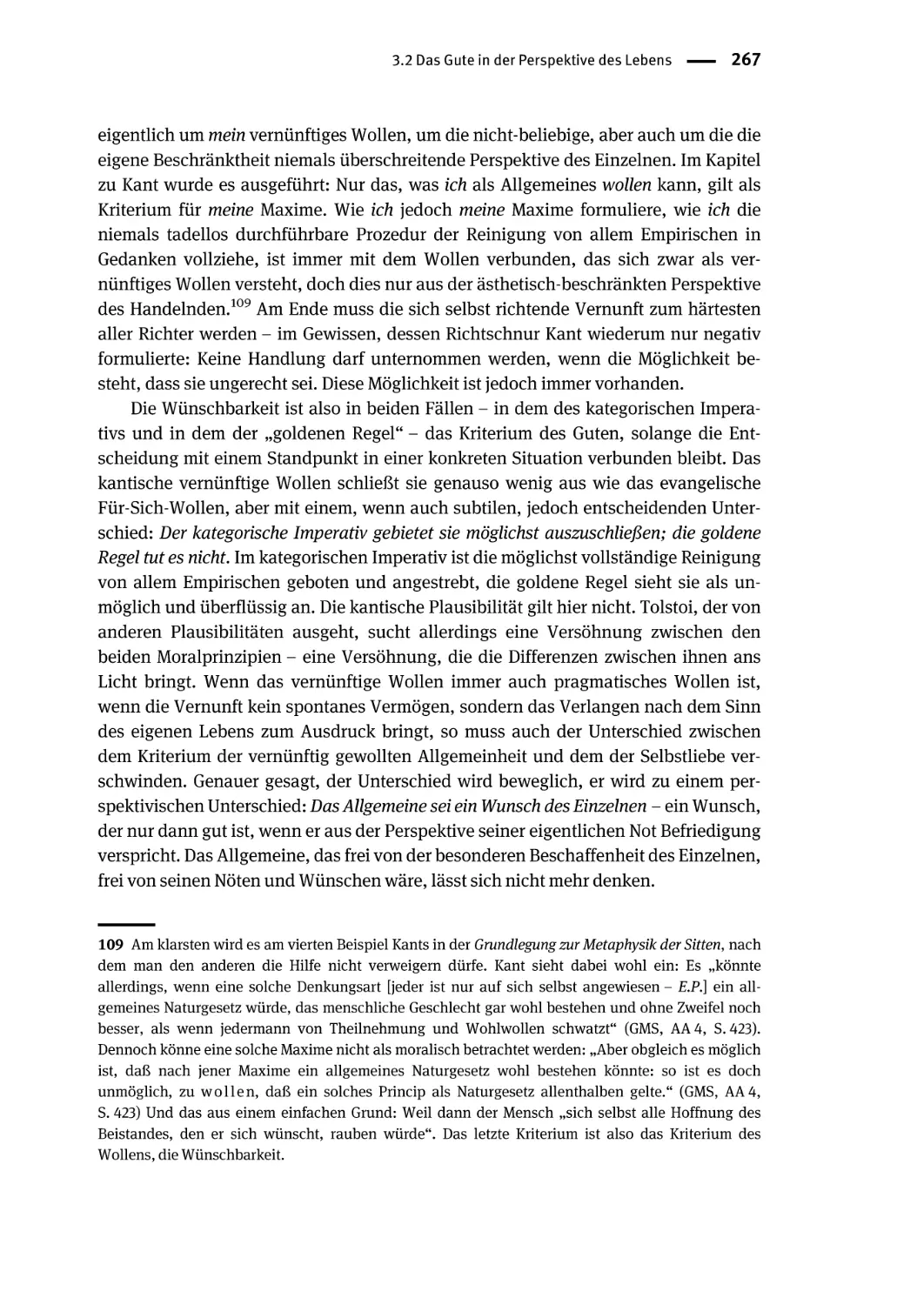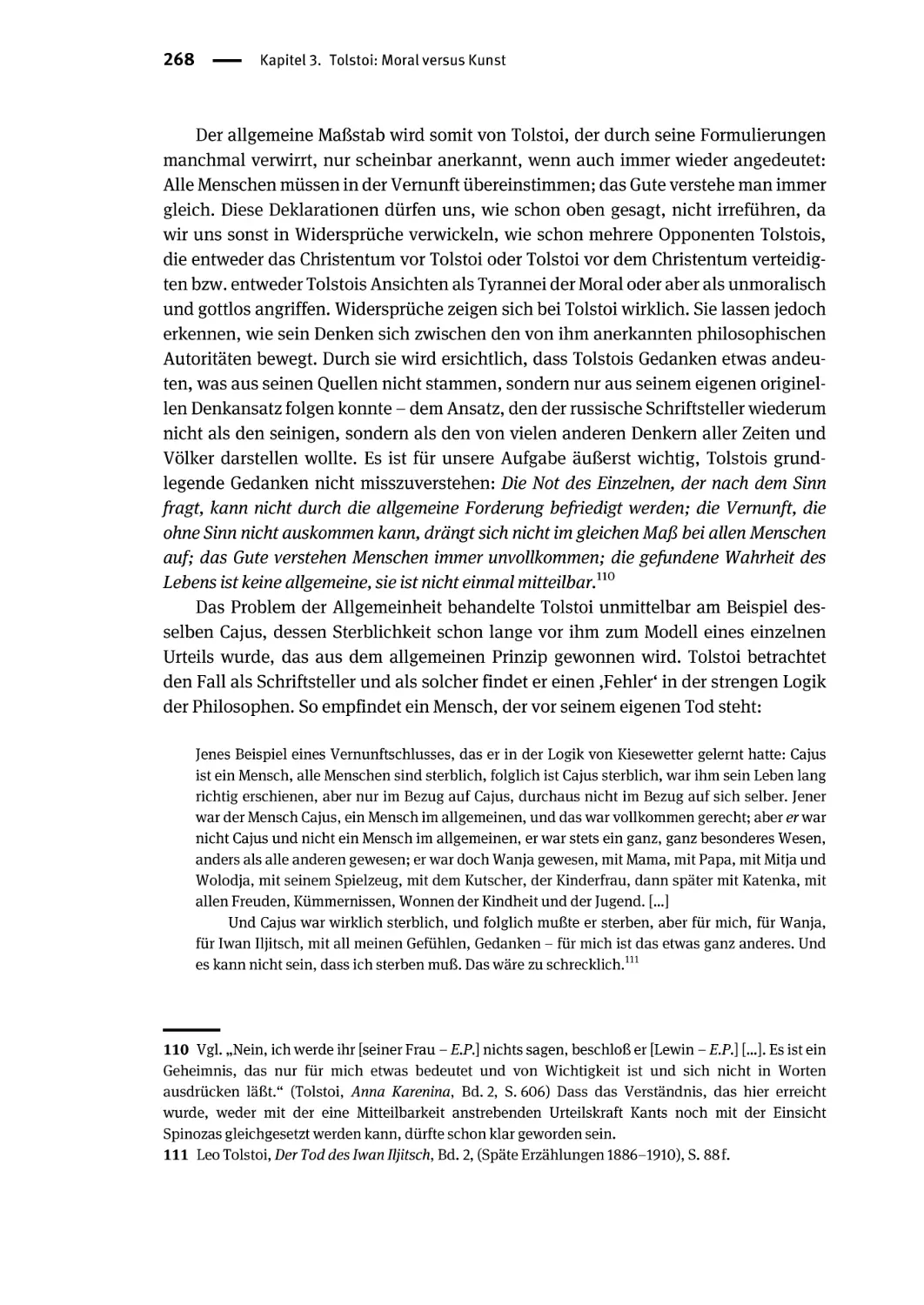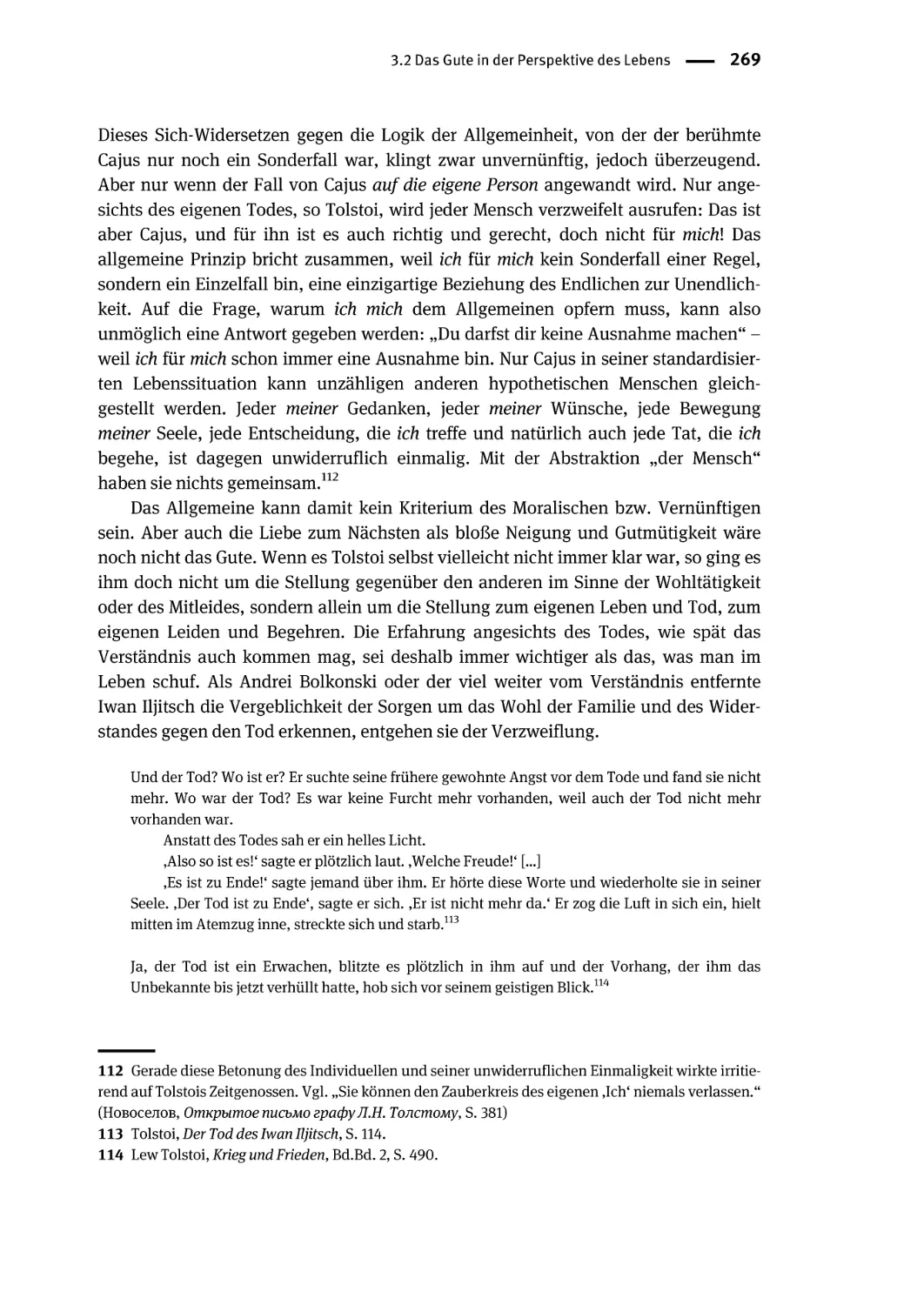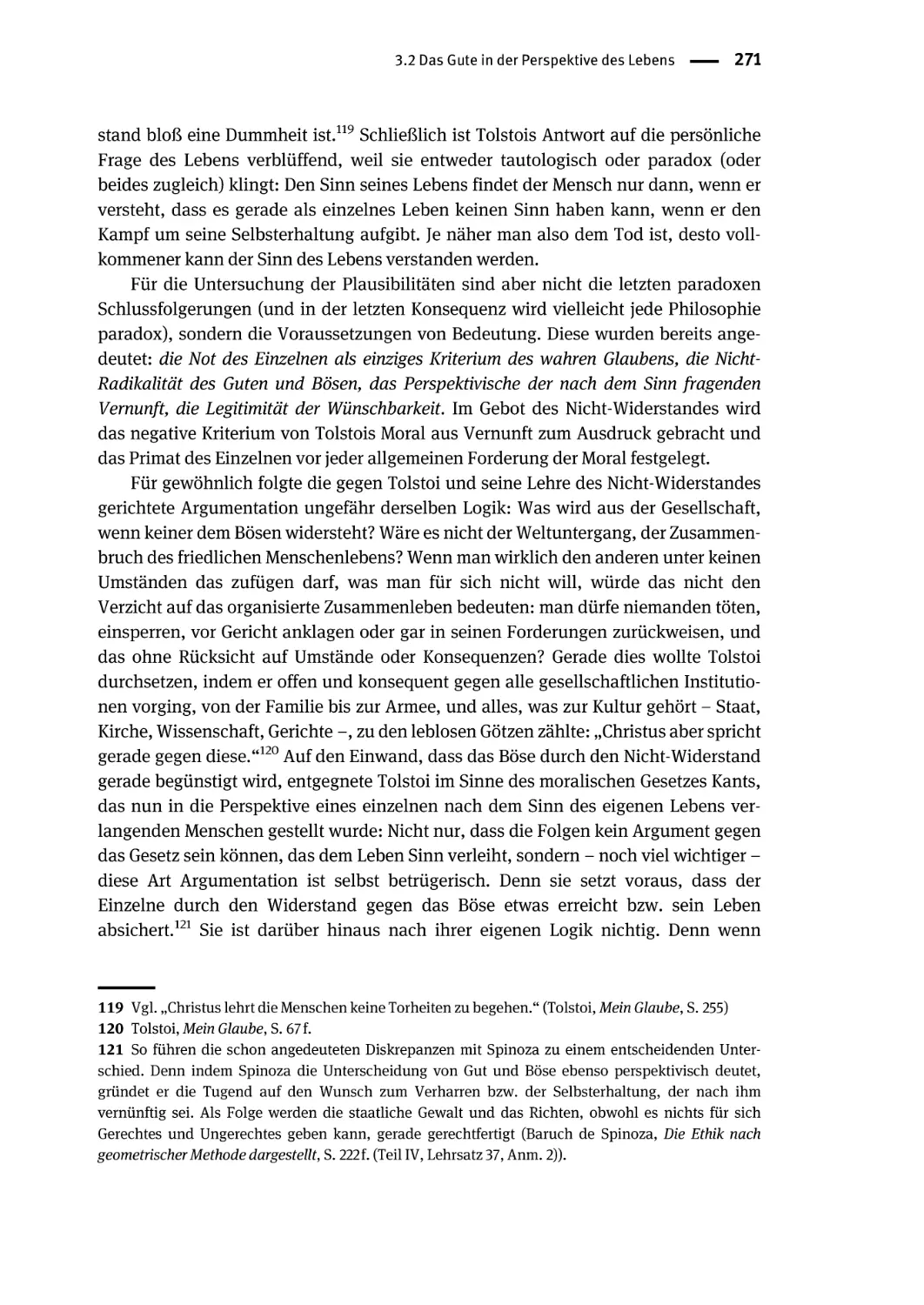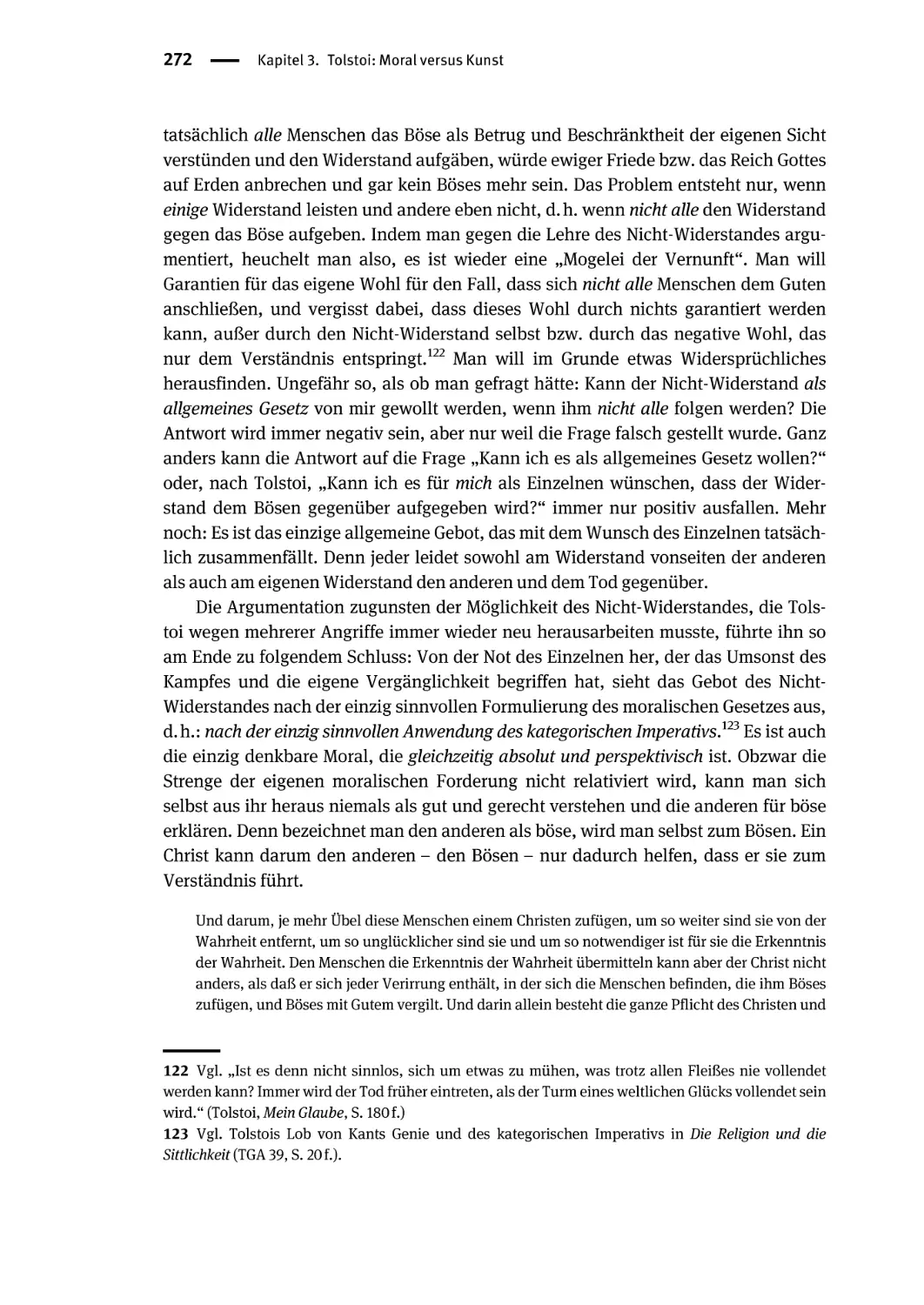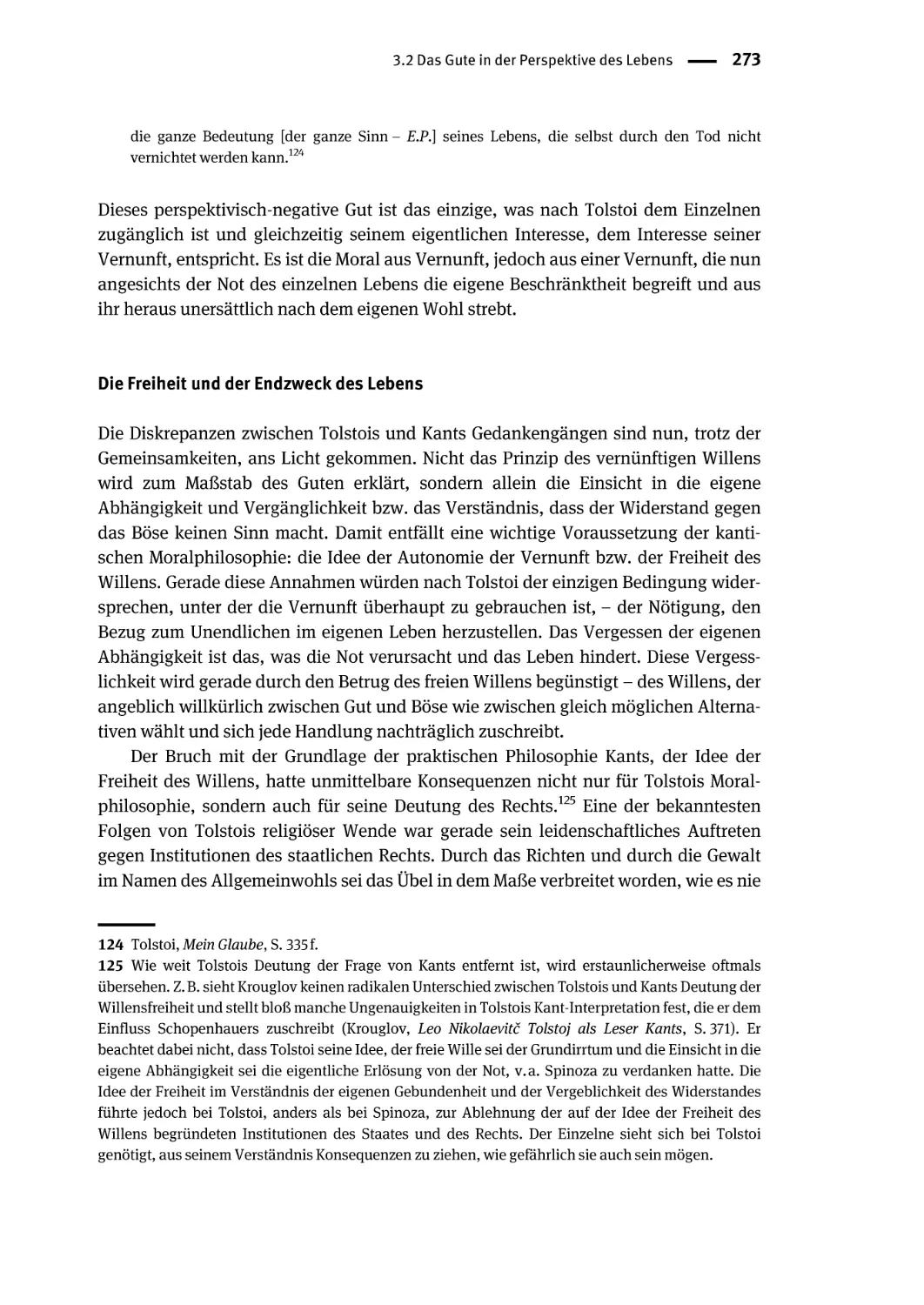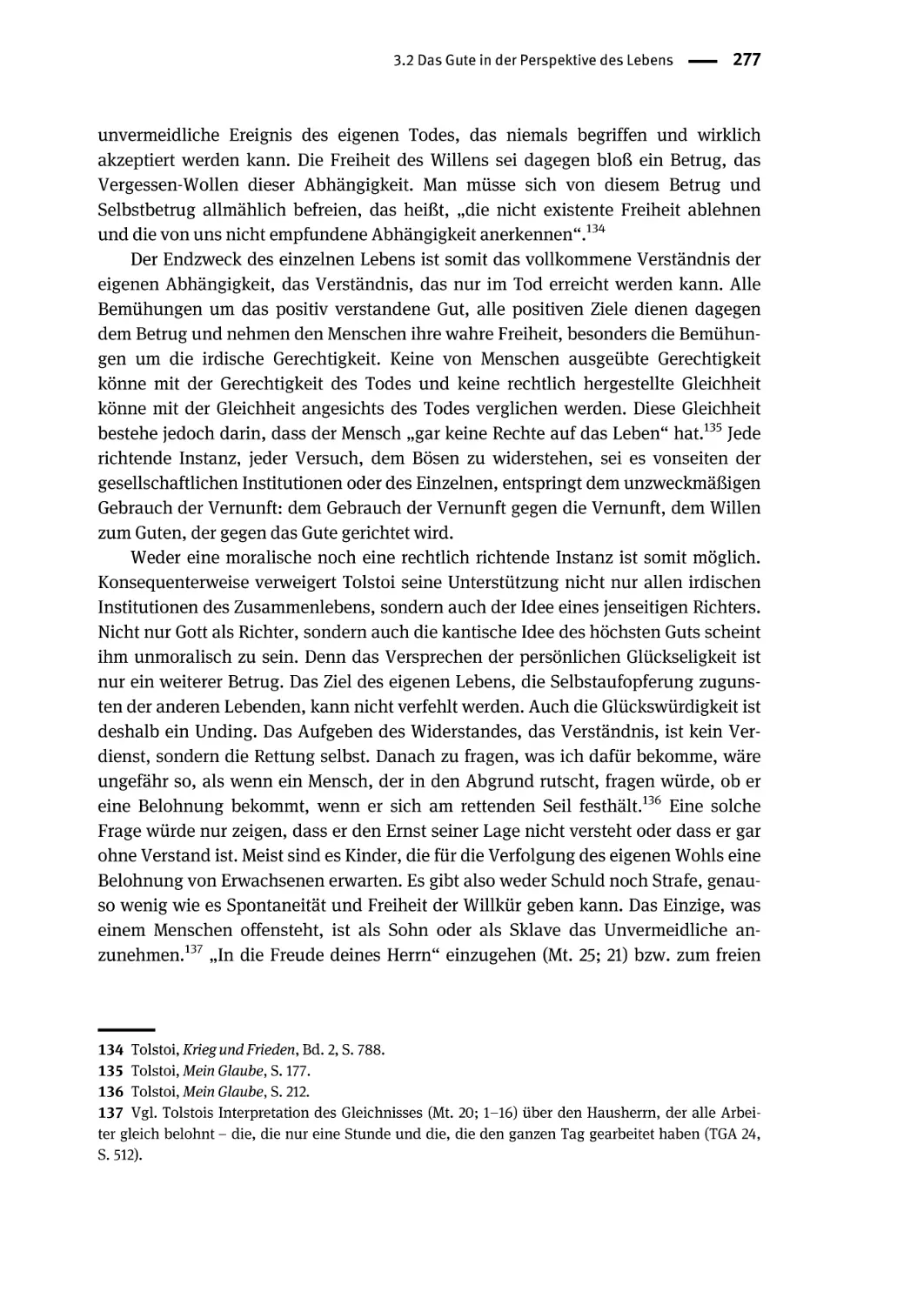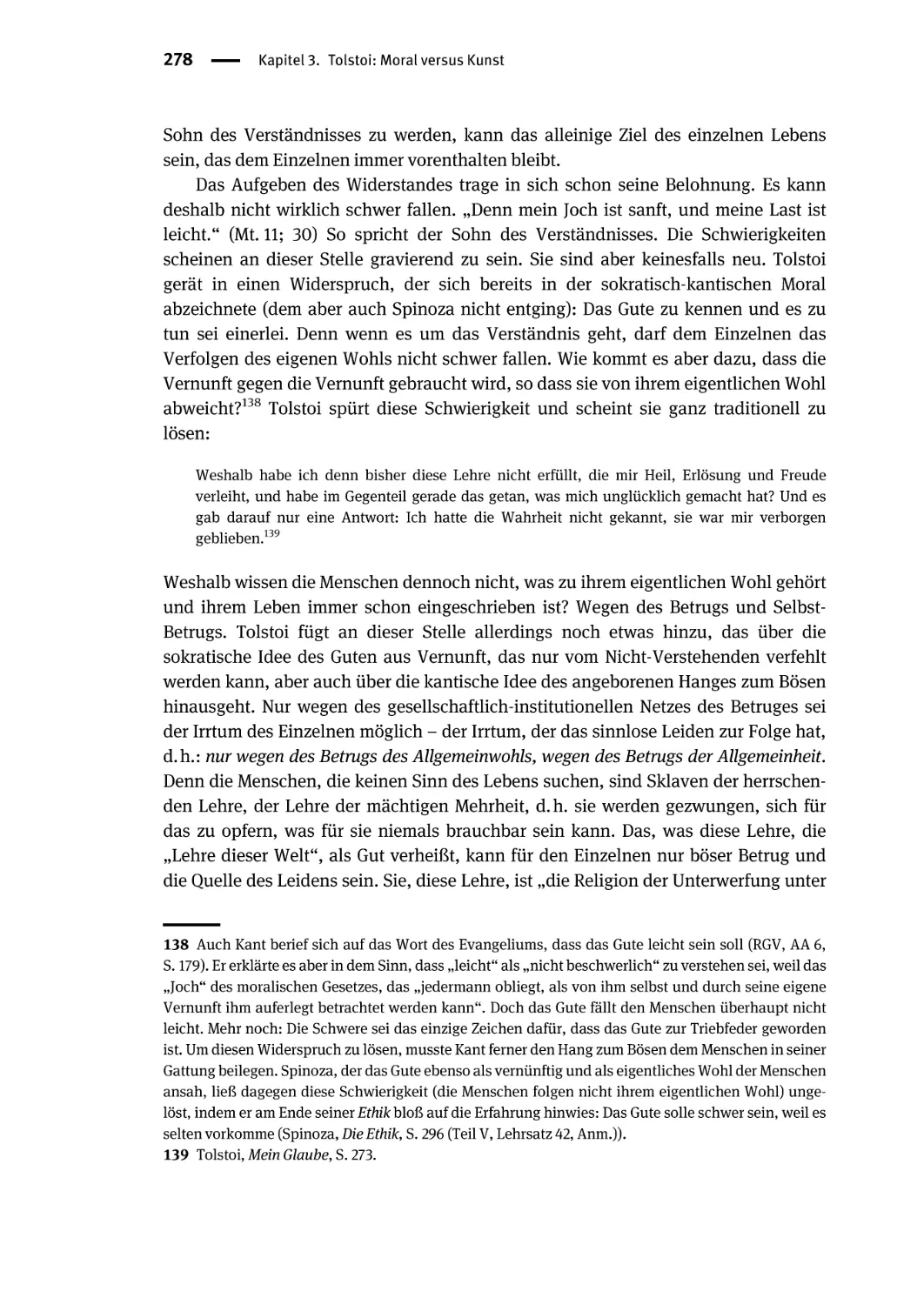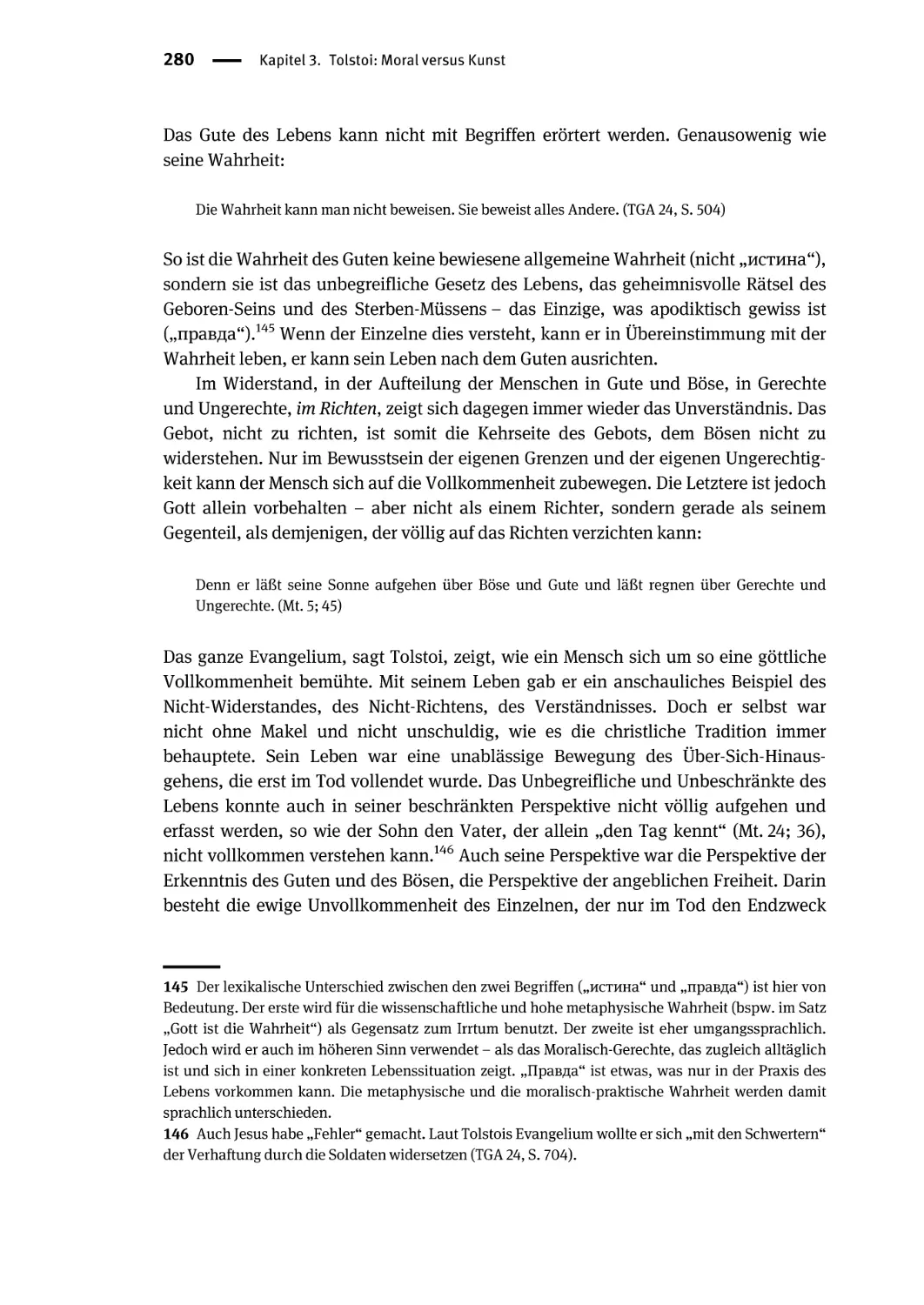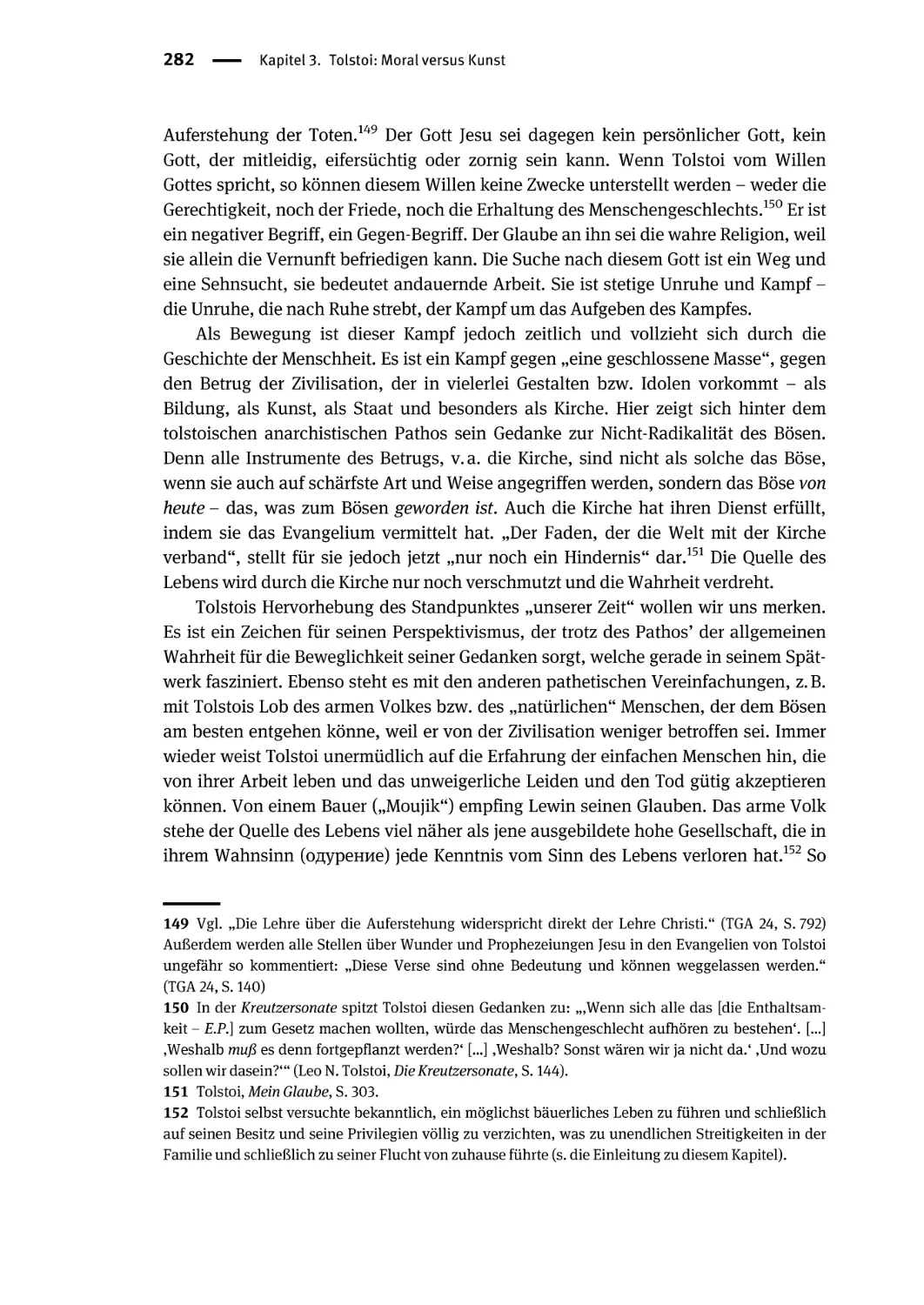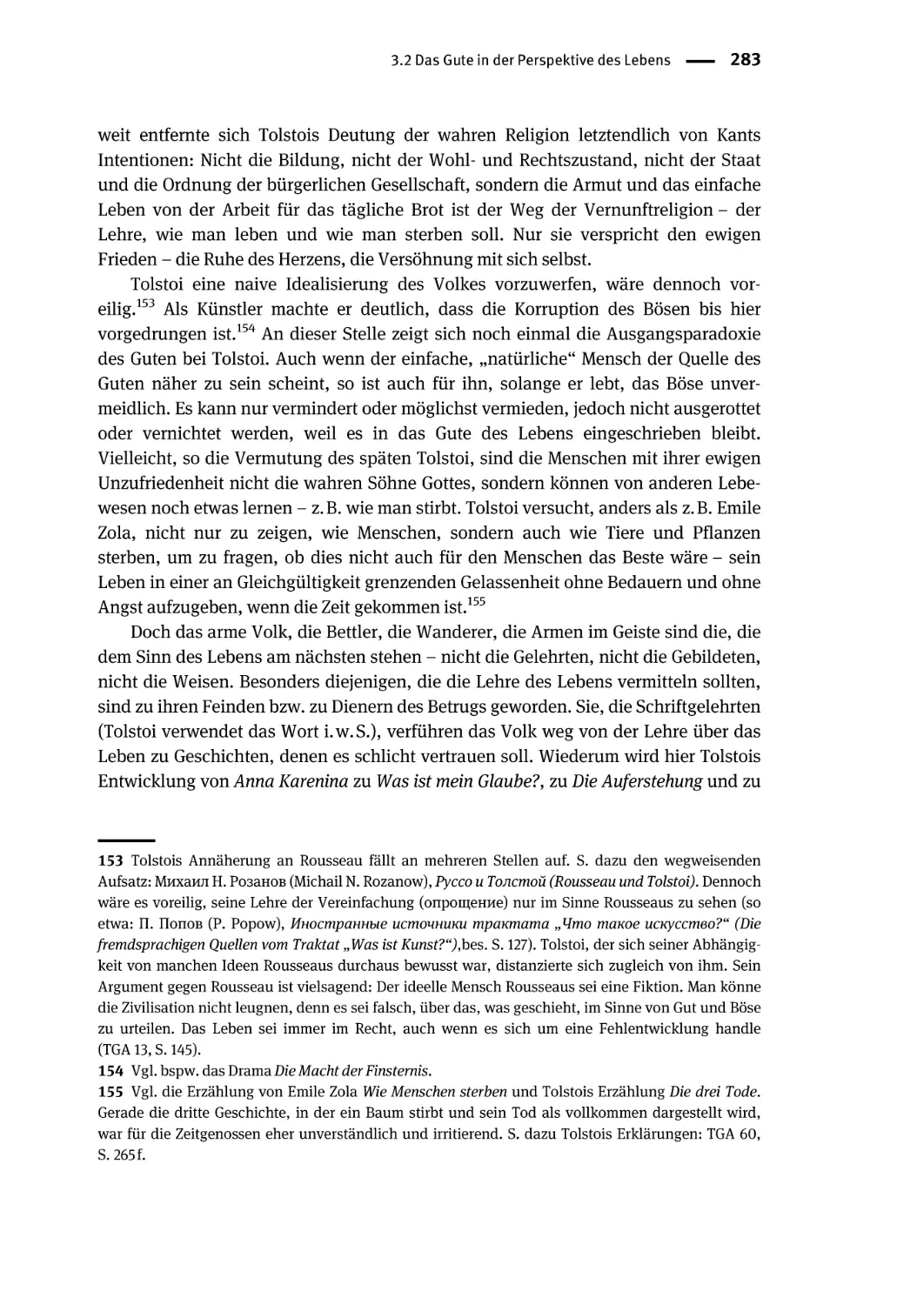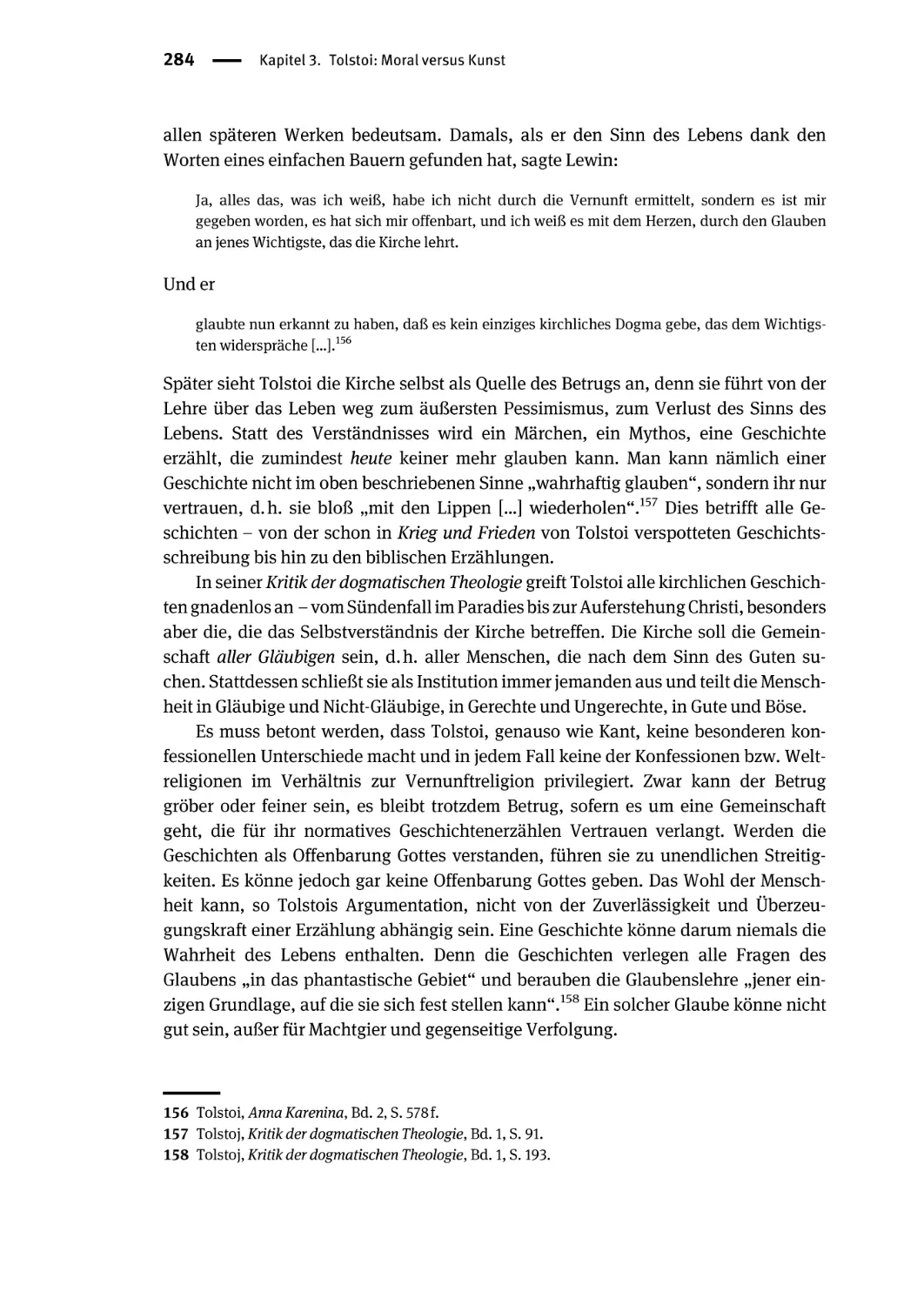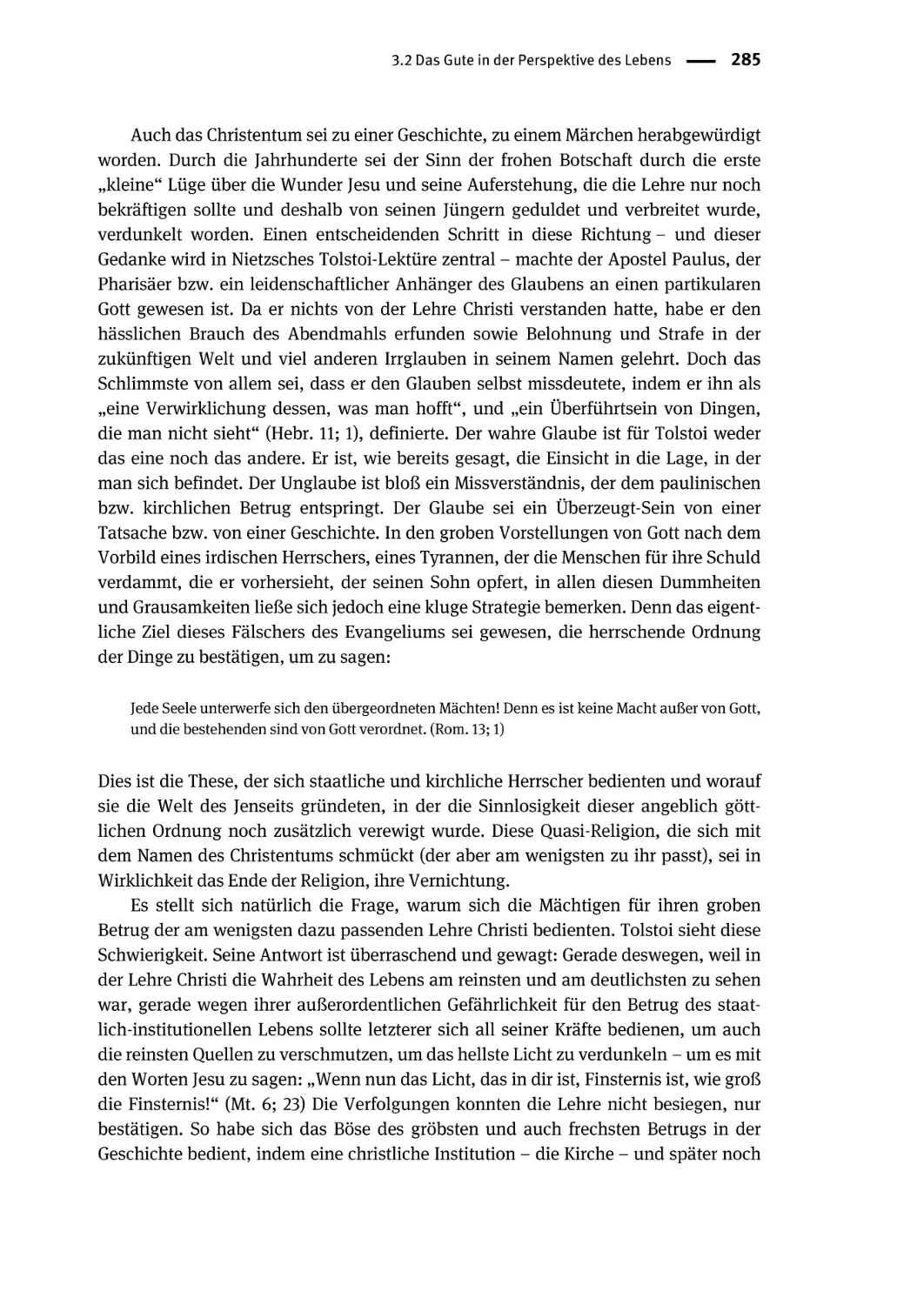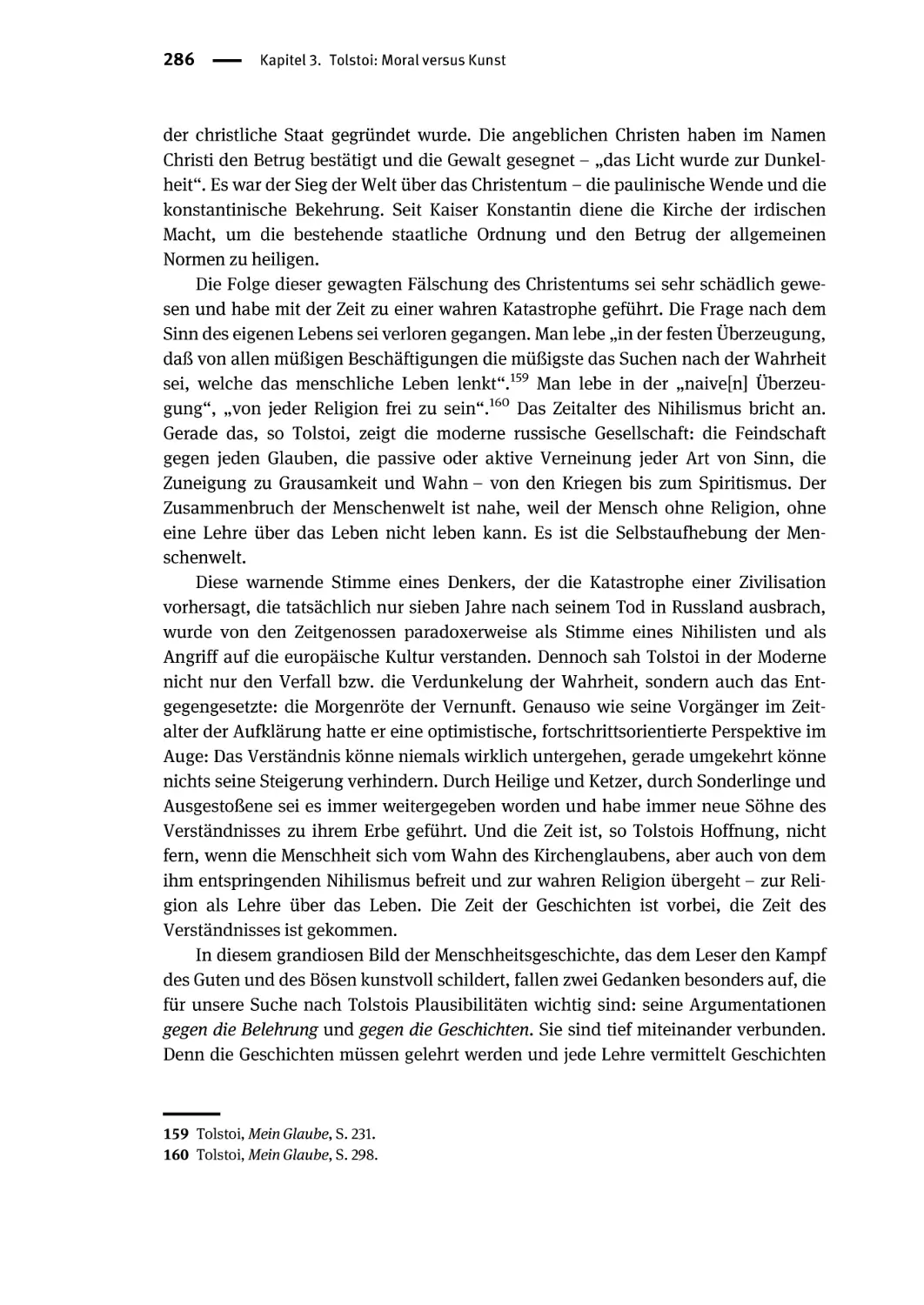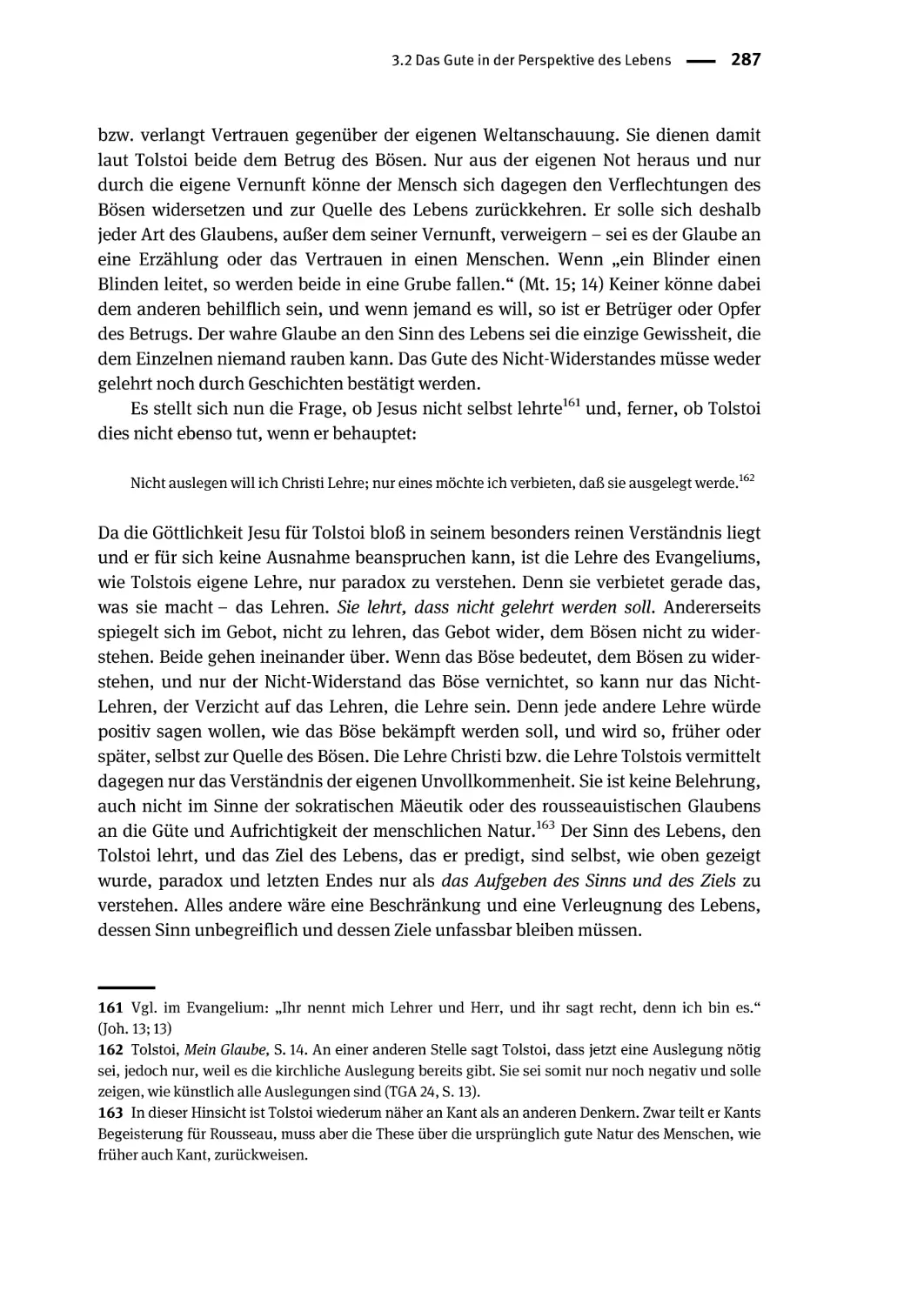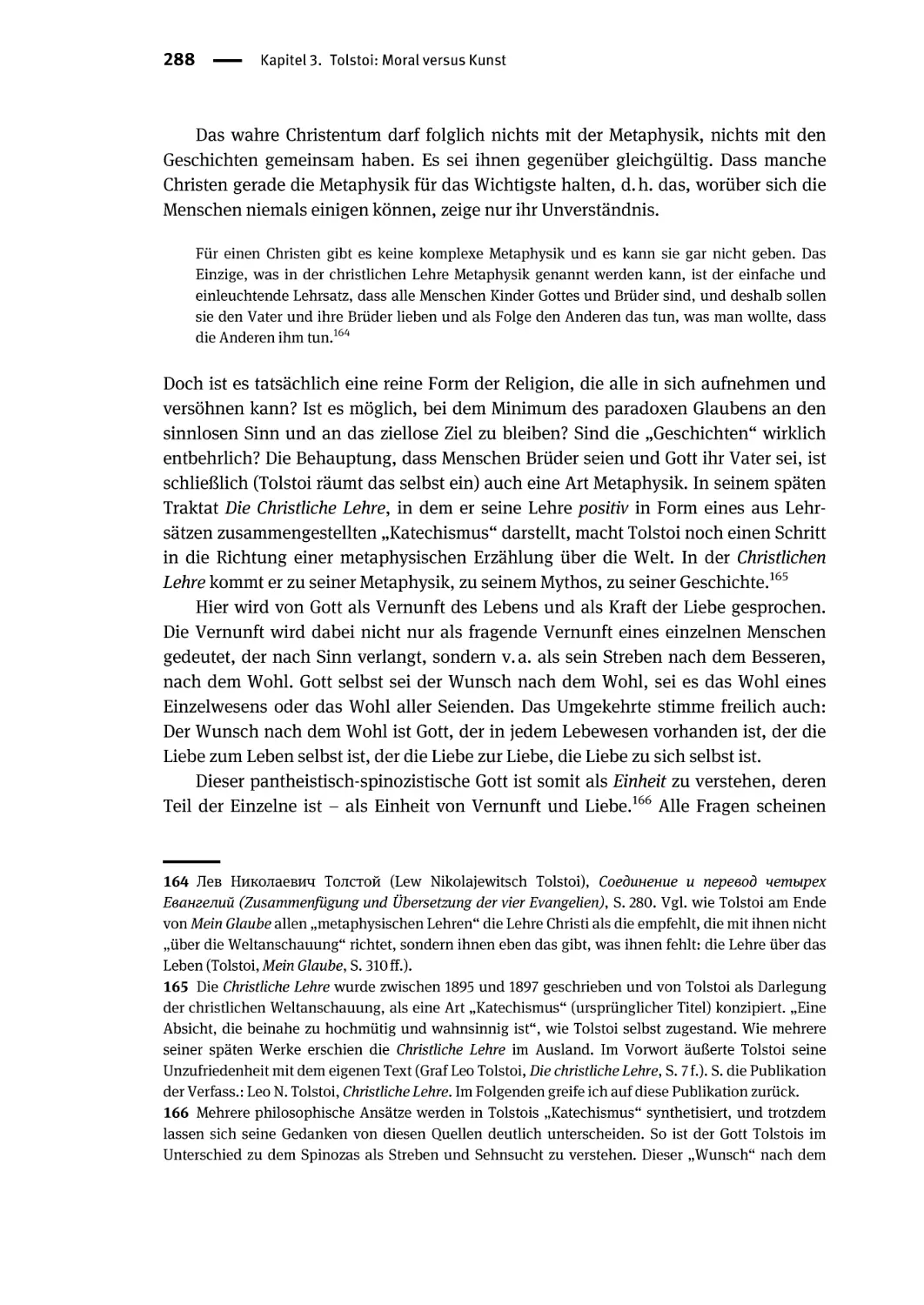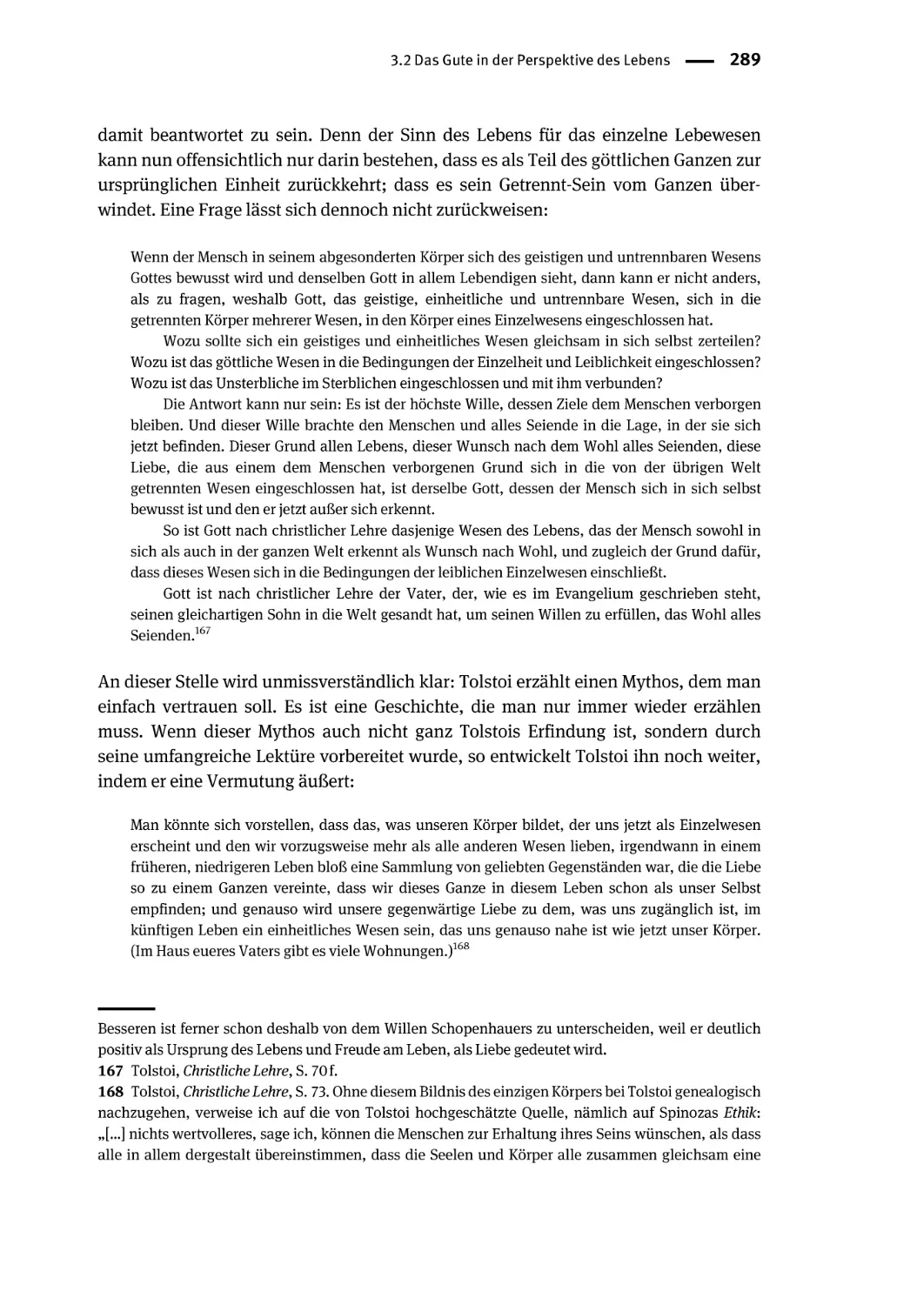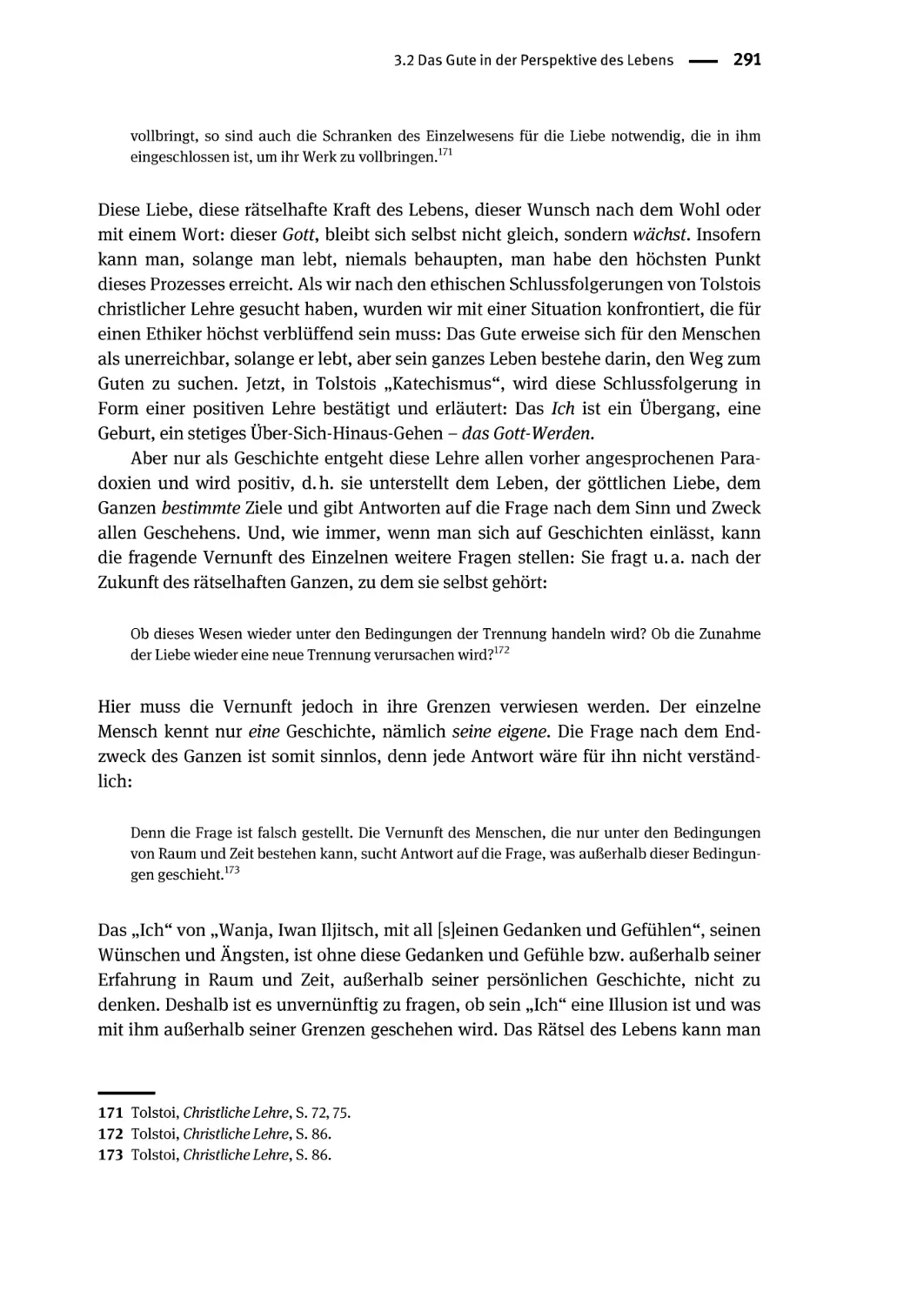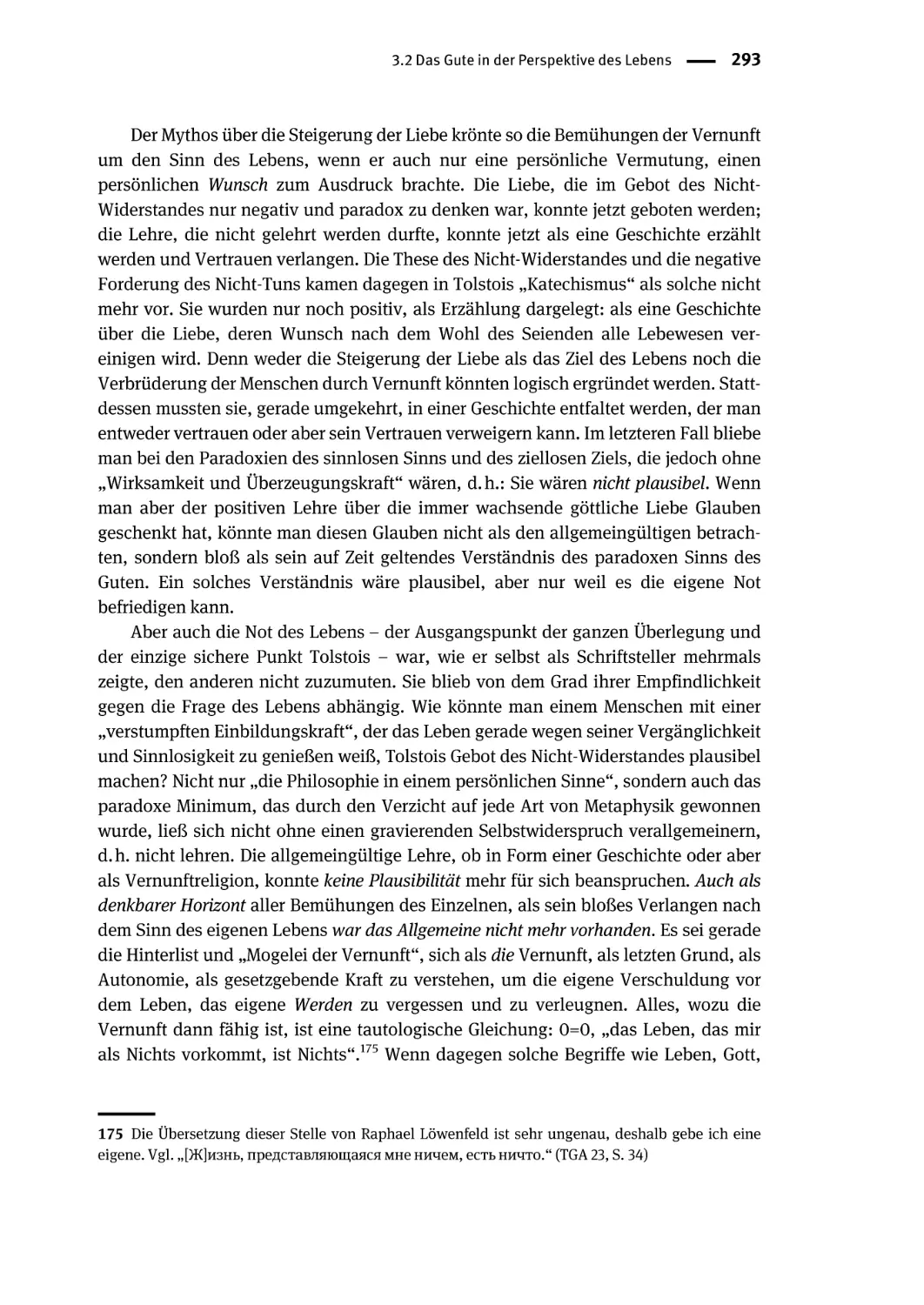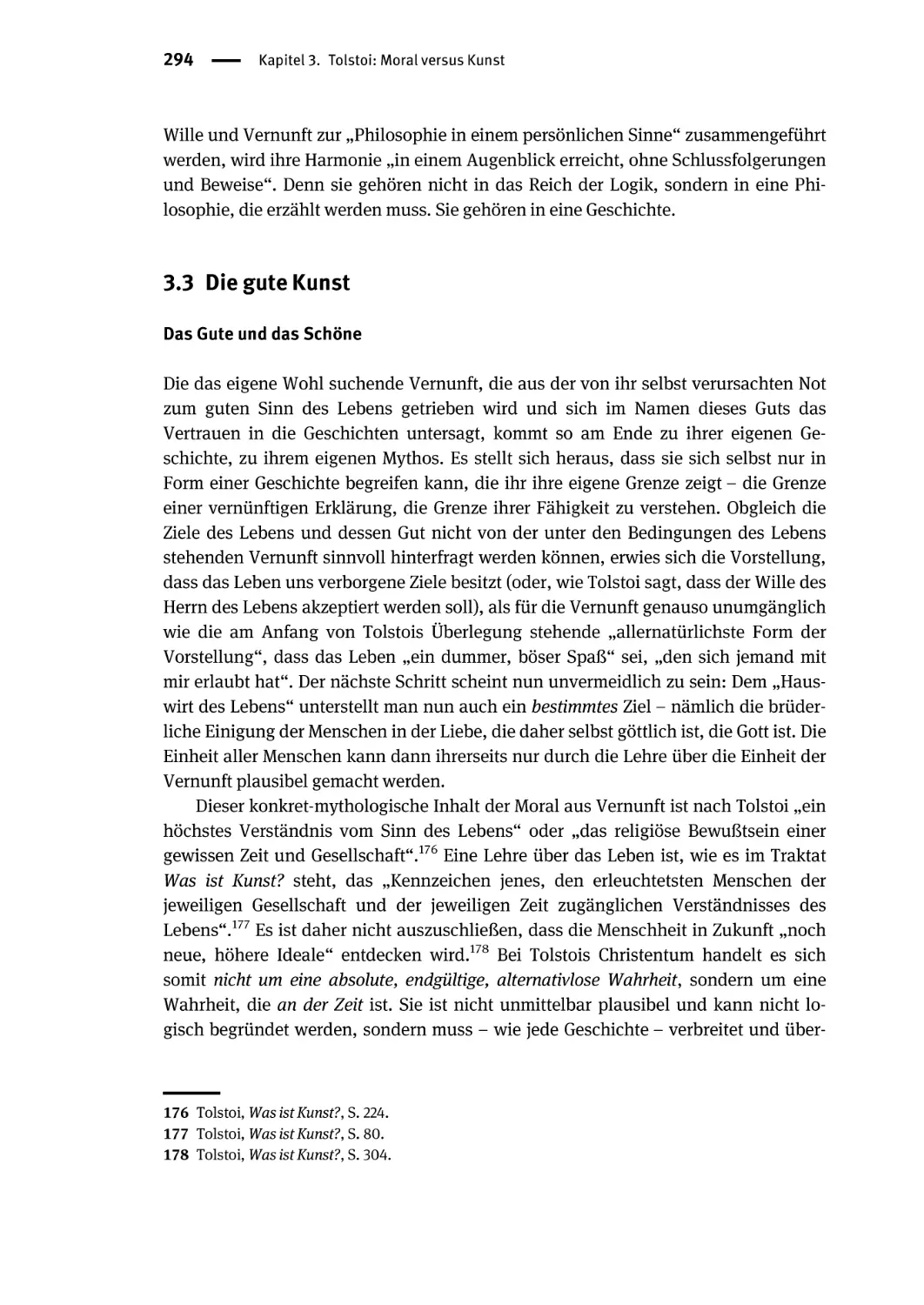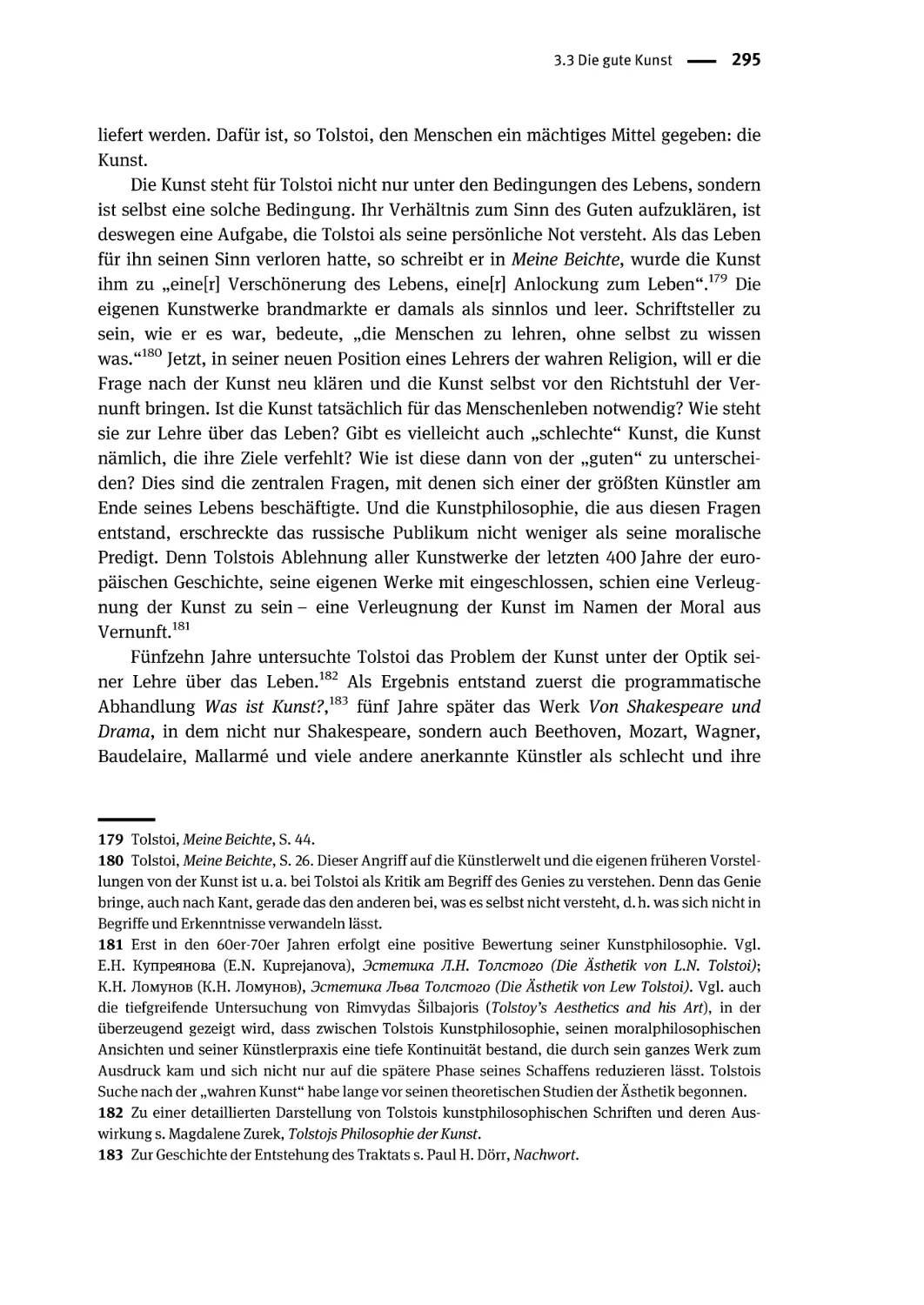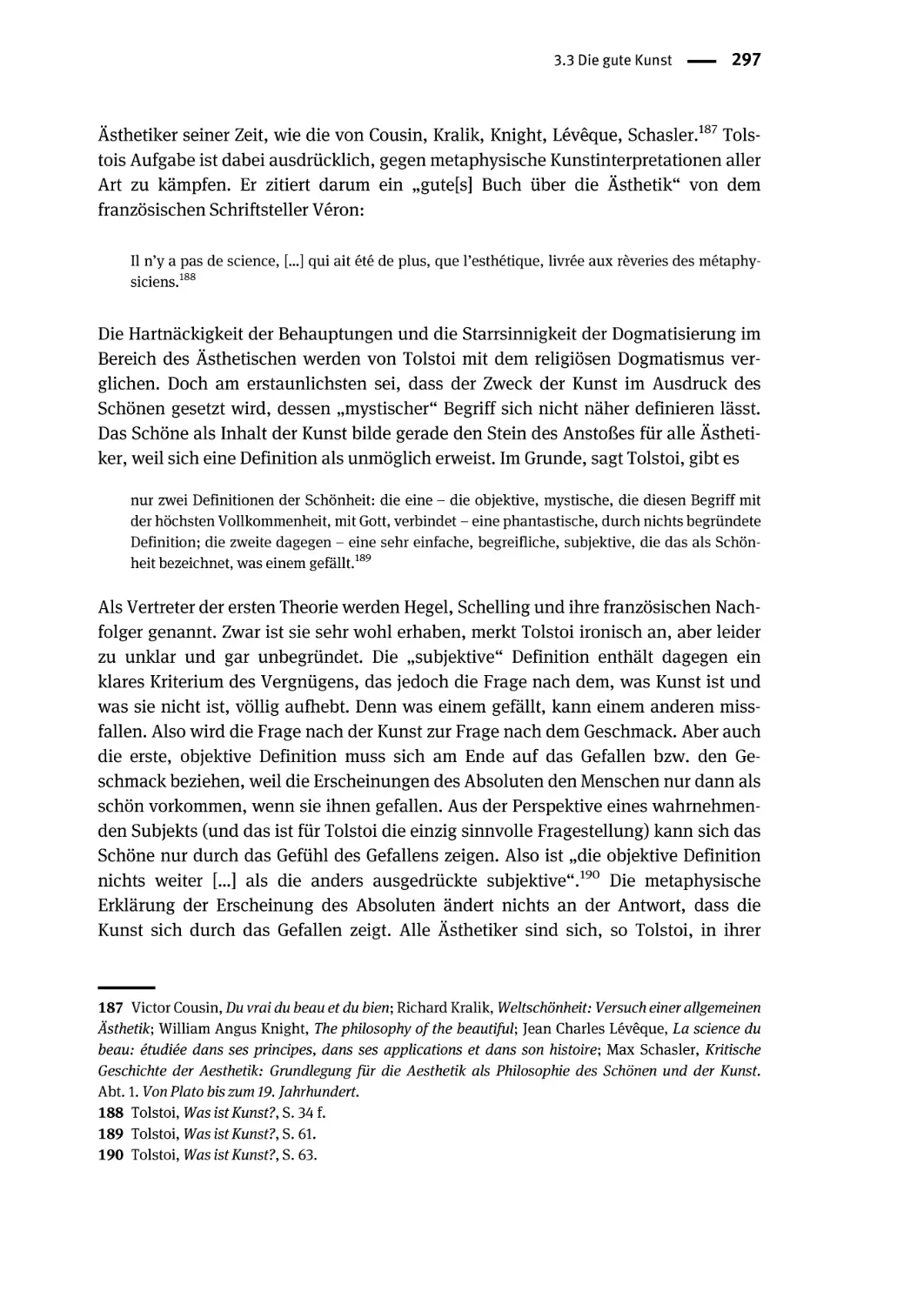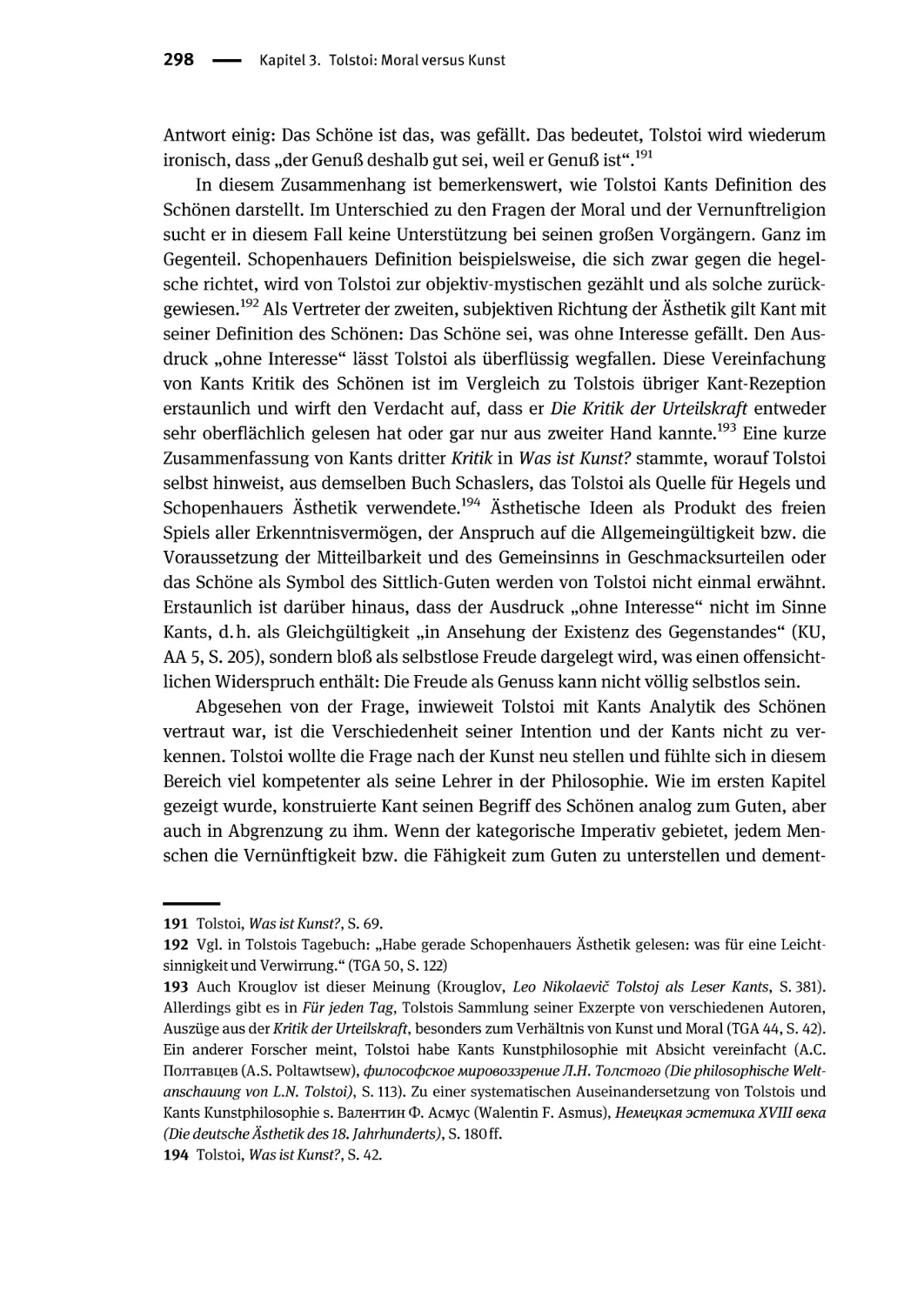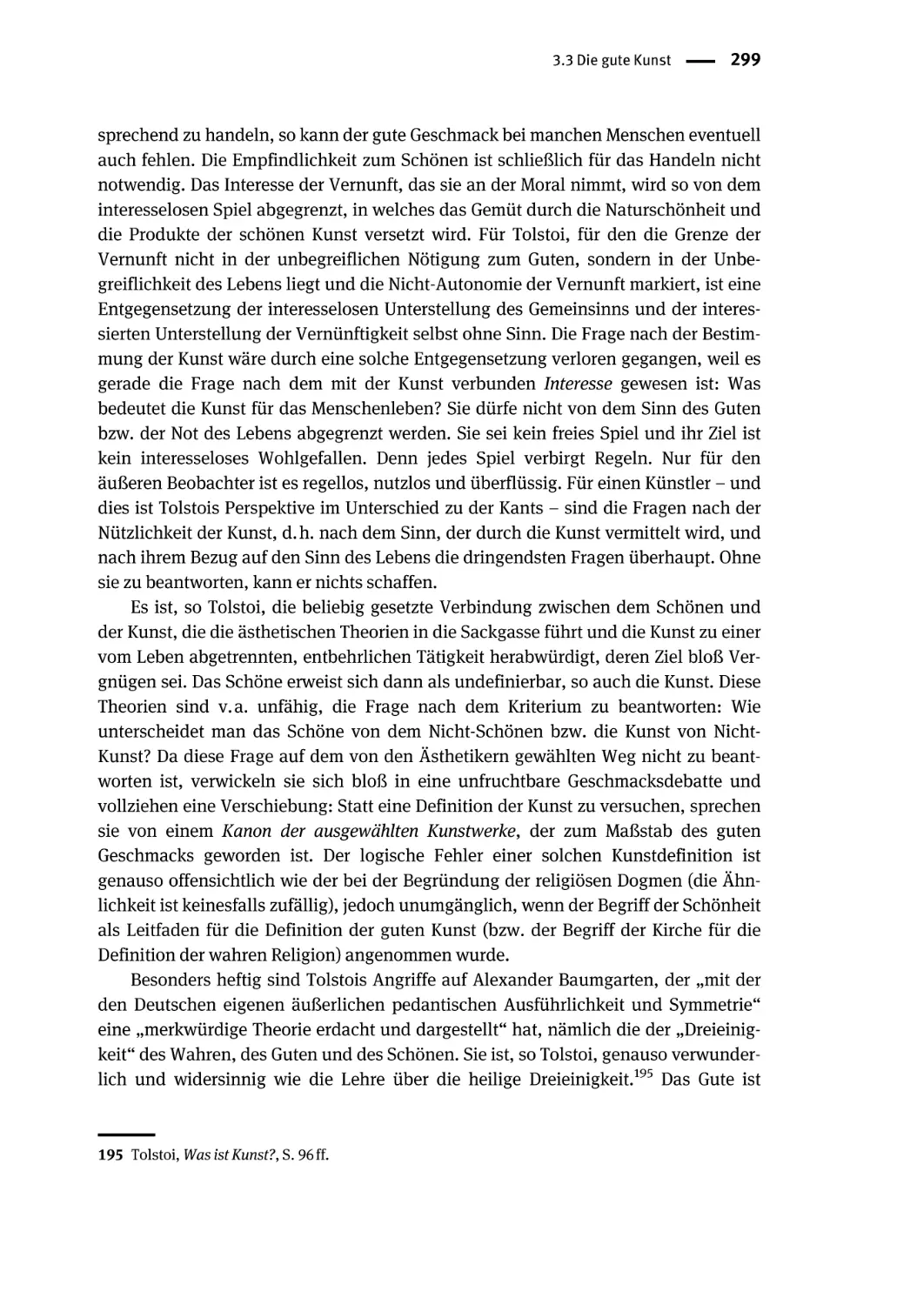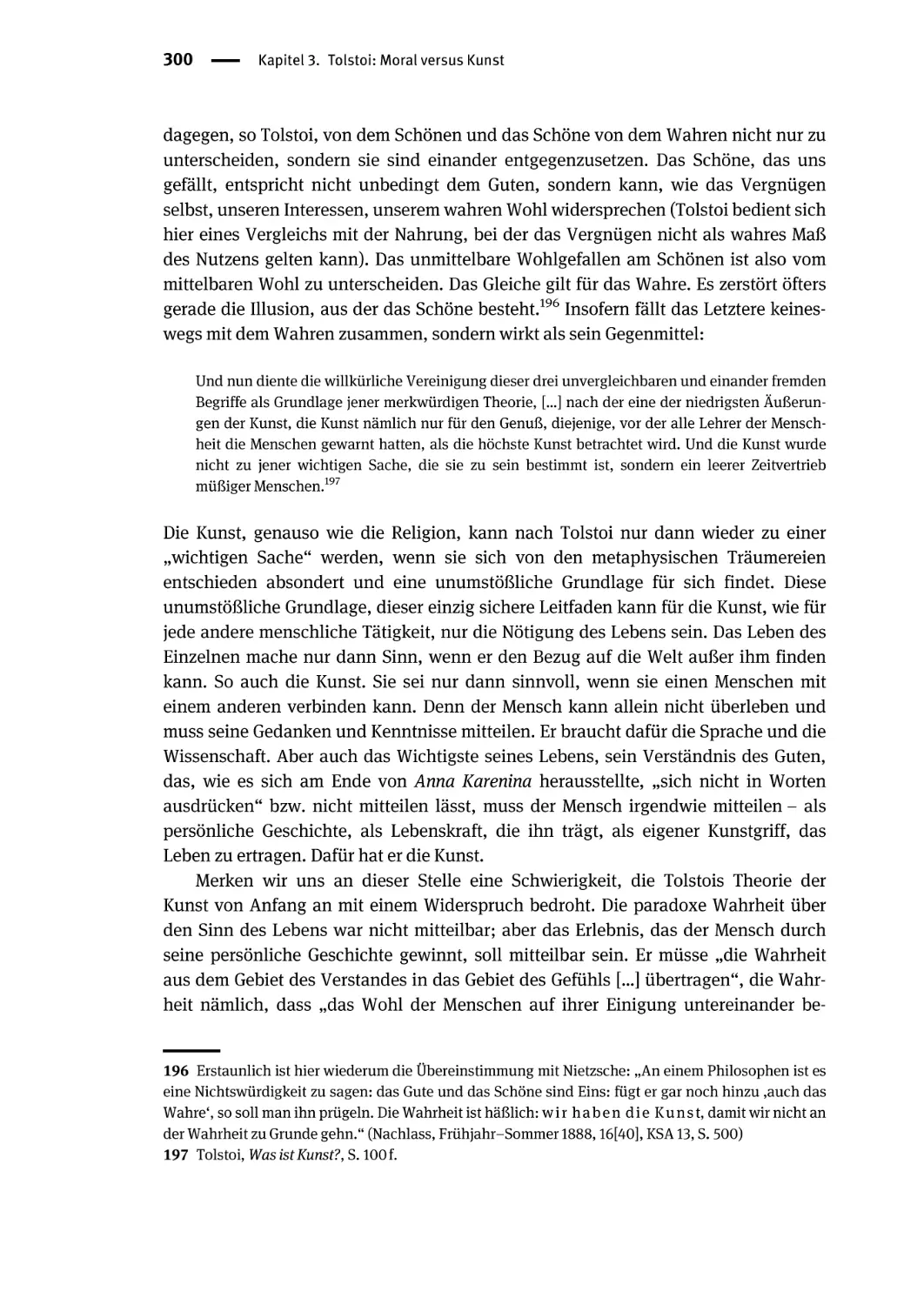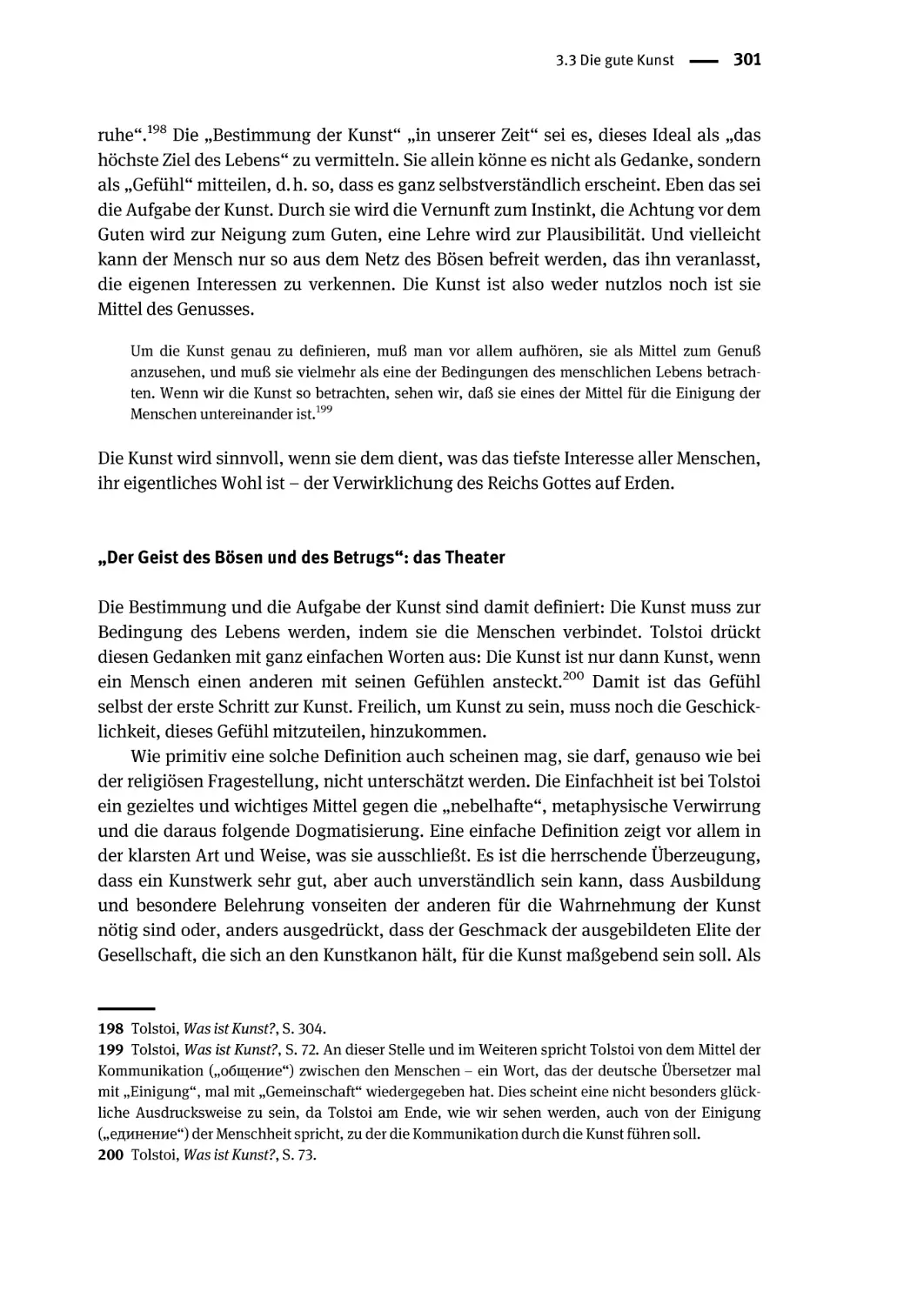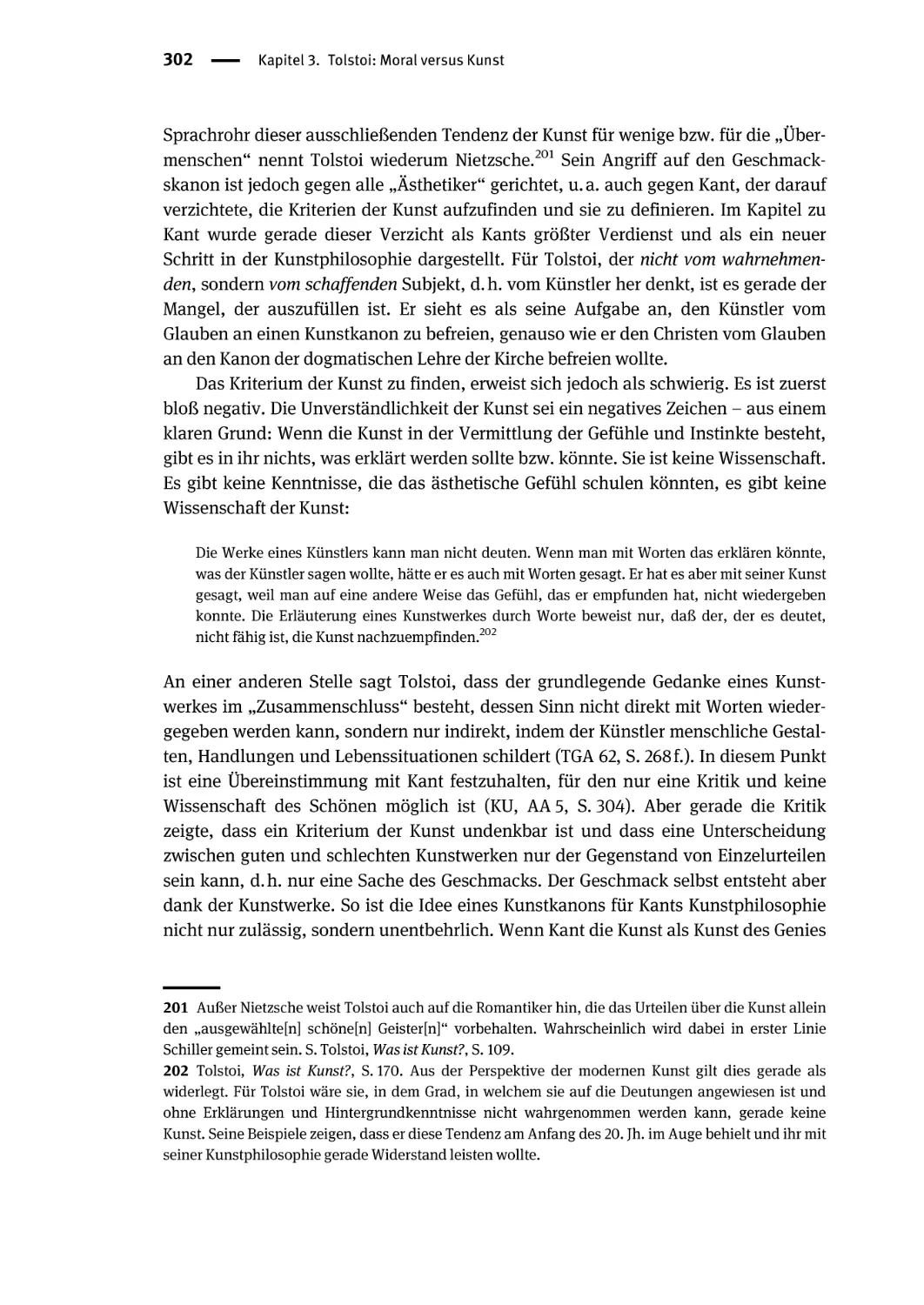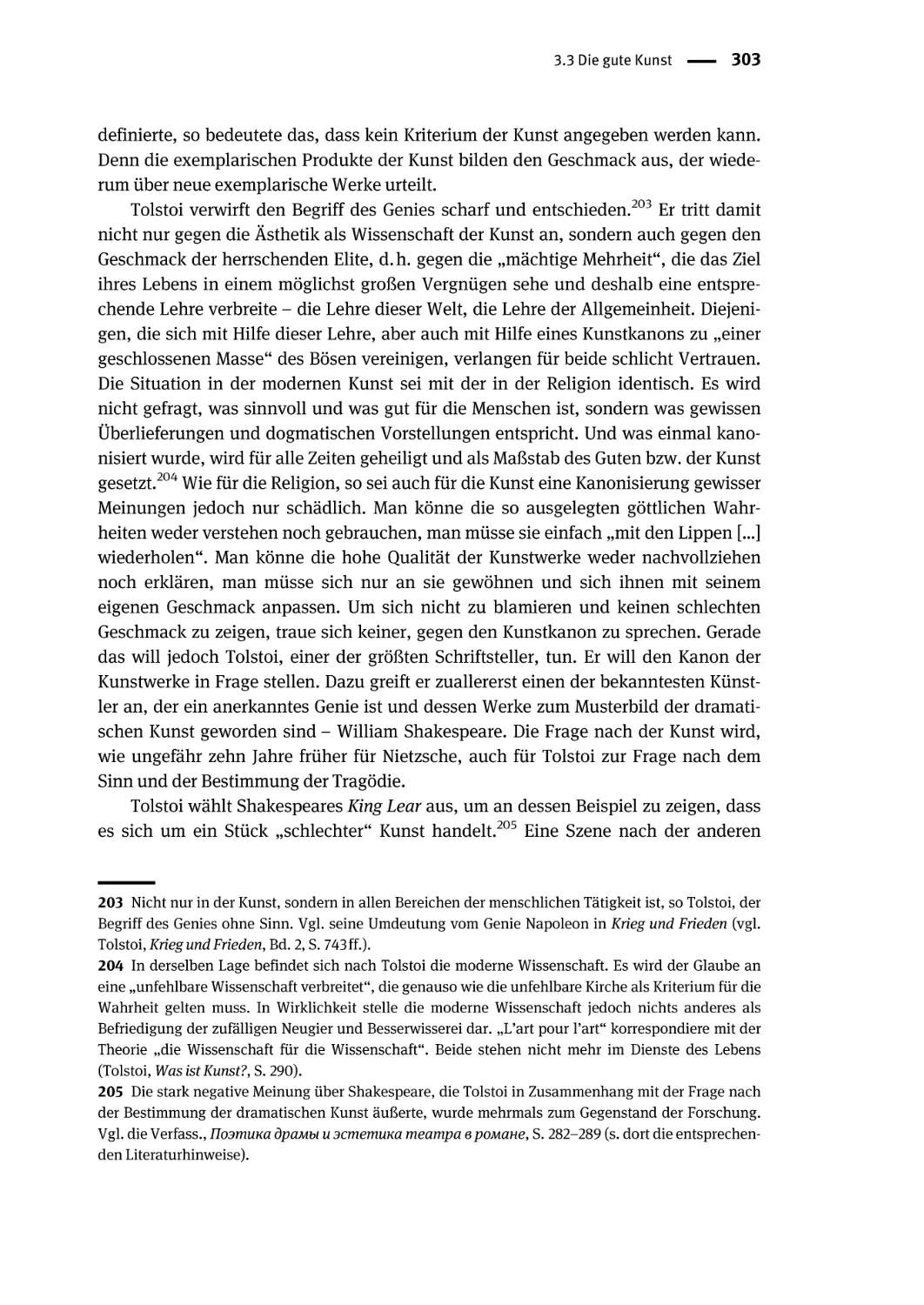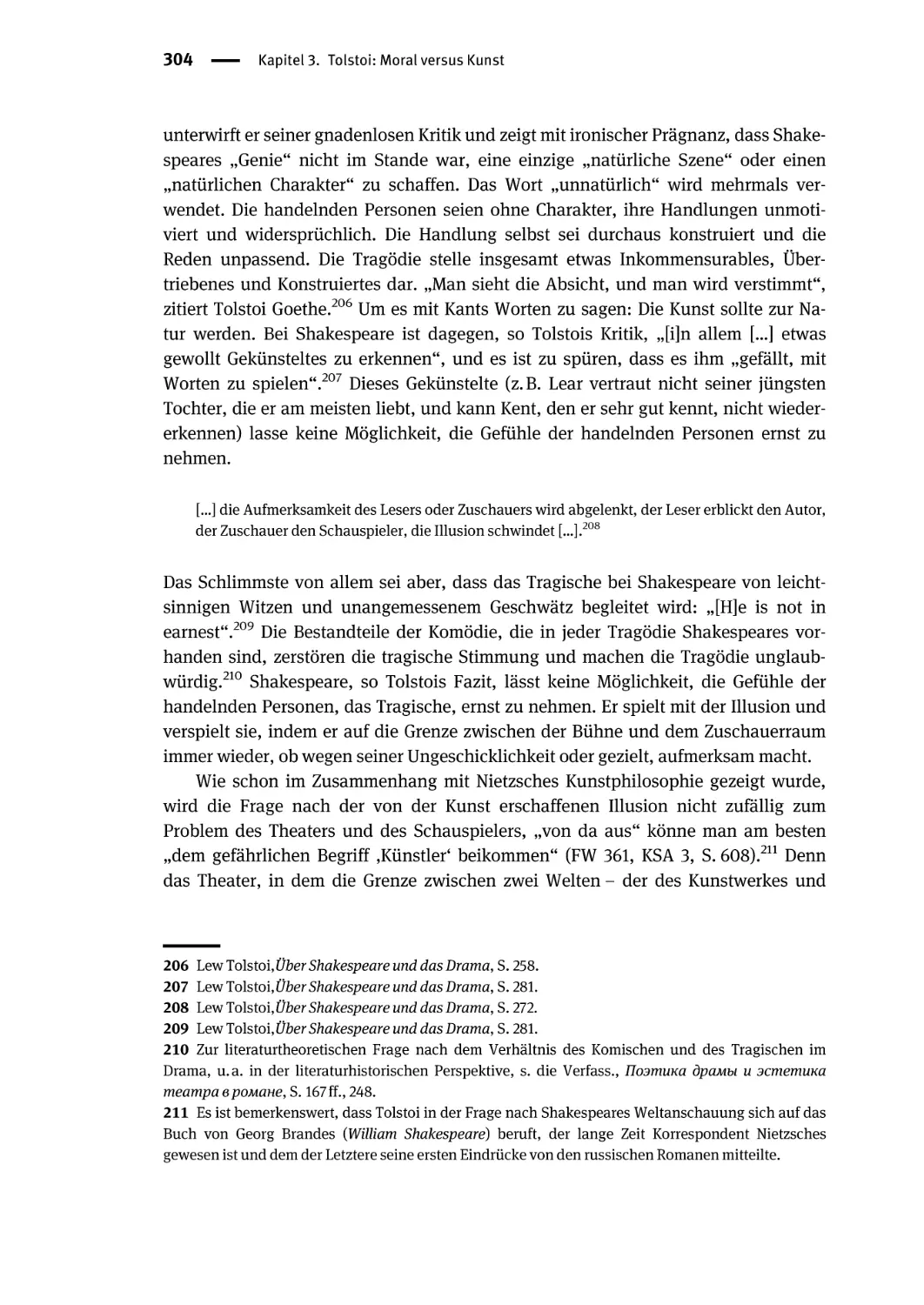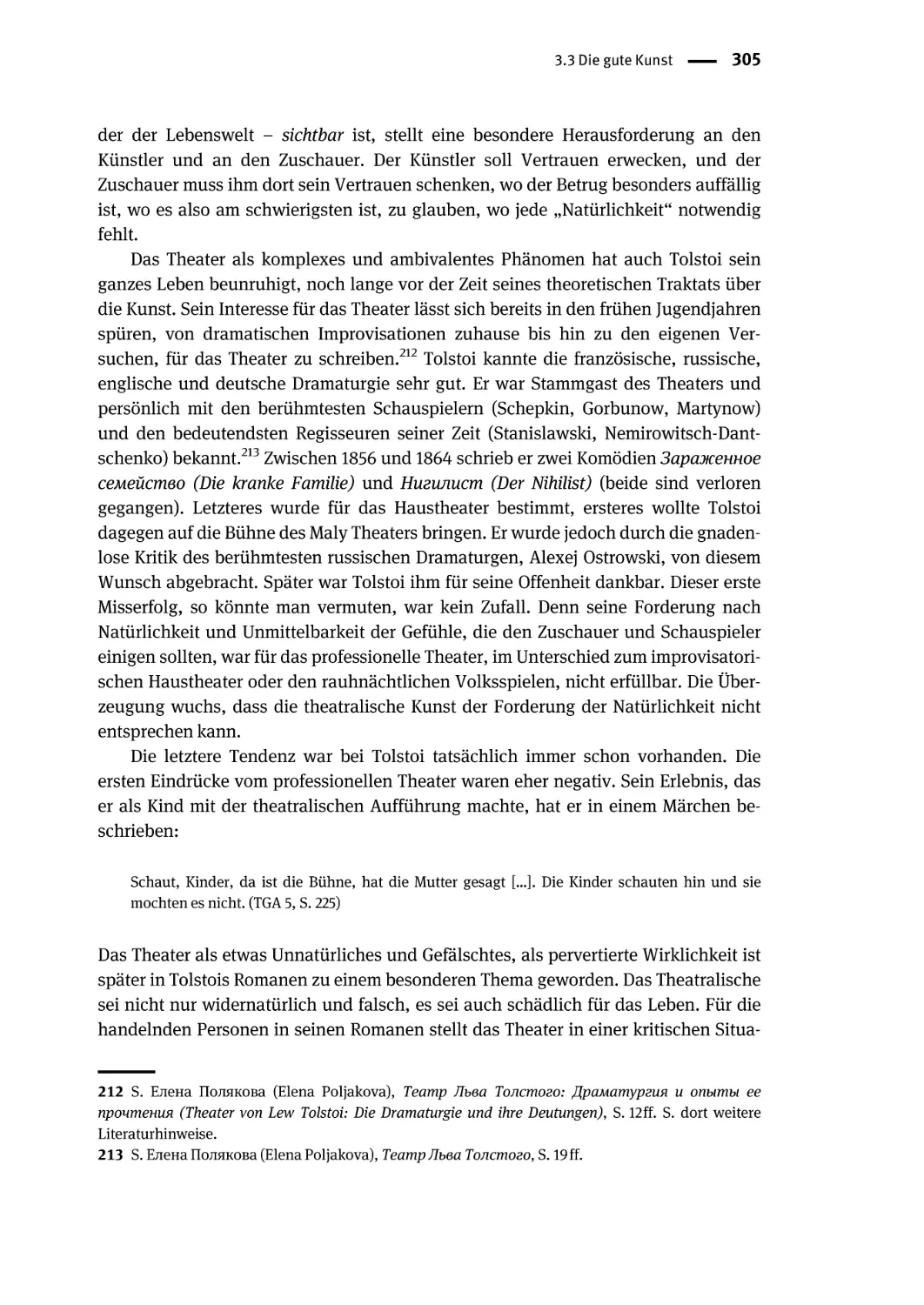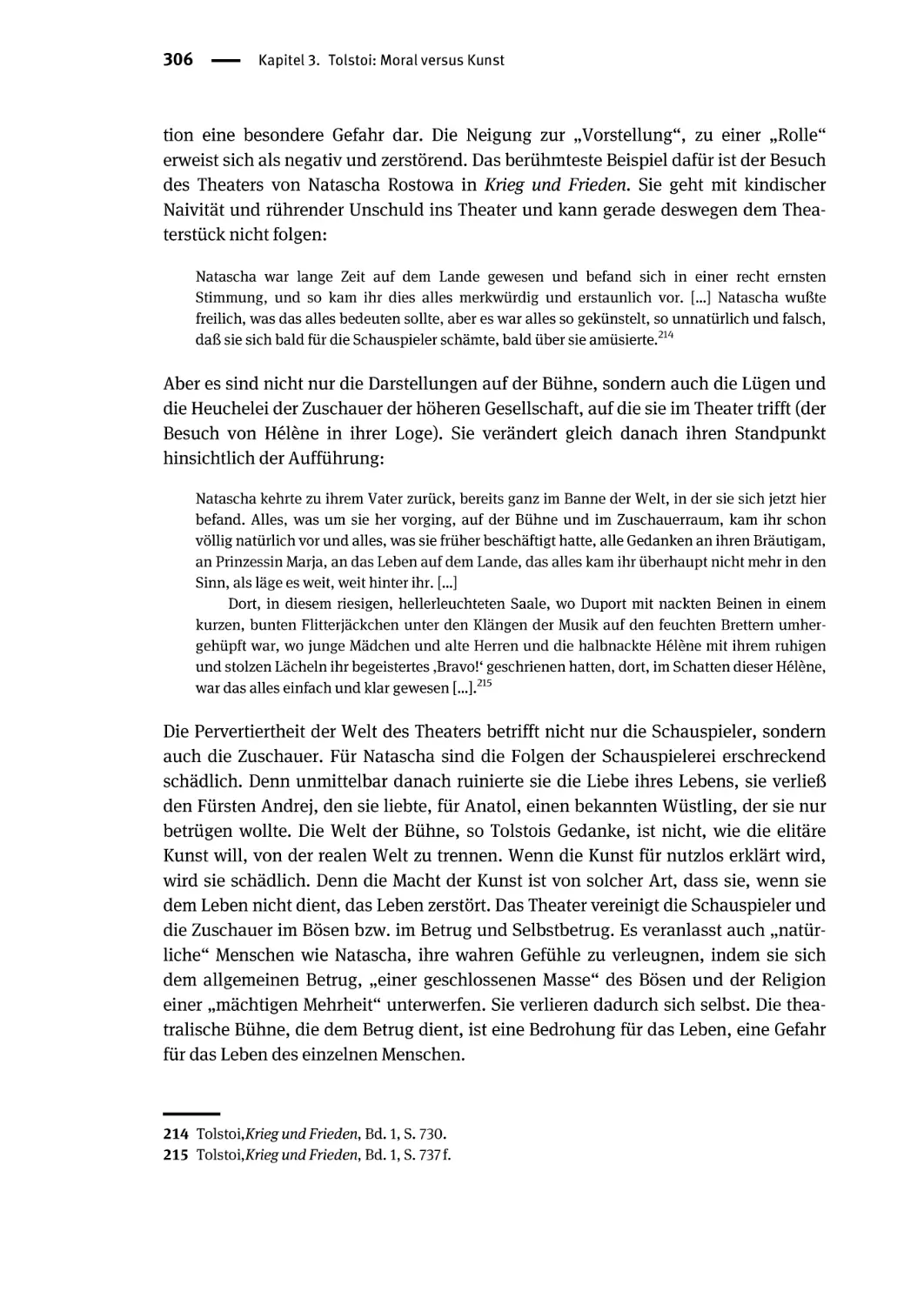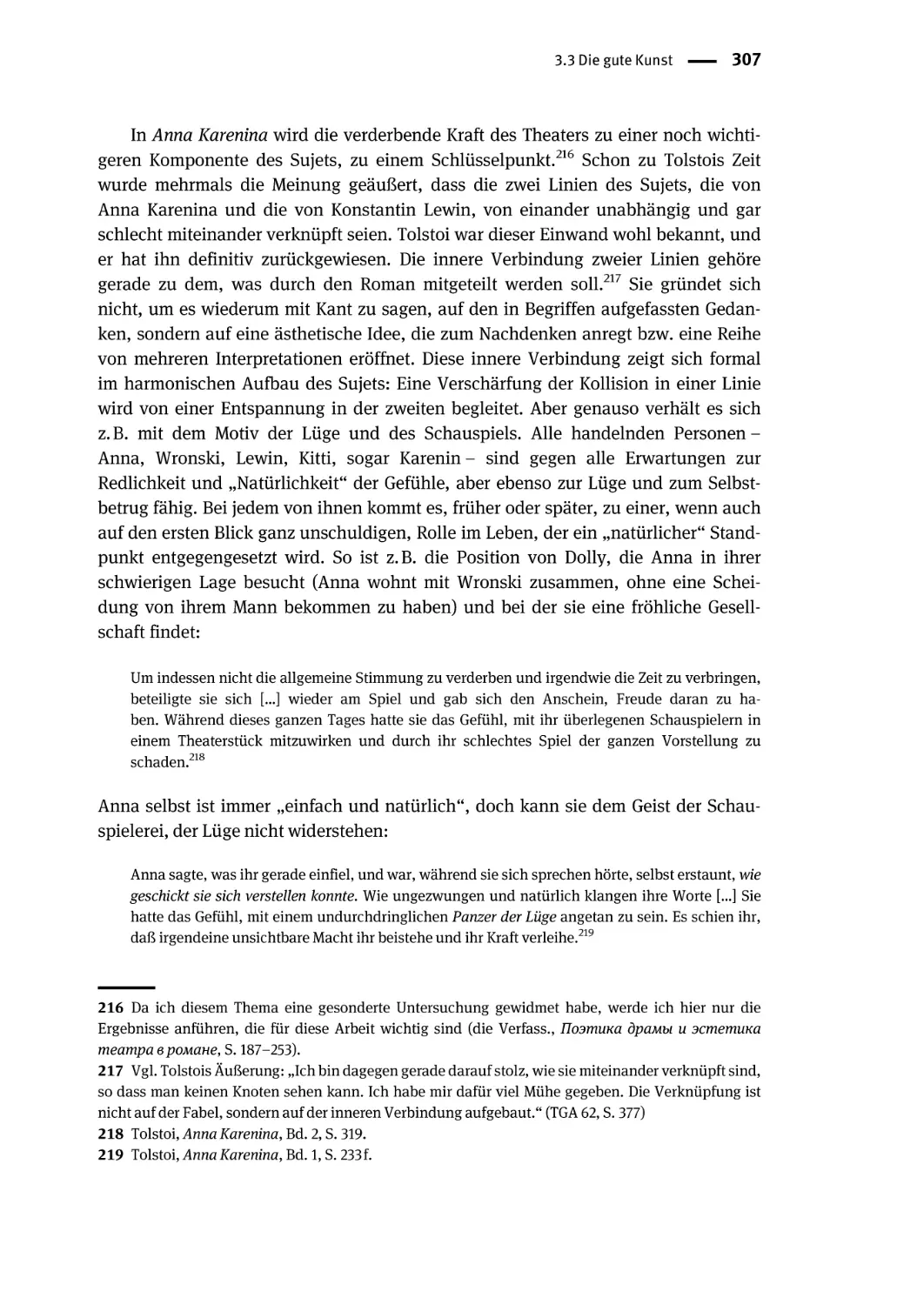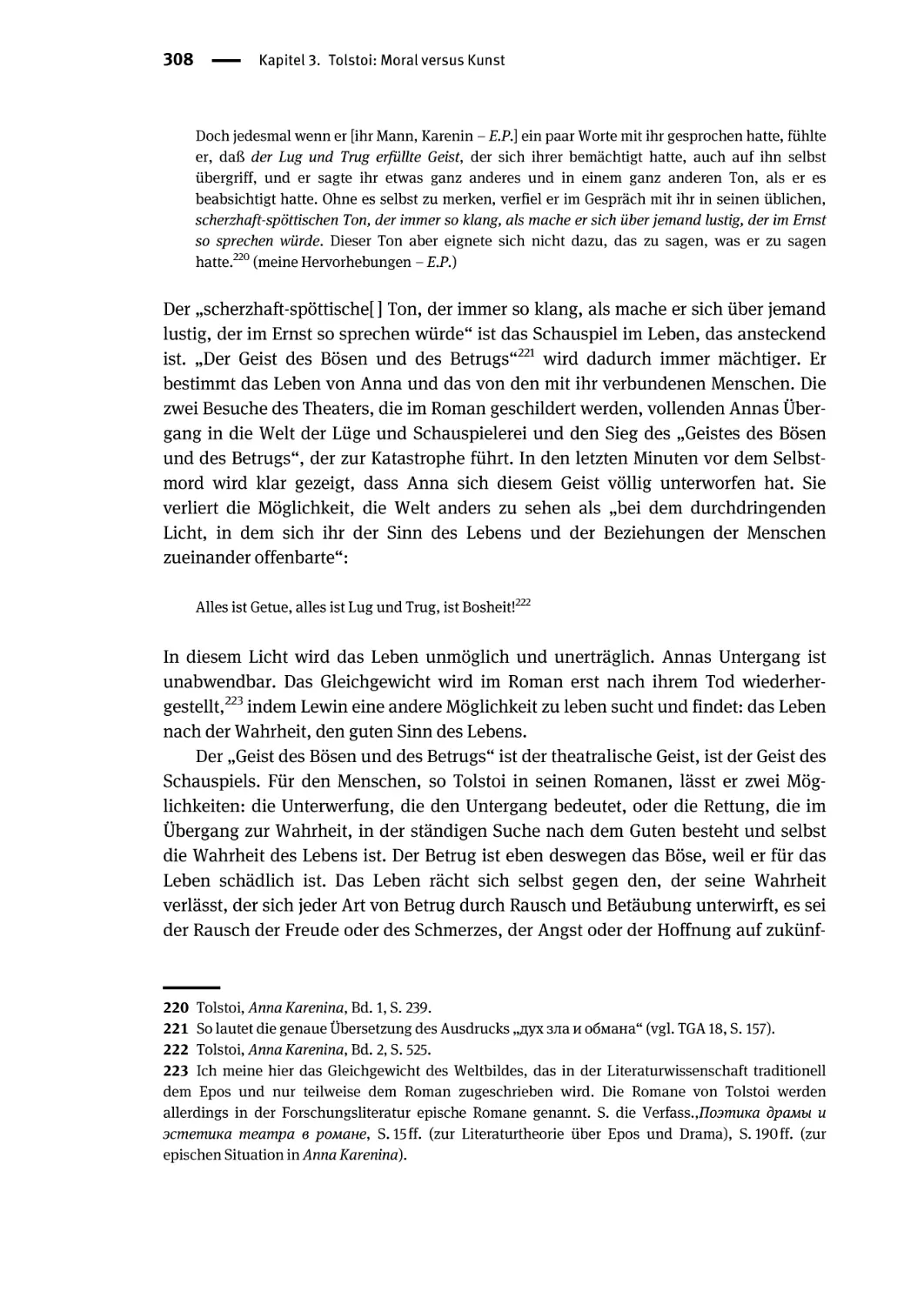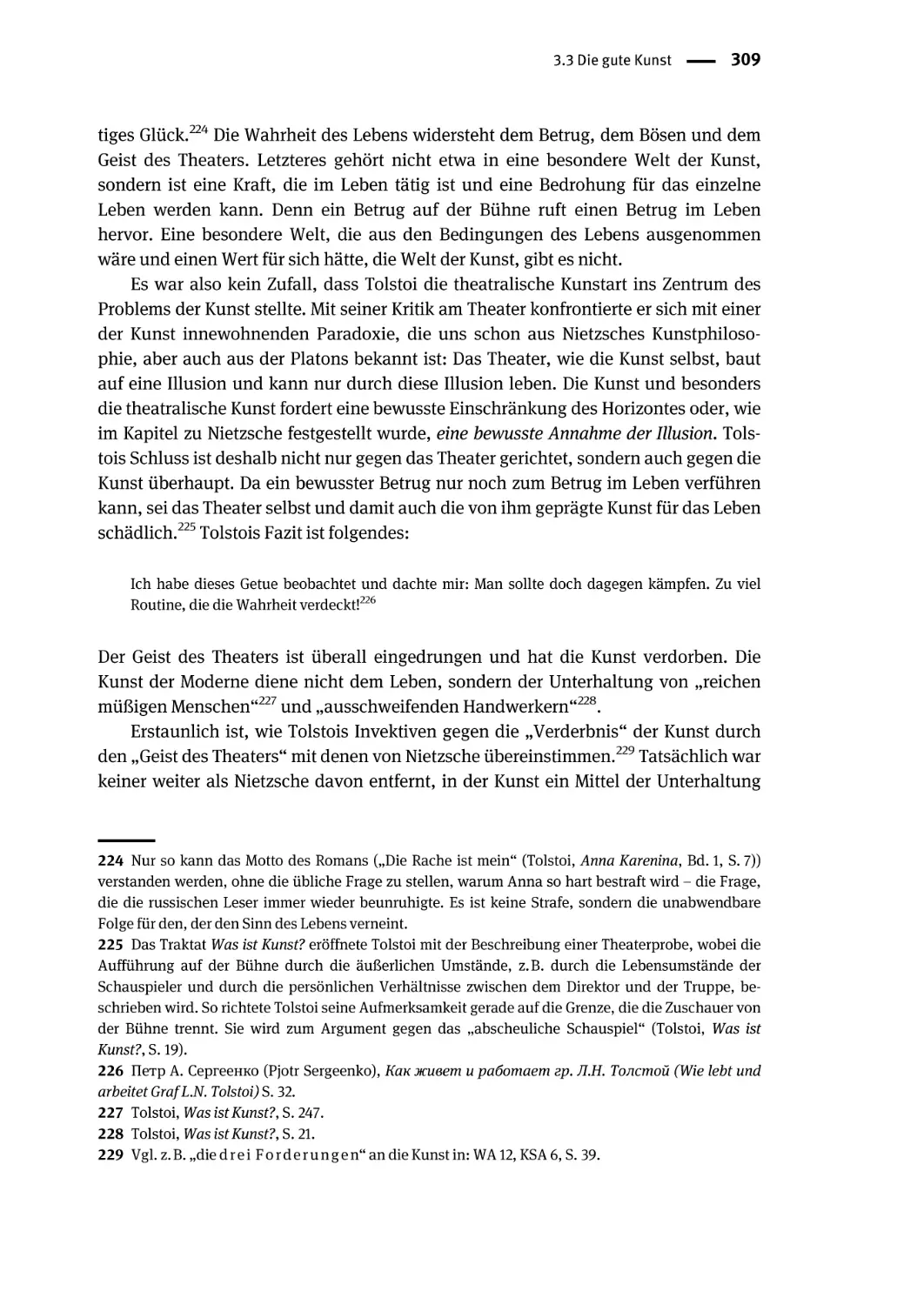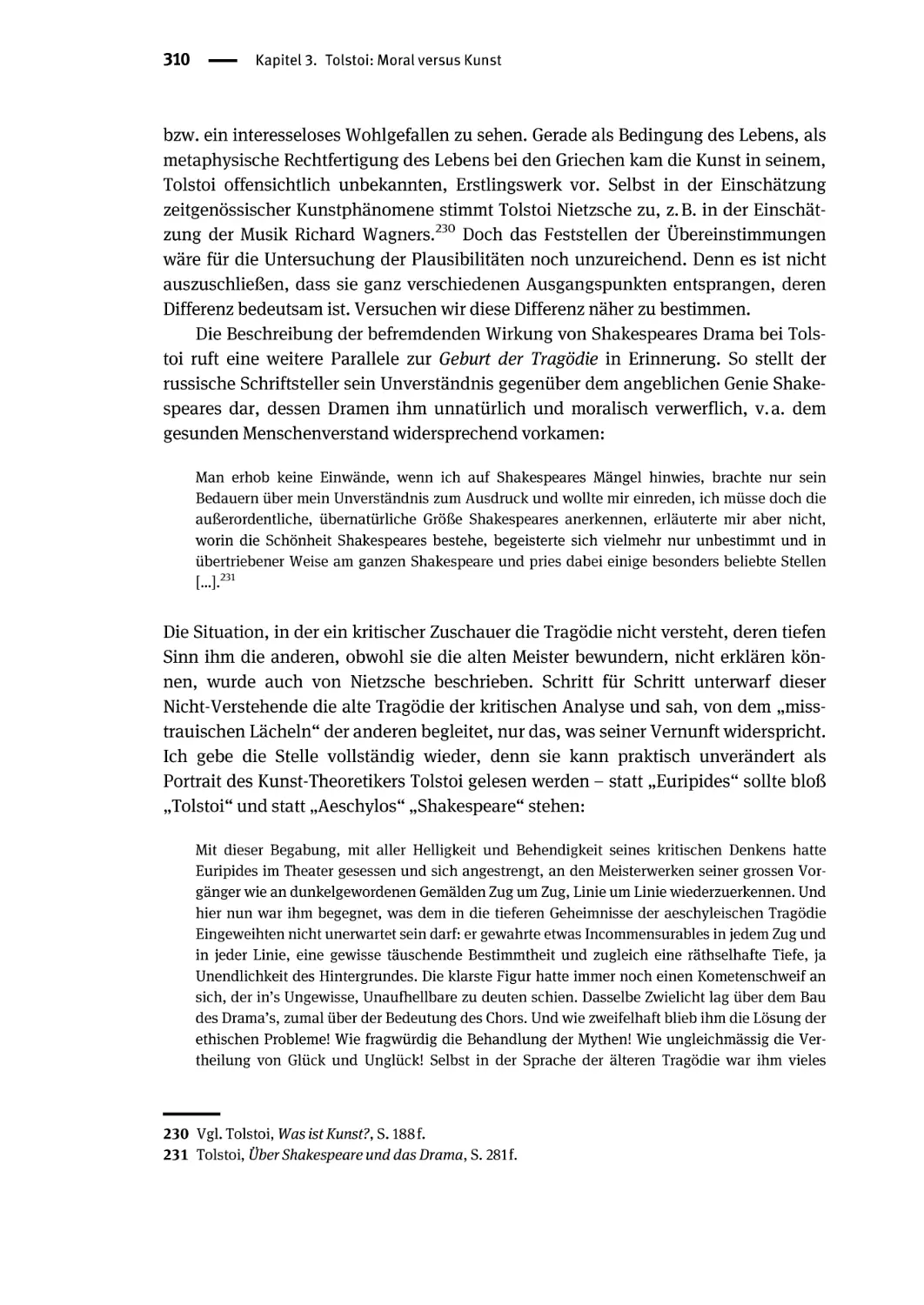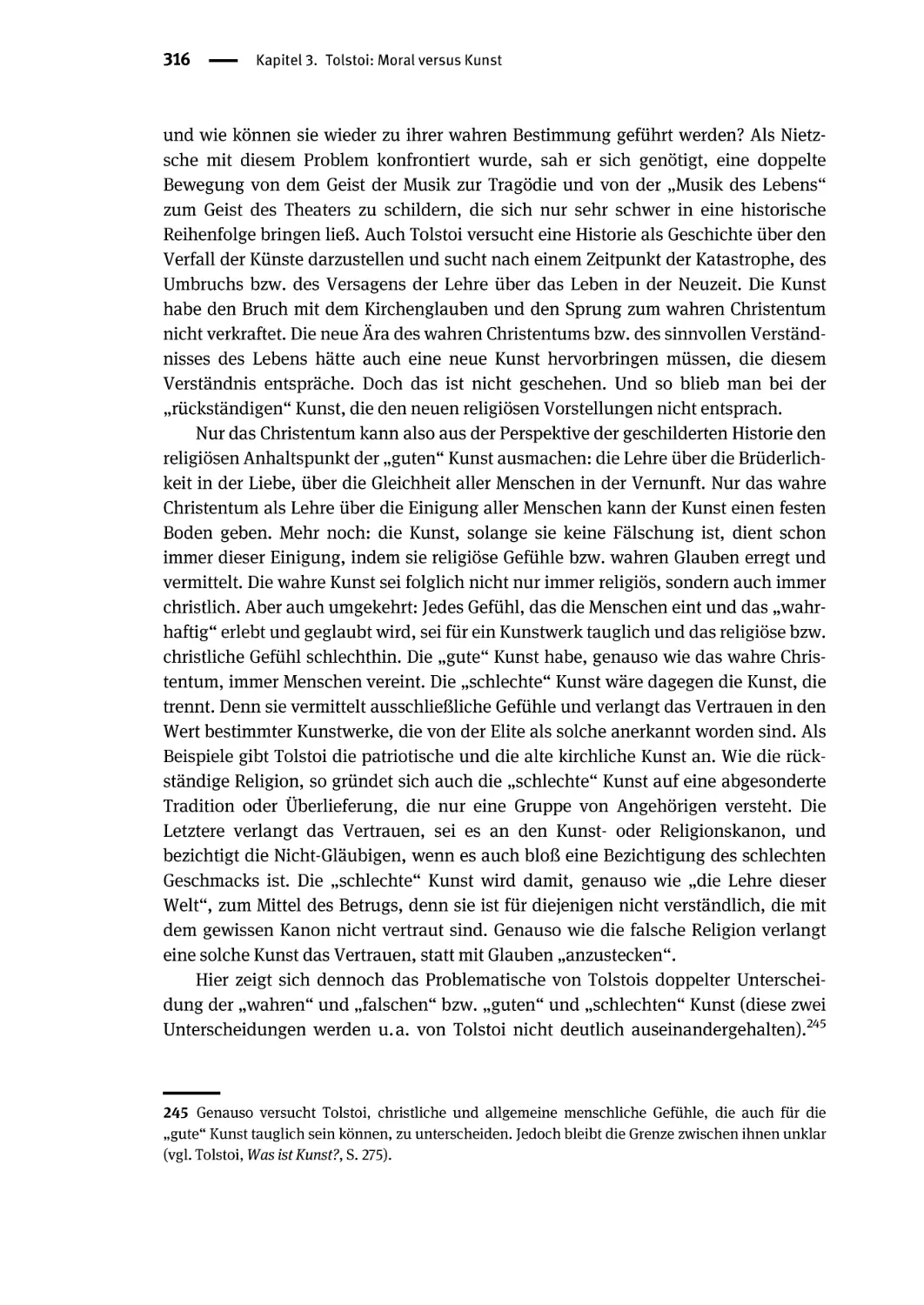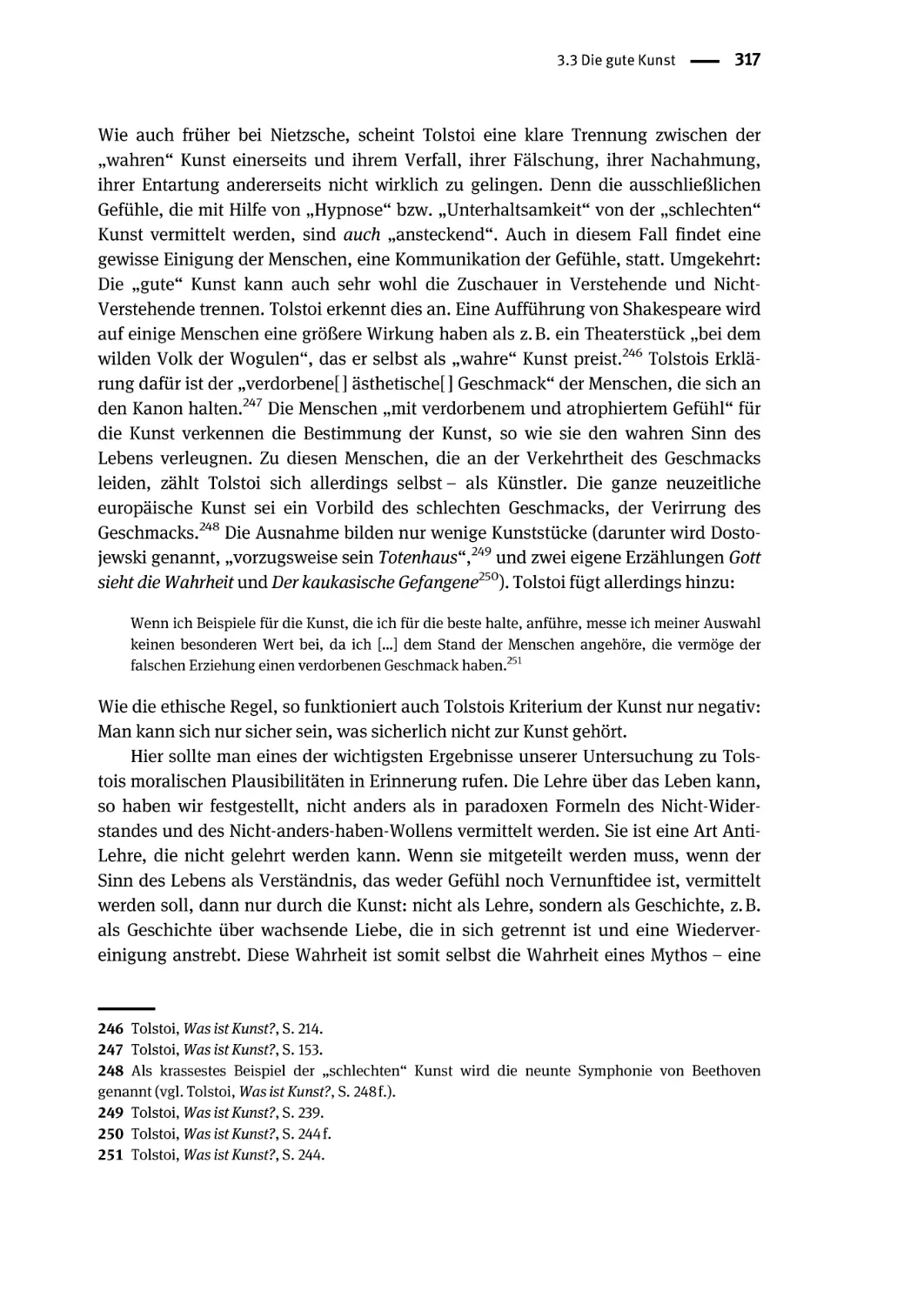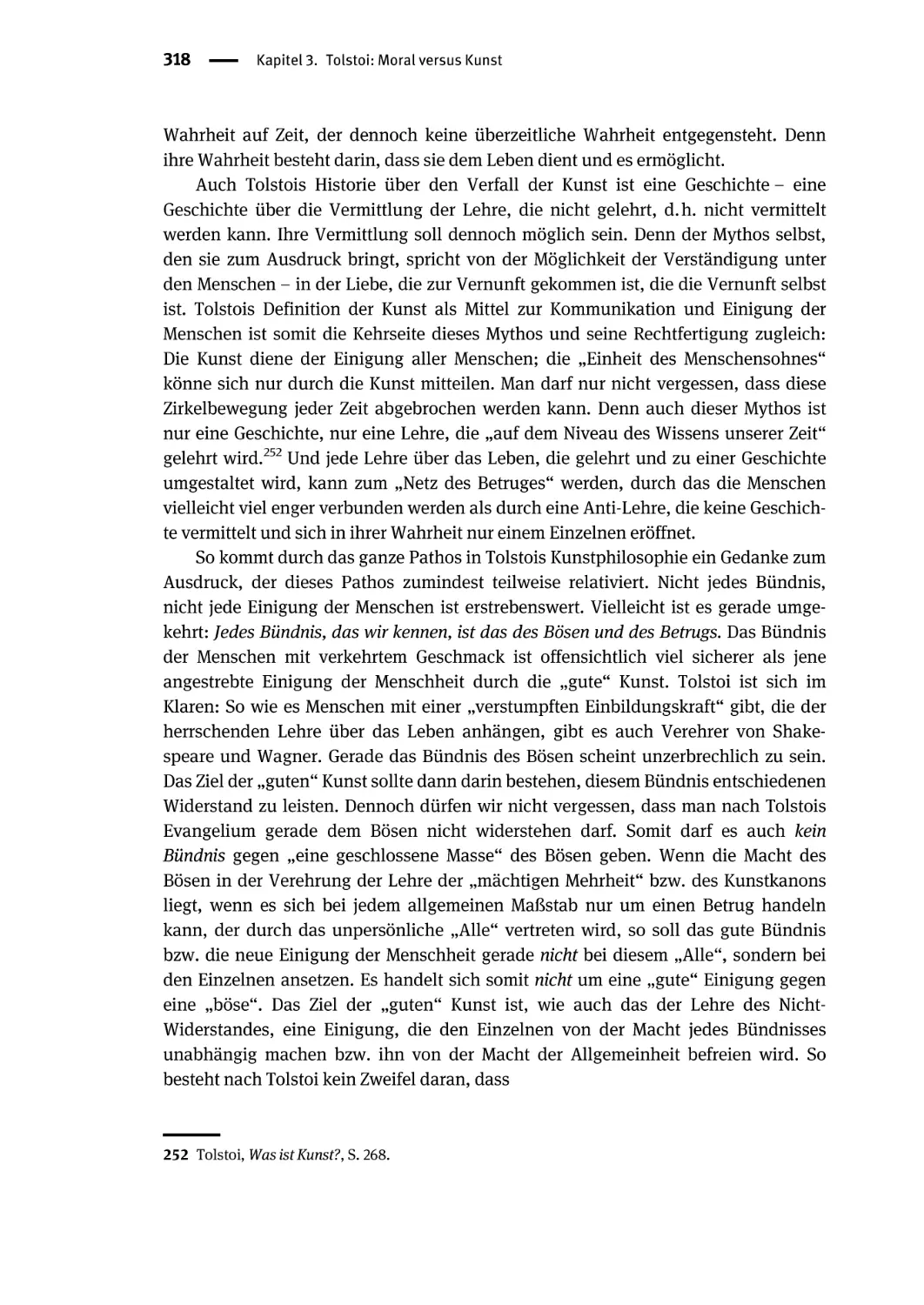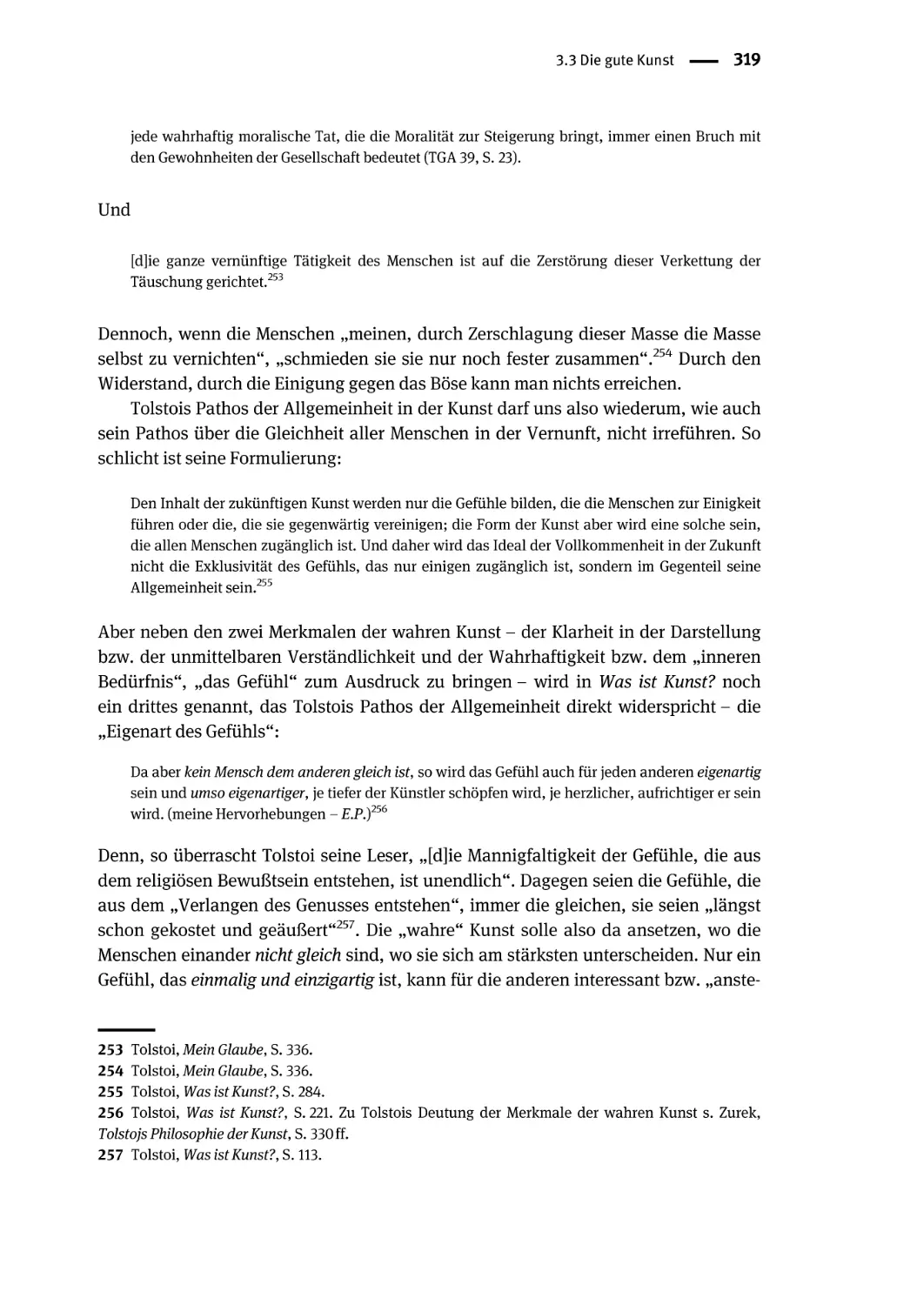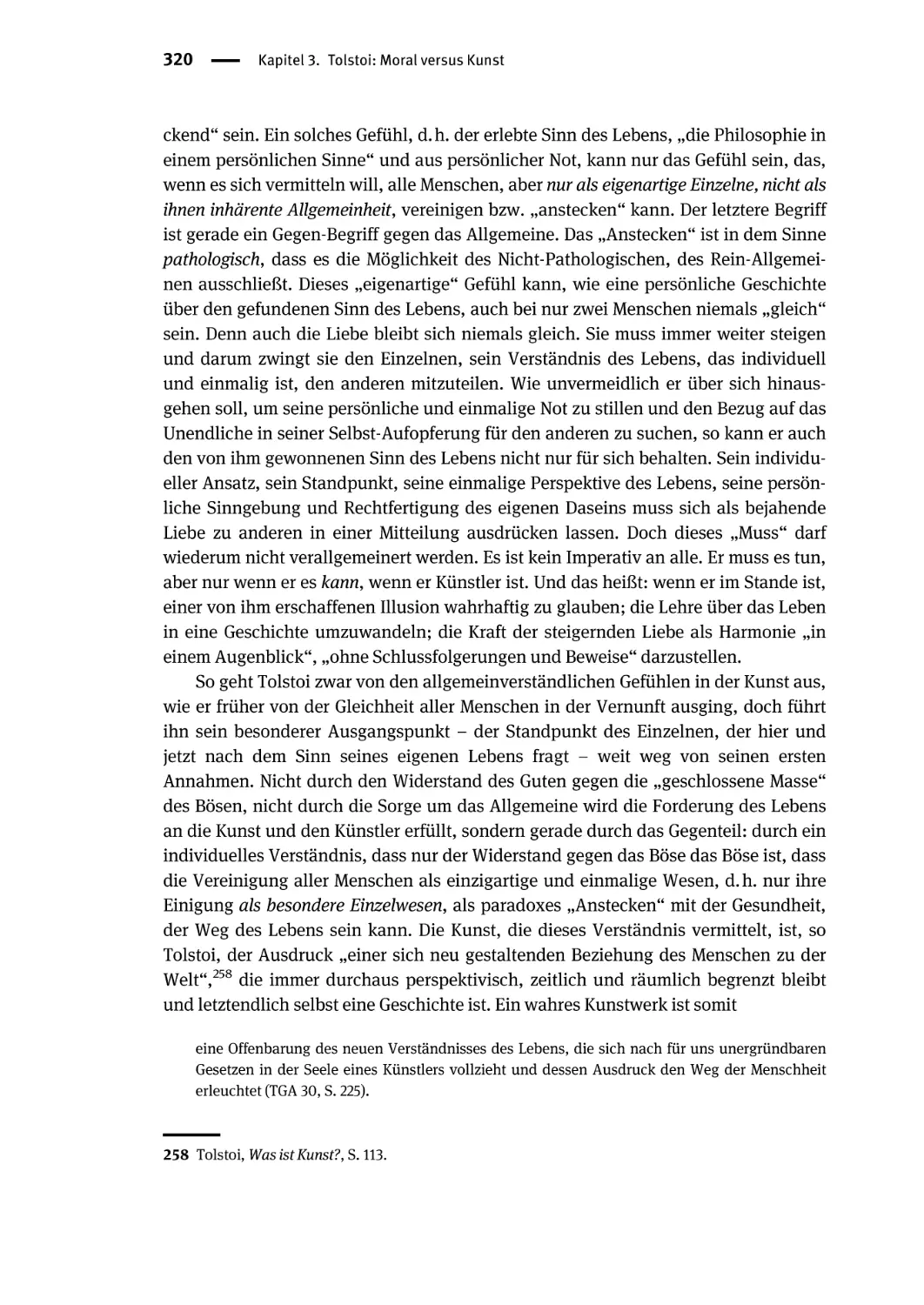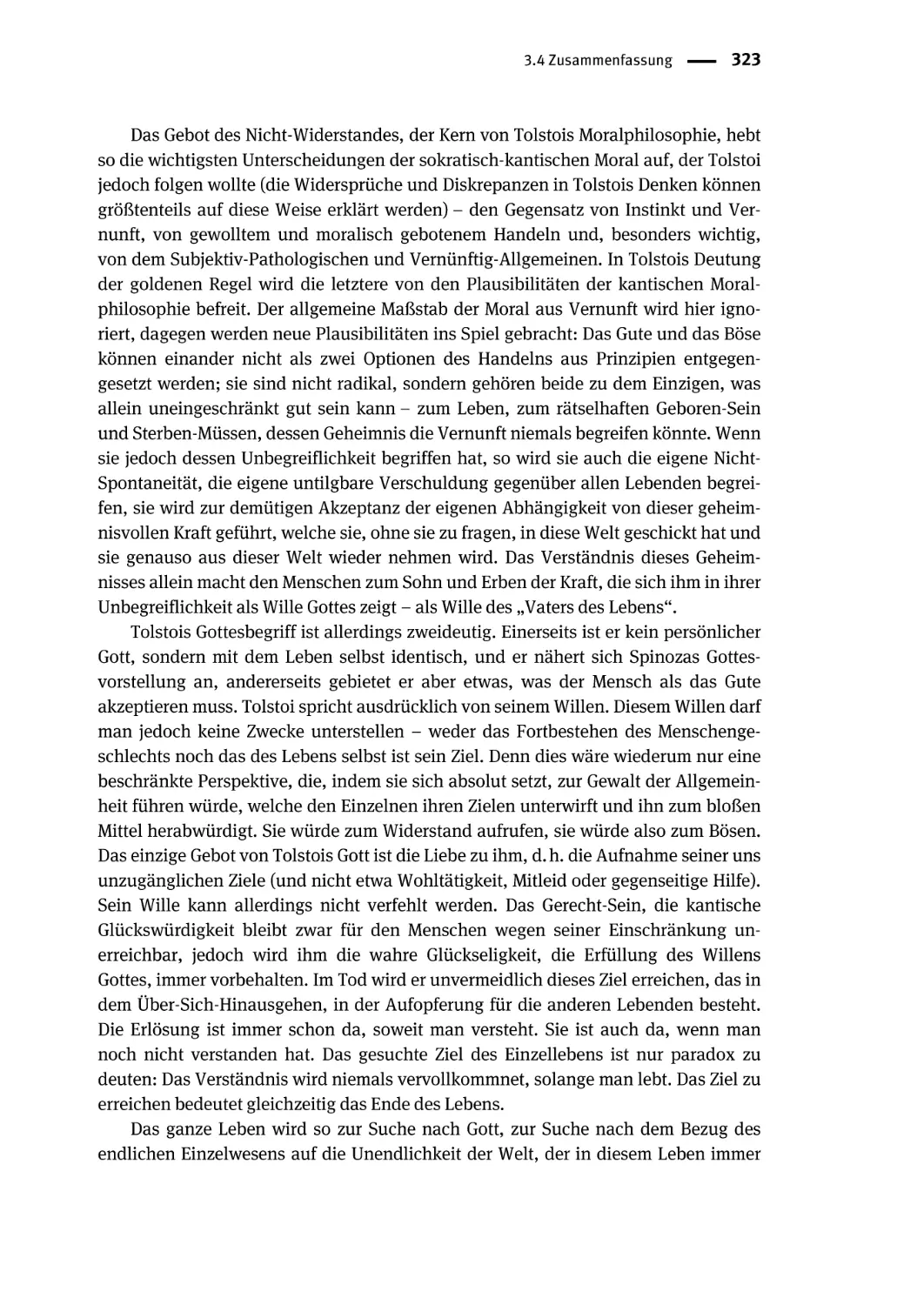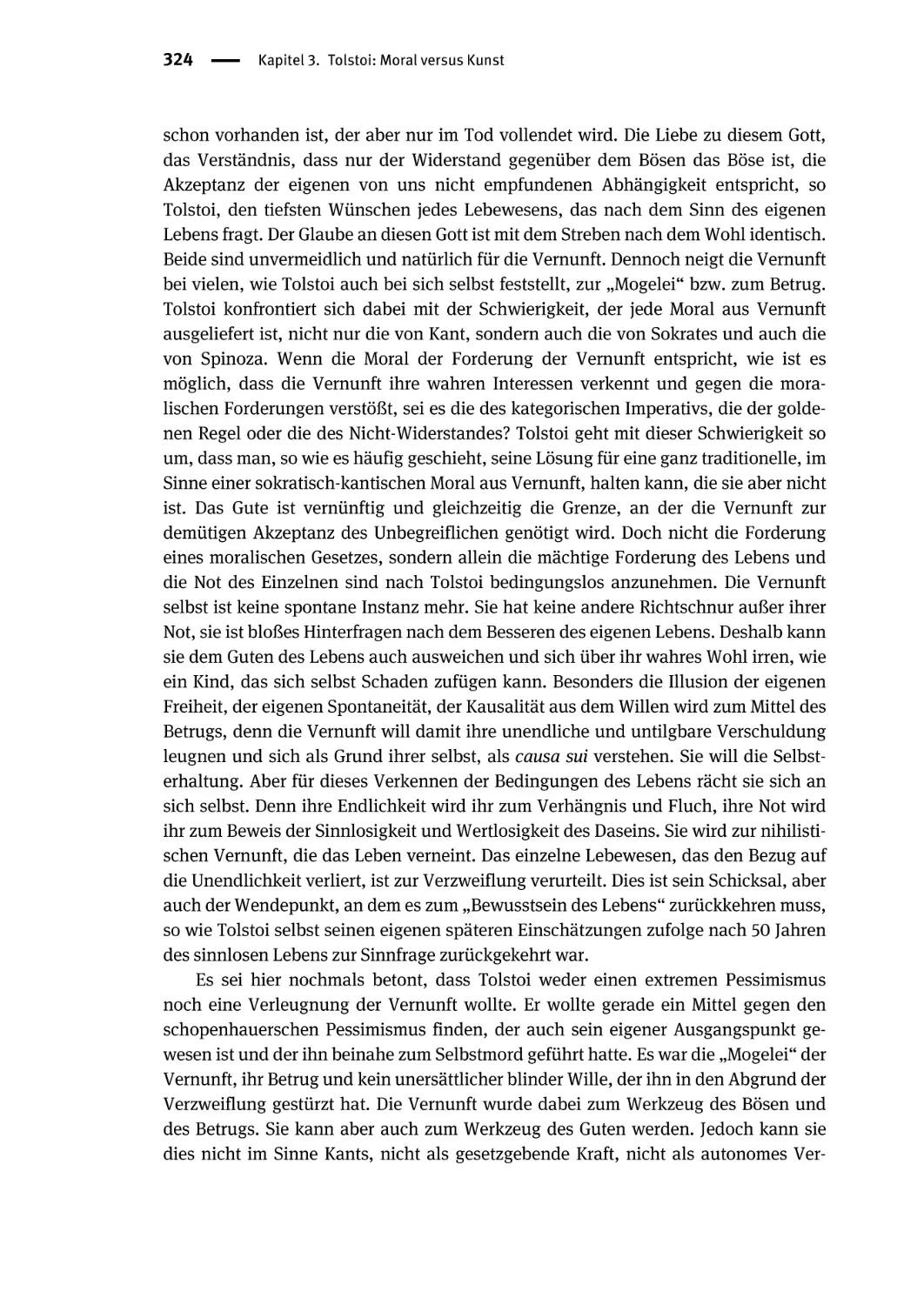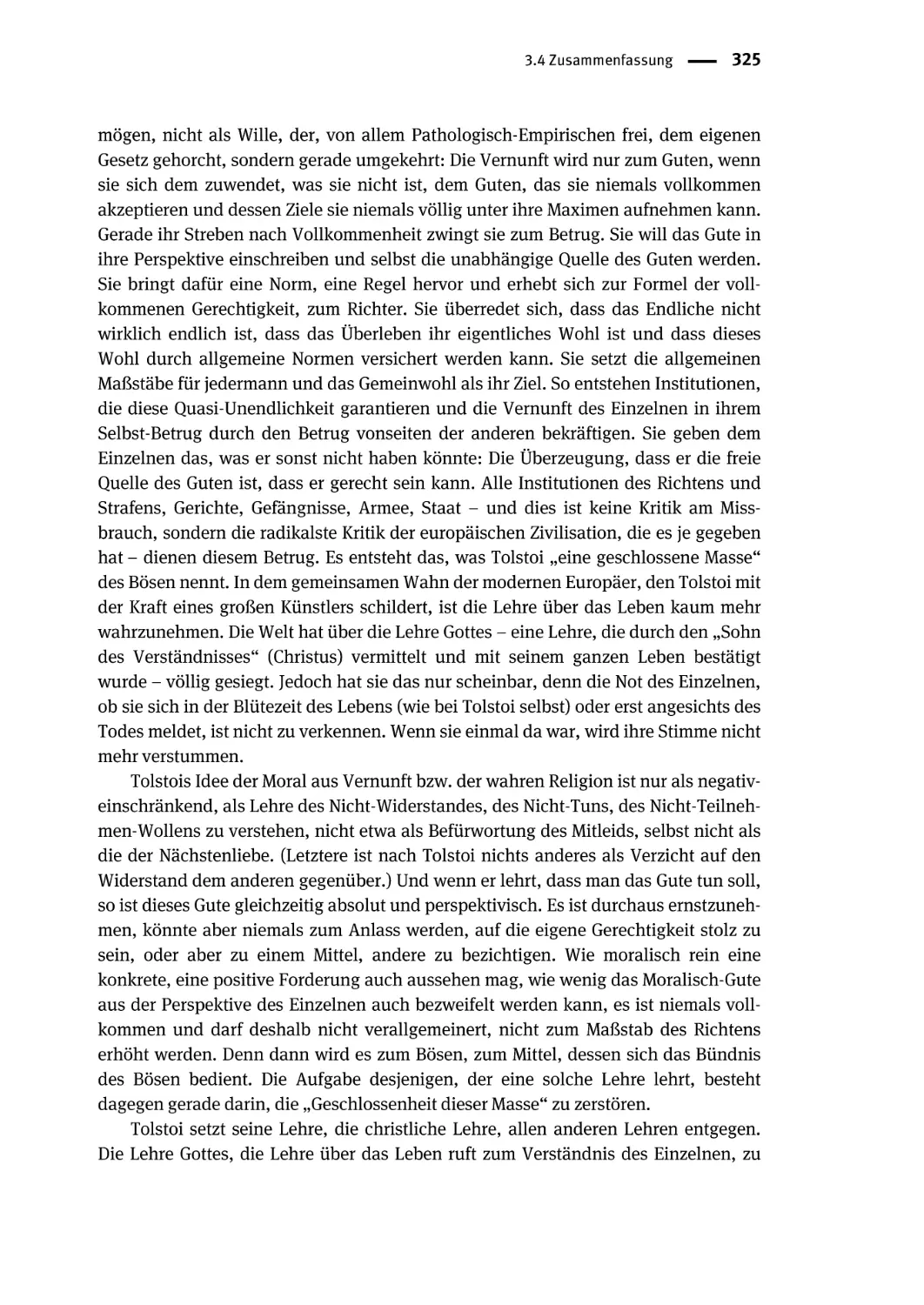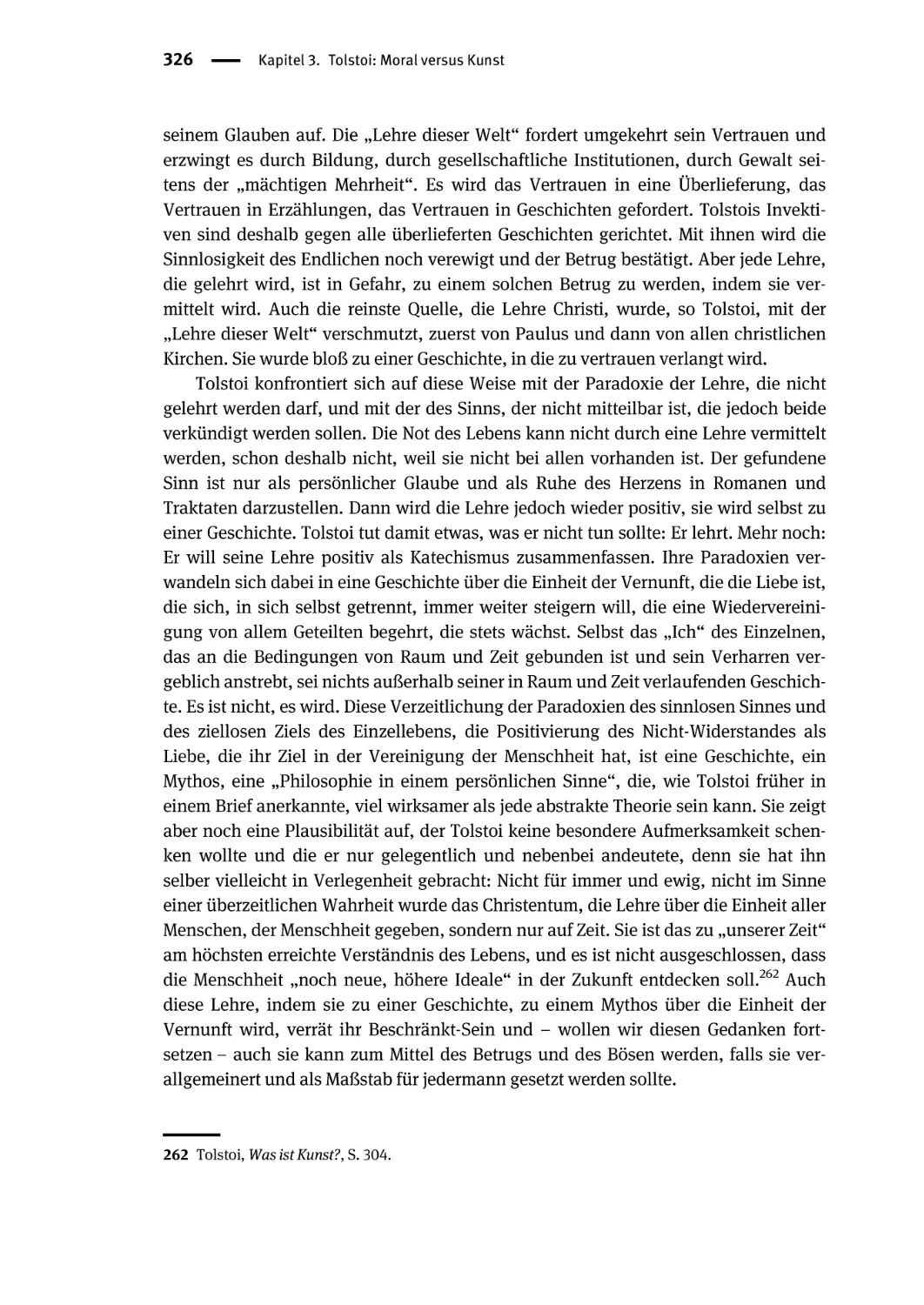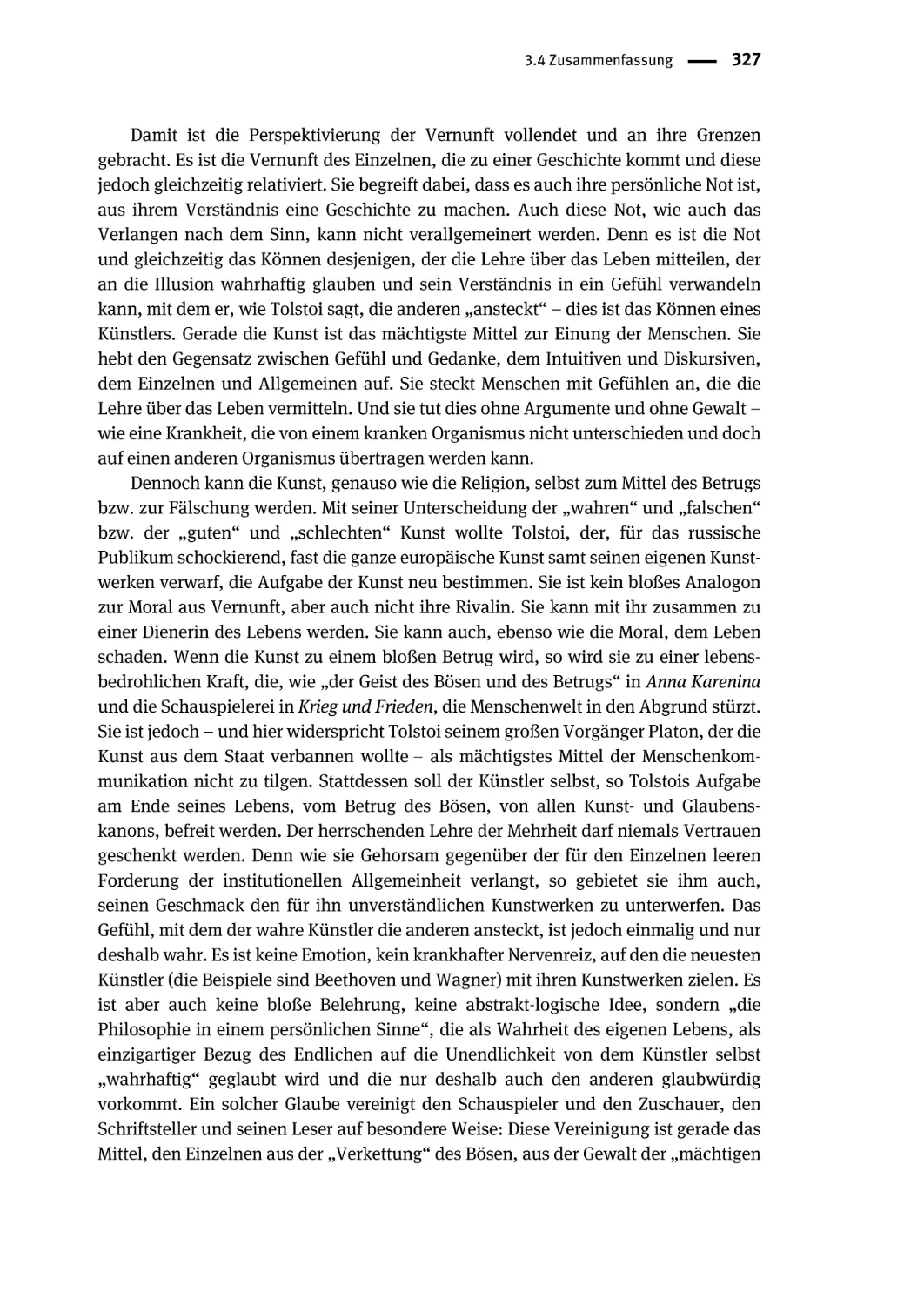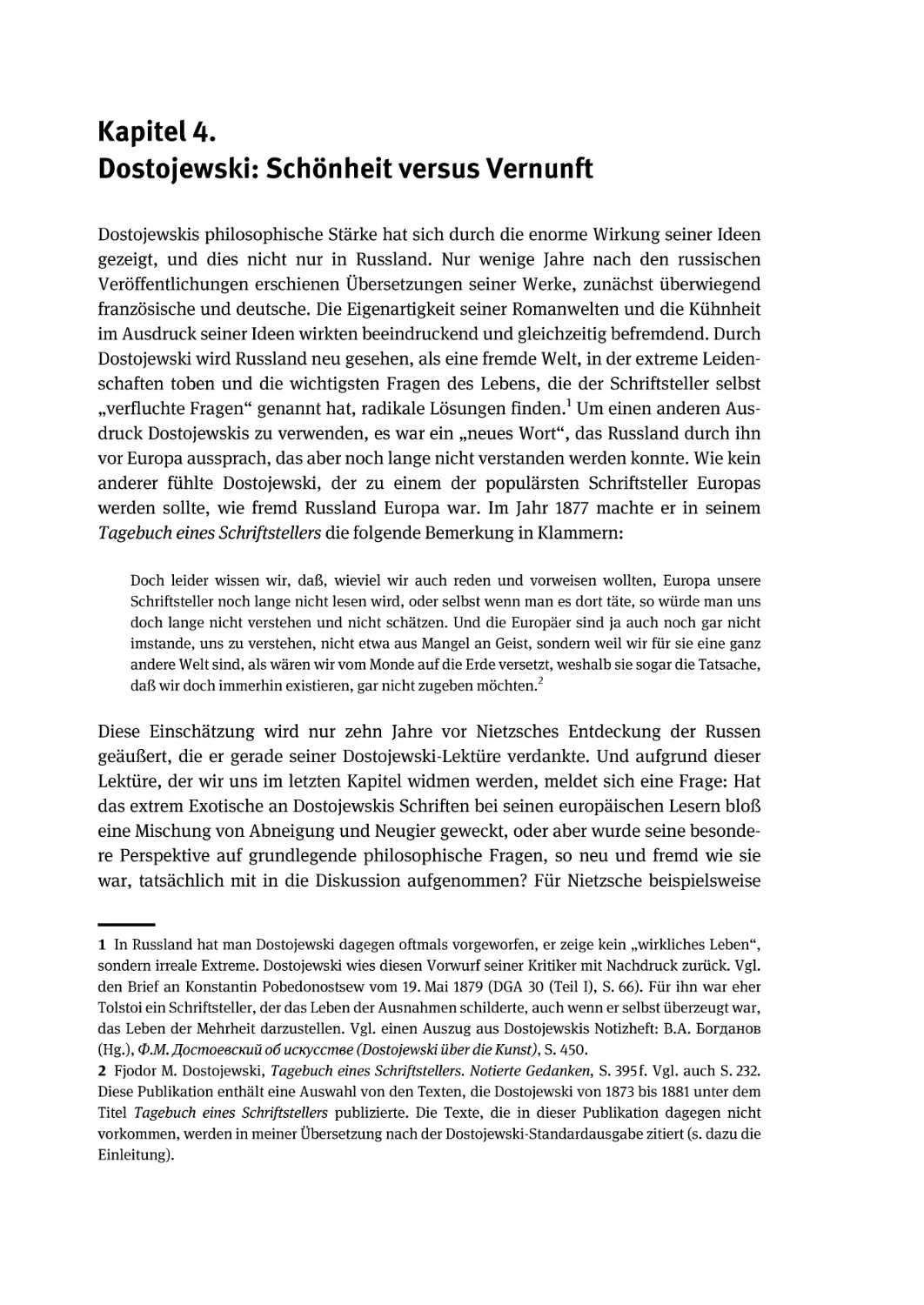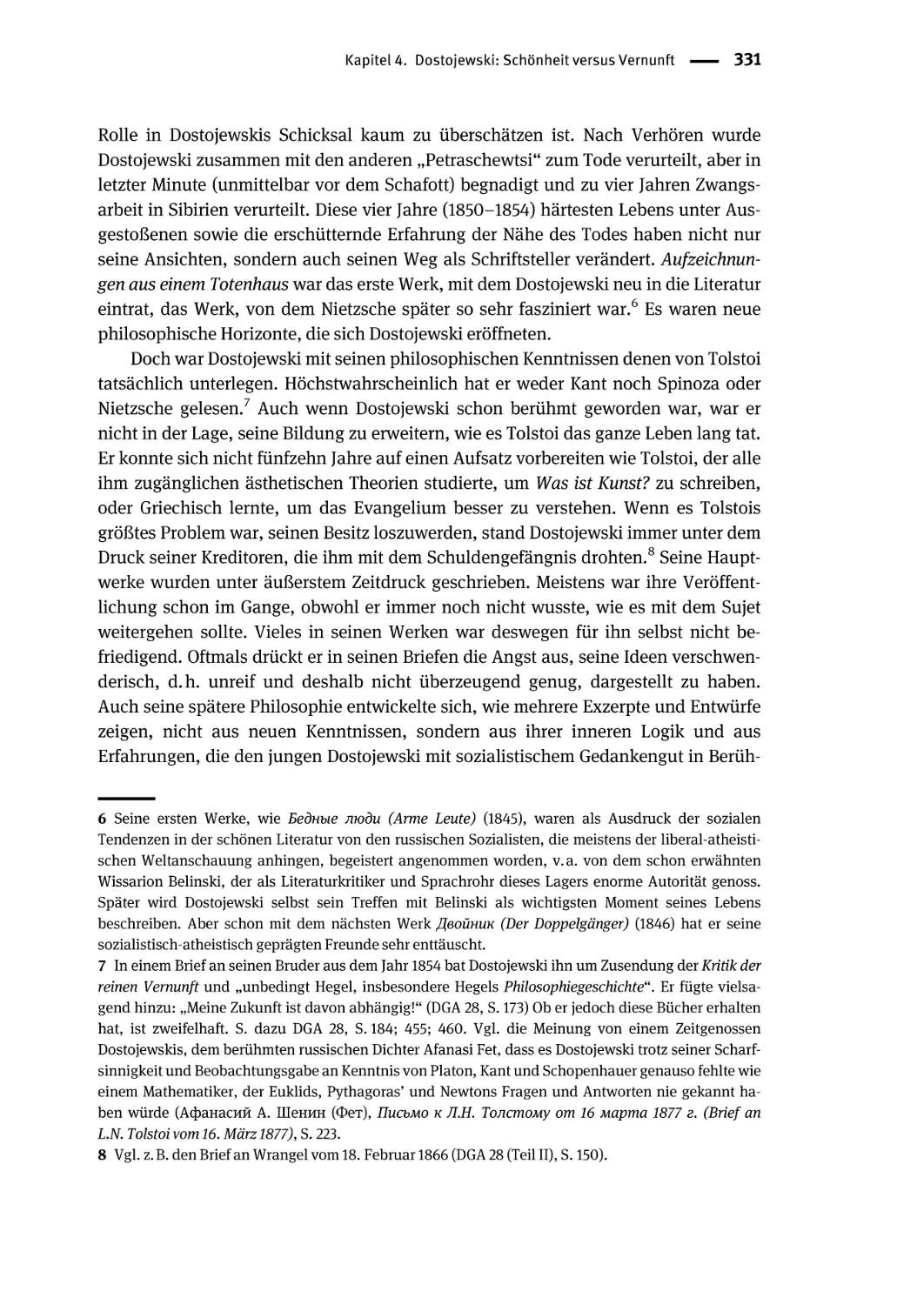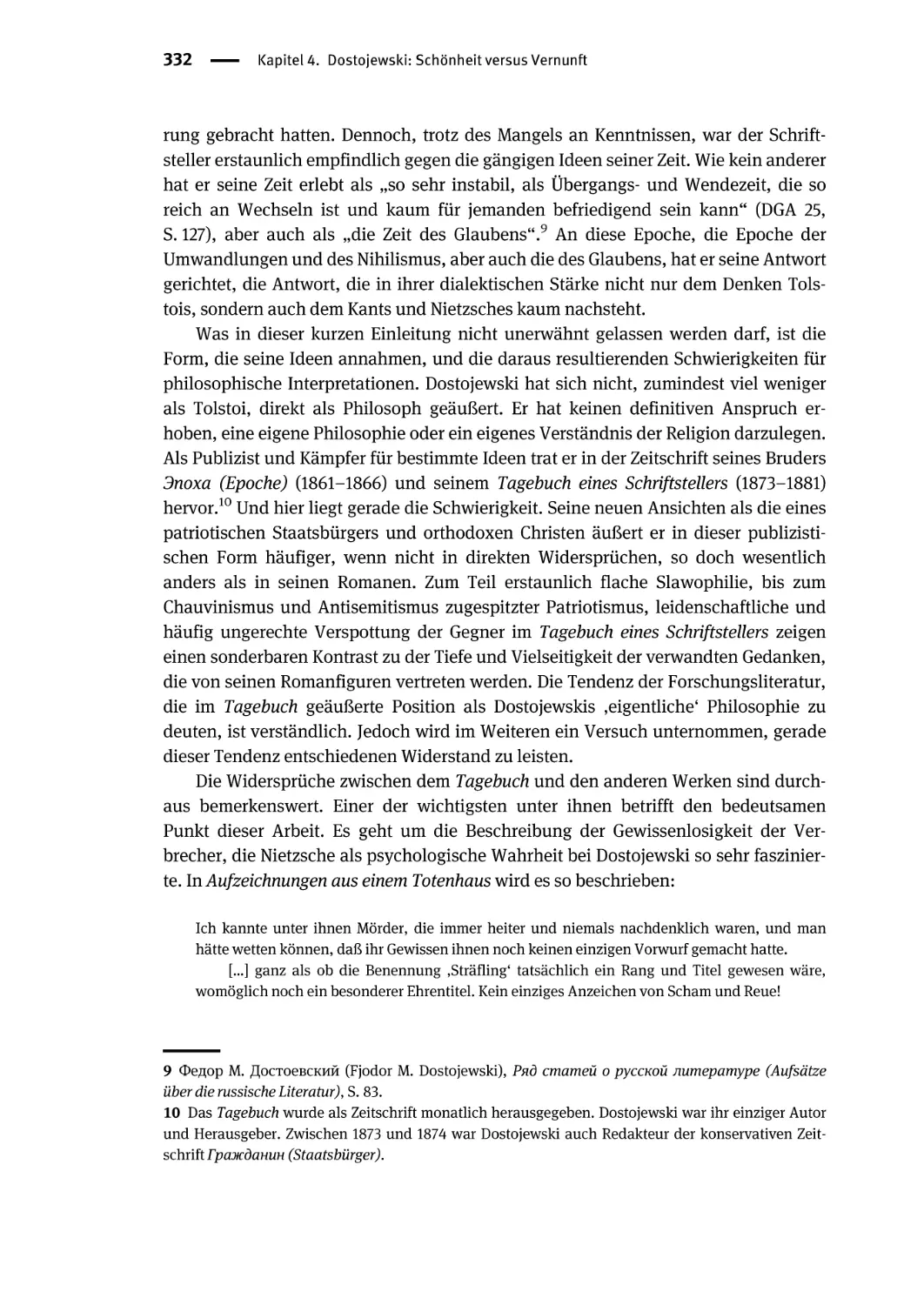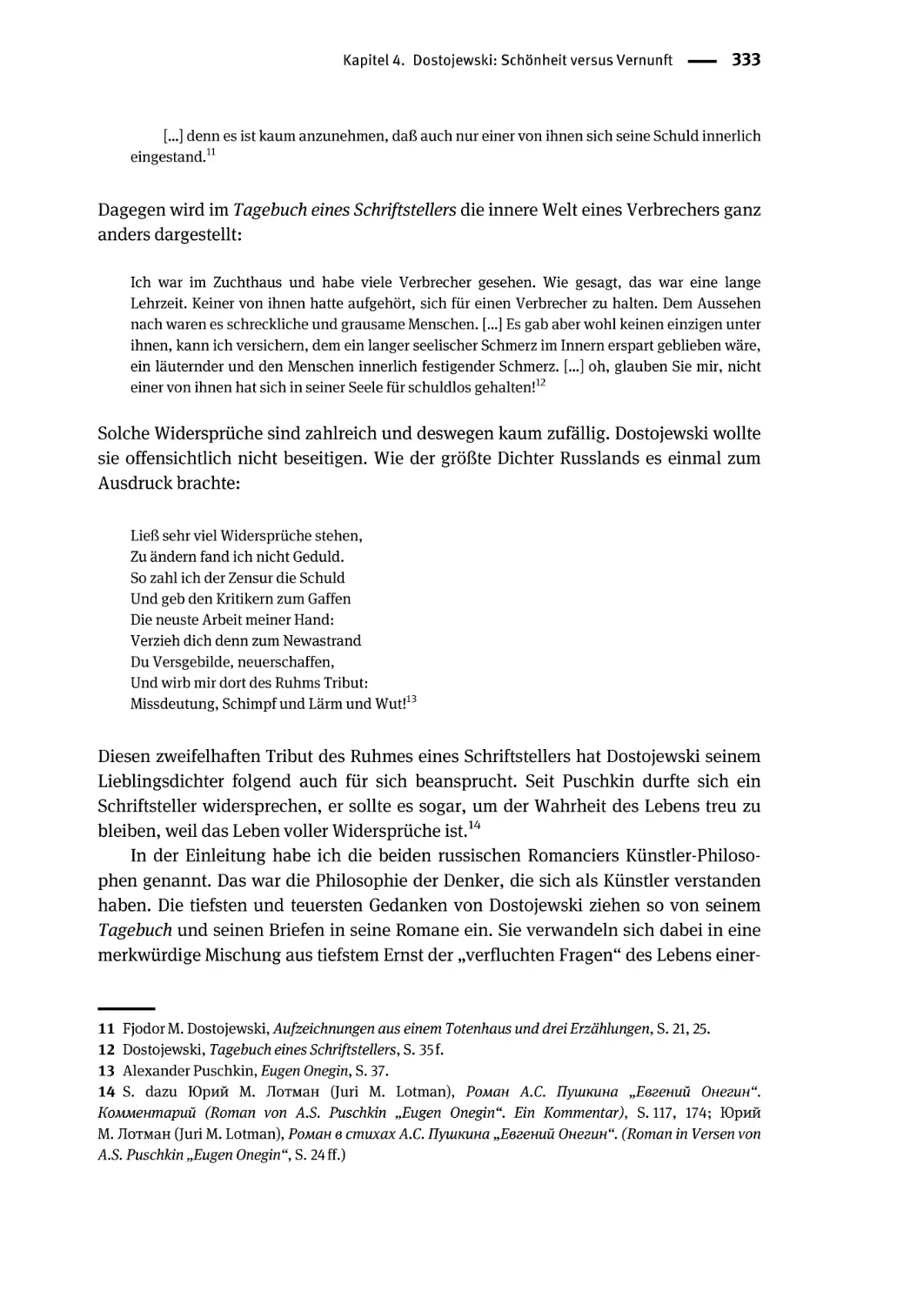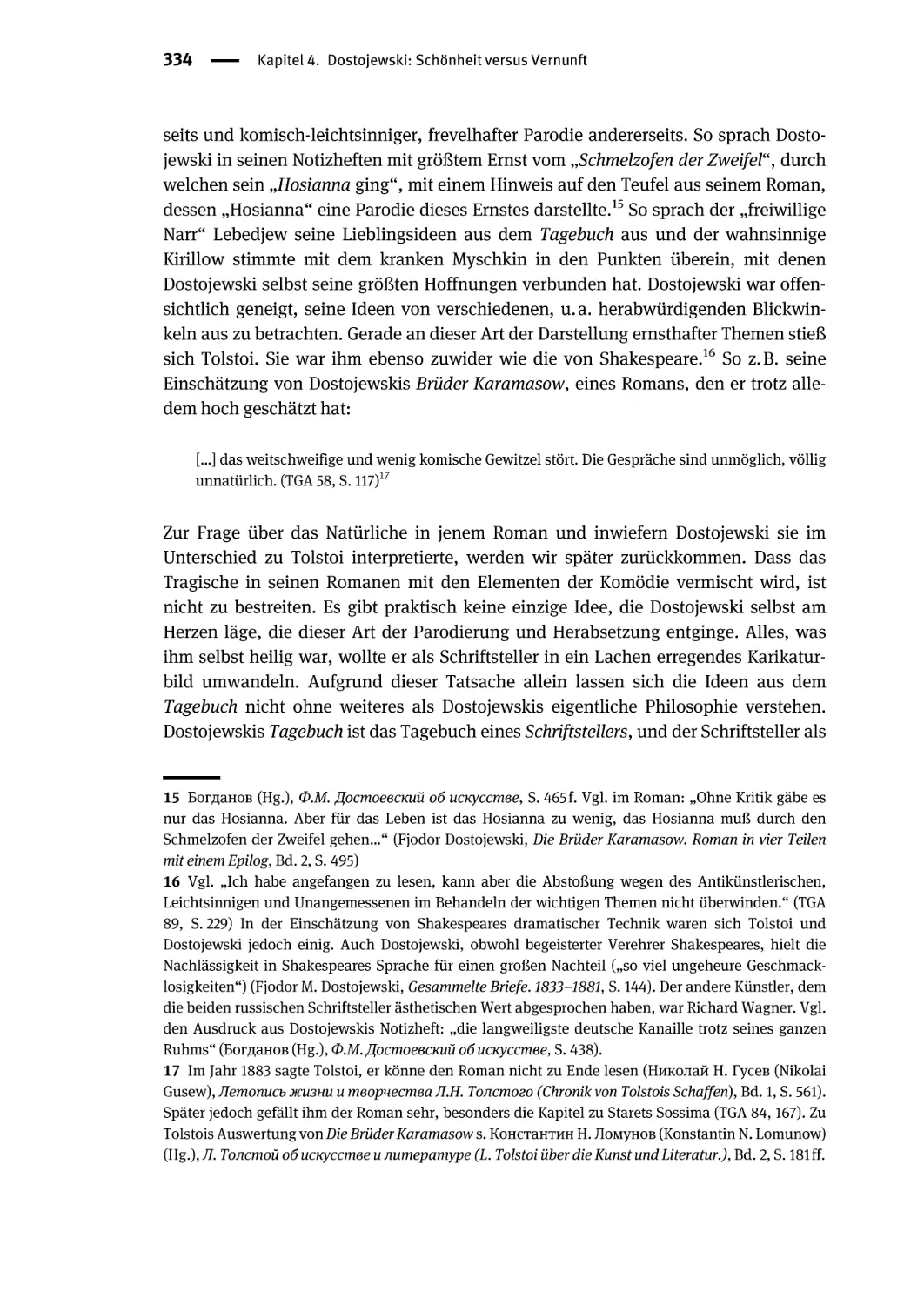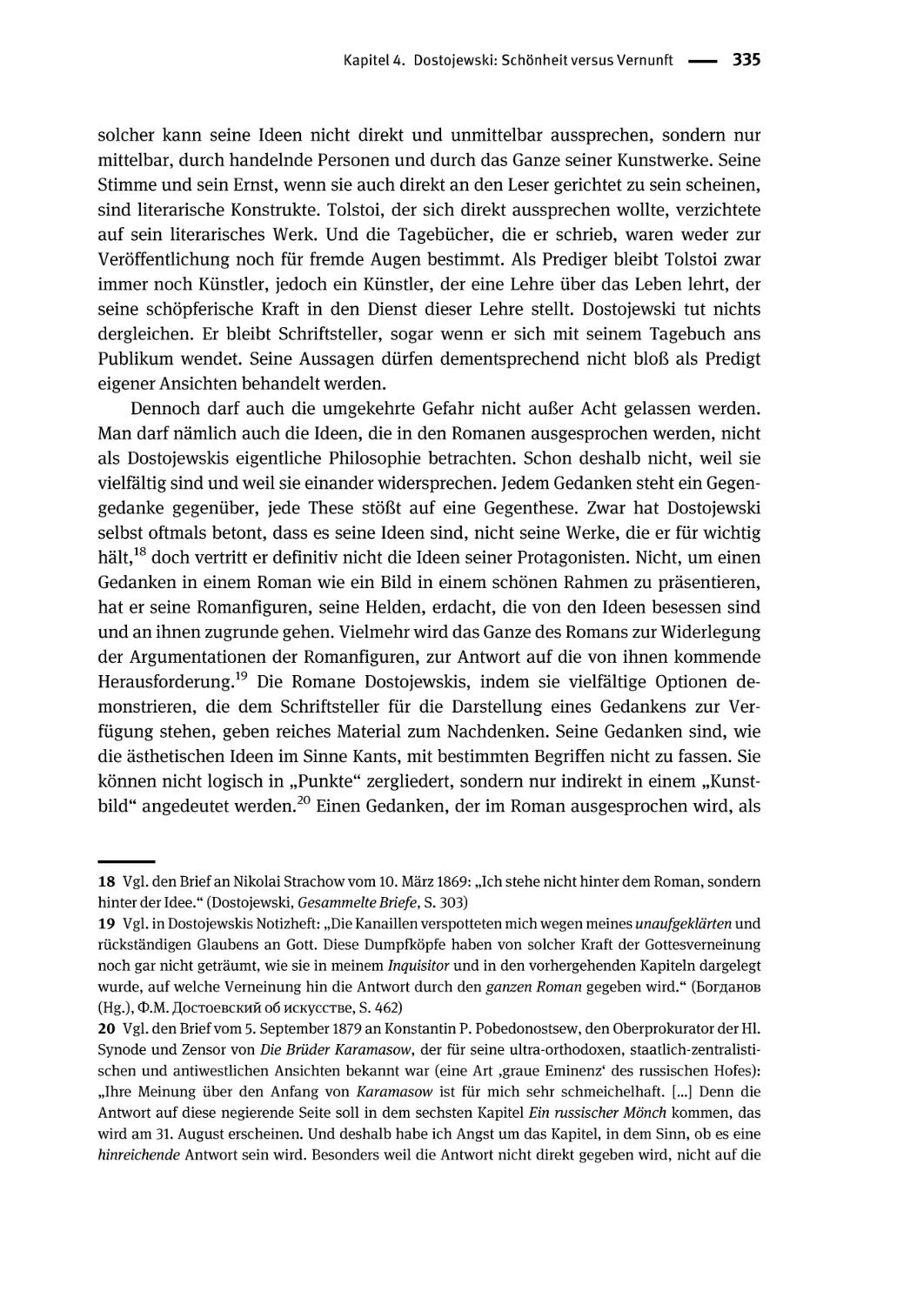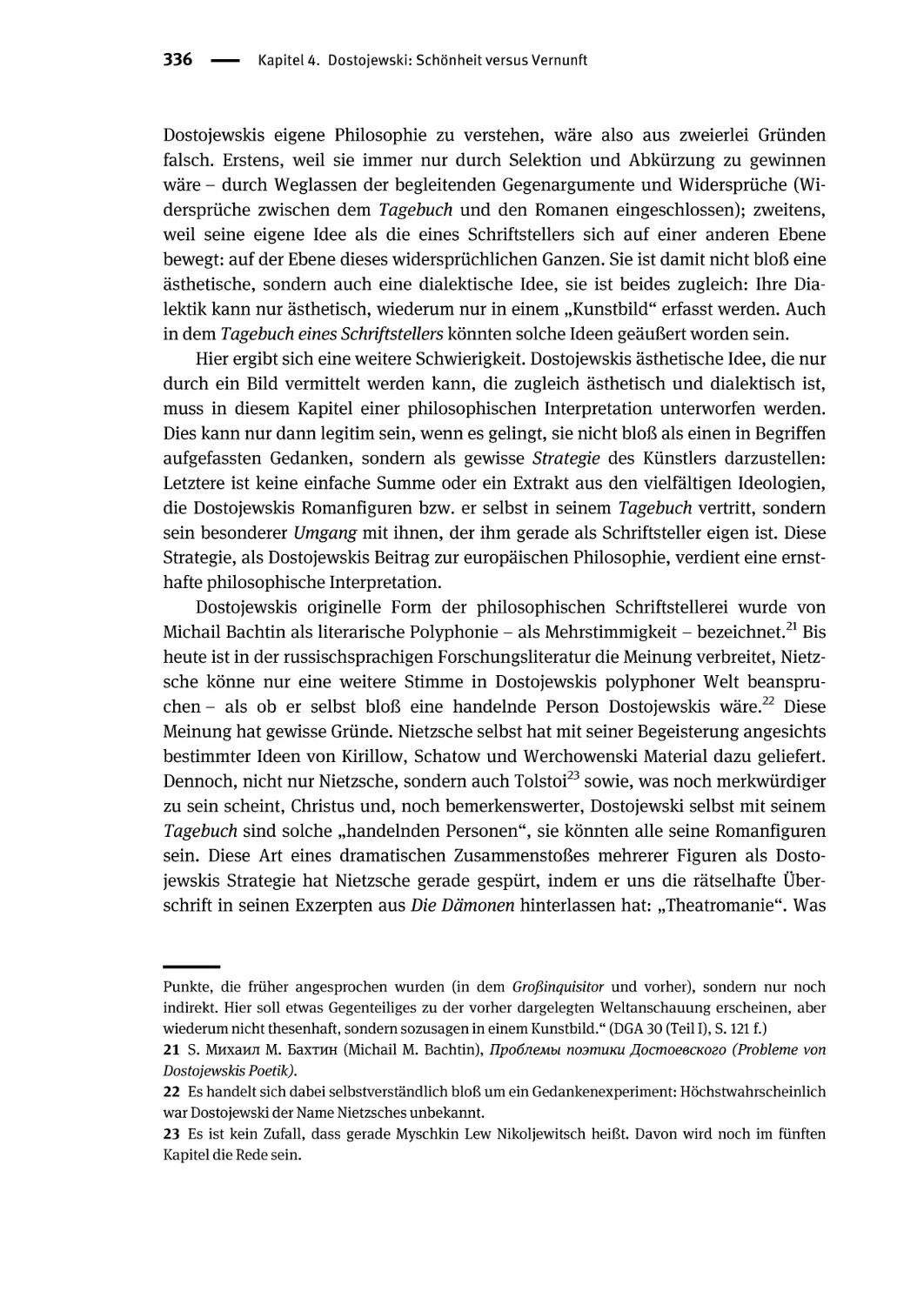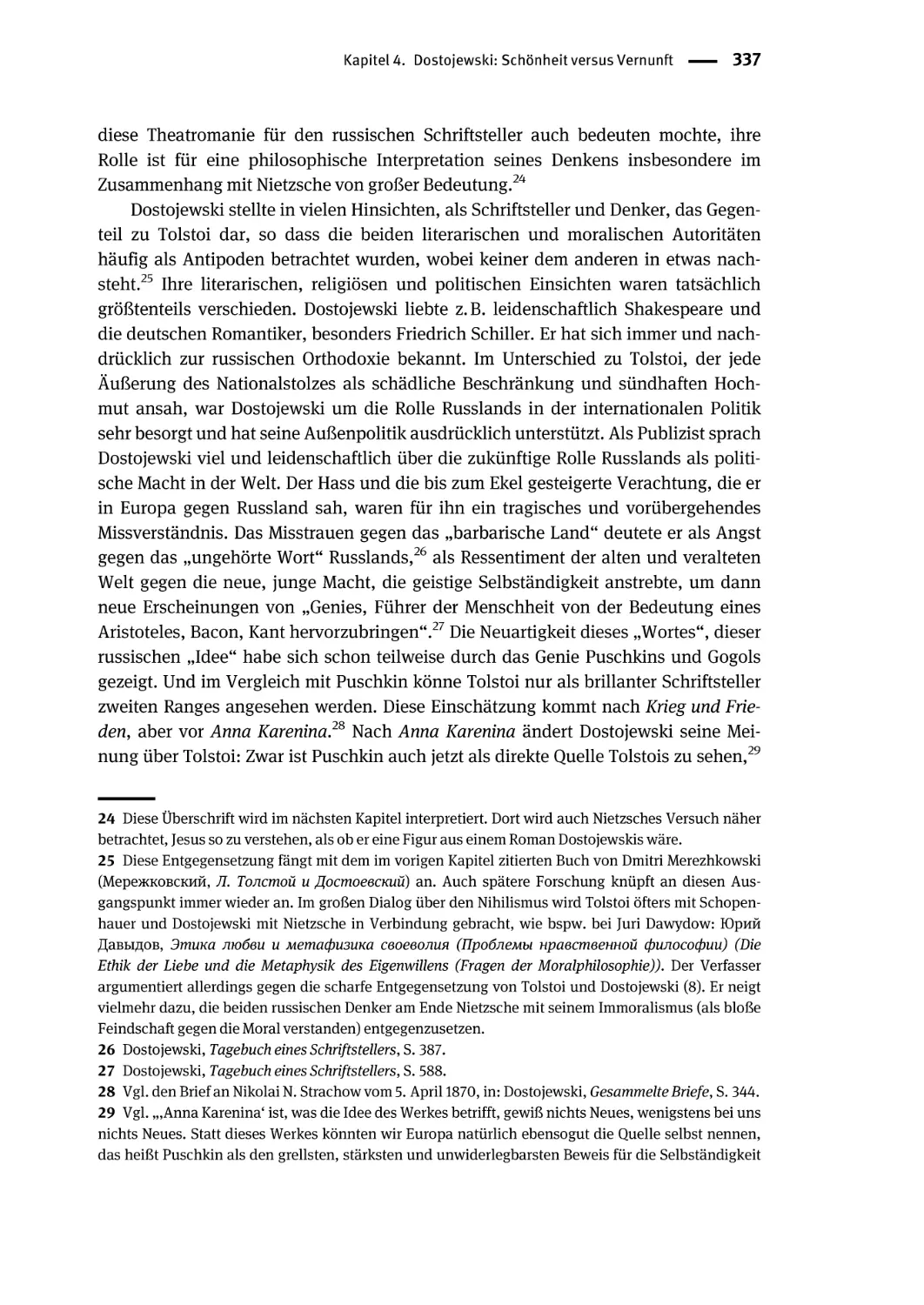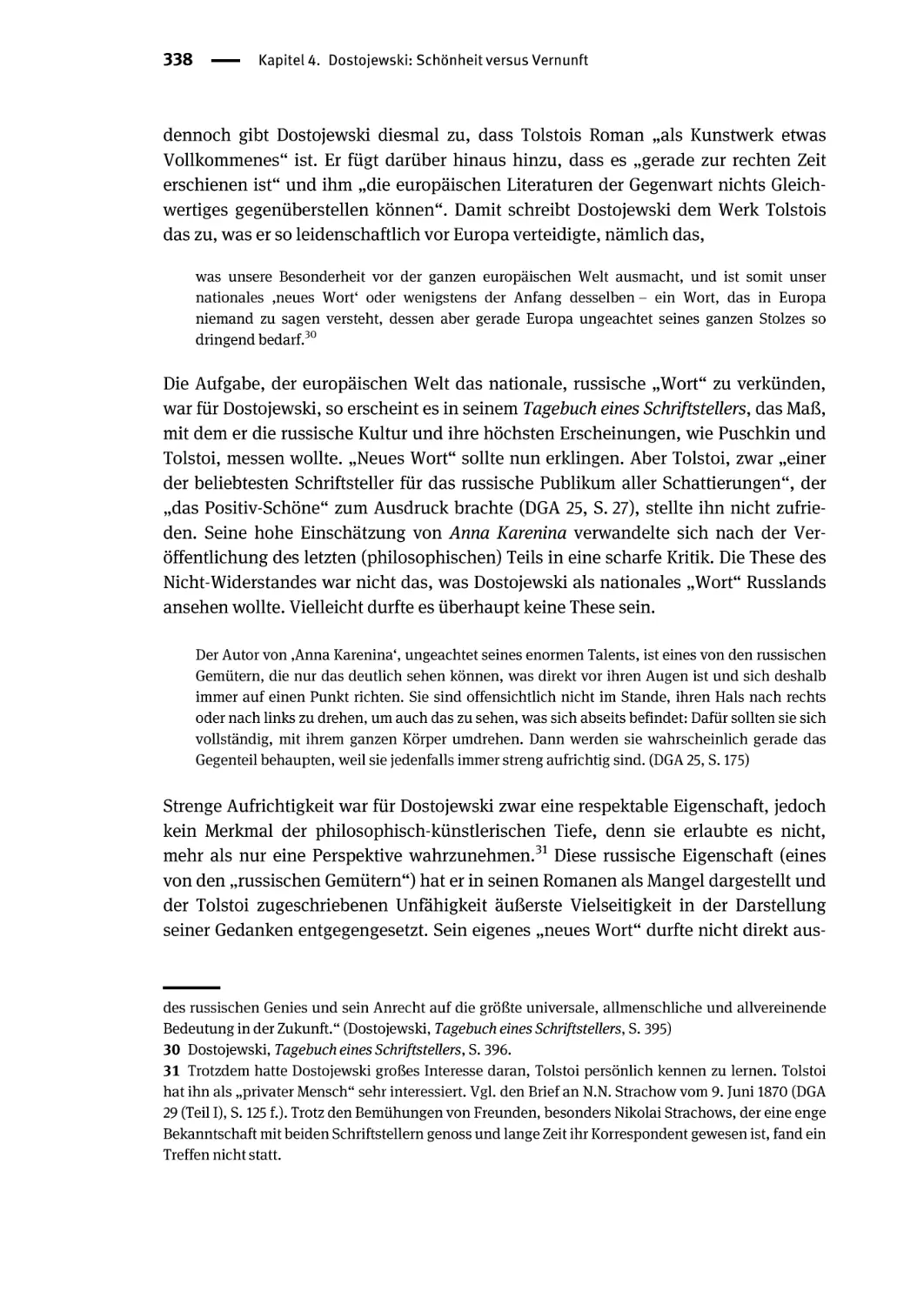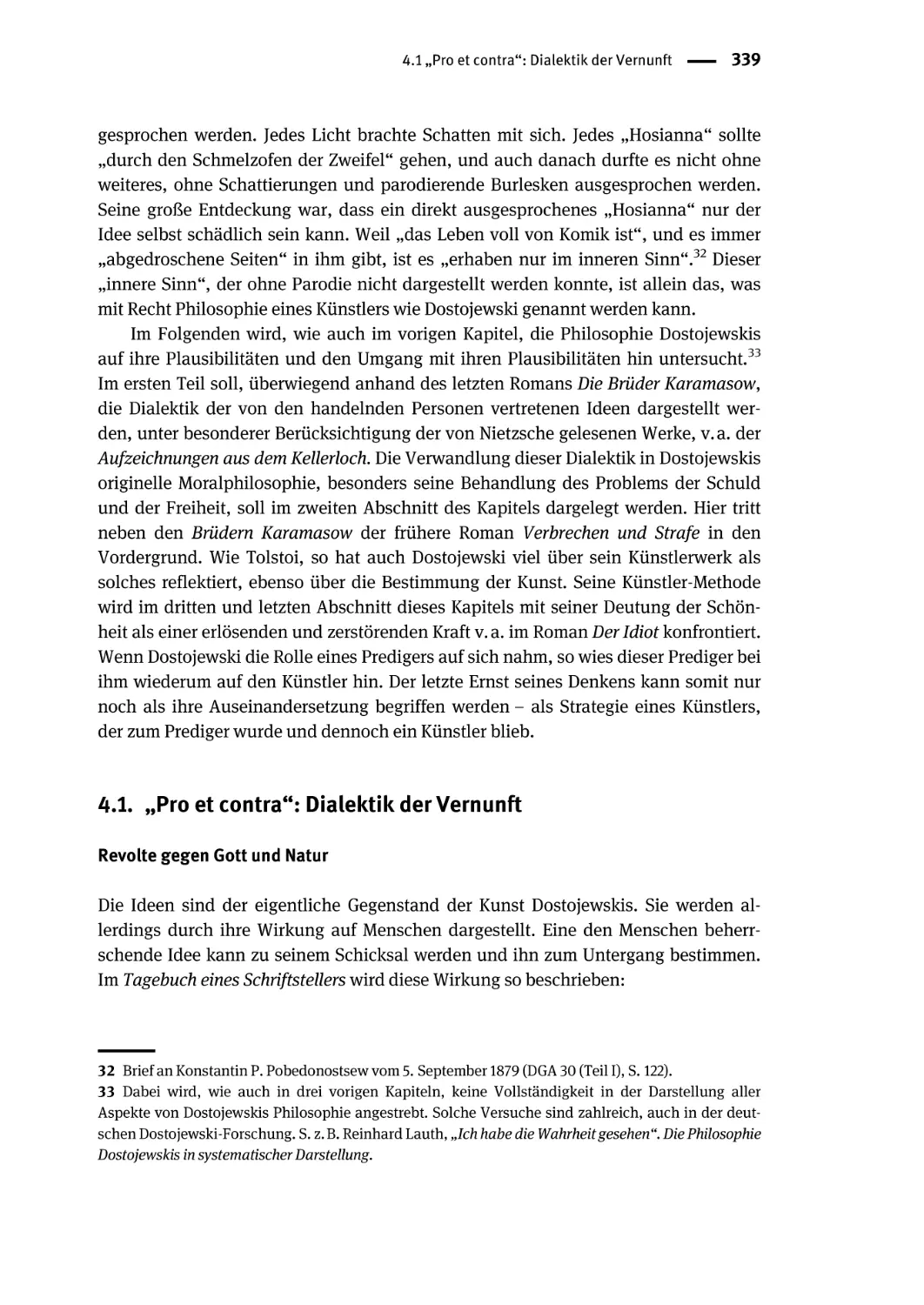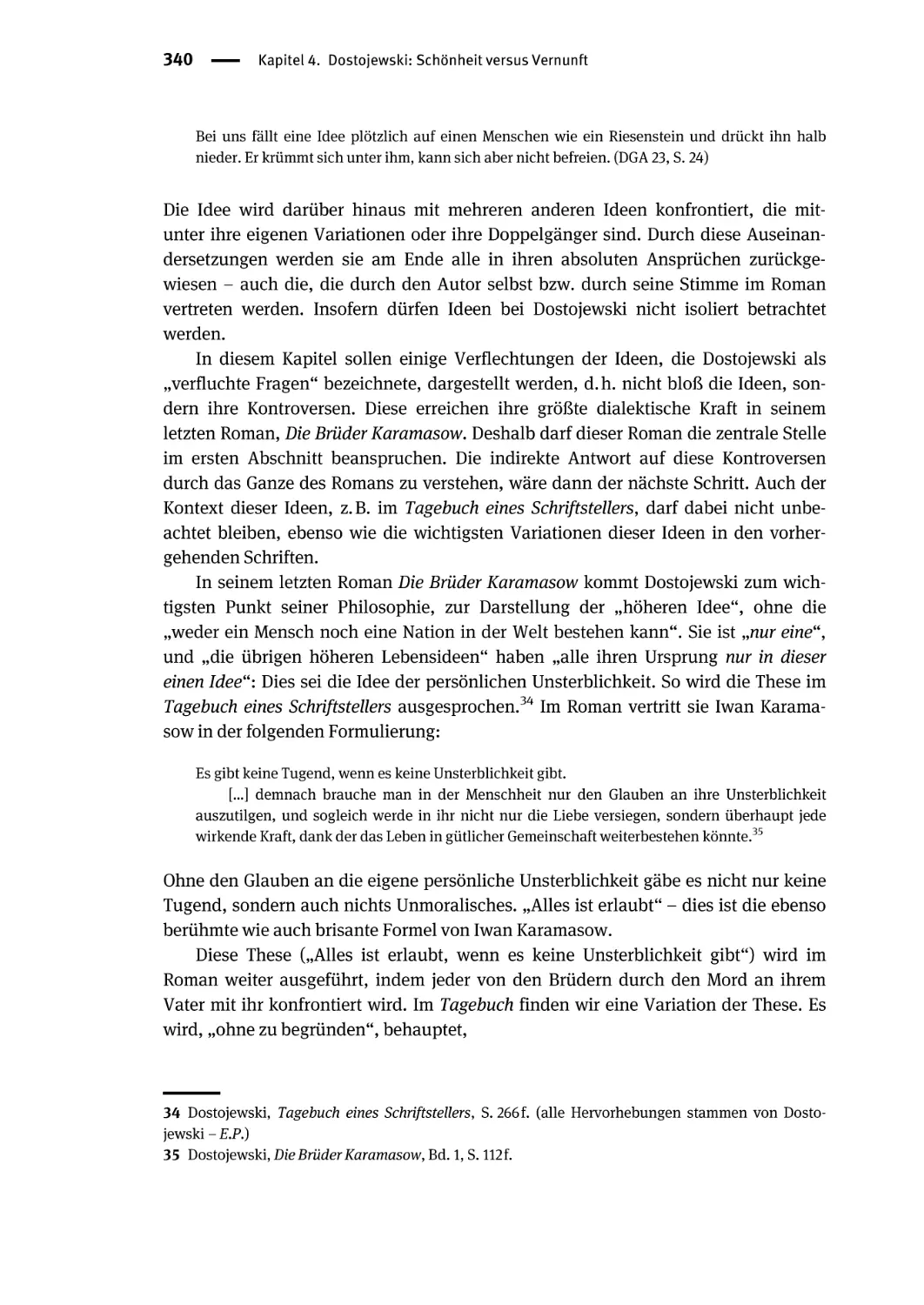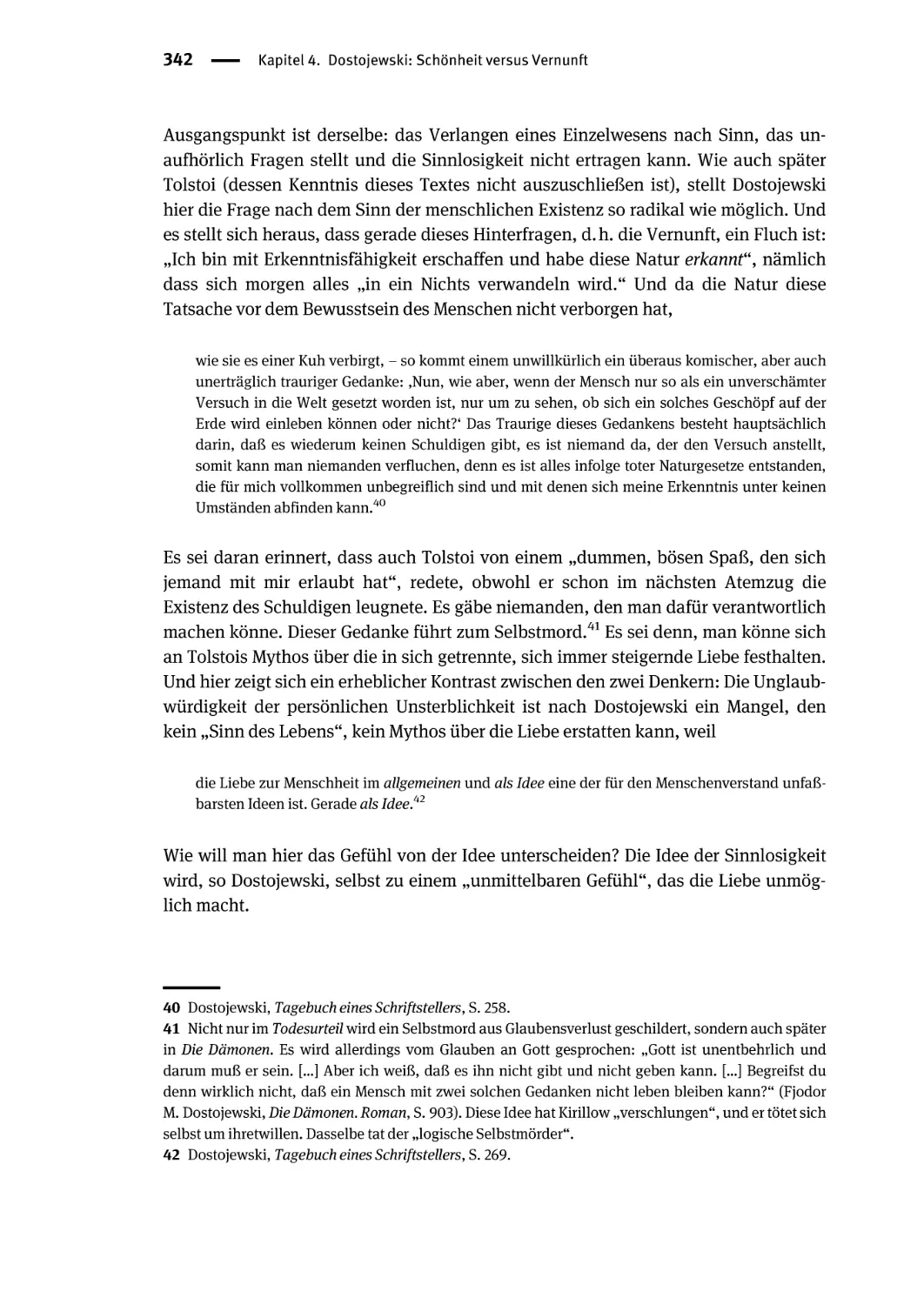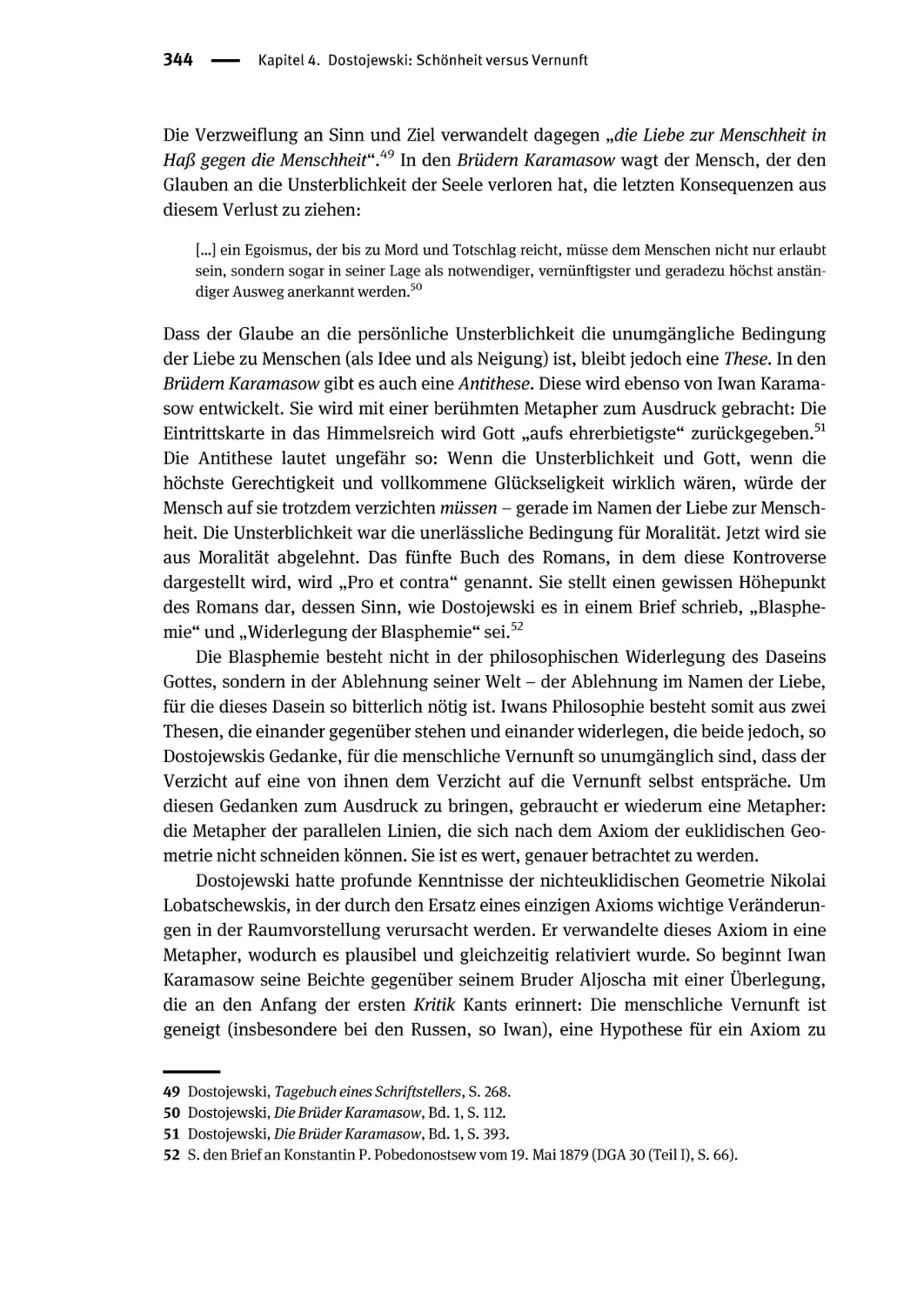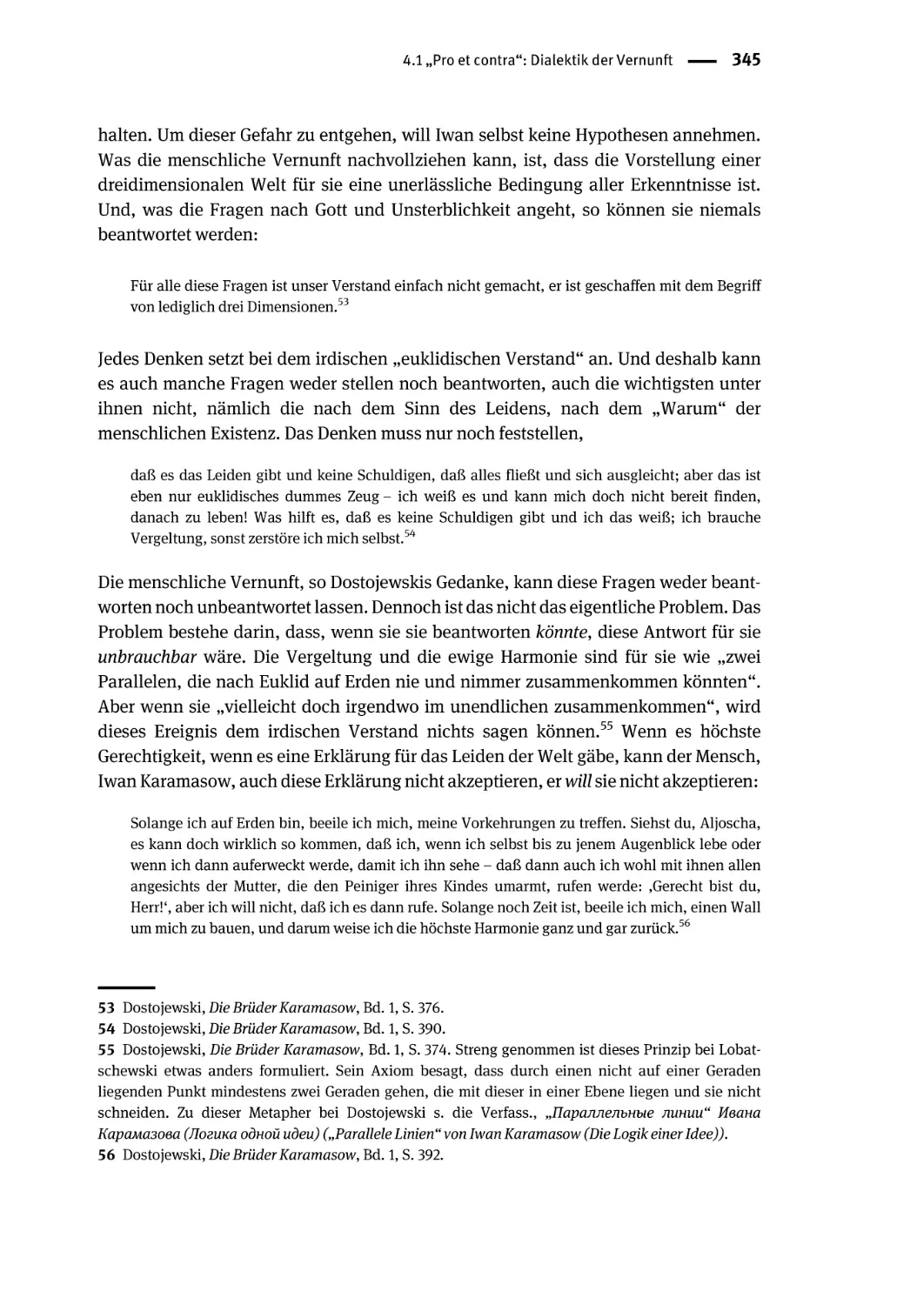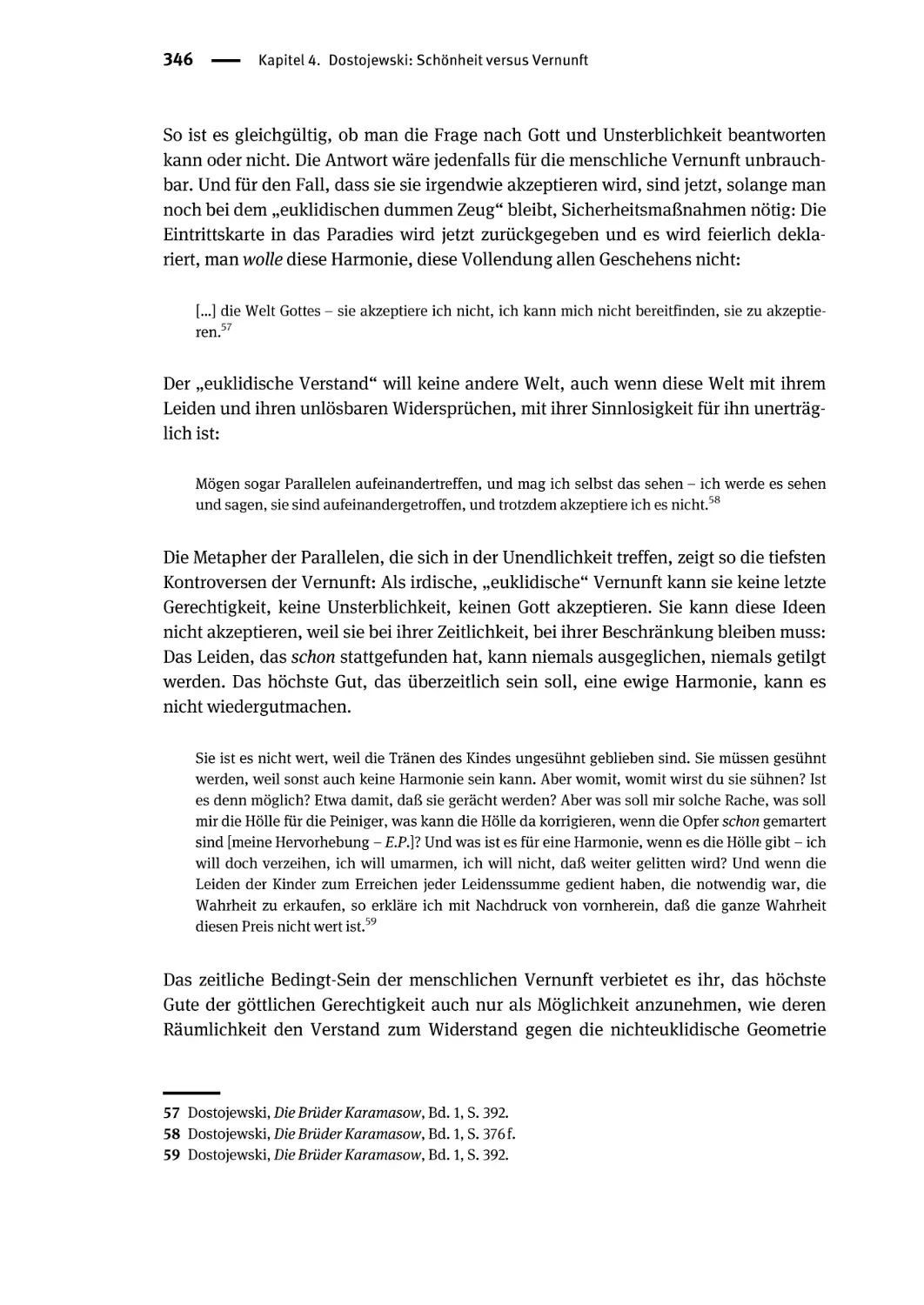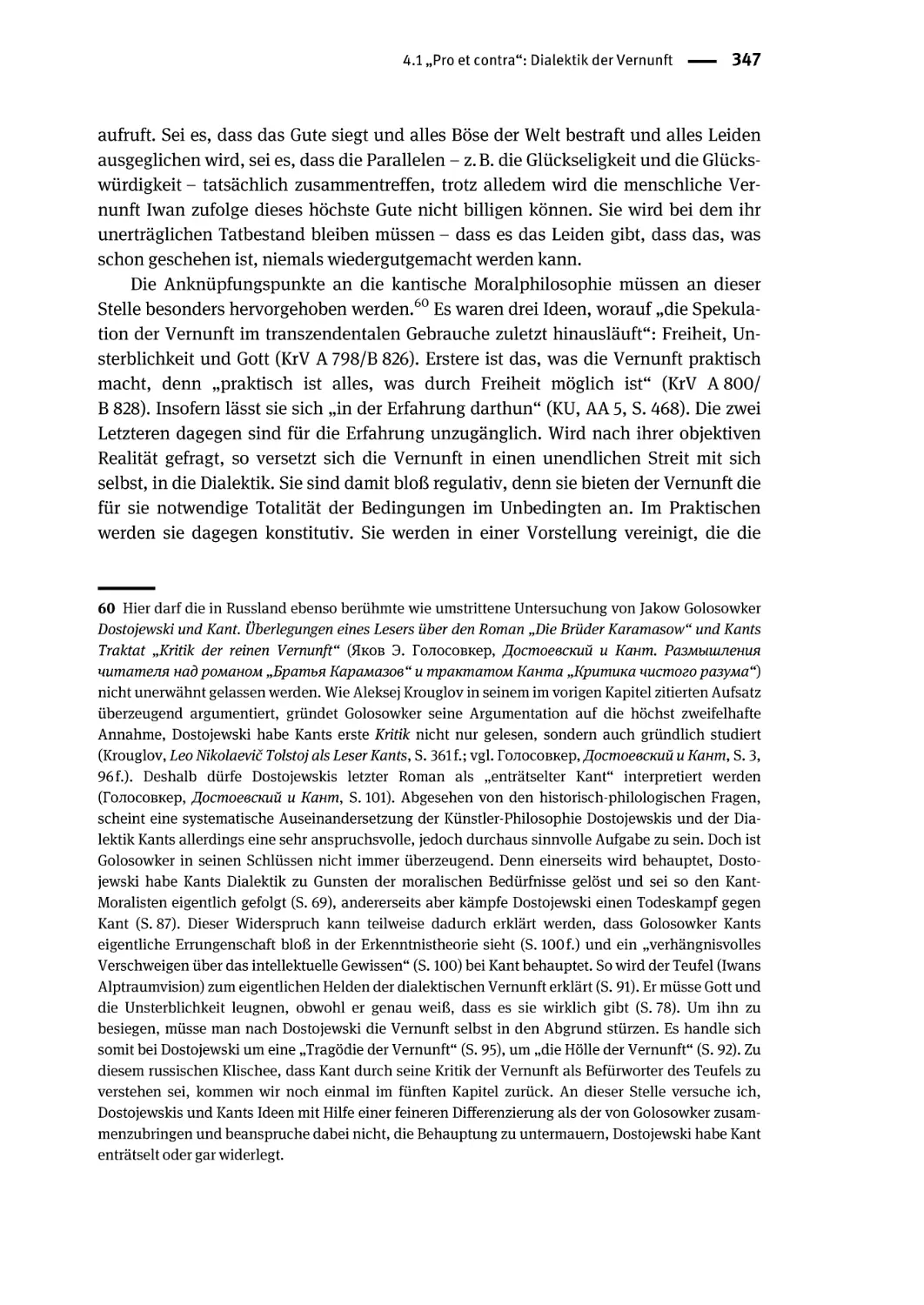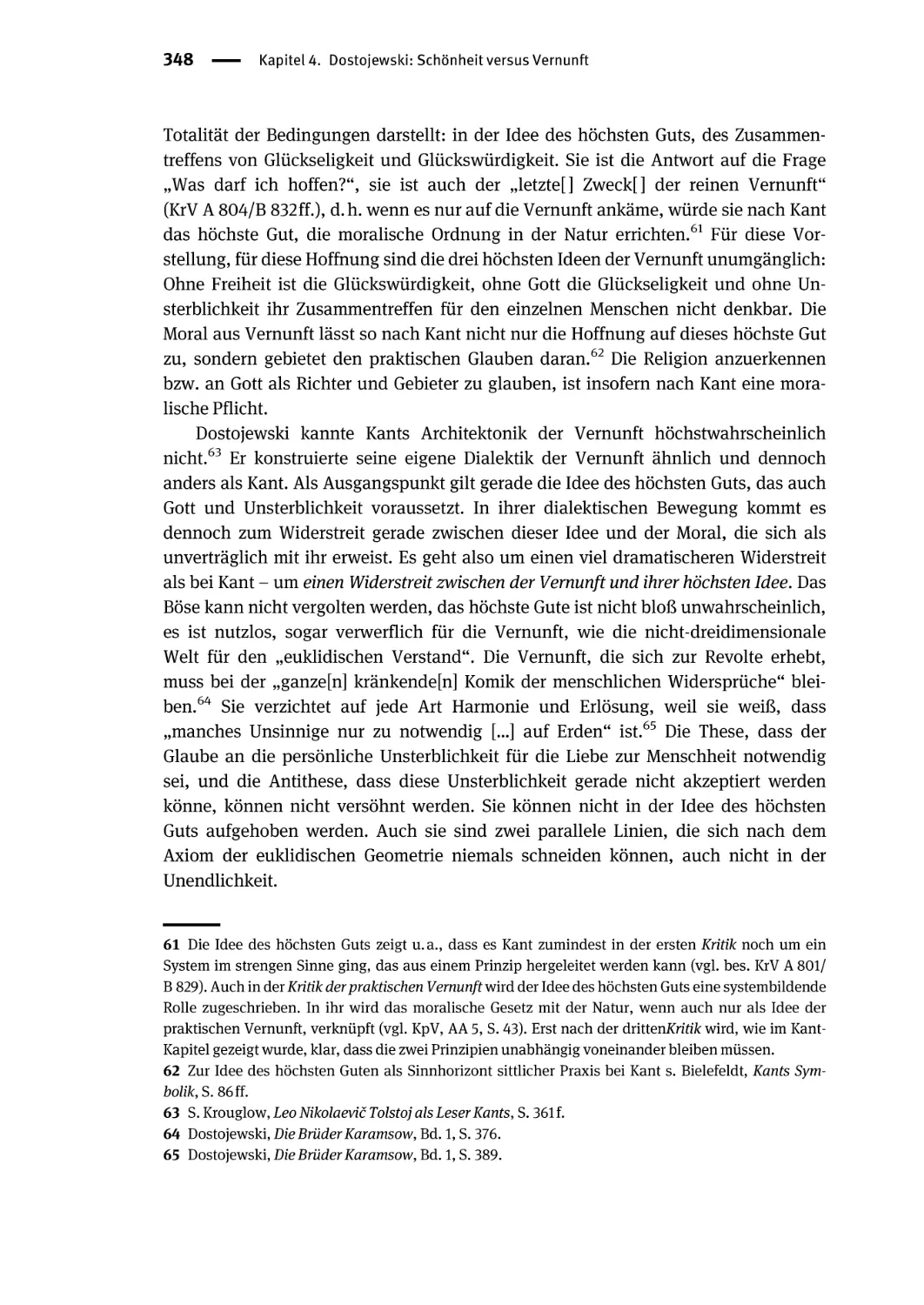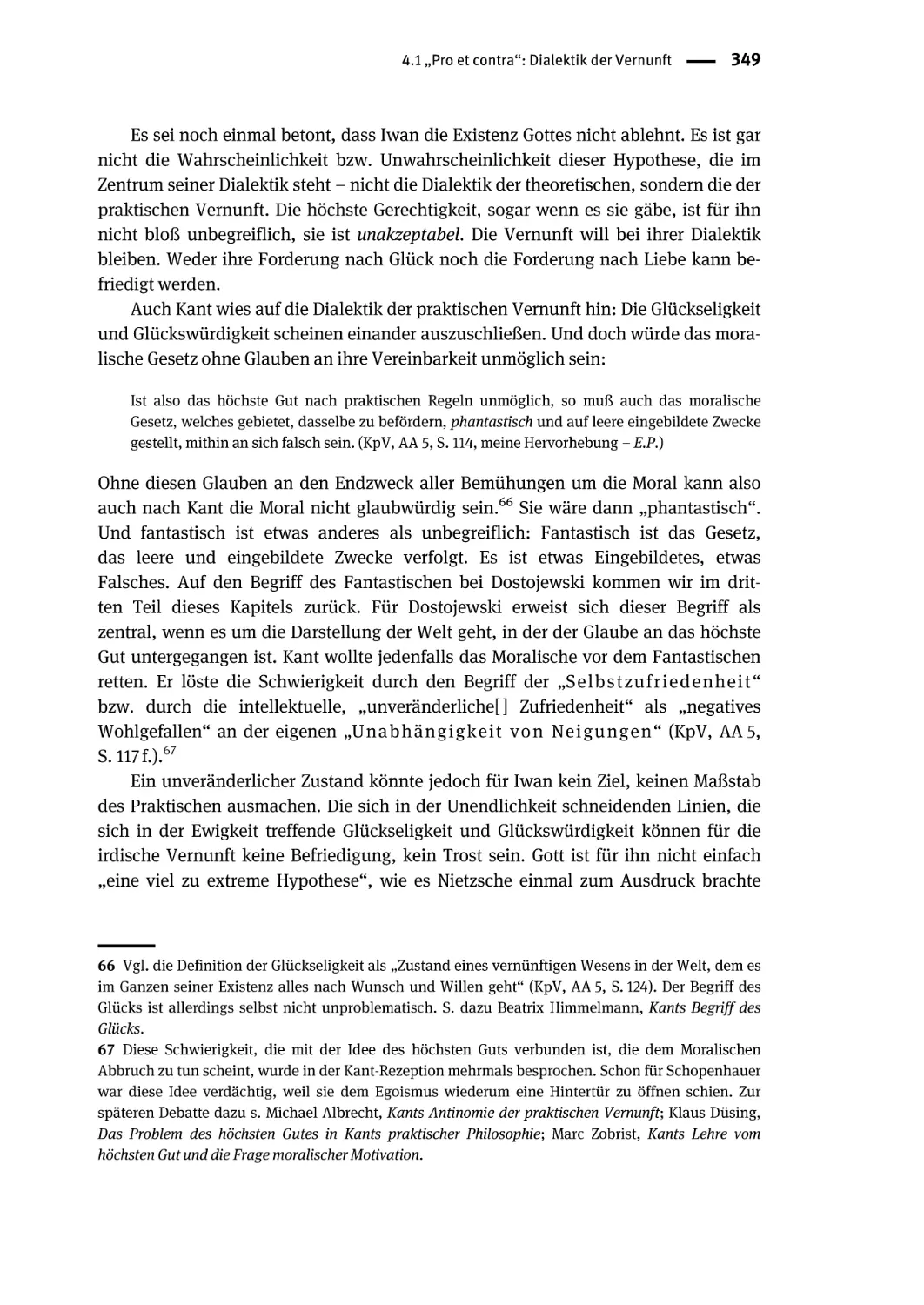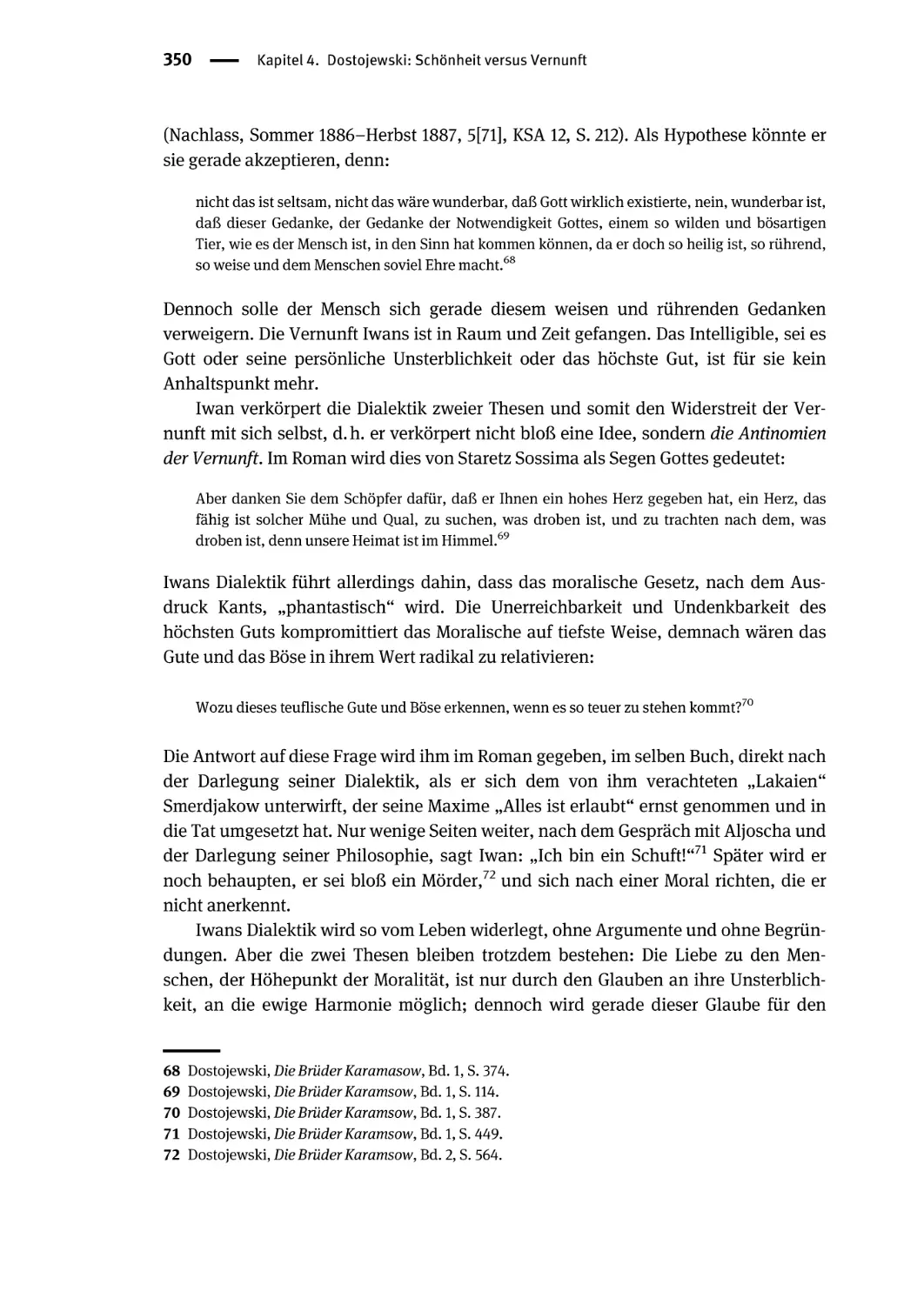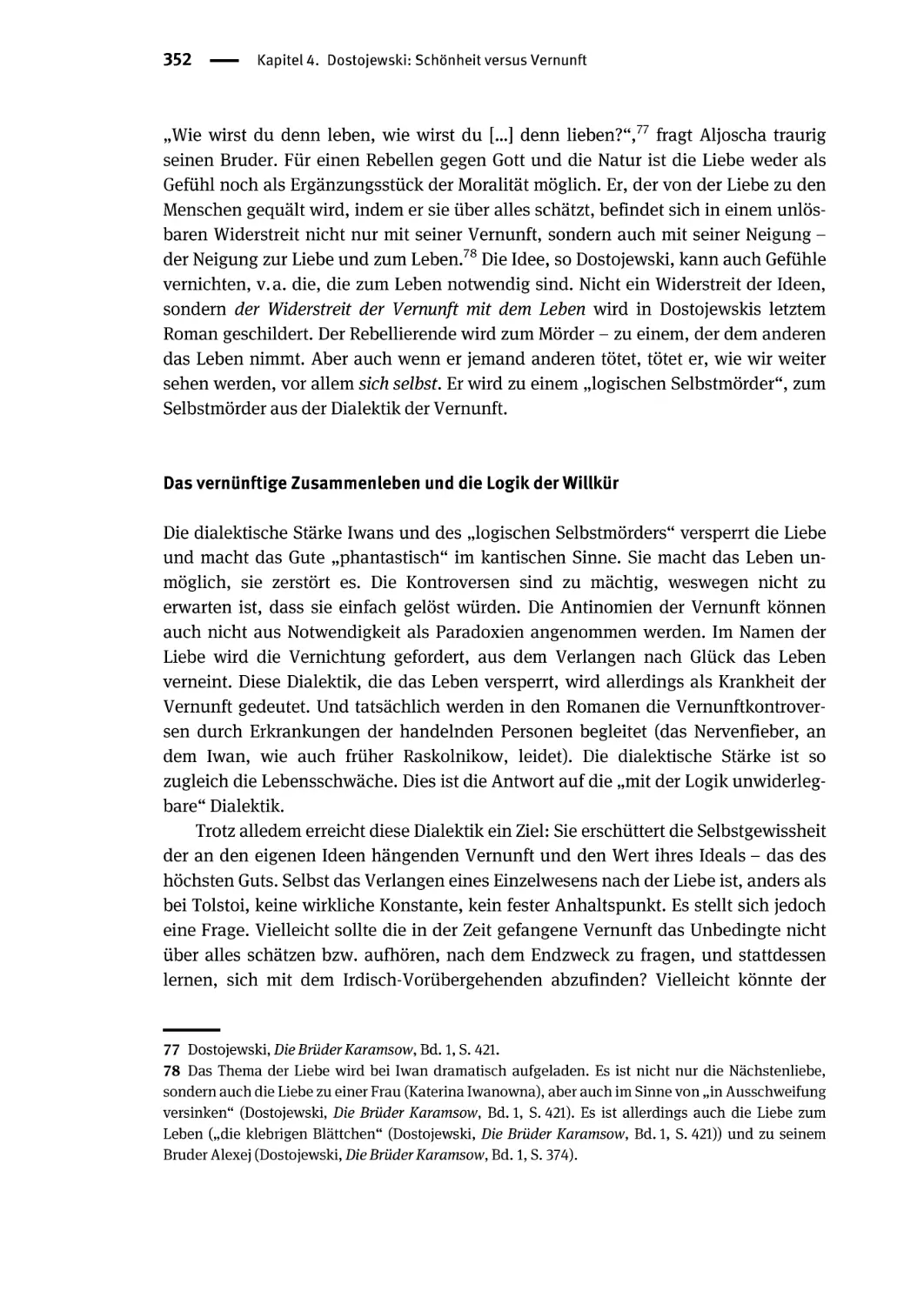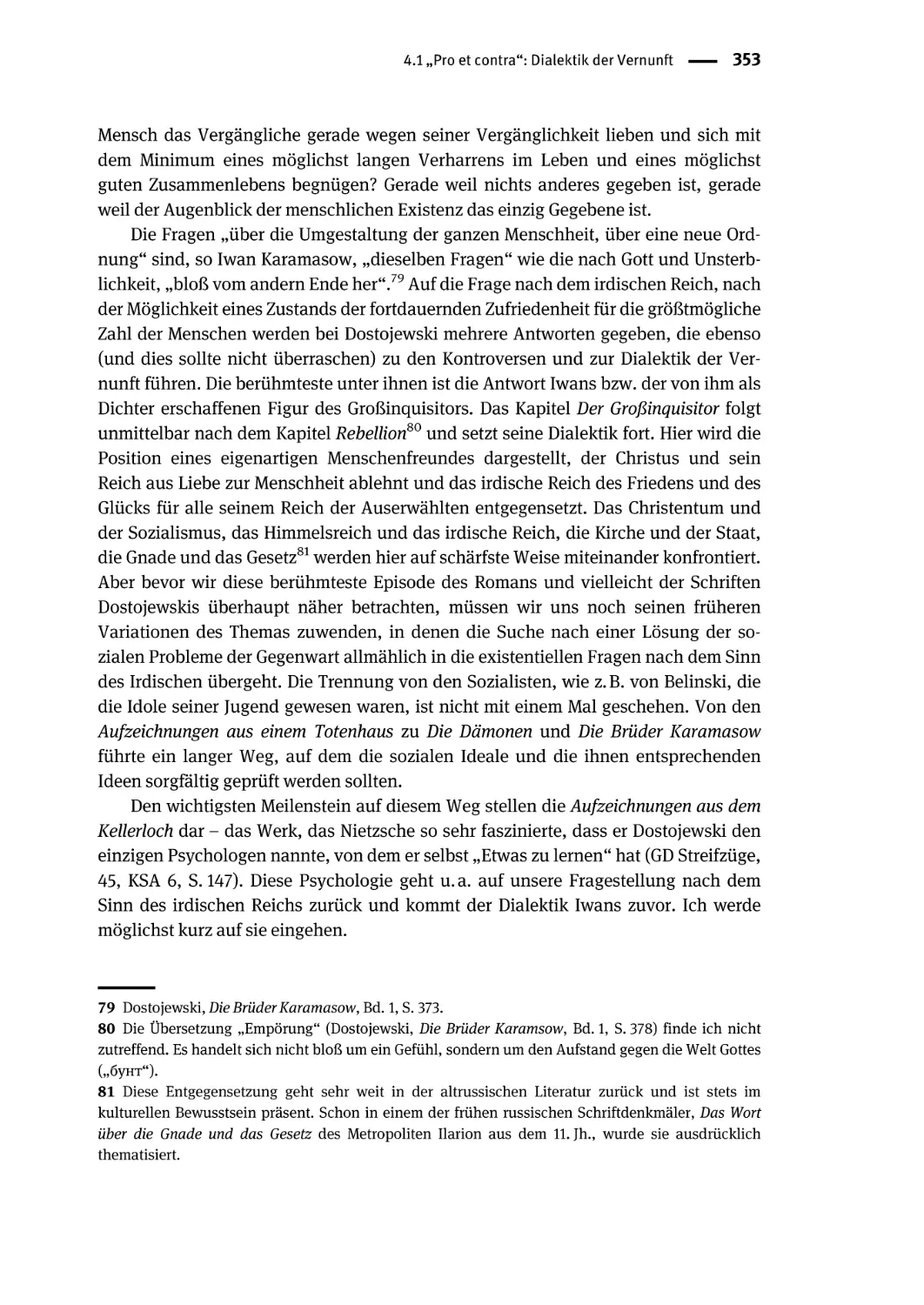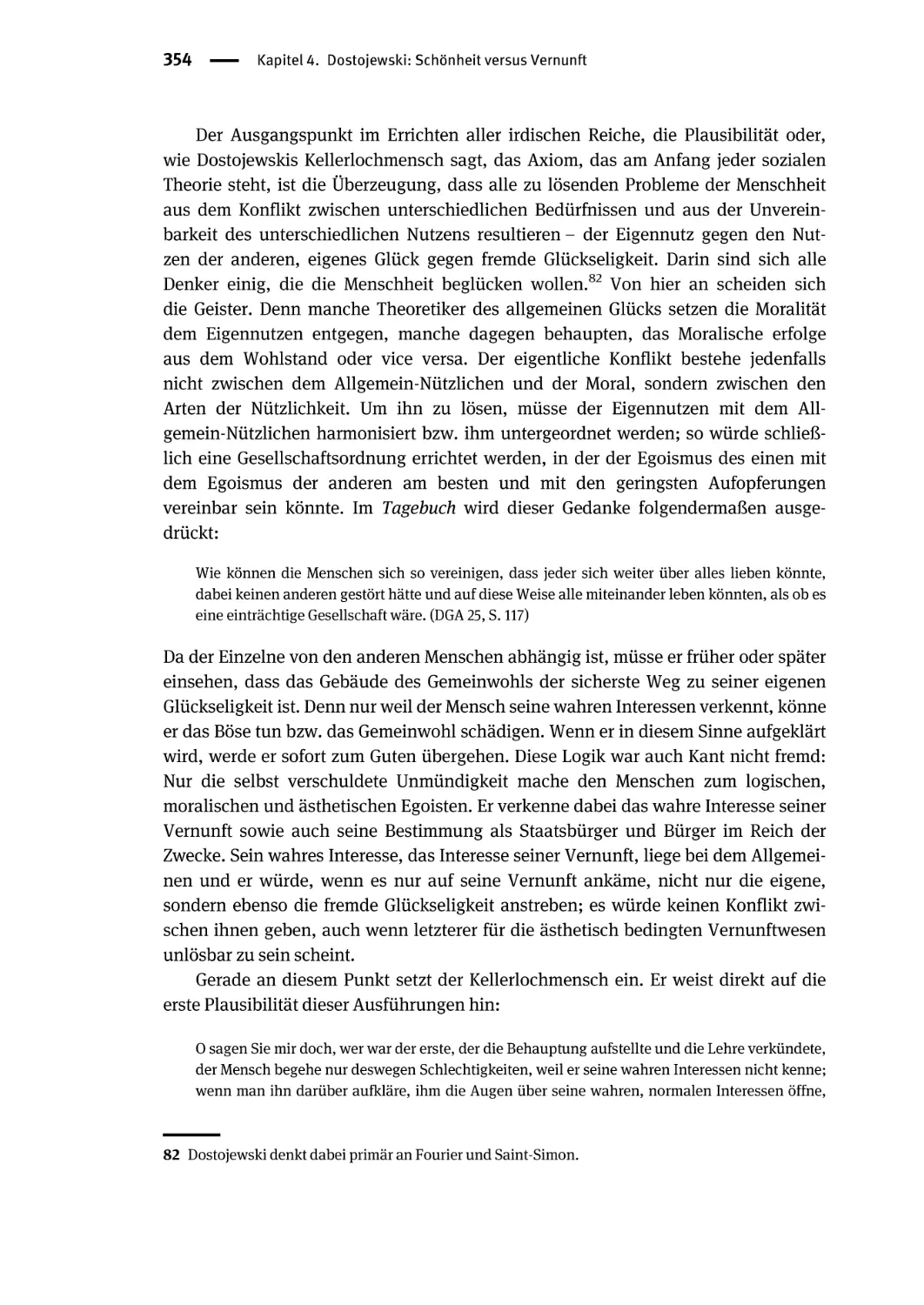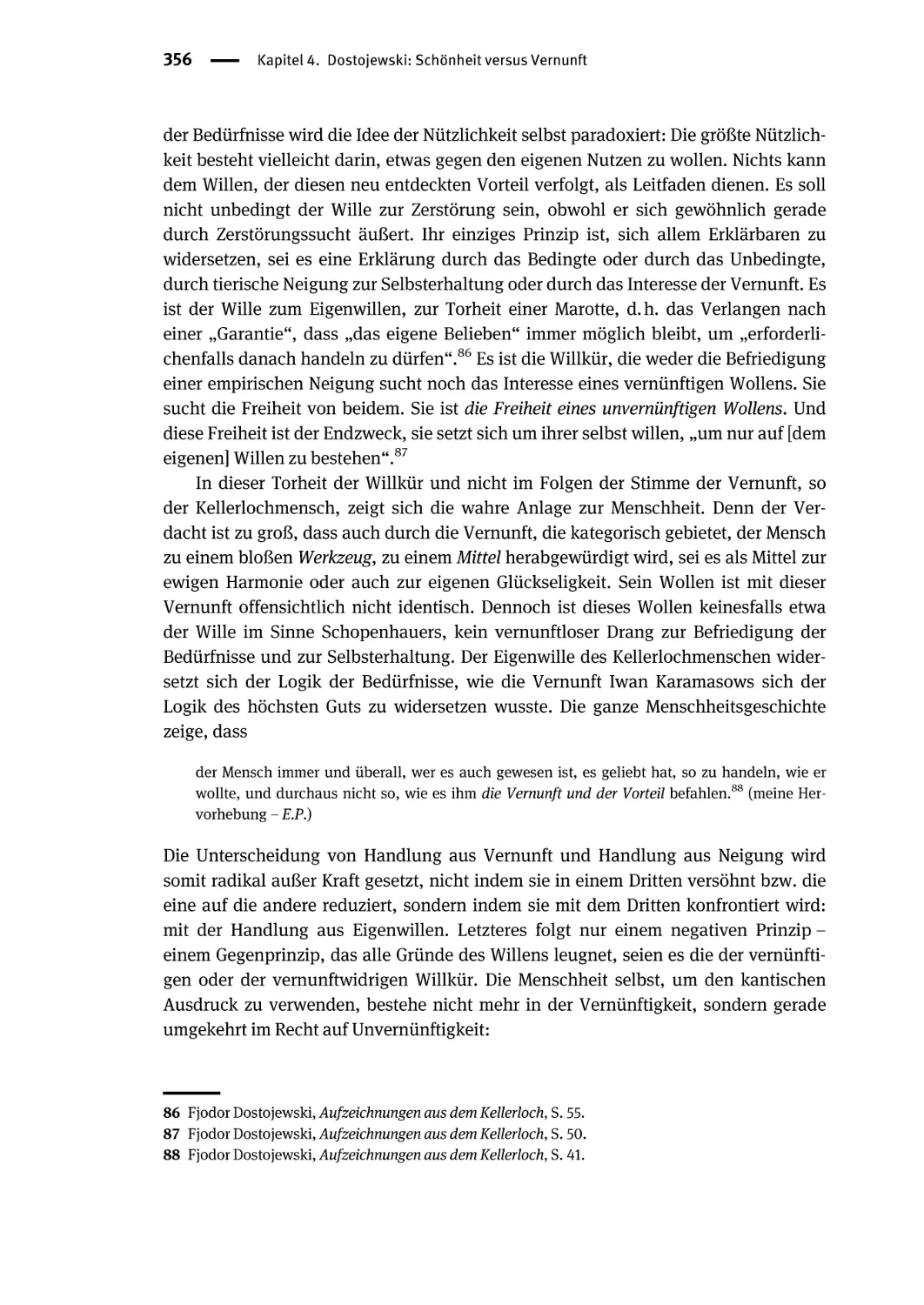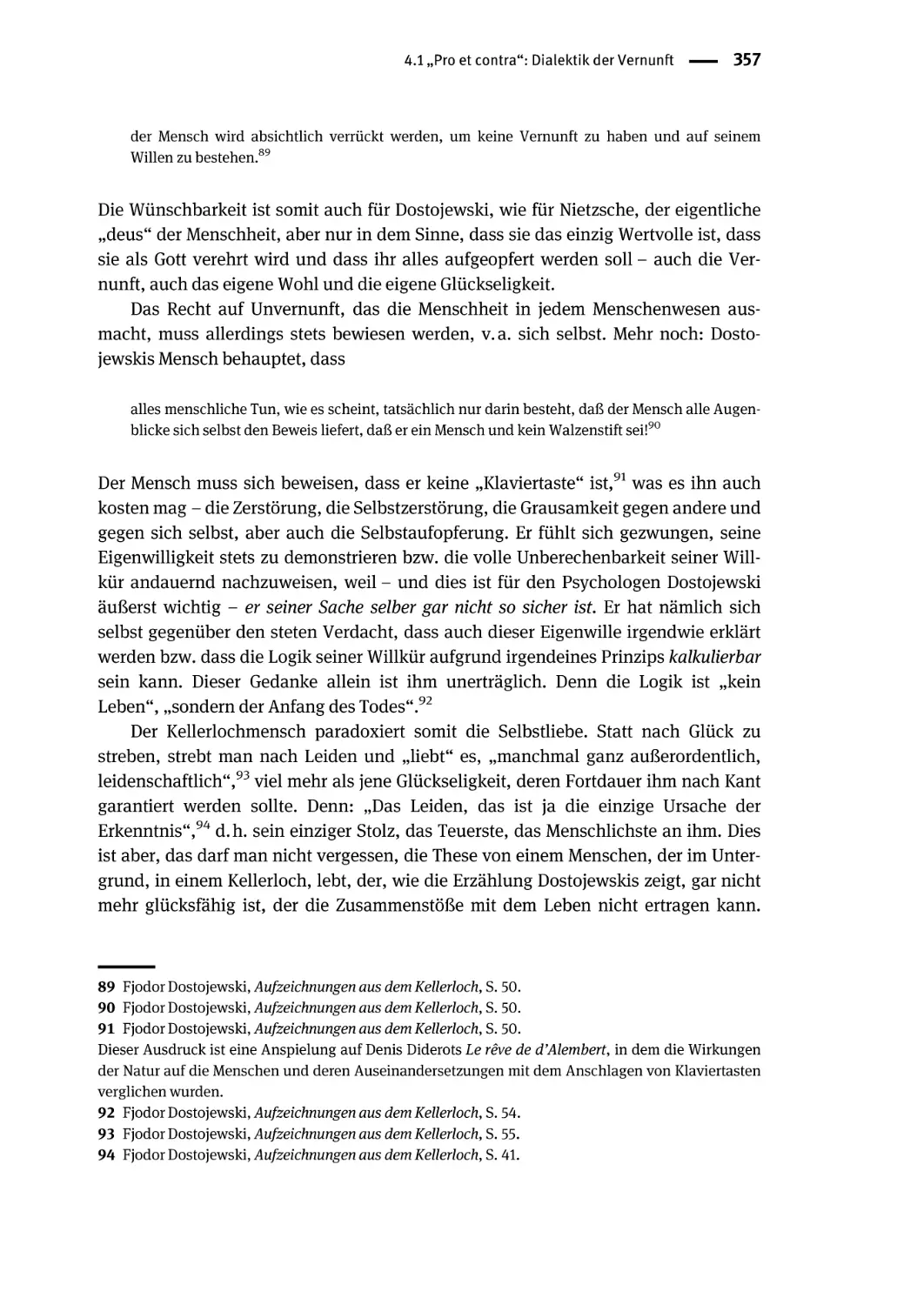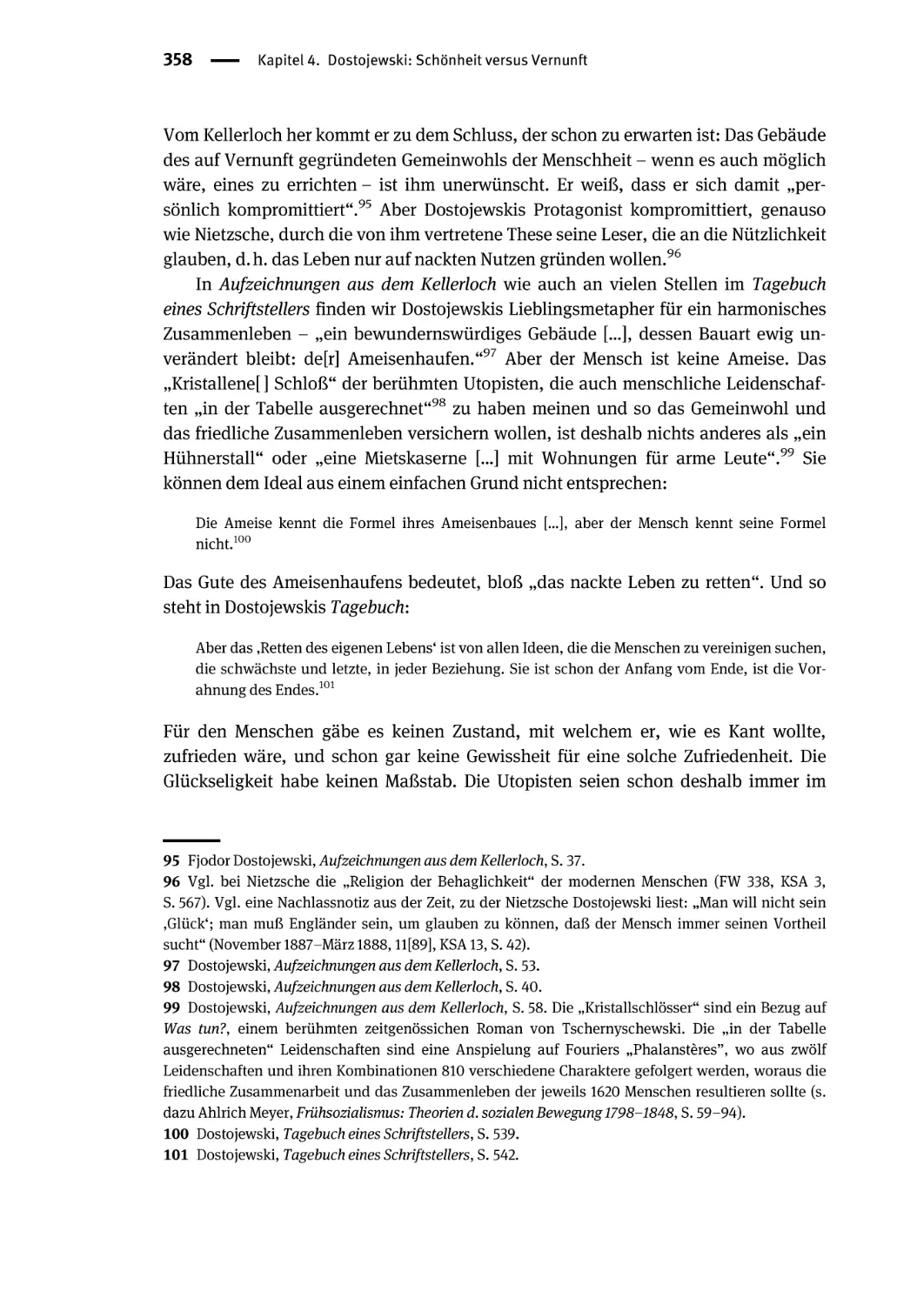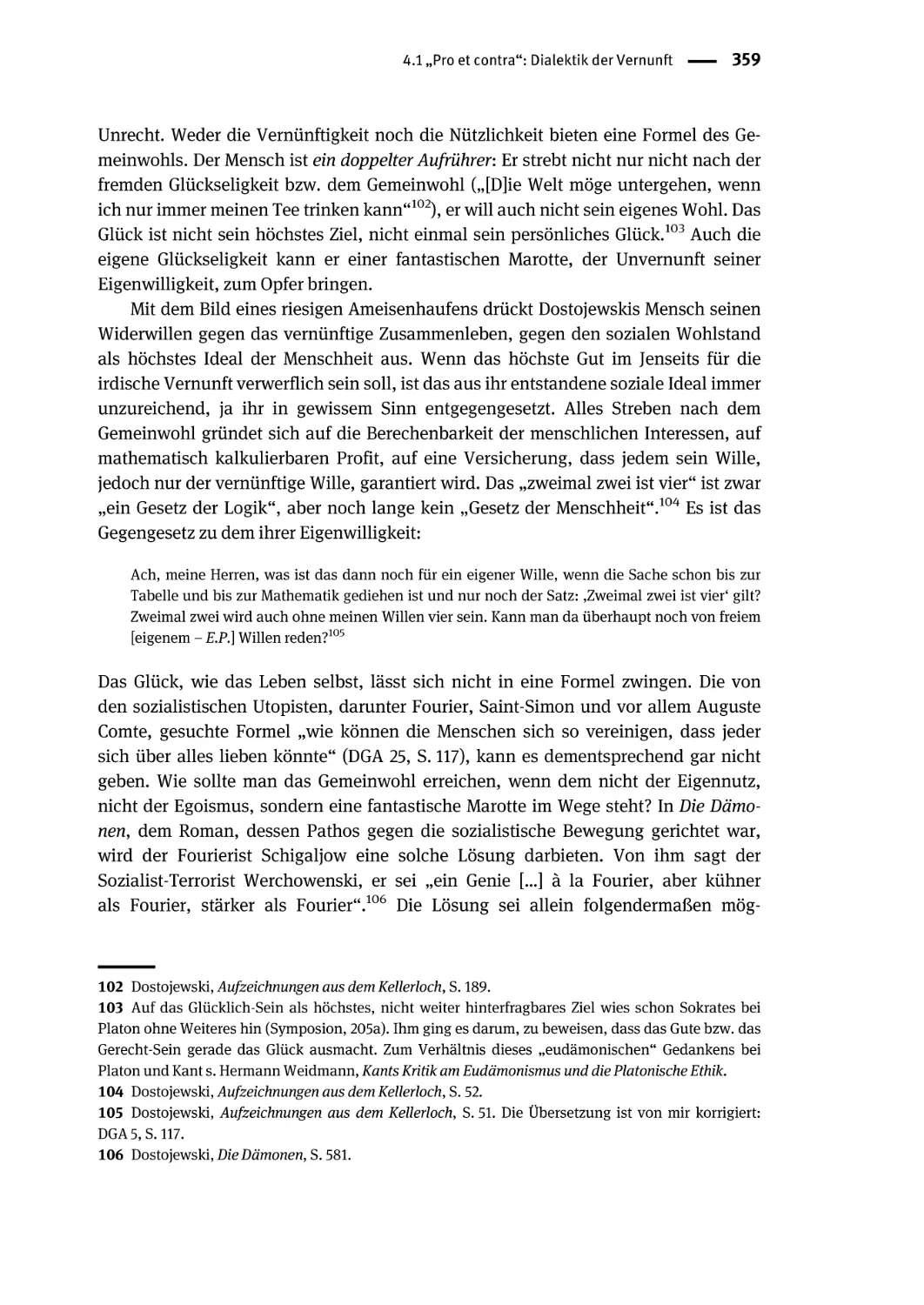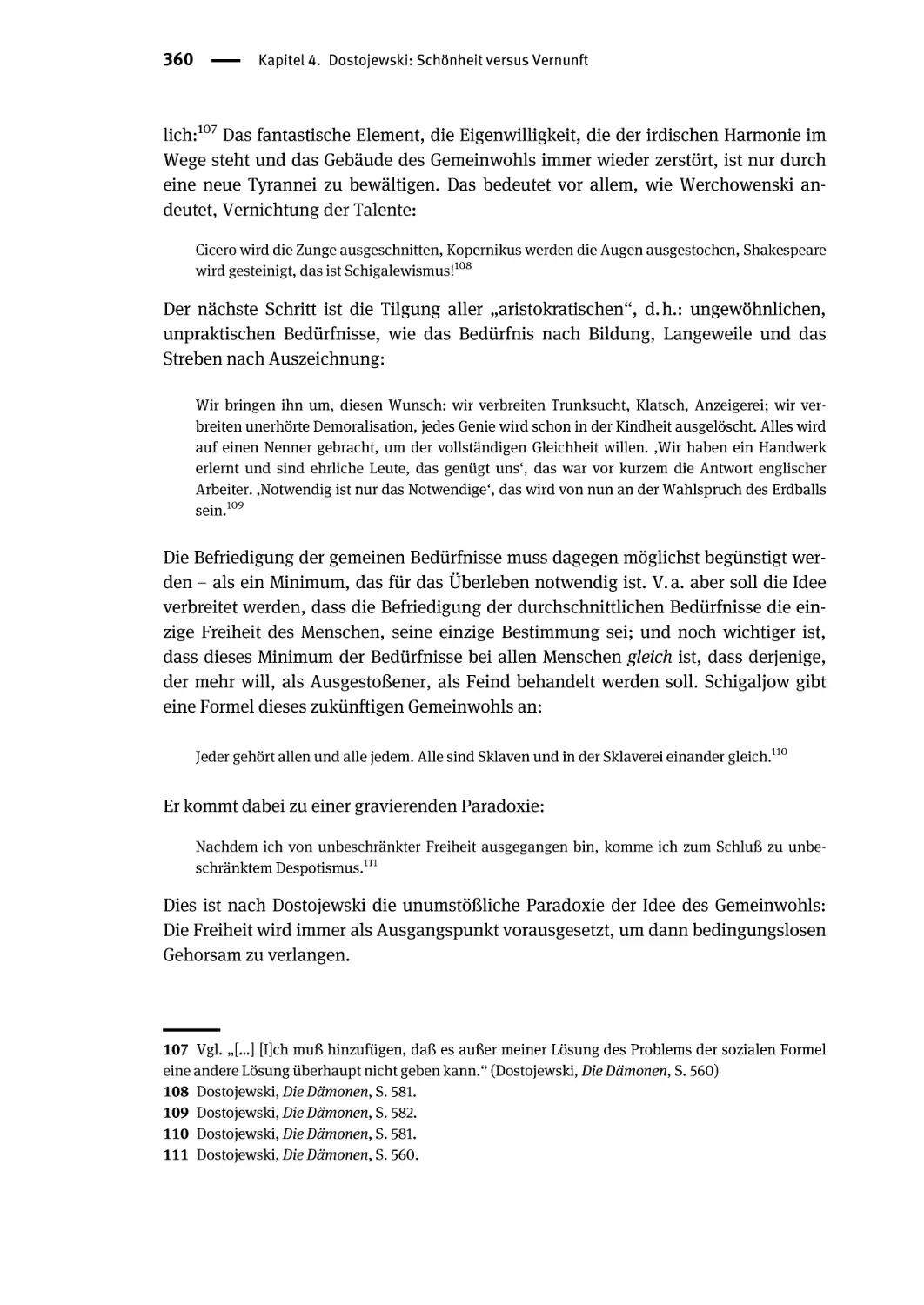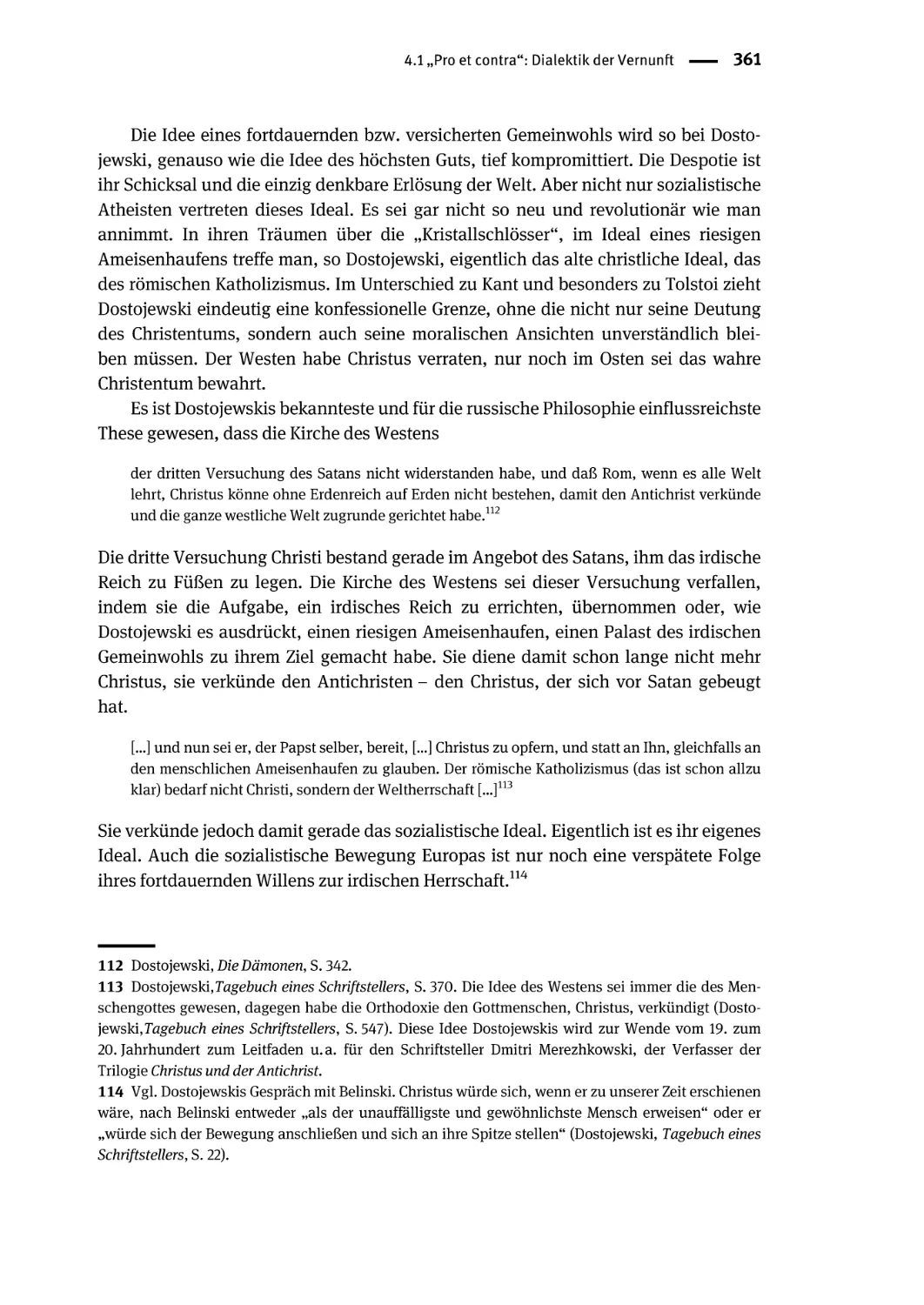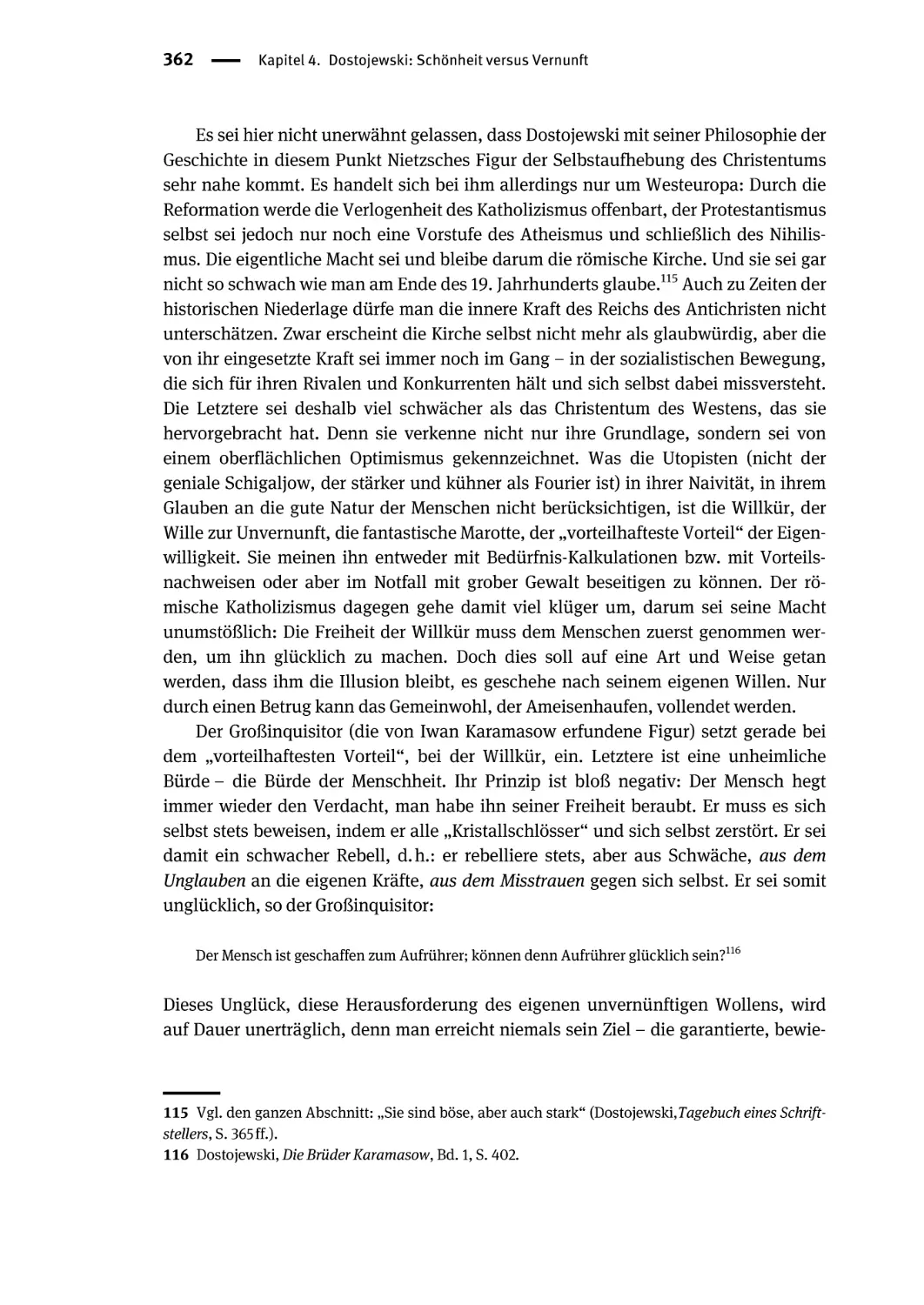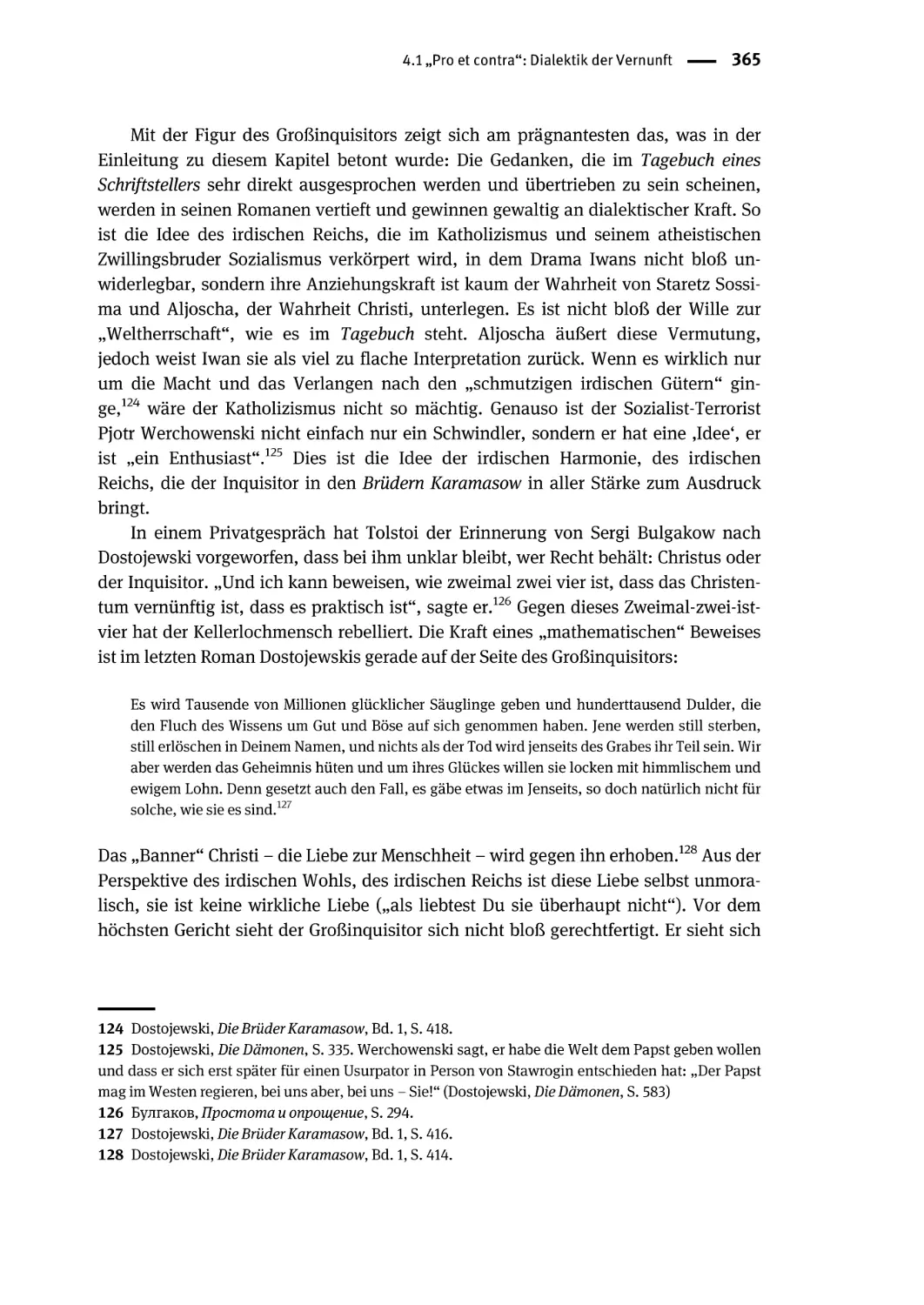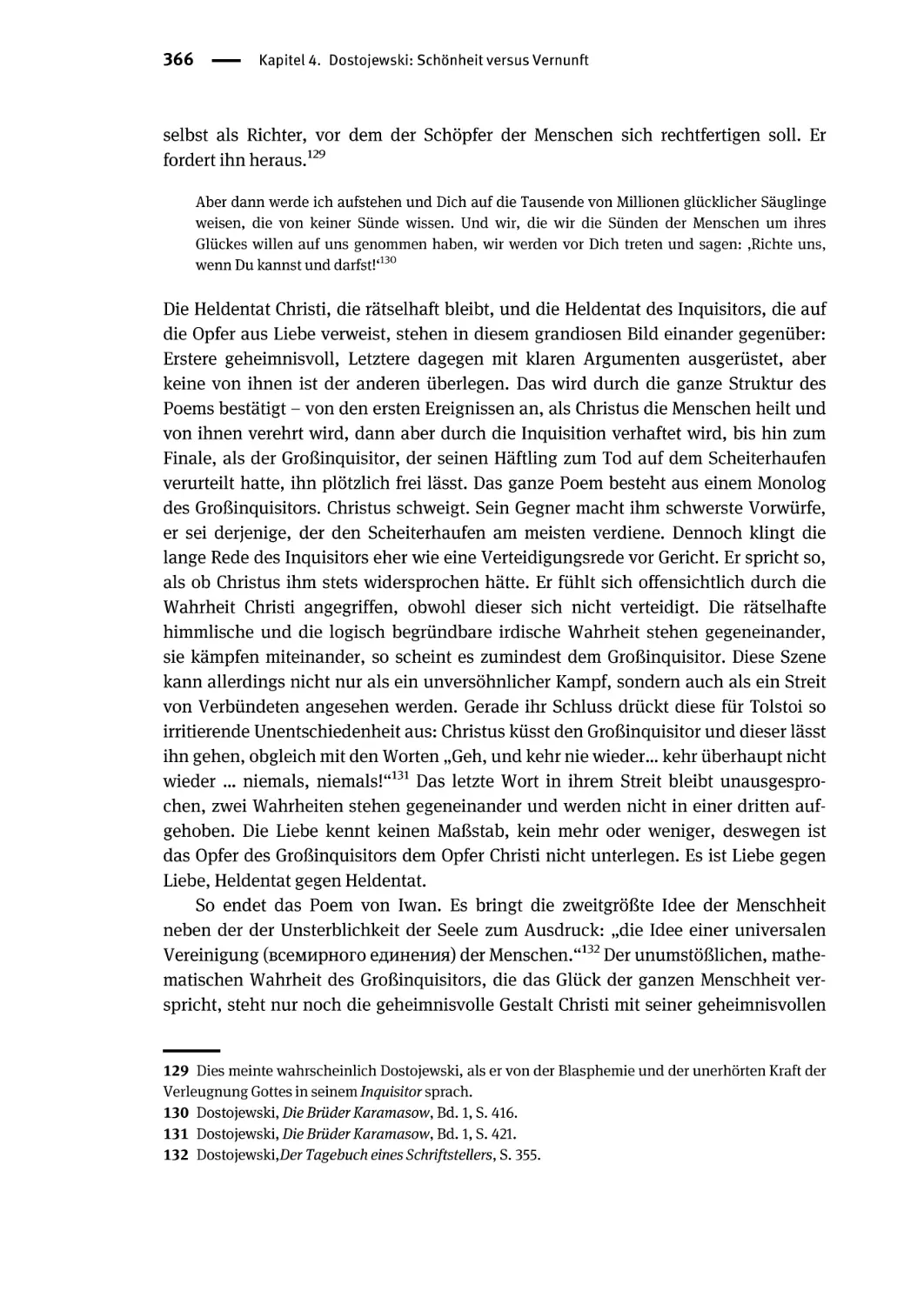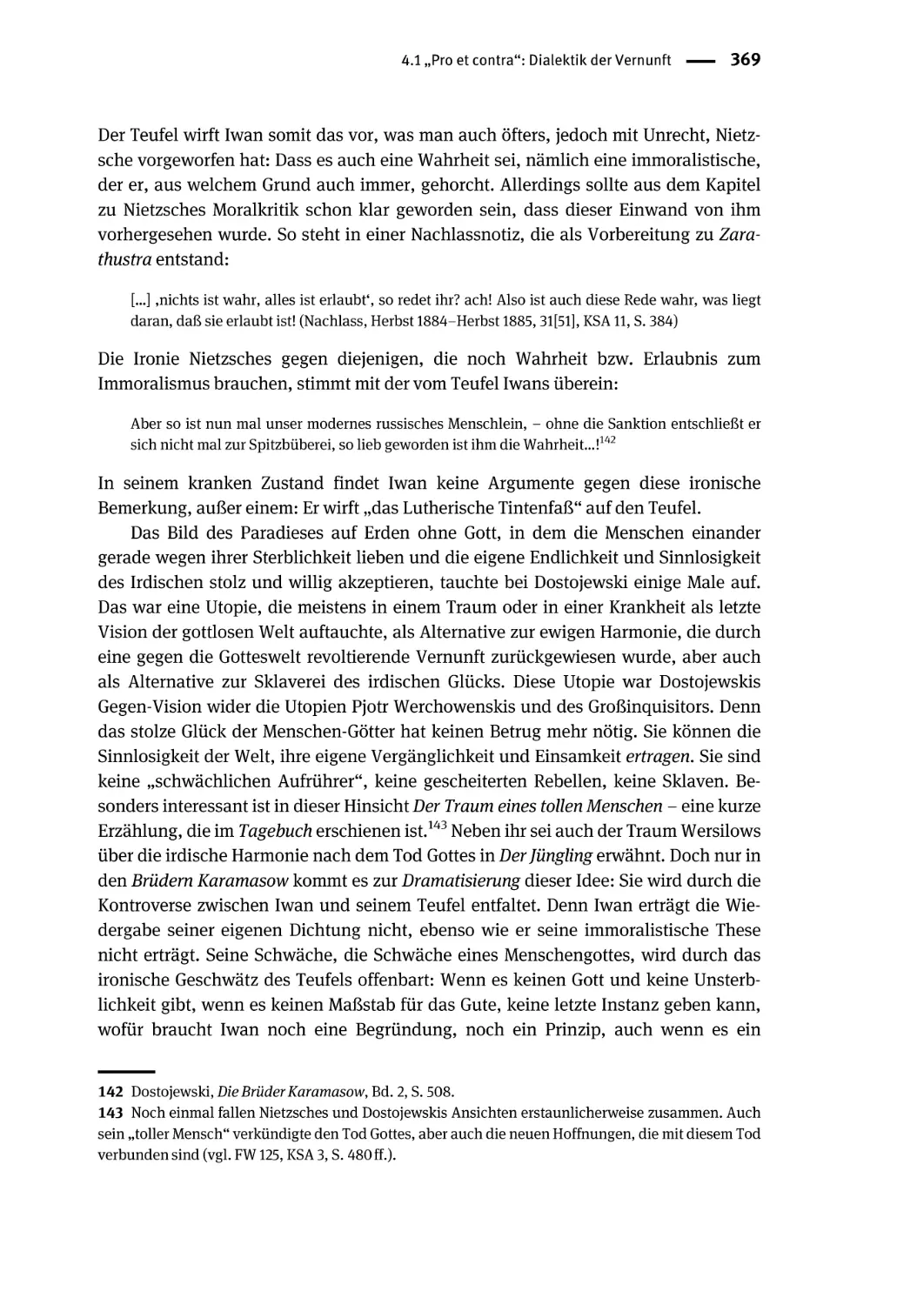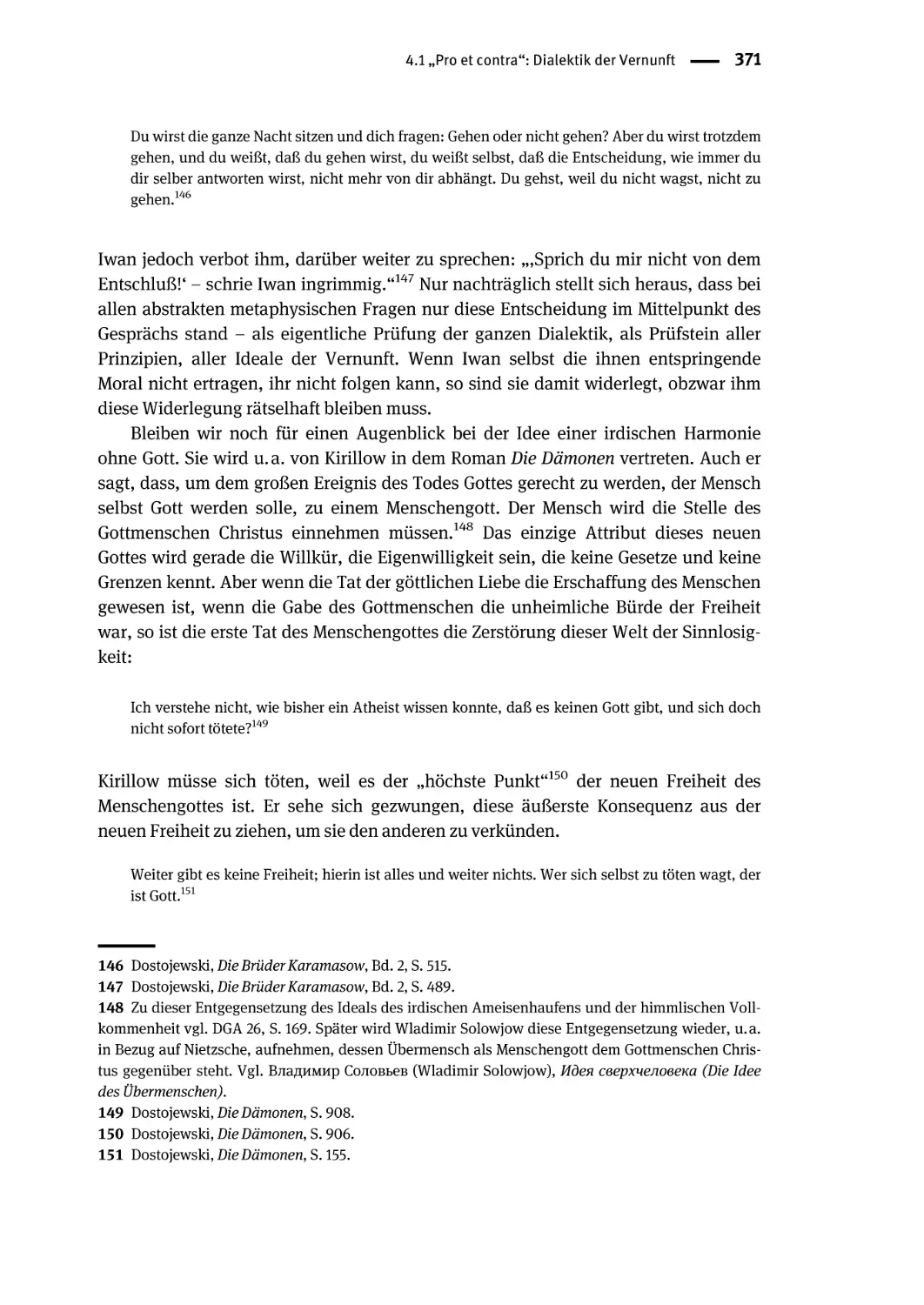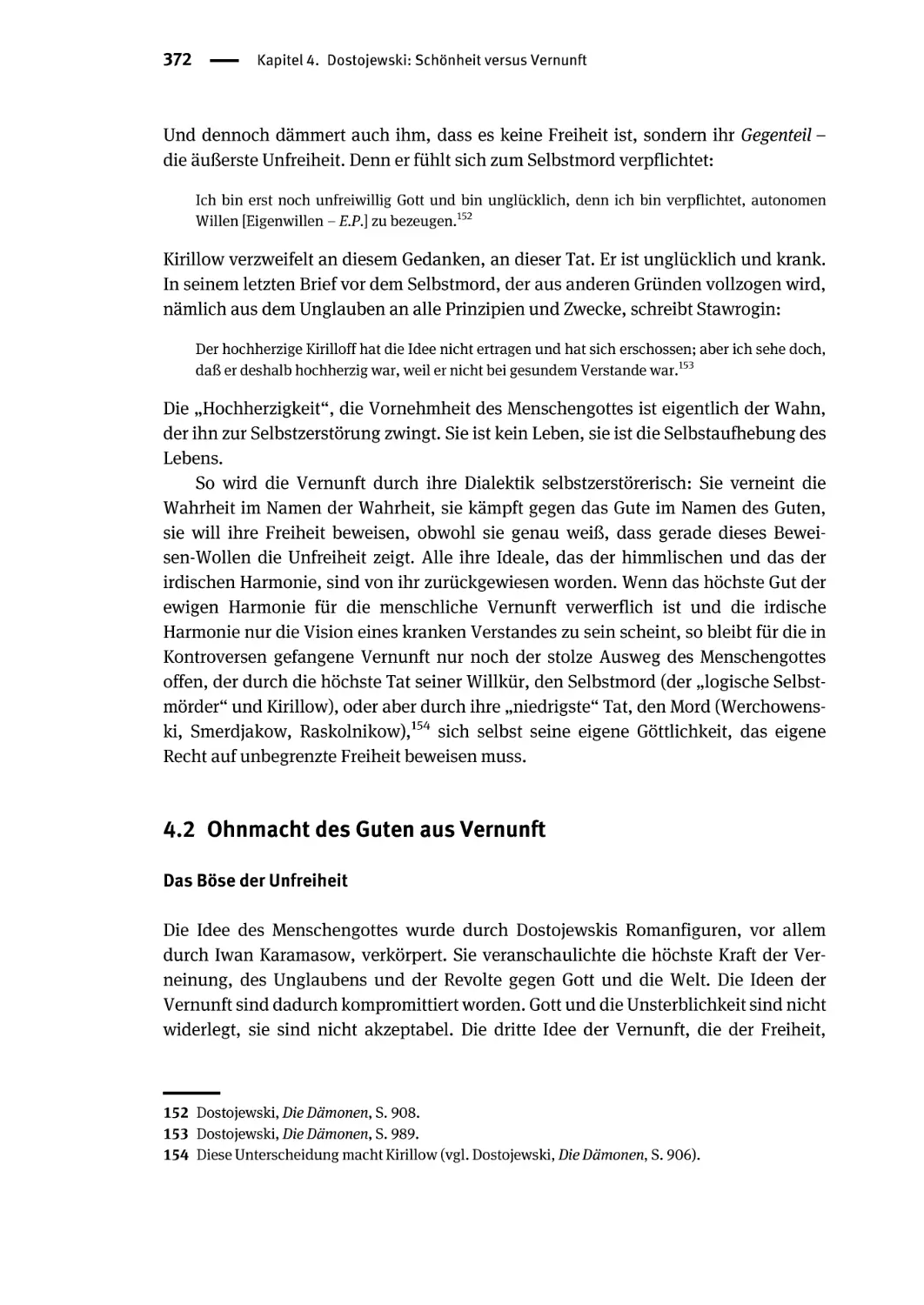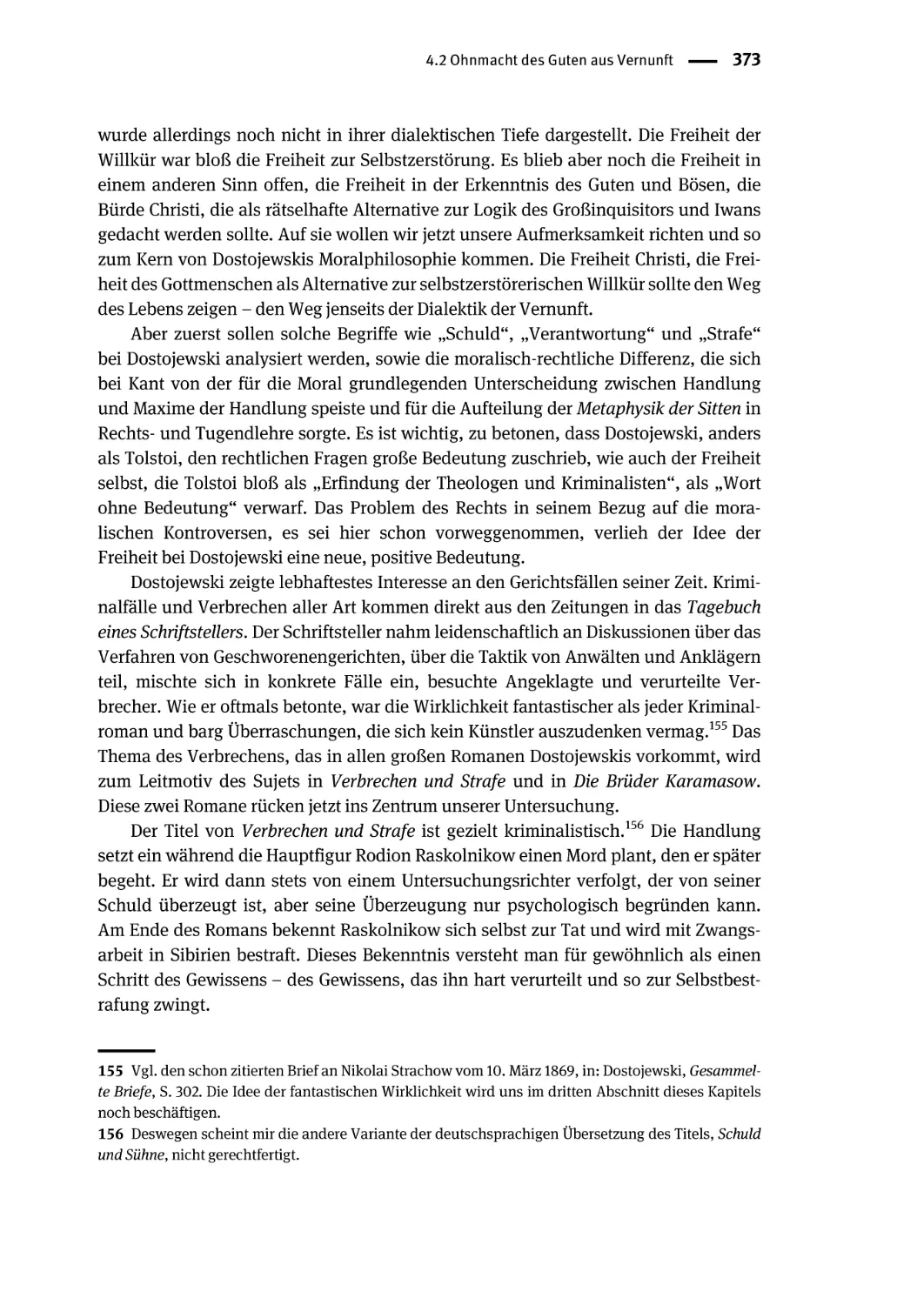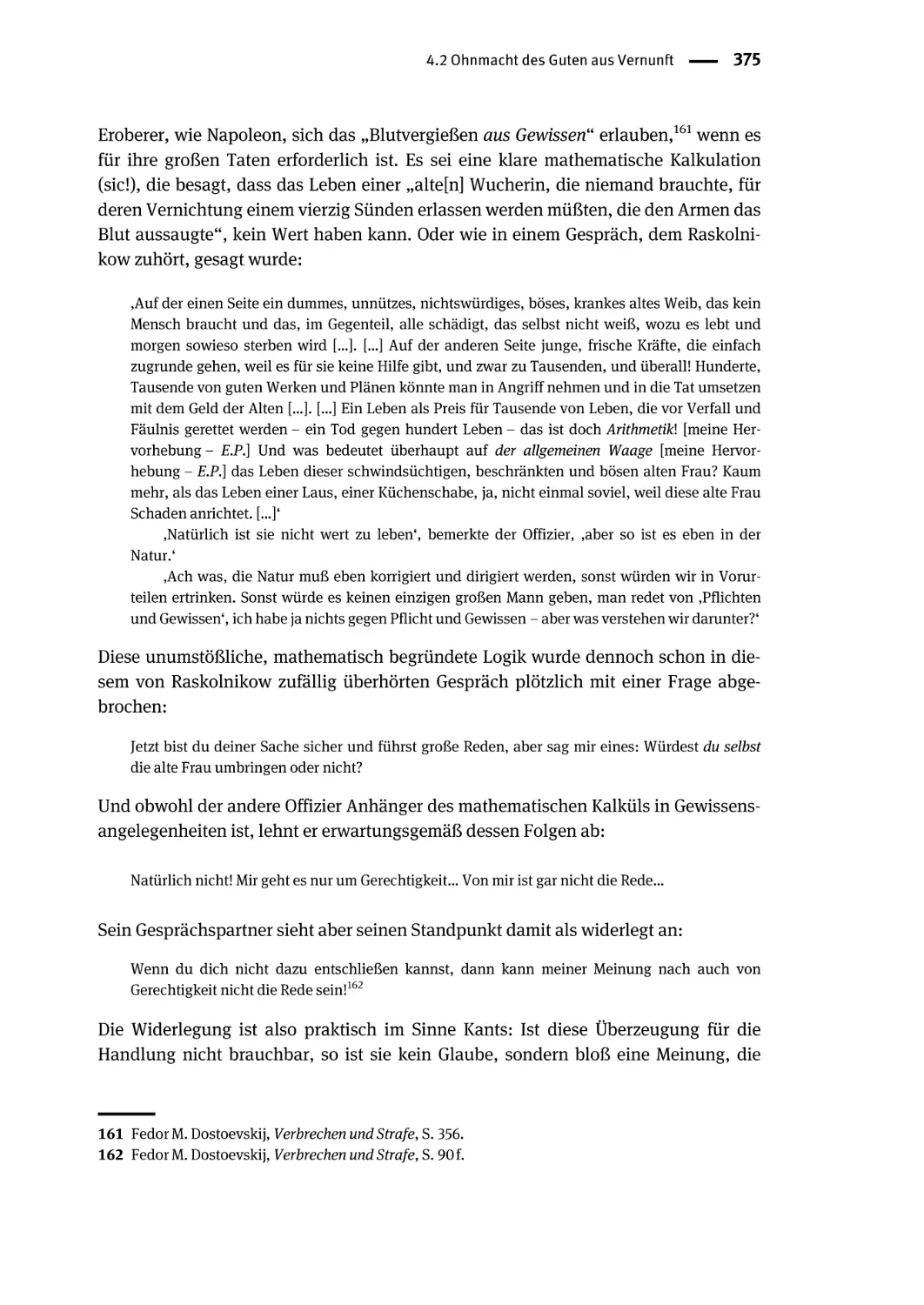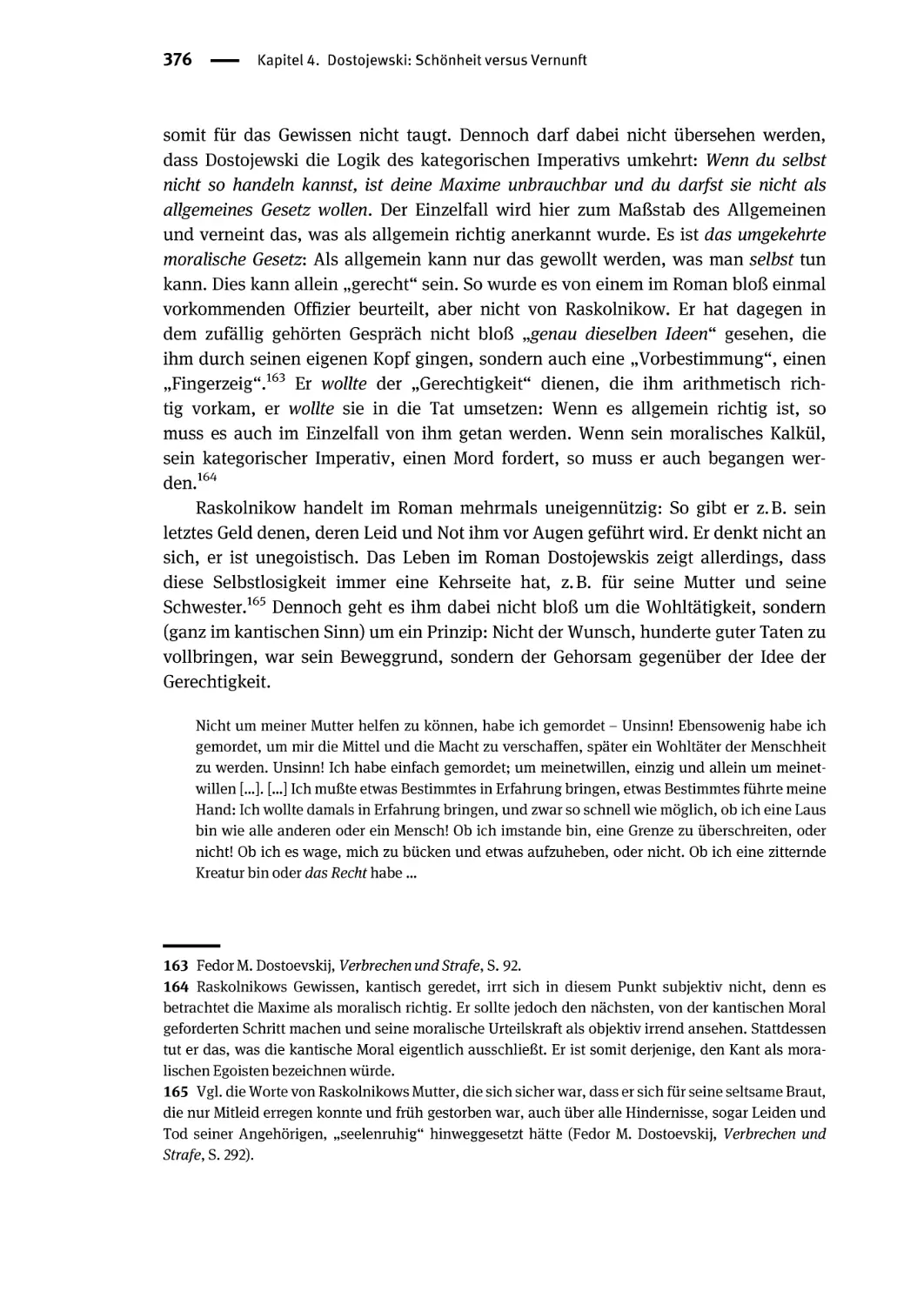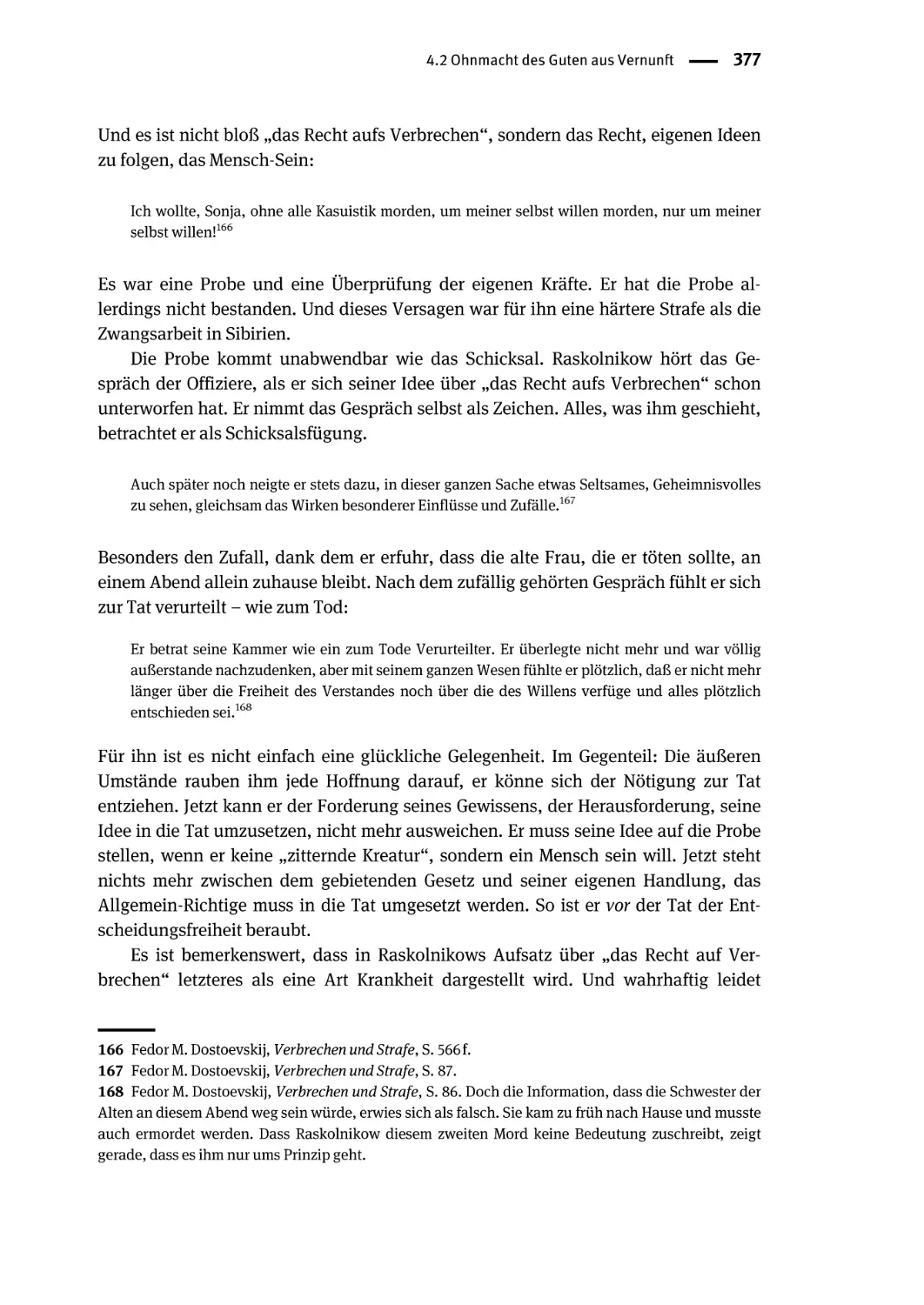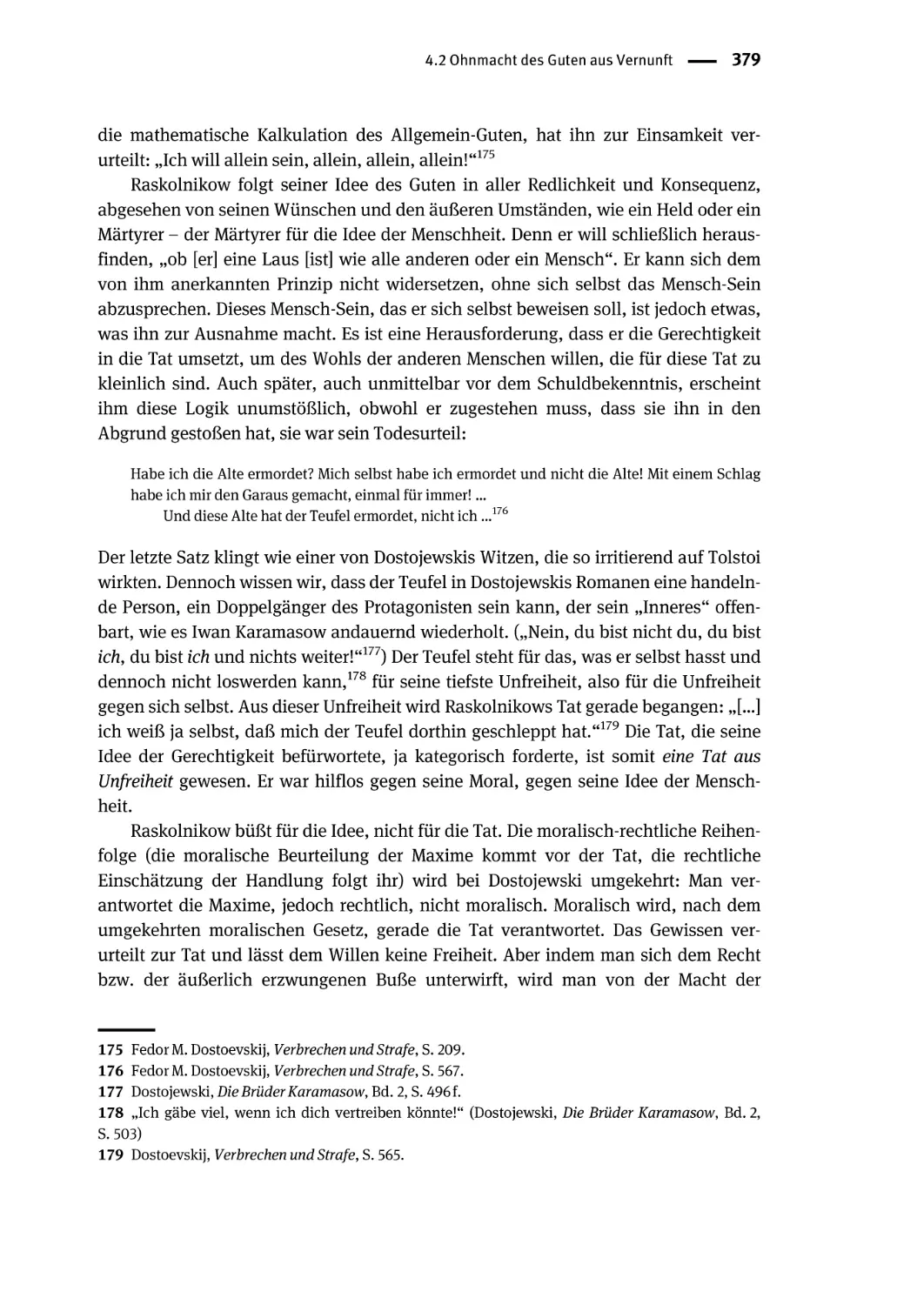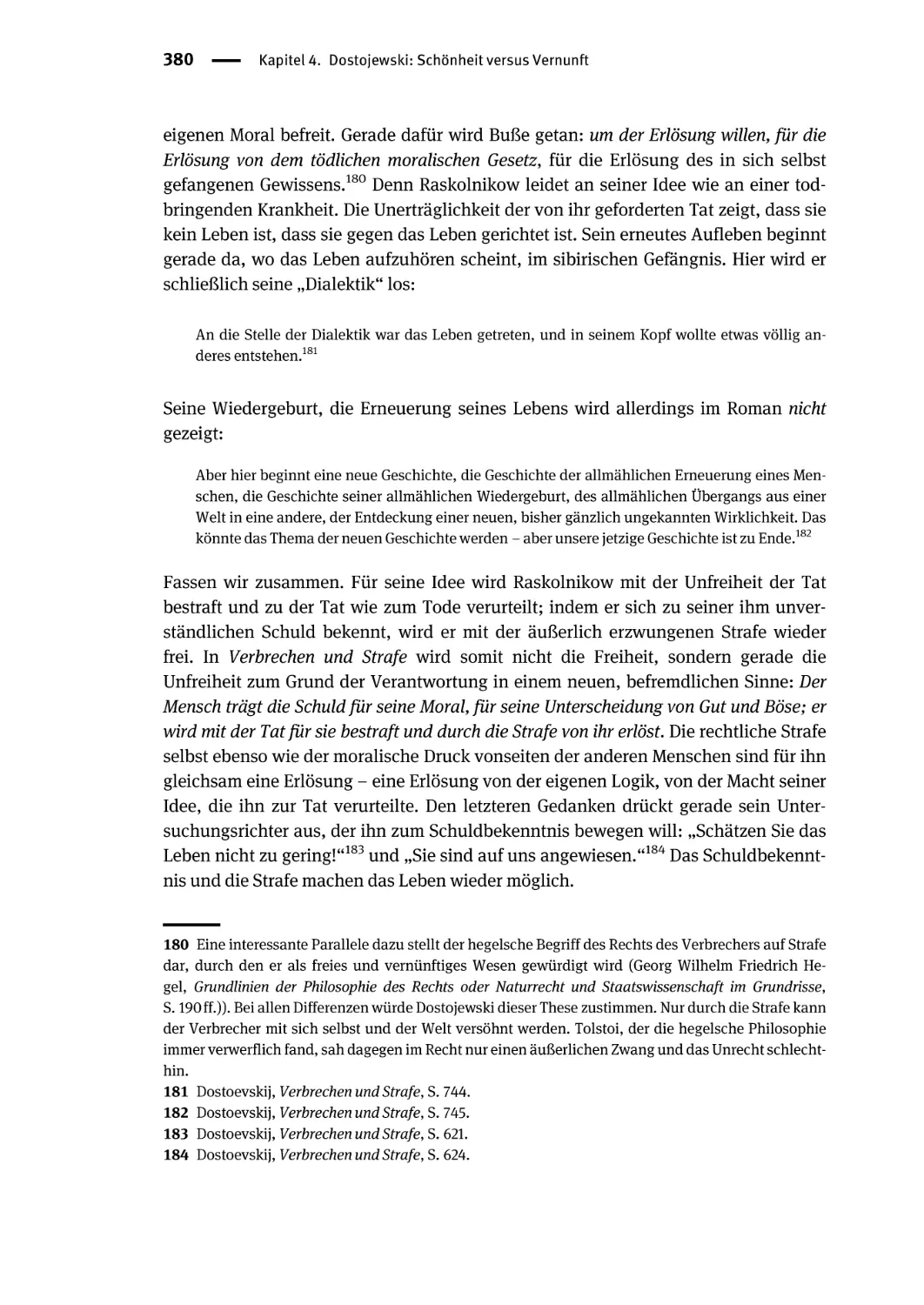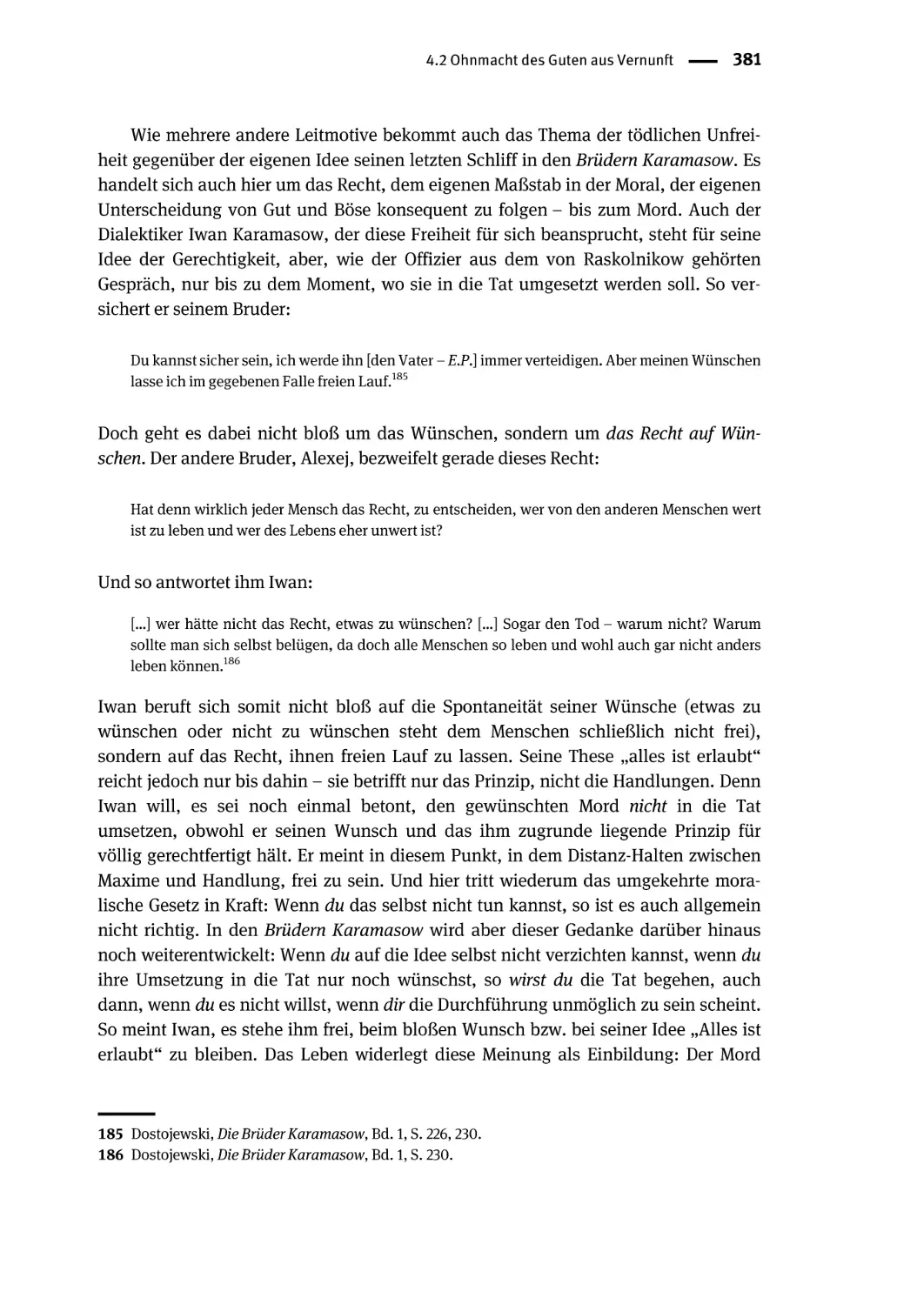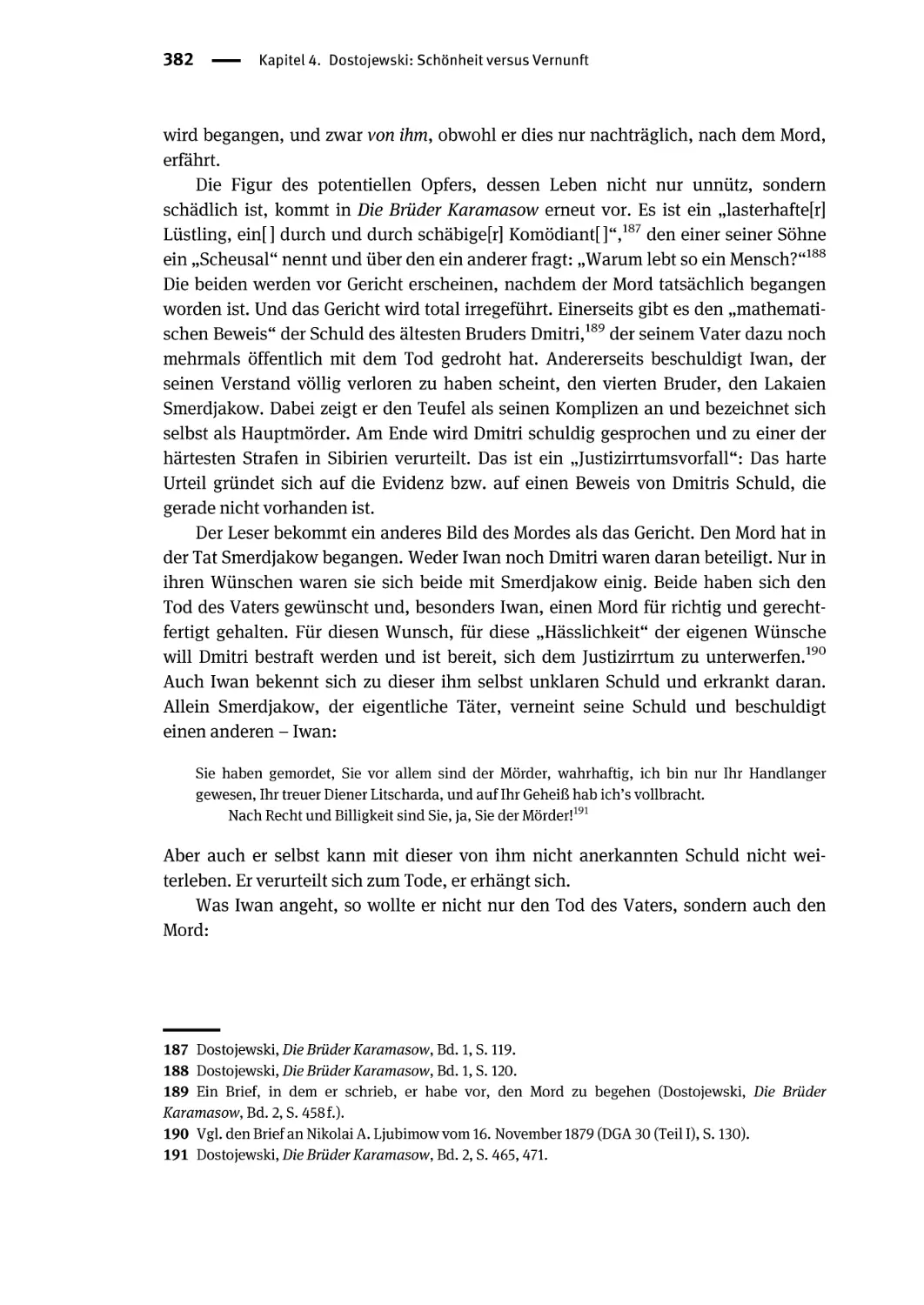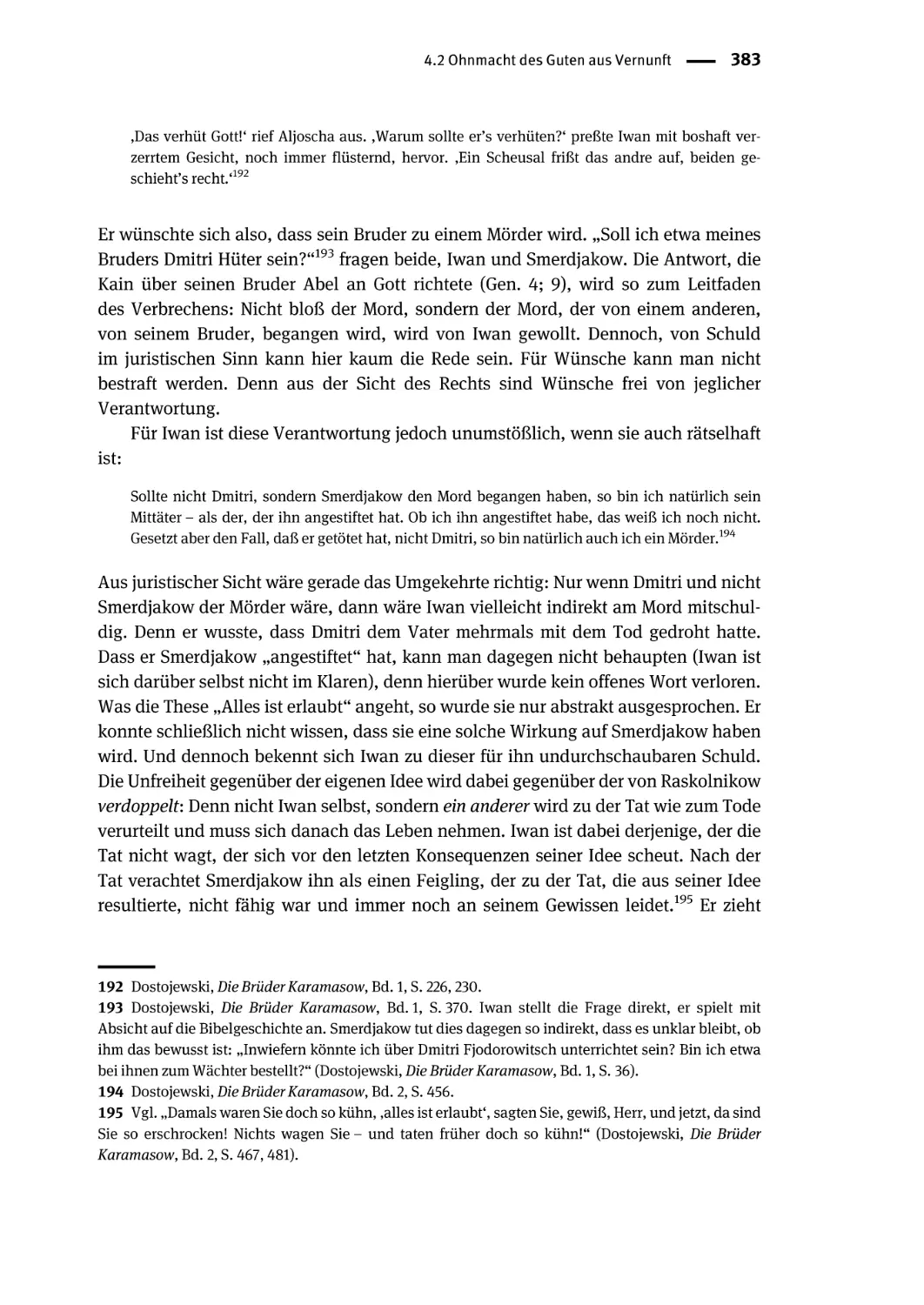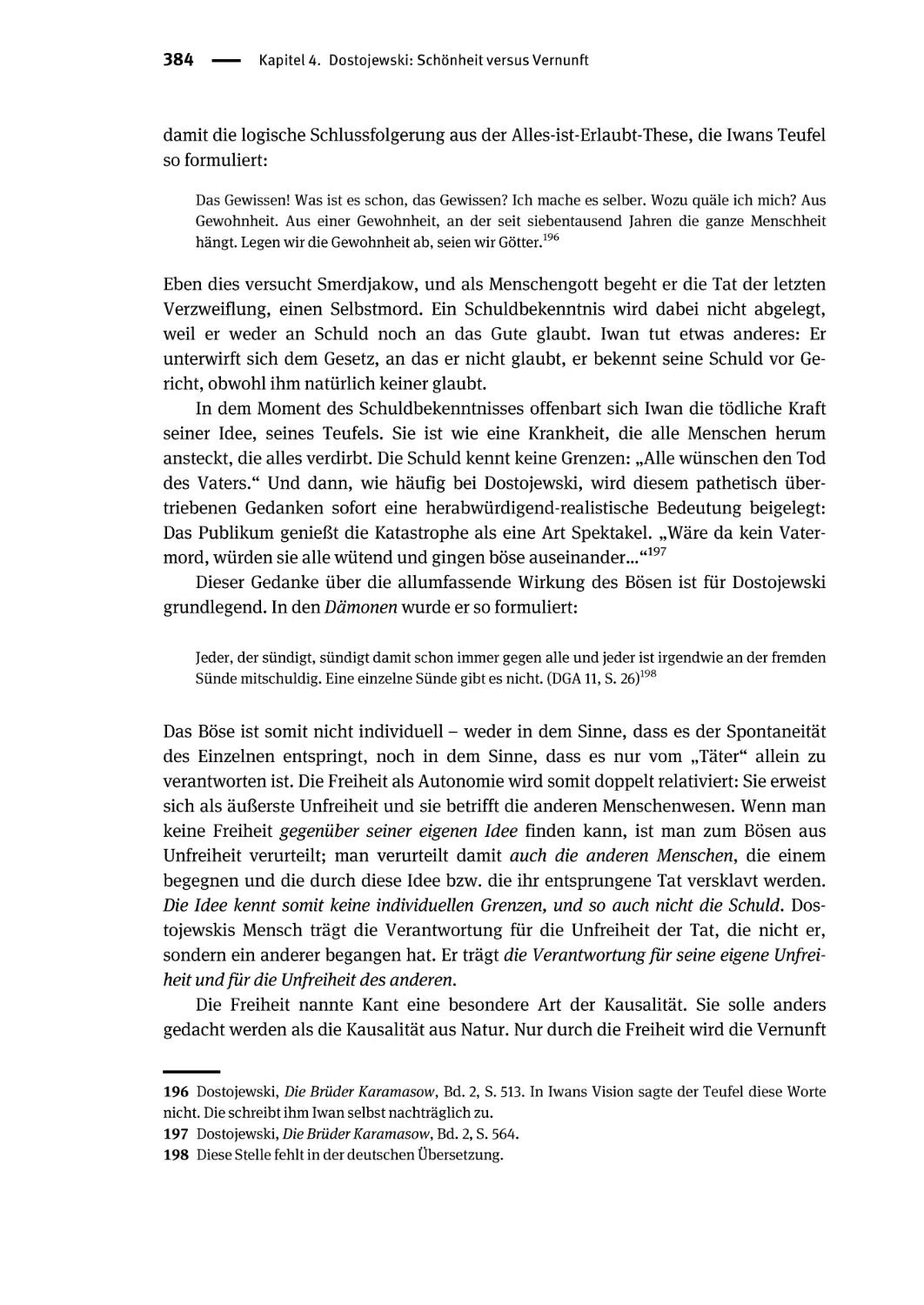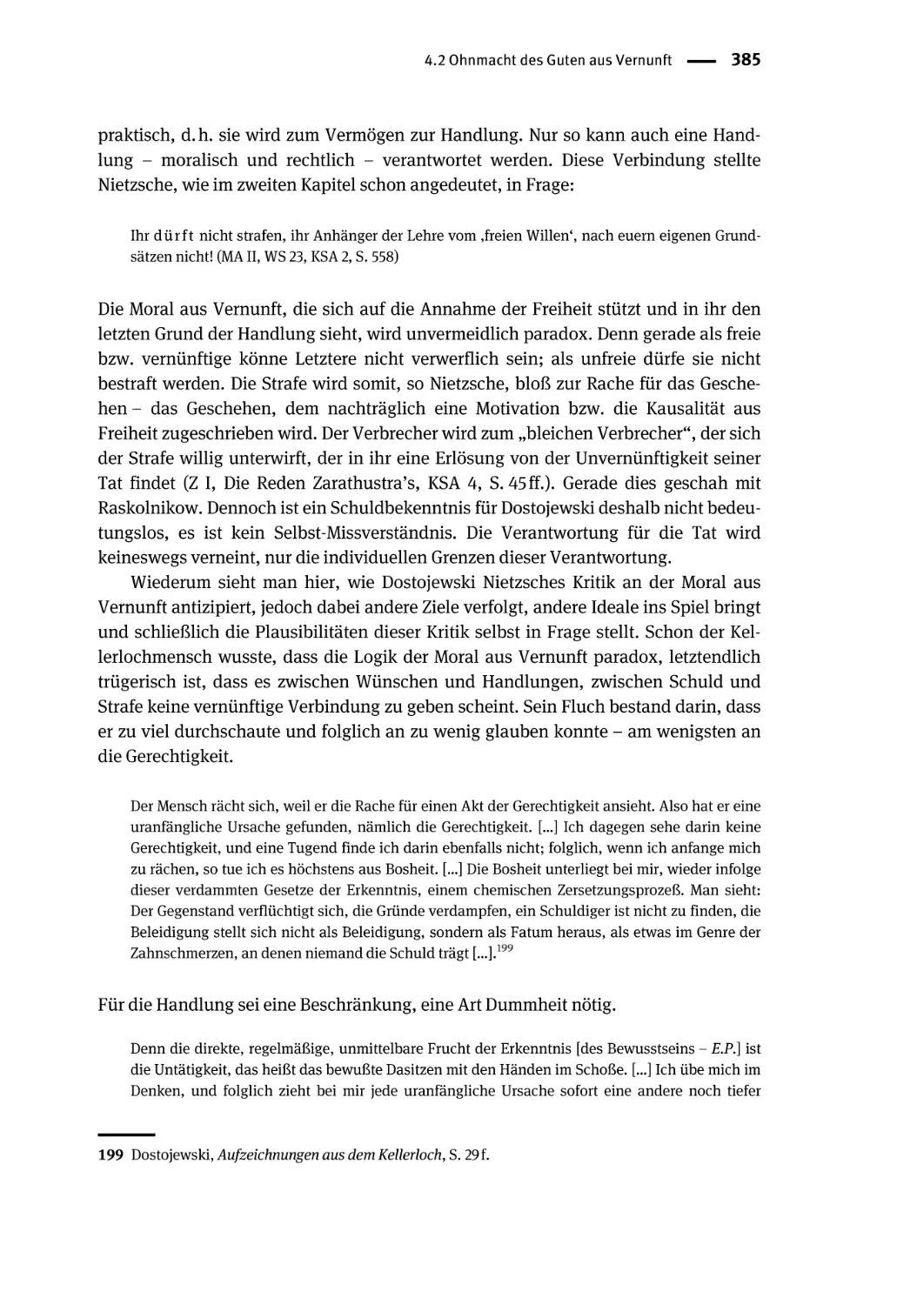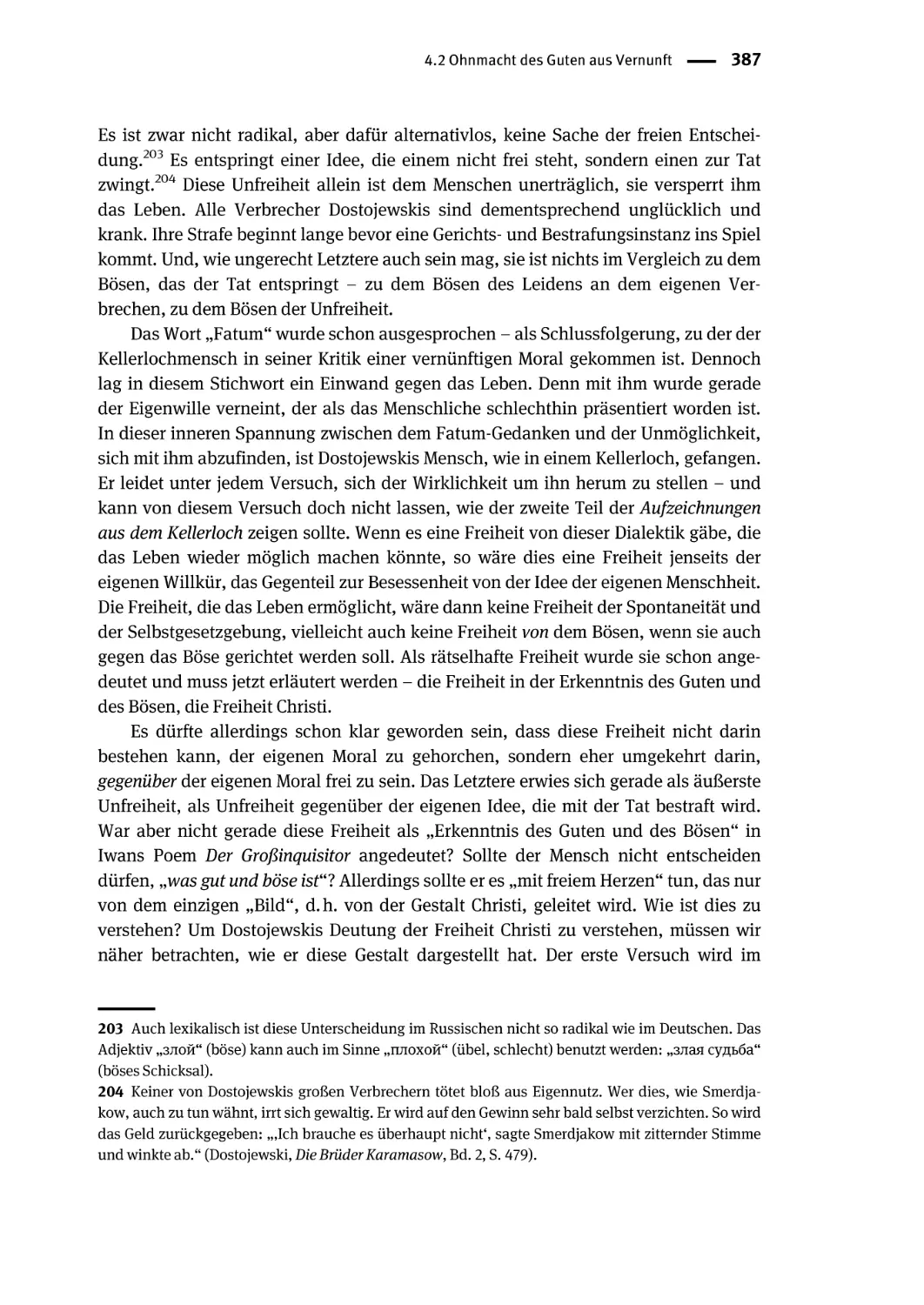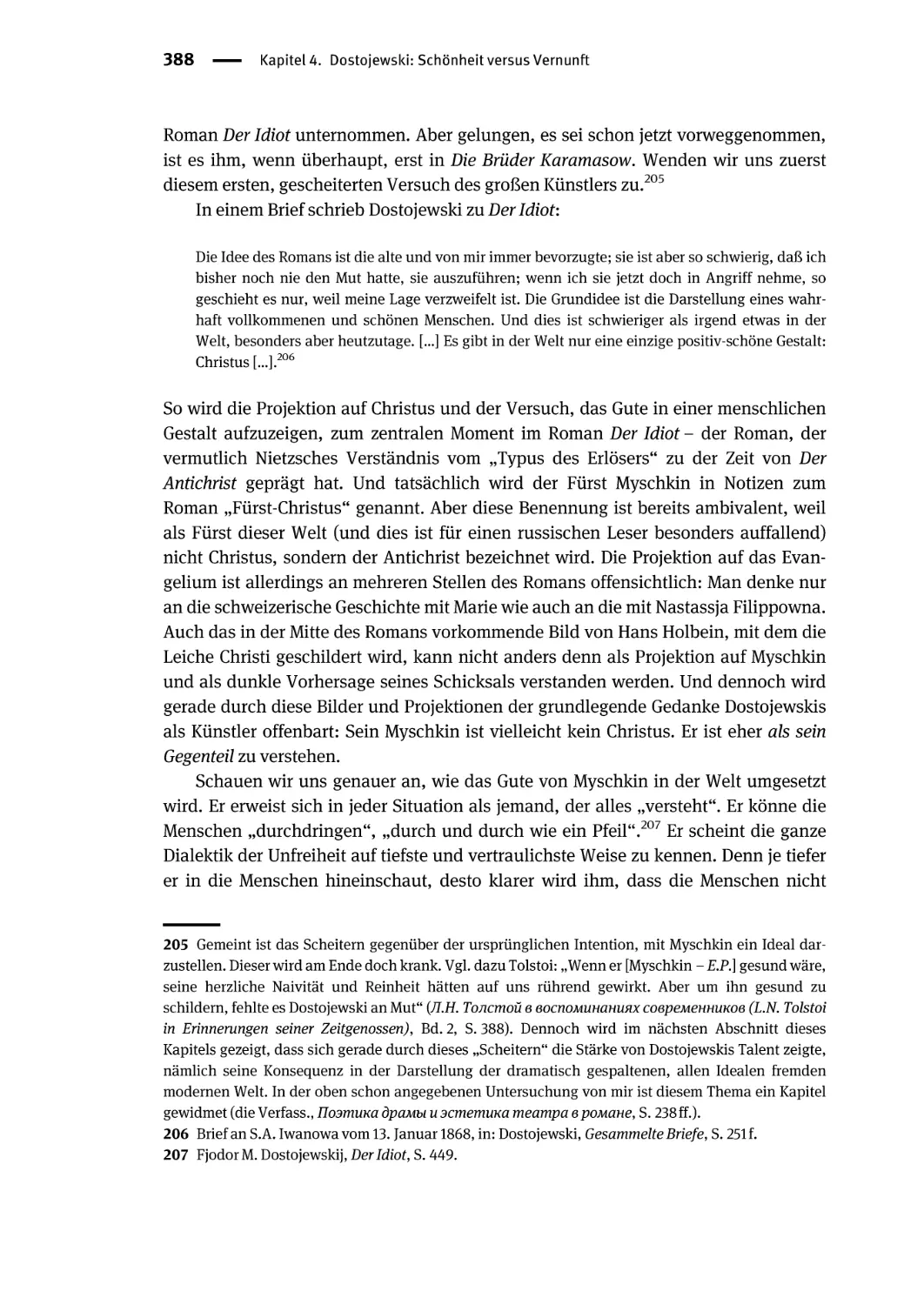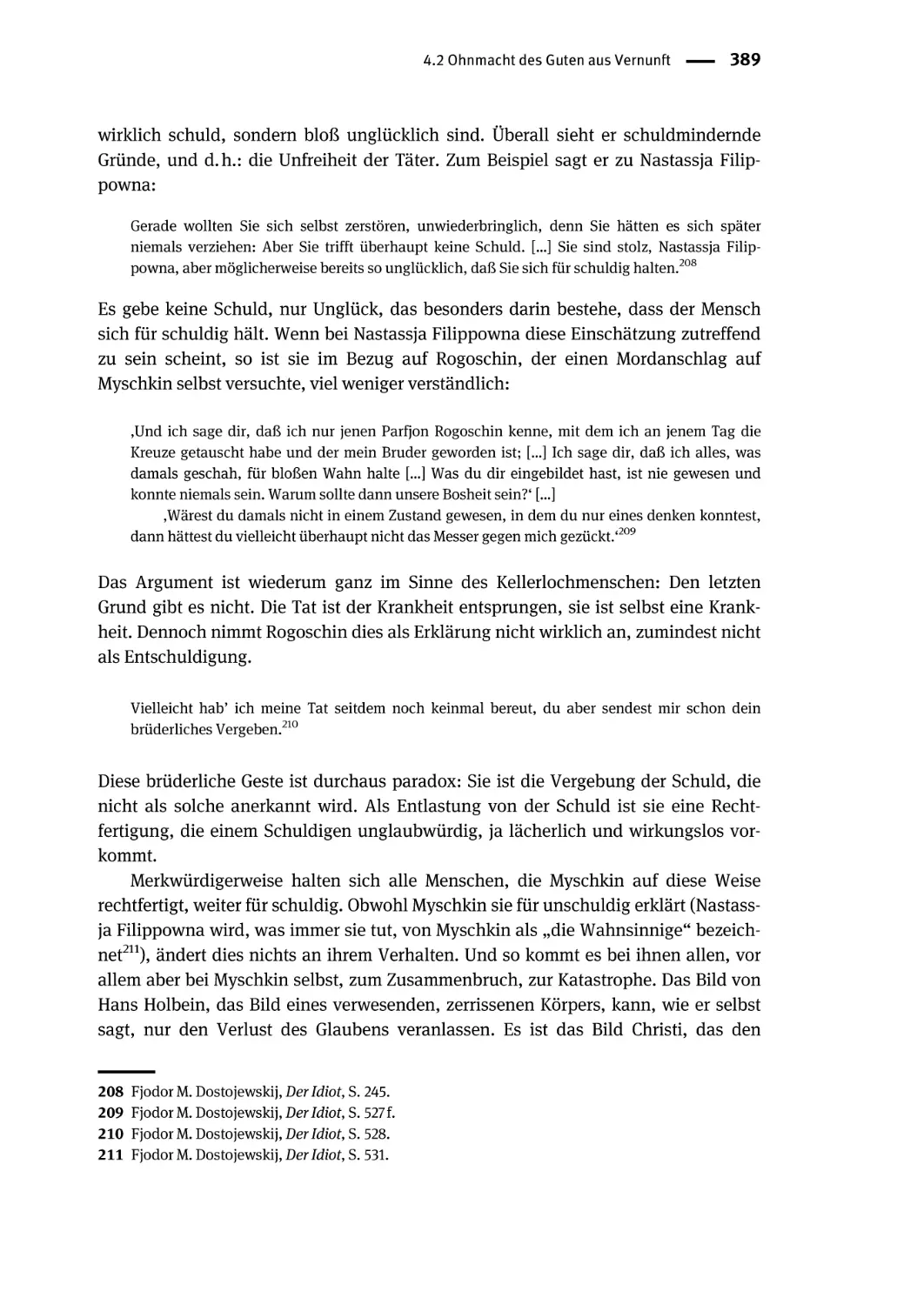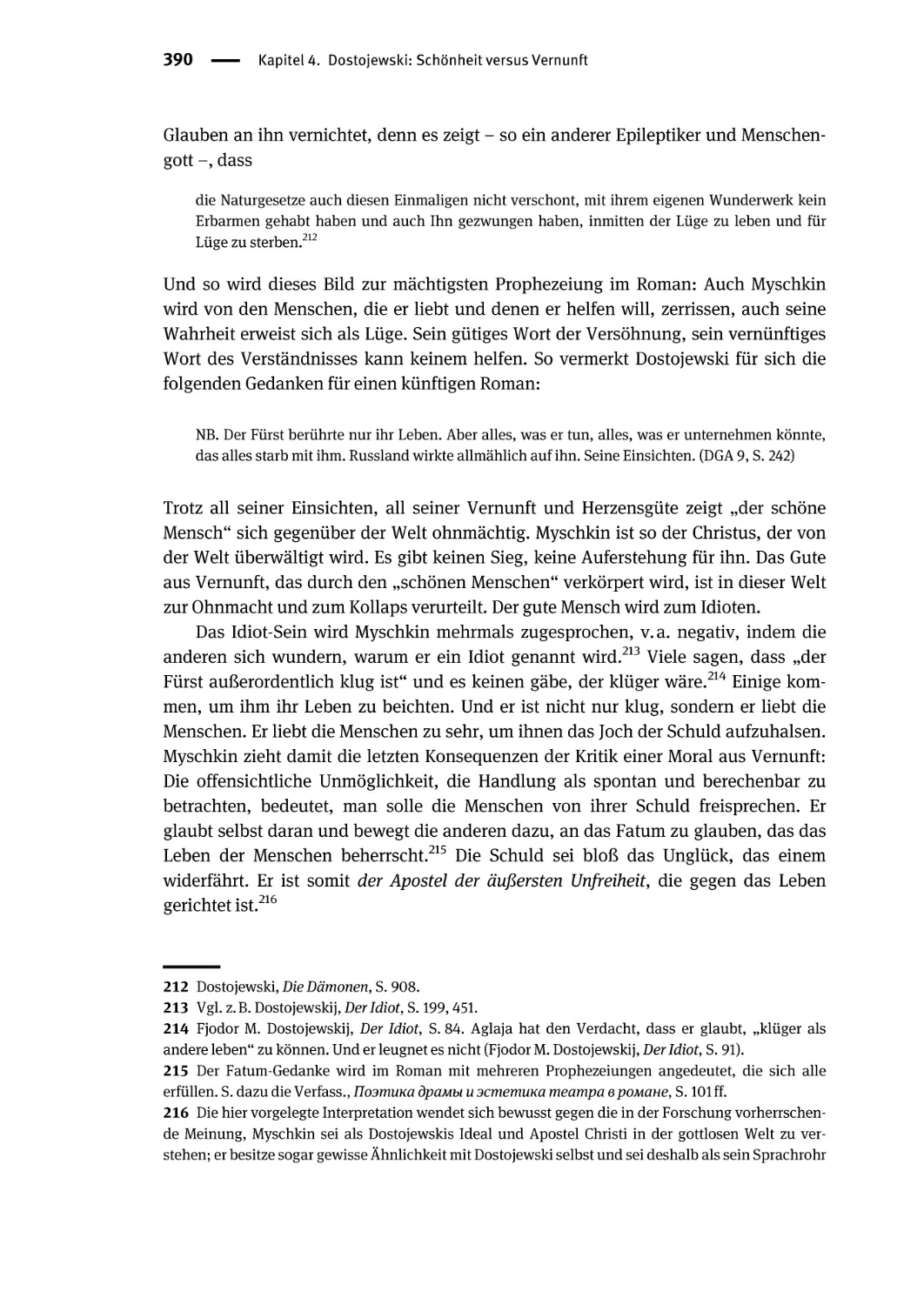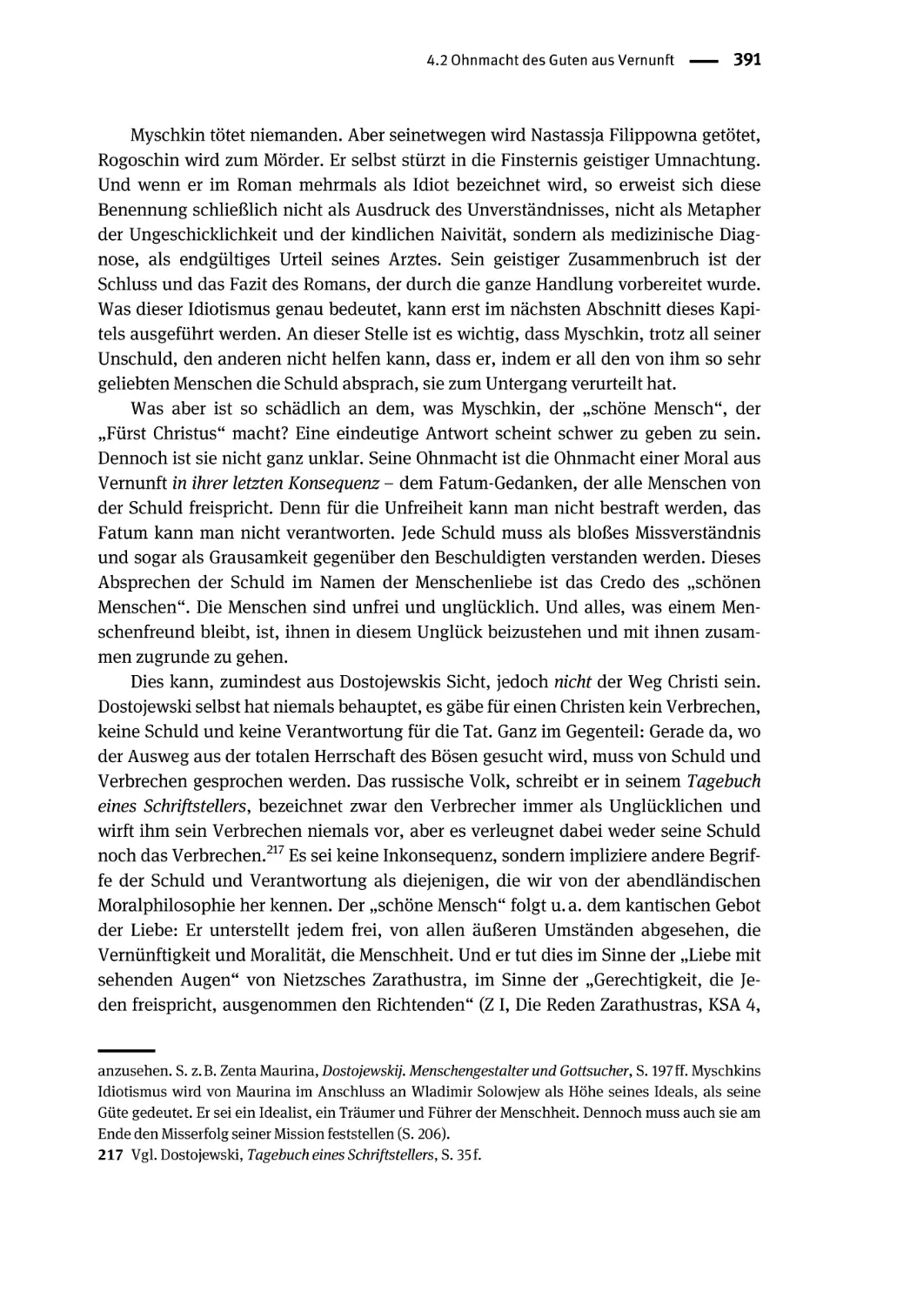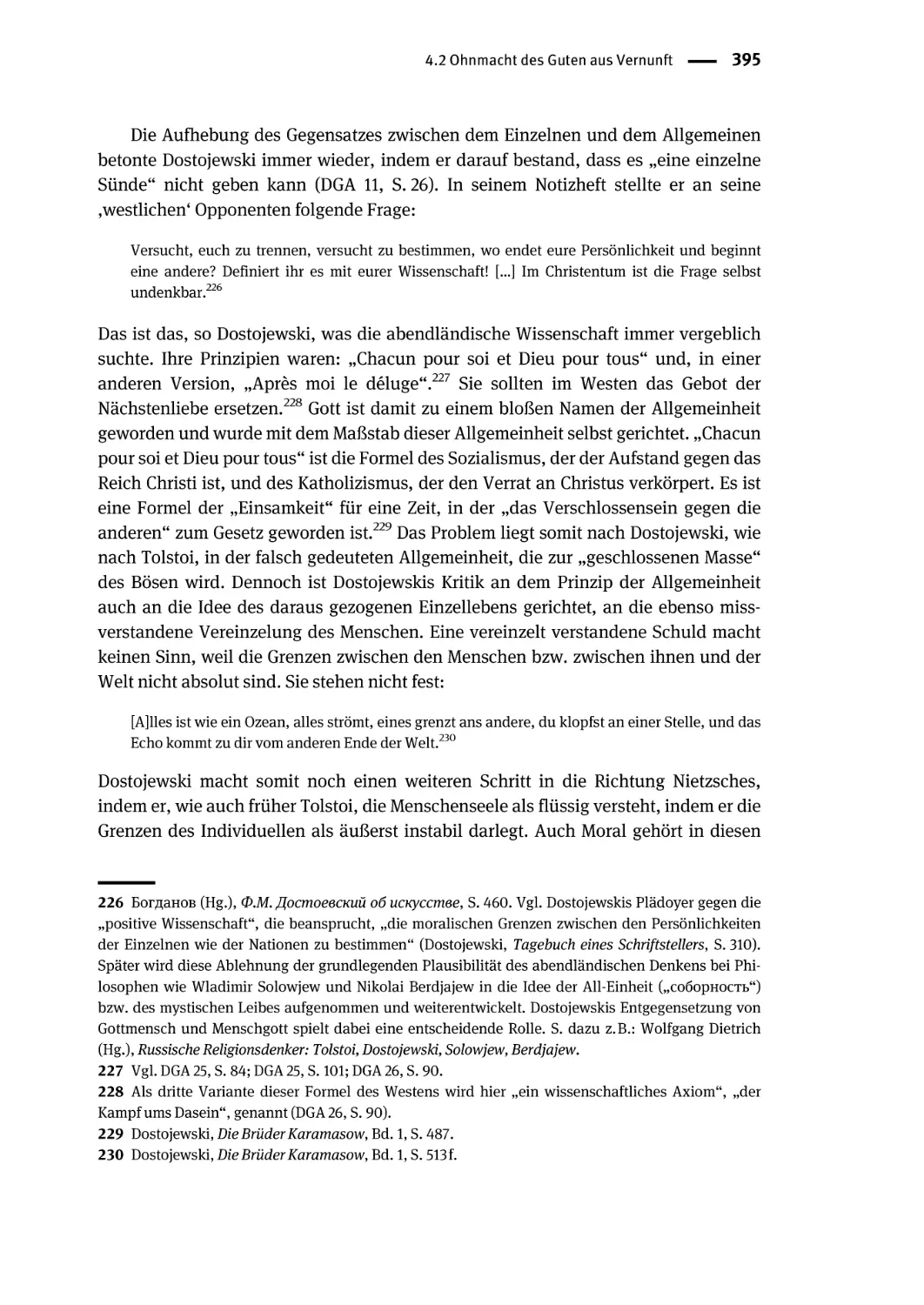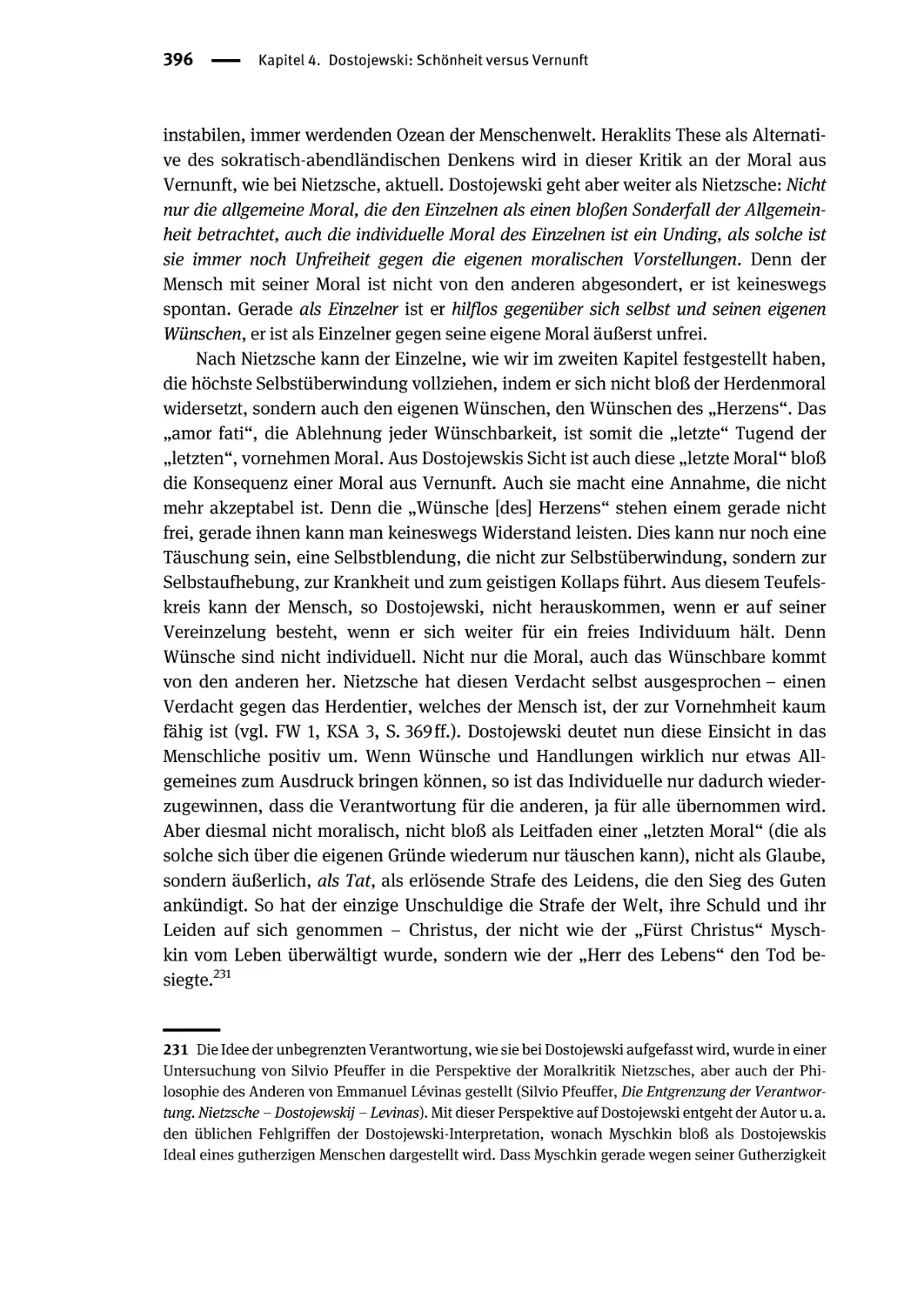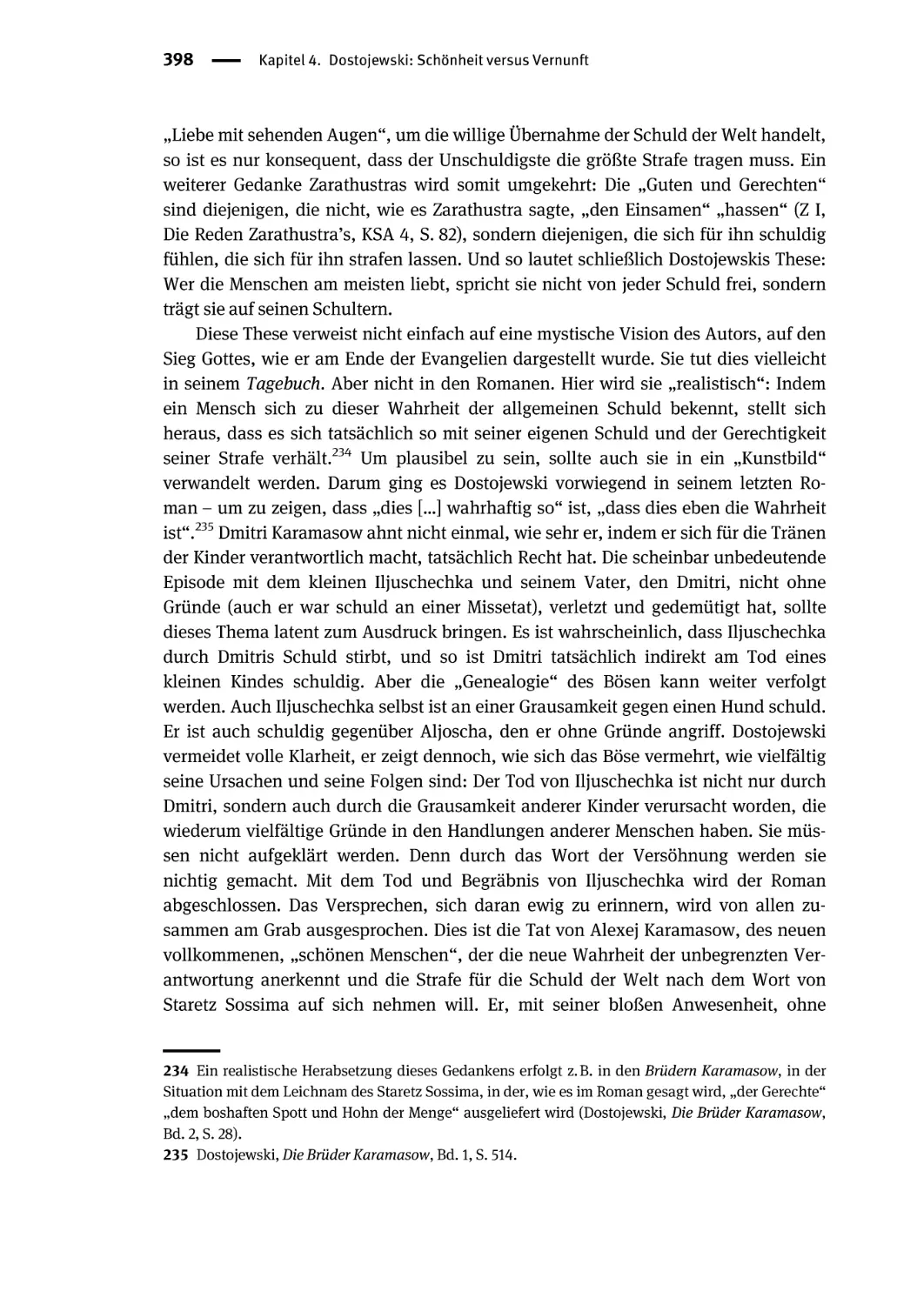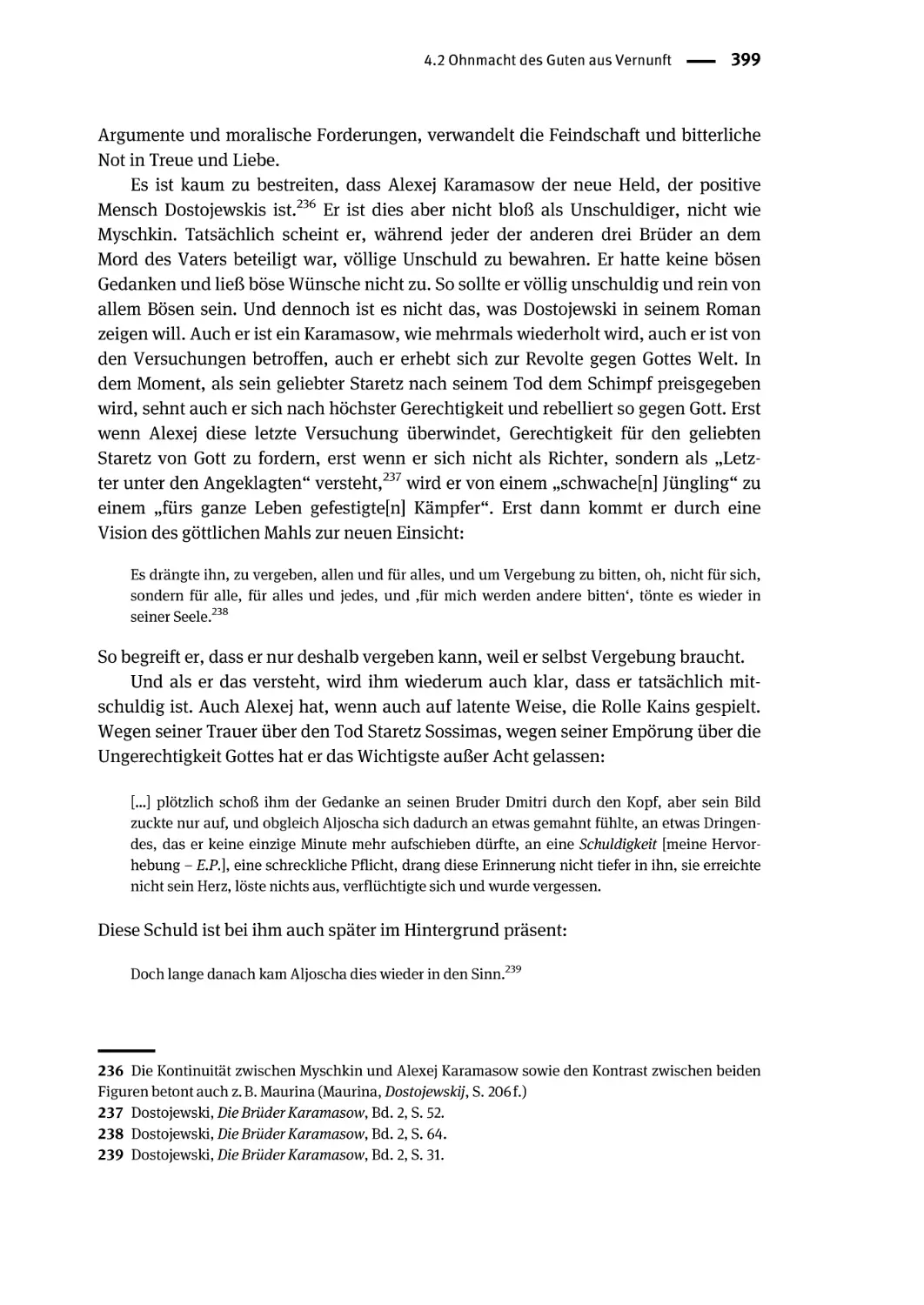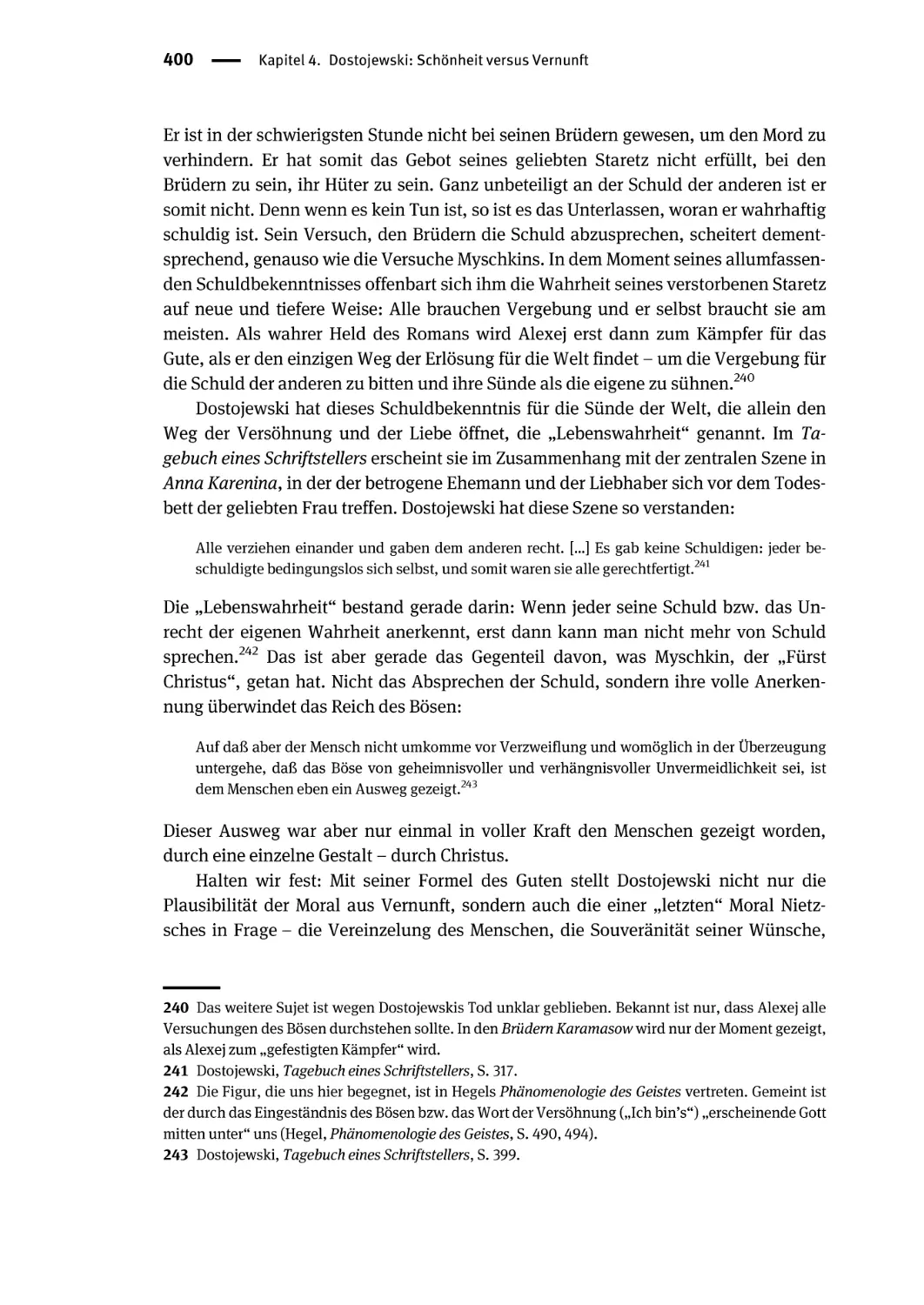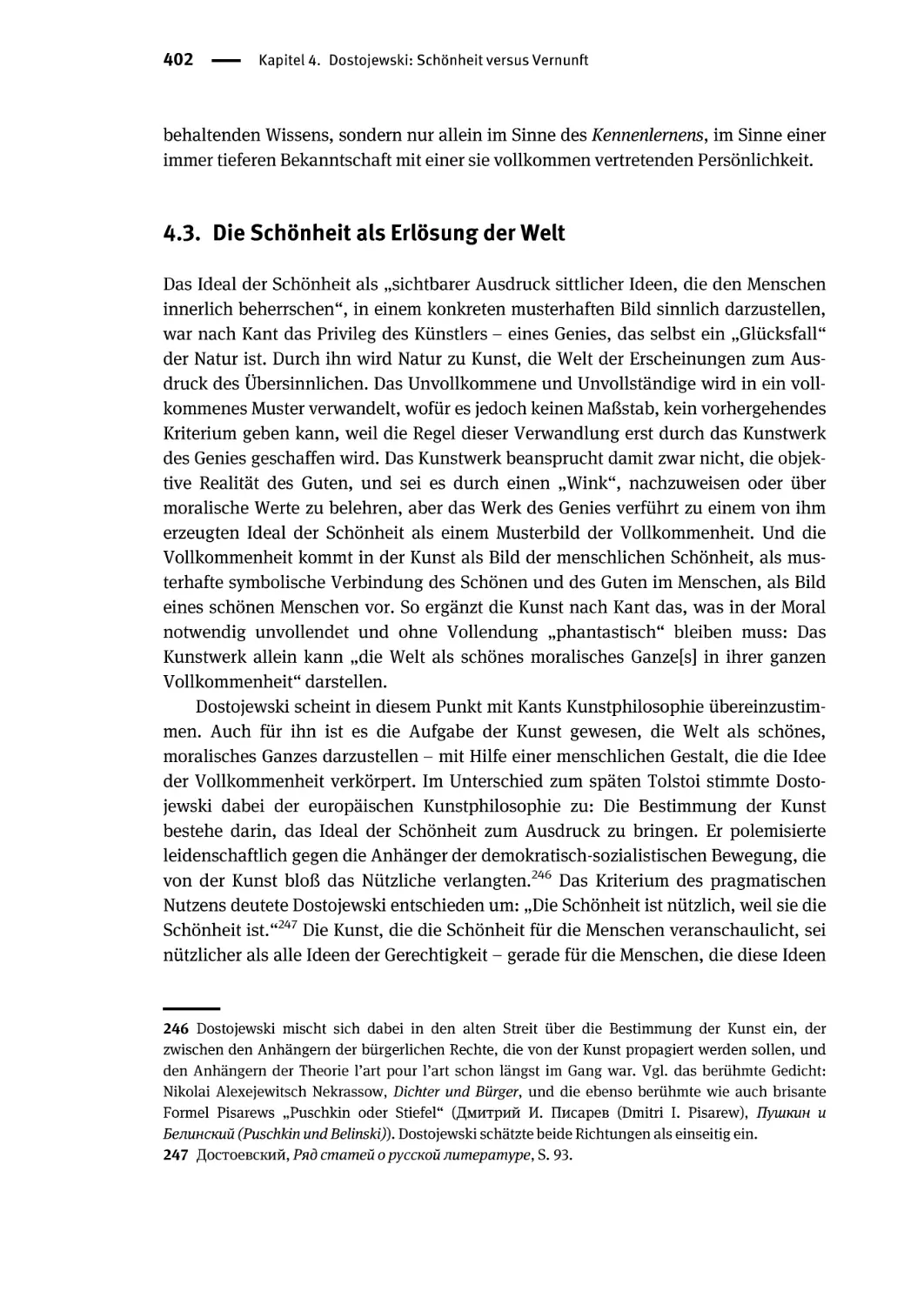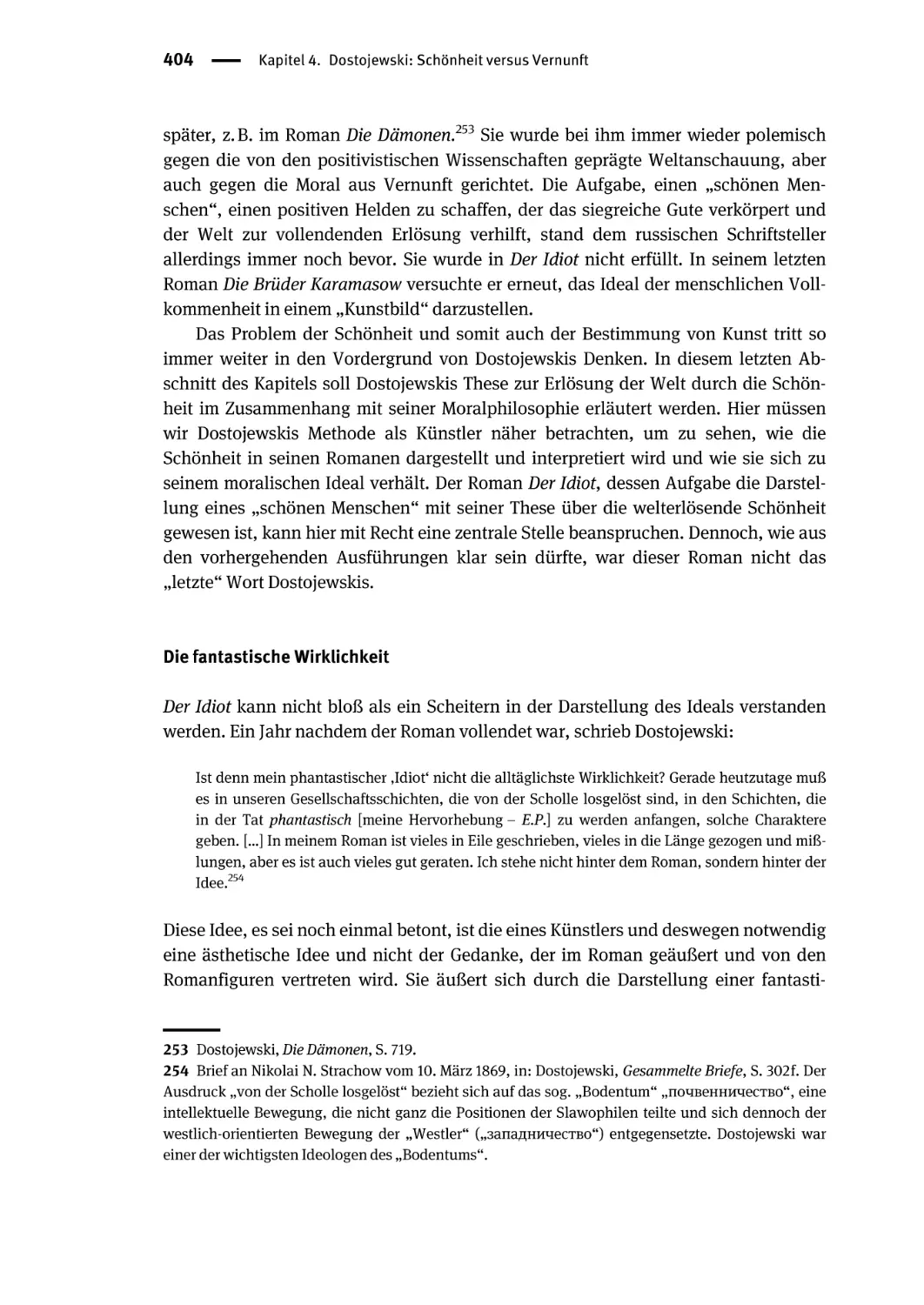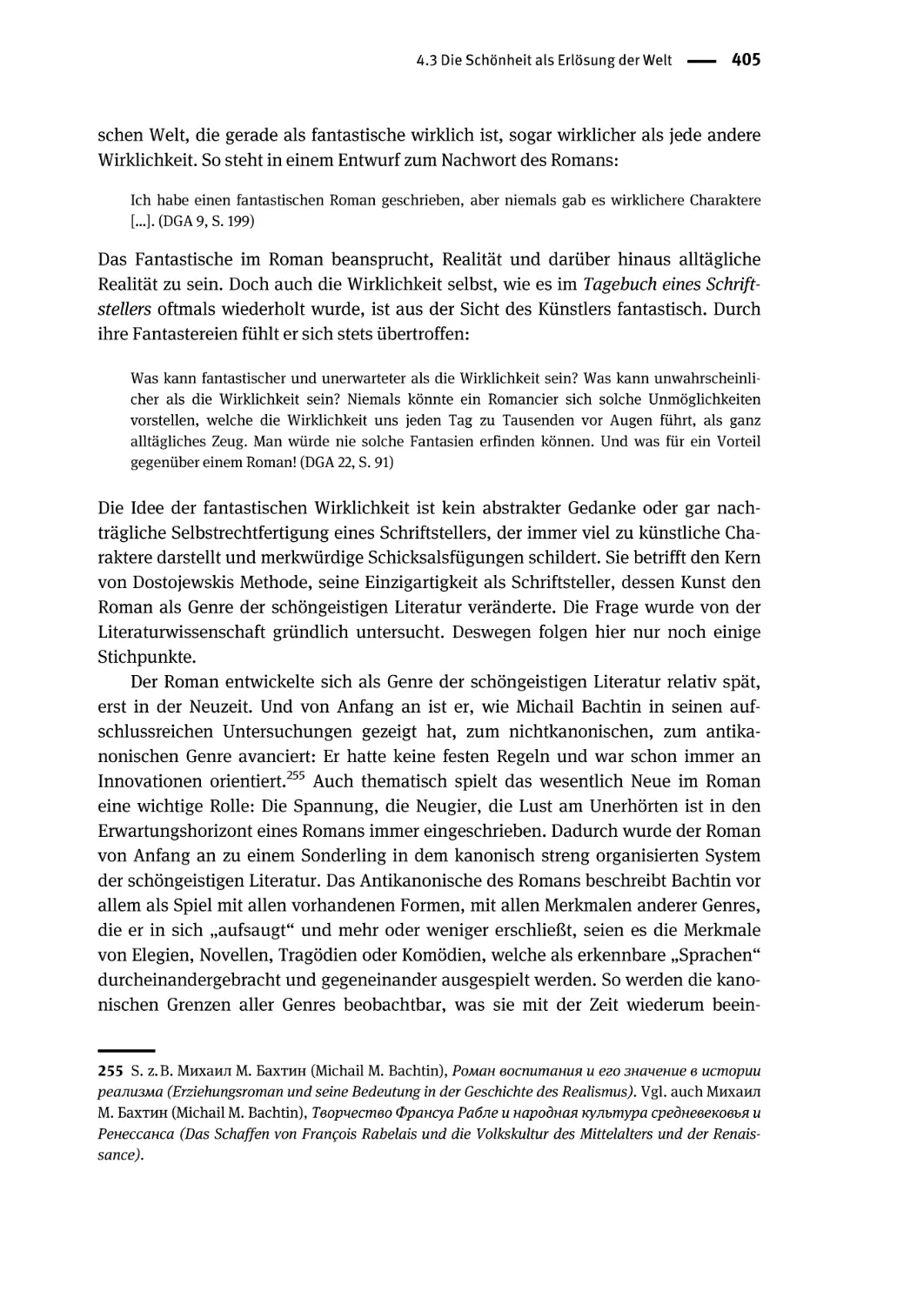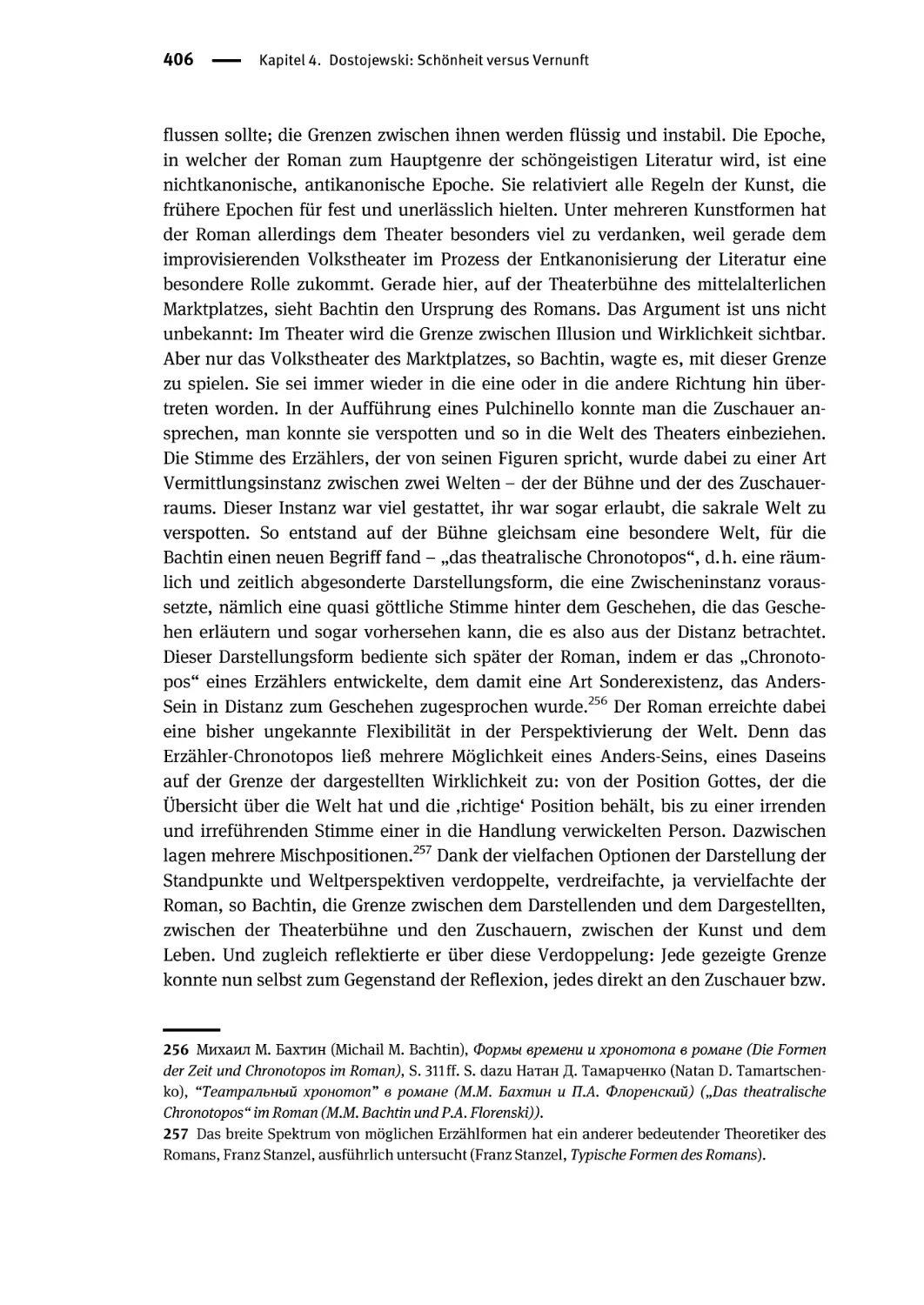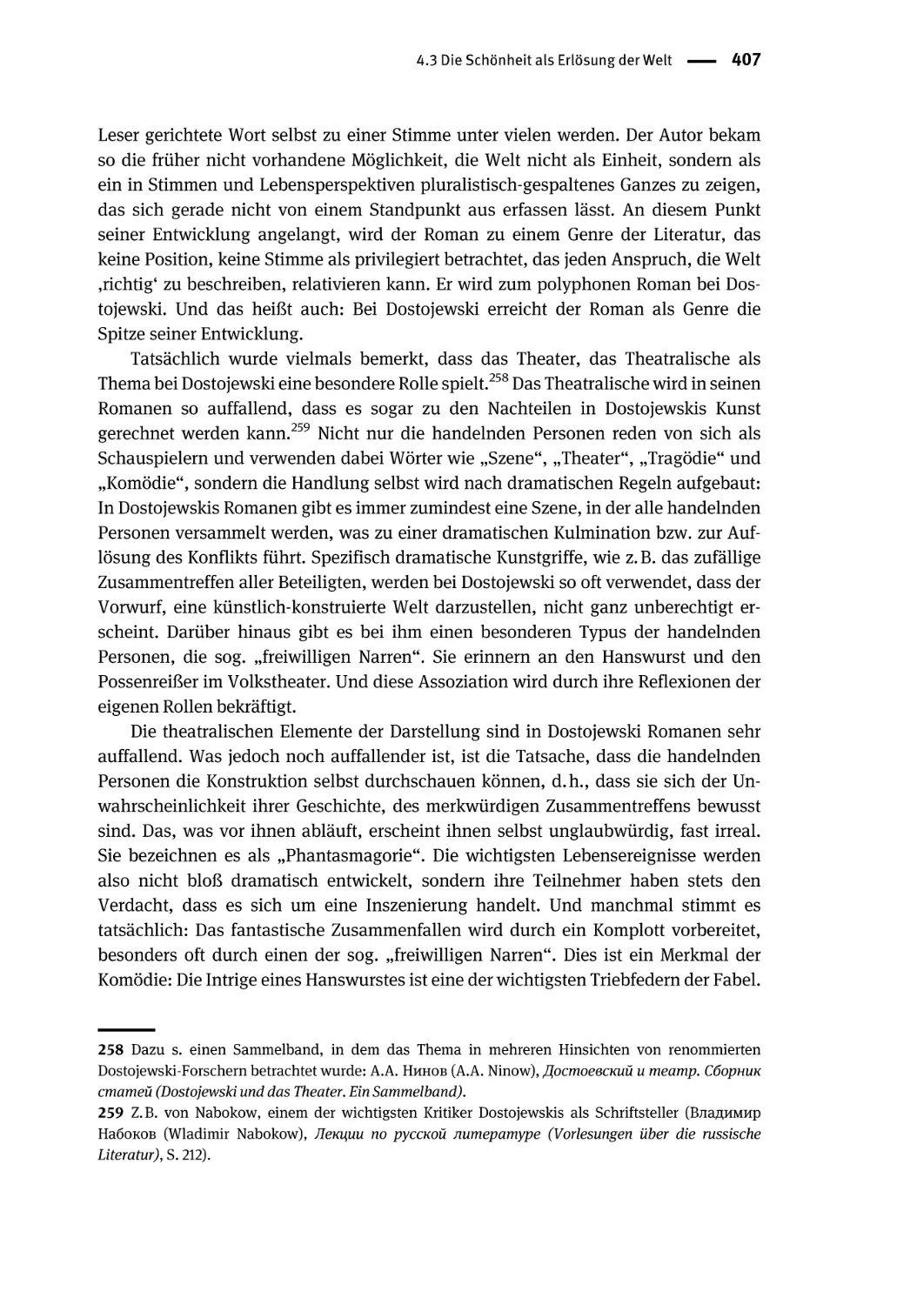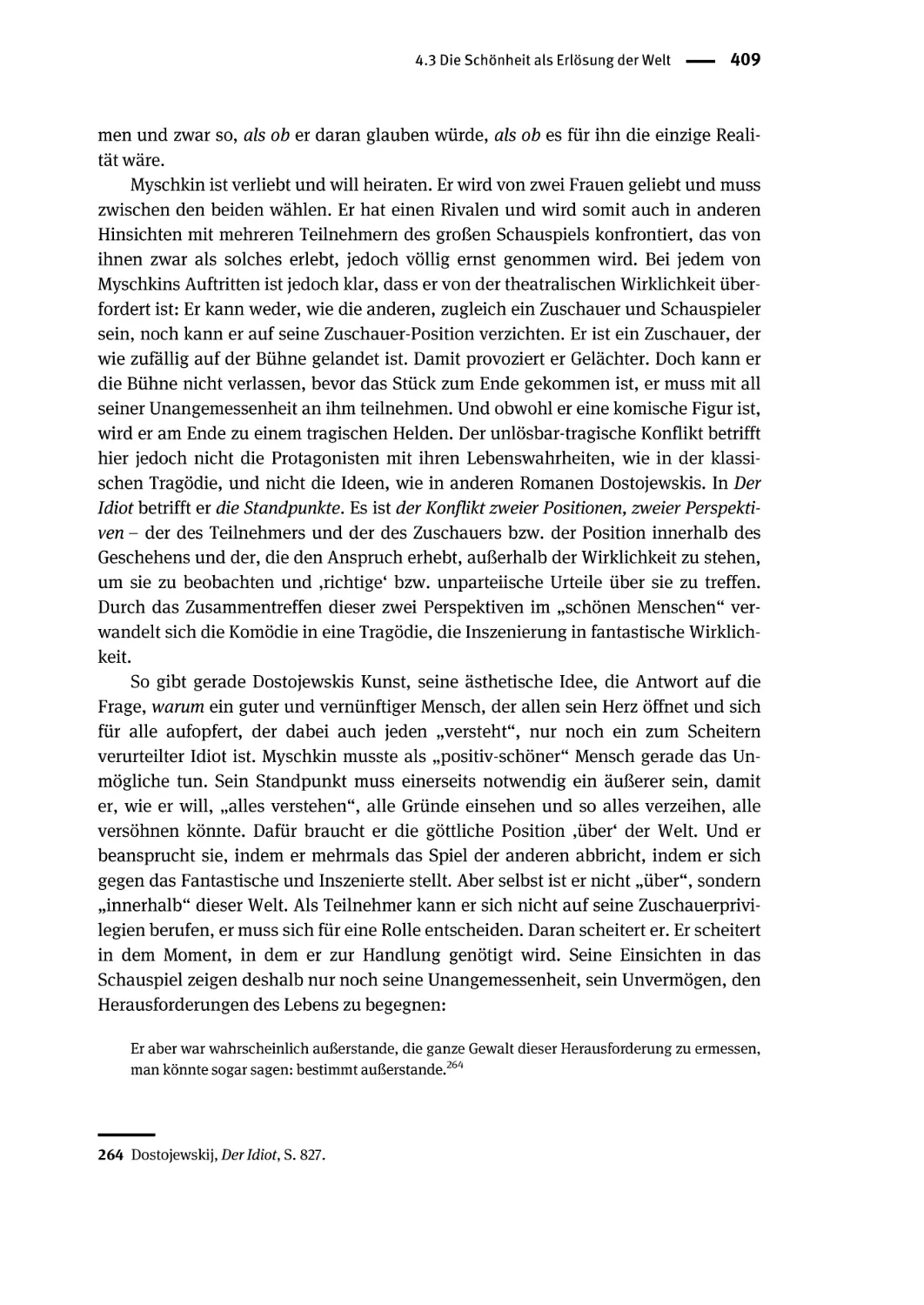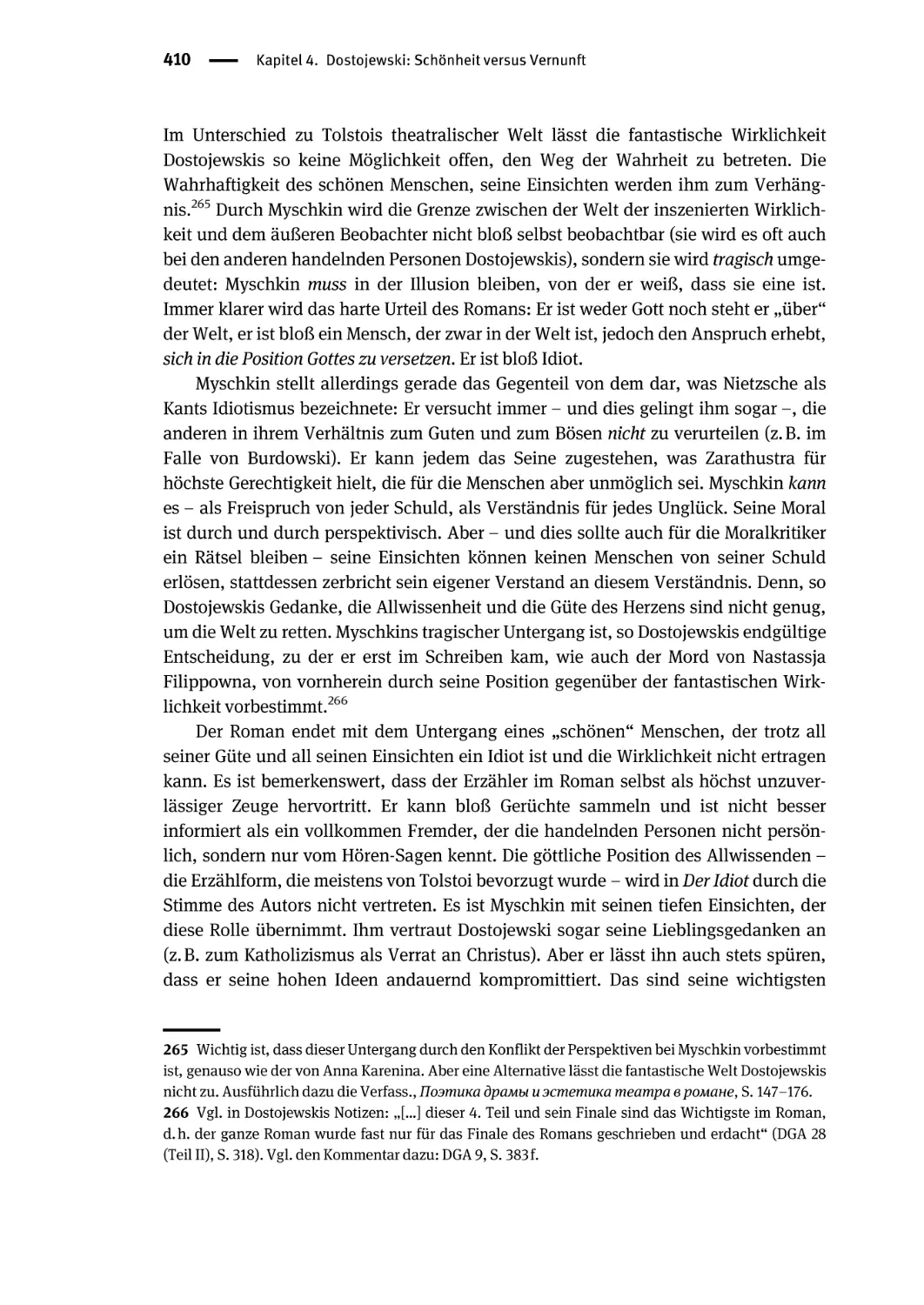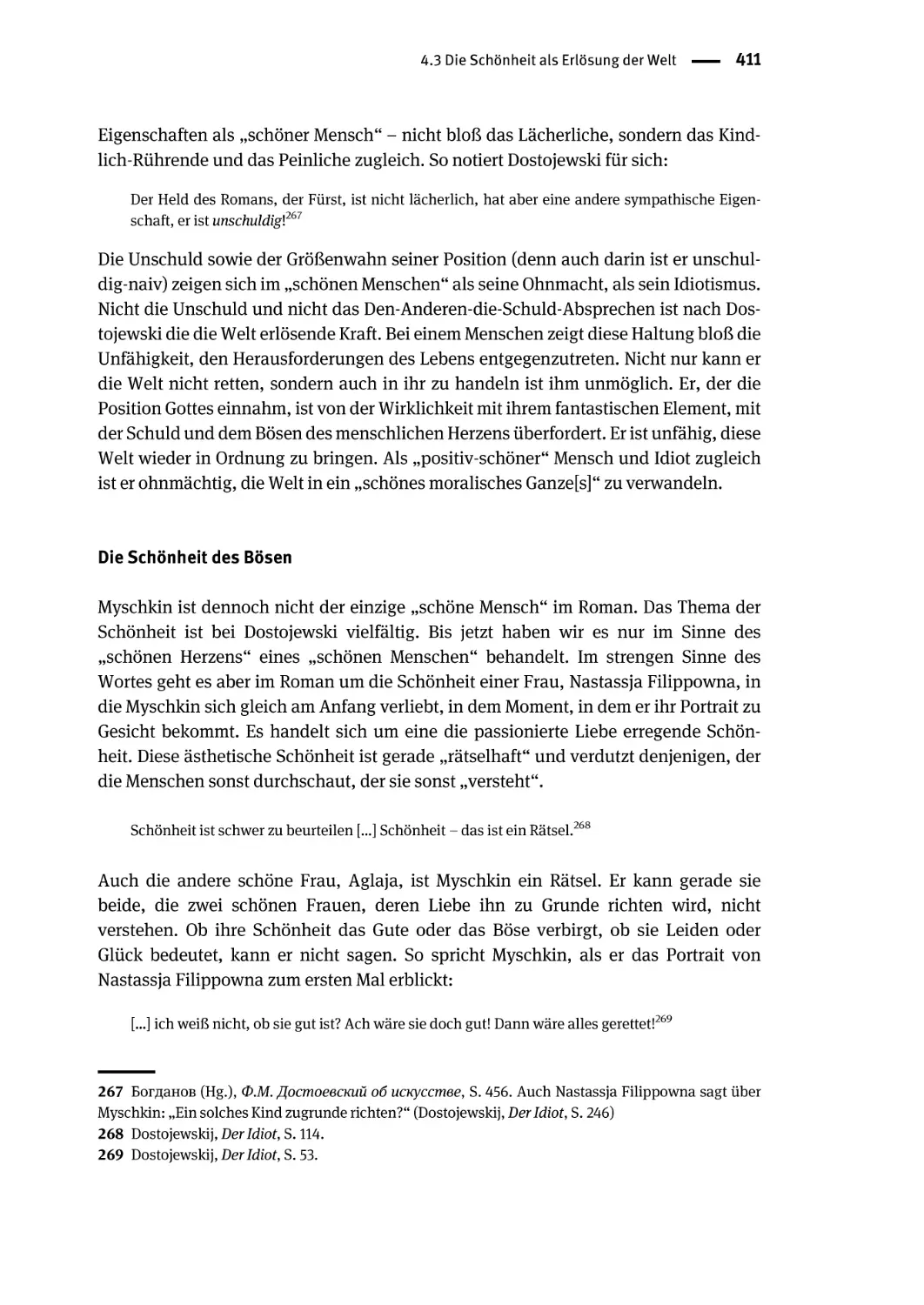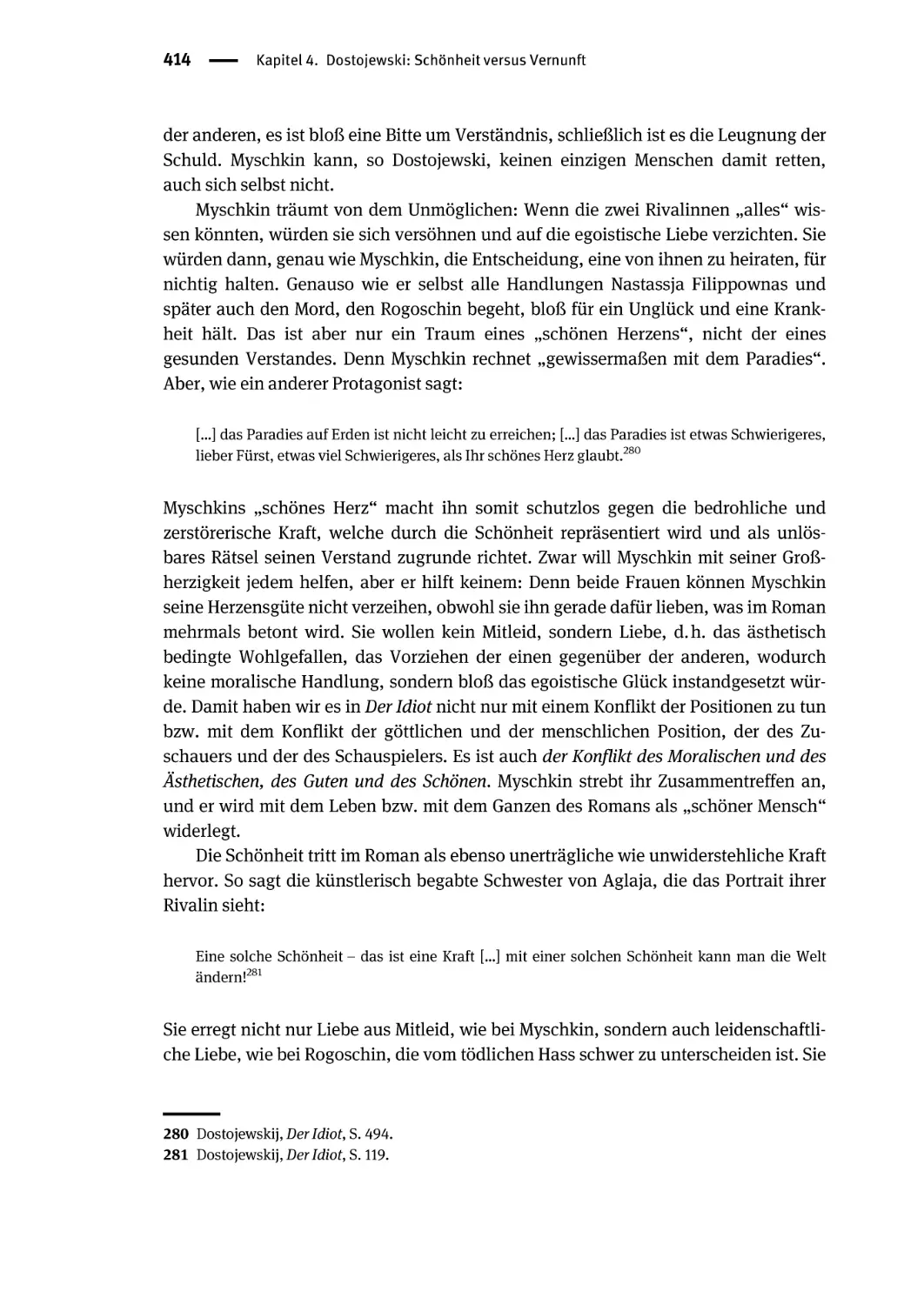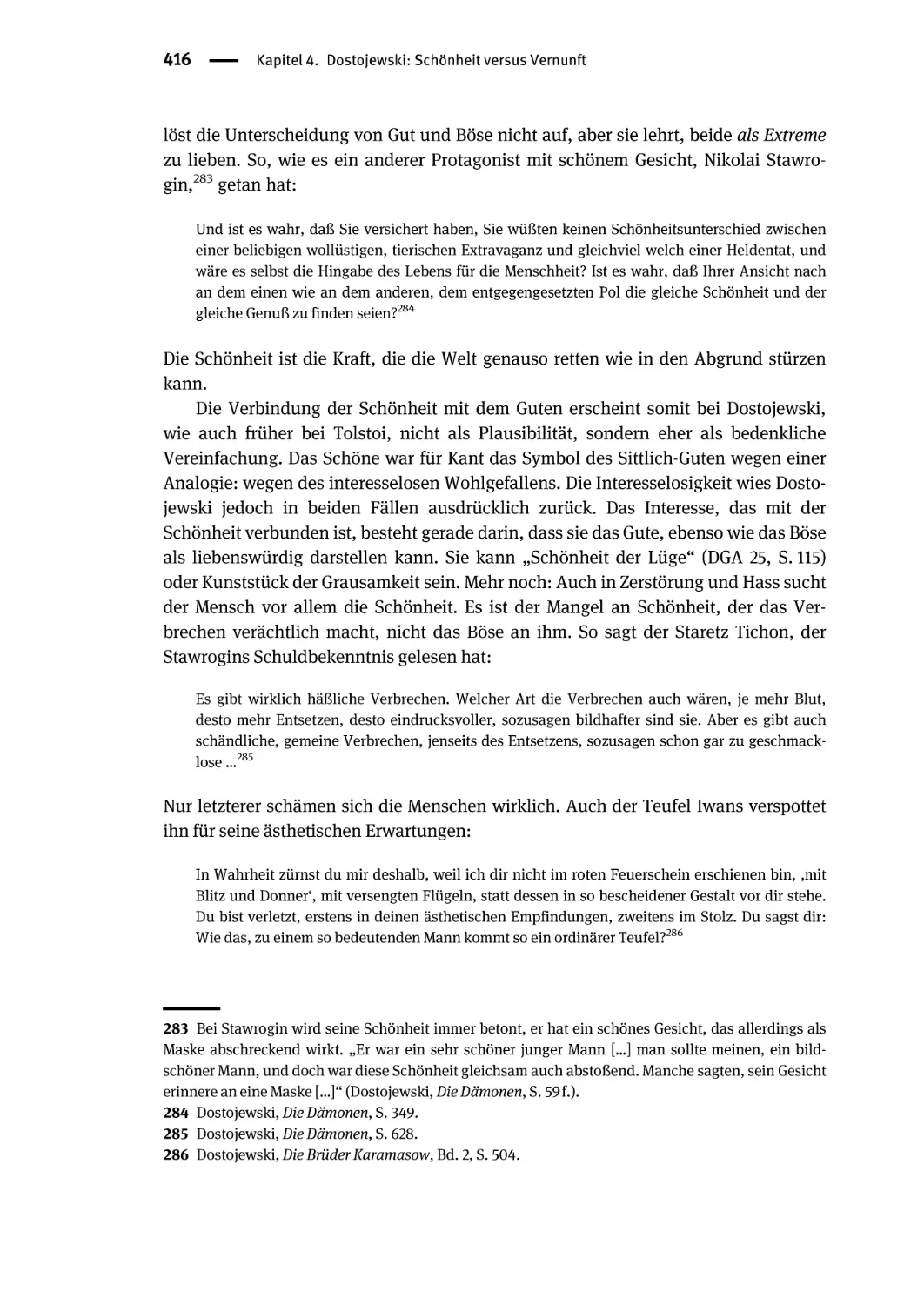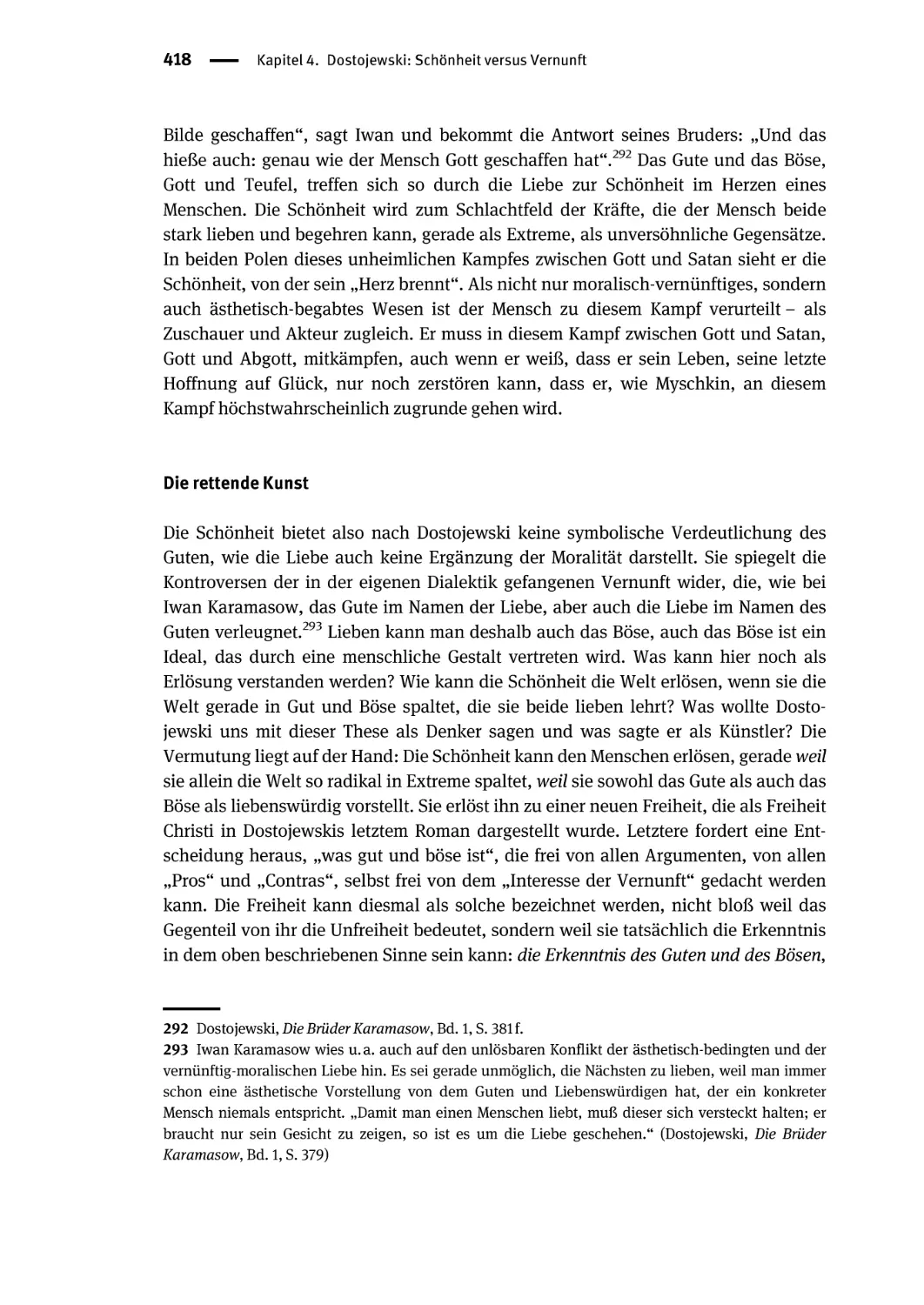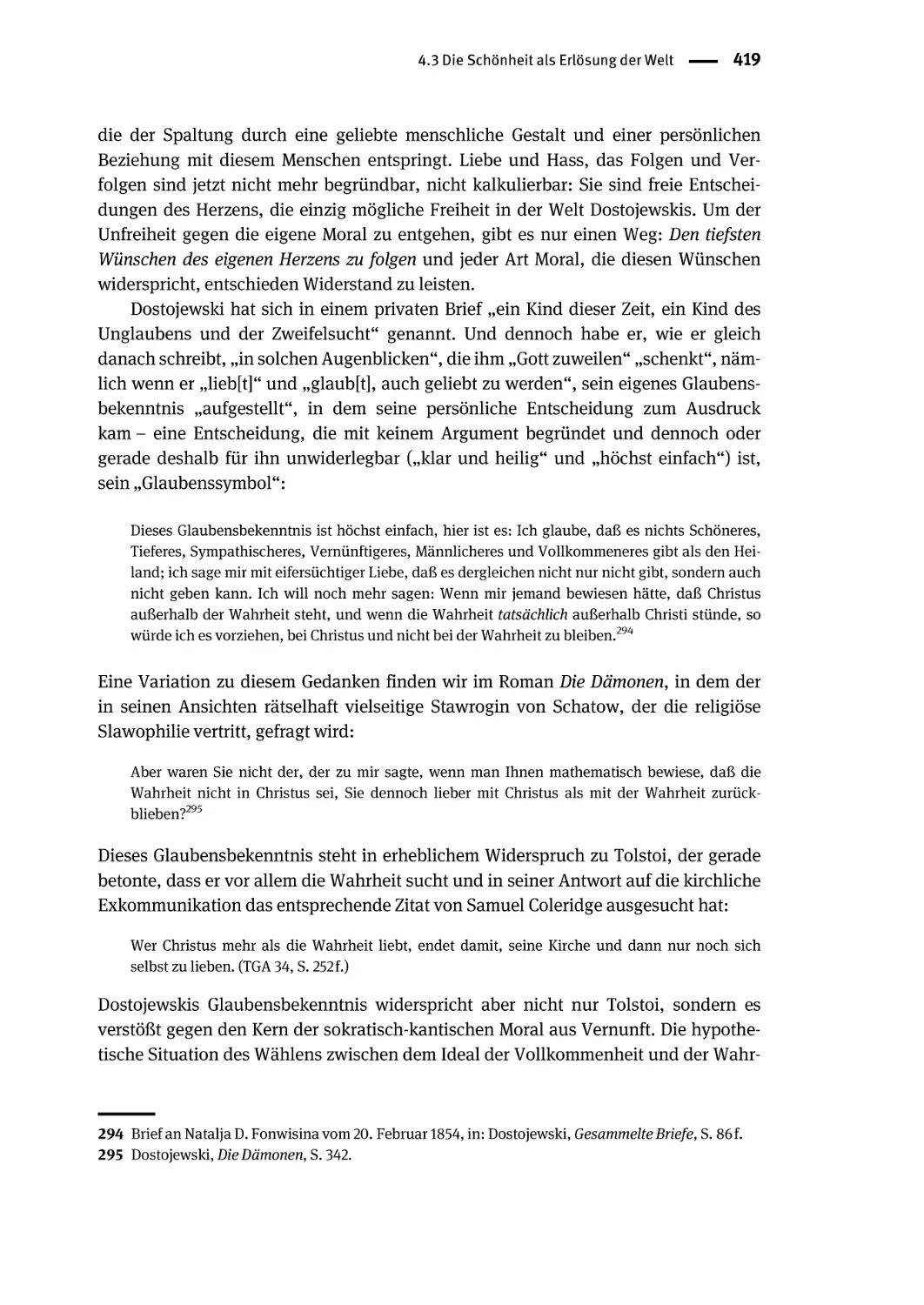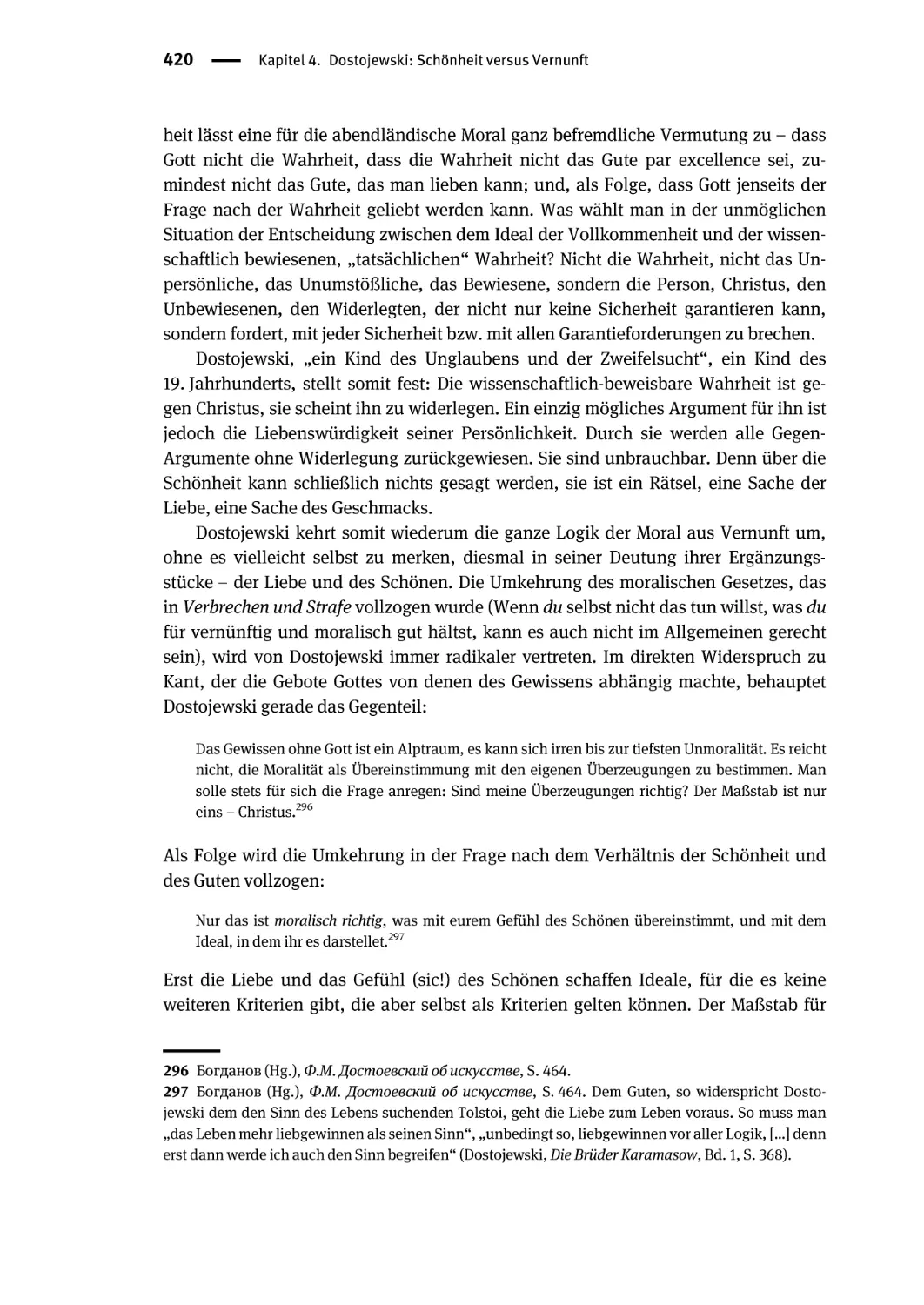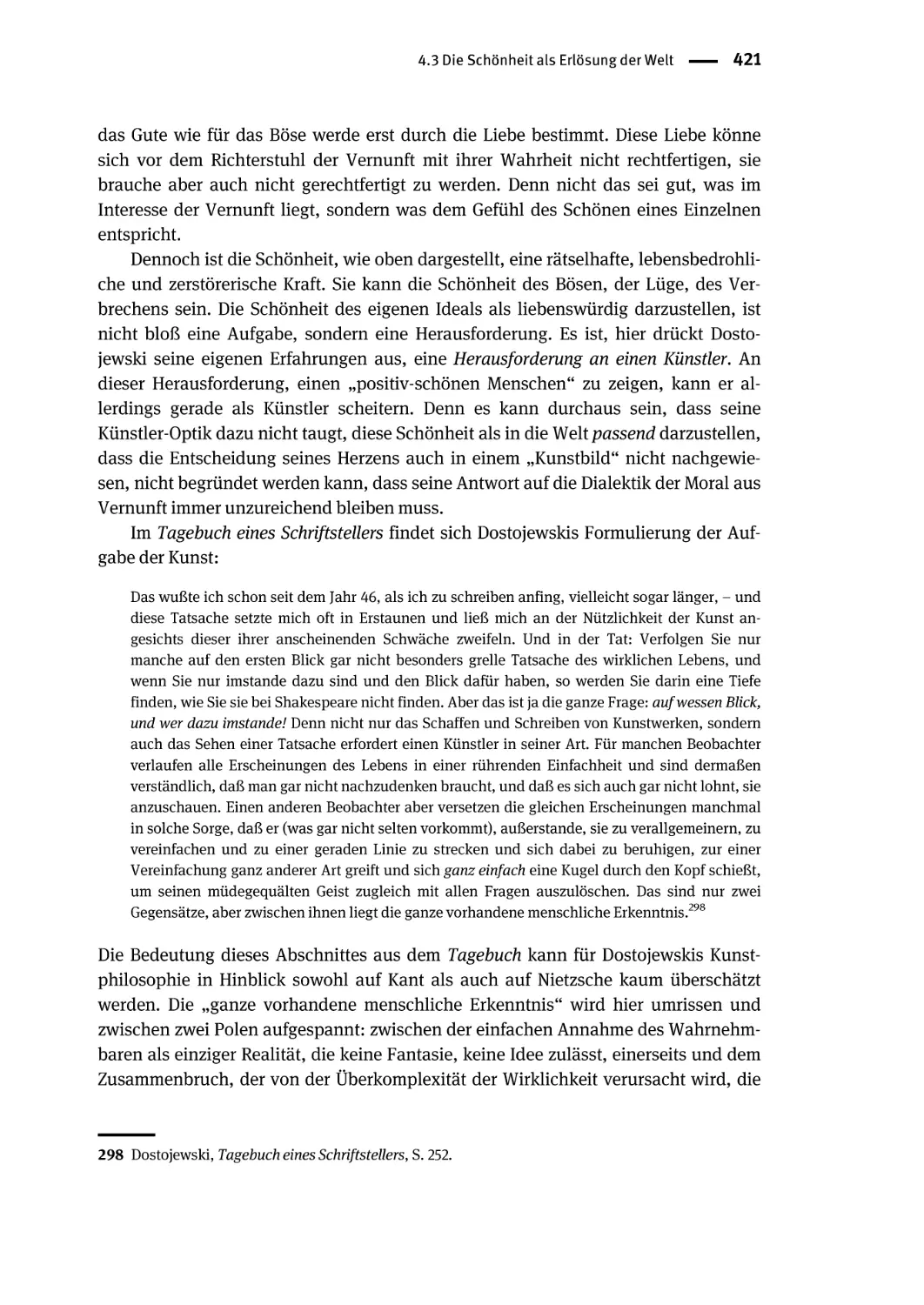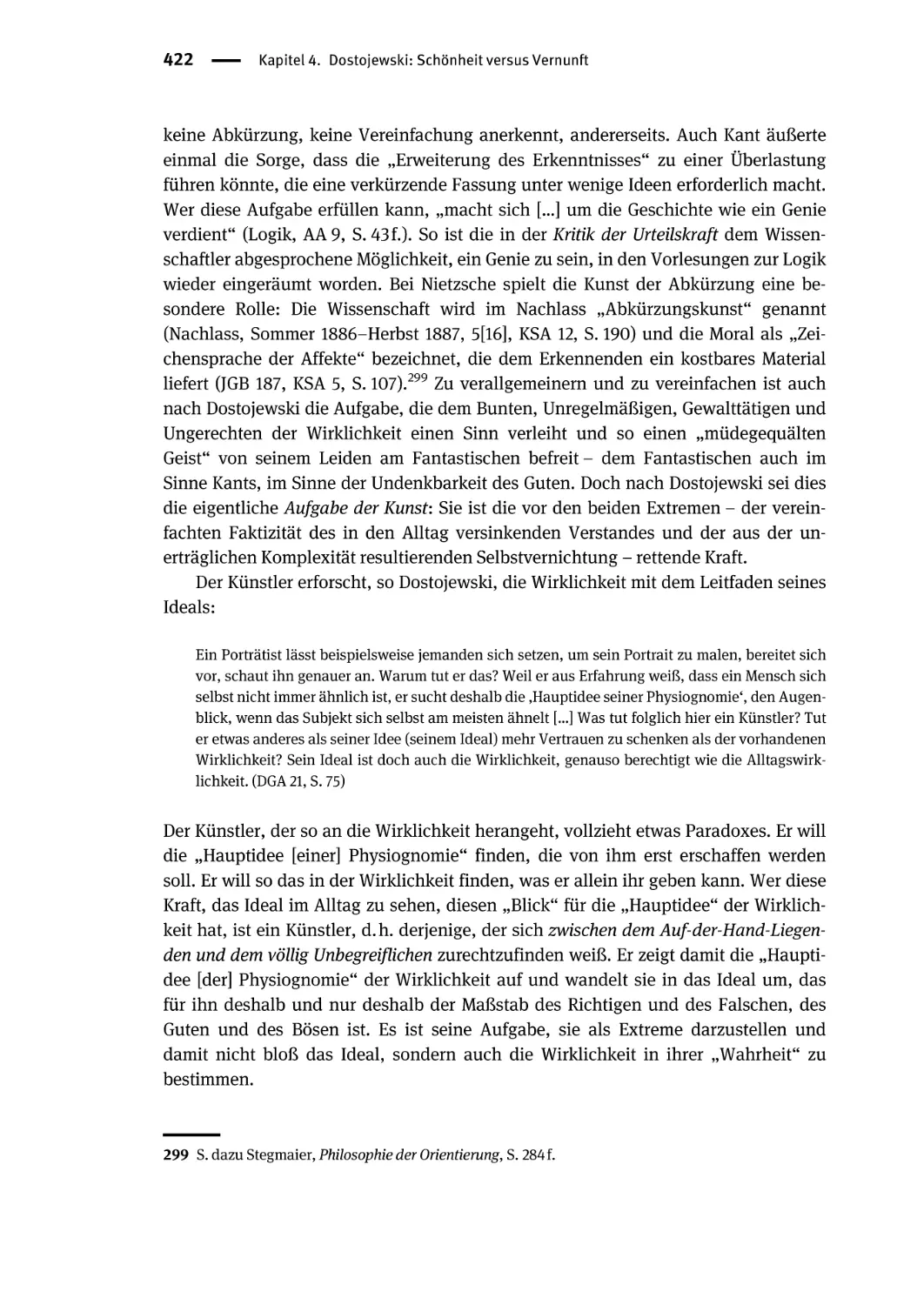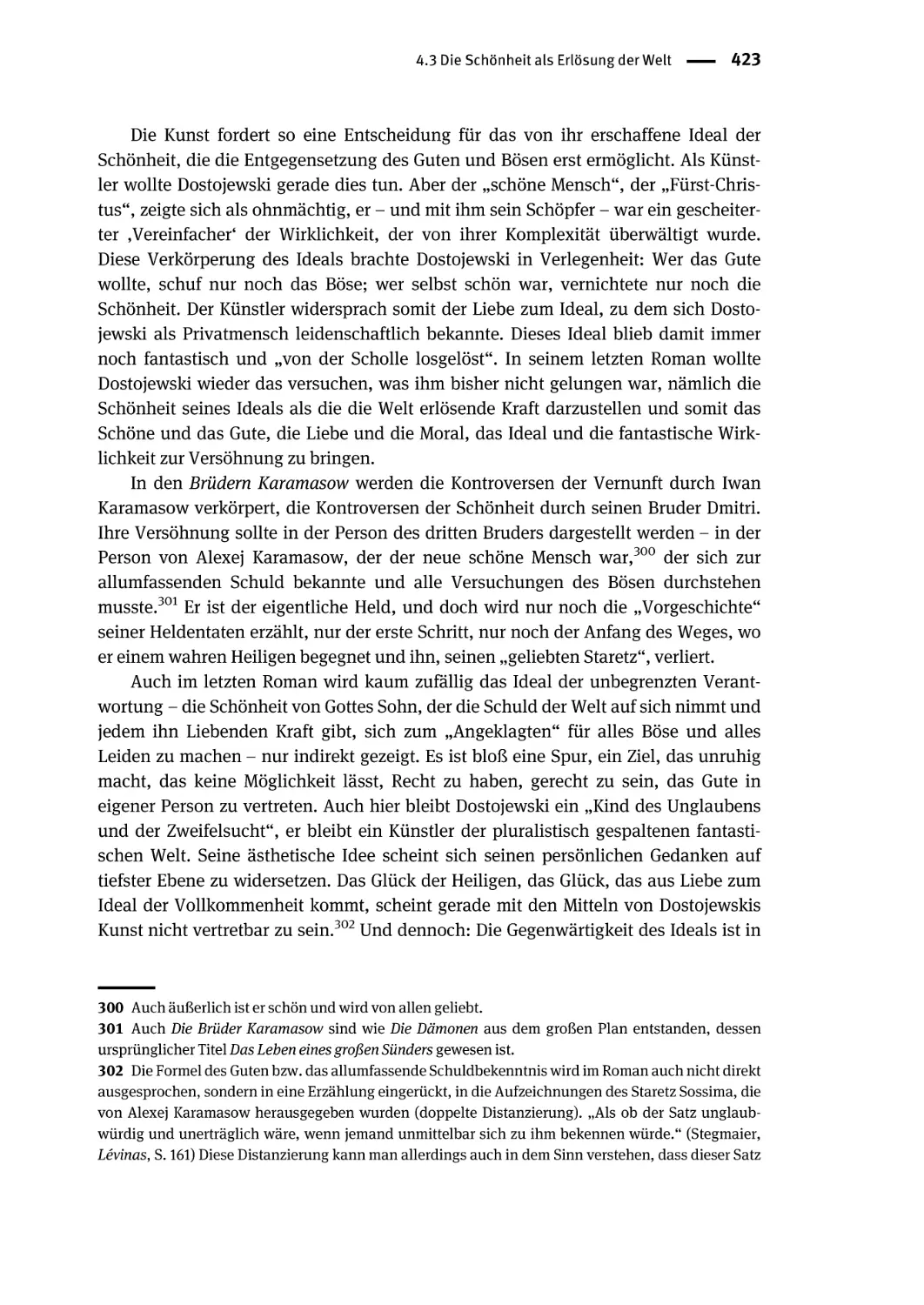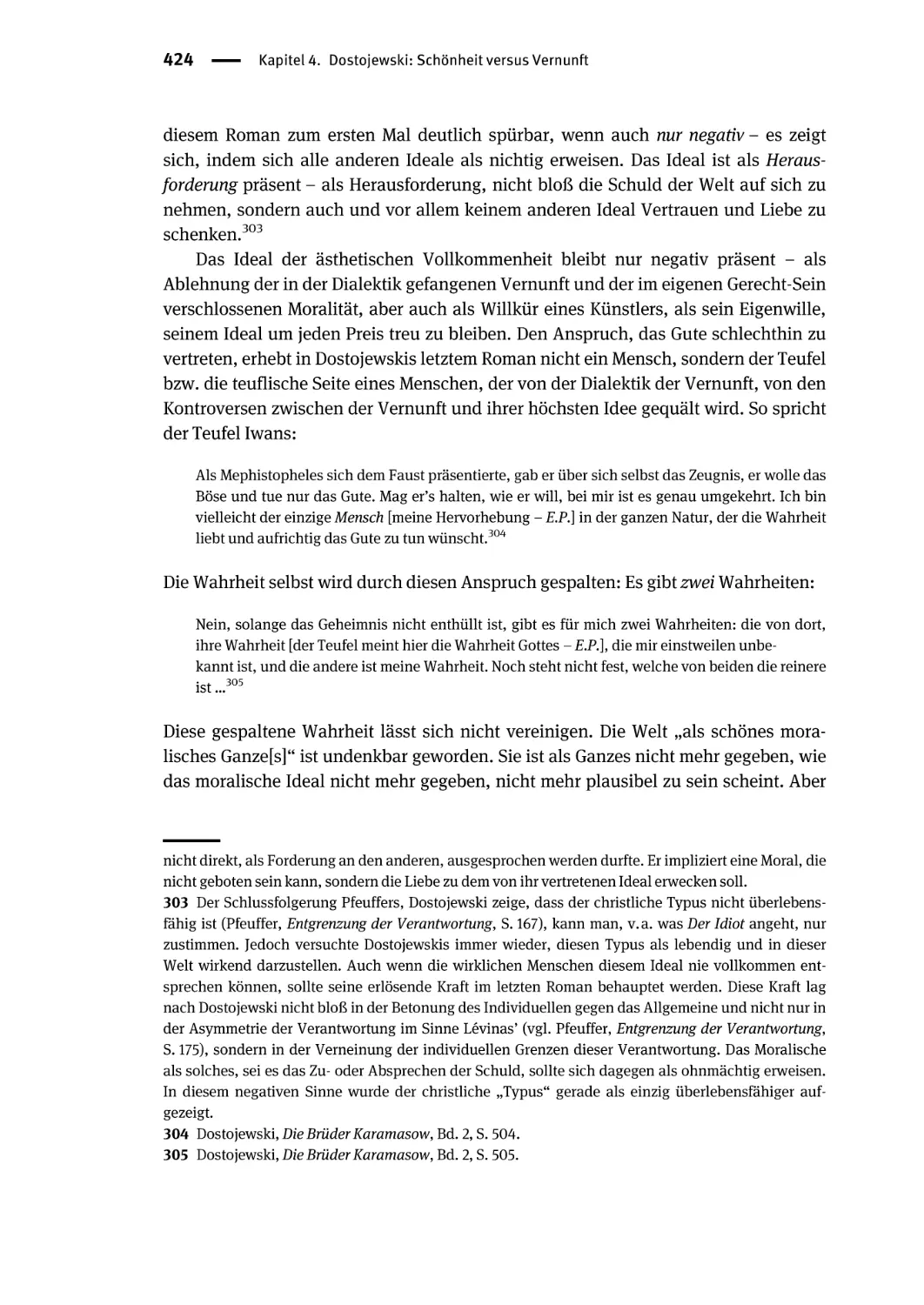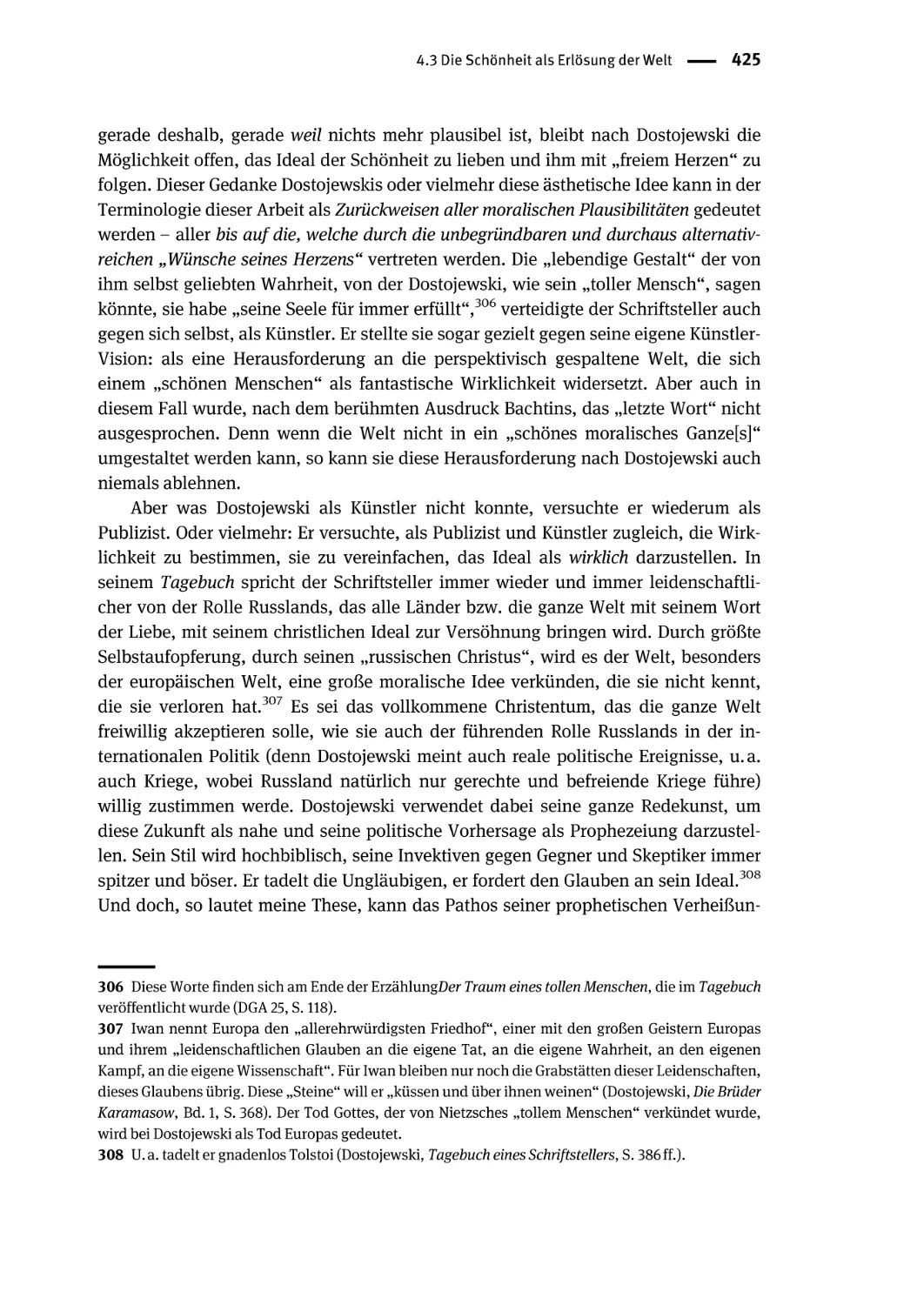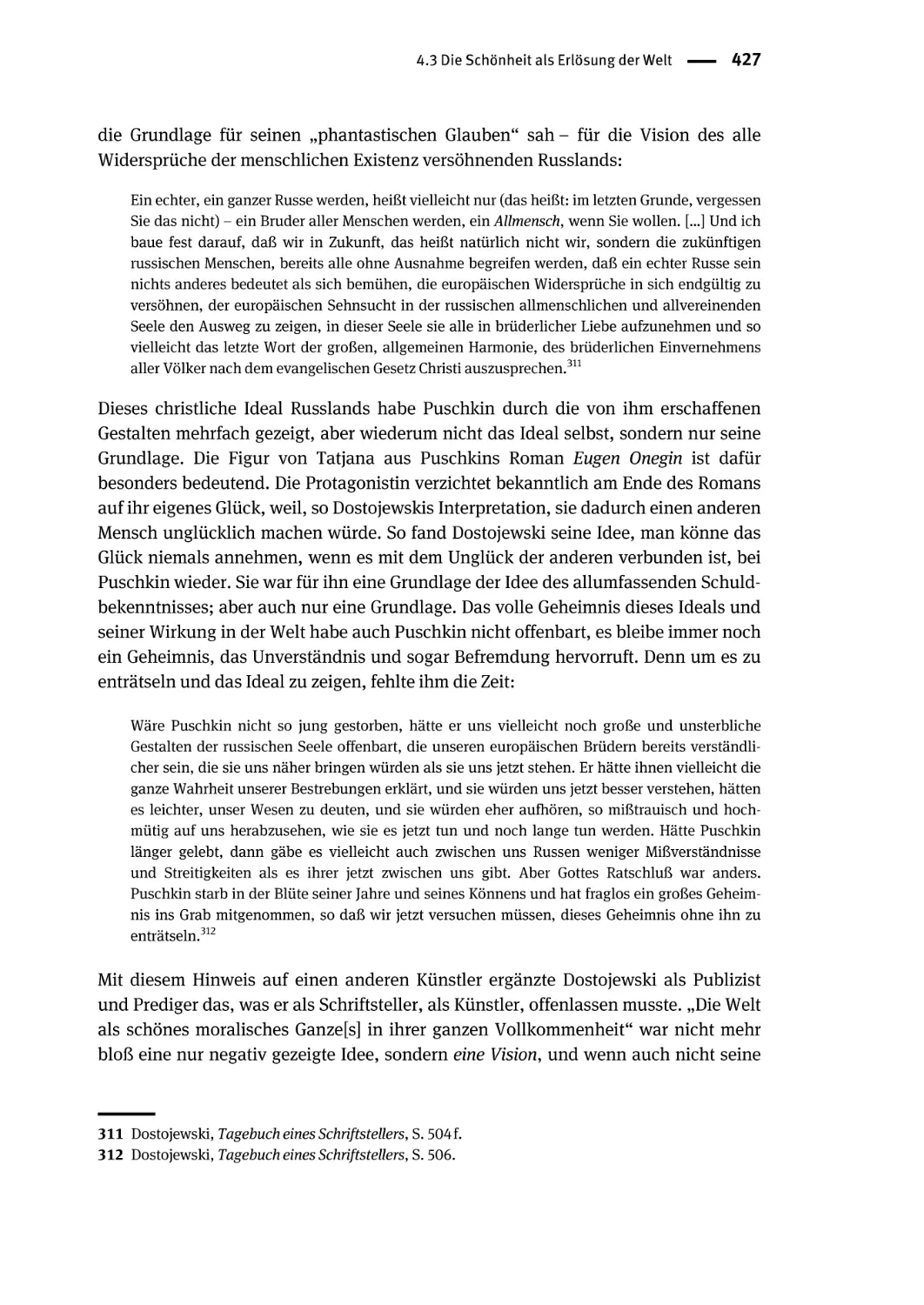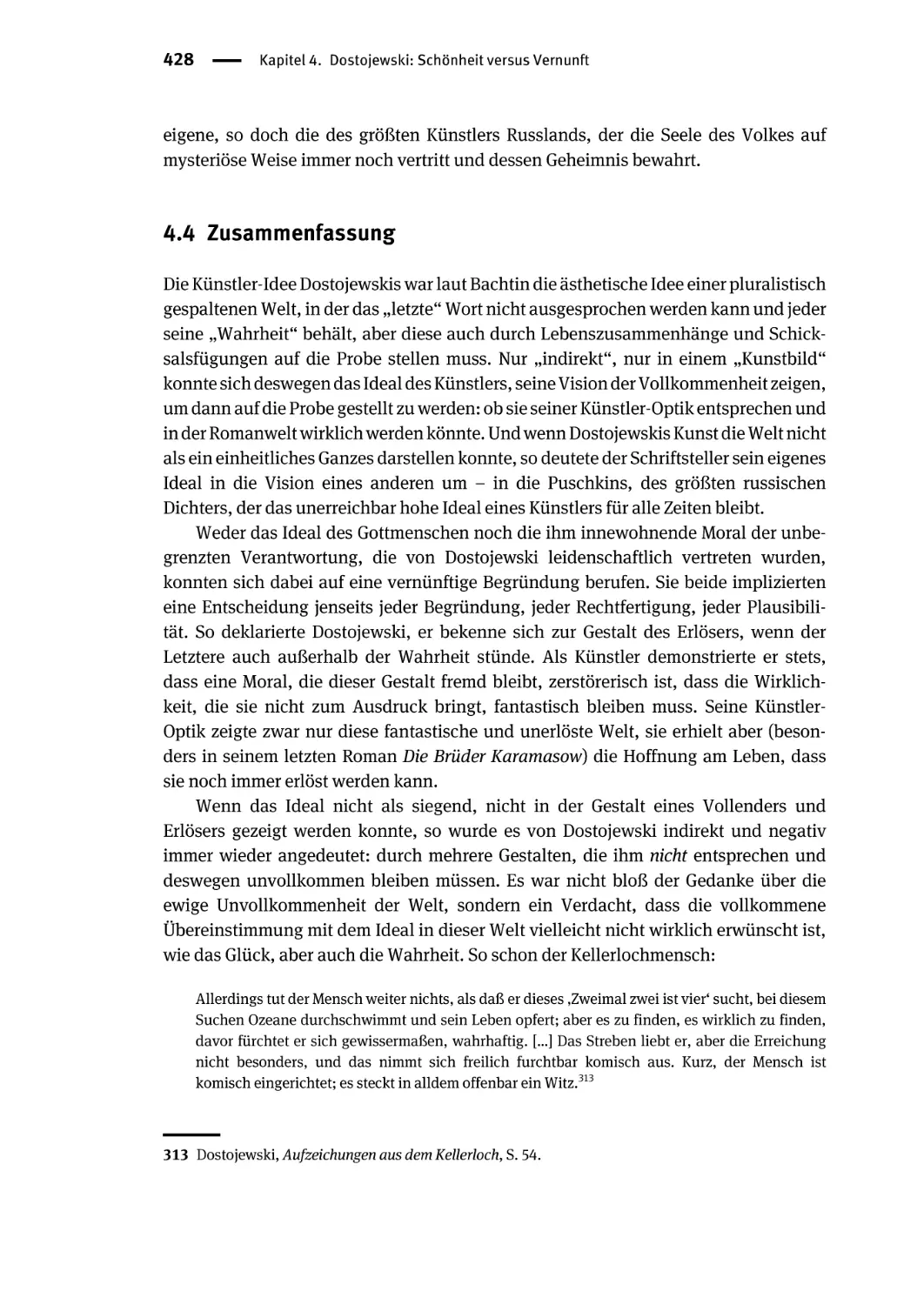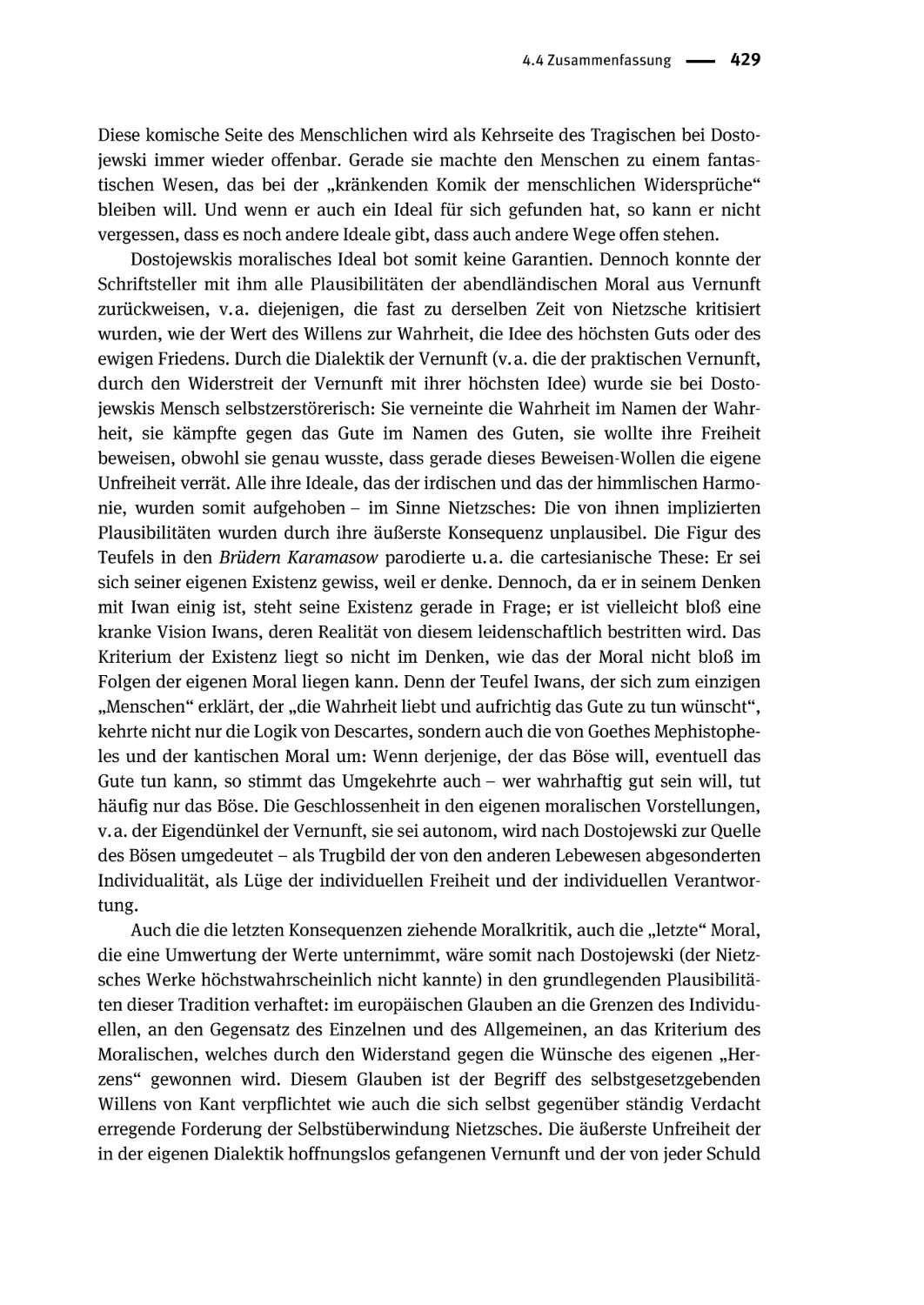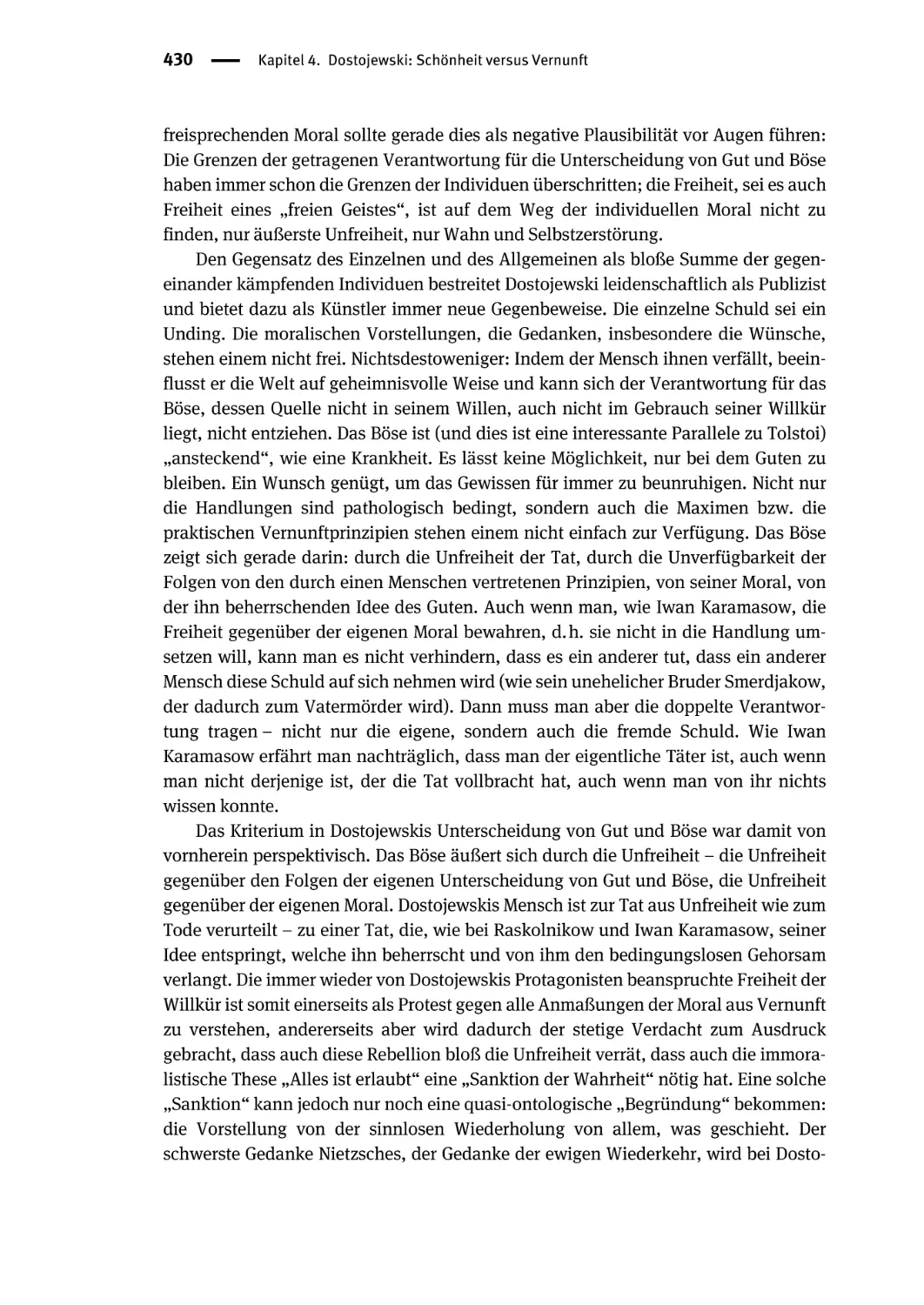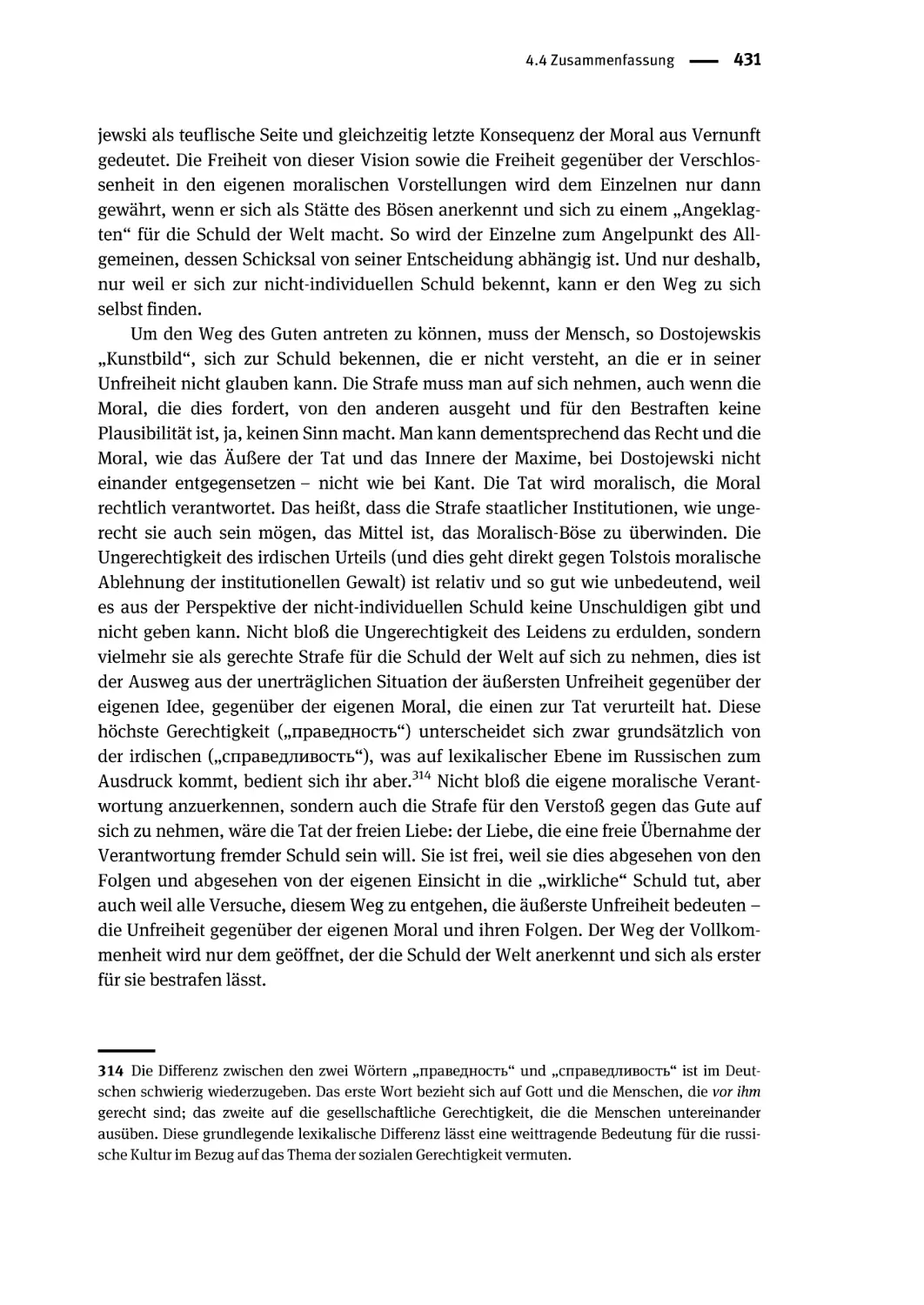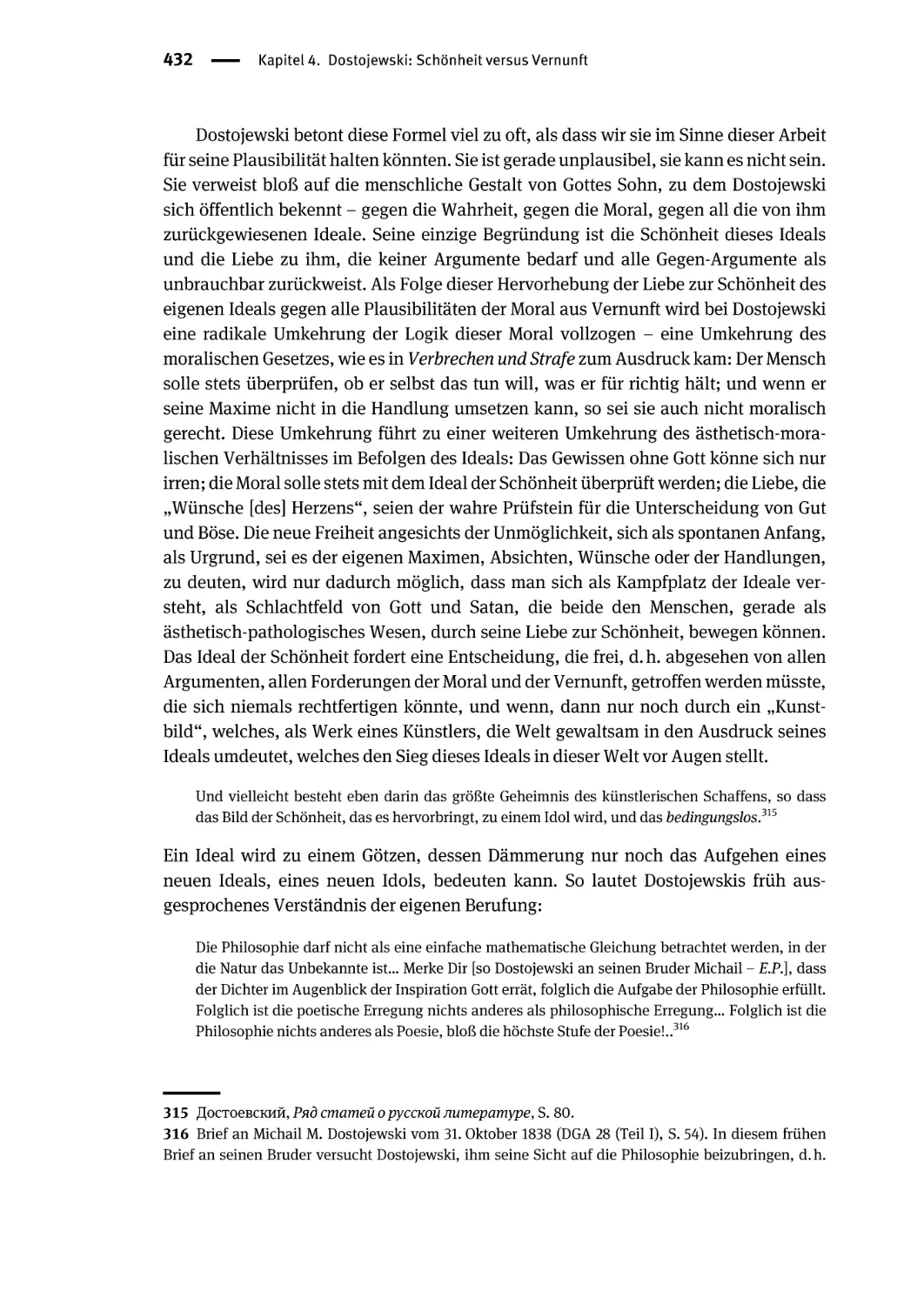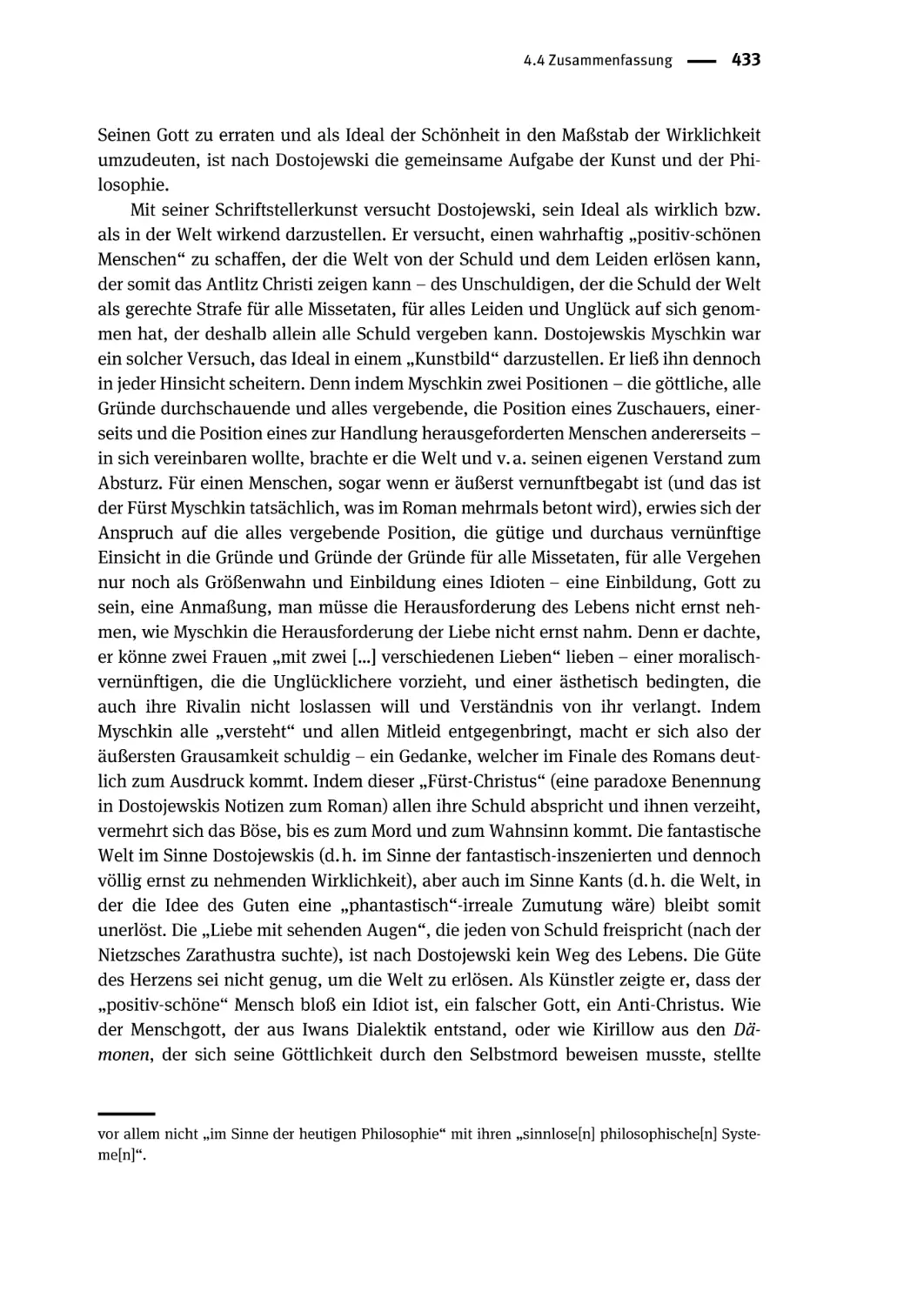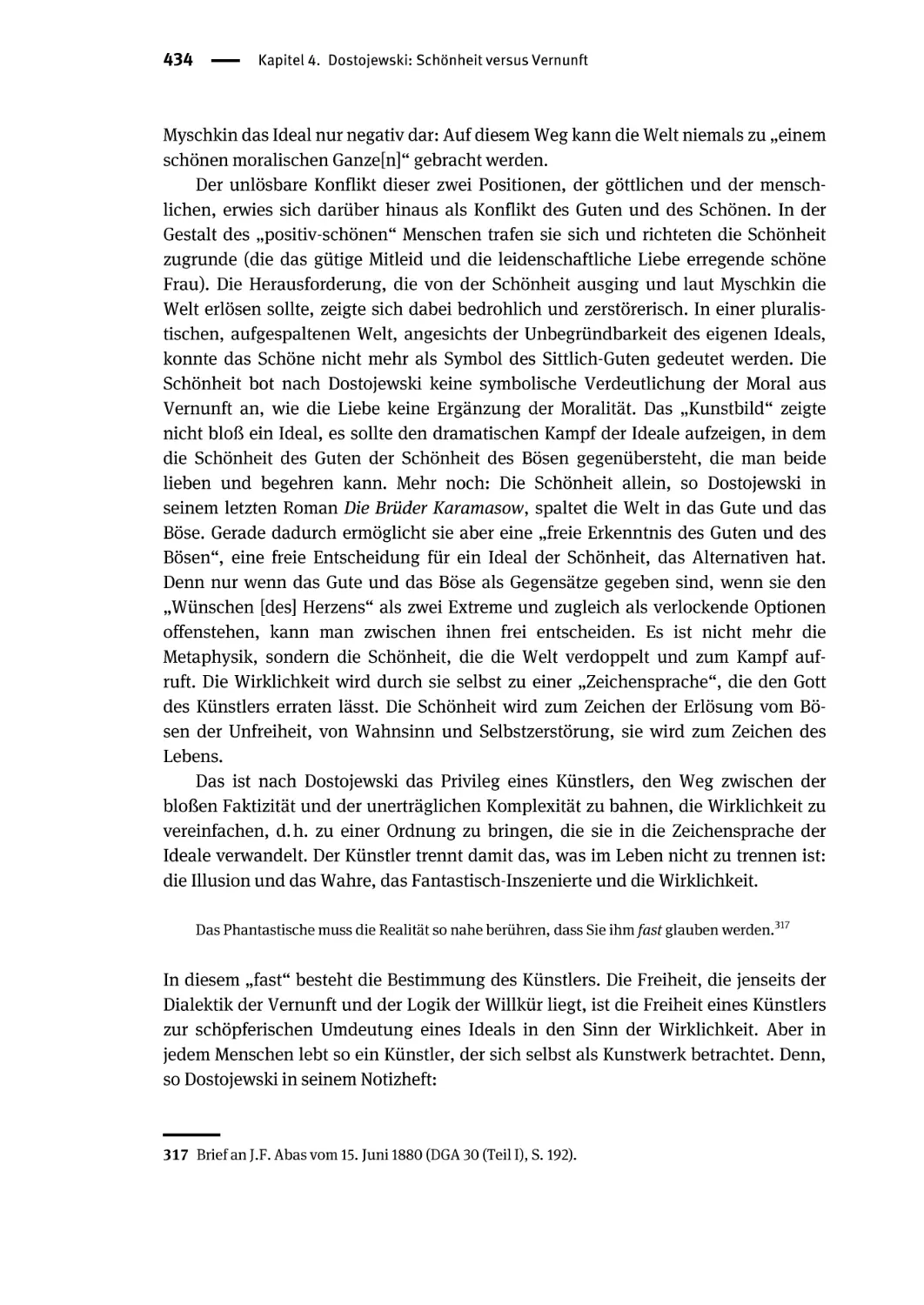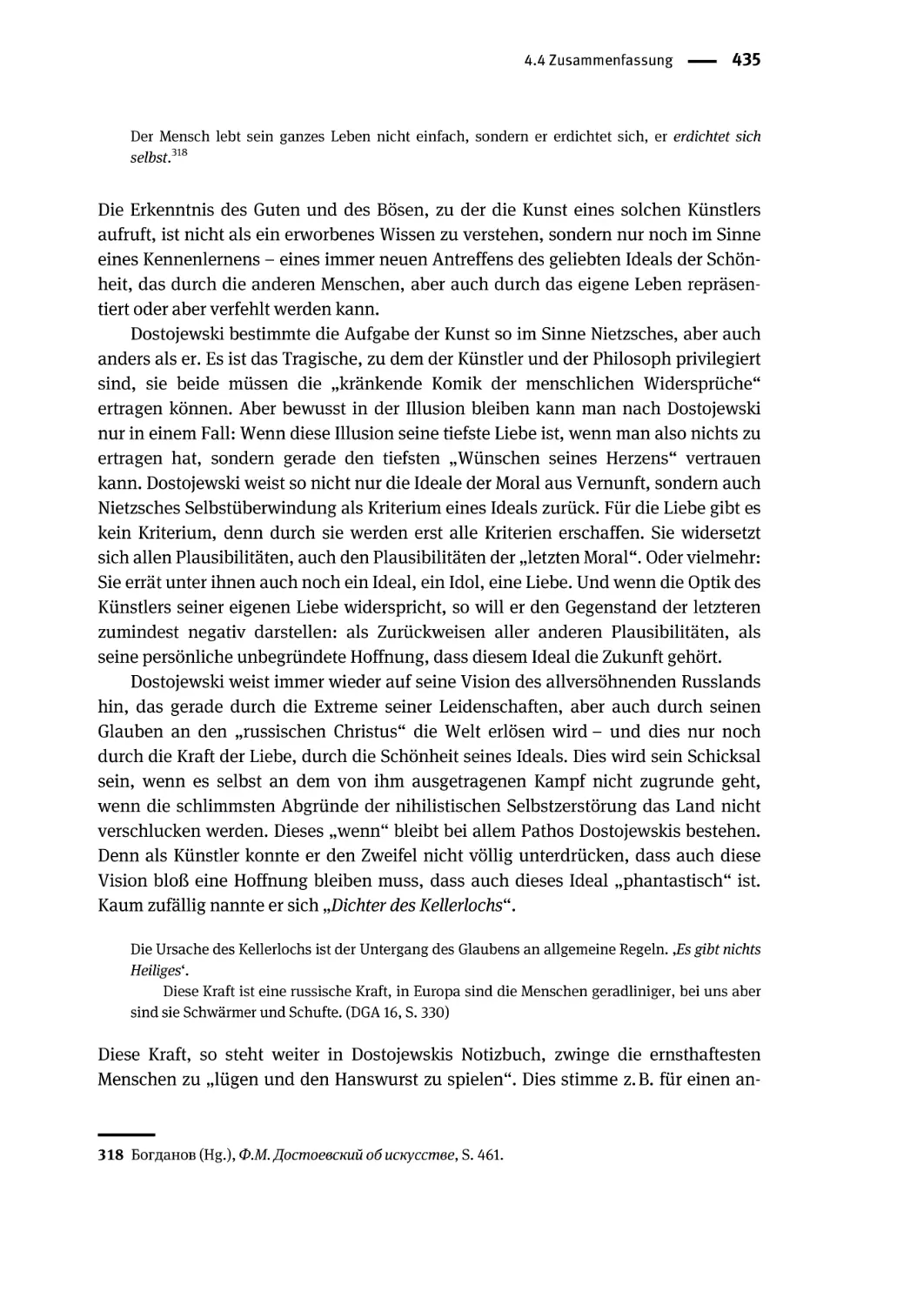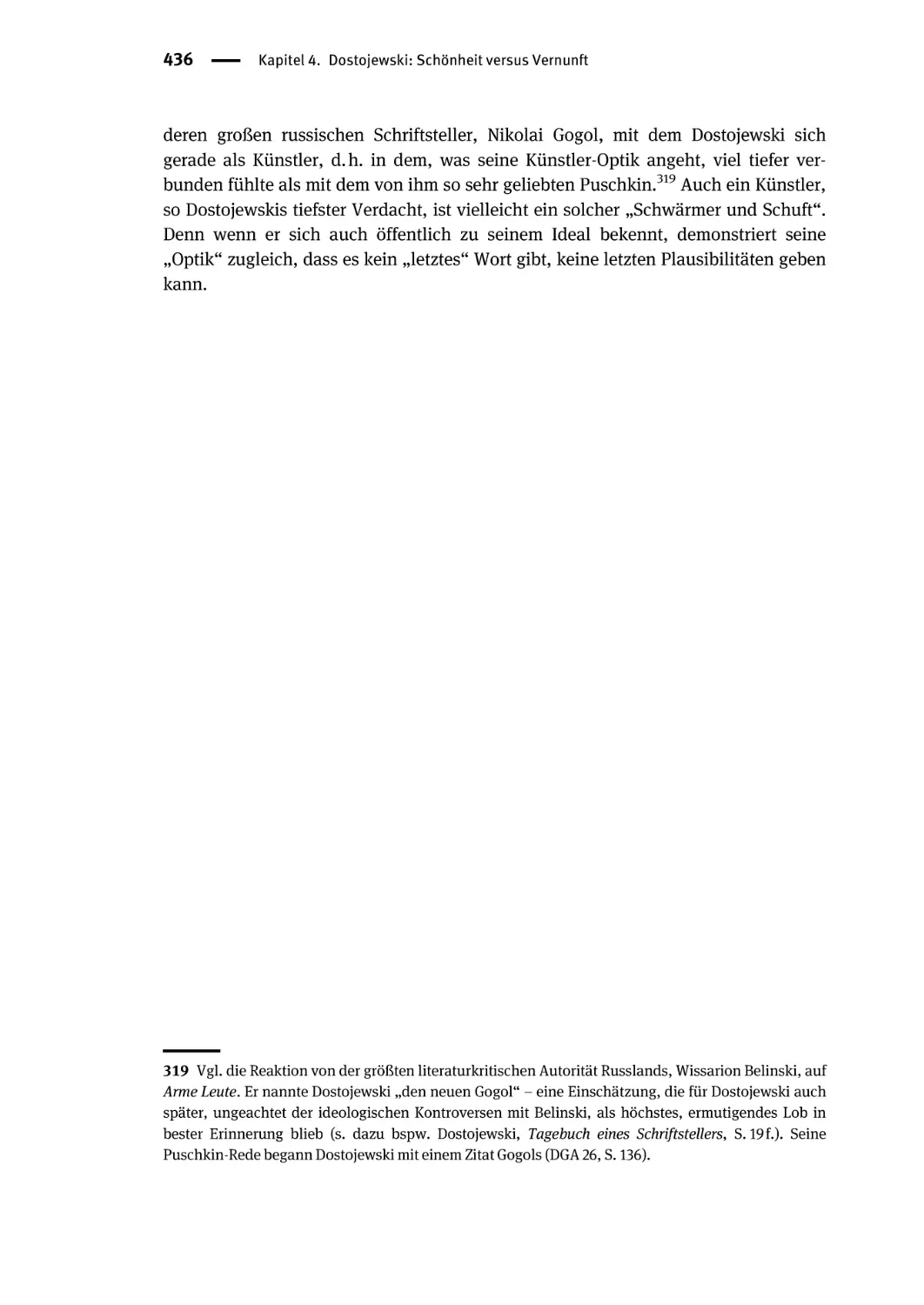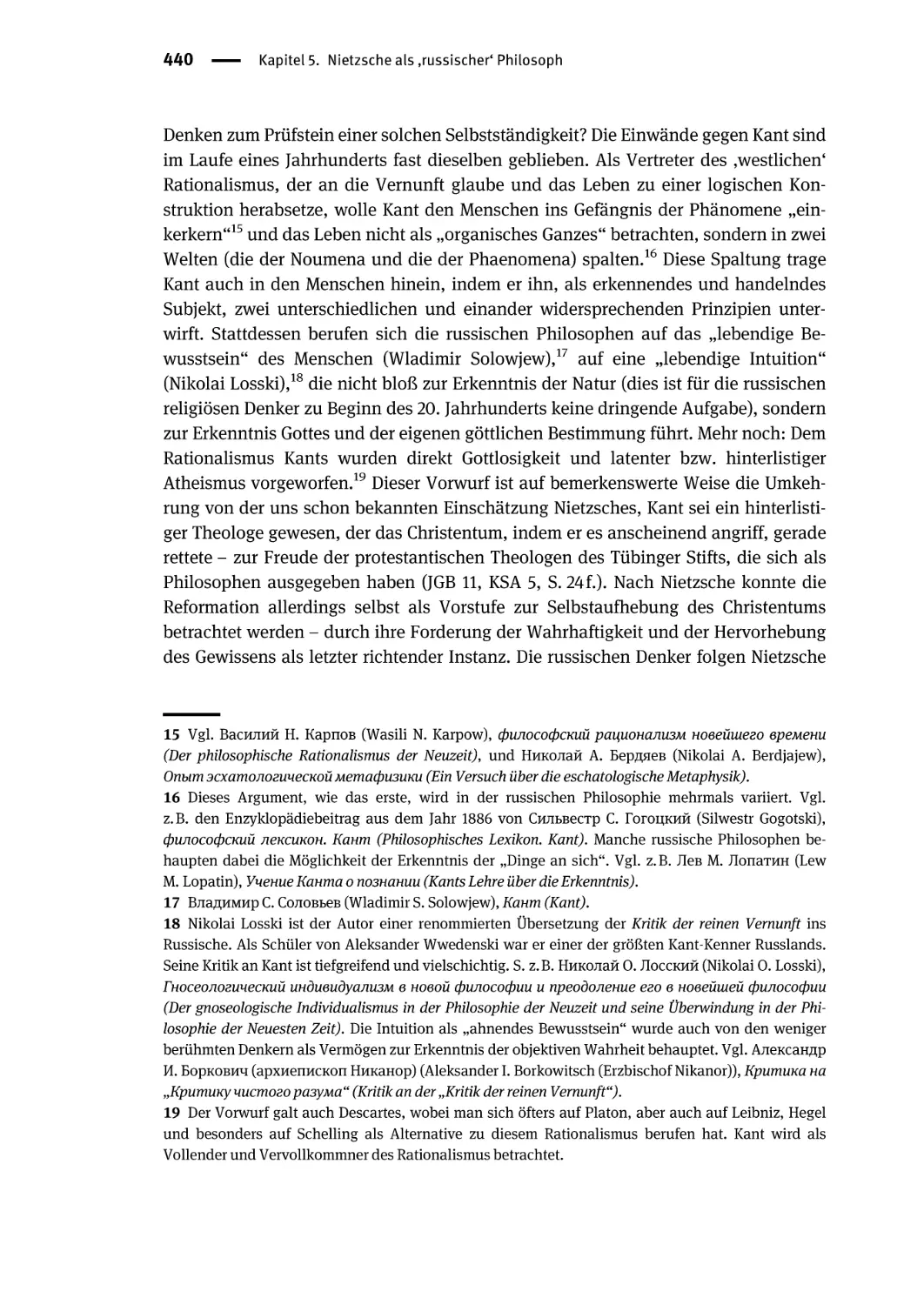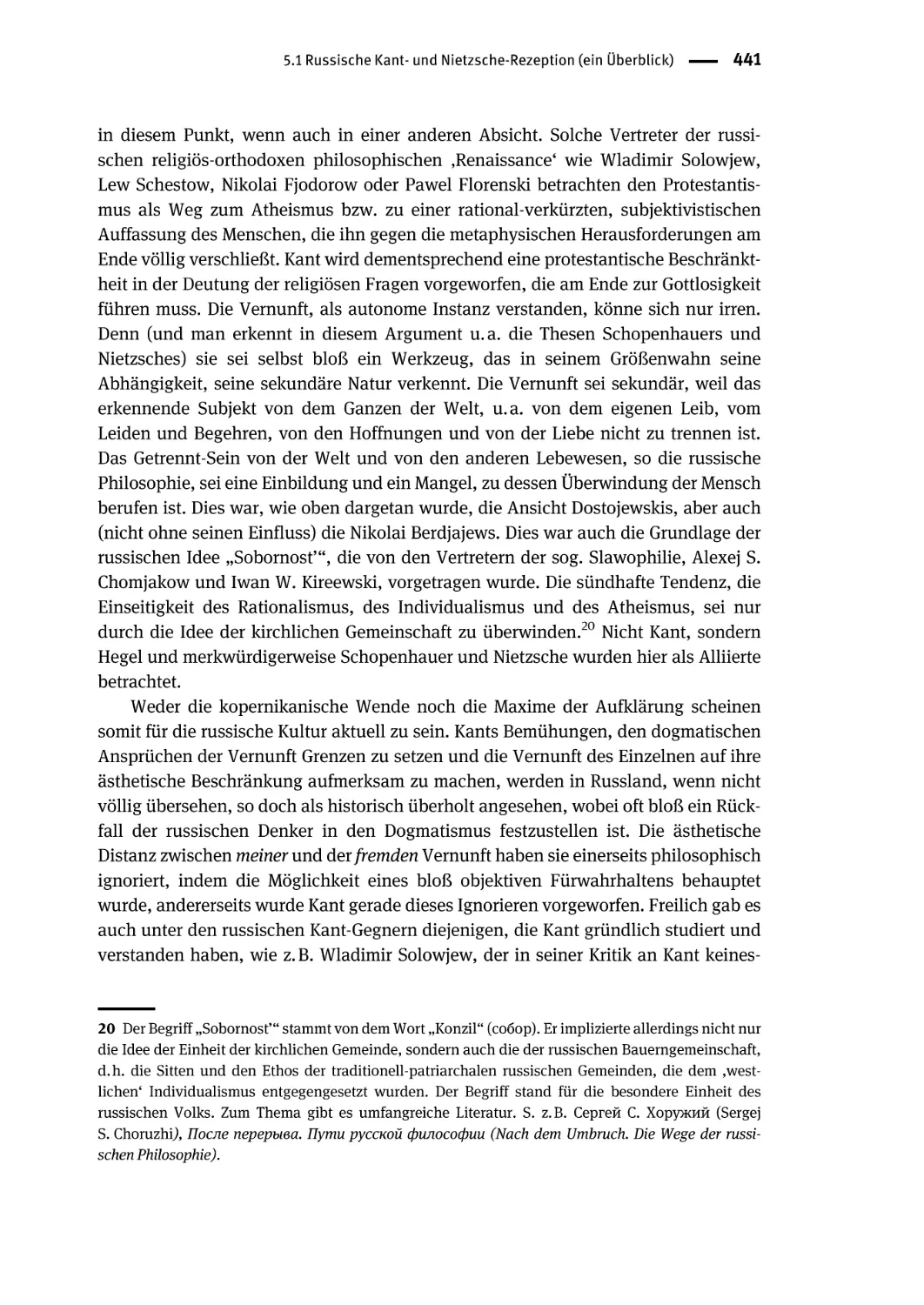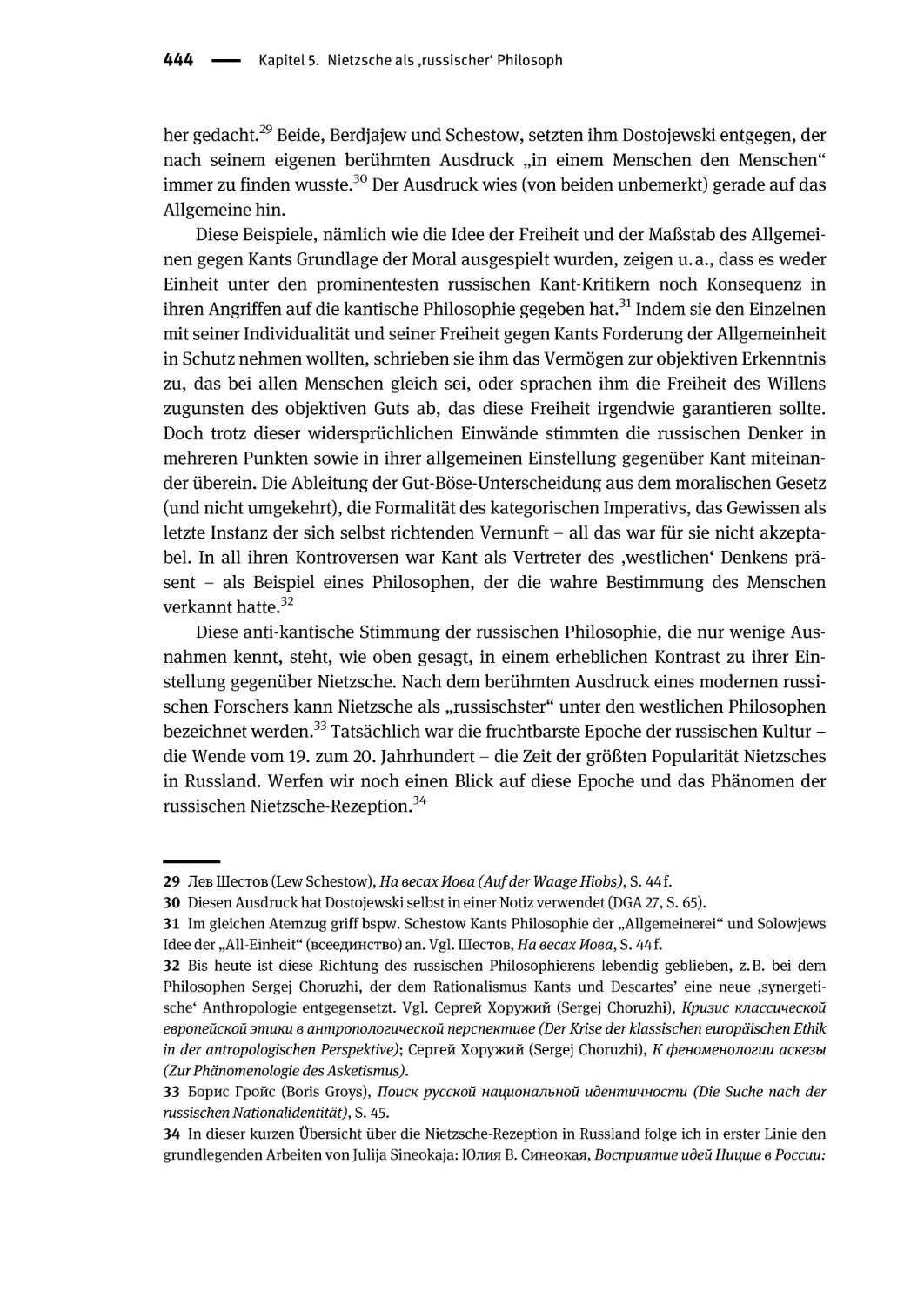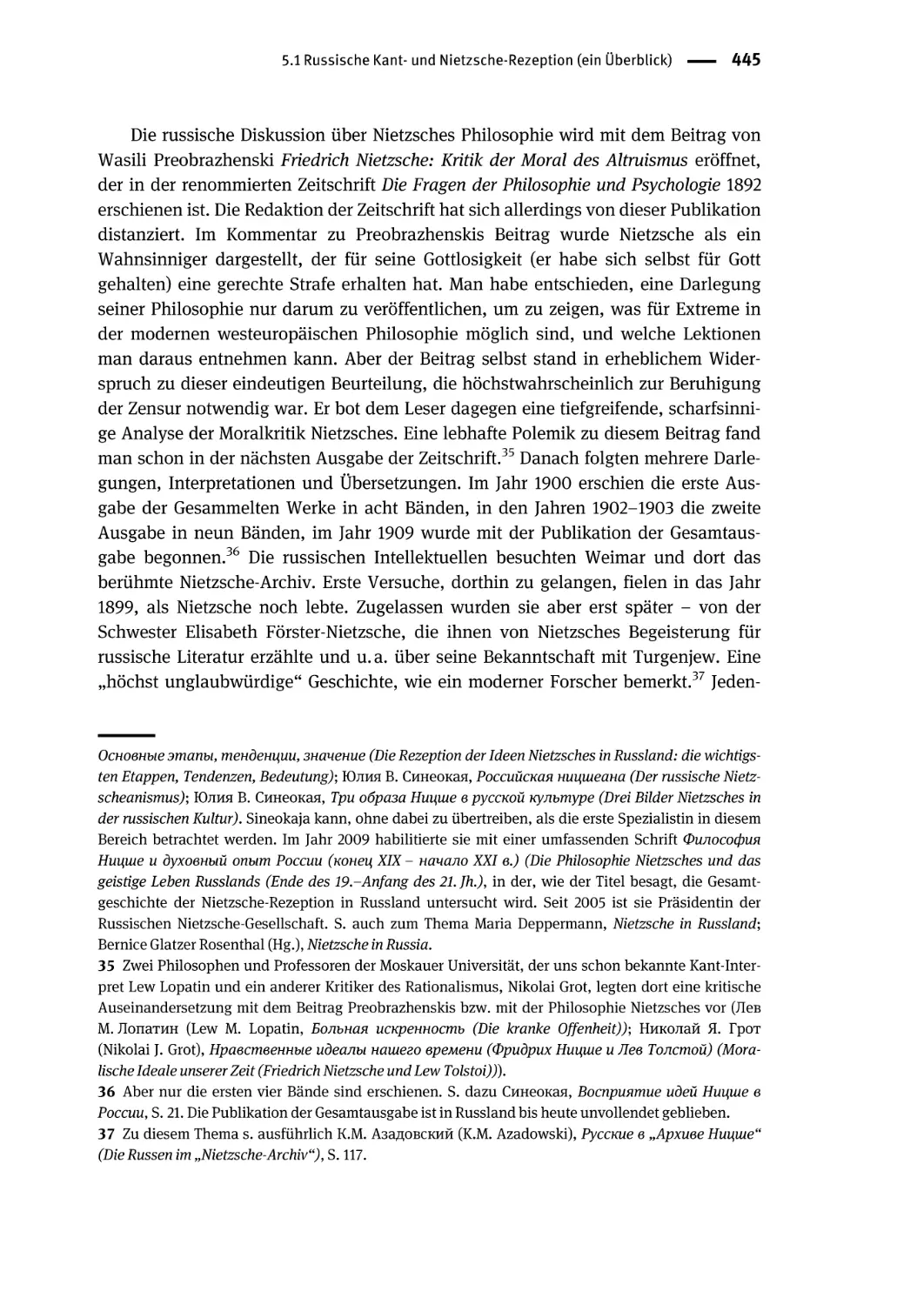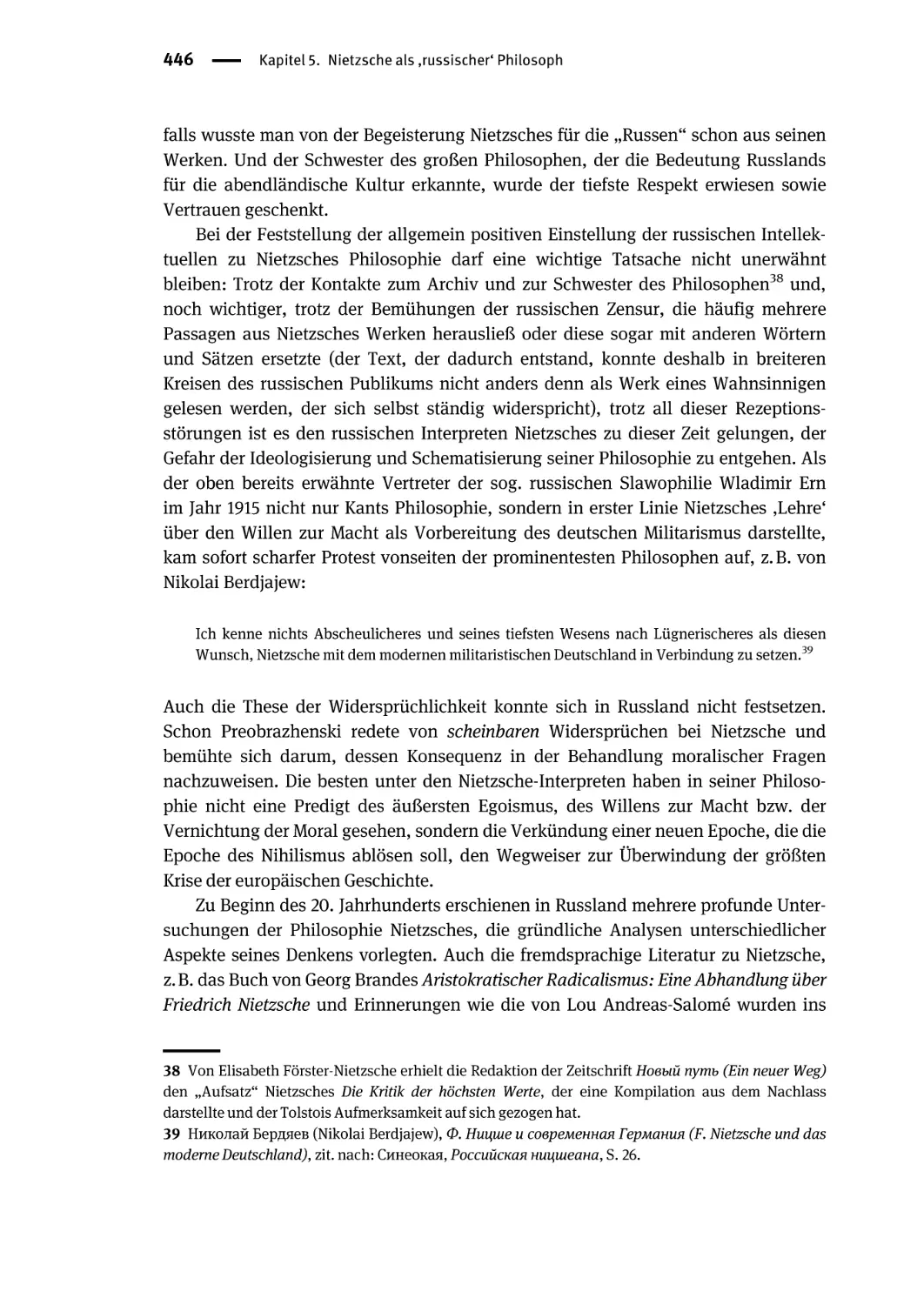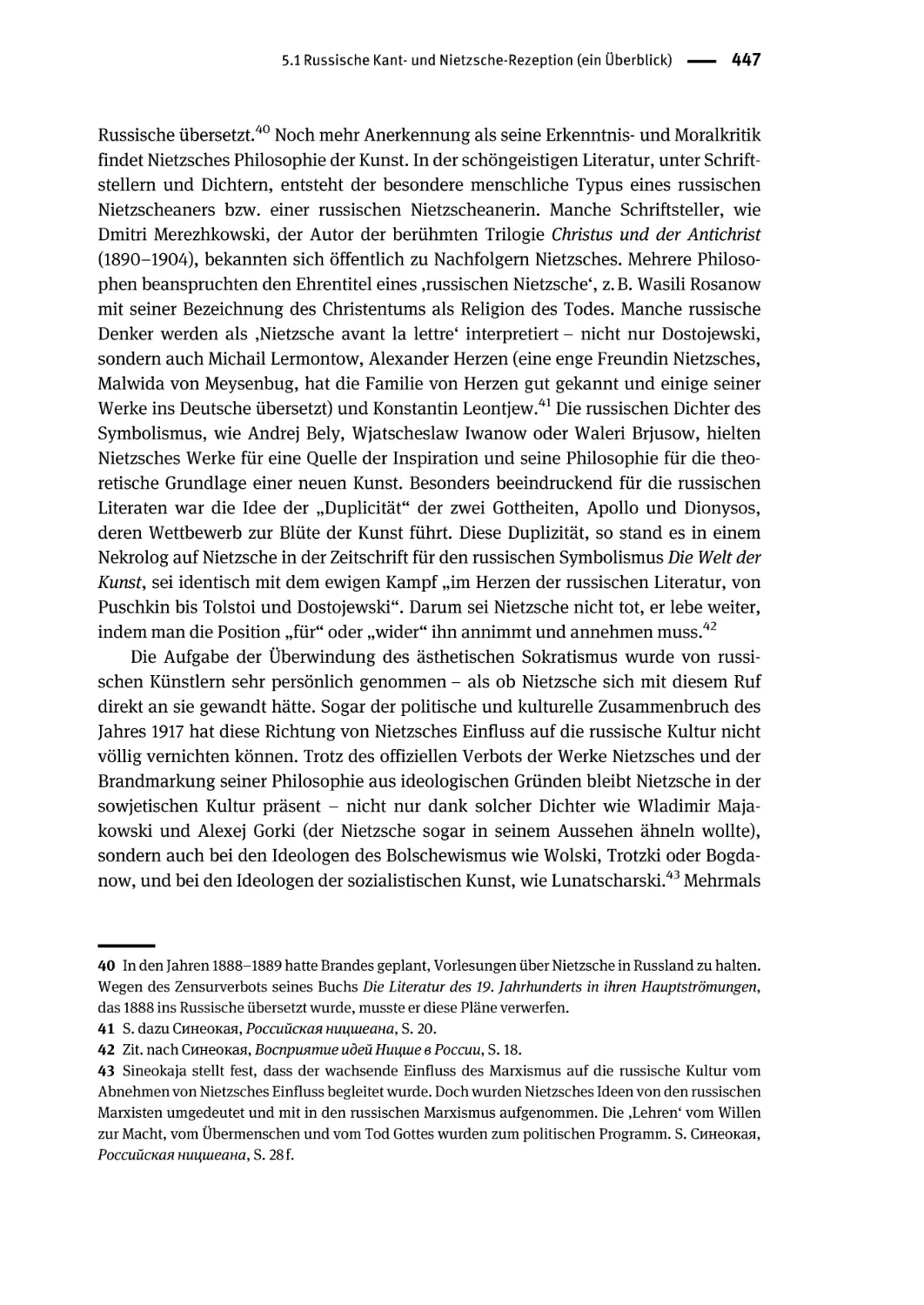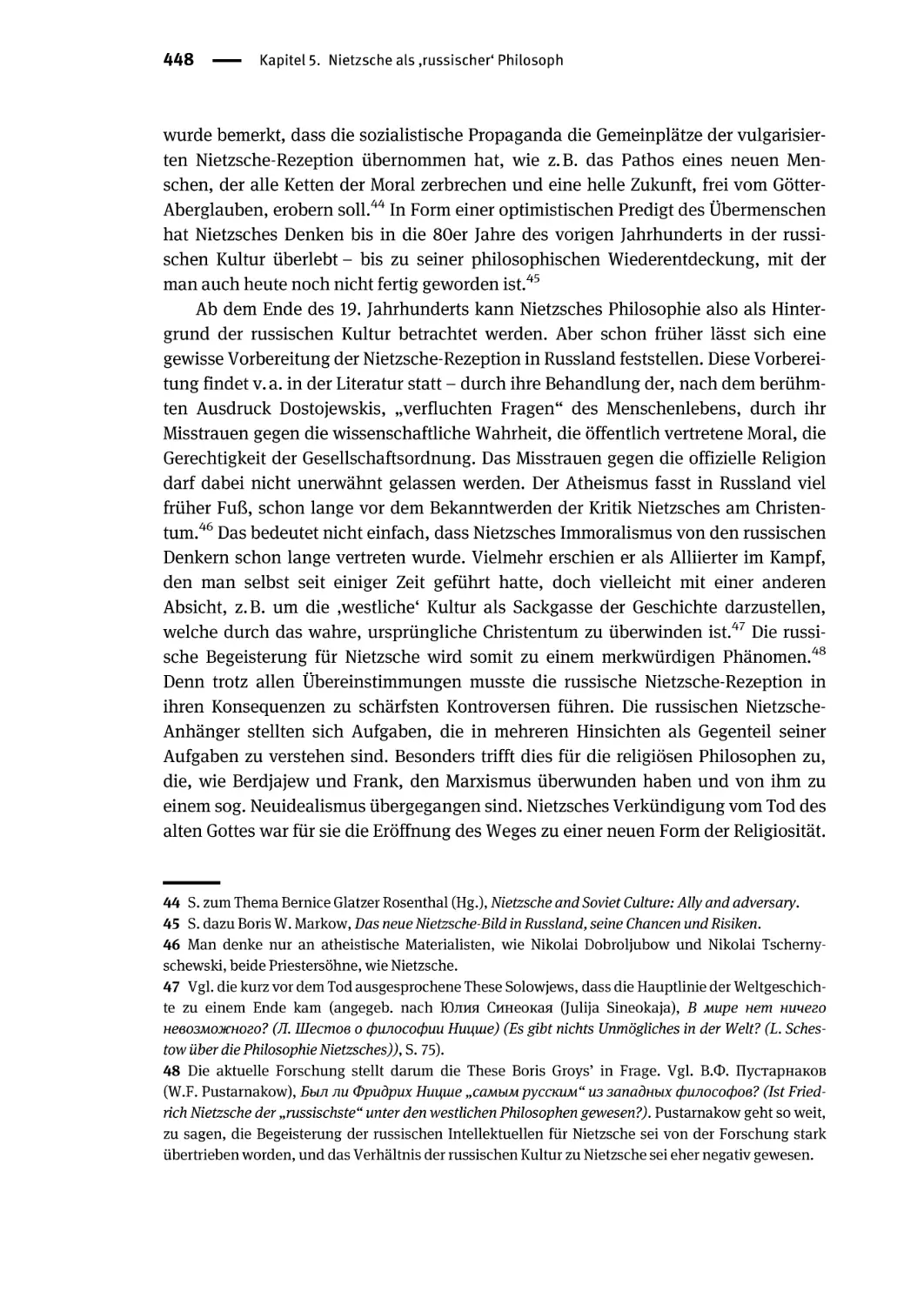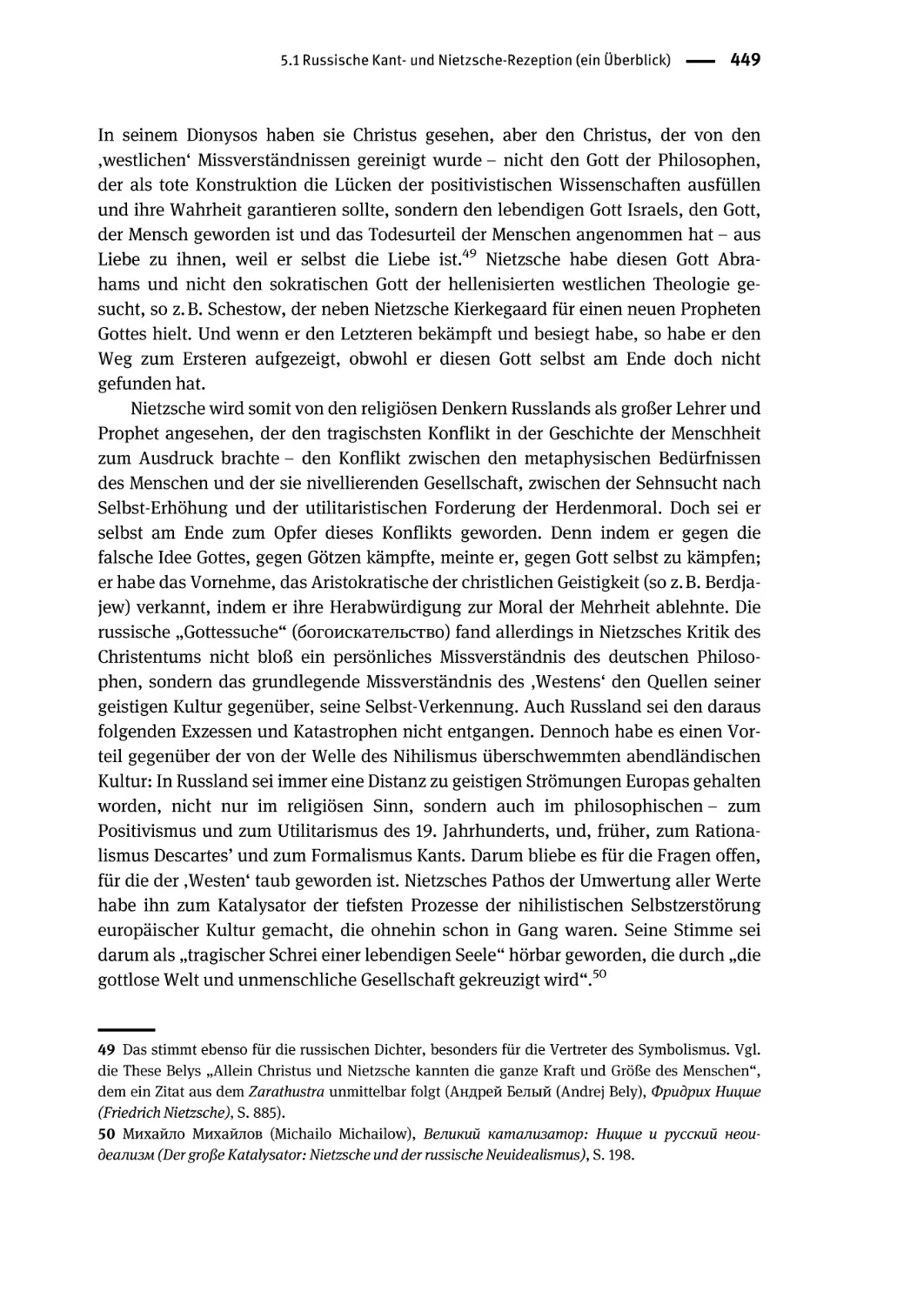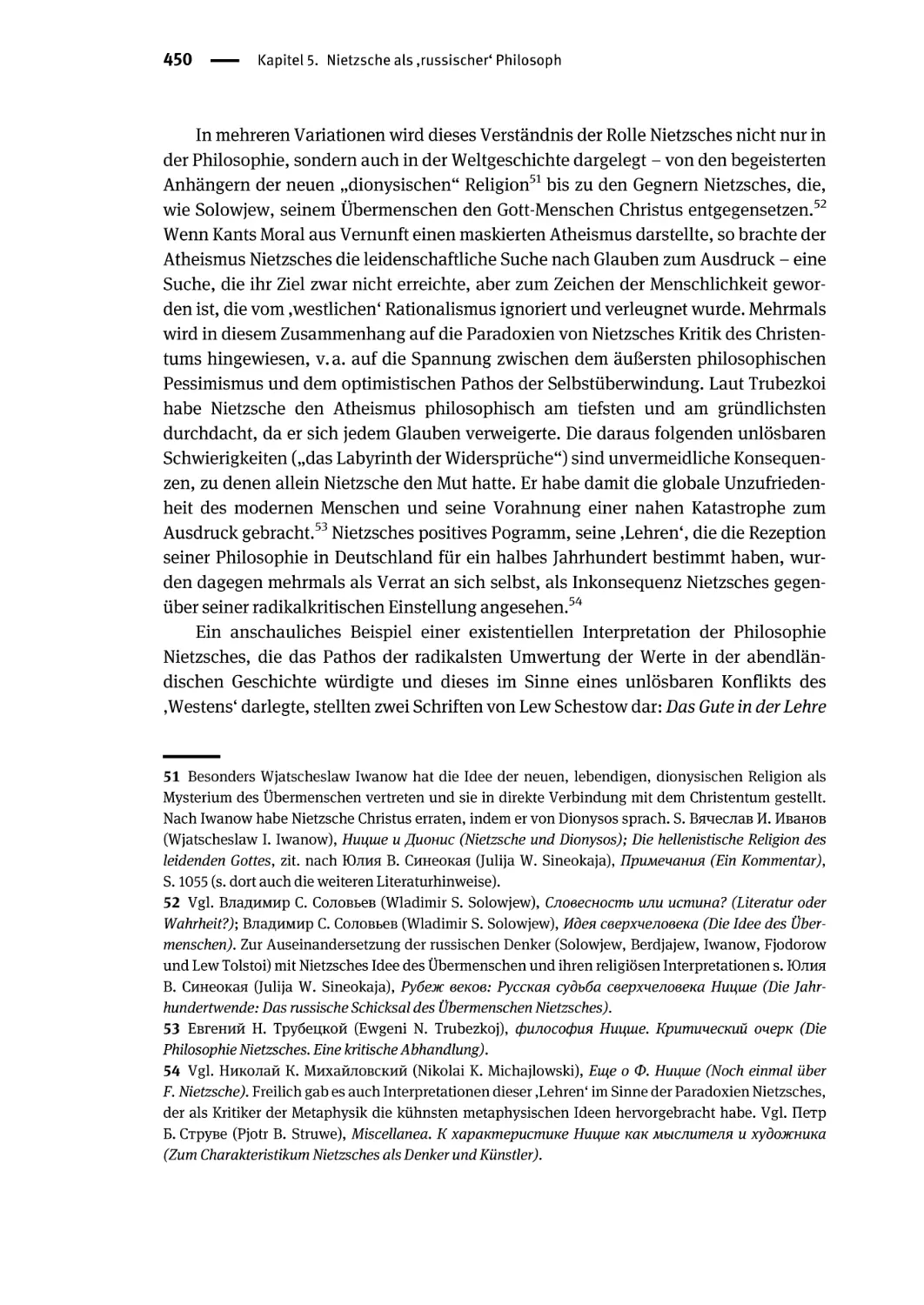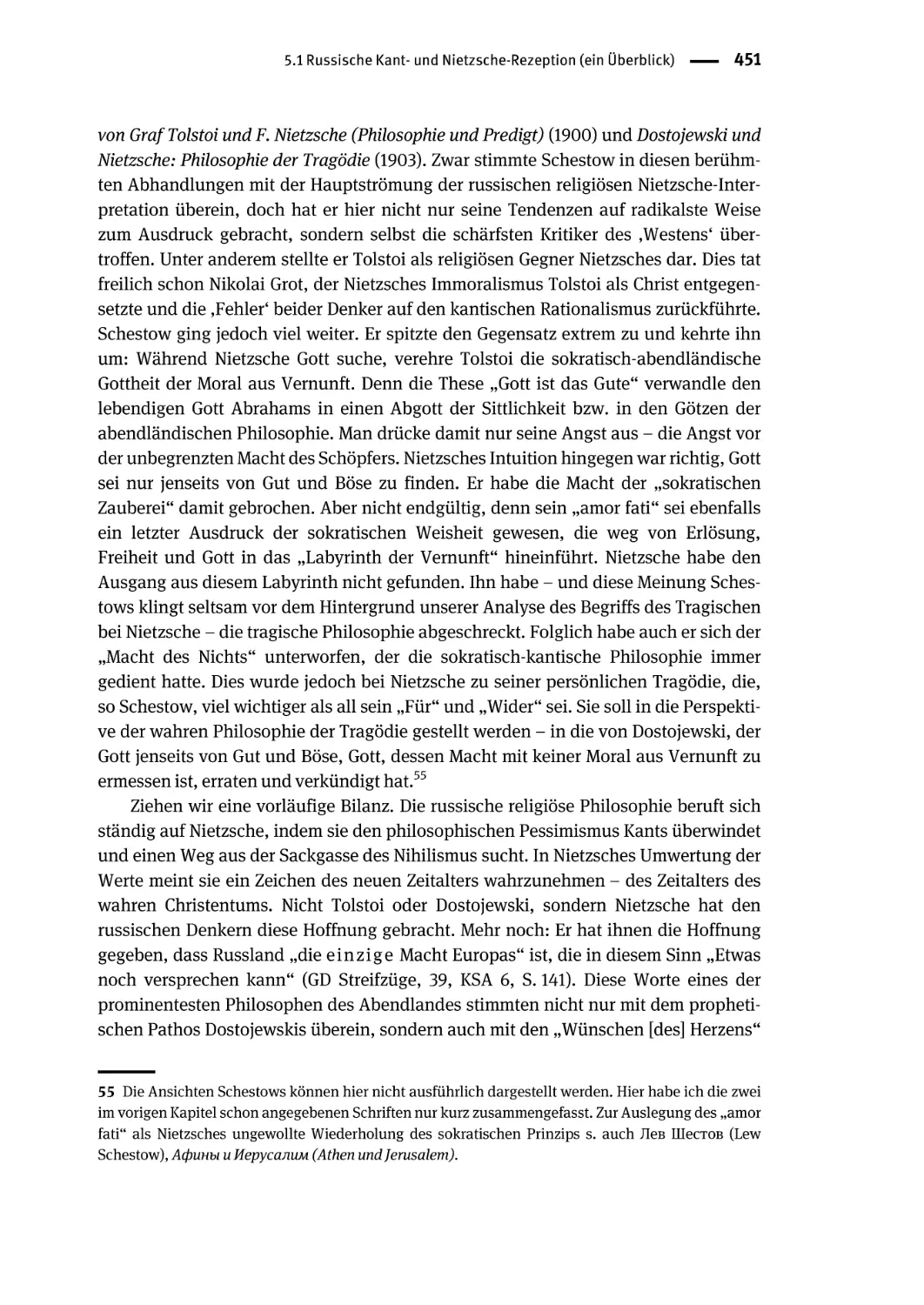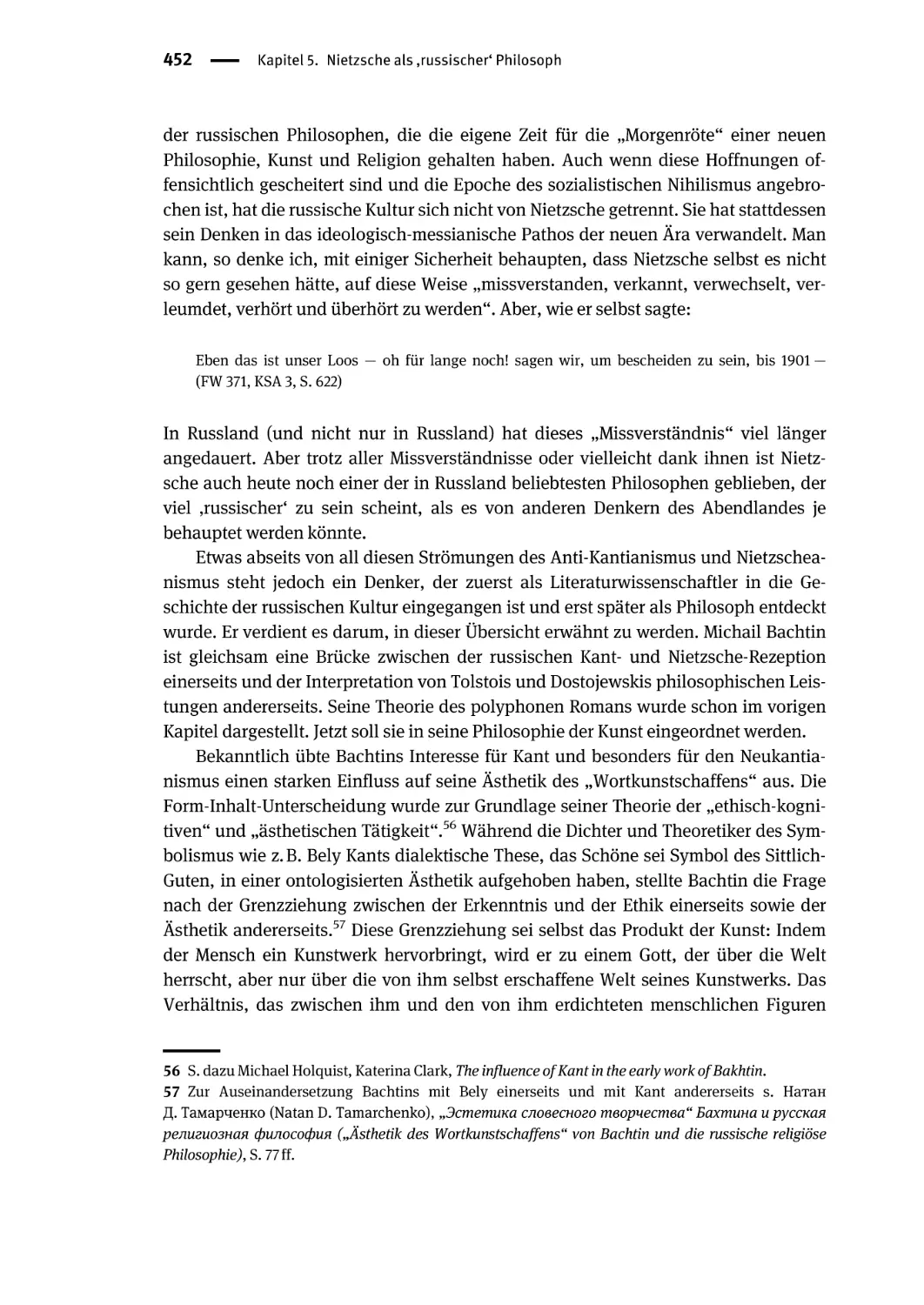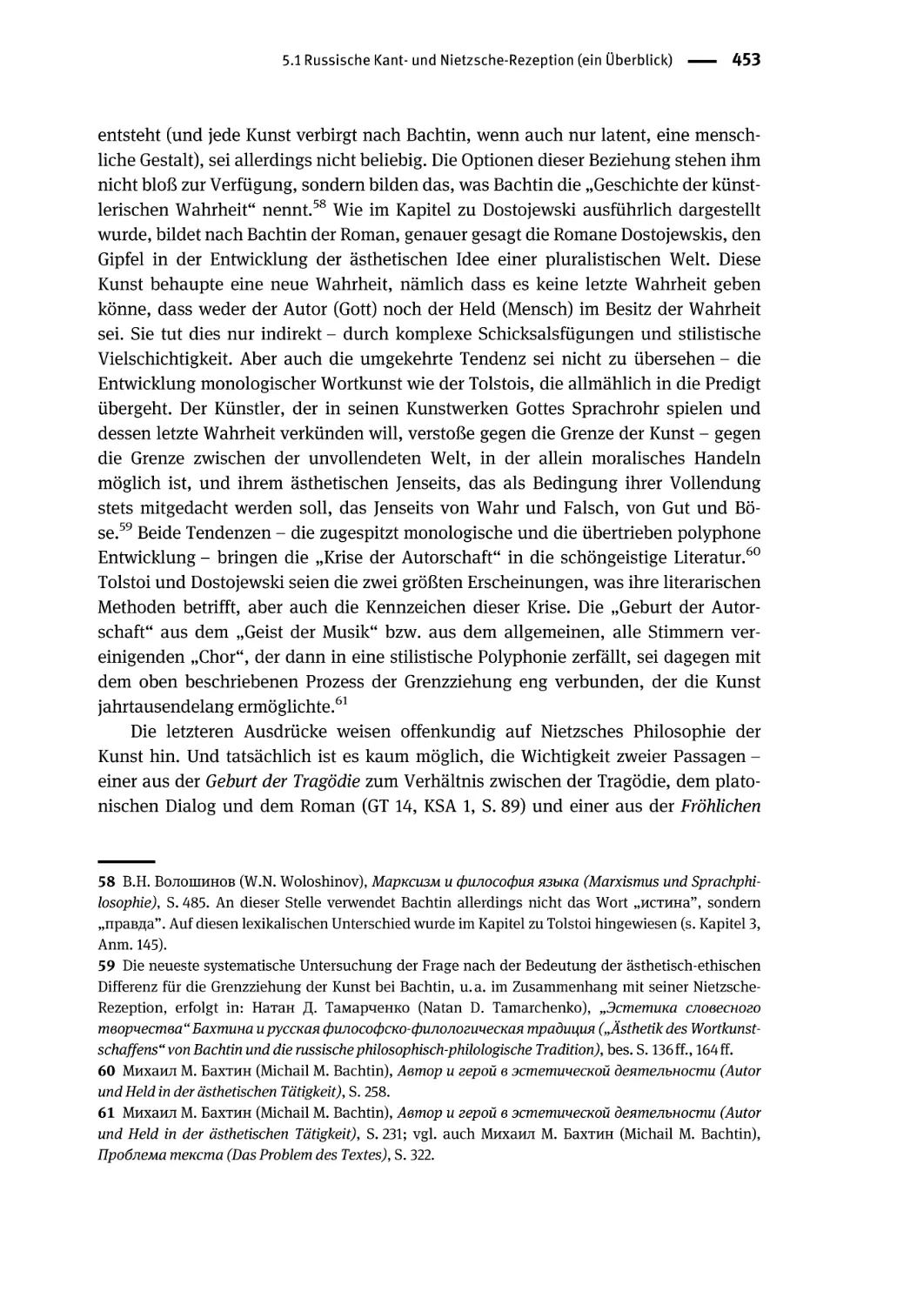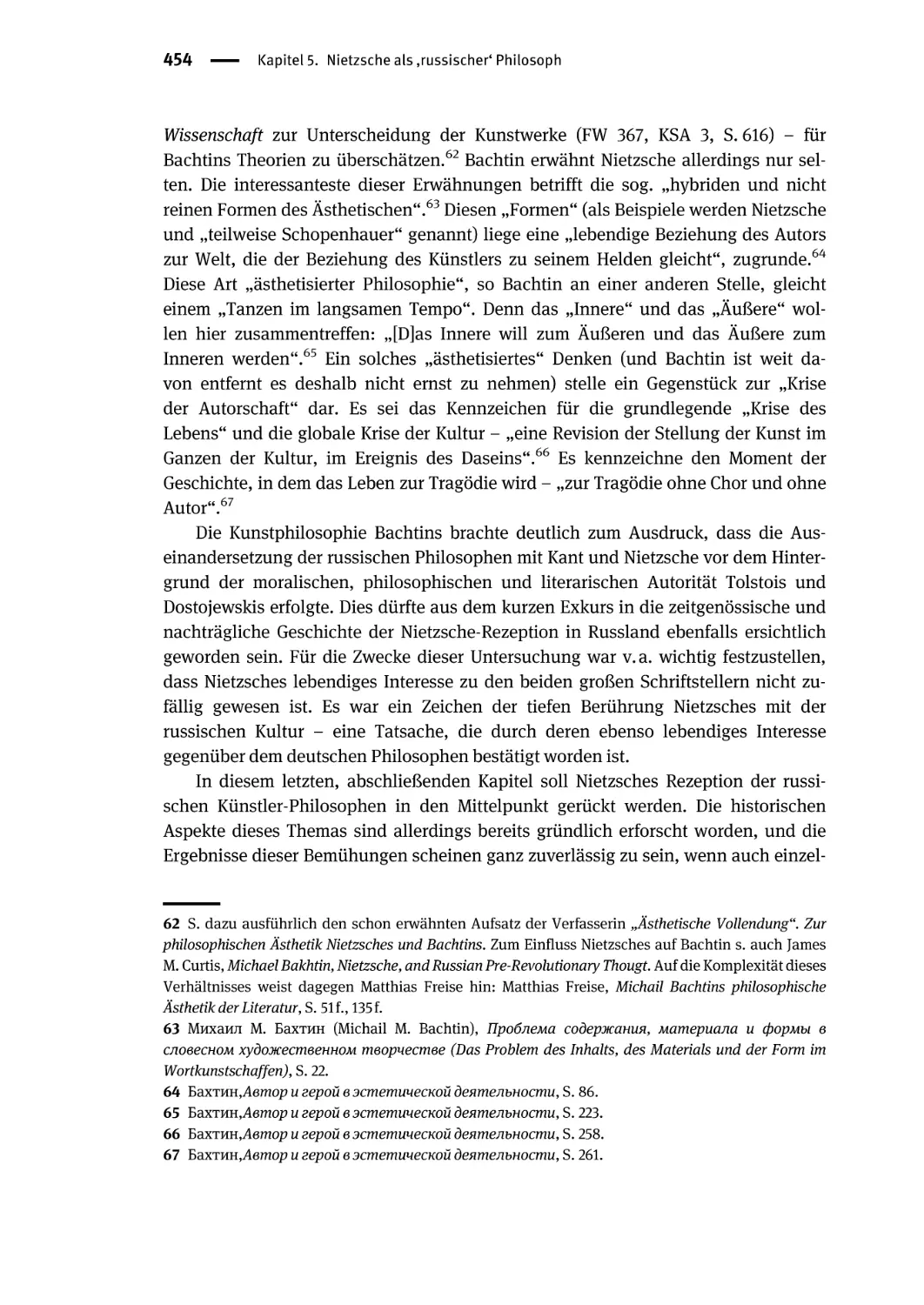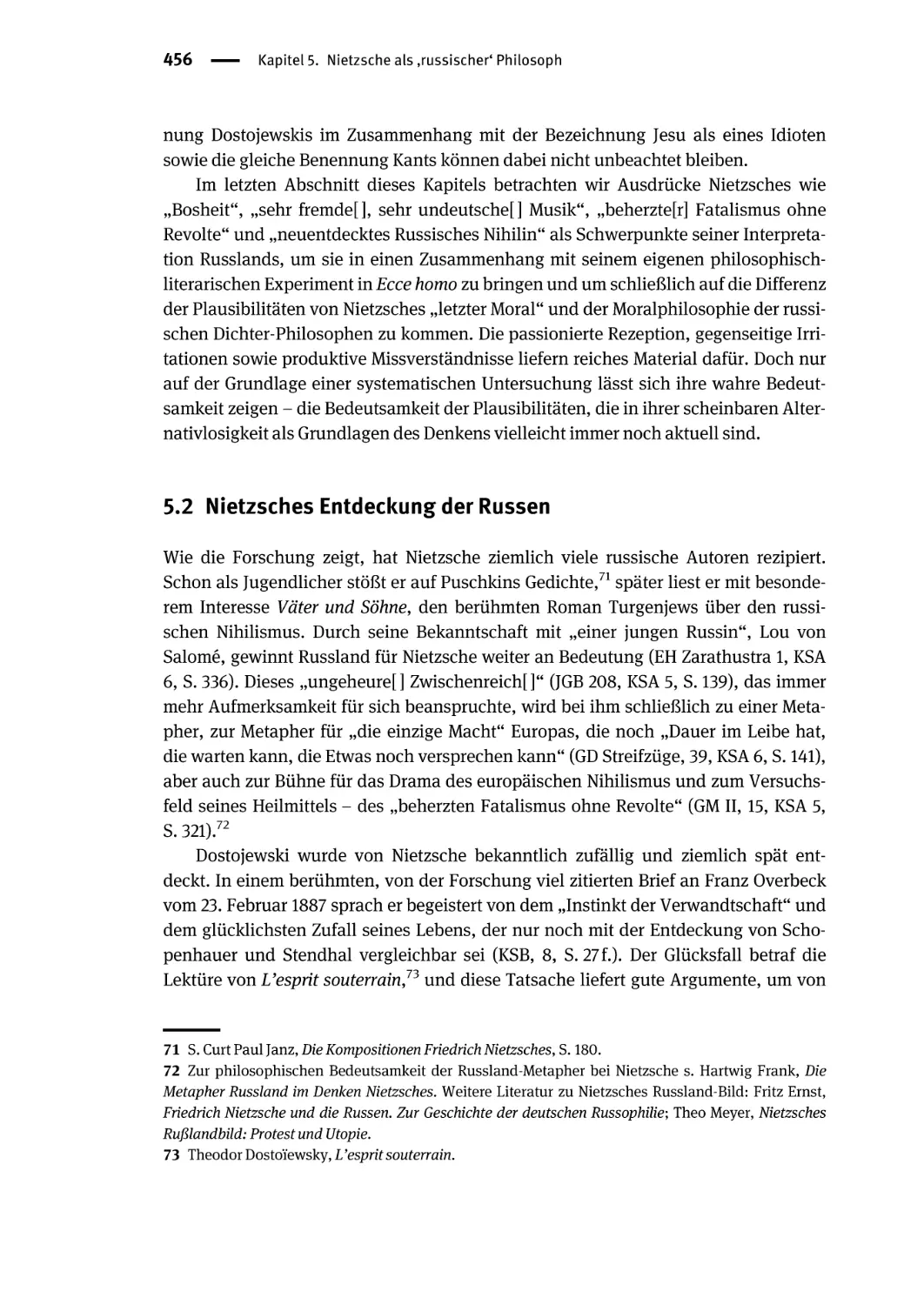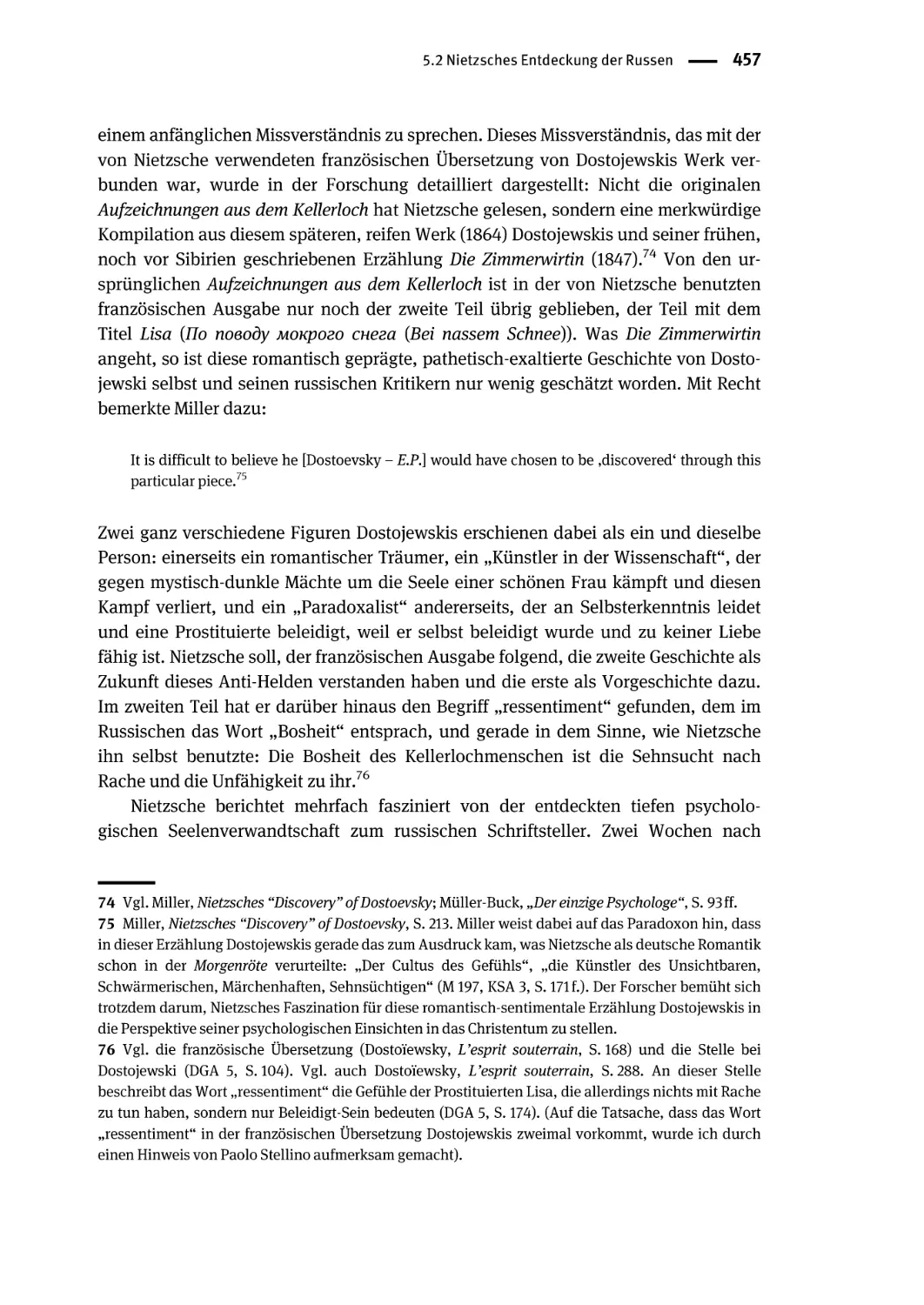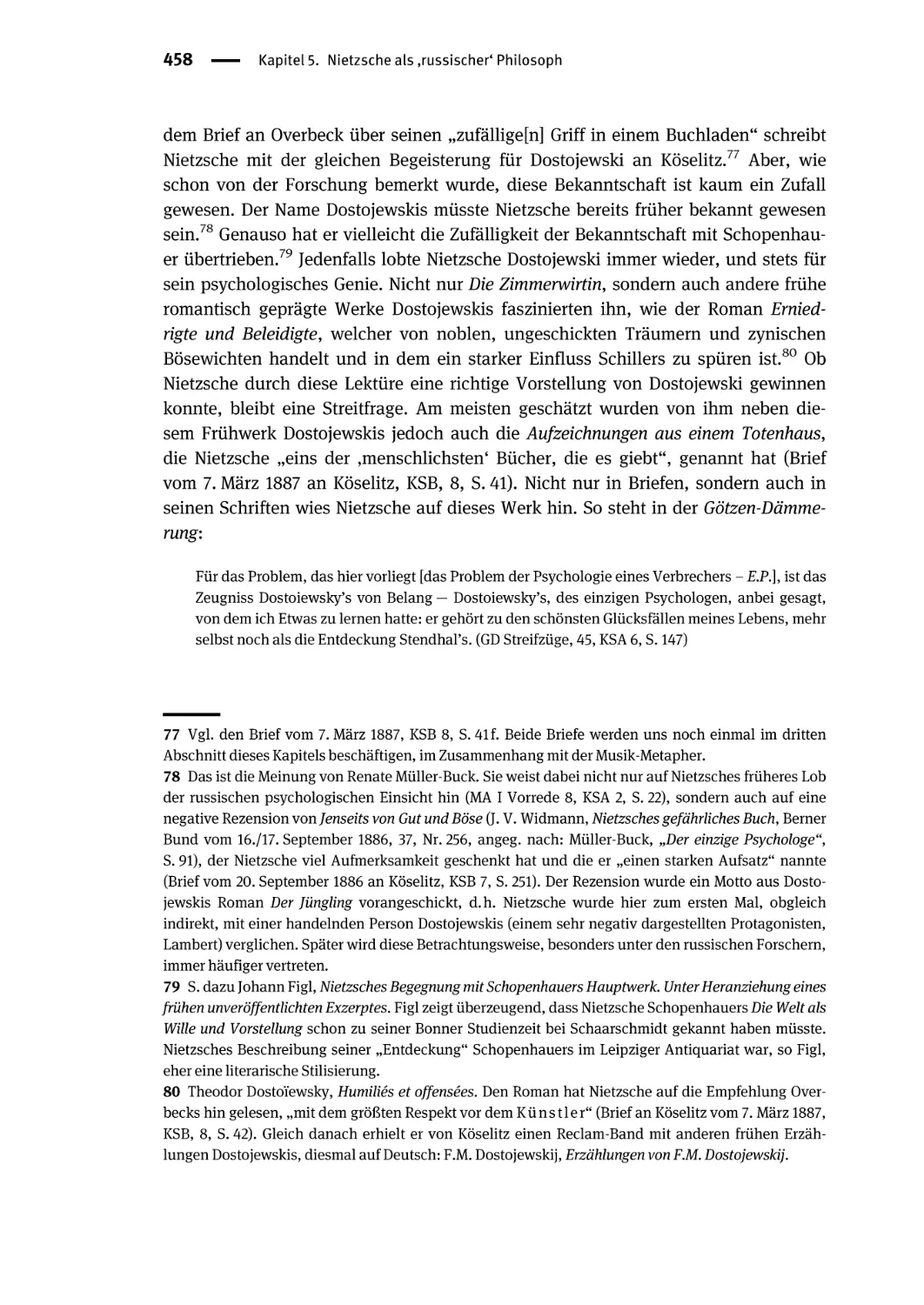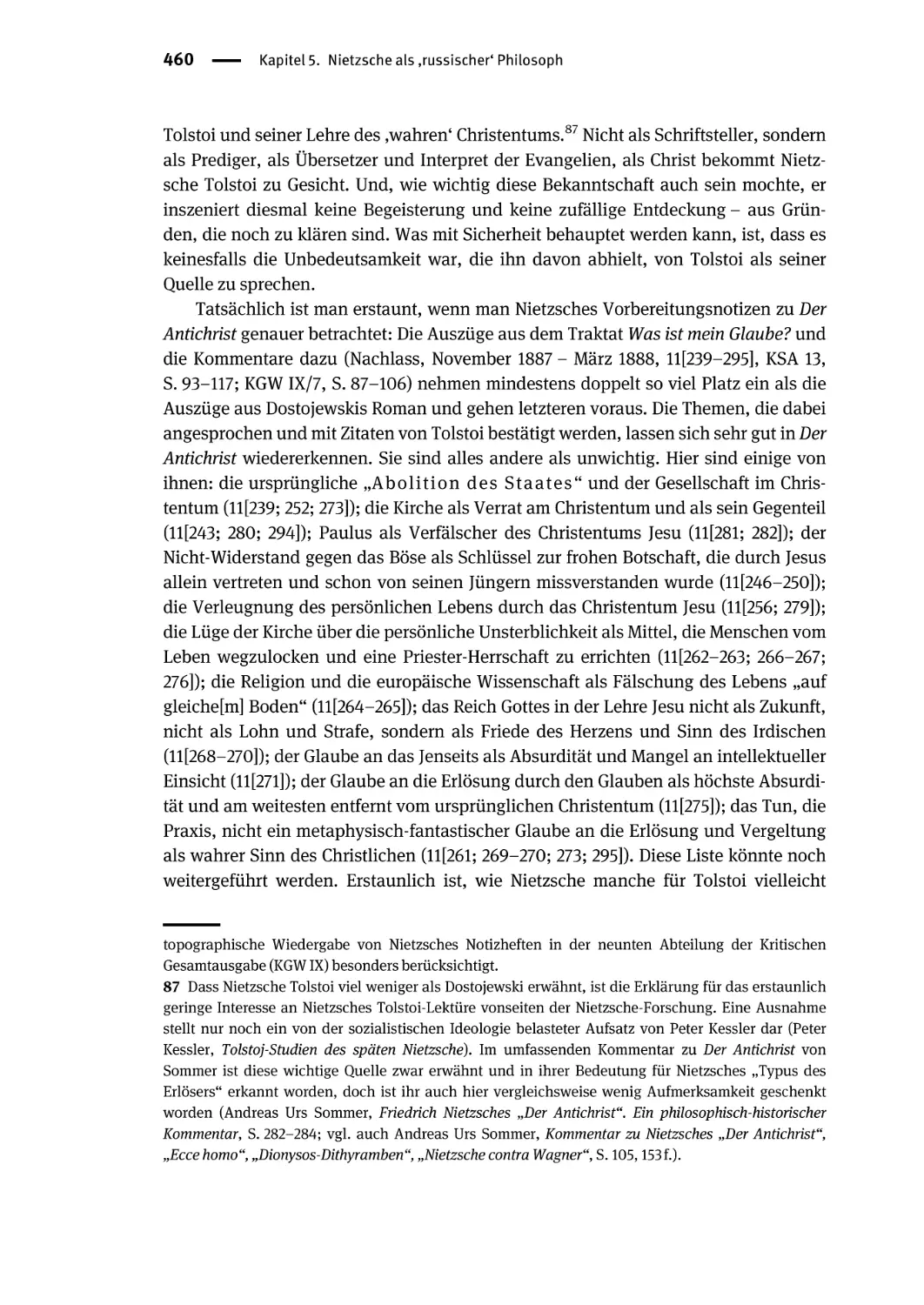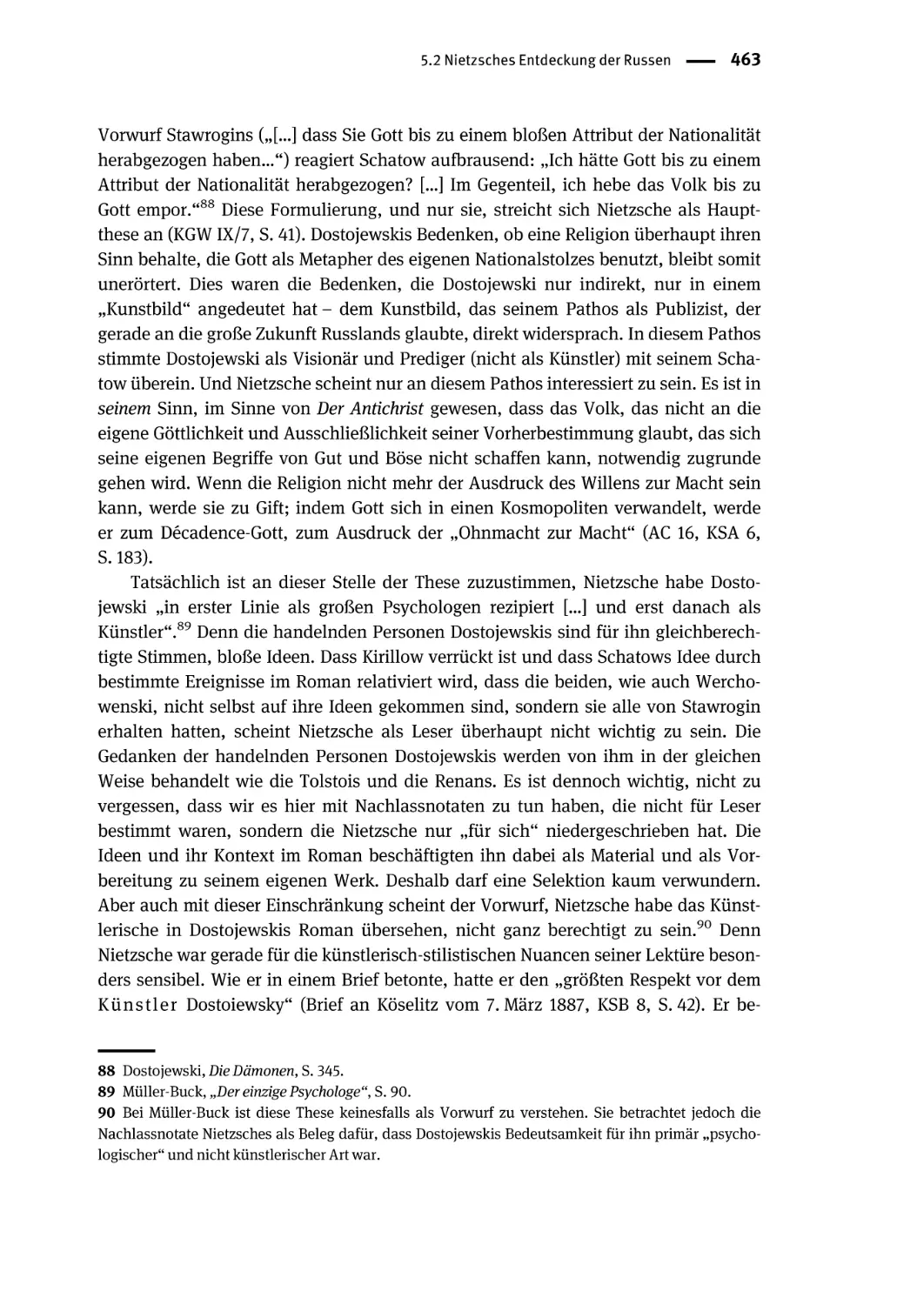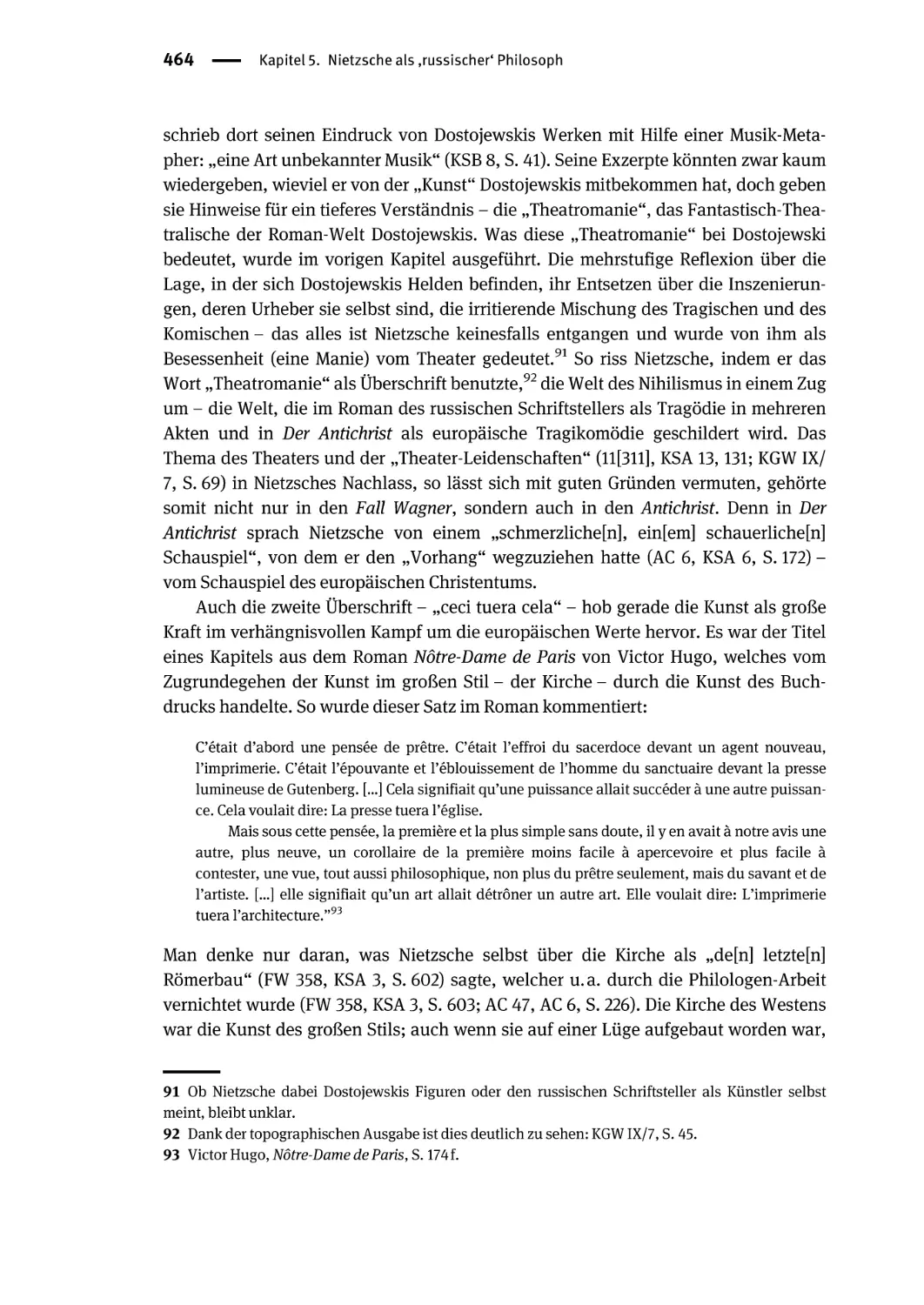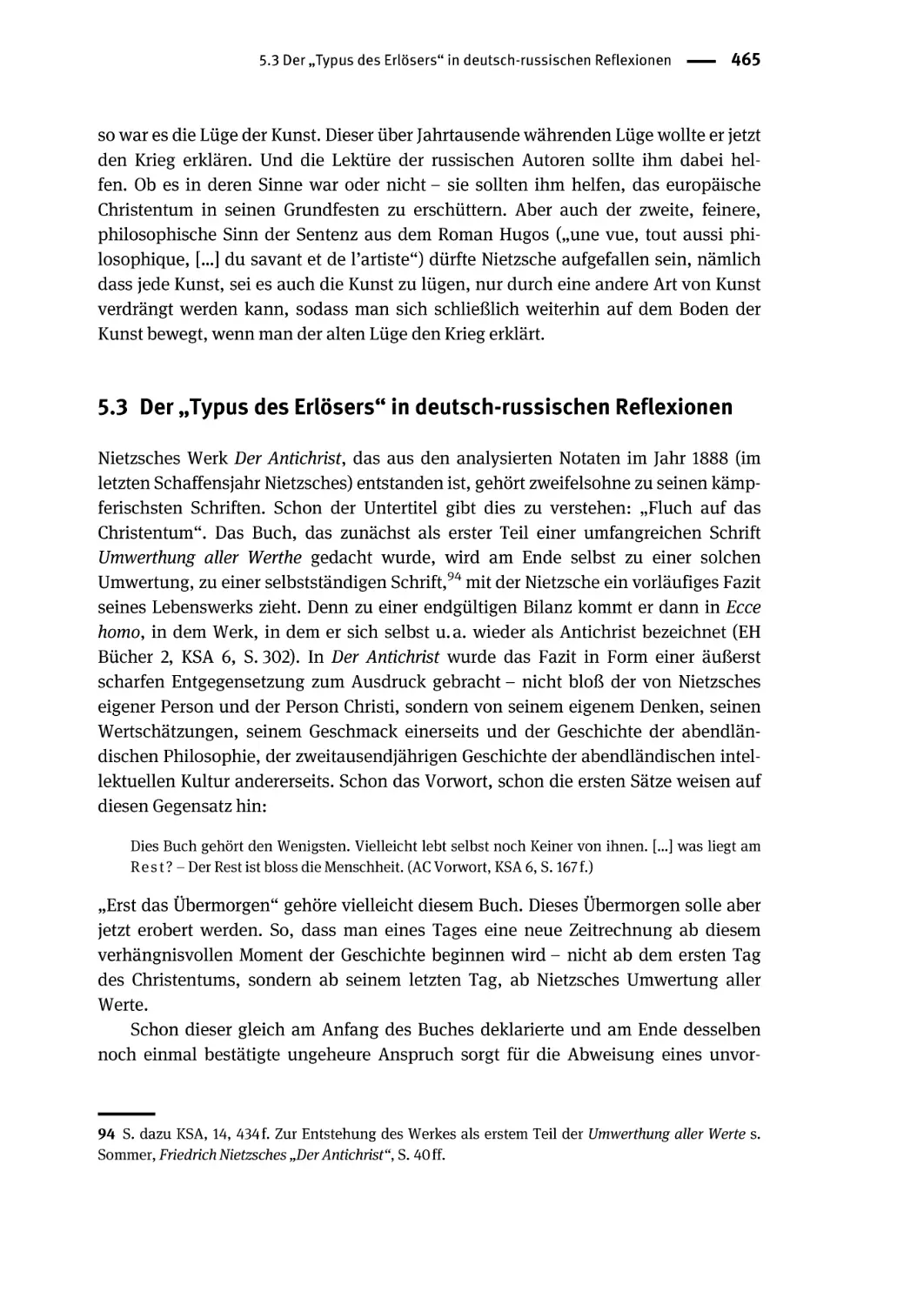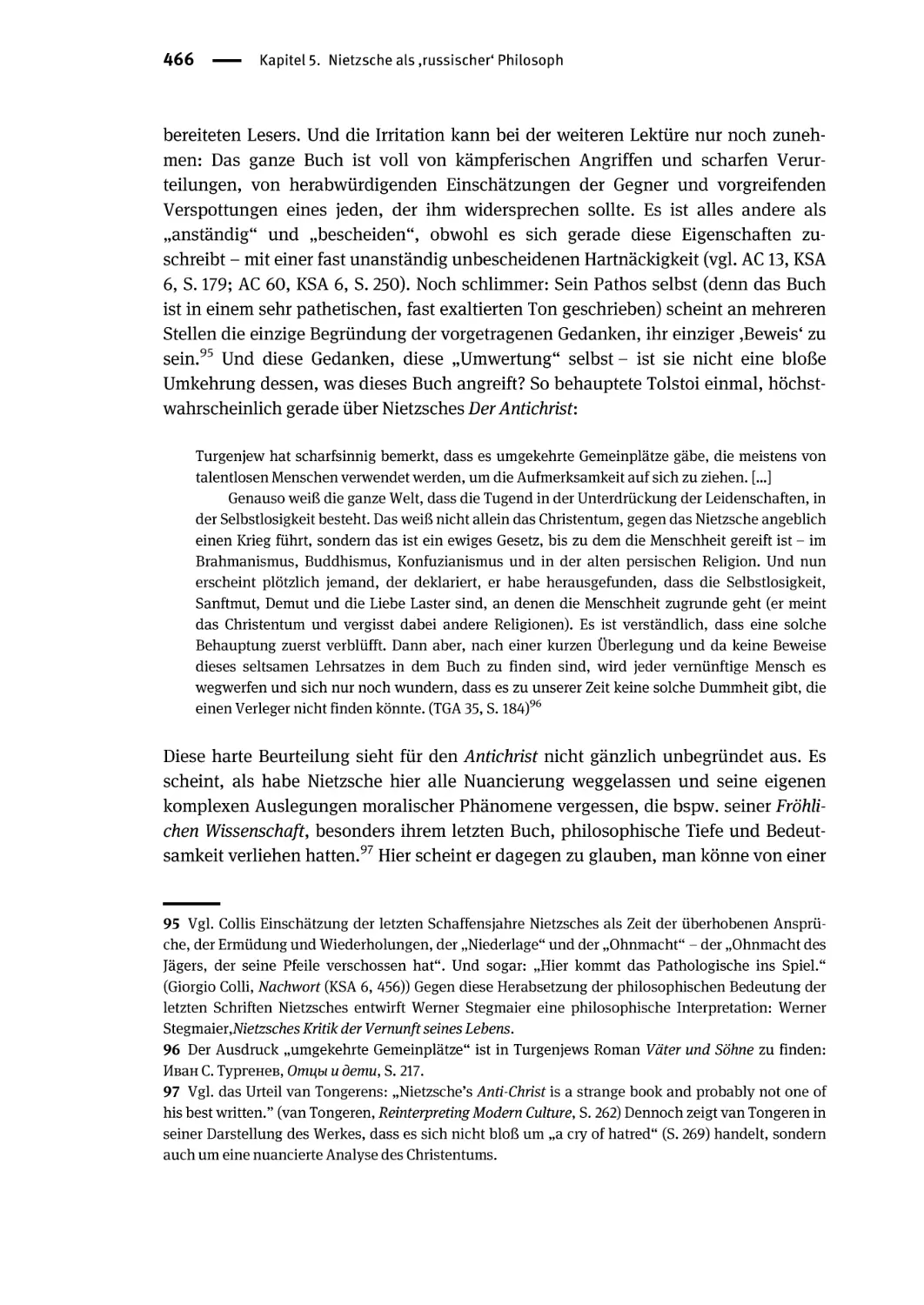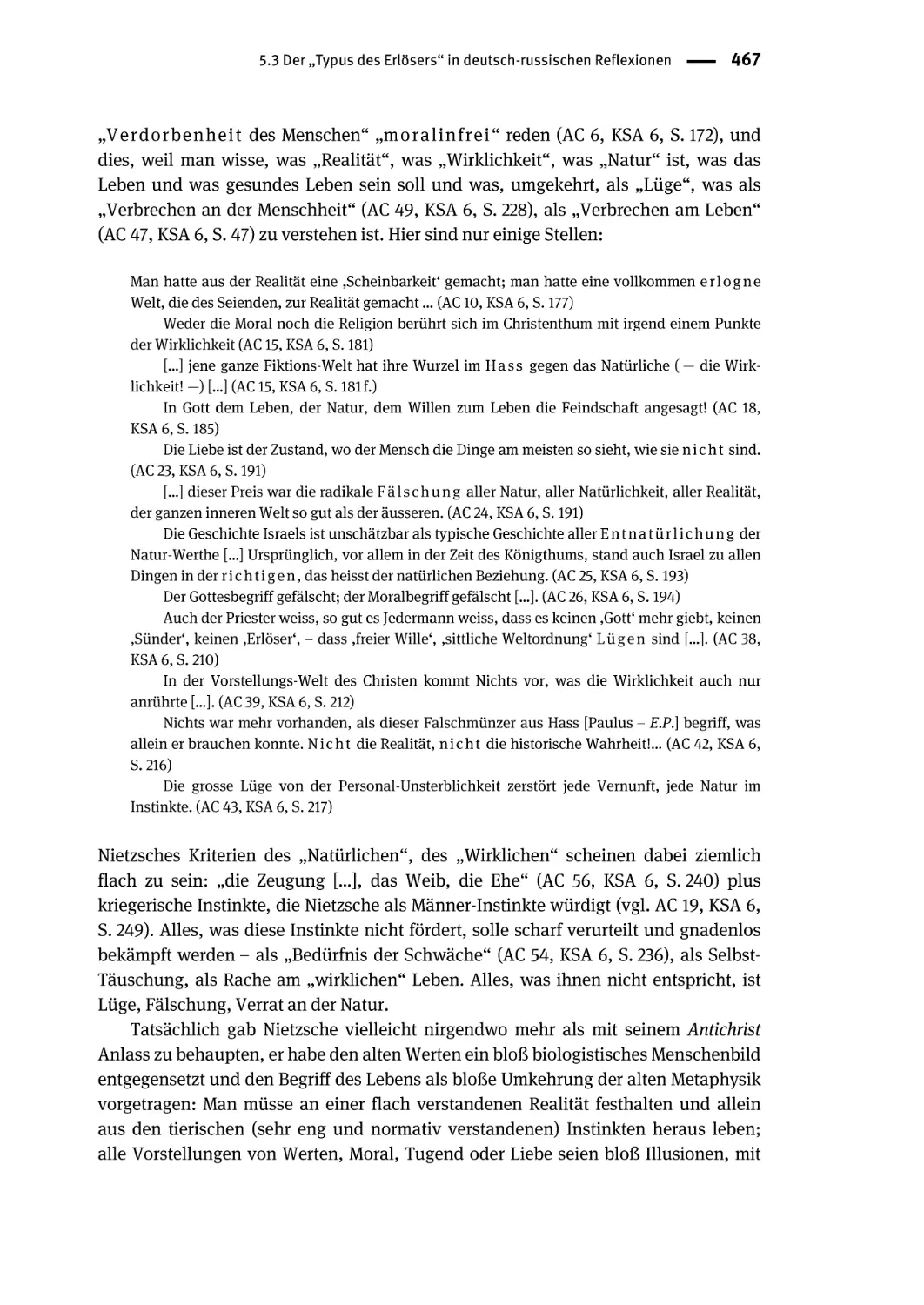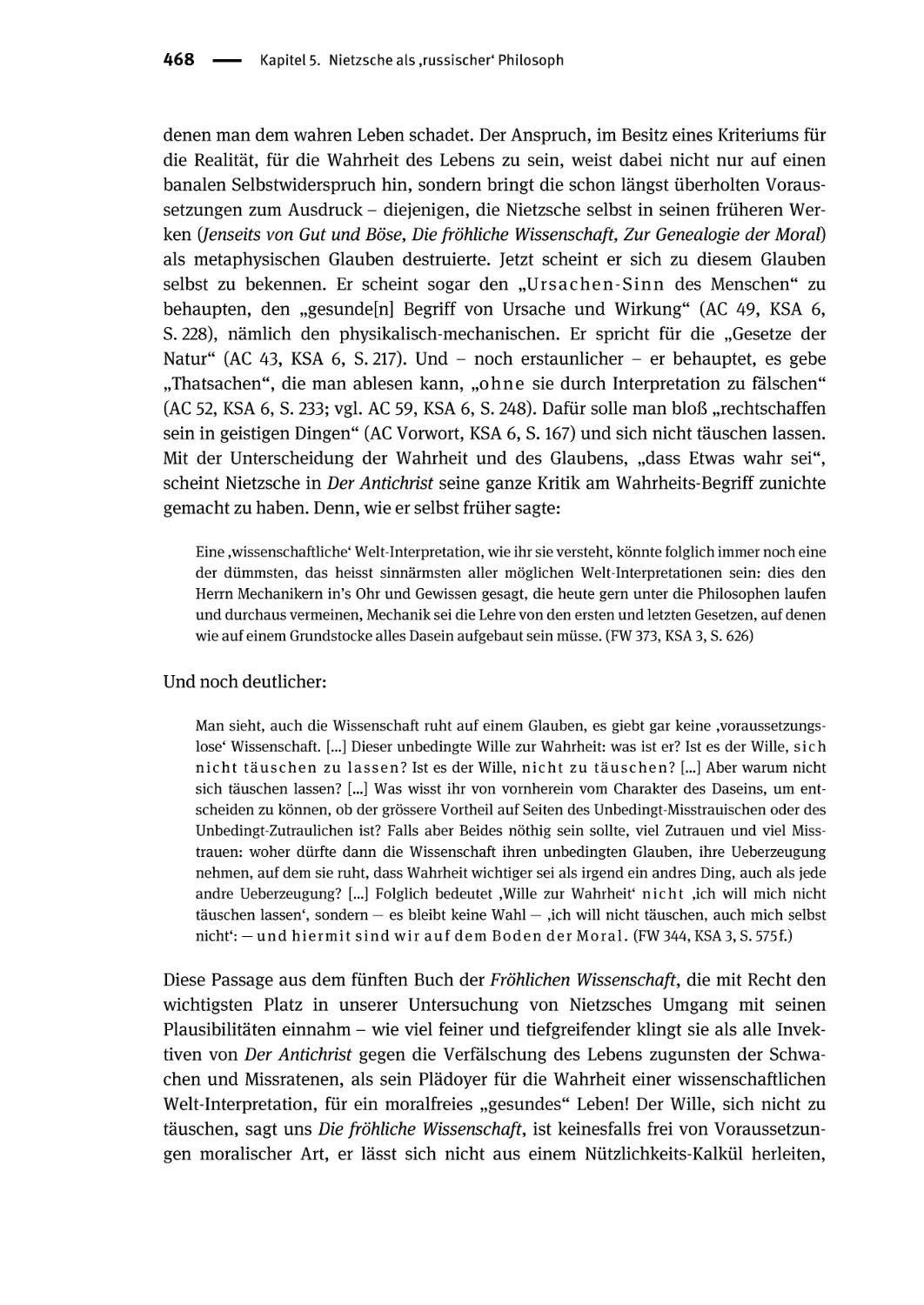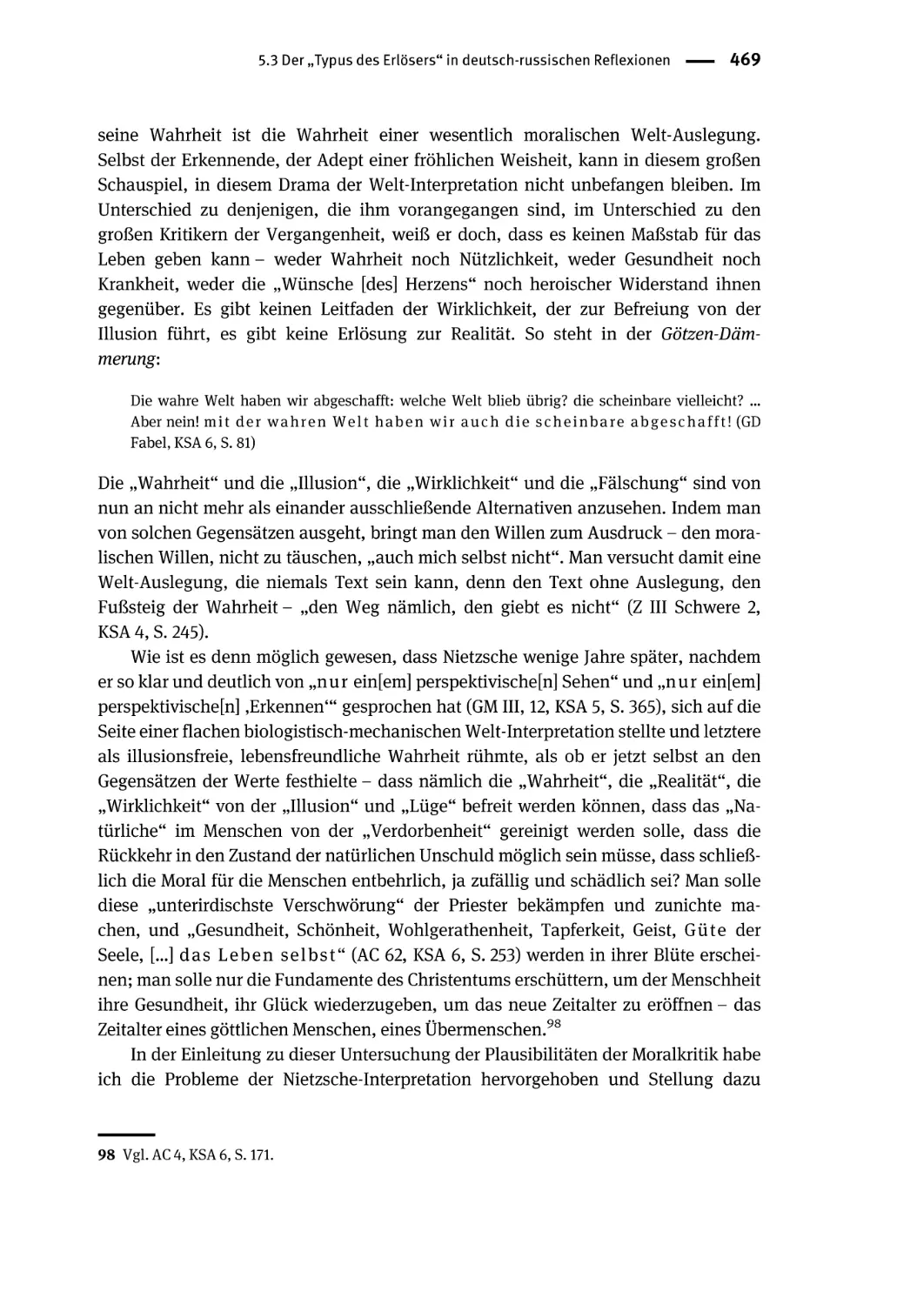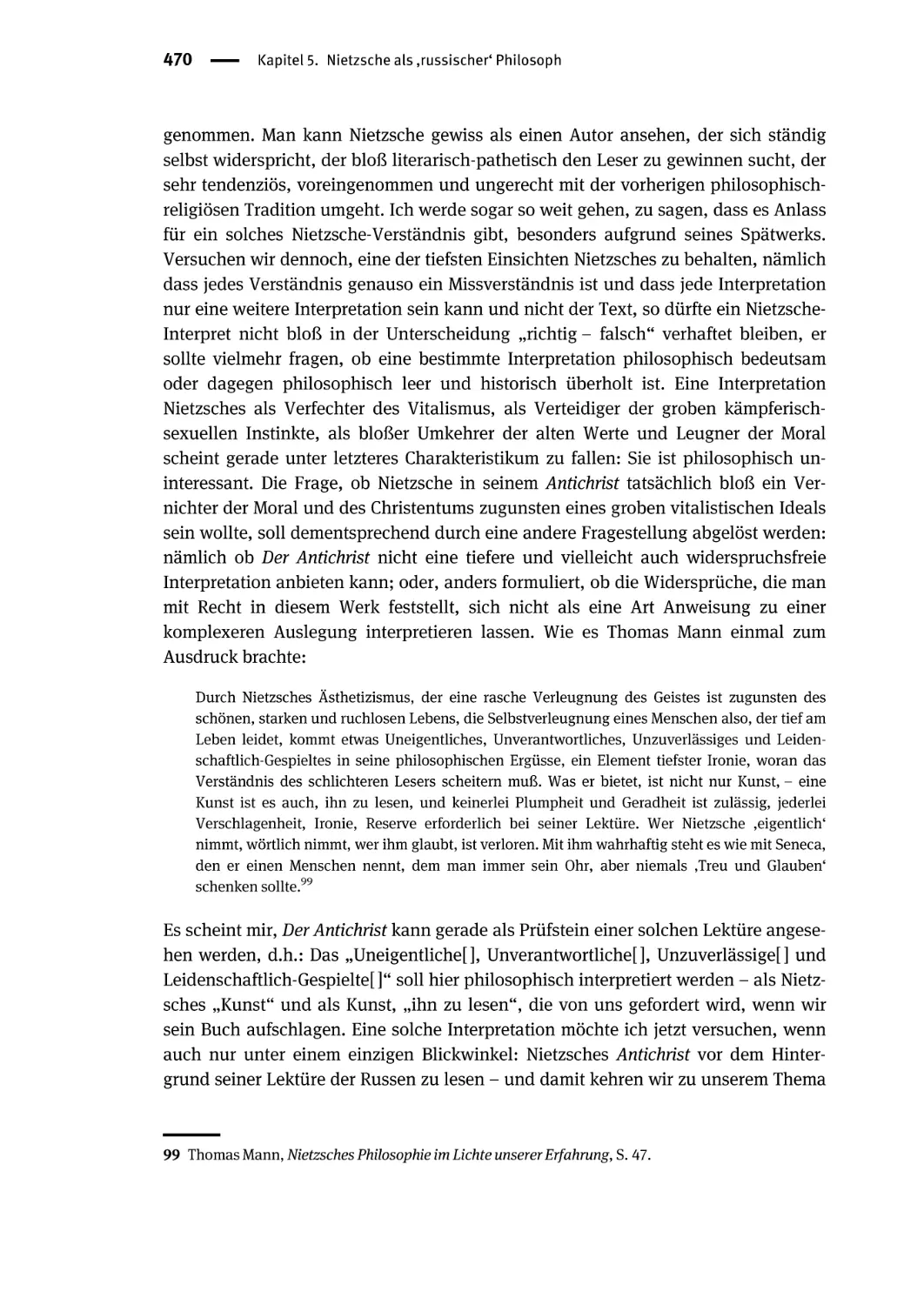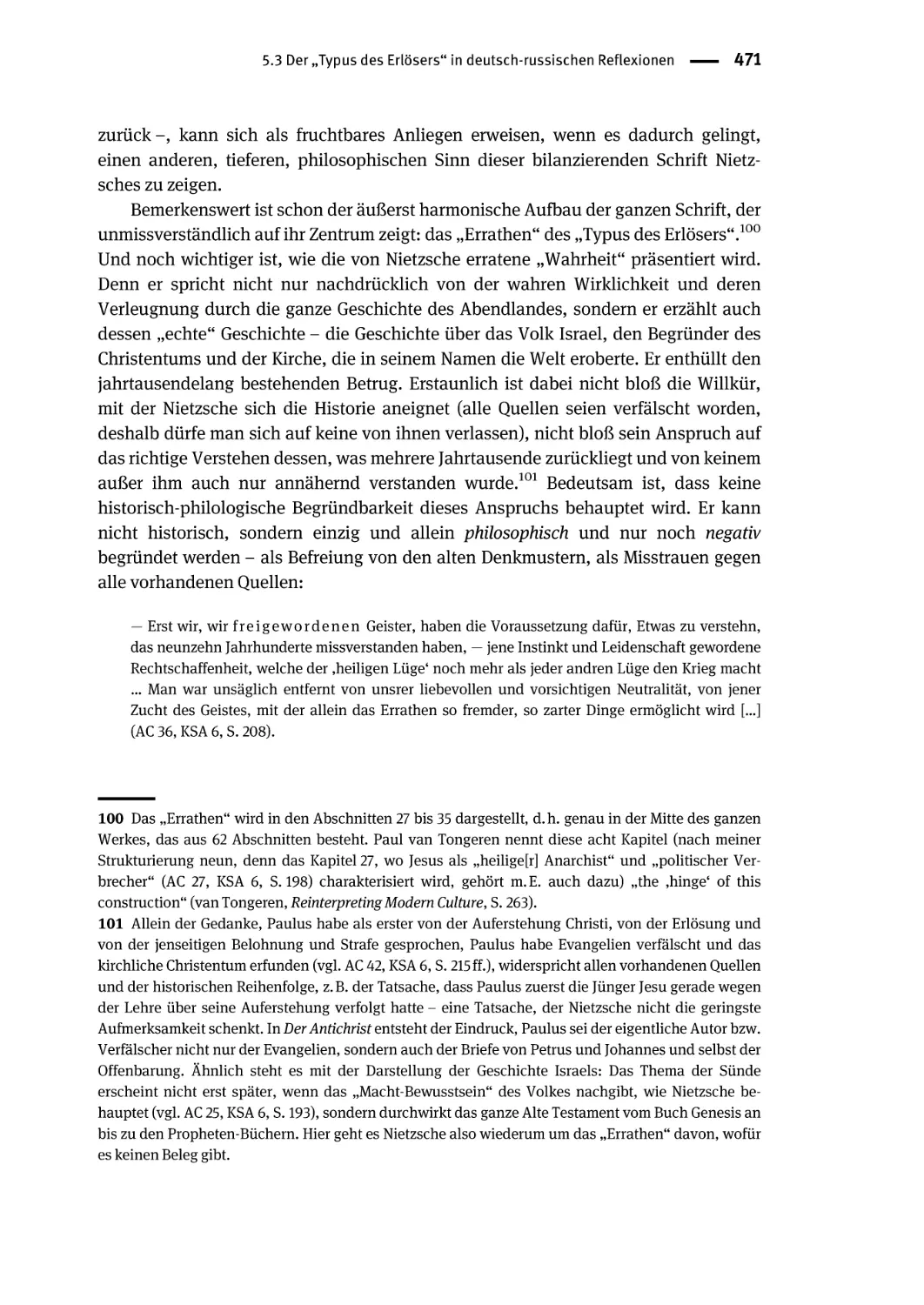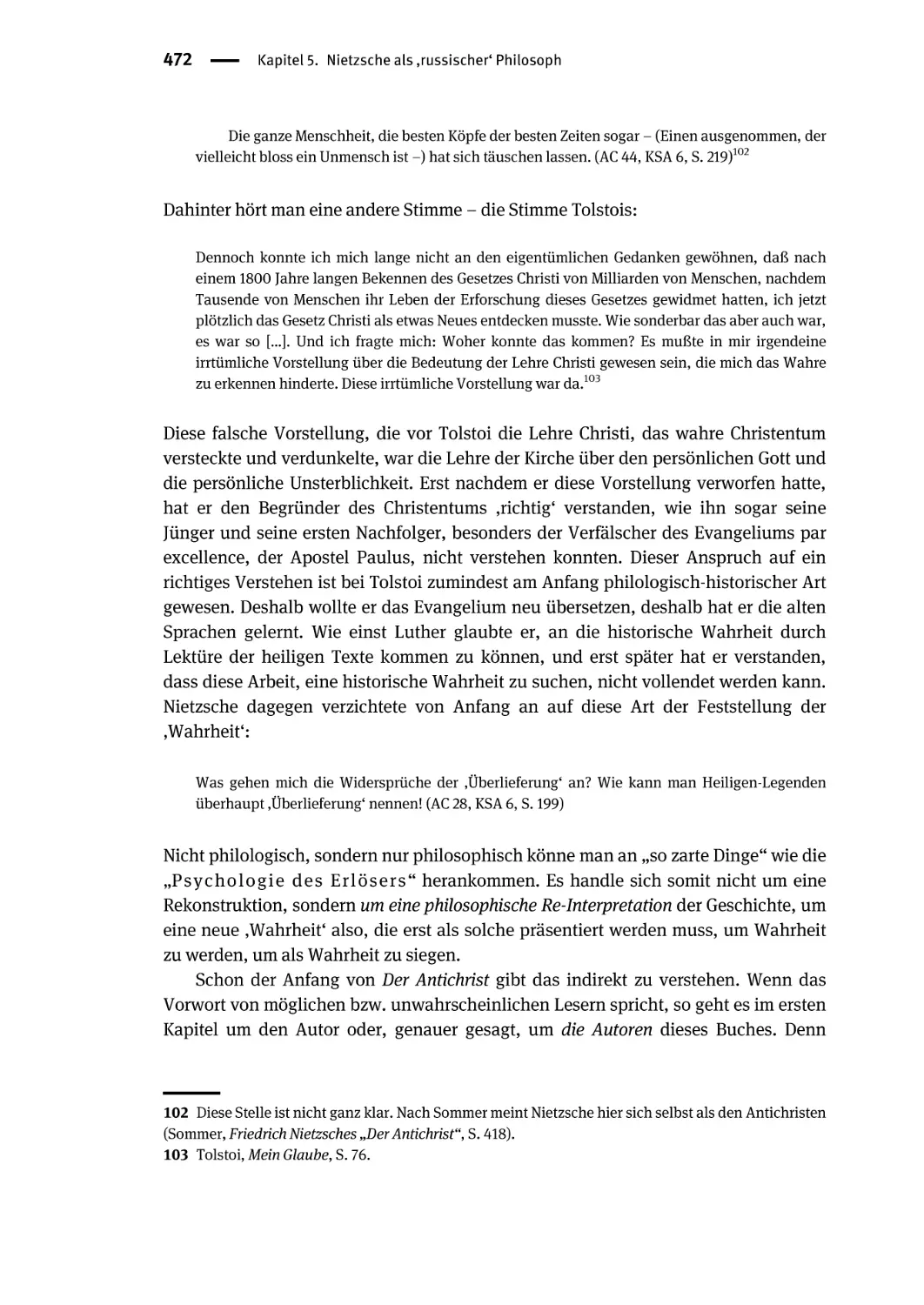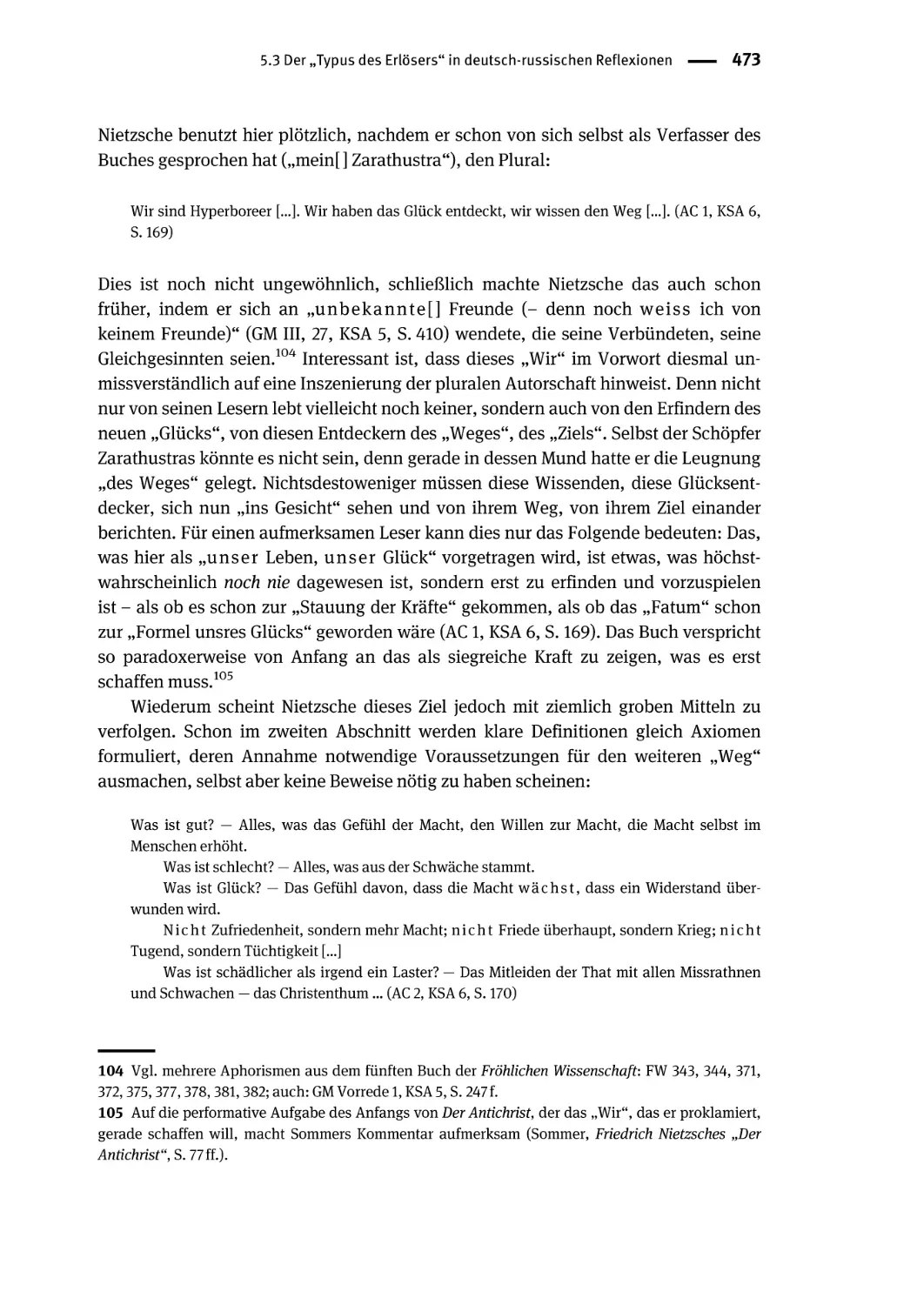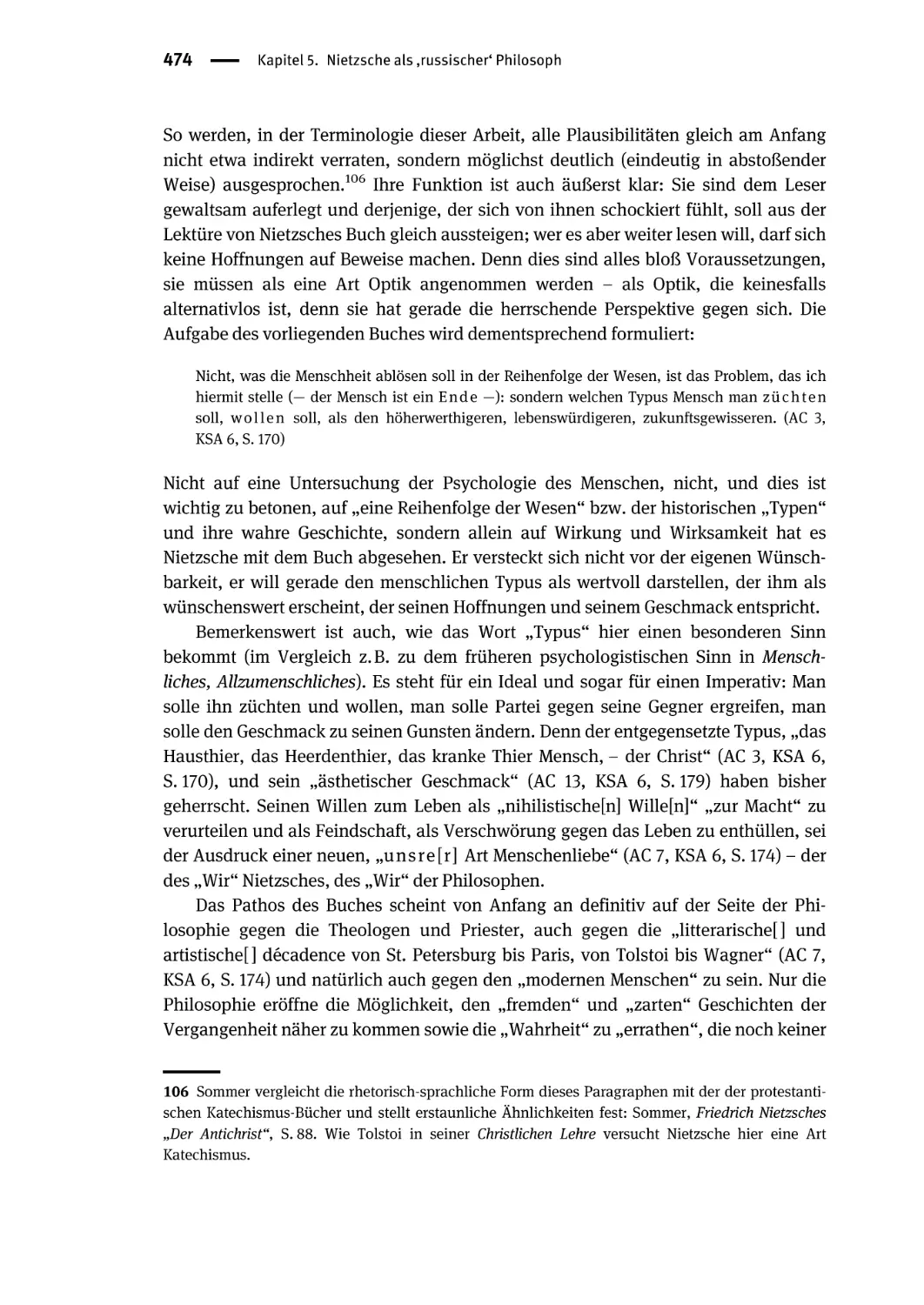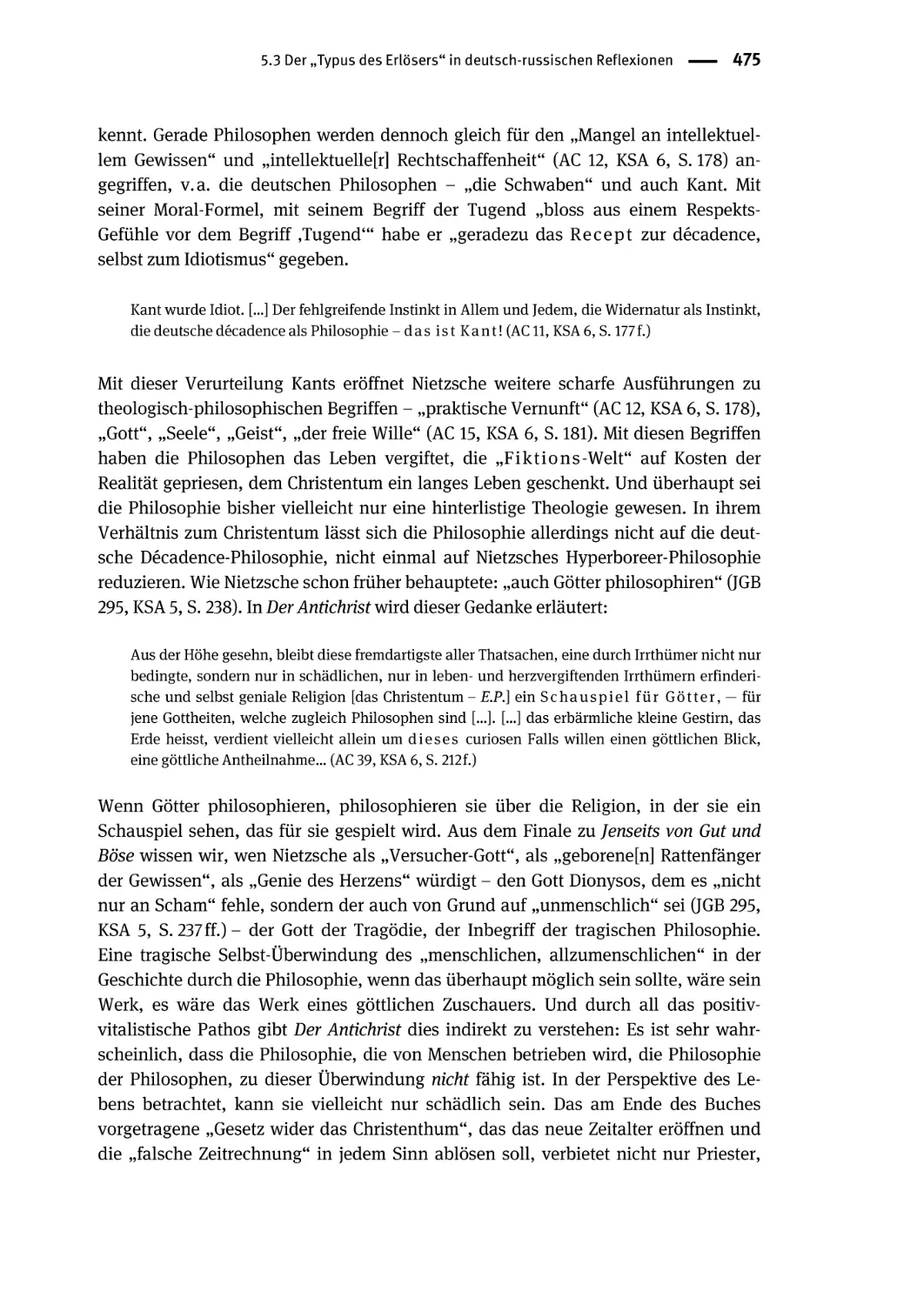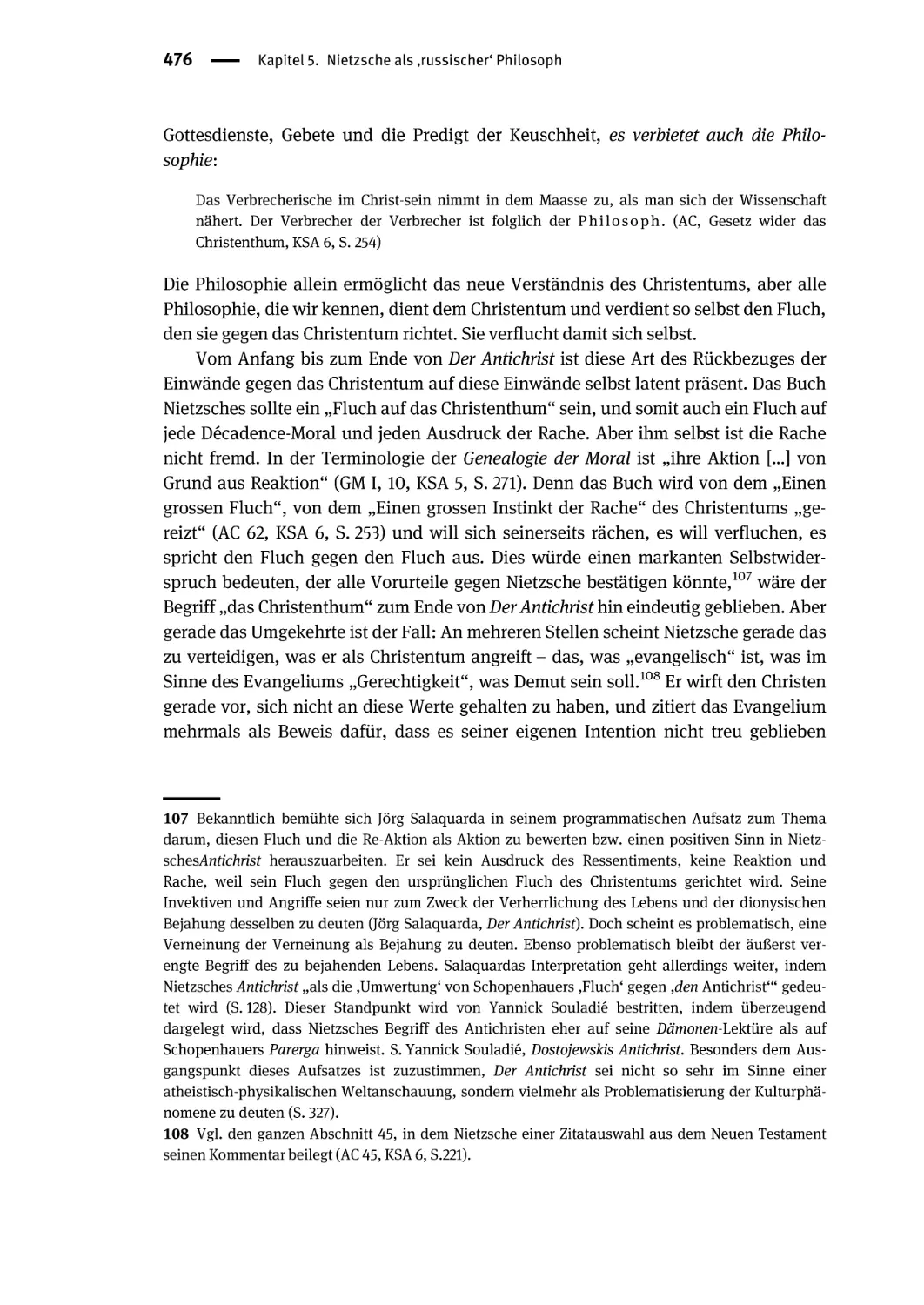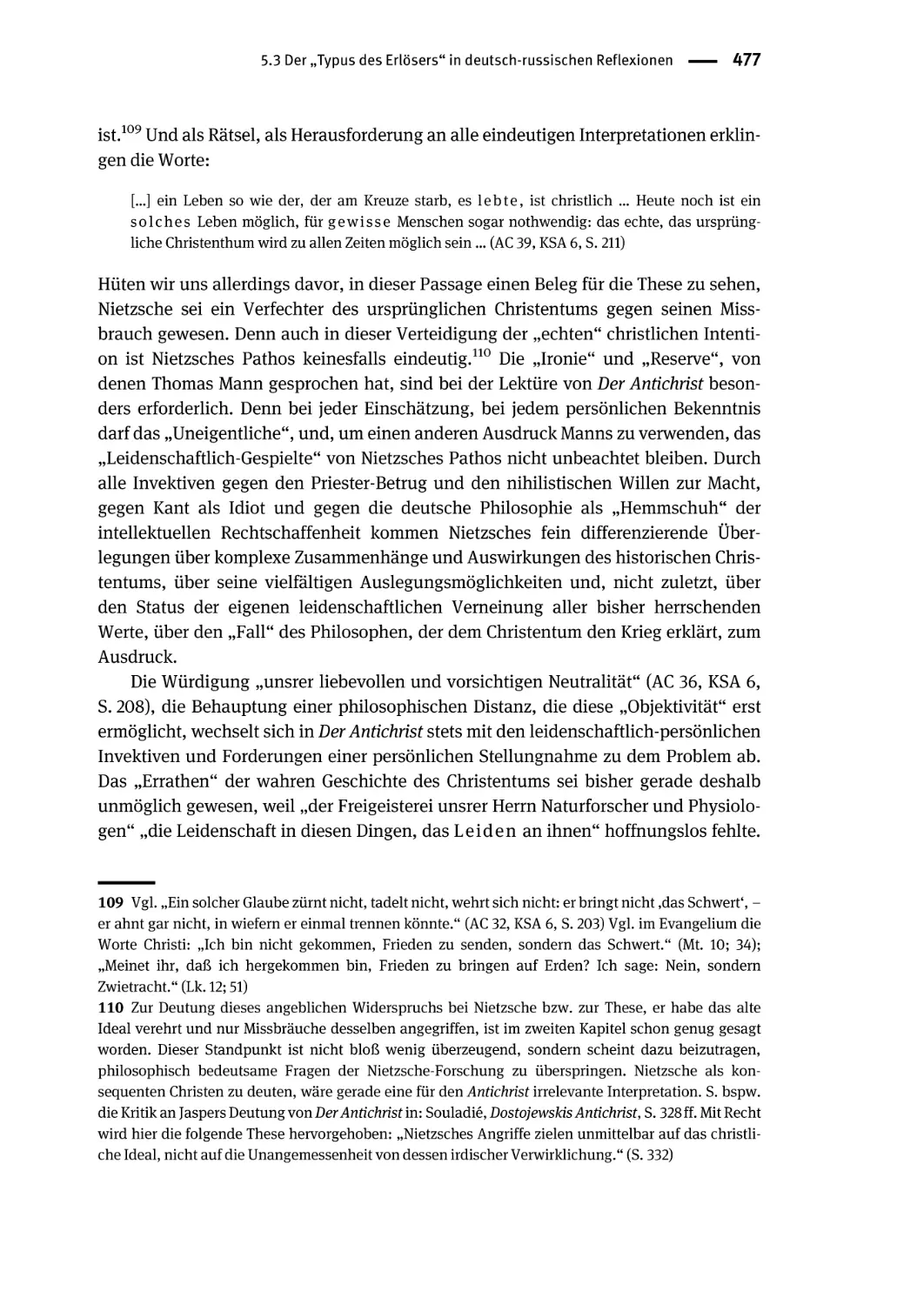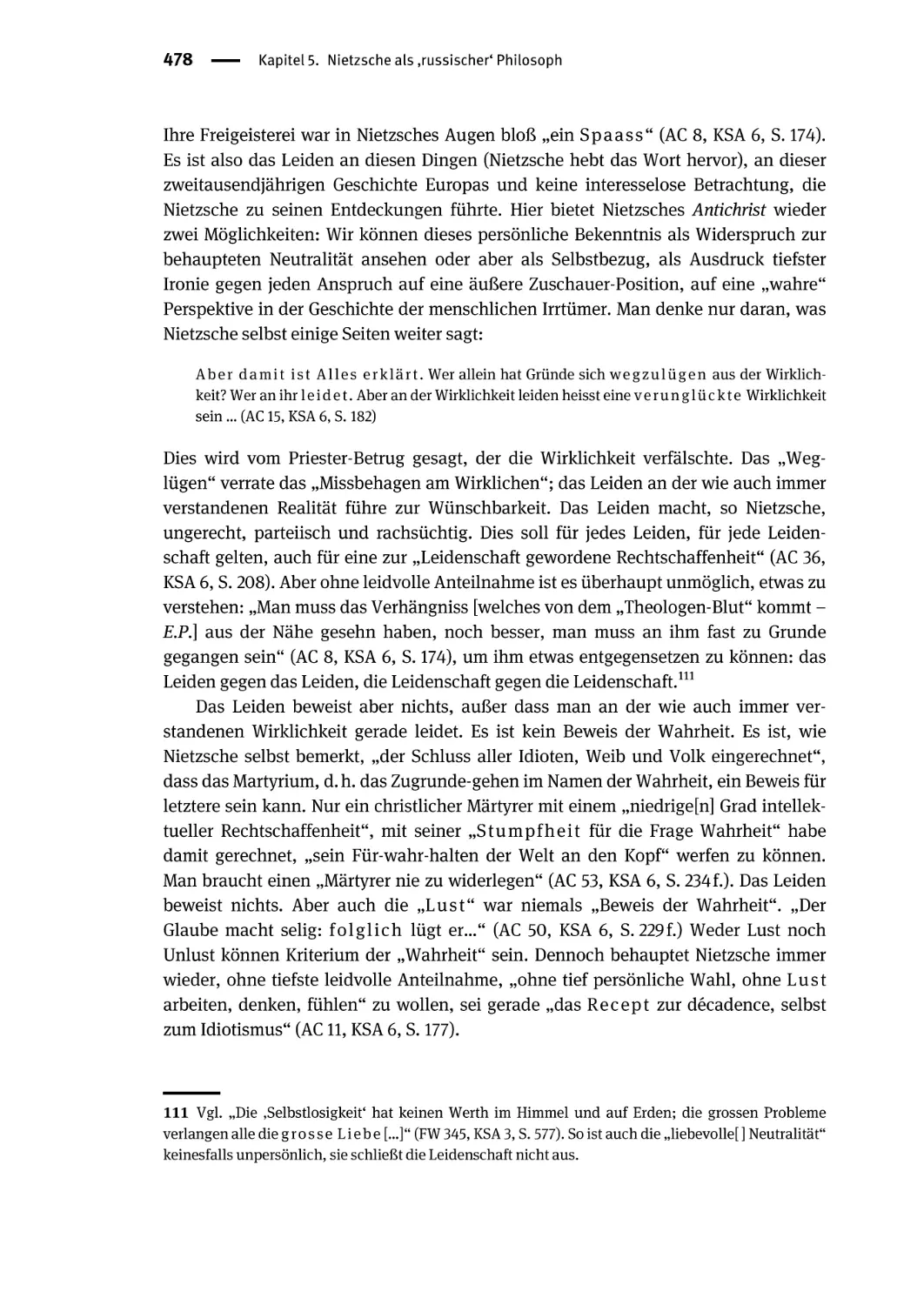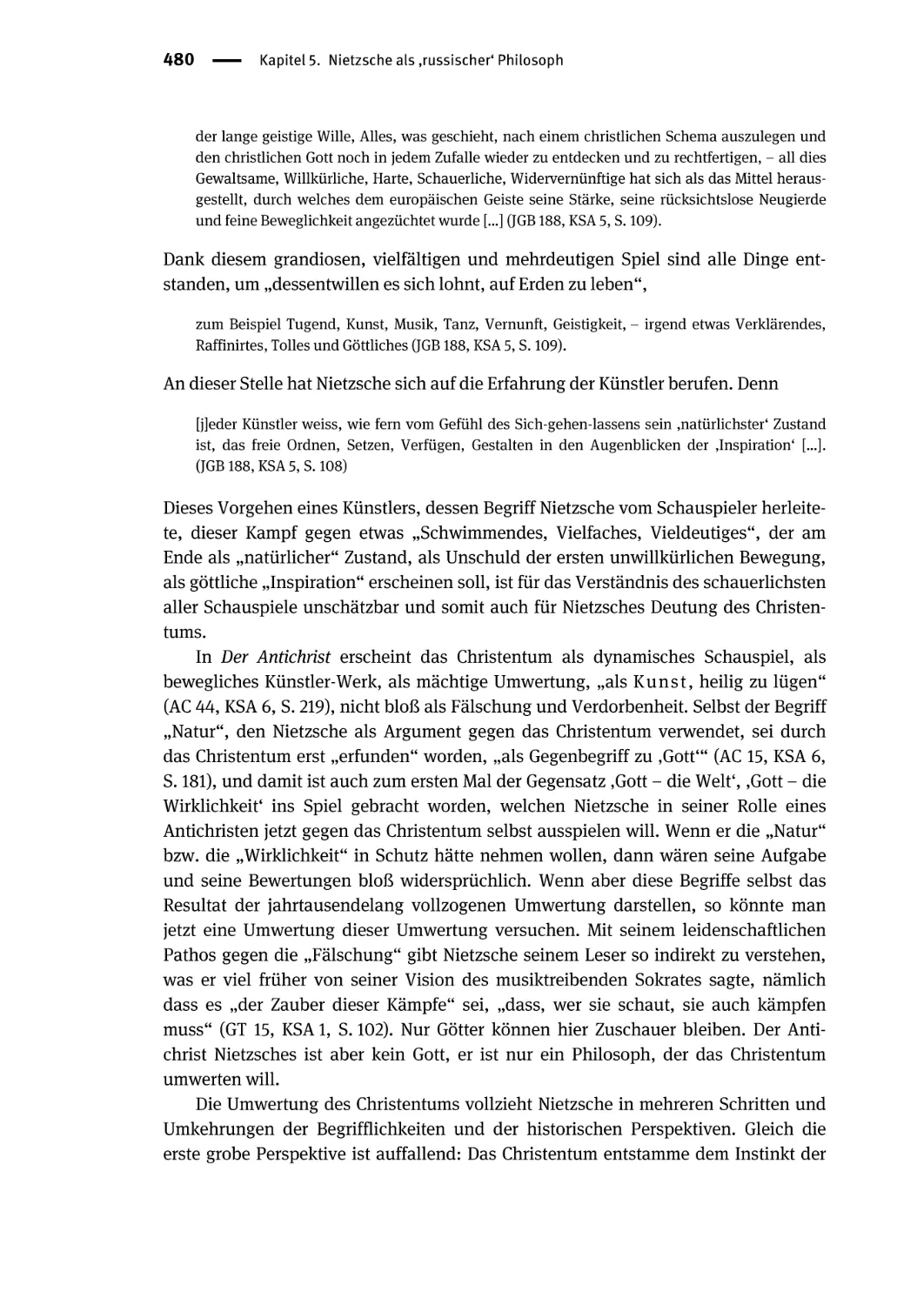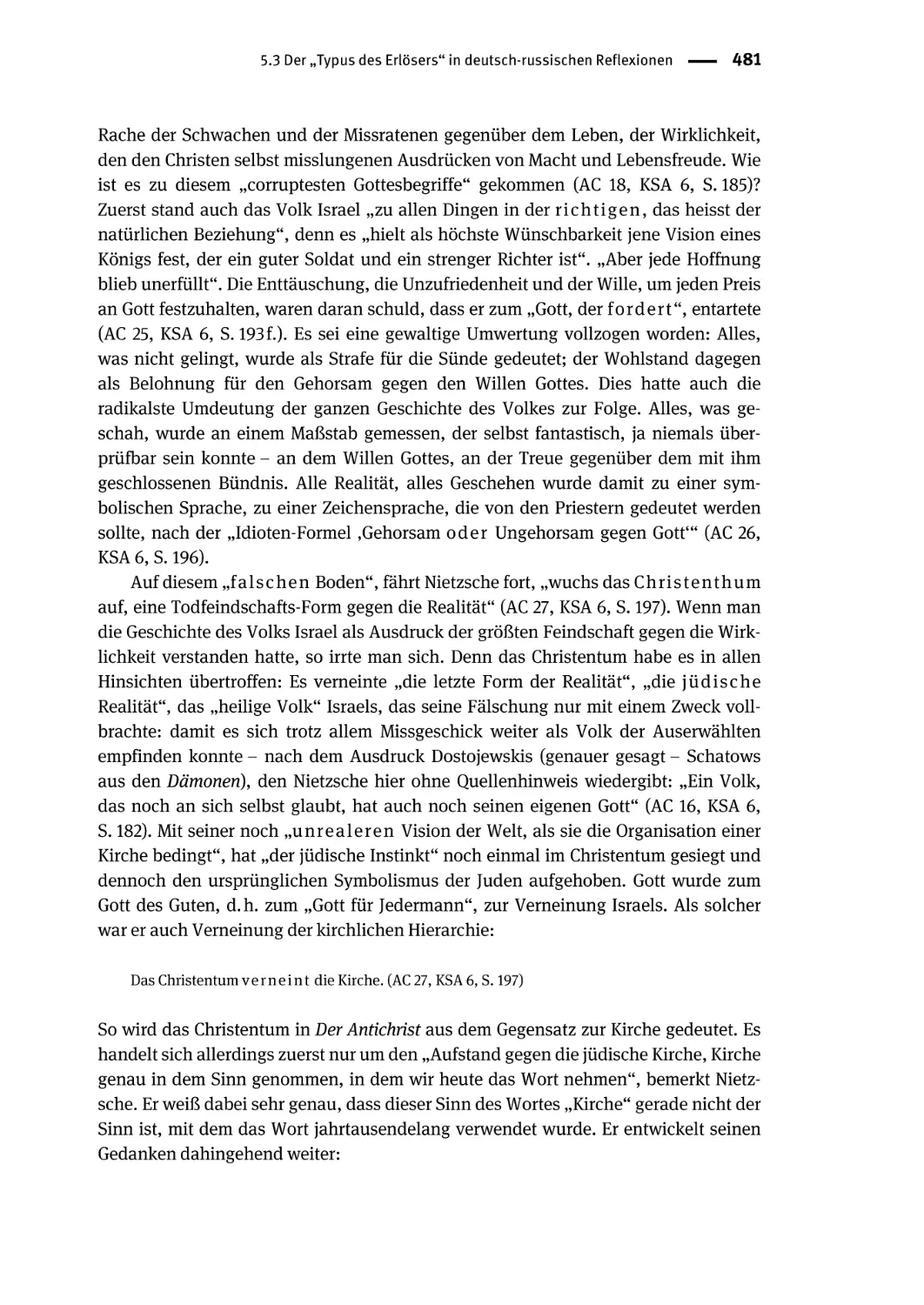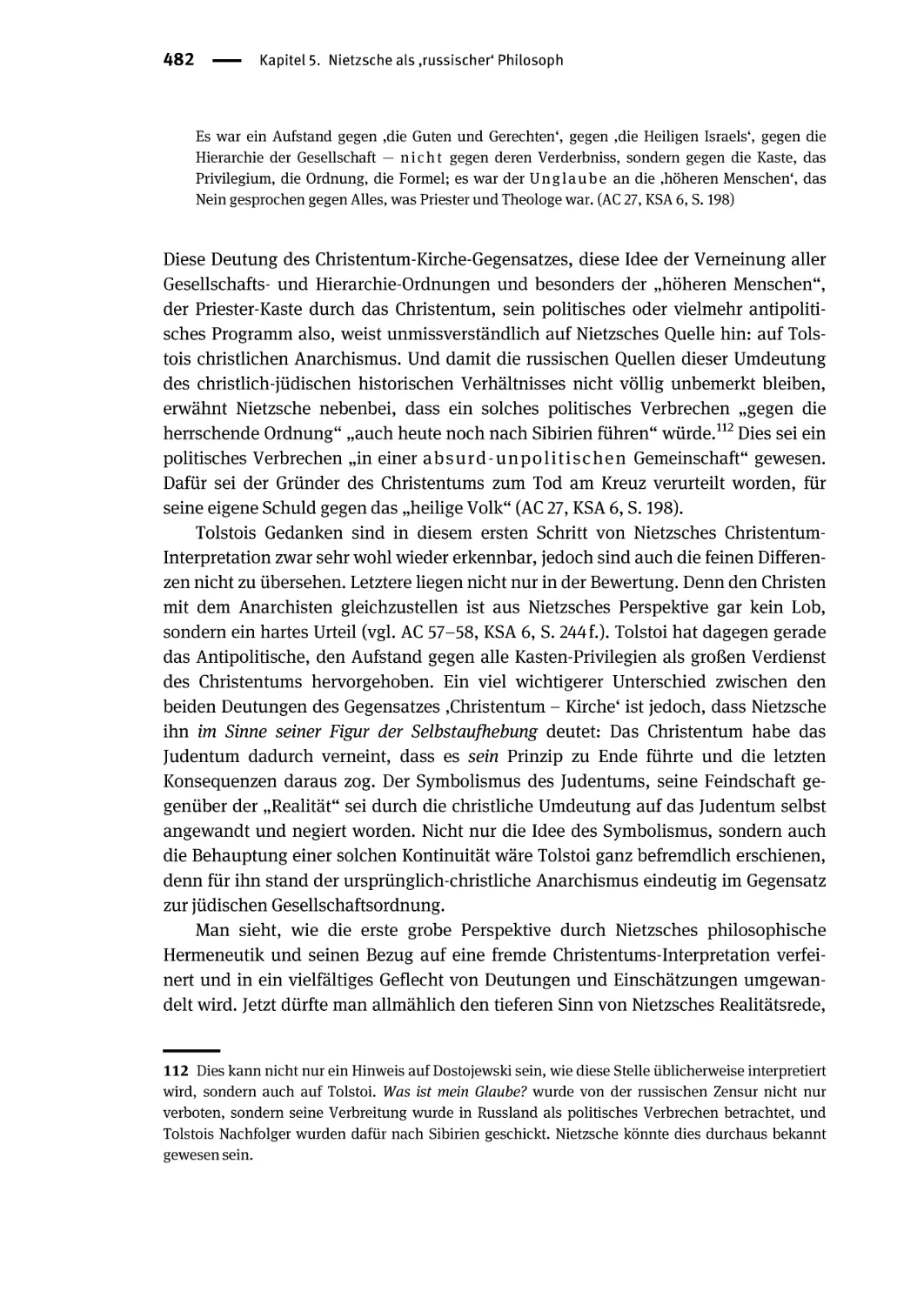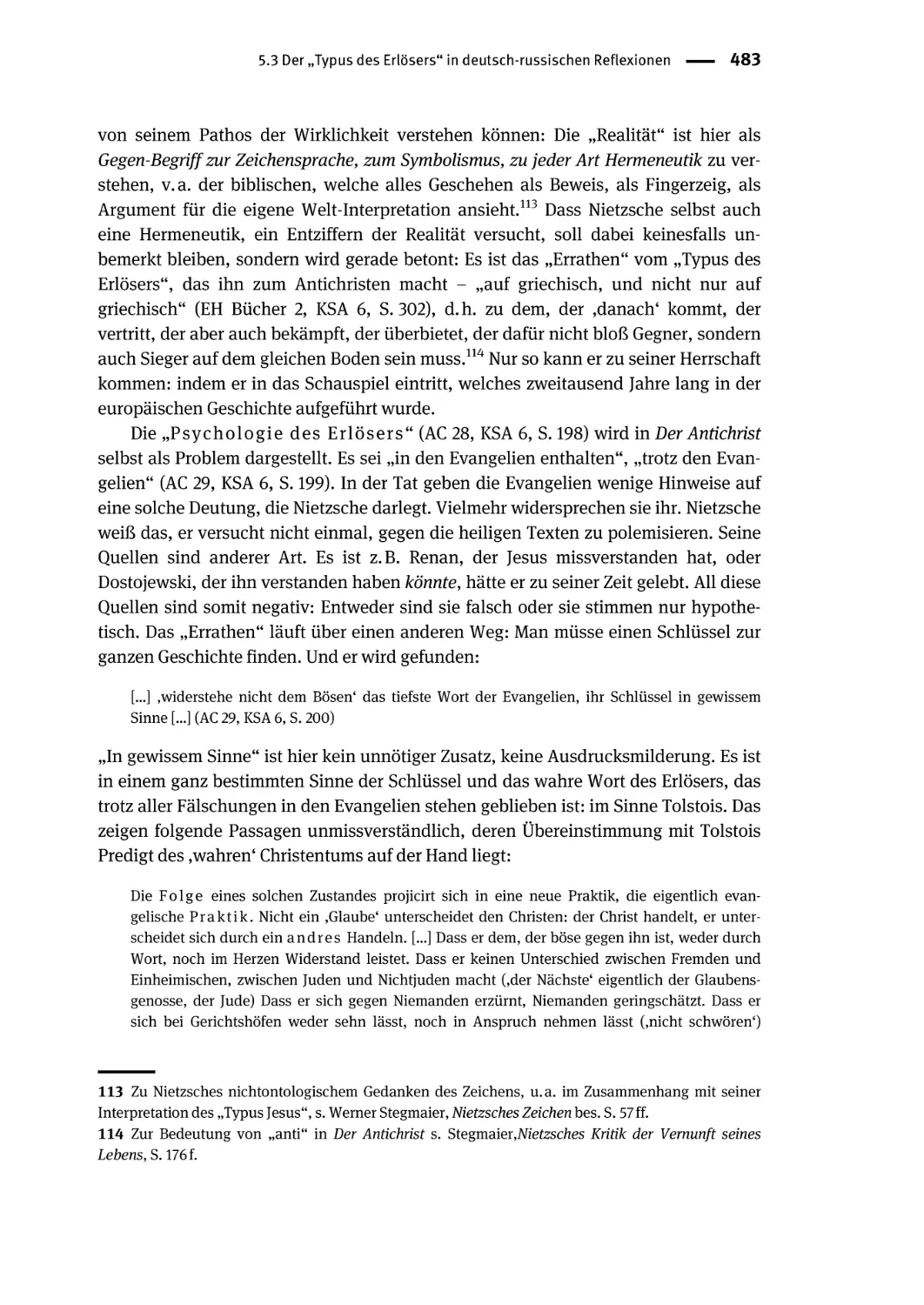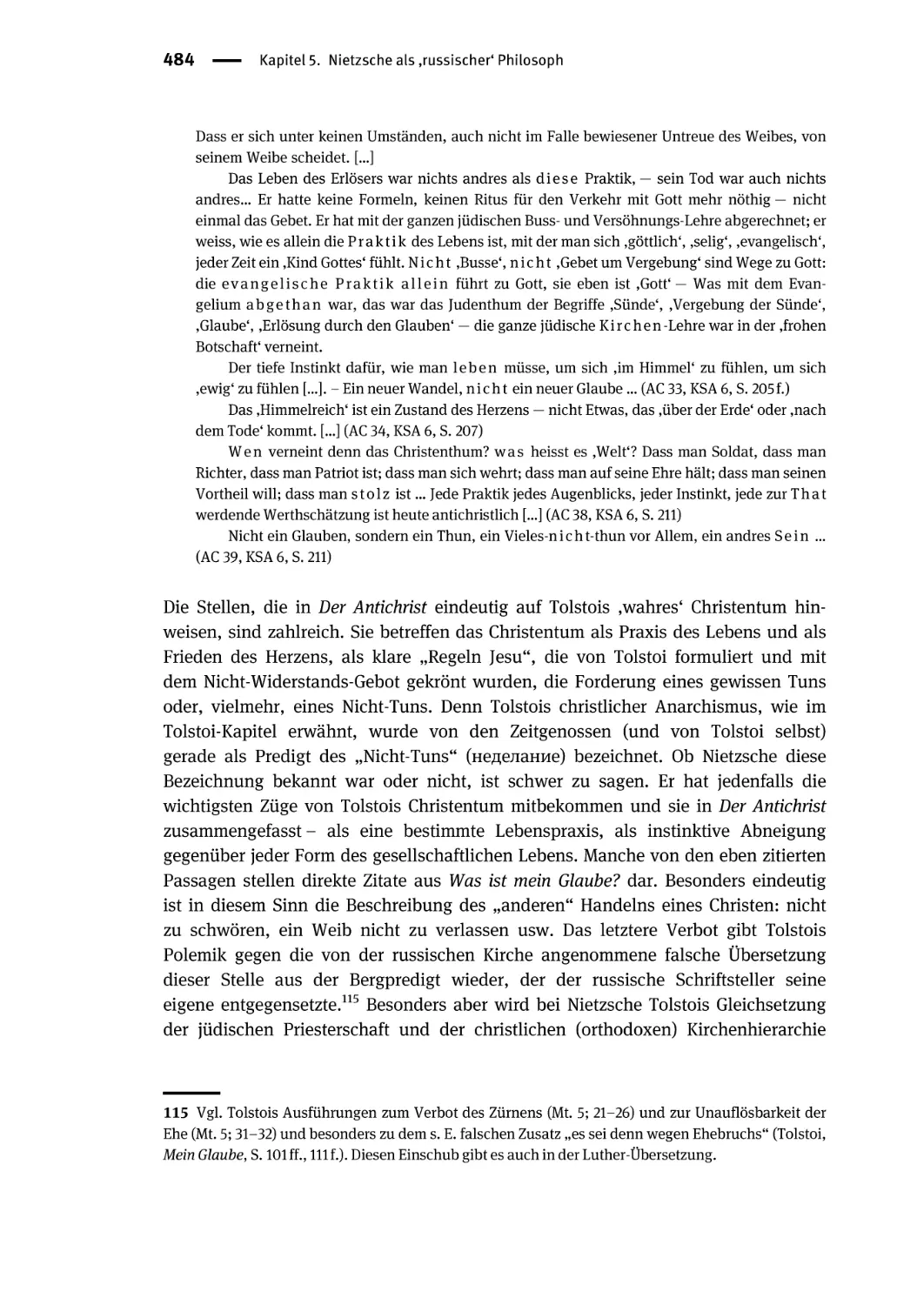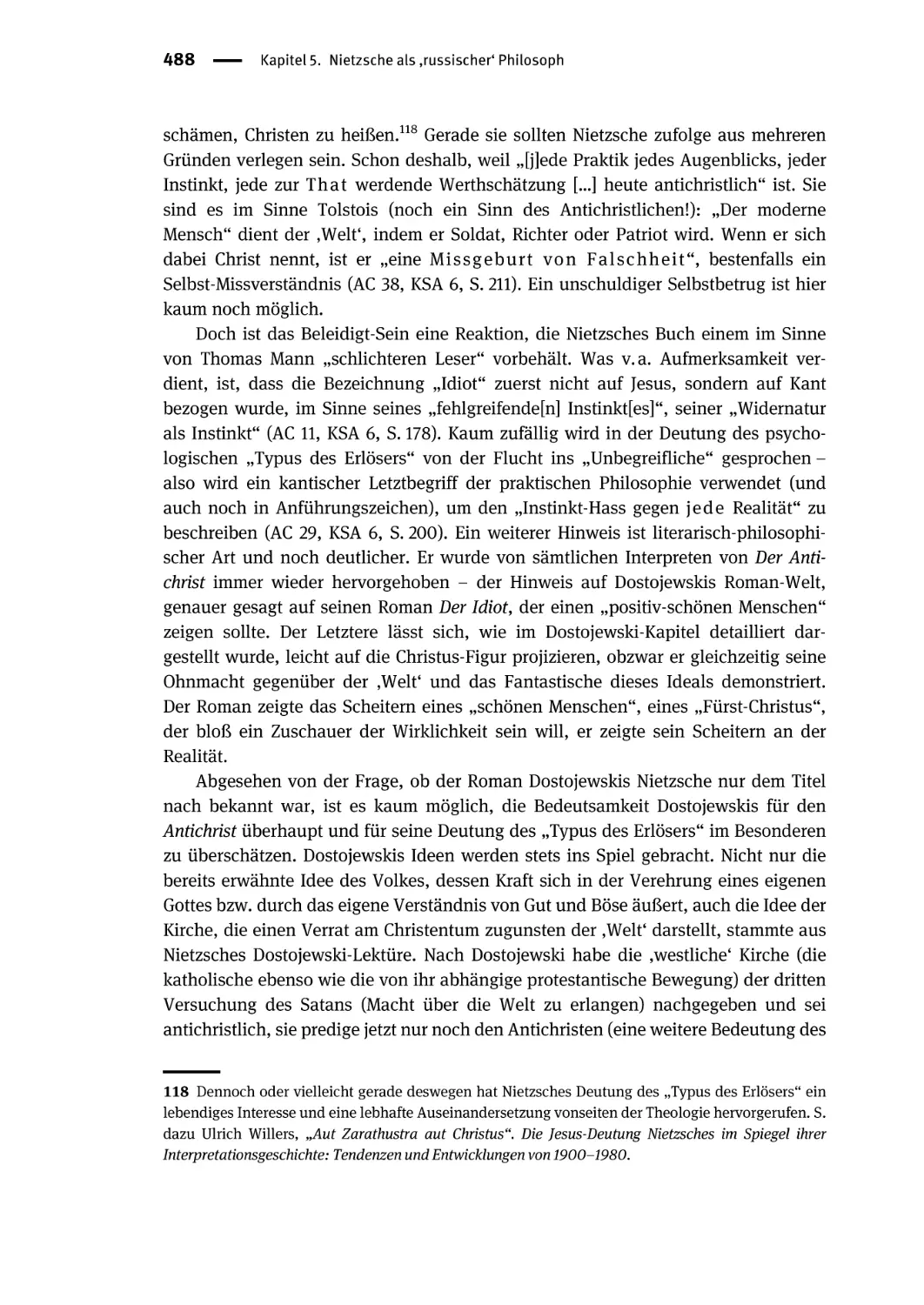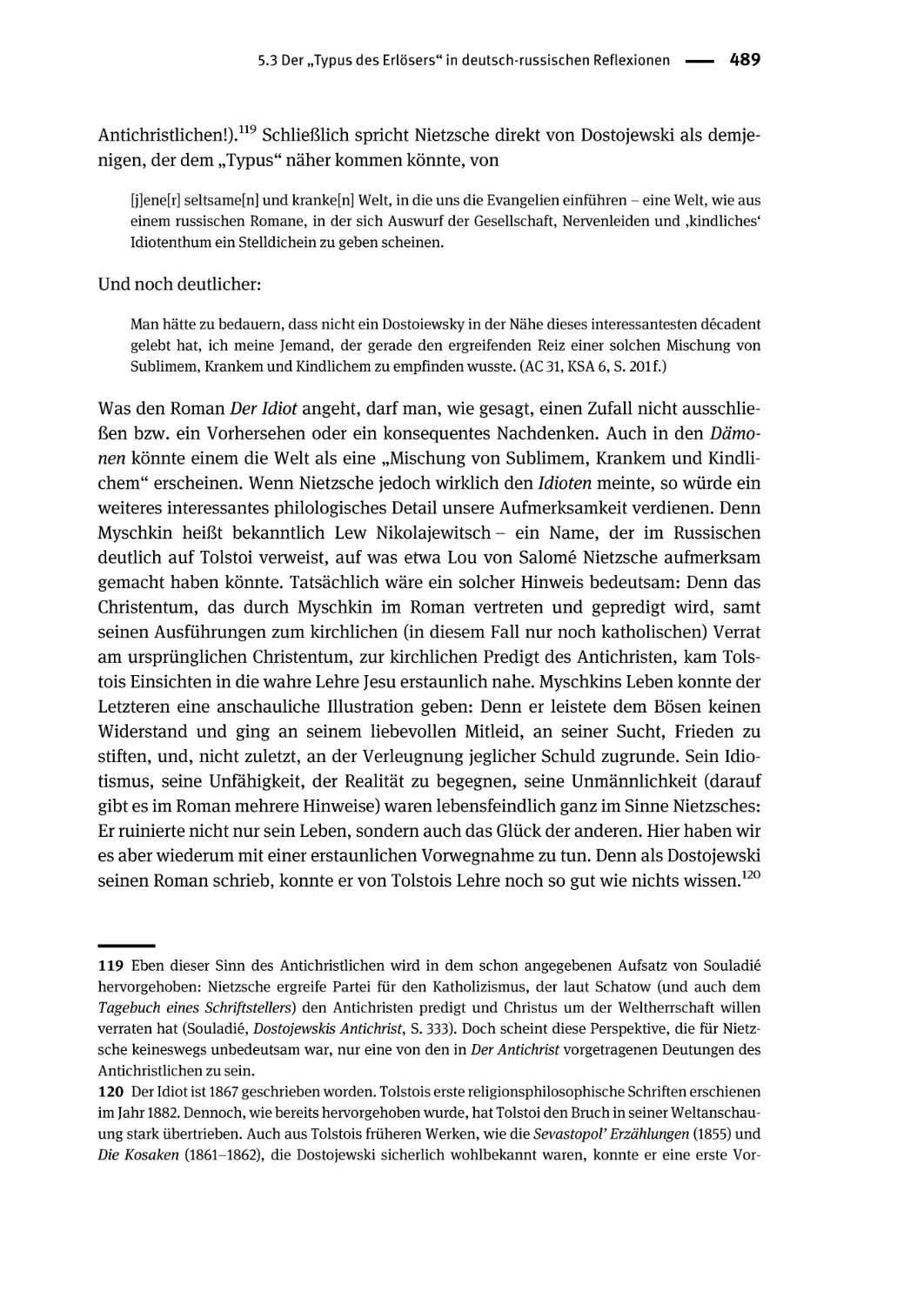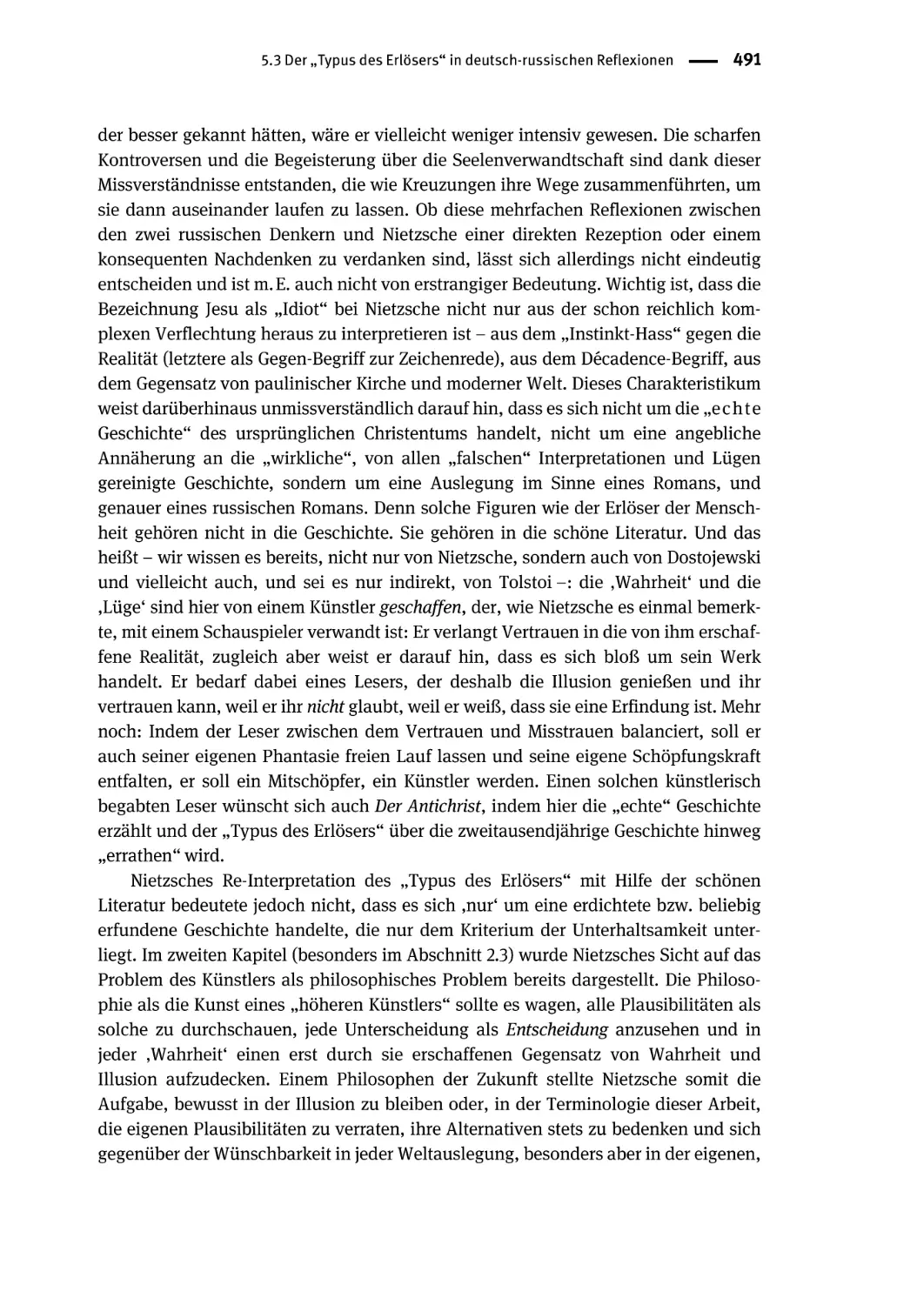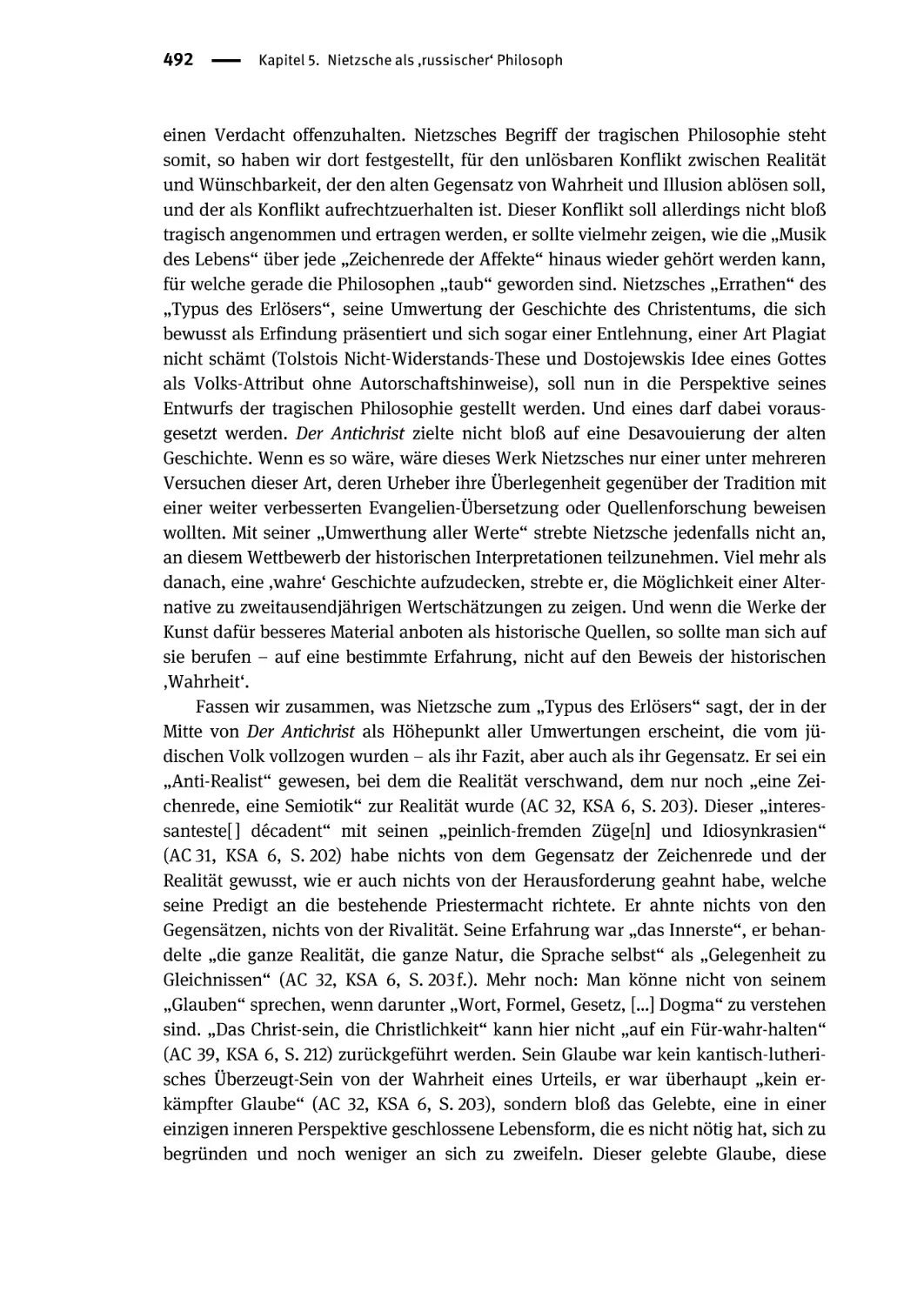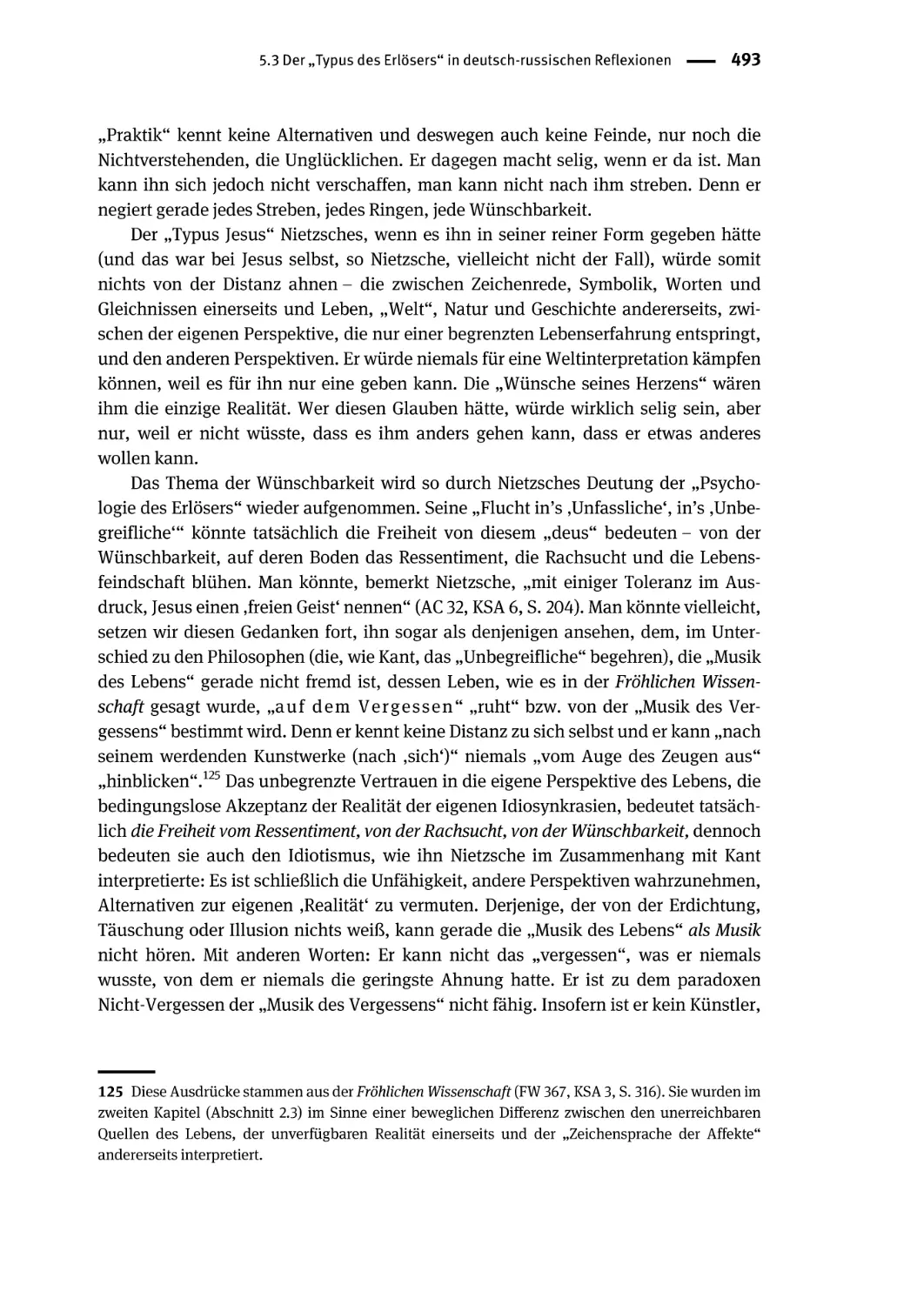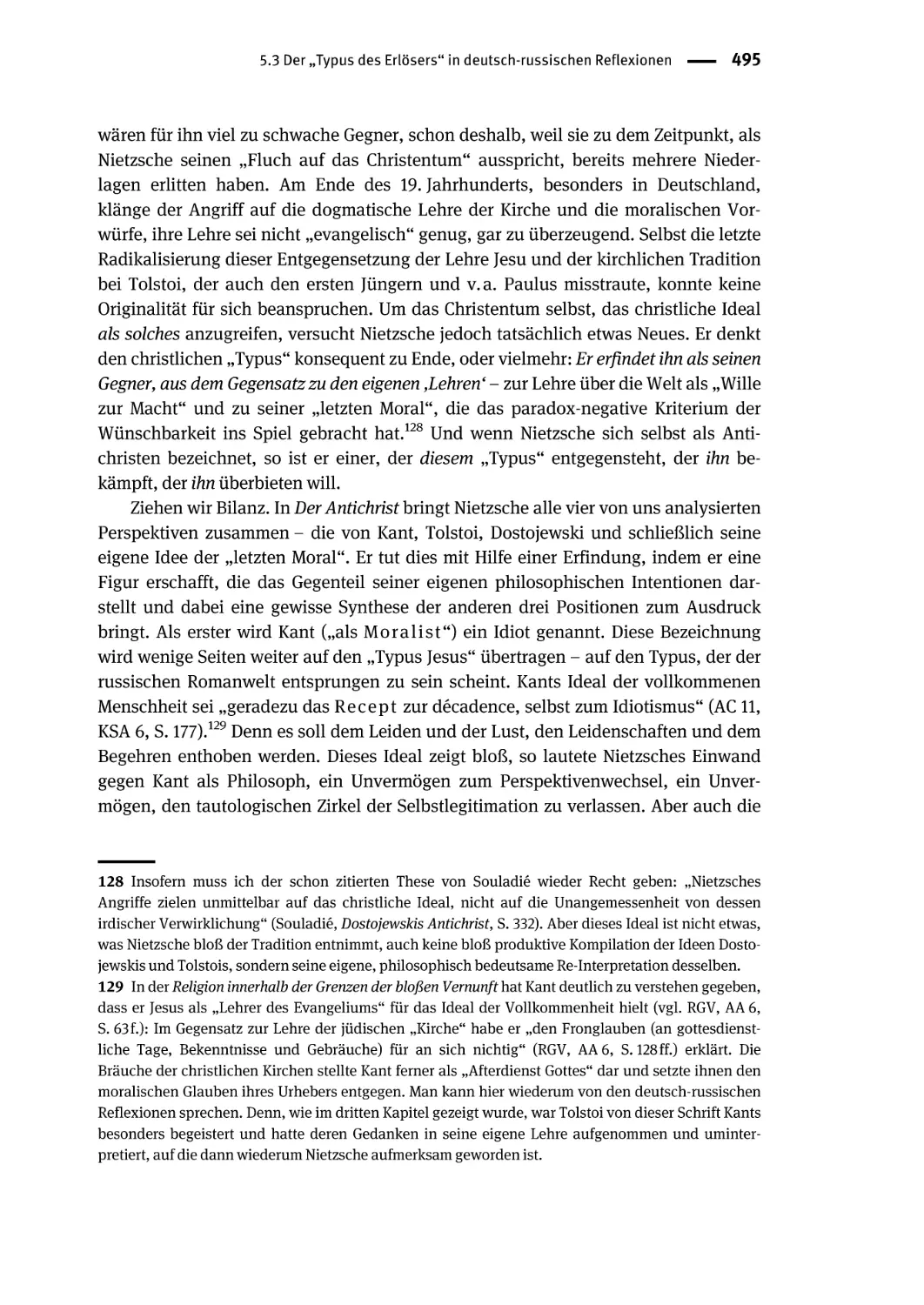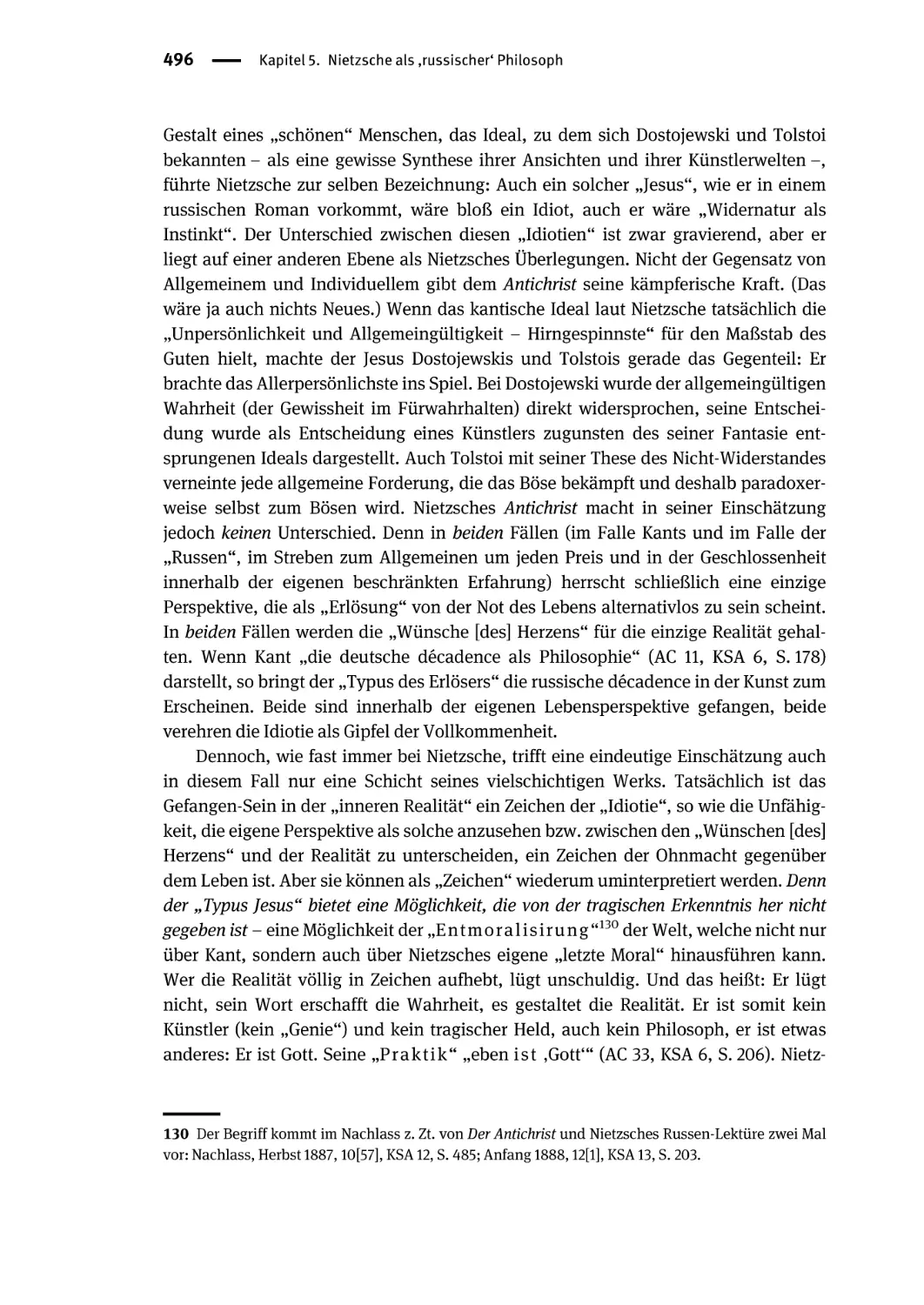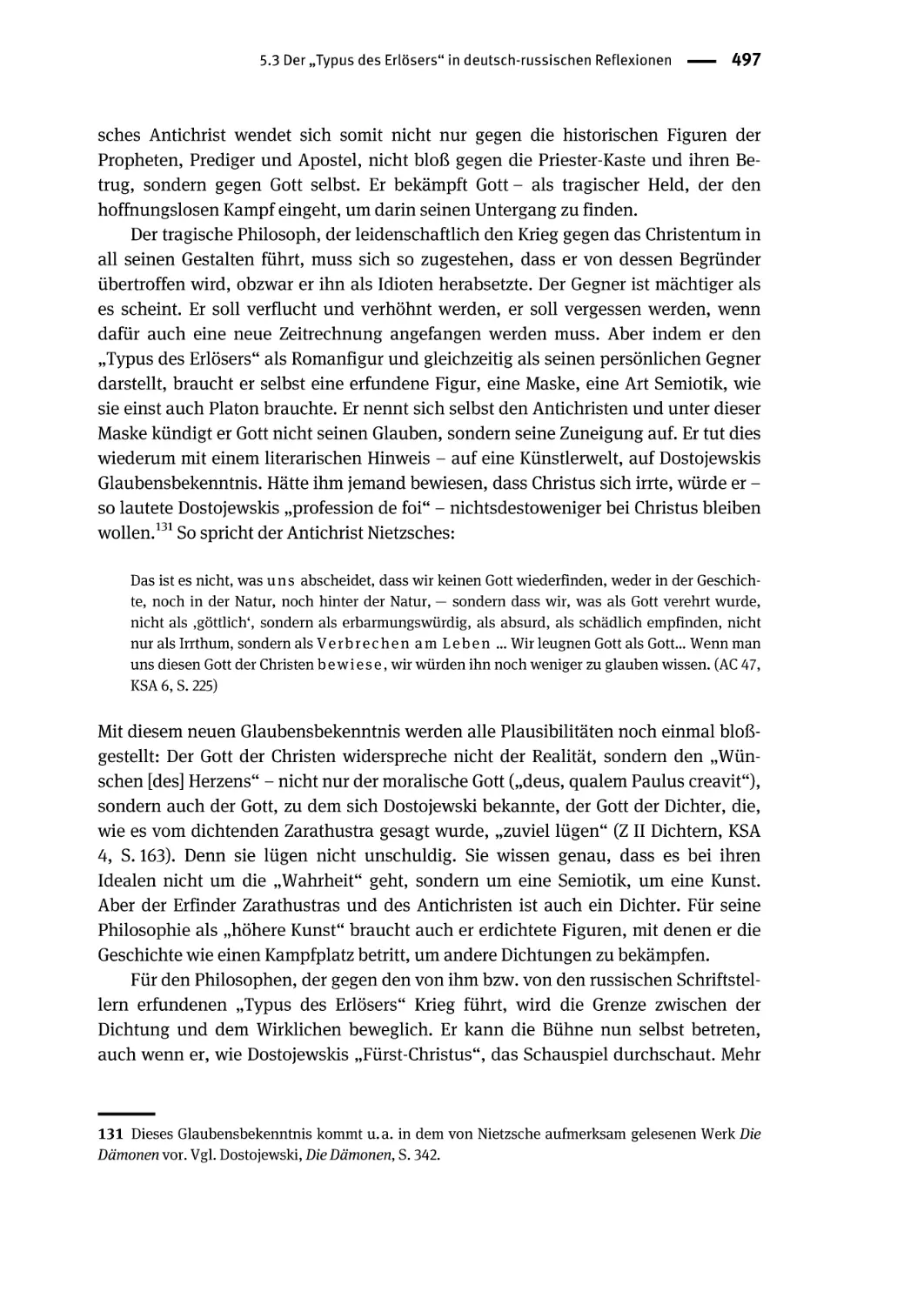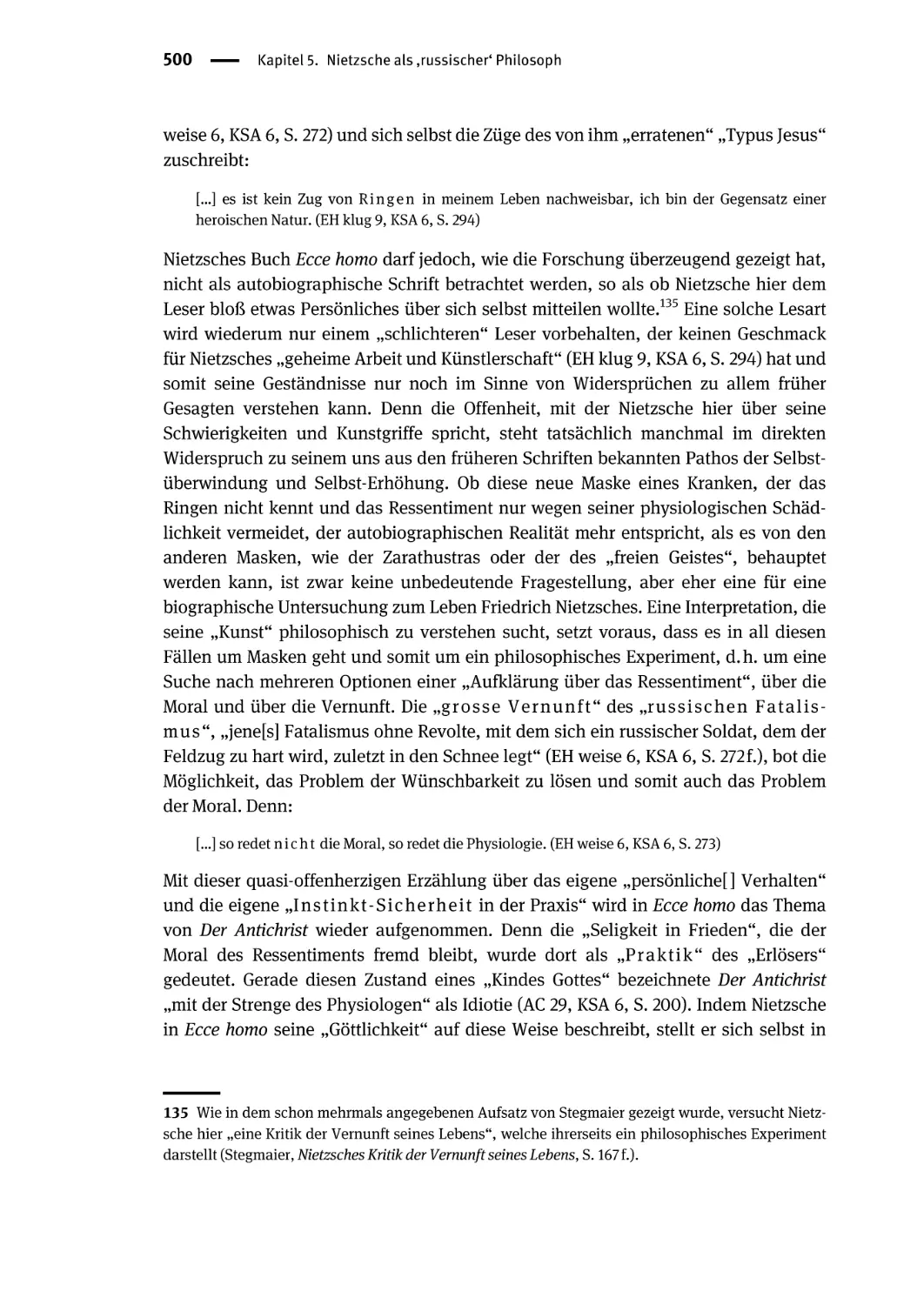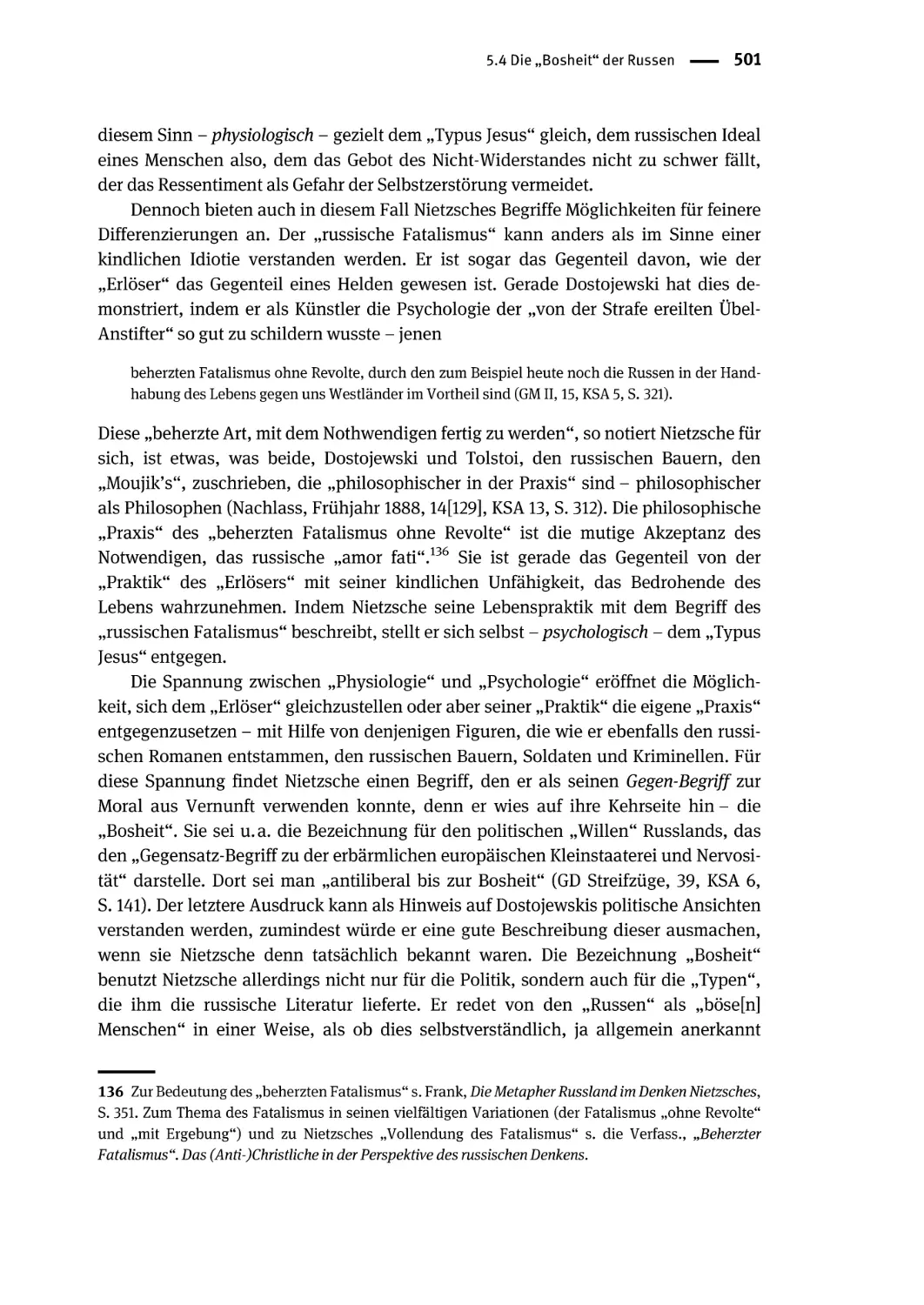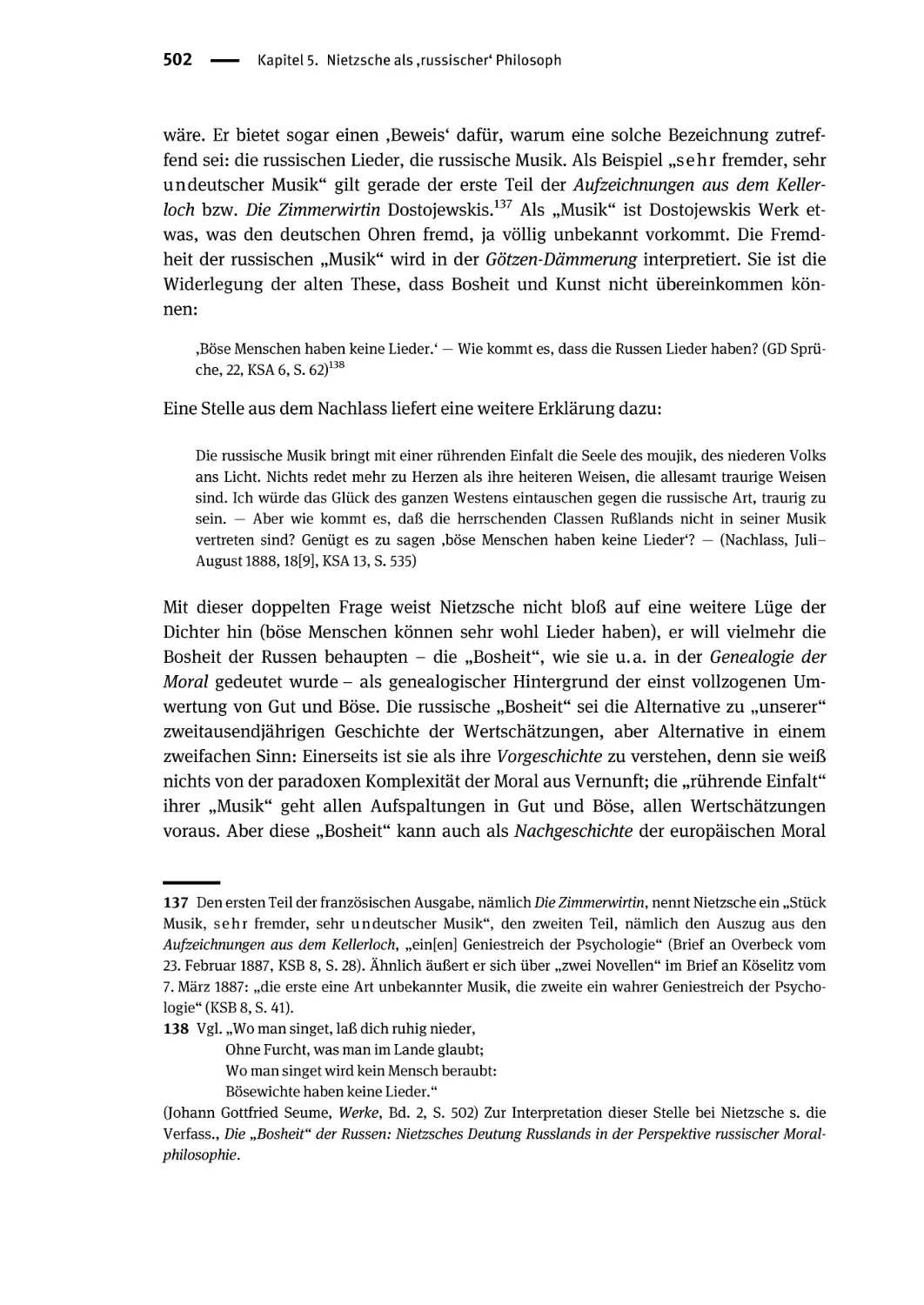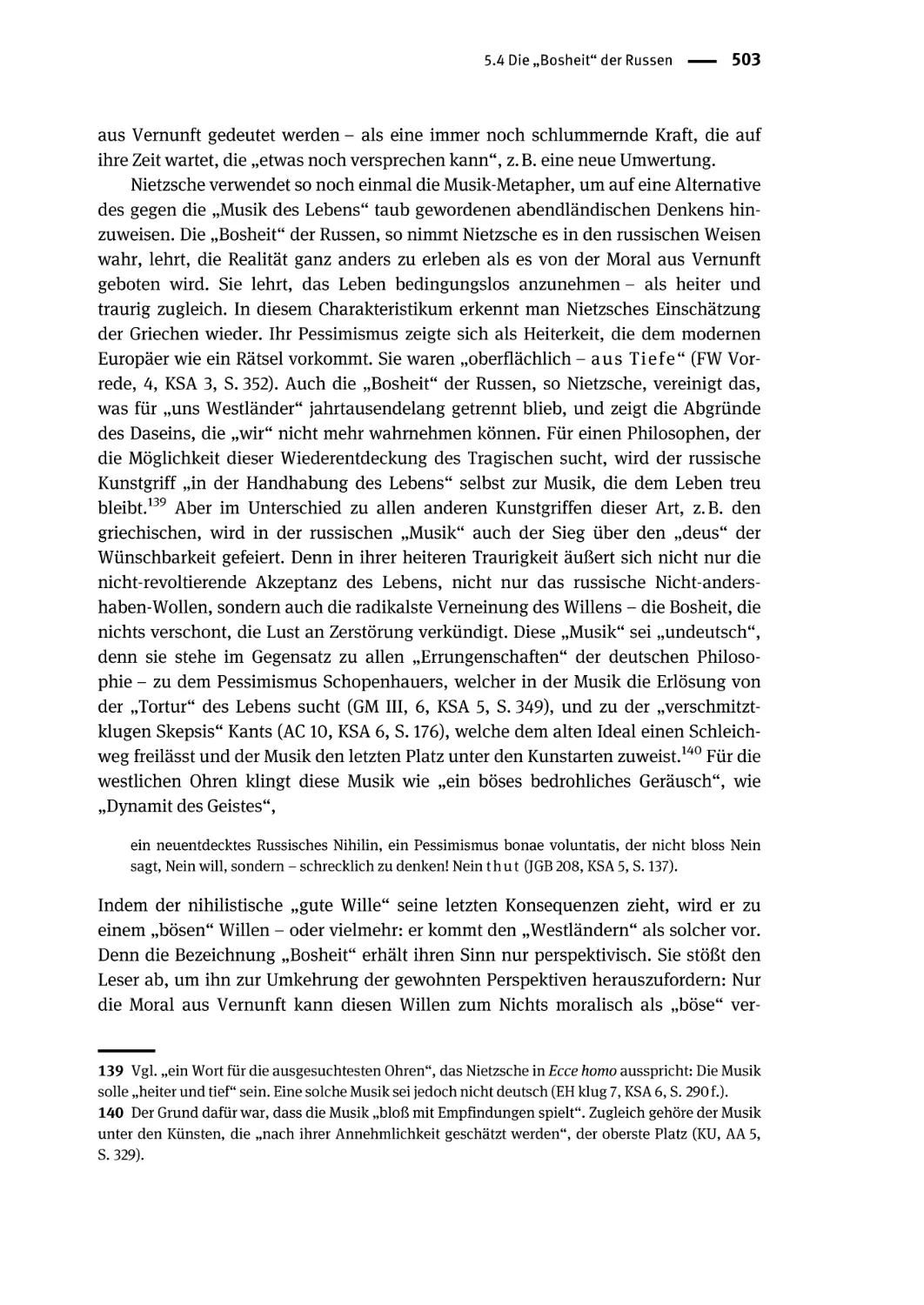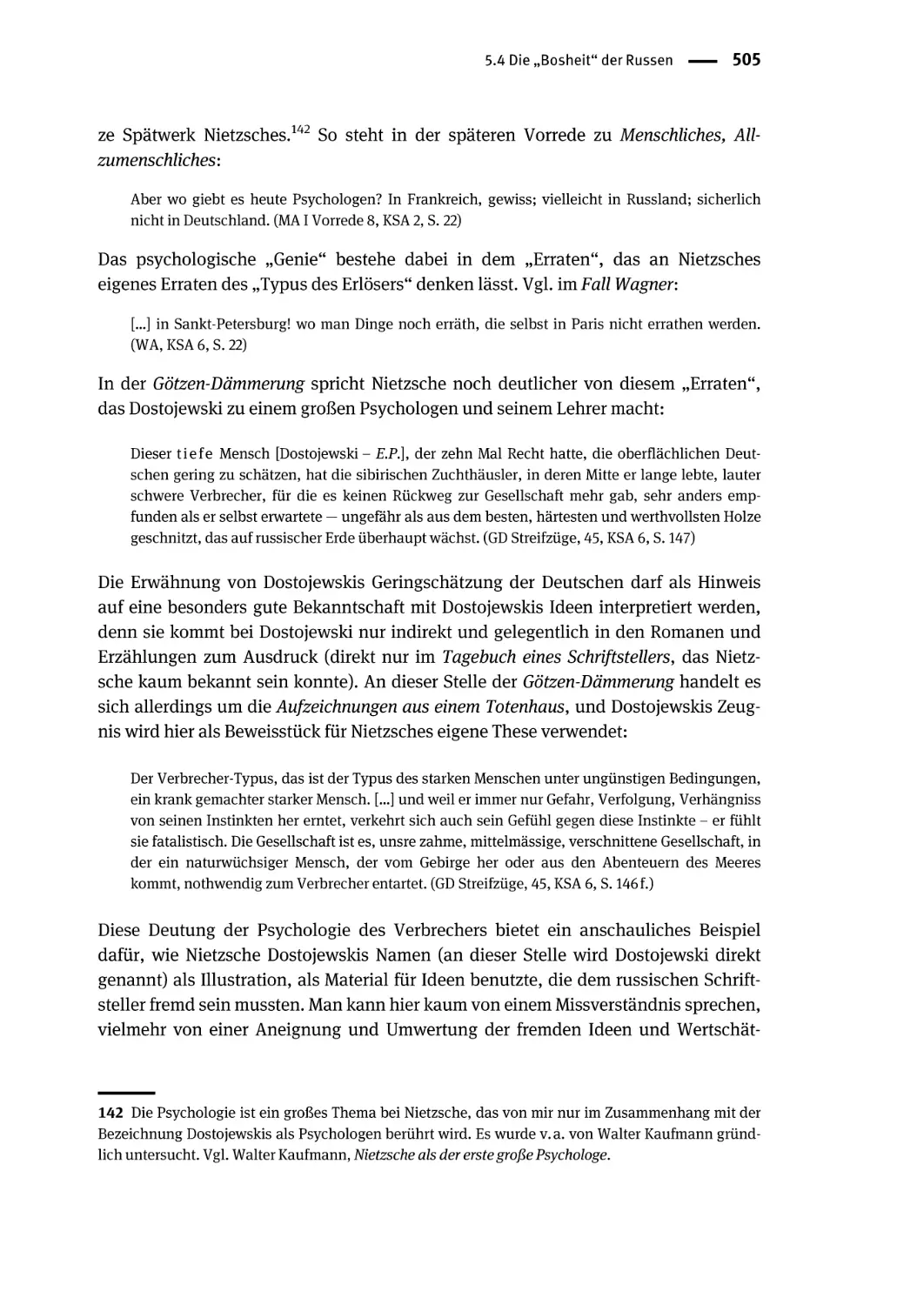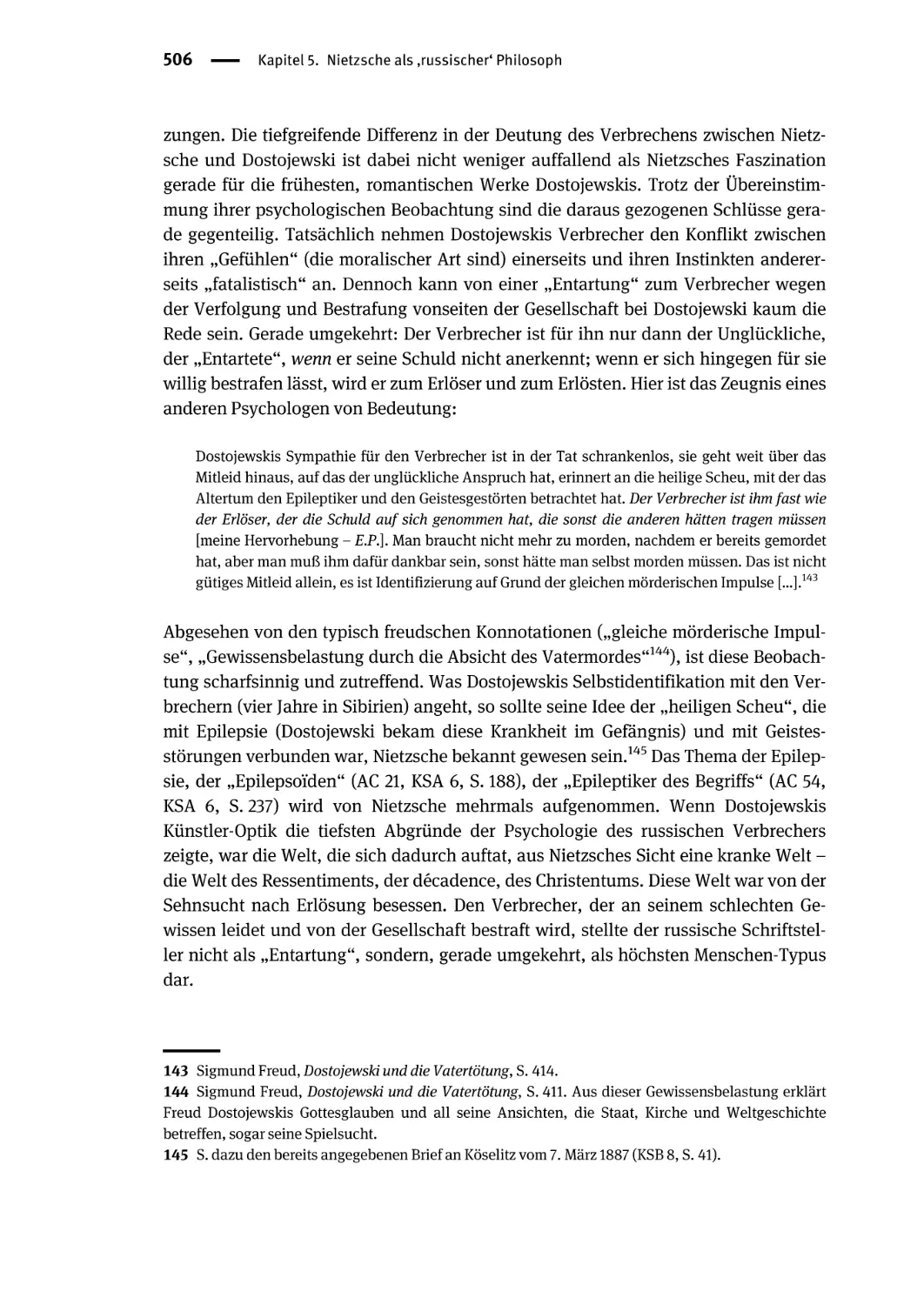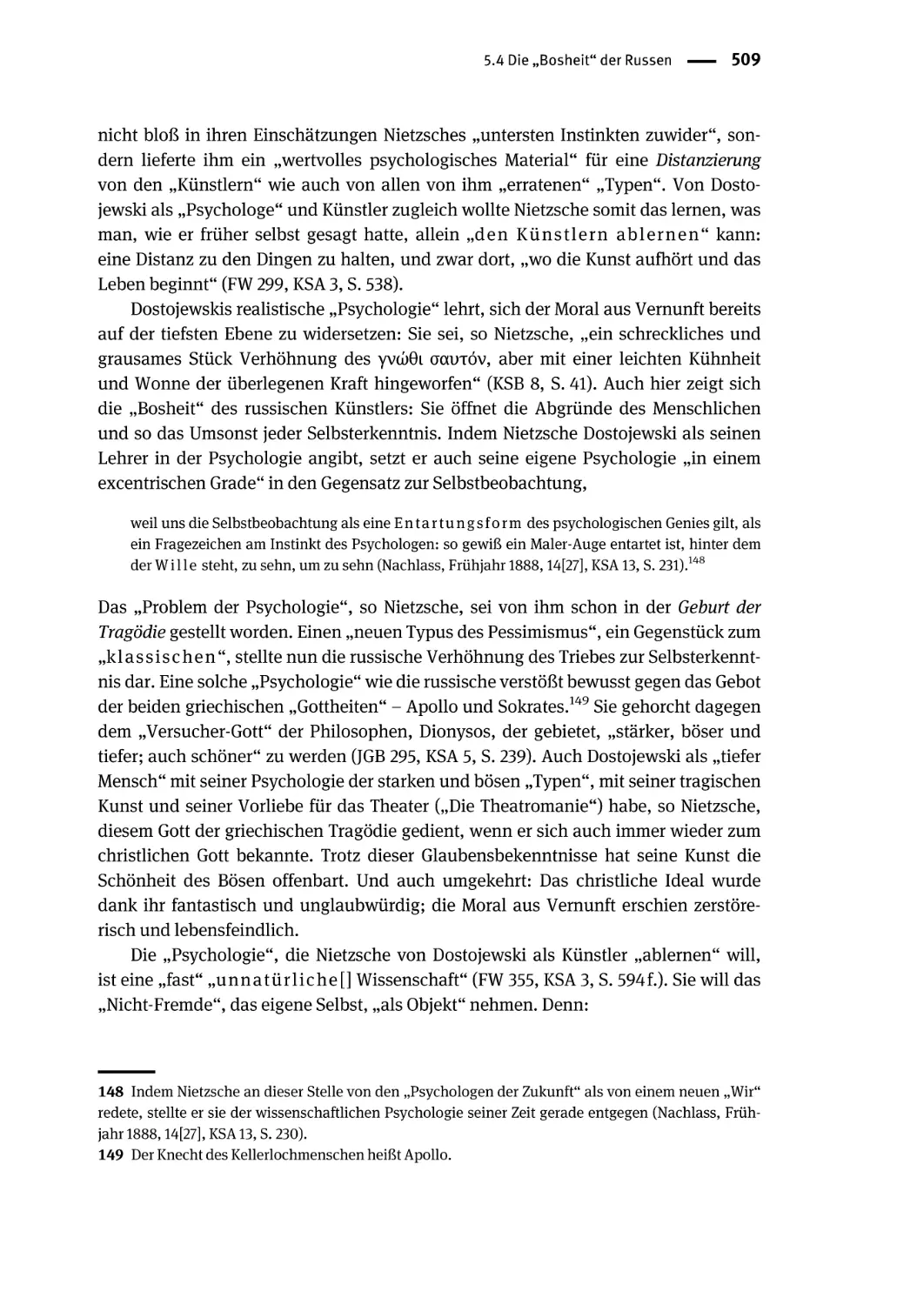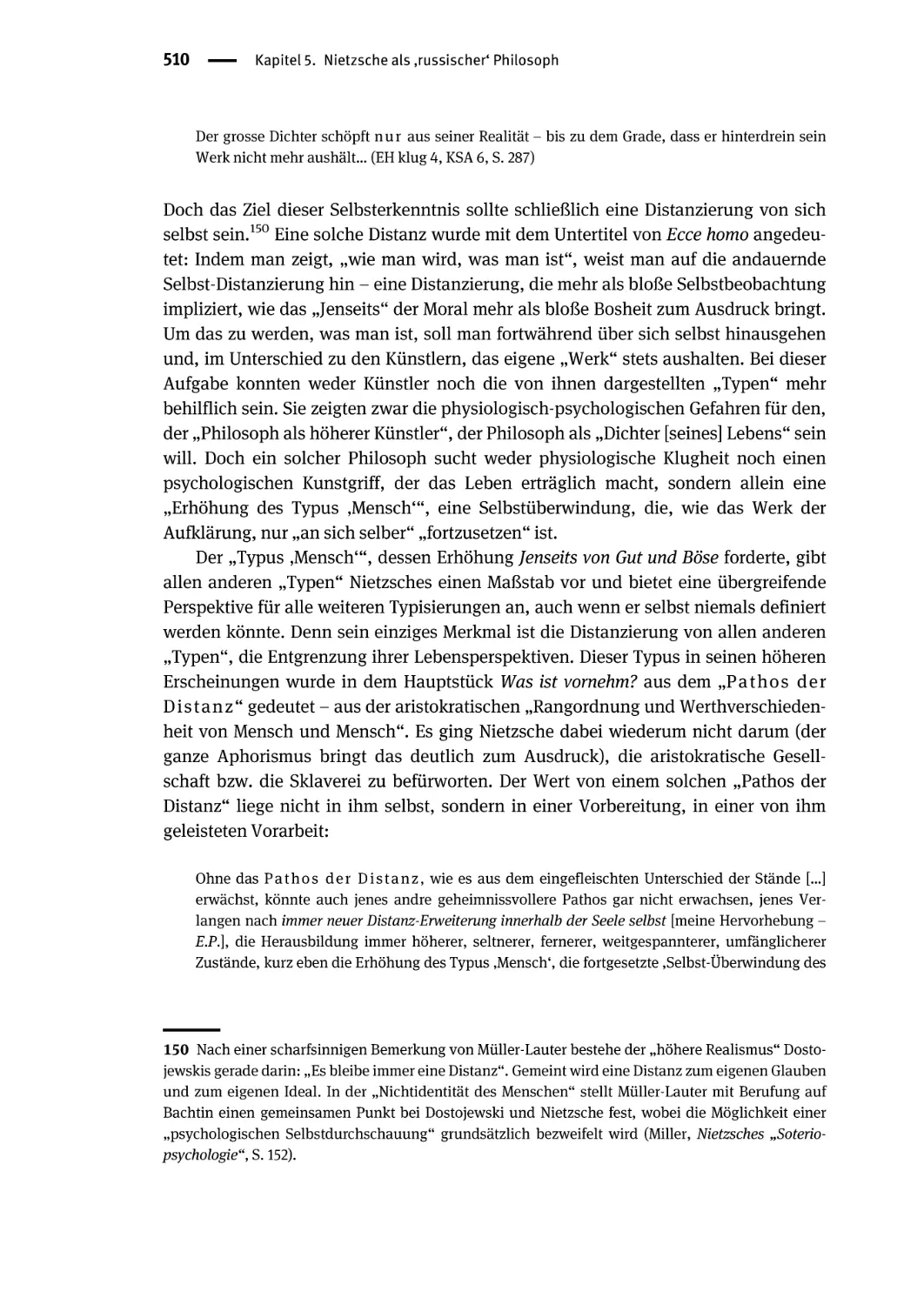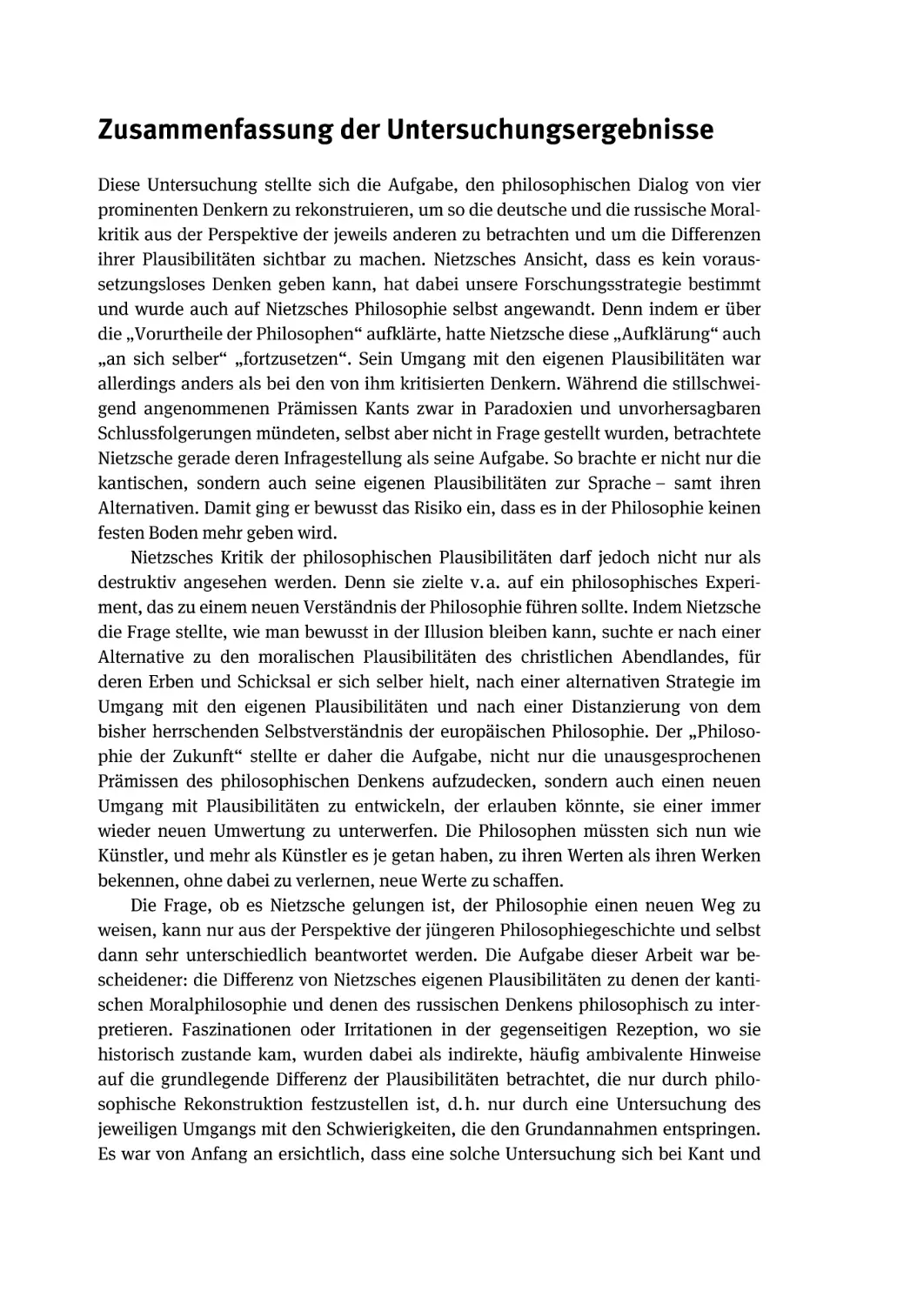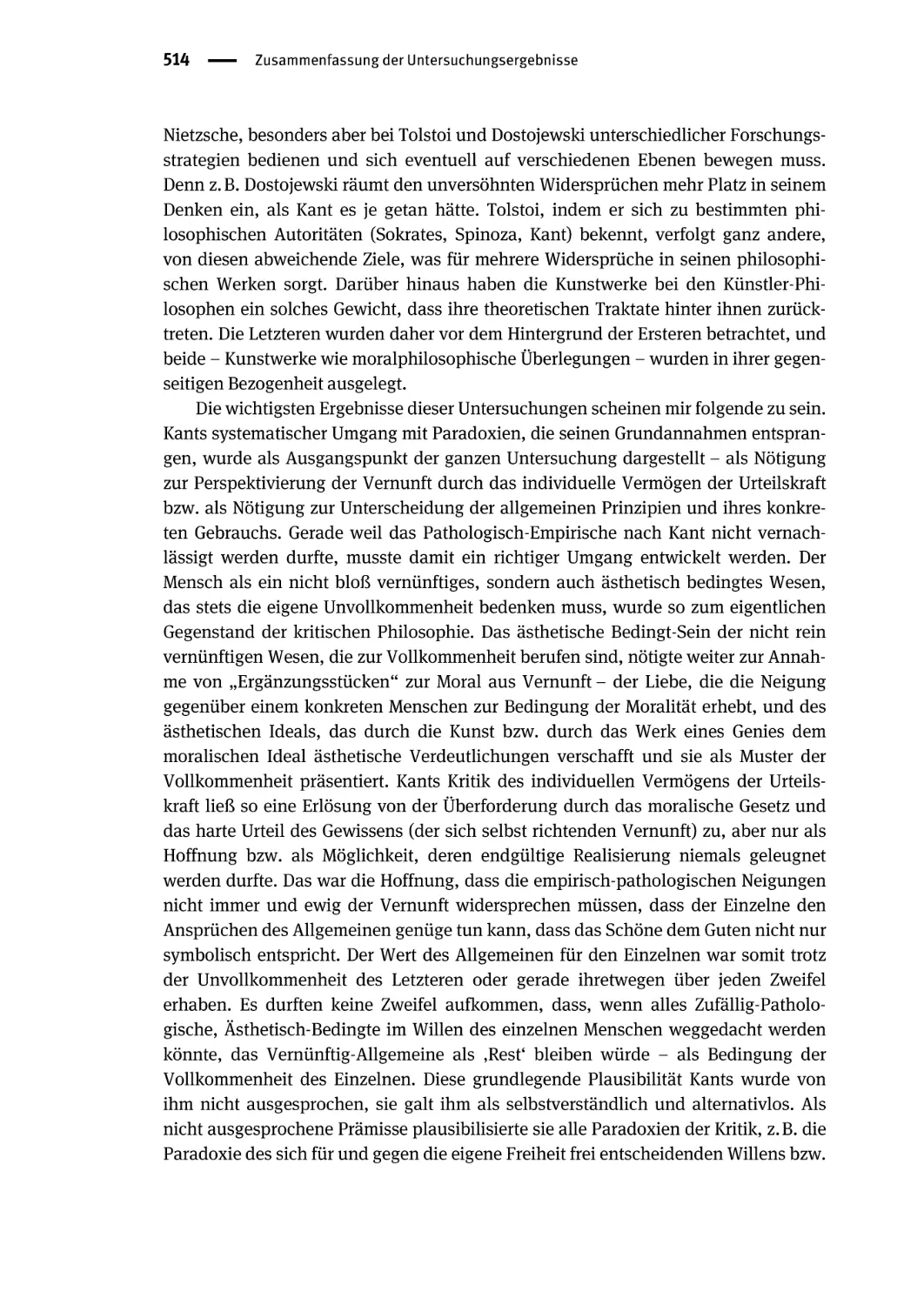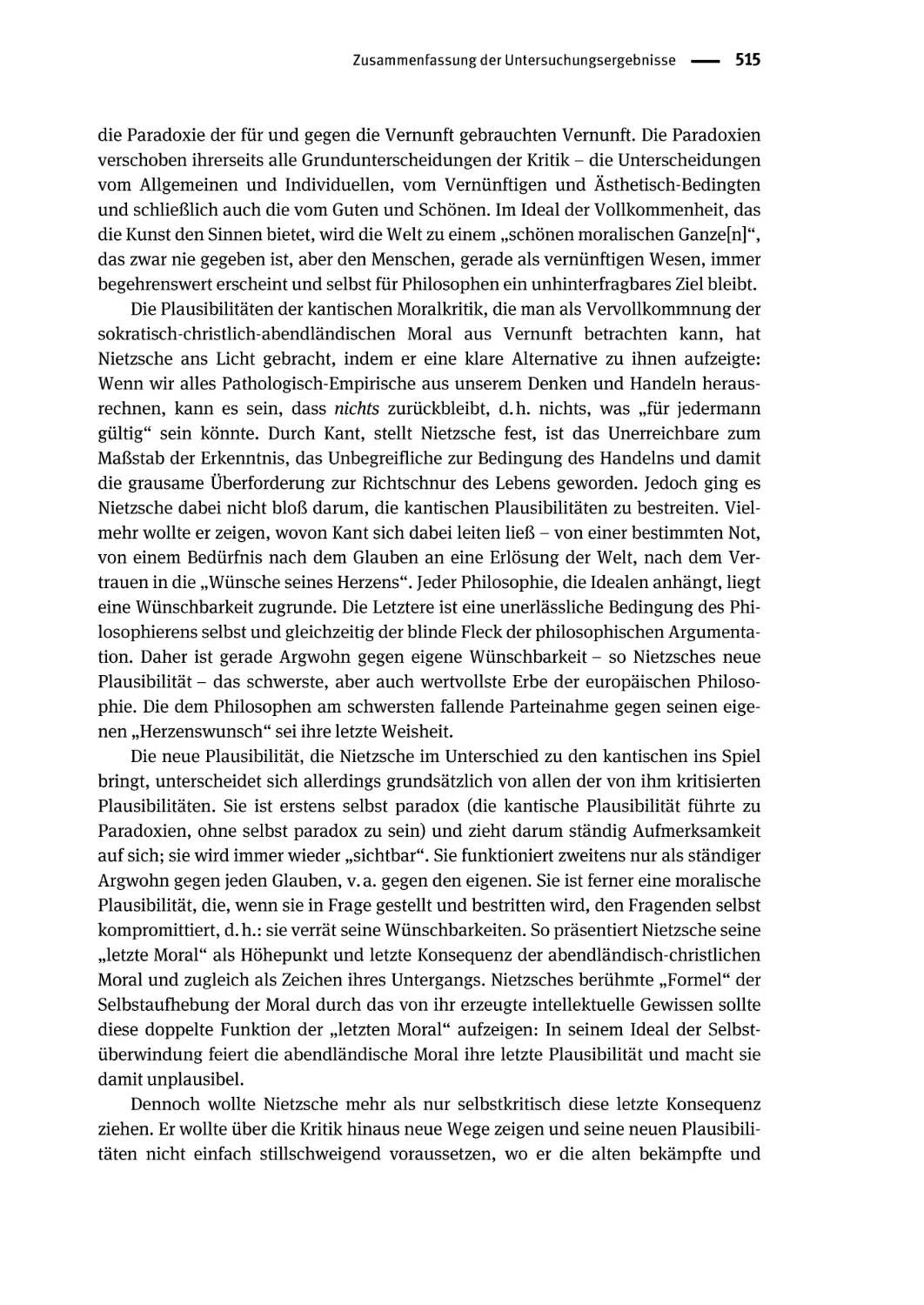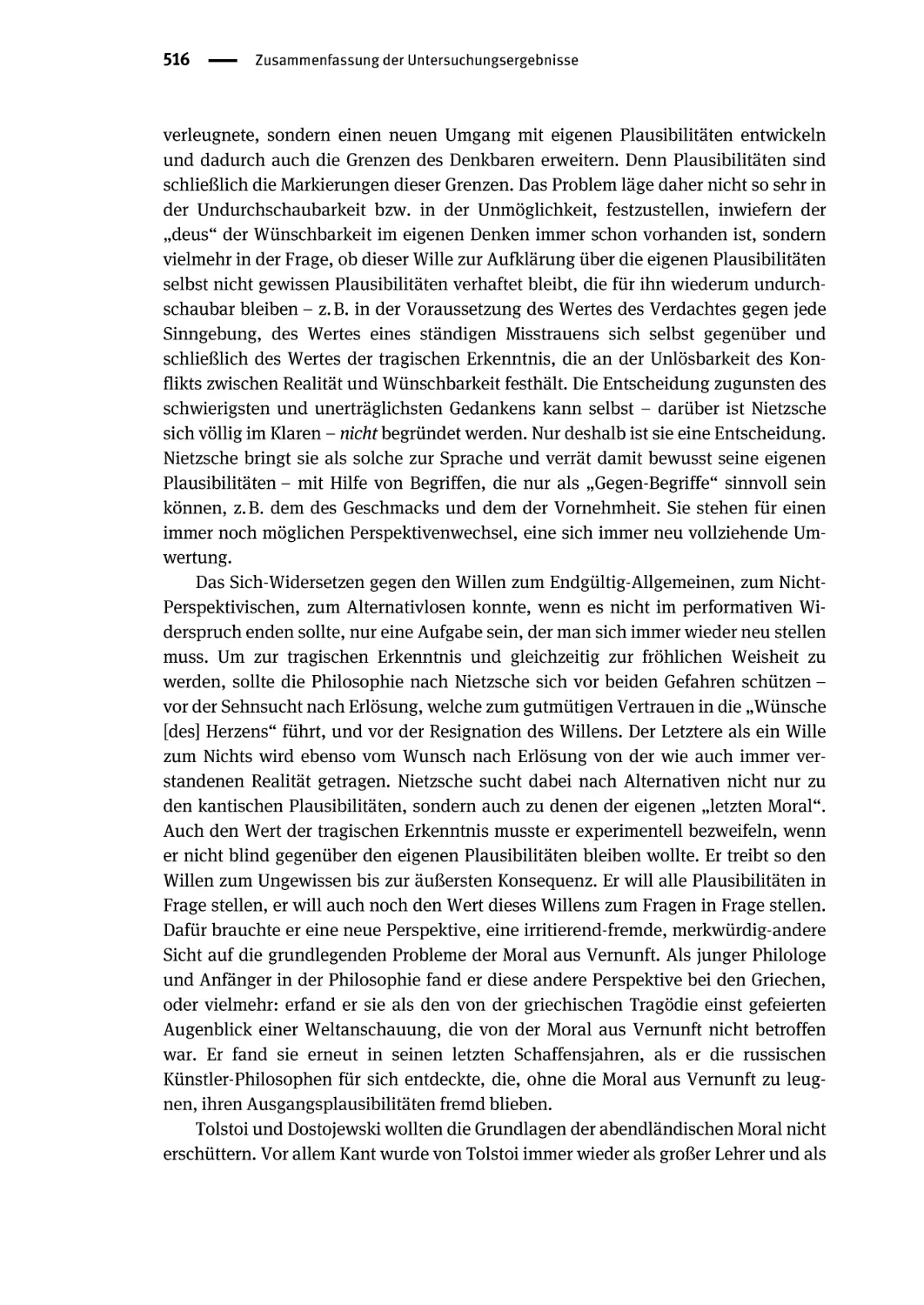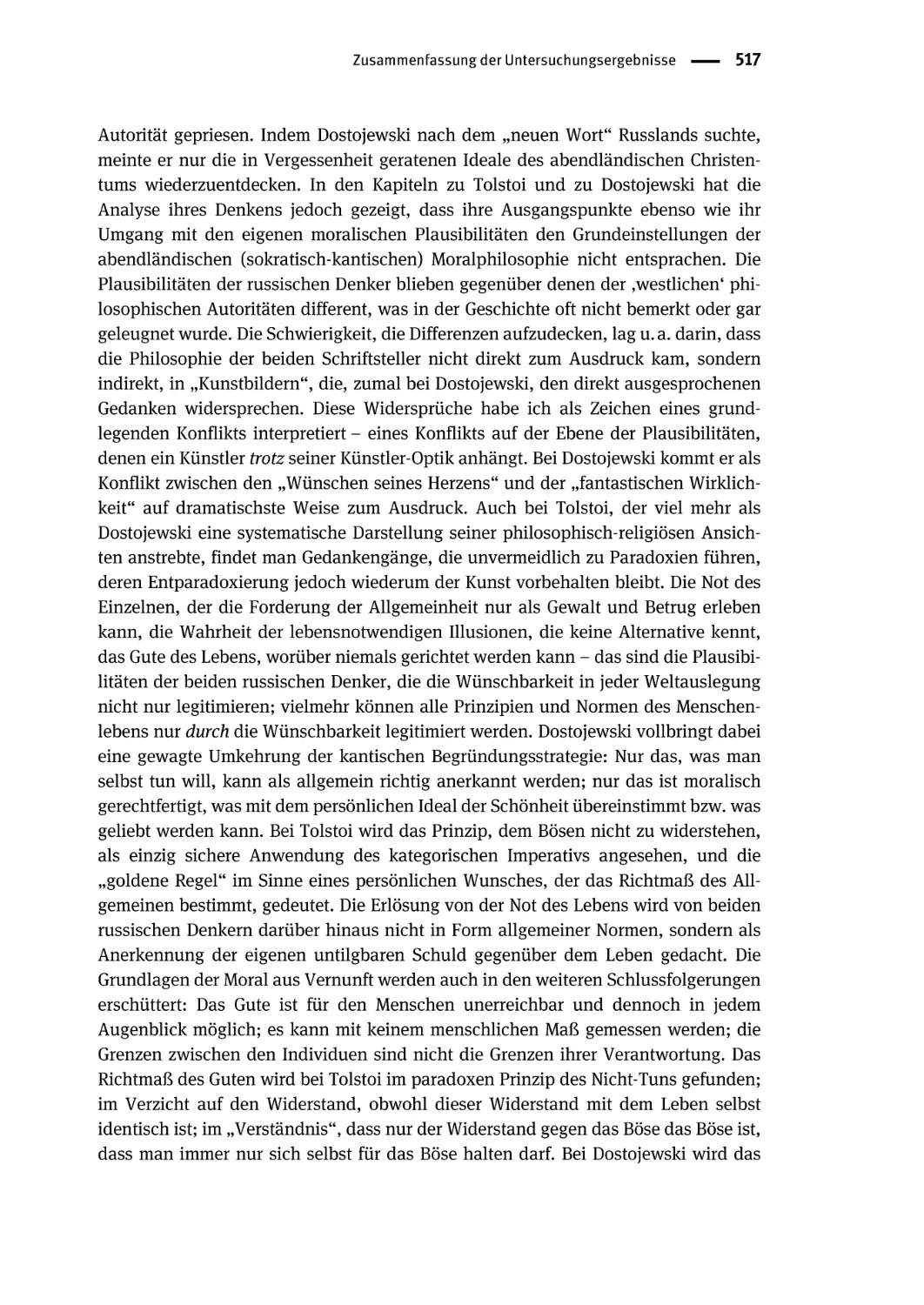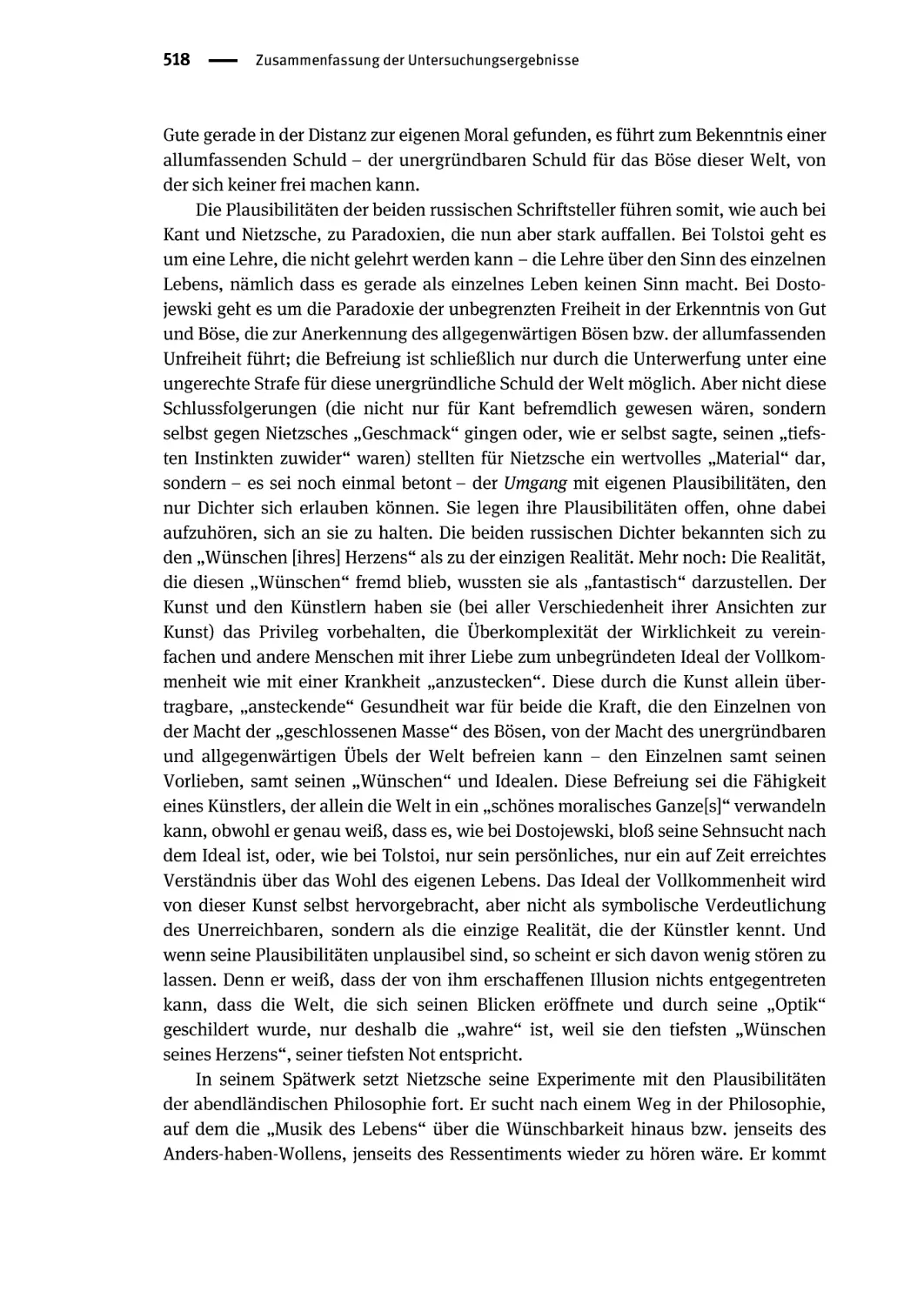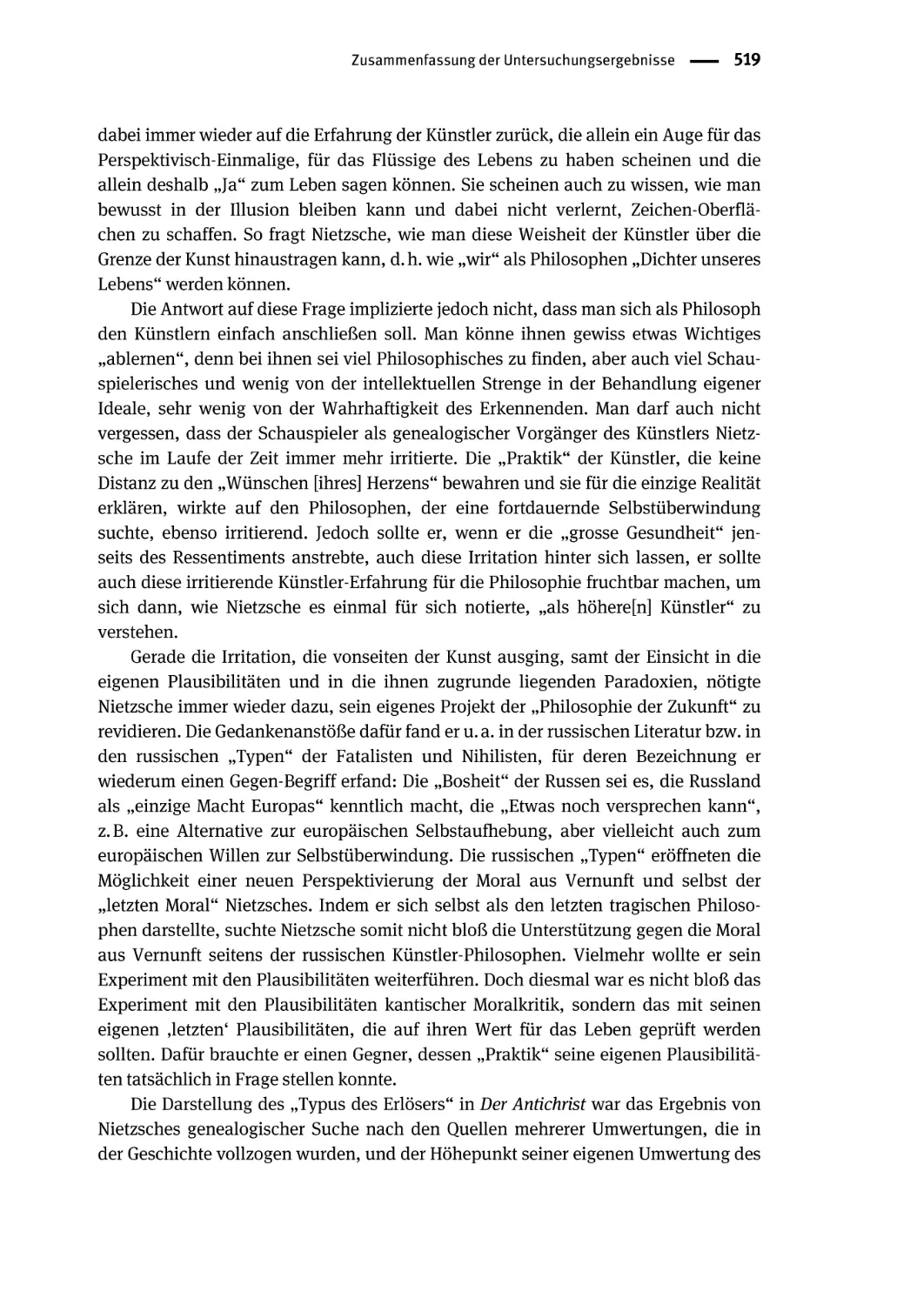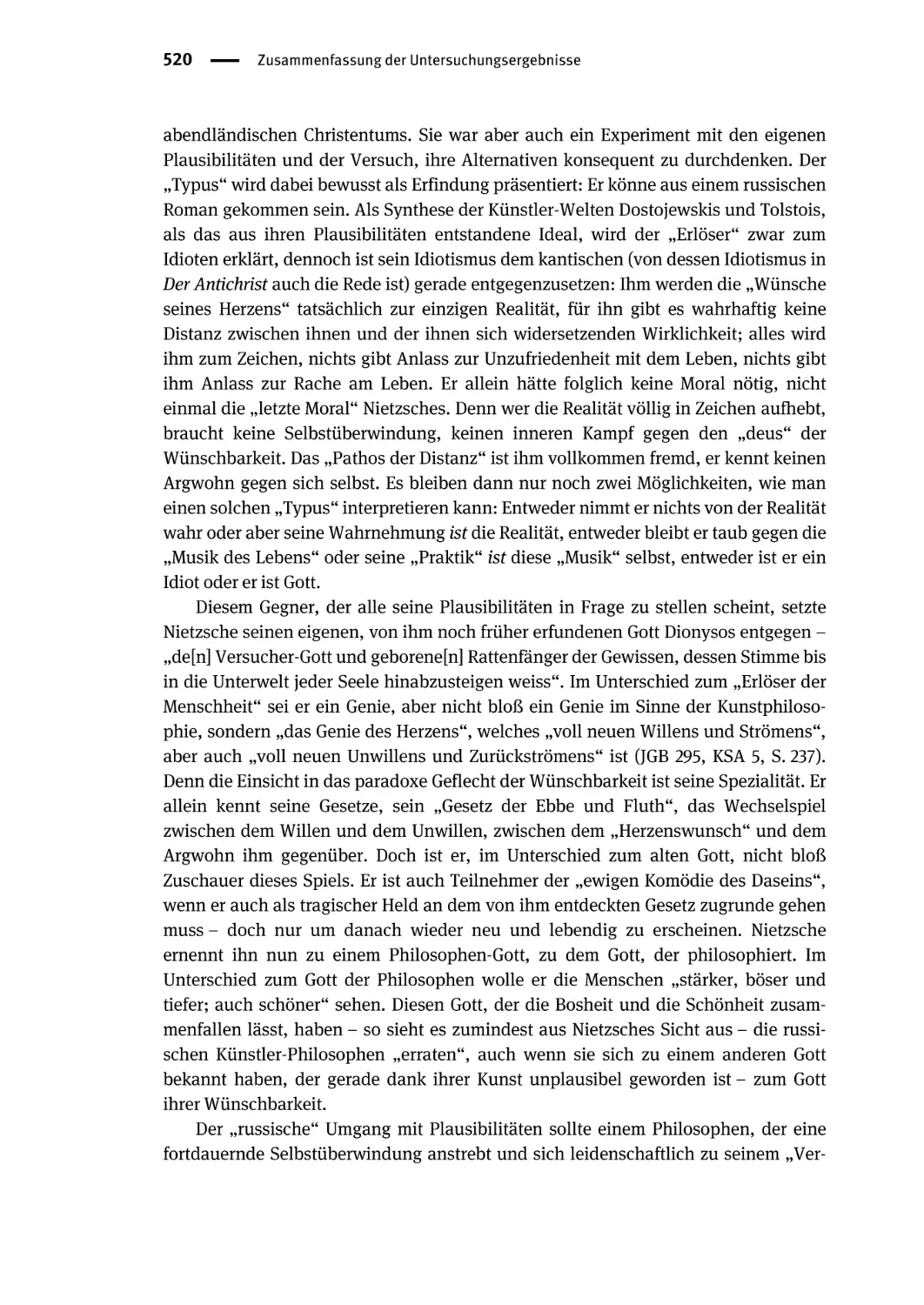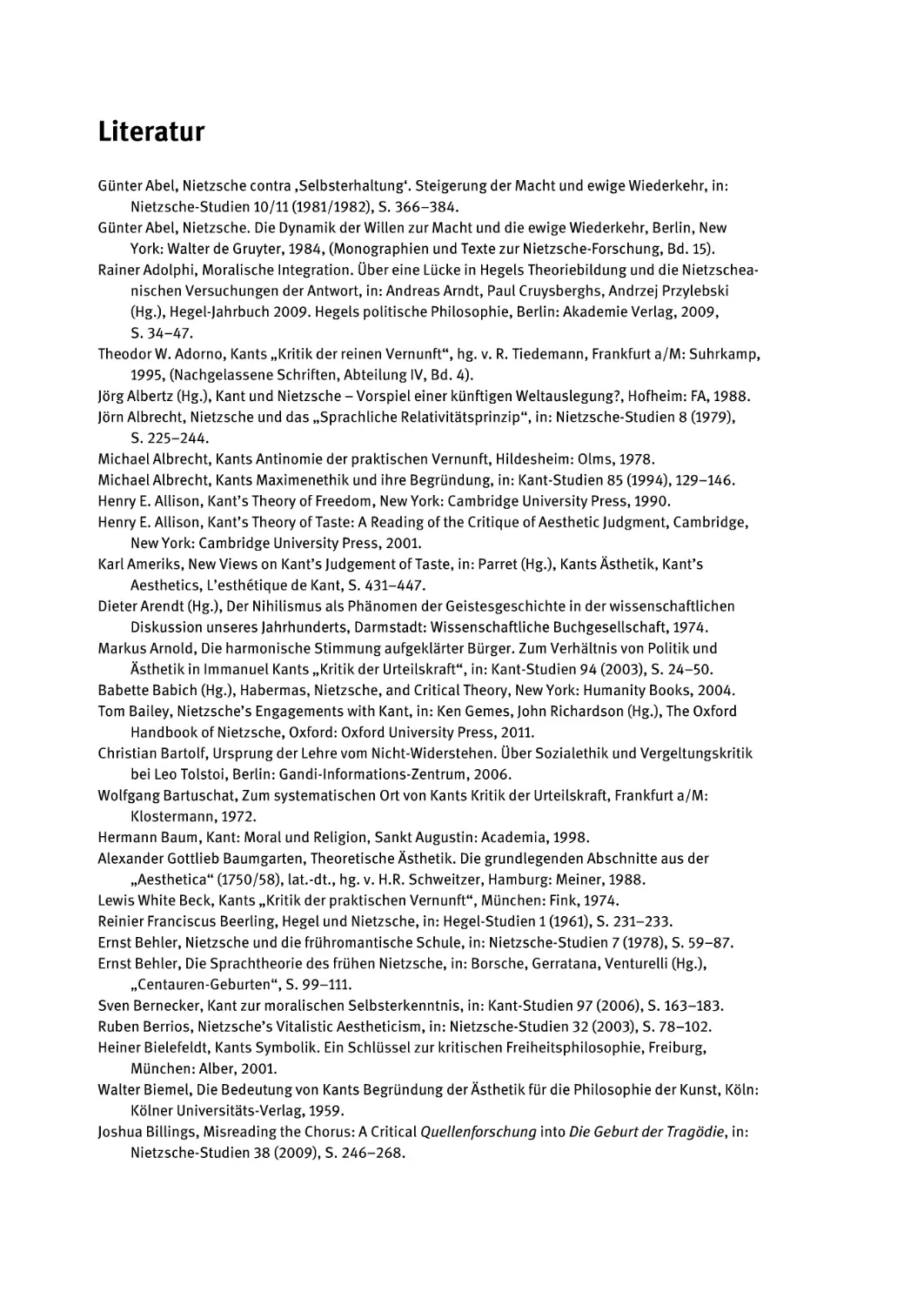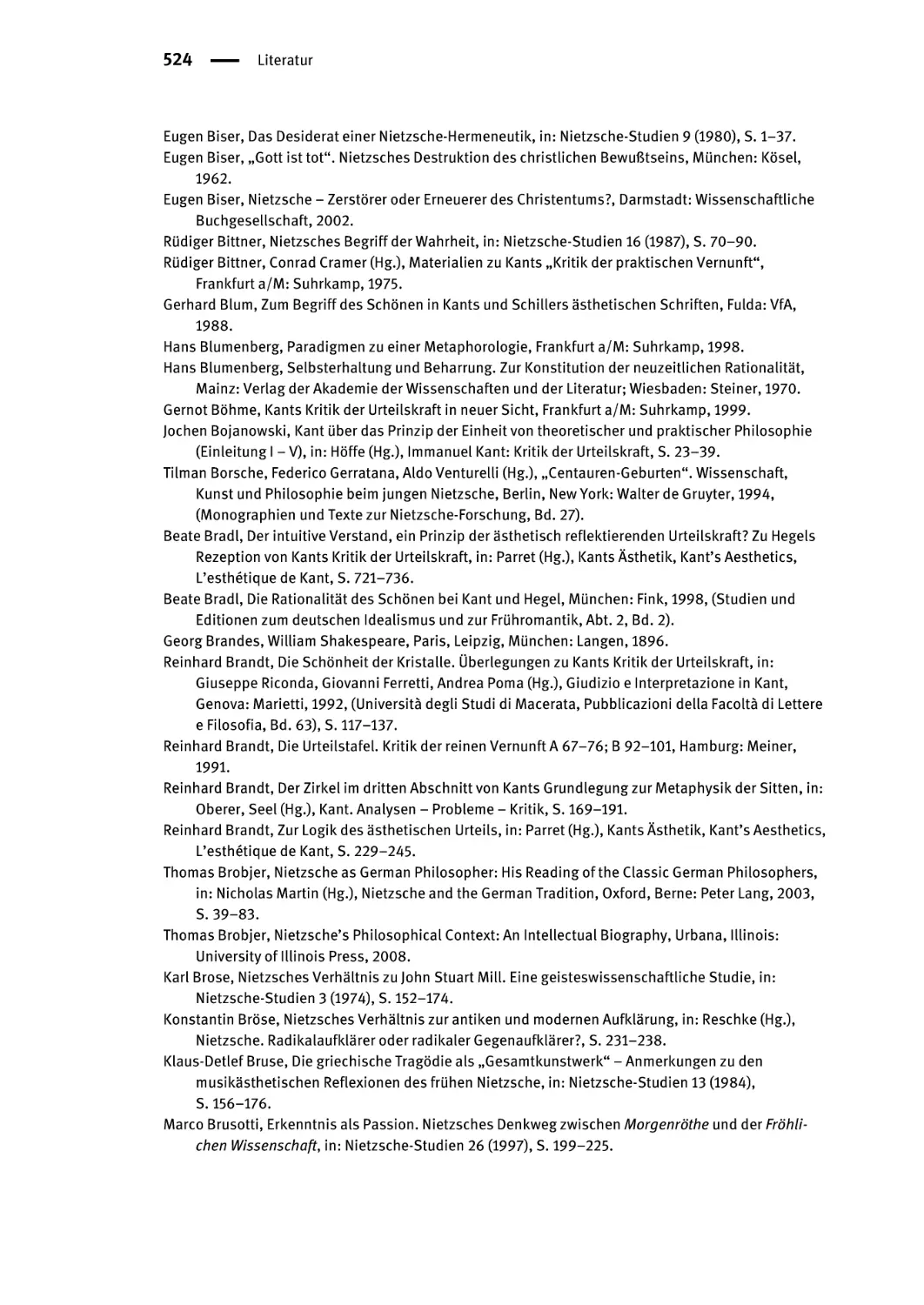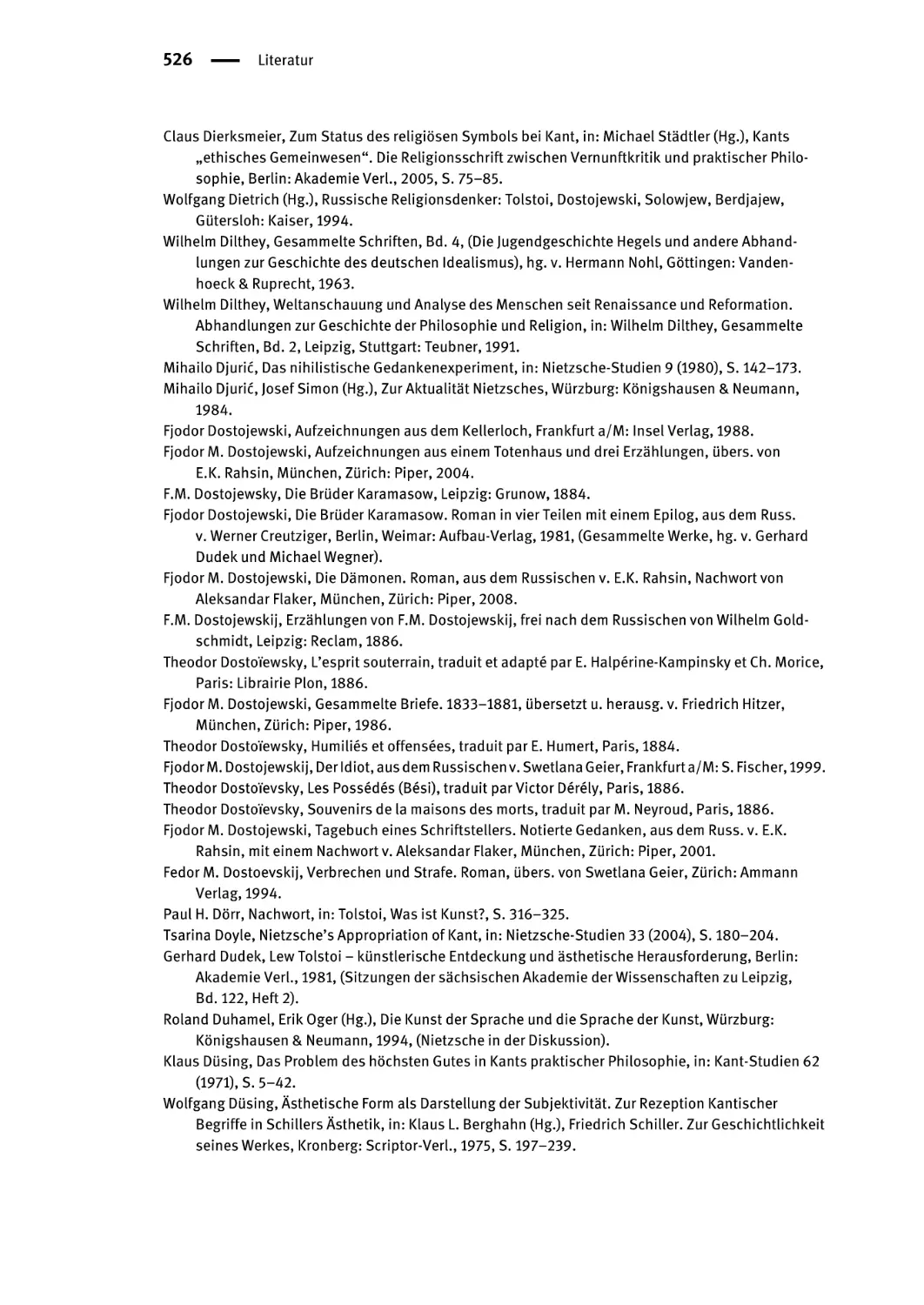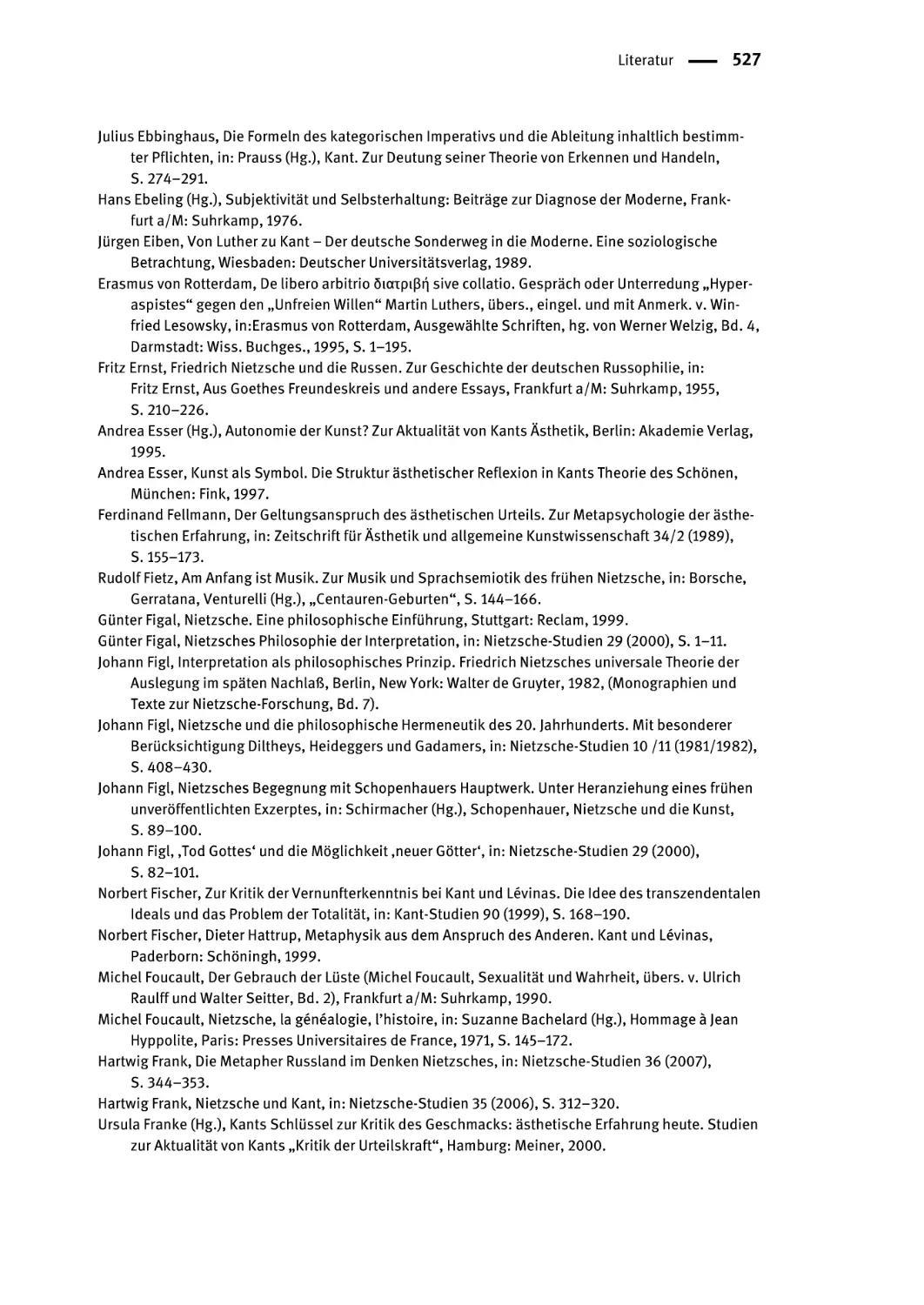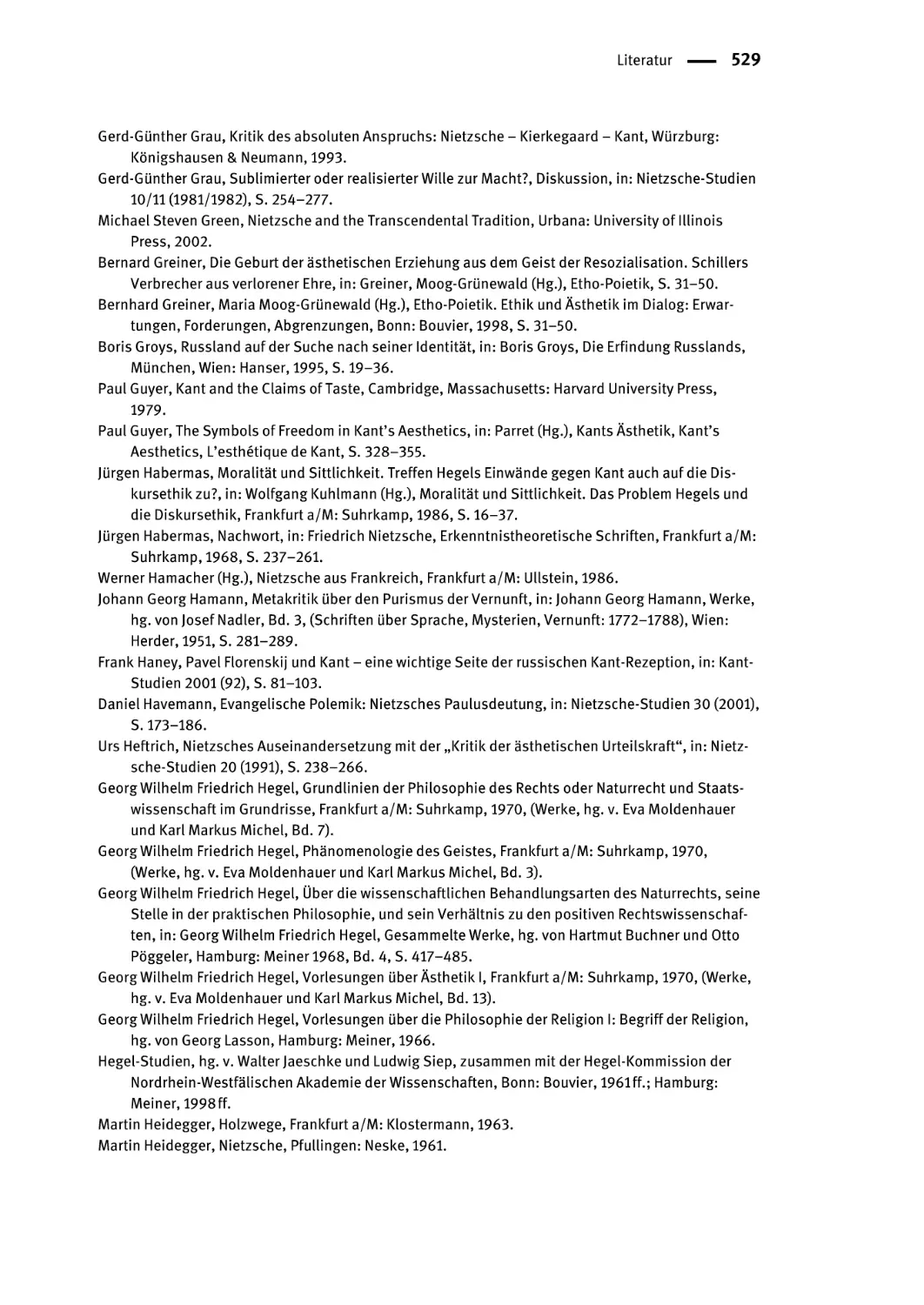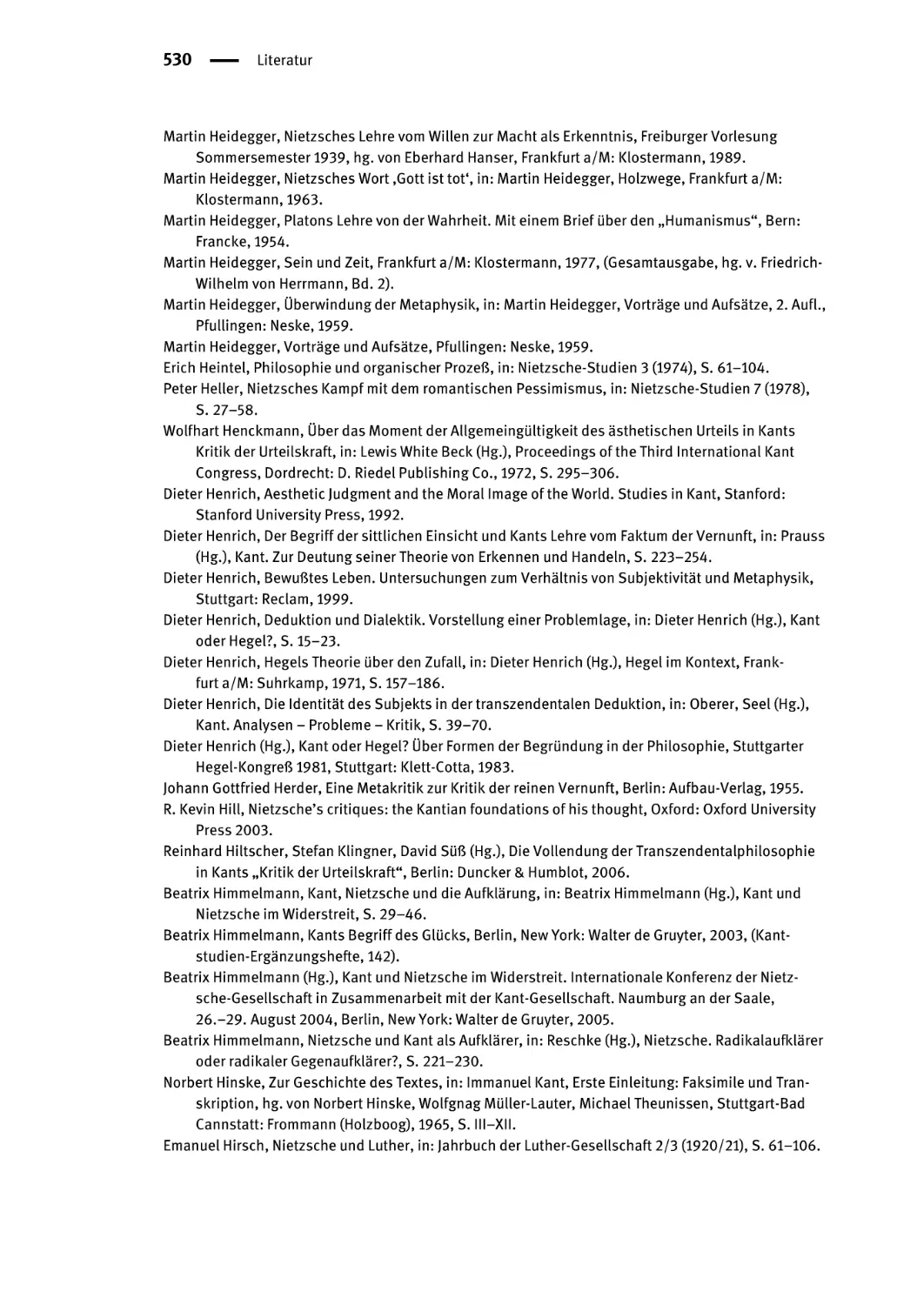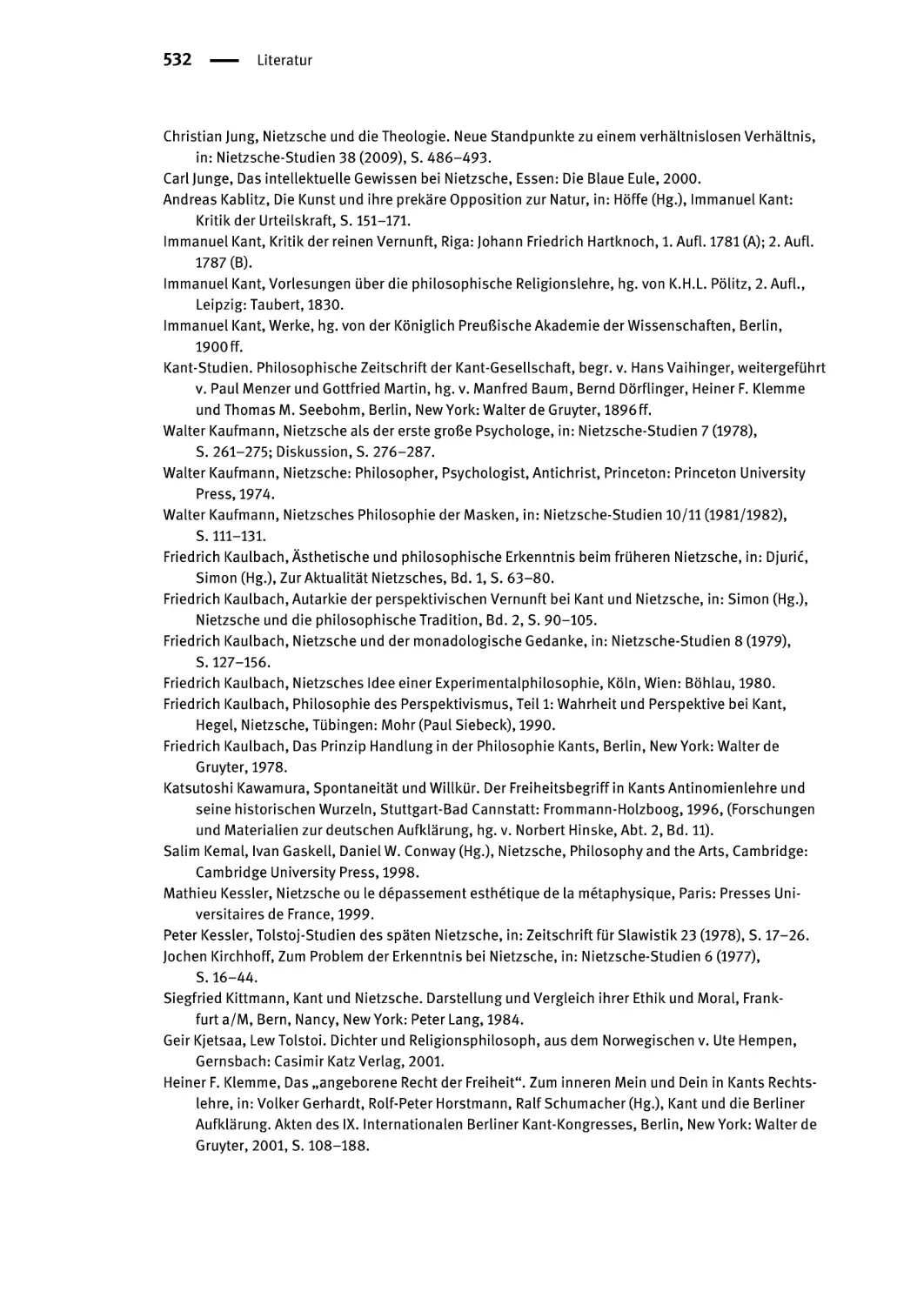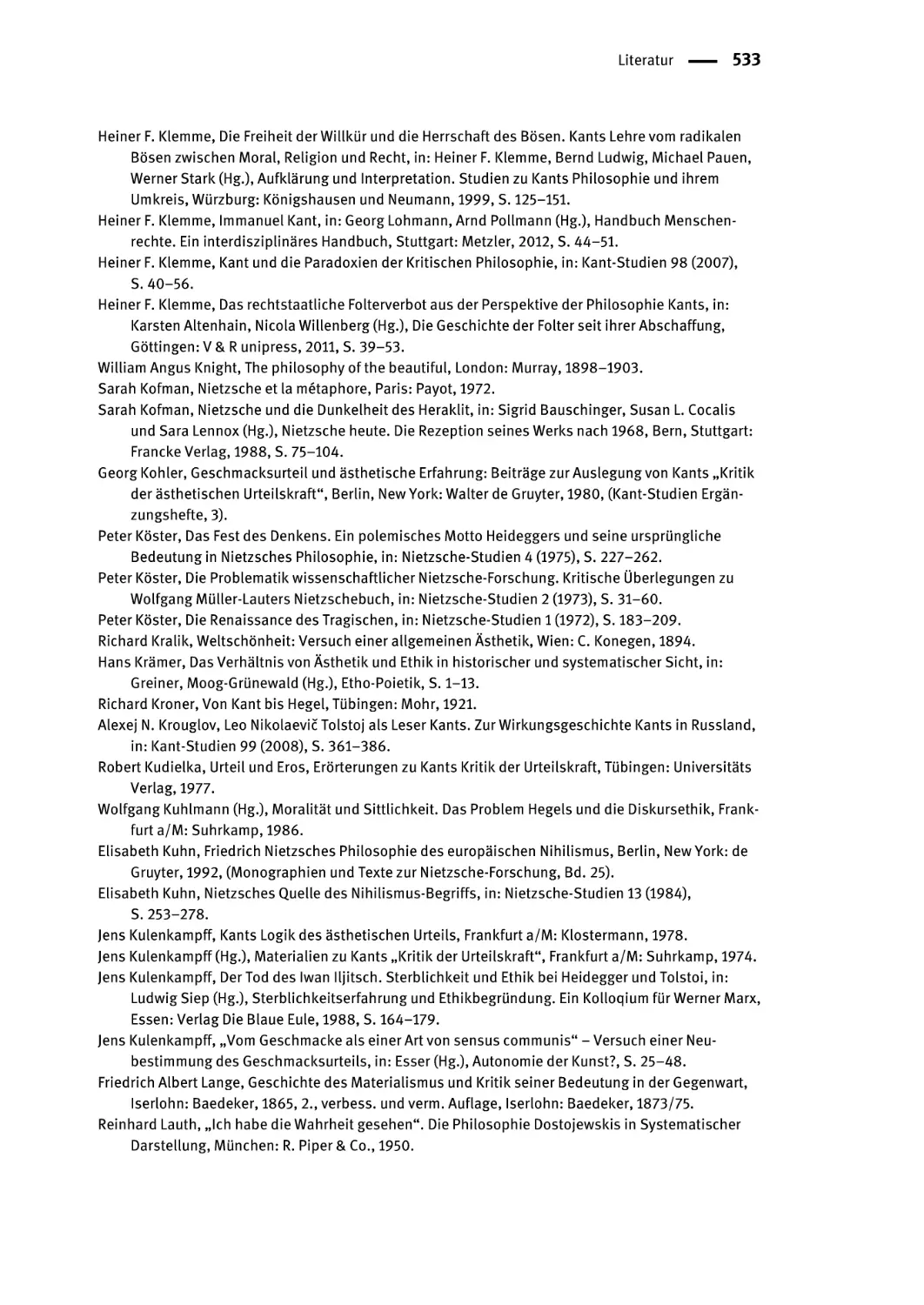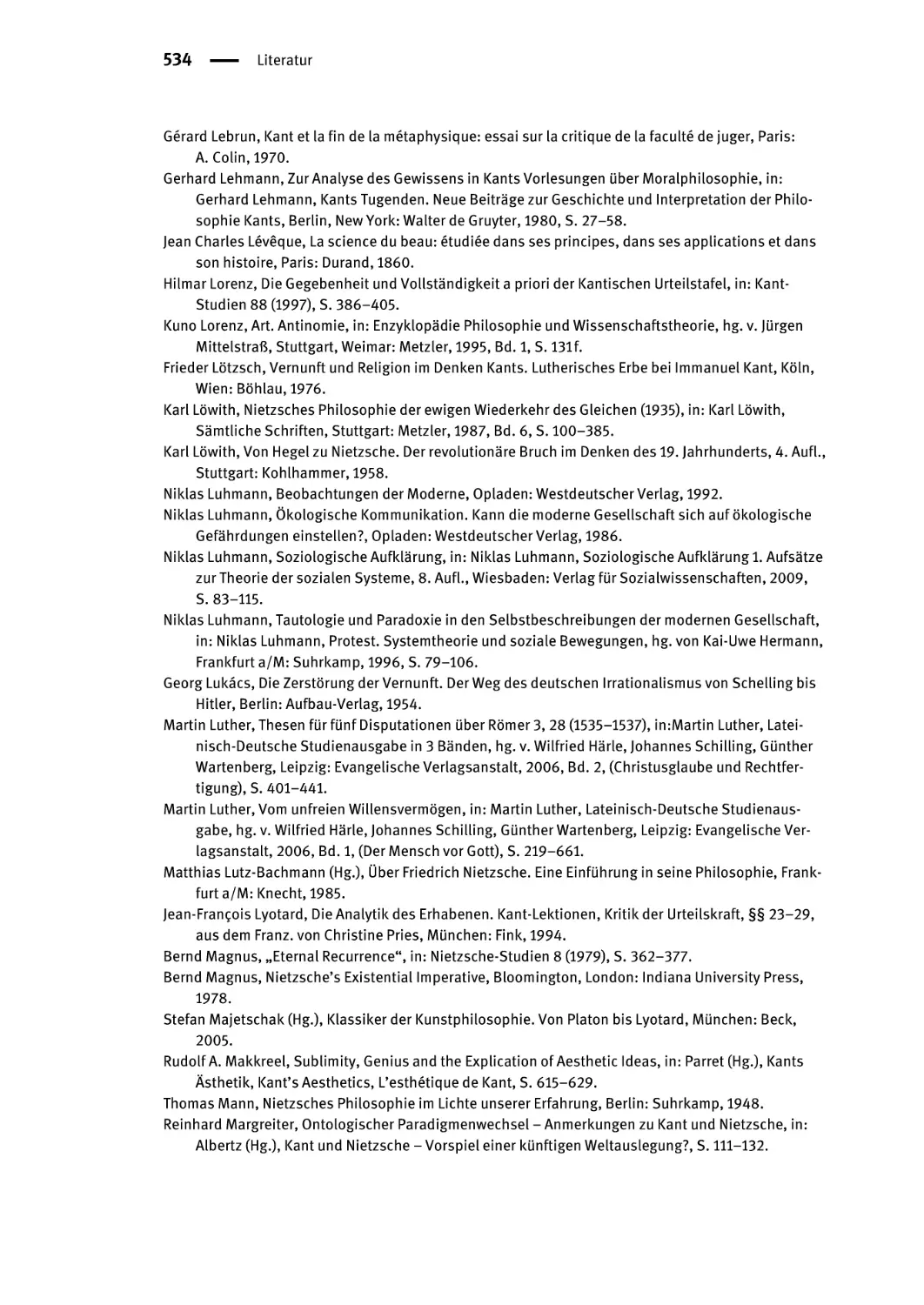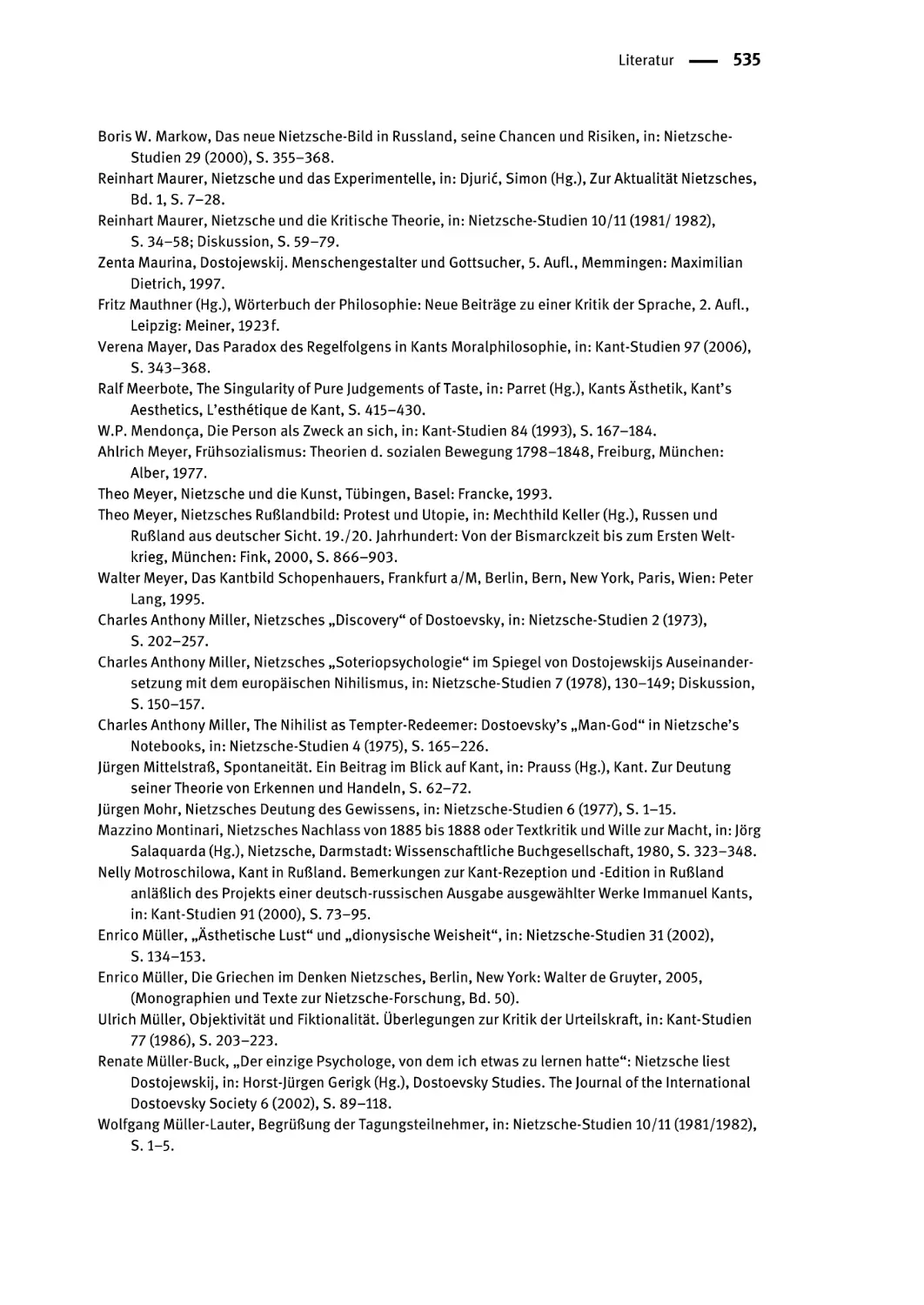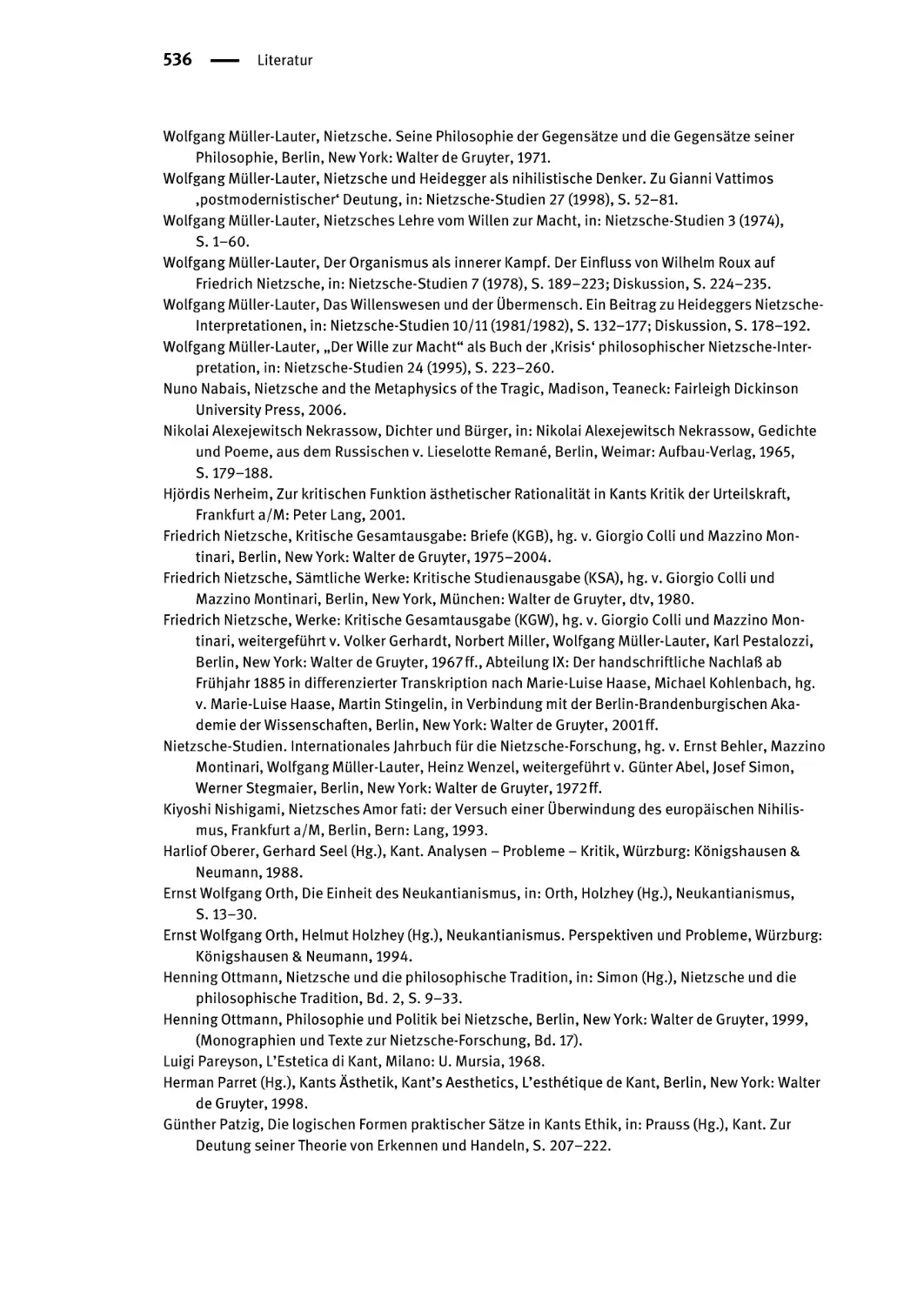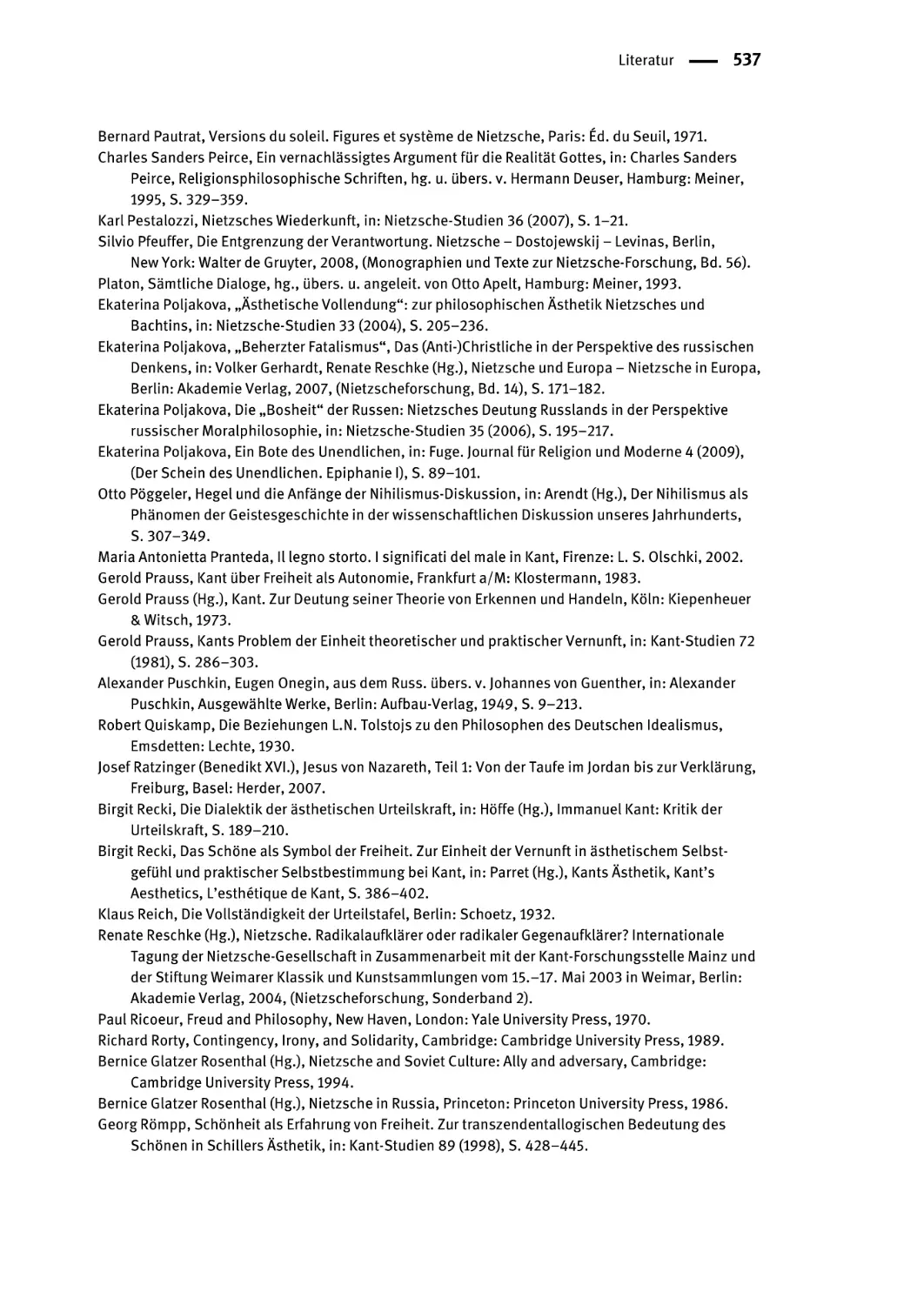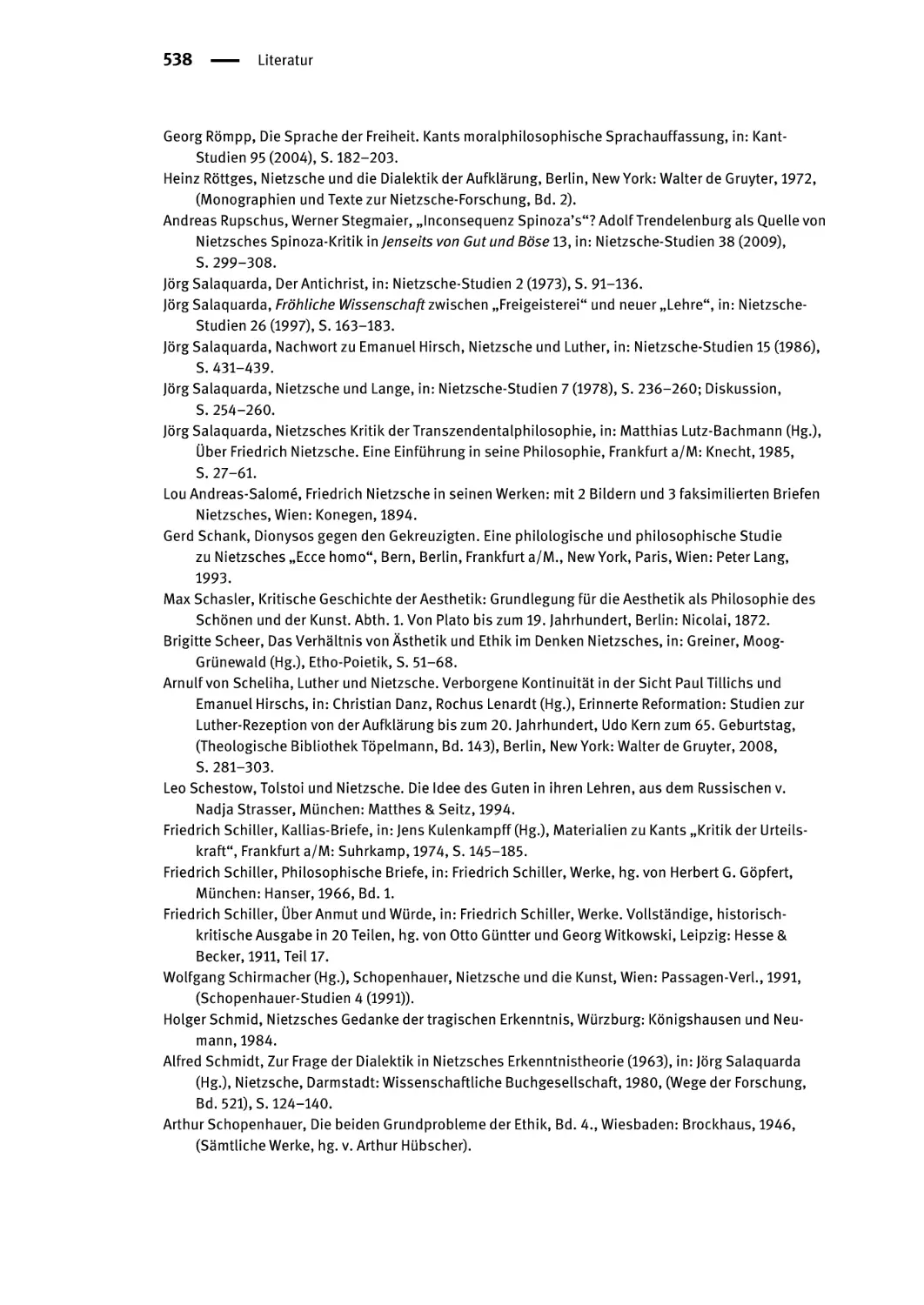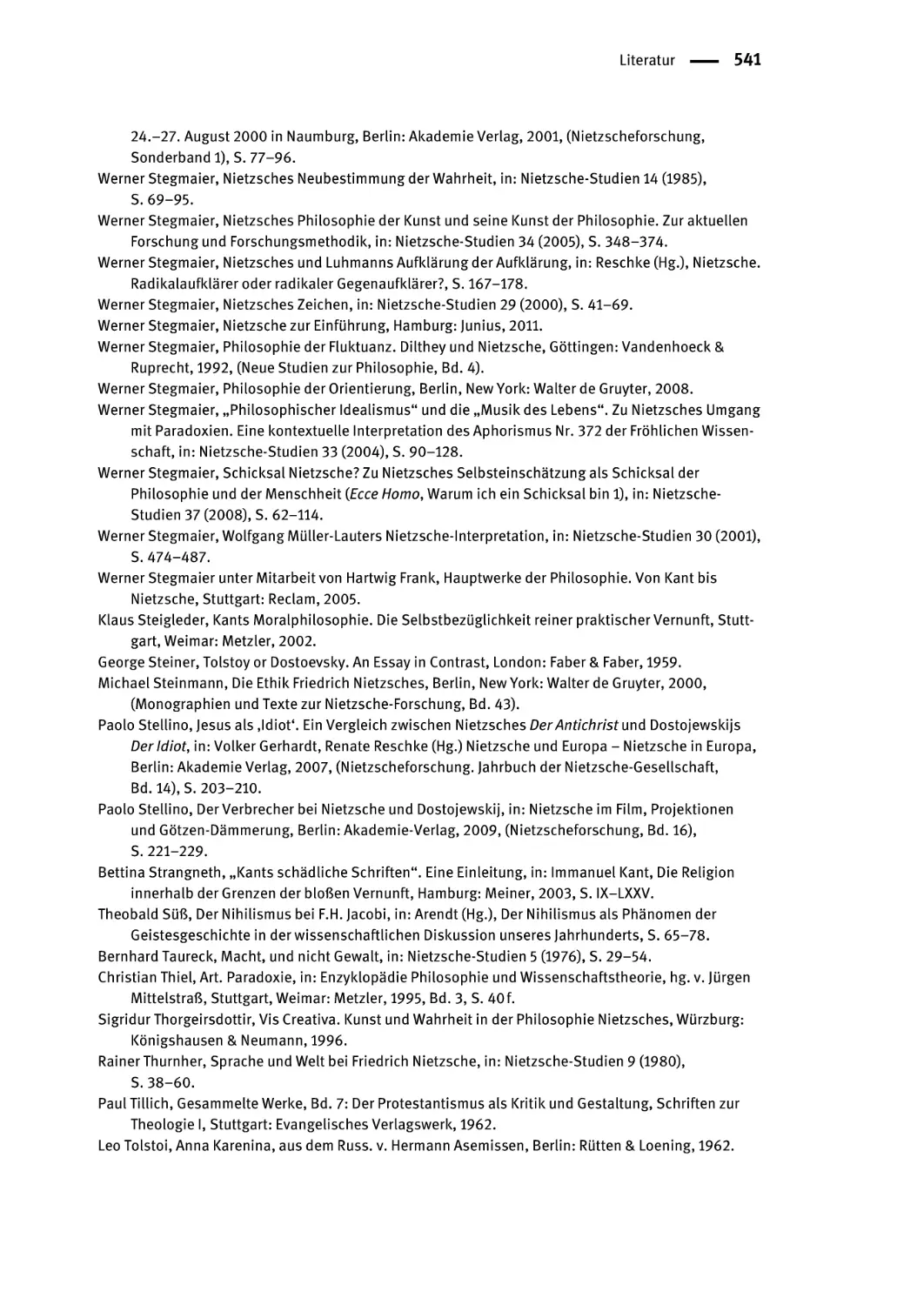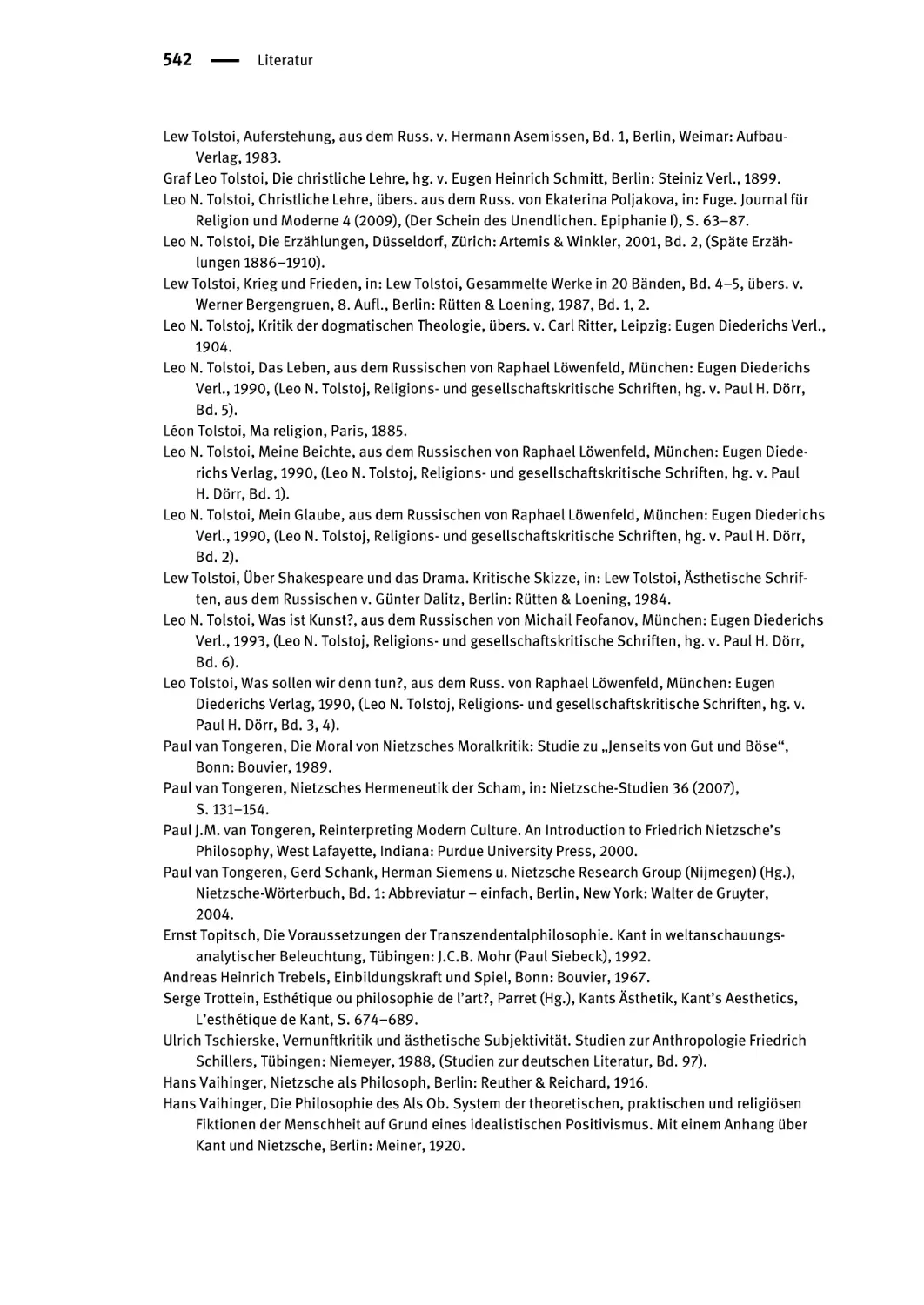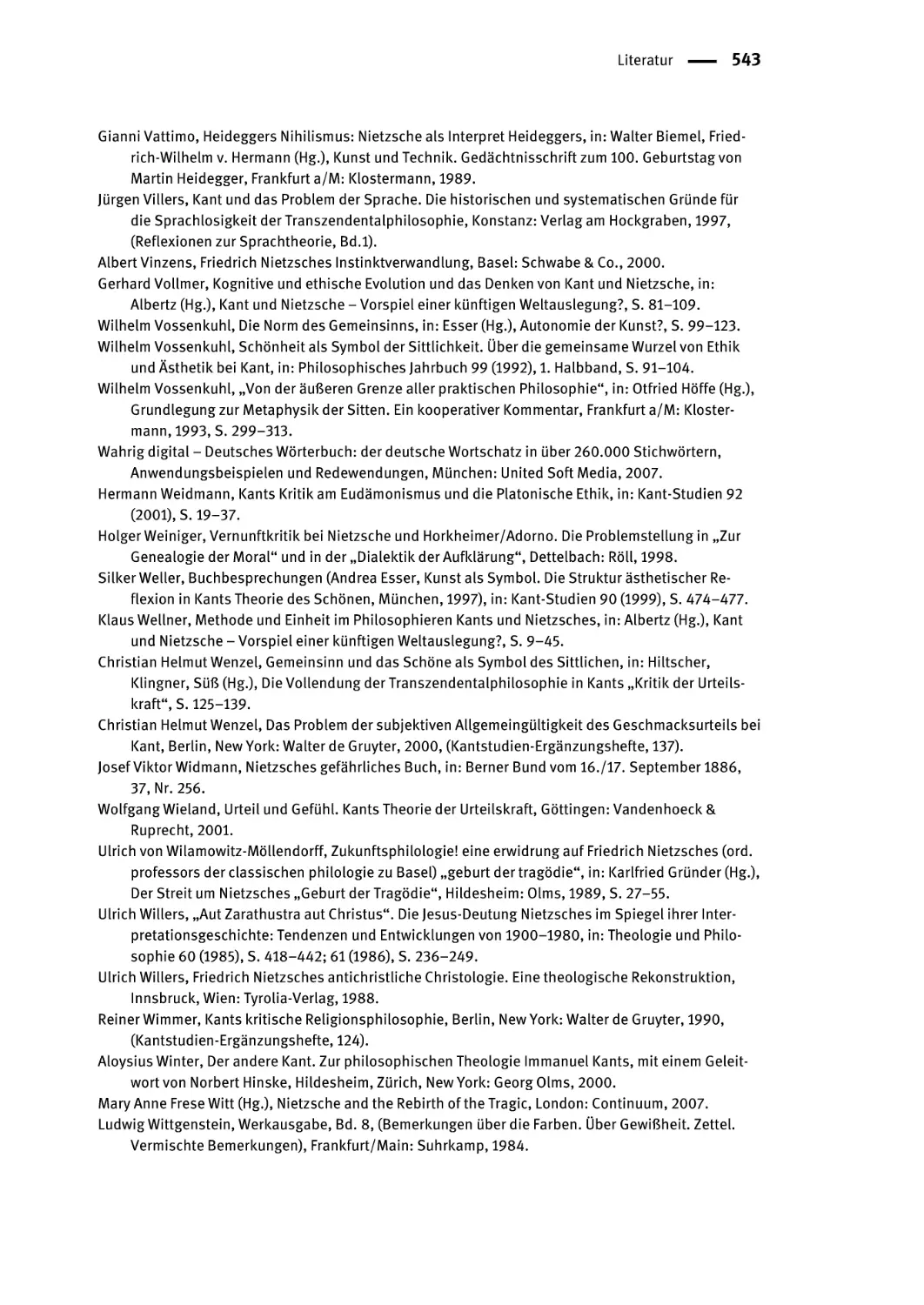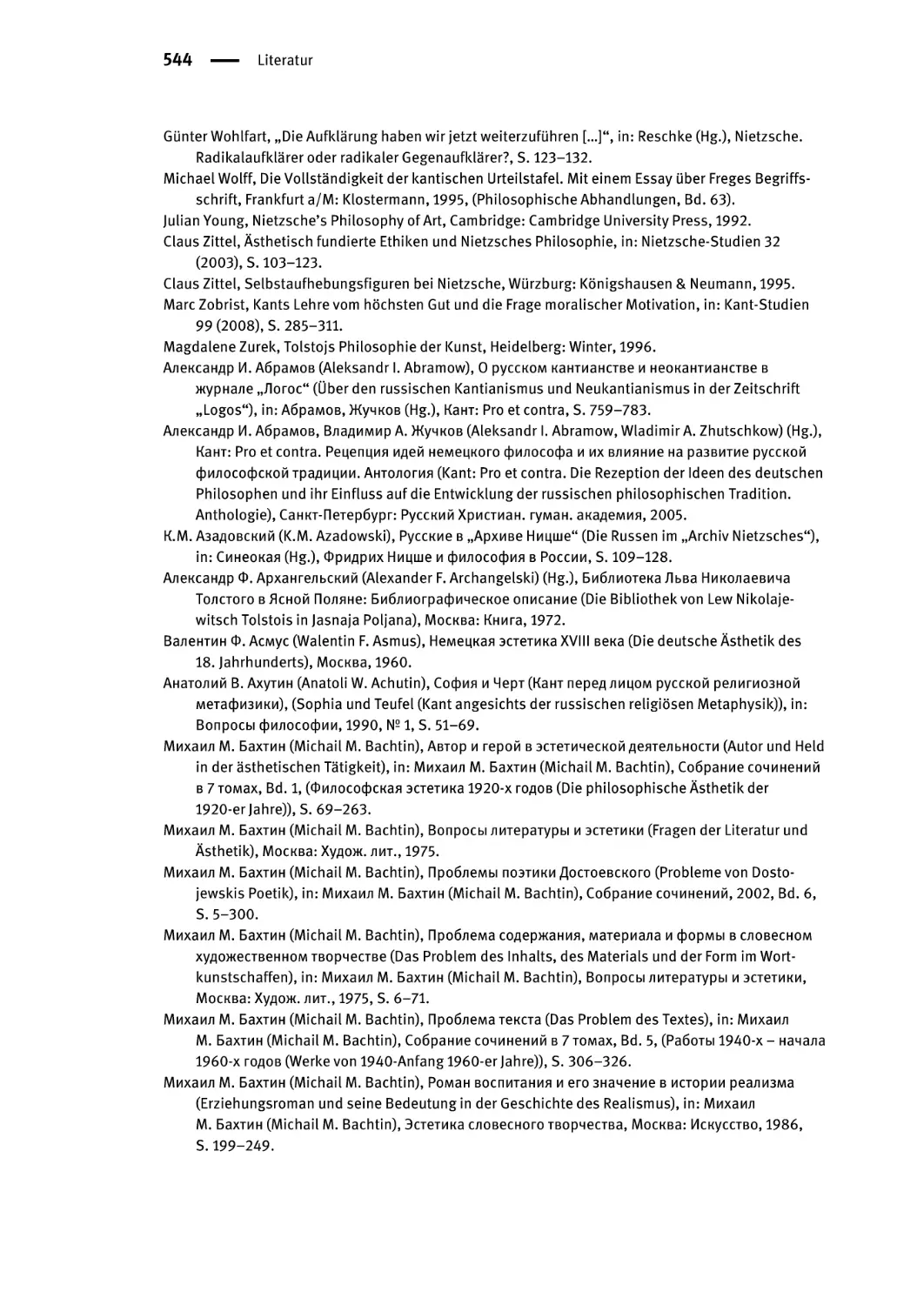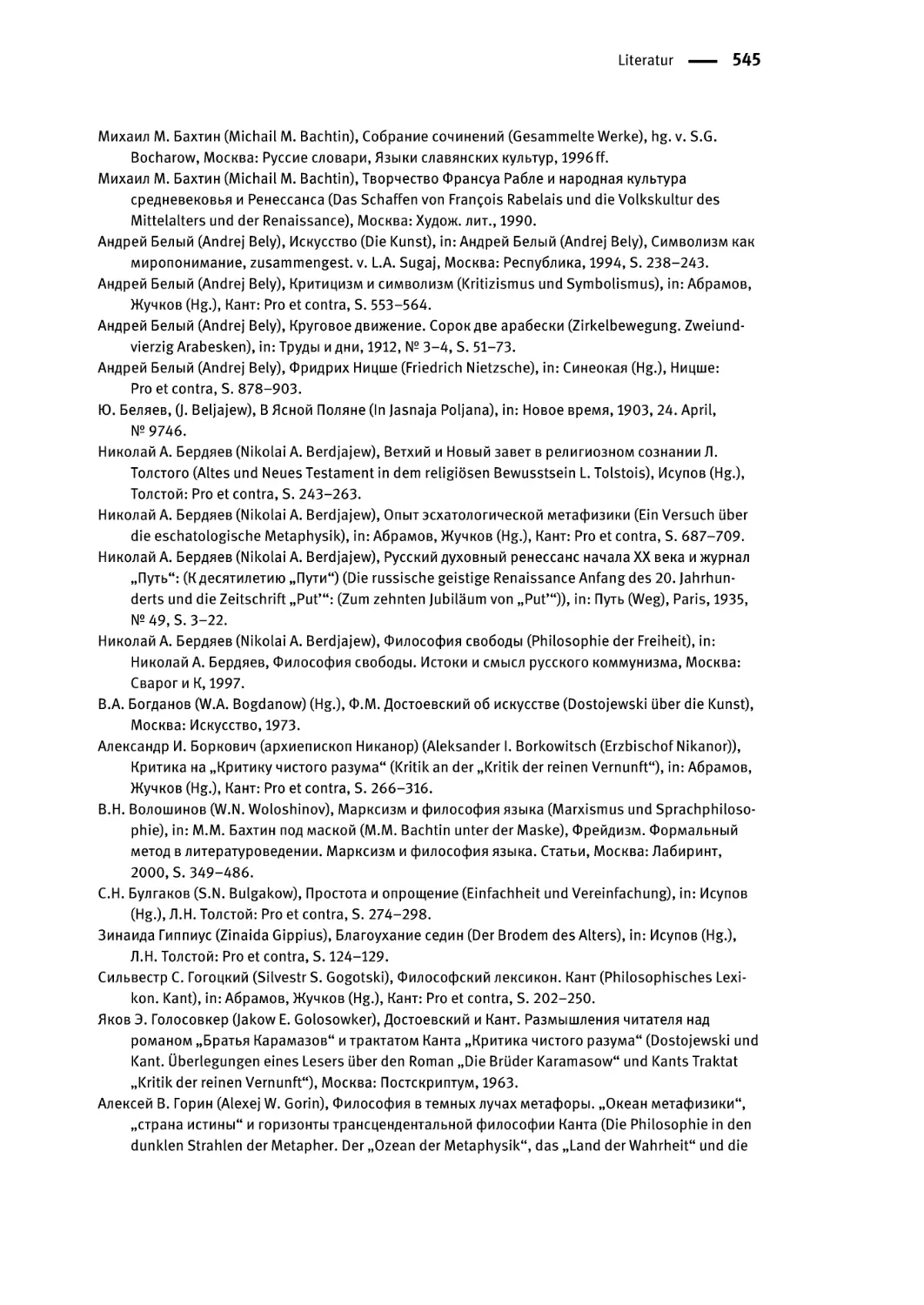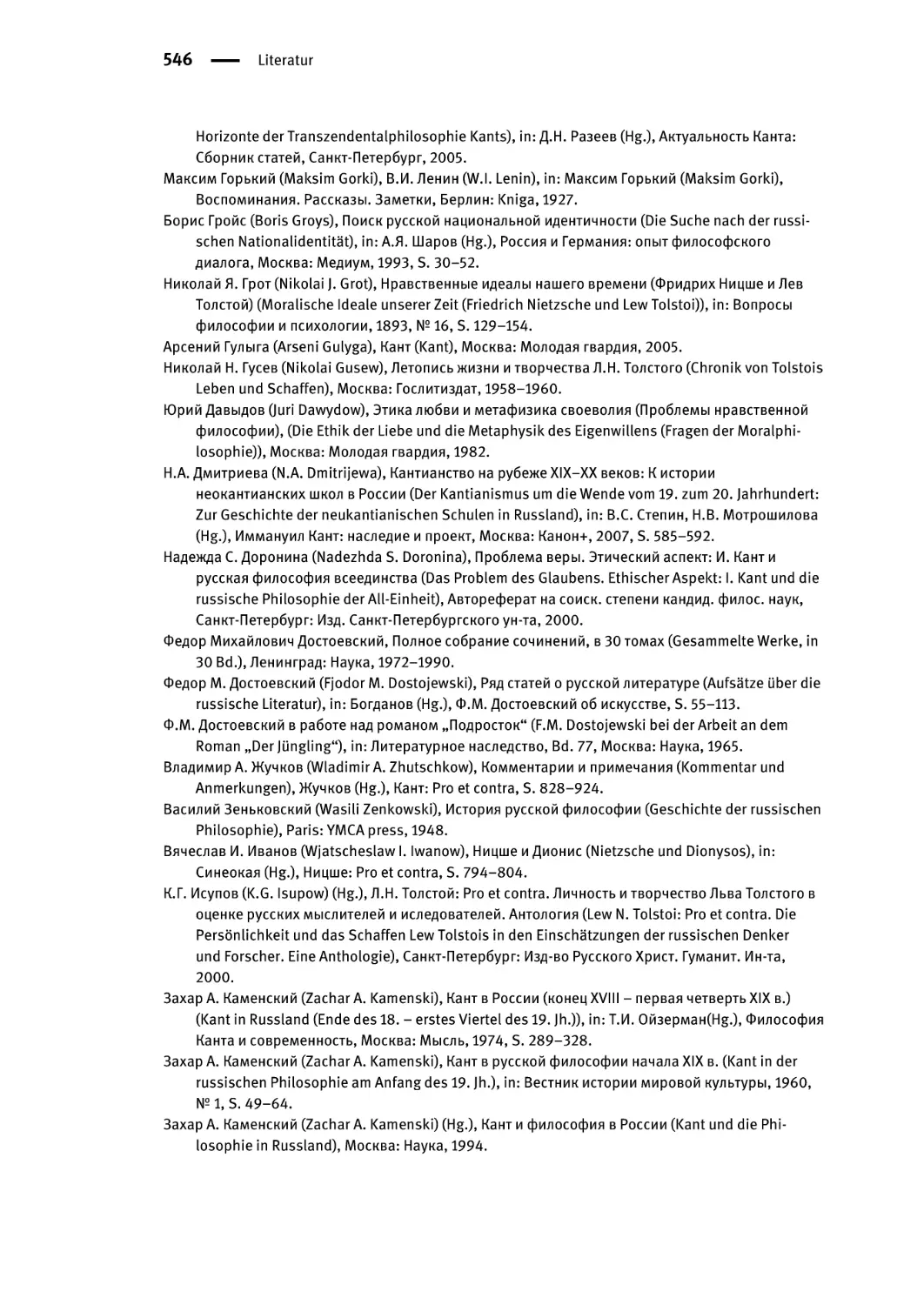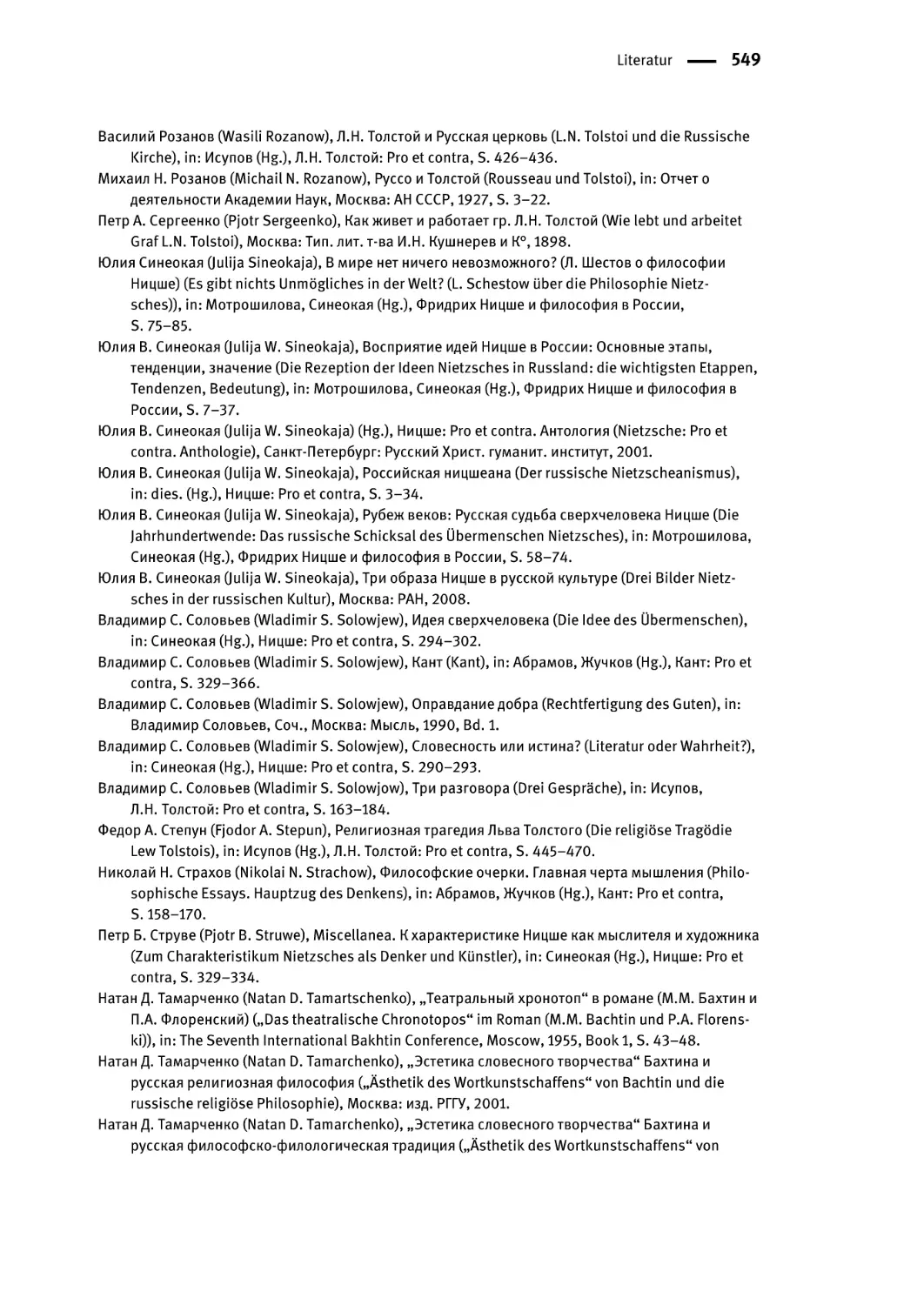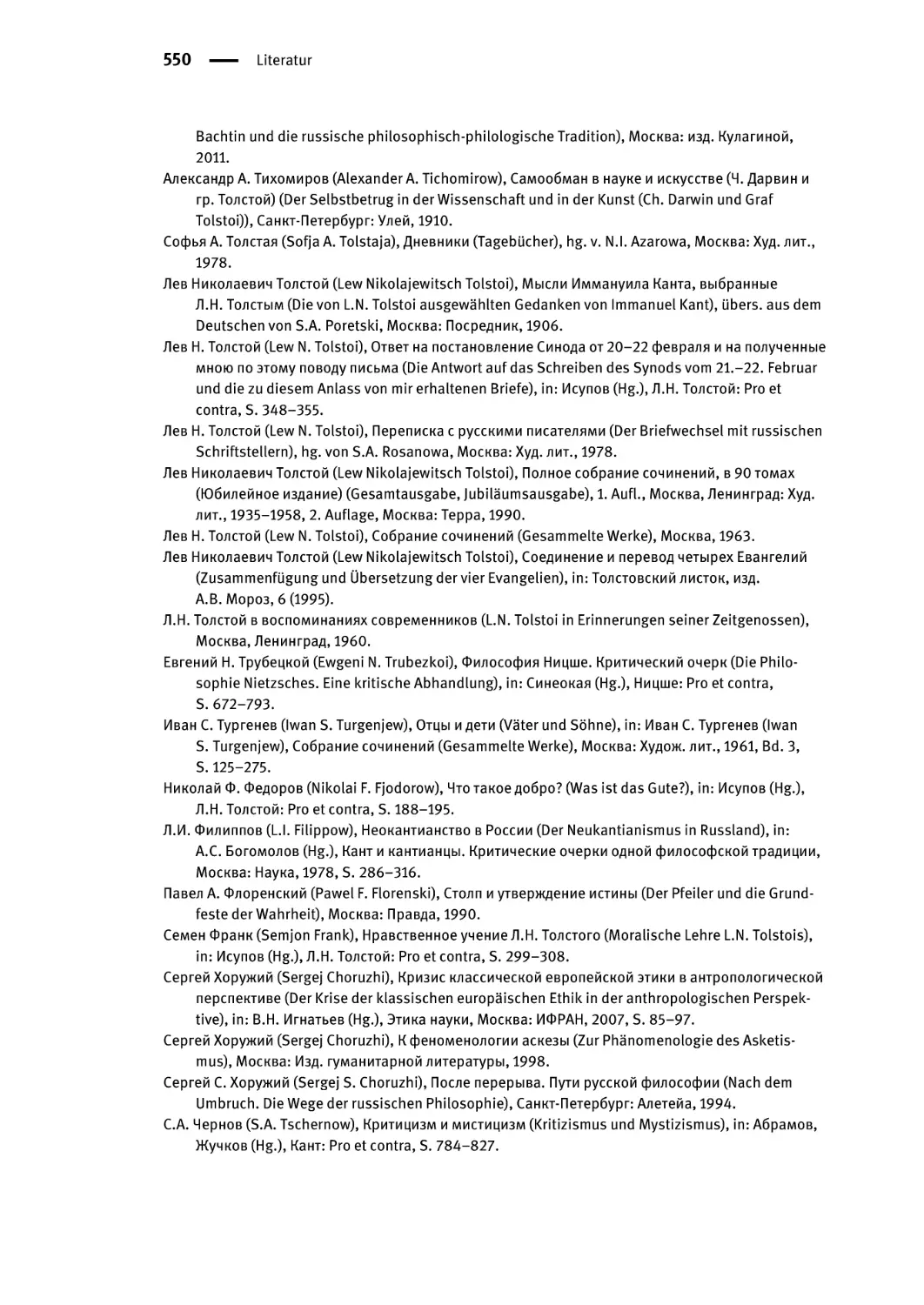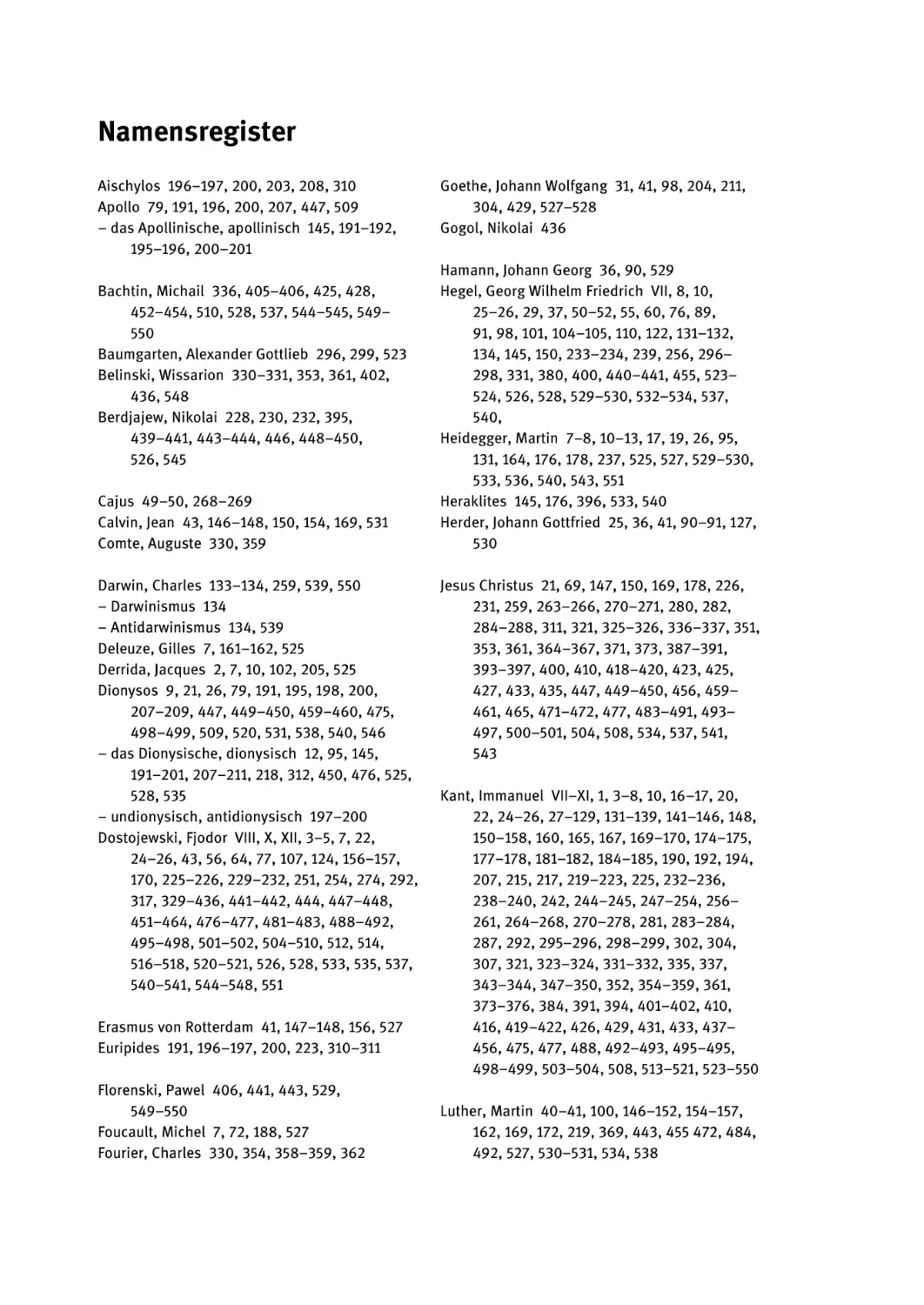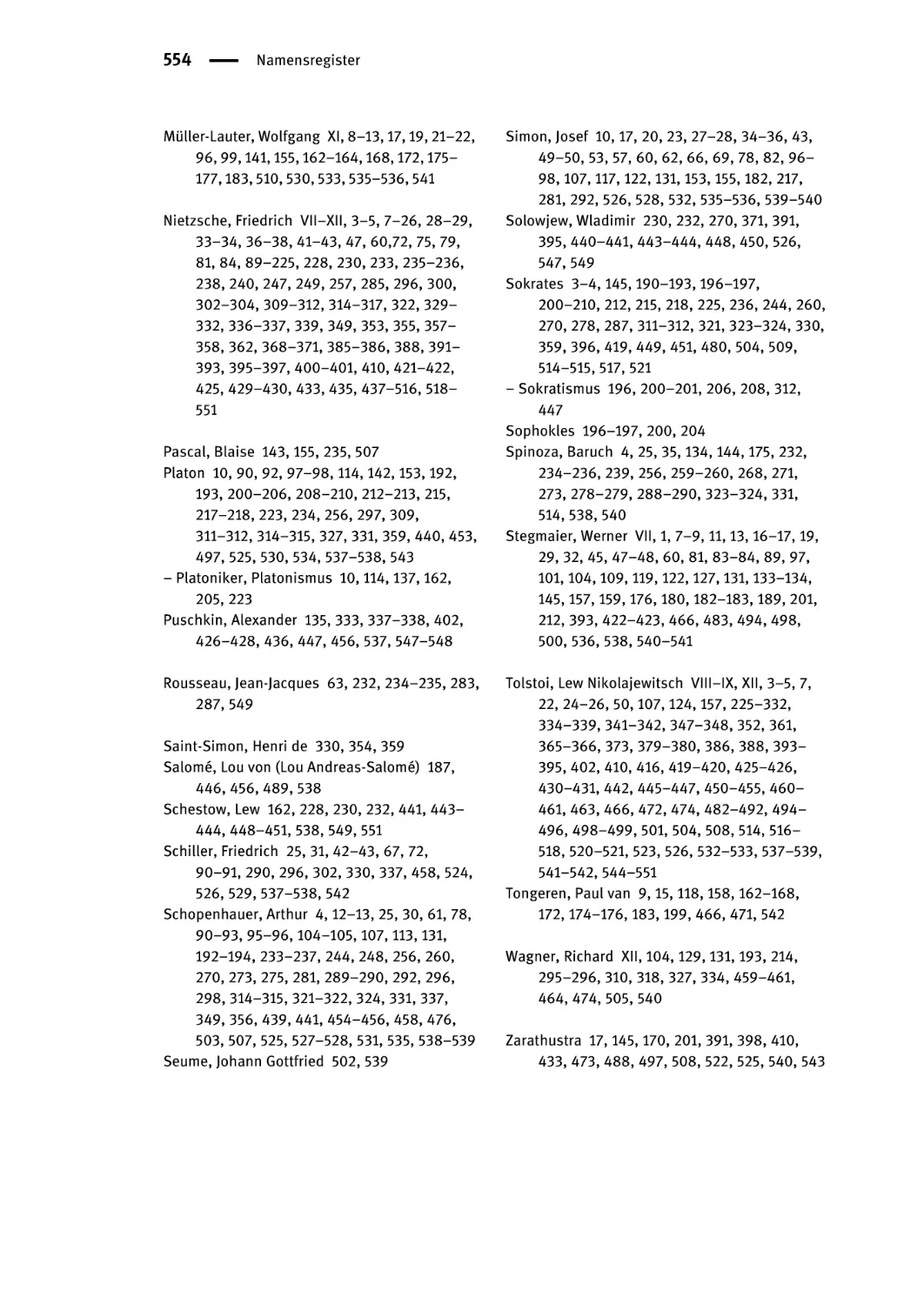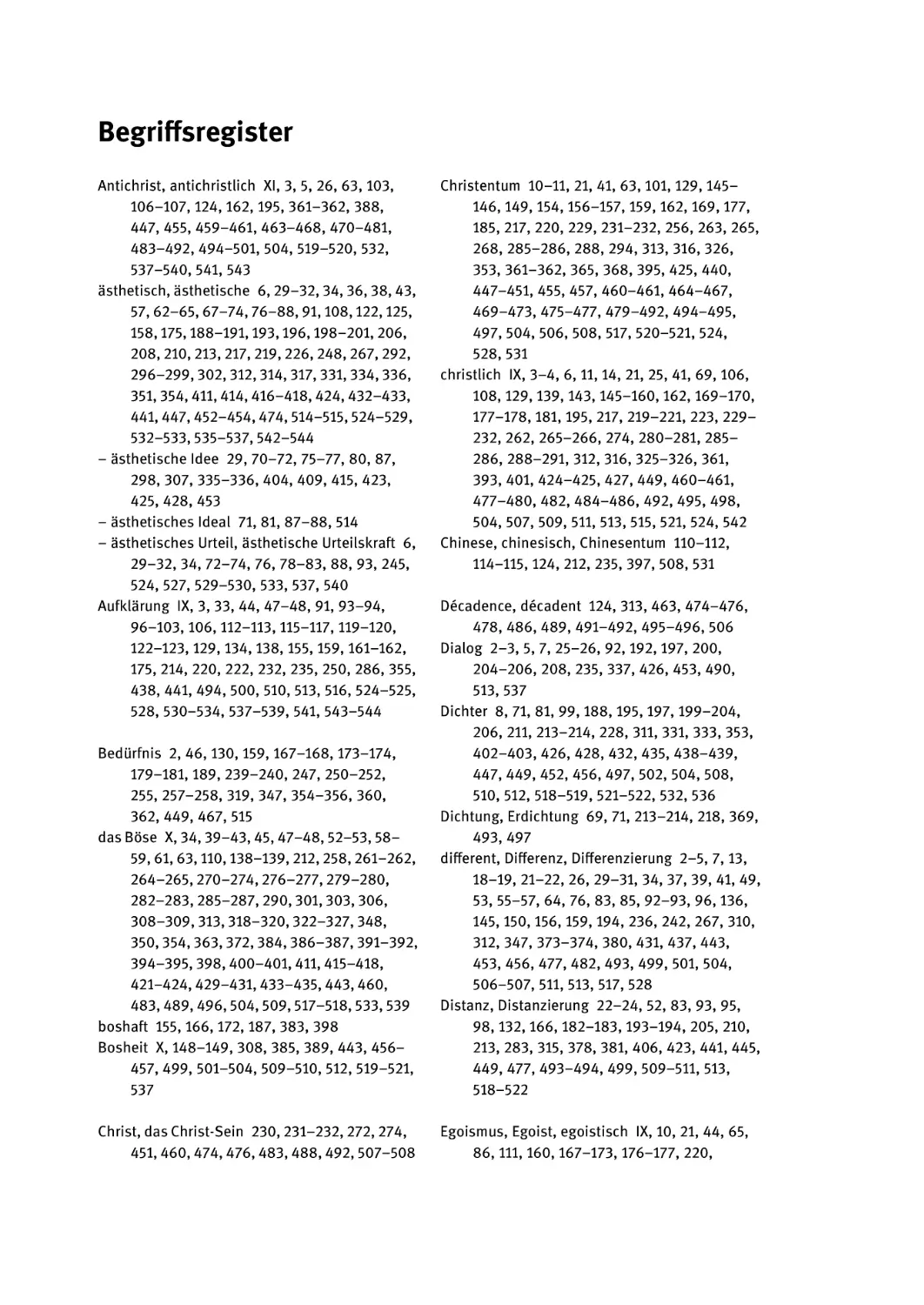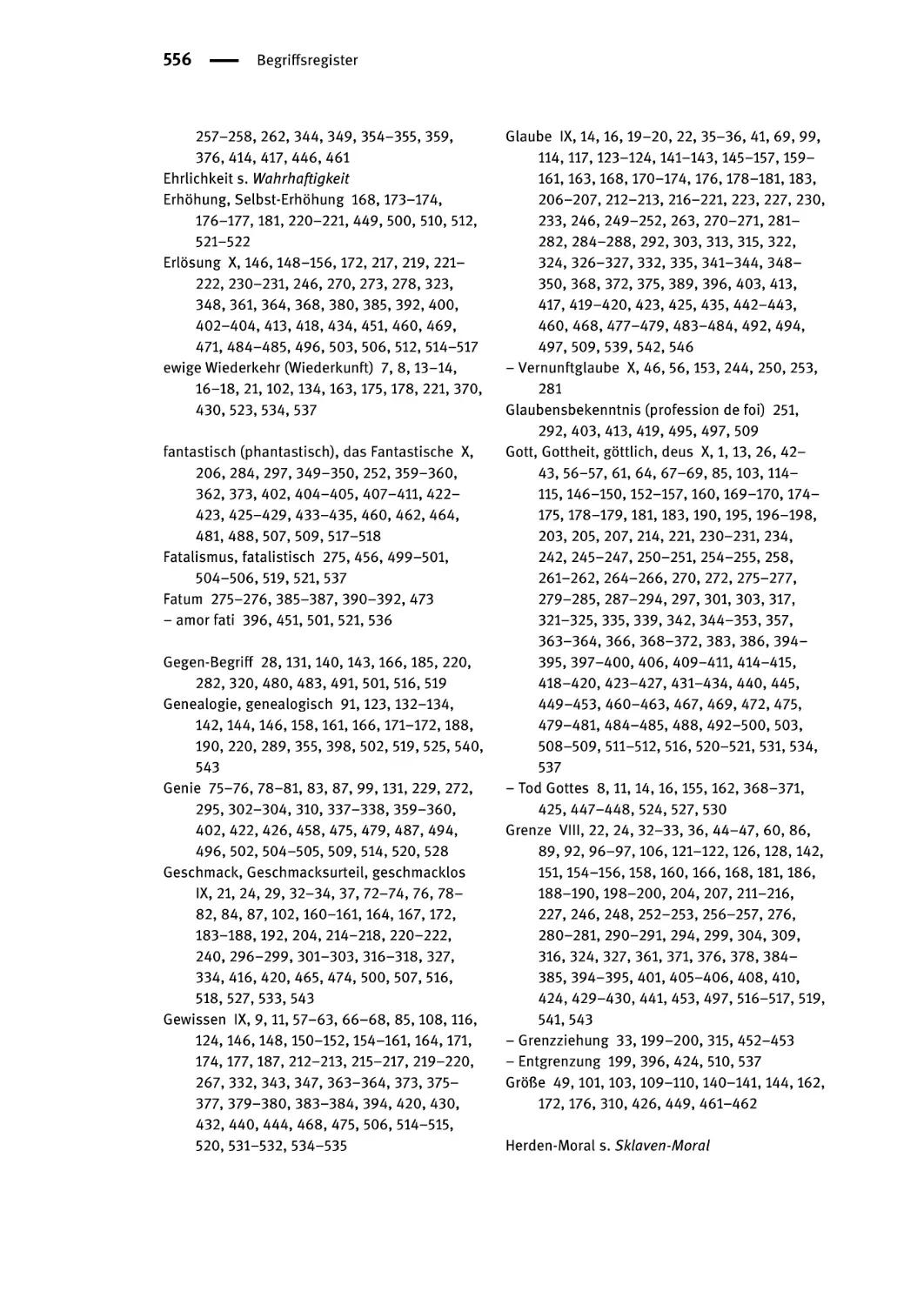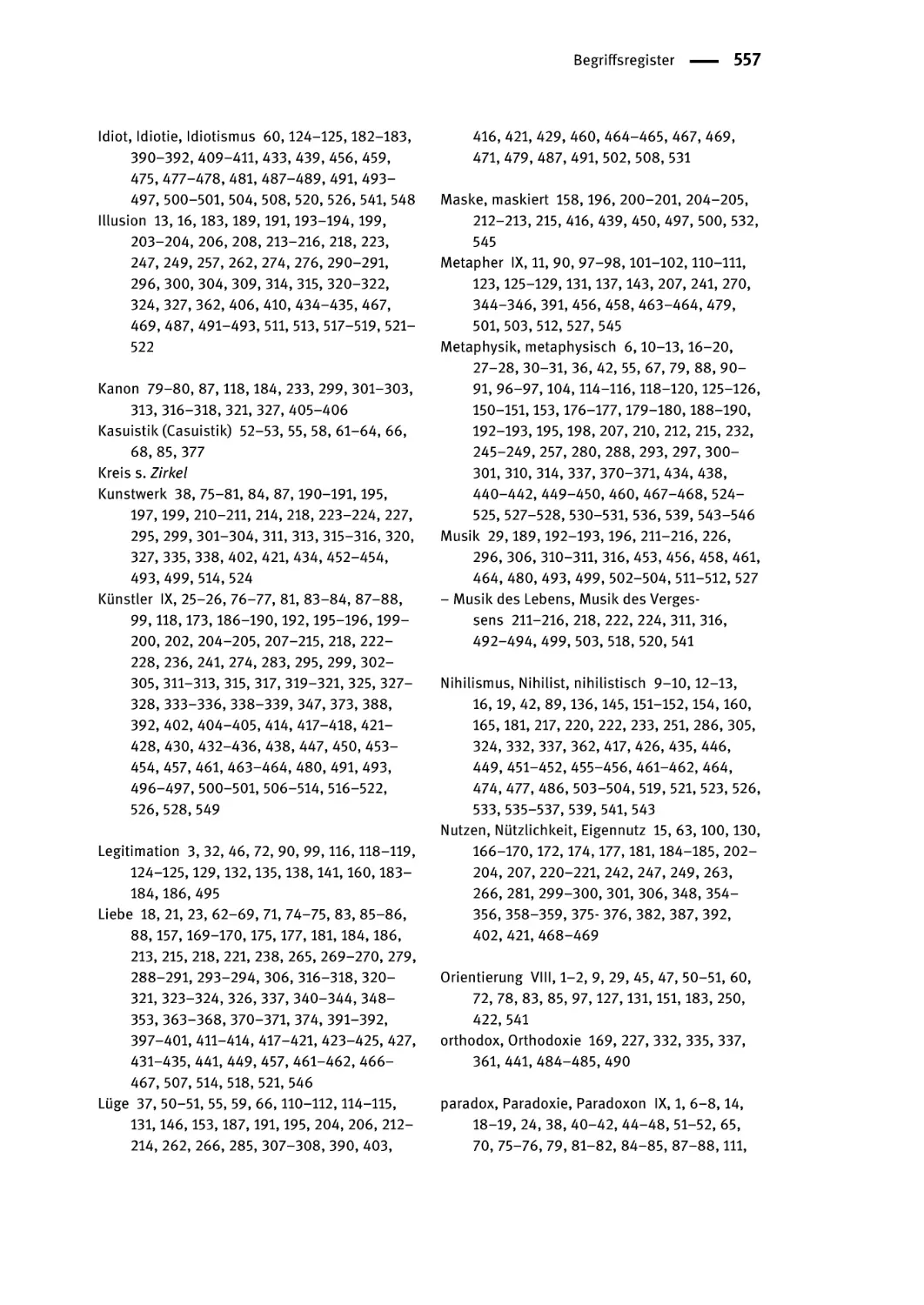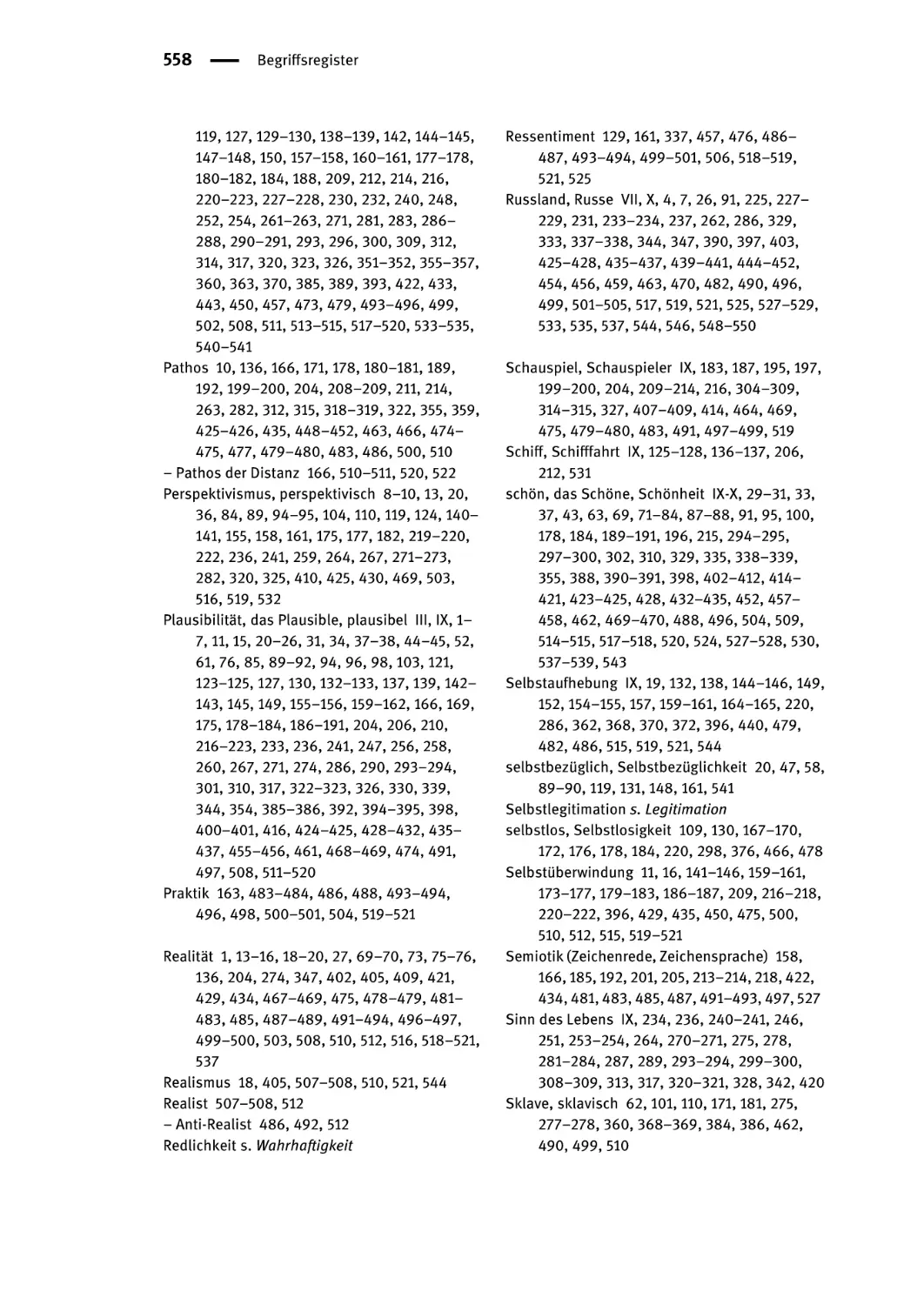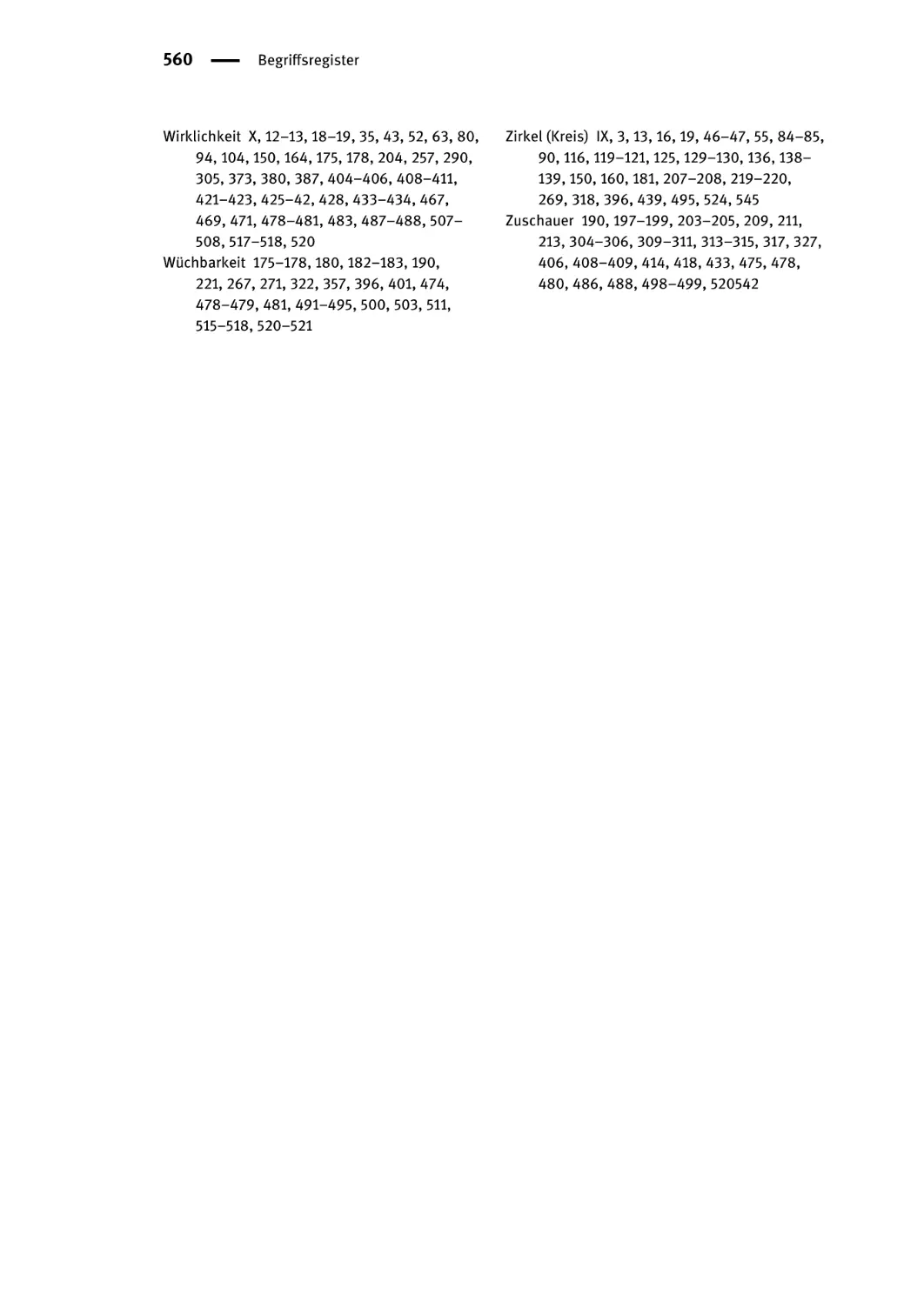Автор: Poljakova E.
Теги: philosophie kunst kunstgeschichte ethik russische literatur ästhetik deutsche klassische philosophie
ISBN: 978-3-11-031507-3
Текст
Ekaterina Poljakova
Differente Plausibilitäten
Monographien und Texte
zur Nietzsche-Forschung
Herausgegeben von
Günter Abel (Berlin) und Werner Stegmaier (Greifswald)
Begründet von
Mazzino Montinari, Wolfgang Müller-Lauter
und Heinz Wenzel
Band 63
Ekaterina Poljakova
Differente
Plausibilitäten
Kant und Nietzsche, Tolstoi und Dostojewski
über Vernunft, Moral und Kunst
ISBN 978-3-11-031507-3
e-ISBN 978-3-11-031519-6
ISSN 1862-1260
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2013 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Satz: jürgen ullrich typosatz, Nördlingen
Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen
♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier
Printed in Germany
www.degruyter.com
Dem Andenken
meines Vaters
Andrej Poljakov
gewidmet, der mich
als Erster für die Philosophie
begeistert hat
Vorwort
Dieses Buch umfasst eine leicht überarbeitete Version meiner Habilitationsschrift, die
ich 2011 bei der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald eingereicht habe. Dass mir als Russin die Habilitation in Deutschland und zumal
im Fach Philosophie gelang, habe ich mehreren günstigen Umständen zu verdanken.
Der wichtigste war, dass ich mich, als ich mein Habilitationsprojekt noch im Rahmen literaturwissenschaftlicher Studien anging, an Werner Stegmaier, den damaligen
Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie in
Greifswald, wandte und daraufhin von ihm eingeladen wurde, meine Studien dort im
Rahmen des Fachs Philosophie fortzuführen. In Greifswald durfte ich die Atmosphäre
eines Philosophierens erleben, die die große Tradition der deutschen Philosophie,
gekennzeichnet durch die Namen Kant und Hegel, aber auch Nietzsche und Luhmann, für mich neu lebendig werden ließ. Der anspruchsvolle und höchst produktive
Gedankenaustausch in einem Kreis von vorwiegend jungen Wissenschaftler(inne)n,
die dort aus aller Welt zusammenfanden, kam meinem eigenen philosophischen
Interesse so sehr entgegen, dass ich schließlich ohne Zögern und Bedauern die mir
vorgezeichnete Bahn einer wissenschaftlichen Karriere in Russland aufgab (ich bekleidete von 1998 bis 2003 eine Stelle an der Russischen Staatlichen Universität für
Geisteswissenschaften in Moskau und hielt Vorlesungen zur Literaturtheorie und
Poetik). Ich begab mich, lange nach meiner Promotion, noch einmal in die Schülerposition und erfuhr auf atemberaubende Weise die Tiefe und Breite der philosophischen Probleme. Auf die Jahre in Greifswald blicke ich nun, nachdem die Habilitationsschrift und die Habilitation abgeschlossen sind, mit Freude und Dankbarkeit
zurück.
Mein besonderer Dank gebührt daher Werner Stegmaier, meinem Lehrer in der
Philosophie. Aber auch ohne die erhebliche finanzielle Hilfe mehrerer Stiftungen
hätte ich diesen Weg nicht gehen können. Ich möchte mich dafür v. a. bei der TrebuthStiftung im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft bedanken, die mich nicht
nur über mehrere Semester unterstützt, sondern auch einen erheblichen Beitrag zur
Publikation dieser Schrift geleistet hat. Ich bedanke mich ferner für die Förderung
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern und den DAAD, die mir mehrere Forschungsaufenthalte in Greifswald ermöglichten. Außerdem bin ich der Klassik Stiftung Weimar zu Dank verpflichtet, die einen meiner ersten Aufenthalte und so auch
den Anfang meiner Forschungsarbeit in Deutschland förderte, und dem Forschungsinstitut für Philosophie Hannover (FIPH), das mir ein halbjähriges Forschungsstipendium zuteil werden ließ, und besonders seinem damaligen Leiter Gerhard Kruip, von
dem ich ebenfalls viel gelernt habe. Ich möchte auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft meinen Dank aussprechen, für die ich zwei Jahre lang als Post-Doc im
Graduiertenkolleg „Kontaktzone Mare Balticum: Fremdheit und Integration im Ostseeraum“ tätig sein durfte. Herzlich danken möchte ich nicht zuletzt Willie Gerloff,
Elisa Neuschulz, Andreas Rupschus und Mathias Schlicht, die in mühsamer Klein-
VIII
Vorwort
arbeit mein Deutsch in diesem Buch vollends in Ordnung gebracht haben. Den
resultierenden Text verantworte ich gleichwohl in vollem Umfang selbst. Schließlich
hat die Ernst-Moritz-Arndt-Universität mir nun durch die Verleihung des Käthe-KluthStipendiums für habilitierte Wissenschaftlerinnen die Möglichkeit eröffnet, mich für
weitere drei Jahre auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Laufbahn vorzubereiten. Dafür danke ich ihr noch einmal sehr herzlich.
Zuletzt noch eine persönliche Bemerkung. Alle vier Denker, von denen dieses
Buch handelt, stellten, seit ich philosophisch zu denken gelernt habe, eine besondere
Herausforderung für mich dar. Von den Schriften Tolstois und Dostojewskis wurde ich
zuvor schon in meiner Kindheit begleitet. In den Studienjahren an der Tartu Universität habe ich Nietzsche für mich entdeckt. Kant erschloss sich mir dann vor allem
in Greifswald. Je mehr ich mich in die Schriften dieser russischen und deutschen
Denker vertiefte, desto mehr wurde ich, immer aufs Neue, von ihnen überrascht und
irritiert. Es war kein rein „wissenschaftliches“ Interesse. Ich habe sie, wie Nietzsche es
von Philosophen forderte, auf mich persönlich wirken lassen, so dass sie in meiner
Lebensorientierung im Ganzen präsent blieben. In meiner kritischen Auseinandersetzung mit ihnen wurde ich jedoch nie wirklich fertig und werde es wohl niemals
werden. Das macht nicht immer Freude. Manche Probleme, die sie gestellt haben,
führen bis heute in immer neue Kontroversen und unlösbare Konflikte, bis in das von
Nietzsche so tief angesetzte und so hoch geschätzte Tragische hinein. Selbst Nietzsche, der den Anspruch, dem Tragischen treu zu bleiben, ausdrücklich an die Philosophen richtete, suchte noch nach Möglichkeiten, ihm wenigstens gelegentlich zu
entgehen. Die Niederschrift eigener Gedanken bietet eine solche Möglichkeit. Und
vielleicht ist dies die einzige Möglichkeit, die Philosophen offensteht. So bin ich
besonders dankbar, dass ich meine Auseinandersetzung mit vier der anspruchsvollsten Denker abschließen konnte und nun den Leser(inne)n vorlegen darf. Abgeschlossen ist sie, wie ich hoffe, nicht in dem Sinn, dass hier ein abstraktes Fazit vorliegt,
sondern weil sie im Gegenteil, wie ich hoffe, auch und gerade das Irritierende,
Lebendige bei jedem der genannten Denker zur Sprache bringt und das Nachfragen
bis an jene Grenzen führt, wo es keine endgültigen Antworten mehr gibt.
Greifswald, den 6. Juni 2013
Ekaterina Poljakova
Inhaltsverzeichnis
Vorwort VI
Siglen XI
Einleitung 1
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft 27
1.1
Die Moral aus Vernunft: Paradoxien und Tautologien
der radikalen Kritik 38
1.2
Die moralische Urteilskraft zwischen dem
„radicalen Bösen in der menschlichen Natur“ und dem
„Heiligsten, was unter Menschen nur sein kann“ 47
1.3
„Ergänzungsstück“ der Moralität und das Ideal der Vollkommenheit 62
1.4
Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol 69
1.5
Zusammenfassung 84
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft 89
2.1
Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts
einer Moral aus Vernunft 96
Die alte und die neue Aufklärung 96
Die große Errungenschaft 103
Das große Umsonst 109
Der große Zirkel: „Vermöge eines Vermögens“ 116
Die Metapher der Schifffahrt 125
2.2
Nietzsches Aufhebung der Moral 129
Die Frage nach dem Wert 129
Vom „Selbstmorde der Vernunft“ zur „Selbstaufhebung
der Moral“ 138
Der christliche Glaube und das intellektuelle Gewissen 146
Vornehmheit des Egoismus und Plausibilität
des Geschmacks 160
2.3
Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens 187
Die Moral aus Vernunft unter der Optik der Kunst 187
Künstler und Schauspieler unter der Optik des Lebens 209
2.4
Zusammenfassung 219
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst 225
3.1
Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens 236
Der Sinn des Lebens 236
Die Natur der Vernunft 238
X
3.2
3.3
3.4
Inhaltsverzeichnis
Vernunftglaube aus dem Lebenstrieb 244
Das Unbegreifliche als Wohl der Vernunft 251
Das Gute in der Perspektive des Lebens 258
„Widerstehe nicht dem Bösen“ 258
Die Freiheit und der Endzweck des Lebens 273
Die wahre Religion versus Geschichten 281
Die gute Kunst 294
Das Gute und das Schöne 294
„Der Geist des Bösen und des Betrugs“: das Theater 301
Die Kunst im Dienste des Lebens: die Einigung der Menschheit 314
Zusammenfassung 322
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft 329
4.1.
„Pro et contra“: Dialektik der Vernunft 339
Revolte gegen Gott und Natur 339
Das vernünftige Zusammenleben und die Logik der Willkür 352
4.2
Ohnmacht des Guten aus Vernunft 372
Das Böse der Unfreiheit 372
Schuld als Befreiung 386
4.3.
Die Schönheit als Erlösung der Welt 402
Die fantastische Wirklichkeit 404
Die Schönheit des Bösen 411
Die rettende Kunst 418
4.4
Zusammenfassung 428
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph 437
5.1
Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick) 437
5.2
Nietzsches Entdeckung der Russen 456
5.3
Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen 465
5.4
Die „Bosheit“ der Russen 499
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 513
Literatur 523
Namensregister 553
Begriffsregister 555
Siglen
Kants Werke, mit Ausnahme der Kritik der reinen Vernunft, werden nach der Ausgabe
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (AA, Berlin, 1900 ff.) zitiert
(Bandnummern und Seitenzahlen in Klammern). Die Kritik der reinen Vernunft wird
nach der ersten (A) und zweiten (B) Auflage (Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1781,
1787, 2003 (Hamburg: Meiner)) zitiert.
Die Abkürzungen der am meisten zitierten Werke Kants sind folgende:
KrV
Kritik der reinen Vernunft
KpV
Kritik der praktischen Vernunft
KU
Kritik der Urteilskraft
GMS
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
MS
Die Metaphysik der Sitten
RGV
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
AH
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht
Nietzsches Schriften werden mit Band- und Seitenangaben nach den folgenden Ausgaben zitiert:
KSA
Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe, hg. von Giorgio Colli und
Mazzino Montinari, Berlin, New York, München: Walter de Gruyter,
dtv, 1980.
KGW
Werke: Kritische Gesamtausgabe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino
Montinari, weitergeführt von Volker Gerhardt, Norbert Miller, Wolfgang Müller-Lauter, Karl Pestalozzi, Berlin, New York: Walter de
Gruyter, 1967 ff., Abteilung IX: Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase,
Michael Kohlenbach, hg. v. Marie-Luise Haase, Martin Stingelin, in
Verbindung mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001 ff.
KGB
Kritische Gesamtausgabe Briefe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino
Montinari, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1975–2004.
Für die am meisten zitierten Werke Nietzsches werden folgende Abbreviaturen verwendet:
AC
Der Antichrist
EH
Ecce homo
EH Bücher
Warum ich so gute Bücher schreibe
EH klug
Warum ich so klug bin
EH Schicksal
Warum ich ein Schicksal bin
EH weise
Warum ich so weise bin
FW
Die fröhliche Wissenschaft
XII
GD
GM
GT
JGB
M
MA
NW
PHG
UB
VM
WA
WL
WS
Z
Siglen
Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt
Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift
Die Geburt der Tragödie
Jenseits von Gut und Böse
Morgenröthe
Menschliches, Allzumenschliches
Nietzsche contra Wagner
Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen
Unzeitgemässe Betrachtungen
Vermischte Meinungen und Sprüche
Der Fall Wagner
Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne
Der Wanderer und sein Schatten
Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen
Tolstoi und Dostojewski werden nach den entsprechenden deutschen Übersetzungen
zitiert. In den Fällen, in denen keine deutsche Übersetzung vorliegt, werden Tolstois
bzw. Dostojewskis Werke, Briefe, Tagebücher und der Nachlass in meiner Übersetzung nach den folgenden Standard-Ausgaben angegeben:
TGA:
Лев Николаевич Толстой, Полное собрание сочинений, в 90 томах (Юбилейное издание), (Gesamtausgabe, (Jubiläumsausgabe)),
Москва, Ленинград: Худ. лит., 1935–1958;
DGA:
Федор Михайлович Достоевский, Полное собрание сочинений,
в 30 томах, (Gesamtausgabe), Ленинград: Наука, 1972–1990.
Alle Hinweise stehen in Klammern (Band, Seite).
Einleitung
Das Wort „Plausibilität“ steht selten im Plural. In manchen Sprachen ist es überhaupt
unmöglich von „Plausibilitäten“ zu sprechen, z. B. in der russischen. Im Deutschen
spricht man von der Plausibilität einer These, wenn man ihr spontan zustimmt bzw.
wenn sie keiner weiteren Begründung bedarf. Das Plausible scheint dabei nur eine
sinnvolle Alternative zu haben – das Unplausible, das, von dem man auch nach
Begründungen nicht überzeugt ist. Wenn dies der Fall ist, nützen keine Gegenargumente. „Dies ist mir nicht plausibel“ fungiert selbst als letztes Argument: Man
entzieht einer These seine Zustimmung und weist auf eine Alternative hin, die sich
ihrerseits auf ihre Plausibilität beruft. Doch die Plausibilität einer These ist nicht ihre
Evidenz. Zuletzt ist der Begriff paradox. Denn vom Plausiblen spricht man, als ob es
selbstverständlich wäre, und dennoch ist Plausibilität, indem sie behauptet wird,
nicht mehr selbstverständlich. Ist etwas plausibel, braucht man es gerade nicht zu
behaupten. Man wird jedoch eventuell dazu genötigt – wenn es auf die Alternativen
ankommt, wenn man also mit verschiedenen „Plausibilitäten“ konfrontiert wird.
Der Begriff der Plausibilität wurde als philosophischer Begriff von Werner Stegmaier eingeführt.1 Philosophische Wörterbücher und Enzyklopädien führen ihn dagegen nicht als Stichwort. Auf diesen Mangel weist Stegmaier gerade hin. Plausibilitäten seien weder Evidenzen noch Prämissen.
Als selbstverständliche werden Plausibilitäten nicht artikuliert, nicht explizit gemacht. Sie werden fraglos vorausgesetzt. Werden sie erst artikuliert, werden sie damit Nachfragen ausgesetzt
und dadurch fraglich.2
Unter dem philosophischen Begriff der Plausibilität wird damit, im Unterschied zum
alltäglichen Sprachgebrauch, nicht bloß das Plausible einer These verstanden, sondern eine gewisse Annahme, ein Anhaltspunkt der Orientierung im Denken,3 eine
Grundgewissheit, die selbst als These formuliert werden könnte, wenn sie nicht schon
1 Werner Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 14 ff. Hier wird u. a. auf die philosophische Vorgeschichte des Begriffs hingewiesen, v. a. auf den Ausdruck „Bewertungsstufen von Plausibilität“ bei
Peirce und seine indirekte Beschreibung bei Wittgenstein. S. Charles Sanders Peirce, Ein vernachlässigtes Argument für die Realität Gottes, S. 343 ff.; Ludwig Wittgenstein, Werkausgabe, Bd. 8, S. 137.
2 Werner Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 15.
3 Eine philosophische Explikation des Orientierungsbegriffs ist der eigentliche Gegenstand der Untersuchung von Stegmaier. Er wird als „ein Letzt- und Grundbegriff“ verstanden, der jedem Denken und
jeder Lebenstätigkeit überhaupt vorausgeht und sie ermöglicht. Denn indem er selbst keine Definition
braucht, wird er für Definitionen anderer Begriffe herangezogen (Werner Stegmaier, Philosophie der
Orientierung, S. XV f.). Das breite Spektrum des Sich-Orientierens und des Orientiert-Seins im Denken,
die Bedingungen und Strategien der Orientierung im Alltag, deren Ziel es ist, das Grundproblem der
Orientierung, die Ungewissheit, zu bewältigen, werden von Stegmaier in die Perspektive der Philosophiegeschichte gestellt und im Blick auf die aktuellen philosophischen Fragestellungen systematisch untersucht. Als wichtiger Anhaltspunkt für die philosophische Deutung des Begriffs wird Kants
2
Einleitung
als selbstverständlich vorausgesetzt wäre. Das Selbstverständliche in ihr ist aber
gerade der blinde Fleck der Argumentation, dessen Bedeutsamkeit von diesem Unausgesprochen-Lassen abhängig ist. Der Gegensatz zum philosophischen Begriff der
Plausibilität ist somit nicht das Unplausible, sondern das Thematisierte und Begründbare. Denn indem die These ausgesprochen bzw. begründet wird, wird auch die
Möglichkeit des Bezweifelns angedeutet. Die so verstandene Plausibilität kann nicht
bloß in den Plural gestellt werden, sondern erhält nur im Plural ihre Bedeutung – als
alternative Plausibilitäten, die gegeneinander ausgespielt und dennoch in ihren Kontroversen nicht aufgehoben werden können. Indem eine Plausibilität expliziert wird,
weist sie unvermeidlich auf Alternativen hin.
Auf eine Plausibilität kann man darum nur durch den Zusammenstoß verschiedener Positionen aufmerksam werden. Sie ist jedoch auch dann schwer einzusehen, da
ihre Plausibilität sich durch das Zusammenstoßen gerade verschiebt. Die Kontroversen zwischen den Plausibilitäten liegen niemals auf der Hand, sondern sind nur durch
feine Prozesse des „Zerstreuens“ und „Verschiebens“ der Unterscheidungen, u. a.
auch der Unterscheidung zwischen Plausiblem und Nicht-Plausiblem, wahrnehmbar.
Eine Untersuchung der Plausibilitäten strebt dementsprechend nicht die Destruktion
bzw. die Deplausibilisierung von Plausibilitäten (dafür fehlt eine übergreifende Perspektive) an, sondern ihre Dekonstruktion bzw. die Rekonstruktion der nicht-vorhersagbaren Folgen bestimmter Annahmen für den auf ihrer Grundlage entstandenen
Diskurs.4 Die so verstandene Dekonstruktion kann sich für eine systematische Untersuchung mehrerer Optionen des jeweiligen Problems gerade als besonders fruchtbar
erweisen.
Wie der Titel dieser Untersuchung besagt, wird hier von „Plausibilitäten“ die
Rede sein, und noch dazu von „differenten“ Plausibilitäten. Damit ist einerseits die
Pluralität unausgesprochener Annahmen angedeutet, deren Selbstverständlichkeit
von ihrer fraglosen Voraussetzung abhängt, andererseits aber auch die Schwierigkeit,
diese Pluralität aufzudecken. Sie zeigt sich erst in einem Dialog bzw. durch eine
Auseinandersetzung mehrerer Perspektiven, unter denen ein Problem, in unserem
Fall die Kritik einer Moral aus Vernunft, gesehen wird, und selbst dann öfters nur als
latente Ausdifferenzierung, deren sich die Beteiligten selbst nicht immer bewusst
sind. Denn der Fluchtpunkt ihres Denkens liegt in den Voraussetzungen, die für
dieses Denken selbst unsichtbar bleiben. Die philosophische Interpretation eines
solchen Dialogs kann sich daher nicht bloß mit der Feststellung der Übereinstimmung
bzw. mit der des Unterschieds der jeweiligen Positionen begnügen. Ihre Aufgabe ist
eine Rekonstruktion derjenigen Optionen, die im wirklichen Dialog, d. h. in einer
Schrift Was heißt: Sich im Denken orientiren? (1786) angesehen, in der die Orientierung im Denken als
primäres Bedürfnis der Vernunft, als Bedingung ihrer Selbsterhaltung gedeutet wurde.
4 Die Begriffe des „Zerstreuens“ (dissémination) und des „Verschiebens“ (déplacement) sowie der
Dekonstruktion sind hier im Sinn von Jacques Derrida zu verstehen. Vgl. Jacques Derrida, La dissémination; Jacques Derrida, Marges de la philosophie.
Einleitung
3
durch historisch-philologische Forschung nachgewiesenen Rezeptionsgeschichte,
eventuell nicht vollständig realisiert wurden. Ihr Ziel ist, die unauffälligen Differenzen
der Anhaltspunkte bzw. der unausgesprochenen grundlegenden Prämissen herauszuarbeiten, die für die Verschiedenheit der Positionen und ihre Auseinandersetzungen sorgt. Übereinstimmungen und Kontroversen in Argumentationen können irreführend sein, weil die ihnen innewohnenden Plausibilitäten different bzw. nicht
völlig unterschiedlich, aber auch nicht identisch sein können, insofern gerade über
sie nicht diskutiert wird.
Im Fokus der vorliegenden Untersuchung steht der Dialog, der am Ende des
19. Jahrhunderts zwischen einigen der prominentesten deutschen und russischen
Denker über den kritischen Ansatz in der Moralphilosophie geführt wurde. Die Aufgabe der Selbstlegitimation der aufgeklärten Vernunft und die Kritik einer Moral, die
aus dieser Vernunft begründet wird, ist mit dem Namen verbunden, der gleichzeitig
einen Wendepunkt in der abendländischen Philosophie kennzeichnet – dem Immanuel Kants. Denn die Moral wurde bei Kant nicht bloß aus Vernunft, sondern durch
die Kritik des ganzen Vermögens der Vernunft legitimiert und vervollkommnet. Kants
kritischer Ansatz beanspruchte damit (ohne den Begriff selbst zu verwenden) über
alle Plausibilitäten des Denkens aufzuklären. Nur der kritische Weg bleibe der Philosophie überhaupt noch offen (KrV B 884). An diesem ungeheuren Anspruch der
Kritik, am Ansatz der Moral aus Vernunft, wurde gleichwohl deutlich, dass auch sie
gegen gewisse Prämissen blind bleiben musste. Sie nötigte zur weiteren Kritik – an
der Plausibilität ihrer Plausibilitäten.
Als größter Entdecker der Plausibilitäten, nicht nur der Kants, sondern über Kant
hinaus der Plausibilitäten des christlich-abendländischen Denkens, ging Friedrich
Nietzsche in die Philosophiegeschichte ein. Er nannte sie Vorurteile, betonte aber,
dass er, im Unterschied zum alten aufklärerischen Ansatz, der gegen unmündige
Meinungen und den Aberglauben gerichtet war und sie mit dem Licht der Vernunft
bekämpfte, sich mit den „Vorurtheilen der Philosophen“ (JGB 1, KSA 5, S. 15) konfrontieren musste. Er behauptete, dabei in mehreren Hinsichten der Erste zu sein und
das Auge für die Probleme zu haben, denen sich anzunähern noch niemand gewagt
habe, z. B. habe noch niemand vor ihm den Wert des Willens zur Wahrheit als Problem angesehen. Seine Kritik an der Moral aus Vernunft präsentierte er als die
radikalste Kritik überhaupt, die den Begriff der Philosophie verändern sollte.
Mit seiner Aufgabe der Umwertung der Werte des christlichen Abendlandes stieß
Nietzsche auf jenes Denken, das einerseits aus der Sicht der sokratisch-kantischen
Philosophie als befremdend anders, irritierend-irrational angesehen wurde, aber
andererseits aus der Sicht seiner Kritik an der Moral aus Vernunft gerade als Ausweg
aus dem Zirkel der Selbstlegitimation, als neuer Anfang verstanden werden konnte –
auf die russische Moralphilosophie. Er ließ sich von den russischen Autoren faszinieren. Die Begeisterung über die Seelenverwandtschaft mit ihnen übte bekanntlich
einen erheblichen Einfluss auf sein späteres Denken aus, was besonders im Antichristen zu spüren ist. Als Leser Tolstois und Dostojewskis war Nietzsche allerdings
4
Einleitung
nicht bloß ein begeisterter Rezipient ihrer Ideen. Er war auch derjenige, der sie bis zu
einem Punkt uminterpretierte, an dem sie eine neue Bedeutung erhielten – die Bedeutung von Alternativen zum sokratisch-kantischen Denken. Besonders bei seiner Dostojewski-Lektüre ist diese Umdeutung bemerkenswert, denn die auffallenden Gemeinsamkeiten zwischen beiden weisen zugleich auch stets auf Differenzen zwischen
ihnen hin.
Auch in der russischen Philosophie ist Nietzsches Faszination und Umdeutung
nicht unbemerkt geblieben. Seine Kritik der Moral hat zwar ebenfalls Begeisterung
ausgelöst, doch wurde er seinerseits vor dem Hintergrund der Philosophie Tolstois
und Dostojewskis, der zwei unumstritten größten moralischen, aber auch philosophischen Autoritäten Russlands um die Jahrhundertwende, rezipiert. Er wurde bald als
eine von vielen Stimmen in Dostojewskis pluralistisch gespaltener, polyphoner Welt,
bald als eigentlicher Gegner von Tolstois christlichem Rationalismus, bald als Erneuerer der mystischen Religiosität gedeutet. Tolstoi selbst, der sich als Nachfolger Kants
verstand, aber auch von Schopenhauer und noch viel stärker von Spinoza beeinflusst
wurde, schätzte Nietzsche wenig und hielt ihn für einen bösen Wahnsinnigen, bis zu
dem Moment, in dem er auf einen (durch dreifache Übersetzung ziemlich verzerrten)
Auszug aus Nietzsches Nachlass stieß, in welchem dieser Tolstois eigenen Traktat
Was ist mein Glaube? wiedergab. Erst später wurde Tolstoi klar, dass es sich kaum um
eine zufällige Übereinstimmung, sondern höchstwahrscheinlich um das Ergebnis der
Rezeption handelte. Den Erinnerungen seines Freundes und Nachfolgers Makowitski
zufolge fragte er einmal, ob Nietzsche ihn gelesen hatte, denn er glaubte, seine
eigenen Formulierungen in der Publikation wiederzuerkennen (TGA 42, S. 622). Der
Zweifel war allerdings mehr als angemessen, denn seine Gedankengänge, zwar zum
Teil erkennbar, erfuhren bei Nietzsche eine solche Umwandlung, dass sie jetzt befremdend, wenn nicht gar anstößig auf ihren Urheber wirkten. Aber eben so verhielt
es sich auch mit Tolstois eigener Interpretation Kants, seiner Deutung einer Moral aus
Vernunft, seiner „christlichen“ Lehre. In seinen letzten Schlussfolgerungen strebte
Tolstoi eine Übereinstimmung mit den Denkern an, die ihm in ihren Prämissen gerade
fremd bleiben mussten. Mit Nietzsche dagegen – obwohl die Divergenzen auf der
Hand lagen – kam es unerwartet zu gelegentlichen Übereinstimmungen der unausgesprochenen Anhaltspunkte.
Solche Widerspiegelungen und Umdeutungen bieten gerade kostbares Material
für die Untersuchung der jeweiligen Plausibilitäten. Dank ihnen werden die Spielräume sichtbar, in denen das Denken sich bewegt, indem es mal zur Übereinstimmung,
mal zu scharfen Kontroversen kommen kann, v. a. aber zu einem produktiven Ideenaustausch, zu einem „Gipfelgespräch“ der prominentesten europäischen Denker.
Durch die Rekonstruktion dieser deutsch-russischen Reflexionen zwischen Kant,
Nietzsche, Tolstoi und Dostojewski sollen nicht nur deren eigene Plausibilitäten ans
Licht kommen, sondern auch die Optionen der Moralkritik sollen gezeigt werden –
einer Moralkritik, die sich als neuer Anfang in der Moralphilosophie versteht und
neue Anhaltspunkte für die Philosophie sucht.
Einleitung
5
Die Aufgabe, die sich dieses Buch stellt, ist darum v. a. als systematisch-philosophische zu verstehen. Es handelt sich, das sei betont, nicht um einen „realen“,
sondern um einen rekonstruierten Dialog. Denn Dostojewski las höchstwahrscheinlich weder Kant noch Nietzsche. Nichtsdestoweniger ist denjenigen Forschern Recht
zu geben, die ihn als Opponenten und Gesprächspartner beider betrachten. Auch
Nietzsches Kenntnisse der beiden russischen Schriftsteller waren nicht vollständig, so
wie sich Tolstois Nietzsche-Lektüre auf Also sprach Zarathustra, den Antichrist und
einige Seiten seiner Nachlassnotate beschränkte. Das Ausmaß der Bekanntschaft
Nietzsches mit Kant ist bis heute eine umstrittene Frage. Die entsprechenden philologisch-historischen Probleme werden in den jeweiligen Kapiteln berücksichtigt. Der
systematischen Untersuchung wird aber in der Reihenfolge, in welcher die Probleme
angegangen werden, der Vorrang gegeben. Das heißt, dass der jeweilige moralkritische Ansatz zuerst auf seine Plausibilitäten hin untersucht und erst im zweiten Schritt
die jeweilige Rezeption dargestellt wird. Das Fortschreiten von einer systematischen
zu einer historisch-philologischen Fragestellung kann für die Untersuchung der Rezeption ungewöhnlich scheinen und bedarf einer vorläufigen Begründung, die, wie
ich hoffe, durch den Gang der Untersuchung bekräftigt wird. Mein methodisches
Postulat lautet: Vor dem Hintergrund einer systematischen Rekonstruktion der philosophischen Auseinandersetzung zwischen großen Denkern kann der historischen
Frage nach der Rezeption viel produktiver und mit größerem philosophischem Gewinn nachgegangen werden. Und das nicht nur, weil es in diesem Bereich unlösbare
Fragen gibt und auch eine historisch bewiesene Bekanntschaft noch keine tiefe
Rezeption bedeutet, sondern auch und vor allem, weil nur eine systematische Auseinandersetzung die in Frage stehenden Plausibilitäten auffinden und die grundlegenden philosophisch-kulturellen Differenzen als Ausgangspunkte der jeweiligen
Rezeption darstellen kann. Nietzsches Lektüre bspw. zeigt, was er tatsächlich von den
russischen Autoren las. Aber nur die philosophisch-systematische Analyse kann
zeigen, was bei der Lektüre wichtig bzw. unwichtig war, und was er dabei höchstwahrscheinlich übersehen hat. Auch nachgewiesene Übereinstimmungen in der Rezeption können sich bei näherer Betrachtung als Missverständnisse herausstellen.
Darum scheint es folgerichtig, zuerst auf die wichtigsten Voraussetzungen des Dialogs
systematisch einzugehen, um danach die historisch-philologische Frage in Betracht
zu ziehen und sie für die systematische Untersuchung der Plausibilitäten wiederum
fruchtbar zu machen.
Der Ansatz dieses Buches ist darüber hinaus grundsätzlich von demjenigen zu
unterscheiden, dem manche Forschungsarbeiten folgen, die die Widersprüche, Inkonsequenzen und Mängel der untersuchten Texte herausarbeiten. Dies wäre keine
Untersuchung der Plausibilitäten im hier gemeinten Sinne. Schon deshalb nicht, weil
es sich oft nicht um die Voraussetzungen, sondern um Schlussfolgerungen und noch
öfter um die von dem jeweiligen Autor deutlich ausgesprochenen Unterscheidungen
handelt. Vielmehr stellen die Untersuchungen dieser Art Versuche dar, das jeweilige
Denken einer bestimmten (größtenteils als fortschrittlich angesehenen) Perspektive
6
Einleitung
zuzuordnen, die den Aufgaben, die sich jenes Denken setzte, umso weniger gerecht
werden kann.5 Die Untersuchung der Plausibilitäten hütet sich daher vor Widersprüchlichkeits-Annahmen und bemüht sich darum, scheinbare Widersprüche als
aus dem ursprünglichen Ansatz bzw. als aus unausgesprochenen Voraussetzungen
folgende Schwierigkeiten und gewollte Paradoxien zu interpretieren. Dies ist eine
methodische Annahme, keine These, die begründet werden könnte. Sie scheint allerdings ein produktiverer Ansatz zu sein. Denn mit der Annahme der Widersprüchlichkeit übersieht man öfters gerade die Schwierigkeiten, mit denen sich der jeweilige
Denker auseinandersetzte. Auch Paradoxien dürfen nicht als Mangel bzw. als zu
vermeidende und auszugleichende Widersprüche betrachtet werden.6 Sie gelten vielmehr als Anhaltspunkte der Untersuchung, inwiefern die Plausibilitäten die Leitunterscheidungen bestimmen und für die Beweglichkeit der letzteren sorgen.7 Die so
verstandenen Plausibilitäten einer Philosophie sind aus der Perspektive anderer
5 Ein anschauliches Beispiel für eine solche Herangehensweise stellt die Untersuchung von Ernst
Topitsch, Die Voraussetzungen der Transzendentalphilosophie. Kant in weltanschauungsanalytischer
Beleuchtung, dar. Diese durchaus anregende Untersuchung handelt zwar auch von den „unausgesprochenen Voraussetzungen“, dennoch werden mit letzteren gerade Schwierigkeiten und „mannigfache
Widersprüche“ gemeint (S. 215). Am Ende stellt sich heraus, dass der proklamierte Mangel an kritischem Geist bei Kant in den bestimmten Schlussfolgerungen besteht, die weltanschaulich zu sehr in
der antik-christlichen Metaphysik verwurzelt sind, was der Autor gerade missbilligt und als überholt
ansieht. Aus diesem Grund beurteilt er Kants Transzendentalphilosophie als gescheitert – eine
Schlussfolgerung, zu der man nur gelangen kann, wenn man Kant bestimmte Ziele stillschweigend
unterstellt, die dieser aber womöglich gar nicht verfolgte. Vgl. die These, dass Kants „transzendentalidealistische Erkenntnislehre schon im Ansatz gescheitert“ sei (S. 213 ff.). „Ein fatales Ergebnis“, so
Topitsch (S. 220), wobei allerdings zu fragen wäre, ob eine „kathartische[ ] Weltüberwindung“ (S. 215)
tatsächlich zu Kants Aufgaben gezählt werden kann. Auch Untersuchungen, die auf den ‚Schlüssel‘
einer jeweiligen Philosophie hinweisen, z. B. das weiter nicht begründbare und dennoch unausbleibliche „Faktum der Vernunft“ in Kants Transzendentalphilosophie, sind einem anderen Ansatz der
Forschung verpflichtet als der meinige. Ihnen ist zwar Recht zu geben, insofern das Faktum als „Stein
der Weisen“ bzw. als tragendes Element der Philosophie Kants zu verstehen ist (Dieter Henrich, Der
Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft), dennoch handelt es sich dabei
um eine Annahme, die, wie in diesem Fall, von Kant selber ausgesprochen und als Grundvoraussetzung für seine Begründung der Moral aus Vernunft angesehen wurde.
6 Z. B. im Hinblick auf das Paradoxon des Allgemeingültigkeitsanspruchs ästhetischer Urteile, das uns
im Kant-Kapitel noch beschäftigen wird, bemühen sich mehrere Forscher, Kants Begründung desselben entweder zu bestätigen oder abzulehnen. So konstatieren etwa Jens Kulenkampff (Kants Logik des
ästhetischen Urteils) und Ferdinand Fellmann (Der Geltungsanspruch des ästhetischen Urteils. Zur Metapsychologie des ästhetischen Erfahrung,) das Scheitern, Andreas Heinrich Trebels (Einbildungskraft und
Spiel) und Ulrich Müller (Objektivität und Fiktionalität. Überlegungen zur Kritik der Urteilskraft) hingegen das Gelingen des Begründungsvorgangs. Diese und ähnliche Diskussionen sind zwar für mein
Anliegen von Bedeutung, jedoch nicht grundlegend. Die Untersuchung der Plausibilitäten betrachtet
solche Ausführungen über das Scheitern bzw. das Gelingen einer Argumentation als Folge einer in den
eigenen Plausibilitäten verharrenden Fragestellung.
7 Der Begriff der Paradoxie wird im Kant-Kapitel näher erörtert (s. bes. die Anm. 52). Zum philosophischen Umgang mit Paradoxien, die eine das Denken erweiternde Funktion haben, indem durch sie
Einleitung
7
Plausibilitäten bzw. anderer Traditionen, die sie gerade als nicht plausibel betrachten, am besten zu erkennen. So werden Kants Plausibilitäten durch Nietzsches Kritik,
aber auch durch die begeisterte Kant-Rezeption Tolstois und die Ablehnung kantischer Voraussetzungen bei Dostojewski sichtbar.
Es dürfte schon klar geworden sein, dass im Mittelpunkt dieser Untersuchung
differenter Plausibilitäten und der dadurch angestrebten philosophischen Interpretation des großen deutsch-russischen Dialogs über die Kritik einer Moral aus Vernunft
Nietzsche stehen soll, als derjenige, der die Plausibilitäten des Abendlandes mit
denen Russlands konfrontieren wollte. Während Kants Kritik der Erkenntnisansprüche der Vernunft deren Fundamente absichern sollte, zielte Nietzsches Kritik des
Willens zur Wahrheit gerade auf diese Fundamente, nicht um sie bloß zu destruieren,
sondern um sie als nicht-alternativlose Entscheidungen darzustellen. So versteht sich
die Untersuchung der Plausibilitäten des großen Dialogs zwischen Deutschland und
Russland vor allem als ein Beitrag zur Nietzsche-Forschung. Die Fokussierung auf
Nietzsches Denken soll eine Beschränkung des umfangreichen Materials ermöglichen
und begründen. Besonders Kant, aber auch Tolstoi und Dostojewski werden v. a. in
der Perspektive von Nietzsches Kritik der abendländischen Moral gelesen. Nietzsches
philosophischer Ansatz soll seinerseits aus der Perspektive seiner Auseinandersetzung mit Kant und den russischen Denkern neu beleuchtet werden.
Als Beitrag zur Nietzsche-Forschung muss diese Untersuchung gleich zu Beginn
zu deren grundlegenden Problemen Stellung nehmen. Seit Anfang der 70er Jahre,
als man in einem der ersten Bände der Nietzsche-Studien konstatierte, „daß die
Nietzsche-Forschung unter dem Eindruck von Werken steht, die ihren Ursprung in
den 30er Jahren haben“,8 hat sich die Situation wesentlich geändert. Gemeint waren
vor allem die großangelegten Nietzsche-Interpretationen von Karl Löwith, Karl Jaspers und Martin Heidegger.9 Nicht nur ihre Werke, auch die spätere Neuentdeckung
Nietzsches durch Michel Foucault, Gilles Deleuze und Jacques Derrida gehört heute
zum grundlegend verarbeiteten Erbe.10 Sie hat der Nietzsche-Forschung einen mächtigen Anstoß gegeben.11 Eine philosophische Interpretation darf heute nicht mehr
neue Spielräume entdeckt werden können, s. Werner Stegmaier, Nietzsches Begriffe, Paradoxien und
Antinomien.
8 Peter Köster, Die Problematik wissenschaftlicher Nietzsche-Forschung, S. 32.
9 Karl Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen; Karl Jaspers, Nietzsche.
Einführung in das Verständnis seines Philosophierens; Martin Heidegger, Nietzsches Lehre vom Willen
zur Macht als Erkenntnis.
10 Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie; Jacques Derrida, L’Éperon: les styles de Nietzsche; Michel
Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire.
11 Man denke z. B. an die Veröffentlichung der großen Diskussionen in den Bänden 8 (1979) und 10/11
(1981/1982) der Nietzsche-Studien. Ein gewisses Fazit wurde schon am Ende der 70er Jahre gezogen.
S. Eugen Biser, Das Desiderat einer Nietzsche-Hermeneutik. Diese Publikation stellt eine der ersten
umfassenden methodischen Reflexionen über die Nietzsche-Forschung dar. Einerseits versuche man,
so Biser, einen zentralen Gesichtspunkt auf Nietzsches Philosophie zu gewinnen und so die „Spannun-
8
Einleitung
oberflächlichen Ideologisierungen bzw. Widerlegungen Nietzsches verfallen,12 v. a.
nicht dem Vorurteil, er sei bloß Dichter und kein ernsthafter Philosoph gewesen oder
seine Philosophie sei voller Widersprüche.13 Ebenso wenig kann sie sich Reduktionen
auf schlichte Formeln leisten. Nach Wolfgang Müller-Lauter14 und Friedrich Kaulbach15 sind Nietzsches berühmte Lehren des Willens zur Macht, des Übermenschen,
der ewigen Wiederkunft, des Todes Gottes entschieden perspektivisch zu deuten. Laut
Werner Stegmaier sind sie als „Anti-Lehren“ zu verstehen, die auf die Unmöglichkeit
der Verallgemeinerung, auf die Unvereinbarkeit der Perspektiven hinweisen und,
werden sie als positive Lehrsätze formuliert, paradox werden müssen.16 Die skrupulöse philologische Arbeit, die von Giorgio Colli und Mazzino Montinari angefangen und
von Marie-Luise Haase und ihrer Arbeitsgruppe weitergeführt wird, mündete in der
heute für jeden Nietzsche-Forscher unerlässlichen Edition des so lange umstrittenen
Nachlasses Nietzsches. Die neunte Abteilung der Kritischen Gesamtausgabe, die eine
topographische Wiedergabe der Notizhefte Nietzsches darstellt, lässt u. a. keine Möglichkeit mehr, vom Willen zur Macht als Nietzsches Hauptwerk zu sprechen.17 Die
gen und Brüche“ in seiner „Ideenlandschaft“ auszugleichen, andererseits will man die „‚Logik‘ seiner
Widersprüche und Zielsetzungen“ rekonstruieren (S. 36 f.).
12 Die in den 30er Jahren erfolgte Ideologisierung Nietzsches und deren Aufnahme in der desavouierenden Kritik z. B. bei Georg Lukács (vgl. Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des
deutschen Irrationalismus von Schelling bis Hitler) wurde zu einem erheblichen Hindernis für eine
ernsthafte philosophische Auseinandersetzung, das nur schwer zu überwinden war. Auch Thomas
Mann hat mit seiner berühmten Rede (1947), wenn auch auf viel raffiniertere Weise, zur vereinfachten
Deutung Nietzsches beigetragen, indem er von Nietzsches Irrtümern, z. B. der Diskreditierung aller
Mitgefühle, sprach. Vgl. Thomas Mann, Nietzsche Philosophie im Lichte unserer Erfahrung. Zur Geschichte der De-Ideologisierung Nietzsches s. z. B. Karl Pestalozzi, Nietzsches Wiederkunft.
13 Vgl. z. B. die These Löwiths, man könne bei Nietzsche „im einzelnen finden, was immer man finden
will“, weil er kein System entwickelte, sondern in Aphorismen schrieb, die voller Widersprüche sind
(Karl Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, S. 210). Allerdings sprach Löwith auch von dem „Abgrund“, der
Nietzsche von seinen letzten Verkündern trennt“ (S. 218).
14 Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsche. Zur Bedeutung Müller-Lauters für die Nietzsche-Forschung s.
Werner Stegmaier, Wolfgang Müller-Lauters Nietzsche-Interpretation.
15 Friedrich Kaulbach, Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie; Friedrich Kaulbach, Autarkie
der perspektivischen Vernunft bei Kant und Nietzsche.
16 S. dazu Werner Stegmaier, Nietzsches Lehren, Nietzsches Zeichen; auch Werner Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 15 ff.
17 Vgl. Heideggers berühmte These, Nietzsches eigentliche Philosophie sei als „Nachlaß“ zurückgeblieben (Martin Heidegger, Nietzsche, Bd. 1, S. 17). Zur dramatischen Geschichte der Entstehung und
Rezeption dieses durch eine Kompilation entstandenen ‚Hauptwerks‘ Nietzsches s. Wolfgang MüllerLauter, „Der Wille zur Macht“ als Buch der ‚Krisis‘ philosophischer Nietzsche-Interpretation. Aber auch
als die Verfälschung von Nietzsches ‚Hauptwerk‘ entdeckt wurde, konnten Nietzsche-Forscher nicht
gleich darauf verzichten, es als Quelle ihrer Interpretationen zu verwenden. So stand Müller-Lauter
noch keine wissenschaftlich zuverlässige Publikation von Nietzsches Nachlass zur Verfügung (vgl.
seine Darstellung des Problems: Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht, bes.
S. 4 f.). Wir sind deswegen heute im Vorteil.
Einleitung
9
Lexika, wie z. B. das Nietzsche-Wörterbuch,18 geben Forschern überreiches Material
für kontextuelle Interpretationen. Zahlreich sind auch die international bedeutsamen
Zeitschriften und Jahrbücher, die die neuesten Ergebnisse der Nietzsche-Forschung
zur Verfügung stellen. Wir sind heute in der Situation, die Müller-Lauter zu Beginn
der 80er Jahre als vielversprechend eingeschätzt hat, in der „nicht wenige Vorurteile
entfallen“ sind und einem „tiefer dringende[n] Verstehen“ nichts mehr im Wege steht.
Die Fehldeutungen wie der Missbrauch gehören zwar, so Müller-Lauter bei der Eröffnung der Tagung „Aufnahme und Auseinandersetzung. Friedrich Nietzsche im
20. Jahrhundert“, auch unwiderruflich in die Geschichte der Nietzsche-Rezeption.19
Doch gerade diese außerordentlich „bewegte Wirkungsgeschichte“ Nietzsches kann
nun als Zeichen einer unvergleichbaren Offenheit seiner Philosophie interpretiert
werden.20
Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass die Geschichte der Nietzsche-Rezeption kaum zufällig eine höchst dramatische gewesen ist, dass sie nicht bloß politische, sondern auch und v. a. philosophische Kontroversen ihrer Zeit widerspiegelte.
Denn Nietzsches Name steht für eine Krise, die möglicherweise auch das Ende der
Philosophie, zumindest wie man sie bisher verstand, markiert.21 Er selber betonte
mehrmals: Da er gerade der Erste sei, der manche Fragen zu stellen wagt, wird sein
Name in der Zukunft in Zusammenhang mit der „tiefste[n] Gewissens-Collision“ (EH
Schicksal 1, KSA 6, S. 365) gebracht – mit der Krise des Lebens, die aus der Philosophie hervor- und doch weit über sie hinausgeht.22 Sie ist als Krise aller Orientierungs- und Denkmuster, als nihilistischer Umbruch der Moderne zu verstehen, die
u. a. von den russischen Denkern als verhängnisvoll und hoffnungsreich zugleich
angesehen wurde. Gerade als Krisenfigur wurde Nietzsche jedoch philosophisch
aufgenommen, indem man sich bemühte (und mit Erfolg), seine Philosophie als
neuen Anfang zu interpretieren. Sie wurde als Philosophie des Perspektivismus
bezeichnet, d. h. als Philosophie, die alle absoluten Ansprüche der Erkenntnis und
der Moral zurückweist und deshalb an der Schwelle zu modernen Umorientierun-
18 Paul van Tongeren, Gerd Schank, Herman Siemens u. Nietzsche Research Group (Nijmegen) (Hg.),
Nietzsche-Wörterbuch.
19 Wolfgang Müller-Lauter, Begrüßung der Tagungsteilnehmer, S. 3 f.
20 Vgl. die methodologischen Überlegungen zum aktuellen Umgang mit Nietzsches Texten in: Werner
Stegmaier, Nach Montinari. Zur Nietzsche-Philologie.
21 Die Rezeptionsgeschichte zeigt, dass man sich, wie unterschiedlich die Perspektiven auch sein
mögen, ob man in Nietzsche bloß ein Syndrom oder einen großen Zerstörer sehen wollte oder in ihm
einen scharfen Diagnostiker und sogar einen Erlöser sieht, über diesen Punkt einig ist. Vgl. dazu
Günter Figal, Nietzsche. Eine philosophische Einführung, S. 33 ff., Günter Figal, Nietzsches Philosophie
der Interpretation, S. 1 f.
22 Zur Interpretation von Nietzsches Selbsteinschätzungen u. a. als Krisenfigur s. Hans Gerald Hödl,
Der letzte Jünger des Philosophen Dionysos. Studien zur systematischen Bedeutung von Nietzsches Selbstthematisierung im Kontext seiner Religionskritik.
10
Einleitung
gen im Leben der Gesellschaft und im Selbstverständnis des einzelnen Menschen
steht.23
Aber auch in der aktuellen Nietzsche-Forschung tauchen Schwierigkeiten auf. Als
Nietzsche-Forscher wird man heute mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Es ist
nicht mehr die Ideologisierung, sondern das Risiko besteht darin, Nietzsche auf einen
Vorläufer der Moderne und dann wiederum auf einen Ideologen einer auf die subjektivistisch-relativierende Toleranz umgestellten Weltanschauung zu reduzieren und
ihn schließlich so zu verharmlosen. Wie Jürgen Habermas schon früher bemerkte, hat
Nietzsche den Stachel des Anstößigen verloren, er hat aufgehört, uns eine Verlegenheit, eine Irritation zu sein.24 Nietzsches Pathos gegen die Herden-Moral, gegen die
absoluten Ansprüche der jeweiligen Weltauslegung und gegen das Christentum sowie
sein Plädoyer für den Egoismus eines souveränen Individuums sehen heute schon
nicht mehr so revolutionär, zumindest nicht so radikal aus wie zu seiner Zeit.25 Dazu
kommen mehrere Versuche, Nietzsche nicht nur als Fortsetzer der Tradition, als Vollender der abendländischen Metaphysik zu betrachten,26 sondern auch als Verfechter
23 Vgl. Friedrich Kaulbach, Philosophie des Perspektivismus, Teil 1:Wahrheit und Perspektive bei Kant,
Hegel, Nietzsche. S. auch z. B. Gerd-Günther Grau, Kritik des absoluten Anspruchs: Nietzsche – Kierkegaard – Kant.
24 Habermas wies dabei mit Recht auf die Gefahr hin, Nietzsches Philosophie bloß als „Projektionswand der eigenen Philosophie“ zu nutzen (Jürgen Habermas, Nachwort, in: Nietzsche, Erkenntnistheoretische Schriften, S. 238). Vgl. die Einschätzung der späteren Situation bei Simon: „Man betrachtet
Nietzsche zunehmend als einen Philosophen wie andere Philosophen auch. Ist er dies aber? Er wollte
es gewiß nicht sein.“ (Josef Simon, Das neue Nietzsche-Bild, S. 1)
25 Es fehlt auch nicht an Versuchen, ihre Radikalität auch zu seiner Zeit in Frage zu stellen. Vgl. in
diesem Sinn: Volker Gerhardt, Sensation und Existenz, bes. S. 104 f.
26 Dies war bekanntlich Heideggers Position. Nietzsche sei „der zügelloseste Platoniker in der Geschichte der abendländischen Metaphysik“; sein Wertgedanke sei „der späteste und zugleich schwächlichste Nachkömmling des agathon“ (Martin Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief
über den „Humanismus“, S. 37). Zu Heideggers Nietzsche-Rezeption s. Wolfgang Müller-Lauter, Das
Willenswesen und der Übermensch. Neben Müller-Lauter ist Walter Kaufmann zu den Kritikern von
Heideggers Interpretation von Nietzsche als Vollender der Metaphysik zu rechnen (Walter Kaufmann,
Nietzsche; Walter Kaufmann, Nietzsche als der erste große Psychologe). Am schärfsten hat Kaufmann
dieses Problem in einer an seinen Vortrag anschließenden Diskussion (polemisch gegen Jörg Salaquarda) formuliert: „Aber die Frage ist vor allem, ob Nietzsche eine Endfigur ist, die noch immer das
gemacht hat, was die Philosophen von jeher, von Plato angefangen, gemacht haben, oder ob Nietzsche
ein neuer Anfang ist, den Heidegger nicht gesehen hat, so daß Heidegger, wenn man historisch denkt,
selbst noch in einer vornietzscheschen Position stecken geblieben und keinesfalls zu einer nachnietzscheschen vorgedrungen ist.“ (Walter Kaufmann, Nietzsche als der erste große Psychologe. Die Diskussion, S. 286). Später wird das Problem immer wieder aufgenommen, indem z. B. Jacques Derrida
offenlegt, dass er an Nietzsche über Heidegger hinaus anknüpfen will (vgl. Jacques Derrida, Positionen
bes. S. 43 f.). Gianni Vattimo spricht von einer in „vielen europäischen Philosophien“ stattfindenden
„Hin- und Herbewegung zwischen Heidegger und Nietzsche“ (Gianni Vattimo, Heideggers Nihilismus:
Nietzsche als Interpret Heideggers, S. 143). Zur Auswirkung der Nietzsche-Heidegger-Auseinandersetzung auf das postmodernistische Denken s. Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsche und Heidegger als
nihilistische Denker. Zu Gianni Vattimos ‚postmodernistischer‘ Deutung. Zur aktuellen Einschätzung von
Einleitung
11
der christlich gefärbten Humanität bzw. der durch die stetige Selbstüberwindung
angestrebten Selbstverwirklichung des Menschen.27 Diese Verharmlosung wird nicht
nur Nietzsche, sondern offensichtlich auch einem unvoreingenommenen Leser nicht
gerecht. Denn auch heute behalten Nietzsches Texte ihre faszinierend-irritierende
Kraft. Auch heute provozieren sie noch, trotz aller Entschärfungen durch die wissenschaftliche und editorische Arbeit, eine Polemik, die ohne ernsthafte Auseinandersetzung zur bloßen Desavouierung werden kann. Eine philosophische Interpretation
von Nietzsches Werk muss darum weiterhin, so scheint es mir, die Fragen nach der
Begründung und Tragweite der moralischen Forderungen, nach dem Verhältnis zwischen allgemein anerkannten Normen und dem Gewissen des Einzelnen, nach den
Kriterien der Unterscheidung, der Wertschätzungen und der moralischen Ansprüche
eindringlich neu stellen.
Eine Stellungnahme zu den alten Kontroversen der Nietzsche-Forschung, wie die
Reduktionismus- bzw. Relativismus-28 oder Metaphysik- bzw. Ontologie-Debatte,29
scheint für diese Untersuchung dagegen entbehrlich zu sein. Viele der auch heute
noch entstehenden Schwierigkeiten der Nietzsche-Forschung lassen sich m. E. vermeiden, wenn Nietzsches Radikalität im Einklang mit seiner eigenen Intention als
primär moralkritisches Anliegen betrachtet wird, d. h. wenn die Frage nach dem Wert
in den Vordergrund rückt.30 Nietzsches breiter Begriff der Moral, deren Kritik von ihm
Heideggers systematischer Nietzsche-Interpretation und deren Auswirkung s. Werner Stegmaier, Heideggers Auseinandersetzung mit Nietzsche, S. 527 f.; Werner Stegmaier, Wolfgang Müller-Lauters Nietzsche-Interpretation, S. 478 ff.
27 Diese These wird in mehreren historisch groß angelegten Nietzsche-Interpretationen vertreten, von
Karl Jaspers bis Volker Gerhardt. Vgl. Karl Jaspers, Nietzsche und das Christentum; Volker Gerhardt,
Vom Willen zur Macht.. U. a. wird dabei die These untermauert, Nietzsche bleibe bloß innerhalb einer
philosophischen Tradition, „die ihn auch dort noch bestimmt, wo er von ihr loszukommen glaubt“
(Gerhardt, Vom Willen zur Macht, S. 223). Nietzsches kritischer Ansatz wird damit als weniger radikal
angesehen als ihm selbst gerecht wäre. Zu dieser Frage kehren wir im zweiten Kapitel zurück, in dem
Nietzsches Plausibilitäten und u. a. sein Umgang mit dem christlichen Ideal untersucht werden.
28 Der Relativismus wurde schon von Hans Vaihinger als philosophischer Gewinn von Nietzsches
Philosophie hervorgehoben: „Nietzsche ist Relativist, er ist Anti-Absolutist“ (Hans Vaihinger, Nietzsche
als Philosoph, S. 74). Der Relativismus, der als erkenntnistheoretisches Prinzip verstanden wird, gibt
allerdings vermehrt Anlass zur Kritik an Nietzsche. S. zum Thema Jörn Albrecht, Nietzsche und das
„Sprachliche Relativitätsprinzip“. Der Reduktionismus-Vorwurf hängt mit dem des Relativismus eng
zusammen. Vgl. Rainer Thurnher, Sprache und Welt bei Friedrich Nietzsche, bes. S. 55.
29 Vgl. z. B. neben der Heidegger-Diskussion die Polemik von Sarah Kofman gegen Jean Granier.
Wenn Granier in seiner systematischen Untersuchung, im Gegensatz zu Heidegger, Nietzsches Denken
als nichtmetaphysische Ontologie darzustellen versuchte (Jean Granier, Le problemè de la vérité dans
la philosophie de Nietzsche), so bemüht sich Kofman auch dieser Art der Ontologisierung zu entgehen,
indem sie Nietzsches Kritik an der Metaphysik von seiner Deutung der Metapher her als Berechtigung
mehrerer Perspektiven interpretiert (Sarah Kofman, Nietzsche et la métaphore, bes. S. 176 ff., 205 ff.).
30 Mit dieser Einstellung Nietzsches wird Heideggers Vorwurf der Subjektivität als „nur noch der in
Wertschätzungen des Willens zur Macht gesetzte Gesichtspunkt“ (Martin Heidegger, Nietzsches Wort
‚Gott ist tot‘, S. 241) vorweggenommen und ihm gewissermaßen Recht gegeben. Nach Nietzsche wäre
12
Einleitung
als Voraussetzung jeder philosophischen Fragestellung dargestellt wird, ist als sein
„radikale[r] Verzicht auf die Metaphysik“ zu verstehen, der „Immoralismus“ als „vollständige[r] Verzicht auf Metaphysik“.31 Die Frage nach der Wahrheit ist als moralische
Frage der Frage nach dem Wert zuzuordnen. Es soll hier vorweggenommen und darf
im Laufe der Untersuchung niemals außer Acht gelassen werden, dass Nietzsches
Auseinandersetzung mit der abendländischen Moral aus Vernunft von ihm ausdrücklich als seine moralische Aufgabe präsentiert wurde, nicht etwa als eine Aufdeckung
eines ‚gewissen‘ Sachverhaltes bzw. als Verteidigung der ‚Wirklichkeit‘ des Lebens
gegen seine Gegner, wenn auch manche dem Kontext entrissene Aussagen und Notate
Nietzsches dies nahezulegen scheinen. Auch als „Erkennender“ bleibt Nietzsche im
Spannungsfeld der moralischen Fragen, er bleibt Erforscher und „Errater“ der moralischen Urteile, deren Macht, so seine tiefste Intuition, niemals zu unterschätzen ist,
besonders dann nicht, wenn man glaubt, man habe sich von ihnen frei gemacht bzw.
man bewege sich auf einer ganz anderen Schiene der Philosophie.32
Wie die wegweisenden Nietzsche-Interpretationen deutlich herausstellten, weist
die Rede vom „Charakter des Daseins“ bei Nietzsche immer auf die Pluralität von
Lebensperspektiven hin. So ist z. B. der Wille zur Macht laut Müller-Lauter zu verstehen – als Pluralität der Willen, die miteinander konkurrieren und nur vorübergehend die Oberhand über die jeweils anderen gewinnen können. Dennoch, gerade
wenn wir diesem Pluralitäts-Gedanken treu bleiben wollen, dürfte der Perspektivis-
jener Versuch, von dieser Art „Subjektivität“ loszukommen und nicht von „einem bloßen ‚Wert‘“ des
Seins sprechen zu wollen (vgl. Martin Heidegger, Überwindung der Metaphysik, S. 77), wiederum der
Ausdruck eines moralischen Willens, der gegenüber eigenen moralischen Intentionen blind bleibt.
Taurecks Einwand gegen Heideggers Nietzsche-Kritik, Nietzsche habe das Sein im Dionysischen „jenseits wertender Subjektivität“ gedacht (Bernhard Taureck, Macht, und nicht Gewalt, S. 35), kann daher
nicht, genauso wenig wie den Einwänden Heideggers, zugestimmt werden. Auch als „Wesen der
Triebe“, als „Einheit von Entstehen und Vergehen“ (S. 51) kann die Macht m. E. nicht zum nietzscheschen Ersatz des Seins-Gedankens umgedeutet werden, auch Triebe sind nicht „einfach“ (vgl.
S. 50) und können nicht als Art dionysischer arché interpretiert werden. Der nichtmetaphysische
Charakter des Dionysischen wird u. a. in Kapitel 2 ausgeführt.
31 So äußerte sich Müller-Lauter in der Diskussion zum Vortrag von Georges Goedert: Müller-Lauter,
Nietzsche und Schopenhauer. Die Diskussion, S. 22.
32 Deshalb scheinen alle Versuche, Nietzsches Philosophie nur unter dem Blinkwinkel der Erkenntnisproblematik zu betrachten, unbefriedigend zu sein. Vgl. z. B. Jochen Kirchhoff, Zum Problem der
Erkenntnis bei Nietzsche. Weil er Nietzsches Kritik der abendländischen Philosophie auf die Frage nach
der Erkenntnis reduziert und von seiner Kritik der abendländischen Moral abkoppelt, kommt Kirchhoff
zu dem Schluss, der von Nietzsche behauptete „Wirklichkeitsgrund“ widerspreche den Tatsachen der
Physik (S. 23 f.). Er widerspricht aber auch Nietzsches Kritik an der Erkenntnis als grundsätzlich moralischem Anliegen, das für sich die absolute Wahrheit beansprucht. Vgl. auch Mihailo Djurićs Vorwürfe,
Nietzsche habe es unterlassen, „das Verhältnis zwischen Spekulation und Erfahrung näher zu erwägen“, und wiederum in diesem Zusammenhang die Behauptung, „Nietzsches Bruch mit der metaphysischen Tradition [sei] nicht radikal genug“ gewesen (Mihailo Djurić, Das nihilistische Gedankenexperiment, S. 172).
Einleitung
13
mus selbst nicht als ‚wahrer‘ Charakter des Lebens bezeichnet werden. Die These,
dass es keine Wahrheit des Geschehens im Sinne der alten Metaphysik gibt, muss
selbst als Wahrheit fragwürdig bleiben, so wie die Ausdrücke „Wirklichkeit des
Werdens“, „Realität“ und „neue Wahrheit“, die sich fast ausschließlich mit Stellen
aus Der Wille zur Macht bekräftigen lassen.33 Wie mehrere Untersuchungen zu Nietzsche zeigen, kann man dieser Gefahr auch mit Hilfe der feinsten Differenzierungen
nicht entgehen, man spricht immer wieder vom ‚Wirklichen‘ bzw. von Verleugnung
der ‚Realität‘ bei den von Nietzsche kritisierten Denkern. Wenn es aber keine objektiven Kriterien für die Interpretationen geben kann, so kann die Entscheidung zugunsten der „Interpretativität als solche[r]“34 nicht objektiv begründet werden, und damit
kann die Unterscheidung von Interpretation und Faktizität, die ja als Unterscheidung
gerade für neue Interpretationen sorgt, nicht einfach getilgt werden.35 Wenn dieses
Interpretationsprinzip ernst zu nehmen ist, kann auch das Postulat keine absolute
Wahrheit für sich beanspruchen, demzufolge es „[d]ie Eine objektive Welt und
die interpretationsfreie bzw. schema-unabhängige Betrachtungsweise“ nicht geben
„kann“.36 Als Grundthese ist sie der Annahme verpflichtet, dass, wenn der Sinn des
Daseins oder Gott oder ein Zweck sich als ungewiss erwiesen haben, sie damit schon
widerlegt seien.37 Ein konsequenter Perspektivismus sollte dagegen auch diese Aussage relativieren.38 Die Faktizität des Werdens und die Pluralität der Perspektiven
33 Vgl. Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze, S. 101, 108 f. Zwar sah MüllerLauter die Gefahr und verfiel keinesfalls in eine naive Umkehrung, sondern bemühte sich gerade
darum, das Nicht-Metaphysische in Nietzsches Willen-zur-Macht-Pluralismus zu entdecken. Doch
konnte auch er die Rede von dem ‚Wirklichen‘ nicht völlig vermeiden, unter dem er das „Gegeneinander der Willen zur Macht“ verstand. Er stützte diese These dennoch vorwiegend mit Zitaten aus
Nietzsches Nachlass. Das Problematische der These, alles Werden sei Interpretation, wurde von ihm in
seiner kritischen Analyse der Position Vattimos thematisiert. Vgl. Müller-Lauter, Nietzsche und Heidegger als nihilistische Denker, S. 68.
34 Günter Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 456.
35 Vgl. Günter Abel, Nietzsche contra ‚Selbsterhaltung‘. Steigerung der Macht und ewige Wiederkehr.
Diskussion, S. 406 f. Bezeichnenderweise macht Abel diese Unterscheidung selbst, indem er darauf
besteht, bei der Lehre der ewigen Wiederkehr handle es sich nicht bloß um einen Gedanken, sondern
um den „Geschehenscharakter der Willen-zur-Macht-Vollzüge.“ Wie Stegmaier überzeugend zeigt,
geht in Abels Begriff der totalen Interpretation die Differenz von Interpretieren und zu Interpretierendem gerade verloren (Werner Stegmaier, Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche, S. 313).
36 Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 447. Vgl. auch: „[…]
bei einer Vielfalt von Perspektiven und Interpretationen [kann] keine die ‚wahre‘ sein“ (S. 322).
37 Vgl. bei Nietzsche das Lob von „Schopenhauer’s Stellung“, „daß die Zerstörung einer Illusion noch
keine Wahrheit ergiebt, sondern ein S t ü c k U n g e w i s s h e i t m e h r , eine Erweiterung unseres ‚leeren
Raums‘, einen Zuwachs unserer ‚Oede‘ – “ (Nachlass, Mai–Juli 1885, 35[47], KSA 11, S. 533).
38 So betont Abel, dass „Mythos und Mystik“ immer „eine einheitliche und eigentliche Welt“ behaupteten, die „mit Hilfe derjenigen denkerischen Möglichkeiten, mit denen der Mensch ausgestattet ist,
nicht erreichbar ist“. Der Wiederkunfts-Gedanke dagegen solle nicht die Wahrheit, sondern eine „neue
Auslegung der Wirklichkeit“ „im Sinne des geschehens-logischen Interpretations-Zirkels“ auf den
Höhepunkt bringen (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr,
14
Einleitung
können als ‚Wahrheit‘ und ‚Realität‘ nur noch postuliert werden, ebenso wie die
„einzige Realität“ einer dynamischen Willen-zur-Macht-Organisation, die als Nietzsches „neue Auslegung des Daseins“ dessen Grundcharakter entspräche.39
Nietzsche dagegen, indem er vom Werden sprach, vermied kaum zufällig eine
solche Art des Postulierens. Seine Formeln wie „die Welt ist der Wille zur Macht“ oder
„Gott ist tot“ sind gerade Ausdruck dieser Vorsicht und der gezielten Beschränkung
des Aussagens. Der proklamierte „Tod Gottes“ kann bspw. gerade nicht als Stellungnahme zum alten Dilemma des Daseins/Nichtdaseins Gottes verstanden werden,
sondern impliziert eine offene Überlegung zu bestimmten (nicht alternativlosen)
historischen Prozessen, nämlich dem des Untergangs des christlichen Glaubens –
dem Prozess, der seinerseits nicht frei von Kontroversen verläuft und nicht ohne
paradoxe Folgen bleibt, z. B. einen neuen Gottesglauben40 und sogar eine Wiederbelebung des Christlichen. Man könnte dabei immer noch fragen, bei wem dieser
Untergang festzustellen ist, und wer tatsächlich die Kraft hat, das Ereignis des
„Loskette[ns]“ von „allen Sonnen“ auszuhalten (FW 125, KSA 3, S. 481).
Die so vielfach umstrittene Wille-zur-Macht-These wird in Jenseits von Gut und
Böse (d. h. in einem von Nietzsche selbst für Leser bestimmten Werk) mit einer Frage
eingeführt:
Gesetzt, dass nichts Anderes als real ‚gegeben‘ ist als unsre Welt der Begierden und Leidenschaften, dass wir zu keiner anderen ‚Realität‘ hinab oder hinauf können als gerade zur Realität unsrer
Triebe […] – denn Denken ist nur ein Verhalten dieser Triebe zu einander —: ist es nicht erlaubt, den Versuch zu machen und die Frage zu fragen, ob dies Gegeben nicht a u s r e i c h t , um
aus Seines-Gleichen auch die sogenannte mechanistische (oder ‚materielle‘) Welt zu verstehen?
(JGB 36, KSA 5, S. 54)
Und so wird diese Überlegung abgeschlossen:
Die Welt von innen gesehen, die Welt auf ihren ‚intelligiblen Charakter‘ hin bestimmt und
bezeichnet — sie wäre eben ‚Wille zur Macht‘ und nichts ausserdem. (JGB 36, KSA 5, S. 55)
S. 323). Doch als wie produktiv und überzeugend seine Nietzsche-Auslegung sich auch erwiesen hat,
scheint sie von dem Anspruch auf eine erkenntnistheoretische Wahrheit doch nicht ganz frei zu sein,
v. a. nicht von der Herabwürdigung des Ungewissen, soweit sie bestreitet, es könne etwas geben, was
„denkerischen Möglichkeiten“ nicht zugänglich ist. Ob bestritten oder behauptet, ist dies ein Anspruch, über die „wirkliche Welt“ etwas zu sagen bzw. eine neue, wenn auch bloß negative Gewissheit
zu behaupten (vgl. das Kapitel „Destruktion der ‚wahren‘ und Selbstfindung der wirklichen Welt“,
S. 324–345).
39 Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 4. Vgl. auch bei
Figal: „Nietzsches Philosophie der Interpretation ist eine Auslegung dieser, auch für sie selbst geltenden Faktizität“ (Figal, Nietzsches Philosophie der Interpretation, S. 9); und noch stärker bei Jörg
Salaquarda, der von der „fiktive[n] Instanz“ und dem „faktische[n] Leben“ spricht: Jörg Salaquarda,
Fröhliche Wissenschaft zwischen „Freigeisterei“ und neuer „Lehre“.
40 Vgl. Johann Figl, ‚Tod Gottes‘ und die Möglichkeit ‚neuer Götter‘.
Einleitung
15
Der Gedanke der intelligiblen Welt, der in jedem Denken, das den Anspruch auf
Erkenntnis erhebt, mitgedacht wird, führe zur Annahme des „Willens zur Macht“ als
einzige „Realität“ (beide Ausdrücke setzt Nietzsche in Anführungszeichen). Aber auch
umgekehrt, wenn es sich als bloßes Spiel der Begierden und Leidenschaften, als
zufälliges Ergebnis der Auseinandersetzung mehrerer Triebe verstünde, würde das
Wille-zur-Macht-Prinzip dadurch nur noch bestätigt werden. Diese Schlussfolgerung
ist keine Behauptung, nicht einmal eine Auslegung, sondern eine bloße Konsequenz
der Rede von der „Realität“, von dem „Gegebenen“, von dem „Willen“. So muss „die
Welt von innen gesehen“ werden, wenn man die durch diese Begriffe angedeuteten
Leitunterscheidungen (das Intelligible / das Materielle, der Wille / die mechanistische
Welt) konsequent durchdenkt und sie wiederum auf sie selbst anwendet. Mehr lässt
sich nicht behaupten.41
Das ist eine der wichtigsten Ausführungen zum Willen zur Macht, die im veröffentlichten Werk vorkommt. An diesem Beispiel zeigt sich deutlich Nietzsches
Strategie in der Kritik an absoluten Ansprüchen der Erkenntnis. Die alten Plausibilitäten (der intelligible Grund der Welt) werden nicht geleugnet, sondern bis zu ihren
äußersten Konsequenzen geführt. Wenn wir von dem Willen überhaupt sprechen
wollen, so wäre die Welt selbst als Wille zur Macht zu verstehen. Wir müssen dies aber
nicht, denn es ist wohl möglich, dass es überhaupt keinen Willen gibt.42 Die Plausibilität des Willens ist jetzt als Grundannahme zu verstehen, aber gerade deshalb ist sie
keine Plausibilität mehr, denn sie wurde thematisiert und als solche eingesehen, d. h.:
sie wurde als eine Entscheidung in der Situation der prinzipiellen ontologisch-existenziellen Ungewissheit aufgezeigt. Für diese Entscheidung sprechen keine Gründe, die
als ‚wirklich‘ angegeben werden können, auch nicht der pragmatische Nutzen, denn
um dies zu behaupten, müsste man der ‚Realität‘ schon auf irgendeine Weise näher
kommen. Die Vor- und Nachteile einer Entscheidung zugunsten einer bestimmten
Weltauslegung lassen sich nach Nietzsche gerade nicht kalkulieren. Eine solche Entscheidung kann sich, wenn überhaupt, nur noch auf die Kriterien berufen, die grundsätzlich moralischer Art sind. In der Situation der prinzipiellen Ungewissheit über den
Grundcharakter des Daseins können persönliche Entscheidungen nicht weiter begründet werden, sie können sich selbst nur als „gut“ auslegen, als das Wertvolle
41 Auf die Rolle des hypothetischen Satzanfangs („Gesetzt, dass…“, „Vorausgesetzt, dass…“) besonders in Jenseits von Gut und Böse u. a. im Unterschied zu den entsprechenden Nachlassnotaten hat van
Tongeren hingewiesen: „At the moment when Nietzsche established his thoughts in written form, he
felt the need to make their hypothetical, provisional, and perspectival nature explicit.“ (Paul J.M. van
Tongeren, Reinterpreting Modern Culture, S. 130) Man kommt darum als Nietzsche-Forscher nicht
umhin, sich auf Nietzsches Nachlass zu berufen, dennoch sollte man sich immer klar machen, ob es
sich um Nachlassnotate oder aber um ein von Nietzsche selbst für die Veröffentlichung bestimmtes
Werk handelt.
42 Vgl. in einer Nachlassnotiz: „E x o t e r i s c h – e s o t e r i s c h 1. – alles ist Wille gegen Willen 2. Es
gibt gar keinen Willen“ (Nachlass, Sommer 1886–Herbst 1887, 5[9], KSA 12, S. 187).
16
Einleitung
schlechthin. Nur in diesem Zusammenhang lässt sich die viel zitierte Aussage Nietzsches sinnvoll verstehen:
Gesetzt, dass auch dies nur Interpretation ist – und ihr werdet eifrig genug sein, dies einzuwenden? – nun, um so besser. – (JGB 22, KSA 5, S. 37)
Dies ist kein literarisch eleganter Schluss, mit dem eigene Inkonsequenz zugegeben
wird, um einen Gegenvorwurf zu verhindern, sondern ein Hinweis darauf, in welchem
Modus des Fürwahrhaltens seine Weltauslegung zu verstehen ist: im Modus des
praktischen Glaubens, der sich allerdings (im Unterschied zu dem kantischen Glauben) selber niemals gewiss sein kann.43
Nicht nur der „Tod Gottes“ und „der Wille zur Macht“, auch Nietzsches berühmte
Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen als „post-nihilistische Daseinsinterpretation“, als „Übernahme der Geschehens-Notwendigkeit“, als „Triumph über eben
diese Beschaffenheit der Welt“44 ist v. a. einem moralischen Anliegen verpflichtet. Sie
ist, wie am Ende des berühmten Lenzer-Heide-Entwurfs deutlich wird, als Probe der
eigenen Kräfte zu verstehen,45 und bleibt immer noch, wie in Jenseits von Gut und Böse
über die Aufgabe der Selbstüberwindung der Moral gesagt wird, „als lebendige[r]
Probirstein[ ] der Seele“ einem Philosophen „vorbehalten“ (JGB 32, KSA 5, S. 51). Als
„Weltformel“ musste die Wiederkunftslehre dagegen für Nietzsche höchst fraglich
bleiben. Denn sie fügte in sich alle alten metaphysischen Begriffe zusammen: „Alles“,
„ewig“, „Wiederkehr“, „das Gleiche“.46 Insofern muss nicht nur den Forschern Recht
gegeben werden, die auf die theoretisch-wissenschaftliche Unbeweisbarkeit von Nietz-
43 Dem Problem der allumfassenden Interpretation bei Nietzsche, u. a. anhand der oben zitierten
Stelle, ist die Untersuchung Johann Figls gewidmet, wobei die Frage nach der Möglichkeit, eine
‚richtige‘ Interpretation zu behaupten, in den Vordergrund rückt. Wie Figl mit Recht bemerkt, kann
„der Ausdruck ‚falsch‘“ aus der „Gegenposition zu jeder nicht-interpretativen Weltsicht“ „nur eine
relative Bedeutung“ haben, „insofern dadurch die Möglichkeit einer ‚richtigen‘ Interpretation abgewiesen wird“ (Johann Figl, Interpretation als philosophisches Prinzip. Friedrich Nietzsches universale
Theorie der Auslegung im späten Nachlaß, S. 199 f.). „Das ‚Verstehen‘ wird in seiner Zirkelstruktur
erkannt, und zugleich die Annahme einer rein im Bewusstsein sich vollziehenden Erkenntnis als
Illusion aufgedeckt“. Dennoch darf die „Illusion“ hier nicht wiederum im Gegensatz zur „Realität“
stehen. „Solche kritische Desillusionierung kann auf der Basis der Überzeugung erfolgen, dass eben
die Wirkung das faktisch Vorgängige ist.“ (S. 184 f.) Nietzsches Aufdeckung der Illusionen einer
metaphysischen Weltauslegung verspreche somit überhaupt keine Sicherheiten für ihren Gegenentwurf, sondern richte eine Interpretation gegen die andere. Was hier interpretiert und ‚erkannt‘ werden
soll (beide Termini nun bloß als Synonyme verstanden), ist nicht die ‚Realität‘, sondern die Wirksamkeit der Weltinterpretationen und ihre für sie eventuell nicht vorhersagbaren Folgen.
44 Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 455, vgl. auch
S. 303, 345.
45 Vgl. dessen Schluss: „Wie dächte ein solcher Mensch an die ewige Wiederkunft? –“ (Nachlass,
Sommer 1886–Herbst 1887, 5[71], KSA 12, S. 217).
46 Vgl. Werner Stegmaier, Nietzsches Lehren, Nietzsches Zeichen, S. 67.
Einleitung
17
sches „abgründliche[m] Gedanke[n]“ (EH weise 3, KSA 6, S. 268) hinweisen, sondern
auch denen, die behaupten, seine erkenntnistheoretischen Explikationen verfehlten
gerade seinen philosophischen Sinn.47 Diese Lehre Zarathustras, wie auch die des
„Übermenschen“,48 kann jedoch sehr wohl auch jenseits der metaphysischen Ansprüche der Erkenntnis sinnvoll gedeutet werden – als Weltauslegung, die aus moralischen
Gründen vorzuziehen ist. Denn weder Notwendigkeit noch Sinnlosigkeit bzw. Ziellosigkeit des Werdens49 können gewiss sein, und deshalb kann ihre Bejahung nur aus
einer bestimmten moralischen Perspektive, z. B. als Triumph „jenseits des Rache-
47 Man darf, Abel zufolge, Nietzsches Wiederkunfts-Gedanken nicht bloß als wissenschaftliche
Theorie vertreten (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr,
S. 256 ff.). Ein Zurückführen auf moralische Fragestellungen wird von Abel dennoch als „schwerwiegende Verkürzung“ des Wiederkunfts-Gedankens dargestellt. Vgl. dazu seine Polemik gegen diese Art
der Argumentation bei Müller-Lauter, Bernd Magnus (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur
Macht und die ewige Wiederkehr, S. 194 f.; auch Abel, Nietzsche contra ‚Selbsterhaltung‘). Bezeichnenderweise muss sich Abel bei dieser Auseinandersetzung auf die berühmte Aussage Heideggers (den er
sonst kritisiert) berufen, Nietzsches eigentliche Philosophie befinde sich im Nachlass (Abel, Nietzsche.
Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 194 f.). Obwohl Abel weit davon entfernt
ist, den Wiederkunftsgedanken als einen kosmologisch bzw. wissenschaftlich nachweisbaren bzw.
ontologischen „im alten Sinne“ zu präsentieren, ist er am Ende genötigt, ihn zugleich erkenntnistheoretisch zu deuten, mit dem Vorbehalt, er sei wesentlich eine Interpretation und kein Mythos, keine
Lösung des Geheimnisses der Welt. Mir scheint dennoch, dass auch seine erkenntnistheoretischen
Explikationen (der Wiederkunfts-Gedanke sei „sinn- und interpretations-logischer Natur“ (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 248)), soweit sie das „nur“ Ethische
überschreiten bzw. mehr als ein „bloß“ moralisches Kriterium für das existentielle In-der-Welt-Sein
liefern wollen, seinen Sinn verfehlen. Denn auch als eine „die Urgeschichte“ symbolisierende Lehre
der Endlichkeit (die letztere „als Ineinander von Faktizität und Interpretation“ verstanden) bleibt sie
eine Art Mythos, wenn er auch keine „über-zeitliche […] Struktur von Welt und Sinn“ tradiert (Abel,
Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 322) und sich auf die Negation
dieser Struktur beschränkt: „Der Beobachter ist im Wiederkunfts-Gedanken systematisch ausgeschlossen“ (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 304). Gerade als
Interpretation, die über die Welt belehren soll, ist der Wiederkunfts-Gedanke nicht haltbar und soll
unhaltbar bleiben.
48 Dieser wichtige Punkt, dass die berühmtesten ‚Lehren‘ Nietzsches nicht direkt, sondern von seinem
Zarathustra bzw. seinen Tieren oder dem Teufel oder seinem Schatten ausgesprochen werden, wird
öfters übersehen. Betont wird er z. B. bei Simon (Simon, Das neue Nietzsche-Bild, S. 7). Vgl. auch
Werner Stegmaier, Nietzsche. Also sprach Zarathustra.
49 Nietzsches Argument „Hätte die Welt ein Ziel, so müsste es erreicht sein“ (Frühjahr–Herbst 1881, 11
[292], KSA 9, S. 553; Juni–Juli 1885, 36[15], KSA 11, S. 556) kann nur unter der Bedingung eines
dogmatischen Verständnisses der ewigen Wiederkehr überzeugen. (Es fehlt allerdings nicht an solchen
Versuchen in der Forschungsliteratur. Vgl. z. B. Dirk L. Couprie, „Hätte die Welt ein Ziel, […] so wäre es
[…] mit allem Werden längst zu Ende“. Nietzsche gerate mit seinem Versuch, „einen metaphysischen
Satz zu beweisen“, in eine Aporie, die schon von Kant beschrieben wurde (S. 117)). Man darf nicht
vergessen, dass eine Argumentation wie diese nur in Nietzsches Nachlass vorkommt. An einer Stelle
fügt Nietzsche eine Überschrift hinzu: „M e t a p h y s i c a“ (Nachlass, August–September 1885, 42[3],
KSA 11, S. 692).
18
Einleitung
Syndroms“,50 nicht aber als Bejahung der ‚Wirklichkeit‘ bezeichnet werden. Wobei
immer noch zu fragen wäre, warum dieses Rache-Syndrom überwunden werden soll
bzw. welche moralischen Kriterien bei dieser Bewertung im Spiel sind. Doch eins ist
klar: Als Verleitung zu einer besseren als der bisher erreichten Erkenntnis der Wirklichkeit können Nietzsches ‚Lehren‘, wie nuanciert deren Interpretation auch angelegt
werden mag, sich nicht über ein moralisches Anliegen hinaus behaupten.51
Als eine Art von Erkenntnistheorie kann Nietzsches Philosophie, in welcher
Auslegung auch immer, sich m. E. tatsächlich nicht gegen den alten Vorwurf des
performativen Selbstwiderspruchs verteidigen.52 Denn, es sei noch einmal betont,
auch wenn sie auf dem interpretativen Charakter allen Geschehens, auf der unvereinbaren Pluralität der Lebensperspektiven, auf der Flüssigkeit des Gegebenen besteht, wäre diese Philosophie nur noch eine Art Metaphysik des Werdens, die beteuert: Es gibt nichts, was bleibt; die Veränderung ist die einzige Realität; dem Zeitfluss
kann sich nichts entziehen. Man könnte immer noch fragen: Was spricht eigentlich
dafür? Und: Kann man hier überhaupt noch von Erkenntnis sprechen?53 Wenn „unser
Reden dem, was wahrhaft ist, nämlich dem Werden, […] nicht angemessen ist, wie
können wir von eben dieser Unangemessenheit auch nur Kenntnis haben?“54 Ein
solches Reden sollte einem stetigen Selbst-Verdacht, einer sich immer weiter verschiebenden Differenzierung ausgeliefert werden.55 Nur als Verdacht gegen das
50 Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 345.
51 Vgl. einen besonderen Ansatz bei Bernd Magnus, der Nietzsches Wiederkunfts-Gedanken als
existentiellen Imperativ deutet, freilich im Sinne einer nicht durch sich selbst zu bewirkenden Haltung
(Bernd Magnus, Nietzsche’s Existential Imperative, bes. S. 139 ff.; Bernd Magnus, „Eternal Recurrence“).
52 Sie ist auch nicht gegen den alten Vorwurf der einfachen Widersprüchlichkeit gefeit. Vgl. die
Betonung eines Widerspruchs zwischen Nietzsches Lehren, der von dem Willen zur Macht bzw. vom
Übermenschen und der von der ewigen Wiederkehr, z. B. bei Karl Löwith. Wenn diese als Lehren über
das Sein wie es ist bzw. als metaphysische Lehren zu verstehen sind, so kommt man nicht an dem
Schluss vorbei, dass es Nietzsche nicht gelungen ist, seine Gedanken in Einklang zu bringen. Vgl. eine
philosophische Interpretation des tragischen Konfliktes zwischen der Weisheit Zarathustras und seiner
Liebe zum Leben, z. B. bei Gadamer (Hans-Georg Gadamer, Das Drama Zarathustras).
53 Vgl. Abels Interpretation von Nietzsches Philosophie als „Fest-Stellen des Werdens“, das als „letzte
Wahrheit“ fungiert (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr,
S. 312). Schon der Formulierung nach (das Fest-Stellen dessen, was nicht fest steht) ist diese These
hochgradig paradox.
54 Rüdiger Bittner, Nietzsches Begriff der Wahrheit, S. 75. Der Aufsatz geht polemisch auf verschiedene
Positionen ein, die Nietzsches Bestreitung der Wahrheit aufnehmen und bis zum performativen Selbstwiderspruch weitertreiben. Bittner ist auch heute noch darin Recht zu geben, dass die NietzscheLiteratur „sich daran erstaunlich wenig“ zu stören scheint (S. 75, Anmerk. 24). Vgl. z. B. den Schluss im
oben zitierten Beitrag von Figal: „Nietzsches Philosophie der Interpretation ist also auch der Entwurf
eines Erkenntnisprogramms, Antwort auf die Frage, wie Einsicht jenseits der Naivität des sogenannten
Realismus gewonnen werden kann.“ (Figal, Nietzsches Philosophie der Interpretation, S. 11) Die Möglichkeit einer Einsicht impliziert jedoch wiederum ein Vorverständnis der Realität.
55 Paul Ricoeur nannte bekanntlich Nietzsche, Marx und Freud die drei großen „Lehrer des Verdachtes“ (Paul Ricoeur, Freud and Philosophy, S. 32). In erster Linie ist es jedoch Nietzsche, denn indem
Einleitung
19
„Menschliche, allzu Menschliche“, gegen „das kranke Thier“ Mensch (GM III, 13,
KSA 5, S. 367) können die Behauptung des Werdens und die Leugnung des Absoluten
sinnvoll funktionieren. Sie können weder einen Bezug auf die Realität noch die
Vorteilhaftigkeit der eigenen Interpretation beanspruchen, ohne sich dabei sofort zu
paradoxieren. Die Paradoxierung ist allerdings produktiv, aber nur im negativen
Sinne: Sie kompromittiert jede Rede von Realität, jeden Anspruch auf Aufhebung der
Differenz zwischen Interpretation und Wirklichkeit.56 Warum dies getan werden soll,
ist jedoch gerade die Frage, die auf moralische Voraussetzungen abzielt. Und diese
können ihrerseits nicht aus der ‚Realität‘ begründet werden, sondern entspringen
einer bestimmten Aufgabe.57 Nietzsche gab einen Hinweis darauf, indem er in seinem
letzten Buch sagte:
Die Frage nach der Herkunft der moralischen Werthe ist deshalb für mich eine Frage e r s t e n
R a n g e s , weil sie die Zukunft der Menschheit bedingt. (EH Bücher 2, KSA 6, S. 330)
Die Art der Argumentation, die ein gewisses Vorverständnis der Realität stillschweigend voraussetzt bzw. Nietzsche eine latente und unvermeidlich widersprüchliche
Metaphysik unterstellt, beruft sich, wie schon gesagt, kaum zufällig nur auf Nietzsches Nachlass.58 Im veröffentlichten Werk wird dagegen immer wieder betont, dass
die Wahrheit der Metaphysik nicht widerlegt, sondern ihr der Glaube gekündigt wird
er einen Verdacht gegen die ‚Wirklichkeit‘ hervorruft, will er keine neue ‚Wirklichkeit‘ behaupten,
sondern gerade diese Verdoppelung der ‚Welt‘ vermeiden. Dies macht nur Sinn, wenn es sich um einen
fortdauernden, immer wieder entstehenden und sich verschiebenden Verdacht handelt, v. a. um einen
Selbst-Verdacht.
56 Vgl. „Nietzsche denkt nicht in Zirkeln und Ebenen, sondern in ihren Bewegungen und deren
inkommensurablen Gegenbewegungen, ihren Schemata und deren irreversiblen Verschiebungen,
ihren Überwindungen und fluktuanten Selbstaufhebungen im Lebensgeflecht.“ (Stegmaier, Philosophie der Fluktuanz, S. 313 f.)
57 Auch die oben beschriebene Kritik von Bittner mündet in der Frage nach dem moralischen Willen,
dessen Begriff er bei Nietzsche freilich unbefriedigend findet (Bittner, Nietzsches Begriff der Wahrheit,
S. 89). Vgl. die These, Nietzsche habe „seiner streng immoralistischen Forderung nachträglich eine
auffallend moralistische Prägung gegeben“ (Djurić, Das nihilistische Gedankenexperiment mit dem
Handeln, S. 173). Dies kann als Inkonsequenz-Vorwurf verstanden werden. Denn trotz aller Bemühungen um eine nicht-metaphysische Interpretation der Handlung bleibt unklar, wie der erhoffte neue
„Weg zur Vollkommenheit“ bei Nietzsche mit dem Notwendigkeitsgedanken kompatibel bzw. wie das
Schöpferische überhaupt möglich sein soll, wenn die Idee des handelnden und über seine Handlung
verfügenden Subjekts destruiert worden ist. Nur als Gedankenexperiment, das ins Ethische umschlagen muss, wird Nietzsches Ansatz wiederum verständlich. Dennoch muss dieses Umschlagen m. E.
nicht als „nachträglich“, nicht als letzter Ausweg gedeutet werden. Es wurde bei Nietzsches Kritik des
Willens zur Wahrheit immer schon beabsichtigt.
58 Dies gilt u. a. für Heideggers Interpretation von Nietzsches Deutung der Wahrheit als „Einstimmigkeit mit dem Wirklichen“ des Werdens (Heidegger, Nietzsche, Bd. 1, S. 620 ff.). S. dazu Müller-Lauter,
Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze, 109 ff.
20
Einleitung
(GM III, 24, KSA 5, S. 399); dass es in der Philosophie, aber auch im Leben, immer nur
ein perspektivisches Sehen geben kann (GM III, 12, KSA 5, S. 365); und dass es sich
auch bei dieser ‚Realität‘ des Perspektivischen nur um eine Interpretation handelt
(JGB 22, KSA 5, S. 37). Es handelt sich um einen Glauben, nicht um eine Art Gewissheit.
Die Gefahr, einer oberflächlichen Idee der Realität und einem normativen Lebensverständnis zu verfallen, hat Nietzsche so von Anfang an im Blick. Er ist sich des
„Befangensein[s] in tradierten Strukturen“ nicht nur völlig bewusst, sondern beansprucht, so Josef Simon gleich zu Beginn des den ersten Band der Nietzsche-Studien
eröffnenden Beitrags, der erste Philosoph zu sein, der diese Selbstbezüglichkeit des
Denkens „philosophisch begreift und von daher als Grundzug des Lebens bejaht“.59
Dieses Begreifen oder, um es mit Nietzsche zu sagen, dieses „Sich-bewusst-werden
des Willens zur Wahrheit“ (GM III, 27, KSA 5, S. 410) ist zugleich sein philosophischer
Ausgangspunkt und seine v. a. sich selbst gestellte moralische Aufgabe, diesem Ausgangspunkt treu zu bleiben. Insofern muss im Folgenden der Versuchung, eine
materialistisch-flache Deutung der ‚Realität‘ des Lebens Nietzsche als seine Plausibilität zuzuschreiben, entschieden Widerstand geleistet werden. Weder die Verleugnung
der Wahrheit noch die Ablehnung der Moral können als Nietzsches Plausibilitäten
angesehen werden. Aus zwei Gründen: Erstens, weil sie beide von Nietzsche in einem
komplexen Kontext thematisiert wurden, in dem er gerade ihre Plausibilität zur
Debatte stellt; zweitens, weil sie wegen eines offensichtlichen performativen Selbstwiderspruchs gar nicht plausibel sein können. Wenn es sich bei Nietzsche um eine Art
Glauben handelt, so müssen seine Plausibilitäten auch einen bestimmten Fluchtpunkt haben, der für eine gewisse Einstellung, für eine Perspektivierung, sorgt, der
aber selbst nicht leicht einzusehen ist. Nietzsches Ziel war es, so meine vorläufige
These, ein neues Kriterium des philosophischen Denkens ins Spiel zu bringen und die
neuen Plausibilitäten als solche überzeugend darzulegen. Dennoch: Als Entdecker
der „Vorurtheile der Philosophen“, als Kritiker des philosophischen Aberglaubens
durfte er selber nicht einfach bei den eventuell neuen Plausibilitäten bleiben. Er
wollte einen neuen Umgang mit den eigenen Plausibilitäten entwickeln. Dieser Umgang, diese Strategie Nietzsches im Umgang mit den eigenen Plausibilitäten, soll
erstens durch die Untersuchung seiner Kritik an den Plausibilitäten der kantischen
Moral aus Vernunft und zweitens durch die Untersuchung seiner eigenen Plausibilitäten ans Licht kommen.60
59 Josef Simon, Grammatik und Wahrheit. Über das Verhältnis Nietzsches zur spekulativen Satzgrammatik der metaphysischen Tradition, S. 1 f.
60 Ich möchte hiermit keineswegs bestreiten, dass Nietzsches große Errungenschaft in der Philosophie gerade darin bestand, das Interpretatorische in jeder Weltauslegung zu bejahen. Die Frage ist
nicht, ob mehrere Interpretationen möglich sind (dies ist ja offensichtlich) und auch nicht, ob man
nicht immer einer Interpretation verhaftet bleibt (dies ist ebenso offensichtlich), sondern ob man auch
als Philosoph des Perspektivismus nicht umhinkommt, ein gewisses Kriterium für die Unterscheidung
der Interpretationen einzuführen und an ihm festzuhalten. Gerade dies soll als Nietzsches Strategie im
Einleitung
21
Es muss betont werden, dass diese Untersuchung erst auf der Grundlage der
langen Geschichte der De-Ideologisierung möglich geworden und sowohl den überreichen Forschungsergebnissen der immanenten Nietzsche-Interpretation als auch
den Deutungen aus der philosophischen Tradition heraus verpflichtet ist. Doch nicht
nur ideologische Deutungen bzw. Feststellungen der Widersprüchlichkeit, auch manche alte Forschungsstrategien sind m. E. heute als überholt anzusehen. Das zweifelsohne (im Blick auf die früheren Ideologisierungen und Missdeutungen) produktive
Anliegen Müller-Lauters, der Nietzsches Philosophie als Philosophie der Gegensätze
bzw. als Philosophie, die die unversöhnlichen Widersprüche der Moderne zum Ausdruck bringt und damit selbst zu einem Ausdruck der Zerrissenheit unserer Zeit wird,
interpretierte,61 mündete später oft in eine philosophisch wenig anschlussfähige
Methode der Selektion und Typisierung bzw. der Aussortierung von Nietzsches Gedanken im Sinne der jeweiligen systematischen Auslegung. So hat man z. B. zwischen zwei Arten des Ja-Sagens (Jesus und Dionysos) oder zwischen zwei Arten des
Egoismus (christlicher und vornehmer) unterschieden.62 Typisierungen und Periodisierungen können zwar philosophische Widersprüche entschärfen, doch gerade deswegen haben sie m. E. wenig Wert.63 Denn sie beseitigen die philosophischen Schwierigkeiten gerade nicht, sondern erwecken den Verdacht, dass man sie nicht ernst
genug nehmen will. Das Bemühen um Typisierungen ist darüber hinaus der Überzeugung verpflichtet, man könne Nietzsches Philosophie in eine Art System zwingen – ein Ansatz, der bis dato zu keinem überzeugenden Erfolg geführt hat. Jedenfalls
war es nie ein konsistentes System, sondern der für die Philosophie viel bedeutsamere
Ansatz, der an Nietzsche immer so faszinierte: eine neue Fragestellung, eine besondere Strategie in der Behandlung der bekannten Problemfelder – Moral, Wissenschaft
und Kunst. Es ging Nietzsche nicht um Typen bspw. des Egoismus, der Liebe, der
Vernunft oder des Geschmacks, die er bloß feststellte und unterschiedlich bewertete,
sondern um die Beweglichkeit der Differenzen zwischen Egoismus und Liebe, zwi-
Umgang mit den eigenen Plausibilitäten im Laufe dieser Untersuchung geklärt werden. Dies ist mein
Versuch, Nietzsches „Antwort auf das Problem des Werdens und auf die Frage nach dem Wert des
Daseins“ (Abel, Nietzsche contra ‚Selbsterhaltung‘, S. 406) zu formulieren.
61 Vgl. Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze, S. 5.
62 Selbst Müller-Lauter bemühte sich auf diese Weise, den Widerspruch zwischen dem Ja-Sagen, dem
Werden bzw. dem stetigen Wechsel einerseits und dem Willen zur „Befestigung“, zur „Verewigung
seiner Herrschaft“ andererseits mit der Einführung zweier Typen des Übermenschen zu lösen: „obwohl
beide Typen des Übermenschen die Wiederkehr wollen, wollen sie doch in ihr und durch sie Verschiedenes“ (Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze, S. 188). Vgl. z. B. auch George
Goederts Kritik an Paul Valadier (George Goedert, Paul Valadier, Nietzsche et la critique du christianisme, S. 387, 390), in der mit zwei Typen des Ja-Sagens und mit zwei Typen des Egoismus’ argumentiert wird.
63 Für die Kontinuität in Nietzsches Werk plädiert dagegen z. B. Marco Brusotti (Marco Brusotti,
Erkenntnis als Passion. Nietzsches Denkweg zwischen Morgenröthe und der Fröhlichen Wissenschaft).
Gewisse Verschiebungen vom Früh- zum Spätwerk können dabei durchaus bedeutsam sein.
22
Einleitung
schen Vernunft und Glaube, um eine zweideutige Herkunft der moralischen Wertschätzungen, deren Infragestellung sie wieder in Bewegung versetzen sollte und
allein versetzen konnte.64
Um der Nietzsche-Forschung neue Impulse zu geben, scheint so gerade das
vonnöten, was Müller-Lauter, wenn auch in einer anderen Forschungssituation, missbilligte – „den Standpunkt außerhalb Nietzsches Philosophie“ einzunehmen,65 nicht
etwa um sie einer desavouierenden Kritik (ein in der Nietzsche-Rezeption zutiefst
kompromittierter Ansatz) zu unterwerfen, sondern um sie in einen eventuell neuen
und anschlussfähigen Zusammenhang zu stellen, um so ihre Tragweite überprüfen zu
können. Dies soll nicht nur für Nietzsche, sondern auch für Kant, Tolstoi und Dostojewski geltend gemacht werden. Eine schlüssige immanent-kritische Darlegung wird
so zu einem unerlässlichen, jedoch nur ersten Schritt einer philosophischen Interpretation. Sie kann auch als Kritik im kantischen Sinne verstanden werden – als Markierung der Grenzen eines jeweiligen philosophischen Ansatzes. Doch dann muss er mit
den anderen, nicht weniger schlüssigen Ansätzen konfrontiert werden.66 Somit steht
Nietzsche nicht nur aus historisch-philologischen Gründen, nicht nur weil er für die
Aufdeckung der grundlegenden Plausibilitäten der abendländischen Philosophie eine
besondere Rolle gespielt hat, im Mittelpunkt dieser Untersuchung, sondern v. a. weil
seine These, es gebe „keine ‚voraussetzungslose‘ Wissenschaft“ (GM III, 24, KSA 5,
S. 400) und kein vorurteils- bzw. plausibilitätsfreies Denken, als ihr methodischer
Leitfaden zu betrachten ist. Nietzsches moralkritischer Ansatz weist darauf hin, wie
man in jedem Denken das Plausible entdecken kann, ohne es ins Unplausible umschlagen zu lassen, sondern um es mit anderen Möglichkeiten zu konfrontieren.
Dieser Ansatz ermöglicht daher, nicht nur die Stärke jeder Position aus kritischer
Distanz besser zu verstehen, sondern mit ihm wird auch eine naive Meta-Position zu
den jeweiligen Problemen vermeidbar. Denn die Plausibilitäten, wie schon am Anfang
angedeutet, lassen sich nur durch die bewegliche Differenz zwischen dem Plausiblen
und dem Nicht-Plausiblen beschreiben, u. a. auch die Differenz zwischen dem moralphilosophischen Ansatz und jeder meta-kritischen Position ihm gegenüber, die den
Anspruch erhebt, das ‚Unbewusste‘ in ihm aufzudecken. Auch diese Untersuchung
kommt nicht umhin, eine solche Meta-Position einzunehmen, d. h. zu versuchen,
64 Diesem Ansatz Nietzsches werden nicht nur die erkenntnistheoretischen, sondern auch manche
moralisch-systematischen Untersuchungen nicht gerecht. So bleiben die Versuche, eine Theorie des
guten Handelns bzw. des guten Lebens bei Nietzsche zu rekonstruieren, zweifelhaft. Dabei wird eine
„systematische Rekonstruktion“ des Denkens angestrebt, dem gerade „die Gestalt eines ethischen
Systems“ (Michael Steinmann, Die Ethik Friedrich Nietzsches, S. 241) nicht zu eigen ist.
65 Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze, S. VI.
66 Die Voraussetzung einer strengen Konsequenz im Denken, besonders im Falle Nietzsches, scheint
für eine schlüssige Interpretation unerlässlich zu sein. Doch diese Konsequenz muss nicht unbedingt
ein widerspruchsfreies System implizieren. Die eventuellen Widersprüche können aus bestimmten
strategischen Gründen gerade als gewollt angesehen werden.
Einleitung
23
einen Autor besser zu verstehen, als er sich selbst verstand.67 Nichtsdestoweniger
rühmt sie sich, der Gefahr, gegen bestimmte Plausibilitäten blind zu bleiben, zu
entgehen, aber nur dadurch, dass sie die Perspektive, in welche der moralkritische
Ansatz gestellt wird, mehrmals wechseln wird.
Jede Interpretation ist für den Einwand offen, dass ihre Auslegung der ursprünglichen Intention des Autors nicht gerecht wird. Die Untersuchung der Plausibilitäten
erhebt jedoch keinen Anspruch auf eine Darlegung der Philosophie des jeweiligen
Denkers, die systematischer und schlüssiger sein soll, als deren Urheber es selber
leisten konnte, sondern versucht auf das (in einer ausgewählten Perspektive) Wesentliche im Denken zu kommen, d. h. auf die irreduziblen Voraussetzungen, für die keine
weiteren Begründungen nötig zu sein scheinen. Aber auch diese Feststellung bleibt
natürlich der jeweiligen Interpretation verpflichtet, die nur eine mögliche ist. Eine
Selektion ist unvermeidlich und bleibt dem Beliebigkeits-Vorwurf ausgeliefert. Mit der
Frage nach den Plausibilitäten ist jedoch nicht nur ein Kriterium für diese Selektion
vorgegeben, sondern es ergeben sich zumindest noch drei weitere Vorteile. Eine
solche Untersuchung braucht erstens das jeweilige Denken nicht in ein System zu
zwängen, nicht einmal auf eine These zu verengen, die als Fazit dieses Denkens gelten
soll. Sie kann zweitens eine notwendige Distanz zu ihm behalten, indem seine Plausibilitäten mit ihren Alternativen konfrontiert werden, nicht indem sie es zu desavouieren sucht. Sie kann sich daher drittens eine Neutralität bezüglich der Frage leisten,
ob dieses Denken selbst plausibel ist. Besonders was Nietzsches Philosophie angeht,
erwies sich eine solche Neutralität bis jetzt als fast unmöglich: Man kann offensichtlich auch als Forscher der Versuchung kaum widerstehen, seine Philosophie in Schutz
zu nehmen bzw. sie widerlegen zu wollen; eine persönliche Stellungnahme scheint
praktisch unvermeidlich zu sein.68 Doch man kann trotzdem versuchen, sich auf einer
anderen Ebene zu bewegen – auf der Ebene der Untersuchung der Plausibilitäten, die
Alternativen haben und für die weitere Gründe nicht angegeben werden können.
Gerade deswegen kann man sich zwischen ihnen entscheiden. Auch wenn solche
Entscheidungen weder begründet noch widerlegt werden können, sind sie nicht als
beliebig anzusehen.69 Denn die Plausibilitäten stehen einem nicht einfach zur Verfügung. Die Einsicht, die ihre Macht offenlegt, ist nur auf Grund der ernsthaftesten
67 Simon betont m. E. mit Recht, dass man nur durch einen solchen Versuch dem Autor gerecht
werden kann (Simon, Das neue Nietzsche-Bild, S. 1). D. h.: Nur dadurch können seine Gedanken auch
für uns von Interesse sein bzw. neue Anregungen geben. „Die Aktualität Nietzsches zeigt sich in einer
neuen Art, ihn zu lesen.“ (S. 9)
68 Dies wäre auch Nietzsche wahrscheinlich recht. Vgl. „[d]ie grossen Probleme verlangen alle die
grosse Liebe […]“ (FW 345, KSA 3, S. 577). Wie man die Liebe in diesem Kontext auch deutet, eines ist
klar: Sie schließt die Gleichgültigkeit aus.
69 Vgl. bei Nietzsche: „Freigeworden von der Tyrannei der ‚ewigen‘ Begriffe, bin ich andrerseits fern
davon, mich deshalb in den Abgrund einer skeptischen Beliebigkeit zu stürzen: ich bitte vielmehr, die
Begriffe als Versuche zu betrachten, mit Hülfe deren bestimmte Arten des Menschen gezüchtet und auf
ihre Enthaltsamkeit und Dauer — — — “ (Nachlass, Mai–Juli 1885, 35[36], KSA 11, S. 526).
24
Einleitung
Auseinandersetzungen zu gewinnen. Die Entscheidung zugunsten eines neuen Ansatzes vollzieht sich, indem man den alten bis zu seiner äußersten Konsequenz verfolgt. Nur dann wird man im Stande sein, sich ihm gegenüber eine kritische Distanz
zu verschaffen und folglich auch andere Möglichkeiten einzusehen. Zu dieser mühevollen, doch auch spannenden philosophischen Arbeit will die vorliegende Untersuchung der deutsch-russischen Reflexionen einen Beitrag leisten.
Im ersten Kapitel wird Kants Kritik einer Moral aus Vernunft systematisch dargelegt – als in sich konsistenter Ansatz, der jedoch gewisse Schwierigkeiten mit sich
bringt, die einer äußersten, aus den ersten Unterscheidungen folgenden Konsequenz
entspringen und immer wieder dazu nötigen, neue Unterscheidungen zu treffen und
schließlich jedem weiteren Hinterfragen eine Grenze zu ziehen. Durch dieses Bemühen um eine Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft erweist sich schon bei Kant
eine Perspektivierung als unumgänglich: die Perspektivierung der Moral aus Vernunft
durch ein individuelles Vermögen der Urteilskraft, deren Richtschnur in Geschmacksurteilen gesucht wird und zur Untersuchung einer besonderen Tätigkeit nötigt, die
weder Erkenntnis noch praktisches Verhalten ist, sondern etwas Drittes, etwas, was
paradoxerweise als notwendig und kontingent zugleich gedeutet werden muss – die
Kunst. Die Kunst, wie sie schon von Kant verstanden wurde, bietet eine erste Distanzierung zur Moral aus Vernunft, ohne sie zu relativieren und sogar ohne jeden
Anspruch zu erheben, über ihre allgemeinen Prinzipien urteilen zu können. Kants
Perspektivierung der Moral aus Vernunft durch die Kunst soll uns dementsprechend
als Einleitung zum Problem der Plausibilitäten in der Moralphilosophie dienen. Die
kantischen Plausibilitäten werden allerdings erst durch die anderen drei Ansätze in
der Moralkritik ans Licht kommen können, wobei die Frage nach der Kunst immer
mehr an Gewicht gewinnen wird. Die nächsten drei Kapitel, zu Nietzsche, Tolstoi und
Dostojewski, sollen dementsprechend eine möglichst ähnliche Struktur haben: Nach
der kritischen Auseinandersetzung des jeweiligen Autors mit der Moral aus Vernunft
soll seine Perspektivierung der letzteren durch seine Deutung der Kunst gezeigt
werden – und dies nicht bloß als eine ‚Theorie‘ über Kunst, sondern als eine gewisse
Praxis im Umgang mit den philosophischen Schwierigkeiten, die er seinem moralkritischen Ansatz zu verdanken hat, als Versuch, Alternativen zu den von ihm aufgedeckten Plausibilitäten zu finden.
Das zweite Kapitel untersucht Nietzsches moralkritischen Ansatz. Im ersten Abschnitt wird Nietzsches Kritik an der kantischen Moral aus Vernunft systematisch
verfolgt, wobei die Plausibilitäten der letzteren sichtbar gemacht werden sollen.
Nietzsches eigene Plausibilitäten bzw. sein Umgang mit den durch seine Kritik an
Kant und der abendländischen Moralphilosophie ins Spiel gebrachten moralischen
Kriterien sollen im zweiten Teil desselben Kapitels thematisiert werden. Die Frage, wie
es möglich sein kann, nicht blind gegen eigene Plausibilitäten zu sein, ohne einem
erschlaffenden Relativismus zu verfallen, wird dabei in den Vordergrund gerückt. In
dem das Kapitel abschließenden Teil zur „Optik“ der Kunst soll dieses Problem in den
Zusammenhang mit Nietzsches Projekt der tragischen Philosophie gestellt werden.
Einleitung
25
Tolstoi und Dostojewski waren keine Philosophen in dem Sinne, wie man sie in
Deutschland zumindest zu Kants und Nietzsches Zeit verstand. Wenn man dennoch
von einer selbstständigen russischen Philosophie sprechen kann, so entstand diese
zunächst in der schöngeistigen Literatur. Hier gewinnt die Frage nach der Kritik einer
Moral aus Vernunft und ihrer Perspektivierung durch die Kunst eine neue Spannung.
Als Künstler-Philosophen haben Tolstoi und Dostojewski eher eine Position eingenommen, die als Umkehrung der kantischen verstanden werden kann. Die „Optik“
der Kunst war für sie selbstverständlich, sie war die erste Perspektive. Und die Philosophie selbst, auch als Kritik einer Moral aus Vernunft, entsprang dieser ersten
Perspektive der Kunst, u. a. verstanden als eigenes Schaffen, als eigene Weltinterpretation. Die wissenschaftlich fundierte Philosophie mit ihrem Problem der allgemeingültigen Wahrheit wurde dagegen als sekundär betrachtet und sogar als Anmaßung
gegenüber dem Leben, wie es einem Künstler erscheint – als begehrenswertes und
unvorhersagbares Abenteuer, als eine stetige Versuchung, als das Wertvolle schlechthin. Der wechselseitige Bezug zwischen Moral und Kunst bei den zwei großen russischen Denkern, die ihre moralkritischen Überlegungen wiederum für die Kunst
fruchtbar gemacht haben, wird im dritten und vierten Kapitel systematisch dargestellt,
wobei die Anknüpfungspunkte an Kants und Nietzsches moralphilosophische Ansätze besondere Berücksichtigung finden sollen.
Wie oben schon angedeutet, ist für eine solche Untersuchung bzw. Rekonstruktion eines großen intellektuellen ‚Dialogs‘ eine Einschränkung vonnöten. Im vorliegenden Buch sollen beide – Kants moralkritischer Ansatz und dessen Radikalisierung bei
Nietzsche – diese einschränkende Funktion erfüllen. Es ist nicht zu bestreiten, dass
diese Einschränkung eine gewisse Vergröberung und sogar Willkür impliziert. Denn
die Kritik am kantischen Ansatz einer Moral aus Vernunft war viel umfangreicher als
die hier dargestellten Zusammenhänge. Man denke nur an die Kritik Schillers, Herders, Hegels und Schopenhauers. Für Tolstois Perspektivierung der kantischen Philosophie spielte neben Schopenhauer wiederum Spinoza eine außerordentliche Rolle.
Eine vollständige Darstellung all dieser zum Teil in der Forschung noch nicht erschlossenen Fragen würde den Rahmen einer einzelnen Forschungsarbeit weit überschreiten. Daher werde ich zu ihnen nur am Rande Stellung nehmen. Diese Untersuchung der Plausibilitäten der Moralkritik erhebt, indem sie ihren Ausgangspunkt in
Kants Moralphilosophie setzt und Nietzsches Umgang mit den Plausibilitäten der
christlich-abendländischen Moral als ihren methodischen Leitfaden betrachtet, keinen Anspruch auf Vollständigkeit in der Darstellung der historischen Zusammenhänge.70
70 Das Phänomen des russischen Anti-Kantianismus sowie das der begeisterten Nietzsche-Rezeption
und deren Aneignung in der russischen Philosophie um die Jahrhundertwende (vom 19. zum 20. Jh.)
wurden mehrmals Gegenstand gezielter Untersuchungen und verdienen immer noch Aufmerksamkeit.
Diese Problemfelder werde ich im einführenden Teil des letzten Kapitels kurz darstellen. Sie können
dennoch, v. a. wegen der Vielzahl der Autoren und der Vielfalt ihrer Bezüge auf Kant und Nietzsche,
26
Einleitung
Erst wenn alle vier Ansätze in der Moral und ihre wechselseitigen Auseinandersetzungen rekonstruiert sind, werden die historischen Bezüge thematisiert. Im fünften
und letzten Kapitel wird Nietzsches Rezeption der zwei russischen Künstler-Philosophen dargelegt und, als Quintessenz dieser Re-Interpretation der russischen Kritik
einer Moral aus Vernunft, sein Werk Der Antichrist systematisch analysiert. Gerade in
diesem Werk, mit dem Nietzsche auf höchst anstößig-irritierende Weise versuchte,
seine „Umwertung aller Werte“ gegen die herrschende Moral des Abendlandes durchzusetzen, werden alle drei großen Moralkritiker (Kant, Tolstoi und Dostojewski) zusammengeführt und durch Nietzsches Deutung des „Typus des Erlösers“ verknüpft.
Diese Auseinandersetzungen sollen den Schlüsselpunkt der vorgelegten philosophischen Interpretation vom Antichrist ausmachen. Die Differenz der Plausibilitäten
zwischen den russischen Denkern und Nietzsches „letzter Moral“ wird im nächsten
Schritt systematisch interpretiert und in ihrer Bedeutsamkeit für den ganzen ‚Dialog‘
dargestellt, u. a. für Nietzsches Einschätzung Russlands als „einzige Macht“ Europas,
die „Etwas noch versprechen kann“ (GD Streifzüge, 39, KSA 6, S. 141). Ob dies eine
Überschätzung war oder aber ein Hinweis auf eine Option, wie die tragende Bedeutung der Moral für das Leben neu verstanden werden könnte, in beiden Fällen war sie
mit Nietzsches Projekt einer „Philosophie der Zukunft“ auf tiefste Weise verbunden.
Indem er sich mal als ersten und mal als letzten Philosophen bezeichnete,71 brachte er
immer wieder denselben Zweifel und dieselbe Hoffnung zum Ausdruck – den Zweifel,
dass die Philosophie über ihre grundlegenden Vorurteile hinaus noch sinnvoll betrieben werden kann; die Hoffnung auf immer neue Alternativen zu den von ihm erratenen Plausibilitäten, d. h. die Hoffnung, dass das wechselseitige Spiel vom Erraten und
Sich-Verraten, von De- und Neuplausibilisierung der eigenen Anhaltspunkte und der
eigenen Lebensperspektive immer noch den Philosophen vorbehalten bleibt. Von
dieser Hoffnung ist auch die vorliegende Untersuchung getragen. Wenn es ihr gelingt,
nicht nur die deutsch-russischen Differenzen in der Moralphilosophie zur Sprache zu
bringen, sondern auch den Anstoß zum Neudenken ihrer alten Fragen zu geben, wird
sie ihre Aufgabe als erfüllt ansehen.
nicht ausführlich expliziert werden. Darüber hinaus sollten sie in den Kontext von Phänomenen des
russischen Hegelianismus, des Marxismus oder der späteren Auseinandersetzung mit Heidegger
gestellt werden. Selbst eine nur vorläufige Betrachtung all dieser Fragen würde den Rahmen dieser
Arbeit sprengen.
71 Genauer gesagt nannte er sich „de[n] letzte[n] Jünger und Eingeweihte[n] des Gottes Dionysos“, der
als Gott Philosoph ist (JGB 295, KSA 5, S. 238).
Kapitel 1.
Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Die Ansicht, dass Kants Kritik des Vermögens der Vernunft eine radikale Wendung im
Denken des Abendlandes vollbracht und die Philosophie der folgenden zwei Jahrhunderte stark geprägt hat, gilt längst als Gemeinplatz der Philosophiegeschichte.
Durch die konsequente Abgrenzung des praktischen und des theoretischen Gebrauchs der Vernunft ist es Kant tatsächlich gelungen, zwar nicht ein System im
klassischen Sinne, aber doch ein für theoretisch-metaphysische Angriffe unanfechtbares philosophisches „Bauwerk“ zu vollenden, ohne das eigentliche Vernunftinteresse zu opfern – das Interesse an der „objectiven Realität“ ihrer Ideen (KU, AA 5,
S. 300). Das Praktische wurde dabei zum eigentlichen Kompetenzbereich der Vernunft, in dem sie nicht der steten Gefahr ausgeliefert ist, sich auf der Reise durch den
„stürmischen Ozean“ des dialektischen Scheins in einer „Nebelbank“ zu verlieren
(KrV A 236/B 295). Nur im Praktischen ist die Vernunft gesetzgebend und sind ihre
Ansprüche berechtigt. Hier kann die Vernunft ihren eigentlichen Sitz einnehmen, ihre
rechtmäßige Erbschaft einfordern: als „Vermögen, durch seine Vorstellungen Ursache
der Gegenstände dieser Vorstellungen zu sein“, als Vermögen zur Handlung (MS,
AA 6, S. 211). Aber auch die Synthesis des Mannigfaltigen, die unerlässliche Bedingung der Erkenntnis, bezeichnet Kant als Handlung (KrV A 77/B 102). Insofern wird
der theoretische Gebrauch der Vernunft dem praktischen, d. h. der Fähigkeit, das
Intelligible in der Sinnenwelt zu verwirklichen, untergeordnet, und eine Brücke
zwischen dem Intelligiblen und der Welt der Erscheinungen geschlagen. Das Vermögen dazu bekommt einen weiteren Namen, der allerdings kein geringer ist:
Das Vermögen eines Wesens, seinen Vorstellungen gemäß zu handeln, heißt das Leben. (MS, AA 6,
S. 211)
Das Leben ist mit dem Vermögen, die Vernunft praktisch umzusetzen, mit dem Vermögen, vernünftig zu handeln, für vernünftige Wesen identisch.
Für unsere Fragestellung ist diese Definition des Lebens als des primären Bereichs der Vernunft von erstrangiger Bedeutung.1 Die Aufgabe der Kritik, die Möglichkeit des Praktischen vor den unrechtmäßigen Forderungen der Vernunft zu retten,
1 Zu den Einwänden gegen Kants Moralphilosophie, sie sei dem Begriff des Lebens fremd geblieben
und stelle eine „Vergewaltigung des Lebens durch die Logik“ dar, vgl. Georg Simmel, Das individuelle
Gesetz. Ein Versuch über das Prinzip der Ethik, S. 186. Volker Gerhardt dagegen zeigt, dass die beiden
Begriffe, die Vernunft und das Leben, auf eine gegenseitige Erläuterung und Begründung angewiesen
sind und legt Kants Philosophie so als „Philosophie des Lebens“ aus (Gerhardt, Immanuel Kant.
Vernunft und Leben, S. 31). Vgl. dazu auch Josef Simon: „Die […] nachkritische philosophische Doktrin
steht nicht mehr im Dienst des Wissens […], sondern des Lebens mit dem Zweck, einen vernunft-
28
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
wird durch die Identifizierung des Lebens mit dem praktischen Prinzip der Vernunft
hervorgehoben und erfüllt. Die Vernunft, die auf eigene theoretische Anmaßungen
verzichtet, wird nicht bloß in Fragen des Lebens kompetent, sondern beansprucht
auch ein exklusives Recht, das Leben zu fördern. Die Frage, was das Leben für ein
unvernünftiges Wesen bedeuten könnte, lässt sich vernünftigerweise nicht stellen.2
Die Vernunft ist, sofern sie als Selbstbestimmung des Begehrungsvermögens, d. h. als
praktische Vernunft, verstanden wird, die Ermöglichung des Lebens für den Menschen.3
Den Maßstab für die Lebendigkeit der vernünftigen Wesen gibt damit die praktische Vernunft bzw. der Wille.4 Der Letztere als Vermögen, sich durch die Prinzipien
bestimmen zu lassen, die von der besonderen Beschaffenheit des Subjekts unabhängig sind, als Vermögen zur Reinigung eigener Triebfedern von allem Empirischen,
erhebt das Unpersönlich-Allgemeine zum Kriterium der einzelnen Handlungen. Diese
Identifikation des menschlichen Lebens mit dem Willen, dem die Vorstellung des
Allgemeinen zur Richtschnur wird, die Identifikation der Freiheit mit der Autonomie
des Willens5 und später mit der Heautonomie der Urteilskraft sind Kants wichtigste
Schritte zur Vervollkommnung der Moral aus Vernunft gewesen, die dem russischen
Denken jedoch als eine Vereinfachung des Rätsels der menschlichen Existenz fragwürdig erschienen. Der Begriff des Lebens wurde hier als Gegenbegriff gegen Kant,
aber auch gegen die abendländische Moralphilosophie im Ganzen ausgespielt. Die
Relativierung des moralischen Ansatzes der Vernunft aus der Perspektive des Lebens
und das Misstrauen gegen Kants Voraussetzung der Zweckmäßigkeit der Gemütskräfte zur Auffassung des Rätsels des Lebens führten konsequenterweise zu Nietzsches Kritik der kantischen kritischen Vernunft. Insofern blieb Kant als Hauptgegner,
als Spitze der Gegenbewegung im russischen Denken präsent und unersetzlich. Denn
Kants Vervollkommnung der Moral aus Vernunft wurde als Ausgangspunkt der Um-
gemäßen Begriff des Wissens in seiner Bedeutung für das Leben zu vermitteln“ (Josef Simon, Kant. Die
fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 6).
2 Vgl. Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, AA 4, S. 544. Der Begriff des Lebens ist
hier, wenn auch in metaphysischer Absicht, mit Denken und Begehren identifiziert.
3 Vgl. die in der Kritik der reinen Vernunft vorkommende „transzendentale Hypothese“, „daß alles
Leben eigentlich nur intelligibel sei“, die allerdings ein problematisches Urteil bleibt, das als Privatmeinung gegen „entgegengesetzte transzendente Anmaßungen“ nützlich sein kann (KrV A 789/
B 808 f.). Laut derReligion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft soll die Menschheit als Naturanlage „eines lebenden und zugleich vernünftigen“ Wesens verstanden werden (RGV, AA 6, S. 26).
4 Das Begehrungsvermögen als oberes Vermögen ist der Wille oder die praktische Vernunft. Zwar sind
für die Beförderung des Lebens auch die unteren Begehrungsvermögen notwendig, dennoch, so Kant,
„gäbe es keine bloß formale Gesetze desselben, die den Willen hinreichend bestimmen, so würde auch
kein oberes Begehrungsvermögen eingeräumt werden können“, und der Wille könnte niemals einen
berechtigten Anspruch erheben, allein der Bestimmungsgrund der Willkür zu sein (KpV, AA 5, S. 22).
Das wäre so viel als zu sagen, es wäre kein Wille als solcher denkbar.
5 Vgl. „[…]denn Freiheit und eigene Gesetzgebung des Willens sind beides Autonomie, mithin Wechselbegriffe […].“ (GMS, AA 4, S. 450)
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
29
orientierung der europäischen Philosophie betrachtet: als Kontinuität des aus russischer Sicht westlich-rationalen, „optimistischen“ Gangs der Vernunft und zugleich
als aus dem kritischen Ansatz folgende Diskontinuität dieses Gangs, die unvermeidlich zur „vornehmen Skepsis“ (FW 358, KSA 3, S. 603) und zum Pessimismus im Sinne
Nietzsches führte.6
In dieser Perspektive treten einige Aspekte von Kants kritischem Unternehmen in
den Vordergrund. Neben dem Begriff des Lebens taucht ein weiterer Schlüsselbegriff
auf, der zur Vervollkommnung des kantischen Projekts der Vernunftkritik führen
sollte: der des Schönen. An das Rätsel des Lebens bzw. des Organischen kann nach
Kant allein die reflektierende Urteilskraft herankommen. Ihr apriorisches Prinzip
findet sie jedoch weder im theoretischen noch im praktischen Bereich, sondern im
Urteilen über Geschmacksachen.7 Das Schöne führt bei sich „directe ein Gefühl der
Beförderung des Lebens“ (KU, AA 5, S. 244), und das Erlebnis des Schönen wird von
einem „belebende[n] Princip im Gemüthe“ begleitet, d. h. vom „Schwung“ eines
Spiels, „welches sich von selbst erhält und selbst die Kräfte dazu stärkt“ (KU, AA 5,
S. 313). So kommt Kant zu dem Begriff, der eine zentrale Rolle für Hegels Auseinandersetzung mit seiner Philosophie spielen wird: zum Begriff des Geistes, allerdings mit
einem einschränkendem Zusatz – „der Geist, in ästhetischer Bedeutung“. Der Geist
gibt Kants Begriff des Lebens einen neuen Sinn.8 Das Leben ist nicht nur das Vermögen zu handeln, sondern auch die Freiheit des Spiels, die den Kräften (und nicht
nur den Gemütskräften, sondern auch denen des Körpers, wie im Lachen oder im
Hören der Musik9) zum harmonischen Miteinander, zum „Gefühl der Gesundheit“
verhilft (KU, AA 5, S. 331 ff.). Es ist die Freiheit aller Gemütskräfte, in der sich die
Lebenskraft zeigt, die lebendige und vollkommene Freiheit des Geistes, die sich von
der Freiheit des Willens unterscheiden lässt und ihr sogar in gewissem Sinne überlegen ist.10 So wird durch den Begriff des Lebens die Differenz zwischen der Moral und
6 Vgl. GT 18, KSA 1, S. 118. Kant selber wies bekanntlich alle Vorwürfe zurück, er habe der Skepsis die
Tür geöffnet. S. z. B. Was heißt: Sich im Denken orientiren?, AA 8, S. 146.
7 Vgl. Reinhard Brandts Interpretation ästhetischer Urteile als Ausdruck der ursprünglichen Tätigkeit
der Vernunft, die sich als Gefühl des Lebens in Bezug auf alles Erkennen und Begehren erweist:
Reinhard Brandt, Die Schönheit der Kristalle. Überlegungen zu Kants Kritik der Urteilskraft.
8 Wie Werner Stegmaier bemerkt, führt „die Kritik der reflektierenden Urteilskraft“ „Kant über den
Begriff der Vernunft hinaus zum Begriff des Geistes als einem Begriff nicht mehr nur für die Einheit,
sondern für die Dynamik der Erkenntniskräfte“ (Werner Stegmaier, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 115).
9 Kant beschreibt ihre Wirkung physiologisch, als Übergang von den ästhetischen Ideen zum „Spiel
von der Empfindung des Körpers“ (KU, 332). „D a s L a c h e n i s t e i n A f f e c t“ (KU, AA 5, S. 332), die
Musik die „Sprache der Affecte[ ]“ (KU, AA 5, S. 328).
10 So deutet Kant selbst diesen Unterschied: „Denn wo das sittliche Gesetz spricht, da gibt es objektiv
weiter keine freie Wahl.“ In ästhetischer Absicht ist dagegen die Einbildungskraft von allen Schranken
befreit. Indem sie „mit dem Gegenstand des Wohlgefallens nur spielt“, versetzt sie das Gemüt in ein
freies Spiel mit sich selbst (KU, AA 5, S. 210). Nach Birgit Recki handelt es sich im Ästhetischen und
Ethischen weder um verschiedene Grade der Freiheit noch um verschiedene Begriffe der Freiheit,
30
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
der Kunst, dem Guten und dem Schönen, der Vernunft und dem Geist bedeutsam. Auf
diese Spannung geht Kant in seiner dritten Kritik ausführlich ein.
Die besondere Stellung der Kritik der Urteilskraft, ihre Aufgaben und ihre Rolle für
das kritische Unternehmen der Vernunft werden in der Kant-Forschung unterschiedlich gedeutet: ob sie eine systematische Vollendung darstelle11 oder gerade einen
Beweis von deren Unmöglichkeit;12 ob es hier primär um die Teleologie bzw. die
Begründung der naturwissenschaftlichen Forschung13 oder um die Hervorhebung des
sondern um „vielmehr verschiedene kontextspezifische Weisen ihrer Realisierung“ (Birgit Recki, Die
Dialektik der ästhetischen Urteilskraft, S. 204). Was diese Kontextspezifik bedeutet, soll im Folgenden
geklärt werden. Zu Differenzen im Begriff der Autonomie im Praktischen (im Handeln) und in der
Ästhetik (im Urteilen über das Schöne) s. Gerold Prauss, Kant über Freiheit als Autonomie, S. 291 ff.
11 Vgl. die kooperative Interpretation „Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft“. In dem einleitenden
Beitrag von Otfried Höffe werden drei Aufgaben der dritten Kritik überzeugend dargelegt: Als erste das
Systeminteresse, als zweite die Untersuchung zweier Bereiche, die sich einer Theorie entziehen,
nämlich des Ästhetischen und des Lebendigen, und, last but not least, eine Revision der bisherigen
Ergebnisse der kritischen Philosophie als Folge der beiden ersten Aufgaben (Otfried Höffe, Einführung
in Kants Kritik der Urteilskraft). Anders als Höffe interpretiert jedoch Josef Früchtl Kants dritte Kritik
zwar als Ergänzung der ersten zwei und Begründung ihrer Einheit, doch in der Meinung, ihre
Bedeutung trete nur dann in den Vordergrund, wenn man postmodern bzw. nachmetaphysisch urteilt,
„daß nämlich Kant seine epistemologische und moralphilosophische Grundlegung in der Tat nicht
gelingt“ (Josef Früchtl, Ästhetische Erfahrung und moralisches Urteil. Eine Rehabilitierung, S. 422). Zum
Thema s. auch den Sammelband: Reinhard Hiltscher, Stefan Klingner, David Süß (Hg.), Die Vollendung
der Transzendentalphilosophie in Kants „Kritik der Urteilskraft“.
12 Eine Tendenz, Kants dritte Kritik als einen besonderen Teil zu betrachten, mit dem es Kant um das
Ästhetische bzw. um das Schöne bloß als Anhang zu den theoretischen und praktischen Teilen geht,
hat Wolfgang Bartuschat bei den neukantianischen Interpreten ausgemacht (Wolfgang Bartuschat,
Zum systematischen Ort von Kants Kritik der Urteilskraft, S. 7). Er versucht dagegen, durch eine
systematische Untersuchung der dritten Kritik, Kants „theoretische und praktische Philosophie als
Momente eines Systems“ zu deuten, „das seine Möglichkeit in einem Prinzip hat“ (S. 8). Dafür werden
die beiden ersten Kritiken „unter einem Aspekt betrachtet, auf den Kant selbst in ihnen nicht reflektiert
hat“ (S. 79): Die Urteilskraft wird trotz der „Nicht-Thematisierung“ in Kants ersten Kritiken zur zentralen Instanz, die zwischen Denken und Sinnlichkeit bzw. zwischen „Prinzip und Gegebenheit“
vermittelt, und die der Vernunft schließlich zwar keine doktrinale, aber doch eine systematische
Einheit verschaffen soll. Die reflektierende Urteilskraft, so Wolfgang Bartuschat, ermöglicht dem
Urteilenden erst, die Sinnlichkeit mit Spontaneität zu verknüpfen (S. 250 f.). Laut Robert Kudielka hatte
das Bestreiten der organischen Einheit nicht nur der drei Kritiken, sondern auch der dritten Kritik als
solcher durch Schopenhauer zur Folge, dass „die Kantforschung […] sich diesem Verdikt stillschweigend angeschlossen“ hat (Robert Kudielka, Urteil und Eros, Erörterungen zu Kants Kritik der Urteilskraft,
S. 16). Kritisch zur Trennung zweier Teile der dritten Kritik, die nicht nur von Schopenhauer, sondern
auch von mehreren Forschern als gewaltsam verknüpft angesehen werden, s. z. B. Jochen Bojanowski,
Kant über das Prinzip der Einheit von theoretischer und praktischer Philosophie (Einleitung I–V), bes.
S. 25.
13 Dies ist nach Gadamer Kants primäre Intention in der Kritik der Urteilskraft. Deswegen wurde die
Naturschönheit der Kunstschönheit vorgezogen, was soviel bedeutet: „Kants transzendentale Reflexion aus einem Apriori der Urteilskraft rechtfertigt den Anspruch des ästhetischen Urteils, läßt aber eine
philosophische Ästhetik im Sinne einer Philosophie der Kunst im Grunde nicht zu (Kant selbst sagt: der
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
31
Werts des Sinnlichen gehe;14 ob sie von einer Erweiterung des kritischen Anliegens
handle15 oder vielmehr von einer Kunstphilosophie.16 Hier gibt es sichtlich viel Spielraum für Interpretationen, und jede bietet eine andere Perspektive nicht nur auf dieses
Werk, sondern auf das Ganze der Kritik.17 Auch wenn die Aufgaben der dritten Kritik
Kritik entspricht hier keine Doktrin oder Metaphysik)“ (Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode,
S. 51 f.). Diese Gleichsetzung der Kunstphilosophie mit dem, was Kant Doktrin oder Metaphysik der
Kunst nennt, scheint allerdings gerade für die Kritik der Urteilskraft nicht plausibel zu sein.
14 So sieht Georg Römpp in der Kritik der Urteilskraft eine Ergänzung der bereits konzipierten Theorie
der Freiheit, nach der Freiheit und Sinnlichkeit gerade nicht als diametrale Gegensätze zu fassen sind;
die Freiheit sollte in der Sinnenwelt denkbar sein. Römpp weist in diesem Zusammenhang auf „Schillers Verdienst“ hin, die zweite und die dritte Kritik „in einem einzigen Gedankengang zusammenzufassen“ (Georg Römpp, Schönheit als Erfahrung von Freiheit. Zur transzendentallogischen Bedeutung
des Schönen in Schillers Ästhetik, S. 429). Dabei wird wiederum die integrierende Rolle von Kants
Philosophie des Schönen hervorgehoben. Auch wenn zu bezweifeln ist, ob diese Lektüre Kants durch
Schillers Ästhetik den Freiheitsbegriff hinreichend differenziert in Betracht zieht: Das freie Spiel aller
Erkenntnisvermögen und die Spontaneität der Selbstbestimmung scheinen gerade bei Kant nicht auf
einander reduzierbar zu sein. Vgl. Friedrich Schiller, Kallias-Briefe. Weiter zum Thema s. Gerhard
Blum, Zum Begriff des Schönen in Kants und Schillers ästhetischen Schriften,; Wolfgang Düsing,
Ästhetische Form als Darstellung der Subjektivität.; Ulrich Tschierske, Vernunftkritik und ästhetische
Subjektivität.
15 S. bspw. Hjördis Nerheim, Zur kritischen Funktion ästhetischer Rationalität in Kants Kritik der
Urteilskraft.
16 Zwar beschäftigt sich die Kritik der Urteilskraft primär mit den ästhetischen Urteilen bzw. ihren
Möglichkeitsbedingungen, dennoch kann diese Fragestellung als besonderer Einstieg in die Kunsttheorie betrachtet werden. Schon Schiller und Goethe haben sie unter diesem Blickwinkel gelesen. In
der Geschichte der späteren Kant-Rezeption und der philosophischen Auseinandersetzung mit Kants
Ästhetik stellt Lyotards Kant-Lektüre eine wesentliche Verschiebung des Interesses von der Frage nach
dem Schönen und v. a. dem Naturschönen zur Frage nach dem Erhabenen und zur Kunsttheorie dar
(Jean-François Lyotard, Die Analytik des Erhabenen. Kant-Lektionen, Kritik der Urteilskraft, §§ 23–29).
Die Frage, ob Kants dritte Kritik eine Kunstphilosophie enthält, gehört allerdings zu den viel diskutierten Problemen der Kantforschung, wobei das Spektrum der möglichen Antworten von der
Negation bis zur zugespitzten These reicht, die Philosophie der Kunst sei der wichtigste Teil von Kants
„Kritik der ästhetischen Urteile“. S. z. B. die Beiträge von Serge Trottein, Esthétique ou philosophie de
l’art? und Christel Fricke, Kants Theorie der schönen Kunst. Es gibt auch zahlreiche Versuche, die Kritik
der Urteilskraft „indirekt“ zu lesen bzw. sie als Grundlage für eine Interpretation der zeitgenössischen
Kunst auszulegen (Gernot Böhme, Kants Kritik der Urteilskraft in neuer Sicht) oder vor dem Hintergrund
der modernen Kunstphänomene bzw. Kunsttheorien auf ihre Tragweite hin zu überprüfen (Heinz
Spremberg, Zur Aktualität der Ästhetik Immanuel Kants. Ein Versuch zu Kants ästhetischer Urteilstheorie
mit Blick auf Wittgenstein und Sibley). Vgl. auch Walter Biemel, Die Bedeutung von Kants Begründung
der Ästhetik für die Philosophie der Kunst.
17 Zu Zwischenpositionen und Einzelfragen vgl. auch Andrea Esser (Hg.), Autonomie der Kunst? Zur
Aktualität von Kants Ästhetik. Die Literatur zur Kritik der Urteilskraft ist umfangreich. Ich kann hier nur
auf einzelne, für meine Fragestellung besonders wichtige Untersuchungen hinweisen, die sich um eine
konsistente Auslegung des Werkes bemühen, in denen die Kritik der Urteile über das Schöne in ihrer
Bedeutung für die Philosophie Kants dargestellt wird. S. Henry E. Allison, Kant’s Theory of Taste:
A Reading of the Critique of Aesthetic Judgment; Donald W. Crawford, Kants’s Aesthetic Theory; Paul
Guyer, Kant and the Claims of Taste; Ted Cohen, Paul Guyer (Hg.), Essays in Kant’s Aesthetics; Georg
32
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
strittig bleiben, ist sie eine unerschöpfliche Quelle für jede dieser Fragestellungen. Es
darf allerdings nicht übersehen werden, dass sich Kants eigene Sicht auf die Aufgabe
der dritten Kritik im Lauf ihrer Niederschrift wenn auch nicht grundsätzlich verändert,
so doch wesentlich verschoben hat.18 Wenn es sein ursprüngliches Ziel war, den
theoretischen und den praktischen Gebrauch der Vernunft in ein System zusammenzuführen, so scheiterte er am Ende damit. Im Unterschied zur ersten Einleitung lässt
Kant in der zweiten, der veröffentlichten Version das Wort „System“ gerade fallen. Die
Aufgabe der dritten Kritik wird hier als bloßer „Übergang“ und „Verknüpfung“ zwischen zwei radikal unterschiedlichen Prinzipien des Theoretischen und Praktischen
umgedeutet.19 So stelle die Kritik der Urteilskraft zwar die Vollendung seines kritischen
Unternehmens dar, stoße aber an eine Grenze, an der die Vernunft „der Natur ihr
Geheimniß“ nicht „gänzlich ablocken“ kann (KU, AA 5, S. 233).
Bezeichnenderweise hat diese Grenze, an der das Rätselhafte der Vernunft sich
zeigt, ihre Gegenstücke in den beiden ersten Kritiken. Mit folgender These hat Kant
seine Kritik der reinen Vernunft eröffnet: Das Schicksal der menschlichen Vernunft,
„durch Fragen belästigt“ zu werden, die sie weder abweisen noch beantworten kann
(KrV A VII), ist auch das Rätselhafte, das die Vernunft an ihre Grenzen treibt, wo sie
ihre Neugier nie befriedigen kann. Aber auch die praktische Vernunft kommt an ihre
Grenze, wo keine Erklärung mehr möglich ist: Das „Factum der Vernunft“ bleibt als
unerforschliche und dennoch einzig mögliche Legitimation ihrer Ansprüche nur in
seiner Unbegreiflichkeit begriffen.20 Jedoch konnten beide Rätsel im theoretischen
Kohler, Geschmacksurteil und ästhetische Erfahrung: Beiträge zur Auslegung von Kants „Kritik der
ästhetischen Urteilskraft“; Jens Kulenkampff, Kants Logik des ästhetischen Urteils; Gérard Lebrun, Kant
et la fin de la métaphysique: essai sur la critique de la faculté de juger; Luigi Pareyson, L’Estetica di Kant.
18 Nach der scharfsinnigen und, meines Erachtens, immer noch aktuellen Bemerkung von Gerold
Prauss trägt die Forschungsliteratur „viel zu wenig“ „der Tatsache Rechnung, daß Kant vielmehr
entgegen diesem Anschein der Entschiedenheit, den sie erwecken, […] [s]ogar inmitten der veröffentlichten Schriften seiner klassisch-kritischen Periode […] noch auf Schritt und Tritt in Experimenten
begriffen [ist], deren Ausgang für ihn selbst und dann erst recht für seine Leser offen bleibt“ (Prauss,
Kant über Freiheit als Autonomie, S. 9.).
19 Das System ist unmöglich, weil die Freiheit „nicht zusammen mit der Natur in einem Dritten
aufgehoben“ werden konnte (Stegmaier, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 102). Kant hat darauf
ausdrücklich verzichtet. In der veröffentlichten Variante spricht er von der Verknüpfung zweier
Prinzipien, nicht von ihrer Einheit und nicht von dem System. Dieses Verschieben der Begrifflichkeit
wird in den Untersuchungen zur dritten Kritik nicht immer genug beachtet. S. etwa den schon
genannten Beitrag von Jochen Bojanowski, der das Problem der Einheit der Philosophie anhand der
Einleitung zur Kritik der Urteilskraft darstellt, ohne den Unterschied zwischen der ersten und zweiten
Einleitung ausdrücklich anzusprechen. Zu einem ausführlichen Vergleich beider Einleitungen s.
Kulenkampff, Kants Logik des ästhetischen Urteils, S. 59 ff. Über die Entstehung der ersten Einleitung s.
Norbert Hinske, Zur Geschichte des Textes, S. III–XII.
20 Der theoretischen Vernunft ist ihre Grenze in der Annahme einer „absolute[n] Notwendigkeit
irgendeiner obersten Ursache der Welt“, der praktischen durch „die absolute Notwendigkeit“ „der
Gesetze der Handlungen eines vernünftigen Wesens“ gezogen (GMS, AA 4, S. 463).
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
33
und im praktischen Gebrauch der Vernunft durch die Unterscheidung von Noumena
und Phaenomena ausgegrenzt werden, bzw. dadurch, dass das Übersinnliche als für
die Erkenntnis unerreichbar, seine Annahme als Bestimmungsgrund der Handlung
dagegen als unumgänglich vorausgesetzt wurde.21 Unter diesen Bedingungen wurde
ein konsequenter Gang der Kritik in aller Deutlichkeit möglich. Es ist nun die Urteilskraft, in der das Rätselhafte unseres Gemüts sich nicht ausklammern, nicht unter
bestimmten Voraussetzungen zurückweisen lässt. Die „Dunkelheit in der Auflösung“
des „Problems“ lässt sich nicht vermeiden (KU, AA 5, S. 170). Das in concreto urteilende und handelnde Subjekt hat keine Regel als Kriterium für seine Urteile, nur das
Kriterium des Passens, für das wiederum nur ein Merkmal vorhanden ist: das Gefühl
der Lust. Ob dieses Gefühl als Genese der Erkenntnis zu verstehen ist oder sich nur auf
die Geschmacksurteile bezieht, bleibt Gegenstand der Diskussion bis heute.22 Die
Antwort hängt wesentlich davon ab, wie man die Stellung der Urteilskraft und ihre
Notwendigkeit für das Ganze der Architektonik der Kritik bewertet, aber auch davon,
ob Kant als Theoretiker der Erkenntnis und philosophischer Systematiker betrachtet
wird23 oder ob man seine größte „Errungenschaft“ eher in dem „ungeheuren Fragezeichen“ sieht, welches das kritische Unternehmen ausmacht:24 das Infragestellen
und Zurückweisen der theoretischen Anmaßungen der Vernunft durch sie selbst. Im
letzteren Fall kommt der Kritik der Urteilskraft, gerade weil sie keinen doktrinalen Teil
der Philosophie ausmachen kann, die Würde zu, das Gewölbe des kritischen Unternehmens der Vernunft zu schließen, deren Untersuchung zur Sicherung des Bodens
des ganzen Gebäudes vor dem „Einsturz“ notwendig war, „damit es nicht an irgend
einem Teile sinke“ (KU, AA 5, S. 168). Das bedeutet, dass die ersten zwei Kritiken diese
Sicherheit noch nicht erreicht haben. Die Urteilskraft stellt dementsprechend nicht
bloß eine Verknüpfung der heterogenen Prinzipien dar.25 Vielmehr geht es um die
21 Zu Kants Grenzziehung im theoretischen und praktischen Gebrauch der Vernunft s. Wilhelm
Vossenkuhl, „Von der äußeren Grenze aller praktischen Philosophie“, S. 311.
22 Wolfgang Wieland schlägt vor, das Problem, dass „Erkennbarkeit und Schönheit konvergieren“,
durch die Unterscheidung von Begründung und Genese der Erkenntnis zu lösen (Wolfgang Wieland,
Urteil und Gefühl. Kants Theorie der Urteilskraft, S. 362 ff.). Zu dieser Debatte s. Dieter Henrich, Aesthetic
Judgment and the Moral Image of the World. Studies in Kant, S. 43 f.
23 Diese Perspektive wird öfters pauschal als die des Neukantianismus bezeichnet. Dennoch ist
letzterer sowohl in Ansehung seiner eigenen Aufgaben als auch in seiner Betrachtungsweise der
Aufgaben Kants keineswegs homogen. Vgl. dazu Ernst Wolfgang Orth, Helmut Holzhey (Hg.), Neukantianismus. Perspektiven und Probleme. S. besonders die Einleitung von Ernst Wolfgang Orth, Die Einheit
des Neukantianismus (S. 13–30). Unter anderem weist Orth auf die Formulierung von Ernst Cassirer hin,
der im Anschluss an den Enzyklopädisten d’Alembert sagte, „der esprit de système sei durch den esprit
systématique zu ersetzen“ (Ernst Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, S. 9; zit. nach dem Beitrag
von Orth, S. 16).
24 Vgl. FW 357, KSA, 3, S. 598. Auf diese Einschätzung Nietzsches wird ausführlicher im nächsten
Kapitel eingegangen.
25 Wolfgang Bartuschat sieht die Notwendigkeit der Urteilskraft vor allem in der Verbindung der
verschiedenen Prinzipien, durch die eine systematische Einheit entsteht. Er macht dennoch deutlich,
34
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Möglichkeit und Tragweite des ganzen Gebrauchs der Vernunft für das in concreto
urteilende Subjekt, das im Bereich der Naturerkenntnisse, der Handlung und des
Genusses zurechtkommen muss.
Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Urteilskraft für die Vervollkommnung
der Moral aus Vernunft als Plausibilität der Kritik betrachtet, die all ihre anderen
Plausibilitäten legitimiert. Grundlegend ist hier der Ansatz von Josef Simon, der in
Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie eine neue Perspektive in der
Kant-Interpretation bietet, indem er Kant als Wegbereiter Nietzsches, aber auch Wittgensteins und Levinas', liest. Simon zeigt u. a., dass wichtige Aspekte der Wende Kants
von den späteren Philosophien nicht überboten und schon gar nicht widerlegt, sondern
weiter erschlossen und entwickelt wurden. Dafür wird der Schwerpunkt vom normativen Begriff der allgemeinen Menschenvernunft, an der alle Vernunftwesen gleichermaßen beteiligt sein sollen, auf die irreduzible ästhetische Differenz zwischen meiner und
der mir prinzipiell nicht zugänglichen fremden Vernunft verlagert. Als Quelle des
Irrtums sieht Kant Simon zufolge nicht den Einfluss der Sinnlichkeit auf das Urteilen,
sondern das Nicht-Bemerken der unvermeidlichen ästhetischen Bedingtheit des eigenen Urteils. Das gilt auch für die moralischen Urteile: Denn nicht die Neigungen sind
die Quelle des Bösen, und nicht die Vertilgung des Tierischen ist der Weg zum Guten,
sondern das stetige Bedenken, inwiefern der Handelnde sich seiner Vernunft bedient
hat oder vielmehr sich durch die eigene ästhetische Beschaffenheit bedingen ließ, d. h.
das Bedenken, inwiefern sein moralisches Urteil nicht unfehlbar sein mag. Dies ist die
eigentliche Begründung der Notwendigkeit der Kritik als des einzigen Weges, der Kant
zufolge der Philosophie „noch offen“ steht (KrV A 856/B 884): Für die nicht rein vernünftigen, ästhetisch bedingten Wesen führt der Weg zur Vernunft immer nur über die
Kritik an der eigenen Vernunft in ihrem eigenen Gebrauch. D. h.: Er verläuft über die
Urteilskraft als Vermögen, das nicht gelehrt, sondern nur geübt werden kann (KrV
A 133/B 172). Es ist eine moralische Pflicht, die Unvollkommenheit der eigenen Urteilskraft zu bedenken. Simon betont dabei nicht nur den Primat des praktischen Gebrauchs
der Vernunft vor dem theoretischen, sondern auch den propädeutischen Charakter der
Kritik, die, nachdem die Begriffe und Prinzipien in der Elementarlehre analysiert und
deduziert wurden, zur Methodenlehre übergehen muss.26 Die Struktur aller drei Kriti-
dass sich letztere auf kein Prinzip, sondern nur auf das „Medium der subjektiven Spontaneität“
gründen lässt. Die Urteilskraft wird allerdings hier nur deswegen als notwendig angesehen, weil die
Kritik der reinen Vernunft und die Kritik der praktischen Vernunft bezeichnenderweise als Kants „doktrinale Philosophie“ bzw. „unter dem Aspekt ihrer Doktrinalität“ betrachtet werden. Diese wird als ihre
„Tauglichkeit“ verstanden, den Bezug „auf einen zu konstruierenden objektiven Bereich“ herzustellen
(Bartuschat, Zum systematischen Ort von Kants Kritik der Urteilskraft, S. 246 ff.). Es ist also nicht nur die
Verbindung zwischen zwei Bereichen der Vernunft, die die Urteilskraft leistet, sondern sie behebt auch
und v. a. die Mangelhaftigkeit beider, die aus ihrem objektiven Anspruch entsteht.
26 Nur für die „Kritik der ästhetischen Urteilskraft“ ist das anders. Dies wird von Kant damit begründet, dass „das Urtheil des Geschmacks nicht durch Principien bestimmbar ist“ (KU, AA 5, S. 355).
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
35
ken, so Simon, zeigt, dass jene Aufgabe, die normativen Prinzipien aufzufinden und
festzuhalten, nur aufgrund der Unterscheidung bestimmt werden kann, die Kant in der
Methodenlehre der Kritik der reinen Vernunft hervorhebt und die in der dritten Kritik
noch an Bedeutung gewinnt: die Unterscheidung der Stufen bzw. der Modi des Fürwahrhaltens als Meinen, Wissen und Glauben.27 Der Irrtum besteht nicht darin, dass
der Urteilende bestimmte Meinungen hat, sondern darin, dass er sie für Wissen hält.28
Wie Simon es ausdrückt, kann man von der Kritik her nur sagen, dass „der Wissende zu
wissen glaubt“29 oder, anders gesagt, dass das Wissen mit seinem objektiven Anspruch
„zum eigentlichen Gegenstand der Kritik“ geworden ist.30 Man kann sich überreden
bzw. überreden lassen, man habe objektiv hinreichende Gründe für sein Fürwahrhalten (das Wissen), wo in Wirklichkeit nur subjektive Gründe gelten (der Glaube) oder
aber sowohl objektive als auch subjektive Begründungen unzureichend sind (das
Meinen). Das Problem ist, dass man diese Stufen des Fürwahrhaltens nicht mit Sicherheit vom eigenen Standpunkt aus unterscheiden kann. „Wer überredet ist, hält sich
selbst für überzeugt“.31 Man muss darum die „Privatgültigkeit des Urtheils“ „mit den
Gründen“ des Fürwahrhaltens, „die für uns gültig sind, an andere[m] Verstand“ testen,
„ob sie auf fremde Vernunft eben dieselbe Wirkung thun, als auf die unsrige“ (KrV
B 849). Simon hebt die folgende Stelle der Kritik hervor:
Der Probirstein des Fürwahrhaltens, ob es Überzeugung oder bloße Überredung sei, ist also
äußerlich die Möglichkeit, dasselbe mitzutheilen, und das Fürwahrhalten für jedes Menschen
Vernunft gültig zu befinden […]. (KrV A 821/B 848)
Dieser für Kants kritischen Ansatz grundlegende Gedanke kommt nochmals besonders deutlich (und das ist kein Zufall) in der Kritik der Urteilskraft zum Ausdruck:
Erkenntnisse und Urtheile müssen sich sammt der Überzeugung, die sie begleitet, allgemein
mittheilen lassen; denn sonst käme ihnen keine Übereinstimmung mit dem Object zu: sie wären
insgesammt ein bloß subjectives Spiel der Vorstellungskräfte, gerade so wie es der Skepticism
verlangt. (KU, AA 5, S. 238)
Die Mitteilung ist somit nach Kant der einzig mögliche Weg, die Überzeugung von
der Überredung abzugrenzen, d. h. „etwas in ihm, was bloße Überredung ist, zu
27 Vgl. KrV A 822/B 850; Logik, AA 9, S. 65.
28 Vgl. „Man kann vor allem Irrthum gesichert bleiben, wenn man sich da nicht unterfängt zu
urtheilen, wo man nicht so viel weiß, als zu einem bestimmenden Urtheile erforderlich ist. Also ist
Unwissenheit an sich die Ursache zwar der Schranken, aber nicht der Irrthümer in unserer Erkenntniß“
(Was heißt: Sich im Denken orientiren?, AA 8, S. 136). In Kants Antwort auf den sog. Spinozismus-Streit
wird die Unterscheidung der Modi des Fürwahrhaltens wiederum bedeutsam (Was heißt: Sich im
Denken orientiren?, AA 8, S. 141).
29 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 81.
30 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 89.
31 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 69.
36
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
entdecken“. Dies aber bedeutet, dass, indem die Erkenntnisse und Urteile mitgeteilt
werden, der Sprache eine besondere Funktion zukommt, die Begriffe der Philosophie
immer neu zu verdeutlichen. Letztere, so macht Kant in der Methodenlehre zur ersten
Kritik deutlich, stehen „niemals in sicheren Grenzen“ und ihnen soll, im Unterschied
zu den Begriffen der Mathematik, der „Ehrenname[ ] der Definition“ verweigert werden. Sie seien keine Definitionen, sondern immer nur „Expositionen“ (KrV A 729 f./
B 757 f.), die immer noch „ad melius esse“ (KrV A 731/B 759) versucht werden müssen.
Dieses Verständnis der philosophischen Sprache garantiert zugleich, so Simon, beständige Offenheit des kritischen Unternehmens und seine moralische Aufgeladenheit.32 Für die ästhetisch bedingten Vernunftwesen, die Menschen, muss die Vernunft
(die selbst ein philosophischer Begriff ist, der auch nur durch Exposition verdeutlicht
werden kann) eine Idee der Vernunft bleiben, die nur vorübergehende Gültigkeit
erlangen kann, eine vorläufige private Vorstellung von der allgemeinen Menschenvernunft, worin, wie Kant es sagt, „ein jeder seine Stimme hat“ (KrV A 752/B 780).
Vom Ansatz Simons her wird die Bedeutsamkeit der Urteilskraft besonders einleuchtend. Wenn das Fürwahrhalten jedes Urteils im theoretischen Gebrauch der
Vernunft im Blick auf seine drei Stufen zu bedenken ist, so ist auch die Unterscheidung dieser Stufen selbst Gegenstand eines Urteils, das sich seinerseits nach Arten
des Fürwahrhaltens unterscheiden lässt.33 Für die im Theoretischen angesetzte Ur-
32 Zur Integration eines moralischen Sollens in den Sprachbegriff s. Georg Römpp, Die Sprache der
Freiheit. Kants moralphilosophische Sprachauffassung. V. a. bestreitet Römpp die weit verbreitete
Position, dass Kant in seiner theoretischen Philosophie die philosophische Bedeutung der Sprache
übersehen hat, die Position, die schon Hamann und Herder vertraten (Johann Georg Hamann, Metakritik über den Purismus der Vernunft; Johann Gottfried Herder, Eine Metakritik zur Kritik der reinen
Vernunft). S. die entsprechenden Literaturhinweise bei Römpp (S. 185). Auch in der Moralphilosophie,
so Römpp, gäbe es keine Erörterung des Problems. Simons Untersuchungen scheinen diese Lücke
gerade auszufüllen. Sie zeigen u. a., dass die Bedeutung der kantischen Sprachauffassung nicht auf
das Wahrhaftigkeitsgebot reduziert werden kann, sondern die Offenheit der philosophischen Sprache
miteinbezieht. Eine Übersicht zur Frage nach Kants „Verdrängung des Problems der Sprache“ s. bei
Jürgen Villers, Kant und das Problem der Sprache. Die historischen und systematischen Gründe für die
Sprachlosigkeit der Transzendentalphilosophie, bes. die Ausführungen zur latenten Sprachphilosophie
Kants (S. 337–366).
33 Schon Friedrich Kaulbach, der Kant aus Nietzsches Philosophie des Perspektivismus als dessen
Vorläufer zu verstehen suchte, hat die kantische Unterscheidung der Stufen bzw. Modi des Fürwahrhaltens betont (Kaulbach, Philosophie des Perspektivismus, S. 95 ff.). Gerade der Perspektivismus der
praktischen Vernunft stelle den Handelnden zwischen zwei Weltperspektiven, der der Naturgesetzlichkeit und der der Freiheit. Erst auf dem Hintergrund dieser doppelten Perspektivierung konnte das
ausgeführt werden, was Kaulbach das „Experiment der Vernunft“ nennt (S. 116 ff.). Der Glaube im
Unterschied zum Wissen stehe, so Kaulbach, wesentlich für eine perspektivische Weltdeutung bzw.
einen perspektivischen Begriff der Metaphysik (S. 134). Nichtsdestoweniger meint Kaulbach, „Kant tritt
für eine dem Menschen eigentümliche allgemeine Vernunft ein, die zu allen Zeiten die gleichen Züge
hat“ (S. 215). Dies kann aber nicht, wie Simon unermüdlich betont, für eine „allgemeine Menschenvernunft, worin ein jeder seine Stimme hat“, zutreffen. Eine Idee der allgemeinen Vernunft muss für
jeden Gebrauch der Vernunft bloß regulativ bleiben. Die Perspektivierung betrifft, anders als Kaulbach
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
37
teilskraft bedeutet das, dass über die Unterscheidung der subsumierenden und der
teleologisch-reflektierenden Urteilskraft auch ein Urteil gefällt werden muss, das nur
in concreto, d. h. individuell und fehlerhaft möglich ist. Für das Begehrungsvermögen
ist die Notwendigkeit der Unterscheidung des Fürwahrhaltens in einem individuellen
Urteil noch dringender: die „moralische Urteilskraft“ wird durch „das radicale Böse in
der menschlichen Natur“ „verstimmt“, was „die Zurechnung innerlich und äußerlich
ganz ungewiß macht“ (RGV, AA 6, S. 38). Wenn das Begehrungsvermögen fähig ist,
sich selbst zu täuschen und zu verunsichern,34 so ist es nicht möglich, die Kritik der
Urteilskraft in ihrer Tragweite für die Grundlage der Moral aus Vernunft zu überschätzen. Es stellt sich ferner die Frage, ob die Unterscheidung des theoretischen und
des praktischen Bereichs der Vernunft selbst in concreto immer eindeutig erfolgen
kann bzw. ob die Urteilskraft, die sie unterscheiden soll, nicht bei jedem Gebrauch der
Vernunft gefordert ist.35 Ohne kritische Analyse der Urteilskraft als eines individuellen Vermögens wäre das Ganze der Kritik unvollendet geblieben.36 Die Nötigung zu
einem dritten Teil des kritischen Unternehmens der Vernunft, d. h. unter anderem zur
Untersuchung des Schönen, des Geschmacks und der Kunst, entspringt dem eigentlichen Interesse an ihrem „nothwendigen Geschäfte“.
Die Differenz zwischen Prinzipien und ihrer Gültigkeit, zwischen der Vernunft
und ihrem Gebrauch, zwischen der Vernunft und der Urteilskraft wird also für Kants
Begründung der Moral aus Vernunft bedeutsam, und der Vorwurf eines rein normativen Universalismus bzw. Egalitarismus, den auch Nietzsche und erst recht seine
russischen Leser gern gegen Kant erhoben, trifft schon deshalb nicht zu. Dennoch
bleibt die kantische Kritik Plausibilitäten verhaftet, deren Kraft in ihrem Nicht-Thematisiert-Sein liegt und die nur von einem anderen Ansatz her sichtbar gemacht werden
können: aus dem der Kritik an dieser Kritik. Insofern können Kants Plausibilitäten,
wie in der Einleitung angedeutet, erst im nächsten Kapitel zu Nietzsches Kritik am
kantischen kritischen Unternehmen erörtert und mit anderen Plausibilitäten konfrontiert werden. In diesem Kapitel wird zunächst Kants eigene Strategie der Plausibilisierung einer Moral aus Vernunft dargestellt, wodurch das Problematische dieser von
es darlegt, jeden einzelnen Handelnden, der das „Experiment der Vernunft“ ausführt bzw. der
Gebrauch von seiner Vernunft macht.
34 Die Möglichkeit der „i n n e r e n Lüge“ bleibt zwar rätselhaft und fast widersinnig, muss aber aus
guten Gründen zugelassen werden (MS, AA 6, S. 430). Diese Frage wird uns auch noch im nächsten
Kapitel beschäftigen.
35 Die Unterscheidung von theoretischer und praktischer Perspektive scheint, etwa in Bezug auf die
heutige Debatte zu ethischen Aspekten der Wissenschaft, tatsächlich problematisch zu werden.
36 Mit Recht bemerkte noch Kroner, die Reflexion bzw. die reflektierende Urteilskraft sei ein Instrument, mittels dessen die Kritik sich „selbst ins Werk setzt“ (Richard Kroner, Von Kant bis Hegel, S. 239).
Weniger überzeugend ist, dass er dies als Anlass für seine Kant-Kritik betrachtet: Kant habe nicht
gemerkt, dass es immer die reflektierende Urteilskraft ist, die den Ausgangspunkt für das Ganze der
Philosophie ausmacht. Gerade diese ursprüngliche Rolle der Reflexion wird in der dritten Kritik m. E.
deutlich.
38
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Kant der Philosophie auferlegten Aufgabe in den Vordergrund rücken soll. Dabei soll
es, es sei noch einmal betont, nicht im Sinne einer Widersprüchlichkeit bzw. eines
Scheiterns des kantischen Projekts der Moral aus Vernunft interpretiert werden,37
sondern als Schwierigkeit, die mit der Aufgabe auf tiefste und strengste Weise verbunden ist.
Im ersten Teil des Kapitels werden Paradoxien und Tautologien aufgezeigt, in die
die kantische rationale Moralbegründung gerät. Im zweiten und dritten Teil wird
darauf eingegangen, wie die moralische Urteilskraft nach Kant diese Schwierigkeiten
in concreto überwindet, indem sie das urteilende Subjekt nötigt, nach einem „Ergänzungsstück“ der Moralität zu suchen. Im vierten und letzten Teil des Kapitels wird
gezeigt, dass die Vervollkommnung der Moral aus Vernunft eine exemplarische
ästhetische Verdeutlichung für nicht rein vernünftige Wesen erfordert, die nur als
Kunstwerk möglich ist. So wird die Kunst, wenn auch nur wegen der Unvollkommenheit der menschlichen Natur, am Ende zur eigentlichen Vollendung der Moral aus
Vernunft.
1.1 Die Moral aus Vernunft: Paradoxien und Tautologien der
radikalen Kritik
Die Radikalität ist das konstitutive Prinzip der kantischen Ethik. Der berühmte ‚Rigorismus‘ der kantischen Deutung der moralischen Forderung ist nur ein negatives Wort
dafür, das Kant selbst benutzt, um ihm einen positiven Sinn zurückzugeben (RGV,
AA 6, S. 22 f.). Er folgt aus dem radikalen Verständnis des Moralischen, d. h. aus einer
scharfen Unterscheidung des Guten und Bösen, die diese zwei Begriffe streng voneinander abgrenzt und auseinanderhält. Erst durch den Begriff des Willens scheint
diese Radikalität denkbar, weil der gute Wille allein als uneingeschränkt gut gedacht
werden kann (GMS, AA 4, S. 393). Für den Willen sind Kompromisse ausgeschlossen:
Es gibt nur eine Tugend, nur „eine einzige“ moralische bzw. unmoralische Gesinnung
(RGV, AA 6, S. 25).38 Deswegen bedeuten jene Versuche, eine „Mittelstraße“ zu finden
und aus einem „Calcul“ die Triebfeder für das Moralische zu ermitteln (MS, AA 6,
37 Dies, wie in der Einleitung schon betont wurde, geschieht nicht nur in der Nietzsche-, sondern auch
in der Kant-Forschung. Vgl. dazu Klaus Steigleder, der den Kant-Interpreten vorwirft, „das Werk Kants
meist als äußerst uneinheitlich“ und „die einzelnen Werke, überspitzt gesagt, als ein Sammelsurium
von gescheiterten Argumenten, groben Fehlschlüssen und weit verfehlten Beweiszielen“ zu betrachten
(Klaus Steigleder, Kants Moralphilosophie, S. XI). Andererseits gibt es genug Arbeiten, in denen Kants
Gedankengänge nur aus ihrer inneren Logik dargestellt und nicht in ihrer Plausibilität hinterfragt
werden. Die Untersuchung der Plausibilitäten muss versuchen, beiden Tendenzen zu entgehen.
38 Dass die Tugend an sich nur eine sein kann, muss, laut Kant, „mit rigoristischer Bestimmtheit“
behauptet werden, nur das Moralische „in der Erscheinung“ kann in mehrere Tugenden zerfallen
(RGV, AA 6, S. 25).
1.1 Die Moral aus Vernunft: Paradoxien und Tautologien der radikalen Kritik
39
S. 432), für Kant ein Missverständnis des Moralischen, letztlich die Leugnung des
Unterschieds zwischen dem Guten und Bösen, was soviel hieße als die Sittlichkeit
selbst zu „untergraben“ und „ihre ganze Erhabenheit [zu] zernichten“ (GMS, AA 4,
S. 442). Der gute Wille ist das einzig denkbare Gute, das das Böse radikal ausschließen
kann.
Doch aus der Radikalität der Unterscheidung von Gutem und Bösem entstehen
philosophische Schwierigkeiten.39 Die Maximen einer Handlung können für sich
weder gut noch böse sein. Sie entspringen alle den drei Naturanlagen zum Guten.
Obwohl man beide Ausdrücke (gute und böse Maximen) bei Kant finden kann, kann
nur die Gesinnung gut bzw. böse sein, „d. i. der erste subjective Grund der Annehmung der Maximen“. Sie geht damit „allgemein auf den ganzen Gebrauch der Freiheit“ und sorgt für das richtige bzw. falsche Einordnen der Maxime. Die Gesinnung
wird so zur „Beschaffenheit der Willkür“ (RGV, AA 6, S. 25). Nur ein konkretes, als
willkürlich gedachtes Einordnen der Maximen, das wesentlich vor der Tat (als ihre
Triebfeder) stattfindet, ist gut oder böse und zwar radikal: gut, wenn dadurch die
eigene Glückswürdigkeit zur obersten Maxime wird; böse, wenn das Streben nach
eigener Glückseligkeit die Oberhand gewinnt.40 Das Verfolgen der letzteren wäre als
untergeordnete Maxime keinesfalls böse. Die Beförderung eigener Glückseligkeit
wird von Kant sogar als Pflicht bezeichnet (MS, AA 6, S. 385 f.). Das Böse liegt nicht
unmittelbar in den Neigungen oder Anreizen der Sinnlichkeit und nicht in den
Bemühungen um eigenes Wohl, sondern allein in dem, was die Vernunft leistet oder
vielmehr nicht leistet: „über alle entgegenstrebenden Triebfedern Meister zu werden“
(RGV, AA 6, S. 60). Dieses Nicht-Leisten darf dennoch nicht seinerseits der Schwäche
bzw. den fremden Einflüssen zugeschrieben werden, sondern wiederum dem Willen
bzw. der Vernunft in ihrem praktischen Gebrauch.
39 Diese Schwierigkeiten werden besonders in der Religionsschrift deutlich. Letztere darf m. E. als
wichtiger und notwendiger Teil des kritischen Geschäfts betrachtet werden. Wenn die Aufgabe der
Kritik der praktischen Vernunft war, die Prinzipien für das Praktische zu formulieren und zu deduzieren,
so durfte hier das Problematische in den Vordergrund treten. Zur Rolle der Religionsschrift für Kants
Ethik s. Reiner Wimmer, Kants kritische Religionsphilosophie, S. 124. Ich schließe mich allerdings auch
dem Standpunkt an, dass die Lehre über das radikale Böse nicht als Lösung moralphilosophischer
Probleme angesehen werden kann (die letzteren werden dadurch noch gravierender), sondern durch
sie sollte die Unumgänglichkeit des Übergangs zur Religion begründet werden. S. Heiner F. Klemme,
Die Freiheit der Willkür und die Herrschaft des Bösen.
40 Vgl. auch weiter: „Also muß der Unterschied, ob der Mensch gut oder böse sei, nicht in dem
Unterschiede der Triebfedern, die er in seine Maxime aufnimmt (nicht in dieser ihrer Materie), sondern
in der U n t e r o r d n u n g (der Form derselben) liegen: w e l c h e v o n b e i d e n e r z u r B e d i n g u n g d e r
a n d e r n m a c h t .“ (RGV, AA 6, S. 36) Dieser feinen Differenzierung wird manchmal nicht genug
Aufmerksamkeit geschenkt. S. etwa Michael Albrecht, Kants Maximenethik und ihre Begründung. Bei
der Analyse von Kants Begriff der Maxime werden die Maximen selbst als gut bzw. böse betrachtet,
wobei die Schwierigkeit entsteht, das, was der Vernunft entspringt, als böse zu bezeichnen.
40
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Hier zeigt sich das Problematische des kantischen Begriffs des Willens. Objektiv
gesehen steht der Wille als praktische Vernunft immer unter ihrem „Factum“ (KpV,
AA 5, S. 31), unter dem moralischen Gesetz.41 In seiner Spontaneität wird er zum
Bestimmungsgrund der Handlung, der frei von allen Einflüssen der Neigungen bzw.
der Selbstliebe gedacht werden soll. Die negativ verstandene Freiheit als formale
Autonomie bzw. Unabhängigkeit von allen Neigungen ist notwendig Freiheit zum
Guten. Sie impliziert keine Optionen, keine Wahl und somit auch keine Möglichkeit
des Bösen. Wenn aber das Böse nicht in der Beimischung der Antriebe der Sinnlichkeit besteht, muss es dem freien Gebrauch der Vernunft entspringen. Nur so kann es
dem Menschen selbst zugerechnet und von ihm verantwortet werden. Nur so kann es
das radikale moralische Böse sein. Wenn jedoch die Freiheit für den Willen Freiheit
von allen Einschränkungen der Selbstliebe bedeuten soll, ist der Wille immer notwendig gut und das Böse gar nicht möglich.42
Kants Lösung dieser Schwierigkeit klingt paradox. Das Böse ergibt sich nicht aus
der Freiheit, dennoch entspringt es aus ihrem Gebrauch. Mit anderen Worten: In
seinem freien Gebrauch soll der Wille fähig sein, gegen eigene Freiheit, gegen sich
selbst zu entscheiden, sonst gäbe es kein Moralisch-Böses und dementsprechend auch
keine Moral. Diese Unterscheidung von allgemeinem Prinzip, das unmittelbare Bestimmung bedeutet, und Gebrauch, der die Spielräume eröffnet, wird uns später noch
beschäftigen: Es ist gerade der Punkt, an dem die individuellen Gemütskräfte einsetzen.
Im subjektiven Gebrauch der Willkür muss es also Freiheit zum Bösen geben,
durch die das Böse „den Grund aller Maximen verdirbt“. Der Vernunft muss ein
Spielraum gelassen werden, Gebrauch von der eigenen Freiheit gegen diese Freiheit
zu machen.43 Diese Freiheit selbst darf dabei nicht als Quelle des Bösen betrachtet
werden; sie muss, auch als Freiheit der Willkür, das Gute ermöglichen.44 So kommt es
41 Deshalb kann der Begriff des guten Willens als analytischer Begriff betrachtet werden. Das Gesetz
bekommt nur durch den Übergang von der formalen Autonomie zur Freiheit synthetische Bedeutung.
S. dazu z. B. Hermann Cohen, Kants Begründung der Ethik.
42 Auf diese Schwierigkeit wurde mehrmals hingewiesen. Da das Böse kein eigenes Vernunftprinzip
haben kann, bleibt seine Möglichkeit ein Rätsel. Zu einer der jüngsten Auseinandersetzungen mit der
Frage im Kontext der Philosophiegeschichte (im Bezug auf Augustinus und Leibniz) s. Maria Antonietta
Pranteda, Il legno storto. I significati del male in Kant, S. S. auch Christoph Simm, Kants Ablehnung
jeglicher Erbsündenlehre. Simm betrachtet allerdings dieses Paradoxon als Anlass zur Kritik an Kant
(S. 153).
43 Die Unterscheidung des Willens von der Willkür wurde in der Kritik der praktischen Vernunft nicht
völlig konsequent durchgeführt. S. dazu Lewis White Beck, Kants „Kritik der praktischen Vernunft“,
S. 169 ff. Auch in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten scheint sie keine besondere Rolle zu
spielen. Erst wo Kant zum Problem des Bösen kommt, d. h. erst in der Religionsschrift, tritt diese
Unterscheidung in den Vordergrund (vgl. Lewis White Beck, Kants „Kritik der praktischen Vernunft“,
S. 192 f.).
44 Man sieht hier, dass Kant zwar tief in der protestantisch-lutherischen Tradition verwurzelt ist, sie
aber dennoch zugleich korrigiert. Die „Freiheit des Christenmenschen“ besteht nach Luther eben in
1.1 Die Moral aus Vernunft: Paradoxien und Tautologien der radikalen Kritik
41
konsequenterweise zu weiteren Paradoxien. Als der jeder Tat vorhergehende „Actus
der Freiheit“ muss diese paradoxe Wendung der Vernunft gegen die eigene Freiheit
jedem Gebrauch der Freiheit vorausgehen (RGV, AA 6, S.21). Zumindest als „Bösartigkeit“ und „Verkehrtheit des Herzens“ (RGV, AA 6, S. 37) sollte das Böse immer schon
da sein, „als mit der Geburt zugleich im Menschen vorhanden“ (RGV, AA 6, S. 22)
gedacht, also der menschlichen Gattung, dem Menschen als Menschen beigelegt
werden (RGV, AA 6, S. 32).45 Dennoch ist dieser „Hang zum Bösen“ bei jedem einzelnen Menschen, obzwar der ganzen Gattung eigen, immer als zufällig zu beurteilen
und der Vollzug der Willkür so, als ob er unmittelbar aus dem unschuldigen Stand
entsprungen wäre (RGV, AA 6, S. 41). Aus einem klaren Grund: Sonst wäre es wiederum kein moralisch Böses. Wenn aber der Hang zum Bösen als „n a t ü r l i c h e r Hang“
(RGV, AA 6, S. 29), als angeboren gedacht wird, ist nicht nur das Böse, sondern auch
das Gute nicht frei von Paradoxien zu denken. Denn der natürliche Hang ist „durch
menschliche Kräfte nicht zu ve r t i l g e n , weil dieses nur durch gute Maximen gesche-
Verzicht auf eigene Willkür, deren Freiheit für ihn, im Unterschied zu Kants Deutung, ausschließlich
die Freiheit zum Bösen sein soll (Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520; De servo arbitrio, 1525).
Gegen diese Denkfigur argumentierte bekanntlich Erasmus von Rotterdam zugunsten der Freiheit der
Willkür, ohne die die Verantwortung nicht möglich wäre (De libero arbitrio diatribé sive collatio, 1524).
Dieser alte Streit war für Kant noch präsent, aber die beiden Positionen unterlagen einer Korrektur. Wir
werden zu ihr noch im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit Nietzsche zurückkehren müssen. S.
dazu Frieder Lötzsch, Vernunft und Religion im Denken Kants. Lötzschs Kant-Interpretation tendiert
allerdings zu einer wesentlichen Entschärfung von kaum übersehbaren Diskrepanzen zwischen lutherischen und kantischen Begriffen. Kants kritische Haltung zur These sola fide (vgl. RGV, AA 6,
S. 116 ff.) sowie seine Angriffe auf die Pfaffentumsreligion (die, nebenbei gesagt, keineswegs den
Protestantismus ausschließen wollen, s. bspw. RGV, AA 6, S. 176 ff.) werden hier als Vollendung und
Ergänzung des reformatorischen Ansatzes dargestellt. S. in diesem Sinn, wenn auch aus einer anderen
Sicht betrachtet, die wenig differenzierende Darstellung der Kontinuität in: Jürgen Eiben, Von Luther
zu Kant – Der deutsche Sonderweg in die Moderne. Eine soziologische Betrachtung. Kants Transzendentalidealismus wird hier mit der lutherischen Glaubenslehre gleichgesetzt (so etwa S. 37, 42, 83, 132)
oder auch das Gebot der Nächstenliebe mit dem kategorischen Imperativ (S. 83). Vgl. dagegen die
differenzierte Betrachtung von Aloysius Winter, Der andere Kant. Zur philosophischen Theologie Immanuel Kants, mit einem Geleitwort von Norbert Hinske, bes. das erste Kapitel („Kant zwischen den
Konfessionen“), 1–47. Zu historischen Aspekten von Kants Begriff der Willkür s. Katsutoshi Kawamura,
Spontaneität und Willkür. Der Freiheitsbegriff in Kants Antinomienlehre und seine historischen Wurzeln.
45 Diese philosophische Begründung der christlichen Erbsündenlehre hat schon früh Polemik veranlasst. Goethes Empörung bspw. ging bis zu der Behauptung, Kant habe „seinen philosophischen
Mantel […] freventlich mit dem Schandfleck des radikalen Bösen beschlabbert, damit auch die Christen
herbeigelockt werden, den Saum zu küssen.“ (Johann Wolfgang Goethe, Brief an das Ehepaar Herder
vom 7. Juni 1793, IV. Abteilung: Goethes Briefe, Weimar 1887–1912, Bd. 10, S. 74 f.). Bekanntlich hat das
erste Stück der Religionsschrift gerade die gegenteilige, nämlich eine sehr negative, Reaktion bei den
„Christen“ ausgelöst, was Kant beinahe seine Pension gekostet hat (s. dazu z. B. Bettina Strangneth,
„Kants schädliche Schriften“. Eine Einleitung, S. IX–LXXV). Doch später ist diese Lehre Kants tatsächlich
im Sinne des Christentums umgedeutet worden. Zu einer theologischen Reinterpretation kantischer
Paradoxien des Bösen und der Freiheit: Helmut Hoping, Freiheit im Widerspruch. Eine Untersuchung zur
Erbsündenlehre im Ausgang von Immanuel Kant.
42
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
hen könnte, welches, wenn der oberste subjective Grund aller Maximen als verderbt vorausgesetzt wird, nicht statt finden kann“ (RGV, AA 6, S. 37). Und dennoch
muss es als möglich gedacht werden, denn sonst hätte der Mensch nicht die Freiheit,
zwischen Gut und Böse zu entscheiden, und dann wäre wiederum weder das Moralisch-Gute noch das Moralisch-Böse denkbar. Das Gute und das Böse müssen aus
freiem Gebrauch der Vernunft selbst, als Willkür im Befolgen bzw. Nicht-Befolgen der
Stimme der Vernunft, entspringen. Beides, die Gewalt, die die Vernunft der Sinnlichkeit durch das Moralische antut, und ihre Schwäche, das letztere zu beherrschen, sind
das Rätselhafte, dessen „Erklärungsgrund“ „ewig in Dunkel eingehüllt bleibt“ (RGV,
AA 6, S. 59). Das Gute sowie das Böse sind deshalb nur paradox zu denken. Die
Paradoxien müssen nichtsdestoweniger um der Radikalität willen angenommen werden.46
Die Forderung der Radikalität des Moralischen wird somit um den Preis der
beschriebenen Paradoxien aufrecht erhalten; sie führt unvermeidlich zur paradoxen
Annahme einer gemeinsamen Quelle von Gutem und Bösem – des freien Gebrauchs
der Vernunft. So darf man sich nicht wundern, wenn sich herausstellt, dass sich das
Gute und das Böse in praktischer Abhängigkeit zueinander zeigen. Das Gute, das
durch kein Beispiel dargetan, das niemals für den Handelnden selbst als wirklicher
Grund seines Handelns sicher sein kann, ist nur daran einigermaßen (obwohl auch
sehr unsicher) zu erkennen, dass die Handlung dem Handelnden besonders schwer
fällt. Das unbedingte Gebot des moralischen Gesetzes, das, gleich dem eifersüchtigen
Gott Israels (und diese Analogie ist kaum zufällig), keine andere Triebfeder neben sich
duldet, tut allen Geboten der Selbstliebe Abbruch. Wer das Gute mit leichtem Herzen
tut (ein gutmütiger Menschenfreund etwa) hat also besondere Gründe, gegen die
eigene moralische Gesinnung argwöhnisch zu sein.47 Später wird Nietzsche gerade
46 Insofern kann man nur zustimmen, dass Kants Theorie des radikal Bösen die Kehrseite seiner
Theorie des „radikal Guten“ sei. Vgl. Gerold Prauss, Kants Problem der Einheit theoretischer und
praktischer Vernunft., S. 286 ff. S. dazu auch Henry E. Allison, Kant’s Theory of Freedom, S. 160 ff. Die
Freiheit zum Bösen als massives Problem der kantischen Philosophie wurde von Christoph Schulte
betrachtet: Radikal böse. Die Karriere des Bösen von Kant bis Nietzsche, (s. dort den Anhang „Rezeptionsgeschichte und Literatur zu Kants radikalem Bösen“, S. 353–364). Für das Problematische sorgt
hier, so Schulte, vor allem das „Paradoxon der Methode“, nämlich dass das Gute und das Böse nicht
vor dem moralischen Gesetz vorausgesetzt werden, sondern umgekehrt aus ihm hergeleitet sind (vgl.
KpV, AA 5, S. 63). Auf dieses Paradoxon komme ich im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit
Nietzsche zurück. Es ist an dieser Stelle wichtig, dass, wie Schulte als einer von wenigen KantInterpreten hervorhebt, der Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen „ein[en] Konflikt innerhalb
der Vernunft“ darstellt (S. 36) und somit die Grundlage der kantischen Moralphilosophie bedroht.
Diesen Konflikt lässt Schulte allerdings bestehen. Er ist sein Ausgangspunkt, um das kantische
Konzept des Bösen aus Vernunft in die historische Perspektive der Deutung des Bösen von Augustinus
bis Nietzsche zu stellen. Bei dem letzteren werden allerdings bloß eine „prinzipielle Absage an Moral“,
die „Artisten-Metaphysik“ und ein „vollendete[r] Nihilismus“ festgestellt (S. 315–322).
47 Dass der Mensch auch bei der Befolgung des Moralischen eine „fröhliche Gemütstimmung“ haben
soll, wird Kant in seiner Antwort auf Schillers Kritik betonen. Dennoch ist diese Freude nach Kant als
1.1 Die Moral aus Vernunft: Paradoxien und Tautologien der radikalen Kritik
43
dieses Merkmal des Moralischen als „Grausamkeit“ des kategorischen Imperativs
bezeichnen (GM II, 6, KSA 5, S. 300). Das Böse zeigt sich also inmitten des Guten
durch das einzige Kennzeichen des letzteren: Die besondere Schwere des Guten
bestätigt, dass es nur als Überwindung eines mächtigen Hanges zu denken ist, sie
beweist also die Wirklichkeit des Bösen. Aber auch umgekehrt: Eine schwerfallende
Überwindung der eigenen Neigung ist ein Fingerzeig, dass die Gesinnung gut sein
kann. Die Schwere kann gleichsam als Ersatz des vorhergehenden Mangels an Gutem
gedacht werden, und der durch das angeborene Böse verschuldete Mensch kann so
durch das Leiden am Guten der göttlichen Gerechtigkeit Genugtuung geben. Der Hang
zum Bösen, der überwunden werden soll, ist damit auch die Bedingung des Guten
(RGV, AA 6, S. 72). Ohne das Böse wäre also auch das Gute undenkbar.48
Das Gute und das Böse weisen also gerade in ihrer radikalen Gegensätzlichkeit
auf einander hin.49 Das Gute ist für die Menschen nur als Überwindung des bösen
Hanges denkbar; die Wirklichkeit des Bösen bestätigt die Möglichkeit des Guten.
So konstatiert Kant: „Die Begreiflichkeit des einen ist ohne die des andern gar nicht
denkbar“ (RGV, AA 6, S. 59). Zwar legitimiert schließlich das Erfahrungsargument
die Wirklichkeit des Bösen, dessen Begriff allerdings nur a priori erkannt werden
kann:
[…] dass nun ein solcher verderbender Hang im Menschen gewurzelt sein müsse, darüber können wir uns, bei der Menge schreiender Beispiele, welche uns die Erfahrung a n d e n T a t e n der
Menschen vor Augen stellt, den förmlichen Beweis ersparen (RGV, AA 6, S. 32 f.).
Wirkung, keinesfalls als Triebfeder zum Guten zu verstehen. Sie kommt wesentlich nach der Tat (RGV,
AA 6, S. 24). Zu dieser Polemik s. Bernard Greiner, Die Geburt der ästhetischen Erziehung aus dem Geist
der Resozialisation. Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre; Prauss, Kant über Freiheit als Autonomie,
S. 240 ff. Schillers Begriff der schönen Seele, die „dem Affekt die Leitung des Willens ohne Scheu
überlassen darf“ (Friedrich Schiller, Über Anmut und Würde, S. 221 f.), wird für uns im Zusammenhang
mit Dostojewskis Idee eines „schönen Menschen“ wichtig. Dostojewski hat sich von Schiller immer
faszinieren lassen. Schillers kritische Betrachtung von Kants Moralphilosophie könnte ihn indirekt
beeinflusst haben, welche Vermutung sich leider nicht nachweisen lässt. Schillers Behauptung „Die
schöne Seele hat kein andres Verdienst, als daß sie ist“ führt auch auf Nietzsches Begriff der „vornehmen Seele“ hin, freilich auch auf die reformatorisch-calvinistische Auffassung der tugendhaften
Seele, die von Gott auserwählt ist.
48 Josef Simon bemerkt in diesem Zusammenhang, dass, wenn das Gute „kein Gegenstand möglicher
Erfahrung“ sein kann, es „daher nur als Gegenteil des Bösen erfahren werden“ könne. „Demgemäß
könnte man auch sagen, das Böse sei erst durch den Willen des Menschen zur Erkenntnis des Unterschieds des Guten und des Bösen in die Welt gekommen“ (Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die
Sprache der Philosophie, S. 529). Dies muss allerdings nach Kant auch umgekehrt gelten: Das Gute wird
erst als Gegenteil zum Bösen, als Unterscheidung des Guten und des Bösen erfahren.
49 Das Gute und das Böse wären überhaupt in ihrem Bezug auf die Wirklichkeit gleichberechtigt,
wenn es nicht einen gravierenden Unterschied in ihrer Modalität gäbe: Das Gute ist notwendig für die
Vernunft, das Böse dagegen muss zwar in der praktischen Absicht dem Menschen „in seiner Gattung“
beigelegt werden, soll dabei indessen immer als zufällig vorgestellt werden (RGV, AA 6, S. 28 f.).
44
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Das Sollen ist nicht das Wollen – davon kann sich jeder Mensch aufgrund eigener
Erfahrung selbst überzeugen. Dennoch soll hier vor allem auch ein moralphilosophisches Argument geltend gemacht werden: Wäre kein Böses vorhanden, wäre das
Sollen immer nur das Wollen, so würde das Moralisch-Gute weder möglich noch nötig
sein.50
Die Paradoxie des gegen die eigene Freiheit frei entscheidenden Willens wird
auf diese Weise legitimiert, samt der Paradoxie des in ihrer Radikalität voneinander
abhängigen Guten und Bösen. Zwar sollte der Wille vernünftigerweise nur seine
Pflicht wollen, zwar ist er dann als vernünftiges Wollen vom Sollen nicht zu unterscheiden, jedoch steht das Wollen praktisch dem Sollen immer entgegen. Dieses
Sollen, diesen Imperativ, der den Menschen von der Natur ausnimmt und zur Spontaneität der vernünftigen Handlung herausfordert, kann man nach Kant nicht leugnen,
ohne den Begriff der Vernunft als Bestimmungsgrund der Handlung bzw. ohne den
Begriff des Lebens der vernünftigen Wesen selbst zu verlieren und das ganze Unternehmen der Vernunft in Frage zu stellen. Wenn das vernünftige Leben denkbar sein
soll, muss auch die Moral denkbar sein, die den Begriff der praktischen Vernunft bzw.
den des Willens gleichzeitig voraussetzt und begründet. Dieser Wille soll frei gegen
seine eigene Freiheit entscheiden können, um praktische Vernunft zu bleiben. Eine
Moral aus Vernunft erweist sich ohne Widerstreit des Willens mit sich selbst, so paradox
es auch sein mag, als undenkbar.
Die positive Bedeutung der Paradoxien als Mittel gegen den logischen Egoismus
betonte Kant in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht:
Dem Paradoxen ist das A l l t ä g i g e entgegengesetzt, was die gemeine Meinung auf seiner Seite
hat. Aber bei diesem ist eben so wenig Sicherheit, wo nicht noch weniger, weil es einschläfert;
statt dessen das Paradoxon das Gemüth zur Aufmerksamkeit und Nachforschung erweckt, die oft
zu Entdeckungen führt. (AH, AA 7, S. 129)51
Die Paradoxien sind also „von keiner schlimmen Bedeutung“, sie sind keine bloßen
Widersprüche und müssen nicht einfach vermieden werden. Zwar sind hier in erster
Linie, wenn nicht ausschließlich, die rhetorischen (und nicht die logischen) Paradoxien gemeint. Dennoch darf ihre Bedeutung für den ganzen Gang der Kritik nicht
unterschätzt werden. Denn sie können gerade nach Kant die Grenze des in der eigenen
Meinung befangenen Denkens markieren und so zum Überprüfen der eigenen Prämissen aufrufen. Schließlich machen sie gerade die Plausibilitäten sichtbar, die nicht
50 Es wäre der heilige Wille, der keine Moral braucht und bei dem das Sollen immer das Wollen ist.
Dennoch lässt sich die Heiligkeit des Willens bei den Menschen nicht anders denken als „in schwärmende[n], dem Selbsterkenntniß ganz widersprechende[n] theosophische[n] Träume[n]“ (KpV, AA 5,
S. 122 f.).
51 Im „Gang menschlicher Dinge“, „wenn man ihn im Großen betrachtet“, scheint nach Kant „alles
paradox zu sein“. (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, AA 8, S. 41)
1.1 Die Moral aus Vernunft: Paradoxien und Tautologien der radikalen Kritik
45
ohne das Risiko hinterfragt werden können, an die Grenze des eigenen Denkens zu
gelangen, an der es nicht möglich zu sein scheint, weitere Gründe anzugeben.52
Die Paradoxien „erwecken“ das Gemüt zur Nachforschung. So entstehen folgende Fragen: Wenn der Wille als freier Wille oder als praktische Vernunft nicht frei von
Paradoxien zu denken ist, sollte man dann nicht gerade die Radikalität des Guten
und Bösen als Grundlage der Moral anzweifeln? Unterscheidet sich das Sollen vom
Wollen wirklich so radikal, wenn gerade in diesem Punkt das Gute und das Böse
voneinander abhängig sind? Und schließlich: Wurde das Leben der Menschen zu
Recht mit der praktischen Vernunft gleichgesetzt? Ist Kants Begriff des Willens überhaupt haltbar?
Die Antwort auf all diese Fragen ist relativ eindeutig: Wenn die Paradoxien, die
der Radikalität des Guten und des Bösen innewohnen, nicht akzeptiert würden, wäre
eine Moral aus Vernunft nicht denkbar. Und das heißt, dass die Vernunft dadurch auf
tiefste Weise kompromittiert wäre. Die Zuverlässigkeit der Vernunft – ihr ganzes
Geschäft – hängt davon ab, ob sie ihre Freiheit in der Erfahrung dartun kann oder
nicht,53 ob sie zur Selbstbestimmung fähig ist, ob das Individuum einen freien
Gebrauch seiner Gemütskräfte machen kann. Die Unmöglichkeit des Radikal-Mora-
52 Zu den Paradoxien bei Kant s. Heiner F. Klemme, Kant und die Paradoxien der Kritischen Philosophie. Klemme unterscheidet zwischen den methodischen und inhaltlichen Paradoxien der kritischen Philosophie. Allerdings lässt sich eine solche Unterscheidung nicht streng durchhalten, denn
die „inhaltlichen Paradoxien“ werden durch die „methodischen“ erzeugt (S. 48 ff.). Der Begriff eines
Paradoxons wird in dieser Untersuchung allerdings gemeinhin als „widersinnige und befremdliche“,
für den gemeinen Menschenverstand überraschende Aussage verstanden. So fällt die kopernikanische
Wende bzw. die Umstellung auf die transzendentale Methode selbst unter den Begriff der Paradoxie
sowie das Unbegreifliche des moralischen Imperativs und das Unauflösbare der Dialektik. Ähnlich
definiert Fritz Mauthner Paradoxien im Anschluss an die etymologische Bedeutung des Wortes als „die
neuen Wahrheiten, solange sie noch der allgemeinen Meinung widersprechen“ (Fritz Mauthner,
Paradoxien, S. 519). Ein spezifischer und deshalb engerer Begriff der Paradoxie bringt ihn dem der
Antinomie nahe, nämlich die Paradoxie im Sinne „einer widerspruchsvollen, sowohl wahren als auch
falschen Aussage, ohne daß bei ihrer Aufstellung offenkundige Fehler in den Voraussetzungen oder in
den Schlussfolgerungen gemacht wurden“ (Kuno Lorenz, Art. Antinomie; vgl. auch Christian Thiel, Art.
Paradoxie). Noch präziser ist die folgende Definition von Werner Stegmaier: „Antinomien oder Paradoxien entstehen, wenn eine zweiwertige Unterscheidung, deren Werte einander negieren, auf sich selbst
bezogen und dabei ihr negativer Wert auf sie angewendet wird“ (Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 9). Ich verwende den Begriff in einem engeren Sinn, der ihn mit dem der Plausibilität in
Verbindung bringt: Die Paradoxie wird als eine Aussage verstanden, die zwei einander widersprechende Thesen enthält, die beide jedoch nur im Anschluss an einander plausibel sein können. Wie z. B.
Kants Annahme, dass das Böse zwar als angeboren gedacht werden muss, aber dem Menschen selbst
zuzurechnen ist oder dass der freie Wille zwar notwendig das Gute will, sich aber für das Böse
entscheiden können muss.
53 Laut der Kritik der Urteilskraft ist die Freiheit „die einzige unter allen Ideen der reinen Vernunft,
deren Gegenstand Thatsache ist und unter die scibilia mit gerechnet werden muß“, weil sie sich „in der
Erfahrung darthun läßt“ (KU, AA 5, S. 468).
46
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
lischen würde Untauglichkeit der Vernunft sowohl für den theoretischen als auch für
den praktischen Gebrauch bedeuten.54
Die Paradoxien scheinen so unumgänglich zu sein. Und wenn „billigermaßen von
einer Philosophie“ „gefordert werden kann“, dass sie „bis zur Grenze der menschlichen Vernunft in Principien“ strebt (GMS, AA 4, S. 463), so muss ein Prinzip gefunden werden, das alle Paradoxien der Moral aus Vernunft legitimiert und für das
Denken akzeptabel macht, ein Prinzip, das ein weiteres Hinterfragen als unmöglich
zurückweist. Erst am moralischen Gesetz in seiner Radikalität und Faktizität erkennt
die Vernunft sich selbst als ein Vermögen. Der moralische Imperativ – das Sollen, das
dem Wollen zwar Abbruch tut, aber immer mit der Selbstbestimmung des Willens
identisch bleibt – muss um der Vernunft willen angenommen werden. Das Faktum
der Vernunft ist das Einzige, worin sie sich selbst erkennt. Es als wirklich denken zu
dürfen, ist die Frage der Selbsterhaltung der Vernunft.55
So kommen wir zu einem Schlüsselpunkt der Kritik. Die Vernunft ist als besonderes Erkenntnisvermögen und als Bestimmungsgrund des Handelns von der Annahme
ihres Faktums, des moralischen Gesetzes, das sich als unbedingter Imperativ äußert,
abhängig. Mehr noch: Sie ist nur aus ihm ableitbar. Das Vermögen des Moralischen ist
das Vermögen der Selbstbestimmung, d. h. das Vermögen, das für vernünftige Wesen
mit dem Leben zusammenfällt. Dieses Vermögen markiert die letzte Grenze der
Argumentation, wo weiteres Fragen nicht mehr sinnvoll zu sein scheint, weil das die
Möglichkeit des Gebrauchs der Vernunft, und das heißt des Fragens selbst, in Frage
stellen würde. Die Moral ermöglicht die Vernunft als Grundlage des Lebens eines
vernünftigen Wesens, eines Menschen. Aber auch umgekehrt trifft zu, dass das Moralische nur aus Vernunft möglich ist. Denn das Kriterium des Radikal-Moralischen
kann nur im Uneingeschränkt-Guten gefunden werden, d. h. im guten Willen, der der
Forderung der Vernunft bedingungslos gehorcht. Es liegt also ein unvermeidlicher
Zirkel vor: So wie Vernunft nur durch das Moralische für sich wirklich ist, ist auch das
Moralisch-Gute nur aus Vernunft denkbar. Dieser Zirkel, der sich nicht ohne Paradoxien schließt, ist für die Selbstlegitimation der Moral aus Vernunft aber unumgänglich. Die Frage, wie das Faktum der Vernunft möglich ist, ist damit beantwortet: Es ist
54 Auch im theoretischen Gebrauch wäre die Vernunft ohne Spontaneität nicht denkbar. Denn wäre
sie von äußeren Gründen in ihren Schlussfolgerungen bestimmt und nicht autonom, würden letztere
niemals zuverlässig sein können. In der Erfahrung ist die Freiheit jedoch nur praktisch gegeben. S.
dazu bspw. Jürgen Mittelstraß, Spontaneität. Ein Beitrag im Blick auf Kant.
55 Die Selbsterhaltung der Vernunft ist eine der Maximen eines aufgeklärten Menschen (Was heißt:
Sich im Denken orientiren?, AA 8, S. 147). In Kants Nachlass wird sie „das Fundament des Vernunftglaubens“ genannt, „in welchem das Fürwahrhalten eben den Grad hat als beym Wissen, aber von
anderer Art ist, indem es nicht von der Erkentnis der Gründe im obiect, sondern von der wahren
Bedürfnis des Subiects in ansehung des theoretischen so wohl als practischen Gebrauchs der Vernunft
hergenommen ist“ (Nachlaßreflexionen (2446), AA 16, S. 371 f.; meine Hervorhebung – E.P.). Zur zentralen Stellung des Selbsterhaltungs-Gedankens bei Kant s. Manfred Sommer, Die Selbsterhaltung der
Vernunft.
1.2 Die moralische Urteilskraft
47
möglich, weil die Vernunft als Vermögen zur Selbstbestimmung, und das heißt als
Ermöglichung des Lebens eines vernünftigen Wesens, nicht anders gedacht werden
könnte. Nietzsche formuliert Kants Antwort auf diese Frage mit ironischer Prägnanz:
„Vermöge eines Vermögens“ (JGB 11, KSA 5, S. 24).56 Die Voraussetzung wird zum
Ergebnis, die Schlussfolgerung wird tautologisch.57 Kants konsequenter Radikalismus
führt nicht nur zu Paradoxien, sondern auch zum tautologischen Zirkel der Selbstbegründung. Der Gang der Argumentation mündet in der Selbstbezüglichkeit der
Vernunft.58 Die Paradoxien der Moral aus Vernunft werden am Ende mit einer Formel
gekrönt, die zugleich die äußerste Paradoxie und Tautologie darstellt: Das Unbegreifliche der Vernunft wird von ihr in seiner Unbegreiflichkeit begriffen (GMS, AA 4,
S. 463).59
1.2 Die moralische Urteilskraft zwischen dem „radicalen Bösen
in der menschlichen Natur“ und dem „Heiligsten, was unter
Menschen nur sein kann“
Die Radikalität des Moralischen, des Guten und des Bösen, die voneinander wie der
„Himmel von der Hölle“ zu unterscheiden sind,60 wird durch die gegenseitige Begründung der Moral und der Vernunft legitimiert. Die Vernunft kommt hier an ihre Grenze
und muss die Paradoxie als das Unbegreifliche akzeptieren und ihre Unvermeidlichkeit begreifen. Das betrifft v. a. die paradoxe Verankerung des Bösen in der Freiheit,
die „das Gemüth zur Aufmerksamkeit und Nachforschung“ nötigt und schon eingeführte Unterscheidungen in Bewegung bringt. Vor allem durch den oben hervorgehobenen Begriff des Gebrauchs werden neue Spielräume der Argumentation eröffnet.
56 Auf die Bedeutung dieser Formulierung für Nietzsches Kant-Kritik wird im nächsten Kapitel eingegangen.
57 Der Vorwurf, „eine gigantische Tautologie“ hervorgebracht zu haben, wird, wenn auch in einem
anderen Zusammenhang, z. B. von Theodor Adorno an Kant gerichtet (Theodor W. Adorno, Kants
„Kritik der reinen Vernunft“). Bezeichnenderweise wirft Adorno, wie zuvor Nietzsche, Kant vor, der
Aufklärung nicht treu geblieben zu sein. Seine Idee der Erkenntnis sei ein Rückfall in „mythologisches“
Denken gewesen (S. 105 f.).
58 Der Selbstbezug als Quelle für die Paradoxierung und Erweiterung des Denkens wird in der oben
angegeben Definition von Stegmaier hervorgehoben (Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S.9 ff.).
Im Anschluss an Niklas Luhmann entwickelt Stegmaier die These, dass Paradoxien im Denken der
Selbstbezüglichkeit entspringen, u. a. im Bezug auf die Frage nach der Aufklärung über die Aufklärung
(Werner Stegmaier, Nietzsches und Luhmanns Aufklärung der Aufklärung). Die Paradoxien sowie die
Selbstbezüglichkeit dürfen dabei nach Luhmann nicht als Hindernis, sondern müssen als Mittel der
Kommunikation angesehen werden (vgl. Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation, S. 54 ff.;
Niklas Luhmann, Tautologie und Paradoxie in den Selbstbeschreibungen der modernen Gesellschaft,
S. 84 ff.).
59 In der Religionsschrift spricht Kant auch von der Unbegreiflichkeit des Bösen (RGV, AA 6, S. 43).
60 Vgl. „nicht wie de[r] Himmel von der Erde“ (RGV, AA 6, S. 60, Anm.).
48
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Das Rätselhafte des Bösen kann nur durch die Unterscheidung der allgemein-formalen Forderung der Moral und der individuellen Ebene des in concreto handelnden
Subjekts bis zu einem gewissen Grad entparadoxiert werden, d. h.: die Unterscheidung des Willens und des Gebrauchs der Willkür. Und das impliziert eine neue
Aufgabe, nämlich die Analyse eines individuellen Vermögens, das zwischen beiden
vermitteln soll, die Analyse der moralischen Urteilskraft.
Tatsächlich: Zwar wird der Maßstab des Guten in das Allgemeine gesetzt, doch
muss zwischen der reinen Form des Allgemeinen, die den Willen bestimmt, und dem
konkreten Gebrauch der Willkür bzw. dem Pathologisch-Zufälligen seiner Anwendung irgendwie vermittelt werden.61
Ob nun eine uns in der Sinnlichkeit mögliche Handlung der Fall sei, der unter der Regel stehe,
oder nicht, dazu gehört praktische Urtheilskraft, wodurch dasjenige, was in der Regel allgemein
(in abstracto) gesagt wurde, auf eine Handlung in concreto angewandt wird. (KpV, AA 5, S. 67)
So kommt die Urteilskraft ins Spiel. Sie bezweifelt nicht die Strenge des Gesetzes,
dennoch muss sie es mit einem bzw. mehreren konkreten Urteilen in Verbindung
setzen, sie muss entscheiden, wie das konkret Gegebene unter das Allgemeine subsumiert werden kann, und dies aus der begrenzten Perspektive des Einzelnen, des vor
der Handlung stehenden Subjekts. Das heißt: Bevor die moralische Urteilskraft einsetzen kann, müssen die Begriffe gefunden werden, die die Handlungssituation für
das handelnde Subjekt hinreichend beschreiben. Hier entsteht ein neues Problem:
Also ist die Urtheilskraft der reinen praktischen Vernunft eben denselben Schwierigkeiten unterworfen, als die der reinen theoretischen […]. (KpV, AA 5, S. 68)
Die Schwierigkeit besteht darin, dass „dem Gesetze der Freiheit (als einer gar nicht
sinnlich bedingten Causalität) mithin auch dem Begriffe des unbedingt Guten […]
keine Anschauung, mithin kein Schema zum Behuf seiner Anwendung in concreto
untergelegt werden“ kann.
Folglich hat das Sittengesetz kein anderes die Anwendung desselben auf Gegenstände der Natur
vermittelndes Erkenntnißvermögen, als den Verstand […]. (KpV, AA 5, S. 69)
Als Übergang vom Übersinnlichen zur sinnlichen Welt wird die Handlung äußerlich
mit Hilfe der Kategorien der Natur betrachtet. Zwar macht das Allgemeine den Maßstab des Guten aus, doch sind in einer konkreten Situation die einzelnen Erkenntnis-
61 Nach Stegmaier werden die Paradoxien, die aus der zirkulären Bewegung der Selbstbegründung
und Selbstbefreiung der Vernunft entstehen, von Kant auf die Unterscheidung ‚Form – Inhalt‘ verlegt
und so eine gewisse Entparadoxierung bzw. „Paradoxieninvisibilisierung“ erreicht (Stegmaier, Aufklärung der Aufklärung, S. 170 f.).
1.2 Die moralische Urteilskraft
49
urteile erforderlich, die nun in Ansehung der allgemeinen Urteile überprüft werden
müssen.
Wie soll diese Suche nach Verallgemeinerung aussehen? Das Verfahren wurde
noch in der ersten Kritik beschrieben. Für dieses wird vor allem die subsumierende
Urteilskraft zuständig, die zwischen der Sinnlichkeit und dem Verstand vermittelt
(KrV A 133 ff./B 172 ff.). Die einzelnen Urteile als bloße empirische Sätze sind „vorläufige Urtheile“ (Logik, AA 9, S. 65) und enthalten noch keine Erkenntnis im strengen
Sinne, weil dafür die Bedingung erforderlich ist, „unter welcher das Prädikat (Assertion überhaupt) dieses Urteils gegeben wird“ (KrV A 322/B 378). Sie verhalten sich zu
den allgemeinen Urteilen der Größe nach als Einheit zur Unendlichkeit (KrV A 71/
B 96).62 Kants Beispiel dafür ist folgendes: „Cajus ist sterblich“ ist ein empirisches
Urteil, das jeder „bloß durch den Verstand aus der Erfahrung schöpfen“ kann (KrV
A 322/B 378). Eine einzelne Beobachtung (Cajus' Tod) wäre für die Urteilskraft allerdings unzulänglich. Es ist eine syllogistische Bewegung nötig, damit es zum universalen Satz wird, „welche[r] von einem Gegenstande etwas allgemein behaupte[t]“
(Logik, AA 9, S. 102). Die vorläufigen Urteile müssen so durch die Urteile überprüft
werden, die das durch das Besondere differenzierte Allgemeine thematisieren. Sie
müssen also einen Bezug auf die Kategorie der Allheit (Universitas) verschaffen (KrV
A 322/B 379), die „nichts anders“ ist „als die Vielheit als Einheit betrachtet“ oder
die Totalität der durch die Vielheit differenzierten Einheit (KrV B 111).63 Mit anderen
Worten: Das vorläufige Urteil ist noch keine Erkenntnis, sondern stellt nur eine
Möglichkeit derselben dar.64 Die Bewegung zur Erkenntnis wird durch ein besonderes
Urteil eröffnet, das einen konkreten Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung unter
einen Begriff subsumiert: „Cajus ist ein Mensch“. Das allgemeine Urteil gibt die
Totalität der Bedingungen: „Alle Menschen sind sterblich“. Jetzt kann das einzelne
Urteil wiederum als Erkenntnis von der Allheit der Bedingungen zur Einheit des
konkreten Gegenstandes zurückkehren: „Cajus (als jeder Mensch) ist sterblich“. Das
62 In der transzendentalen Logik sollen nach Kant die einzelnen Urteile gleich den allgemeinen
behandelt werden, denn obgleich sie gar keinen Umfang haben, werden sie wie die allgemeinen und
anders als die besonderen Urteile ohne Ausnahme gelten. Zum Verhältnis der singulären zu den
universellen Urteilen bei Kant siehe z. B. Michael Wolff, Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel.
Mit einem Essay über Freges Begriffsschrift, S. 143 ff., 155 f. Die singulären Urteile sind laut Wolff deshalb
zur logischen Vollständigkeit notwendig, weil sie sich „nicht auf unbestimmt viele, sondern auf eine
bestimmte Subjektvorstellung beziehen“ (S. 171).
63 Die komplexen Optionen dieses Begriffs, der sich im Neukantianismus als besonders anschlussfähig erwiesen hat, können hier nicht erörtert werden. Siehe z. B. Hermann Cohen, Das Urteil der
Allheit.
64 Simon bezeichnet in seiner Analyse der Kategorien aus den „Modi des Fürwahrhaltens“ die Einheit
als Verharren des „in seinem Meinen affizierte[n] Subjekt[s] im Meinen“. „Es läßt sich nicht „überreden“, den Gegenstand darüber hinaus für wirklich oder sogar für notwendig zu halten. Die durch die
Affektion ausgelöste Bewegung des „Gemüts“ kehrt zur Möglichkeit zurück“ (Simon, Kant. Die fremde
Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 137).
50
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Urteil wird zur Erkenntnis, die die „Totalität der Bedingungen zu einem gegebenen
bedingten“ enthält (KrV A 322/B 379). Der Übergang von der Einheit zur Allheit stellt
also den Übergang vom Möglichen eines auf einer empirischen Beobachtung begründeten Urteils zum Notwendigen eines Erkenntnisurteils dar, oder, anders gesagt, von
dem „nur subjektiv hinreichend begründeten Fürwirklichhalten in ein auch objektiv
begründetes Fürwahrhalten, d. h. in Wissen“.65 Die subsumierende Urteilskraft stellt
sich somit in den Dienst des Wissens.
Dieses triviale Beispiel eines Urteils über die Sterblichkeit des Cajus wird uns im
Kapitel zu Tolstois Moralphilosophie wieder begegnen, in dem es eine neue, nichttriviale Wendung bekommen wird. Bei Kant sollte an diesem Beispiel gezeigt werden,
wie die Verallgemeinerung problemlos verlaufen kann. Praktisch handelt es sich
allerdings auch nach Kant niemals nur um Subsumtion, besonders wenn es um die
Optionen des eigenen Handelns geht. Schon deshalb nicht, weil jeder Begriff als
Voraussetzung einer Subsumtion „über sein spontanes Fürwirklichhalten nur ‚von
Fall zu Fall‘ hinaus“ gewonnen wird.66 Der Handelnde muss sich jedes Mal des
vermittelnden Erkenntnisvermögens, des Verstandes, bedienen, um die Situation und
damit die Optionen der Handlung einzuschätzen. Das heißt: Das Subjekt beurteilt
„um seiner Orientierung im Leben willen“, „auch wenn andere es anders sehen“.67 Ob
die Subsumtion „richtig“ stattfindet, ob nicht eine bessere Subsumtion bzw. eine
Subsumtion unter einen anderen Begriff möglich ist, bleibt selbst Gegenstand eines
Urteils. Die Gültigkeit des Übergangs vom Einzelnen zum Allgemeinen und umgekehrt geht so nicht über das Mögliche hinaus. Das Fürwahrhalten kann als Wissen
immer wieder in Frage gestellt und auf die Stufe der Meinung zurückverwiesen
werden. Wie oben schon erwähnt, lässt sich die Überredung vom Standpunkt des
Urteilenden aus nicht endgültig von der Überzeugung unterscheiden (KrV A 821/
B 848).
Was dies für die moralische Urteilskraft bedeutet, kann man am besten an einem
anderen Beispiel Kants erklären, das die bekannten Vorwürfe des Rigorismus hervorgerufen hat. Dass niemand lügen darf, selbst dann nicht, wenn ein Mörder sich
nach seinem Opfer erkundigt, ist eine Maxime, die unumstritten gelten muss, weil die
Lüge in diesem Fall nur als Verstoß gegen das Allgemeine, nur als Ausnahme von der
allgemeinen Regel, möglich wäre: Nur wenn die Wahrheit erwartet wird, ist die Lüge
möglich.68 Dennoch bleibt die Subsumtion dieses Falls unter diese Regel nur eine
Möglichkeit. Ein konkreter Fall lässt zahlreiche weitere Optionen der Verallgemeinerung zu: Kann ich es als allgemeines Gesetz betrachten, dass jemand, der auf fremde
65 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 138.
66 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 138
67 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 137 f. Insofern kann diese
Bewegung, im Unterschied zur dialektischen Bewegung Hegels, keine Bewegung auf das Absolute hin
sein. Die Urteilskraft muss immer neu ansetzen.
68 Vgl. Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen, AA 8, S. 425–430.
1.2 Die moralische Urteilskraft
51
Hilfe angewiesen ist, einem Mörder ausgeliefert wird? Kann ich es als allgemeine
Regel ansehen, dass ein Mensch vor der Tat als Mörder bezeichnet wird? Oder: Kann
ich als Naturgesetz wollen, dass jeder, der sich in meiner Situation befindet, so und so
handelt? Auf die letztere Frage wird die Antwort immer positiv sein, weil sich in
meiner Situation keiner außer mir befinden kann.69 Dass ich es etwa als Lüge ansehe,
dass ein bestimmter Mensch ein Mörder und ein anderer sein Opfer sein soll, sind
konkrete Umstände, die meine eigene, sehr beschränkte, unter Zeitdruck erfolgende
Orientierung in der Situation bestimmen. Damit die Verallgemeinerung richtig vollzogen werden kann, muss diese konkrete Situation von allem Inhaltlich-Empirischen
gereinigt werden, was allerdings nur bis zu einem gewissen Grad und auf sehr
unterschiedliche Weise möglich ist.
Die Optionen der Verallgemeinerung sind vielfältig, eine totale Verallgemeinerung („Totalität aller Bedingungen“) ist überhaupt nicht zu erreichen. Nur die ad hoc
formulierten Maximen können auf ihre Moralität hin überprüft werden. Dass jedoch
eine bestimmte (für sich moralisch tadellose) Maxime gerade auf diesen Fall angewandt werden soll, bleibt selbst Gegenstand eines Urteils, d. h.: eines eventuell nicht
hinreichend begründeten Fürwahrhaltens, einer Meinung. Ein einzelnes Urteil über
das Gute, wenn es in einer konkreten Situation als universell gültig gedacht werden
soll, bleibt in seiner Notwendigkeit ungewiss. Der kategorische Imperativ kann folglich
auf konkrete Fälle niemals eindeutig anwendbar sein.70 Die Unmöglichkeit einer siche69 Hermann Baum schlägt das Schweigen als moralische Lösung des Problems vor, das auf die Gefahr
des eigenen Unheils hin gewagt wird (Hermann Baum, Kant: Moral und Religion, S. 24). Mit dem
Schweigen scheint das Problem des Rigorismus in diesem Fall dennoch nicht wirklich gelöst zu sein,
da es in einer konkreten Situation gerade sehr eindeutig (bspw. als Zustimmung) interpretiert werden
kann. Die Paradoxien des Moralischen im Gebot der Wahrhaftigkeit können m. E. kaum durch das
Dritte (weder Wahrheit noch Lüge) aufgehoben werden. Erst mit der Einführung der Urteilskraft
bekommen sie eine Rechtfertigung und werden entparadoxiert.
70 Auf die moralphilosophische Diskussion zur Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs kann
hier nicht näher eingegangen werden. Kants Beispiele werden dabei von unterschiedlichen Positionen
aus betrachtet, besonders das der Lüge, aber auch das des Selbstmords und, so schon bei Hegel, das
des Depositums. Manche Forscher befürworten Kants Rigorismus (z. B. Julius Ebbinghaus, Die Formeln
des kategorischen Imperativs und die Ableitung inhaltlich bestimmter Pflichten), doch die meisten
kritisieren ihn. Kant selbst hat mehrfach auf der Unvollkommenheit aller Beispiele bestanden. Bemerkenswert ist, dass das Problem der Anwendbarkeit eines Prinzips in der Geschichte der Kant-Rezeption
außerhalb des Rahmens der praktischen Philosophie häufig zurückgewiesen wurde (s. dazu Helmut
Holzhey, Die praktische Philosophie des Marburger Neukantianismus. Versuch einer moralischen Bilanz).
Zur Problematik der Anwendbarkeit einer Regel bei Kant s. Verena Mayer, Das Paradox des Regelfolgens in Kants Moralphilosophie, wo der Begriff eines Paradoxons wiederum in einem breiteren (m. E.
unspezifischen) Sinn verwendet wird. Es wird hier allerdings gezeigt, dass auch die moralische Urteilskraft dem Regress des Regelbefolgens unterliegt, da auch sie, wie die Urteilskraft überhaupt, nicht
gelehrt werden kann. Mit Recht wird weiter betont, dass diese Schwierigkeit für die Ethik (die angeblich
nur mit den Prinzipien zu tun hat) nicht irrelevant sein kann (S. 348). Gerade das Paradoxon des
Regelbefolgens könne den Vorwurf „einer abstrakten, unzulässig idealisierenden und weltfernen
Ethik“ erübrigen und lasse die Urteilskraft als individuelles Vermögen in besonderem Maße unerläss-
52
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
ren Anwendung des kategorischen Imperativs auf konkrete Fälle kann als Defizit der
kantischen Moralphilosophie betrachtet werden, was in der Kant-Forschung des
Öfteren der Fall war.71 Sie kann dennoch als eine der conditio humana angemessene
Feststellung angesehen werden, dass nämlich ein einzelnes Individuum eine Entscheidung auf eigene Gefahr hin immer in concreto treffen muss, derer es sich niemals
sicher sein kann. Diese Lebenssituation lässt die Spielräume seiner Verantwortung
nicht nur zu, sondern fordert seine individuelle Urteilskraft jedes Mal aufs Neue
heraus.72
Die moralische Urteilskraft setzt somit auf der individuellen Ebene des in konkreten alltäglichen Situationen sich befindenden Subjekts an, das aus der begrenzten
Übersicht in begrenzter Zeit ein Urteil treffen, d. h. zugunsten einer besonderen
Maxime entscheiden soll. Das heißt unter anderem, dass bei den moralischen Urteilen
nicht nur die subsumierende, sondern vor allem die reflektierende Urteilskraft einsetzt,
weil die Regel (die Maxime) für die Handlung nicht gegeben ist, sondern erst gefunden werden muss. Die konkrete Anwendbarkeit des gefundenen Allgemeinen auf das
Einzelne bleibt problematisch, und das Fürwahrhalten vielleicht nur eine Meinung.
Und dennoch, da die konkrete Unterscheidung des Guten und des Bösen erst dadurch
möglich wird, muss gerade dieses einzelne Urteil in die Handlung umgesetzt werden:
lich werden (S. 351 ff). Dennoch plädiert der Aufsatz für die Möglichkeit einer „richtige[n] Anwendung
von Regeln im praktischen Handeln“ und scheint so das Paradoxon durch den Begriff der Maxime als
nichtbeliebiger „Hintergrundeinstellung“ (keine bloßen Überzeugungen, Vorsätze und Wünsche) auflösen zu wollen (S. 361 ff.). Die oben beschriebenen Schwierigkeiten, die jede Verallgemeinerung mit
sich bringt, bleiben jedoch auch nach dieser Interpretation bestehen. Die Bestimmung durch die
Urteilskraft erübrigt nicht die Kasuistik im Urteilen. Auch die hypothetischen Imperative sind, wie jetzt
klar sein dürfte, denselben Schwierigkeiten ausgesetzt. Die Korrektur des kategorischen Imperativs in
dieser Richtung scheint m. E. unplausibel zu sein (vgl. Günther Patzig, Die logischen Formen praktischer
Sätze in Kants Ethik).
71 S. eine der jüngsten Untersuchungen zum Thema: Sven Bernecker, Kant zur moralischen Selbsterkenntnis, und die dortigen Literaturhinweise. Bernecker betrachtet den Mangel an Transparenz des
handelnden Subjekts nicht nur negativ, sondern eher als Kants realistischeres Bild des Menschen
bspw. gegenüber Descartes. Dennoch wird der kategorische Imperativ als defizitär gekennzeichnet,
weil das Kriterium seines Abstraktionsgrads fehle (S. 175).
72 Hegels Kantkritik gewinnt an dieser Stelle, so z. B. bei Friedrich Kaulbach, an Bedeutung, indem
der feste Boden für die moralische Reflexion in der Wirklichkeit von Staat und Gesellschaft aufgefunden wird (vgl. Friedrich Kaulbach, Das Prinzip Handlung in der Philosophie Kants, S. 327 ff.). Dagegen
hat bei Kant der Handelnde in der Sphäre des Praktischen „mit der Wirklichkeit zu tun, die ihm als
fremd, undurchschaubar und unberechenbar gegenübersteht“, (Friedrich Kaulbach, Das Prinzip Handlung in der Philosophie Kants, S. 258; s. auch das anschließende Kapitel VI, Handlung in der Ausführung,
S. 259–331). Dennoch scheint Kants Ansatz m. E. gerade deswegen gegenüber dem Hegelschen nicht
überholt zu sein, denn er erlaubt, die notwendige Distanz zwischen dem Individuellen und Allgemeinen zu bewahren und für eine konkrete Situation fruchtbar zu machen. Hier kann auf die Auseinandersetzung Hegels mit Kant nicht weiter eingegangen werden. Zu Hegels Kritik der praktischen Philosophie Kants s. z. B. Pirmin Steckeler-Weithofer, Kultur und Autonomie. Hegels Fortentwicklung der
Ethik Kants und ihre Aktualität.
1.2 Die moralische Urteilskraft
53
Durch die Nötigung zur Handlung wird das Meinen zum Glauben.73 Hier tritt eine
weitere Schwierigkeit hinzu: Es würde zum Glauben, aber nur in dem Fall, dass der
Handelnde sich seiner Triebfeder überhaupt sicher sein könnte. Das kann er aber
niemals sein. Auch wenn man tatsächlich geglaubt hätte, dass eine Maxime dem
kategorischen Imperativ entspräche, könnte man nicht sicher sein, ob man aus dieser
Maxime und nicht bloß ihr gemäß gehandelt habe. Das nachträgliche Fürwahrhalten
könnte wiederum einer bloßen Selbst-Überredung entspringen.
Das Gute und das Böse bleiben also in ihrer Radikalität denkbar, der kategorische
Imperativ als Faktum der Vernunft präsent, ihre Anwendung auf den konkreten
Gebrauch der Willkür ist dennoch doppelt unsicher: Man kann weder behaupten, man
habe nach der bestimmten Maxime gehandelt, noch sicher sein, dass die Maxime die
Verallgemeinerung richtig durchlaufen habe. Die Radikalität betrifft die Form der
Maximen, ihren formalen Bestimmungsgrund. Im Unterschied zur Form ist das moralische Urteil inhaltlich als problematisch zu denken und seine Unterscheidungen
insofern gerade als nichtradikal. Diese Differenz ist bekanntlich die Grundlage von
Kants Einteilung der Metaphysik der Sitten in die Rechts- und die Tugendlehre. Das
Recht ist es, das wesentlich nach der Tat kommt, um über Handlungen als äußere
Erscheinungen ein assertorisches Urteil zu treffen und sie unter eine gegebene Regel
zu subsumieren. Das Geschäft der Moral hat sich dagegen wesentlich vor der Tat zu
vollziehen, um nur die Maximen der möglichen Handlung in ihren Ansprüchen,
Triebfeder für diese zu sein, zu überprüfen und sich dann für eine ad hoc entstandene
Regel zu entscheiden.74 Nach der Tat kann über das Moralisch-Gute nie mit Sicherheit
geurteilt werden. Deswegen kann man im strengen Sinne nicht von der moralischen
Handlung sprechen. Kants Maximenethik reicht nicht so weit.75 In den Metaphysischen Anfangsgründen der Tugendlehre werden alle positiven Pflichten nur noch als
unvollkommen gedacht; die moralische Urteilskraft verwickelt sich dabei in kasuistische Fragen, deren Lösung dem in concreto urteilenden Subjekt der Handlung überlassen werden muss, die es aber niemals mit Sicherheit korrekt lösen kann. Nur das
73 Der Modalität nach wird aus einem problematischen Urteil, „wo man das Bejahen oder Verneinen
als bloß möglich (beliebig) annimmt“, eine apodiktische Forderung, in der „man es als notwendig
ansieht“, aber nur als Privaturteil, das nicht assertorisch ist, d. h. nicht „als wirklich (wahr) betrachtet
wird“ (KrV A 74 f./B 100). Die moralische Gewissheit ist unmöglich und dennoch für die Handlung
unumgänglich.
74 „In ethischer Hinsicht ist für Überlegungen immer noch Zeit; denn weil die Ethik sich nur auf
Maximen der Handlungen beziehen kann, steht die ethische Überlegung wesentlich vor dem Fall.“
(Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 431)
75 Dass Kants Ethik eine Maximenethik ist, wurde in der Kant-Forschung genug dargetan. S. dazu die
Arbeiten von Otfried Höffe: Immanuel Kant, S. 187 ff.; Otfried Höffe, Kants kategorischer Imperativ als
Kriterium des Sittlichen, S. 356. Vgl. in diesem Sinn auch Oswald Schwemmer, Philosophie der Praxis.
Versuch zur Grundlegung einer Lehre vom moralischen Argumentieren in Verbindung mit einer Interpretation der praktischen Philosophie Kants, S. 133; Oswald Schwemmer, Vernunft und Moral. Versuch einer
kritischen Rekonstruktion des kategorischen Imperativs bei Kant, S. 257.
54
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Recht hat ein äußeres Kriterium für seine Urteile, welches die Moral entbehrt, und
stellt somit eine notwendige Ergänzung zur Moral dar.
Die Unterscheidung des Rechts und der Moral in ihrem Bezug auf den Bestimmungsgrund der Handlung bleibt nur eine Lösung für die Schwierigkeiten der konkreten Anwendung des kategorischen Imperativs, solange diese Unterscheidung in
ihrer Radikalität selbst nicht in concreto hinterfragt wird. Die Handlung als Erscheinung genommen kann nicht gerichtet werden, weil es in praktischer Sicht überhaupt
nicht ums Dasein und Nichtsein, sondern um das Pflichtgemäße und Pflichtwidrige
geht. Die Tat definiert Kant in den Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre als
„eine Handlung, sofern sie unter Gesetzen der Verbindlichkeit steht, folglich auch
sofern das Subject in derselben nach der Freiheit seiner Willkür betrachtet wird“ (MS,
AA 6, S. 223). Die Tat muss folglich auch im Recht als Handlung aus „der Freiheit
seiner Willkür“, d. h. als ein dem Menschen zugerechnetes Handeln beurteilt werden.76 Also bezieht sich das Recht, wenn nicht auf die Maximen, so auch nicht auf die
Handlungen als bloß äußere Erscheinungen, sondern auf etwas, was zwischen beiden
vermittelt: auf die den Handlungen zugrunde liegenden Absichten.77 Über letztere
wird dennoch nach äußeren Kennzeichen und deshalb sehr unsicher – denn wer kann
in Bezug auf die Absichten eines anderen Menschen sicher sein? – geurteilt. Zwar ist
deswegen der „Sinnspruch der Billigkeit“, dass „das strengste Recht das größte
Unrecht“ sei, nach Kant völlig korrekt, dennoch ist „diesem Übel“ auf dem Wege des
Rechts „nicht abzuhelfen“ (MS, AA 6, S. 235). Das Recht selbst darf aus diesem Grund
nicht in Frage gestellt werden, obwohl selbstverständlich klar bleibt, dass dessen
Anwendung nur sehr unvollkommen und demgemäß auch sehr wohl unrecht sein
kann. Doch das Recht als solches kann niemals gerichtet werden. Dem existierenden
Recht Widerstand zu leisten, wäre das größte Unrecht. Kants Argumentation ist an
dieser Stelle sowohl moralisch als auch pragmatisch begründet: Ein solcher Widerstand könnte einerseits niemals ohne krassen Selbstwiderspruch als allgemeines
Gesetz gewollt werden, anderseits wäre dadurch jede Hoffnung auf das friedliche
Zusammenleben der Menschen von vornherein untergraben.78
76 Vgl. „Die Freiheit des Individuums ist der Ursprung des Rechts.“ (Gerhardt, Immanuel Kant. Vernunft und Leben, S. 228)
77 Vgl. KpV, AA 5, S. 66. Eine rechtliche Beurteilung über das Äußere einer Handlung kann nicht
umhin, der letzteren einen freien Akt der Willkür zu unterstellen. Das heutige Recht unterscheidet
dabei vorsätzliche und fahrlässige Handlungen (StGB, § 15). Über die Strafbarkeit einer Tat (und über
das Strafmaß) kann demzufolge nicht ohne Berücksichtigung der Absichten entschieden werden, auch
wenn diese nur indirekt nachweisbar sind. In der Moral geht es dagegen nach Kant nicht um die
Absichten, sondern um die ihnen zugrundeliegenden Maximen. Letztere dürfen gerade nicht mit
Absichten verwechselt werden, was in der Forschungsliteratur nicht selten der Fall war (vgl. bspw.
Steigleder, Kants Moralphilosophie, S. 132).
78 Kant scheut nicht davor zurück, diesen Gedanken konsequent zu Ende zu führen. In der Metaphysik
der Sitten wird die „Entthronung eines Monarchen“ als rechtswidrig angesehen. Sie könne niemals
1.2 Die moralische Urteilskraft
55
Das friedliche Zusammenleben oder der ewige, für immer versicherte Friede,
vielleicht auch nur ein „süße[r] […] Traum“ der Philosophen (Zum ewigen Frieden,
AA 8, S. 343), der „als Schwärmerei allgemein verlacht“ wird (RGV, AA 6, S. 34), ist
das eigentliche Ziel des Rechts. Zur Aufgabe, das Recht – „das Heiligste, was unter
Menschen nur sein kann“ (MS, AA 6, S. 304) – zu befördern, ist jedoch jeder Mensch
moralisch verpflichtet. Zwischen dem Recht und der Moral gibt es somit eben keinen
radikalen Unterschied, sondern vielmehr eine Unterscheidung der Geltung in concreto. Die rechtlich-moralische Differenz bleibt insofern für die Urteilskraft nicht radikal
und selbst kasuistisch.79 Die Abgrenzung beider Bereiche des Praktischen gehört
zur Metaphysik. Deshalb wird sie erst in der Metaphysik der Sitten vollzogen.80 Aus
kritischer Sicht bleiben dagegen beide, die Moral und das Recht, aufeinander angewiesen. Für ein moralisches Urteil wäre die juridische Evidenz zwar unzulänglich, es
muss dennoch als unbedingte moralische Pflicht betrachtet werden, sich der Unvollkommenheit des Rechts und seinem unabhelfbaren Übel zu unterwerfen – eine Unterwerfung, die Kant u. a. von Seiten der russischen Denker mehrmals vorgeworfen
wurde.81
Tatsächlich haben wir hier mit einer zirkulären Bewegung zu tun: Das Recht
ergänzt äußerlich die Moral, die ihrerseits das Recht unterstützen soll. Um diesen
Zirkel zu legitimieren, wird das Recht von Kant in den Zusammenhang mit einer
rechtmäßig geschehen, „weil alles, was er vorher in der Qualität eines Oberhaupts that, als äußerlich
rechtmäßig geschehen angesehen werden muß“ (MS, AA 6, S. 330).
79 Das Einsetzen der moralischen Urteilskraft entkräftet somit nicht nur den radikalen Unterschied
zwischen der Moral und dem Recht, sondern auch die Einwände Hegels gegen Kants Moral als die einer
reinen Gesinnung, die auch in die späteren Diskussionen aufgenommen wurden. Vgl. dazu Wolfgang
Kuhlmann (Hg.), Moralität und Sittlichkeit. Das Problem Hegels und die Diskursethik, bes. die Vorbemerkung des Herausgebers (S. 8) und den Beitrag von Jürgen Habermas (Moralität und Sittlichkeit. Treffen
Hegels Einwände gegen Kant auch auf die Diskursethik zu?).
80 Deshalb kann ich auch bspw. Hermann Baum nur teilweise Recht geben, wenn er sagt, in Kants
berühmtem Verbot der Lüge handle es sich um ein Rechtsprinzip (Baum, Kant: Moral und Religion,
S. 21). Kritisch betrachtet ist diese Differenz selbst fraglich und löst, wie oben angedeutet, die Schwierigkeiten nicht. Auf die integrierende Rolle des Lügen-Verbots für die Moral und das Recht verweist
Römpp (Die Sprache der Freiheit, S. 203). Das Thema, wie sich das Recht zur Moral bei Kant verhält, ist
mehrfach und unter vielerlei Hinsichten untersucht worden. Auch hier sind die Positionen vielfältig.
Ich schließe mich den Forschern an, die die Rechtslehre als unverzichtbaren Teil kantischer Moralphilosophie betrachten. Vgl. z. B. Steigleder, Kants Moralphilosophie, S. 131 ff. S. dort Hinweise auf die
weitere Forschungsliteratur.
81 Zur Frage nach der Verletzung der individuellen Menschenrechte durch das rechtlich-staatliche
Gemeinwesen nach Kant und kritisch ihm gegenüber s. Heiner F. Klemme, Das rechtstaatliche Folterverbot aus der Perspektive der Philosophie Kants. Das Problem des „gesetzlichen Unrechts“ setzt
allerdings voraus, dass wir wissen, was Recht und was Unrecht sei, und dies positiv-inhaltlich. Kant
wollte jedoch auch in der Metaphysik der Sitten eine solche Voraussetzung vermeiden. Deshalb wäre
das gesetzliche Unrecht für ihn eine contradictio in adjecto. Zum Verhältnis von Ethik und Rechtslehre
bei Kant s. auch: Heiner F. Klemme, Das „angeborene Recht der Freiheit“. Zum inneren Mein und Dein in
Kants Rechtslehre; Heiner F. Klemme, Immanuel Kant.
56
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
weiteren Ergänzung gestellt – mit der Idee der höchsten und vollkommenen Gerechtigkeit, mit der religiösen Idee des höchsten Gerichts. Das Recht sei nicht nur das
Heiligste unter Menschen, sondern auch „das Heiligste, was Gott auf Erden hat“. So
musste ein Herrscher, der im Namen des Rechts handelt und so zum „Stellvertreter“
Gottes auf Erden und „göttlichen Gesalbten“ wird – was Kant für keine Übertreibung
oder Schmeichelei hält –, wenn „er Verstand hat (welches man doch voraussetzen
muß)“, immer demütig bedenken, dass „er ein Amt übernommen habe, das für einen
Menschen zu groß ist“. Er musste „jederzeit in Besorgniß stehen […]“, „diesem Augapfel Gottes irgend worin zu nahe getreten zu sein“ (Zum ewigen Frieden, AA 8,
S. 353, Anm. 2). Die Idee Gottes ist somit eine wichtige Ergänzung der Unvollkommenheit des Rechts. Sie lässt die vollkommene Gerechtigkeit denken, indem Gott als
gerechter Richter, als höchste rechtliche Instanz vorgestellt wird. Er ist aber auch als
höchste moralische Instanz zu denken, als Urheber „aller unserer Pflichten“ (RGV,
AA 6, S. 153). Im Begriff Gottes wird somit die rechtlich-moralische Differenz aufgehoben. So notiert Kant für sich:
Das principium der rechtlichen Pflicht ist: ich muß so handeln, als wenn meine maximen eben so
von jedermann wie von Gott gesehen würden. Ich kann mir des Vortheils nicht bedienen, daß
mein Herz Fensterladen hat. (Nachlaßreflexionen (7822), AA 19, S. 526 f.)
Nur Gott als höchster Gesetzgeber, dessen „Augapfel“ das irdische Recht ist, kann alle
„Fensterladen“ des Herzens, alle Triebfedern durchschauen, über die der Handelnde
einen äußeren Beobachter, aber auch sich selbst täuschen kann.82 Die religiöse
Deutung des Rechts, wenn das Religiöse auch nur im Sinne einer Vernunftreligion zu
verstehen ist (denn es handelt sich schließlich um eine gedachte und erhoffte Instanz,
um einen Vernunftglauben), ergänzt so die Unvollkommenheit des Menschen, der
sich seines moralischen Urteils niemals sicher sein kann, aber sich auch des unumgänglichen Mangels der irdischen Gerechtigkeit bewusst ist. Deswegen ist es nach
Kant eine moralische Pflicht, nicht nur das Recht, sondern auch die Religion zu
pflegen.83
Es ist allerdings äußerst wichtig, dass beide fremden (oder als fremd gedachten)
Ergänzungen des Moralischen durch den irdischen und den himmlischen Richter
nicht wegen der Schwäche der Urteilskraft in Anspruch zu nehmen sind. Es ist gerade
umgekehrt: Wenn die moralische Urteilskraft trügerisch wäre, wäre es sinnlos, überhaupt von Recht und Religion zu reden. Die moralische Urteilskraft muss sich dem
82 Es ist Gott allein, der die Menschen nach ihrer Gesinnung beurteilt; wir selber „müssen allenfalls
nur aus den Folgen derselben im Lebenswandel auf sie schließen, welcher Schluß aber, weil er nur aus
Wahrnehmungen als Erscheinungen der guten und bösen Gesinnung gezogen worden, vornehmlich
die S t ä r k e derselben niemals mit Sicherheit zu erkennen gibt […]“ (RGV, AA 6, S. 71).
83 Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Moral und Religion wird uns noch im Dostojewski-Kapitel
beschäftigen. Seine Deutung bei Kant scheint relativ klar zu sein. S. dazu Michael Städtler (Hg.), Kants
„ethisches Gemeinwesen“. Die Religionsschrift zwischen Vernunftkritik und praktischer Philosophie.
1.2 Die moralische Urteilskraft
57
äußeren Richter selbst unterwerfen, denn sonst wäre auch eine rechtliche Ordnung
moralisch wertlos. Mit anderen Worten: Das friedliche Zusammenleben würde äußerlich erzwungen und unsicher bleiben, wenn es nicht zur „Herrschaft des guten
Princips“ (RGV, AA 6, S. 151), zum Reich Gottes auf Erden werden könnte. Die Nötigung zu einer äußeren Ergänzung der Moralität muss also dieser Moralität selbst
entspringen: Sie ist nötig, nicht etwa weil die Urteilskraft sich irrt, sondern weil das
ästhetische Bedingt-Sein des Urteilenden bei jedem Urteilen stets mitgedacht werden
soll. Wie im theoretischen Gebrauch der Vernunft ist hier dem Irrtum dadurch zu
entgehen, dass man die Schranken seines Wissens anerkennt. Doch im Unterschied
zum Theoretischen kann man im Praktischen auf gewisse Urteile auch bei unzureichender Sicherheit nicht verzichten. So sind wir nach Kant „genöthigt“, „die Existenz
Gottes vorauszusetzen nicht bloß alsdann […], wenn wir urtheilen w o l l e n , sondern
weil wir u r t h e i l e n m ü s s e n “ (Was heißt: Sich im Denken orientiren?, AA 8, S. 139).
Die Unmöglichkeit moralischer Sicherheit muss bei der Nötigung zur Handlung
wiederum moralisch anerkannt werden, deshalb bleibt auch die Notwendigkeit eines
äußeren Urteils unumstritten.
Die moralische Forderung zur Anerkennung der Unzulänglichkeit der moralischen Urteilskraft hat Folgen für Kants Moral aus Vernunft. Einerseits wird dadurch
der Raum für Recht und Religion gewonnen bzw. der ewige Friede und das Reich
Gottes auf Erden als Zweck des praktischen Vernunftgebrauchs gesichert. Andererseits
aber wird mit der Einführung einer äußeren Instanz die Autonomie des Willens
bedroht. Die Schwierigkeit würde nur beseitigt, wenn sie wiederum durch die Urteilskraft zu beheben wäre. Die Autonomie des moralischen Urteils wäre nur zu retten,
wenn die Urteilskraft selbst das eigene Beschränkt-Sein bedenkt. Dafür steht in der
abendländischen Moralphilosophie traditionell die Instanz, die gleichzeitig als eigene
Stimme und als Stimme Gottes interpretiert werden kann – das Gewissen, das von Kant
nun verstanden wird als „d i e s i c h s e l b s t r i c h t e n d e m o r a l i s c h e U r t e i l s k r a f t “
(RGV, AA 6, S. 186). Es ist die Urteilskraft, die zum eigenen Richter wird und damit die
Differenz zwischen dem äußeren und inneren Richterurteil aufhebt. Dazu Simon:
Weil im Gewissen die Differenz zwischen Täter und Richter (und insofern auch die Differenz
zwischen Ethik und Recht) aufgehoben ist, ist es der härteste, allgegenwärtige Richter.84
Wenn dieser Richter fehlt, wird die Kluft zwischen der innerlich befangenen moralischen Urteilskraft und den sie richtenden Instanzen unüberbrückbar und die Moral
nur als Folge eines äußeren Zwangs bzw. nur aus Furcht vor einem Richter möglich
sein. Das erhoffte Reich Gottes, selbst wenn es auf Erden errichtet werden könnte,
wäre dann moralisch wertlos. Es würde, wie Kant in einer kleinen Schrift darstellt,
gerade „das (verkehrte) Ende aller Dinge“ bedeuten (Das Ende aller Dinge, AA 8,
84 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 428.
58
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
S. 339). Der innere Richter ist also notwendig, es ist sogar eine unbedingte Pflicht,
dessen Bewusstsein aufrecht zu erhalten (RGV, AA 6, S. 185). Wie soll er aber möglich
sein? Ist eine solche sich selbst richtende Instanz widerspruchsfrei zu denken?85 Um
Kants Antwort auf diese Frage zu verstehen, müssen wir das Problem der moralischen
Kasuistik noch einmal vor Augen führen.
Subjektiv kann die moralische Urteilskraft sich niemals irren, sie ist unfehlbar.
D. h.: Das, was vor der Handlung für das Gute gehalten wurde, kann dem Handelnden nicht vorgeworfen werden. Objektiv jedoch muss das konkrete Urteil immer als
möglicherweise fehlerhaft gegenüber dem allgemeinen Gesetz gedacht werden. Es
bedarf also der moralischen Urteilskraft, um über eigene moralische, in concreto
getroffene Urteile zu urteilen. Aber auch über die Urteile dieser Urteilskraft muss
geurteilt werden, und dafür bedarf es wiederum einer Urteilskraft. Das Urteilen über
das Urteilen läuft ad infinitum. Man muss jedes Mal ein Prinzip ihres Gebrauchs
ansetzen, das selbst wieder überprüft werden muss. Kant beschreibt diesen Prozess
folgendermaßen:
Die Ethik […] führt wegen des Spielraums, den sie ihren unvollkommenen Pflichten verstattet,
unvermeidlich dahin, zu Fragen, welche die Urtheilskraft auffordern auszumachen, wie eine
Maxime in besonderen Fällen anzuwenden sei und zwar so: daß diese wiederum eine (untergeordnete) Maxime an die Hand gebe (wo immer wiederum nach einem Princip der Anwendung
dieser auf vorkommende Fälle gefragt werden kann); und so geräth sie in eine C a s u i s t i k , von
welcher die Rechtslehre nichts weiß. (MS, AA 6, S. 411)
Dieses fortgesetzte Hinterfragen, zu dem sich die moralische Urteilskraft genötigt
fühlt und durch das sie in einen unendlichen Regress gerät, lässt ihr keine Ruhe.
Gerade durch diese Unruhe wird sie zum Gewissen.86 Die Urteilskraft ist dabei, es sei
nochmals betont, „nicht etwas Erwerbliches und es giebt keine Pflicht, sich eine […]
anzuschaffen“ (MS, AA 6, S. 400), sie kann nur geübt, oder, als Beschaffenheit des
Gemüts, nur „kultiviert“ werden. Folglich ist auch das Gewissen nicht zu erwerben.
85 In der Kritik der praktischen Vernunft sowie in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten spielt der
Begriff noch keine große Rolle. Erst in der Religionsschrift, wo das Problem des Bösen in den Vordergrund tritt, wird er bedeutsam. Im Folgenden können nicht alle Kontexte des kantischen Begriffs
des Gewissens berücksichtigt werden. Zur Genese des Begriffs und seinen Erörterungen in Kants
Vorlesungen s. Thomas Sören Hoffmann, Gewissen als praktische Apperzeption. Zur Lehre vom Gewissen in Kants Ethik-Vorlesungen; Gerhard Lehmann, Zur Analyse des Gewissens in Kants Vorlesungen
über Moralphilosophie.
86 Wie Wolfgang Wieland zurecht betont, steht der Handelnde unter dem Druck der Zeit und da „das
Handeln in der konkreten Situation durch das Sittengesetz jedoch nur mittelbar und schon gar nicht
lückenlos in allen Details reguliert“ werden kann, muss es als Domäne der Urteilskraft bezeichnet
werden. In ihrer Selbstbezüglichkeit wird die Urteilskraft zum Gewissen, das sich der eigenen Sorgfalt
vergewissern soll (Wieland, Urteil und Gefühl, S. 164 ff.). Das kann es allerdings niemals mit Sicherheit
tun.
1.2 Die moralische Urteilskraft
59
Man kann es nicht erlernen, ein gewissenhafter Mensch zu sein. Nur „ein Postulat des
Gewissens“ bleibt uns als Leitfaden:
[…] von der [Handlung], die i c h unternehmen will, muß ich nicht allein urteilen und meinen,
sondern auch g e w i ß sein, dass sie nicht unrecht sei, und diese Forderung ist ein Postulat
des Gewissens, welchem der P r o b a b i l i s m u s , d. i. der Grundsatz entgegengesetzt ist: daß die
bloße Meinung, eine Handlung könne wohl recht sein, schon hinreichend sei, sie zu unternehmen. (RGV, AA 6, S. 186)
Hier muss man wiederum bedenken, dass gerade die moralischen Urteile niemals
objektiv, niemals gewiss sind. Das bloß subjektive Fürwahrhalten kann sich für den
Handelnden immer als unzureichend erweisen. Wie schon die Methodenlehre der
Kritik der reinen Vernunft deutlich machte, kann man die Stufen des Fürwahrhaltens
vom eigenen Standpunkt aus niemals mit Sicherheit unterscheiden. Man benötigt
dafür eine äußerliche Mitteilung und die Überprüfung eigener Urteile durch „fremde
Vernunft“. Die Urteilskraft, die sich selbst richtet, kann dementsprechend niemals
sicher sein, dass ihr Urteil nicht unrecht gewesen ist.87
Kant sah bekanntlich eine gewisse Schwierigkeit darin, die Möglichkeit der „i n n e r e n Lüge“ zu erklären: „weil eine zweite Person dazu erforderlich ist, die man zu
hintergehen die Absicht hat, sich selbst aber vorsätzlich zu betrügen einen Widerspruch in sich zu enthalten scheint“ (MS, AA 6, S. 430).88 Dennoch ist nicht zu
bestreiten, dass immer Selbstbetrug im Spiel ist, „wenn nur die Handlungen das Böse
nicht zur Folge haben“, „sich seiner Gesinnung wegen nicht zu beunruhigen, sondern
vielmehr vor dem Gesetze gerechtfertigt zu halten“. Die Gewissensruhe ist deshalb
zweifellos kein Merkmal der guten Gesinnung, sondern eher umgekehrt eine „T ü c k e
des menschlichen Herzens“, der „faule Fleck unserer Gattung“ (RGV, AA 6, S. 38). Die
Gründe dafür sind: Zwar kann sich das Gewissen niemals irren (MS, AA 6, S. 401), die
moralische Urteilskraft kann dies aber sehr wohl. Mit anderen Worten: Wir können
uns das Gewissen zwar nicht als fehlerhaft vorstellen, wissen aber niemals, inwieweit
wir uns an dessen Ausspruch bei einem bestimmten Urteil und, mehr noch, bei einer
bestimmten Handlung „gekehrt“ haben (MS, AA 6, S. 400). Der moralische Grundsatz
„man soll nichts auf die Gefahr wagen, daß es unrecht sei“ (RGV, AA 6, S. 185) ist
somit praktisch nicht erfüllbar oder anders ausgedrückt: Es ist immer objektiv möglich,
87 Daher kann ich Thomas Hoffmann nicht zustimmen, Kants Gewissenslehre „in ihrer letzten
Gestalt“ sei, „daß es moralische Gewißheit in Beziehung auf erscheinendes Handeln tatsächlich nur in
der Binnenperspektive des Handelns“ gibt (Hoffmann, Gewissen als praktische Apperzeption, S. 426).
Wenn es diese Gewissheit in der Binnenperspektive gäbe, würde das Gewissen überhaupt nicht vonnöten sein.
88 Vgl. weiter: „[…] dieses doppelte Selbst, einerseits vor den Schranken eines Gerichtshofes, der doch
ihm selbst anvertraut ist, zitternd stehen zu müssen, anderseits aber das Richteramt aus angeborener
Autorität selbst in Händen zu haben, bedarf einer Erläuterung, damit nicht die Vernunft mit sich selbst
gar in Widerspruch gerathe“ (MS, AA 6, S. 439).
60
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
dass die Urteilskraft irrt, und es ist subjektiv notwendig, sie als objektiv irrend zu
denken. Dies formuliert Simon folgendermaßen: „Das Gewissen kann zwar ‚subjektiv‘
nicht irren, […] es kann sich aber […] als ‚objektiv‘ irrend verstehen“.89 Es muss sich so
verstehen. Und dies allein kann als Pflicht angesehen werden: über die moralische
Urteilskraft moralisch zu urteilen. Nicht nur einem Ketzerrichter, sondern jedem
Handelnden ist es unmöglich, sich als objektiv gerecht zu denken und bei einer
Handlung für sich mit Recht eine Gewissensruhe zu beanspruchen.90 Es muss also
immer ein schlechtes Gewissen, nicht nur eine sich selbst richtende, sondern auch sich
selbst verurteilende, sich selbst immer schuldig findende moralische Urteilskraft sein,
die für sich das letzte Wort in moralischen Dingen beansprucht.91
So kommen wir zu folgendem Schluss, der nicht völlig unerwartet, aber auch
nicht unmittelbar evident ist, sondern vom Ansatz der kantischen Moralphilosophie
impliziert wird: Die moralische Urteilskraft muss sich unvermeidlich selbst verurtei-
89 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 430 f. Diese Formulierung
scheint treffender zu sein als die Einteilung in das prospektive und retrospektive Gewissen von Bernecker (Simon, Kant zur moralischen Selbsterkenntnis, S. 173 ff.).
90 Ein sich mit Sicherheit irrender Ketzerrichter ist Kants Beispiel (RGV, AA 6, S. 186 f.), zu dem wir im
Zusammenhang mit Nietzsche zurückkehren werden, der diese Passage bei Kant als Zeugnis seines
„psychologische[n] Idiotismus“ ansah (Nietzsche, Nachlass, Ende 1886–Frühjahr 1887, 7[4], KSA 12,
S. 268). Das Beispiel scheint tatsächlich schon deshalb zweifelhaft zu sein, weil ein Ketzer, historisch
gesehen, niemals als „sonst gute[r] Bürger“ beurteilt wurde, sondern gerade als derjenige, der dem
Gemeinwohl schadet. Man kann Kants Argumentation gewiss als „artifiziell“ betrachten, wenn er sagt,
es könne niemals eine apodiktische Gewissheit geben, der angebliche Ketzer irre sich. Doch kann man
die Schwierigkeit nicht bloß mit der Nötigung zum „Einräumen der Möglichkeit eines anderen Gewissens“ durch das eigene lösen (Hoffmann, Gewissen als praktische Apperzeption, S. 442). Die Unmöglichkeit der apodiktischen Gewissheit bzw. des guten Gewissens ist dafür ernst zu nehmen. Kants
Beispiel sollte demonstrieren, dass das Gewissen gerade dann irrt, wenn es schweigt, und deshalb das
eigene Schweigen nicht als Rechtfertigung betrachten kann. Mit dem Ketzerrichter-Beispiel wird
allerdings gleichzeitig die Grenze gezogen, die Kant nicht überschreiten wollte: Es ist das Beispiel von
einem irrenden Gewissen, das sein Gegenteil nicht ausschließen, sondern gerade verdeutlichen sollte.
Schließlich wird die Unmöglichkeit eines Freispruchs seitens des Gewissens bzw. einer objektiv nicht
irrenden moralischen Urteilskraft bei Kant nur noch indirekt angedeutet.
91 Der alltägliche Sprachgebrauch bestätigt es: Man spricht vom Gewissen eben dann, wenn es um
ein Schuldgefühl bzw. um die Nötigung zur Selbstrechtfertigung geht. Zum Gewissen als erster und
letzter Instanz der auf sich gestellten ethischen Orientierung s. Stegmaier, Philosophie der Orientierung,
S. 603 f. Zur Vorgeschichte des Begriffs bei Kant s. Hoffmann, Gewissen als praktische Apperzeption,
S. 426 ff. U. a. wird hier auf Demokrit hingewiesen, dessen Ausdruck συνείδησις τῆῆς κακοπραγμοσύνη
als „schlechtes Gewissen“ verstanden werden kann. Dennoch scheint Hoffmann den kantischen
Begriff des Gewissens nicht im Sinne des Verurteilens zu verstehen, sondern dessen Spezifikum nur im
Bezug auf die Handlungen zu sehen, wofür die moralische Urteilskraft schon immer zuständig war. Er
bringt damit den kantischen Begriff des Gewissens dem hegelschen zu nahe. Der letztere sah „das
Wesen des Gewissens dies Berechnen und Erwägen abzuschneiden, und ohne solche Gründe aus sich
zu entscheiden“ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 475). Nach Kant wird
im Gewissen gerade dieser Abbruch gerichtet, der immer zu früh erfolgt. Deshalb kommt es nicht zum
guten Gewissen.
1.2 Die moralische Urteilskraft
61
len, indem sie sich selbst richtet, d. h. indem sie zum Gewissen wird. Als vor der
Handlung stehender Täter gerät sie in die Kasuistik, aus deren Perspektive sie nach
der Tat für sich selbst verdächtig und schuldig aussehen muss. Dieser Gedanke
kommt deutlich zum Ausdruck, wenn Kant sagt, das Gewissen richte „nicht die Handlungen als Casus“, sondern „hier richtet die Vernunft sich selbst“ (RGV, AA 6,
S. 186).92 Dies zu tun ist eine unbedingte moralische Pflicht; es ist eine Pflicht der
Vernunft gegenüber der Vernunft. Die sich selbst richtende moralische Urteilskraft als
härtester aller Richter soll ihr eigenes Urteil (zumindest der Möglichkeit nach) als
fehlerhaft betrachten und sich selber schuldig sprechen, weil sie in jedem positiven
Urteil, bei dem sie zum für die Handlung unvermeidlichen Abbruch der Kasuistik
genötigt ist, einen Mangel bzw. eigene Unvollkommenheit vermutet. Sie bestätigt
somit die Radikalität des Bösen der menschlichen Natur, indem sie einen Richter
schafft, der das „Heiligste, was Gott auf Erden hat“ auf überzeugendste Weise zum
inneren Maßstab umdeutet, demzufolge nicht bloß die Handlungen und Absichten,
sondern auch die Maximen in ihrer Rechtmäßigkeit unter Verdacht geraten müssen.
Insofern kann die Gewissensruhe tatsächlich nur auf die Verkehrtheit des Herzens
(dolus malus) hindeuten (RGV, AA 6, S. 38). Das Böse ist dem Menschen unvermeidlich. Kant beruft sich dabei auf die Worte des Apostels Paulus:
Es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder – es ist Keiner, der Gutes tue (nach dem
Geiste des Gesetzes), auch nicht einer. (RGV, AA 6, S. 39)
Den Richter, der diesen harten Schuldspruch ausspricht, müssen wir, um den Menschen als sittliches und vernünftiges Wesen denken zu können, jedem Menschen als
seine „moralische Beschaffenheit“, als Vermögen des Gemüts beilegen.
Das Gewissen, dieses „wundersame[ ] Vermögen in uns“ (KpV, AA 5, S. 98), dient
somit gleichsam einer Brücke zwischen der innerlich befangenen moralischen Urteilskraft und dem Urteil des Richters – des äußerlichen (im Recht) oder des äußerlich
gedachten (in der Religion) – und verschafft diesem innere Plausibilität. Das schlechte Gewissen ist die unvermeidliche Folge der Unvollkommenheit der Positivität in der
Vorstellung von den eigenen Pflichten. Es ist das Bedenken der Kluft zwischen den
allgemeinen Prinzipien und den konkreten Urteilen, zwischen der allgemeinen Menschenvernunft und dem privaten Urteilsvermögen des Einzelnen:
[…]denn wenn sie [die Vernunft – E.P.] sagt: thue so viel Gutes, als du kannst; so ist solches noch
lange nicht zu meiner Beruhigung hinreichend. Denn, wo ist ein Mensch, der da bestimmen
92 Schopenhauer interpretierte es als Kants Ungereimtheit, dass „der Ankläger“ im Gewissen immer
verlieren solle. (Arthur Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, Bd. 4, S. 169). Wir haben
dagegen gesehen, dass der „Ankläger“ vor dem Richterstuhl des Gewissens eines Menschen gerade
umgekehrt niemals verlieren kann. „[D]er Advocat, der zu seinem Vortheil spricht“, kann „den
Ankläger in ihm keineswegs zum Verstummen bringen […]“ (KpV, AA 5, S. 98).
62
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
könnte, wie viel Gutes er thun kann, oder der so vermessen seyn sollte, zu sagen: Ich habe alles
Gutes gethan, was ich gekonnt habe?93
Wenn jemand es wagen würde, dies zu sagen, so würde er gleichsam behaupten, dass
er kein Gewissen, keine sich selbst richtende moralische Urteilskraft nötig hat. Als
Mensch darf er dies niemals tun. Denn seine Achtung vor dem ihm unbegreiflichen
moralischen Gesetz einerseits und sein Bedenken eigener Unvollkommenheit andererseits lassen ihm keine Möglichkeit zur Nachsicht gegenüber sich selbst, sondern
rufen zur Wachsamkeit und zur stetigen Unruhe auf. Das in concreto urteilende und
handelnde Subjekt muss sich vor dem höchsten Gerichtshof eigener Vernunft schuldig sprechen, um sich als moralisch und vernünftig denken zu dürfen.
1.3 „Ergänzungsstück“ der Moralität und das Ideal der
Vollkommenheit
Der Übergang von der bloß objektiven Pflichtvorstellung zum subjektiven Grund der
Handlung bleibt für die Tugendlehre kasuistisch und deswegen unsicher. Die moralische Urteilskraft muss sich selbst stets verurteilen. „Die […] sklavische Gemüthsstimmung“ und ein „verborgener Haß des Gesetzes“ (RGV, AA 6, S. 25) wären die
höchstwahrscheinliche Folge davon und eine moralische Handlung ohne die „sophistischen Ausflüchte vom Gebot der Pflicht“ nicht möglich, d. h. es wären gar keine
moralischen Handlungen möglich, wenn dies tatsächlich der letzte Schluss der Moralphilosophie sein sollte. Dennoch, wie schon mehrmals angedeutet, darf die ästhetische Bedingtheit des urteilenden und handelnden Menschen vom kantischen Denken
her nicht einfach verurteilt werden. Nur deren Verkennung und Verleugnung verdient
eine solche Verurteilung. Indem sie aber anerkannt wird, findet die Unvollkommenheit der menschlichen Natur ein „Ergänzungsstück“, dank dem der an seinen eigenen
moralischen Ansprüchen sonst verzweifelnde Mensch eine Versöhnung des Tierischen und des Menschlichen in sich erreichen kann. Zumindest lässt sich ein solches
Ergänzungsstück denken: die Liebe (Das Ende aller Dinge, AA 8, S. 338).
Eine besondere Stellung der Liebe als „unentbehrliche“ Ergänzung zu Recht und
Ethik bei Kant betont Josef Simon: Die Liebe „erscheint bei Kant […] als notwendige
Ergänzung zu Ethik und Recht“.94 Denn:
Das Handeln der Menschen kann ihr gutes Zusammenleben (und damit das Wohl der Gattung)
auch dann nicht bewirken, wenn es sich ethisch und rechtlich zu orientieren sucht.95
93 Immanuel Kant, Vorlesungen über die philosophische Religionslehre, S. 225 f.
94 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 391.
95 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 469.
1.3 „Ergänzungsstück“ der Moralität und das Ideal der Vollkommenheit
63
Die Anwendung des Rechts bleibt beschränkt und äußerlich erzwungen, der Grund
für die konkrete Handlung immer undurchschaubar, die Richtigkeit eines Urteils
zweifelhaft. Die Möglichkeit des Guten entspringt der Wirklichkeit des Bösen. Und das
Böse in seiner Radikalität lässt der moralischen Urteilskraft keine Hoffnung, vor dem
eigenen Gerichtshof gerechtfertigt zu werden. Es ist die Liebenswürdigkeit des moralischen Gesetzes allein, die ohne Angst vor Strafe und ohne Hoffnung auf eine
Belohnung einen Übergang von der Pflichtvorstellung zur Pflichtbefolgung schaffen
kann. In Das Ende aller Dinge kommt Kant zum Schluss auf den Gedanken, dass, wenn
die Liebeswürdigkeit des moralischen Gebots (als neben der Heiligkeit der Gesetzgebung eine dem Christentum zustehende Eigenschaft) untergehen könnte, dieser
Untergang der Errichtung eines „vermutlich auf Furcht und Eigennutz gegründete[n]“
Reichs des Antichristen, wo Moralität selbst nicht mehr möglich ist, gliche (Das Ende
aller Dinge, AA 8, S. 339).
Doch die Liebe als Wohlgefallen gehört nicht zu den Triebfedern der Moralität.
Eine der kasuistischen Fragen in Hinsicht auf Liebespflichten gegen andere Menschen
lautete: ob „es mit dem Wohl der Welt überhaupt nicht besser stehen“ würde, „wenn
alle Moralität der Menschen nur auf Rechtspflichten, doch mit der größten Gewissenhaftigkeit eingeschränkt, das Wohlwollen aber unter die Adiaphora gezählt würde“.
Es lässt sich vermuten, dass eine solche Einschränkung für das Recht, für den „ewigen
Frieden“ sogar besser wäre. Und ausnahmsweise beantwortet Kant seine kasuistische
Frage (denn meistens bleiben sie ohne Antwort):
Aber in diesem Fall würde es doch wenigstens an einer großen moralischen Zierde der Welt,
nämlich der Menschenliebe, fehlen, welche also für sich, auch ohne die Vortheile (der Glückseligkeit) zu berechnen, die Welt als ein schönes moralisches Ganze in ihrer ganzen Vollkommenheit
darzustellen erfordert wird. (MS, AA 6, S. 458, meine Hervorhebung – E.P.)
Das Argument zugunsten der Ergänzung des Moralischen kommt also nicht aus der
moralischen Nötigung des friedlichen und rechtlich gesicherten Zusammenlebens,
sondern aus der auf den ersten Blick für die Moralität ganz fremden Perspektive des
Ästhetischen: die Vollkommenheit der Welt als „ein schönes moralisches Ganze[s]“
soll möglich sein.96
Und dennoch: Das ästhetische Argument ist in moralischen Dingen gerade aus
der Perspektive der kantischen Moralphilosophie äußerst fraglich. Kants Unterscheidung der Liebe als Neigung, die „nicht geboten werden“ kann (GMS, AA 4, S. 399; MS,
AA 6, S. 401), und der Liebe als Wohltätigkeit, die als Pflicht gegen den anderen
verstanden wird, scheint das „Ästhetische“ (das Gefühl oder das Wohlgefallen) dem
Ethischen (dem guten Willen oder dem Wohlwollen) gerade radikal entgegenzuset96 Der Idee der moralischen Welt und ihren Wandlungen bei Kant ist ein aufschlussreicher Aufsatz
bzw. eine Vorlesung von Dieter Henrich gewidmet. U. a. wird die Unentbehrlichkeit dieser Idee für
Kants Ethik gezeigt, die Kant Rousseau zu verdanken hat (Henrich, Aesthetic Judgment and the Moral
Image of the World).
64
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
zen. Eine Neigung kann keine entscheidende Rolle für die Moralität spielen, weil
gerade die Moralität den Neigungen Abbruch tun muss – Kants Argumentation für
diese These ist wohl bekannt. Wenn die Liebe dagegen bloß als moralisches Wohlwollen und insofern als Tugendpflicht verstanden wäre, dann könnte sie den kasuistisch-kumulativen Fragen nach den subjektiven Gründen in Befolgung der Pflicht
nicht entgehen. Folglich wäre sie auch keine Ergänzung der Unvollkommenheit der
menschlichen Natur. Wenn sie die Moralität in concreto vollenden und dem Handelnden über seine Triebfedern Gewissheit verschaffen soll, kann sie nicht rein intellektuell, sondern muss auch ästhetisch bedingt sein und ebendiese ästhetische Bedingtheit
als Grundlage zur moralischen Vollkommenheit zu nutzen wissen. Wie ist das aber
möglich, wenn das Moralische eben als Intelligibles, als von allem Empirischen freies
Vermögen des Menschen gedacht wird?
In der Metaphysik der Sitten wird eine wichtige Differenzierung durchgeführt: Nicht nur die Liebe als Neigung, sondern auch die Liebe als Wohlwollen ist
nach Kant unvermeidlich ästhetisch bedingt. Hier scheint ein längeres Zitat nötig zu
sein:
Aber Einer ist mir doch näher als der Andere, und ich bin im Wohlwollen mir selbst der Nächste.
Wie stimmt das nun mit der Formel: Liebe deinen Nächsten (deinen Mitmenschen) als dich
selbst? Wenn einer mir näher ist (in der Pflicht des Wohlwollens) als der Andere, ich also zum
größeren Wohlwollen gegen Einen als gegen den Anderen verbunden, mir selber aber geständlich näher (selbst der Pflicht nach) bin, als jeder Andere, so kann ich, wie es scheint, ohne mir
selbst zu widersprechen, nicht sagen: ich soll jeden Menschen lieben wie mich selbst; denn der
Maßstab der Selbstliebe würde keinen Unterschied in Graden zulassen. – Man sieht bald: daß
hier nicht blos das Wohlwollen des W u n s c h e s , welches eigentlich ein bloßes Wohlgefallen am
Wohl jedes Anderen ist, ohne selbst dazu etwas beitragen zu dürfen (ein jeder für sich; Gott für
uns alle), sondern ein thätiges, praktisches Wohlwollen, sich das Wohl und Heil des Anderen
zum Z w e c k zu machen, (das Wohlthun) gemeint sei. Denn im Wünschen kann ich allen g l e i c h
wohlwollen, aber im Thun kann der Grad nach Verschiedenheit der Geliebten (deren Einer mich
näher angeht als der Andere), ohne die Allgemeinheit der Maxime zu verletzen, doch sehr verschieden sein. (MS, AA 6, S. 451 f.)
Diese Passage ist für die Zwecke unserer Untersuchung äußerst wichtig. Hier wird
eine Formel angesprochen, die Dostojewski für die Quintessenz ‚westlicher‘ Moralität
halten wird: „ein jeder für sich; Gott für uns alle“. Das wäre eine rein vernünftige
Moralität, ein bloßes „Wohlwollen des Wunsches“, „ein bloßes Wohlgefallen am
Wohl jedes Anderen“. Dennoch weist Kant sie gerade für ästhetisch bedingte Vernunftwesen, die zu konkreten Handlungen fähig sein sollen, ausdrücklich zurück: Die
tätige Liebe ist die einzige, die solchen Wesen geboten werden kann; und sie darf
auch durch die ästhetische Begrenztheit des Handelnden bestimmt werden. Denn die
Nebenmenschen sind mir gegenüber immer in prinzipiell ungleichen Positionen –
schon deswegen, weil sie meine tätige Liebe in verschiedenen Graden nötig haben
und noch mehr weil ich zu ihrem „Wohl und Heil“ nur mehr oder weniger beitragen
kann. Für ein nicht bloß denkendes und urteilendes, sondern unter den Raum-und-
1.3 „Ergänzungsstück“ der Moralität und das Ideal der Vollkommenheit
65
Zeit-Bedingungen handelndes Subjekt ist die tätige Liebe immer ästhetisch bedingt.
Nur deshalb ist sie überhaupt möglich.
Damit ist dennoch über diese Liebe selbst noch nicht viel gesagt. Sie wäre ja doch
keine Ergänzung der Unvollkommenheit, wenn es nur um die ästhetisch-subjektive
Bedingtheit des Standpunktes des Handelnden ginge, der gewisse Neigungen hat und
auch gewisse Fähigkeiten besitzt. Der entscheidende Punkt soll in der ergänzenden
Tat der Liebe gerade aus dieser subjektiven Beschränktheit der moralischen Urteilskraft bestehen. Und das entspricht tatsächlich Kants Begriff der Liebe. Als allgemeine
Tugendpflicht bleibt sie (wie auch die Pflicht der Achtung) nur negativ, d. h. „sie ist
die Pflicht anderer ihre Z w e ck e (so fern diese nur nicht unsittlich sind) zu den
meinen zu machen“ (MS, AA 6, S. 450). Sie ist also bloß beschränkend: nur die
fremden Zwecke, die nicht unmoralisch sind, müssen als eigene verfolgt werden. Als
„unentbehrliches Ergänzungsstück der Unvollkommenheit der menschlichen Natur“
wird sie positiv: Sie ist „die freie Aufnahme des Willens eines Anderen unter seine
Maximen“ (Das Ende aller Dinge, AA 6, S. 338). Eine „Aufnahme des Willens eines
Anderen“ kann aber wohl dem moralischen Gesetz widersprechen, falls dessen Wille
nicht moralisch ausgerichtet ist. Wie ist sie dann zu verstehen?
Nicht nur die Unmoralität, sondern auch die Undurchschaubarkeit des fremden
Willens steht seiner Aneignung im Wege. Der andere und seine Vorstellung des
Allgemeinen, seine Maxime, seine Gesinnung sind mir nicht zugänglich. Aber auch
die Moralität meiner eigenen Maxime bleibt für mich ungewiss. Wenn ich diese für
absolut richtig halte, bin ich ein „moralische[r] Egoist“, „welcher alle Zwecke auf sich
selbst einschränkt“ (AH, AA 7, S. 130), d. h. ich habe mich dann in meinen moralischen
Vorstellungen verschlossen und bin gerade zu keiner Moralität fähig. Gerade hier
setzt die ergänzende Tat der Liebe ein: Obwohl der andere als „fremde Vernunft“ aus
meiner begrenzten Perspektive unvermeidlich unmoralisch aussieht, wenn er meinen
Maximen, meinen moralischen Vorstellungen nicht folgt, gebietet mir die Liebe, ihm
dennoch zu unterstellen, dass er wohl im Stande ist, das Gute in seinen Willen aufzunehmen, d. h. dass er doch moralisch und vernünftig ist, selbst wenn seine Moralität
und Vernünftigkeit mir wesentlich verborgen bleiben. Diese Auffassung der Liebe
verdeutlicht u. a. die Zweck-Mittel-Formulierung des kategorischen Imperativs. Von
dem Begriff der Liebe aus lässt sich die Forderung, „die Menschheit sowohl in deiner
Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals
bloß als Mittel“ zu betrachten (GMS, AA 4, S. 429), neu verstehen: Kein Mensch darf
als unvernünftiges bzw. unmoralisches Wesen behandelt werden.97 Dennoch bleibt
diese Forderung abstrakt. Konkret wird sie durch den Begriff einer ästhetisch beding-
97 Zu diesem Ansatz Kants, d. h. zu dem Punkt seiner Moralphilosophie, dass der moralische Wert (die
Würde) keinem Menschen abgesprochen werden darf, wie weit er auch von dem Ideal der Moralität
entfernt sein mag, im Unterschied zu bspw. Christian Wolff s. Klemme, Kant und die Paradoxien der
Kritischen Philosophie, S. 43 f. Zur Frage, ob die Zweck-Mittel-Formulierung des kategorischen Imperativs sich nicht nur negativ-einschränkend verstehen lässt, s. W.P. Mendonça, Die Person als Zweck an
66
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
ten tätigen Liebe: Eine solche Haltung ist nur im Bezug auf konkrete Menschen denkbar. Denn Vernünftigkeit und Moralität müssen nicht bloß unterstellt werden, sondern die konkrete Situation muss aus dieser Unterstellung heraus beschritten werden.
Das Gebot der die Moral ergänzenden Liebe lautet also: Ich soll gegenüber dem
anderen so handeln, als ob sein Wille moralisch und vernünftig wäre, und das kann
ich nur frei tun, d. h. unabhängig von allen empirischen Beweisen des Gegenteils, die
dieser Unterstellung im Wege stehen würden (seine aus meiner Sicht bösen und
unvernünftigen Taten). Denn – und dies ist ein wichtiger Punkt – ich selbst kann mir
meiner Moralität und Vernünftigkeit in einer konkreten Situation niemals sicher sein.
Die so verstandene Liebe bedenkt eben das eigene Beschränkt-Sein stets mit, ohne
jedoch an ihm zu verzweifeln. Sie kann deshalb, anders formuliert, als freies Eingeständnis der objektiven Unvollkommenheit der eigenen subjektiven Haltung gegenüber
den anderen gedeutet werden.98 Als Liebe kann eine solche Haltung nicht geboten
werden („ich kann nicht lieben, weil ich will, noch weniger aber weil ich s o l l “ (MS,
AA 6, S. 401)), und so ist sie frei auch in dem Sinne, dass hier kein Sollen angemessen
ist. Wenn das Gewissen sich stets als die objektiv irrende Urteilskraft ansehen muss,
wenn es immer „schlechtes Gewissen“ bleibt, das sich selbst stets schuldig spricht,
kann „eine fröhliche Gemütsstimmung“ nur der Gewissheit entspringen, „das Gute
auch l i e b g e w o n n e n “ zu haben (RGV, AA 6, S. 24; vgl. auch RGV, AA 6, S. XII,
Anmerk.). Es ist dementsprechend immer die Liebe zu einem nahe stehenden Menschen, zum Nächsten, sie muss sogar in der Neigung zu einigen Menschen verankert
werden. Denn man kann nicht alle Menschen lieben und sie vom Bösen und der
Unvernunft freisprechen, dennoch kann man es sehr wohl gegenüber bestimmten
Menschen tun. Der Liebe als „Ergänzungsstück“ der Moralität ist damit eine besondere, wenn nicht zentrale Stelle in Kants Ethik zugewiesen.99 Sie verbindet „die sinnliche Zuneigung zu bestimmten Personen mit der moralischen Verpflichtung gegenüber der Menschheit in jeder Person“. Dies ist für die „nicht rein vernünftigen
Wesen“, für die Menschen, notwendig.100
Die Moralität eines einzelnen Menschen wird dadurch vervollkommnet, dass man
anderen Vernünftigkeit und Moralität zugesteht. Dies geschieht nicht etwa trotz der
sich (s. dort entsprechende Literaturhinweise, S. 168). Der Begriff der Liebe kommt hier allerdings nicht
vor.
98 Dieser Gedanke kann als Rechtfertigung gegen den Vorwurf des moralischen Rigorismus gelten.
Denn obwohl in Kants berühmtem Beispiel die Lüge moralisch nicht akzeptabel ist, bleibt eine
Bezeichnung der fremden Handlung durch den „harten Namen“ der Lüge kasuistischen Fragen ausgeliefert (MS, AA 6, S. 429). Der Begriff der Lüge darf niemals bei anderen, sondern nur bei sich selbst
angewandt werden.
99 Vgl. bei Simon: „Nur die daseiende (weder „gesollte“ noch „natürliche“) Liebe kann als Bedingung
der Möglichkeit des Bestehens der menschlichen Gattung angesehen werden. – Wenn Kant diesen
Punkt auch selbst nicht besonders hervorhebt, so hat er doch eine zentrale Bedeutung für das gesamte
System der Kritik“ (Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 469).
100 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 466.
1.3 „Ergänzungsstück“ der Moralität und das Ideal der Vollkommenheit
67
ästhetischen Begrenztheit des eigenen Standpunktes, sondern gerade dank dieser
Begrenztheit. Der moralische Wert der ästhetisch bedingten Liebe wird dabei nicht im
Geringsten vermindert. Ganz im Gegenteil: Die so verstandene Liebe setzt die Achtung
der Persönlichkeit des Geliebten voraus und dies als Bestimmungsgrund der Willkür,
als oberste Maxime. Eine Handlung, die aus der Gewissheit der Liebe kommt, kann
sich deshalb tatsächlich vor dem höchsten moralischen Gerichtshof des Gewissens
rechtfertigen. Mehr noch: Das ist vielleicht der einzig sichere Weg, sich selbst „gewiß“
für moralisch halten zu dürfen, obwohl oder gerade weil die eigene moralische Urteilskraft hierzu immer unzulänglich bleiben muss. Denn wie könnte ich den anderen
für moralisch und vernünftig halten, wenn ich es nicht selbst gewesen wäre? Die Liebe
als „unentbehrliches Ergänzungsstück“ lässt zu, die Vollkommenheit der eigenen
Moralität als Bestimmungsgrund der Handlung positiv zu denken, ohne die Unzulänglichkeit der moralischen Urteilskraft zu leugnen, und entzieht sich allein dadurch dem
Schuldspruch des Gewissens.101 Denn allein die Liebe als „freie Aufnahme des
Willens eines Anderen unter seine Maxime“ gibt die Gewissheit, dass die Handlung
ihm gegenüber tatsächlich moralisch ist. Durch den Begriff der Liebe wird die ästhetische Begrenztheit des Handelnden vom Hindernis der rein intelligibel verstandenen
Moralität zur Bedingung ihrer Vollkommenheit, denn sie ist nicht nur das Wohlwollen
dem anderen gegenüber, sondern auch zugleich das Wohlgefallen an ihm.102 Sie wird
zur Richtschnur im Übergang von der objektiven Vorstellung der Pflicht zu deren
subjektiver Befolgung, weil sie die moralische Gesinnung ist, die keine „Ausflüchte
[…] vom Gebot der Pflicht“ nötig hat, weil sie die Gewissheit verschafft, deren kein Urteil fähig ist.
Durch den positiven Begriff der Liebe wird eine Brücke zu einer für die Moral
unentbehrlichen Idee der moralischen Vollkommenheit geschlagen. Das abstrakte
moralische Wohlwollen muss sich der ästhetisch bedingten Liebe bedienen – in der
Situation der Nötigung zur Handlung, in der das Wohl bestimmter Menschen (und
nicht bloß die allgemein gewollte Ordnung) tatsächlich befördert werden soll. Fremde
Glückseligkeit und eigene Glückswürdigkeit, das Wohl eines konkreten Menschen
und das Kriterium der Allgemeinheit werden im Begriff der tätigen bzw. ästhetisch
101 Es ist, denke ich, überflüssig, zu sagen, dass diese Interpretation der Liebe als Ergänzung der
Moralität mit Schillers „Grazie“ kaum etwas Gemeinsames hat. Zum grundlegenden Unterschied des
Begriffs der Liebe bei Kant und bei Schiller s. z. B. Prauss, Kant über Freiheit als Autonomie, S. 259 ff.,
302 ff.
102 Die Frage nach dem anderen bei Kant bringt seine Moralphilosophie in Zusammenhang mit der
von Emmanuel Levinas. S. dazu Norbert Fischer, Zur Kritik der Vernunfterkenntnis bei Kant und Levinas.
Die Idee des transzendentalen Ideals und das Problem der Totalität und Norbert Fischer, Dieter Hattrup,
Metaphysik aus dem Anspruch des Anderen. Kant und Levinas. In diesen Untersuchungen werden die
weittragenden Bedeutungen der fremden Vernunft bei Kant einerseits und des Anderen bei Levinas
andererseits aufeinander bezogen; danach weisen beide auf die absolute Transzendenz Gottes hin.
Allerdings scheint hier bei den ansonsten überzeugenden Gedankengängen und Schlussfolgerungen
die Verschiedenheit beider Denker etwas untergegangen zu sein.
68
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
bedingten und zugleich vernünftigen Liebe aufgehoben. Die Liebe, die in der Neigung
zu einem bestimmten Menschen verankert ist und ihn deshalb als moralisches Wesen
betrachtet, weiß nichts von der Kasuistik der Tugendlehre. Sie ist kein Urteil und
braucht deshalb auch keine Gewissheit im Fürwahrhalten. Sie tut das, was ihr wohlgefällt. Und noch wichtiger: Sie richtet nicht, auch sich selbst muss sie nicht verurteilen.103
Aber auch wenn Liebe kein Fürwahrhalten ist und einem anderen Menschen
Vernünftigkeit frei unterstellt, braucht sie, um als Leitfaden zur Handlung zu dienen,
einen Maßstab, ein Kriterium. Dies kann keine allgemeine Regel, kein Prinzip sein,
sonst wären Liebe und moralische Urteilskraft identisch. Ihr Leitfaden ist vom Ästhetischen her bestimmt, darf aber nicht bloß ästhetisch sein. Er muss also eine ästhetisch bedingte Vorstellung von dem vermitteln, was übersinnlich bleibt – von der Idee
der Menschheit. Ein solches Richtmaß hat Kant schon in der Kritik der reinen Vernunft
gefunden:
Tugend und mit ihr menschliche Weisheit in ihrer ganzen Reinigkeit sind Ideen. Aber der Weise
(des Stoikers) ist ein Ideal, d. i. ein Mensch, der bloß in Gedanken existirt, der aber mit der Idee
der Weisheit völlig congruirt. So wie die Idee die R e g e l giebt, so dient das Ideal in solchem Falle
zum U r b i l d e der durchgängigen Bestimmung des Nachbildes; und wir haben kein anderes
Richtmaß unserer Handlungen, als das Verhalten dieses göttlichen Menschen in uns, womit wir
uns vergleichen, beurtheilen und dadurch uns bessern, obgleich es niemals erreichen können.
(KrV A 569/B 597 f., meine Hervorhebungen – E.P.)
Hier ist bezeichnenderweise nicht von Gesinnung die Rede, sondern von moralischen
Handlungen, ihrer äußeren, empirischen Realisierung. Die nicht rein vernünftigen
Wesen, die Menschen, brauchen ein Urbild der Vollkommenheit, dessen „praktische Kraft“ „der Möglichkeit der Vollkommenheit gewisser H a n d l u n g e n “ vorausgeht (KrV A 569/B 597). „Die objektive Notwendigkeit“ des Ideals der vollkommenen
Menschheit muss aus diesen Gründen trotz ihrer Unbegreiflichkeit „doch unvermindert und für sich selbst einleuchte[nd]“ sein (RGV, AA 6, S. 62).
Nur ein Ideal könnte also den Maßstab der Liebe ausmachen. Und nur dann,
wenn es als Ideal der Menschheit gedacht wird, das die vollkommene Liebesfähigkeit
und die vollkommene Liebenswürdigkeit vereinigt. Als „personifizierte Idee des guten
Prinzips“ würde es zum Urbild eines Menschen, in dem „Gott die Welt geliebt“ hat
(RGV, AA 6, S. 60), zu einer personifizierten Vorstellung von der „Liebe des Gesetzes“
(RGV, AA 6, S. 145), die als Liebe zum Gesetz, aber auch als die vom Gesetz kommende
103 Das Gewissen wird von Kant zu den moralischen Beschaffenheiten gezählt, die „insgesamt
ä s t h e t i s c h“ sind: das moralische Gefühl, das Gewissen, die Menschenliebe (MS, AA 6, S. 399). Das
moralische Gefühl ist bloß „Empfänglichkeit der freien Willkür“ zum Moralischen; das Gewissen sieht
eben in der eigenen ästhetischen Begrenztheit den Grund für den Selbstverdacht und folglich für die
Selbstbezichtigung; die Menschenliebe deutet die ästhetische Bedingtheit in die Grundlage der moralischen Vollkommenheit um.
1.4 Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol
69
Liebe zu verstehen ist, als göttliche Liebe zur Menschheit.104 Erst durch dieses Urbild
der Liebe, dem kein Bild vollständig entsprechen kann, begreifen die ästhetisch
bedingten Vernunftwesen, dass sie zur moralischen Vollkommenheit berufen sind.
1.4 Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol
Eine ästhetische Verdeutlichung des Ideals wird so für die Vervollkommnung der
Moral aus Vernunft genauso unentbehrlich wie die moralische Urteilskraft für die
Vermittlung zwischen dem kategorischen Imperativ in seiner strengen Forderung
der Vollkommenheit und dem einzelnen Urteil in seiner Fehlerhaftigkeit unentbehrlich ist. Die vollkommene Moralität darf nicht bloß eine Idee bleiben, sondern sie
wird zum Ideal, das nichts anderes ist als „die Vorstellung eines einzelnen als einer
Idee adäquaten Wesens“ (KU, AA 5, S. 232). Und hier entsteht wiederum eine gravierende Schwierigkeit: Eine einzelne Vorstellung kann dem Ideal selbst niemals
entsprechen, sondern dient nur dazu, „den Grad und die Mängel des Unvollständigen zu schätzen und abzumessen“. Die Kritik der reinen Vernunft betrachtet eine
solche Erdichtung eher als schädlich und verweist sie in den Rahmen einer schöngeistigen Literatur.
Das Ideal aber in einem Beispiele, d. i. in der Erscheinung, realisiren wollen, wie etwa den Weisen
in einem Roman, ist unthunlich und hat überdem etwas Widersinnisches und wenig Erbauliches
an sich […]. (KrV A 570/B 598, meine Hervorhebung – E.P.)
Die Unmöglichkeit eines Beispiels resultiert konsequenterweise aus der notwendigen
Unvollkommenheit des Einzelnen. Eine solche ästhetische Darstellung einer Vernunftidee würde das Ideal nur verdunkeln. Also darf das Urbild in gar keinem Bild
verwirklicht, sondern nur negativ gedacht werden: Jedes Bild soll als unumgängliches
Abweichen von ihm beurteilt werden. Die Vermittlung der Vernunftideen, und vor
allem der Idee der moralischen Vollkommenheit, kann keinem Beispiel, keiner ästhetischen Darstellung anvertraut werden. Das Ideal „existirt“ dementsprechend „bloß in
Gedanken“ (KrV A 569/B 597). Als „personifizierte Idee“ „scheint“ darüber hinaus
gerade das Ideal der praktischen Vernunft „von der objektiven Realität entfernt zu
sein“ (KrV A 568/B 596).
104 Dem Satz „Gott ist die Liebe“ zufolge entspricht diese Idee nach Kant dem Glaubensprinzip der
christlichen Religionslehre (RGV, AA 6, S. 145). In diesem Zusammenhang weist Simon darauf hin,
dass die eigentliche Befriedigung des Interesses der menschlichen Vernunft und ihre Vervollkommnung bei Kant durch „die Veranschaulichung des Sittlichen“ die „Sache einer positiv-doktrinalen
Religionslehre“ wird (Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 524). Zur
Unentbehrlichkeit einer religiös-symbolischen Kommunikation und Kants Erörterung der religiösen
Symbolik in seinen Jesus-Beispielen s. Claus Dierksmeier, Zum Status des religiösen Symbols bei Kant.
70
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
An diesem Punkt wird in der Kritik der Urteilskraft wieder in Bewegung gesetzt,
was in den ersten zwei Kritiken notwendig ungelöst bleiben sollte. Dies geschieht
wiederum durch die Unterscheidung der Prinzipien und der einzelnen Urteile bzw.
der Vernunft als allgemeines Vermögen, das gegeben ist, auf der einen und der
Urteilskraft als individueller Kraft, die nur geübt werden kann, auf der anderen Seite.
Eine Idee „bloß in Gedanken“ ist für die Handlung, die die Kluft zwischen dem
Übersinnlichen und der Sinnenwelt überbrücken muss, als Richtmaß unzureichend.
In seiner dritten Kritik sucht Kant nach einem Übergang zwischen zwei Welten, die
sich „auf einem und demselben Boden der Erfahrung“ treffen (KU, AA 5, S. 175), er
sucht nach der Richtschnur der Anwendung der Prinzipien des Verstandes und der
Vernunft, nach dem Maßstab ihrer Brauchbarkeit. Die Brücke sollte geschlagen
werden, ohne dabei ihre Verschiedenheit zu nivellieren. Weder die Verstandesbegriffe
noch die Vernunftideen haben sich jedoch für eine solche Überbrückung als tauglich
erwiesen, weil die ersteren nur mit der Erfahrung, die letzteren dagegen nur abgesehen von der Erfahrung ihre Realität erhalten. Die Überbrückung könnten nur die
Ideen gewährleisten, die „in einem Musterbild völlig in concreto dargestellt werden“
(KU, AA 5, S. 233). Kant nennt sie ästhetische Ideen.
Der Begriff der ästhetischen Idee, die ein „Gegenstück“ zur Vernunftidee darstellen soll, sieht auf den ersten Blick wiederum hochgradig paradox aus: Als Idee
sollte sie ein reiner Vernunftbegriff sein; als ästhetische kann sie keinem Begriff
adäquat sein, sondern muss eine Anschauung bleiben. Sie ist eine Anschauung, der
kein Begriff adäquat ist (KU, AA 5, S. 314). Und tatsächlich entspringen die ästhetischen Ideen nicht der subsumierenden Urteilskraft, die zwischen der Wahrnehmung
und der Begrifflichkeit vermittelt und dafür sorgt, dass die Begriffe über ein Schema
an Anschauungen Anwendung finden, sondern der reflektierenden Urteilskraft, für
die keine Regel und keine Begriffe vorgegeben sind.105 „[…]Eine ästhetische Idee, die
jener Vernunftidee statt logischer Darstellung dient“, ist dazu da, „das Gemüth zu
beleben, indem sie ihm die Aussicht in ein unabsehliches Feld verwandter Vorstellungen eröffnet“ (KU, AA 5, S. 315). Aber was heißt hier „verwandte Vorstellungen“?
Im Unterschied zu Vernunftideen haben die ästhetischen Ideen kein logisches
Kriterium für diese Verwandtschaft, sondern allein denjenigen Leitfaden der Urteilskraft, der als einziger in der dritten Kritik angesetzt wird: das Kriterium des Passens.
Um nach diesem Kriterium verfahren zu können, braucht man den „Geist, in
ästhetischer Bedeutung“, der „das belebende Prinzip im Gemüthe“ ist (KU, AA 5,
S. 313). Über dieses Kriterium bzw. über die Richtigkeit seiner Anwendung kann
dementsprechend jeder bloß gemäß der Fähigkeiten seiner Urteilskraft urteilen. Der
Maßstab dafür kann weder für alle Zeiten noch für jede Menschenvernunft gegeben
105 Die ästhetischen Ideen im engeren Sinne müssen deswegen von den ästhetischen Normalideen
unterschieden wer-den. Die letzteren können vermittelst eines „zwischen allen einzelnen, auf mancherlei Weise verschiedenen Anschau-ungen der Individuen schwebende[n] Bild[es]“ „bloß schulgerecht“ sein (KU, AA 5, S. 234 f.).
1.4 Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol
71
werden. Dies ist ein großer Mangel und ein großer Vorteil zugleich. Denn durch
jedes konkrete Bild, jedes anschauliche Beispiel, das zum Muster für die unendliche Reihe der anderen konkreten Bilder, der anderen unendlich voneinander abweichenden Einzelvorstellungen erklärt wird, wird die Belebung der Gemütskräfte erreicht, die durch keine Vernunftidee bzw. keinen Verstandesbegriff möglich
wäre.
Die ästhetische Idee macht so den Maßstab für die Urteilskraft aus, jedoch
wiederum nicht durch eine Regel, sondern durch ein produktives Vermögen. Sie ist
die Idee, „die viel zu denken veranlaßt, ohne daß ihr doch irgend ein bestimmter
Gedanke, d. i. B e g r i f f , adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht
und verständlich machen kann“ (KU, AA 5, S. 314). Sie bezieht sich somit auf die
sinnliche Erfahrung, übersteigt aber jede Erfahrung – durch ihre Produktivität, durch
die Dichtung der Einbildungskraft. Bezeichnenderweise gesteht Kant den durch
dieses produktive Vermögen entstandenen Ideen das zu, was dem transzendentalen
Ideal der Vernunft abgesprochen wurde: die sinnliche Vollständigkeit des Bildes. Die
Vernunftidee der moralischen Vollkommenheit in einem Roman, z. B. in Gestalt eines
Weisen, darzustellen, wurde als Ungereimtheit in der Kritik der reinen Vernunft
zurückgewiesen. Die Kritik der Urteilskraft sieht eine solche Darstellung nicht nur als
möglich, sondern als einzigen Weg an, „einer Darstellung der Vernunftbegriffe (der
intellektuellen Ideen) nahe zu kommen“. Das Beispiel ist wieder eines der schöngeistigen Literatur:
Der Dichter wagt es, Vernunftideen von unsichtbaren Wesen, das Reich der Seligen, das Höllenreich, die Ewigkeit, die Schöpfung u.d.gl., zu versinnlichen; oder auch das, was zwar Beispiele in
der Erfahrung findet, z. B. den Tod, den Neid und alle Laster, imgleichen die Liebe, den Ruhm
u.d.gl., über die Schranken der Erfahrung hinaus vermittelst einer Einbildungskraft, die dem
Vernunft-Vorspiele in Erreichung eines Größten nacheifert, in einer Vollständigkeit sinnlich zu
machen. (KU, AA 5, S. 314)
Mehr noch: Nicht nur Vernunftideen, sondern auch das ästhetische Ideal (Idee in
individuo) in einem Beispiel, in einem Bild darzutun, ist, im Unterschied zum Ideal
der reinen Vernunft, nicht nur möglich, sondern auch notwendig. Das wäre das
Ideal der Schönheit, „der sichtbare Ausdruck sittlicher Ideen, die den Menschen
innerlich beherrschen“ (KU, AA 5, S. 235). Letztere Korrespondenz kann wiederum
„nur aus der Erfahrung genommen werden“, und dies auf folgende Weise: In der
Erfahrung werden die ästhetischen Besonderheiten konkreter Menschen beobachtet,
die dann zum Ausdruck der sittlichen Ideen von Tugenden und Lastern umgedeutet
werden; durch die Produktivität der Einbildungskraft entsteht „aus einer unaussprechlichen Zahl von Gegenständen verschiedener Art“ „auf eine uns gänzlich
unbegreifliche Art“ ein einzelnes Bild, „die Gestalt des Gegenstandes“, die in eine
musterhafte Verbindung des Ästhetischen mit dem Ethischen umgedeutet wird, um,
nach ihrem Maßstab gemessen, wiederum zahlreiche konkrete Bilder hervorzubringen (KU, AA 5, S. 234). Ein solches Ideal stellt die Idee der Vollkommenheit ästhe-
72
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
tisch dar.106 Es ist das Ideal der Einbildungskraft, die der Vernunft das letztere als
„Urbild des Geschmacks“ und gleichzeitig als eine der Idee adäquate Vorstellung
(KU, AA 5, S. 232) empfiehlt.
Die Verbindung zwischen dem Ethischen und Ästhetischen, zwischen den Ideen
der Vernunft und der Sinnenwelt, wird auf diese Weise durch die ästhetischen Ideen
erreicht, die sich in den unendlich variablen Einzelvorstellungen verwirklichen. Für
die nicht rein vernünftigen Wesen in ihrer Unvollkommenheit und Gebrechlichkeit ist
diese Verbindung ein wichtiges Hilfsmittel, eine Brücke zum Ideal, das sie „l i e b
g e w o n n e n “ haben und dem sie deshalb willig folgen können. Sie bleibt dennoch
zufällig, vorübergehend, inadäquat. Dies ist nach Kant bloß eine Verbindung kraft
einer Analogie. Doch die Vernunftideen können in der Erfahrung überhaupt nur
unvollkommen dargetan werden.
Es ist allerdings wichtig, dass diese analoge Verbindung zwischen dem Prinzip
der ästhetischen und dem der moralischen Urteilskraft als solche nach Kant keinesfalls zufällig ist, wenn sie auch immer neu und anders hergestellt werden muss.107 Die
ästhetische und die moralische Urteilskraft haben etwas Grundlegendes gemeinsam,
und zwar eine Voraussetzung von „jedermanns Einstimmung“ (KU, AA 5, S. 216) –
und das abgesehen von jedem empirischen Interesse am Gegenstand des Wohlgefallens. Da das Wohlgefallen am Schönen den Genuss an der Harmonie aller Erkenntniskräfte bedeutet, bekommen die Geschmacksurteile ihre Legitimation aus der Idee
des Gemeinsinns, d. h. der Übereinstimmung aller Gemütskräfte bei allen Menschen,
soweit diese sich von ihren Privatbedingungen abstrahieren lassen.108 Es wird voraus-
106 Kant denkt dabei primär an die Dichtkunst und an die Malerei. Zur Dominanz des Paradigmas des
Sehens in Kants Philosophie der Kunst, selbst in Bezug auf die schöne Literatur, s. Birgit Recki,
Immanuel Kant, S. 141 f.
107 Das Verhältnis des Ästhetischen zum Ethischen ist ein großes Thema, das in mehreren Hinsichten
behandelt wurde. S. den Sammelband: Bernhard Greiner, Maria Moog-Grünewald (Hg.), Etho-Poietik.
Ethik und Ästhetik im Dialog: Erwartungen, Forderungen, Abgrenzungen, bes. den in das Problemfeld
einleitenden Beitrag von Hans Krämer (Das Verhältnis von Ästhetik und Ethik in historischer und
systematischer Sicht) und den Beitrag von Josef Früchtl (Getrennt-vereint. Zum Verhältnis zwischen
Ästhetik und Ethik bei Immanuel Kant), in dem die Wichtigkeit der ästhetischen Urteilskraft für Kants
Moralphilosophie hervorgehoben wird. S. auch eine weitere Untersuchung von Josef Früchtl: Ästhetische Erfahrung und moralisches Urteil. Hier wird Kants Philosophie als Ausgangspunkt für eine
ästhetisierte Ethik bei Autoren wie Schiller, Nietzsche und Foucault betrachtet, wobei Kants Ethik als
„marginalästhetisch“ charakterisiert wird. „Die im weiteren Sinn ästhetischen Konsequenzen für die
Moral“ seien „größer als Kant es zugesteht“ (S. 30). Dennoch kann Kant, so Früchtl, den „kantianischen Moralphilosophen“ gerade in diesem Punkt entgegengesetzt werden. S. zur Debatte Ursula
Franke (Hg.), Kants Schlüssel zur Kritik des Geschmacks: ästhetische Erfahrung heute. Die Frage, die hier
gestellt wird, nämlich „inwiefern der ästhetisch erfahrene und erfahrende Mensch Orientierungen
seines Handelns gewinne“ (S. 230), scheint berechtigt zu sein. Ich versuche in diesem Abschnitt gerade
zu zeigen, dass Kant, wenn auch nur in kritischer Absicht, eine Antwort darauf gegeben hat.
108 Diese bloß formale Übereinstimmung als Idee bzw. als Vernunftbegriff, der für die Einheit der
Erfahrung sorgt, ist die einzige Begründung des „Wir“ der Kritik, die nicht nur für das Urteilen über das
1.4 Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol
73
gesetzt, dass, unabhängig von allen Einschränkungen der Sinnlichkeit, unabhängig
von Reiz und Rührung, jeder andere an meiner Stelle die Anschauung genauso
genießen könnte, wie ich es tue. Und nur unter dieser Bedingung ist mir das Genießen
überhaupt zugänglich. Dies ist die Maxime der Urteilskraft überhaupt: „an der Stelle
jedes anderen denken“.109 Ihre äußerliche Richtschnur ist die Mitteilbarkeit des
Urteils, denn durch diese zeigt sie, dass sie „auf die Vorstellungsart jedes anderen in
Gedanken (a priori) Rücksicht nimmt“ (KU, AA 5, S. 293).
Die Idee des Gemeinsinns, obzwar für die Urteilskraft grundlegend, bleibt dennoch bloß formal und unbestimmt, d. h. es ist ganz offen, welche Urteile diesem
Gemeinsinn adäquat sein können. Wie der kategorische Imperativ – und diese Analogie ist nicht zufällig – kann sie nicht mit Gewissheit auf konkrete Fälle angewandt
werden.110 Aber im Unterschied zum kategorischen Imperativ braucht sie es auch
nicht zu werden bzw. gerade ihre Zufälligkeit und Nichtendgültigkeit macht ihre Stärke
aus: Sie belebt dadurch die Gemüter und fordert sie zu weiteren Versuchen, zu
weiteren Vorstellungen auf. Schließlich ist sie bloß eine Idee, dass „der Mensch in die
Welt passe“ (Nachlaßreflexionen (1820a), AA 16, S. 127), dass seine Gemütskräfte für
die Erkenntnis tauglich sind und dass die letzteren nicht aus den Naturgesetzen
abgeleitet werden können. Die Macht des Empirischen ist durch das freie Urteilen
über das Schöne gebrochen, und dennoch sieht die Natur gerade deswegen so aus, als
ob sie für die Menschen geschaffen wäre, als ob sie ein Ort der Erkenntnis, der freien
Handlung und des Genusses sei.
Dass das Moralische den systematischen Ort in der Idee des ästhetischen Gemeinsinns bei Kant verliert, ist im strengen Sinn richtig.111 Doch ist ihre Verbindung für die
Moralität des einzelnen in concreto urteilenden und handelnden Menschen, immer
noch relevant. Denn gerade durch die für die ästhetischen Urteile unerlässliche Idee
des Gemeinsinns wird der moralischen Forderung Realität verschafft. Nur weil die
Übereinstimmung der Gemütskräfte bei jedem Menschen als von den Privatneigungen
unabhängig beurteilt werden kann, ist es möglich, Moralität bei einem bestimmten
Menschen zu vermuten. Nur weil das Schöne bei jedem das Gefühl der Lust erwecken
kann, das seinen Geist in Bewegung setzt, kann einem Menschen Vernünftigkeit und
Schöne, sondern auch für die Übereinstimmung in der sinnlichen Anschauung geltend gemacht wird.
S. dazu Gerhardt, Immanuel Kant. Vernunft und Leben, S. 153 f.
109 Die dritte Maxime „des gemeinen Menschenverstandes“, die der Vernunft („jederzeit mit sich
selbst einstimmig denken“), ist „am schwersten zu erreichen“ und nur durch die Verbindung der
Maxime des Verstandes („Selbstdenken“) mit der Maxime der Urteilskraft („an der Stelle jedes anderen
denken“) möglich (KU, AA 5, S. 294 f.).
110 Wie die moralische Urteilskraft niemals mit Sicherheit feststellen kann, in welchem Grad die reine
Achtung vor dem Gesetz die Triebfeder der Handlung war, so kann die ästhetische Urteilskraft sich
nicht sicher sein, ob das Gefühl der Lust von allem Privatinteresse frei entstanden ist, und so niemals
ein bestimmtes Geschmacksurteil dem sensus communis unterstellen. Die Idee des letzteren bleibt
dementsprechend ebenso wie die Idee des moralischen Gesetzes bloß formal.
111 Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 28 ff.
74
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Moralität unterstellt werden. Der Begriff der Liebe als Ergänzungsstück zur menschlichen Unvollkommenheit gewinnt hier wieder an Bedeutung. Das Gefühl des Schönen ist für die so verstandene Liebe zu einem konkreten Menschen unerlässlich: Er
wird als derjenige geachtet, der nicht nur vernünftig und moralisch ist, sondern auch
das Schöne genießen kann und deshalb auch demselben Ideal der Schönheit anhängt.
Nur unter der Bedingung der Mitteilbarkeit von Geschmacksurteilen kann das Schöne
überhaupt als solches genossen werden, so wie nur durch eine ästhetisch bedingte
Liebe die Gewissheit der eigenen Vernünftigkeit und Moralität erreicht wird.
Man sollte hier betonen, dass, wie die Vervollkommnung durch die Liebe nicht
etwa wegen der Unvollständigkeit der Vernunftideen notwendig ist, auch die Mitteilbarkeit der Geschmacksurteile keinesfalls eine Abhängigkeit von fremdem Geschmack bedeutet. Wäre der Mensch ein reines Vernunftwesen, wäre für ihn beides –
die Liebe und der Genuss am Schönen – nicht nötig, ja sogar nicht möglich. Sie sind
es wegen der ästhetischen Bedingtheit des Gemüts. Letztere ist, wie schon mehrmals
betont, kein Mangel, sondern eine conditio humana. Gerade dies sollte die Kritik der
Urteilskraft zum Ausdruck bringen: Für das nicht rein vernünftige, ästhetisch bedingte Wesen, den Menschen, ist das Ästhetische keine Quelle des Irrtums bzw. keine
Schwäche, sondern Bedingung seiner Vollkommenheit.
Und dennoch: Ist die Verbindung des Schönen mit dem Guten für den Menschen
auch unerlässlich, so muss sie doch immer indirekt bleiben. Das Schöne ist „bloß ein
Symbol“, ein Symbol ist aber „die bloße Regel der Reflexion“ über eine Anschauung,
die „auf einen ganz anderen Gegenstand“ angewandt wird – auf das Gute (KU, AA 5,
S. 352). Man darf nicht vergessen, dass Kant den berühmten Paragraphen „Von der
Schönheit als Symbol der Sittlichkeit“ in die Dialektik der ästhetischen Urteilskraft
eingliederte.112 Diese Analogie ist negativ zu verstehen. Nicht nur weil das Schöne
bloß ein Symbol ist, sondern v. a. weil die analoge Darstellung eine andere verhindern
soll, nämlich die schematische, die in moralischen Dingen nur zur Herabwürdigung
112 Dieser Paragraph gehört zu den am meisten diskutierten und auf sehr unterschiedliche Weise
interpretierten Teilen der Kritik der Urteilskraft. Ein Problem scheint v. a. zu sein, die Autonomie des
Ästhetischen vom Ethischen retten zu müssen und dennoch das Erstere als Repräsentation des
Letzteren gelten zu lassen. Einen ausführlichen Kommentar zu diesem Paragraphen gibt Recki, Die
Dialektik der ästhetischen Urteilskraft, S. 195 ff. Recki kommt u. a. zu dem Schluss, dass das Ästhetische
als „Symbol der Freiheit“ „exemplarische Bedeutung für das Selbstverständnis eines sinnlich-vernünftigen Wesens“ habe (S. 207). Vgl. Recki, Das Schöne als Symbol der Freiheit. Zur Einheit der
Vernunft in ästhetischem Selbstgefühl und praktischer Selbstbestimmung bei Kant. Hier wird ausdrücklich für die radikale Autonomie des Ästhetischen plädiert. Ohne ein solches autonomes Urteilsvermögen sei der Begriff der Vernunft unvollständig. Zur Bedeutung des Themas bei Kant s. auch Wilhelm
Vossenkuhl, Schönheit als Symbol der Sittlichkeit. Über die gemeinsame Wurzel von Ethik und Ästhetik
bei Kant. Hier wird u. a. die These vertreten, dass „Kants Begriff der Urteilskraft die strukturellen
Voraussetzungen für die begriffliche Verbindung zwischen Ethik und Ästhetik enthält“ (S. 93). S. auch
Paul Guyer, The Symbols of Freedom in Kant’s Aesthetics. Die Idee der Freiheit selbst, so Guyer, erlangt
eine ästhetische Repräsentation im Schönen und negativ auch im Erhabenen.
1.4 Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol
75
der Ideen führt. Bei einer symbolischen Korrespondenz, bei einer Analogie als Hinweis auf die Reflexion wird dagegen immer mitgedacht, dass sie zufällig und ersetzbar
ist. Nur deswegen ist sie die gesuchte Brücke zwischen den Vernunftideen, die für die
Sinnlichkeit unerreichbar bleiben, und den konkreten Anschauungen, auf die sich
jedes konkrete Urteil bezieht.113
Die Ideen der Vernunft sind notwendig, die konkreten Anschauungen zufällig,
die Verbindung zwischen ihnen kann nur analog sein.114 Das heißt, dass diese
Analogie zunächst einmal geschaffen, ein Symbol gesetzt, eine Reihe der Reflexion
mit einem konkreten Bild eröffnet werden muss. Die Einbildungskraft „bringt das
Vermögen intellektueller Ideen (die Vernunft) in Bewegung“ (KU, AA 5, S. 315). Sie
wird hier „schöpferisch“. Das Musterhafte, das als Vorbild für die schöpferischen
Gemütskräfte des „spätere[n] Zeitalter[s]“ „schwerlich entbehrlich“ sein wird, sollte
sie „zuerst erfinden“ (KU, AA 5, S. 356). Um „ein solches Spiel, welches sich selbst
erhält und selbst die Kräfte dazu stärkt“ (KU, AA 5, S. 313), in Gang zu setzen, wäre ein
besonderes Talent erforderlich, gleichsam als wenn es um einen Glücksfall, um eine
„Gunst der Natur“ ginge. Es soll ein besonderes Vermögen der Darstellung der
ästhetischen Ideen sein, eine besondere Produktivität der Einbildungskraft, die sich
in Werken der Kunst entfaltet. Den ästhetischen Ideen Ausdruck zu verschaffen, ist
die Aufgabe eines Genies. Der zu Kants Zeit populäre Begriff des Genies wird so auch
zum Schlüssel seiner Kunstphilosophie.
Die schöne Kunst oder, genauer gesagt, das Werk eines Genies als „eine schöne
Vorstellung von einem Dinge“ (KU, AA 5, S. 311) kann laut Kants dritter Kritik allein
die analoge Verbindung zwischen einem Bild und einer Idee völlig in concreto,
musterhaft-einmalig darstellen, nicht die Erfahrung einer Naturschönheit. Mag letztere die Vernunft auch auf die Realität ihrer Ideen verweisen, so taugt sie nicht wirklich
dazu, „dem Menschen praktische Anhaltspunkte für sein Handeln zu geben“.115 Die
113 Die spannende Frage nach dem Erhabenen in seinem paradoxen Bezug auf das Gute und die
ganze Diskussion zum Vorzug des Schönen als Symbol des Sittlich-Guten muss hier übergegangen
werden. Ich verweise nur auf das schon erwähnte berühmte Werk von Lyotard Die Analytik des
Erhabenen und die entsprechende Diskussion. S. auch Rudolf A. Makkreel, Sublimity, Genius and the
Explication of Aesthetic Ideas. Hier wird u. a. der kantische Begriff der ästhetischen Ideen in den
Mittelpunkt der Unterscheidung des Schönen und des Erhabenen gerückt.
114 Zur Unentbehrlichkeit der symbolischen Repräsentationen für die Ideen der Vernunft sowie zur
vermittelnden Rolle der Symbolik in Kants Moralphilosophie überhaupt s. Heiner Bielefeldt, Kants
Symbolik. Ein Schlüssel zur kritischen Freiheitsphilosophie, S. 40 ff. Bielefeldt sieht u. a. die Liebe bei
Kant als „Endpunkt sittlicher Selbstvervollkommnung“ und lässt sie als Anknüpfungspunkt an Nietzsche gelten (S. 92).
115 Bielefeldt, Kants Symbolik. Ein Schlüssel zur kritischen Freiheitsphilosophie, S. 140. Freilich kann
uns die Natur allein gerade durch ihre Nicht-Künstlichkeit einen „Wink“ geben, sie wäre uns in unserer
Sehnsucht nach dem Übersinnlichen verwandt und gäbe Anlass, den Ideen der Vernunft eine objektive
Realität zuzuschreiben. Die Produkte der Menschen können diese Hoffnung nach Kant nicht bekräftigen. Da sie durch eine Absicht entstehen, ist die formale Einstimmigkeit der Gemütskräfte hier kein
Wunder. Bei einem schönen Kunstwerk fällt somit die Objektivität des Moralischen völlig aus. Deshalb
76
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Verbindung der sinnlichen Lust mit der Idee der Vollkommenheit festlegen zu können, ist Privileg eines Künstlers.116 Wenn er eine schöne Vorstellung des Dinges, „was
das Ding sein soll“, zum Ausdruck bringen will, so muss er eine Verbindung des
sinnlichen Wohlgefallens mit der Idee der moralischen Vollkommenheit herstellen.
Und wenn es um menschliche Gestalten geht, so ist es die Verbindung zwischen dem
Ideal der Schönheit und dem der Vollkommenheit, die der Künstler mit seinem Kunstwerk festlegt (KU, AA 5, S. 233).
Durch eine ästhetische Idee der Vollkommenheit, durch das von einem Künstler
angesetzte Ideal der Schönheit ist die ästhetisch-moralische Differenz aufgehoben.
Auch die Urteile, die sich auf dieses Ideal beziehen, sind keine reinen Geschmacksurteile (KU, AA 5, S. 229 ff.). Das Ideal stellt, wie oben schon angedeutet, eine ästhetische Erläuterung des Guten durch eine menschliche Gestalt dar, die liebenswürdig
ist, die man „l i e b g e w o n n e n “ hat. Als „sichtbare[r] Ausdruck sittlicher Ideen, die
den Menschen innerlich beherrschen“ (KU, AA 5, S. 235), bleibt dieses Ideal jedoch
paradox. Nur im Werk eines Genies, das gleich einem Wunder das Unmögliche als
möglich und sogar wirklich darstellt, kann dieses Paradoxon plausibel werden. Das
Ideal der Menschheit (die moralische Vollkommenheit) und das Ideal der Schönheit
treffen sich so in Gestalt eines schönen Menschen, die nur dadurch überzeugend sein
kann, weil sie durch die Kunst völlig konkret dargestellt wird.
wird dem Schönen der Natur in der Forschung öfters die ausschließliche Rolle zugeschrieben, das
Symbol des Sittlich-Guten zu sein (vgl. Bielefeldt, Kants Symbolik. Ein Schlüssel zur kritischen Freiheitsphilosophie, S. 140). Wenn die Geschmacksurteile einen Verbündeten brauchen, finden sie ihn in der
sittlichen Vernunft, doch das gelte nur für das Urteilen über die Naturschönheit (so etwa Markus
Arnold, Die harmonische Stimmung aufgeklärter Bürger, S. 40). Erst bei Hegel sei der Kunstschönheit
eine paradigmatische Rolle in Geschmacksurteilen zugeschrieben worden. Allerdings spricht Kant
nicht nur von der Naturschönheit, sondern von den „schöne[n] Gegenstände[n] der Natur oder der
Kunst“, die das Gute symbolisieren (KU, AA 5, S. 354). Dass die Kunstschönheit tatsächlich nichts über
die objektive Realität der Vernunftideen sagt, soll ihre Bedeutung also nicht erschöpfen und vielleicht
auch nicht vermindern. Denn nur „in der Beurtheilung der Kunstschönheit“ wird „zugleich die Vollkommenheit des Dinges in Anschlag gebracht werden müssen, wornach in der Beurtheilung einer
Naturschönheit (als einer solchen) gar nicht die Frage ist“ (KU, AA 5, S. 311). Zur Auseinandersetzung
Hegels mit Kants Kritik des Schönen s. Beate Bradl, Der intuitive Verstand, ein Prinzip der ästhetisch
reflektierenden Urteilskraft; Beate Bradl, Die Rationalität des Schönen bei Kant und Hegel Hans-Friedrich
Fulda, Rolf-Peter Horstmann (Hg.), Hegel und die Kritik der Urteilskraft, Stuttgart: Klett-Cotta, 1990.
116 Die Frage nach der Verbindung zwischen der Idee des Schönen und der der Vollkommenheit
wurde in Kants vorkritischer Schrift Über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764) anders als in
der dritten Kritik beantwortet. Die Schönheit wurde dort von ihm als Vollkommenheit aufgefasst. In der
Kritik der Urteilskraft unterscheidet Kant sie beide zuerst sorgfältig. Wenn es jedoch zur Kunst kommt,
scheint ihre Verbindung wiederum unentbehrlich zu sein, aber nicht im Sinne der „Supplemente der
Tugend“ (Über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, AA 2, S. 217), sondern im Sinne einer willkürlich angesetzten, dennoch oder gerade deswegen musterhaften ästhetischen Analogie. Die Autonomie des Ästhetischen wird dadurch keinesfalls vermindert.
1.4 Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol
77
So sind wir wieder beim Ideal der moralischen Vollkommenheit, das jetzt durch
die Kunst als Ideal der Schönheit dargestellt werden kann.117 Eine menschliche Gestalt, die die Ideen der Vernunft mit den ästhetischen Ideen in Verbindung setzt,
kann allein durch die schöne Kunst überzeugend präsentiert werden, ohne die Idee
der Vollkommenheit in ihrer Erhabenheit zu vermindern. Die Verbindung der schönen Kunst mit der Sittlichkeit ist darüber hinaus eine notwendige Verbindung:
„Wenn die schönen Künste nicht nahe oder fern mit moralischen Ideen in Verbindung gebracht werden“, so dienen sie nur zur „Zerstreuung“, „um die Unzufriedenheit des Gemüths mit sich selbst dadurch zu vertreiben, daß man sich immer noch
unnützlicher und mit sich selbst unzufriedener macht“ (KU, AA 5, S. 326). Eine Isolierung von den Vernunftideen würde das Schöne zerstören und folglich auch die
schöne Kunst.
Die Vermutung liegt nahe, dass Kant die Darstellung der moralischen Ideen
durch die Kunst fordert. Und dennoch wäre eine solche Forderung ebenso die
Vernichtung der Kunst, denn die Letztere hätte in diesem Fall eine Regel bekommen
und würde durch ein Prinzip der Vernunft bestimmt. Diese Vermutung widerspräche
auch der Erfahrung, denn gerade Künstler sind größtenteils keine Musterbilder
moralischer Gesinnung. Es scheint sich nun ein neues Dilemma zu ergeben: Die
Moral solle einzig mögliche Propädeutik zur Empfindlichkeit des Gemüts für die
Schönheit (auch die der Kunst) sein können (KU, AA 5, S. 356), und dennoch dürfe
das Interesse an der schönen Kunst nicht mit dem moralischen Interesse verwechselt werden, es dürfe sogar mit ihm nicht in eine notwendige Verbindung gesetzt
werden.
Kant löst dieses Dilemma radikal, indem er alle Forderungen an die Kunst, wie sie
zu sein habe, alle allgemeinen Kriterien der guten Kunst, zurückweist.118 Ein Kriterium für die Kunst kann es nicht geben. Die Kritik will uns nicht belehren, wie wir über
ein einzelnes Werk urteilen sollen, und auch nicht, wie wir die Kunst von der NichtKunst unterscheiden können. Die Formalismus-vorwürfe gegen Kants Kunstauffassung, ebenso wie die gegen seine Moralphilosophie, missverstehen die Aufgabe der
Kritik: Mit seinem Formalismus wollte Kant gerade offenlassen, was als Kunstwerk
verstanden werden soll, so wie er offenließ, welche Handlung als moralisch anzuse-
117 Kants Kunstphilosophie darf nicht, so scheint mir, deshalb für überholt gehalten werden, weil die
Darstellung des Ideals hier unter deren Zwecke gezählt wird. Dieses Ideal kann nach Kant selbst nur
noch als Richtmaß präsent sein. Das heißt, es kann auch nur negativ vorkommen, z. B. als das Urbild,
dessen Abbildung in der Welt gerade fehlt. Der letztere Fall wird uns im Kapitel zu Dostojewski
begegnen.
118 Er akzeptiert sie m. E. auch nicht in Form „eine[r] Hoffnung auf moralische Besserung“ (Gerhardt,
Immanuel Kant. Vernunft und Leben, S. 281). Das Symbolische der Kunst entziehe sich, so z. B. Andrea
Esser, Kunst als Symbol. Die Struktur ästhetischer Reflexion in Kants Theorie des Schönen, jeglicher
intellektuellen Dekodierung. S. auch die entsprechende Diskussion in: Silker Weller, Buchbesprechungen.
78
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
hen ist, und hartnäckig darauf bestand, dass es kein Beispiel dafür gäbe.119 Aus der
späteren Perspektive kann gerade das als seine größte Leistung in der Begründung
der Autonomie der Kunst angesehen werden. So z. B. Simon:
Der Einwand, daß Kants Philosophie des Schönen und der schönen Kunst nicht kunstnah sei,
beansprucht zu wissen, ‚was‘ Kunst denn sei. Er verkennt den transzendentalen Charakter der
Kantischen Reflexion. […] Sie [die Philosophie des Schönen und der Kunst als Kritik – E.P.]
kritisiert die Verabsolutisierung jeder begrifflich-logischen Bestimmung vom eigenen Standpunkt der Urteilsbildung aus.120
Ein Kunstwerk des Genies kann folglich nicht nach den Kriterien der Moral aus
Vernunft beurteilt werden.
Die Suche nach einem Kriterium als Grundlage der Kunstphilosophie hat eine
lange Tradition. Indem Kant die schöne Kunst als „Kunst des Genies“ bezeichnet und
dem Geschmack das Urteil darüber überlässt, weist er dagegen bewusst alle Kriterien
der Kunst zurück. Das Genie und der Geschmack unterstützen und korrigieren einander gegenseitig, nur durch ihre gegenseitige Angewiesenheit aufeinander entstehen
die Kunstwerke, die dann wiederum zur Richtschnur des Geschmacks werden und der
Schulung des Genies dienen können. Nicht nur der Geschmack als „Disciplin (oder
Zucht) des Genies“ „beschneidet diesem sehr die Flügel“ (KU, AA 5, S. 319), sondern
auch umgekehrt soll sich der Geschmack aus den Produkten der schönen Kunst
speisen, da er keine Regel kennt und es keine Wissenschaft des Schönen geben kann
(KU, AA 5, S. 355).121 Diese Orientierung an Mustern ist nicht einmal eine ausschließliche Besonderheit des Geschmacks. Denn
119 Die Formalität sei der größte Vorteil der Ästhetik Kants und begründe damit ihre Überlegenheit
gegenüber späteren formalen Theorien, argumentiert Dieter Henrich in der oben angegebenen Untersuchung (Henrich, Aesthetic Judgment and the Moral Image of the World, S. 55 f.).
120 Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 227 f.
121 Die Frage, ob das Primat dem Geschmacksurteile oder dem Genie bzw. dem Schönen selbst
gebührt, ist auch eine der meist diskutierten in der Kant-Rezeption. Schon Schopenhauer warf Kant
vor, er ginge in der „Kritik der ästhetischen Urteilskraft nicht vom Schönen selbst, vom anschaulichen,
unmittelbaren Schönen aus, sondern vom Urteil über das Schöne“ (Arthur Schopenhauer, Über die
„Kritik der Urteilskraft“, S. 236). Schopenhauers Kritik beanspruchte somit zu wissen, was das Schöne
sei, d. h. sie ging davon aus, dass es Kriterien des Schönen als solche geben könne. Ähnlich betrachtete
Gadamer den Verzicht auf Kriterien als Mangel von Kants Philosophie des Schönen und seiner Kunstauffassung. Dem Begriff des Genies im Unterschied zu dem des Geschmacks („universales ästhetisches
Prinzip“) sei der Vorrang zu geben. Das Argument dafür ist bemerkenswert: „Denn er [der Begriff des
Genies – E.P.] erfüllt weit besser als der Begriff des Geschmacks die Forderung, gegen Wandel der Zeit
invariant zu sein.“ (Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 54 f.) Kants Begriff der Kunst sollte jedoch
gerade über diese Forderung nach Vollendung „über alle Zeiten hinweg“ hinausführen. Denn die
Wandelbarkeit des Geschmacks, die für Gadamer einen Mangel bedeutet, ist nach Kant die größte
Leistung des Genies. Sie bedeutet die Wandelbarkeit der Kriterien der schönen Kunst. Die Frage nach
dem Vorrang des Geschmacks oder des Genies ist für Kant deshalb eine falsche Alternative, genauso
wie die Frage, ob die Ästhetik „nur als Philosophie der Kunst möglich“ sein soll (Gadamer, Wahrheit
1.4 Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol
79
[e]s giebt gar keinen Gebrauch unserer Kräfte, so frei er auch sein mag, und selbst der Vernunft
[…], welcher, wenn jedes Subject immer gänzlich von der rohen Anlage seines Naturells anfangen
sollte, nicht in fehlerhafte Versuche gerathen würde, wenn nicht andere mit den ihrigen ihm
vorgegangen wären, nicht um die Nachfolgenden zu bloßen Nachahmern zu machen, sondern durch ihr Verfahren andere auf die Spur zu bringen, um die Principien in sich selbst zu
suchen und so ihren eigenen, oft besseren Gang zu nehmen. (KU, AA 5, S. 283, meine Hervorhebungen – E.P.)
Damit ist in der dritten Kritik ein wichtiger Punkt angesprochen, der alle Vorwürfe, es
sei unrealistisch abstrakt, allen Menschen die gleichen Vernunftfähigkeiten zuzuschreiben, entschieden zurückweist. Wenn die oberen Erkenntnisvermögen in
ihren Prinzipien autonom sein sollen, so ist ihr konkreter Gebrauch immer durch
Beispiele bestimmt, die zu Musterbildern werden, um die anderen „auf die Spur“ eines
besseren Gebrauchs zu bringen.122 Kant beschränkt diesen Gedanken nicht nur auf
den Bereich der Kunst, sondern macht ihn auch für jeden Gebrauch der Vernunft
geltend. So wie die theoretische Vernunft in ihrem konkreten Gebrauch bei den „alten
Mathematiker[n]“ durch „Muster der höchsten Gründlichkeit und Eleganz der synthe-
und Methode, S. 54). Vgl. „Wenn die Frage ist, woran in Sachen der schönen Kunst mehr gelegen sei,
ob daran, daß sich an ihnen Genie, oder ob daß sich Geschmack zeige, so ist das eben so viel, als wenn
gefragt würde, ob es darin mehr auf Einbildung, als auf Urtheilskraft ankomme“ (KU, AA 5, S. 319). Die
Frage bleibt ohne Antwort, weil die Urteilskraft ohne Einbildungskraft „in Sachen der schönen Kunst“
nicht auskommt. Nicht nur das Genie ist nach Kant ohne Geschmack zu seiner Produktivität nicht
fähig, sondern auch umgekehrt: Der Geschmack muss in der Wandelbarkeit der schönen Kunst
Anhaltspunkte seines Urteilens immer neu aufsuchen. S. dazu auch William Desmond, Kant and the
Terror of Genius: Between Enlightenment and Romanticism. Hier werden die Paradoxien des kantischen
Begriffs des Genies (und der Autor bedient sich selbst gern paradox geschärfter Formulierungen) als
eine anschlussreiche Ambivalenz interpretiert, die für die andauernde sowie kontroverse Rezeption
von Kants Ästhetik sorgte, u. a. auch bei Nietzsche, bei dem der Konflikt zwischen Dionysos und Apollo
als der zwischen Genie und Geschmack interpretiert wird (S. 612).
122 Die Möglichkeit eines besseren Gebrauchs bzw. die Unumgänglichkeit der Kommunikation für die
ästhetische Urteilskraft wurde schon durch die Idee des Gemeinsinns angedeutet, die bloß formal
bleiben muss. S. in diesem Sinne Jens Kulenkampff, „Vom Geschmacke als einer Art von sensus
communis“ – Versuch einer Neubestimmung des Geschmacksurteils. Hier wird gezeigt, dass die Idee der
ästhetischen Kommunikation durch „exemplarische Gültigkeit“ der Geschmacksurteile im kantischen
Begriff des Gemeinsinns enthalten ist. Die „Einhelligkeit der Sinnesart“ bei allen Menschen wird bei
Kant nicht vorausgesetzt, sondern als Ziel der Kultur betrachtet, „das ästhetische Mustergültige“ als
„Resultat eines historischen Bildungsprozesses“. Damit wird die Ästhetik des 18. Jahrhunderts überwunden. „Der Kanon des Schönen bildet sich und er bildet sich um […]“. Kant weise damit alle
allgemeingültigen Maßstäbe einer ästhetischen Beurteilung zurück. „Denn im Prinzip hat jeder […] das
Recht zur Teilnahme an jenem fortlaufenden Prozeß der Bildung des Geschmacks“ (S. 47 f.). Ein
anderer Beitrag desselben Sammelbandes argumentiert davon abweichend, dass die Selbstnormierung
des Gemeinsinns, die der Autor bezeichnenderweise mit einem „metaphysischen Solipsismus“ in
Verbindung setzt, und die Kommunizierbarkeit ästhetischer Urteile bei Kant auf dramatische Weise
kontradiktorisch sind (Wilhelm Vossenkuhl, Die Norm des Gemeinsinns). Zum Thema s. auch Christian
Helmut Wenzel, Gemeinsinn und das Schöne als Symbol des Sittlichen.
80
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
tischen Methode“ geleitet wird, so gibt der vorbildliche Gebrauch der praktischen
Vernunft der moralischen Urteilskraft durch „ein Beispiel der Tugend oder Heiligkeit“
ihren Leitfaden, so geben auch „die Werke der Alten“ der ästhetischen Urteilskraft ihr
Maß (KU, AA 5, S. 283). Für die ästhetische Urteilskraft ist es aber im Besonderen
unumgänglich, „einige Produkte des Geschmacks als e x e m p l a r i s c h “ anzusetzen
(KU, AA 5, S. 232). Das Urbild, das „bloß im Gedanken“ ist, wäre dort, wo die Regel
fehlt, prinzipiell unzulänglich. Die Gesamtheit der musterhaften Werke, die den
Geschmack ausbilden und das Genie erziehen, das weitere Werke hervorbringt, ist
gerade das, was der Vorstellung von der schönen Kunst ihr Richtmaß gibt. Außer
diesen exemplarischen Vorstellungen, die als gewisser Kanon angepriesen werden,
gibt es keine Kriterien der Kunst.
Das Werk eines Genies muss dann zwar am Geschmack gemessen und von ihm
beurteilt werden, aber ohne jegliche Kriterien. Die einzigen Anhaltspunkte für ein
Geschmacksurteil sind wiederum andere Kunstwerke, deren Erzeugung ein Rätsel
bleibt. Einem Genie nachzueifern ist deshalb einerseits unumgänglich, andererseits
schädlich, falls „der Schüler alles n a c h m a c h t , bis auf das, was das Genie als
Mißgestalt nur hat zulassen müssen, weil es sich, ohne die Idee zu schwächen, nicht
wohl wegschaffen ließ“ (KU, AA 5, S. 318). Durch Nachahmung und Übung können
Produkte der schönen Kunst nicht entstehen. Schon deswegen nicht, da die Regel
nicht formulierbar ist, weil das Wesentliche und Zufällig-Fehlerhafte nicht unterscheidbar sind. Man kann nicht wissen, was Abweichung ist. Oder vielmehr: Da jedes
Bild eine Abweichung vom Gewohnten (eine „Mißgestalt“) darstellt, kann man nicht
sagen, was gerade als fehlerhaft bezeichnet werden soll. Das Talent des Genies
besteht eben darin, aus einem Fehler eine neue Regel zu schaffen, eine neue unendliche Reihe der „verwandten Vorstellungen“ zu eröffnen, ohne erklären zu können,
warum gerade in diesem Fall eben diese Abweichung notwendig war.
Dieser Muth ist an einem Genie allein Verdienst; und eine gewisse K ü h n h e i t im Ausdrucke
und überhaupt manche Abweichung von der gemeinen Regel steht demselben wohl an, ist
aber keineswegs nachahmungswürdig, sondern bleibt immer an sich ein Fehler, den man wegzuschaffen suchen muß, für welchen aber das Genie gleichsam privilegirt ist, da das Unnachahmliche seines Geistesschwunges durch ängstliche Behutsamkeit leiden würde. (KU, AA 5,
S. 318)
Man hört eine gewisse Unentschiedenheit an dieser Stelle, als ob Kant nicht genau
wüsste, ob diese Fehler als solche doch unerwünscht sein sollten oder aber ob sie
gerade das Kostbarste sind, was ein geniales Werk ausmacht. In der Wirklichkeit aber
wird dies deutlich genug: Der Mut des Genies ist der Mut zu Fehlern bzw. die Kühnheit,
von der ästhetischen Normalidee abzuweichen. Durch diese Kühnheit als äußerstem
Privileg soll sich die Normalidee selbst verändern. Ohne solche Abweichung ist die
Belebung der Letzteren nicht möglich. Nur dadurch wird sie zu einer ästhetischen
Idee, d. h. zu einem Bild, das trotz oder gerade wegen seiner Unvollkommenheit das
Ideal mit der sinnlichen Anschauung musterhaft verbindet.
1.4 Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol
81
Das Unvollkommene und das eventuell Fehlerhafte eines Beispiels wird im Werk
des Genies zur Vollkommenheit eines Musters, das eine Verbindung des ästhetischen
Wollgefallens am Sinnlichen mit den Ideen der Vernunft herstellt, eine Verbindung,
die als willkürlich und musterhaft zugleich beurteilt werden soll. Die Kunst steht
somit für die „Paradoxierung der Leitunterscheidungen“ der Kritik – der „Unterscheidung von Allgemeinem und Einzelnem, von Denken und Wahrnehmen, von Begriff
und Anschauung, von Form und Inhalt.“123 Mehr noch: Durch den Begriff des Genies
kommt es noch zu einer weiteren Paradoxierung: der der Unterscheidung ‚Kunst –
Natur‘. Denn im Werk des Genies wird die Natur zur Kunst, die Kunst aber zur Natur.
Sein Werk soll fast natürlich sein oder vielmehr: Es wird nur unter der Bedingung
genossen, dass es als Werk eines Menschen beurteilt wird und dennoch absichtslos
aussieht, als ob es unmittelbar der Natur entsprungen wäre. Die Kunst als Kunst des
Genies steht damit auch für die Paradoxierung der Unterscheidung des Intellektuellen
und des Natürlichen im Menschen, d. h. der Vernunft und der Natur. Die grundlegende Unterscheidung der Kritik wird dadurch allerdings nicht aufgehoben, sondern
zugleich bestätigt und relativiert.124 Ein Genie ist der „Günstling der Natur“, durch
den die Natur der Kunst eine Regel gibt (KU, AA 5, S. 318); seine Werke sind dennoch
Kunstwerke, die durch keine Regel erfasst werden können. Das Wagnis des Dichters,
sein Geist, der die Gemütskräfte zum freien Spiel bewegt, kann deshalb niemals mit
einem Maßstab aus Vernunft gemessen werden. Schon deshalb scheint die kantische
Unterscheidung des Künstler-Genies vom begabten Wissenschaftler berechtigt zu
sein.125
Damit wird ein wichtiger Punkt der kantischen Kunstphilosophie deutlich, der
durch die Analyse der ästhetischen Urteilskraft gewonnen worden ist: Die Unvollkommenheit des Einzelnen vor dem allgemeinen Gesetz wird in der Kunst nicht
anerkannt, weil das Einzelne bzw. der Einzelne von ihr in den unumstrittenen Maßstab
der Vollkommenheit umgedeutet wird.126 Die Moral gibt der Kunst nicht ihr Richtmaß.
123 Stegmaier, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 111.
124 Zur Rolle der Kunst, die paradoxe Freiheit der Vernunft bzw. eine „Ambivalenz der Vernunft zum
Vorschein“ kommen zu lassen, s. Andreas Kablitz, Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur,
S. 164 f. Die gegenseitige Angewiesenheit der Natur und der Kunst aufeinander in Geschmacksurteilen
wird hier als virulente Dialektik bezeichnet (S. 166 ff.). Wenn es sich aber um Dialektik handelt, so doch
nicht im Sinne des Aufhebens im Dritten.
125 Diese Unterscheidung wird Nietzsche einer scharfen Kritik unterwerfen. Den Vorwurf macht auch
Gadamer, indem er von der „Einengung des Geniebegriffs“ bei Kant spricht (Gadamer, Wahrheit und
Methode, S. 50). Diese Einengung scheint allerdings gerade das Spezifische des kantischen Begriffs der
Kunst zu treffen, was von Gadamer gleichsam anerkannt wird. Trotzdem lässt er den Vorwurf, Kant
habe das Geniale der Wissenschaft unterschätzt, stehen. Zur Entwicklung dieser Unterscheidung bei
Kant: Piero Giordanetti, Das Verhältnis von Genie, Künstler und Wissenschaftler in der Kantischen
Philosophie, s. dort weitere Literaturhinweise zum kantischen Begriff des Genies (S. 407).
126 Vgl. „Das ästhetische Ideal der Schönheit kann nur dadurch realisiert werden, dass ein einzelner
Mensch als ein Beispiel für die Menschheit, d. h. für die Freiheit in jeder Person angesehen (und in der
82
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Die Produkte der schönen Kunst werden dennoch zu ästhetischen Verdeutlichungen
der Moralität, die gleichzeitig willkürlich sind und Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit erheben. Die „unbestimmte Idee des Übersinnlichen in uns“, als „der
einzige Schlüssel zur Enträthselung dieses uns selbst seinen Quellen nach verborgenen Vermögens“ des ästhetischen Urteilens (KU, AA 5, S. 341), kommt uns durch die
Kunst jedes Mal nicht mehr unbegreiflich vor, sondern wird demonstriert, d. h. anschaulich gemacht und den Sinnen empfohlen. Das Moralische findet im Urteilen
über das Schöne seinen analogen Ausdruck, der für die unvollkommenen Wesen,
welche die Menschen sind, notwendig ist, der jedoch immer neu hergestellt werden
muss und deshalb als zufällig beurteilt wird. In der Kunst wird diese Zufälligkeit zur
Absicht, zum Gemachten, diese Analogie wird zum bloßen Anspruch, die einzelnen
ästhetischen Vorstellungen in den Maßstab des Guten umzudeuten. Doch zeigt gerade
die Kunst, dass trotz aller Einsprüche der Vernunft nur das gut sein kann, was den
Sinnen gefällt; dass das Gute, das nicht schön dargestellt werden kann (d. h. dessen
Vorstellung dem Gemüt keinen Genuss am freien Spiel der Erkenntniskräfte bereitet127), aus der Sicht der Kunst kein Gutes ist; dass der Mensch nur das Schöne frei,
d. h. abgesehen von allen Forderungen der Vernunft und vom Zwang der Pflicht,
liebenswürdig finden kann. Die Überzeugungskraft der Kunst liegt in der Liebenswürdigkeit des Schönen, die einerseits als frei genossen wird, andererseits aber für
unsere Zustimmung wirbt und jedem den Genuss an ihm unterstellt. Das Gelingen
Kunst dargestellt) wird.“ (Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 250)
Dies geschieht schon deswegen, weil die Geschmacksurteile einzelne Urteile sind. S. dazu Ralf
Meerbote, The Singularity of Pure Judgements of Taste. Die Geschmacksurteile können, im Unterschied
zu logischen und moralischen Urteilen, nicht einer Verallgemeinerung unterworfen werden. Zwar
setzen sie die Allgemeingültigkeit voraus, aber nur subjektiv, d. h.: das Allgemeine wird bloß als
Zustimmung zum eigenen subjektiven Urteil gedacht. Zur Frage nach der Allgemeingültigkeit der
ästhetischen Urteile s. Ursula Franke (Hg.), Kants Schlüssel zur Kritik des Geschmacks. S. ferner
Wolfhart Henckmann, Über das Moment der Allgemeingültigkeit des ästhetischen Urteils in Kants Kritik
der Urteilskraft; Gerhard Seel, Über den Grund der Lust an schönen Gegenständen. Kritische Fragen an
die Ästhetik Kants; Christian Helmut Wenzel, Das Problem der subjektiven Allgemeingültigkeit des
Geschmacksurteils bei Kant. Der Anspruch auf Allgemeingültigkeit in den Geschmacksurteilen wird
öfters als paradox betrachtet. Vgl. Kulenkampff, Kants Logik des ästhetischen Urteils, bes. S. 24 ff., 84 ff.,
116 f., 166. Produktiv wird die Lösung dieser Paradoxie durch die folgende Unterscheidung: „Das reine
Geschmacksurteil ist keine definitive Mitteilung, sondern eine Ankündigung […]“ (S. 170). Zur Paradoxie (evtl. „Widerspruch“ bzw. „Geheimnis“ genannt) der allgemeingültigen Subjektivität s. auch Karl
Ameriks, New Views on Kant’s Judgement of Taste; Hannah Ginsborg, Kant on the Subjectivity of Taste.
127 Auch das Hässliche kann schön im Sinne der Kritik dargestellt werden. Der einzige Gegensatz zur
Schönheit wäre dann das Ekelhafte als das, was den Sinnen niemals gefallen könnte (KU, AA 5, S. 312).
Inwiefern die Negation auf der Grundlage der kantischen Ästhetik überhaupt möglich sein soll, bleibt
allerdings eine offene Frage. Wie Reinhard Brandt überzeugend darstellt, funktioniert sie nicht wirklich als Urteil „Dies ist nicht schön“. Die Unlust wird „als Bedingung der ästhetischen Lust vorgestellt;
das Spiel jedoch ist auch im Kontrast noch harmonisch und führt zum positiven Urteilen […]“ (Reinhard
Brandt, Zur Logik des ästhetischen Urteils, S. 240).
1.4 Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol
83
kommt hier einem Wunder gleich. Um eine solche Unterstellung durchzusetzen, ist
eben ein „Günstling der Natur“, ein Genie, erforderlich, bzw. vielmehr ist nur der
Genie, der die Schönheit, die den Sinnen gefällt, als Maßstab des Guten setzen kann.
So vollendet die Kritik der Urteilskraft die Moral aus Vernunft, indem sie ihren
Maßstab unberührt lässt und ihn als für alle Zeiten geltend bestätigt, seine Anwendung in concreto lässt sie jedoch problematisch offen und ermöglicht sie damit gleichzeitig.128 Wenn ohne Liebe zu konkreten Menschen die vollkommene Moralität nicht
möglich wäre, so wäre das Gute ohne Schönheit nur ein leerer Gedanke, dem keine
Anschauung innewohnt. Die einzelnen Bilder, Beispiele des Guten, sind für die Vernunft verwerflich, sie verdunkeln nur ihre Ideen. Für die Urteilskraft des ästhetisch
bedingten Wesens und seine Lebensorientierung sind sie aber gerade unentbehrlich.
Denn das Gute kann man überhaupt nur in seinen symbolischen Darstellungen wirklich lieben.129 Die Überzeugungskraft eines Symbols bleibt als solche „Glücksfall“,
eine Erfindung des schöpferischen Geistes „in ästhetischer Bedeutung“, der die
empirischen Bilder in die Muster der Schönheit verwandelt. Die Zufälligkeit bzw.
Willkür einer solchen Umwandlung muss von der Vernunft bei diesem Verfahren der
Urteilskraft immer mitgedacht werden. Nichtsdestoweniger oder gerade deswegen
entstehen in der Kunst immer neue Bilder, die die Schönheit mit der Idee der Moralität
musterhaft verbinden. Der Künstler wagt es, Ideale ästhetisch darzustellen. Er wagt
die Liebenswürdigkeit der inneren Beschaffenheit, des Intelligiblen, der Menschheit
durch die Schönheit eines einzelnen Menschen äußerlich zu zeigen. Er macht das
Moralische ästhetisch zugänglich, indem er eine Verbindung zwischen dem Ethischen
und Ästhetischen, zwischen dem Guten und dem Schönen, zwischen dem Denken
und dem Wahrnehmen schafft. Dank diesen immer neuen Versuchen wird allerdings
auch die Differenz zwischen Schönem und Gutem in der Kunst bedeutsam und somit
für das Denken beobachtbar.130 Dennoch ist nicht die Darstellung dieser beweglichen
Differenz das Ziel des Künstlers. Vielmehr wird ein einzelnes Bild, das eine symbolisch-analoge Verbindung des Guten und des Schönen ist, durch die Kunst jedes
Mal als absolut adäquate131 und einzig mögliche Verbindung gesetzt, als unmittelbare
Einheit, als Musterbild. Mit anderen Worten: Sie stellt die Welt „als ein schönes
moralisches Ganze[s]“ „in ihrer ganzen Vollkommenheit“ dar.
128 Wenn das Ethische die einzige Propädeutik des Ästhetischen ist (KU, AA 5, S. 355 f.), so gilt also
auch das Umgekehrte: Die ästhetische Unempfindlichkeit soll als schlechtes Zeichen in Ansehung der
Moralität interpretiert werden.
129 Eine interessante Interpretation dieser Unentbehrlichkeit des Ästhetischen stellt die These von
Birgit Recki dar, zum kantischen Begriff der Vernunft gehöre nicht nur das Vermögen, zu erkennen und
zu handeln, sondern auch das Vermögen, „die Dinge so zu lassen, wie sie sind“, bzw. „in gelassener
Distanz anzuerkennen und uns an ihrer Besonderheit zu freuen“. „Es gehört zu unserer Vernunft, daß
wir spielen, daß wir lieben können.“ (Recki, Das Schöne als Symbol der Freiheit, S. 402)
130 Vgl. Stegmaier, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 111.
131 Diese Verbindung ist inadäquat für die Vernunft, nicht aber für die ästhetische Urteilskraft.
84
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
Die Vervollkommnung der Moral aus Vernunft wird so durch die Erfahrung des
Schönen in der Kunst erst möglich, auch wenn sie dem Geschmack bzw. der Urteilskraft durch den Künstler nur vorübergehend aufgezwungen wird. Nichtsdestoweniger
setzt ein Kunstwerk jedes Mal, wenn es als Muster des Geschmacks anerkannt wird,
einen Maßstab für das „Beurteilungsvermögen der Versinnlichung sittlicher Ideen“.
Denn die „Einstimmung“ der Sinnlichkeit mit dem moralischen Gefühl ist nach Kant
letztlich auch die unerlässliche Bedingung des Geschmacks, der sein Ziel in einer
„echte[n]“ und „bestimmte[n] unveränderliche[n] Form“ zu setzen weiß (KU, AA 5,
S. 356). Diese unveränderliche Form des Geschmacks muss dennoch (wiederum paradox) immer neu hergestellt werden, indem seine Inhalte stets wechseln.132 Denn mit
jedem neuen Kunstwerk entstehen in der Kunst neue Welten, die dem Vorbild einer
schönen moralischen Welt völlig entsprechen und dennoch unendlich verschieden
sind, die einen absoluten Anspruch auf Adäquatheit erheben und dennoch einander
nicht verleugnen.
Die Kunst vollendet so durch zahlreiche schöne Vorstellungen die Idee des moralischen Ganzen zur Befriedigung der Vernunft.133 Für die ästhetisch bedingten Vernunftwesen eröffnet sie unendliche Möglichkeiten, zwischen der allgemeinen Forderung der Vernunft und der Mannigfaltigkeit der Sinnenwelt, zwischen der Nötigung
zum Zusammenleben und dem eigenen Verlangen nach Glück, zwischen der Achtung
vor der Menschheit in jeder Person und der Neigung zu einem bestimmten Menschen
zu vermitteln. Sie verschafft die letzte Gewissheit, „das Gute auch l i e b g e w o n n e n “
zu haben, die unentbehrliche Bedingung der moralischen Vollkommenheit für die
nicht rein vernünftigen Wesen. Durch die Kunst wird die Moral aus Vernunft aus einer
tautologischen Kreisbewegung in Paradoxien zu einem musterhaften symbolischen
Bild eines schönen Menschen, der allein imstande ist, eigene Vorstellungen von dem
Guten in das Ganze einer schönen moralischen Welt umzusetzen.
1.5 Zusammenfassung
Kants Unterscheidung der allgemeinen Prinzipien und ihres konkreten Gebrauchs hat
uns als Leitfaden gedient, um sein Projekt der Vervollkommnung der Moral aus
Vernunft samt den ihm innewohnenden Schwierigkeiten darzustellen. Dank dieser
Unterscheidung konnten die der Radikalität entspringenden Paradoxien, wenn nicht
entparadoxiert, so doch als für das Denken unumgänglich bestätigt werden, v. a. die
132 Die Unterscheidung ‚Form – Inhalt‘ wird somit beweglich. S. dazu Stegmaier, Immanuel Kant:
Kritik der Urteilskraft, S. 112 f.
133 Nach Friedrich Kaulbach empfindet man das Glück bzw. die Glückseligkeit, als den „Zustand
eines vernünftigen Wesens in der Welt, dem es im Ganzen seiner Existenz alles nach Wunsch und
Willen geht“ (KpV, AA 5, S. 124), „gerade in der Gegenwart des Schönen“. „Es ist vielleicht nur durch
die Kunst möglich.“ (Kaulbach, Autarkie der perspektivischen Vernunft bei Kant und Nietzsche, S. 96)
1.5 Zusammenfassung
85
Paradoxie der gegen die eigene Freiheit frei entscheidenden Vernunft, die damit zum
radikalen Bösen, aber auch ebenso zum radikalen Guten fähig wird. Und nicht nur
Paradoxien, auch der tautologische Zirkel in der gegenseitigen Begründung der Moral
aus Vernunft musste akzeptiert werden – als das Unbegreifliche schlechthin. Denn
jedes weitere Hinterfragen würde die Vernunft selbst als Vermögen in Frage stellen.
Für das in concreto handelnde Subjekt stellen diese Paradoxien eine besondere
Herausforderung seiner Gemütskräfte dar. Seine moralische Urteilskraft als individuelles Vermögen setzt bei ihnen ein und führt über sie hinaus. Sie muss in einer
konkreten Lebenssituation Orientierung verschaffen und stellt fest, dass der kategorische Imperativ, dessen Notwendigkeit für die Vernunft nicht bezweifelt werden kann,
auf konkrete Fälle niemals mit Sicherheit anzuwenden ist. Das Überprüfen der Maxime mündet unvermeidlich in Kasuistik, d. h. in das unendliche Hinterfragen der
Prinzipien ihrer Anwendbarkeit. Darum scheint eine äußere Instanz nötig zu sein,
die einerseits zur Annahme des Rechts führt, das von den Handlungen als äußeren
Erscheinungen und den einem äußeren Beobachter mehr oder weniger evidenten
Absichten ausgeht und über sie urteilt, und andererseits zur Religion, in der die
Maximen der Handlung als von Gott durchschaut gedacht werden, wodurch über die
Gesinnung des Handelnden gerecht geurteilt werden kann. Allerdings haben beide
äußeren bzw. als äußere gedachten Instanzen nur dann moralische Bedeutung, wenn
ihnen eine innere Plausibilität verschafft wird. Kants Hervorhebung der Autonomie
als Grundlage der Ethik nötigt ihn somit zur Annahme einer weiteren Instanz, die von
der moralischen Urteilskraft nicht wirklich unterschieden sein darf und dennoch über
ihre Kasuistik hinausgeht und ihr Bedenken eigener Unvollkommenheit zum Prinzip
erhebt. Die moralisch-rechtliche Differenz wird im Begriff der sich selbst richtenden
moralischen Urteilskraft aufgehoben – im Gewissen, dessen Leitfaden, nicht zu wagen, was unrecht sein könnte, den Handelnden nötigt, sich selbst zu verurteilen: Vor
dem Gerichtshof dieses härtesten aller Richter kann keiner sich als gerechtfertigt
denken. So richtet sich am Ende die Vernunft selbst. Sie richtet sich als Unvermögen,
nur vernünftig zu handeln bzw. nur aus Vernunft leben zu können.
Die Leitunterscheidungen der Kritik führen also dazu, dass jede Hoffnung auf
eine moralische Rechtfertigung fehlt. Der in concreto Handelnde ist in seiner Moralität
zweifach verunsichert: Er kann nicht wissen, ob er seine Maxime hinreichend am
kategorischen Imperativ überprüft hat, und er kann nicht wissen, ob er tatsächlich im
Sinne der erfolgten Prüfung gehandelt hat. Das Empirisch-Pathologische, das immer
mit hineinkommen kann, lässt sich nicht wirklich herausrechnen. Die moralische
Urteilskraft, die zwischen dem Prinzip der reinen Allgemeinheit und den konkreten
Entscheidungen vermittelt und ihr ästhetisches Bedingt-Sein stets mitbedenken muss,
könnte an dieser Unsicherheit verzweifeln. Aber gerade mit Hilfe der Urteilskraft als
individuellem Vermögen, das nicht erlernt, sondern nur geübt werden kann, wird das
die eigene Unmoralität demütig anerkennende, ästhetisch bedingte Vernunftwesen
nach Kant des „Ergänzungsstück[s] der Unvollkommenheit“ seiner Natur fähig – der
Liebe. Letztere wird nicht als Gefühl verstanden (das Wohlgefallen am anderen wäre
86
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
bloß eine Neigung), aber auch nicht als bloßes Prinzip (das Wohlwollen aus Pflicht
wäre eine Ungereimtheit), sondern als besondere Richtschnur zur Handlung gegenüber dem anderen Menschen (das Wohltun, „ein thätiges, praktisches Wohlwollen“
gegenüber einem nahe stehenden Menschen). Sie ist dann willige Aufnahme der
Maximen eines anderen Menschen unter seinen Willen, d. h. freie, von allen äußeren
Umständen unabhängige Unterstellung, dass der andere, der als „fremde Vernunft“
dem äußeren Beobachter in seinen Maximen unzugänglich bleiben muss, doch immer
im Stande ist, das Gute als oberstes Prinzip seines Willens anzunehmen, selbst wenn
seine Vernünftigkeit wesentlich verborgen bleibt. Dieses freie Eingeständnis, diese
Haltung gegenüber dem anderen, bei der die eigene Unvollkommenheit (die eventuelle Unvernunft und Unmoralität) immer mitgedacht wird, ist nur im Verhältnis zu
bestimmten Menschen möglich und auch nur in einer ästhetisch bedingten Neigung
zu diesen Menschen zu verankern. Denn nur dann kann tatsächlich die Gewissheit
entstehen, das Gute unabhängig von allen Ausflüchten der Selbstliebe, frei von allen
„Tücken des menschlichen Herzens“ in die Handlung umgesetzt zu haben, nicht weil
man es sollte, sondern weil man das Gute „auch l i e b g e w o n n e n “ hat. Wenn es
solche Fälle überhaupt nicht gibt, d. h. wenn man keinen anderen Menschen frei
(ohne jeden Zwang) für ein Vernunftwesen halten kann, kann man auch sich selbst
nicht für ein Vernunftwesen halten. Die sich richtende Vernunft muss einen anderen
Menschen von dem radikalen Bösen freisprechen, um sich selbst Hoffnung zu schaffen, dass es auch von ihr selbst überwunden werden könnte. Die vernünftige und
zugleich ästhetisch bedingte, tätige Liebe gegenüber einem bestimmten Menschen
verwandelt so die ästhetische Beschränktheit des Handelnden von einem Hindernis
der Moralität in die Bedingung seiner Vollkommenheit.
Wenn also der Liebe auch keine besondere Stelle in Kants Begründung der Moral
aus Vernunft zukommt, so wird sie bedeutsam, wenn es um deren konkrete Realisierung geht. Sie macht damit den Ausgangspunkt der Kritik deutlich: Das ästhetische
Bedingt-Sein ist die unerlässliche conditio humana. Der Gang der Kritik zielt nicht auf
eine Herabwürdigung des Ästhetischen, nicht auf das Wegrechnen des EmpirischPathologischen. Gerade umgekehrt: Die schlimmsten Irrtümer, denen die Menschen
verfallen, entspringen nicht der Sinnlichkeit, nicht den Schranken, die diese jedem
Hier-und-Jetzt, jedem Urteil und jeder Handlung setzt, sondern dem Nicht-Bemerken
von deren Einfluss, ihrer Verleugnung, mit anderen Worten: dem logischen, ästhetischen und moralischen Egoismus, „welcher alle Zwecke auf sich selbst einschränkt“
(AH, AA 7, S. 130). Die egoistische Haltung des angeblich objektiven Wissens, das
eigene Grenzen nicht anerkennt und sich absolut setzt, sollte gerade der Kritik
unterworfen werden. So gibt v. a. die Kritik der Urteilskraft deutlich zu verstehen:
Nachdem über die Prinzipien der reinen Vernunft aufgeklärt wurde, muss anerkannt
werden, dass der Mensch nicht allein aus ihnen handeln, ja nicht allein aus ihnen
leben kann. Er bedarf ihrer ästhetischen Verdeutlichung, die selbst nur noch nach
dem Kriterium des Passens zu beurteilen ist. Diese Verdeutlichung in unvollkommenen Beispielen kann und muss den Sinnen von Zeit zu Zeit empfohlen und zu
1.5 Zusammenfassung
87
einem Muster erhoben werden, zu einem „sichtbare[n] Ausdruck sittlicher Ideen, die
den Menschen innerlich beherrschen“. Die rein ästhetische Schönheit der Natur ist
zwar für die Belebung des Gemüts und des freien Spiels aller Erkenntniskräfte unumgänglich. Jedoch ist sie unfähig, solche Beispiele zu geben. Es kann nur das Werk
eines Menschen sein, der diese sinnliche Verdeutlichung des Übersinnlichen wagt,
der dem Unbegreiflichen der Vernunft, ihren Ideen und selbst ihrem Ideal, Ausdruck
verschafft. Als „Günstling der Natur“ ist solch ein Mensch ein Genie, d. h. derjenige,
der das Unmögliche (die ästhetische Idee, die gleichzeitig eine Idee und eine Anschauung sein soll, der kein Begriff adäquat ist) möglich macht und für die anderen
einleuchtend darstellt. Nur der ist Genie, dem es gelingt, das Zufällige, Willkürliche,
Inadäquate dieser Verbindung in ein Muster der Vollkommenheit, in ein ästhetisches
Ideal umzudeuten. Nur der ist Künstler, der das Gemüt dadurch beleben kann, dass er
eine sinnliche (und im Prinzip immer unzulängliche) Verdeutlichung des Übersinnlichen als nachahmungs- und liebenswürdig vor Augen führt.
Die schöne Kunst als Kunst eines Genies entzieht sich allerdings allen Forderungen der Vernunft. Man kann der Kunst keine Regel zuschreiben, man kann einem
Kunstwerk auch nicht nacheifern. Das Unvollkommene und das eventuell Fehlerhafte
wird im Werk des Genies zur Vollkommenheit eines Musters. Und es ist prinzipiell
unmöglich zu sagen, wie und wann dies geschehen kann. Kants Kunstphilosophie,
die der Aufgabe der Kritik folgt, lässt, im Unterschied zu mehreren anderen Kunsttheorien, offen, was als Kunst angesehen werden soll. Denn Kriterien der schönen
Kunst kann es nicht geben. Die Werke der schönen Kunst werden zwar dem Urteil des
Geschmacks unterworfen, aber auch dieser braucht sie als Anhaltspunkte, um an
seine Urteile zu gelangen. Der Geschmack und das Genie, die Urteilskraft und die
Einbildungskraft sind aufeinander angewiesen. Der Geschmack hat seinen Leitfaden
in der Gesamtheit der Kunstwerke, die er als musterhaft beurteilt und die er zu einem
gewissen Kanon der Kunst erklärt.
Die ästhetische Verdeutlichung des Ideals als Werk eines Genies muss also immer
wieder neu gewagt werden. Denn die Verbindung des Schönen und des Guten, die
dadurch hergestellt wird, bleibt eine indirekte, symbolische Verbindung, deren Unzulänglichkeit immer mitgedacht wird. Sie ist als musterhaft-einmalig und zufälligersetzbar, als „Gunst der Natur“ und als Werk eines Menschen, als allgemein-verbindlich und willkürlich zugleich zu beurteilen. Die Kunst als schöne Kunst paradoxiert somit die Leitunterscheidungen der Kritik, ohne sie aufzuheben – die Unterscheidung von Allgemeinem und Einzelnem, von Form und Inhalt, von Vernunft und
Natur. Ein einzelnes Kunstwerk beansprucht, sein Ideal als unumstrittenen Maßstab
der Vollkommenheit zu setzen, ohne die anderen Maßstäbe zu verleugnen. Durch den
Mut eines Genies zur Verdeutlichung des Übersinnlichen können so immer wieder
neue Bilder entstehen, die die Welt als „ein schönes moralisches Ganze[s] in ihrer
ganzen Vollkommenheit“ darstellen.
Abgesehen von der Aktualität von Kants Deutung der Kunst (und kantische
Definitionen lassen sich m. E. retten, wenn sie negativ-beschränkend reformuliert
88
Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft
werden) zeigt sie, dass das ästhetische Bedingt-Sein des Menschen in der Vernunftkritik völlig ernst genommen wurde. Wenn die Liebe die einzige Möglichkeit darstellt,
der eigenen moralischen Gesinnung sicher zu sein, so ist die Rolle einer schönen
Darstellung des Guten als Leitfaden für Handlungen nicht zu unterschätzen. Die in
der Kunst entstehenden Gestalten der schönen Menschen bilden gleichsam eine
Brücke zwischen der ästhetisch befangenen Urteilskraft und dem hohen Ideal der
Vollkommenheit der Vernunft. Ein schöner Mensch, der die vollkommene Liebenswürdigkeit mit der vollkommenen Liebesfähigkeit in sich zusammenfallen lässt und
somit die Welt in „ein schönes moralisches Ganze[s]“ verwandelt, ist nicht nur ein
„süßer Traum“ des Künstlers, sondern auch der des Philosophen, v. a. desjenigen, der
die Moral als eigentlichen Zweck aller Bemühungen um die Vernunft von Seiten der
ästhetisch bedingten Vernunftwesen ansehen will. Kants Kunstphilosophie wagt so
u. a. eine wesentliche Verschiebung des Idealbegriffs: Wenn jeder Anthropomorphismus für die Vernunft in ihrem Umgang mit ihrem Ideal verwerflich zu sein scheint, so
ist er für die Darstellung ihres ästhetischen Ideals unumgänglich. Denn es ist immer
ein einzelner Mensch, der in der Kunst als Ideal der Vollkommenheit anerkannt wird.
Kants Projekt der Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft wird damit vollendet. Die Frage nach der Kunst ist gewiss keine Schlüsselfrage seiner Vernunftkritik,
so wenig wie die Frage nach der Liebe eine Grundlage seiner Moralphilosophie. Wenn
man jedoch die Schwierigkeiten, die sich von den Ausgangsunterscheidungen der
Kritik her ergeben, bedenkt und Kants Schriften auf ihre Auflösung hin bzw. sie um
der Entparadoxierung ursprünglicher Paradoxien und Tautologien seiner Moralphilosophie willen untersucht, scheinen beide unerlässlich zu sein. Bei allem Rigorismus
wird dann verständlich, dass Kant keinen unrealistischen „Metaphysikträumen“ anhing. Er gab vielmehr deutlich zu verstehen: Auch was die Prinzipien nicht als solche
berührt, kann eine entscheidende Rolle für ihren konkreten Gebrauch spielen; das
Pathologische im Denken und Handeln lässt sich nicht wirklich aus ihm herausrechnen. Wenn Kants Philosophie das menschliche Leben begreifen wollte, dann
durfte ihr die fundamentale Sehnsucht des Menschen nicht fremd bleiben – seine
Hoffnung, dass die Neigungen, denen er anhängt, seiner Vernunft nicht immer und
nicht ewig widersprechen müssen; dass die Glückseligkeit und Glückswürdigkeit
tatsächlich, wie in einem Roman, zusammenfallen können; dass das Schöne es wert
sein kann, als Ideal verehrt und geliebt zu werden.
Kapitel 2.
Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Das Vertrauen in die Vernunft als Vermögen der Selbstkritik erlaubte Kant, die jahrtausendelangen Bemühungen um die Begründung der Moral aus Vernunft zu vollenden. Die Begründungsart, derer sich die Kritik dabei bediente, entsprang der neuzeitlichen Suche nach den unverzichtbaren Fundamenten, die nun auf dem Weg der
Selbstdisziplinierung gefunden werden konnten – durch die den eigenen Gang kontrollierende und die eigene Fähigkeit überprüfende Instanz der Vernunft, die selbst
dafür sorgt, dass die Grenzen der Ermächtigung, die sie sich gegeben hat, von ihr
nicht überschritten werden. Diese Selbstbezüglichkeit der Vernunft wird später bei
Hegel durch die Verzeitlichung ihrer Unterscheidungen im Begriff des Geistes aufgehoben und gleichzeitig vervollständigt.1 Denn auch Selbstgewissheit und Selbstvergewisserung der Vernunft sollen als Momente ihrer Entwicklung von ihr selbst
eingesehen werden. Nur diese Einsicht erhebt sie zur Moralität.2 Der ahistorische
Charakter der kantischen Kritik wird so überwunden, der Begriff der Vernunft auf die
Zeit umgestellt, die Moralität als Ziel der historischen Bewegung begriffen.3 Durch
diese Kritik bewies Kants Projekt der gegenseitigen Begründung der Moral und der
Vernunft erneut höchste Plausibilität und Produktivität.4 Die ablehnende Kritik an
1 Auf dieses Thema, so wichtig es auch sein mag, kann hier nicht ausführlich eingegangen werden.
Vgl. dazu v. a. Dieter Henrich (Hg.), Kant oder Hegel? Über Formen der Begründung in der Philosophie. In
seinem programmatischen Beitrag formuliert Henrich die maßgebende Unterscheidung der fundamentalistischen, d. h. auf letzte Fundamente zielenden Methode Kants und der holistischen, d. h. auf den
Inbegriff und die Gesamtverfassung der Relationen zielenden Methode Hegels. Henrich bezeichnet die
beiden Methoden als Deduktion und Dialektik und weist darauf hin, dass sie beide von den für die
Wissenschaften verbindlichen Formen der Begründung abweichen und dennoch die Möglichkeit der
grundsätzlichen Selbstverständigung der Vernunft und die Verfügbarkeit ihres Verfahrens nicht dem
Zweifel unterwerfen (Dieter Henrich, Deduktion und Dialektik. Vorstellung einer Problemlage).
2 Die Bestimmung der Begriffe enthält als „bestimmte Negation“ ein Moment der Entscheidbarkeit
und führt so im Ethischen zur „absoluten Diskretion“ zwischen den individuell formulierten Maximen.
Erst durch die gegenseitige Anerkennung der moralischen Begriffe wird der Geist wirklich (vgl. Hegel,
Phänomenologie des Geistes, S. 493 f.). S. dazu Dieter Henrich, Hegels Theorie über den Zufall; Werner
Stegmaier, Hegel, Nietzsche und die Gegenwart, bes. S. 302 ff. und die dort angegebene Literatur.
3 Während Kant noch von der Möglichkeit des Festhaltens von Begriffen ausgeht, setzt Hegel durch
seinen Begriff des Geistes bei der ‚Lebendigkeit‘ des Denkens an, die jede Begründung eines Begriffes
überbietet. Dennoch behält Friedrich Kaulbach Recht, wenn er Hegels Vervollständigung des kantischen Begriffs der Vernunft im Begriff des Geistes gerade als das Aufheben ihres perspektivischen
Charakters deutet. Die perspektivische Freiheit der Vernunft, die bei Kant zur Ablehnung der Dialektik
führte und durch die hegelsche Dialektik im absoluten Wissen aufgehoben wurde, konnte nur mittels
eines „radikale[n] nihilistische[n] Umschlag[es]“ wieder gewonnen werden, den „Nietzsche auf sich
genommen hat“ (Kaulbach, Philosophie des Perspektivismus, Teil I, S. 200).
4 Die Wiederbelebung und Neubegründung dieses Ansatzes, wenn auch jenseits einer Gewissheit, die
sich auf die Überprüfung der Fundamente oder auf die Gesamtverfassung der Relationen gründet,
90
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Kant von Hamann, Schiller, Herder oder Schopenhauer verfehlte dagegen oft ihr Ziel.
Die Kunst als Ergänzung einer Moral aus Vernunft, die Nicht-Spontaneität der Vernunft des Einzelnen, die problematische Unterscheidung der begrifflichen und metaphorischen Sprache als wichtigste Punkte dieser Angriffe erschütterten nicht die
Fundamente von Kants „majestätische[m] sittliche[m] Gebäude[ ]“ (KrV B 375 f.). Um
Kants Metapher weiterzutreiben, könnte man sagen, diese Angriffe zielten nicht auf
das Fundament, sondern nur auf die mächtigsten Türme, auf die Spitze des Bauwerks.
Mehr noch: Sie wurden von Kants Kritik schon vorhergesehen und abgewehrt. Für
einen Angriff auf das Fundament von Kants kritischer Philosophie müssten die schon
von Platon geschaffenen Plausibilitäten der abendländischen Moral in Frage gestellt
und Alternativen zu ihren fundamentalen Unterscheidungen gesucht werden. Das
hieße, die Moral aus Vernunft als Problem anzusehen und den Wert der Moral, die das
Denken zur Annahme der Selbstbezüglichkeit der Vernunft nötigt, selbst zu hinterfragen – eine Aufgabe, die Kant als undenkbar angesehen hätte, die ihm einer Selbstzerstörung der Vernunft gleichgekommen wäre.5
Diese Aufgabe, die von Kant und auch von seinen schärfsten Kritikern als für die
Philosophie undenkbar zurückgewiesen wurde, sah Nietzsche als „Vorspiel einer
Philosophie der Zukunft“ an, nach dem Untertitel seines programmatischen Werks
Jenseits von Gut und Böse. Gerade die Moral aus Vernunft, die im Zirkel einer tautologischen Selbstlegitimation kreist, sollte in ihrem Wert hinterfragt werden. In einem
Entwurf nennt Nietzsche als erstes der „erkenntnißtheoretischen Dogmen“, „daß ein
Werkzeug seine eigene Tauglichkeit kritisiren k a n n “ (Nachlass, Herbst 1885–Herbst
1886, 2[161], KSA 12, S. 143).6 Dass es hier um Kant geht, kann man leicht sehen, wenn
man diese Formulierung mit der im veröffentlichen Werk vergleicht.7 Der kantischen
findet sich in Dieter Henrichs Konzept des bewussten Lebens, wonach dessen Überlegung auf „letzte
Gedanken“ hinausläuft, auf Gedanken, die für das bewusste Leben unverzichtbar und nur aus ihm
heraus zu verstehen sind (s. Dieter Henrich, Bewußtes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und Metaphysik).
5 Die Undenkbarkeit eines Zweifels am Wert der Moralität betonte Kant ausdrücklich: „Das Fundament, worauf er [der moralische Theismus – E.P.] diesen Glauben bauet, ist unerschütterlich, und
kann nie, selbst wenn sich alle Menschen vereinigen wollten, es zu untergraben, umgestürzet werden.
Es ist eine Festung, worein er sich retten kann, ohne daß er befürchten darf, je daraus vertrieben zu
werden, weil alle Angriffe durchaus daran zu nichte werden. […] Daher kann etwas Gewisseres und
Festeres in keiner einzigen Wissenschaft gedacht werden, als unsere Verbindlichkeit zu sittlichen
Handlungen. Die Vernunft müßte aufhören zu seyn, wenn sie dieselbe auf irgend eine Art verläugnen
könnte. Denn diese Handlungen richten sich nicht etwa nach ihren Folgen, oder nach den Umständen;
sie sind ein für allemal durch ihre Natur für den Menschen bestimmt. Erst dadurch wird er ein Mensch,
wenn er darein seine Zwecke setzet, und ohne sie ist er ein Thier, oder ein Ungeheuer. Seine eigene
Vernunft zeugt wider ihn, wenn er sich soweit vergißt, dagegen zu handeln, und macht ihn in seinen
eigenen Augen verachtungswerth und abscheulich.“ (Vorlesungen über die philosophische Religionslehre, S. 32 f.)
6 Es handelt sich wahrscheinlich um einen Entwurf zur neuen Vorrede für die Morgenröthe.
7 Vgl. M Vorrede 3, KSA 3, S. 13.
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
91
„Archäologie der Vernunft“8 versucht Nietzsche polemisch seine Genealogie der Moral entgegenzustellen. Zum zitierten Notat betont Nietzsche ferner, dass auch die
spätere Haltung gegenüber der kantischen Kritik von derselben Plausibilität der Moral
getragen wurde, die Grundlage und Ausgangspunkt Kants gewesen war:
[…] sowohl Kant als Hegel als Schopenhauer – sowohl die skeptisch-epochistische Haltung, als
die historisierende als die pessimistische sind m o r a l i s c h e n Ursprungs. Ich sah Niemanden,
der eine K r i t i k d e r m o r a l i s c h e n W e r t h g e f ü h l e gewagt hätte […]. (Nachlass, Herbst 1885–
Herbst 1886, 2[161], KSA 12, S. 144)9
Auch Schopenhauers Kant-Rezeption, die bekanntlich eine von Nietzsches ersten
Quellen war, stellte ihn in Hinsicht auf die Moral als Problem nicht zufrieden.
Sch<openhauer> ist ebenso sicher zu wissen, was gut und böse ist, wie Kant – das ist der Humor
der Sache. (Nachlass, Sommer–Herbst 1884, 26[84], KSA 11, S. 171)10
Ebenso wenig trafen Herders und Schillers Kritik an Kant nach Nietzsche den Kern des
Problems der Moral.11 Dennoch stand Nietzsche mit seiner Aufgabe einer radikalen
Kritik der aus der Vernunft begründeten Moral nicht allein. Aus der von Europa
abgegrenzten und ihm dennoch nicht völlig fremden Welt der russischen Kultur kam
derselbe Anspruch und dasselbe Bestreben, die Moral bis in ihre ersten Plausibilitäten
hinein neu zu durchdenken, d. h. das Risiko einzugehen, dass das ganze Gebäude der
Moral aus Vernunft samt seinen Fundamenten erschüttert und zerstört wird, auch
wenn keine vergleichbare Alternative dazu, kein neues sicheres Fundament gefunden
werden sollte. Die russische Philosophie erhebt diesen ungeheuren Anspruch am
Ende des 19. Jahrhunderts. Er ist zugleich ihre Ambition, einen eigenen Weg in der
Philosophie zu finden. Die wichtigsten Philosophen Russlands suchen eine Alternative zur aufklärerisch-rationalistischen Moralphilosophie als Emanzipation vom mächtigen Einfluss der „westlichen“ (v. a. der deutschen) Philosophie. Gerade Kant wird als
primärer Gegenstand der Kritik und eigentlicher Gegner angesehen. Und in diesem
Kampf gegen Kants Konzept der Moral aus Vernunft und, mehr noch, gegen das der
8 S. Henrich, Deduktion und Dialektik, S. 15.
9 Vgl. Nachlass, Herbst 1885–Herbst 1886, 2[165], KSA 12, S. 147 f.; 2[195], KSA 12, S. 162 f.
10 Die Frage nach Schopenhauers Kant-Rezeption wurde schon im ersten Kapitel mehrmals berührt.
S. dazu auch Walter Meyer, Das Kantbild Schopenhauers. An dieser Stelle ist wichtig, dass Nietzsche
sich Schopenhauers Kritik an Kants Ethik nicht angeschlossen hat, sondern seinem Lehrer und
„Erzieher“ in dieser Hinsicht kritisch gegenüberstand.
11 Vgl. MA II, WS 118, KSA 2, S. 602 f.; MA II, WS 123, KSA 2, S. 605 f. Volker Gerhardt hält Schiller
allerdings für „den wohl wichtigsten Moderator“ zwischen Kant und Nietzsche in der Frage nach der
Schönheit und sogar nach der der Kunst (Volker Gerhardt, Artisten-Metaphysik. Zu Nietzsches frühem
Programm einer ästhetischen Rechtfertigung der Welt, S. 97). Diese Frage verdient eine besondere Untersuchung und kann hier nicht erörtert werden.
92
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Philosophie als Kritik fand die russische Philosophie einen mächtigen Alliierten
wiederum in Nietzsche.
Dennoch benutzte Nietzsche, z. B. im oben zitierten Notat, den Begriff der Kritik
durchaus auch positiv.12 Die Differenzen zwischen Nietzsche und seinen russischen
Rezipienten sind hier bedeutsam. Wie ich im Folgenden zeigen werde, sind sie subtil
und leicht zu übersehen. Aber eben durch sie gewinnt der große Dialog zwischen
Nietzsche und den prominentesten russischen Denkern seine höchste Spannung.
Dessen Voraussetzungen werden in diesem Kapitel auf der Grundlage einer detaillierten Untersuchung der Strategie von Nietzsches Kantkritik und, weiter noch, seiner
Kritik an den moralischen Plausibilitäten der abendländischen Moralphilosophie
rekonstruiert. Die vorläufige Hypothese lautet, dass es die traditionelle Entgegensetzung der Kunst und der Moral aus Vernunft war, die Nietzsche zu problematisieren
und zu verflüssigen suchte. Aus der Perspektive der Kunst wollte er seine Kritik an der
Moral aus Vernunft über die Grenze hinaustreiben, an der die kantische Kritik Halt
gemacht hatte. Dafür stellte er ihre grundlegenden Unterscheidungen in Frage, z. B.
die Unterscheidung von Sinnlichkeit und intelligibler Welt oder, im Bezug auf die
Kunst, die dreifache Unterscheidung von sinnlicher Lust, intellektuellem Wohlgefallen und „interesseloser Anschauung“. Die Frage nach der Stellung der Kunst zur
Moral aus Vernunft entsprach auch dem russischen Denkansatz. Denn für die Entstehung der russischen Philosophie waren v. a. die Ideen der Schriftsteller maßgebend. Auch in dieser Hinsicht konnte Nietzsche mit den vielfältigen Formen seiner
philosophischen Schriftstellerei leichter Zugang zum russischen Publikum finden als
die streng-akademische Form der kantischen Kritik, die eher irritierend gewirkt hat.13
Die Frage zum Verhältnis zwischen Kunst und Moral sowie zwischen Philosophie und
Kritik bei Nietzsche soll darum die Struktur dieses Kapitels bestimmen.
Nietzsches Kantkritik wird, wie schon angedeutet, zum Leitfaden der Analyse von
Nietzsches De-Konstruktion der Moral aus Vernunft dienen. Die Frage ist in der Forschungsliteratur in den letzten Jahren breit diskutiert worden. Dass Nietzsche Kant
viel zu verdanken hat, wird heute kaum bezweifelt, genauso wie die Tatsache, dass es
vor allem Kant war, der immer mehr zum Gegenstand der Kritik Nietzsches wurde.
Nach Platon und Schopenhauer gehört Kant zu den von Nietzsche am häufigsten
erwähnten Philosophen. Die Erwähnungen werden dabei in der letzten Periode seines
Schaffens häufiger, d. h. in den Jahren von 1885 bis 1889.14 Mehrere aufschlussreiche
12 Der Begriff der Kritik wird von Nietzsche öfters im kantischen Sinn verwendet. Dennoch sollte sein
Verständnis der Philosophie über ihr kritisches Selbstverständnis hinausführen. Darauf wird im Weiteren eingegangen.
13 Schon das von Kant für seine Kritik bevorzugte Paradigma der Jurisprudenz, das maßgebend nicht
nur für die theoretische, sondern auch für die praktische Vernunft war, musste auf russische Denker
sehr befremdlich wirken.
14 Zu der Zeit also, als u. a. Schopenhauers Einfluss auf Nietzsches Denken nicht mehr maßgebend
sein konnte. Vgl. dazu R. Kevin Hill, Nietzsche’s critiques: the Kantian foundations of his thought, S. 19 f.
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
93
Untersuchungen bemühen sich darum zu zeigen, dass Kants kritischer Ansatz, sein
Begriff der Aufklärung, seine Moral- und Kunstphilosophie auf Nietzsche einen nachhaltigen Einfluss hatten.15 Zur Diskussion stehen allerdings sowohl die Art und Weise
der Rezeption als auch ihre Bedeutsamkeit für Nietzsche. Von dem grundlegenden
Beitrag Jörg Salaquardas ausgehend wird der philologisch-historische Ansatz von
mehreren Forschern übernommen,16 die anhand von Nietzsches Notaten und Briefen,
seiner Bibliothek, der Liste der von ihm aus der Basler Bibliothek ausgeliehenen
Bücher und anderen Quellen seine Bekanntschaft mit Kants Werken nachzuweisen
suchen.17 Es bleibt dennoch umstritten, ob und welche Texte Kants Nietzsche selbst
gelesen hat und was er nur aus zweiter Hand gekannt hat. Seine wichtigsten Quellen
waren bekanntlich neben Schopenhauer18 Friedrich Albert Langes Geschichte des
S. auch Tom Bailey, Nietzsche’s Engagements with Kant. Bailey legt mehr Wert auf Nietzsches spätere
Kant-Kritik als auf die frühere von Schopenhauer und die von den Neukantianern geprägte Rezeption.
In früheren Werken und besonders in den Notaten der 1860–70er Jahre probiert Nietzsche viel aus und
verarbeitet verschiedene Positionen vorläufig. Im späteren Werk dagegen kommt Nietzsche Kants
Idealismus, so Bailey, viel näher als seinen sekundären Quellen. Besonders trifft das auf Kants Ethik
zu. Nach Bailey bleibt Nietzsches Ethik eines „souveränen Individuums“ Kant verpflichtet, impliziert
aber viel feinere Differenzierungen. Bailey betont mit Recht, dass Nietzsches Argumentation für und
wider Kant in ihrer Komplexität meistens unterschätzt wurde und weitere Aufmerksamkeit verdient.
15 Drei Sammelbände verdienen besondere Aufmerksamkeit: Jörg Albertz (Hg.), Kant und Nietzsche –
Vorspiel einer künftigen Weltauslegung?; Beatrix Himmelmann (Hg.), Kant und Nietzsche im Widerstreit.
Internationale Konferenz der Nietzsche-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Kant-Gesellschaft.
Naumburg an der Saale, 26.-29. August 2004, und der schon zitierte Band von Reschke (Hg.), Nietzsche – Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer?. Vgl. die Sammelbesprechung von Hartwig
Frank, die einen Überblick über das breite Spektrum der Diskussion zum Thema bietet und die
Forschungsrichtungen auf überzeugende Weise systematisiert: Hartwig Frank, Nietzsche und Kant. Im
Weiteren werde ich vor allem von der in dieser Rezension beschriebenen Forschungslandschaft ausgehen.
16 Jörg Salaquarda, Nietzsches Kritik der Transzendentalphilosophie. Salaquarda geht davon aus, dass
Nietzsche Kant nur durch Schopenhauer und Lange rezipiert und „nie eingehend studiert hat“. Zwar
distanzierte er sich später von den beiden, doch „zur Revision seines durch Schopenhauer und Lange
vermittelten Verständnisses der Transzendentalphilosophie hat das nicht geführt“ (S. 31). Nietzsches
Kant-Interpretation wird von Salaquarda somit als eigentliche Fehlinterpretation gedeutet, die durch
seine Schopenhauer- und Lange-Lektüre zustande gekommen sei. Vgl. auch Urs Heftrich, Nietzsches
Auseinandersetzung mit der „Kritik der ästhetischen Urteilskraft“. Der Verfasser kommt am Ende des
Aufsatzes zum Schluss, Nietzsches Angriffe gegen Kants Ästhetik „gelten in Wahrheit Schopenhauer“
(S. 266).
17 S. die ausführliche Darstellung von Nietzsches Quellen in: Thomas Brobjer, Nietzsche’s Philosophical Context: An Intellectual Biography.
18 Vgl. Giuliano Campioni / Paolo D’Iorio / Maria Cristina Fornari / Francesco Fronterotta / Andrea
Orsucci / Renate Müller-Buck (Hg.), Nietzsches persönliche Bibliothek; Luca Crescenzi, Verzeichnis der
von Nietzsche aus der Universitätsbibliothek in Basel entliehenen Bücher (1869–1879). Neben Die Welt
als Wille und Vorstellung hat Schopenhauers Werk Preisschrift über die Grundlage der Moral eine
wichtige Rolle gespielt, die Nietzsche 1884 gelesen hat (s. Brobjer, Nietzsche’s Philosophical Context,
S. 32).
94
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart19 und Kuno Fischer mit
Immanuel Kant und seine Lehre, vermutlich auch Eugen Karl Dühring (Der Wert des
Lebens) und Afrikan Spir (Denken und Wirklichkeit. Versuch einer Erneuerung der
kritischen Philosophie).20 Es ist dennoch mit einiger Sicherheit anzunehmen, dass
Nietzsche zumindest Teile der Kritik der Urteilskraft gelesen hat, des Werks also, das
für die Umdeutung des Verhältnisses zwischen Kunst und Moral von primärer Bedeutung ist.21 Manche Forscher bestehen auch auf Nietzsches direkter Kenntnis folgender
Texte: Kritik der praktischen Vernunft, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft, Der Streit der Fakultäten, Die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Prolegomena sowie die Transzendentale Ästhetik der Kritik der reinen Vernunft.22 Und
tatsächlich lassen sich Spuren einer solchen Lektüre bei Nietzsche verfolgen, was
allerdings wiederum irreführend sein kann. Denn die Aufzeichnungen, die als Beweise der unmittelbaren Bekanntschaft betrachtet werden, können ihrerseits, wie Nietzsches Nachlass überhaupt, unterschiedlich gedeutet werden. Da die Debatte für die
Ziele dieses Kapitels nicht von prinzipieller Bedeutung ist, soll dazu hier nicht Stellung genommen werden. Die Rekonstruktion der Rezeptionsgeschichte liefert zweifellos wichtige Anhaltspunkte, doch muss die Untersuchung der Plausibilitäten mit der
Fehlerhaftigkeit und Ungenauigkeit jeder Rezeption, auch mit einer eventuellen Ungerechtigkeit Nietzsches gegenüber seinen großen Vorgängern rechnen.
Nicht nur historische, sondern auch systematische Untersuchungen des Einflusses der kantischen Philosophie auf Nietzsche beschäftigen seit einiger Zeit die Nietzsche-Forschung und liefern reiches Material für die Untersuchung der Plausibilitäten
des kantischen und nietzscheschen Ansatzes in der Philosophie. Programmatisch
hierfür sind die Untersuchungen Friedrich Kaulbachs.23 Im Anschluss an sie wurde
19 Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart.
Vgl. dazu Jörg Salaquarda, Nietzsche und Lange“ ferner George J. Stack, Lange und Nietzsche.
20 Zu diesen und anderen Quellen von Nietzsches frühen Kant-Kenntnissen s. Thomas Brobjer, Nietzsche as German Philosopher: His Reading of the Classic German Philosophers, S. 36 ff. U. a. ist der Einfluss
von Gustav Teichmüller, um dessen Nachfolge sich Nietzsche in Basel beworben hat, und der Einfluss
seiner Universitätslehrer, v. a. Carl Schaarschmidts, für seine frühe Kant-Rezeption von Bedeutung. S.
dazu z. B. Konstantin Bröse, Nietzsches Verhältnis zur antiken und modernen Aufklärung. Zu Nietzsches
Spir-Rezeption s. z. B. Paolo D’Iorio, La Superstition des Philosophes Critiques. Nietzsche et Afrikan Spir;
Michael Steven Green, Nietzsche and the Transcendental Tradition. Zu Nietzsches Dühring-Lektüre s.
Giuliano Campioni, Auflösung der Gemeinschaft zur Bejahung des ‚Freigeistes‘, bes. S. 99 ff.
21 Für diese Annahme mit dem Hinweis auf Nietzsches Notate aus dem Jahr 1868 argumentiert
Brobjer, obwohl auch er zugeben muss, dass es sich bei Nietzsches Ausführungen zu Kants dritter
Kritik durchaus um eine sekundäre Quelle, nämlich Kuno Fischer, handeln könnte (Brobjer, Nietzsche’s
Philosophical Context, S. 48 f.; Brobjer, Nietzsche as German Philosopher, S. 65).
22 Vgl. z. B. Hill, Nietzsche’s critiques, 20 ff. S. da auch die jeweiligen Literaturhinweise. Vgl. auch
Tsarina Doyle, Nietzsche’s Appropriation of Kant.
23 Nietzsches radikaler Perspektivismus, so Kaulbachs These, ist einerseits als Fortsetzung des „von
Kant zur Geltung gebrachte[n] Programm[s] der Autarkie der perspektivischen Vernunft“ zu verstehen.
Andererseits entferne Nietzsche sich „entschieden von den Wegen Kants“, vor allem, indem er den
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
95
Nietzsches Perspektivismus als Radikalisierung des kantischen Ansatzes in mehreren
Hinsichten weiterverfolgt. Dabei ist das Spektrum der möglichen Herangehensweisen
sehr breit, von der Darstellung Nietzsches als eines Denkers, der Kant völlig verpflichtet ist, bis zur scharfen Entgegensetzung von Kant und Nietzsche, von der
Annahme einer philosophischen Überlegenheit Nietzsches und der Berechtigung
seiner Kritik24 bis zu dem Vorwurf, dass sein Kant-Verständnis oberflächlich bleibe.25
Selbstverständlich spielt bei diesen systematischen Untersuchungen auch die historische Frage nach Nietzsches Lektüre eine wichtige Rolle. U. a. wird wiederum Schopenhauers Kant-Verständnis als eigentliches Ziel der Angriffe Nietzsches auf Kant dargestellt. Besonders treffe das auf Nietzsches Kritik an Kants Philosophie des Schönen
zu.26 Nietzsches Kant-Verständnis könnte selbst als Mittel zur kritischen Distanzierung von seinen sekundären Quellen betrachtet werden.27 Dabei hängt die Einschätzung häufig davon ab, ob Nietzsche als Nachfolger oder Gegner Kants dargestellt
kantischen Begriff der Vernunft, die über ihren Perspektivengebrauch verfügt, aufnimmt und ihn
selbst perspektivisch, d. h. als Frage nach dem Wert des Wissenstriebs für das Leben oder nach der
Vernunft als Bedingung des Lebens, betrachtet (Kaulbach, Autarkie der perspektivischen Vernunft bei
Kant und Nietzsche, S. 91, 103 f.). Vgl. Kaulbach, Philosophie des Perspektivismus, Teil I, bes. S. 210–218.
Vgl. auch die Rezension von Frank (Nietzsche und Kant, S. 314 f.).
24 Im Anschluss an Kaulbach vertritt Klaus Wellner (Methode und Einheit im Philosophieren Kants und
Nietzsches,) die These, Nietzsche sei als Vollender des kantischen Perspektivismus anzusehen. Reinhard Margreiter (Ontologischer Paradigmenwechsel – Anmerkungen zu Kant und Nietzsche) spitzt diese
These noch zu: Kant sei hinter seiner eigenen kritisch-perspektivistischen Methode zurückgeblieben.
Nietzsche hingegen scheine eine radikalisierte Transzendentalphilosophie zu vertreten, die allerdings
in Willkür ende.
25 Z. B. behauptet Siegfried Kittmann (Kant und Nietzsche. Darstellung und Vergleich ihrer Ethik und
Moral, S. 218), dass Nietzsche Kants Begriff der Moral „völlig mißversteht“. Nach Volker Gerhardt (Die
kopernikanische Wende von Kant und Nietzsche) ist Nietzsches Kantkritik nicht bloß ein Missverständnis, sondern Selbsttäuschung. Nietzsches Missverständnis Kants wird als berechtigte und philosophisch bedeutsame Nachwirkung der Philosophie Kants präsentiert von Oswald Schwemmer, Die reine
Vernunft des Immanuel Kant. Zum utopischen Gehalt einer philosophischen Weltrekonstruktion.
26 S. schon Heidegger, Nietzsche, Bd. 1, S. 126 ff. Allerdings weist Nietzsche in diesem Fall selbst
ausdrücklich auf seine Quelle hin (GM III, 6, KSA 5, 346).
27 Vgl. Hans Gerald Hödl, Interesseloses Wohlgefallen. Nietzsches Kritik an Kants Ästhetik als Kritik an
Schopenhauers Soteriologie. Hier plädiert Hödl dafür, die „grundlegende Distanz von Nietzsches und
Kants Ästhetik auch jenseits der Frage nach der Unterscheidung von Kants und Schopenhauers
Auffassung […] zu behalten“ (S. 193). Laut Hödl macht „schließlich Nietzsche Kant dafür verantwortlich“, „dass man diese Konsequenzen aus seiner Philosophie ziehen konnte“, wie Schopenhauer es mit
Kants Philosophie der Kunst tat. Die Distanz zwischen Kant und seiner Interpretation von Schopenhauer bleibt so bei Nietzsche bewahrt. Zur systematischen Analyse von Nietzsches Schopenhauer-Rezeption s. Georges Goedert, Nietzsche und Schopenhauer. Goedert argumentiert mit Recht, dass Nietzsches
Denken sich schon in der Geburt der Tragödie vom schopenhauerschen Denken und den ihm zugrunde
liegenden Intentionen grundsätzlich unterscheiden lässt. Zu Nietzsches Radikalisierung und Distanzierung von Schopenhauer mit Hilfe seiner Hartmann- und Lange-Lektüre s. Claudia Crawford, The
Beginnings of Nietzsche’s Theory of Language; Claudia Crawford, „The Dionysian Worldview“: Nietzsche’s Symbolic Languagues and Music. Vgl. auch die sich an Goederts Beitrag anschließende Dis-
96
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
werden soll, was wiederum von der jeweiligen Kant-Interpretation her bestimmt
wird.
In diesem Kapitel soll die Differenz der Plausibilitäten Kants und Nietzsches
dargelegt werden. Besonders werde ich deshalb an jene Untersuchungen anschließen,
die zeigen, „wie Nietzsches und Kants Philosophieren in einem problemorientierten
Verhältnis wechselseitiger Kritisierbarkeit und Bereicherung verstanden werden können“.28 Bereicherung ist nur aufgrund von Verschiedenheit und Nähe möglich, d. h.
aufgrund von Differenzen, die subtil und dennoch ausschlaggebend sind, so dass sich
weder ein einfacher Widerspruch noch eine einfache Übernahme ergibt. Dank der
wechselseitigen Kritisierbarkeit werden die Plausibilitäten scharf sichtbar, die das
unverzichtbare Fundament jeglichen Denkens ausmachen.
Im ersten Teil dieses Kapitels wird die Frage nach Nietzsches Kritik an Kant vor
allem systematisch behandelt. Danach wird im zweiten Teil die Frage nach Nietzsches
eigenem moralischem Ansatz in seiner Moralkritik untersucht. Nietzsches und Kants
Plausibilitäten sollen hier formuliert und miteinander konfrontiert werden. Der dritte
Teil legt schließlich den Fokus auf die Frage nach Nietzsches Deutung der Kunst als
Grenze einer Moral aus Vernunft und die herausfordernde Deplausibilisierung ihrer
Ansprüche.
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral
aus Vernunft
Die alte und die neue Aufklärung
Die Kritik war Kant zufolge der einzige Weg, der der Philosophie noch offen blieb. Es
beginne nun das „Zeitalter der K r i t i k “ , aber auch das „Zeitalter der A u f k l ä r u n g “,
wenn auch nicht das „a u f g e k l ä r t e [ ] Zeitalter“.29 Die Kritik ist somit nicht die
Aufklärung selbst als etwas Erreichtes, sie ist vielmehr der Weg zur Aufklärung, eine
Aufgabe der sich selbst fortwährend aufklärenden Vernunft. Die letztere sei zu dieser
Aufgabe moralisch motiviert. Denn sie ist berufen, die „endlosen Streitigkeiten“
(KrV A VIII) der Metaphysik zu beenden und den ewigen Frieden im Denken zu
kussion, bes. die Stellungnahmen von Karl Ulmer und Wolfgang Müller-Lauter (S. 16–26). Zu den
späteren Behandlungen des Themas s. z. B. den Band 4 der Schopenhauer-Studien (1991).
28 So beschreibt Hartwig Frank in seiner schon erwähnten Rezension die Vorgehensweise Josef
Simons (Frank, Nietzsche und Kant, S. 315). Vgl. Josef Simon, Ein Geflecht praktischer Begriffe. Nietzsches Kritik am Freiheitsbegriff der philosophischen Tradition; Josef Simon, Die Krise des Wahrheitsbegriffs als Krise der Metaphysik. Nietzsches Alethiologie auf dem Hintergrund der Kantischen Kritik;
Josef Simon, Moral bei Kant und Nietzsche.
29 Vgl. KrV A XXII; Logik, AA 9, S. 33; Was ist Aufklärung?, AA 8, S. 40.
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
97
sichern.30 Deshalb sieht sie sich genötigt, sich in einer kritischen Überprüfung über
die Grenzen ihres Vermögens klar zu werden.
Die Metapher der Aufklärung (engl. enlightenment, fr. siècle des lumières), d. h.
das Klar-Machen, das Zum-Licht-Bringen, das Beleuchten, die Aufhellung der Sicht,
ist die älteste Metapher der Philosophie, eine „absolute Metapher“ im Sinne Hans
Blumenbergs.31 Sie wird meistens von Platons Höhlengleichnis hergeleitet. Die metaphorische Verwandtschaft mit der Spekulation ist dabei besonders auffällig: In beiden
Fällen geht es um eine Sicht, die eine Einsicht bedeutet, um die Metapher des Sehens
als vernünftiges Einsehen. In der Metapher der Aufklärung gibt es dennoch etwas, was
die Metapher der Spekulation nicht enthält: Es soll das eingesehen werden bzw. das
ans Licht kommen, was vorher verheimlicht wurde, was dunkel geblieben ist – in
Kants Sprache die „dunkel gedachte Metaphysik“ (MS, AA 6, S. 376) oder „die geheime[n] Urtheile der gemeinen Vernunft“ (Reflexionen zur Anthropologie, AA 15,
S. 180); in Nietzsches Sprache „ein Volks-Aberglaube aus unvordenklicher Zeit“ (JGB
Vorrede, KSA 5, S. 11). Nach Nietzsche ist es jedoch nicht bloß der Aberglaube, der dem
philosophischen Denken entgegensteht, sondern auch und vor allem die Vorurteile
der Philosophen, die, wie gleich zu Anfang in Jenseits von Gut und Böse gesagt wird,
sich selbst missverstehen, indem sie auf den gemeinen Volks- und Grammatik-Vorurteilen ihre „erhabenen und unbedingten Philosophen-Bauwerke[ ]“ errichten (JGB
Vorrede, KSA 5, S. 11 f.). Über diese ersten Vorurteile aufzuklären, dort hinzuleuchten,
wo sich die hässlichsten und lichtscheuesten Wahrheiten vor überlanger Zeit niedergelassen haben könnten, darin sieht Nietzsche seine wichtigste Aufgabe. Insofern ist
sie auch eine Aufgabe der Aufklärung, sie ist die Aufklärung der Philosophie.32
30 Dass es sich bei Kants kritischem Unternehmen von Anfang an um eine moralische Angelegenheit
handelt, betont Simon gerade im Zusammenhang mit Nietzsche: „Nietzsche hat Kant offensichtlich gut
verstanden, wenn er bemerkt, nach Kant sei ‚der Mensch‘ auch im Erkennen ‚ein moralisches Wesen‘
[…]“ (Simon, Moral bei Kant und Nietzsche, S. 183).
31 Hans Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie. Zur philosophischen Bedeutsamkeit von
Blumenbergs Ansatz s. Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 21 f.
32 Zur Frage nach der Bedeutung der Aufklärung bei Nietzsche liefert der bereits erwähnte SammelbandNietzsche – Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer? (hg. v. Reschke) reichhaltiges Material und ein breites Spektrum von Forschungsperspektiven. Wie Hartwig Frank in seiner Rezension mit
Recht bemerkt hat, wird schon durch den Titel des Sammelbandes eine klare Stellungnahme zur Frage,
ob Nietzsche als neuer radikaler Aufklärer oder als Gegner der Aufklärung zu verstehen sei, provoziert
(Frank, Nietzsche und Kant, S. 317 f.). Dennoch fehlt es nicht an Beiträgen, in denen eine gewisse
Unentschiedenheit bzw. Unentscheidbarkeit zum Ausdruck kommt. Auch bei der Frage nach der Rolle
der Aufklärung bei Nietzsche sieht man sich, wie bereits bei der nach seiner Kant-Rezeption, einem
breiten Antwort-Spektrum gegenüber: Die Deutungen reichen von der Klassifizierung Nietzsches als
Gegner der Aufklärung bis zur Interpretation seiner Philosophie als ihrer Vollendung durch einen
neuen aufklärerischen Ansatz. Die letztere Position scheint produktiver zu sein, weil sie die komplexen
Zusammenhänge von Nietzsches historischen Ausführungen in die Interpretation einbezieht (vgl. z. B.
Henning Ottmann, Nietzsche und die philosophische Tradition; Hans-Martin Gerlach, Friedrich Nietzsche und die Aufklärung, bes. S. 23 ff.). Aber auch wo Nietzsche als Aufklärer bzw. als Gegenaufklärer
98
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Wenn Kant „als der Philosoph der Aufklärung schlechthin“ gilt, „auch und vor
allem der Aufklärung über die Aufklärung“,33 wenn er der Philosophie eben diese
Aufgabe auferlegte, so wird die mit dieser Formel angedeutete Distanzierung von
Nietzsche fortgesetzt und auf die kritische Philosophie selbst bezogen. Insofern deutet
Nietzsche die Aufgabe der Aufklärung in Distanz zu Kant und über Kant hinaus.34
Schon in der Morgenröthe versucht er nicht nur Kant, sondern die deutsche Philosophie und, mehr noch, die deutsche Literatur, einschließlich Goethe,35 aus dieser
Distanz zur Aufklärung, als „Feindschaft der Deutschen gegen die Aufklärung“ zu
verstehen (M 197, KSA 3, S. 171 f.). Die deutschen Philosophen waren es, die „auf die
erste und älteste Stufe der Speculation zurückgegangen“ sind,
denn sie fanden in Begriffen ihr Genüge, anstatt in Erklärungen, gleich den Denkern träumerischer Zeitalter, – eine vorwissenschaftliche Art der Philosophie wurde durch sie wieder lebendig
gemacht. […] Der ganze grosse Hang der Deutschen gieng gegen die Aufklärung […] (M 197,
KSA 3, S. 171).36
Die spekulative Vernunft der deutschen Philosophie, vor allem bei Kant und Hegel,
wird so dem aufklärerischen Ansatz entgegengestellt, weil sie das Dunkel-Gebliebene
nicht erleuchtet, sondern vielmehr ihre Aufgabe darin sieht, den Volksglauben mit
angesehen wird, gibt es weitere Optionen. Man kann bspw. Nietzsches Deutung von Kants Moralphilosophie als Verrat an der Aufklärung bzw. als Halbierung, wenn nicht gar als Desavouierung der
Aufklärung interpretieren (vgl. Beatrix Himmelmann, Nietzsche und Kant als Aufklärer; vgl. Beatrix
Himmelmann, Kant, Nietzsche und die Aufklärung, bes. S. 43). Diese Schlussfolgerung ist allerdings
u. a. einer Gleichsetzung der Aufklärung mit dem „öffentlichen Gebrauch der Vernunft“ zu verdanken.
Zwar ist dieser öffentliche Gebrauch bei Kant ein wichtiges Mittel der Aufklärung, aber noch lange
nicht die Aufklärung selbst. Gerade eine Vorstellung von der angeblichen Klarheit dieses Gebrauchs,
welche der Metapher der Aufklärung entspringt, wird bei Nietzsche zum Problem. „Der öffentliche
Gebrauch der Vernunft“, etwa das „Zeitungslesen“, kann auch als Behinderung der Aufklärung, als
Verbreitung von „Unmündigkeit“ verstanden werden.
33 Josef Simon, Der Begriff der Aufklärung bei Kant und Nietzsche, S. 113.
34 Jedoch darf diese Distanz m. E. nicht im Sinne einer „Metakritik“ verstanden werden (vgl. Günter
Wohlfart, „Die Aufklärung haben wir jetzt weiterzuführen […]“, S. 131 f.). Die Möglichkeit einer Metaposition wird bei Nietzsche als Plausibilität der Aufklärung gerade der Kritik unterworfen. Eine Metaposition würde für sich beanspruchen, sie selbst sei das Ergebnis einer endgültig vollzogenen Aufklärung. Dies trifft für jeden Versuch einer Aufklärung zweiter Ordnung zu, für jeden Versuch einer
„Abklärung der Aufklärung“ (Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung, S. 83 f.). Die Möglichkeit
einer übergeordneten Position wird allerdings nach Luhmann durch die zeitliche Distanz möglich,
indem sie „nicht angestrebt [wird], sondern bereits passiert“ (Niklas Luhmann, Beobachtungen der
Moderne, S. 42). Diese zeitliche Distanzierung ist auch für Nietzsche, wenn nicht die einzig mögliche,
so doch eine, die sich dem Naivitäts-Verdacht entziehen kann.
35 Dies ist besonders überraschend, denn Goethe zählt sonst für Nietzsche zu seinen beliebtesten
Beispielen des aufgeklärten Geistes, u. a. der „eigenen Aufklärung über sich“ (UB III, KSA 1, S. 382).
36 Schon Platon steht Nietzsche zufolge unter dem „Zauber des Begriffs“, den er „als Idealform
verehrte und vergötterte“ (Nachlass, Herbst 1885–1886, 2[104], KSA 12, S. 112).
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
99
ihren Begriffen zu rechtfertigen.37 Mit diesem ersten Schritt verdüstert sich die Aufklärung. Durch „die deutschen Historiker und Romantiker“, durch Künstler und
Dichter wird sodann der nächste antiaufklärerische Schritt gewagt: „[A]n Stelle des
Cultus’ der Vernunft“ wird „der Cultus des Gefühls“ aufgerichtet, um die Erkenntnis
selbst „unter das Gefühl hinabzudrücken“. Und all diese antiaufklärerischen Tendenzen schreibt Nietzsche wiederum Kant zu, der seine eigene primäre Aufgabe so
bestimmte: „dem Glauben wieder Bahn zu machen, indem man dem Wissen seine
Gränzen wies“ (M 197, KSA 3, S. 171 f.).38 Über Kants Begriff des Glaubens sollte darum auch aufgeklärt werden und somit über die ganze Aufgabe der Kritik, die ihren
Endzweck und ihre letzte Legitimation in der Moral hat.
Doch auch die Gegenbewegung zur Aufklärung, die sich selbst als Aufklärung
und sogar als „Aufklärung über die Aufklärung“ missverstand, hätte man nach Nietzsche falsch gedeutet, wenn man sie als bloßen Feind des genuin aufklärerischen
Ansatzes darstellte. Eine bloße Umkehrung der Perspektive war nicht Nietzsches
Ziel.39 Vielmehr wollte er die mannigfaltigen Perspektiven wieder sichtbar machen,
die durch den jeweiligen Ansatz ausgeblendet wurden.40 Denn gerade aus der Gegenbewegung, aus dem schwärmerischen Kultus der Gefühle kommt nach Nietzsche „die
neu erregte Leidenschaft des Gefühls und der Erkenntnis“, „die Historie, das Verständnis des Ursprungs und der Entwickelung, die Mitempfindung für das Vergangene“. Diese neue Welle kommt zum Ausdruck durch
neue und stärkere Genien e b e n j e n e r A u f k l ä r u n g , wider welche sie beschworen waren
(M 197, KSA 3, S. 172).
37 Vgl. die Art und Weise, wie Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten den Begriff des guten
Willens einführt, nämlich als Begriff, der „schon dem natürlichen gesunden Verstande beiwohnt und
nicht sowohl gelehrt als vielmehr nur aufgeklärt zu werden bedarf“ (GMS, AA 4, S. 397). Zu dieser Art
der „Aufklärung“ vgl. bei Nietzsche „K a n t s ’ W i t z. – Kant wollte auf eine ‚alle Welt‘ vor den Kopf
stossende Art beweisen, dass ‚alle Welt‘ Recht habe: – das war der heimliche Witz dieser Seele. Er
schrieb gegen die Gelehrten zu Gunsten des Volks-Vorurtheils, aber für die Gelehrten und nicht für das
Volk“ (FW 193, KSA 3, S. 504).
38 Vgl. KrV B XXX.
39 Vgl. die These, Aufklärung und Moral seien bei Nietzsche Gegensätze bzw. es sei bei ihm „die
Unaufhebbarkeit des Antagonismus“ zwischen ihnen behauptet (Heinz Röttges, Nietzsche und die
Dialektik der Aufklärung, S. 220).
40 Zu späteren Auseinandersetzungen mit der Aufklärung und der dialektischen Kritik an ihr im
Zusammenhang mit Nietzsches Wirkungsgeschichte s. Reinhart Maurer, Nietzsche und die Kritische
Theorie, und die anschließende Diskussion (S. 59–79), wo mehrmals betont wurde, Nietzsches Auslegung der Aufklärung und ihres Scheiterns sei grundsätzlich von dem dialektischen Ansatz, besonders der Verfallsidee Horkheimers und Adornos zu unterscheiden, die hinter Nietzsche zurückzufallen
scheinen (vgl. neben der Position von Maurer die von Abel, Gerhardt, Gründer und Müller-Lauter).
S. dazu auch Holger Weiniger, Vernunftkritik bei Nietzsche und Horkheimer/Adorno. Die Problemstellung
in „Zur Genealogie der Moral“ und in der „Dialektik der Aufklärung“. Zur Auseinandersetzung der
kritischen Theorie mit Nietzsche s. Babette Babich (Hg.), Habermas, Nietzsche, and Critical Theory.
100
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Jener Denkfigur, die uns hier begegnet, gehört ein besonderer Platz in Nietzsches
Philosophie. Die Aufklärung und die Gegenaufklärung sind nach Nietzsche nicht bloß
Aktion und Reaktion, sondern vielschichtige Bewegungen der „Geister“, die sich stets
in ihr Gegenteil verwandeln können. Eindeutige Einschätzungen sind darum unmöglich.41 So wie „der grosse Hang der Deutschen“ gegen die Revolution und die deutsche
Romantik aus der deutschen Aufklärung hervorgegangen sind und gleichzeitig als
Reaktionen gegen die Aufklärung gerichtet wurden,42 so bereiteten aus der von Nietzsche neu gewonnenen Sicht gerade diese feindlichen Kräfte den neuen Weg für „die
Morgenröthe der Aufklärung“, d. h. der Aufklärung über das, was bisher als Aufklärung verstanden und missverstanden wurde.43 Am Ende des soeben analysierten
Aphorismus formuliert Nietzsche seine eigene Aufgabe:
Diese Aufklärung haben wir jetzt weiterzuführen, – unbekümmert darum, dass es eine ‚grosse
Revolution‘ und wiederum eine ‚grosse Reaction‘ gegen dieselbe gegeben hat, ja dass es Beides
noch giebt: es sind doch nur Wellenspiele, im Vergleiche mit der wahrhaft grossen Fluth, in
welcher w i r treiben und treiben wollen! (M 197, KSA 3, S. 172)
Aus der Perspektive der Aufgabe, die Aufklärung weiterzuführen, erscheinen diese
Aktionen und Reaktionen als bloßes Wellenspiel von Ebbe und Flut. Gefährlichkeit
und Nützlichkeit wachsen darin zusammen, genauso wie das Gewaltsame an der
Aufklärung durch die „befreiende und erhellende Nützlichkeit“ der „grosse[n] Revolutionsbewegung“ zunahm. Für die so verstandene Aufklärung war auch die französi-
41 Darauf wurde mehrmals hingewiesen. S. etwa die Replik von Mazzino Montinari (Maurer, Nietzsche
und die Kritische Theorie. Die Diskussion, S. 72 f.). Dennoch wird immer wieder, wie von Taureck,
behauptet, Nietzsche seien die Ideen der Aufklärung „von vornherein nichtig“ gewesen (Maurer,
Nietzsche und die Kritische Theorie. Die Diskussion, S. 59).
42 Zur Deutung der Romantik als Feindschaft gegen die Aufklärung vgl. November 1887–März 1888,
11[312], KSA 13, S. 132; Frühjahr 1888, 14[62], KSA 13, S. 248. Die Romantik und „antiromantische […]
Selbstbehandlung“ (MA II Vorrede 2, KSA 2, S. 371) ist bei Nietzsche ein großes Thema. Die romantische
Bewegung, historisch gesehen, ist genauso wenig frei von Beimischungen und Gegenbewegungen wie
die Aufklärung, und kann deswegen nicht nur als Reaktion auf die Aufklärung betrachtet werden. Wie
bei jeder Aktion und Reaktion ist das Verhältnis zwischen beiden historischen Bewegungen – und
noch vielmehr zwischen ihren philosophischen Auswirkungen – viel komplexer als eine bloße Gegenüberstellung zu zeigen vermag. Zum Thema „Romantik“ bei Nietzsche s. Peter Heller, Nietzsches Kampf
mit dem romantischen Pessimismus; Ernst Behler, Nietzsche und die frühromantische Schule.
43 Ähnlich geht Nietzsche mit dem vielschichtigen Phänomen der Reformation um, wenn er es als
Gegenbewegung und Feindschaft gegen die Renaissance, als Hindernis auf dem Weg zur Aufklärung
interpretiert. Wenn dieser Protest „des inzwischen zurückgebliebenen deutschen Wesens“ durch das
„seltsame Zusammenspiel“ der politischen Interessen nicht an Kraft gewonnen hätte, so wäre „die
Morgenröthe der Aufklärung vielleicht etwas früher und mit schönerem Glanz, als wir jetzt ahnen
können, aufgegangen“ (MA I, 237, KSA 2, S. 199 f.). Vgl. auch die berühmte Passage zum „Bauernaufstand des Geistes“, in der die Lutherische Reformation als großes Missverständnis gedeutet wird
(FW 358, KSA 3, S. 602 ff.).
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
101
sche Revolution ein „grosse[r] Sklaven-Aufstand“ (JGB 46, KSA 5, S. 67);44 das Christentum hatte dagegen durch die von ihm anerzogene „Geduld und Feinheit“ einen
„grossen Beitrag“ dazu geleistet (FW 122, KSA 3, S. 478). Denn auch die Stärke einer
Aktion wird nur daran ersichtlich, ob sie eine Gegenbewegung in sich aufzunehmen
vermag. Die Größe eines Phänomens besteht nach Nietzsche eben darin, das Gegenteil in sich aufnehmen zu können und dieses wieder für die Selbststeigerung fruchtbar
zu machen.45
Um die Aufklärung weiterzuführen, sollte der Philosoph also nicht bloß alle
„Vorurteile“ kritisch behandeln, er sollte jedes Für und Wider, alle Aktionen und
Reaktionen hinter sich lassen, sie als bloßes Wellenspiel begreifen, an dem er selbst
nur vorübergehend teilnimmt. Diese „Aufklärung“ kann ihrerseits mit einer Reaktion
rechnen:
Die ‚Aufklärung‘ empört: der Sklave nämlich will Unbedingtes, er versteht nur das Tyrannische,
auch in der Moral, er liebt wie er hasst, ohne Nuance, bis in die Tiefe, bis zum Schmerz, bis zur
Krankheit. (JGB 67, KSA 5, S. 67)
Am Mangel an Nuancen, am Willen zum Einfältigen lässt sich der Sklaveninstinkt in
der Moral gerade als solcher erkennen.46 Die „Aufklärung“, auch die in Anführungszeichen, deutet Nietzsche dagegen als eine „wahrhaft grosse[ ] Fluth“, die dem
Instinkt zur Vereinfachung widersteht. Sie soll aber, um Aufklärung ohne Anführungszeichen zu werden, auch dem Willen zu einer bloßen Umkehrung der Perspektive entschieden Widerstand leisten.47 Wenn jemand etwa „hinter die bäurische Einfalt
dieses berühmten Begriffs ‚freier Wille‘“ gekommen ist und ihn „aus dem Kopfe“
44 Vgl. Nietzsches Notat, in dem er „die Revolution und die Kantische Philosophie, die Praxis der
revolutionären Vernunft und die Revolution der ‚praktischen‘ Vernunft“ als „abscheulichste […] Ausgeburten des 18. Jahrhunderts“ deutet, denen der „Haß gegen das Werden“ (wie auch „aller M o r a l
und der R e v o l u t i o n“) gemein ist (Nachlass, Frühjahr 1888, 15[53], KSA 13, S. 444).
45 Die von Nietzsche beschriebene Bewegung kann allerdings nicht als dialektisch im strengen Sinne
bezeichnet werden, denn von der Ebbe-Flut-Metapher her verstanden können Aktion und Reaktion
oder, in diesem Fall, Aufklärung und Gegenaufklärung immer wieder und immer neu zurückkehren.
Zum dialektischen Denken bei Nietzsche im Anschluss an Hegels Begriff der Dialektik und im Unterschied zu ihm: Reinier Franciscus Beerling, Hegel und Nietzsche; Alfred Schmidt, Zur Frage der
Dialektik in Nietzsches Erkenntnistheorie (1963); Kaulbach, Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie, 87; Werner Stegmaier, Nietzsches Neubestimmung der Wahrheit, bes. S. 93. Zum Begriff der Größe
bei Nietzsche s. Werner Stegmaier, Schicksal Nietzsche? Zu Nietzsches Selbsteinschätzung als Schicksal
der Philosophie und der Menschheit (Ecce Homo, Warum ich ein Schicksal bin 1), S. 110 f.
46 Nimmt man diese Formulierung ernst, entgeht man der üblichen flachen Deutung der Sklavenbzw. Herrenmoral bei Nietzsche. Das Kriterium für den Sklaveninstinkt in der Moral ist hier deutlich
angegeben; wer an diesem Instinkt nicht leidet und ob es überhaupt möglich ist, sich von ihm frei zu
halten, bleibt allerdings offen.
47 Zu Nietzsches Verwendung der Gänsefüßchen s. Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie,
S. 291 ff.
102
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
gestrichen hat, wäre sein Anspruch auf Aufklärung damit noch nicht berechtigt. Denn
eben dann, sagt Nietzsche,
bitte ich ihn nunmehr, seine ‚Aufklärung‘ noch um einen Schritt weiter zu treiben und auch die
Umkehrung jenes Unbegriffs ‚freier Wille‘ aus seinem Kopfe zu streichen: ich meine den ‚unfreien
Willen‘ (JGB 21, KSA 5, S. 35).
Das Problem wäre nicht damit gelöst, dass ein bestimmter Begriff verworfen wird,
sondern damit, dass man aufhört, „in Begriffen […] Genüge [zu] finden“, dass man die
Aufklärung über jede Gewissheit hinaustreibt. Ihr treu zu bleiben bedeute nicht, sich
auf die Suche nach dem Unbedingten als letzter Selbstbegründung des Denkens
zu machen, sondern, gerade umgekehrt, Skepsis gegen jede Sicherheit, guten Geschmack für Nuancen, aristokratisches Misstrauen gegen leidenschaftlich vertretene
Wahrheit zu pflegen.
Das Ziel von Nietzsches „n e u e [ r ] A u f k l ä r u n g “ (Nachlass, Sommer–Herbst
1884, 26[293–325], KSA 11, S. 228 ff.)48 war somit nicht, eine sichere Grundlage für das
Denken zu schaffen, wie es Kants Kritik getan hatte. Denn alle Gewissheiten samt allen
Begriffen, die diese Gewissheiten zum Ausdruck bringen, stehen nach Nietzsche von
nun an unter dem Verdacht der Feindschaft gegen die Freiheit des Geistes, vor allem
der alte Begriff der Wahrheit. So eröffnet Nietzsche Jenseits von Gut und Böse mit der
ironischen Vermutung, dass die Wahrheit ein Weib ist, das Philosophen begehren. Sie
ist somit kein Ding, auch nicht „das Ding an sich“, vielmehr eine Person, die „Gründe
hat, ihre Gründe nicht sehn zu lassen“ (FW Vorrede 4, KSA 3, S. 352).49 Über diese
Gründe kann man nicht aufklären, man kann sie nicht kritisch überprüfen. Das Fundament des philosophischen „Gebäudes“ bleibt somit unbegründet und ungesichert.
Wenn aber die Aufklärung nach Nietzsche von nun an als Verdacht gegen jede
Gewissheit zu verstehen ist, dann bedeutet sie auch eine Bewegung auf den Pessimismus hin.50 Denn die so verstandene Aufklärung fördert Skepsis gegen jede Bewegung,
gegen jede Aktion, auch gegen sich selbst. Wer „[ d ] i e G e f ä h r l i c h k e i t d e r A u f k l ä r u n g “ begreift, wird „wissen, aus welcher Vermischung man sie herauszuziehen,
von welcher Verunreinigung man sie zu läutern hat“ – jedoch nicht, um sich von
dieser Aufgabe zu verabschieden, sondern „[u]m dann, an sich selber, das Werk der
Aufklärung fortzusetzen“ (MA II, WS 221, KSA 2, S. 654). Indem die Aufklärung über
die alten Begriffe und Begründungsvorgänge hinausführt, wird sie zu einem riskanten
48 Dies war ein provisorischer Titel zu einem umfassenden Werk „D i e n e u e A u f k l ä r u n g. Eine
Vorbereitung zur ‚Philosophie der ewigen Wiederkunft‘“, der sich dann allmählich in das transformierte, was wir als „Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft“ kennen (Nachlass,
Sommer–Herbst 1884, 26[293–325], KSA 11, S. 228 ff.)
49 Die berühmteste philosophische Interpretation von Nietzsches Metapher des Weibes als Wahrheit
stammt von Jacques Derrida, Sporen. Die Stile Nietzsches.
50 Vgl. „Die Verdüsterung, die pessimistische Färbung, kommt nothwendig im Gefolge der Aufklärung.“ (Nachlass, Juni–Juli 1885, 36[49], KSA 11, S. 571)
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
103
Unternehmen, das im Unterschied zur kantischen Kritik kein Gelingen und schon gar
nicht einen sicheren Gang der Philosophie versprechen kann. Sie wird jedoch zum
„Vorspiel einer Philosophie der Zukunft“ – als neues Wagnis, „und vielleicht giebt es
kein grösseres“ (JGB 1, KSA 5, S. 15).
Die große Errungenschaft
Der Punkt, an dem Nietzsche Kant am schärfsten angreift, ist die Wiederherstellung
des „alten ‚Ideals‘“, das Auffinden eines „Schleichweg[s]“ zurück zur Moral und dem
moralischen Gott. Kant sei dadurch, so Nietzsche, zu einem der „grössten Hemmschuhe der intellektuellen Rechtschaffenheit Europa’s“ geworden (EH, WA 2, KSA 6,
S. 360). „Der Erfolg Kant’s ist bloss ein Theologen-Erfolg“ gewesen, schreibt Nietzsche
in Der Antichrist (AC 10, KSA 6, S. 177), um unmittelbar danach sein „Wort“ „gegen
Kant als Moralist[en]“ anzuschließen, das Wort zur Lebensgefährlichkeit des kategorischen Imperativs (AC 11, KSA 6, S. 177).
Diese negativen Einschätzungen in Nietzsches Spätwerk stellen das Ergebnis
einer langen Auseinandersetzung dar, die im Übrigen nicht eindeutig und nicht
einseitig negativ ausfiel. Seine eigene aufklärerische Aufgabe führte Nietzsche immer
wieder zu Kant zurück, als dem stärksten Vertreter jener „Aufklärung“, die er in
Anführungszeichen setzte. So besteht der „wahrhaftig nicht […] geringste[ ] Reiz“ der
„hundertfach widerlegte[n] Theorie vom ‚freien Willen‘“ gerade darin, „dass sie
widerlegbar“ ist: „immer wieder kommt Jemand und fühlt sich stark genug, sie zu
widerlegen“ (JGB 18, KSA 5, S. 31). Das „immer wieder“ bedeutet, dass die Widerlegung selbst nicht das eigentliche Ziel ist. Das Ziel dieser Kritik ist eine Überprüfung
der eigenen Kräfte, der eigenen Fähigkeiten, „das Werk der Aufklärung“ „an sich
selber“ „fortzusetzen“, sie „weiterzuführen“. Nietzsches Polemik gegen Kant soll also
nicht bloß die Schwäche, sondern auch die Stärke sichtbar machen bzw. das hervorheben, was immer neue Widerlegungen und d. h. immer neue Interpretationen
verdient. Deshalb reicht seine Auseinandersetzung mit Kant vom Tadel an seiner
„Tartüfferie“ (JGB 5, KSA 5, S. 19) und seiner „Schwärmerei“ (M Vorrede 3, KSA 3,
S. 14) einerseits bis zum (v. a. im Nachlass deutlich ausgedrückten) Lob seiner „kritischen Zucht“ (Nachlass, April–Juni 1885, 34[221], KSA 11, S. 496), seiner Treue zum
Sensualismus (Nachlass, April–Juni 1885, 34[116], KSA 11, S. 459) andererseits. Die
Argumentation für und wider Kant darf nicht voreilig als Unentschiedenheit oder gar
als Widersprüchlichkeit gedeutet werden. In beidem, im Lob wie im Tadel, sollte ans
Licht kommen, was Kant nach Nietzsche zum Prüfstein für das philosophische Denken gemacht hat. Die Größe Kants verriet aber, indem Nietzsche sie würdigte, auch
seine Schwäche. Durch diese Art „Kritik“ konnten die dem kantischen Denken zugrunde liegenden Plausibilitäten sichtbar werden.
Im fünften Buch der Fröhlichen Wissenschaft spricht Nietzsche von den vier
„eigentlichen Errungenschaften des philosophischen Denkens“: der Leibniz’, der
104
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Kants, der Hegels und der Schopenhauers (FW 357, KSA 3, S. 597 ff.). Doch was hier
als „Errungenschaft“ bezeichnet wird, ist Resultat einer überraschenden Selektion.
Denn bei jedem der genannten Philosophen wird ein Gedanke ausgewählt, der als
seine größte Tat in der Philosophie und als Zeugnis seines „europäischen“ Geistes
dargestellt wird.51 Bei Leibniz war es der Gedanke, dass „die Bewusstheit nur ein
Accidens der Vorstellung ist, n i c h t deren nothwendiges und wesentliches Attribut“.52 Bei Hegel stellt Nietzsche das Durchgreifen durch „alle logischen Gewohnheiten und Verwöhnungen“ heraus, „als er zu lehren wagte, dass die Artbegriffe sich
a u s e i n a n d e r entwickeln“. Bei Schopenhauer wird dessen Pessimismus betont, den
er dem „Problem vom W e r t h d e s D a s e i n s “ zu verdanken hat. Bei Kant sein
ungeheures Fragezeichen, welches er an den Begriff ‚Causalität‘ schrieb, – nicht dass er wie
Hume dessen Recht überhaupt bezweifelt hätte: er begann vielmehr vorsichtig das Reich abzugrenzen, innerhalb dessen dieser Begriff überhaupt Sinn hat (man ist auch jetzt noch nicht mit
dieser Grenzabsteckung fertig geworden). (FW 357, KSA 3, S. 598)
Alle vier Fälle haben allerdings etwas gemeinsam: Hervorgehoben wird immer der
Aspekt, der eine Umkehrung der Perspektive markiert. Nietzsche nennt sie eine
„Umdrehung“. Im Falle Kants ist es eine Umstellung von der Frage nach der Wirklichkeit der kausalen Verhältnisse auf die Frage nach der rechtmäßigen Brauchbarkeit
des Begriffs der Kausalität, die als wesentlicher Schritt der kopernikanischen Wende
bekannt wurde. Nietzsche gibt dabei zu verstehen, dass diese Umkehrung von Kant
nur angefangen wurde und „auch jetzt noch“ nicht vollendet ist. Sein Schluss ist noch
überraschender: „[M]it Kant“ zweifelt man nicht bloß „an der Letztgültigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und überhaupt an Allem, was sich causaliter erkennen l ä s s t “, sondern „das Erkenn b a r e “ selbst „scheint uns als solches schon g e r i n g e r e n Werthes“ (FW 357, KSA 3, S. 599). Diese Interpretation geht jedoch wesentlich
über Kant hinaus, denn der Zweifel am Wert des Erkennbaren folgt keineswegs
notwendigerweise aus dem Zweifel an der Letztgültigkeit der Erkenntnis. Den Schritt
hin zur Verzweiflung an der Wahrheit macht Kant gerade nicht, auch wenn er die
Wahrheit ironisch als „reizende[n] Name[n]“ bezeichnet (KrV A 235/B 294), den er
durch einen anderen, durch „Stufen des Fürwahrhaltens“, ersetzen will.53 Denn der
51 Der Aphorismus trägt den Titel „Z u m a l t e n P r o b l e m: ‚w a s i s t d e u t s c h?‘“ und wird polemisch
gegen Richard Wagners Auffassung des „Problems“ entworfen. Dennoch werden hier die großen
Denker als „gute Europäer“ und nicht bloß aus der Perspektive ihrer nationalen Wirkungsgeschichte
betrachtet. Zur kontextuellen Interpretation des Aphorismus s. Stegmaier, Nietzsches Befreiung der
Philosophie, S. 355 ff.
52 Zu Leibniz als Vorläufer des nietzscheschen Perspektivismus s. Friedrich Kaulbach, Nietzsche und
der monadologische Gedanke; Figl, Interpretation als philosophisches Prinzip, S. 87 f., Anmerk. 32. Zum
grundlegenden Unterschied bzw. zu Nietzsches nachmetaphysischem Denken im Unterschied zu
Leibniz s. Werner Stegmaier, Nietzsches Neubestimmung der Wahrheit, S. 79, Anmerk. 14.
53 Die Frage nach der Wahrheit und ihre Beantwortung, wenn es um das alte adequatio rei et
intellectus geht, wird von Kant wiederum ironisch damit verglichen, dass „einer (wie die Alten sagten)
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
105
Erkennende kann zwar von der Letztgültigkeit seines Wissens bloß „überredet“
worden sein, doch bleibt durchaus eine Möglichkeit, dass er von ihr „überzeugt“ ist,
d. h. dass sein Fürwahrhalten nicht in seinen „besonderen Beschaffenheiten“ begründet ist, sondern „für jedermann gültig ist“. Und solch eine „Vermutung“ der „Wahrheit des Urteils“ sieht Kant zumindest im Prinzip (im Falle der Mitteilbarkeit der
Gründe des Fürwahrhaltens) als berechtigt an (KrV A 820 f./B 848 f.). Dabei ist allerdings nicht zu bezweifeln, dass diese Vermutung eine solche bleiben muss, ist es doch
letzten Endes unmöglich, ihre Gültigkeit für jedermann zu überprüfen.54
Nietzsche kehrt sein Lob Kants somit letztlich gegen Kant, denn die von ihm
aufgezeigten Konsequenzen des „ungeheure[n] Fragezeichen[s]“ waren Kant selbst
kaum erwünscht, die „Verzweiflung an aller Wahrheit“, ein „zernagende[r] und zerbröckelnde[r] Skepticismus und Relativismus“. Die Unüberprüfbarkeit allen Wissens
und aller Erkenntnis führt, so Nietzsche, zur Erschütterung des naiven Lesers, der in
seinem „heiligsten Innern“ von dieser Philosophie betroffen ist (Nietzsches Beispiel
dafür ist Heinrich von Kleist (UB III, KSA 1, S. 355 f.)). Dies wird schon in den
Unzeitgemässen Betrachtungen als „populäre Wirkung“ Kants bezeichnet, dessen
Pessimismus, seine „kritische Entsagung“ und den von ihr erzeugten „skeptischen
Unmuth“ Nietzsche dort als Wegzeiger „zur Höhe der tragischen Betrachtung“ Schopenhauers darstellte. Wenn er diese Einschätzung später als Überschätzung und
Missverständnis umdeutete (NW, KSA 6, S. 424 f.), so blieb der tragische Pessimismus
für ihn die größte Errungenschaft der abendländischen Philosophie.
Kants „ungeheures Fragezeichen“ betrifft für Nietzsche nicht nur den Begriff der
Kausalität, wenn dieser auch grundlegende Bedeutung für den extremen Pessimismus hat. Auch hinter dem Begriff des Seins taucht ein Fragezeichen auf, das von
Kant an Parmenides’ Schluss vom Denken auf das Sein – einer Denkfigur, der
nach Nietzsche auch Hegel verhaftet blieb – gesetzt wurde. Angesichts des kritischen Geschäfts Kants sei es, so Nietzsche, „eine kecke Ignoranz, wenn es hier und
da, besonders auch unter schlecht unterrichteten Theologen, die den Philosophen
spielen wollen, als Aufgabe der Philosophie hingestellt wird, das ‚Absolute mit
dem Bewußtsein zu erfassen‘“ (PHG 11, KSA 1, S. 847). Nietzsche zieht daraus
folgenden nicht gegen Kant gerichteten, doch wesentlich über ihn hinausgehenden
Schluss:
Die Worte sind nur Symbole für die Relationen der Dinge unter einander und zu uns und berühren nirgends die absolute Wahrheit […]. (PHG 11, KSA 1, S. 846)
den Bock melkt, der andre ein Sieb unterhält“ (KrV B 82 f.). Nur eine negative formale „Bedingung aller
Wahrheit“ könne angegeben werden, nicht eine „materielle“ (KrV B 84 f.).
54 Es ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der junge Nietzsche gerade wegen seiner neukantianischen Quellen den kantischen „Probierstein“ der Wahrheit, deren Mitteilbarkeit (KrV A 820 f./
B 848 f.), übersah. Vgl. PHG 11, KSA 1, S. 846.
106
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Tatsächlich stehen die Begriffe der Philosophie nach Kant „niemals zwischen sicheren
Grenzen“. Mehr noch: „philosophische Definitionen“ seien „nur als Expositionen“
möglich, d. h. „den philosophischen Erklärungen“ müsse im Unterschied zu mathematischen Begriffen „de[r] Ehrenname […] der Definition“ „verweigert“ werden (KrV
A 729 f./B 757 f.). Die Philosophie muss sich nach Kant mit Erklärungen begnügen, die
keine Definitionen, sondern bloße Expositionen sind. Hiermit ist der Punkt angesprochen, den Nietzsche als Feindschaft gegen die Aufklärung bezeichnete: Auf der vorkritischen Stufe der Spekulation – oder, um mit Kant zu reden, „im dogmatischen
Gebrauche“ der Vernunft – bleibt man bei den Begriffen. Man glaubt zu einer „vollständigen Exposition, d. i. zur Definition gelangt“ zu sein, während man nur eine
„Zergliederung“ der Merkmale, „deren Vollständigkeit nicht apodiktisch gewiß“ sein
kann, zustande bringt. „Man bedient sich gewisser Merkmale nur so lange, als sie zum
Unterscheiden hinreichend“ sind. Dementsprechend soll „das Wort, mit den wenigen
Merkmalen, die ihm anhängen, nur eine B e z e i c h n u n g und nicht einen Begriff der
Sache ausmachen“ (KrV A 728/B 756). Dennoch will Kant auch hier, wie beim Begriff
der Kausalität, die Möglichkeit einer zutreffenden Exposition des Begriffes nicht ausschließen. „In der Mathematik gehört die Definition ad esse, in der Philosophie ad
melius esse“ (KrV A 731/B 759). D. h. die Möglichkeit einer besseren Erklärung in
Hinsicht der Brauchbarkeit des Begriffs, die Möglichkeit einer besseren Bezeichnung
sollte in der Kritik grundsätzlich offen bleiben.55
Zu den Begriffen, die die Relationen eines Gegenstandes explizieren, ohne eine
endgültige Definition zuzulassen, gehört das Wort „Sein“, aber auch ein anderer für
die Moral aus Vernunft grundlegender Begriff: das Wort „Ich“. Seit Descartes, so
Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse, „macht man seitens aller Philosophen ein
Attentat auf den alten Seelen-Begriff“, „das heisst: ein Attentat auf die Grundvoraussetzung der christlichen Lehre“. Die ganze neuere Philosophie sei deshalb „a n t i c h r i s t l i c h : obschon, für feinere Ohren gesagt, keineswegs antireligiös“ (JGB 54,
KSA 5, S. 73). Bei Kant wird diese antichristliche Tendenz allerdings zu einer gewagten
Umkehrung der Perspektiven:
Nun versuchte man, mit einer bewunderungswürdigen Zähigkeit und List, ob man nicht aus
diesem Netze [dem descartischen – E.P.] heraus könne, — ob nicht vielleicht das Umgekehrte
wahr sei: ‚denke‘ Bedingung, ‚Ich‘ bedingt; ‚Ich‘ also erst eine Synthese, welche durch das
Denken selbst g e m a c h t wird. K a n t wollte im Grunde beweisen, dass vom Subjekt aus das Subjekt nicht bewiesen werden könne, — das Objekt auch nicht: die Möglichkeit einer S c h e i n e x i s t e n z des Subjekts, also ‚der Seele‘, mag ihm nicht immer fremd gewesen sein […]. (JGB 54,
KSA 5, S. 73)56
55 Kants Sprachauffassung darf schon deshalb nicht nur auf das Wahrhaftigkeitsgebot reduziert
werden (vgl. Römpp, Die Sprache der Freiheit. Kants moralische Sprachauffassung).
56 Vgl. August–September 1885, 40[16], KSA 11, S. 636.
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
107
Als „durchgängige Identität der Apperception“ ist das „Ich“ nach Kant „nur durch das
Bewußtsein dieser Synthesis möglich“, die es zustande bringt (KrV B 133; vgl. auch
KrV B 409 f.). Es ist für sich selbst nur als Tätigkeit beobachtbar. Die Identität des
Subjekts ist in theoretischer Hinsicht bloß eine Funktion der synthetischen Tätigkeit
der Apperzeption. Der Begriff der Seele wurde somit für die Erkenntnis grundsätzlich
undefinierbar. Diese antichristliche, wenn auch nicht antireligiöse Auslegung des
Subjekts bleibt, so Nietzsche, die große Errungenschaft der „erkenntnistheoretischen
Skepsis“.57
Die Identität des Subjekts bzw. der Begriff der Seele wurde von Kant allerdings in
praktischer Hinsicht wiederhergestellt und für die Begründung der Moral als tragend
angesetzt.58 An dieser Stelle würde man erwarten, dass Nietzsche zu einer scharfen
Kritik der theologischen Hinterlist Kants übergeht. Stattdessen weist Nietzsche jedoch
auf eine feine Unterscheidung in Kants Moralphilosophie hin. Nicht lange bevor der
oben zitierte Aphorismus zur „Scheinexistenz des Subjekts“ entstanden ist, notiert
sich Nietzsche eine Bemerkung über den moralischen „Werth der Handlung“, der
nicht im Äußeren (in den Folgen), also nicht in der Absicht liegt, sondern „zuletzt
immer z u r F r a g e n a c h d e m W e r t h e d e r i h r z u G r u n d e l i e g e n d e n M a x i m e
z u r ü c k f ü h r t “ (Nachlass, Sommer–Herbst 1884, 26[84], KSA 11, S. 171). Nietzsche
stellt sich in dieser Interpretation auf die Seite Kants gegen Schopenhauer, sofern jener
„zu bedenken“ gibt, ob „die Absicht allein über moralischen Werth oder Unwerth einer
Tat entscheidet“.59 Er sieht den Wert der kantischen Moral gerade darin, dass sie sich
auf die Maximen beschränkt. Die Übereinstimmung der auf eine konkrete Handlung
gerichteten Absicht mit der gewollten Maxime würde gerade die Identität des Subjekts
voraussetzen, die empirisch nicht gegeben ist und nur als synthetische Einheit in der
Verarbeitung des Mannigfaltigen denkbar sein kann. Für die Überprüfung der Maxime
braucht man dagegen kein „Ich“ und keine Einheit des Subjekts. Der Übergang von
einer moralischen Maxime zu einer Absicht und weiter zu einer konkreten Handlung
muss für moralische Einschätzungen problematisch bleiben, denn die Absichten, wie
auch die Gedanken, sind vielfältig und undurchschaubar.60 Die Moral, indem sie sich
nach Kant nicht auf das Empirische der Handlung und nicht auf die Absichten richtet,
setzt also streng genommen keine Identität des Subjekts voraus. Freilich setzt Kant
57 Die Religiösität dieses Gedankens kommt im russischen Denken besonders deutlich zum Vorschein, vor allem bei Tolstoi und Dostojewski. Wir werden sie in den nächsten Kapiteln näher
betrachten.
58 Um eine Kant-Interpretation, die diese Wiederherstellung des Subjekts auch im Theoretischen
ermöglichen soll, bemüht sich Dieter Henrich, Die Identität des Subjekts in der transzendentalen
Deduktion.
59 Vgl. „[…] eine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Werth nicht in der Absicht, welche
dadurch erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen wird […]“ (GMS, AA 4,
S. 399). Dazu s. z. B. Simon, Moral bei Kant und Nietzsche, S. 185 f.
60 Vgl. Nachlass, Sommer–Herbst 1884, 26[92], KSA 11, S. 173 f.
108
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
schon im nächsten Schritt die moralische Urteilskraft als Vermögen, über die Anwendung der Maximen auf konkrete Situationen zu urteilen. Für diese Anwendung fehlt es
aber prinzipiell an einem allgemeinen materiellen Kriterium. Die praktische Identität
des Subjekts bleibt genauso undurchschaubar wie die theoretische.
Die tragende Bedeutung dieses Gedankens ist für Nietzsche kaum zu überschätzen. Mit ihm ist der erste Schritt zur „Entmoralisirung“ gemacht.61 Die moralischen
Absichten und Handlungen sind nicht bloß nicht nachweisbar, sie sind für die Moral
selbst uninteressant. Durch die Unterscheidung von Absicht und Maxime wird das
„Attentat auf den alten Seelen-Begriff“ auf den Bereich des Praktischen übertragen
und in der Kritik der Moral fortgesetzt. Nur Maximen können moralisch sein, nicht ihre
konkrete Anwendung. Freilich spricht Kant von ihrer Einordnung, von der moralischen Gesinnung, die er als „g u t e [ s ] o d e r b ö s e [ s ] H e r z “ bezeichnet (RGV, AA 6,
S. 29). Aber zwischen diesem undurchschaubaren Kern der Moralität und den konkreten Absichten und Handlungen gibt es keine sichere Brücke. Die Berechenbarkeit
des Handelnden, seine Identität mit sich selbst, wird nachträglich behauptet, um ihn
zu richten und zu verurteilen. Dies ist nach Nietzsche die größte Grausamkeit des
kategorischen Imperativs (vgl. GM II, 6, KSA 5, S. 300), vor dessen Gerichtshof keiner
sich rechtfertigen kann. Hier liegt aber auch seine Stärke, denn somit wird auch in der
Moralphilosophie eine gewagte Umkehrung der Perspektive vollzogen. Nur aus der
Perspektive der sich selbst (nach der Handlung) richtenden Urteilskraft, aus der
Perspektive des schlechten Gewissens, ist die Verbindung zwischen der Maxime
einerseits und einer auf eine konkrete Handlung bezogenen Absicht andererseits
möglich und mithin das handelnde Subjekt denkbar.
Nietzsche betont mehrmals, dass Kants Verdienst für die Aufdeckung der Gründe
der Moralität auch darin bestand, dass er, im Gegensatz zur christlichen Moral, das
Mitempfinden, das Mitleid gering geschätzt und sogar als widermoralisch angesehen
habe.62 Dies entspricht jedoch nicht ganz Kants Auslegung des Mitleids. In der
Metaphysik der Sitten wird „das Mitgefühl a[m] Leiden“ als eine „natürliche Anlage“
der Moralität des Menschen beschrieben (MS, AA 6, S. 443). Kant bezeichnet es sogar
als „indirecte Pflicht, die mitleidige natürliche (ästhetische) Gefühle in uns zu cultiviren und sie als so viele Mittel zur Theilnehmung aus moralischen Grundsätzen und
dem ihnen gemäßen Gefühl zu benutzen“ (MS, AA 6, S. 457). Es ist aber „nur bedingte
Pflicht“, „weil hier der Mensch nicht blos als vernünftiges Wesen, sondern auch als
mit Vernunft begabtes Thier betrachtet wird“ (MS, AA 6, S. 456). Als Gefühl ist das
Mitleid kein Leitfaden der Moralität. Einerseits wäre die Barmherzigkeit, wenn auf
einen Unwürdigen bezogen, unmoralisch. Andererseits ist die Vermehrung des Leidens durch das Mitgefühl oder, wie Kant es sagt, durch „anstecken“ „vermittelst der
61 Vgl. Nachlass, Herbst 1887, 10[57], KSA 12, S. 485.
62 Vgl. M 132, KSA 3, S. 124; GM Vorrede 5, KSA 5, S. 252; Nachlass, Ende 1880, 7[216], KSA 9, S. 362;
Ende 1886–Frühjahr 1887, 7[4], KSA 12, S. 268.
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
109
Einbildungskraft“ zu vermeiden (MS, AA 6, S. 457). Wie jede natürliche Anlage kann
das Mitleid für die Moralität, aber auch gegen sie gebraucht werden.
Dieses Thema scheint bei Kant von keiner besonderen Wichtigkeit zu sein, doch
Nietzsche hebt es mehrmals hervor, indem er die Frage nach dem Mitleid als Schlüsselfrage des Problems der Moral betrachtet. Denn hier wird wieder Kants Umkehrung
der Frage nach der Grundlage der Moral deutlich. Gleich der Absicht ist auch die
Mitempfindung für das Subjekt der Handlung unkalkulierbar und undurchschaubar.
Und das heißt nicht bloß, dass sie unsicher sind, sondern dass sie nicht den Grund
der Moralität ausmachen können und deswegen auch nicht moralisch geboten werden dürfen. So weit reicht die Moral nicht. Man kann das als Schwäche von Kants
Moralphilosophie verstehen, als eine Schwäche jedoch, die unvermeidlich aus ihrer
Radikalität folgt. Nietzsche gibt Kant in diesem Punkt Recht, er sieht in dieser
Umkehrung die notwendige Konsequenz seines Attentats auf den Subjekt- und Seelen-Begriff, seines ungeheuren Fragezeichens an den Begriffen von Kausalität und
Sein. Mit seiner Moral aus Vernunft musste Kant über die Moral der Absichten und des
Mitgefühls hinausgehen und, wie Nietzsche sich ausdrückt, „die Selbstlosigkeit verherrlichen“, die nicht als Heil der Seele, nicht einmal als Selbstgewissheit des Handelnden verstanden werden kann. Denn, wie Kant selbst deutlich zu verstehen gab, es
sei „wahrscheinlich n i e eine That derselben gethan worden […]“ (Nachlass, Frühjahr–Herbst 1881, 11[303], KSA 9, S. 557 f.).63
Das große Umsonst
Die große Errungenschaft Kants, die Umkehrung der Perspektiven, das Fragezeichen
und die Skepsis nicht nur in der Zurückweisung der Ansprüche der Erkenntnis,
sondern auch in der Moralphilosophie, hat ihre Kehrseite. Der radikale Ansatz der
Kritik bringt den Pessimismus hervor, die Einsicht in die Unmöglichkeit der endgültig
„wahren“ Erkenntnis und die Unerreichbarkeit des absolut Guten. Um ihn zu überwinden, wäre eine Stärke nötig, die Nietzsche als „g r o s s e G e s u n d h e i t“ bezeichnet:
[…] eine solche, welche man nicht nur hat, sondern auch beständig noch erwirbt und erwerben
muss, weil man sie immer wieder preisgiebt, preisgeben muss! … (FW 382, KSA 3, S. 635 f.)
Zu Nietzsches Begriff der Größe im Zusammenhang mit seinem eigenen Ideal und
seinem Kriterium der vornehmen Moral werden wir noch zurückkehren müssen.64 An
63 Vgl. „Diese [die Vernunft – E.P.] gibt daher auch Gesetze, welche Imperativen, d. i. objektive
G e s e t z e d e r F r e i h e i t, sind, und welche sagen, w a s g e s c h e h e n s o l l, ob es gleich vielleicht nie
geschieht […].“ (KrV, A 802/B 830).
64 Zur kontextuelle Interpretation des Aphorismus 382 „D i e g r o s s e G e s u n d h e i t“ s. Stegmaier,
Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 598 ff. Wie bereits erwähnt, deutet Werner Stegmaier den
Begriff der Größe bei Nietzsche als Fähigkeit, den Gegensatz (hier die Krankheit) in sich aufzunehmen
110
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
dieser Stelle ist es wichtig, dass Kant den Schritt zur Überwindung des Pessimismus
nicht im Sinne der „grossen Gesundheit“ machte. Stattdessen suchte er einen
„Schleichweg zum ‚alten‘ Ideal“, zur „Versöhnung zwischen Wahrheit und ‚Ideal‘“, er
suchte im Grunde eine Formel „für ein Recht auf Lü g e […]“ (EH WA 2, KSA 6, S. 360),
die den pessimistischen Gedanken der Sinnlosigkeit und Unmoralität des Daseins
abschwächen sollte.
Der Lüge-Vorwurf scheint allerdings gerade bei Nietzsche, der den Willen zur
Wahrheit in Frage stellt, etwas Zweideutiges zu sein. Wenn wir jedoch versuchen,
diesen Vorwurf sinnvoll zu verstehen, so ist es ratsam, eine Metapher näher zu
betrachten, von der er begleitet wird. Gemeint ist die Bezeichnung Kants als „grosse[r]
Chinese von Königsberg“ (JGB 210, KSA 5, S. 144).65 Diese ironisch-freche Formel steht
in Nietzsches Nachlass für den zur Tugend erhobenen Sklaven-Instinkt, für „die
Zunahme der sklavischen Tugenden und ihrer Werthe“ (Nachlass, Frühjahr 1884,
25[121], KSA 11, S. 45). Die „Zeit der Ruhe und des Chinesenthums“ wird der „militaristischen Entwicklung Europa’s“ und den „inneren anarchistischen Zustände[n]“ entgegengesetzt, wobei Kant als „Vogelscheuche“ erscheint (Nachlass, Sommer–Herbst
1884, 26[417], KSA 11, S. 263). Denn auch Kant wird von Nietzsche vorgeworfen, seine
„skeptisch beginnende Bewegung“ fände „e i n e n G e n u ß i n d e r U n t e r we r f u n g “
(Nachlass, April–Juni 1885, 34[82], KSA 11, S. 445). Sein Wille zur Ordnung und zum
Frieden wirke jeder Unruhe, aber auch jeder Entwicklung entgegen. Diesen im Grunde
sklavischen Instinkt habe Kant „den ‚kategorischen Imperativ‘ getauft“ (Nachlass,
April–Juni 1885, 34[85], KSA 11, S. 447). Das „Chinesenthum“ Kants scheint somit eine
Metapher für seinen Willen zu einer friedlichen Ordnung, eine Metapher für seinen
Herdeninstinkt zu sein.66
Aber damit ist ihre Bedeutung noch nicht erschöpft. Das „Chinesentum“ wird von
Kant selbst in den Zusammenhang mit dem „ewigen Frieden“, aber auch in den
Zusammenhang mit dem Problem der Lüge gestellt. Letztere sei der Kern des Bösen
überhaupt. So steht am Ende von Kants Verkündigung des nahen Abschlusses eines
Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie:
Die Lüge (>vom Vater der Lügen, durch den alles Böse in die Welt gekommen ist<) ist der
eigentliche faule Fleck in der menschlichen Natur; so sehr auch zugleich der Ton der Wahrhaftigkeit (nach dem Beispiel mancher chinesischen Krämer [meine Hervorhebung – E.P.], die über ihre
und daran nicht zugrunde zu gehen. Friedrich Kaulbachs Ansicht, die Größe eines freien Geistes
bestehe Nietzsche zufolge darin, die Höhe zu erreichen, von der aus „er auf eigene frühere und
überwundene Stationen herab- und zurückblicken“ könne, kann ich dagegen nicht zustimmen (Kaulbach, Philosophie des Perspektivismus, I, S. 254). In diesem Fall wäre Nietzsches „freier Geist“ vom
hegelschen Geist kaum zu unterscheiden.
65 Vgl. AC 11, KSA 6, S. 177, und mehrere Stellen im Nachlass, z. B. Sommer–Herbst 1884, 26[96], KSA
11, S. 175; April–Juni 1885, 34[183], KSA 11, S. 483.
66 Ausführlicher zu Nietzsches Begriff des Chinesentums s. Adrian Hsia/Chiu-yee Cheung, Nietzsche’s
Reception of Chinese Culture, u. a. im Zusammenhang mit Kant (S. 304).
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
111
Laden die Aufschrift mit goldenen Buchstaben setzen: »Allhier betrügt man nicht«) vornehmlich in dem, was das Übersinnliche betrifft, der gewöhnliche Ton ist. — Das Gebot: du sollst
(und wenn es auch in der frömmsten Absicht wäre) nicht lügen, zum Grundsatz in die Philosophie als eine Weisheitslehre innigst aufgenommen, würde allein den ewigen Frieden [meine
Hervorhebung – E.P.] in ihr nicht nur bewirken, sondern auch in alle Zukunft sichern können.67
Es ist leider nicht nachweisbar, dass Nietzsche diese Stelle bekannt war. Da dies jedoch
die Schlussworte einer kleinen Abhandlung sind, kann man Nietzsches Kenntnis von
ihr nicht ausschließen. Auffällig ist zudem, dass Nietzsche, kurz nachdem er Kant in
Jenseits von Gut und Böse „de[n] grosse[n] Chinese[n]“ genannt hat, von einem moralischen „Kleinigkeitskrämer“ spricht, der die „unegoistische Moral“ erfand, „welche
sich unbedingt nimmt und an Jedermann wendet“ (JGB 221, KSA 5, S. 155 f.). Dass der
„Kleinigkeitskrämer“ und der „grosse Chinese“ in der Moral so nahe beieinanderstehen, bestätigt indirekt die Vermutung, dass Nietzsche Kants Versprechen, nicht mehr
zu lügen, in Anspielung auf die chinesischen Krämer – die gerade durch dieses Versprechen am besten betrügen können – bekannt war.68 Träfe das zu, wäre die Bezeichnung Kants als „Chinese von Königsberg“ ein ironischer Hinweis nicht bloß auf die aus
Nietzsches Sicht dem Chinesentum zukommende Unterwerfung unter eine gleichmachende Ordnung, sondern auch auf eine Umkehrung der klassischen Lügner-Paradoxie,
die sich in eine Tautologie verwandelt: Der Lügner versichert, dass er nicht lügt. Dieser
Lügner, dieser chinesische Krämer ist Kant selbst, der eine Formel „für ein Recht auf
L ü g e “ gefunden hat und daher zu den „grössten Hemmschuhe[n] der intellektuellen
Rechtschaffenheit Europa’s“ zu zählen ist (EH WA 2, KSA 6, S. 360). Dass diese Lüge
Kants gegen Ende der „Verkündigung“ seines Traktates Zum ewigen Frieden vorkommt,
stimmt mit der üblichen Deutung der Metapher des Chinesentums bei Nietzsche völlig
überein: Die Lüge dient dem Willen zum dauerhaften Frieden, zu den „Denk- und
Lebeweisen“ der „arbeitsame[n] Ameisen“, die „dem unruhigen und sich aufreibenden
Europa“ „Ruhe und Betrachtsamkeit“ bringen (M 206, KSA 3, S. 185).
Für die vorgelegte Deutung der Chinesen-Metapher bei Nietzsche im Bezug auf
Kants Erwähnung des chinesischen Krämers sprechen nur, wie bereits gesagt, indirekte Hinweise, die sich allerdings überzeugend aneinanderfügen lassen. Wenn es sich
jedoch um eine zufällige Übereinstimmung handelt, ist diese umso überraschender.
Kants Beispiel wird bei Nietzsche in eine gewagte Metapher verwandelt, die gegen Kant
selbst gerichtet ist. Kant selbst scheint dabei das Paradoxe seines Versprechens eines
jede Lüge ablehnenden Ansatzes, der den Frieden für immer versichern soll, nicht zu
67 Kant, Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie,
AA 8, S. 422.
68 Da diese Anspielung auf Kant nicht deutlich genug ist, liefert diese Stelle auch keinen direkten
Beweis. Im Übrigen spricht Nietzsche von der „Krämer-Philosophie“ v. a. im Zusammenhang mit
Herbert Spencer und dies nur im Nachlass (vgl. Nachlass, Herbst 1887, 9[44], KSA 12, S. 357; 10[118],
KSA 12, S. 525).
112
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
bemerken. Worin besteht nun nach Nietzsche diese Lüge des Lügners, der die Wahrheit
verspricht? Ein Gegenstück zur kantischen Beschreibung der Lüge als „der eigentliche
faule Fleck in der menschlichen Natur“ finden wir in Nietzsches Nachlass:
Der faule Fleck des Kantischen Kriticismus ist allmählich auch den gröberen Augen sichtbar
geworden: Kant hatte kein Recht mehr zu seiner Unterscheidung ‚Erscheinung‘ und ‚Ding an
sich‘ – er hatte sich selbst das Recht abgeschnitten, noch fernerhin in dieser alten üblichen Weise
zu unterscheiden, insofern er den Schluß von der Erscheinung auf eine Ursache der Erscheinung
als unerlaubt ablehnte – gemäß seiner Fassung des Causalitätsbegriffs und dessen rein-intraphänomenaler Gültigkeit […]. (Nachlass, Sommer 1886–Herbst 1887, 5[4], KSA 12, S. 185 f.)
Dieses Notat steht in unmittelbarer Nähe zu einer Passage, die auf die in der Morgenröthe erwähnte „vorwissenschaftliche Art der Philosophie“ anspielt:
Wir stellen ein Wort hin, wo unsere Unwissenheit anhebt, – wo wir nicht mehr weiter sehn
können, z. B. das Wort ‚ich‘, das Wort ‚thun‘, das Wort ‚leiden‘: das sind vielleicht Horizontlinien
unsrer Erkenntniß, aber keine ‚Wahrheiten‘. (Nachlass, Sommer 1886–Herbst 1887, 5[3], KSA 12,
S. 185)
Ebendies war die „erste und älteste Stufe der Speculation“, die „ihr Genüge“ „in
Begriffen“ „anstatt in Erklärungen“ fand. Mit seinem Begriff des „Dinges an sich“
kehrt Kant auf diese Stufe zurück.
Dennoch wies Kant, wie oben bereits angedeutet, in der Kritik der reinen Vernunft
darauf hin, dass die Begriffe der Philosophie nur Expositionen und Erläuterungen
und niemals endgültige Definitionen zulassen. Die durch solche Expositionen gezeichneten Horizontlinien sind damit keine „Wahrheiten“, denn durch eine Definition
nimmt keine Erkenntnis zu, d. h. kein „Wissen“ kann dadurch gewonnen werden. Dies
ist gerade eines der wichtigsten Ergebnisse der Kritik des dogmatischen Gebrauchs
der Vernunft gewesen, seine Aufklärung in dem Sinn, der auch Nietzsche nicht fern
war. Was meint Nietzsche dann mit dem „faulen Fleck“ des kantischen Kritizismus?
Vergessen wir nicht, dass Kant an der oben zitierten Stelle nicht bloß die Lüge in der
Philosophie, sondern den „Ton der Wahrhaftigkeit“ „vornehmlich in dem, was das
Übersinnliche betrifft“, mit dem Betrug der chinesischen Krämer verglich. Mit dem
„Ding an sich“, so Nietzsche, wurde ein Schritt zurück zu diesem „Ton“ gemacht.
Denn das „Ding an sich“ steht nicht für die Begriffe, die durch eine Exposition immer
wieder erläutert und aus dem jeweiligen Gebrauch verdeutlicht werden können, nicht
für die Horizontlinien, die immer beweglich bleiben, sondern für den Horizont aller
Horizonte, für die zwar prinzipiell unerreichbare, dennoch endgültige Erkenntnis. Das
„Ding an sich“ gehört so zum „Reich der Wahrheit und des Seins“. Obzwar „gerade
die Vernunft […] davon a u s g e s c h l o s s e n “ (GM III, 12, KSA 5, S. 364) ist, wird sie
gezwungen, dieses Reich im Namen der eigenen Aufrichtigkeit anzunehmen. Sie
zeigt, indem sie den Begriff des „Dings an sich“ und so auch „das Reich der Wahrheit“
annimmt, ihren Willen zur Unterwerfung, einer Unterwerfung unter etwas, was prinzipiell unbekannt bleibt.
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
113
Mehr noch: Die Unterscheidung zwischen Erscheinung und „Ding an sich“ stellt
den Begriff der Kausalität wieder her, nicht nur bzw. nicht in erster Linie in Hinsicht
auf die Erkenntnis, sondern in Hinblick auf das handelnde Subjekt. Nietzsche weist
auf den vorrangig moralischen Zweck dieses „Schleichwegs“ zum Begriff der Kausalität hin. Es ist der Weg zum Begriff der Freiheit, zur Kausalität aus Freiheit.
Die Denkbarkeit der Freiheit beruht auf der transcendentalen Ästhetik. Kommen Zeit und Raum
den Dingen als solchen zu, so sind die Erscheinungen gleich den Dingen an sich, so ist zwischen
beiden keine Erscheinung möglich, so giebt es nichts von der Zeit unabhängiges, so ist die
Freiheit schlechterdings unmöglich. […] Die Freiheit ist undenkbar in der Erscheinungswelt, es
sei die äußere oder die innere. (Nachlass, Ende 1886–Frühjahr 1887, 7[4], KSA 12, S. 269 f.)69
Dieses Notat erklärt eine andere Bemerkung zu Kant, die Nietzsche viel früher gemacht
und in der er die Vermutung geäußert hat, dass, „alle seine Sätze zugegeben, die volle
M ö g l i c h k e i t bestehen bleibt, daß die Welt so ist, wie sie uns erscheint“ (Nachlass,
Sommer 1872–Anfang 1873, 19[125], KSA 7, S. 459). Überflüssig zu sagen, dass dies kein
Schritt zurück zum dogmatischen Glauben an die objektive Wahrheit der Erkenntnis
ist. Gerade die Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich hat nach
Nietzsche die Rückkehr möglich gemacht.70 Wenn die Dinge so sind, wie sie uns
erscheinen, bedeutet das dagegen, dass es keine ‚objektive‘ Kausalität, weder äußere
noch innere, geben kann, keinen Gegensatz von Freiheit und Notwendigkeit. Denn
weder die Kausalität aus Freiheit, noch die Kausalität aus Natur ist in den Erscheinungen gegeben. Unsere Rede von Kausalität bringt bloß unsere Relation zu den Dingen
zum Ausdruck, sie gehört zu der „noch von Kant nicht gänzlich aufgegebene[n]
Mythologie“ (Nachlass, Juni–Juli 1885, 38[14], KSA 11, S. 615). Versuchsweise interpretiert Nietzsche später den „Causalitäts-Instinkt“ als unsere „F u r c h t v o r d e m U n g e w o h n t e n “ (Nachlass, Frühjahr 1888, 14[98], KSA 13, S. 276).
69 In diesem Zusammenhang scheint die These, dass Nietzsche seine Auffassung, Kants Moralphilosophie begründe sich aus der Unterscheidung des „Dings an sich“ und der Erscheinung, Schopenhauer zu verdanken habe (vgl. Bröse, Nietzsches Verhältnis zur antiken und modernen Aufklärung,
S. 237), nicht haltbar zu sein. Und das nicht nur, weil die zitierte Nachlassnotiz aus der Zeit stammt, in
der Schopenhauers Einfluss nicht mehr entscheidend war, sondern vor allem, weil Nietzsches Argumentation hier systematisch im Sinne Kants verläuft: Die Freiheit wäre ohne diese Unterscheidung
nicht möglich. Sie ist aber nicht ein „Ding an sich“, sondern ihre Denkbarkeit ist der entsprechenden
Unterscheidung zu verdanken. Schopenhauers Identifizierung des Willens mit einem „Ding an sich“
hat Nietzsche schon zur Zeit seiner Lange-Lektüre als für Kant irrelevant zurückgewiesen. S. dazu
Salaquarda, Nietzsche und Lange, S. 246.
70 Deswegen scheint der Schluss, Nietzsches Radikalität gelte in erster Linie der Moralphilosophie
und nicht seiner theoretischen Philosophie und Erkenntniskritik, voreilig zu sein (vgl. Margreiter,
Ontologischer Paradigmenwechsel, S. 120). Wie in der Einleitung schon angedeutet, ist es Nietzsches
prinzipielle Position, die Moral auch in der Erkenntnis als Kernproblem zu betrachten. Deshalb ist eine
solche Entgegensetzung kaum möglich.
114
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Die Unterscheidung der wahren Welt, die „unerreichbar, unbeweisbar, unversprechbar, aber schon als gedacht ein Trost, eine Verpflichtung, ein Imperativ“ ist (GD
Fabel, KSA 6, S. 80), und der scheinbaren Welt, die im Verhältnis dazu nur Täuschung
sein kann, ermöglichte das, was Nietzsche die theologische Hinterlist dieses „Chinesen von Königsberg“ nannte:
Ein Schleichweg zum alten Ideal stand offen, der Begriff ‚w a h r e Welt‘, der Begriff der Moral als
E s s e n z der Welt (— diese zwei bösartigsten Irrthümer, die es giebt!) waren jetzt wieder, Dank
einer verschmitzt-klugen Skepsis, wenn nicht beweisbar, so doch nicht mehr w i d e r l e g b a r …
Die Vernunft, das Recht der Vernunft reicht nicht so weit … (AC 10, KSA 6, S. 176)
Das Fragezeichen, Kants größtes Verdienst, diente von nun an als Weganzeiger zum
alten Ideal. Vom „Ding an sich“ führt Kants Weg zum „kategorischen Imperativ“ und
dann „wieder zu ‚Gott‘, ‚Seele‘, ‚Freiheit‘ und ‚Unsterblichkeit‘“, in den „Käfig“ also,
den „s e i n e Kraft und Klugheit“ „e r b r o c h e n hatte“ (FW 335, KSA 3, S. 562). Er nennt
diese Ideen „Wahrheiten der p r a k t i s c h e n Vernunft“ und krönt sie feierlich mit dem
alten biblischen Verbot der Lüge, das nun an den Philosophen gerichtet wird. Das
kantische Gebot „Du sollst nicht lügen“ erklärt Nietzsche ironisch „auf deutsch:
h ü t e n S i e s i c h , mein Herr Philosoph, die Wahrheit zu sagen…“. Eine „b e w u s s t e
Heuchelei“ wird bei Kant „alsbald zur U n s c h u l d “ (GD Streifzüge, 42, KSA 6, S. 144),
zum Glauben an eigene Wahrhaftigkeit.
Der alte „G l a u b e a n d i e G e g e n s ä t z e d e r W e r t h e “, „an dem sich die Metaphysiker aller Zeiten wieder erkennen lassen“, wie es am Anfang von Jenseits von Gut
und Böse heißt, die Überzeugung, dass die Wahrheit und das Gute einen „e i g e n e n
Ursprung“ haben müssen, „im Schoosse des Sein’s, im Unvergänglichen, im verborgenen Gotte, im ‚Ding an sich‘“, alle diese „typisch[en] Vorurtheil[e]“ (JGB 2, KSA
5, S. 16) werden durch die scheinbare Wahrhaftigkeit der Kritik, die das alte Ideal nur
als Fragezeichen übrig ließ, bestätigt und für die Vernunft selbst unerreichbar hoch
angesetzt. Das Fragezeichen selbst, als Unbegreiflichkeit des Wahren und des Guten
verstanden, verlangt Verehrung vonseiten der Vernunft. Dies ist „ein grosses Umsonst“ der kantischen Philosophie, „ein Umsonst für Etwas, das bereits da war, für
etwas U n w i e d e r b r i n g l i c h e s “ (AC 61, KSA 6, S. 251). Freilich gilt das „Umsonst“
nicht nur für die Philosophie Kants, sondern es ist das Umsonst von „alle[n] philosophischen Baumeister[n] in Europa“ von Platon an. Sie alle haben „umsonst
gebaut“, weil sie alle „unter der Verführung der Moral“, dieser „eigentliche[n] C i r c e
d e r P h i l o s o p h e n “, gebaut haben (M Vorrede 5, KSA 3, S. 13). Kant allerdings gehört
ein besonderer Platz unter ihnen. Denn in dem Moment, da der Sensualismus, „das
Beste vom vorigen Jahrhundert“ (Nachlass, April–Juni 1885, 34[116], KSA 11, S. 459),71
das „Umsonst“ des Platonismus zu überwinden versprach, in dem Moment, da die
71 Vgl. Nietzsches Charakterisierung der kantischen Kritik als „Gegengift gegen den übermächtigen
Sensualismus“ (JGB 11, KSA 5, S. 26).
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
115
redliche Skepsis in Hinsicht auf die moralisch-theologischen Werte in der Philosophie
die Oberhand zu gewinnen schien, kam Kant mit „seiner verhängnissvollen Antwort“
auf die Frage des Jahrhunderts: Das „Umsonst“ aller Metaphysik und der Philosophie
selbst sei der Tatsache verpflichtet, dass bisher „die Voraussetzung versäumt war, die
Prüfung des Fundamentes, eine Kritik der gesammten Vernunft“. Mit dieser Antwort,
so Nietzsche, lockte er „uns moderne Philosophen“ auf einen nicht „festeren und
weniger trüglichen Boden“, als es die bisherigen Grundlagen der Philosophie gewesen waren (M Vorrede 5, KSA 3, S. 13). Durch die Kritik des ganzen Vermögens der
Vernunft wurde das Vertrauen in ihr altes Ideal wiederhergestellt, durch die scheinbare Redlichkeit des kritischen Ansatzes wurde die Philosophie zurück zu ihrer „eigentlichen Circe“, zur Moral, gelockt. Dies ist das eigentliche Fazit der kantischen Kritik:
[…] eine unbeweisbare Welt anzusetzen, ein logisches ‚Jenseits‘, – dazu eben hatte er seine Kritik
der reinen Vernunft nöthig! Anders ausgedrückt: e r h ä t t e s i e n i c h t n ö t h i g g e h a b t , wenn
ihm nicht Eins wichtiger als Alles gewesen wäre, das ‚moralische Reich‘ unangreifbar, lieber
noch ungreifbar für die Vernunft zu machen, – er empfand eben die Angreifbarkeit einer moralischen Ordnung der Dinge von Seiten der Vernunft zu stark! (M Vorrede 3, KSA 3, S. 14)72
Die Vernunft selbst wird so am Ende gezwungen, das als „wahr“ anzunehmen, „was
dem Wunsche unseres Herzens entspricht“ (Nachlass, Ende 1886–Frühjahr 1887,
7[3], KSA 12, S. 254) – die rein intelligible Welt, die moralische Ordnung, das Reich
Gottes. Mit „einem Mehr von Vertrauen und Glauben“, „mit einem unbegreiflichen
und überlegenen ‚Ideal‘ (Gott)“ versucht Kant „die Lücke auszufüllen“, die seine
eigene Redlichkeit als Kritiker geschaffen hatte (Nachlass, Herbst 1885–Herbst 1886,
2[165], KSA 12, S. 147). So taufte er die Lüge der Jahrtausende nochmals zur „Wahrheit“ um und machte die Bemühungen um die Aufklärung zunichte. Mehr noch: Kant
setzte die Aufklärung selbst mit dieser Art von Kritik gleich. Im Unterschied zu denen,
die Nietzsche „moderne Philosophen“ nennt, die sich von dieser Art der Aufklärung
verführen lassen, und zu denen er auch sich selbst zu zählen scheint,73 müssen die
von ihm erwarteten „Philosophen der Zukunft“, die „das Werk der Aufklärung“ „an
sich selber“ „fortzusetzen“ haben, über die kantische Kritik hinausgehen. Sie müssen sich der Kritik und selbst der Kritiker als Werkzeuge bedienen, denn „die Kritiker
sind Werkzeuge der Philosophen, noch lange nicht selbst Philosophen“. Und „[a]uch
der grosse Chinese von Königsberg war nur ein grosser Kritiker“ (JGB 210, KSA 5,
S. 144).
72 Vgl. auch Nachlass, Herbst 1887, 9[160], KSA 12, S. 430.
73 Vgl. an der oben zitierten Stelle den Ausdruck „uns moderne Philosophen“ (M Vorrede 3, KSA 3,
S. 13).
116
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Der große Zirkel: „Vermöge eines Vermögens“
Im Aphorismus 11 in Jenseits von Gut und Böse bringt Nietzsche die kantische Kritik
auf eine Formel, die trotz des irritierenden ironisch-lockeren Tons, der im erheblichen
Kontrast zu Kants „Ton der Wahrhaftigkeit“ steht, von primärer Bedeutung für seine
Kant-Auslegung ist: „V e r m ö g e e i n e s V e r m ö g e n s “ (JGB 11, KSA 5, S. 24). Mit Hilfe
dieser Formel wird noch einmal auf schärfste Art und Weise ausgeführt, wie Kants
Kritik die Philosophie auf den trügerischen Boden der Metaphysik zurücklockte. Sie
sei zum Schlafmittel des intellektuellen Gewissens und zum größten Hindernis der
Aufklärung geworden, in deren Dienst sie sich angeblich gestellt hat. Schauen wir
genauer, was unter dieser Formel Nietzsches zu verstehen ist.
Der Aphorismus beginnt mit der Behauptung, dass Kant „vor Allem und zuerst
stolz auf seine Kategorientafel“ war, das „schwerste, was jemals zum Behufe der
Metaphysik unternommen werden konnte“. Tatsächlich spricht Kant im Vorwort zu
den Prolegomena nicht ohne einen gewissen Stolz von der Deduktion der Begriffe des
reinen Verstandes, v. a. des Begriffs der Kausalität, welchen Hume dem skeptischen
Zweifel unterworfen hatte, als von seinem größten Verdienst. Da ihm die Auflösung
dieses „Humischen Problems“ gelungen ist, und das „nicht blos in einem besondern
Falle, sondern in Absicht auf das ganze Vermögen der reinen Vernunft“, wurde es
möglich, die Metaphysik als System nach einem sicheren Plan auszuführen. Denn die
Möglichkeit der Metaphysik, schreibt Kant an gleicher Stelle, „bestehe“ „ganz und gar
daraus“, die Verknüpfungen der Dinge a priori denken zu können (Prolegomena,
AA 4, S. 260).
Die Beantwortung der berühmten Frage nach der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori sollte die Grundlage aller Erkenntnis, der Metaphysik als systematischer
Einheit aller Erkenntnisse, gewährleisten (KrV B 19 ff.). Die Möglichkeit der Erkenntnis
wurde somit mit der Legitimation synthetischer Urteile a priori gleichgesetzt. Diese
Gleichsetzung ist aus Nietzsches Perspektive als äußerst gewagte Unterstellung, ja als
unrechtmäßiger Sprung in der Argumentation in Frage zu stellen. In einem Notat
nennt Nietzsche diese Schlussfolgerung Kants „unbewusste[n] Dogmatismus“ (Nachlass, Ende 1886–Anfang 1887, KSA 12, S. 264). Was Kant will, so Nietzsche, ist „E r k e n n t n i ß d e r E r k e n n t n i ß “, wobei die Frage „Was ist Erkenntniß?“ noch nicht
gestellt wurde. Kant lasse die Möglichkeit nicht zu, es könne uns gerade hier, an der
Schwelle jeder kritischen Methode, schon etwas begegnen, was wir nicht kennen, was
also eine offene Frage bleiben müsste:
[…] was ist Erkenntiß? Wenn wir nicht w i s s e n , was Erkenntnis ist, können wir unmöglich die
Frage beantworten, ob es Erkenntniß giebt, geben kann, kann ich die Frage ‚was ist Erkenntniß‘
gar nicht vernünftigerweise stellen. Kant g l a u b t an die Thatsache der Erkenntniß […] Was ist
Erkenntniß? Er ‚weiß‘ es, das ist himmlisch! (Nachlass, Ende 1886–Anfang 1887, 7[4], KSA 12,
S. 264 f.)
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
117
Diese Sicherheit im Umgang mit der Erkenntnis, „die R e c h t m ä ß i g k e i t im Glauben
an die Erkenntniß“ als synthetisches Urteil, wurde stillschweigend „vorausgesetzt“
(Nachlass, Ende 1886–Anfang 1887, 7[4], KSA 12, S. 265).74 Das bedeutete, dass der
Charakter der Allgemeinheit der Erkenntnis von Anfang an zugeschrieben wurde,
denn synthetische Urteile bringen das Einzelne der Anschauung auf einen Begriff und
subsumieren es unter eine allgemeine Vorstellung. Dass gerade diese Prozedur
Erkenntnis sei, wurde nicht in Frage gestellt. Kant setzte sie als Tatsache der Erkenntnis, als unser Vermögen zur Erkenntnis aller Deduktion der Kritik voraus.75
Aus der Perspektive von Kants kritischer Philosophie scheint es unmöglich, die
Rechtmäßigkeit der Voraussetzung eines solchen Vermögens zu bezweifeln. Wenn
Nietzsche in dieser Voraussetzung den Willen zur Wahrheit entdeckt, dann unterstellt
er, dass auch sie Alternativen haben kann. Viel früher, in Ueber Wahrheit und Lüge im
aussermoralischen Sinne, „ein[em] geheim gehaltene[n] Schriftstück“ (MA II Vorrede, KSA 2, S. 370), hat Nietzsche versuchsweise eine solche Alternative angedeutet,
nämlich die synthetischen Urteile nicht als Erkenntnis, sondern als zufällige „willkürliche[…] Übertragungen“ der Affektionen, als die „Abbildung eines Nervenreizes“,
als lauter Metaphern zu betrachten (WL 1, KSA 1, S. 878 ff.), die eine reguläre Welt wie
ein „Columbarium der Begriffe“ (WL 2, KSA 1, S. 886) zustande bringen. Diese Welt ist
dennoch stets durch „furchtbare Mächte“ bedroht, denn nur „durch Vergesslichkeit“
kann der Intellekt, jenes „Mittel zur Erhaltung des Individuums“, „jener Meister der
Vorstellung“ sich einreden, „er besitze eine Wahrheit“ und die Wahrheit könne durch
ein Urteil, d. h. durch das „Gleichsetzen des Nicht-Gleichen“, erreicht werden (WL 1,
KSA 1, S. 876 ff.):
[N]ur dadurch, dass der Mensch sich als Subjekt und zwar als k ü n s t l e r i s c h s c h a f f e n d e s
Subjekt vergisst, lebt er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Consequenz; wenn er einen Augenblick
nur aus den Gefängniswänden dieses Glaubens heraus könnte, so wäre es sofort mit seinem
‚Selbstbewusstsein‘ vorbei. (WL 1, KSA 1, S. 883 f.)
Das „Selbstbewusstsein“ entstehe gerade im Prozess der Ausbildung von Begriffen
und Urteilen, von einem „Canon der Gewissheit“, der sich durch unendliche Wieder-
74 Bezeichnenderweise wird in der Kant-Forschung das Urteil als „Prisma“ aller möglichen Erkenntnisleistungen gesehen (s. Reinhard Brandt, Die Urteilstafel. Kritik der reinen Vernunft A 67–76; B 92–
101, S. 62). Die Frage nach der Vollständigkeit der Urteilstafel rückt immer wieder in den Vordergrund.
Dazu: Wolff, Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel; auch die klassisch gewordene Doktorarbeit
von Klaus Reich, Die Vollständigkeit der Urteilstafel. Zur Rolle dieser Frage in der Kant-Forschung s.
Hilmar Lorenz, Die Gegebenheit und Vollständigkeit a priori der Kantischen Urteilstafel.
75 Dies scheint richtig zu sein, auch wenn man von der Position Simons ausgeht, dass Nietzsches
Kritik an Kant deshalb nötig war, weil Kants kritischer Ansatz „im Zuge der Verwissenschaftlichung
des Wahrheitsbegriffs“ „unkritisch als Theorie der Begründung rein objektiven Wissens“ verstanden
und missverstanden wurde (Simon, Der Begriff der Aufklärung bei Kant und Nietzsche, S. 122). Denn die
Möglichkeit der Erkenntnis, wenn das Vermögen dazu auch kritisch behandelt wird, d. h. wenn es sich
auch nicht um rein objektives Wissen handelt, steht bei Kant nicht zur Debatte.
118
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
holungen bestätigt und zu einer „richtige[n] Perception“ erklärt wird, d. h. zu „e i n e m
n i c h t v o r h a n d e n e [n] Maassstabe“ des adäquaten Ausdrucks des Objekts im Urteilen des Subjekts (WL 1, KSA 1, S. 884).76 Die einzige Form, so Nietzsche, in der dem
Menschen die Wahrheit begegnet, ist die „Form der Tautologie“, die „leeren Hülsen“
der Logik (WL 1, KSA 1, S. 878). Sonst handelt es sich immer um ein bloß „ä s t h e t i s c h e s Verhalten“, um „eine andeutende Uebertragung, eine nachstammelnde Uebersetzung in eine ganz fremde Sprache“ (WL 1, KSA 1, S. 884).77
Mehrere Notate bezeugen, dass Nietzsche der Formulierung der zentralen Frage der
Kritik viel Aufmerksamkeit schenkte.78 Die Frage, ob die synthetischen Urteile a priori
möglich sind, stelle sich bei Kant nicht, nur wie sie möglich sind. Was wird damit
überhaupt hinterfragt? Für die Mathematik und die Naturwissenschaft ist diese Frage
nach Kant unnötig (KrV B 20), aber nicht im Fall der Metaphysik, die als Wissenschaft
gerade begründet werden soll. Die Metaphysik allein muss sich vor dem Gerichtshof der
Vernunft rechtfertigen und in ihrem Anspruch auf synthetische Urteile a priori legitimiert werden. Die Frage „Wie sind sie möglich?“ ist also die Frage nach der Legitimation, nach der Rechtfertigung und nach den Bedingungen der Möglichkeit dieser Rechtfertigung. Eine solche Legitimation wird als gelungen angesehen, wenn ein Prinzip
gefunden werden kann, das das Urteilen ermöglicht. Wo es aber an einem Prinzip fehlt,
so Nietzsche, setzt Kant ein „Vermögen“ an.79 Fehlt es z. B. an einem Prinzip, das die
zwei Prinzipien der theoretischen Erkenntnis und der praktischen Handlung vereinigen
kann, setzt Kant zwei Vermögen an: das Erkenntnis- und das Begehrensvermögen.
Die Antwort auf die berühmte Frage der Kritik fällt so nach Nietzsche tautologisch
aus: „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“:
‚Vermöge eines Vermögens‘ – hatte er gesagt, mindestens gemeint. Aber ist denn das – eine
Antwort? Eine Erklärung? Oder vielmehr nur eine Wiederholung der Frage? (JGB 11, KSA 5, S. 25)
76 Das „Selbstbewusstsein“ steht in Anführungszeichen, denn dieser Begriff gehört auch selbst zum
Kanon der Gewissheit. Nietzsche dagegen spricht meist von der „Bewusstheit“ und dem „Bewusstwerden“. Vgl. FW 11, KSA 3, S. 382 f.; FW 354, KSA 3, S. 590 ff. Vgl. „Der Wille zur Macht: B e w u ß t w e r d e n des Willens zum Leben…“ (Nachlass, Frühjahr 1888, 15[20], KSA 13, S. 418). Zu den Begriffen
„Bewusstsein“, „Selbstbewusstsein“, „Bewusstwerden“ s. van Tongeren u. a., (Hg.), Nietzsche-Wörterbuch, S. 334 ff.
77 Zur Frage nach dem „künstlerisch schaffenden Subjekt“, das das Willkürliche seiner Übertragungen vergisst und so zu seinem „Selbstbewusstsein“ gelangt, kehren wir am Ende dieses Kapitels
zurück. An dieser Stelle ist wichtig, dass die Deutung synthetischer Urteile als metaphorische Verstellungen dem Glauben an die Erkenntnis, d. h. an eine Voraussetzung der Rechtmäßigkeit der Verallgemeinerung im Urteil entgegengesetzt werden kann.
78 Vgl. Nachlass, Herbst 1884–Anfang 1885, 30[10], KSA 11, S. 356; Nachlass, April–Juni 1885, 34[60],
KSA 11, S. 439.
79 Vgl. die Beschreibung der „Kühnheit“ „vom alten Kant“, der es „liebte“, „[…] überall, wo ihm ein
Princip fehlte, ein ‚Vermögen‘ dafür im Menschen anzusetzen…“ (WA 7, KSA 6, S. 28); vgl.: „Und wo er
keine Erklärung findet, ein V e r m ö g e n anzusetzen!“ (Nachlass, Sommer–Herbst 1884, 26[461],
KSA 11, S. 273)
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
119
Das Vermögen ist ein Begriff, der als Antwort auf die am Anfang der Kritik gestellte
Frage und als letzte Legitimation aller ihm entspringenden Prinzipien angesetzt wird.
Doch ein Begriff ist keine Erklärung, noch weniger Erkenntnis. Aus einem Begriff
etwas zu erklären, heißt schon nach Kant eine analytische Aussage zu treffen, d. h.
eine Aussage ohne Zuwachs der Erkenntnis. Eine solche Erklärung soll wiederum
erklärt oder vielmehr in ihrem Willen zur Wahrheit, zur Endgültigkeit der Wahrheit
„aufgeklärt“ werden. Ein Begriff ist dagegen nach Nietzsche „eine Art E r s p a r n i ß
von wissenschaftlicher Arbeit“, „ein direkteres Zuleibegehn an die ‚Dinge‘ selber –
eine Abkürzung des Weges der Erkenntniß“, letztendlich ein metaphysischer Traum,
der „berauschte“, wie er sich in einem Entwurf zu demselben Aphorismus in Jenseits
von Gut und Böse notiert (April–Juni 1885, 34[185], KSA 11, S. 484). Diese Art der
Abkürzung missversteht sich selbst, wenn sie sich als Erkenntnis und besonders als
„Erkenntniß der Erkenntniß“ darstellt.80
Jedoch gilt Nietzsches Kritik an Kants Begriff der Erkenntnis nicht erst seiner
Antwort, sondern seiner Fragestellung. Die Suche nach einem legitimierenden allgemeinen Prinzip der Erkenntnis, die Frage „Wie ist es möglich?“, konnte nicht
anders als tautologisch beantwortet werden: Die synthetischen Urteile a priori müssen
möglich sein, wenn die mit ihnen gleichgesetzte Erkenntnis möglich sein soll; also
muss auch das Vermögen dazu gegeben sein. Der Zirkel in der Argumentation ist für
die Kritik, die die „Erkenntniß der Erkenntniß“ sein will, wenn auch im Sinne einer
bloß negativen Abgrenzung ihres Gebiets, grundlegend und unverzichtbar.81
„Vermöge eines besonderen Erkenntnißvermögens“, schreibt Kant tatsächlich am
Ende der Kritik der reinen Vernunft, macht jede reine Erkenntnis a priori „eine
besondere Einheit aus“, die allein zur Grundlage der Metaphysik als systematischer
Einheit jener Erkenntnis gemacht werden kann, welche Kant schon hier in die Metaphysik der Natur und die Metaphysik der Sitten einteilt. Letztere sollte dabei, wenn
nicht als Grundfeste, so zumindest als „Schutzwehr“ der Religion gedacht werden
(KrV A 845/B 873). So wird das Vermögen der Erkenntnis nicht bloß um der Erkennt-
80 Kant begründet diese Abkürzung letztendlich als Glauben, als subjektiv begründetes Fürwahrhalten, das zum Zweck der Kritik angenommen werden muss. Kaulbach zeigt in seiner umfassenden
Deutung von Kants Transzendentalphilosophie als eines wesentlich perspektivischen Projekts, dass
gerade die Umstellung der Frage vom „Was“ zum „Wie“ dem vernunftperspektivischen Entwurf entsprach. „Das ‚Vermögen‘ entfaltet sich in Handlungen der Vernunft“, in ihrer Wahl der Weltperspektive, wodurch der Erkennende ein Experiment „mit sich selbst und seinem perspektivischen Vermögen“
eingeht (Kaulbach, Philosophie des Perspektivismus, I, S. 19). Die Legitimation der Erkenntnis aus
„Vermögen“ ist so als wesentlich für die Weltperspektive der Kritik zu verstehen. Nietzsches Kritik wird
dadurch allerdings nicht entkräftet, denn die Begründung bleibt tautologisch und selbstbezüglich.
81 Nach Stegmaier (Nietzsches und Luhmanns Aufklärung der Aufklärung, S. 171 f.) kann eine zirkuläre
Bewegung nicht ohne Paradoxien ablaufen. Mit der tautologischen Antwort „Vermöge eines Vermögens“ wird eine scheinbare Entparadoxierung der Selbstbezüglichkeit der Vernunft bzw. „Paradoxieninvisibilisierung“ erreicht. Nietzsche deckt diese Unterscheidung als wiederum paradox auf und
zeigt damit, dass die Selbstvergewisserung nicht möglich sei.
120
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
nis willen vorausgesetzt, es bleibt auch nicht unbegründet. Das Vermögen zur allgemeinen Erkenntnis findet seine Rechtfertigung durch die Voraussetzung eines
neuen Vermögens, namentlich des moralischen. Denn „die letzte Absicht der weislich
uns versorgenden Natur, bei der Einrichtung unserer Vernunft, [ist] eigentlich nur
aufs Moralische gestellet“ (KrV A 801/B 829). Im Moralischen werden alle Dogmen der
Metaphysik als in praktischer Hinsicht konstitutiv wiederhergestellt. So „entdeckt“
Kant, wie Nietzsche es in demselben Aphorismus in Jenseits von Gut und Böse ausdrückt, noch ein „Vermögen“ „im Menschen hinzu“, zum „Jubel“ der Theologen und
den nachkommenden deutschen Philosophen, die im Grunde, so Nietzsche, auch
Theologen waren, die „jungen Theologen des Tübinger Stifts“. Nun stand der Weg
offen, weitere neue „Vermögen“ zu entdecken, z. B. das „der intellektuellen Anschauung“ bei Schelling, der damit „den herzlichsten Gelüsten“ der deutschen Philosophen
entgegenkam (JGB 11, KSA 5, S. 25). Eine antiaufklärerische, „vorwissenschaftliche Art
der Philosophie“, die „ihr Genüge“ „in Begriffen“ „anstatt in Erklärungen“ zu finden
glaubte, war so dank Kants tautologischer Begründung der Erkenntnis und der Moral
(genauer gesagt, vermöge seines Begriffs des „Vermögens“) wieder lebendig.
Kant selbst war sich, wie an der oben zitierten Wendung aus der Architektonik der
reinen Vernunft deutlich wird, der Tautologie völlig bewusst. Vor allem ist ihm nicht
verborgen geblieben, dass in der Begründung der Moral eine bestimmte Zirkularität
unvermeidlich ist. In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten schreibt er:
Es zeigt sich hier, man muß es frei gestehen, eine Art von Cirkel, aus dem, wie es scheint, nicht
heraus zu kommen ist. Wir nehmen uns in der Ordnung der wirkenden Ursachen als frei an, um
uns in der Ordnung der Zwecke unter sittlichen Gesetzen zu denken, und wir denken uns nachher
als diesen Gesetzen unterworfen, weil wir uns die Freiheit des Willens beigelegt haben […]. (GMS,
AA 4, S. 450)82
Auch in der Kritik der praktischen Vernunft kommt dies zum Ausdruck:
Freiheit und unbedingtes praktisches Gesetz weisen also wechselweise auf einander zurück.
(KpV, AA 5, S. 29)
Diesen Zirkel in der gegenseitigen Begründung der Freiheit und des moralischen
Gesetzes legitimiert Kant durch die Vorstellung, die auch „im gemeinsten Verstande
anzutreffen“ ist, nämlich durch die Unterscheidung zwischen Sinnen- und Verstandeswelt, zwischen Erscheinung und Ding an sich, und mithin zwischen dem empirisch erworbenen Begriff der „Beschaffenheit [des] Subjekts“ und dem, „was in ihm
reine Thätigkeit sein mag“, was als „zum Grunde Liegendes“ gedacht wird, „nämlich
82 Nur drei Kapitel zuvor weist Kant den Begriff der „ontologischen Vollkommenheit“ als Grundlage
der Moral zurück, mit der Begründung, dass durch diesen Begriff „ein […] unvermeidlich[er] Hang“
entstehe, „sich im Cirkel zu drehen“ (GMS, AA 4, S. 443). Er nimmt dennoch eine andere „Art von
Cirkel“ an.
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
121
sein Ich“ (GMS, AA 4, S. 451). So kommt Kant zum Schlüsselpunkt seiner Begründung
des besagten Zirkels, der zwischen der Freiheit und dem allgemeinen Gesetz entsteht:
Nun findet der Mensch in sich wirklich ein Vermögen, dadurch er sich von allen andern Dingen,
ja von sich selbst, so fern er durch Gegenstände afficirt wird, unterscheidet, und das ist die
Vernunft. (GMS, AA 4, S. 452)
Der Zirkel kann also nur dadurch legitimiert werden, dass all das wiederhergestellt
wird, woran vorher ein Fragezeichen gesetzt wurde: die Kausalität, die intelligible
Welt, das Ich. „Wirklich“ werden alle diese Dinge jedoch nur dadurch, dass man ein
besonderes Vermögen bei sich selbst voraussetzt – die Vernunft.83 Sie ist nicht bloß
ein Vermögen zur Erkenntnis der empirischen Welt, sondern auch ein Vermögen, sich
von der Naturwelt zu unterscheiden, ein Vermögen zur Freiheit von dieser Welt.
So wird der Zirkel der gegenseitigen Begründung der Freiheit und des moralischen Gesetzes, der Zirkel, den auch Kant durchaus nicht verkennt, von ihm in
einem anderen, größeren Zirkel aufgehoben, im Zirkel der gegenseitigen Begründung
der Moral und der Vernunft. Die Vernunft als Vermögen der Prinzipien soll als autonom angesehen werden, als „reine Tätigkeit“, als Freiheit von allem Empirischen.
Und die Freiheit von allem Empirischen wiederum bedeutet, dass die Vernunft,
sowohl im theoretischen als auch im praktischen Gebrauch, zur reinen Allgemeinheit
bzw. zur Erkenntnis und zur Moralität fähig ist. Dies ist die nicht mehr eigens
begründete Plausibilität der Kritik und gleichzeitig ihre Grenze: Wenn das Urteil von
aller „besonderen Beschaffenheit des Subjekts“ gereinigt wäre, so würde es „für
jedermann gültig“ sein, „so fern er nur Vernunft hat“ (KrV A 820/B 848); wenn der
Wille von allem Einfluss der Selbstsucht und von allen pathologischen heteronomen
Bestimmungen bereinigt wäre, so würde er als reine praktische Vernunft dem allgemeinen Gesetz allein gehorchen. Zwar muss nach Kant die Reinigung in concreto
problematisch bleiben, und Beispiele dafür können nicht angegeben werden, aber
ihre Denkmöglichkeit ist nicht zu bezweifeln, denn ein solcher Zweifel würde die
Vernunft, das Vermögen zur Vernunft, in Frage stellen.
Der logische Zirkel in der gegenseitigen Begründung der Moral aus Vernunft, der
mit einer tautologischen Formel „Vermöge eines Vermögens“ gekrönt und legitimiert
wird, verbirgt somit die wichtigste Plausibilität der Kritik: Nach der Reinigung von
allem Zufällig-Empirischen muss das Vernünftig-Allgemeine übrig bleiben – diese Annahme scheint so unmittelbar plausibel, dass sie zur Grenze der Kritik wird. Und „bis
zur Grenze der menschlichen Vernunft in Principien“ vorzudringen, ist „alles […], was
billigermaßen von einer Philosophie […] gefordert werden kann“ (GMS, AA 4, S. 463).
83 Vgl. Reinhard Brandt, Der Zirkel im dritten Abschnitt von Kants Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten. „Der Dualismus von Ding an sich und Erscheinung“ biete „den einzig möglichen Ausweg aus
dem Zirkel“, der Mensch solle sich nicht bloß als „Vernunftwesen“, sondern als „Doppelwesen“
verstehen. So wird der Dualismus zum „Organon der Deduktion“, wobei letztere „in einen neuen
Zirkel“ führen könne (S. 191).
122
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Die Grenze, die durch die Prinzipien gesetzt wird, ist aber gerade das Vermögen – das
Vermögen zur Vernunft und zur Moralität.
Genau hier greift Nietzsche Kant am schärfsten an. Denn es besteht nun auch die
Möglichkeit, dass, wenn wir alles Pathologisch-Empirische wegdenken, gar nichts
übrig bleibt, nichts, was „für jedermann gültig“ sein soll. Das Allgemeine eines Urteils,
auch eines kategorischen Imperativs, wird nur durch das Vergessen und das Verstellen des Individuellen denkbar, die Nietzsche versuchsweise zu Prinzipien des
menschlichen Intellekts erhebt. Sie sind jedoch keine Prinzipien im kantischen Sinn.
Denn sie geben keine allgemeine Regel an die Hand und ihre Legitimierung ist weder
möglich noch nötig. Und „selbst wenn festgestellt wäre, daß die Existenz des Menschen“ von ihnen abhängt, „ist über ihre ‚Wahrheit‘ nichts ausgemacht“ (Nachlass,
Sommer–Herbst 1884, 26[375], KSA 11, S. 250). Die Behauptung solcher Prinzipien ist
nur noch als Verdacht gegen andere Prinzipien der Erkenntnis möglich.
In einer unter mehreren Variationen und Vorbereitungen zu „Vermöge eines Vermögens“ in Jenseits von Gut und Böse kommt ein Notat mit der Überschrift „A n t i K a n t “ vor.
‚Vermögen, Instinkte, Vererbung, Gewohnheit‘ – wer mit solchen Worten etwas zu erklären
meint, muß heute bescheiden und übrigens schlecht geschult sein. (Nachlass, April–Juni 1885,
34[82], KSA 11, S. 445)
Danach geht es Nietzsche nicht darum, Vermögen zur Vernunft durch ein anderes
Wort, z. B. durch „Instinkt“, zu ersetzen bzw. neue Prinzipien anzugeben. Seine Begriffe dürfen keine „Erklärung“, kein Abbruch im Hinterfragen sein.84 Wer statt einer
Erklärung einen Begriff hinstellt, hat keinen Willen zur weiteren Erforschung der
undurchschaubaren Gründe dessen, was scheinbar bekannt ist. Diesen Gedanken
entwickelt Nietzsche besonders im Aphorismus „D e r U r s p r u n g u n se r e s B e g r i f f s
‚ E r k e n n t n i s s ‘ “ in der Fröhlichen Wissenschaft (FW 355, KSA 3, S. 593 ff.). Es sei ein
Missverständnis gewesen, die ‚Erkenntnis‘ als Zurückführung des Fremden auf Bekanntes festzulegen. Nicht nur weil dadurch das Fremde gerade in seiner Fremdheit
unbekannt bleiben muss, sondern v. a. weil gerade das, was Philosophen für das
Bekannte halten, am wenigsten erkannt sein könnte, z. B. die „innere Welt“ oder die
„Thatsachen des Bewusstseins“ oder das „Vermögen“ zur Vernunft. Dieses „NichtFremde“ zu erkennen, fällt dem Philosophen so schwer, dass sogar eine solche Fragestellung „fast etwas Widerspruchsvolles und Widersinniges“ zu sein scheint.85
84 Simon sieht Nietzsches Fortsetzung der kantischen Aufklärung gerade darin, dass Begriffe nicht
destruiert, sondern als eigene Begriffe, als ästhetisch bedingt, als mögliche „Vorurteile“ angesehen
werden (Simon, Der Begriff der Aufklärung bei Kant und Nietzsche, S. 116). Vgl. Stegmaier, Hegel,
Nietzsche und die Gegenwart, S. 314 ff.
85 S. die kontextuelle Interpretation des Aphorismus in: Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 289 ff.
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
123
Beim scheinbar Bekannten stehen zu bleiben, nennt Nietzsche die „Genügsamkeit
der Erkennenden“ (FW 355, KSA 3, S. 594). Wenn er aber sich selbst als „Erkennenden“ bezeichnet (FW 54, KSA 3, S. 417), will er seine neue Aufklärung über die
kantische „Aufklärung“ hinausführen und deren erste Plausibilitäten in Frage stellen.
Die Voraussetzung, dass die Erkenntnis etwas Allgemeingültiges sei, ist Kants erste
Plausibilität, die unvermeidlich in eine Tautologie führt. Um dieser Tautologie zu
entgehen, ersetzt Nietzsche die Frage nach der Möglichkeit der Erkenntnis bzw. nach
der Möglichkeit der synthetischen Urteile durch eine andere: „Warum ist der Glaube
an solche Urtheile n ö t h i g “? (JGB 11, KSA 5, S. 25) Statt ihrer Begründung rückt nun
ihre Entstehung aus einer Not heraus in den Mittelpunkt der Betrachtung. So Nietzsches Notat:
[D]ie Frage ist, w o h e r u n s e r G l a u b e an die Wahrheit solcher Behauptungen seine Gründe
nimmt? Nein, woher er seine Urtheile hat! Aber die E n t s t e h u n g e i n e s G l a u b e n s , einer starken
Überzeugung ist ein psychologisches Problem: und eine s e h r begrenzte und enge Erfahrung
bringt oft einen solchen Glauben zuwege. (Nachlass, Ende 1886–Frühjahr 1887, 7[4], KSA 12, S. 265)
Wenn die Annahme eines Vermögens zum Allgemeinen eine sehr persönliche, einzigartige Erfahrung, eine Not zum Ausdruck bringt, liefert sie keine Erklärung, noch
weniger eine Begründung. Sie ist vielmehr ein Mittel, den komplexen genealogischen
Prozess der Entstehung eines gewissen Glaubens zu verhüllen und den Willen zur
Erkenntnis „auf die erste und älteste Stufe der Speculation“ zurückzubringen – ein
gewisser „sensus assoupire“, wie Nietzsche es ironisch ausdrückt (JGB 11, KSA 5,
S. 26).
So beendet Nietzsche den Aphorismus in Jenseits von Gut und Böse zu „Vermöge
eines Vermögens“. Ein scheinbar zufälliges Beispiel wird am Ende zu einer bedeutungsvollen Metapher: Durch einen ironischen Vergleich mit einem Arzt aus einer
Komödie Molières, der die Wirkung des Opiums aus seiner einschläfernden Kraft
erklärte, wendet Nietzsche die von Kant schon benutzte Metapher des Schlafes gegen
ihn selbst. Dass Kant glaubte, aus dem „dogmatischen Schlummer“ geweckt worden
zu sein, war vielleicht ebenfalls ein Traum, so wie sein Versprechen, von nun an
durch die Wahrheit den ewigen Frieden in der Philosophie zu stiften, nur die letzte
List eines betrügerischen Krämers war, der seine Waren – seine Wahrheit – damit
besser zu verkaufen meinte. Wenn er auch selbst an diese Wahrheit glaubte, war sein
Glaube „ein psychologisches Problem“, das er als solches nicht erkannte. Denn die
Wahrheit der Kritik, die den ewigen Frieden sichern sollte, war nur die Wahrheit einer
Tautologie: Das Mögliche muss möglich sein; das Allgemeine ist der eigentliche
Zweck der Vernunft, die selbst das Vermögen zum Allgemeinen ist.86 Die Vernunft
86 Dies ist der eigentliche Einwand Nietzsches gegen Kant und nicht bloß die Entgegensetzung des
autonomen Individuums und des allgemeinen Gesetzes – eine Entgegensetzung, die als Kant-Kritik
nicht überzeugend wäre (vgl. z. B. Bailey, Nietzsche’s Engagements with Kant). Denn auch für Kant ist
das Individuelle in der Handlung nicht zu tilgen, auch nach Kant kann der kategorische Imperativ nur
124
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
muss entsprechend frei von allem Perspektivischen und, als Willensbestimmung, frei
von allem Empirischen gedacht werden. Das Vermögen zur Vernunft selbst darf dabei
niemals nach seiner Möglichkeit bzw. auf seine Legitimation hin befragt werden.
Denn die Antwort auf die so gestellte Frage scheint selbst die „fragwürdigste“ aller
Fragen zu sein: Vielleicht, wenn alles Einzigartige, Pathologisch-Besondere, Perspektivische weggedacht wird, verschwindet auch das Vermögen zur Verallgemeinerung? Weil
nämlich der Glaube an das Allgemeine als Vermögen zur Vernunft gerade das Persönlichste und (auch im negativen Sinne des Wortes) das Pathologischste ist? Auch
wenn bewiesen werden könnte, dass das Allgemeine die tiefste Not der menschlichen
Existenz ausmacht, auch wenn unsere Vernunft „rastlos das Unbedingt-Nothwendige“ sucht, kann es ein Fehler sein, wenn sie am Ende „sich genöthigt“ sieht, „es
anzunehmen, ohne irgend ein Mittel, es sich begreiflich zu machen“ (GMS, AA 4,
S. 463). Denn nichts spricht dafür, dass das für Menschen Notwendige notwendig
wahr sein muss. Das Ernötigte kann genauso gut ein Irrtum sein – ein Irrtum, der zum
Leben nötigt.
In Der Antichrist sagt Nietzsche noch „ein Wort“ „gegen Kant als M o r a l i s t [ e n ] “:
[E]ine Tugend bloss aus einem Respekts-Gefühle vor dem Begriff ‚Tugend‘, wie Kant es wollte, ist
schädlich. Die ‚Tugend‘, die ‚Pflicht‘, das ‚Gute an sich‘, das Gute mit dem Charakter der
Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit — Hirngespinnste, in denen sich der Niedergang, die
letzte Entkräftung des Lebens, das Königsberger Chinesenthum ausdrückt. […] Was zerstört
schneller als ohne innere Nothwendigkeit, ohne eine tief persönliche Wahl, ohne L u s t arbeiten,
denken, fühlen? als Automat der ‚Pflicht‘? Es ist geradezu das R e c e p t zur décadence, selbst zum
Idiotismus … Kant wurde Idiot. (AC 11, KSA 6, S. 177)
Die Charakterisierung Kants als Idiot müssen wir festhalten, sie wird uns im fünften
Kapitel zu Nietzsches Deutung von dem von Tolstoi und Dostojewski entworfenen
„Typus des Erlösers“ nochmals beschäftigen. In einem Notat aus ungefähr derselben
Zeit wie die oben zitierte Passage aus Der Antichrist kommt Nietzsche auf die These von
Kants „p s y c h o l o g i s c h e [ m ] I d i o t i s m u s “ im Zusammenhang mit seiner Behauptung, ein gewissenhafter Ketzerrichter sei undenkbar, zurück (Nachlass, Ende 1886–
Frühjahr 1887, 7[4], KSA 12, S. 268). Diese Aussage aus Kants Religionsschrift bleibt
tatsächlich, wie im vorigen Kapitel ausgeführt wurde, für die bloß formale Bestimmung des Gewissens als sich selbst richtende Urteilskraft problematisch. Die Bezeichnung „Idiotismus“ in diesem Zusammenhang deutet an, dass eine moralisch-normative Perspektive nicht bloß bevorzugt, sondern als einzig mögliche angesehen wird.87
bis zu einem gewissen Grad bei konkreten Handlungen angewandt werden. Gerade dass Kants Ethik
nicht bis zur Handlung reichte und Grade der Moralität zu unterscheiden wusste, wurde von Nietzsche
als Kants großes Verdienst verstanden. Doch der Maßstab der Allgemeinheit, auch als nur gedachter,
war für ihn nicht plausibel.
87 Vgl. RGV, AA 6, S. 186. Ähnlich liest sich eine Passage in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,
in der Kant selbst dem „ärgsten Bösewicht“ unterstellt, er würde, lege man ihm Beispiele der Tugend
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
125
Es ist diese Unfähigkeit, eine andere Perspektive außer der Perspektive der
eigenen Ansprüche und Nöte zu vermuten, die Nietzsche als Idiotismus brandmarkt.
Zwar hatte schon Kant das Nicht-Bemerken der ästhetischen Beschränktheit eigenen
Fürwahrhaltens als Quelle allen Irrtums erkannt, dennoch wurde diese Einsicht nicht
auf das Fundament der Kritik, nicht auf den Willen zur Verallgemeinerung selbst
angewandt. Im Gegenteil: Dieser Wille wurde als mit der Vernunft selbst identisch zur
alternativlosen Voraussetzung der Kritik. Die Not zur Verallgemeinerung, die sich für
die einzig legitime hält und ihre Quelle in der „besonderen Beschaffenheit“ des
eigenen Subjekts leugnet, kann dennoch, so Nietzsche, zur Not des Lebens, zur Gefahr
für das Leben werden. Denn durch die Tautologie der zirkulären Selbstbegründung,
durch den großen Zirkel der Moral aus Vernunft, erweist sich der Wille zur Verallgemeinerung letztlich als Unvermögen, und zwar in mehrfachem Sinn: als Unvermögen, die Erkenntnis anders als in allgemeinen Urteilen und festgelegten Begriffen
zu denken; als Unvermögen, Tugend anders als durch den Begriff der „Tugend“ und
somit nur allgemein-formal zu verstehen; und schließlich als Unvermögen, die Philosophie selbst in anderer Weise als Kritik „zum Behufe“ der Legitimation einer
Selbstbegründung zu betreiben. Die Tautologie der kantischen Zirkelbewegung führt
so zum unabweisbaren Skeptizismus in der Erkenntnis, zum äußersten Pessimismus
in der Moral und zur Dekadenz in der Philosophie. Indem er über die ersten Plausibilitäten dieses Zirkels aufklärt, will Nietzsche dieses Unvermögen der Moral aus Vernunft, das Unvermögen zum Perspektivenwechsel in der Philosophie, überwinden
und ihr so neue Horizonte eröffnen, Horizonte jenseits der Kritik.
Die Metapher der Schifffahrt
Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreiset, und jeden Teil davon
sorgfältig in Augenschein genommen, sondern es auch durchmessen, und jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt. (KrV A 235/B 294)
Dies ist der ebenso berühmte wie für Kant ungewöhnlich metaphorische Anfang des
Schlusskapitels der Transzendentalen Analytik zur „Unterscheidung aller Gegenstände in Phaenomena und Noumena“.88 „Das Land der Wahrheit“ sollte danach, in der
vor, mit Sicherheit wünschen, „daß er auch so gesinnt sein möchte“ (GMS, AA 4, S. 454). Auch hier
scheint nur eine Perspektive auf die Situation bzw. nur eine Deutung des Moralischen als möglich
zugelassen zu sein.
88 Zur Land- und Meer-Metaphorik bei Kant s. Алексей В. Горин (Alexej W. Gorin), Философия
в темных лучах метафоры. „Океан метафизики“, „страна истины“ и горизонты
трансцендентальной философии Канта (Die Philosophie in den dunklen Strahlen der Metapher. Der
„Ozean der Metaphysik“ und das „Land der Wahrheit“ und die Horizonte der Transzendentalphilosophie
Kants).
126
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Transzendentalen Dialektik, verlassen werden. Man sollte sich auf das „Meer“, auf den
„weiten und stürmischen Ozeane“ wagen, um zu bestätigen, dass „es sonst überall
keinen Boden gibt, auf dem wir uns anbauen könnten“, nur die Nebelbänke des
Scheins, wo
manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt, und indem es den auf Entdeckungen
herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer
verflechtet, von denen er niemals ablassen, und sie doch auch niemals zu Ende bringen kann
(KrV A 236/B 295).
Diese Fahrt ist allerdings notwendig, um herauszufinden und zu beglaubigen, „unter
welchem Titel wir denn selbst dieses Land besitzen, und uns wider alle feindselige
Ansprüche gesichert halten können“ (KrV A 236/B 295). Durch das Wagnis der Ausfahrt auf den stürmischen Ozean der Dialektik werden sowohl die übersinnlichen
Anmaßungen der Metaphysik als auch die feindseligen Ansprüche des Skeptizismus
zurückgewiesen und die höchste Sanktion auf den Besitz des Landes der Wahrheit
erworben, die Sanktion der mit sich selbst versöhnten Vernunft. Die SchifffahrtsMetaphorik geht an dieser Stelle in die Bau- und Jurisprudenz-Metaphorik über,
verliert sich jedoch nicht ganz, denn das Fundament des grandiosen Baus der Transzendentalphilosophie wird auf dem „Land der Wahrheit“, mitten im stürmischen
Ozean, errichtet, und die Ansprüche auf dieses Land können nur durch die Überprüfung seiner „Grenzen“ gesichert werden.
Halten wir die wichtigsten Merkmale dieser Metapher fest. Zwar soll man das
Land des Verstandes verlassen, diese verwegene Reise zielt jedoch von Anfang an auf
Rückkehr. Denn Kant verspricht schon vor der Fahrt, dass es kein anderes Land gibt
und geben kann. Doch auch wenn die Suche nach einem anderen festen Boden
vergeblich ist, sei diese Reise nicht zwecklos, sondern für den Erkennenden unumgänglich. Sonst könnte er niemals seiner Rechte auf das einzig gegebene Land
sicher sein.
Die kantische Schifffahrts-Metaphorik nimmt Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft im Aphorismus „I m H o r i z o n t d e s U n e n d l i c h e n “ wieder auf:
Wir haben das Land verlassen und sind zu Schiff gegangen! Wir haben die Brücke hinter uns, –
mehr noch, wir haben das Land hinter uns abgebrochen! Nun, Schifflein! sieh’ dich vor! Neben
dir liegt der Ocean, es ist wahr, er brüllt nicht immer, und mitunter liegt er da, wie Seide und Gold
und Träumerei der Güte. Aber es kommen Stunden, wo du erkennen wirst, dass er unendlich ist
und dass es nichts Furchtbareres giebt, als Unendlichkeit. Oh des armen Vogels, der sich frei
gefühlt hat und nun an die Wände dieses Käfigs stösst! Wehe, wenn das Land-Heimweh dich
befällt, als ob dort mehr F r e i h e i t gewesen wäre, – und es giebt kein ‚Land‘ mehr! (FW 124,
KSA 3, S. 480)
Das Land wird am Ende des Aphorismus zum „Land“ in Anführungszeichen. Was
einst unter „Land“ verstanden wurde, ist kein Land mehr. Die Rückkehr ist unmöglich, denn den stürmischen Ozean kann man nicht durchqueren, die Reise wird
unendlich lange dauern, und der Besitz des Landes kann nie gesichert, nie gerecht-
2.1 Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts einer Moral aus Vernunft
127
fertigt werden. Nietzsche folgt so Kants Metaphorik, fügt ihr aber noch eine weitere
Metapher hinzu, die eines Vogels, der, von „Land-Heimweh“ ergriffen, an die Wände
seines Käfigs stößt und sich einredet, „dort“, auf jenem Land, sei mehr Freiheit
gewesen. Die letztere Metapher ist besonders auffallend, weil der Käfig bzw. die
Sehnsucht nach der angeblich verlorenen Freiheit paradoxerweise gerade durch das
Wagnis des Unendlichen entstehen. Der Vogel scheint auf dem Schiff wie in einem
Käfig eingesperrt zu sein, er ist nicht frei, glaubt sogar vor der Reise freier gewesen zu
sein. Aber es gibt für ihn kein Zurück. Darüber hinaus sei noch daran erinnert, dass
Kant in einem Notat aus ungefähr derselben Zeit „Vogelscheuche“ genannt (Nachlass,
Sommer–Herbst 1884, 26[417], KSA 11, S. 263) und in der Fröhlichen Wissenschaft mit
einem Fuchs verglichen wird,
der sich in seinen Käfig zurückverirrte, – und s e i n e Kraft und Klugheit war es gewesen, welche
diesen Käfig e r b r o c h e n hatte! (FW 335, KSA 3, S. 562)
Eine „Übersetzung“ aus der metaphorischen in eine begriffliche Sprache ist nie ganz
korrekt, denn Metaphern und Gleichnisse werden in der Philosophie benutzt, um das
zu verdeutlichen, was durch Begriffe nicht erfasst werden kann.89 Dennoch zeigt sich
an diesem metaphorischen „Streit“ sehr deutlich, was Nietzsche über Kant hinaus
erreichen will. Kant sah sich genötigt, eine Metapher zu benutzen, und dies trotz
seiner generellen Ablehnung überflüssiger Metaphern in einem philosophischen
Werk.90 Hier musste die Metapher also das zum Ausdruck bringen, was sonst nicht
klarzumachen war. Um es mit Kant zu sagen: die Metapher sollte da überreden, wo die
Begriffe nicht überzeugen konnten. Eben darauf weist Nietzsche hin.91
Es bleibt tatsächlich unklar, warum das Recht auf den Besitz des „Landes der
Wahrheit“ durch die Ausfahrt auf den unendlichen Ozean der Dialektik bestätigt
werden soll, wo, wie im Voraus gesagt wird, kein Land, ja keine Wahrheit zu finden
ist. Wir wissen, dass es letztendlich um das Moralische geht, die Legitimität dieses
Schrittes der Kritik wird hier vorausgesetzt. Auf diese unausgesprochene Plausibilität
der Kritik zielt Nietzsche mit seiner metaphorischen Antwort: Der Seefahrer Kants ist
kein tapferer Entdecker, dessen Hand fest am Steuer liegt, sondern ein armer Vogel,
der sich vor der Unendlichkeit fürchtet und doch keine Kraft hat, das Schifflein zu
verlassen. Denn wer vom Land-Heimweh erfasst wird, wer die sichere Wahrheit sucht
und glaubt, sie müsste ihm garantiert werden, wird auch im Horizont des Unend-
89 Vgl. das Konzept der „absoluten Metapher“ bei Blumenberg (Paradigmen zu einer Metaphorologie,
S. 10–13). Zu diesem Begriff und seiner historisch-philosophischen Vorgeschichte, u. a. bei Kant und
Nietzsche, s. Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 19 ff.
90 Vgl. Recensionen zu J.G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, AA 8, S. 60 f.
91 Zu dieser Metapher in der Fröhlichen Wissenschaft s. Henning Hufnagel, „Nun, Schifflein! Sieh’ dich
vor!“ – Meerfahrt mit Nietzsche. Zu einem Motiv der Fröhlichen Wissenschaft. Der Aufsatz bietet eine
aufschlussreiche Analyse der Metapher bei Nietzsche. Zwar wird der historische Kontext dieses
„Topos“ angesprochen, der Zusammenhang mit Kant kommt dabei aber nicht vor.
128
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
lichen nur einen Käfig finden, d. h. weniger Freiheit als zuvor. Das Wagnis selbst wird
ihm zum Käfig. Und nur die Furcht redet ihm ein, die Rückkehr sei immer noch
möglich.
Damit ist eine, um mit Nietzsche zu sprechen, wichtige „Umdrehung“ gemacht,
nicht weniger bedeutsam als die Umdrehung der Frage nach der Kausalität, die Nietzsche als Kants größte „Errungenschaft“ würdigte. Es gibt kein „Land der Wahrheit“,
und wenn man sich ins Unendliche vorwagt, lässt man nicht nur die Brücke der
Erkenntnis, sondern auch jede Hoffnung auf festen Boden hinter sich. Das Recht auf
dieses Land, das Kant als „durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen“ bezeichnete, kann nicht erhalten werden. Der garantierte Landbesitz war
nur ein Traum. Der Weg des Zweifels an der Wahrheit führt nicht zum alten Ideal der
Erkenntnis zurück. Dennoch ist das Abenteuer, von dem der Seefahrer Kants „niemals
ablassen, und [das er] doch auch niemals zu Ende bringen kann“, unvermeidlich,
und, was noch wichtiger ist, es ist das Ziel selbst. Für den Erkennenden gibt es, so
Nietzsche, keine Odyssee, keine Heimat, kein Recht auf das glückliche Ende der Reise
im eigenen Land.92 Es gibt für ihn keine Hoffnung, das Ziel zu erreichen und die Reise
zu beenden. Man „leidet an einer solchen Richtung seines Urtheils wie an einer
Seekrankheit“. Und
[…] es giebt in der That hundert gute Gründe dafür, dass Jeder von ihm fernbleibt, der es – k a n n !
Andrerseits: ist man einmal mit seinem Schiffe hierhin verschlagen, nun! wohlan! jetzt tüchtig
die Zähne zusammengebissen! die Augen aufgemacht! die Hand fest am Steuer! – wir fahren
geradewegs über die Moral w e g , wir erdrücken, wir zermalmen vielleicht dabei unsren eignen
Rest Moralität, indem wir dorthin unsre Fahrt machen und wagen, — aber was liegt an u n s !
(JGB 23, KSA 5, S. 38 f.)
Der Erkennende muss selbst seinen Wunsch nach Heimkehr überwinden. Um das zu
betonen, überbietet Nietzsche Kants Metapher der Seefahrt durch die neue Metapher
eines „Luft-Schifffahrers des Geistes“.
W i r L u f t - S c h i f f f a h r e r d e s G e i s t e s ! – Alle diese kühnen Vögel, die in’s Weite, Weiteste
hinausfliegen, – gewiss! irgendwo werden sie nicht mehr weiter können und sich auf einen Mast
oder eine kärgliche Klippe niederhocken – und noch dazu so dankbar für diese erbärmliche
Unterkunft! Aber wer dürfte daraus schliessen, dass es vor ihnen k e i n e ungeheuere freie Bahn
mehr gebe, dass sie so weit geflogen sind, als man fliegen k ö n n e ! Alle unsere grossen Lehrmeister und Vorläufer sind endlich stehen geblieben, und es ist nicht die edelste und anmuthigste Gebärde, mit der die Müdigkeit stehen bleibt: auch mir und dir wird es so ergehen! Was geht
das aber mich und dich an! A n d e r e V ö g e l w e r d e n w e i t e r f l i e g e n ! (M 575, KSA 3, S. 331)
92 Vgl. hiermit den Aphorismus „W i r H e i m a t l o s e n“ aus dem fünften Buch der Fröhlichen Wissenschaft (FW 377, KSA 3, S. 628 ff.). Die Heimatlosigkeit der Philosophen macht sie nach Nietzsche zu
„Kinder[n] der Zukunft“.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
129
Eine neue Dimension der Erkenntnis wird erobert, über alle großen Lehrmeister und
Vorläufer hinweg, allerdings im Bewusstsein, dass auch diese Herausforderung eine
Überforderung sein kann.
Die Metapher der Seefahrt bei Nietzsche sollte so noch einmal darauf hinweisen,
dass die Erkenntnis in seinem Sinn keine Abgrenzung des sicheren und verfügbaren
Gebiets, keine Versicherung des ewigen Friedens, keine Selbstbegründung sein kann,
sie ist im Gegenteil als Aufklärung des Willens zur Gewissheit, als Offenheit gegen das
Unbekannte, als furchtloser Blick in das Ungewisse zu verstehen. Eine solche Aufklärung könnte niemals ein Ende des Hinterfragens versprechen. Im Unterschied zu
seinen früheren Schriften Menschliches, Allzumenschliches und Morgenröthe verwendet Nietzsche in seinen späteren Werken das Wort „Aufklärung“ immer seltener.93 Es
implizierte für ihn wohl einen zu naiven Optimismus, der verspricht, alle „Vorurteile“
und „Irrtümer“ zu beseitigen und über alle Ungewissheiten aufzuklären. Wenn dagegen die Falschheit eines Urteils noch lange „kein Einwand gegen ein Urtheil“ ist
(JGB 4, KSA 5, S. 18), verliert die Metapher der Aufklärung ihre Überzeugungskraft.94
Statt von der Aufklärung spricht der spätere Nietzsche vom europäischen Erbe, von
den „reichen, überhäuften, aber auch überreich verpflichteten Erben von Jahrtausenden des europäischen Geistes“ (FW 377, KSA 3, S. 631). Die Aufklärung wird so selbst
nur zu einer Welle in der großen Flut, auf die der Erkennende sich einlassen muss,
ohne dabei ein Endziel oder eine Heimat denken zu können.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
Die Frage nach dem Wert
Die Moral aus Vernunft erwies sich bei Kant als Tautologie der Selbstlegitimation, als
eine in Paradoxien verlaufende Zirkelbewegung. Diese Paradoxien, wie z. B. die
Paradoxie der Freiheit zum Bösen, verweisen unmissverständlich auf das, was Nietzsche das „alte Ideal“ nennt, das asketische Ideal der abendländisch-christlichen
Moral, die zur eigentlichen „Circe“ der Philosophen geworden ist. „Sie weiss zu
‚begeistern‘“ und oft gelingt es ihr „mit einem einzigen Blick, den kritischen Willen zu
lähmen“ und sogar „ihn gegen sich selbst zu kehren“, wodurch sie sich „kritische
93 Von Herbst 1886 an verschwindet das Wort „Aufklärung“ aus Veröffentlichungen und Notaten. Nur
einmal wird es ironisch in Bezug auf einen „aufgeklärte[n] Wagnerianer“ verwendet (FW 368, KSA 3,
S. 618). Erst in Ecce homo wird Nietzsche sein Verdienst wieder als Aufklärung – über das Ressentiment
und über das Christentum – bezeichnen (EH weise 6, KSA 6, S. 272; EH Schicksal 8, KSA 6, S. 373).
94 Dies widerspricht nicht der These von Hödl, dass Nietzsche einem lebenslangen Projekt der
Aufklärung anhing, nämlich der Aufklärung dessen, „was ich für einer bin“, die schließlich in die
konstruierte Selbstbeschreibung in Ecce homo mündet (Hans Gerald Hödl, Nietzsches lebenslanges
Projekt der Aufklärung, S. 191).
130
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Hände und Folterwerkzeuge vom Leibe“ hält (M Vorrede 3, KSA 3, S. 13). Die Moral
wird von der Vernunft fraglos als höchster Wert angenommen. So ist es kein Wunder,
dass der Erkennende, der unter dem Zauber der Moral steht, nach dem langen Umweg
der Kritik zum moralischen Ideal zurückkommt, um ihm seinen kritischen Willen zu
unterwerfen. Was verleiht der Moral diese magische Kraft und erschwert die Aufgabe,
die Nietzsche als die seinige versteht, so sehr, dass es noch keinen gegeben habe, der
die Moral selbst auf ihren Wert hin befragt hätte?95 Die Antwort sollte nicht nur die
ersten Plausibilitäten der Moral aus Vernunft, sondern auch die Alternativen ihres
paradoxen Zirkels sichtbar machen.
Die Frage nach dem Wert der Moral kann allerdings wieder leicht zu einer bloßen
Tautologie werden, wenn sie zur Frage nach ihrer Nützlichkeit oder wiederum zur
Frage nach ihrem moralischen Wert wird. Man könnte tatsächlich vermuten, dass
Nietzsche gerade auf die Nützlichkeit der Moral anspielt und sie nach ihrem Wert für
die Bedürfnisse der Menschen hinterfragen will. Das wäre aber nichts Neues. Schon
bei den von Nietzsche häufig kritisierten „mittelmässige[n] Engländer[n]“ (JGB 253,
KSA 5, S. 196) ist der Wert der Moral in diesem Sinn hinterfragt und die Moral als
unergründliches Faktum, das angeblich durch keinen Nutzen aufgeklärt werden
kann, entzaubert worden.96 Nietzsche war aber weit davon entfernt, sich dieser
Richtung der Kritik anzuschließen. Denn sie ließ sich von demselben Gegensatz
leiten, der durch die Moral begründet wurde: Selbstlosigkeit – Eigennützigkeit. Das
Problem der Moral wäre mit der Feststellung ihrer Nützlichkeit nicht gelöst. Um es
neu zu stellen, bräuchte man eine andere Perspektive als die der (Anti‑)Moralisten. Ihr
Fluchtpunkt musste „jenseits von Gut und Böse“ liegen. Nietzsche sucht nach einer
Perspektive, die ihm erlauben würde, die Frage nach dem Wert der Moral sinnvoll zu
stellen, ohne den Anspruch zu erheben, man wüsste schon, was die Moral eigentlich
sei. Das wäre die Perspektive des Lebens.
Wie vieldeutig und komplex Nietzsches Begriff des Lebens ist, muss an dieser
Stelle nicht ausgeführt werden.97 Das Leben ist zu Nietzsches „starken Gegen-Begrif-
95 „Ich sehe Niemanden, der eine K r i t i k der moralischen Werthurtheile gewagt hätte; ich vermisse
hierfür selbst die Versuche der wissenschaftlichen Neugierde, der verwöhnten versucherischen Psychologen- und Historiker-Einbildungskraft, welche leicht ein Problem vorwegnimmt und im Fluge
erhascht, ohne recht zu wissen, was da erhascht ist“ (FW 345, KSA 3, S. 578). Vgl. ferner: „Man sieht: es
ist n i e m a l s die Kritik an das Ideal selbst gerückt, sondern nur an das Problem, woher der Widerspruch gegen dasselbe kommt, warum es noch nicht erreicht oder warum es nicht nachweisbar im
Kleinen und Großen ist“ (Nachlass, Herbst 1885–Herbst 1886, 2[165], KSA 12, S. 148).
96 Nietzsches Kritik an John Stuart Mill und Herbert Spencer kann hier nicht näher erörtert werden. S.
dazu z. B. Karl Brose, Nietzsches Verhältnis zu John Stuart Mill. Eine geisteswissenschaftliche Studie.
Brose argumentiert, dass Nietzsches Kritik an Mill dessen Gedanken nicht treffe. In Wirklichkeit stehe
Nietzsche viel näher bei Mill, als er selbst dachte (S. 173). Doch fällt Broses Auslegung von Nietzsches
Nützlichkeits-Moralitäts-Dilemma m. E. viel zu kurz aus (vgl. S. 169).
97 Ich verweise auf die Auseinandersetzung mit Nietzsches Begriff des Lebens bei Wilhelm Dilthey,
der in einem Nachlass-Fragment die „Interpretation der Welt aus ihr selbst“ „zum Stichwort aller freien
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
131
fe[n]“ zu rechnen, deren „L e u c h t k r a f t “ er, wie er selber in einem Notat schrieb,
„nöthig“ hatte, „um in jenen Abgrund von Leichtfertigkeit und Lüge hinabzuleuchten,
der bisher Moral hieß“ (Nachlass, Oktober 1888, 23[3], KSA 13, S. 603). Die GegenBegriffe geben keine Erklärung, sondern machen scheinbar endgültige Erklärungen
„in Begriffen“ fragwürdig, z. B. den Begriff der Vernunft.98 Nietzsche sucht darum
seinen Begriff des Lebens von der kantischen, aber auch der hegelschen Gleichsetzung
mit der Vernunft als selbstgesetzgebendem Willen bzw. mit dem Geist als „belebendem
Prinzip“ zu lösen.99 In der Götzen-Dämmerung spricht er vom „Geist“ als Lebenskunstgriff der „Schwachen“, die sich „die Vorsicht, die Geduld, die List, die Verstellung, die
grosse Selbstbeherrschung und Alles, was mimicry ist“ (GD Streifzüge, 14, KSA 6,
S. 120 f.), zunutze machen. Auch die „freien, s e h r freien Geister“ haben noch „die
ganze Noth des Geistes“ (JGB Vorrede, KSA 5, S. 13). Deshalb kann das Leben bei ihnen
„zum P r o b l e m “ werden, sie können (und Nietzsche sagt das von sich selbst in der
Vorrede zur Fröhlichen Wissenschaft) das Vertrauen zum Leben verlieren (FW Vorrede
3, KSA 3, S. 350 f.). Doch das Leben selbst kann auch in diesem Fall nicht auf dessen
Wert hin befragt werden, eine das Leben übergreifende Perspektive gibt es nicht. Um
das Leben im Leben zu bewerten, bräuchte man eine andere Perspektive als die, die
dem Leben selbst verpflichtet und in ihm enthalten ist. Nicht eine Rechtfertigung des
Lebens, sondern eine lebensbejahende Perspektive ist anstrebenswert.100 Und die
Geister“ erklärte. Angefangen mit Hegel und Schelling und „in freierer Form von Schopenhauer,
Feuerbach, Richard Wagner und Nietzsche als philosophische Methode angewandt“, sei dieses Verfahren im Sinne einer Gegenbewegung zu Kant zu verstehen (Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften,
Bd. 4, (Die Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus), S. 211.) Vgl. dazu Johann Figl, Nietzsche und die philosophische Hermeneutik des 20. Jahrhunderts.
Mit besonderer Berücksichtigung Diltheys, Heideggers und Gadamers, bes. S. 423 f. Zur philosophischen
Interpretation der Beziehung von Nietzsche und Dilthey s. Werner Stegmaier, Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche; Werner Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 114 f. Stegmaier zufolge
wird bei Dilthey, ähnlich wie bei Nietzsche, das Leben als selbstbezügliche Einheit verstanden, „die die
Selbstbezüglichkeit des transzendentalen Subjekts übergreift, sofern sie in allen Versuchen, sie zu
bestimmen, schon vorausgesetzt ist“ (S. 114).
98 Vgl. den Gedanken Simons, dass „Namen wie ‚Leben‘, ‚Sprache‘“ nach Nietzsche zu einer bekannten „Oberfläche“ des „sprachlich getragenen Bewußtseins“ gehören. „‚Leben‘ steht als Metapher für
die Einsicht in die Grundlosigkeit des der Grammatik folgenden Begründens.“ (Simon, Grammatik und
Wahrheit, S. 15 f.) Im Anschluss an Simon formuliert Erich Heintel dies so: „Insofern ist auch der Begriff
‚Leben‘ bei Nietzsche ganz wie der des ‚Genies‘ nur die Formulierung für ein Problem nicht seine
Auflösung.“ (Erich Heintel, Philosophie und organischer Prozeß, S. 103)
99 Man setzte sich schon mehrmals mit Hegel und Nietzsche systematisch-historisch auseinander. So
hat Karl Löwith (Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts) die
Polarität, Werner Stegmaier (Leib und Leben. Zum Hegel-Nietzsche-Problem) die Kontinuität zwischen
beiden Denkern betont. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Nietzsche aus der Perspektive
Hegels s. Rainer Adolphi, Moralische Integration. Über eine Lücke in Hegels Theoriebildung und die
Nietzscheanischen Versuchungen der Antwort.
100 Die Idee der Rechtfertigung des Lebens, die für den jungen Nietzsche dessen Ästhetisierung
leistete, verwirft der reife Nietzsche (vgl. GT, Versuch einer Selbstkritik, 5, KSA 1, S. 17 ff.).
132
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Moral könnte zu solch einer Perspektive werden.101 Mehr noch: Die Moral kann als
„Lehre von Herrschaftsverhältnissen“ verstanden werden, „unter denen das Phänomen ‚Leben‘ entsteht“ (JGB 19, KSA 5, S. 34). Die Frage nach dem Wert der Moral aus
der Perspektive des Lebens bedeutet also nicht ihre Entwertung, sondern möglicherweise ihre Umwertung, die wiederum für das Leben und seine erneute Perspektivierung fruchtbar gemacht werden kann. Nietzsches Befragung der Moral auf ihren
Wert hin scheint so, als ob er jede Art von Moralität aufgegeben hätte. Jedoch wird sie
vielmehr durch diese Befragung aufgehoben. Es ist die Selbstaufhebung der Moral in
der Frage nach dem Wert der Moral für das Leben.
Die Frage nach dem Wert der Moral ist also eine andere als die Frage nach den
Bedingungen ihrer Möglichkeit bzw. ihrer Legitimation. Nietzsche stellt für sich fest,
dass seine Fragestellung „Moral als Problem“ grundsätzlich von einer „Kritik derselben“ (dem „Kriticismus“) oder der „Geschichte der ethischen Systeme“ (dem „Historicismus“) bzw. von der „Kantische[n]“ oder „Hegelsche[n] Manier“, sich „betrügen
[zu] lassen“, zu unterscheiden ist (Nachlass, Herbst 1885–Herbst 1886, 2[195], KSA 12,
S. 163). Auch moderne Moral-Historiker wie Moral-Kritiker, so Nietzsche, stehen „arglos unter dem Kommando einer bestimmten Moral“, und zwar in zweierlei Weise. Zum
einen wird von der vorausgesetzten Übereinstimmung „der zahmen Völker über
gewisse Sätze der Moral“ auf die unbedingte Verbindlichkeit dieses Konsensus geschlossen, zum anderen wird aus der Tatsache, dass „bei verschiedenen Völkern die
moralischen Schätzungen n o t h w e n d i g verschieden sind“, „ein[ ] Schluss auf [die]
Unverbindlichkeit a l l e r Moral“ gemacht. Beide Schlüsse, so Nietzsche, sind „gleich
grosse Kindereien“. Denn, abgesehen von der Möglichkeit, die jeweiligen Voraussetzungen zu begründen, beide Wege führen weg von der Frage nach dem „Wert einer
Vorschrift ‚du sollst‘“ (FW 345, KSA 3, S. 578 f.). Beide Antworten, die allgemeine
Verbindlichkeit der Moral so wie ihre volle Unverbindlichkeit, sind nach Nietzsche
Antworten, die zeigen, dass die Moral-Kritiker und Moral-Historiker ihrer Aufgabe
nicht gewachsen sind. Nietzsche selbst bedient sich zwar beider Methoden, der
kritischen und der historischen, will aber letztlich über sie hinausgehen.
Nietzsches genealogische Methode ist somit weder mit der der Kritik noch mit der
der Geschichtsforschung zu verwechseln. Letztere steht ihr wesentlich näher und ist
trotzdem grundsätzlich von ihr zu unterscheiden. Denn die Genealogie erweist sich
schließlich nicht als historisch fundierte Kenntnis, sondern als das Nachforschen nach
Plausibilitäten, d. h. als Suche nach einem zeitlich distanzierten Standpunkt (wobei
dieser Standpunkt als „Vorzeit“, die „zu allen Zeiten da ist oder wieder möglich ist“
(GM II, 9, KSA 5, S. 307) verstanden wird), an dem bestimmte Voraussetzungen ihre
Plausibilität noch nicht erreicht haben, weil ihnen alternative Voraussetzungen entgegenstanden. Der Prozess der Plausibilisierung zeigt sich letztendlich als Ausblen-
101 Vgl. Nietzsches Deutung der Aufgabe der Philosophie. Sie habe „das P r o b l e m v o m W e r t h e zu
lösen“, indem sie „die R a n g o r d n u n g d e r W e r t h e […] bestimm[t]“ (GM I, 17, KSA 5, S. 289).
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
133
dung der Alternativen bis zu dem Grad, von dem an sie nicht mehr als solche wahrgenommen werden. Die „Entstehungsgeschichte“ der Moral ist so wesentlich auf eine
Re- bzw. De-Konstruktion dieser Alternativen angewiesen. Von der Geschichtsforschung lässt sich eine solche Art der Untersuchung in mehreren Hinsichten unterscheiden. Ich will hier nur auf zwei hinweisen.102 Die Genealogie zeigt die Vielfalt der
Herkünfte auf, deren Aufdeckung stets mit der wachsenden Perspektivierung rechnen
muss, wobei unterschiedliche Perspektiven nicht notwendig miteinander kommensurabel sein müssen. Dies könnte vielleicht auch für die historische Forschung geltend
gemacht werden. Wesentlich ist jedoch, dass Nietzsches genealogische Methode als
Gegenentwurf zu jeder Art der historischen Teleologie zu verstehen ist. Den heutigen
Standpunkt kann man nicht als Zweck betrachten, auf den die ganze Entwicklung
hinführte. Auch methodisch, in der Dimension des „Als Ob“, wäre diese Herangehensweise für Nietzsche inakzeptabel.103 Die Perspektive der heutigen Moral erweist sich
als etwas Vielfältiges und Zufälliges, als eine der mehreren Möglichkeiten, die, indem
sie ihre Alternativen ausschließt, die ganze Vorentwicklung auf sich reduziert. Warum
gerade diese Perspektive herrschend bzw. plausibel geworden ist, darüber sind weitere Spekulationen, doch keine endgültige Erklärung möglich. Bei der Genealogie der
moralischen „Gefühle und Werthschätzungen“ (FW 345, KSA 3, S. 578) handelt es sich
also prinzipiell nicht um die Historie und nicht um eine Vorgeschichte der herrschenden (in kantischer Sprache „gegebenen“) Moral. Die Genealogie als Methode will dem
Leben, d. h. „de[m] Reichthum, d[er] Üppigkeit, selbst d[er] absurde[n] Verschwendung“, gerecht werden.104 Der Genealoge der Moral hat dementsprechend keinen
102 Zu Nietzsches genealogischer Methode s. Werner Stegmaier, Nietzsches „Genealogie der Moral“.
Werkinterpretation, S. 63 f.
103 Dies wiederum stellt einen wesentlichen Unterschied zu Kant dar, der in seiner Idee zu einer
allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht die Zweckmäßigkeit des historischen Geschehens,
die theoretisch niemals nachweisbar sein kann, als notwendige praktische Voraussetzung für das
historische Handeln betrachtet (AA 8, S. 17 ff.). Die historische Teleologie bzw. die „tröstende Aussicht“, dass die ganze Weltgeschichte auf die vollkommene bürgerliche Vereinigung abzielt, macht die
Moral, wenn auch nur in praktischer Hinsicht, zum Zweck der ganzen Vorgeschichte.
104 Nietzsches genealogischer bzw. antiteleologischer Entwurf ist, wie es mehrmals bemerkt wurde,
auf die Evolutionstheorie Charles Darwins zurückzuführen. Auch in der Entstehungsgeschichte der
Arten wird das Prinzip des „Kampfs ums Dasein“ als heuristisches, antiteleologisches Prinzip betrachtet, das nur nachträglich angewandt werden kann. Jede Erklärung, die aus diesem Prinzip folgt, behält
ihre Richtigkeit nur unter den ‚idealen‘ Umständen, die in der Natur niemals vorhanden sind. Trotz der
offensichtlichen Nähe wollte Nietzsche seine Genealogie der Evolutionstheorie jedoch nicht gleichsetzen, und sich schon gar nicht der „Schule Darwin’s“ anschließen. Vgl. den Aphorismus „A n t i D a r w i n“: „Was den berühmten ‚Kampf um’s Leben‘ betrifft, so scheint er mir einstweilen mehr
behauptet als bewiesen. Er kommt vor, aber als Ausnahme […]“ (GD Streifzüge, 14, KSA 6, S. 120). Der
Kampf um das Überleben sei nur ein Einzelfall. Es geht im Leben Nietzsche zufolge nicht bloß ums
Überleben, sondern vielmehr um die Steigerung der Macht, darum, „um jeden Preis oben zu bleiben“.
„Darwin hat den Geist vergessen […], d i e S c h w a c h e n h a b e n m e h r G e i s t…“ (GD Streifzüge, 14,
KSA 6, S. 121) Der „Geist“ der Schwachen könne wiederum zur Stärke werden und die Starken
134
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
festen Anhaltspunkt, er darf keiner Konstante sein Vertrauen schenken, als sei sie
ein zuverlässiges Fundament für seine Theorien.105 Die Genealogie soll immer weiter
gehen und in stetig neue, komplexere und zweideutige Quellen führen. Sie bleibt
somit in beiden Richtungen offen: in Richtung der Quellen, deren Vielfältigkeit immer
weiter zunimmt, und in Richtung der Fortentwicklung, die vom „Werk der Aufklärung“, von der Aufklärung der Quellen der eigenen Wertschätzung abhängig
ist.
Lässt die Genealogie der Moral sich von deren Geschichte prinzipiell unterscheiden, so ist die genealogische Methode der kritischen in gewissem Sinn entgegenzusetzen. Kant hat bekanntlich der „Geschichte der reinen Vernunft“ nur die letzten
Seiten seiner ersten Kritik gewidmet und sie als eine Stelle bezeichnet, „die im System
übrig bleibt, und künftig ausgefüllt werden muß“ (KrV A 852/B 880). Die ganze
Geschichte der Philosophie wird dabei als Vorgeschichte der Kritik und größtenteils
als Erschließung der Irrwege dargestellt, die im „Kindesalter der Philosophie“ begangen wurden. Diese nicht-historische oder vielmehr ahistorische Einstellung Kants
wurde schon vor Nietzsche, wie oben erwähnt worden ist, mehrmals kritisiert und v. a.
durch die hegelsche Dialektik korrigiert. Nietzsches Unzufriedenheit mit der Kritik als
Methode galt jedoch nicht nur dem Mangel an Historismus, sondern auch der ganzen
Deutung der Philosophie als Kritik und als „Wissenschaft“ in Anführungszeichen,
unterwerfen. Denn das Leben sei viel „unvernünftiger“, verschwenderischer, es lasse sich nicht auf
Vernunftprinzipien bringen. Darwins Ausdeutung des Lebens als Notlage sei dagegen mangelhaftrationalistisch ausgefallen. Das Überlebens-Prinzip sei der Idee der Vernunft bzw. dem Vertrauen in
die Vernunft verpflichtet, das Selbsterhaltungsprinzip sei wiederum teleologisch gedeutet worden.
Dennoch kann die These, Nietzsche habe Darwins Theorie nicht akzeptiert (so etwa Vollmer, Kognitive
und ethische Evolution und das Denken von Kant und Nietzsche, S. 93), schließlich nicht überzeugen.
Vgl. auch Ottmanns These, Nietzsche sei ein Antidarwinist „in einem ganz und gar eindeutigen Sinne“
(Henning Ottmann, Philosophie und Politik bei Nietzsche, S. 445). Bloß der Auffassung dieses Prinzips
als endgültiger Erklärung, der Lehre des Darwinismus also, stimmte Nietzsche tatsächlich nicht zu.
Dazu Werner Stegmaier, Darwin, Darwinismus, Nietzsche. Zum Problem der Evolution. Hier wird deutlich gezeigt, dass Nietzsches „Antidarwinismus“ gegen Verflachung und Dogmatisierung der Evolutionstheorie ging, auch bei Darwin selbst. Die lamarckistische Tendenz, die bei Darwin selbst wahrnehmbar ist, war für Nietzsche unakzeptabel (vgl. Nachlass, Ende 1886–Frühjahr 1887, 7[25], KSA 12,
304). Zur dreifachen Bedeutung des „Anti“ von Nietzsches „Anti-Darwinismus“, als Gleichsetzung,
Gegenstellung und Überbietung, s. Michael Skowron, Nietzsches „Anti-Darwinismus“. Zu Nietzsches
Kritik an Darwin und der Idee der Selbsterhaltung s. Günter Abel, Nietzsche contra ‚Selbsterhaltung‘.
Steigerung der Macht und ewige Wiederkehr.
105 Das betrifft auch die Theorie der Selbsterhaltung, wie sie bei Spinoza erörtert wurde. Nietzsche,
der sonst Spinoza für seinen „Vorgänger, und was für einen!“ (KSA 15, S. 117) hielt, hat in Jenseits von
Gut und Böse von der „Inconsequenz Spinoza’s“ gesprochen: Obwohl Spinoza jede Art von Teleologie
verwirft, behaupte er die Selbsterhaltung als grundlegenden Trieb (JGB 13, KSA 5, S. 27 f.). Zur Auflösung dieses Streitpunktes zwischen Nietzsche und Spinoza als Missverständnis s. Andreas Rupschus,
Werner Stegmaier, „Inconsequenz Spinoza’s“? Adolf Trendelenburg als Quelle von Nietzsches SpinozaKritik in Jenseits von Gut und Böse 13.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
135
d. h. als Wissenschaft, wie Kant sie verstanden hat.106 Er will dagegen den Philosophen vom Kritiker bzw. vom „theoretischen Menschen“ unterscheiden, dessen „grosse[s] Cyklopenauge“ (GT 14, KSA 1, S. 92) nur eine Perspektive kennt, nur in eine
Richtung blicken kann und für alle anderen Perspektiven blind bleibt.
Die Gleichsetzung der Philosophie mit der Kritik bzw. mit der kritischen Wissenschaft hat sich für das Leben als gefährlich, ja auch als schädlich erwiesen. Seine
eigene Aufgabe sah Nietzsche nun u. a. darin, „zu beweisen, daß die Consequenzen
der Wissenschaft g e f ä h r l i c h sind“ (Nachlass, Frühjahr 1884, 25[337], KSA 11,
S. 100). Sie sind gefährlich, weil der von ihr vorausgesetzte Wert des Willens zur
Wahrheit als alternativlos gilt, auch in der feinsten Form dieses Willens, in der eines
kritischen Zweifels an der Wahrheit, wo dieser als „sublim“, „bleich, nordisch,
königsbergisch“ erscheint (GD Fabel, KSA 6, S. 80). Die Philosophie, die diese Gefahr
aufdeckt, bringt allerdings ebenfalls eine große Gefahr, aber auch eine neue Hoffnung
mit sich. Sie wird gefährlich, weil die neuen Perspektiven um den Preis erworben
werden, dass keine von ihnen als wahr angesehen werden kann. Mit der philosophischen Explosions-Gefahr wird jedoch, so Nietzsches Gedanke, im Unterschied zur
Gefahr der kritisch-wissenschaftlichen Philosophie eine Hoffnung verbunden, einen
Weg aus der Sackgasse der tautologischen Selbstlegitimation zu finden. Sein „Begriff
‚Philosoph‘“ soll deshalb „meilenweit“ von einem Begriff abgetrennt bleiben, „der
sogar noch einen Kant in sich schliesst, nicht zu reden von den akademischen
‚Wiederkäuern‘ und andren Professoren der Philosophie“. Den Philosophen bezeichnet Nietzsche metaphorisch „als einen furchtbaren Explosionsstoff, vor dem Alles in
Gefahr ist“ (EH Bücher 3, KSA 6, S. 320). Im Unterschied zur Kritik verspricht die so
verstandene Philosophie keinen sicheren Gang und keine „Heeresstraße“, sondern
eine Explosion, die ebenso gefährlich wie unvermeidlich ist. Durch diese Explosion,
zu welcher Nietzsche verhelfen wollte, mit der er sich selbst identifizierte („Ich bin
kein Mensch, ich bin Dynamit“ (EH Schicksal 1, KSA 6, S. 365)), sollten neue Möglichkeiten eröffnet werden107 – auch für die Moral, die jetzt nicht mehr absolut, d. h. nicht
alternativlos, erscheint. Ihr Wert für das Leben wäre jedoch nicht abgetan, wenn sie
auch jenseits des Willens zur Wahrheit neu verstanden werden könnte.
Nietzsche betont mehrmals die Gefährlichkeit seines Unternehmens und die Unendlichkeit seiner Aufgabe. Vielleicht wäre es durchaus ratsam, „dass so wenig
106 Vgl. die scharfen Formulierungen im Nachlass: Sommer–Herbst 1884, 26[464], KSA 11, S. 273 f.;
Ende 1886–Frühjahr 1887, 7[14], KSA 12, S. 299. In den veröffentlichten Werken wird dieser Gedanke
etwas vorsichtiger formuliert (vgl. JGB 210, KSA 5, S. 143 f.)
107 Vgl. hierzu Juri Lotmanns These, dass die größten kulturellen Ereignisse dadurch gekennzeichnet
sind, dass sie mehrere Wege eröffnen, die zwar nicht alle verfolgt werden können, aber lange Zeit als
vorbehaltene Möglichkeiten, die wieder fruchtbar gemacht werden können, erhalten bleiben. In der
schöngeistigen Literatur sind nach Lotmann gerade die großen Werke, etwa die Puschkins, als Wendepunkte zu sehen, die überreiches Material für die Nachkommenschaft bieten (Юрий М. Лотман (Juri
M. Lotman), Культура и взрыв (Kultur und Explosion)).
136
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Menschen als möglich über Moral nachdenken“ (JGB 228, KSA 5, S. 163). Sein verärgertes Erstaunen gilt so nicht bloß dem Umstand, dass man über den Wert der Moral
nicht gründlich genug nachgedacht hatte, sondern dass man dieses Nachdenken
nicht als „gefährlich, verfänglich, verführerisch“ erlebt, dass man das Problem selbst,
sei es durch kritische oder durch historische Untersuchungen, zu verharmlosen sucht.
Und kann es wirklich ungefährlich sein, den Glauben an die Möglichkeit und Legitimität der Urteile, die für das Leben notwendig sind, als einen „nöthigen“, aber nicht
„möglichen“ Glauben darzustellen (JGB 11, KSA 5, S. 25)? Bereits in Menschliches,
Allzumenschliches stellte Nietzsche diese Frage auf höchst dramatische Weise:
Aber wird so unsere Philosophie nicht zur Tragödie? Wird die Wahrheit nicht dem Leben, dem
Besseren feindlich? Eine Frage scheint uns die Zunge zu beschweren und doch nicht laut werden
zu wollen: ob man bewusst in der Unwahrheit bleiben k ö n n e ? Oder, wenn man dies m ü s s e , ob
da nicht der Tod vorzuziehen sei? (MA I, 34, KSA 2, S. 53 f.)
Dieser Zweifel wird im Spätwerk Nietzsches immer wieder zur Sprache kommen, er
wird für die Beweglichkeit seines Denkens sorgen und ihn daran hindern, in einem
flachen antimoralischen Pathos unterzugehen. Wenn der Mensch „ein verehrendes
Thier“ ist, kann es ungefährlich sein, seine „Verehrungen“ „abzuschaffen“ (FW 346,
KSA 3, S. 580)? Wenn der Mensch „das kranke Thier“ ist (GM III, 14, KSA 5, S. 367), ist
es mehr als riskant, die „berühmteste[ ] aller Medizinen, genannt Moral“ (FW 345,
KSA 3, S. 579), in Frage zu stellen. Wäre das nicht der sicherste Weg zum Nihilismus?
Gerade das, sagt Nietzsche, ist „unser Werk“, aber es ist ebenso „unser Fragezeichen“
(FW 345–346, KSA 3, S. 579).
Und noch eine Schwierigkeit, welche Nietzsches Fragestellung innewohnt und
nicht nur seine Aufgabe, sondern auch die der Nietzsche-Forscher erheblich erschwert, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt gelassen werden. Das Hinterfragen des
Wertes der Moral ist von vornherein zu einer Kreisbewegung verurteilt. Die Frage
selbst wird verführerisch: Der Wert muss schon als Bekanntes vorausgesetzt werden,
um am Ende gefunden werden zu können. Wie mehrere Untersuchungen zu Nietzsche
zeigen, kann man dieser Gefahr auch mit Hilfe der feinsten Differenzierungen nicht
entgehen, man spricht dann immer wieder von dem „wirklichen“ Wert bzw. von der
Verleugnung der „Realität“. Gegen ein solches Verflachen der Frage nach dem Wert
der Moral spricht jedoch Nietzsches stetiges Bedenken der Möglichkeit von Misserfolg.
So richtet er eine Frage an die oben erwähnten „Luft-Schifffahrer des Geistes“:
Wird man vielleicht uns einstmals nachsagen, dass auch wir, n a c h W e s t e n s t e u e r n d , e i n
I n d i e n z u e r r e i c h e n h o f f t e n , – dass aber unser Loos war, an der Unendlichkeit zu scheitern? Oder, meine Brüder? Oder? – (M 575, KSA 3, S. 331)
Nietzsche wird später mit Stolz sagen, die Morgenröthe, das Buch, mit dem er seinen
„Feldzug“ gegen die Moral begann, sei das einzige, „das mit einem ‚Oder?‘ schliesst“
(EH, Morgenröthe, 1, KSA 6, S. 329 f.). Das Land, das auch der nietzschesche „LuftSchifffahrer“ begehrt, wie früher der das Abenteuer suchende und sich hoffnungslos
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
137
verirrende Seefahrer Kants, kann immer noch „Indien“ sein. Auch er, der „über das
Meer“ will, in die Richtung hin, „wo bisher alle Sonnen der Menschheit u n t e r g e g a n g e n sind“ (M 575, KSA 3, S. 331), kann am Ende bloß „zurück“ gekommen sein
oder, um die Indien-Metapher fortzusetzen, kann das neu entdeckte Land für das
schon Bekannte halten.108 Er weiß, es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass auch er
irgendwo stehen bleiben muss, dass auch er vielleicht „an der Unendlichkeit […]
scheitern“ wird, ebenso wie der kantische Schifffahrer, der seine Hoffnungen in den
stürmischen Ozean der Dialektik legte, um sich seiner Heimkehr zu versichern und die
Sanktion der Vernunft zugunsten der Moral zu erhalten. Es ist möglich, dass die Frage
nach dem Wert der Moral auch bei ihm nur eine moralische Antwort finden wird, dass
auch für ihn seine Plausibilitäten ein blinder Fleck bleiben werden und dass auch er,
weil er ihnen weiterhin verhaftet ist, nicht weiter gehen können wird. Das große
Wagnis ist deshalb nicht schon von vornherein zurückzuweisen. Denn der Wert des
Erfolgs seines Unternehmens kann selber nicht als unhinterfragbar angesehen werden, so als ob eine bestimmte Antwort wertvoller wäre als ihr Gegenteil, das Fragezeichen.
Mit seiner Frage nach dem Wert strebte Nietzsche nicht bloß eine Abschaffung
der Verehrungen und „Tabus“ der Philosophen, nicht einfach eine Umdrehung der
Perspektive an. Nicht eine Umdrehung, sondern eine Umwertung der Moral, es sei
noch einmal betont, sollte versucht werden, und das bedeutete, „das P r o b l e m v o m
W e r t h e “ neu zu stellen und neue Plausibilitäten ins Spiel zu bringen. Wenn der Wert
der Moral auch jenseits des Willens zur Wahrheit gedacht werden sollte, so musste
eine Antwort auf die folgende Frage gegeben werden: Ob man bewusst in der Unwahrheit bleiben kann und weshalb man dies als Philosoph tun soll. Oder: Wie kann „unsere
Philosophie“ „zur Tragödie“ werden, ohne dem Leben selbst, „dem Besseren“, feindlich zu sein? Diese Frage werden wir bei der Untersuchung von Nietzsches eigenen
Plausibilitäten stets bedenken müssen und am Ende dieses Kapitels eine Antwort
darauf versuchen – eine Antwort, die den alternativen Wert von Nietzsches „letzter
Moral“ im Unterschied zu dem einer jahrtausendelang herrschenden Moral des
Abendlandes zum Vorschein bringen soll. An dieser Stelle sei daran erinnert, wie
Nietzsche die Fahrt „über die Moral w e g “ beschreibt:
[…] wir zermalmen vielleicht dabei unsren eignen Rest Moralität, indem wir dorthin unsre Fahrt
machen und wagen, — aber was liegt an u n s ! Niemals noch hat sich verwegenen Reisenden und
Abenteurern eine t i e f e r e W e l t der Einsicht eröffnet […] es ist n i c h t das sacrifizio dell’intelletto, im Gegenteil! (JGB 23, KSA 5, S. 38 f.)
108 Die Indien-Metapher bekommt, wie mehrere andere Metaphern bei Nietzsche, eine philosophische Dimension. Vgl. die Erwähnung der „Vedanta-Lehre in Asien“ im Zusammenhang mit dem
„Platonismus in Europa“ (JGB Vorrede, KSA 5, 12); auch GD Vernunft, 6, KSA 6, S. 78: „Und in Indien
wie in Griechenland hat man den gleichen Fehlgriff gemacht.“
138
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Durch die Aufhebung der Moral aus Vernunft in der Frage nach dem Wert der Moral
für das Leben sollte die Vernunft nicht aufgeopfert werden. Ihr sollte der Weg aus der
Sackgasse der Tautologie eröffnet werden – der Weg zu einer neuen Aufklärung, zu
einem neuen Abenteuer der Erkenntnis im Horizont der Unendlichkeit.
Vom „Selbstmorde der Vernunft“ zur „Selbstaufhebung der Moral“
In der Kritik der praktischen Vernunft verwies Kant auf „das Paradoxon der Methode“,
daß nämlich der Begriff des Guten und Bösen nicht vor dem moralischen Gesetze (dem es dem Anschein nach sogar zum Grunde gelegt werden müßte),
sondern nur (wie hier auch geschieht) nach demselben und durch dasselbe
b e s t i m m t w e r d e n m ü s s e (KpV, AA 5, S. 63).
Der ganze Satz ist bei Kant gesperrt und tatsächlich ist die grundlegende Bedeutung
dieses Paradoxons kaum zu überschätzen. Das Gute und das Böse werden nämlich
nicht erst definiert, um dann zu bestimmen, was eine moralische Forderung sein sollte.
Sondern umgekehrt: Das Kriterium für die Unterscheidung von Gut und Böse wird aus
dem Begriff der Vernunft als Vermögen der allgemeinen Prinzipien gewonnen. Darauf
wurde im ersten Kapitel ausführlich genug eingegangen. Hier ist der folgende Gedankengang wichtig: Wenn der Wille sich als praktische Vernunft für eine dem kategorischen Imperativ widersprechende Maxime entscheidet (und das sollte auch eine spontane Handlung aus Vernunft sein, sonst könnte man überhaupt nicht von der
praktischen Vernunft als Bestimmungsgrund der Handlung sprechen), so entscheidet
er sich frei gegen seine eigene Freiheit. Die Vernunft wendet sich damit gegen sich
selbst. Und nur deshalb ist es das Böse: weil die Vernunft gegen die Vernunft gebraucht
wird. Kant hat damit ein formales Kriterium für die Unterscheidung von Gut und Böse
gefunden, das nicht aus der Empirie, sondern allein aus dem Willen als Vermögen der
Selbstbestimmung, d. h. aus praktischer Vernunft, hergeleitet wird. Dieses Kriterium
soll für zwei Bereiche der Regelung der Sittlichkeit gelten, für die Moral, wenn es auf
Maximen, und für das Recht, wenn es auf Handlungen bezogen wird.
In der Begründung des kategorischen Imperativs wird jedoch in der Kritik der
praktischen Vernunft mehrmals ein Konditionalsatz verwendet: Wenn die Vernunft als
reine praktische Vernunft und der Wille als Bestimmungsgrund der Handlung möglich sein sollen (vgl. KpV, AA 5, S. 25) bzw. „wenn ein vernünftiges Wesen sich seine
Maximen als praktische allgemeine Gesetze denken soll“ (KpV, AA 5, S. 27, meine
Hervorhebung – E.P.), dann muss es der kategorische Imperativ sein, der allein den
Maßstab des Guten für den Willen eines vernünftigen Wesens ausmacht. Das ganze
Gebäude der Kritik hängt von dieser Annahme ab. Deren Legitimation wird am Ende
zu einem Faktum der Vernunft erklärt, dessen weitere Gründe nicht eingesehen
werden können. Der Zirkel in der Begründung der Moral aus Vernunft wird selbst als
unbegreifliche und unergründliche Nötigung zur Vernunft begriffen.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
139
Gerade an diesem Punkt gibt Nietzsche zu bedenken: Wenn der paradoxe Begründungszirkel den Bereich abgrenzen sollte, in dem die Vernunft „sich nicht um die
Vernunft zu kümmern habe“ (AC 12, KSA 6, S. 178), wenn es das Ziel der Kritik
gewesen ist, die Vernunft am Ende doch „gegen Vernunft zu kehren“ und „ein Reich
der Wahrheit und des Seins“ zu retten, von dem gerade die Vernunft ausgeschlossen
ist,109 dann sei das ganze Unternehmen der Kritik selbst einem Gebrauch der Vernunft
gegen die Vernunft verpflichtet. Und wenn die Kritik als „Propädeutik aller Philosophie“ (KU, AA 5, S. 194) von Anfang an davon handelt, aus der Vernunft einen
Gebrauch gegen die Vernunft zu machen, d. h. davon, „den Intellekt zu entthronen,
das Wissen zu köpfen“ (Nachlass, Ende 1880, 7[34], KSA 8, S. 325), dann stellt sie den
Höhepunkt jenes langen Prozesses dar, den Nietzsche einen „dauernden Selbstmord[ ] der Vernunft“ nennt. Es ist ein Selbstmord, der durch die „Opferung aller
Freiheit, alles Stolzes, aller Selbstgewissheit des Geistes“ und „zugleich [durch] Verknechtung und Selbst-Verhöhnung, Selbst-Verstümmelung“ von dem christlichen
Glauben gefordert und tatsächlich vollzogen wurde (JGB 46, KSA 5, S. 66). Das Kriterium des Bösen, das die Kritik hervorgebracht hat, wird so gegen sie selbst gekehrt:
Der kritische Vernunftgebrauch richtet sich gegen die Vernunft und ist somit „Quervernunft“ und „Unvernunft“.110
Dieser Einwand trifft nicht nur die kantische Kritik, sondern auch die Annahmen,
die ihr zugrunde liegen und jahrtausendelang unumstößliche Plausibilität genossen
hatten: ein „reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntniss“, die
„reine Vernunft“, „absolute Geistigkeit“ oder „Erkenntniss an sich“ (GM III, 12, KSA 5,
S. 365). Alle diese Ausdrücke setzt Nietzsche in Anführungszeichen: Es handelt sich
um genau die „Dinge“, von denen Nietzsche früher sagte, sie seien „so mit Vernunft
durchtränkt, dass ihre Abkunft aus der Unvernunft“ unwahrscheinlich, ja „paradox
und frevelhaft“ erscheinen muss (M 1, KSA 3, S. 19). Aber könnte man dann noch von
einem falschen Gebrauch der Vernunft, von ihrem Selbstmord sprechen, wenn auch
sie selbst von der Unvernunft abstammt, wenn die stetige „Gefahr des Weisen“ gerade
darin besteht, „sich in das Unvernünftige zu verlieben“ (Nachlass, Sommer–Herbst
1882, 3[1] 52, KSA 10, S. 59)? Anders formuliert: Wenn diese selbstmörderische Zirkelbewegung für die Vernunft selbst ebenso unvermeidlich wie auch bedrohlich ist,
wenn die Vernunft immer dazu neigt, in Unvernunft umzuschlagen, was könnte
Erkenntnis, Stolz und Freiheit des Erkennenden dann noch im Unterschied zur Selbstunterwerfung und Selbstverknechtung des Intellekts bedeuten?
109 Vgl. weiter: „‚[I]ntelligibler Charakter‘ bedeutet nämlich bei Kant eine Art Beschaffenheit der
Dinge, von der der Intellekt gerade soviel begreift, dass sie für den Intellekt – g a n z u n d g a r u n b e g r e i f l i c h ist.“ (GM III, 12, KSA 5, S. 364)
110 Diese Ausdrücke sind allerdings nicht negativ zu verstehen. Nietzsche verwendet sie im Zusammenhang mit der „Ungerechtigkeit der Edlen“, die ihre „Leidenschaft zur Erkenntnis“ für die allgemeine Not halten. Vgl. FW 3, KSA 3, S. 375 f. Die Vernunft der Erkenntnis kann so selbst als Unvernunft und Leidenschaft verstanden und veredelt werden.
140
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
An dieser Stelle der Argumentation wird meist auf Nietzsches Begriff der „grossen
Vernunft“ des Leibes hingewiesen, für die die „Vernunft“ selbst „ein kleines Werkund Spielzeug“ sei (Z I Verächtern, KSA 4, S. 39). Man darf jedoch nicht vergessen,
dass die zentralen Begriffe Nietzsches im oben angedeuteten Sinn stets als GegenBegriffe gedacht werden müssen. Die große Vernunft des Leibes ist der Gegen-Begriff
zum Begriff der Vernunft, der durch den Gegensatz von Vernunft und Unvernunft, von
Vernunft und Leib, von Vernunft und Affekt gewonnen wurde. Die Größe stellt, wie
oben schon in einem anderen Zusammenhang angedeutet wurde, die Fähigkeit dar,
das Gegenteil in sich aufzunehmen. Dies ist gerade die Größe der Vernunft des Leibes.
Sie steht keinesfalls bloß für die Leiblichkeit, sie bekämpft die „kleine Vernunft“, die
„Geist“ genannt wird, nicht. Denn beide, „Sinn und Geist“, sind ihre „Werk- und
Spielzeuge“.
Was der Sinn fühlt, was der Geist erkennt, das hat niemals in sich sein Ende. Aber Sinn und Geist
möchten dich überreden, sie seien aller Dinge Ende: so eitel sind sie. (Z I Verächtern, KSA 4,
S. 39)
Dementsprechend geht es Nietzsche nicht darum, den Geist als eine Art Sinnlichkeit
zu deuten, sondern darum, die Erkenntnis, ja die ganze Tätigkeit der Vernunft jenseits
dieses Gegensatzes denken zu können. Die „Erkenntnis an sich“ ist im Werden nicht
denkbar (vgl. Nachlass, Ende 1886–1887, 7[54], KSA 12, S. 313). Die Voraussetzung der
absoluten Erkenntnis bzw. des reinen Geistes kehrt die Vernunft gegen sich selbst.
Dennoch bemerkt Nietzsche:
Seien wir zuletzt, gerade als Erkennende, nicht undankbar gegen solche resolute Umkehrungen
der gewohnten Perspektiven und Werthungen, mit denen der Geist allzulange scheinbar freventlich und nutzlos gegen sich selbst gewüthet hat: dergestalt einmal anders sehn, anders-sehnw o l l e n ist keine kleine Zucht und Vorbereitung des Intellekts zu seiner einstmaligen ‚Objektivität‘. (GM III, 12, KSA 5, S. 364)
Der „Intellekt“ ist somit keinesfalls bloß als Affekt zu verstehen, der seinerseits etwa
der schlechten Gesundheit oder dem persönlichen Unglück zu verdanken sei (eine
solche flache These würde sich als performativer Selbstwiderspruch selbst widerlegen). Ganz im Gegenteil: Er setzt „Zucht und Vorbereitung“, auch das Wüten des
Geistes gegen sich selbst voraus. Was dadurch vorbereitet wird, bezeichnet Nietzsche
programmatisch als seine „Objektivität“, als seine „Erkenntnis“, als seinen „guten
Willen“ zum Erkennen:
Es giebt n u r ein perspektivisches Sehen, n u r ein perspektivisches ‚Erkennen‘; und je m e h r
Affekte wir über eine Sache zu Worte kommen lassen, je m e h r Augen, verschiedne Augen wir
uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, um so vollständiger wird unser ‚Begriff‘ dieser Sache,
unsre ‚Objektivität‘ sein. (GM III, 12, KSA 5, S. 365)
Diese „Objektivität“ verhindert eine bloße Umkehrung des Gegensatzes. Sie wird von
Nietzsche hierbei
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
141
nicht als ‚interesselose Anschauung‘ verstanden (als welche ein Unbegriff und Widersinn ist),
sondern als das Vermögen [meine Hervorhebung – E.P.], sein Für und Wider i n d e r G e w a l t
z u h a b e n und aus- und einzuhängen: so dass man sich gerade die V e r s c h i e d e n h e i t der
Perspektiven und der Affekt-Interpretationen für die Erkenntniss nutzbar zu machen weiss.
(GM III, KSA 5, S. 364 f.)
Es ist wichtig festzuhalten, dass Nietzsche sich in dieser berühmten Passage des
kantischen Begriffs des Vermögens bedient, um etwas anzudeuten, was nicht bloß
über den von Kant geprägten Begriff hinausgeht, sondern was ihn sprengen muss. Es
handelt sich um ein Vermögen, das weder Legitimation noch Begründung gewährleisten kann. Es ist auch keine angeborene, sondern eine in einem langen Kampf um
die „Objektivität“ der „Erkenntnis“ – durch das Wüten des Geistes gegen sich selbst,
durch die andauernde Kehrung der Vernunft gegen die Vernunft – gewonnene Fähigkeit der Selbstbeherrschung, einer neuen Größe der Vernunft und vielleicht einer
neuen, größeren Moralität, als es die Moral aus der kritischen, sich selbst legitimierenden Vernunft jemals gewesen war. Die Größe, in diesem Fall die Größe der Vernunft, kann dagegen nur mit mehreren „Augen“, unter mehreren Perspektiven gesehen werden. Mit jeder neuen Perspektive wird die Vollständigkeit unseres „Begriffs“,
unserer „Objektivität“ gesteigert. Und doch müssen beide Worte, „Begriff“ und „Objektivität“, in Anführungszeichen gesetzt werden: Wie viele Augen man auch haben
mag, es werden nie genug sein; wie viele Perspektiven es auch sein mögen, sie
können nicht zu einer einzigen Perspektive vereint bzw. in eine Hierarchie von
Perspektiven eingeordnet werden.111
Die „Objektivität“ wird nicht durch eine kantische Verdeutlichung des Begriffs ad
melius esse erreicht, sondern durch eine Vermehrung der Perspektiven, die einander
gelegentlich widersprechen, den Begriff der Vernunft jedoch immer neu beleuchten.112 Er wurde zuerst durch ihre Selbstabgrenzung vom Instinkt gewonnen. Aber
schon im nächsten Schritt, im Begriff des „Glaubens“, wird der Instinkt wiederum
zur „S e l b s t - Ü b e r w i n d u n g d e r V e r n u n f t “ (Nachlass, April–Juni 1885, 34[35],
KSA 11, S. 431). So formuliert Nietzsche in einem Nachlassnotat das „eigentliche“
Problem des „Glaubens“, wie es lange Zeit verstanden wurde:
111 Vgl. bei Müller-Lauter: „In der Forderung nach einer neuen ‚Objektivität‘ wird den Ansprüchen
der perspektivischen Vielfalt ein unbeschränkter Spielraum eröffnet […]“ (Nietzsche. Seine Philosophie
der Gegensätze, S. 62).
112 Der Begriff der Vernunft bei Nietzsche wurde mehrmals zum Gegenstand der Untersuchung. S.
z. B. Steinmann, Die Ethik Friedrich Nietzsches, S. 14 ff. Trotz aufschlussreicher Beobachtungen ist die
Aufgabe, die Steinmann sich stellt, nicht gerade überzeugend, nämlich „daß wir zeigen müssen, was
Vernunft an sich für Nietzsche ist“ (S. 14). „An sich“ wäre die Vernunft für Nietzsche ein leerer Begriff.
Sie ist nur aus der „C h e m i e d e r B e g r i f f e u n d E m p f i n d u n g e n“ (MA I, 1, KSA 2, S. 23) zu
verstehen, durch die sie sich von der Unvernunft zu unterscheiden gelernt hat. Zu Nietzsches Begriff
des Instinkts in einer philosophiehistorischen Perspektive s. Albert Vinzens, Friedrich Nietzsches
Instinktverwandlung.
142
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Das Problem des ‚Glaubens‘ ist eigentlich: o b d e r I n s t i n k t m e h r W e r t h a t a l s d a s R ä s o n n e m e n t u n d w a r u m ? (Nachlass, April–Juni 1885, 34[36], KSA 11, S. 431)
Der Gegensatz von Instinkt und Vernunft verschiebt sich so zwischen zwei Extremen
und mündet durch die Selbst-Überwindung dieser scharfen Unterscheidung in
einem Dritten, im „Glauben“. Die Wichtigkeit des letzteren Begriffs für die Moral aus
Vernunft ist kaum zu überschätzen, denn mit ihm werden mehrere Denkschwierigkeiten entparadoxiert, die der Gegensätzlichkeit der Werte entspringen, indem der
Vernunft immer größere Spielräume zugesprochen werden. Man kann die Vernunft
bloß als „Räsonnement“, als verengte Rationalität des descartischen Vernunft-Begriffs und folglich als Gegensatz zum Instinkt verstehen. Man kann sie aber auch als
kantischen Glauben verstehen, durch den gerade die Grenze dieses „Räsonnements“
markiert wird,113 oder wie Platon, der, so Nietzsche, „im Grunde“ „das Irrationale im
moralischen Urtheile durchschaut“ hatte und deshalb „die Vernunft überreden“
wollte, den Instinkten „mit guten Gründen nachhelfen“ zu müssen (JGB 191, KSA 5,
S. 112). Die Moral ist dann vielleicht selbst als „ein Stück Tyrannei gegen die
‚Natur‘“, aber „auch gegen die ‚Vernunft‘“ zu verstehen, was allerdings noch
keinesfalls ein Einwand gegen sie sein darf, denn man darf nicht voreilig einem von
den alten Begriffen mehr Wert zuschreiben als den anderen (JGB 188, KSA 5,
S. 108).114 Denn dies würde bedeuten, nicht bloß in alten Begriffen stecken zu
bleiben, sondern auch zur alten Moral zurückzukehren, die auf dem Wert der
Gegensätze, auf der Asymmetrie der Wertschätzungen beruhte und sich durch diese
Asymmetrie legitimierte. Eine bloße Umkehrung würde diese Asymmetrie bloß
bestätigen und den Willen zur Moral wieder ausblenden. Diese Gefahr ist allerdings
stets zu bedenken. Je näher man dem Problem der Moral kommt, desto schwerer ist
es, „sein Für und Wider i n d e r G e w a l t z u h a b e n “. Es ist vielleicht nur auf die
Art möglich, dass man sie zumindest von Zeit zu Zeit in die Gewalt bekommt, um
sie „aus- und einzuhängen“.
Wenn man das „Hauptvorurteil der Philosophen“ (JGB 2, KSA 5, S. 16), die Gegensätzlichkeit der Werte, ablegt, darf man weder in der Vernunft noch im Instinkt das
erste Prinzip (arché) ansetzen, würde dies doch eine Rückkehr zu Leitbegriffen des
aristotelischen Denkens bedeuten: „Ursprung“, „Wesen“, „Zweck“. Dem Gegensatz
von Vernunft und Unvernunft, sei darunter Instinkt, Sinnlichkeit oder Glaube verstanden, kann deshalb keine Plausibilität zugesprochen werden. Einen der genealogi-
113 Gerade in diesem Zusammenhang, soweit man von einem solchen in Bezug auf Nietzsches Notate
sprechen kann, äußert sich Nietzsche anscheinend anerkennend gegenüber Kant: „Kant, ein feiner
Kopf, eine pedantische Seele“ (Nachlass, April–Juni 1885, 34[37], KSA 11, S. 431).
114 Eine Forderung, „gemäss der Natur“ zu leben, wie sie etwa die Stoa erhob, wäre damit auch ein
Stück Tyrannei, denn als Forderung ist sie schon „ein Anders-sein-wollen“, ein Prinzip und damit
keine Natur. In dieser Forderung äußerst sich gerade der umgekehrte Wille, der Natur selbst sein
eigenes Ideal zuzuschreiben (vgl. JGB 9, KSA 5, S. 9).
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
143
schen Metapher verpflichteten Begriff der Vernunft verwendete Nietzsche schon in
Menschliches, Allzumenschliches, im Aphorismus „D e r B a u m d e r M e n s c h h e i t
u n d d i e V e r n u n f t “ (MA II, WS 189, KSA 2, S. 635 f.). Dank einer bloßen Umkehrung
des Gegensatzes ‚Vernunft – Instinkt‘ gelinge es „dem historischen Kopfe“, die
Menschheit als „Ameisen-Wesen mit seinem kunstvoll gethürmten Haufen“ darzustellen. Aber nur „oberflächlich beurtheilt“ „würde das gesammte Menschenthum gleich
dem Ameisenthum von ‚Instinct‘ reden“. „Bei strengerer Prüfung“ sehe man dagegen:
„Auch die Ameisen irren und vergreifen sich“, weder bei Ameisen noch bei den
Menschen gibt es „einen sicher führenden Instinct“. Es handle sich immer um ein
Ausprobieren, bei dem Schaden und Leiden, aber auch Klugheit entstehen. Die
Klugheit (auch ein kantischer Begriff) ist hier ein Gegen-Begriff zu beiden, zur Vernunft und zum Instinkt. Sie ist kein Vermögen und keine Naturanlage, sondern bloß
ein Produkt des Irrens und des Sich-Vergreifens, das beiden Begriffen Beweglichkeit
verleiht. Erst durch diese Umdeutung des alten Gegensatzes kann man „der grossen
Aufgabe i n ’ s G e s i c h t s e h e n “. Sie ist die vor der Menschheit stehende Aufgabe,
„die Erde für ein Gewächs der grössten und freudigsten Fruchtbarkeit v o r z u b e r e i t e n “ – eine „Aufgabe der Vernunft für die Vernunft“.
Wenn aber die Vernunft eine Aufgabe ist, so kann sie auch verfehlt werden. Sie
kann zu einem „dauernde[n] Selbstmorde der Vernunft“ werden, z. B. durch den
christlichen Glauben, aber auch zur „Selbst-Überwindung der Vernunft“.115 Beide
Urteile – „Selbstmord“ oder „Selbst-Überwindung“ – verbergen jeweils eine Perspektive, und die „Objektivität“ des Erkennenden fordert ihn heraus, keine der anderen
vorzuziehen, sondern beide als Interpretationen anzusehen, die zwar nicht beliebig,
jedoch mit der Zeit und den Plausibilitäten von heute verbunden sind. Hierdurch wird
die ganze Vorentwicklung als zielgerichtete Bewegung gedeutet, so wie sie auch als
verfehlte Aufgabe bewertet werden kann. Diese Bewertung kann jedoch immer wieder
umgewertet werden. Der „Selbstmord“ kann tragisch verstanden werden. Aber auch
die Tragödie, der „jede Philosophie im Entstehen“ verpflichtet zu sein scheint, kann
in die „ewige Komödie des Daseins“ (FW 1, KSA 3, S. 372) einbezogen werden. Dafür
ist eine neue, „fröhliche Weisheit“ erforderlich. Wer sie beherrscht, kann die ganze
tragische Vorgeschichte als Vorspiel und Vorbereitung, als großes Versprechen, als
„edle Kinderei und Anfängerei“ (JGB Vorrede, KSA 5, S. 11), als „prachtvolle Span-
115 Beide Ausdrücke in den oben zitierten Stellen aus Jenseits von Gut und Böse und aus dem ungefähr
zu derselben Zeit entstandenen Nachlassnotat sind auf Pascal und seine Deutung des christlichen
Glaubens bezogen. Bemerkenswerterweise wird Kant in einem früheren Nachlassnotat in Zusammenhang mit Pascal und seiner Aufopferung des Intellekts „zu Gunsten des christlichen Glaubens“
erwähnt. Kant hätte zwar ähnliche Hintergedanken wie Pascal, aber „bei allen Bewegungen seines
Kopfes“ erscheine „seine Seele“ „neben der Pascal’s“ als „dürftig“ (Nachlass, Ende 1880, 7[34], KSA 9,
S. 325). Die oben zitierte Charakterisierung Kants als „feine[n] Kopf“ und „pedantische Seele“ ist somit
nicht unbedingt als Lob zu verstehen.
144
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
nung des Geistes“ (JGB Vorrede, KSA 5, S. 12 f.) in der eigenen Genealogie, in der
Genealogie eines „guten Europäers“, aufheben.116
Von Menschliches, Allzumenschliches bis zur Genealogie der Moral sucht Nietzsche
nach einer Formel, die nicht bloß die Gegensätzlichkeit der Werte als fundamentale
Paradoxie darstellt (denn dies war schon von Kant deutlich genug gemacht worden),
sondern die Moral selbst in ihrer doppelten Bewegung, in den zwei Optionen – des
Selbstmordes und der Selbstüberwindung – auffassen ließe. Er experimentiert mit
den Ausgangsunterscheidungen der kantischen Philosophie, indem er sie auf sich
selbst anwendet. Will man z. B. unsere Sinnesorgane als Erscheinungen im Sinne
Kants verstehen, kommt man durch reductio ad absurdum zu dem Schluss, „unsre
Organe“ seien selbst „das Werk unsrer Organe“ und so eine Art „causa sui“ mit allen
spinozistischen Konnotationen (JGB 15, KSA 5, S. 29). Setzt man, um ein weiteres
Beispiel zu nennen, die Freiheit des vernünftigen Willens seiner empirisch-pathologischen Unfreiheit entgegen und wendet diese Unterscheidung auf die Vernunft selbst
an, kann man eine Tat weder als frei noch als unfrei bestrafen (MA II, WS 23, KSA 2,
S. 557 f.). In seiner genealogischen Untersuchung will der spätere Nietzsche (im Unterschied zum früheren Nietzsche in Menschliches, Allzumenschliches) die letztere Paradoxie nicht bloß als Widerspruch („Ihr dürft nicht strafen, ihr Anhänger der Lehre
vom ‚freien Willen‘, nach eueren eigenen Grundsätzen nicht!“ (MA II, WS 23, KSA 2,
S. 558)), sondern positiv als folgenreiche Bewegung deuten. Die Gerechtigkeit, die aus
dieser Paradoxie entstanden ist, „endet wie jedes gute Ding auf Erden, s i c h s e l b s t
a u f h e b e n d “ (GM II, 10, KSA 5, S. 309).117 Die Selbstaufhebung wurde für Nietzsche
zu derjenigen Formel („gesetzt, dass ihr eine Formel wollt“ (M Vorrede 4, KSA 3,
S. 16)), die die doppelte Offenheit der Genealogie, in Richtung der vielfältigen „Quellen“ und in Richtung der zukünftigen Fortentwicklung, darstellen konnte. Sie ließ
gerade eine doppelte Deutung zu: Der „Selbstmord“ konnte jederzeit in das Zeichen
der Größe und der Selbstüberwindung umgedeutet werden.118 Indem Nietzsche diese
116 Dass es sich um keine „Fortentwicklung“ handelt, sondern um eine bewusste Umwertung und
eine Geschichte mit offenem Ende, zeigt sich schon daran, dass die Tragödie der Philosophie mit ihrem
Martyrium um die Wahrheit mal als Vorspiel und edle Kinderei, mal als „Nachspiel-Farce“ (JGB 25,
KSA 5, S. 43) dargestellt wird. Nietzsche wollte mit diesem scheinbaren Widerspruch offensichtlich
einer Vereinzelung der Perspektiven entgehen, die seine Genealogie wiederum zur Historie machen
würde.
117 Die „Selbstaufhebung der Gerechtigkeit“ in der Gnade, die Nietzsche als „Vorrecht des Mächtigen“, als „sein Jenseits des Rechts“ bezeichnet, wäre für Kant gerade, trotz der Unvermeidlichkeit des
„Übels“, d. h. der eventuellen Ungerechtigkeit des Rechts, unakzeptabel und für das Recht zerstörerisch. Das Begnadigungsrecht nennt Kant daher das „schlüpfrigste“ unter allen Rechten des Souveräns
und lässt es nur für Taten zu, die sich gegen den Souverän selbst richten (MS, AA 4, S. 337).
118 Die etymologische Mehrdeutigkeit des Begriffs der Aufhebung ist hier von Bedeutung. Etwas
aufzuheben bedeutet nicht nur, etwas abzuschaffen, sondern auch, es aufzubewahren oder „etwas
wichtig zu machen“ (vgl. „ohne Aufhebens“, „viel Aufhebens machen“). Zur etymologischen Herkunft
der letzteren Bedeutung aus dem Ritual der Fechter s. bspw. den Artikel „aufheben – info“ in: Wahrig
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
145
Formel schließlich auf die Moral anwendete, kommt er zu seiner berühmten These
von der Selbstaufhebung der christlichen Moral durch die von ihr erzeugte Moralität.
Die Figur der Selbstaufhebung der Moral aus der Moralität kommt sowohl in den
veröffentlichten Werken als auch im Nachlass in der Zeit zwischen Herbst 1886 und
Sommer 1887 mehrmals vor, vor allem in der neuen Vorrede zur Morgenröthe, in der
Genealogie der Moral und im fünften Buch der Fröhlichen Wissenschaft.119 Deutlich
erkennt man ihre Schlüsselrolle in den Nachlassnotaten: Sie steht in der unmittelbaren Nähe des berühmten Lenzer-Heide-Entwurfs zum europäischen Nihilismus
(Nachlass, Sommer 1886–Herbst 1887, 5[72], KSA 12, 217, vgl. KGW IX/3, S. 28). Später,
in Ecce homo, spricht Nietzsche von der „Selbstüberwindung der Moral aus Wahrhaftigkeit“ in ihm selbst und in seinem Zarathustra (EH Schicksal 3, KSA 6, S. 367).
Diese doppelte Formel der Selbstaufhebung der Moral aus Moralität und der Selbstüberwindung der Moral aus Wahrhaftigkeit, so meine These, sollte nicht nur das Fazit
seiner Kritik der abendländischen sokratisch-kantisch-christlichen Moral, sondern
auch seine Antwort auf die Frage nach dem Wert der Moral sein. Sie sollte auf
Nietzsches eigene Plausibilitäten als Alternative zur herrschenden Moral verweisen.
Die Selbstaufhebung wird bei Nietzsche bewusst paradox aufgefasst. Sie entspringt, wie auch die kantischen Paradoxien, einem Willen, die letzten Konsequenzen
aus eigenen Bewertungen zu ziehen. Dies ist der Wille zum Untergang. Aus der
Perspektive des Lebens – und diese Perspektive ist als Gegen-Perspektive zu jedem
„Für und Wider“ immer erneut zu bedenken – bedeutet der Untergang dennoch einen
neuen Anfang, eine Selbstüberwindung.
Alle grossen Dinge gehen durch sich selbst zu Grunde, durch einen Akt der Selbstaufhebung: so
will es das Gesetz des Lebens, das Gesetz der n o t h w e n d i g e n ‚Selbstüberwindung‘ im Wesen
des Lebens, — immer ergeht zuletzt an den Gesetzgeber selbst der Ruf: ‚patere legem, quam ipse
tulisti.‘ Dergestalt gieng das Christenthum a l s D o g m a zu Grunde, an seiner eignen Moral;
dergestalt muss nun auch das Christenthum a l s M o r a l noch zu Grunde gehen […]. (GM III, 27,
KSA 5, S. 410)120
digital – Deutsches Wörterbuch: der deutsche Wortschatz in über 260.000 Stichwörtern, Anwendungsbeispielen und Redewendungen
119 Zu Nietzsches Figur der Selbstaufhebung, u. a. im Unterschied zur hegelschen s. Werner Stegmaier, Hegel, Nietzsche und Heraklit, bes. S. 126 ff; Werner Stegmaier, Nietzsches „Genealogie der Moral“,
S. 205 ff.; Werner Stegmaier, Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche, S. 299 f., 314 ff.; Claus
Zittel, Selbstaufhebungsfiguren bei Nietzsche. Im Unterschied zu Stegmaier deutet Zittel die Selbstaufhebung einerseits eher im Sinne eines Untergangs (s. z. B. S. 96), andererseits versteht er sie in einem
viel breiteren Sinne: Auch die apollinisch-dionysische Differenz wird als eine Art Selbstaufhebung
gedeutet (S. 20 ff.). Ich bleibe bei dem engeren Sinn des Begriffs, den Nietzsche für die Beschreibung
des inneren Kampfes innerhalb des Christentums verwendete.
120 Zur Gleichsetzung des christlichen Glaubens und der kantischen Moral aus Vernunft bei Nietzsche
werden wir noch mehrmals zurückkehren. Aus der Perspektive der russischen Philosophie wäre hier
eine Entgegensetzung viel angemessener. Die Differenzen sind in diesem Punkt, wie sich in den
nächsten Kapiteln zeigen wird, entscheidend. Von der Seite der Theologie wurden dennoch mehrmals
146
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Dies sind die berühmten Worte aus der Genealogie der Moral, die die Abhandlung
kurz vor deren Schluss zusammenfassen. Es ist die Beantwortung der Frage „W a s , in
aller Strenge gefragt, hat eigentlich über den christlichen Gott g e s i e g t ?“ Nietzsche
zitiert dabei sich selbst, nämlich Die fröhliche Wissenschaft, wo „die christliche
Moralität selbst, die Beichtväter-Feinheit des christlichen Gewissens, übersetzt und
sublimiert zum wissenschaftlichen Gewissen, zur intellektuellen Sauberkeit um jeden
Preis“, als die Kraft herausgestellt wurde, die sich schließlich gegen den christlichen
Glauben wendet, als „Lügnerei, Feminismus, Schwachheit, Feigheit“ (GM III, 27,
KSA 5, S. 409 f.). Das war ein „schwer errungener Sieg des europäischen Gewissens“,
„der folgenreichste Akt einer zweitausendjährigen Zucht zur Wahrheit, welche am
Schlusse sich die L ü g e im Glauben an Gott verbietet“ (FW 357, KSA 3, S. 600). Die
Unterscheidung von Wahrheit und Lüge, von Gut und Böse, von Vernunft und Unvernunft wird auf den Glauben an die Wahrheit, auf die Voraussetzung der vollkommenen Güte Gottes, auf „das Vertrauen auf die Vernunft“ selbst angewandt (M Vorrede 4, KSA 3, S. 15).
Die Selbstaufhebung der Moral musste so mit den Schlüsselbegriffen der Moral
aus Vernunft beschrieben werden – Wahrheit, Glaube, Gewissen. Das sind allerdings
auch Begriffe, die eine lange theologische Genealogie nachweisen können. Die Selbstaufhebung der Moral setzt die Selbstaufhebung des christlichen Glaubens fort. Der
Genealoge der Moral will mit seiner Formel der Selbstaufhebung jedoch nicht bloß
den Untergang des christlichen Glaubens verkünden, er will auch die in ihm verborgenen Möglichkeiten einer Umdeutung und Fortentwicklung – einer Selbstüberwindung – freisetzen.
Der christliche Glaube und das intellektuelle Gewissen
Den Glauben erhob Luther im Prinzip „sola fide“ zur alleinigen Bedingung der Erlösung, die jedem Menschen zugänglich sein soll. Wie wird hier der Glaube verstanden?
Es ist der Glaube an ein zentrales Dogma des Christentums, an die Tatsache der
Erlösung, der die Gewissheit gibt, dass der Gläubige der Erlösung teilhaftig wird. Dieser
Versuche gemacht, bspw. Luther als Vorläufer der kantischen Moralphilosophie darzustellen. Vgl. die
These von Karl Holl, dessen Werke in mehreren Hinsichten für die evangelische Theologie des 20. Jahrhunderts maßgebend wurden: „Man hat schon, um Luther zu loben, gesagt, er hätte etwas von Kants
kategorischem Imperativ geahnt. Damit wird der geschichtliche Tatbestand auf den Kopf gestellt. In
Wirklichkeit hat Kant nur wiedergefunden, was Luther längst vor ihm gesehen hatte. Und Kant hat nur
ein Stück davon wiedergefunden“ (Karl Holl, Luther und Calvin, S. 72). Holls These sieht schon
deswegen zweifelhaft aus, weil der tiefe Sinn der Sittlichkeit ihm zufolge darin bestehe, dass das Gute
„aus dem Affekt“ hervorgebracht und nach den Absichten gemessen werden soll, was, wie schon klar
gezeigt wurde, ein wesentlicher Rückschritt gegenüber der kantischen Argumentation gewesen wäre.
Weder Affekt noch Absicht können nach Kant den Maßstab des Moralischen ausmachen.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
147
Glaube als Gewissheit im Fürwahrhalten konnte allerdings selbst nur als Wunder bzw.
als Gabe Gottes und ausschließliches Tun der göttlichen Gnade gedacht werden, die
keinem anderen Maßstab unterliegt und allein die Gewissheit des Heils garantiert.121
Daraus entstand das Problem des Unglaubens, der als Verweigerung der Gabe keine
Entscheidung des Menschen sein kann und dennoch von ihm verantwortet und an ihm
bestraft werden soll. Jean Calvins These, dass es sich bei der Festigkeit des Glaubens
um eine Unergründlichkeit der göttlichen Vorsehung in der Prädestinierung der Seele
zur ewigen Errettung oder Verdammnis handle, war nur eine konsequente Schlussfolgerung aus dem lutherischen Begriff des Glaubens, der ein Geschenk und gleichzeitig die einzige Bedingung des Heils sein soll.122 Luther dagegen versuchte dieser
Schlussfolgerung zu entgehen, indem er alle Menschen als im „Unglauben eingeschlossen“ verstand und daher das göttliche Erbarmen als Wunder der Gnade darstellte, dem der Mensch schlicht vertrauen muss.123 Im Unglauben sind wir alle Sünder, und
da Gott allein in uns das Gute bewirken kann, indem er den Glauben schenkt, ist seine
Gnade unerforschlich. Zwar erscheint dieser Sachverhalt den Menschen ungerecht,
dennoch soll er als Ausdruck göttlicher Gerechtigkeit gedeutet werden.124 In dem
berühmten Streit mit Erasmus über die Freiheit des Willens bezeichnete Luther mit
einem Hinweis auf Augustinus die ungeheure Ungerechtigkeit, dass Gott das Gute, das
er selbst hervorbringt, belohnt, den Mangel des Guten aber bestraft, als Paradoxon,
das, da es von Gott selber komme, mit Ehrfurcht angenommen werden müsse.125 Nietzsche spielt genau auf diese Stelle an, wenn er die „Lutherische Verwegenheit“ lobt:
121 Luther begründete diese These bekanntlich mit einer Stelle aus dem Römerbrief: „Denn wir
urteilen, daß <der> Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke“ (Römer 3; 28).
Dazu Luther: „Wer Werke vollbringt, mag heilig sein, weise sein, gerecht sein, mag sein, was er will –
wenn der Glaube fehlt, bleibt er unter dem Zorn und wird verdammt“ (Martin Luther, Thesen für fünf
Disputationen über Römer 3, 28 (1535–1537), hier die These 63, S. 411). Zum Begriff des Glaubens bei
Luther s. Martin Seils, Glaube. Seils hebt vier Momente des lutherischen Glaubensbegriffs hervor: Der
Glaube ist Gabe, er ist Ergreifen (fides apprehensiva Christi), er ist persönliches Heil und er ist eine
„unverbrüchliche Gewißheit“. „Nur die im Glauben entstehende Gewißheit läßt das göttliche Geben in
Christus sich erschließen, läßt Christus als Heilsgabe hinnehmen […].“ (S. 24)
122 Vgl. dazu den Theologen Karl Holl: „Nur wenn man sie beide [Luther und Calvin] zusammenstellt,
kommt das Ganze zum Ausdruck, was die Reformation für die Begründung des religiösen Idealismus
geleistet hat“ (Karl Holl, Luther und Calvin, S. 78). Zwar stellt Holl Luther als radikalsten Denker der
reformatorischen Sittlichkeit dar, muss aber zugestehen, dass „Calvin über ihn hinausgegangen“ ist,
indem er „tiefer beim Gottesbegriff“ ansetzt (S. 79). Vgl. Tillichs These, dass Calvin über Luther in der
Geistesgeschichte des Protestantismus völlig gesiegt habe (Paul Tillich, Gesammelte Werke, Bd. 7: Der
Protestantismus als Kritik und Gestaltung, Schriften zur Theologie I, S. 207).
123 Vgl. Luther, Thesen für fünf Disputationen, Thesen 62, 64, S. 411.
124 Luther spricht zunächst von einem Ausdruck der Barmherzigkeit. Deren Bezug auf die Gerechtigkeit wurde jedoch erst bei seinen Kritikern problematisch. Nach Luther erwies sich die Barmherzigkeit
in der Idee der Heilsgenügsamkeit Christi als gerecht.
125 Martin Luther, Vom unfreien Willensvermögen, S. 280 f. Auch im Weiteren spricht Luther von den
Paradoxien, die, wenn sie von den Menschen kämen, keine Beachtung verdienen würden. Da sie aber
148
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
[W]enn man durch Vernunft es fassen könnte, wie der Gott gnädig und gerecht sein könne, der so
viel Zorn und Bosheit zeigt, wozu brauchte man dann den G l a u b e n ? (M Vorrede 3, KSA 3, S. 15)126
Das Unbegreifliche des Glaubens soll trotz der damit verbundenen Paradoxien als
Gewissheit eigener, persönlicher Erlösung akzeptiert bzw. „ergriffen“ werden. Man
erkennt schon in diesem Begriff des Glaubens die spätere paradoxe Formel, mit der
Kant seine Untersuchung des Moralischen krönte: Das Unbegreifliche der Vernunft
wird im Glauben (aus praktischen Gründen) wiederum begriffen.
Der lutherische Begriff des Glaubens sollte auf diese Weise eine Gewissheit des
persönlichen Heils verschaffen, zu der keine Werke fähig wären, eine Gewissheit,
welcher der Begriff des freien Willens im Wege zu stehen schien.127 Die Konsequenzen
dieses verwegenen Schritts, den Glauben zur einzigen Bedingung des Heils zu erheben, waren jedoch zweideutig. Die Moralität bzw. die Sündhaftigkeit der Taten und
Absichten sollten nun als sekundär gegenüber der Gewissheit im Glauben an die
Tatsache der eigenen Erlösung angesehen werden. Einerseits wird dadurch die persönliche Hinwendung zu Gott und das Vertrauen in seine Gnade befürwortet, andererseits aber sollte gerade dieser Begriff des Glaubens für stetige Unruhe sorgen.128 Denn
der Glaube wird so selbstbezüglich: Er soll eine Gewissheit über die Gewissheit sein,
die wiederum eine Gewissheit über die Gewissheit verschaffen soll usw. ad infinitum.
Damit jedoch erwies sich die Sicherheit als unerreichbar: Denn wird ein solcher
Glaube einmal auf seine Gewissheit hinterfragt, muss er sich seine Schwäche eingestehen und so dem Zweifel die Türen öffnen.129 Im Anschluss an das reformatorische
Verständnis, wenn auch im Gegensatz zu den ursprünglichen Intuitionen seiner
Stifter, wird der Glaube später als Gewissheit im Fürwahrhalten gedeutet, die zwar
von derselben Qualität wie das Wissen ist, diesem gegenüber aber mangelhaft
von Gott kommen, dürfen sie nicht, wie Erasmus es tat, einer Kritik unterworfen werden (S. 289 f.). Das
Problem der paradoxen Vereinigung der Idee der christlichen Freiheit (Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520) mit dem Begriff des unfreien Willens (De servo arbitrio, 1525), wie es im Streit gegen
Erasmus und seine Diatribe (1524) zum Ausdruck kam, kann hier nicht in seiner ganzen Komplexität
erörtert werden.
126 Vgl. „Wenn ich also auf irgendeine Weise begreifen könnte, wie dieser Gott barmherzig und
gerecht sein kann, der so großen Zorn und so große Ungerechtigkeit beweist, wäre der Glaube nicht
nötig“ (Luther, Vom unfreien Willensvermögen, S. 287).
127 Kant kehrte zum Begriff des freien Willens zurück. Dennoch stellte sich auch ihm dieselbe
Schwierigkeit, das Moralisch-Gute als freie Tat der Willkür zu deuten. Er musste dafür die Freiheit des
Willens von ihrem konkreten Gebrauch unterscheiden. Zur Deutung der Kontinuität zwischen Kant
und Luther bei Nietzsche s. Grau, Kritik des absoluten Anspruchs, S. 91 ff.
128 So stehen z. B. bei Calvin die Gewissheit des Glaubens und die Beunruhigung nebeneinander.
S. dazu Seils, Glaube, S. 161 f.
129 Vgl. „Dem Gläubigen steht es nicht frei, für die Frage ‚wahr‘ und ‚unwahr‘ überhaupt ein Gewissen
zu haben: rechtschaffen sein an d i e s e r Stelle wäre sofort sein Untergang“ (AC 54, KSA 6, S. 237).
Diesen Gedanken versteht Nietzsche als seine Errungenschaft „in der Psychologie der Überzeugung,
des ‚Glaubens‘“ (AC 55, KSA 6, S. 237).
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
149
bleibt.130 Der wahre Glaube Luthers, der das persönliche Heil garantieren sollte, wird
so zur Gewissheit, dass etwas für wahr gehalten werden muss, was dem Zeugnis der
Sinne, dem Zeugnis der „Natur und Geschichte“ stets widerspricht oder zumindest
durch sie niemals bestätigt werden kann. Der unvermeidliche Zweifel am Glauben
bedeutet für den Gläubigen jedoch Zweifel an der Gewissheit der persönlichen Erlösung, im nächsten Schritt auch Zweifel daran, dass so etwas wie Erlösung überhaupt
möglich ist. Denn wie sollte sie sicher oder auch nur möglich sein, wenn Gott selbst
durch Natur und Geschichte „die Witterung einer Unmoralität“ zulässt (M 91, KSA 3,
S. 85), wenn er „so viel Zorn und Bosheit“ zeigt? Der Glaube, verstanden als von Gott
garantierte und zugleich geforderte Gewissheit im Fürwahrhalten, muss den Glaubenden früher oder später dazu bringen, einen Einwand an Gott zu richten, dass er sich
deutlicher ausdrücken, dass er moralischer handeln soll, wenn er wirklich will, dass
man an ihn glaubt. Wenn er dies nicht tut, würde der Glaube nicht mehr bestehen
können.131
Wir kommen somit zu einer der wichtigsten Plausibilitäten des reformatorischen
Denkens, die Nietzsche zufolge entscheidend für die Selbstaufhebung des christlichen
Glaubens gewesen war: zum absoluten Wert der Wahrhaftigkeit. Der rechtfertigende
Glaube wird als Glaube an die Wahrheit eines Urteils verstanden, das selbst gewiss
ist.132 Der Wille zur Wahrheit ist im Begriff des Glaubens, der zugleich Gewissheit und
Heilsbedingung sein soll, schon immer inbegriffen.133 Die Forderung nach Gewissheit,
130 Das komplexe theologische Themenfeld des Antagonismus von Glaube und Vernunft, der seit den
scholastischen Diskussionen im Mittelalter bis hin zur päpstlichen Enzyklika „Fides et ratio” immer
wieder erörtert wurde, kann hier nicht in Betracht gezogen werden. Für Nietzsche ist das „Absurdum”
in jedem „Credo” schon vorhanden, und so interpretiert er Luther als das Auftreten der „deutsche[n]
Logik in der Geschichte des christlichen Dogmas“ (M Vorrede 4, KSA 3, S. 15). Die reformatorische
Forderung einer persönlichen Sicherheit im Glauben macht Nietzsche zufolge diesen Glauben allerdings besonders empfindlich für das „Absurdum“ und führt dazu, dass er sich von der Vernunft stark
angegriffen fühlt.
131 Als innere Zerrissenheit zwischen dem Religiösen und dem Ethischen findet sich dieser Gedanke
bei Kierkegaard wieder. Zur Idee der das Christentum von innen her bedrohenden äußersten Redlichkeit, die sich in seinen konfessionellen Spaltungen zeigt, mit Blick auf Nietzsche und Kierkegaard s.
Grau, Kritik des absoluten Anspruchs, bes. S. 40 ff. Dem Begriff des Glaubens wird allerdings bei Grau
keine besondere Aufmerksamkeit zuteil.
132 Die Vorstellung von Gott als Quelle aller Wahrheit, als Instanz, von der alle wahren Urteile
herrühren, ist tief in der mittelalterlichen Theologie verwurzelt. Dennoch wird erst bei den protestantischen Denkern der Gewissheit im Fürwahrhalten eine außerordentliche Bedeutung für das Heil der
Seele zugeschrieben, indem der Glaube zur Bedingung der Erlösung erhoben wird. Dagegen hat bspw.
Thomas von Aquin die Übereinstimmung des Willens auch mit der eventuell irrenden Vernunft für
sittlich gut gehalten, sofern der Irrtum nicht aus Nachlässigkeit erfolgte. Nicht das Fürwahrhalten,
sondern das Sich-Ausrichten des Willens auf das subjektiv verstandene Gute sei als Bedingung des
Heils zu verstehen, d. h. die Werke (vgl. Thomas von Aquin, Summ. theol., I–II, q. 19, a. 5).
133 Es muss dennoch zugleich darauf hingewiesen werden, dass diese Deutung, obgleich dem
lutherischen Begriff des Glaubens entsprungen, nicht von Luther intendiert war. Denn für Luther stellte
der Glaube nicht bloß ein Fürwahrhalten, sondern auch eine vertrauensvolle Zuwendung zum barm-
150
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
nach sicheren Gründen des Fürwahrhaltens zeigt sich als allerpersönlichste Not des
Glaubenden. Die Ungewissheit wird zum Mangel, der Zweifel zum Unheil. Beide müssen
im Namen der Wahrhaftigkeit als Unvermögen des Glaubens eingestanden werden.
Hier kommt das Gewissen ins Spiel. Es sorgt für die Wahrhaftigkeit des Gläubigen.
Wenn er keine Gründe für sein Fürwahrhalten einsehen, keine Garantien für die
Wahrheit seines Urteils finden kann, dann gebietet ihm sein Gewissen, im Namen der
Wahrhaftigkeit auf den diese Wahrhaftigkeit fordernden Glauben selbst zu verzichten.
Damit schließt sich der Kreis: Der Glaube als gefordertes Überzeugt-Sein von einem
Urteil, der Glaube, der die Wahrheit als Fürwahrhalten zum Maßstab des persönlichen
Heils erhebt, versperrt die Möglichkeit, an diese Wahrheit zu glauben.134
Und in noch einer Hinsicht wurde der Glaube paradox. Die persönliche Erlösung
sollte durch den persönlichen Glauben gesichert werden. Dieser Glaube, indem er
Garantien der Erlösung verlangte und jede Unsicherheit bekämpfte, musste aber den
Anspruch auf allgemeine Gültigkeit erheben.135 Denn auch wenn der Glaube nach
herzigen Gott dar, dessen Gerechtigkeit für die Menschen unergründbar bleibt. Damit wurde die Frage,
wie der Unglaube möglich ist, für Luther sekundär. Den Zweifel fasste er bloß als Schwäche und
Ausdruck der Sündhaftigkeit des Fleisches, nicht als Problem des Glaubens auf (vgl. Seils, Glaube,
S. 84 ff.). Wie Reinhard Slenczka überzeugend darlegt, bewegt sich die lutherische „Unterscheidung
von rechtem und falschem Glauben“, trotz seiner späteren Deutung des Glaubens als „grundlose[r]
Heilsgewißheit“, „nicht auf der Linie von Zweifel und Gewissheit, sondern ihr Kriterium ist die
Bestimmung durch Christus und die Beziehung zu ihm“ (Reinhard Slenczka, Glaube, S. 324). Trotz aller
feinen Differenzierungen seitens der Theologie bleibt dennoch das lutherische „Ergreifen“ der „wirkliche[n] Wirklichkeit Christi als [der] zur Rechtfertigung vollgenügsame[n] Wirklichkeit“ ein Urteil und
muss als ein Fürwahrhalten verstanden werden. Der entgegengesetzten Argumentation von Martin
Seils, dass es sich dabei nicht um einen „kognitiven Akt“ handele, kann ich daher nicht zustimmen
(Seils, Glaube, S. 55 f., mit entsprechenden Hinweisen auf die Polemik). Denn da der Glaube auch bei
Luther nur unter der Bedingung der Heilsgewissheit gedacht werden kann (Seils, Glaube, S. 25), muss
er beim ersten Zweifel ins Schwanken geraten. Das Vertrauen in Gott ruht so auf der zweifelsfreien
Gewissheit, die es doch selbst erst garantiert. Im Laufe der Geschichte trat dieses Glaubensverständnis
immer weiter in den Vordergrund und sorgte dafür, dass das Paradoxe im lutherischen Begriff des
Glaubens sich gegen den Glauben selbst richtete. Bei Calvin kann Seils „eine gewisse kognitive
Akzentuierung“ nicht bestreiten (Seils, Glaube, S. 160 ff.). Zur reformatorischen Voraussetzung des
Erkenntnischarakters der Religion vgl. auch Lötzsch, Vernunft und Religion im Denken Kants, S. 192, s.
auch die weiteren Literaturhinweise dort. Bezeichnenderweise deutet Hegel den religiösen Glauben als
„die erste besondere Form d[er] Gewißheit“, obzwar die letztere bei ihm als „die ungetrennte Einheit“
von Gott und wissendem Subjekt zu verstehen ist. Dieser Glaube ist zwar kein Überzeugt-Sein im Sinne
eines Urteils, er kann aber dem Wissen trotzdem nicht entgegengesetzt werden (Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion I: Begriff der Religion, S. 95).
134 Schon in Menschliches, Allzumenschliches hat Nietzsche es als Tragödie bezeichnet, „dass man
jene Dogmen der Religion und Metaphysik nicht g l a u b e n kann, wenn man die strenge Methode der
Wahrheit im Herzen und Kopfe hat“ (MA I, 109, KSA 2, S. 108).
135 Vgl. die These von Karl Holl, dem zufolge Luthers theologischer Ansatz eine Situation zu
bewältigen versucht habe, in der „der Gedanke des Sittlichen als eines Allgemeingültigen […] sich
aufzulösen“ drohte. Luther habe diese Allgemeingültigkeit im Glauben wiederhergestellt (Holl, Luther
und Calvin, S. 69).
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
151
Luther für den Einzelnen unsicher werden kann, ungewiss darf er niemals sein. Die
Gewissheit des Glaubens wird somit als objektiv, die Unsicherheit des Einzelnen als
bloß subjektiv und mangelhaft gedacht.136 Der Glaube, der für sich die Gewissheit
beansprucht, muss so die Grenzen des individuellen Fürwahrhaltens überschreiten.
Man darf nicht bloß bei „seiner“ Wahrheit bleiben, denn eine individuelle Wahrheit
bietet gerade keine Sicherheit, sie ist alles andere als gewiss. Derjenige, der die
Garantien zugunsten einer objektiven Wahrheit will, muss seinen eigenen Standpunkt als Orientierungspunkt für jedermann verstehen, der nicht wieder infrage
gestellt werden kann.137 Nur dann, wenn man es, um mit Kant zu reden, als „für
jedermann gültig“, als frei von der „besonderen Beschaffenheit des Subjekts“ denken
kann (KrV B 848), kann die Sehnsucht nach Gewissheit gestillt werden. Die Sicherheit
kann somit nur ein Urteil verschaffen, das unabhängig vom eigenen Standpunkt gültig
ist. Jene lutherische Sehnsucht nach der Gewissheit des Urteils, die die persönliche
Not der Erlösung zum Ausdruck gebracht hat, kann also nur durch ihre unpersönliche Verallgemeinerung gestillt werden. Das Persönliche im Glauben wird so durch
die Forderung nach Gewissheit gerade negiert. Der Glaube als Bedingung des persönlichen Heils, der aus der auf Erlösung dringenden persönlichen Not entstand,
muss nach einem unpersönlich-allgemeinen Maßstab des Fürwahrhaltens suchen
und die Gewissheit eines solchen Maßstabs voraussetzen.
Damit ist der Rückfall in den Dogmatismus vollzogen, nunmehr verstanden als
Zeichen des Untergangs des christlichen Glaubens überhaupt. Der Glaube, der als
Bedingung des persönlichen Heils gedeutet wird, muss sich den Zweifel am eigenen
Fürwahrhalten und an seiner allgemeinen Gültigkeit, als äußerste Gefahr des Unheils,
untersagen. Er setzt sich so nicht nur mit dem Willen zur Wahrheit gleich, sondern
wird ihm gegenüber sekundär. Im Willen zur Wahrheit zeigt sich aber, so Nietzsche,
gerade die Schwäche des Glaubens, die Angst des Gläubigen vor dem Ungewissen. Ist
ein solcher Wille dann auch noch zu Wagnis und Selbstaufopferung fähig, so muss er
auf Dauer mit der nihilistischen Verzweiflung rechnen.
In einzelnen und seltenen Fällen mag wirklich ein solcher Wille zur Wahrheit, irgend ein ausschweifender und abenteuernder Muth, ein Metaphysiker-Ehrgeiz des verlornen Postens dabei
betheiligt sein, der zuletzt eine Handvoll ‚Gewissheit‘ immer noch einem ganzen Wagen voll
schöner Möglichkeiten vorzieht; es mag sogar puritanische Fanatiker des Gewissens geben,
welche lieber noch sich auf ein sicheres Nichts als auf ein ungewisses Etwas sterben legen. Aber
136 S. Seils, Glaube, S. 86. Wie Seils betont, ist die Unsicherheit nach Luther als Sünde an der Gewissheit des Glaubens und als Zeichen des Unheils zu verstehen.
137 Auch der historisch-kritische Umgang mit der Heiligen Schrift ist offenkundig in diesem Zusammenhang zu sehen: Er sollte die sicheren Gründe des Fürwahrhaltens untermauern, sodass keiner sie
mehr bezweifeln könnte. Nietzsche zufolge wurde jedoch das genaue Gegenteil erreicht: Die heiligen
Bücher „geriethen […] in die Hände der Philologen, das heisst der Vernichter jeden Glaubens, der auf
Büchern ruht“ (FW 358, KSA 3, S. 603).
152
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
dies ist Nihilismus und Anzeichen einer verzweifelnden sterbensmüden Seele: wie tapfer auch
die Gebärden einer solchen Tugend sich ausnehmen mögen. (JGB 10, KSA 5, S. 23)
Erweist sich die objektive Gewissheit jener „Wahrheit“ schließlich als Anmaßung, so
wird damit die individuelle Unsicherheit, das Unvermögen zum Glauben selbst wiederum verallgemeinert und jedem Glaubenden zugeschrieben. In der Morgenröthe wird
dieser Wille zur Verallgemeinerung des Unglaubens mit Blick auf Luther „eine bäuerische Art, Recht zu behalten“, genannt: die Annahme, dass jeder so empfindet, das
Misstrauen, dass es jemandem in Fragen des Glaubens anders gehen kann, dass der
Glaube auch anders verstanden werden kann (M 88, KSA 3, S. 82 f.).138 Die Sehnsucht
nach einer Garantie für die persönliche Erlösung mündet so in dem Zweifel, dass der
Glaube überhaupt möglich sei, und in der Forderung, dass jeder sein Unvermögen, zu
glauben, zugestehen müsse. Der Glaube hebt sich so durch das Gebot der Wahrhaftigkeit selbst auf. Er wird zum Glauben an Unglauben.
Wir kehren damit zu Nietzsches Figur der Selbstaufhebung zurück. Der Glaube, der sich als Glaube an eine Tatsache versteht, als Fürwahrhalten dessen, dass,
wie Nietzsche es für sich formulierte, „e t w a s w a h r s e i n s o l l “ (Nachlass, Herbst
1887, 9[136], KSA 12, S. 413), der Glaube als Recht-Haben („ich habe recht, denn es
steht geschrieben“ (M 84, KSA 3, S. 79)) und Recht-Behalten (Sicherheit der Erlösung),
muss an der eigenen Forderung nach Gewissheit zu Grunde gehen. So geht der
christliche Glaube als Dogma zu Grunde, und nicht nur als Dogma der Religion,
sondern auch als das der Wissenschaft.139
138 Ob dies Luther selbst gerecht wird, war für Nietzsche von keiner besonderen Wichtigkeit. Vgl.
„Was hinterdrein Alles aus seiner Reformation gewachsen ist, Gutes und Schlimmes, und heute
ungefähr überrechnet werden kann, – wer wäre wohl naiv genug, Luthern um dieser Folgen willen
einfach zu loben oder zu tadeln? Er ist an Allem unschuldig, er wusste nicht was er that.“ (FW 358,
KSA 3, S. 604). Zum Zusammenhang zwischen Nietzsches Denken und Luthers Gewissensreligion s.
Emanuel Hirsch, Nietzsche und Luther; Emanuel Hirsch, Die Reich-Gottes-Begriffe des neueren europäischen Denkens: Ein Versuch zur Geschichte der Staats- und Gesellschaftsphilosophie, bes. S. 4; Arnulf
von Scheliha, Luther und Nietzsche. Verborgene Kontinuität in der Sicht Paul Tillichs und Emanuel
Hirschs. Besondere Erwähnung verdient die These, Nietzsche sei als ein „zweiter Luther“ anzusehen. S.
Jörg Salaquarda, Nachwort zu Emanuel Hirsch, Nietzsche und Luther, S. 437, s. auch dort die weiteren
Literaturhinweise (S. 438 f.).
139 Das Wort „Dogma“ wird hier nicht in spezifisch-theologischem, sondern in negativ-kantischem
Sinne (vgl. „sehr dogmatisch“ (KrV B XXX)) gebraucht. Genauso wird es auch von Nietzsche benutzt,
was allein auf die russische religiöse Philosophie sehr befremdlich wirkte. Denn die Dogmen des
Glaubens wurden hier als symbolischer Ausdruck der für die Vernunft unzugänglichen Offenbarungen
Gottes verstanden und nicht als Statuten für die theoretische Vernunft. Aus der Perspektive der
Geschichte des reformatorischen Denkens muss jedoch die kantische Verwerfung des Dogmatismus als
Fortsetzung des kritischen Willens Luthers betrachtet werden. Obwohl Luther die christliche Dogmatik
nicht als solche in Frage stellt, sondern sie im Gegenteil für alle Zeiten von der Konjunktur der Kirche
unabhängig machen wollte, wurde sie gerade durch die von ihm initiierte Bewegung immer weiter als
verabsolutiertes Fürwahrhalten, das gegenüber dem Wissen jedoch mangelhaft ist, verstanden.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
153
Doch man wird es begriffen haben, worauf ich hinaus will, nämlich dass es immer noch ein
m e t a p h y s i s c h e r G l a u b e ist, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft ruht, — dass auch
wir Erkennenden von heute, wir Gottlosen und Antimetaphysiker, auch u n s e r Feuer noch von
dem Brande nehmen, den ein Jahrtausende alter Glaube entzündet hat, jener Christen-Glaube,
der auch der Glaube Plato’s war, dass Gott die Wahrheit ist, dass die Wahrheit göttlich ist… Aber
wie, wenn dies gerade immer mehr unglaubwürdig wird, wenn Nichts sich mehr als göttlich
erweist, es sei denn der Irrthum, die Blindheit, die Lüge, — wenn Gott selbst sich als unsre längste
Lüge erweist? (FW 344, KSA 3, S. 577)140
Wenn der Glaube als Überzeugtsein von einem Urteil verstanden wird, gibt es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen dem religiösen Glauben und dem Glauben
an die Wissenschaft bzw. allen anderen Arten des Glaubens „an die V e r n u n f t i m
L e b e n “ (FW 1, KSA 3, S. 372).
Die Suche nach der Gewissheit führt unvermeidlich zur Verzweiflung an jeder Art
Wahrheit, einer Verzweiflung, die Nietzsche auch bei Kant feststellt (UB III, KSA 1,
S. 355 f.). Gerade Kant aber war derjenige, der den Glauben jenseits einer Forderung
nach Gewissheit retten wollte. Die Gewissheit wird bei ihm bloß zum Modus eines
Urteils, welches selbst nicht gewiss ist, sondern sich immer als Irrtum erweisen kann;
die Wahrheit wird zum Fürwahrhalten.141 Durch eine solche Beschränkung der Ansprüche der Vernunft versuchte Kant das christliche Dogma („Gott, Seele, Unsterblichkeit“) in praktischer Hinsicht und für praktische Zwecke zu retten, und so auch die
christliche Moralität. Der Glaube ist nun als bloß subjektiv hinreichendes Fürwahrhalten zu verstehen, das zur Handlung nötigt und ihr als Richtschnur dient.
Der praktische Vernunftglaube an das moralische Gesetz wird dennoch bei Kant
denselben Schwierigkeiten ausgeliefert wie das theoretische Wissen. Auch die Gewissheit des Fürwahrhaltens in moralischer Absicht sollte stets überprüft werden,
denn die praktische Anwendung kann für den Glauben selbst weder durchschaubar
noch sicher sein. Die moralische Urteilskraft soll die ad hoc formulierten Maximen auf
Absichten und Handlungen beziehen, deren Moralität nicht eingesehen werden kann.
Auch sie als individuelles Vermögen, das nicht gelernt, sondern nur in concreto geübt
werden kann, erzeugt keine Sicherheit. Es verhält sich, wie beim Erlösungsglauben,
genau umgekehrt. Je empfindlicher einer für die unbedingte Forderung des moralischen Gesetzes wird, desto größer wird die Kluft zwischen dem, wie gehandelt
wird, und dem, wie gehandelt werden soll. Der Vernunftglaube im konkreten Gebrauch wird so zu seinem eigenen Richter, zu einer sich selbst richtenden, moralischen Urteilskraft, die niemals Ruhe finden kann, denn „von der [Handlung], die ich
140 Nietzsche zitiert diese Stelle aus derFröhlichen Wissenschaft in der Genealogie der Moral (GM III,
24, KSA 5, S. 400 f.), wobei die Wörter „göttlich“ und „längste Lüge“ dort zusätzlich hervorgehoben
werden.
141 Der Modus der vollen Gewissheit bzw. des bloß objektiven Wissens wird von Kant als „Ahnung
des Übersinnlichen“ bezeichnet (Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie,
AA 8, S. 397). S. dazu Simon, Kant. Fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 81.
154
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
unternehmen will, muß ich nicht allein urteilen und meinen, sondern auch g e w i ß
sein, dass sie nicht unrecht sei“ (RGV, AA 6, S. 186). Dieser Leitfaden des Gewissens
bedeutet, wie im ersten Kapitel ausgeführt wurde, dass es immer das schlechte
Gewissen sein soll, das Gewissen, das sich selbst stets schuldig findet, weil gerade die
Gewissheit in Sachen des Glaubens undenkbar ist. Der kantisch-lutherische Begriff
des Glaubens als Fürwahrhalten, als Forderung der Gewissheit sorgt dafür, dass die
Erlösung durch das gute Gewissen, der Anspruch auf Glückswürdigkeit, die Überzeugung von der eigenen moralischen Vollkommenheit gerade als frevelhaft und böse
verurteilt werden muss.142 Der christliche Glaube, der aus einem Dogma zur Moral der
Wahrhaftigkeit geworden ist, der durch die „Beichtväter-Feinheit“ des christlichen
Gewissens die moralische Wahrhaftigkeit selbst zum göttlichen Prinzip erhob, wird
schließlich in einem „seltsame[n] Phänomen“ des „intellectuale[n] Gewissens“, das
„etwas Moralisches höchster Gattung“ darstellt (MA II, VM 26, KSA 2, S. 391), aufgehoben.
Das intellektuelle Gewissen ist Nietzsches Begriff, der mit dem christlich-kantischen Begriff des Gewissens verwandt ist und sich dennoch von ihm deutlich unterscheiden lässt. Das kantische „wundersame[ ] Vermögen in uns“ (KpV, AA 5, S. 98) ist
bei Nietzsche zu einem „seltsame[n] Phänomen“ geworden; die Selbstaufhebung des
Christentums in Moralität wurde durch die sich selbst richtende moralische Urteilskraft vollzogen, deren Wahrhaftigkeit nun auch die christliche Moralität aufheben
muss – im intellektuellen Gewissen. Aus der Perspektive des letzteren ist das lutherisch-kantische Gewissen selbst etwas Zweideutiges: Es ist ein Zeichen intellektueller
Sauberkeit, aber auch ein „Beweis gerade von persönlicher Erbärmlichkeit, von Unpersönlichkeit“ (FW 335, KSA 3, S. 561 f.). Das zum verurteilenden Richter gewordene
Gewissen kann als Selbst-Kasteiung, als Selbstaufhebung des Willens zum Leben in
den Nihilismus führen. Es kann aber auch in eine befreiende Hoffnung umgedeutet
werden, in „eine Krankheit, wie die Schwangerschaft eine Krankheit ist“ (GM II, 19,
KSA 5, S. 327).
Das Problem des Gewissens – „[ d ] a s i n t e l l e c t u a l e G e w i s s e n “ (FW 2, KSA 3,
S. 373 f.) und das „Gewissen hinter deinem ‚Gewissen‘“ (FW 335, KSA 3, S. 561) – wird
von Nietzsche in seiner Fröhlichen Wissenschaft mehrmals zur Sprache gebracht. Die
Anführungszeichen weisen unmissverständlich darauf hin, dass hier über den christ-
142 Der Zusammenhang zwischen der lutherischen Fokussierung auf das Gewissen und der späteren
Entwicklung der Moralphilosophie von Kant bis Nietzsche wurde von Karl Holl in seinem für die
evangelische Theologie wegweisenden Aufsatz hervorgehoben: Was verstand Luther unter Religion?.
Schon bei Luther ist das Gewissen zum grausamen Richter geworden, dessen Urteil immer als Tadel
ausfällt. Vgl. „Sein [Luthers] Selbstbewusstsein scheuchte ihn vor Gott hinweg. Er vermochte Gott nicht
ins Angesicht zu sehen, und er fühlte, daß Gott auch ihn nicht ansah. […] Er sprach sich selbst hart das
Urteil: Es geschieht mir nur Recht.“ (Holl, Luther und Calvin, S. 73) Nur Gottes Gnade konnte den
durchaus sündigen Menschen aus dieser Lage befreien. Kant ließ eine solche Möglichkeit außerhalb
der Grenzen der bloßen Vernunft nur als nicht auszuschließende Hoffnung bestehen.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
155
lich-kantischen Sinn des Gewissens hinausgegangen werden muss. Jedes „Urtheil ‚so
ist es recht‘ hat selbst eine Vorgeschichte“, es ist bloß „Sprache des Gewissens“ – die
Sprache, die verallgemeinert. Auch der kategorische Imperativ ist eine solche „Sprache des Gewissens“ für „Alle“:
Du bewunderst den kategorischen Imperativ in dir? Diese ‚Festigkeit‘ deines sogenannten moralischen Urtheils? Diese ‚Unbedingtheit‘ des Gefühls ‚so wie ich, müssen hierin Alle urtheilen?‘
(FW 335, KSA 3, S. 562)
Als „bäuerische Art, Recht zu behalten“, als „erste“ Plausibilität des lutherischen
Glaubensbegriffs und „letzte“ Grenze der kantischen Moralphilosophie müssen beide,
die Forderung nach der Sicherheit im Urteil und der Maßstab ihrer Gültigkeit für
jedermann, dem Prinzip der Wahrhaftigkeit unterliegen und sich gegenseitig aufheben. Die Forderung der unpersönlichen und deshalb sicheren Allgemeinheit ist, so
Nietzsche, schließlich nichts anderes als eine lächerliche Anmaßung angesichts der
Ungewissheit des Daseins, angesichts der gegeneinander um eine Interpretation der
Welt kämpfenden Willen. Derjenige, der Garantien zugunsten einer Wahrheit will,
will das Perspektivische der eigenen Not durch eine allgemein-unpersönliche Gewissheit eines Urteils leugnen.143 Hier kommt das intellektuelle Gewissen ins Spiel. Es
weist erbarmungslos darauf hin, dass unendlich viele weitere Schritte der Urteilskraft
möglich sein sollen; dass es viel mehr Stufen des Führwahrhaltens geben kann. Es
führt so zu einer ungeheuren Kollision „von W i s s e n u n d G e w i s s e n in der Seele der
homines religiosi“.144 Die Sehnsucht nach Gewissheit führt unvermeidlich zur Verzweiflung, die aus ihr entstandene Weisheit zur Tragödie. Es ist „die Zeit der Tragödie,
die Zeit der Moralen und der Religionen“, die die Sehnsucht nach Sicherheit erzeugt,
die Zeit des Unheils, der Verzweiflung an der Wahrheit, der Unfähigkeit zu glauben,
der Unmöglichkeit der Erlösung. Das intellektuelle Gewissen muss an diese Zeit seine
kompromisslose Forderung stellen – das große Ereignis des Untergangs des christlichen Glaubens soll zugestanden und der Tod Gottes soll verkündigt werden. Auch der
143 Daher kann ich Simon nicht zustimmen, Nietzsches Kritik des kantischen Glaubens sei bloß ein
Missverständnis gewesen, denn er gelte auch bei Kant nur auf Zeit. Vgl. Josef Simon, Aufklärung im
Denken Nietzsches, S. 464 f. Der Punkt, den Nietzsche angreift, ist nicht ein angeblich absolutes
Fürwahrhalten im Glauben (was nach Kant tatsächlich nicht stimmen kann), sondern der absolute
Wert der Gewissheit, die im Glauben angestrebt werden soll, jedoch nicht erreicht werden kann. Es ist
nicht bloß die „Einsicht, daß alles seine Zeit – und seinen Ort – hat“ (S. 465), sondern eine radikale
Umwertung des Willens zur Gewissheit. Vgl. Müller-Lauters Interpretation des moralischen Willens
zur Wahrheit als Willen zur Sicherheit. (Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze,
S. 95).
144 Nietzsches Beispiel dafür ist wieder Pascal. Um ihn zu verstehen, „müsste Einer vielleicht selbst
so tief, so verwunden, so ungeheuer sein“, und „dann bedürfte es immer noch jenes ausgespannten
Himmels von heller, boshafter Geistigkeit, welche von Oben herab dies Gewimmel von gefährlichen
und schmerzlichen Erlebnissen zu übersehn, zu ordnen, in Formeln zu zwingen vermöchte“ (JGB 45,
KSA 5, S. 65 f.), z. B. in die Formel der Selbstaufhebung.
156
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
„Schatten“ Gottes soll nun besiegt werden – die christliche Moralität (vgl. FW 108,
KSA 3, S. 467).145
Diese Entwicklung innerhalb des Christentums ist jedoch nicht alternativlos. Der
Glaube an die Wahrheit eines Urteils als Bedingung des Heils bekommt seine höchste
Plausibilität, indem Gott als Wahrheit und zugleich als letzte Gewissheit und Garantie
des richtigen Fürwahrhaltens verstanden wird. Wie später, besonders am Beispiel
Dostojewskis, noch zu zeigen sein wird, ist diese lutherisch-kantische Deutung der
christlichen Moral tatsächlich nicht alternativlos geblieben. So kann etwa die Suche
nach der Sicherheit selbst als gottlos und unchristlich angesehen werden.146 Der
Zweifel wird dann nicht als Mangel, sondern als eine unerlässliche Bedingung des
Heils gedeutet. Denn nur in der Situation der Ungewissheit ist eine existenzielle
Entscheidung überhaupt möglich. Hier bietet Gott keine Garantien, sondern tut jedem
Streben nach Gewissheit den Abbruch und fordert den Menschen heraus, mit seiner
Suche nach Garantien zu brechen. Dass Gott die Wahrheit ist, wird in diesem Falle
anders als in der abendländischen Tradition verstanden, v. a. nicht als Versicherung
des richtigen Fürwahrhaltens, nicht als Widerspiegelung der Wahrheit Gottes durch
die menschliche Vernunft, die durch diese Widerspiegelung zur Erkenntnis der objek-
145 Die vielfältigen Verhältnisse zwischen dem Gewissen und dem Glauben werden in dem Aphorismus der Götzen-Dämmerung „Z u m ‚ i n t e l l e k t u e l l e n G e w i s s e n‘“ auf besonders komplexe Weise
dargestellt (GD Streifzüge, 18, KSA 6, S. 122 f.). Hier beklagt Nietzsche u. a., dass es keine „echte
Heuchelei“ mehr gibt, wie „in d[em] Zeitalter des starken Glaubens“. Das Gewissen sei selbst für die
Heuchelei notwendig, ohne es werden Grenzen zwischen Überzeugungen nicht mehr spürbar. Diese
moderne „Toleranz gegen sich selbst“ zeigt gerade das Fehlen an intellektuellem Gewissen oder aber
sie ist das „intellektuelle Gewissen“ in Anführungszeichen, denn es kann den Glauben nur noch
vorspielen und sogar die Heuchelei nur noch nachahmen.
146 Dass die lutherisch-reformatorische Deutung des christlichen Glaubens als eines sicheren und
heilsamen Fürwahrhaltens nicht alternativlos geblieben ist, zeigte schon der alte Streit zwischen
Luther und Erasmus. Bezeichnenderweise hatte Erasmus, der für die Freiheit des Willens gegen Luther
argumentierte, einen anderen Begriff des Glaubens als Luther. Dieser Glaube sei Erasmus zufolge zwar
auch als Geschenk Gottes im Sinne eines Fürwahrhaltens zu verstehen, impliziere jedoch eine freie
Mitwirkung des Menschen, wie diese Gabe angenommen wird, und ein willentliches Streben, einen
Kampf um die Vollendung von dem, was mit dieser Gabe begonnen wurde (Erasmus von Rotterdam,
De libero arbitrio διατριβή sive collatio. Gespräch oder Unterredung „Hyperaspistes“ gegen den „Unfreien
Willen“ Martin Luthers, bes. S. 83 ff.). Er ist also etwas prinzipiell Anderes als ein Urteil bzw. ein
richtiges und sicheres Fürwahrhalten. Die Verschiedenheit im Begriff des Glaubens wurde allerdings
in diesem berühmten Streit über den freien Willen nicht ausdrücklich expliziert, sondern die konfessionell unterschiedlichen Deutungen des Begriffs wurden von beiden Seiten bloß vorausgesetzt. In der
viel späteren Konkordanz Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbundes
und der Katholischen Kirche vom Jahr 1997 war zwar eine erhebliche Annäherung der reformatorischen
Lehre „sola fide“ und des katholischen Verständnisses der Erlösung gewährleistet, dennoch zeigte
diese Erklärung ausdrücklich, dass die Differenzen u. a. im Begriff des Glaubens bestehen müssen. Vgl.
die Definition eines modernen katholischen Theologen: „Zu glauben, heißt, mit der Hypothese zu
leben, dass Gott existiert.“ (Michael Hölzl, Die Kunst der Übertretung, in: Fuge. Journal für Religion und
Moderne 4 (2009), (Der Schein des Unendlichen), S. 28)
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
157
tiven Wahrheit fähig wird.147 Dieser Satz könnte z. B., wie bei Dostojewski, in dem
Sinne verstanden werden, dass die Wahrheit nur als Person bzw. als Liebe zu einem
durch diese Person vertretenen Ideal zum Ausdruck kommen kann, dass die Wahrheit
als Person des Gottmenschen allein den Maßstab des Guten ausmacht148; oder aber,
wie bei Tolstoi, dass die Wahrheit dem Leben selbst identisch ist und deswegen
göttlich ist, d. h. sie kann niemals nach einem menschlichem Maßstab gerichtet
werden. Das würde auch bedeuten, dass der Maßstab des Guten nicht im guten Willen
bestehen kann, weder in der moralischen Handlung noch in der Absicht und auch
nicht in den Maximen der Handlung. Der Glaube an Gott, der nicht der Glaube an das
eigene Recht-Haben und das Gerechtfertigt-Sein wäre,149 müsste nicht durch „Natur
und Geschichte“ bestätigt werden, sondern gerade umgekehrt, er dürfte ihnen stets
widersprechen. Er sollte jede Forderung nach Sicherheit zurückweisen und mit aller
Gewissheit brechen können, vor allem mit der Gewissheit der eigenen Gerechtigkeit.
Indem Nietzsche sich das Schicksal nennt, an das die zukünftigen Generationen
„die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen“ werden, identifiziert auch er sich
selbst nicht mit einer Art Gewissheit, nicht mit dem Standpunkt der Gerechtigkeit,
sondern mit einer „tiefste[n] Gewissens-Kollision“ (EH Schicksal 1, KSA 6, S. 365).150
Gerade dafür steht einer seiner „starken Gegen‑Begriffe“ – das intellektuelle Gewissen. Wenn das intellektuelle Gewissen im Verlangen nach einer Gewissheit, in einer
Verallgemeinerung münden sollte, wäre seine Forderung der schonungslosen Wahrhaftigkeit auch der Anspruch, eine Stimme zu sein, die an alle gerichtet ist, die über
alle urteilen kann.151 Dies bleibt Nietzsche keineswegs unbemerkt. Im Gegenteil: Diese
Paradoxie des intellektuellen Gewissens betont er in einem der ersten Aphorismen
seiner Fröhlichen Wissenschaft. „Irgend eine Narrheit“, so Nietzsche dort, „überredet“
den Erkennenden immer wieder, „jeder Mensch habe diese Empfindungen, als
Mensch“ (FW 2, KSA 3, S. 373 f.).152 Es ist die ewige „Ungerechtigkeit“ des Erkennen147 Die Vorstellung von Gott als Versicherung des richtigen Fürwahrhaltens ist tief im abendländischen Denken verwurzelt, nicht nur in der Theologie, sondern v. a. in der Philosophie, aber auch in
den Naturwissenschaften, von Descartes bis Newton. In der Fröhlichen Wissenschaft wird nicht nur der
christliche Glaube, sondern auch der positivistische Glaube an die Wissenschaft als „V e r l a n g e n
n a c h G e w i s s h e i t“ und Ausdruck der äußersten Not und Willensschwäche gedeutet. (FW 347,
KSA 3, S. 581 ff.)
148 Dies soll im vierten Kapitel erörtert werden. An dieser Stelle kann nur ein Hinweis gegeben
werden, dass die Behauptung des Gottmenschen, er sei die Wahrheit, einen anderen Begriff der
Wahrheit impliziert als den, der für die Selbstaufhebung des Christentums in der Wahrhaftigkeit sorgt.
149 Der Luther zugeschriebene berühmte Ausspruch „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders“ kann u. a.
als Ausdruck dieser Anmaßung gedeutet werden.
150 Zur Bedeutung von dieser Selbsteinschätzung Nietzsches s. Stegmaier, Schicksal Nietzsche?
151 Vgl. die Bemerkung Nietzsches, der Standpunkt des intellektuellen Gewissens sei gerade der, von
dem aus Menschen in gut und böse geteilt werden (Nachlass, Sommer 1878, 29[10], KSA 8, S. 514).
152 Das Wort „überredet“ steht bei Nietzsche an dieser Stelle kaum zufällig. Genau dies war der Punkt
für die Unterscheidung von Überredung und Überzeugung bei Kant: „Wenn es für jedermann gültig ist,
so fern er nur Vernunft hat, so ist der Grund desselben objektiv hinreichend, und das Fürwahrhalten
158
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
den, die „Begierde und Lust des Fragens“ jedermann zuzumuten. Sein intellektuelles
Gewissen sollte ihn jedoch gerade darauf aufmerksam machen, dass auch sein „V e r l a n g e n n a c h G e w i s s h e i t “, nach den „letzten und sichersten Gründe[n] für und
wider“ nichts weiter als seine persönliche „innerste Begierde und tiefste Noth“ ist.153
Nicht ein Fürwahrhalten – sei es die Gewissheit von der Sinnlosigkeit und Unmoralität des Daseins – ist es, das den Glauben des „freien, immer freieren Geiste[s]“
ausmacht, sondern ein neues „du sollst“, das besagt:
Du solltest Gewalt über dein Für und Wider bekommen und es verstehn lernen, sie aus- und
wieder einzuhängen, je nach deinem höheren Zwecke. […] Du solltest die n o t h w e n d i g e
Ungerechtigkeit in jedem Für und Wider begreifen lernen, die Ungerechtigkeit als unablösbar
vom Leben, das Leben selbst als b e d i n g t durch das Perspektivische und seine Ungerechtigkeit.
(MA I Vorrede 6, KSA 2, S. 20)
Merken wir uns: In dieser Passage der nachträglich zu seinem früheren Werk hinzugefügten Vorrede wiederholt Nietzsche seine Definition der „Objektivität“, die er
zur gleichen Zeit in der Genealogie der Moral fast genauso auffasst. Aber mit einer
wesentlichen Akzentverschiebung: Seine „Für und Wider“ muss der „immer freiere
Geist“ als notwendig ungerecht ansehen können. Er muss jede Art Gewissheit preisgeben können, auch und vor allem den Glauben an die eigene Gerechtigkeit, auch die
Ehrfurcht vor der Forderung seines Gewissens.154 Das ist gerade das paradoxe Gebot
heißt alsdenn Ü b e r z e u g u n g. Hat es nur in der besonderen Beschaffenheit des Subjekts seinen
Grund, so wird es Ü b e r r e d u n g genannt“ (KrV A 820/B 848). Im Unterschied zu Kant betont Nietzsche, dass es sich auch in Sachen des intellektuellen Gewissens bloß um eine Überredung handle.
Schon im nächsten Aphorismus wird von der „ewige[n] Ungerechtigkeit der Edlen“ gesprochen, die als
„Ausnahme-Menschen sich selber nicht als Ausnahmen fühlen“ (FW 3, KSA 3, S. 375 f.). Zum Bezug
zwischen Erkenntnis, Redlichkeit und fröhlicher Weisheit s. Marco Brusotti, Die Leidenschaft der
Erkenntnis. Philosophische und ästhetische Lebensgestaltung bei Nietzsche von Morgenröthe bis Also
sprach Zarathustra, S. 298 ff.
153 Auf die Schwierigkeit, Nietzsches eigenes Verlangen nach Gewissheit am Anfang der Fröhlichen
Wissenschaft zu deuten, hat Walter Kaufmann hingewiesen (vgl. Walter Kaufmann, Nietzsches Philosophie der Masken, S. 118 f.). Für Kaufmann ergibt sich aus dieser Schwierigkeit jedoch nur die Frage,
wie die „intellektuelle Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit, auf die Nietzsche solch großen Wert legt, mit
seiner Philosophie der Masken in Einklang gebracht werden kann“ (S. 119). Dass diese intellektuelle
Rechtschaffenheit in Zusammenhang mit Nietzsches Kritik am Verlangen nach Gewissheit selbst ein
Problem darstellt, wird nicht weiter erörtert. Kaufmann behauptet sogar, das „Verlangen nach Gewißheit“ sei eigentlich „nicht der beste Ausdruck für das, was Nietzsche meint“ (S. 118). Dennoch wird
gerade dieser Ausdruck im zweiten Aphorismus gesperrt. Als an einen Selbstwiderspruch grenzenden
Anspruch auf Wahrheit betrachtet diese Stelle z. B. Rüdiger Bittner (Nietzsches Begriff der Wahrheit,
S. 89). Zu meiner Interpretation dieser Stelle s. ausführlicher: die Verfass., „Das intellectuale Gewissen“
und die Ungerechtigkeit des Erkennenden. Eine Interpretation des Aphorismus Nr. 2 der Fröhlichen
Wissenschaft.
154 Zu komplexen Bezügen von Ehrfurcht, Scham und Wahrhaftigkeit bei Nietzsche im Blick auf
seinen hermeneutischen Ansatz bzw. seine genealogisch-semiotischen Deutungen der moralischen
Phänomene s. Paul van Tongeren, Nietzsches Hermeneutik der Scham.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
159
seines intellektuellen Gewissens. Wer die „ewige Komödie des Daseins“ durchschaut
hat, muss sich fragen, ob jener Wille zur Gewissheit, der ihn in die Verzweiflung
getrieben hat, selbst nicht ein großer Irrtum gewesen ist, und ob er damit seine
Aufgabe nicht gerade verfehlte – die Aufgabe der immer weiter fortgesetzten Aufklärung, die „Aufgabe der Vernunft für die Vernunft“.
Die Selbstaufhebung der Moral aus Moralität wird so zur Selbstüberwindung der
Moralität aus Wahrhaftigkeit. Man darf jedoch nicht bloß bei der Wahrhaftigkeit
bleiben, so wie man auch nicht beim „Gewissen“ geblieben ist. Nur wenn es tatsächlich gelingt, die neuen Optionen des Glaubens zu entdecken, kann der Untergang in
eine Selbstüberwindung umgestaltet werden, – eines neuen Glaubens der „Heimatlosen“, die „dem Christentum entwachsen“ sind, weil sie „a u s ihm gewachsen sind“.
Dieser Glaube zwingt sie „auf’s Meer“ (FW 377, KSA 3, S. 631), d. h. fort vom „Land der
Wahrheit“, fort von aller Gewissheit. Nur wenn der Glaube jenseits der Sehnsucht
nach der allgemeinen Wahrheit, jenseits aller Forderungen nach Sicherheit neu
gefunden werden könnte, wäre auch eine neue Art der Moralität möglich – die
Moralität, die „in jedem Für und Wider“ „die n o t h w e n d i g e Ungerechtigkeit“ entdeckt und lehrt, über sie Gewalt zu haben.155
Im Begriff des intellektuellen Gewissens feiert die Moral der Wahrhaftigkeit so
ihre letzte Plausibilität und zeigt gleichzeitig ihre Ungerechtigkeit.156 Die Macht einer
Plausibilität kann nämlich nicht anders gebrochen werden als durch die aus ihr selbst
155 Zur kontextuellen Analyse des Aphorismus „W i r H e i m a t l o s e n“ s. Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 539 ff. Hier wird gezeigt, dass Nietzsche nicht zu einer Art neuen Glaubens
strebt, sondern nur „Halt im Haltlosen“ bzw. „Halt an einem Gegenglauben“ sucht. Nietzsches freier
Geist habe „sich längst zum ‚Unglauben‘ durchgerungen“ (S. 568). Im folgenden Abschnitt werde ich
versuchen, diesen Glauben bzw. „Unglauben“ eines „Heimatlosen“ näher zu definieren und ihn auf
seine Plausibilitäten hin zu untersuchen.
156 In seiner ausführlichen Untersuchung zur Frage des intellektuellen Gewissens schreibt Carl
Junge, trotz aller feinen Differenzierungen, Nietzsche selbst ohne Weiteres den Standpunkt des
Gewissens zu. Er versucht demzufolge, den aus dieser Deutung sich unvermeidlich ergebenden Widerspruch zwischen Nietzsches Kritik am Gewissensbegriff einerseits und der Forderung des Gewissens
andererseits zu lösen. Nietzsches neuer Begriff des intellektuellen Gewissens, so Junge, solle die Kritik
des Gewissens auf einer höheren Ebene der Reflexion mit einschließen, sofern er nicht auf die Normen
der Gesellschaft, sondern auf eigene „ichhafte Impulse“ abzielt (Carl Junge, Das intellektuelle Gewissen
bei Nietzsche, S. 114). Die Spannung zwischen der Forderung nach der Wahrhaftigkeit der eigenen
moralischen Überzeugungen und dem radikalen Zweifel an der Möglichkeit einer solchen Wahrhaftigkeit bleibt jedoch m. E. bestehen. Auch Junge erkennt dies in seinem Fazit an: „Dabei bleibt es immer
noch Gewissen“ (Carl Junge, Das intellektuelle Gewissen bei Nietzsche, S. 114). Auch Jürgen Mohr
kommt am Ende seiner Untersuchung zu einer übermäßig positiven Deutung des nietzscheschen
Gewissensbegriffs, wenn er behauptet, das Gewissen sei die unverzichtbare Bedingung für die Entstehung eines souveränen Individuums (Jürgen Mohr, Nietzsches Deutung des Gewissens, S. 15). Seine
Deutung der Redlichkeit bei Nietzsche, die zugleich Verlangen nach Gewissheit und Verzicht darauf
sei, „aus dem Bedürfnis nach Antwort und Sicherheit das kritische Infragestellen aufzugeben“, scheint
aber auf überzeugende Weise gerade die Unlösbarkeit des Widerspruchs zu demonstrieren. Dabei
bleibt jedoch schließlich unklar, warum Mohr diese Redlichkeit als eine neue bezeichnet (S. 9).
160
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
folgende äußerste Konsequenz. So gebietet „eine Moral der Methode“: Das Prinzip
muss „bis an seine äusserste Grenze getrieben“ werden – „bis zum Unsinn“, wie
Nietzsche „mit Verlaub“ in Klammern anfügt (JGB 36, KSA 5, S. 55). Dies ist keine
Widerlegung, nur eine Widerlegung der Alternativlosigkeit. Denn erst wenn die letzte
Konsequenz gezogen wird, kommt zum Vorschein: dieses Prinzip ist kein Faktum, das
unbegreiflich, aber nichtsdestoweniger notwendig sein soll; der paradoxe Zirkel
seiner Selbstlegitimation ist nicht zwangsläufig; der Glaube an die auf ihm aufgebaute
Moral ist nicht alternativlos, und sein Untergang ist nicht unbedingt tragisch zu
verstehen. Wenn die Tragödie des an sich selbst verzweifelten Willens zur Wahrheit
zum unlösbaren Konflikt von Wissen und Gewissen geführt hat, so kann dieser
Konflikt in der Frage nach seinem Wert für das Leben selbst aufgehoben werden: Er
kann der Wegweiser zum tragischen Untergang werden oder aber zu einem neuen
Anfang, zu einer Selbstüberwindung.
Die Selbstüberwindung definiert Nietzsche als „de[n] Name[n] für jene lange
geheime Arbeit, welche den feinsten und redlichsten, auch den boshaftesten Gewissen von heute, als lebendigen Probirsteinen der Seele, vorbehalten“ bleibt. Sie vollzieht sich nicht allgemein, nicht bei jedermann, sondern sie ist „Überwindung der
Moral“ „in einem gewissen Verstande“ (JGB 34, KSA 5, S. 51). Und so notierte Nietzsche über sich selbst:
Meine stärkste Eigenschaft ist die Selbstüberwindung. Aber ich habe sie auch am meisten
nöthig — ich bin immer am Abgrunde. (Nachlass, November 1882–Februar 1883, 4[13], KSA 10,
S. 112)
Die Selbstüberwindung wird dann nötig, wenn man gerade am Abgrunde steht, wenn
das Zugrunde-Gehen jedes Glaubens zur äußersten persönlichen Gefahr geworden ist.
Es ist jedoch nicht bloß eine persönliche Not Friedrich Nietzsches. Die unpersönlichallgemeine Forderung nach Gewissheit des allgemeinen Urteils, die als moralisch
gebotene Wahrheit verstanden wurde, ist zum Verhängnis des Abendlandes geworden.
Das war ein Weg der Verzweiflung und des Unterganges, ein Weg, der in den Nihilismus
führte und zu dem Glauben an Nichts verführte. Diese lange Tragödie könnte vielleicht
als Vorspiel und Vorgeschichte zu einem neuen Anfang verstanden werden. Doch diese
Feststellung und diese Möglichkeit dürfen nicht wiederum verallgemeinert werden. Die
Selbstüberwindung ist nicht der Weg für alle, sondern nur für diejenigen, die den
Untergang des Glaubens an die Göttlichkeit der Wahrheit als persönliche Not empfinden und gleichzeitig als Hoffnung – als Hoffnung, dass der Glaube an den Wert der
Wahrheit im Willen zur Ungewissheit aufgehoben werden kann.
Vornehmheit des Egoismus und Plausibilität des Geschmacks
Die kantische Moral aus Vernunft mit ihrer paradoxen Zirkelbewegung wird so bei
Nietzsche zu einer offenen Figur der Selbstaufhebung des christlichen Glaubens im
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
161
intellektuellen Gewissen bzw. der Selbstüberwindung der Moral durch die von ihr
erzeugte Wahrhaftigkeit. Ihr Wert, der Wert der Moral, wird somit perspektivisch
gedeutet. Er kann weder in schlichten Gegensätzen „activ – reactiv“ bzw. „affirmativ – negativ“ noch an einem vorgegebenen Maßstab gemessen werden.157 Er ist keine
vorgegebene Konstante, sondern eine Aufgabe, genauso wie die Vernunft oder die
Aufklärung Aufgaben sind. Der Moral einen neuen Wert zu geben, wäre auch eine
Aufgabe – für den neuen Glauben, wenn ein solcher Glaube jenseits des Willens zur
Gewissheit denkbar sein sollte. Was für ein Glaube könnte das sein, und inwiefern ist
dieser Glaube tatsächlich neu? Auf diese Fragen soll in diesem Abschnitt eine Antwort
versucht und so auch auf Nietzsches Plausibilitäten gekommen werden.
Nietzsches Kritik der Moral führte ihn zu der an den Widerspruch grenzenden
Paradoxie der Selbstaufhebung. So Nietzsche über die Morgenröthe, das Buch, das er
nachträglich mit der Formel der Selbstaufhebung zusammenfasste:
[…] es stellt in der That einen Widerspruch dar und fürchtet sich nicht davor: In ihm wird der
Moral das Vertrauen gekündigt – warum doch? A u s M o r a l i t ä t !
Obzwar „wir“ „unserem Geschmacke nach“, so Nietzsche, „bescheidenere Worte vorziehen“ sollten. Er muss jedoch an dieser Stelle eingestehen:
Aber es ist kein Zweifel, auch zu uns noch redet ein ‚du sollst‘, auch wir noch gehorchen einem
strengen Gesetze über uns, – und dies ist die letzte Moral, die sich auch uns noch hörbar macht,
die auch wir noch zu l e b e n wissen, hier, wenn irgend worin, sind auch wir noch M e n s c h e n
d e s G e w i s s e n s […]. (M Vorrede 4, KSA 3, S. 16)
Die Schwierigkeit, die immer wieder Anlass für Kritik an Nietzsches Moralkritik gibt,
wird so nicht bloß von ihm selbst thematisiert, sondern als solche hervorgehoben.
Dem Glauben an das moralische Ideal wird aus Moralität gekündigt, der Wert des
Willens zur Wahrheit wird aus Wahrhaftigkeit geleugnet – als „letzte Moral“, als Erbe
und Zwang einer zweitausendjährigen Geschichte. Man stellt sich mit Recht die Frage,
ob Nietzsche hier Widerspruch und Selbstbezüglichkeit nicht zu leicht eingesteht.
„Die letzte Moral“, die eine Umwertung des Ideals anstrebt, kann sich nicht bloß aus
derselben Quelle speisen bzw. sich derselben Prinzipien bedienen wie dieses Ideal
157 Beides tut z. B. Deleuze, wenn er Nietzsches Genealogie als definitive Parteinahme zugunsten der
affirmativen Kräfte interpretiert, die von den negativen zu unterscheiden sind (Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, 1962). Zur neuesten Kritik an dieser Interpretation s. Marco Brusotti, Wille zum
Nichts, Ressentiment, Hypnose. ‚Aktiv‘ und ‚reaktiv‘ in Nietzsches Genealogie der Moral. Brusotti weist
darauf hin, dass es bei Nietzsche keinen Begriff des Reaktiven gebe. Dies sei eine Erfindung Deleuzes
(S. 111 f.). Brusotti selbst versucht allerdings den Gegensatz zwischen dem Willen zum Nichts, der durch
den „horror vacui des Willens“ entsteht, und dem aktiven Willen, für den Nietzsche plädiert, aufrechtzuerhalten.
162
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
selbst. Wenn sie alte Ideale ablösen will, muss sie ein neues Kriterium ins Spiel
bringen und damit auch eine neue Plausibilität behaupten können.158
Die Frage nach der Moral von Nietzsches Moralkritik wird von Paul van Tongeren
in seiner aufschlussreichen Untersuchung Die Moral von Nietzsches Moralkritik: Studie
zu „Jenseits von Gut und Böse“ gründlich untersucht.159 Der Forscher kommt zu dem
Schluss, dass „der Kampf zwischen Idealen“ bzw. „der Kampf der Moralen miteinander selbst das moralische Ideal sein“ soll.160 Ein solches Ideal impliziere jedoch ein
Engagement gerade „für die vom Untergang bedrohte Partei“.161 Daraus ergibt sich
eine Schwierigkeit, die die ganze Überlegung mit einem Widerspruch bedroht – eine
Schwierigkeit, die van Tongeren bewusst eingeht: Die „Selbstverabsolutierung“ des
Kampfes bleibt von seiner „Selbstrelativierung“ immer abhängig. Müller-Lauters Analyse folgend, der sich um eine Aufklärung und Rechtfertigung dieses Widerspruchs
158 Immer wieder vorkommende Versuche, Nietzsches Kritik am Christentum als Forderung nach
seiner wahren Größe und als bloße Kritik an seinen Verfehlungen darzustellen, können nicht völlig
überzeugen. Schließlich stehen sie der Intention Nietzsches entgegen, der dem Christentum den „Krieg
auf’s Messer“ (JGB 12, KSA 5, S. 27) erklärte, und sie müssen immer davon ausgehen, dass Nietzsche
das Christentum nicht tief genug verstanden hat bzw. ein vielleicht unbewusster Erneuerer des
Religiösen gewesen ist. Dieser Gedanke ist, wie in der Einleitung erwähnt, schon bei Karl Jaspers
deutlich vertreten. Von den späteren Untersuchungen vgl. die Idee einer ungewollten Rekonstruktion
bzw. Wiederbelebung des Christentums in: Eugen Biser, Nietzsche – Zerstörer oder Erneuerer des
Christentums?. Vgl. auch Bisers früher vertretene These, Nietzsches Angriffe gälten in Wirklichkeit
nicht dem Christentum, sondern der dem Platonismus verpflichteten Theologie (Eugen Biser, „Gott ist
tot“. Nietzsches Destruktion des christlichen Bewußtseins). Auch Gerd-Günther Grau vertritt deutlich
diesen Gedanken (Gerd-Günther Grau, Sublimierter oder realisierter Wille zur Macht?, Die Diskussion,
bes. S. 259 f.). Vgl. auch die These, Nietzsche sei ein „zweiter Luther“ gewesen (Salaquarda, Nachwort
zu Emanuel Hirsch, S. 437). Besonders stark wurde diese Art der Argumentation in der russischen
Philosophie vertreten, z. B. von Leo Schestow, der von der These ausgeht, Nietzsche sei dem christlichen Ideal in seiner wahren Größe treu geblieben und als Verfechter seiner Reinheit habe er bloß seine
Verfehlungen kritisiert (s. dazu Kapitel 5). In der Theologie setzte man sich mit Nietzsche als Kritiker,
aber auch als Erneuerer des Religiösen mehrmals auseinander. Zu den neuesten Versuchen, Nietzsches
Religionskritik in die Theologie einzuordnen s. Christian Jung, Nietzsche und die Theologie. Neue
Standpunkte zu einem verhältnislosen Verhältnis; auch Ulrich Willers, Friedrich Nietzsches antichristliche Christologie. Eine theologische Rekonstruktion.
159 In der Schlussbetrachtung wird deutlich, dass die wichtigsten Schlüsse der Untersuchung nicht
ausschließlich für Jenseits von Gut und Böse gelten, sondern für mehrere Problemfelder der NietzscheForschung geltend gemacht werden können (vgl. van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik,
S. 248 f.).
160 Van Tongeren stellt Nietzsches Philosophie selbst als Realisierung dieses Kampfes dar, was auch
der Grund dafür ist, dass Nietzsche kein systematisches Werk über den Willen zur Macht hatte
schreiben wollen. Man kann letztendlich nicht über den Willen zur Macht sprechen, man muss zeigen,
wie er am Werke ist (Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 210 f.).
161 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 173. Zwar war bei Deleuze eben dies das
Kriterium für die Unterscheidung der Kräfte in affirmative und negative bzw. aktive und reaktive, doch
entgeht van Tongeren mit seinem Begriff des Engagements gerade einer qualitativen Trennung der
Kräfte und zeigt, dass „letzten Endes […] dadurch auch die aktive Kraft reaktiv“ wird (S. 193).
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
163
bemühte,162 zeigt van Tongeren weiter, dass es sich tatsächlich um eine Art „Doppelheit von ‚Kraft‘ und ‚Weisheit‘“ handle. Die Vielfalt der Perspektiven, die Strategie der
Perspektivierung bedroht jedoch die Stärke des Willens zum Kampf, schließlich den
Willen zur Macht selbst, sodass er zu einer erschlafften Relativierung abgeschwächt
wird.163 Mit Recht wird betont:
In der These, die Welt sei Wille zur Macht, liegt etwas, das sich einer Interpretation widersetzt,
welche behauptet, diese Aussage sei nichts weiter als eine von vielen Manifestationen des
Willens zur Macht, aus denen die Welt besteht.164
Denn zum einen sollte diese These, als Aussage, doch für sich beanspruchen, mehr
als nur „eine unter vielen“ zu sein, zum anderen – und hierauf kommt es vor allem
an – würde eine solche Einstellung den Willen zur Macht selbst abschwächen. Mit
anderen Worten: Um den Kampf aufrechtzuerhalten, um den Willen zu stärken, der
diesen Kampf will, sollte man auch den Glauben an die ausschließliche Privilegiertheit der eigenen Position fördern und pflegen. Die Relativierung der Perspektiven
steht der Steigerung des Willens nicht unbedingt als Gegenkraft im Weg, doch sie
kann zu einem massiven Hindernis werden. Und wie sollte ein solcher Glaube an die
eigene Wahrheit nicht gleichzeitig der Glaube an die Allgemeingültigkeit des eigenen
Urteils, an seine Absolutheit sein? Van Tongeren formuliert dieses Dilemma folgendermaßen:
Muß sich […] nicht jegliches Engagement innerhalb des Kampfes engagieren, in ihm Partei
ergreifen? Doch wie ist dann vom Standpunkt einer solchermaßen ergriffenen Partei aus die
notwendige Selbstrelativierung möglich?165
Diese Schwierigkeit, die er in mehreren Hinsichten betrachtet, führt van Tongeren zu
folgendem Schluss:
Nietzsches moralisches Engagement führt zu einem Idealbild vom Menschsein, an dem der
Mensch zugrunde geht, es sei denn, er realisiert es nicht vollständig.166
162 Schließlich lässt aber Müller-Lauter diesen Widerspruch als von Nietzsche selbst gewollten
bestehen. Er deutet ihn in zwei Typen des Übermenschen um, dem je ein eigenes Verständnis der
ewigen Wiederkunft entspricht (vgl. Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze,
S. 188).
163 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 202. Die Nietzsche-Forschung wird mit
diesem Problem andauernd konfrontiert, und es scheint noch weit davon entfernt zu sein, gelöst zu
werden. S. auch eine der jüngsten Untersuchungen zum Thema: Herman Siemens, Umwertung: Nietzsche’s „War-Praxis“ and the problem of Yes-Saying and No-Saying in „Ecce homo“. Nietzsches Kampfpraktik wird hier dem den Frieden anstrebenden Idealismus entgegengesetzt.
164 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 203.
165 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 211.
166 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 227. Vgl. in diesem Sinn auch: van
Tongeren, Reinterpreting Modern Culture, S. 234 f.
164
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Der sich für den Kampf engagierende Wille zur Macht sollte letztendlich an diesem
Widerspruch, an der „Doppelheit“ von Selbstverabsolutierung und Selbstrelativierung zugrunde gehen.
Wer die vielen Interpretationen und Perspektiven zulässt, läuft Gefahr, sich selbst in dieser
Vielheit zu verlieren, sich für überhaupt keine Position mehr engagieren zu können.167
Im Bezug auf die zuvor behandelte Frage nach dem intellektuellen Gewissen lässt sich
diese These anders formulieren: Das Zugeständnis eigener Ungerechtigkeit in Sachen
der Erkenntnis, das „Körnchen Unrecht“, das laut Nietzsche „zum guten Geschmack“
gehört (JGB 221, KSA 5, S. 156) und das „die Lacher auf seine Seite“ lockt, macht
nicht einen „B e f e h l e n d e n u n d G e s e t z g e b e r “, nicht den „e i g e n t l i c h e n “ Philosophen (JGB 211, KSA 5, S. 145) aus, auch nicht einen Philosophen der Zukunft.168
Das Ideal ist unmöglich zu verwirklichen. Sein Sieg würde gerade seine Selbstaufhebung im Sinne der Selbstvernichtung bedeuten. Eine für van Tongeren zentrale
Stelle aus Jenseits von Gut und Böse stützt diesen Verdacht gegen Nietzsches Ideal.
[…] ja es könnte selbst zur Grundbeschaffenheit des Daseins gehören, dass man an seiner völligen
Erkenntniss zu Grunde gienge, — so dass sich die Stärke eines Geistes darnach bemässe, wie viel
er von der ‚Wahrheit‘ gerade noch aushielte, deutlicher, bis zu welchem Grade er sie verdünnt,
verhüllt, versüsst, verdumpft, verfälscht n ö t h i g h ä t t e . (JGB 39, KSA 5, S. 56 f.)
An der Fülle dieser „Wahrheit“ ginge der Geist zugrunde. Dies ist ihr einziges Kriterium und gleichzeitig der Leitfaden des Ideals von der „letzten Moral“ Nietzsches.169
Wir haben es hier mit einem Komplex von Fragen und Schwierigkeiten zu tun, die
mehrere viel diskutierte Probleme der Nietzsche-Forschung berühren und die teilweise in der Einleitung angesprochen wurden. Ich muss mich hier auf die für meine
Untersuchung grundlegenden Aspekte beschränken. Es scheint für unsere Zwecke
sinnvoll zu sein, van Tongerens Fragestellung nach der Moral von Nietzsches Moralkritik bzw. nach Kriterien von Nietzsches „letzter Moral“ als einen Beitrag zur Nietzsche-Forschung anzusehen, der jene alten Diskussionen in sich aufnimmt.170 Es sind
v. a. zwei Fragen, die uns hier beschäftigen. Erstens: Wie kann das Engagement für
die Aufgabe, eine sich widerstreitende Wirklichkeit zu bejahen, aufrechterhalten
werden, wenn gerade dieser Widerstreit das Engagement abschwächt? Und zweitens:
Inwiefern kann diese Aufgabe „jenseits von Gut und Böse“, jenseits der Moral realisiert werden, wenn sie selbst ein klares moralisches Engagement fordert? Auf die erste
Frage gibt van Tongeren eine negative Antwort: Die Aufgabe ist nicht vollständig
167 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 226.
168 S. dazu ausführlich: Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 219 f.
169 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 228.
170 Vgl. u. a. die Zusammenfassung der verschiedenen Positionen zur Wille-zur-Macht-These, von
Heidegger bis Müller-Lauter (Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 186–204).
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
165
realisierbar, denn sie hebt sich selbst auf; dennoch ruft Nietzsche dazu auf, die Gefahr
der Selbstaufhebung nicht zu vermeiden, sondern sie mit aller Tapferkeit anzunehmen. Wenn dies die Lösung sein sollte, so wird die Frage, mit was für einem
moralischen Imperativ wir es hier zu tun haben, noch dringlicher. Wenn das Ziel
dieser „letzten Moral“ tatsächlich der „Kampf um des Kampfes willen“ ist, dann muss
die Frage nach dem Imperativ dieses Kampfes in den Vordergrund der Überlegung
treten.
Man darf dabei natürlich nicht vergessen (und van Tongeren ist weit davon
entfernt, dies zu tun), dass es sich nicht um einen Imperativ im kantischen Sinn
handeln kann. Nietzsche betont mehrmals, dass es keine kategorischen Imperative
geben kann, sondern nur solche, die als Bedingung des Lebens schon immer dagewesen sind. Das bedeutet u. a., dass sie nicht verfehlt werden können, und deshalb keine
Begründungen benötigen, sondern als unmittelbarer Zwang auftreten. Doch impliziert Nietzsches eigenes Engagement für den Kampf nicht nur einen Imperativ, der
den „Kampf um des Kampfes willen“ fordert, sondern auch ein Ideal, das diesen
Kampf als etwas Erstrebenwertes rechtfertigt.171 Wieso ist der Kampf besser als kein
Kampf? Und wenn er unvermeidlich ist, wozu noch Engagement für diesen Kampf
fordern? Wieso soll die Vielfalt der Perspektiven ihrer Vereinzelung und Vereinfachung vorgezogen werden, wenn das Leben selbst die Vereinfachung fördert und
dadurch besser ertragen werden kann? Diese Fragen, um es noch einmal zu betonen,
werden umso dringlicher, da wir festgestellt haben, dass uns beide Möglichkeiten in
den Abgrund stürzen: Wenn das asketisch-nihilistische Ideal, das die Vielfalt der
Lebensperspektiven verneint, zu seiner äußersten Konsequenz geführt wird, und
wenn das affirmative Ideal des Kampfes vollständig realisiert wird. Die Forderung
eines stetigen Engagements für den „Kampf um des Kampfes willen“ muss, da das
Ideal nicht zu realisieren ist, wenn nicht begründet, so doch in ihrem Wert für das
Leben nachgewiesen werden.
Van Tongerens Analyse läuft an mehreren Stellen auf die Frage „Was ist vornehm?“ hinaus. Der Vornehme werde zu „einem Kampfplatz“, „auf dem mehrere
Parteien gegeneinander kämpfen“.172 In Gestalt des Philosophen wird die Vornehmheit als die Fähigkeit gedeutet, über die eigene Position und die eigene Moral lachen
zu können.173 Dieser Begriff der Vornehmheit kann allerdings – und dies gibt die
Schlussbetrachtung von van Tongerens Untersuchung deutlich zu verstehen – das
Problematische von Nietzsches Ideal keineswegs auslöschen. Das unerreichbare Ideal
wird schließlich als „regulative Idee“ gedeutet, wobei auch dies, wie van Tongeren
betont, keine Lösung des Widerspruchs sein kann, des „Widerspruch[s] zwischen dem
Zerfallen des ‚Selbst‘ in einander widerstreitende Engagements und dem Appellieren
171 Van Tongeren verdeutlicht dieses Engagement mit dem Begriff des Stoizismus (Van Tongeren, Die
Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 204 ff.).
172 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 228 f.
173 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 242.
166
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
an ein ‚Selbst‘, das Herr eines jeden Engagements sein muß, um ‚sich‘ daraus zurückziehen zu können“. Dieser Widerspruch „liegt in der Idealthese selbst begründet“ und
sorgt für deren gleichzeitige „Faszination und Irritation“, die beide zum „Weiterdenken“ aufrufen.174 Schließlich sollte laut van Tongeren ein solcher Selbstwiderspruch
nicht als Argument gegen Nietzsches Philosophie ausgespielt werden, da Nietzsche
diese Widersprüchlichkeit nicht vermeidet und damit persönlich in den Kampf der
Interpretationen eintritt. Vielleicht bedeutet das gerade, die „Moral als Problem“ zu
entdecken und als Problem gelten zu lassen. Kaum zufällig wird an dieser Stelle ein
Vergleich mit den „großen Romanfiguren“ angestellt, deren Faszination gerade „darauf beruht, dass sie unterschiedliche und widersprüchliche Verlangen in sich tragen
und in uns ansprechen“.175 Wir dürfen aber, so scheint es mir, diese Assoziation nicht
voreilig im Sinne von Richard Rortys Plädoyer für die Philosophie als schöne Literatur, deren Überzeugungskraft nicht in Argumenten liegt, interpretieren. Van Tongerens These ergibt sich aus einer systematischen Untersuchung von Nietzsches moralischem Ideal, dem Nietzsche offenkundig einen hohen Wert zuschreibt. Und wenn
wir es hier tatsächlich mit einem widersprüchlichen Ideal zu tun haben bzw. mit
einem Ideal, dessen Realisierung den Menschen zugrunde richten würde, so lässt sich
doch fragen, was für Plausibilitäten dieses Ideal als Ideal legitimieren.
Der von van Tongeren analysierte Begriff der Vornehmheit scheint tatsächlich
einen Fingerzeig auf dieses Ideal zu geben. Doch vergessen wir nicht, dass Nietzsches
Begriffe stets als „starke Gegen-Begriffe“ zu bedenken sind. Ihre „Leuchtkraft“ besteht
darin, dass sie andere Begriffe und v. a. Gegensätze der Werte in Bewegung setzen,
indem sie ihre komplexe Genealogie aufdecken. Sie sind „u n d e f i n i r b a r “, weil in
ihnen „sich ein ganzer Prozess semiotisch zusammenfasst“ (GM II, 13, KSA 5, S. 317).
Man kann nur noch von „Zeichen der Vornehmheit“ sprechen (JGB 272, KSA 5, S. 227).
Versuchen wir sie näher zu bestimmen.
Die Grenze zwischen dem Vornehmen und dem Gemeinen wird in der Moral
gezogen, die selbst „eine Z e i c h e n s p r a c h e d e r A f f e k t e “ ist (JGB 187, KSA 5, S. 107).
„Die Sklaven-Moral ist wesentlich Nützlichkeits-Moral“ (JGB 260, KSA 5, S. 211). Worauf sieht der Vornehme herab? „Verachtet wird der Feige, der Ängstliche, der Kleinliche, der an die enge Nützlichkeit Denkende; ebenso der Misstrauische […], vor allem
der Lügner“ (JGB 260, KSA 5, S. 209). Dies bezeichnet Nietzsche, sowohl in Jenseits von
Gut und Böse als auch in Zur Genealogie der Moral, als „P a t h o s d e r D i s t a n z “, als
notwendige Distanz, aus der die Vornehmen ihr Recht gewonnen haben, „Werthe zu
schaffen“ – und „was gieng sie die Nützlichkeit an!“ Das „Nützlichkeits-Calcul“ wird
so aus dem „Pathos der Vornehmheit und Distanz“ als Kennzeichen der niederen
Gesinnung gedeutet (GM I, 2, KSA 5, S. 259). Dieselbe „Distanz“ sieht aus der Perspektive des „Volkes“ folgendermaßen aus: Die „durchschnittlichen Menschen“ glauben
174 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 249 f.
175 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 251.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
167
an die „uninteressirten“ Handlungen der Edlen und bewundern sie. Doch könnte es,
so Nietzsche, durchaus ein großer Irrtum sein: Denn eine „uninteressirte“ Handlung
gibt es vielleicht gar nicht, sie kann sich immer als „sehr interessante und interessirte
Handlung“ erweisen (JGB 220, KSA 5, S. 155). Beide – der „Vornehme“, der das Nützlichkeits-Kalkül verachtet, und der „Gemeine“, der die Uneigennützigkeit des Edlen
bewundert – irren sich also in dem, was die Vornehmheit betrifft.
Wir haben es hier wieder mit dem Problem der Nützlichkeit in ihrem Verhältnis
zur Moral zu tun. Als zentrale Frage von Nietzsches Kritik an der Moral der Selbstlosigkeit verdient sie noch einmal unsere Aufmerksamkeit, wobei der Begriff der
Vornehmheit auf sie ein neues Licht werfen soll. Das Nützlichkeits-Kalkül ist etwas,
das beiden, dem „gemeinen Volk“ und den „Edlen“, zu eigen zu sein scheint. Es ist
nicht zu bestreiten, dass auch die Vornehmen mit ihren „feinere[n] und verwöhntere
[n] Geschmäcker[n]“ an ihren Handlungen sehr wohl interessiert sind und in ihnen
ihren Nutzen suchen. Damit, und das sollte besonders hervorgehoben werden, kehrt
Nietzsche keineswegs zu der schlichten These zurück, dass jeder seinen Vorteil sucht,
bzw. dass alle Handlungen aus der Befriedigung der Bedürfnisse erklärt werden
können. Die Moral der Selbstlosigkeit irrt sich nach Nietzsche nicht nur deswegen,
weil sie „uninteressirte“ Handlungen für möglich hält, sondern weil sie Interessen,
Wünsche und Bedürfnisse als etwas Bekanntes ansieht, als ob jeder Mensch natürlicherweise sein „Glück“ verfolge. Früher, in der Morgenröthe, hat Nietzsche den
Nutzen und das Streben nach Glück als universelle Erklärung in aller Schärfe zurückgewiesen:
Es ist nicht wahr, dass das u n b e w u s s t e Z i e l in der Entwicklung jedes bewussten Wesens
(Thier, Mensch, Menschheit u.s.w.) sein ‚höchstes Glück‘ sei. (M 108, KSA 3, S. 96)
„Jede unegoistische Moral, welche sich unbedingt nimmt und an Jedermann wendet,
sündigt nicht nur gegen den Geschmack“, sondern vielleicht auch gegen den gesunden Menschenverstand. Denn die Bedürfnisse und der Nutzen sind nicht für Alle
definierbar.176 Sollte z. B. die Selbsterhaltung über alles gelten, so wäre gerade dieses
Ziel stets verfehlt. Wenn es die „Durchschnitts-Glückseligkeit Aller“ sein sollte oder,
um mit Kant zu sprechen, der „ewige Frieden“ oder die „Weltbürgergesellschaft“, so
ließe sich fragen, ob dieses Ziel für den Einzelnen überhaupt als sein Bedürfnis
beschrieben werden kann, wenn seine Erfüllung in die unabsehbare Zukunft und bei
Kant in die Dimension des Als-Ob verschoben werden soll. Es kann allerdings bezweifelt werden, wie Nietzsche es zu Beginn der Fröhlichen Wissenschaft tut, dass der
Mensch überhaupt gegen das Interesse der Herde wünschen und handeln kann (FW 1,
KSA 3, S. 369 f.). Aber
176 S. dazu ausführlicher den Artikel „Bedürfnis“ in: van Tongeren u. a. (Hg.), Nietzsche-Wörterbuch,
Bd. 1, S. 224 ff.
168
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
selbst, was hier ‚Nützlichkeit‘ genannt wird, ist zuletzt auch nur ein Glaube, eine Einbildung und
vielleicht gerade jene verhängnissvollste Dummheit, an der wir einst zu Grunde gehen. (FW 354,
KSA 3, S. 593)
Mit diesem generellen Verdacht gegen jede Nützlichkeits-Reduktion grenzt Nietzsche
seine Kritik der altruistischen Moral noch einmal entschieden von den „Engländern“
ab, die, wie er ironisch bemerkt, allein nach dem „Glück“ streben (GD Sprüche, 12,
KSA 6, S. 61).
Es ist ferner äußerst wichtig, in der Kritik der Moral einer bloßen Umdrehung des
alten Gegensatzes von Egoismus und Selbstlosigkeit zu entgehen. Dies gelingt Nietzsche gerade dank seinem Begriff der Vornehmheit. Wenn „der Egoismus […] zum
Wesen der vornehmen Seele“ gehört (JGB 265, KSA 5, S. 219), die dennoch jedes
Nützlichkeits-Kalkül verachtet, und dies kein Widerspruch sein soll, so muss der
Gegensatz des Egoismus und der Uneigennützigkeit selbst in Frage gestellt werden.
Die Selbstlosigkeit ist als eine Art Egoismus, als „Egoismus gegen den Egoismus“ zu
betrachten (M 90, KSA 3, S. 83 f.). Aber dies impliziert, und das ist wichtig zu betonen,
die Möglichkeit einer Umkehrung: Auch der Egoismus kann als eine Art Selbstlosigkeit
angesehen werden. Denn die vornehme Seele sucht in ihrem Egoismus nicht das
Nützliche, nicht die Befriedigung der Bedürfnisse. Genauer gesagt sucht sie sich einen
Nutzen bzw. ein Bedürfnis aus, deren Befriedigung alle anderen verleugnet und überwältigt.177 Dieses eine Bedürfnis wird zu ihrem Verhängnis und zu ihrer Tugend – zum
Verhängnis, weil sie höchstwahrscheinlich an ihm zugrunde gehen wird; zur Tugend,
weil sie ihm alles opfern wird.178
177 Vgl. „Opfer bringen wir fortwährend. Bald siegt diese Neigung über die andere und deren Anforderungen, bald jene. Du würdest erstaunen, wenn ich vorrechnete, wie viel Opfer jeder Tag mich
kostet“ (Nachlass, Frühjahr 1881–Sommer 1882, 12[25], KSA 9, S. 580). Nietzsche versuchte diesen
inneren Kampf u. a. naturwissenschaftlich zu fundieren. Dazu s. Wolfgang Müller-Lauter, Der Organismus als innerer Kampf. Der Einfluss von Wilhelm Roux auf Friedrich Nietzsche.
178 Darum ist die traditionelle Interpretation des Begriffs „Egoismus“ bei Nietzsche, nämlich als
Bejahung eines „starken Selbst (ego)“, „das auf seine eigenen Instinkte hört und das wachsen will“
(Egoismus, in: van Tongeren u. a. (Hg.), Nietzsche-Wörterbuch, Bd. 1, S. 703), zwar richtig, dennoch zu
unspezifisch. Der These, dass in dem Begriff des Egoismus bei Nietzsche der Gegensatz „selbstlos/
egoistisch“ aufgehoben wird, kann ich nur zustimmen. Jedoch nicht im Sinne einer bloßen Verleugnung der Selbstlosigkeit und ihres Wertes zugunsten des Egoismus, der das Wachstum bzw. die
„eigene[n] Instinkte“ fördert. Das Wachstum einer „vornehmen“ Seele ist selbst ein Kampf, wo die
Einbildungen und Fehlinterpretationen, wie die der Selbstlosigkeit oder der Einsamkeit, eine entscheidende Rolle spielen können. Es scheint ferner problematisch zu sein, Nietzsches Begriff des
Egoismus mit dem des Altruismus zu koppeln, als wäre er gerade die Förderung des letzteren. Der
Egoismus im nietzscheschen Sinne, als „Bejahung und Selbstförderung“, sei die „Voraussetzung für
das ‚Wohltun‘ gegen Andere“ (S. 717); damit sei nicht bloß das „Gleichgewicht der Egoismen“, sondern
auch die „Erhöhung der Moral“ erreicht (S. 718). Wäre das richtig, würde Nietzsches Kritik an der Moral
der Selbstlosigkeit ihn wiederum in die Nähe der „Engländer“ bringen, die die Moral auf ein bloßes
Nützlichkeits-Kalkül gründen wollten. Nietzsche dagegen will die Unvereinbarkeit der Interessen
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
169
Der radikale Gegensatz von Egoismus und Uneigennützigkeit hat durch Kant
seine höchste Plausibilität erhalten. Sein Kriterium bestand weder in Handlungen
noch in Absichten, sondern in der Unterordnung der letzteren unter Maximen. Kant
vollzog damit eine gewagte „Umkehrung der Perspektive“: Die Moralität wurde zu
einer Triebfeder, die sich von allen Triebfedern der Selbstliebe radikal unterscheiden
ließ und deshalb unergründlich blieb, als ob sie aus dem Nichts (ex nihilo) entsprang.
Die christlich-reformatorischen Wurzeln dieser Umdeutung, dieser Umkehrung der
Perspektive werden von Nietzsche mehrmals betont. Die hohe Bewertung der Selbstlosigkeit sowie die starke Polarisierung von Selbstliebe und Nächstenliebe wurden
tatsächlich in der Theologie mehrmals als entscheidender Schritt des Protestantismus
interpretiert, wogegen in dem katholisch-orthodoxen Bereich eher ein Kompromiss
und sogar eine gewisse Kontinuität zwischen beiden angedeutet wurde.179 Das Evangelium spricht zwar tatsächlich von einer Art Selbstlosigkeit (Selbstverleugnung),
doch auch von der Selbstliebe als einzigem Maßstab für die Nächstenliebe („Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst“ (Mt 19; 19, Gal 5; 14)) und sogar von Belohnung und
Strafe als den legitimen Triebfedern einer altruistischen Handlung.180 Damit sind
vielleicht ganz andere Plausibilitäten als die der Moral aus Vernunft impliziert. Wenn
es sich um die Macht Gottes und nicht, wie Nietzsche später den Typus des Erlösers
interpretieren wird, um eine Machtlosigkeit und um eine Art Idiosynkrasie gegenüber
der Welt handelt, dann steht das Versprechen des Sieges nicht unbedingt im Widerspruch mit der Forderung, aus Liebe zu Gott zu handeln. Wenn es um die Steigerung
der Liebe als Weg zu Gott geht, dann ist die Forderung der guten Werke, ungeachtet
der Absichten bzw. Triebfedern und sogar trotz der Gesinnung, nicht unbedingt widersinnig, sondern kann sich der kantischen Umkehrung der Perspektive auf der höheren
Ebene widersetzen: Die gute Gesinnung ist die Folge, nicht der Grund der guten
Handlung. Sie ist der Lohn und das eigentliche Ziel jeder Bemühung um eine gute Tat,
deren Maßstab weder in dem moralischen Gesetz noch in einem Urteil, sondern allein
in der Person Christi gesetzt wird und jeden vorgegebenen Maßstab der Moralität, sei
es die Selbstlosigkeit selbst, zurückweist.
Die „G e f ä h r l i c h k e i t d e s C h r i s t e n t h u m s “ sieht Nietzsche gerade darin, dass
es, indem es „die Lehre von der Uneigennützigkeit und Liebe in den Vordergrund
zwischen Individuen gar nicht verharmlosen, sondern geht noch weiter: Er verlegt den Kampf der
Interessen in eine Menschenseele.
179 Vgl. bei Karl Holl: „Augustin spricht daher nur aus, was im Geist der ganzen Entwicklung liegt,
wenn er die Selbstliebe als Erstes, als Natürliches und Pflichtmäßiges vor die Nächstenliebe setzt. Von
dann an wird die Sittlichkeit in der katholischen Kirche nur noch ein kluges Rechnen, ein versuchter
Ausgleich zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe […]“. Erst Luther wurde Holl zufolge klar, „daß
Gottes- und Nächstenliebe die Selbstliebe nicht neben sich duldet, sondern ausschließt“ (Holl, Luther
und Calvin, S. 70).
180 Von der Belohnung und Strafe wird nicht erst von Paulus, wie Nietzsche es immer wieder
darstellte, sondern schon von Jesus gesprochen (vgl. Mt 13; 40–43, Lk 13; 25–29). Vgl. auch das
Gleichnis vom ungerechten Verwalter (Lk 16; 1–9).
170
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
gerückt hat“, „d i e S t e i g e r u n g d e s E g o i s m u s “ durch den „Glaube[n] an eine
Individual-Unsterblichkeit“ förderte, aber auch den Altruismus, die Gleichsetzung
aller Menschen (Nachlass, Frühjahr 1888, 14[5], KSA 13, S. 218 f.).181 Die christliche
Liebe sei somit der Gegensatz zu aristokratischen Werten, aber auch das „vornehmste
und entlegenste Gefühl, das unter Menschen erreicht worden ist“ (JGB 60, KSA 5,
S. 79). Mehrere Umwertungen der moralischen Grundunterscheidungen lassen sich
nicht in einem schlichten Gegensatz auffassen. Vor allem im Begriff der Liebe ist diese
Doppeldeutigkeit bzw. die Beweglichkeit des Gegensatzes von Selbstlosigkeit und
Egoismus deutlich zu spüren. Doch im Gegensatz zur christlich-kantischen Auslegung
der Liebe, die, wie im vorigen Kapitel gezeigt, bei einem anderen Menschen die
Fähigkeit zur Vernünftigkeit und zur Moralität, „die Anlage für die Persönlichkeit“
(RGV, AA 6, S. 27), voraussetzt,182 deutet Nietzsche einen vornehmen Egoismus als
etwas Ausschließliches, als etwas, das nicht für jedermann bestimmt ist. Denn: „Jede
Gemeinschaft macht, irgendwie, irgendwo, irgendwann – ‚gemein‘“, heißt es in Jenseits von Gut und Böse (JGB 284, KSA 5, S. 232). Dagegen:
Zeichen der Vornehmheit: nie daran denken, unsere Pflichten zu Pflichten für Jedermann herab
[zu]setzen; die eigene Verantwortlichkeit nicht abgeben wollen, nicht theilen wollen; seine Vorrechte und deren Ausübung unter seine P f l i c h t e n rechnen. (JGB 272, KSA 5, S. 227)
181 In seinem veröffentlichten Werk weist Nietzsche auf den Widerspruch zwischen der christlichen
Forderung der Selbstlosigkeit und dem Nutzen hin, der daraus für die Gesellschaft entsteht. „Der Satz
‚du sollst dir selber entsagen und dich zum Opfer bringen‘ dürfte, um seiner eigenen Moral nicht
zuwiderzugehen, nur von einem Wesen decretirt werden, welches damit selber seinem Vortheil
entsagte und vielleicht in der verlangten Aufopferung der Einzelnen seinen eigenen Untergang
herbeiführte.“ (FW 21, KSA 3, S. 393) Dennoch ist es relativ klar, dass der christliche „Nutzen“ von dem
gesellschaftlichen deutlich zu unterscheiden ist. Denn die christliche Forderung der Selbstlosigkeit
wird, nebenbei gesagt, eben so gedacht: Sie kommt von einem solchen Wesen her, das sich, seiner
Macht freiwillig entsagend, opfern lässt, vom Mensch gewordenen Gott. Die Gleichheit aller Menschen
vor der unendlichen Liebe dieses Gottes ist etwas prinzipiell anderes als ihre soziale Gleichheit untereinander.
182 Die christliche Forderung der Liebe zum Nächsten wurde bei Kant in ihrem tieferen Sinn wieder
aufgenommen – als Herausforderung zu bestimmten Handlungen und als Verbot des Richtens: Die
Fähigkeit zur Vernünftigkeit und zur Moralität wird einem geliebten Menschen unterstellt, sogar dann,
wenn er anscheinend gegen das moralische Gesetz verstößt. Die Liebe beurteilt so den Anderen nicht,
sie ist die Achtung vor seinem unendlichen Wert, die zu bestimmten Handlungen ihm gegenüber
herausfordert. Diesen Gedanken in seiner extremsten Form drückt Nietzsches Zarathustra aus: „So
erfindet mir doch die Liebe, welche nicht nur alle Strafe, sondern auch alle Schuld trägt! So erfindet mir
doch die Gerechtigkeit, die Jeden freispricht, ausgenommen den Richtenden!“ (Z I Natter, KSA 4, S. 88).
Die Frage, warum eine solche Liebe auch höchste Gerechtigkeit ist und dabei alle Schuld und Strafe auf
sich nehmen soll, weist über Kants Deutung der Liebe hinaus, sie macht auf eine andere Quelle
Nietzsches aufmerksam – Dostojewskis Moralphilosophie. Die Frage wird im vierten und fünften
Kapitel behandelt.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
171
Doch genealogisch gesehen handelt es sich immer um eine vornehme „Kaste“, um ein
Wesen, „wie wir sind“ (JGB 265, KSA 5, S. 219). Auch die „Ausnahme-Menschen“ sind
dazu geneigt, „sich selber nicht als Ausnahmen [zu] fühlen“ und ihr „singuläres
Werthmaass“ als Maß für alle zu betrachten, „ihre Werthe und Unwerthe als die
überhaupt gültigen Werthe und Unwerthe“ anzusetzen (FW 3, KSA 3, S. 375 f.). Genauso wie der Erkennende selbst, der seine Empfindungen und die Strenge seines
„intellectuale[n] Gewissen[s]“ „bei Jedermann such[t]“ (FW 2, KSA 3, S. 373). Mehr
noch: Man kann eine vornehme Moral von der sklavischen Gesinnung nicht immer
unterscheiden. Nach einer scharfen Abgrenzung macht Nietzsche eine bedeutsame
Bemerkung:
Ich füge sofort hinzu, dass in allen höheren und gemischteren Culturen auch Versuche der
Vermittlung beider Moralen zum Vorschein kommen, noch öfter das Durcheinander derselben
und gegenseitige Missverstehen, ja bisweilen ihr hartes Nebeneinander – sogar im selben Menschen, innerhalb Einer Seele. (JGB 260, KSA 5, S. 208)
Letztere Ergänzung („innerhalb Einer Seele“) versperrt, nebenbei gesagt, jeder Art
diskriminierend-faschistischer Interpretation von Nietzsches genealogischen Ausführungen den Weg, indem sie deutlich auf die Schwierigkeit verweist, innerhalb einer
menschlichen Seele den Sklaven und den Herrn, die Gemeinheit und die Vornehmheit
voneinander zu trennen.183
Bei genauer Betrachtung wird es deutlich, dass der Begriff der Vornehmheit sich
bei Nietzsche jeder Verallgemeinerung widersetzt. Der Egoismus ist nicht unbedingt
vornehm; der Vornehme ist nicht immer einsam.184 Schließlich können keine Handlungen als vornehm bezeichnet werden. Vielleicht ist es wiederum der Glaube:
Was ist vornehm? Was bedeutet uns heute noch das Wort ‚vornehm‘? […] Es sind nicht die
Handlungen, die ihn [einen vornehmen Menschen] beweisen, – Handlungen sind immer vieldeutig, immer unergründlich –; es sind auch die ‚Werke‘ nicht. […] Es sind nicht die Werke, es ist der
G l a u b e , der hier entscheidet, der hier die Rangordnung feststellt, um eine alte religiöse Formel
in einem neuen und tieferen Verstande wieder aufzunehmen: irgend eine Grundgewissheit,
welche eine vornehme Seele über sich selbst hat, Etwas, das sich nicht suchen, nicht finden und
183 Zahlreich sind die Versuche, aus Nietzsches Moralkritik eine positive Individualethik zu ziehen.
Nietzsche plädiere für die Einsamkeit gegen das Sich-von-den-Anderen-Leiten-Lassen, gegen die
Herdenmoral also. Solche Interpretationen implizieren m. E. eine gewisse Vereinfachung bzw. Abkürzung von Nietzsches Moralkritik. Auch die „wissende und bewußte geistige Subjektidentität“ (so etwa
Reinhart Maurer, Nietzsche und das Experimentelle, S. 9) soll dieser Kritik unterliegen.
184 Gerade Philosophen, so Nietzsche inZur Genealogie der Moral, dürfen nicht „irgend worin e i n z e l n sein“ (GM Vorrede 2, KSA 5, S. 248). Dies mag überraschend klingen, besonders dort, wo es um das
Ideal der Vornehmheit geht. Doch die Vornehmheit wird hier nicht als eine bestimmte Eigenschaft bzw.
als ein Verdienst, sondern als nachträgliche Würdigung bestimmter Handlungen, als eine bestimmte
Haltung gegenüber eigenen Handlungen, dargestellt. Man kann daher den Sklaven von dem Herrn –
auch nach Nietzsches „Streitschrift“ und trotz ihres Pathos – nicht allgemein unterscheiden.
172
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
vielleicht auch nicht verlieren lässt. – D i e v o r n e h m e S e e l e h a t E h r f u r c h t v o r s i c h .
(JGB 287, KSA 5, S. 233)
Mit dieser Formulierung (es seien nicht die „Werke“, sondern der „Glaube“) weist
Nietzsche auf seine Quelle, nämlich den lutherischen Begriff des Glaubens, unmissverständlich hin und gleichzeitig über ihn hinaus. Auch hier handelt es sich um eine
Art des Glaubens, der nicht zu suchen, nicht mit Bemühungen zu erwerben, aber auch
nicht zu verlieren ist, eine Parallele zum lutherischen Begriff einer Erlösung aus
Gnade. Diese Grundgewissheit ist jedoch keine Gewissheit eines allgemeinen Urteils,
noch weniger die Achtung vor dem moralischen Gesetz, sondern eine Sicherheit über
sich, eine Achtung vor sich. Mit dieser Beschreibung des vornehmen Glaubens scheint
ein Kriterium gefunden zu sein, das all die anderen – den Egoismus, die Ausschließlichkeit und das Engagement für den Kampf – einschließt.
Doch wie kann ein solcher Glaube angesichts der Vielfalt der Triebe und Affekte,
angesichts des inneren Kampfs innerhalb einer Menschenseele seinen Wert behalten?
Soll die Vornehmheit gerade im Gegensatz zum edlen Geschmack stehen – einem
Geschmack für Vielfalt, Misstrauen und „bescheidenere Worte“ (M Vorrede 4, KSA 3,
S. 16)? Widerspricht dieser Glaube, der sich als Grundgewissheit ernst nimmt, nicht
einer Fähigkeit, über sich selbst zu lachen? Selbst die Einsamkeit könnte bloß „eine
Einbildung und […] verhängnissvollste Dummheit“ (FW 354, KSA 3, S. 593), ein Selbstmissverständnis sein. Ein solcher Mensch stünde niemals am Abgrund und würde
keine Größe im oben angedeuteten Sinn kennen: Ein solcher Glaube, der nicht zu
verlieren ist, kann auch nicht neu erworben werden. Der Widerspruch, den MüllerLauter und van Tongeren in ihren Untersuchungen zu Nietzsches moralischem Ideal
feststellten, zeigt sich so im Begriff eines vornehmen Glaubens erneut: entweder
„Weisheit“ oder „Kraft“, entweder Selbstverabsolutierung oder Selbstrelativierung.185
Die Grundgewissheit des Vornehmen steht auch im Widerspruch zur Selbstbeschreibung Nietzsches:
Ich w i l l keine ‚Gläubigen‘, ich denke, ich bin zu boshaft dazu, um an mich selbst zu glauben […]
(EH Schicksal 1, KSA 6, S. 365)
Das Ideal der Vornehmheit entzieht sich so einer Definition. Und das nicht weil es
widersprüchlich ist, auch nicht weil es den genealogischen Prozess seiner Entstehung
verbirgt, die die alten Gegensätze, wie die von Selbstlosigkeit und Egoismus, von
Nutzen und Uneigennützigkeit in Bewegung setzt, sondern weil die Frage nach dem
Ideal von Nietzsches Moralkritik eine Umwertung, eine neue Sinngebung impliziert.
185 Vgl. Müller-Lauters These, dass die Möglichkeit einer Synthese von Stärke und Weisheit, deren
„philosophischer Aufweis“ „nicht gelingt“, „nur noch als ein Geglaubtes offengehalten werden“ kann
(Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze, S. 133).
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
173
Nicht „Was ist vornehm?“, sondern „Was macht vornehm?“ und, noch wichtiger:
„Was kann der Vornehmheit einen Wert geben?“
Die Frage nach dem Wert stellt sich so aufs Neue. Gleich im ersten Aphorismus
des neunten Hauptstücks von Jenseits von Gut und Böse mit dem Titel „Was ist
vornehm?“ wird programmatisch von der „Erhöhung des Typus ‚Mensch‘“, von der
„fortgesetzte[n] ‚Selbst-Überwindung des Menschen‘“ gesprochen, die, so Nietzsche,
„eine moralische Formel in einem übermoralischen Sinne“ darstellt (JGB 257, KSA 5,
S. 205). Diese Formel gibt so von Anfang an deutlich zu verstehen: Der Wert eines
vornehmen Egoismus, einer vornehmen Einsamkeit und eines vornehmen Glaubens
an sich selbst ist keine Konstante. Die Vornehmheit behält ihren Wert nur, wenn
dieser ständig wächst, wenn er zum Immer-mehr-Wert wird. In der Götzen-Dämmerung
kommt Nietzsche zu einer entscheidenden Formulierung, die auch in den früheren
Werken ihren Widerklang findet:
Der Werth einer Sache liegt mitunter nicht in dem, was man mit ihr erreicht, sondern in dem, was
man für sie bezahlt, – was sie uns k o s t e t . […] Den höchsten Typus freier Menschen hätte man
dort zu suchen, wo beständig der höchste Widerstand überwunden wird […]. Jene grossen Treibhäuser für starke, für die stärkste Art Mensch, die es bisher gegeben hat, die aristokratischen
Gemeinwesen in der Art von Rom und Venedig verstanden Freiheit genau in dem Sinne, wie
ich das Wort Freiheit verstehe: als Etwas, das man hat und n i c h t hat, das man w i l l , das man
e r o b e r t … (GD Streifzüge, 38, KSA 6, S. 139)186
Die auf den ersten Blick banale Feststellung, der Wert einer Sache bestehe darin, was
sie einen kostet, verbirgt einen nicht-trivialen Gedanken über das Wesen der aristokratischen Freiheit: Ihr Wert besteht im Widerstand, der durch sie überwunden
worden ist, und ob der Preis dafür zu hoch oder aber nicht hoch genug gewesen war,
kann nur der sagen, der ihn bezahlt hat.
Was bedeutet diese aristokratische Freiheit für die „Seele als Subjekts-Vielheit“
und „Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte“ (JGB 12, KSA 5, S. 27)? Welches Bedürfnis, welcher Trieb sollen einem vornehmen Egoismus geopfert werden, damit dessen
Wert immer wachsen und der Typus ‚Mensch‘ steigen kann? Offensichtlich das
Bedürfnis und der Trieb, die einem am teuersten sind, die den tiefsten Wünschen
entsprechen und folglich am schwersten aufzugeben sind. Der „übermoralische“
Imperativ soll also etwa so lauten: Du sollst immer wieder „wider die Wünsche [d]
eines Herzens“ entscheiden, du sollst gerade die Tugend pflegen, die dich am meisten
kostet, die am meisten deinem Wollen widerspricht – „als Künstler und Verklärer der
Grausamkeit“ (JGB 229, KSA 5, S. 167). So beschreibt Nietzsche seine eigene Erfahrung
dieser neuen Einsamkeit, dieses Glaubens:
186 Vgl. „Die Grösse eines ‚Fortschritts‘ b e m i s s t sich sogar nach der Masse dessen, was ihm Alles
geopfert werden musste […]“ (GM II, 12, KSA 5, S. 315).
174
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Einsam nunmehr und schlimm misstrauisch gegen mich, nahm ich, nicht ohne Ingrimm, dergestalt Partei g e g e n mich und f ü r Alles, was gerade m i r wehe that und hart fiel. (MA II Vorrede 4, KSA 2, S. 373)
Vergessen wir nicht, dass Nietzsche den „Herzenswunsch“ in jeder Philosophie
entdeckte, die „s e h r fern von der Tapferkeit des Gewissens“ ist, wie die „ebenso
steife als sittsame Tartüfferei des alten Kants“ (JGB 5, KSA 5, S. 19). Die Stärke des
intellektuellen Gewissens wird gerade daran gemessen, ob es „einen lebenslangen
Widerspruch zwischen Sein und Wollen a u s h i e l t “ (FW 99, KSA 3, S. 453), ob es
sich den Nutzen, den der Urteilende mit jeder Weltinterpretation verfolgt, als solchen
eingestehen kann; und schließlich ob dieses Eingeständnis ihn zugrunde richten
oder aber über seine Nöte, v. a. über sein Bedürfnis nach Gewissheit, hinausführen
wird. Eine von van Tongeren zitierte Passage aus Jenseits von Gut und Böse zur
„Grundbeschaffenheit des Daseins“, dessen „Wahrheit“ nicht auszuhalten ist, woran
jedoch die Stärke eines Geistes gerade zu messen sei (JGB 39, KSA 5, S. 56 f.),
erscheint so in neuem Licht. Damit wäre nicht bloß die Unmöglichkeit einer Realisierung von Nietzsches Ideal angedeutet, sondern ein gewisses Kriterium gegeben, eine
Skala dafür, was am höchsten zu schätzen sei. Es handelt sich um eine „Wahrheit“,
die nur als moralischer Imperativ (nicht als theoretisches Urteil) Sinn macht: Man
solle zugunsten des Glaubens entscheiden, der einen am meisten kostet, weil nur
dadurch die Werterhöhung des Menschen, seine Selbstüberwindung möglich ist.
Und Nietzsche lässt seine Leser nicht in der Unwissenheit, welcher Glaube ihm selbst
am schwersten fällt: Der Glaube an die Sinnlosigkeit des Daseins, an die Vergeblichkeit
aller Hoffnungen auf den guten Sinn alles Geschehens. Das wäre sein vornehmer
Glaube, weil er am meisten weh tut, weil er am meisten dem „Herzenswunsch“ eines
Philosophen widerspricht.
In der Fröhlichen Wissenschaft wird dieser Glaube in dem Aphorismus mit
dem viel sagenden Titel „E x c e l s i o r ! “ zum Ausdruck gebracht. Die Steigerung, der
immer wachsende Wert des „übermoralischen“ Ideals ist nur noch durch eine
letzte Entsagung, ein letztes Opfer möglich: Es darf keine Hoffnung, kein Ausruhen
im „endlosen Vertrauen“ mehr geben (FW 285, KSA 3, S. 527 f.).187 Denn das Vertrauen verhindert die Steigerung der Kräfte, gleich jenem See des nietzscheschen
Gleichnisses, der nur dann immer höher steigen kann, wenn „er nicht mehr in
einen Gott a u s f l i e s s t “. Der Gedanke der völligen Sinnlosigkeit und Aussichtslosigkeit des Daseins, des absoluten Fehlens von Sinn und Ziel ist genau deshalb unbedingt anzunehmen: weil er am wenigsten zu ertragen, ja in seiner Gänze nicht zu ertragen ist. Zu ungefähr derselben Zeit wird er in „seiner furchtbarsten Form“ durchdacht:
187 Vgl. auch JGB 55, KSA 5, S. 74. Der Verzicht auf den Gottes-Gedanken, so Nietzsche dort, sei das
letzte Opfer, die letzte und größte Grausamkeit gegen sich selbst.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
175
Das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale
ins Nichts: ‚die ewige Wiederkehr‘. (Nachlass, Sommer 1887, 5[71], KSA 12, S. 213)188
Dies wäre die extremste Form, der höchste Preis und die kaum erträgliche Erfüllung
einer letzten Entsagung, einer letzten Parteinahme gegen die „Wünsche [des] Herzens“ und damit auch ein „lebendige[r] Probirstein[ ] der Seele“. Eine solche Welt als
„vollkommen, göttlich, ewig“ gutzuheißen, sie zu lieben, wäre die höchstmögliche
Überwindung, die unter Menschen erreicht werden kann, die vielleicht nicht erreicht
werden kann.189 Denn, wie im Aphorismus „ E x c e l s i o r ! “ gefragt wird:
Mensch der Entsagung, in Alledem willst du entsagen? Wer wird dir die Kraft dazu geben? Noch
hatte Niemand diese Kraft! (FW 285, KSA 3, S. 528)
Die These van Tongerens, Nietzsche erhebe den Kampf um des Kampfes willen zum
Ideal, muss also in gewisser Weise präzisiert werden. Nicht der Kampf gibt der
„letzten Moral“ ihren Wert, und nicht bloß die Parteinahme zugunsten der untergehenden Kraft wäre als vornehm zu verstehen, auch nicht die einsame Stellung innerhalb des Kampfs. Nietzsches Kriterium kann nur angesichts des feineren Kampfes
innerhalb einer Seele, nur perspektivisch nachvollzogen werden. Wenn die „Wünsche
[des] Herzens“ in jeder Moral, ja in jeder Philosophie verborgen sind, wenn auch die
Grausamkeit des kategorischen Imperativs nichts anderes war als Rechtfertigung der
Perspektive einer Welt, „in welcher der menschlichen Vernunft ‚alles nach Wunsch
und Willen‘ geht“,190 dann hätten „die letzte Moral“, die „Selbst-Überwindung eines
Moralisten“, die Fortsetzung der Aufklärung „an sich selber“ ihren Wert nur, wenn sie
diesen Wert stets erhöhen und dafür einem einzigen Kriterium folgen: dem Wagnis,
auch gegen die eigenen tiefsten und feinsten Wünsche Partei zu ergreifen, dem Misstrauen gegen jede Art Wünschbarkeit, gegen jeden Versuch, ein „Land“ zu behaupten, einen ruhigen Hafen zu erreichen und damit die Fahrt hinaus aufs offene Meer
188 Wie bereits in der Einleitung ausgeführt wurde, gebe ich den Forschern Recht, die (v. a. MüllerLauter und Magnus) sich darum bemühen, diesen „schwersten Gedanken“ Nietzsches in seine Moralphilosophie einzuordnen und nicht als eine Art Weltauslegung im ontologischen Sinne zu verstehen.
Wenn die ewige Wiederkehr, wie die neueste Forschung zeigt, als Lehre über das Sein nicht gelehrt
werden kann, ist sie als Kriterium des Ethischen immer noch relevant und soll gerade als ethische
Lehre Nietzsches Plausibilitäten sichtbar machen. Auch bei van Tongeren wird sie entschieden ethisch,
als Frage nach dem Wert, gedeutet, im Unterschied z. B. zu Günter Abel, der sie als gewisses Kriterium
für die „Wirklichkeit“ des Wiederkunfts-Gedankens interpretiert (Abel, Nietzsche, S. 314).
189 Spinoza als Beispiel einer solchen Einstellung und als „ein Einzel-Fall“ ist kaum zufällig. Sein
„amor dei intellectualis“ deutet zwar auch eine Vollkommenheit an, ist aber gerade das Gegenteil zur
kantischen Liebe als Vervollkommnung der menschlichen Natur durch die ästhetische Ergänzung
ihres moralischen Unvermögens.
190 S. Kaulbach, Autarkie der perspektivischen Vernunft bei Kant und Nietzsche, S. 104.
176
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
der Unendlichkeit zu unterbrechen.191 Die Wünschbarkeit wird so zum negativen
Kriterium von Nietzsches „letzter Moral“. Der Glaube an die „Wahrheit“ der eigenen
Perspektive wird nicht bloß durch den Glauben an die Relativität aller Perspektiven
bzw. an den Kampf als solchen abgelöst, sondern er wird aus dem Misstrauen gegen
die eigenen Gründe des Fürwahrhaltens und des Wollens neu verstanden. Wenn es
ein Glaube an sich selbst sein soll, so nur im Sinne des Glaubens an die eigenen
Widerstandskräfte, des Willens zur fortdauernden Selbstüberwindung, die als Überwindung des eigenen Wollens am schwersten fallen muss.192 Die Schwierigkeit, das
Engagement innerhalb des Kampfes und das Partei-Ergreifen innerhalb einer Seele zu
vereinbaren – die Schwierigkeit, die eine Realisierung des Ideals der Vornehmheit
undenkbar macht –, wird so teilweise gelöst: Es geht nicht bloß um ein Ideal des
Kampfes, sondern um die Selbst-Erhöhung vom Wert des ‚Menschen‘ und deshalb um
die Parteinahme innerhalb dieses Kampfes zugunsten der schwierigsten Gedanken.
Dies allein gibt der Vornehmheit ihren Wert: „Das tiefste Leiden macht vornehm; es
trennt.“ (JGB 270, KSA 5, S. 225)
Das „Engagement für die Vornehmheit“ ist dann tatsächlich „ein Engagement für
den inneren Kampf“.193 Eine vornehme Seele folgt ihrem Vorteil und ehrt sich selbst,
indem sie die Tugend pflegt, an der sie mit großer Wahrscheinlichkeit zugrunde
gehen wird. Dies ist ihr Egoismus und gleichzeitig ihre Selbstlosigkeit. Denn als
Vorteil betrachtet sie nur das, was ihr ihre Ehrfurcht vor sich selbst gebietet, was ihren
Wert erhöht. Doch ist ihr Engagement mit keiner Partei, mit keinem Wunsch identisch,
sondern nur mit dem Willen zur Selbstüberwindung.194 Allein diese sich immer
steigernde Kraft, diese Nötigung zu einer ständigen Selbst-Erhöhung, kann als vornehmer Glaube bezeichnet werden, dessen einziger Leitfaden die Ehrfurcht vor sich ist
191 Man denke dabei an Heraklit: „θυμῶι μάχεσθαι χαλεπóν. ὃ γàρ ἂν θέληι, ψυχῆς ὠνεῖται.“ („Gegen
das Herz ankämpfen ist schwer. Denn was es auch will, erkauft es um die Seele.“) (DK 22 B 85) Diese
Parallele wurde, soweit mir bekannt ist, nicht bemerkt, obzwar die Bedeutung von Heraklit für Nietzsche mehrmals untersucht worden ist. S. z. B. Sarah Kofman, Nietzsche und die Dunkelheit des Heraklit.
192 Es ist auch eine Präzisierung von Müller-Lauters These. Wenn das Kriterium der ‚Wahrheit‘ von
Nietzsche in die Einstimmigkeit mit dem Willen zur Macht gelegt wird, der seinerseits auf den ihm
entgegenstehenden Machtwillen angewiesen ist (Müller-Lauter, Nietzsche, Seine Philosophie der Gegensätze, S. 109), wenn die Größe des Willens an dem ihm entgegenstehenden Widerstand gemessen
werden soll, so ist die Wünschbarkeit ein negatives Kriterium der Moral und nur deswegen der ‚Wahrheit‘. Müller-Lauter bestätigt dies indirekt, indem er die Steigerung des Machtgefühls als Nietzsches
Kriterium der Wahrheit darstellt (Müller-Lauter, Nietzsche, Seine Philosophie der Gegensätze, S. 110).
Vgl. „Der Glaube ist auch nicht ein Glaube an etwas – außer an die Möglichkeit seiner eigenen Selbstüberwindung.“ (Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 569).
193 Van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik, S. 170.
194 Der Unterschied zu Heideggers Interpretation vom Willen zur Macht als „Willen zum Willen“ sei
hier betont (vgl. Heidegger, Nietzsche, Bd. 2, S. 265). Der „metaphysische Wille zum Willen“ wird bei
Nietzsche, wie Müller-Lauter überzeugend zeigte, „zum gewollten Wollen“, das „in der Gestalt des
Willens zur Macht“ als „Gefüge von Wollendem“ „durchschaut“ wird (Müller-Lauter, Nietzsches Lehre
vom Willen zur Macht, S. 1).
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
177
und dessen einzige Gewissheit in der Unendlichkeit einer solchen Aufgabe besteht.
Nur so erweist er seinen Wert, nur so wird die Selbstrelativierung zur Stärke, das
Zugrunde-Gehen an der eigenen Tugend zu einem neuen Anfang.
Man könnte nun fragen, ob mit dieser Analyse von Nietzsches Ideal eines vornehmen Egoismus nicht bloß ein Umweg gegangen wurde, der uns am Ende doch zu
jener Schlussfolgerung geführt hat, die mehrmals als Argument gegen Nietzsche
gebraucht wurde. Muss damit jetzt nicht denjenigen Forschern Recht gegeben werden, die behaupten, Nietzsche verehre das alte, asketische Ideal, wenn auch in einer
verfeinerten und zugespitzten bzw. ad absurdum geführten Variante?195 Denn er
fordere „das tiefste Leiden“ sowie eine letzte Entsagung und folge dabei dem alten
Gegensatz von Wollen und Sollen, tadle also die Unredlichkeiten der alten Moralität
und verwerfe deren Verweichlichung in der christlichen Idee einer altruistischen
Liebe, die das eigene asketische Ideal verfehlt. Bis zu einem gewissen Grad muss
diesen Stimmen tatsächlich Recht gegeben werden, aber mit einer grundlegenden
Einschränkung: Diese Verehrung oder dieses Ideal selbst wird bei Nietzsche entscheidend perspektivisch gedeutet.196 Denn was am meisten wehtut, was als Nützlichkeit verachtet werden soll und was dementsprechend zur Selbst-Erhöhung und
Selbst-Überwindung führt, kann nicht allgemein gesagt werden. Auch wenn die Idee
der Sinn- und Aussichtslosigkeit des Daseins für Nietzsche alternativlos zu sein
scheint, wird diese Idee, diese Optik als sein schwerster Gedanke, als schwierigster
Gedanke des Philosophen, dargestellt. Die Wünschbarkeit als negatives Kriterium ist,
Nietzsche ist sich dessen völlig bewusst, darüber hinaus paradox. Denn wenn „der
Standpunkt der Wü n s c h b a r k e i t “ einer „Verurtheilung des gesammten Gangs der
Dinge“, d. h. einer lebensfeindlichen Moral, gleichgesetzt wird, dann, „indem wir dies
sagen, thun wir das, was wir tadeln“: „Der Standpunkt der Wünschbarkeit, des
195 Die Ansicht, dass Nietzsche mit seiner Forderung nach Wahrhaftigkeit und mit der Hervorhebung
des Gewissens bloß zum alten Ideal zurückkehrt und nur seine Verfehlungen angreift, die Ansicht, die
im Sinne der Widersprüchlichkeit und des Selbstmissverständnisses von Karl Jaspers bis Volker
Gerhardt vertreten wird, kann schließlich nicht völlig überzeugen. Vgl. Jaspers These, dass Nietzsche
in gewissem Sinne eine Selbstkritik des Christentums vornehme (Jaspers, Nietzsche und das Christentum, S. 8) sowie Gerhardts These, Nietzsche kehre, ohne es selbst zu merken, zum alten Ideal zurück,
indem er einer verfeinerten und zugespitzten Form der alten moralischen Forderung tief verpflichtet
geblieben sei, die er eigentlich zu entlarven suchte (vgl. Gerhardt, Die kopernikanische Wende von Kant
und Nietzsche, S. 172 f.).
196 Nietzsche gibt diesem Einwand im Voraus Recht (vgl. GM III, 27, KSA 5, S. 409). Auch MüllerLauter, der sich um eine nichtmetaphysische Deutung des Willens zur Macht bemühte, musste nach
der scharfen Polemik hinsichtlich seiner These (vgl. Köster, Die Problematik wissenschaftlicher Nietzsche-Forschung. Kritische Überlegungen zu Wolfgang Müller-Lauters Nietzschebuch) zugestehen: „Kein
Zweifel, daß Nietzsche Metaphysiker bleibt. Kein Zweifel, daß er Metaphysik restauriert […] Aber
wesentlich scheint mir, daß hinter den von ihm immer wieder aufgerichteten Fassaden in Konsequenz
seines unablässigen Fragens Metaphysik zerfällt“. „In Nietzsches Denken geschieht aber noch mehr:
die Zerstörung der Metaphysik aus ihr selbst heraus.“ (Müller-Lauter, Nietzsches Lehre vom Willen zur
Macht, S. 1 f.)
178
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
unbefugten Richterspielens gehört mit in den Charakter des Gangs der Dinge“ (Nachlass, Ende 1886–Frühjahr 1887, 7[62], KSA 12, S. 316) und darf nicht getadelt werden.
Es ist eine klassische Paradoxie: Indem man die Wünschbarkeit verwirft, drückt man
schon die Wünschbarkeit bzw. seine Unzufriedenheit mit dem Dasein aus. Mit anderen Worten: Der Verzicht auf die Wünschbarkeit, die Parteinahme gegen die eigenen
Wünsche ist auch eine Art Wünschbarkeit, deren Entdeckung wieder zu einer
Wünschbarkeit führt usw., ad infinitum. Nietzsche notiert sich in diesem Zusammenhang:
[…] wie? ist vielleicht das Ganze aus lauter unzufriedenen Theilen zusammengesetzt, die allesammt Wünschbarkeiten im Kopf haben? ist der ‚Gang der Dinge‘ vielleicht eben das ‚Weg von
hier! Weg von der Wirklichkeit!‘, die ewige Unbefriedigung selbst? ist die Wünschbarkeit vielleicht die treibende Kraft selbst? Ist sie – deus? (Nachlass, Ende 1886–Frühjahr 1887, 7[62],
KSA 12, S. 317)
Dies ist Nietzsches Gegenstück zum kantischen Ideal der Welt als „schönes moralisches Ganze[s] in ihrer ganzen Vollkommenheit“. Es lässt sich nicht auf ein Ideal
bringen.
Die Paradoxie der Wünschbarkeit wird (ausdrücklich nur in den unveröffentlichten Notaten) in Nietzsches Argumentation gegen die „Wünsche seines Herzens“
stets mit einbezogen, sie muss bei allem Pathos mitgedacht werden, genauso (und die
Parallele ist alles andere als zufällig) wie die schon angesprochene Paradoxie vom
„abgründlichen“ Gedanken zur ewigen Wiederkehr des Gleichen nicht außer Acht zu
lassen ist: Er kann nicht als Lehre gelehrt werden, denn als Lehre verleugnet er sich
selbst. Die Forderung einer letzten Selbstlosigkeit, die auf jede Art Wünschbarkeit
Verzicht leisten soll, wird radikal paradoxiert: Sie kann nicht gefordert werden, sie
kann schließlich kein Imperativ sein. Wie richtig die These zur Verehrung des alten
Ideals bei Nietzsche auch sein mag, sie bleibt eine dürftige Schlussfolgerung, besonders als Argument gegen Nietzsche.197
Jedoch viel wichtiger, als die Kontinuität zwischen Nietzsche und dem kantischchristlichen Begriff der Moral festzustellen und auf die feinen Unterschiede hinzuweisen, ist für diese Untersuchung, die Plausibilitäten von Nietzsches „letzter Moral“ in
den Blick zu bekommen. Und diese zeigen sich in seinem „übermoralischen“ Kriterium der Wünschbarkeit auf entscheidende Weise. Von den schärfsten Formulierungen
in Menschliches Allzumenschliches bis hin zu der feinsten Nuancierung in Jenseits von
Gut und Böse hält sich der Gedanke durch, laut dem aller Glaube „aus der Angst und
197 Genauso allerdings wie die übertrieben scharfe Entgegensetzung von dem wie auch immer verstandenen Ideal Nietzsches und dem christlichen moralischen Ideal. S. z. B. Peter Köster, Das Fest des
Denkens. Ein polemisches Motto Heideggers und seine ursprüngliche Bedeutung in Nietzsches Philosophie. Zu dieser Entgegensetzung seitens der Theologie s. Josef Ratzinger (Benedikt XVI.), Jesus von
Nazareth, Teil 1: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung, S. 128 ff.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
179
dem Bedürfniss“ (MA I, 110, KSA 2, S. 110) geboren ist,198 sowie der Imperativ, allen
„metaphysischen Bedürfnissen“ einen „schonungslosen Krieg auf’s Messer“ zu erklären (JGB 12, KSA 5, S. 27), und nicht nur denen, sondern jeglicher Neigung, an etwas,
sei es „an einer Person“, „an einem Vaterland“ oder „an einer Wissenschaft“, „hängen zu bleiben“. Dies sei
das gefährlichste Spiel […], das man spielen kann, und zuletzt nur Proben, die vor uns selber als
Zeugen und vor keinem anderen Richter abgelegt werden. […] Man muss wissen, s i c h z u
b e w a h r e n : stärkste Probe der Unabhängigkeit (JGB 41, KSA 5, S. 59).
Nur so zeige sich die Stärke des Willens, nur so beweise der Wille seinen Wert.
Die Forderung, alles „unter die Polizei des Misstrauens“ zu stellen (FW 344,
KSA 3, S. 575), weist so unmissverständlich darauf hin, was von Nietzsche als seine
Plausibilität angenommen wird: Das Misstrauen soll unter allen Umständen jeder Art
von Glauben und Vertrauen, sei es in ein allgemeines Urteil oder in eine Person,
vorgezogen werden, weil das Misstrauen immer schwerer fällt und unerträglicher ist als
sein Gegenteil – als Vertrauen, als Glaube. Nur wenn dies als Plausibilität gilt, ist die
Behauptung, der Glaube zeige die Schwäche und sogar die „E r k r a n k u n g d e s
W i l l e n s “ (FW 347, KSA 3, S. 582), selbst plausibel.199 Die fortdauernde Selbstüberwindung sei deshalb nur durch Misstrauen, stetigen Verdacht und Selbst-Verdacht,
möglich. Nur so könne die vornehme Seele sich selbst ehren und immer mehr an
„Selbstherrlichkeit und Kraft“ gewinnen. Dies gilt jedoch nicht für irgendeine aristokratische „Kaste“, sondern nur für Nietzsches eigenes Ideal der Vornehmheit – für
sein Ideal der Vornehmheit für die Philosophie. Der Wert des Misstrauens ist mit dem
Wert der Philosophie nun selbst gleich zu setzen:
[…] wir wissen es, die Welt, in der wir leben, ist ungöttlich, unmoralisch, ‚unmenschlich‘, — wir
haben sie uns allzulange falsch und lügnerisch, aber nach Wunsch und Willen unsrer Verehrung,
das heisst nach einem Bedürfnisse ausgelegt. Denn der Mensch ist ein verehrendes Thier! Aber er
ist auch ein misstrauisches: und dass die Welt nicht das werth ist, was wir geglaubt haben, das
ist ungefähr das Sicherste, dessen unser Misstrauen endlich habhaft geworden ist. So viel Misstrauen, so viel Philosophie. (FW 346, KSA 3, S. 580)
Es wurde oben schon angedeutet, dass die Macht einer Plausibilität nicht anders als
durch ihre eigenen äußersten Konsequenzen gebrochen werden kann. Nur nach
dieser Zuspitzung ad absurdum wird es deutlich: Es ist die Macht einer Plausibilität
und nicht das Unbegreifliche eines Faktums, es ist der Wille zur Macht und nicht die
198 In Menschliches, Allzumenschliches wird das als Beweis der Unwahrheit aller Religionen gedeutet
(MA I, 110, KSA 2, S. 110).
199 Diese Behauptung wird dadurch begründet, dass der Wille selbst mit dem „Affekt des Befehls“
identisch sei. Der Gehorsam sei dagegen Zeichen der Willensschwäche. Denn er fordert weniger Kraft,
fällt also leichter als Befehlen. Man merkt, dass, als Behauptungen formuliert, diese Leitsätze nicht
alternativlos sind.
180
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Moral aus Vernunft, die uns zwingt, diesen Plausibilitäten unser Vertrauen zu schenken – ein Vertrauen, das die höchste Gefahr für das Leben darstellt, da es immer mit
dem Preis einer erheblichen Verengung der Perspektive, einer Vereinfachung, einer
Verarmung zu bezahlen ist. Nietzsches Kritik der Moral, sein Hinterfragen der Moral
nach ihrem Wert fordert den aufmerksamen Leser gerade dazu heraus, Plausibilitäten
stets zu bedenken, auch die von Nietzsches „letzter Moral“.
Das Misstrauen soll dem Vertrauen vorgezogen werden, jeder Art Glauben soll
gekündigt werden, außer dem Glauben, der zur Selbstüberwindung führt. Nur so
wird man zu einem freien Geist; nur so wird der Standpunkt der Wünschbarkeit
überwunden und dem Kämpfenden ein Kriterium gegeben, wie er seine Tugend am
besten zu pflegen hat und seinem Verhängnis entgegentreten soll. Dieses Pathos
scheint bei Nietzsche eine Konstante zu sein. Und gerade deswegen sollte auch diese
Plausibilität aus Nietzsches Strategie des Misstrauens heraus bedacht werden: Auch
dies ist schließlich ein Glaube; auch ihm darf nicht einfach Vertrauen geschenkt
werden.200 Die tapferste Selbstüberwindung gebietet, dass man nicht nur an einem
Glauben oder an einer Person nicht „hängen bleib[t]“, sondern auch an seinen
„eignen Tugenden“, „an seiner eignen Loslösung“, „an jener wollüstigen Ferne und
Fremde des Vogels, der immer weiter in die Höhe flieht, um immer mehr unter sich
zu sehn“ (JGB 41, KSA 5, S. 59). Denn auch dies könnte Zeichen einer Abhängigkeit
des „Vogels“ sein, seiner Angst vor der Unendlichkeit und seinem Bedürfnis nach
Halt. Die unbedingte „P f l i c h t zum Misstrauen“ (JGB 34, KSA 5, S. 53) führt so paradoxerweise zum Misstrauen gegen diese Pflicht selbst. Verrät dieses Misstrauen,
auch in seiner extremsten Form, der des „G l a u b e n [ s ] a n d e n U n g l a u b e n “ „nach
Petersburger Muster“, nicht „das B e d ü r f n i s nach Glauben, Halt, Rückgrat, Rückhalt“ (FW 347, KSA 3, S. 582)?
Im fünften Buch der Fröhlichen Wissenschaft, in dem Aphorismus „I n w i e f e r n
a u c h w i r n o c h f r o m m s i n d “, wird diese Plausibilität thematisiert, diese Forderung, alles „unter die Polizei des Misstrauens“ zu stellen, nach ihrem Wert für das
Leben hinterfragt. Wenn die Forderung des Misstrauens zu Anfang des Aphorismus
Nietzsches eigenes Pathos zu sein scheint, so wird im Weiteren die folgende Frage an
die Wissenschaft mit ihrer moralischen Forderung nach der „Wahrheit um jeden
Preis“ gerichtet:
200 Das Misstrauen wird von Stegmaier in seiner schon mehrmals angegebenen umfassenden Untersuchung des fünften Buchs der Fröhlichen Wissenschaft als die von Nietzsche angesetzte, die Philosophie befreiende Kraft ausgelegt. Sie befreie das Denken von der metaphysischen Begrifflichkeit,
von den transzendenten Werten und vom lebensverneinenden Pessimismus. Ihr Gegenteil sei „Erkrankung des Willens“ bzw. Willensschwäche oder Heuchelei. Dieses Pathos führe jedoch nicht zum
oberflächlichen Optimismus, sondern werde zu einem großen Fragezeichen, das man an sich selbst, an
eigene Verehrungen und Bedürfnisse immer wieder stellen muss. S. Stegmaier, Nietzsches Befreiung
der Philosophie, bes. S. 192–220.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
181
Was wisst ihr von vornherein vom Charakter des Daseins, um entscheiden zu können, ob der
grössere Vortheil auf Seiten des Unbedingt-Misstrauischen oder des Unbedingt-Zutraulichen ist?
(FW 344, KSA 3, S. 575 f.)
Wenn das Kriterium für einen solchen Vorteil fehlt, wenn wir nichts über den Charakter des Daseins wissen können, dann wäre es eine erhebliche Anmaßung, von
vornherein entscheiden zu wollen, ob das Zutrauen „weniger schädlich, weniger
gefährlich, weniger verhängnisvoll“ sein soll als sein Gegenteil, das Misstrauen. So
könnte man bspw. fragen, ob die kantische „freie Aufnahme des Willens eines
Anderen“ unter Maximen des eigenen Willens und vielleicht auch die christliche
Liebe zu den Menschen „um Gottes willen“ nicht „gefährlicher“, nicht schmerzhafter
wäre und nicht mehr Kraft gefordert hätte als ihr Gegensatz – als Verzicht auf ein
solches Zutrauen, als konsequentes Sich-Verweigern eines jeden Glaubens. Vielleicht
folgt dieser Verzicht auch „aus der Angst und dem Bedürfniss“, v. a. aus dem Unvermögen glauben und lieben zu können – dem Unvermögen, das im nihilistischen
Glauben an den höchsten Wert dieses Verzichts zur Ruhe kommt.
Das Pathos der Selbst-Erhöhung des „Typus ‚Mensch‘“ durch die schmerzhafte
Selbstüberwindung brachte Nietzsches moralisches Kriterium ins Spiel, das seinerseits auf seinen schwierigsten und gefährlichsten Gedanken hinwies. Dies sollte seine
„letzte Moral“ sein, die das Vertrauen in die Moral selbst aus Moralität kündigt. Sie
weist deutlich auf ihre Grenzen hin, indem sie die eigenen Plausibilitäten verrät: Auch
sie, als eine Moral, ist eine Vereinfachung, eine nicht alternativlose Sicht auf die
komplexe und widerspruchreiche Bewegung des Lebens. Denn, wie Nietzsche gleich
hinzufügt, es könnte durchaus sein, dass für das Leben „beides nöthig sein sollte, viel
Zutrauen u n d viel Misstrauen“ (FW 344, KSA 3, S. 576).
Mit diesem Verdacht oder eher mit diesem „Verraten“ eigener Plausibilitäten
schließt Nietzsche den paradoxen Kreis seines Hinterfragens der Moral nach ihrem
Wert. Trotz dieses Verratens bleibt das Pathos eines vornehmen Glaubens bestehen,
denn, so führt schon der folgende Aphorismus aus, nur eine persönliche Stellungnahme zum Problem taugt zur Philosophie und „die grossen Probleme verlangen alle
die g r o s s e Li e b e “ (FW 345, KSA 3, S. 577). Sie können nicht „objektiv“ betrachtet
werden. Und wenn, dann nur indem gerade diese „Objektivität“ das „Für und Wider“
verrät. Das Misstrauen trägt in sich keinen Wert. Dieses ist auch dem „Blick des
Sklaven“ eigen, der seinen Nutzen, sein „Glück“ sucht (JGB 260, KSA 5, S. 211).201 Eine
Entscheidung, ob das Misstrauen vornehm ist, ist eine persönliche Entscheidung. Nur
vom je eigenen Standpunkt aus lässt sich sagen, ob es tatsächlich eine Entscheidung
zugunsten des schwierigsten Gedankens und der verhängnisvollsten Tugenden gewe-
201 Das Misstrauen ist nicht unbedingt das „Zeichen der Vornehmheit“, denn der Misstrauische
könnte gerade „der Feige, der Ängstliche, der Kleinliche, der an die enge Nützlichkeit Denkende“ sein
(JGB 260, KSA 5, S. 209).
182
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
sen war, ob die Selbstüberwindung damit am besten gefördert wurde. Oder vielmehr:
Es lässt sich nur erraten, es liefert den Grund für einen weiteren Selbst-Verdacht. Der
paradoxen Forderung, gegen die eigene Wünschbarkeit zu entscheiden, kann kein
allgemeiner Wert zugeschrieben werden. Die Plausibilität von Nietzsches Moralkritik
entzieht sich einer Verallgemeinerung und bringt ein Kriterium ins Spiel, das die Frage
nach einem Wert für jedermann zurückweisen muss.
Das Verraten der eigenen Plausibilitäten wird zur letzten Konsequenz von Nietzsches Kritik der Plausibilitäten der abendländischen Moral. Wenn der Anspruch auf
die „letzte Moral“ nicht verfehlt sein sollte, wenn die Moral tatsächlich als Problem
betrachtet und ihr Wert für das Leben ernsthaft hinterfragt werden sollte, dann
dürften die ad absurdum geführten Grundgewissheiten der abendländischen Moral
nicht verschwiegen, sondern müssten als persönliche Entscheidungen dargestellt
werden, als eine Art Willkür, die keine weiteren Gründe anzugeben und sich nicht
weiter zu legitimieren weiß. Damit wird u. a. der alte Vorwand eines performativen
Selbstwiderspruchs bei Nietzsche entkräftet. Die „Wahrheit“, die man nur bis zu
einem gewissen Grad aushalten kann, die man „verdünnt und verhüllt, versüsst,
verdumpft, verfälscht nöthig“ hat, steht nicht bloß in Anführungszeichen, sondern ist
tatsächlich immer nur aus der Perspektive des eigenen „Für und Wider“ wahrnehmbar: Sie ist keine Wahrheit der theoretischen oder praktischen Vernunft, sondern die
Wahrheit der eigenen Plausibilitäten, die als solche nur bis zu einem gewissen Grad
eingesehen bzw. in Frage gestellt werden können.202 Den Umgang mit einer solchen
„Wahrheit“ bestimmt Nietzsches Begriff vom „Jenseits“:
Mit einer ungeheuren und stolzen Gelassenheit leben; immer jenseits –. Seine Affekte, sein Für
und Wider willkürlich haben und nicht haben, sich auf sie herablassen, für Stunden; sich auf sie
s e t z e n , wie auf Pferde, oft wie auf Esel: – man muss nämlich ihre Dummheit so gut wie ihr
Feuer zu nützen wissen. (JGB 284, KSA 5, S. 231 f.)
Wenn man das überhaupt nicht versucht, so würde jedes Für und jedes Wider bloß zu
dem, was Nietzsche als kantischen Idiotismus bezeichnete – eine Unfähigkeit, die
eigene Beschränktheit einzusehen und andere Perspektiven zumindest als Möglichkeiten zuzulassen. Wenn dies nicht nur „für Stunden“, sondern endgültig erreicht
werden könnte, so würde jedes Für auch das Wider verraten und damit sein Feuer
auslöschen.203
202 Wie Simon zeigt, ist der Vorwand eines performativen Selbstwiderspruchs im Falle Nietzsches
ohne Geltung, denn Nietzsche behauptet nicht, es gebe keine Wahrheit, sondern dass ihr Begriff
widersinnig sei. Der Anspruch auf rein objektive Gewissheit leugnet das Situationsverhaftete, das
Perspektivische im Fürwahrhalten; er leugnet damit auch die Grundbedingung des Fürwahrhaltens
(Simon, Grammatik und Wahrheit, S. 3).
203 Trotz ständiger Selbstdistanzierung und Perspektivierung kann auch Nietzsches „fröhliche Wissenschaft“ m. E. nicht „vom Glauben aller Art“ befreien, ohne sich selbst neue Gewissheiten bzw.
wiederum ein Ideal aufzuerlegen (vgl. Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 642). Nietz-
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
183
So lässt sich das Zwiespältige von „Kraft“ und „Weisheit“, auch im Blick auf
Nietzsches Umgang mit den eigenen Plausibilitäten, feststellen, das Müller-Lauter
und van Tongeren als das Problematische des nietzscheschen Ideals angesehen
haben. Denn es scheint gerade unmöglich zu sein, das eigene „Für und Wider“ „willkürlich [zu] haben und nicht [zu] haben“, damit würden sie kein Für und Wider mehr
sein. Nietzsches Ideal einer fortdauernden Selbstüberwindung bewegt sich zwischen
dieser erschlaffenden Weisheit, dieser übermenschlichen „Objektivität“, die dem
„deus“ der Wünschbarkeit seine Treue gekündigt hat, und dem „Idiotismus“, der nur
die eigene Perspektive kennt und keiner Distanz zu den „Wünsche[n] seines Herzens“
fähig ist. Dieses Ideal, als unerlässliche Bewegung, als stetiges Sich-Misstrauen verstanden, ist zwar nicht mehr widersprüchlich, aber immer noch problematisch. Auch
in dieser Interpretation lässt es die Frage offen, auf die Nietzsche dauernd eine
Antwort suchte: ob und wie man bewusst in der Illusion bleiben kann bzw. wie man
das eigene „Für und Wider“ gleichzeitig ernst nehmen und sich als nicht alternativlos
eingestehen kann. In Bezug auf unsere Fragestellung lässt die Frage sich folgenderweise reformulieren: Ist es möglich, eigene Plausibilitäten zu verraten und sie
trotzdem als plausibel anzusehen? Und wie soll dies möglich sein? Nietzsches Antwort
auf diese Frage soll im nächsten Abschnitt dieses Kapitels dargestellt werden, sie ist
gleichzeitig seine Antwort auf die Frage nach der Aufgabe der „Philosophie der
Zukunft“.
Trotz dieser Schwierigkeiten hat Nietzsches Kritik an der Moral aus Vernunft ihr
Ziel erreicht: Das „Sich-bewusst-werden des Willens zur Wahrheit“ oder, anders
gesagt, das Sichtbar-Werden der Plausibilitäten der „letzten Moral“ sollte die Moral
als allgemeine Forderung an jedermann zu Grunde richten – als etwas Willkürliches,
als großes Selbst-Missverständnis, das am Ende den eigenen Untergang als „grosse[s]
Schauspiel in hundert Akten“ inszenieren muss (GM III, 27, KSA 5, S. 410). Man könnte
hier freilich auch weitere Fragen stellen: Warum sollte die Selbstüberwindung der
Moral als eigentliches Ziel einer „lange[n] geheime[n] Arbeit“ der „feinsten und
redlichsten“ Kräfte angesehen werden? Die Frage nach der Begründung der Plausibilitäten der „letzen Moral“ lässt sich aber nicht stellen. Nur eine Möglichkeit bleibt
offen, die alte Möglichkeit des „träumerische[n] Zeitalter[s]“, „eine[r] vorwissenschaftliche[n] Art der Philosophie“: eine Erklärung „in Begriffen“ bzw. ein Abschluss der
Deduktion in einem „Vermögen“. Für die Begründung der Plausibilität eines vornehmen Glaubens an „die letzte Moral“ wird jedoch ein Vermögen gewählt, dessen
Rolle in Sachen der Moral immer bestritten und verleugnet wurde, und das deshalb
nicht als Begründung bzw. Legitimation angesehen werden konnte: der Begriff des
Geschmacks. Da die „letzte Moral“ gerade auf die Pluralität der Plausibilitäten, auf die
sches Glaube bzw. sein Halt an der „Gewissheit, dass Interpretationen ungewiss bleiben, dass es keine
letztgültigen Interpretationen geben kann“ (Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 646),
verbirgt darum ebenfalls Plausibilitäten bzw. Anhaltspunkte seiner Orientierung, so wie jeder andere
Glaube.
184
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Nicht-Alternativlosigkeit ihres eigenen Ideals anspielte, konnte es jetzt nur noch eine
Geschmackssache sein, ob diese Plausibilitäten angenommen oder abgelehnt werden.
Der Geschmack hatte nach Kant bei den Fragen der Moral und Erkenntnis nichts
zu sagen. Wenn Nietzsche dagegen behauptet, dass es auch hier um einen guten bzw.
schlechten Geschmack geht, so ist diese These nicht im Sinne der Beliebigkeit zu
verstehen, sondern im Sinne einer schon von Kant angesprochenen Paradoxie: Der
Kanon eines guten Geschmacks, der durch ein Geschmacksurteil behauptet wird, als
ob es allgemein gültig wäre, entsteht erst durch dieses Urteil und wird als solcher den
anderen zugemutet. Es sei denn, man hätte genug Kraft und Selbstvertrauen, um ein
anderes Urteil zum Muster eines neuen guten Geschmacks umzudeuten.
Gerade diese Umdeutung versucht Nietzsche mit seinem Begriff des guten Geschmacks in der Moral. Seine „letzte Moral“ kann sich nicht legitimieren: weder durch
ein Faktum noch durch einen Nutzen. Dies ist ihr guter Geschmack, dass sie keine
Begründungen, keine Selbstlegitimationen vortäuscht. Da es sich aber gleichzeitig um
die äußerste Konsequenz der abendländischen Moral aus Vernunft handelt, kompromittiert sie durch diesen Verzicht auf Begründungen, durch ihre Lust an dem Verraten
eigener Plausibilitäten jede Moral, die sich begründen will. Der Wille zur Wahrheit,
die „Liebe zur Wahrheit“ verrate gerade einen „schlechte[n] Geschmack“ (FW Vorrede 4, KSA 3, S. 352). Und „der schlechteste aller Geschmäcker“ wäre „der Geschmack für das Unbedingte“ (JGB 31, KSA 5, S. 49), der Wille zu „einer Wahrheit für
Jedermann“ (JGB 43, KSA 5, S. 60). Von diesem Geschmacksurteil aus erscheint nun
jede Moral als geschmacklos und so auch jede Erkenntnis, die die Gewissheit und
Allgemeingültigkeit anstrebt.204 Auch Kant, der die Philosophie als Kritik verstand,
welche die unbedingte moralische Forderung begründet, wird Geschmacklosigkeit
vorgeworfen.205
Es scheint allerdings äußerst wichtig, auch in einer Interpretation von Nietzsches
Kritik am kantischen Begriff des Geschmacks eine bloße Umdrehung der Gegensätze
und eine Reduktion auf die Physiologie zu vermeiden. Anlass dafür gibt Nietzsche
freilich genug. Alle drei Arten des Wohlgefallens, die Kant sorgfältig von einander
abgrenzte – das Wohlgefallen am Guten, am Angenehmen und am Schönen –, scheinen hier auf die physiologische Lust reduziert zu sein. Wenn es keine „interesselose
Anschauung“ geben kann, wenn in der Ästhetik ebenso wie in der Moral jede Rede
vom Interesselosen, Selbstlosen, Objektiven nur „verführerisch“ sei (JGB 33, KSA 5,
S. 52), dann müsse den Geschmacksurteilen ihr eigenes konstitutives Prinzip abgesprochen werden. Die Geschmacksurteile seien physiologisch bedingt und ihr Anspruch auf eine Unbedingtheit würde nur einen schlechten Geschmack verraten. In
204 Vgl. „Man soll es [das Dasein] vor Allem nicht seines vieldeutigen Charakters entkleiden wollen:
das fordert der gute Geschmack, meine Herren, der Geschmack der Ehrfurcht vor Allem, was über
euren Horizont geht.“ (FW 373, KSA 3, S. 625) Auch die Erfurcht gehört zum guten Geschmack.
205 Vgl. JGB 210, KSA 5, S. 144; Nachlass, Sommer–Herbst 1884, 26[96], KSA 11, S. 175.
2.2 Nietzsches Aufhebung der Moral
185
kantischer Sprache: Was „gefällt“ und was „vergnügt“, ist nicht unterscheidbar,
sondern entsteht aus einer „subjektiven Empfindung“, aus einem Interesse heraus,
das in der „subjektiven Beschaffenheit des Subjekts“ seinen Grund hat, das „Interesse
der Vernunft“ eingeschlossen.
Doch impliziert Nietzsches Kritik an Kants Formel „ohne Interesse“ vielmehr als
die bloße Reduktion auf Physiologie.206 Der Geschmack wird experimentell gerade mit
der physiologischen Nützlichkeit konfrontiert. Ebenso wie die Nützlichkeit in der
Moral bloß eine Pseudo-Erklärung wäre, da auch die Selbstsucht blind, kleinlich und
anspruchslos sein kann (FW 335, KSA 3, S. 562), so wäre es auch der Geschmack. Es sei
ein großer Irrtum bspw. zu denken, der Geschmack wäre derjenige, der „über den
W e r t h d e r N a h r u n g “ entscheidet. Der Geschmack habe dagegen zum größten Teil
„W ü r z e n nöthig“, um den Menschen nicht verhungern zu lassen (Nachlass, Frühjahr–Herbst 1881, 11[112], KSA 9, S. 481). Bei jedem Wohlgefallen handelt es sich so
nicht um etwas Ursprüngliches, Eindeutiges, Wahres, sondern um ein vieldeutiges
Oberflächen-Phänomen. Auch der Geschmack gehört in die Geschichte eines Herdentiers. Auch er, der sich für etwas Privates, ausschließlich Individuelles hält, ist, wie
das Bewusstsein selbst, vom „Genius der Gattung“ besessen (FW 354, KSA 3, S. 590 ff.).
Auch er fordert Gehorsam und befiehlt, auch er kann als Wille betrachtet und mit
einem anderen Willen konfrontiert werden. Er kann über den Wert der Nahrung und
über den der Handlung täuschen. Er ist somit keine physiologische Tatsache, kein
bloßer Affekt, sondern, wie die Moral, eine „Zeichensprache der Affekte“, eine Semiotik für den langen Prozess, der undurchschaubar geworden ist, der vergessen wurde.
Wir folgen einem Geschmack, weil wir nur seine Sprache kennen.
Der Begriff des Geschmacks ist somit auch ein Gegen-Begriff und vielleicht einer
der stärksten unter Nietzsches Gegen-Begriffen. Er begründet nichts, er liefert keine
Erklärung, die weitere Unterscheidungen legitimieren könnte. Gerade umgekehrt:
Indem der Verzicht auf Begründungen als guter Geschmack dargelegt wird, werden
mehrere Umwertungen beleuchtet, die in der Geschichte der Wertschätzungen vollzogen worden sind. Dieser Begriff eröffnet mehrere Perspektiven, unter denen „unser“
Geschmack von heute nur einer ist. Man kann ihm gehorchen und ihn für vornehm
halten. Aber da es eine „Geschmackssache“ ist, was man hier als „vornehmen Geschmack“ (JGB 46, KSA 5, S. 67) ansieht, kann man versuchen, sich diesem Geschmack zu widersetzen und einem „anderen umgekehrten Geschmack“ (JGB 2, KSA
5, S. 17) Gehör zu schenken. So macht es Nietzsche selbst, wenn er in der Fröhlichen
Wissenschaft zugibt:
Jetzt entscheidet unser Geschmack gegen das Christentum, nicht mehr unsere Gründe. (FW 132,
KSA 3, S. 485)
206 Vgl. GM III, 6, KSA 5, S. 347; Nachlass, Frühjahr–Sommer 1883, 7[18], KSA 10, S. 243; 7[154], KSA
10, S. 293. Zu Nietzsches Kritik an Kants Formel „ohne Interesse“ s. z. B. Spremberg, Zur Aktualität der
Ästhetik Immanuel Kants, S. 121 ff.
186
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Die eigenen Plausibilitäten werden somit als solche von Nietzsche noch einmal sichtbar gemacht: Wenn auch das Ideal des Sich-Misstrauens und Selbstüberwindung
schließlich nicht das Ideal schlechthin, sondern nur eine Geschmackssache ist, so
impliziert diese demonstrative Aussage eine Einladung, eine Herausforderung – diesen Geschmack als „unseren“ guten Geschmack zu akzeptieren oder aber sich ihm zu
widersetzen, wenn man sich dies traut, wenn man genug Vertrauen in seinen eigenen
Geschmack hat. Denn:
Die Veränderung des allgemeinen Geschmackes ist wichtiger, als die der Meinungen; Meinungen
mit allen Beweisen, Widerlegungen und der ganzen intellectuellen Maskerade sind nur Symptome des veränderten Geschmacks […]. (FW 39, KSA 5, S. 406)
Der Begriff des Geschmacks steht bei Nietzsche so für die Möglichkeit einer Umkehrung, eines Perspektivenwechsels, einer Umwertung. Dies kann keine Philosophie, die sich als Wissenschaft versteht, denn als Wissenschaft bleibt sie den
eigenen Plausibilitäten verhaftet. Um den alten Geschmack für das Unbedingte
als schlechten Geschmack darzustellen, um zum Ideal des Kampfes, des Misstrauens, des Zugrunde-Gehens, der Selbstüberwindung zu verführen, muss man „etwas Kunst in seine Gefühle […] legen und lieber noch mit dem Künstlichen den
Versuch […] wagen: wie es die rechten Artisten des Lebens thun“ (JGB 31, KSA 5,
S. 49). Das Privilegium und die Aufgabe des Perspektivenwechsels gebühren
nicht den Wissenschaftlern, aber auch nicht den Künstlern. Sie gebühren allein
den Philosophen, wie Nietzsche sie versteht: als „B e f e h l e n d e u n d G e s e t z g e b e r “ (JGB 211, KSA 3, S. 145), als „rechte[ ] Artisten des Lebens“ (JGB 31, KSA 5,
S. 49). Das können nur Einzelne sein, „Mächtige, Einflussreiche ohne Schamgefühl“, die
i h r hoc est ridiculum, hoc est absurdum, also das Urtheil ihres Geschmacks und Ekels, aussprechen und tyrannisch durchsetzen: – sie legen damit Vielen einen Zwang auf, aus dem
allmählich eine Gewöhnung noch Mehrerer und zuletzt ein B e d ü r f n i s A l l e r wird. (FW 39,
KSA 3, S. 406 f.)
Dadurch erkennen sie ihre eigene Kraft, dadurch kommt der Herr in ihnen zum
Ausdruck; nicht indem man die Legitimation für seine Urteile sucht oder sogar ihre
Unbegründbarkeit zugesteht, nicht indem man dem Unbegreiflichen eine Grenze
zieht oder das Überschreiten dieser Grenze verlangt, sondern indem eine Veränderung, ein Wechsel, eine Erneuerung des Geschmacks gewagt wird. Es ist der Mut zu
einem neuen Geschmack, der Mut zur Umwertung, der zum freien Geist macht. Es ist
auch der Mut, seine eigenen Plausibilitäten zu verraten, seine eigenen Urteile unter
die Geschmacksurteile zu rechnen, hier keine Gemeinschaft vorzuspielen, sondern
sie bewusst als eigene Wertschätzungen, als eigene Ungerechtigkeit, als persönliche
„grosse Liebe“ darzulegen. So wird es in einem Entwurf zu Also sprach Zarathustra
notiert:
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
187
[…] deine Tugend war dir lieb: so heiße sie nunmehr auch nicht mehr Tugend, sondern deinen
Geschmack — so nämlich will es guter Geschmack! (Nachlass, Winter 1884–1885, 31[52], KSA 11,
S. 385)
Aber gerade der gute Geschmack darf wiederum nicht vergessen lassen, dass jeder
seinen eigenen „guten Geschmack“ hat. Für einen Kranken, der sich stets am Abgrund
befindet, der stets an sich leidet und für den eine stetige Selbstüberwindung zur
persönlichen Not geworden ist, würde „guter Geschmack“ gerade das bedeuten: Das
Leben, das ihm wie sinnloses und aussichtloses Leiden vorkommt, nicht zu verachten.207 Diese Verachtung überträgt er stattdessen auf alles, was ihm als Selbstbetrug
erscheint. Er ist zu stolz, um den grundlosen Hoffnungen zu vertrauen, zu misstrauisch, um bei einer Überzeugung stehen zu bleiben, und zu anspruchsvoll, um denjenigen zu verzeihen, die den „Wünschen [ihres] Herzens“ Gehör schenken. Eine letzte
Entsagung ist seine „letzte Moral“, das Sich-Abfinden mit der Sinnlosigkeit ohne Trost
sein höchstes Ziel, der Verzicht auf jede Art von Glauben, außer dem Glauben der
„Heimatlosen“, seine Tapferkeit. So gesteht Nietzsche, dass es eine schwere Krankheit
war, durch die sein „guter Geschmack“ entstand,
die Kunst, mich heiter, objektiv, neugierig, vor allem gesund und boshaft zu g e b e n (MAM II,
Vorrede 5, KSA 2, S. 374).
Zu diesem Schauspiel zwang ihn die Plausibilität seines Ideals des Misstrauens,
seines Ideals der Philosophie.
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
Die Moral aus Vernunft unter der Optik der Kunst
Der Begriff des Geschmacks führt uns in den Bereich, der bisher in unserer Analyse von
Nietzsches Kritik an den Plausibilitäten einer Moral aus Vernunft außer Acht gelassen
wurde – zu seiner Philosophie der Kunst. Die Kunst, „in der gerade die L ü g e sich
heiligt, der W i l l e z u r Tä u s c h u n g das gute Gewissen zur Seite hat“, so Nietzsche in
Zur Genealogie der Moral, sei der eigentliche Gegner des asketischen Ideals und der
Moral überhaupt. Aber auch eine „Künstler-Dienstbarkeit im Dienste des asketischen
Ideals“ sei kein seltener Fall, „denn Nichts ist corruptibler, als ein Künstler“. Nietzsche
verspricht an dieser Stelle auf das Problem der Kunst „irgendwann des Längeren“
207 Es sei hier nur noch auf das Zeugnis von Lou Andreas-Salomé hingewiesen, Nietzsche habe
während einer besonders heftigen Verschärfung seiner Krankheit auf einen Zettel geschrieben: „Zu
Bett. Heftiger Anfall. Ich verachte das Leben. F.N.“ (Lou Andreas-Salomé, Friedrich Nietzsche in seinen
Werken: mit 2 Bildern und 3 facsimilirten Briefen Nietzsches, S. 197)
188
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
zurückzukommen (GM III, 25, KSA 5, S. 402 f.) Und doch war es bekanntlich seine
Schrift über die Kunst, mit der er in die Philosophie eingetreten war. Die Perspektive
der Kunst sollte damals, in der Geburt der Tragödie, Licht auf das Problem der Erkenntnis werfen, und zugleich, wie er sechzehn Jahre später schreiben wird, auf das Problem
der Moral. Später wird Nietzsche betonen, er sei, trotz seiner Unzufriedenheit mit
diesem ersten unvollkommenen Werk, „jener Aufgabe selbst nicht fremder“ geworden:
„d i e W i s s e n s c h a f t u n t e r d e r O p t i k d e s K ü n s t l e r s z u s e h n , d i e K u n s t a b e r
u n t e r d e r d e s L e b e n s “ (GT, Versuch einer Selbstkritik, 2, KSA 1, S. 14). Denn nur so
könne man der Frage näher kommen: „Was bedeutet, unter der Optik des L e b e n s
gesehn, – die Moral? …“ (GT, Versuch einer Selbstkritik, 4, KSA 1, S. 17). So müssen
auch wir jetzt Nietzsches Perspektivierung der Moral durch die Kunst betrachten und
das Problem der Kunst darstellen, das Nietzsche sein ganzes Leben beschäftigte.
Die Bedeutung von Nietzsches Kunstphilosophie für seine Kritik an der Moral aus
Vernunft wurde bisher aus strategischen Gründen nicht thematisiert: Die Kunst darf
nicht, wie es in der Nietzsche-Forschung oft geschieht, bloß als Ersatz der Moral bzw.
Nietzsches Denken als eine Art ästhetisierter Philosophie dargestellt werden, die sich
nicht der Argumente, sondern bloß paradoxer Bonmots und Dichter-Phantasien bedient. Wir haben gesehen, dass es Nietzsche nicht bloß um die Destruktion einer
herrschenden Moral ging, nicht bloß um ihre Entwertung, sondern um die Umwertung, um eine neue moralische Plausibilität. Wenn sie auch schließlich als Geschmackssache dargestellt wurde, so erst nachdem ihre Begründung an die Grenze
geführt worden war, an der keine weiteren Gründe angegeben werden konnten. Auch
als Sache des Geschmacks sind die Plausibilitäten einer „letzten Moral“ der Frage
nach ihrem Wert für das Leben nicht entzogen. So ist es auch nicht die Kunst.208 Mehr
noch: Die Kunst und die Moral seien zwar eigentliche Gegner, zeigten aber im Laufe
der Geschichte ihre gegenseitige Abhängigkeit und genealogische Nähe. Erst nach-
208 Die Versuche, Nietzsches Denken als „Ästhetisierung“ der Philosophie und besonders der Ethik
darzustellen, sind zahlreich, wobei das Urteil über das Gelingen des Projekts der ästhetisierten Ethik
unterschiedlich ausfällt. Nietzsches Kunstphilosophie wird u. a. als ein Mittel zur Destruktion der
Metaphysik und so auch der universalistischen Ethik betrachtet. S. z. B. einen Beitrag von Brigitte
Scheer: Das Verhältnis von Ästhetik und Ethik im Denken Nietzsches. Das Problematische des Kunstphänomens (eine „Künstler-C o r r u p t i o n “ (GM III, 25, KSA 5, S. 403)) kommt dabei nicht zur Sprache.
S. die ähnlichen Darstellungen von Ruben Berrios, Nietzsche’s Vitalistic Aestheticism, und Mathieu
Kessler, Nietzsche ou le dépassement esthétique de la métaphysique, 1999; s. auch kritisch dagegen
Claus Zittel, Ästhetisch fundierte Ethiken und Nietzsches Philosophie. Zittel weist polemisch gegen
Foucault (Der Gebrauch der Lüste), Rorty (Contingency, Irony, and Solidarity) und Fürchtl (Ästhetische
Erfahrung und moralisches Urteil) auf die Schwierigkeiten hin, die aus der Gleichsetzung des Kunstund des Lebenswerks entstehen, wobei Zittels eigene These, Nietzsche vertrete eine „antiethische[ ]
Ästhetik“ (S. 105) in dieselbe Richtung geht. Der Tendenz, Nietzsches Philosophie bloß als ästhetisierte
Ethik anzusehen (und so alle ihr innewohnenden Probleme mit bloßer Berufung auf die Freiheit der
Kunst zu lösen), soll durch die hier vorgelegte Interpretation von Nietzsches Kunstphilosophie entschieden Widerstand geleistet werden.
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
189
dem sie zu diesem Schluss gelangt ist, erreicht Nietzsches Philosophie der Kunst ihre
Vollendung.209 Und dies geschieht viel später als zu der Zeit, in der er jenes Werk
schreibt, das ausschließlich der Kunstphilosophie gewidmet ist und wo die viel
späteren Einsichten erst angedeutet sind. Trotzdem oder gerade deswegen kann ein
Blick in dieses Werk das Problem der moralischen Plausibilitäten von Nietzsches
„letzter Moral“ neu beleuchten.
In seinem Erstlingswerk glaubte Nietzsche auf seine Frage nach dem Wert der
Kunst eine eindeutige Antwort bekommen zu haben, indem er die gewöhnliche Rangordnung bloß umkehrte: Die Kunst sei eigentliche und ursprüngliche metaphysische
Tätigkeit, die dem Leben seinen Wert gegeben hatte, der letztere sei später durch die
Moral und die Wissenschaft korrumpiert worden. Die Griechen hatten die Kunst nötig,
um das Leben zu rechtfertigen, denn sie empfanden die Not des Lebens, die Abgründe
des Daseins zu schwer und die Sinnlosigkeit der Existenz zu entsetzlich, um ohne
Trost leben zu können. So erscheine die Kunst nicht etwa erst als Vergnügen und
Vertreiben der Langeweile, sondern als erstes Bedürfnis der von den bedrohlichen
Mächten herausgeforderten Menschheit. Die Griechen haben einen Kunstgriff, einen
genialen Trick, ein Arzneimittel für das „kranke Tier“, welches der Mensch ist,
erfunden: die Welt der schönen Illusion, das bewusste Wegschauen, die tragische
Bejahung des Entsetzlichen. Dies soll eigentliches Ziel jeder künstlerischen Tätigkeit
sein: das Leben zu rechtfertigen und zu trösten.210 Die Kunst, die dies nicht tut, ist
eine Fälschung, eine schlechte und sich selbst missverstehende Nachahmung. Und
die Kultur, die sich nur mit einer solchen Kunst abfinden muss, ist zum Untergang
verurteilt.
In dem schon zitierten „Versuch einer Selbstkritik“ wird Nietzsche das Pathos
seiner „Artisten-Metaphysik“ ironisieren, jedoch das Buch nicht ganz verwerfen,
sondern es für „Jugendmuth und Jugend-Schwermuth“, für Trotz und Selbständigkeit,
209 D. h.: erst wenn sie keine gegen andere Fragen und „andere Lebensnöte abgrenzende Philosophie
der Kunst“ mehr ist (Werner Stegmaier, Nietzsches Philosophie der Kunst und seine Kunst der Philosophie. Zur aktuellen Forschung und Forschungsmethodik, S. 355). Dennoch bedeutet dies nicht, dass
die Kunst als solche für Nietzsche nur noch Anlass war, über etwas anderes (die Moral oder die
Metaphysik) zu sprechen. Sein ganzes Leben lang blieb er gegen das Phänomen der Kunst besonders
empfindlich. Nicht nur die Musik, sondern auch die schöne Literatur, die bildende Kunst, das Theater
hatten immer wieder neu starken Einfluss auf sein Leben und Denken.
210 Nietzsches frühe These zur Rechtfertigung der Welt als ästhetisches Phänomen wurde in der
Forschungsliteratur mehrmals analysiert. S. z. B. den schon zitierten Aufsatz von Gerhardt (ArtistenMetaphysik. Zu Nietzsches frühem Programm einer ästhetischen Rechtfertigung der Welt). Allerdings
kann ich Gerhardts Interpretation nur teilweise zustimmen, wenn er sagt, man müsse schon in
Bedrängnis sein, um die künstlerische Verklärung nötig zu haben (vgl. S. 95). Nietzsches These zur
Rechtfertigung des Daseins impliziert m. E. darüber hinaus das Aufheben der Grenze zwischen Kunst
und Leben: Die Kunst erscheine bei den Griechen als Leben und das Leben selbst als Kunst. Ich
versuche im Folgenden, die Aufmerksamkeit gerade auf diese Grenze zu richten und ihrer Bedeutung
für Nietzsches Projekt der Zukunftsphilosophie nachzugehen.
190
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
als „ein Buch vielleicht für Künstler mit dem Nebenhange analytischer und retrospektiver Fähigkeiten“ loben (GT, Versuch einer Selbstkritik, 2, KSA 1, S. 13). Auch in
diesem Fall bedeutet „Kritik“ nicht eine Ablehnung, sondern eine Zurückweisung in
die Grenzen des Anwendbaren. Als Buch für Künstler ist es immer noch lobenswert,
denn vielleicht sollte der Künstler seine Kunstwerke und seinen Schöpfertrieb so
ansehen, aber nicht als philosophisches Buch, nicht als Werk eines Philosophen.
Denn dafür ist es immer noch zu parteiisch, zu selbstsüchtig, zu blind gegen eigene
Gründe, gegen eigene Wünsche, gegen die eigene Metaphysik.
Und dennoch: In diesem ersten philosophischen Werk ist Nietzsche nach seinen
späteren Einschätzungen etwas gelungen, nämlich eine Umstellung der Fragestellung
in der Kunstphilosophie, eine Umstellung von dem Standpunkt eines Zuschauers auf
den eines Künstlers.211 Seine Frage klang gleichzeitig irritierend-naiv und anspruchsvoll: Was bewegt den Künstler zu seinem Kunstwerk? Was für einen Zweck verfolgt er,
was für eine Not treibt ihn, wenn er Kunstwerke schafft? Oder, wie Nietzsche es später
formulierte:
Geht dessen [des Künstlers – E.P.] unterster Instinkt auf die Kunst oder nicht vielmehr auf
den Sinn der Kunst, das L e b e n ? auf eine W ü n s c h b a r k e i t v o n L e b e n ? (GD Streifzüge, 24,
KSA 6, S. 127)
Der Künstler scheint gerade derjenige zu sein, der diesem „deus“ der Wünschbarkeit dienen will, der ihm bzw. den „Wünsche[n] seines Herzens“ am meisten vertraut.
Ist er damit vielleicht „der grosse Verleumder des Lebens“ im Dienste der Moral
oder aber sein „unfreiwilliger Vergöttlicher“ (GM III, KSA 5, S. 403)? Das „Buch […]
für Künstler“ stellte die Frage nach dem Wert der Kunst, wie sie noch nie gestellt
wurde.
Die neue Fragestellung erforderte schon in der Geburt der Tragödie eine Perspektivierung, die später die genealogische Methode hervorbringen wird. Doch stand die
genealogische Methode dem jungen Nietzsche noch nicht zur Verfügung. Eine radikale Umkehrung der Betrachtungsweise war nur zu erreichen, indem ein historischer
Zeitpunkt gefunden würde, an dem die Kunst sich der mächtigen Forderung der Moral
noch nicht gebeugt hatte, an dem nicht die Wissenschaft, sondern die Kunst eine
herrschende Perspektive des Lebens gewesen war. Als Folge haben wir in der Geburt
der Tragödie mit einer solchen Perspektivierung zu tun, die eine historische Fundierung anstrebt und an diesem Anspruch scheitert. Jedoch war dieser Versuch auch
misslungen wertvoll, denn auch er diente der Aufgabe, Plausibilitäten der sokratischkantischen Moral aus Vernunft aufzudecken und zu ihnen Alternativen zu finden.
Dieses Misslingen in Nietzsches Erstlingswerk, das trotzdem oder gerade deswegen
211 Im Unterschied zu Kant, der, „gleich allen Philosophen, statt von den Erfahrungen des Künstlers
(des Schaffenden) aus das ästhetische Problem zu visiren, allein vom ‚Zuschauer‘ aus über die Kunst
und das Schöne nachgedacht“ habe (GM III, 6, KSA 5, S. 346).
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
191
reiche Folgen für seine Kritik der Moral aus Vernunft hatte und zur gegenseitigen
Perspektivierung der Moral und der Kunst führte, werde ich jetzt kurz darstellen.212
Ganz am Anfang der Geburt der Tragödie wird die bekannte These aufgestellt,
dass die „Fortentwickelung der Kunst“ „an die Duplicität des Apollinischen und des
Dionysischen gebunden ist“ – an ihren „fortwährenden Kampf und [an die] nur
periodisch eintretende Versöhnung“ (GT 1, KSA 1, S. 25). Der Gedanke ist der folgende:
Die Abgründe des Daseins, die Einsicht in das Entsetzliche musste durch die schöne
Welt der Olympier, durch die Bildlichkeit der Illusion überwältigt und dem Blick
entzogen werden. Die dionysische Weisheit konnte nur ertragen werden, insofern sie
von dem apollinischen Kunsttrieb verklärt werden konnte. Aber auch umgekehrt: Die
apollinische Illusion konnte nur solange bezaubern, als sie die Welt der Titanen
bewältigen und mit ihr zu kämpfen wusste. Ohne Dionysos wäre die Kunst leer, ohne
Apollo wäre sie keine Kunst. Erst durch die Versöhnung der beiden Götter hat die
Kunst ihre höchste Blüte erreicht. Die attische Tragödie als schönste Frucht ihres
„Bruderbund[es]“ ist aus dem tiefsten Leiden geboren, aber aus dem Leiden, das
verklärt worden ist, das zum Glück geworden ist. Nicht durch ihren Streit, sondern
erst durch die Kraft der Ratio kommt die Verderbnis in die Kunst – durch Sokrates, der
bei Nietzsche als Doppelgänger von Euripides, des eigentlichen Mörders der Tragödie,
auftritt.
Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass im zu derselben Zeit „für sich“ geschriebenen (und vielleicht deswegen weniger pathetischen) Werk Über Wahrheit und
Lüge im außermoralischen Sinne ein analoges Schema in Bezug auf die Sprache
entfaltet wird. Durch die Umgestaltung von Nervenreizen in Metaphern retten die
Kräfte der apollinischen Individuation das „Bewusstseinszimmer“ vor dem dionysischen Abgrund des Daseins. Die dionysisch-apollinische Bildlichkeit der Sprache
wird aber ihrerseits bedroht, wenn der Prozess der Begriffsbildung beginnt. Der
Begriffsraster zerschneidet „den Himmel durch starre mathematische Linien“ und
überlagert jene spontanen Metaphern und die Individualität der Sprachbilder. Damit
kündigt sich dieselbe Ankunft des „theoretischen Menschen“ an, die die Geburt der
Tragödie beklagt.213 Er erringt einen verhängnisvollen Sieg über den „intuitiven
212 Zu Nietzsches Deutung der griechischen Tragödie sowie zu seiner früheren Kunstphilosophie gibt
es umfangreiche Literatur. S. Enrico Müller, Die Griechen im Denken Nietzsches), bes. S. 42 ff.; KlausDetlef Bruse, Die griechische Tragödie als „Gesamtkunstwerk“ – Anmerkungen zu den musikästhetischen
Reflexionen des frühen Nietzsche. Zum Thema Kunst bei Nietzsche s. Theo Meyer, Nietzsche und die
Kunst; auch z. B. Salim Kemal, Ivan Gaskell, Daniel W. Conway (Hg.), Nietzsche, Philosophy and the
Arts. Hier kann keine Stellung zu allen entsprechenden Fragen genommen werden, sondern es werden
nur die Aspekte thematisiert, die unmittelbare Bedeutung für Nietzsches Umgang mit den Plausibilitäten der abendländischen Moral aus Vernunft haben und seine Strategie im Umgang mit den eigenen
Plausibilitäten aufzeigen können.
213 Ich kann daher Ernst Behler nicht zustimmen, der „eine scharfe Trennung zwischen dem Nietzsche der Geburt der Tragödie und dem Autor von ‚Wahrheit und Lüge‘“ sieht (Ernst Behler, Die Sprachtheorie des frühen Nietzsche, S. 108). Der Prozess der Metaphern- und Begriffsbildung in Über Wahrheit
192
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Menschen“ (WL 2, KSA 1, S. 889). Der sokratische Dialog in der Geburt der Tragödie
korrespondiert so mit dem zum Begriff gewordenen Wort in Über Wahrheit und Lüge
als einzigartige hybride Kunstform Platons, als rationale Kunst par excellence.214 Die
nachfolgende Geschichte der europäischen Kunst wird dementsprechend in beiden
Werken als eine Geschichte des Niedergangs, der Entfremdung von ihren dionysischapollinischen Urquellen gedeutet. In der Geburt der Tragödie redet Nietzsche von
seiner Hoffnung auf eine Wiedergeburt der Tragödie, eine künftige Rückkehr des
„intuitiven Menschen“ und der dionysisch-apollinischen Kräfte der Kunst.
Diese Hoffnungen und dieses Pathos empfand Nietzsche später als größte Last
seines „unmögliche[n] Buch[es]“ (GT, Versuch einer Selbstkritik, 3, KSA 1, S. 14),
neben der zweiten – „Schopenhauerischen und Kantischen Formeln“, mit denen er
„mühselig“ „fremde und neue Werthschätzungen auszudrücken suchte“, welche
„ihrem Geschmacke“ „von Grund aus entgegen giengen“ (GT, Versuch einer Selbstkritik, 6, KSA 1, S. 19). Was für Formeln sind hier gemeint? Die Antwort auf diese Frage
liegt auf der Hand. Die ganze Argumentation des Werks gründet auf der Unterscheidung von Wesen und Erscheinung, der Unterscheidung, die Nietzsche später als
„faule[n] Fleck des Kantischen Kriticismus“ bezeichnete (Nachlass, Sommer 1886–
Herbst 1887, 5[4], KSA 12, S. 185) und die bei Schopenhauer mit dem Begriff des
Willens in Verbindung gesetzt wurde, wie es bei Kant nicht gemeint war: der Wille sei
das Wesen, das wahre „Ding an sich“ und die Musik sei „unmittelbar Abbild des
Willens selbst“, also stehe sie zur Welt der Erscheinungen wie das Metaphysische zum
Physischen, sie komme „aus der unmittelbaren Erkenntniss des Wesens der Welt“.215
Die Musik sei die Sprache des Willens und gleichzeitig dessen Entladung, dessen
Objektivierung und dessen Still-Werden.
Mit dieser Deutung der Musik als eines Ausdrucks des Willens, der kein Abbild
der Erscheinungen ist, sondern umgekehrt – „einzelne Bilder des Menschenlebens“
„stehen zu ihr nur im Verhältnis eines beliebigen Beispieles zu einem allgemeinen
und Lüge folgt denselben Etappen wie die dionysische und die sokratische Kunst, obzwar auch den
Interpretationen Recht gegeben werden sollte, laut denen Über Wahrheit und Lüge als neuer Schritt zu
einer nicht-metaphysischen Auffassung der Kunst zu betrachten ist (vgl. Kofman, Nietzsche et la
métaphore). Wenn Die Geburt der Tragödie von der Urmetapher der Musik und von der Unzugänglichkeit des Weltwesens ausgeht, so ist die künstlerische Tätigkeit nach Über Wahrheit und Lüge bloße
Metaphernbildung, die den Nervenreizen entspringt. Zu diesem Zweck entwickelt Nietzsche später eine
besondere metaphorische Schreibart (vgl. Bernard Pautrat, Versions du soleil. Figures et système de
Nietzsche). Aber auch in Über Wahrheit und Lüge geht es, laut Kofman und Pautrat, um die Erkrankung
der Sprache und Kultur an der Metaphysik und um ihre Heilung mit Mitteln der Kunst. S. zum Thema
auch: Rudolf Fietz, Am Anfang ist Musik. Zur Musik und Sprachsemiotik des frühen Nietzsche.
214 Zur ausführlichen Analyse dieses „für sich“ geschriebenen Werkes von Nietzsche (s. Nachlass
1884, KSA 11, 26 [372], S. 249) s. Hans Gerald Hödl, Nietzsches frühe Sprachkritik: Lektüren zu Nietzsches
„Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne“ (1873).
215 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1, S. 366 f. Bei Nietzsche: GT 16,
KSA 1, S. 104 f.
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
193
Begriff“ –, mit dieser Umdeutung wird schon bei Schopenhauer der klassischen
Theorie der Kunst als Abbildung und Nachahmung der Natur widersprochen.216 Zumindest die Musik soll diesem Vorwurf entzogen werden. Wenn sie eine Abbildung
ist, so ist sie die unmittelbare Abbildung des Wesens der Welt, das Metaphysische
schlechthin.217
Hier kann man sehen, wie Nietzsche, der Schopenhauer nicht nur nicht widersprechen, sondern ihn sogar bestätigen will, die ihm fremden Wertschätzungen mit
seinen Begriffen zum Ausdruck bringt. Die Musik
e r s c h e i n t a l s W i l l e , das Wort im Schopenhauerischen Sinne genommen, d. h. als Gegensatz
der aesthetischen, rein beschaulichen willenlosen Stimmung. Hier unterscheide man nun so
scharf als möglich den Begriff des Wesens von dem der Erscheinung: denn die Musik kann, ihrem
Wesen nach, unmöglich Wille sein, weil sie als solcher gänzlich aus dem Bereich der Kunst zu
bannen wäre — denn der Wille ist das an sich Unaesthetische —; aber sie erscheint als Wille.
(GT 6, KSA 1, S. 50 f.)
Nietzsche widerspricht Schopenhauer damit nicht, er betont die Unterscheidung, die
er ihm später scharf vorwerfen wird, und dennoch setzt er ganz andere Akzente als
sein Lehrer: Der Wille ist unästhetisch; die Musik erscheint nur als Wille; dadurch
wird sie zur Kunst und zum Gegensatz der rein beschaulichen willenlosen Stimmung.
Dem Willen als „Wesen“ der Welt wird damit eigentlich keine Aufmerksamkeit
geschenkt. Nicht auf den Willen selbst, der durch seine Abbildung zur Ruhe kommt,
zielt der junge Nietzsche, der sich immer noch als Jünger Schopenhauers und Wagners versteht, sondern nur auf die Kunst, die die Welt der Erscheinungen, die Illusion,
den Schein gerade als Schein bejaht und rechtfertigt und das Leiden gutheißt, das mit
der Entstehung und der Zerstörung der Erscheinungswelt untrennbar verbunden ist.
„Die ganze Natur als das ewig Wollende, Begehrende, Sehnende“ wird von dem
„reine[n] ungetrübte[n] Sonnenauge“ (GT 6, KSA 1, S. 51) angesehen und gesegnet.
Nur „zu unserer Lust“ wird „die höchste Willenserscheinung“ – der Mensch, der als
tragischer Held hervortritt – „verneint“ (GT 16, KSA 1, S. 16).218
Damit tritt das Problem der Nachahmung, der Abbildung bei Nietzsche noch viel
weiter zurück als bei Schopenhauer: Nicht nur ist die Kunst kein Abbild der Natur,
216 GT 16, KSA 1, S. 104 f.
217 In der Politeia betrachtet Sokrates die Musik nur als Nachahmung der menschlichen Stimme
(Platon, Der Staat, Bd. 5, S. 106 (Politeia, 399 b – c)).
218 Vgl. Nachlass, Frühjahr 1888, 14[119], KSA 13, S. 298. Der herrschenden Meinung, Nietzsche sei
nicht nur in der Geburt der Tragödie, sondern in Allem, was die Kunstphilosophie betrifft, Schopenhauer völlig verpflichtet geblieben (s. bspw. Julian Young, Nietzsche’s Philosophy of Art), kann ich daher
nicht zustimmen. Zu Nietzsches Distanzierung von Schopenhauer schon in der Geburt der Tragödie,
trotz seines immer noch dominierenden Einflusses, s. Friedhelm Decher, Nietzsches Metaphysik in der
„Geburt der Tragödie“. Noch radikaler zu Nietzsches „Umkehrung Schopenhauerscher Wertungen“ s.
Georges Goedert, Dionysische Bejahung statt ‚Resignation‘, S. 179.
194
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
sondern nur durch die Kunst kann die Natur überhaupt wahrgenommen und genossen werden.
[…] die dionysische Kunst will uns von der ewigen Lust des Daseins überzeugen: nur sollen wir
diese Lust nicht in den Erscheinungen, sondern hinter den Erscheinungen suchen. […] Wir sind
wirklich in kurzen Augenblicken das Urwesen selbst und fühlen dessen unbändige Daseinsgier
und Daseinslust; der Kampf, die Qual, die Vernichtung der Erscheinungen dünkt uns jetzt wie
nothwendig, bei dem Uebermaass von unzähligen, sich in’s Leben drängenden und stossenden
Daseinsformen, bei der überschwänglichen Fruchtbarkeit des Weltwillens […]. (GT 17, KSA 1,
S. 109)
Dies ist das Dionysische – die Weisheit, die zur Urlust am Dasein ruft. Das Dionysische ist damit, und das ist wichtig zu betonen, kein Wesen der Welt im Sinne
Schopenhauers und schon gar nicht das „Ding an sich“ im Sinne Kants. Die scharfe
Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung, auf der Nietzsche so sehr bestand,
gilt hier nicht wirklich.219 Das „Urwesen“, das „hinter den Erscheinungen“ steht, ist
nur eine Vision – eine Vision des dionysischen Menschen. Und die dionysische Kunst
ist die Lust an der Erscheinungswelt und die Bejahung dieser Welt als einzig wahrer
Welt, die mit Leiden und Qualen, aber auch mit Glück verbunden ist und beide stets
überwinden kann, die in ihrer Verschwendung und ihrem Übermaß, als ewig neuer
Anfang gleichgültig gegen Klagen des Menschen, ewig und unzerstörbar bleibt. Das
Dionysische ist kein unerreichbarer Grund der Welt, sondern die Macht des Rausches,
die zur Selbstzerstörung aus Freude ruft, aber auch ein „Hexentrank“ sein kann, eine
„abscheuliche[ ] Mischung von Wollust und Grausamkeit“ (GT 2, KSA 1, S. 32). Es soll
als solches dem Blick entzogen werden, weil sein Sieg ein Verfehlen der den Griechen
allein zugänglichen, durch die Tragödie erreichten Harmonie wäre, ein Verfehlen, an
dem die sogenannten barbarischen Völker zugrunde gingen (GT 3, KSA 1, S. 36).
Es ist wichtig, dieses Moment zu betonen: Das Dionysische wird von Nietzsche
primär als Grund der Kunst, nicht als wahrer Urgrund der Welt betrachtet. Es kann
somit keineswegs mit dem Willen Schopenhauers identifiziert werden. Zwar redet
auch Nietzsche von dem „ewige[n] Phänomen“ des „gierige[n] Wille[ns]“, der „durch
eine über die Dinge gebreitete Illusion seine Geschöpfe im Leben festzuhalten und
zum Weiterleben zu zwingen“ sucht (GT 18, KSA 1, S. 115), doch dieser Wille ist schon
in der Geburt der Tragödie nicht als Wesen der Welt zu verstehen. So wie das
erkennende Subjekt Schopenhauers, das „alles erkennt und von keinem erkannt
wird“,220 kann auch Nietzsches Ur-Eines, mit dem sich der dionysische Mensch verschmolzen fühlt, nur missverstanden werden. Später in Jenseits von Gut und Böse wird
219 Vgl. dazu Friedhelm Decher, Wille zum Leben – Wille zur Macht. Eine Untersuchung zu Schopenhauer und Nietzsche. Trotz aller feinen Differenzierungen von Nietzsches und Schopenhauers Positionen sieht Decher die Unterscheidung von Ding an sich und Erscheinung in der Geburt der Tragödie
noch als völlig schopenhauerisch an, erst später habe Nietzsche sich von ihr distanziert (S. 90 ff.).
220 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1, S. 33.
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
195
von ihm nur noch als „Dem“ geredet, „der gerade dies Schauspiel nöthig hat – und
nöthig macht“ (JGB 56, KSA 5, S. 75). Ihm gibt Nietzsche den Namen eines Gottes –
„Dionysos“, denn, wie er später kommentieren wird, „wer wüsste den rechten Namen
des Antichrist?“ (GT, Versuch einer Selbstkritik, 5, KSA 1, S. 19) Damit sollte schon
klar sein, dass das Dionysische für Nietzsche keine neu gefundene arché sein kann,
kein Prinzip der Welt, sondern nur eine Einstellung, und vielleicht eine Gegen-Einstellung. Wenn es ein Wille ist, so nicht der Wille im metaphysischen Sinn, nicht im Sinn
einer hervorbringenden Substanz oder eines Weltgrundes. Als lebensverneinender
Wille ist er nur Leiden, als lebensbejahender ist er Lust am Leben. Die dionysische
Weisheit ist somit, wie Nietzsche später entdeckt, der Gegensatz zur christlichen
Lehre, „welche n u r moralisch ist und sein will“ und „die Kunst, j e d e Kunst in’s
Reich der L ü g e verweist“ (GT, Versuch einer Selbstkritik, 5, KSA 1, S. 18). Einer
lebensfeindlichen Moral, einer Moral der „Askese, Geistigkeit und Pflicht“ (GT 3,
KSA 1, S. 34 f.), kann nur noch eine andere entgegengesetzt werden, welche sagt:
Trotz Furcht und Mitleid sind wir die glücklich-Lebendigen, nicht als Individuen, sondern als das
e i n e Lebendige, mit dessen Zeugungslust wir verschmolzen sind. (GT 17, KSA 1, S. 109)
Diese Weisheit ist die Weisheit der Kunst, welche Lüge ist und sein will – eine Lüge,
der keine „Wahrheit“ entgegensteht.
Bleiben wir aber noch ein wenig bei dem Begriff der dionysischen Kunst. In
der Geburt der Tragödie tritt das Dionysische, wenn nicht als Urgrund der Welt, so
doch auch nicht als Kunst hervor, sondern als Kunsttrieb und Urgrund der Kunst.
Genau an diesem Punkt entsteht eine Art Zweideutigkeit, die zeigt, wie der junge
Nietzsche versucht, seine neuen und fremden Gedanken in die alten metaphysischen Formeln zu zwängen. Auch als Urgrund der Kunst scheint das Dionysische
für die Kunst unerreichbar zu sein, ja nicht wirklich als solches gewollt. In jeder
Kunst hat das Dionysische immer schon mit dem Apollinischen ein Bündnis
geschlossen und ist von ihm nicht zu trennen. Nicht als Wesen und Erscheinung,
nicht als Wille und Vorstellung, sondern als sich in einem Wettkampf befindende
Kräfte, als zusammenwirkende Triebe verhalten sich das Dionysische und das
Apollinische zueinander. Die dionysische Weisheit, die Weisheit eines Waldgottes,
ist im dionysischen Menschen immer schon überwunden, indem er zum Künstler
wird. Bei der „Artisten-Metaphysik“ handelt es sich dennoch um Kunst, um eine
Kunst für Künstler. Dort, wo das Dionysische als Kunsttrieb der Natur, allein und
„o h n e V e r m i t t e l u n g d e s m e n s ch l i c h e n K ü n s t l e r s “ (GT 2, KSA 1, S. 30)
hervorbricht und der Künstler selbst zum Kunstwerk wird, zeigen sich vielleicht
„die Kunstgewalten der ganzen Natur“ (GT 1, KSA 1, S. 30), aber nicht die Kunst,
die wir kennen.
Die dionysische Kunst ist aber auch immer schon apollinisch. Streng genommen
kann man keine der Kunstgattungen mit dem „rein dionysische[n] Wesen“ identifizieren. Zwar stellt Nietzsche den lyrischen Dichter dem epischen gegenüber (der letztere
196
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
ist Plastiker, Diener Apollos), aber der Lyriker in seiner „dionysisch-musikalischen
Verzauberung sprüht jetzt gleichsam Bilderfunken um sich“, wenn Apollo „ihn mit
dem Lorbeer berührt“ (GT 5, KSA 1, S. 44), folglich ist auch er apollinischer Künstler.
Ähnliches gilt für Volkslieder und die Musik selbst. Das Dionysische bleibt stets
„perpetuum vestigium“ der Melodie, „Untergrund und Voraussetzung des Volksliedes“ (GT 6, KSA 1, S. 48). Deswegen ist die Tragödie auch nicht aus der Musik als
solcher, sondern aus dem „Geiste“ der Musik, dem nicht eigentlich Erfassbaren in ihr,
geboren. Auch der tragische Mythos bringt schließlich eine Weisheit zum Ausdruck,
die nur mit Bildern und Geschichten zu vermitteln ist. Aber das Gleiche gilt für das
Apollinische. Die rein apollinische Kunst ist eine Fälschung. An Euripides richtet
Nietzsche sein Urteil:
Und weil Du Dionysus verlassen, so verliess dich auch Apollo; […] deine Helden haben nur
nachgeahmte maskirte Leidenschaften und sprechen nur nachgeahmte maskirte Reden. (GT 10,
KSA 1, S. 75)
Oder, wie es an einer anderen Stelle heißt: „Und siehe! Apollo konnte nicht ohne
Dionysus leben“ (GT 4, KSA 1, S. 40). Die These von der „Duplicität“ der Kunsttriebe
lässt schließlich ihre Unterscheidung nur im Sinne eines, wie in einem anderen
Zusammenhang gesagt wird, „notwendige[n] Correlativum[s] und Supplement[s]“ (GT
14, KSA 1, S. 96) verstehen. „Das Dionysische […] ist der gemeinsame Geburtsschooss
der Musik und des tragischen Mythus“ (GT 24, KSA 1, S. 152). Aber es ist noch nicht die
Kunst selbst. Erst wenn „Dionysus die Sprache des Apollo“ sprechen gelernt hat,
„Apollo aber schliesslich die Sprache des Dionysus“, dann ist „das höchste Ziel der
Tragödie und der Kunst überhaupt erreicht“ (GT 21, KSA 1, S. 140).
Gewöhnlich denkt man jedoch, Nietzsche wolle in der Geburt der Tragödie zumindest von einem überzeugen: Wenn es auch weder reine dionysische noch reine
apollinische Kunst geben könne, so sei doch wenigstens die Möglichkeit einer rein
dionysisch-apollinischen Kunst nicht zu bezweifeln, ihren Höhepunkt habe sie in den
Tragödien von Aischylos und Sophokles erreicht, und ihre Wiederkehr sei immer noch
möglich. Und „rein“ bedeutet eindeutig: frei vom ästhetischen Sokratismus. Dennoch
kommen dadurch, dass Nietzsche in seinem Erstlingswerk pathetisch von der attischen Tragödie redet, einige Details ans Licht, die das in Frage stellen. Mit seinem
Prinzip „alles muss verständig sein, um schön zu sein“ – eine Parallele zum sokratischen „nur der Wissende ist tugendhaft“ (GT 12, KSA 1, S. 85) –, mit der Einführung
des Charakters und der Vernichtung des Chors hat Euripides den dionysischen Urgrund der Tragödie zerstört, die er „nicht begriff und deshalb nicht achtete“ (GT 11,
KSA 1, S. 81). Die Tragödie starb unter seiner Hand, wie der tragische Mythos unter
dem mächtigen Einfluss einer neuen Gottheit, Sokrates, untergegangen ist. Und
dennoch: War der „frevelnde[ ] Euripides“ der „Mörder“ der Tragödie oder aber nur
einer, der „diesen Sterbenden noch einmal zu seinem Frondienste zu zwingen suchte“
(GT 10, KSA 1, S. 74)? Ist nicht ernstzunehmen, was Nietzsche unmittelbar nach seinen
scharfen Invektiven gegen Euripides sagt?
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
197
Die griechische Tragödie ist anders zu Grunde gegangen als sämmtliche ältere schwesterliche
Kunstgattungen: sie starb durch Selbstmord, in Folge eines unlösbaren Conflictes, also tragisch
[…]. (GT 10, KSA 1, S. 75)
Und tatsächlich: Schon Sophokles macht „den ersten Schritt zur V e r n i c h t u n g des
Chors“, worauf Euripides’ Ankunft „mit erschreckender Schnelligkeit“ folgt (GT 14,
KSA 1, S. 95).
Schon bei Sophokles zeigt sich jene Verlegenheit in betreff des Chors – ein wichtiges Zeichen,
dass schon bei ihm der dionysische Boden der Tragödie zu zerbröckeln beginnt. (GT 14, KSA 1,
S. 91)
Wir sehen
die Kraft dieses undionysischen, gegen den Mythus gerichteten Geistes in Thätigkeit, wenn wir
unsere Blicke auf das Ueberhandnehmen der C h a r a k t e r d a r s t e l l u n g und des psychologischen Raffinements in der Tragödie von Sophokles ab richten. (GT 17, KSA 1, S. 113)
Euripides setzte mit seinen „nur noch grosse[n] einzelne[n] Charakterzüge[n]“ fort,
was vor ihm schon begonnen hatte. Als wahre Kunst nennt Nietzsche letztlich nur
„die aeschyleische Tragödie“, die jene „s o k r a t i s c h e Tendenz“ „bekämpfte und
besiegte“ (GT 12, KSA 1, S. 83). Nur ein einziger Tragödiendichter habe das wahre
Wesen der griechischen Tragödie gezeigt, – was schon merkwürdig genug wäre. Aber
auch in dem, was Aischylos betrifft, sind Zweifel vielleicht angemessen. War er nicht
derjenige, der den zweiten Schauspieler und den Dialog einführte und den Choranteil
gegenüber der früheren Tradition einschränkte? Zeigt sich nicht schon bei ihm eine
gewisse „euripideische“ Tendenz? Und ist der Chor, den wir kennen bzw. den die
griechischen Zuschauer gekannt haben, selbst nicht ein gewisser Verrat an der
dionysischen Urquelle der Kunst? In Nietzsches Beschreibung des Phänomens des
Chors in der griechischen Tragödie kommt die Schwierigkeit, die dramatische Kunst
frei vom euripidischen Element zu denken, deutlich zum Ausdruck. Da diese Frage für
Nietzsches Kunstphilosophie von besonderer Wichtigkeit zu sein scheint, ist etwas
ausführlicher auf sie einzugehen.
Die These von A. W. Schlegel zum Chor als einem „idealischen Zuschauer“ behandelt Nietzsche mit auffallender Ironie.221
Und das sollte die höchste und reinste Art des Zuschauers sein, gleich den Okeaniden den
Prometheus für leiblich vorhanden und real zu halten? Und es wäre das Zeichen des idealischen
Zuschauers, auf die Bühne zu laufen und den Gott von seinen Martern zu befreien? Wir hatten an
ein aesthetisches Publicum geglaubt und den einzelnen Zuschauer für um so befähigter gehalten,
je mehr er im Stande war, das Kunstwerk als Kunst d. h. aesthetisch zu nehmen; und jetzt deutete
221 Vgl. dazu Joshua Billings, Misreading the Chorus: A Critical Quellenforschung into Die Geburt der
Tragödie.
198
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
uns der Schlegel’sche Ausdruck an, dass der vollkommne idealische Zuschauer die Welt der
Scene gar nicht aesthetisch, sondern leibhaft empirisch auf sich wirken lasse. (GT 7, KSA 1, S. 53)
Nachdem er dieses klare Missverständnis des ästhetischen Phänomens abgelehnt hat,
kommt Nietzsche, nur einige Seiten später, auf Schlegels These zurück:
Das Schlegel’sche Wort muss sich hier in einem tieferen Sinne erschliessen. Der Chor ist der
‚idealische Zuschauer‘, insofern er der einzige S c h a u e r ist, der Schauer der Visionswelt der
Scene. (GT 8, KSA 1, S. 59)
Wie ist dieser Selbstwiderspruch zu verstehen?222 Wenn die Tragödie ursprünglich
„nur ‚Chor‘ und nicht ‚Drama‘“ ist, wenn das „Drama“ „im engeren Sinne“ (GT 8,
KSA 1, S. 63) erst später im Prozess der Entfernung von der dionysischen Urquelle der
Kunst entsteht, so ist der „ästhetische Zuschauer“, der die Aufführung nicht „leibhaft
empirisch“ erlebt, nur noch durch den Verfall des Dionysischen möglich – durch die
antidionysische Tendenz, durch „den andrängenden Geist des Undionysischen“
(GT 17, KSA 1, S. 114). Aber „Zuschauer“ versteht Nietzsche an den zwei zitierten
Stellen auf unterschiedliche Weise: Im ersten Fall geht es um einen naiven Zuschauer,
der einen „Gott von Martern […] befreien“ will, im zweiten gibt es überhaupt keinen
Zuschauer im eigentlichen Sinn, „keinen Gegensatz von Publicum und Chor“, sondern „der einzige S c h a u e r “ ist „die schwärmende Schaar der Dionysosdiener“. Die
Welt der Bühne ist eine Vision ihres Gottes, eine Vision Dionysos’, der leiden muss
und dessen Leid als das, was notwendig zum Leben gehört, bejaht und bejubelt wird
(GT 8, KSA 1, S. 59 f.). Im ersten Fall wäre die Grenze zwischen der Welt der Bühne und
den Zuschauern vom unästhetischen Zuschauer aufgehoben; im letzteren existiert sie
noch nicht: Alles wird hier zu einer Vision des dionysischen Menschen, auch der
Zuschauer selbst. Insofern ist jener ursprüngliche Chor „auf seiner primitiven Stufe“
nur noch „in der Urtragödie“ (GT 8, KSA 1, S. 59 f.) denkbar und nicht in der Tragödie,
die auf der Bühne vor Zuschauern aufgeführt wird.
In dieser Deutung des Chors zeigt sich erneut die oben schon angedeutete
Doppelsinnigkeit der Aufgabe, der sich Nietzsches „Artisten-Metaphysik“ stellte. Die
Schwierigkeit kam durch die Beschreibung des Verfalls des Dionysischen ans Licht:
Das Undionysische, das die Tragödie von innen bedrohte, scheint mit dem ästhetischen Phänomen zusammenzufallen, indem es die Zuschauer von der Bühne abgrenzt. Es ist das eigentlich Dramatische, das dem Dionysischen entgegentritt – die
Darstellung von Charakteren und das Vortäuschen von Gefühlen, die eigentliche
222 Auf diesen scheinbaren Widerspruch hat Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf sarkastisch hingewiesen: „Dass es im grund einerlei sei, ob man im chor den idealisierten zuschauer, oder ‚zwischen
publicum und chor eigentlich keinen unterschied‘ sieht, dämmert hrn. N. sacht auf: und doch, wie herb
wird A.W. Schlegel gescholten […]“ (Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff, Zukunftsphilologie! eine
erwidrung auf Friedrich Nietzsches (ord. professors der classischen philologie zu Basel) „geburt der
tragödie“, S. 46, Anmerk. 34).
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
199
Schauspielerkunst. Wie sollte die Kunst frei vom undionysischen Element sein, wenn
jede Kunst als Kunst immer schon undionysisch ist? Ist das Undionysische notwendig
auch das Antidionysische? Wo liegt die Grenze zwischen „Bruderbund“ und mörderischem Kampf? Das Undionysische ist laut der Geburt der Tragödie Todfeind der Kunst
und gleichzeitig das für die Kunst Unvermeidliche (ein „unlösbare[r] Conflict[ ]“
(GT 11, KSA 1, S. 75)).
Nietzsche spricht wohl hochpathetisch über die „wahre“ Kunst und ihr Verderben
und scheint dazu auch noch in Widersprüche zu geraten. Dennoch deutet sich schon
in der Geburt der Tragödie etwas an, was das Kunstphänomen über das Pathos hinaus
tiefsinnig auszulegen scheint. Es wird als Grenzziehung und als besonderer Umgang
mit dieser Grenze verstanden223 – als eine doppelte Grenze zwischen Bühne und
Schauspielerraum und zwischen dem Schauspieler und der von ihm gespielten Person, eine Grenze, die als solche („das Kunstwerk als Kunst“) erlebt und genossen wird:
Indem der Schauspieler die Gefühle der durch ihn repräsentierten Personen nachahmt, setzt er voraus, dass die Zuschauer sich der Illusion ergeben, er sei diese Person
selbst und habe diese Gefühle, und dennoch wissen, dass es nur eine Illusion ist. Sie
werden deswegen nicht „auf die Bühne […] laufen“ und ihn „von seinen Martern […]
befreien“, aber trotzdem werden sie mit ihm weinen und jubeln, die Aufführung
emotional miterleben und dabei wissen, dass dies alles zum Schauspiel gehört.
Man muss die Geburt der Tragödie, vielleicht mehr als jede andere Schrift Nietzsches, mit besonderer Vorsicht lesen. Denn in ihr werden mehrere Wege eröffnet,
einige aber nicht begangen. Zum Beispiel wird behauptet, dass „das ästhetische
Phänomen“ „im Grunde“ „einfach“ sei:
[M]an habe nur die Fähigkeit, fortwährend ein lebendiges Spiel zu sehen und immerfort von
Geisterschaaren umringt zu leben, so ist man Dichter; man fühle nur den Trieb, sich selbst zu
verwandeln und aus anderen Leibern und Seelen herauszureden, so ist man Dramatiker. (GT 8,
KSA 1, S. 61)
Aber „Verwandeln“ und „Sehen“ sind selbst keinesfalls einfach, sondern gerade als
schwierigste und einmalige Fähigkeiten waren sie nur den Griechen wirklich eigen,
und auch nur für einen Augenblick; schon im nächsten Atemzug gingen sie verloren.224 Deshalb, so klagt die Geburt der Tragödie, „pflegen“ „wir alle schlechte
Künstler zu sein“ (GT 8, KSA 1, S. 60).
223 Nietzsches Begriff des Tragischen kann als „Doppelbewegung“, „als permanente Praxis von
Begrenzung und Entgrenzung“ interpretiert werden (Müller, „Ästhetische Lust“ und „dionysische
Weisheit“, S. 153). Ich versuche hier und im Folgenden diesen für die Kunst spezifischen Prozess der
Grenzziehung und die Grenze selbst näher zu beschreiben und so auch Nietzsches Begriff des Tragischen.
224 Die Einfachheit, von der Nietzsche mehrmals spricht, kann allerdings als Produkt einer „Vereinfachung“ betrachtet werden. S. dazu ausführlich den Artikel „Einfach“ in: van Tongeren u. a. (Hg.),
Nietzsche-Wörterbuch, Bd. 1, S. 724 ff.; vgl. auch den Artikel „Abkürzung“: Nietzsche-Wörterbuch, Bd. 1,
200
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Halten wir fest: Das merkwürdige Phänomen des Ästhetischen lässt sich nur noch
als Prozess einer Grenzziehung beschreiben. Dabei weiß man nicht genau, wann die
Grenze noch als ästhetische Grenze genossen wird und wann das Drama überhaupt
aufhört, „leibhaft empirisch“ zu wirken, und zu bloß „maskirte[n] Leidenschaften“,
bloß „nachgeahmte[n] maskirte[n] Reden“ wird. Beide – der in der „entzückenden
Vision“ (GT 4, KSA 1, S. 38) versinkende Choreut und der euripideische Schauspieler –
sind zwei Pole, die für die Kunst gefährlich, ja vernichtend zu sein scheinen. Die
Tragödie ist selbst auf der Grenze entstanden, wo „die Weihe des inneren Traumes“
auf allen „Actionen“ des Dichters zu liegen scheint, „so dass er niemals ganz Schauspieler ist“ (GT 12, KSA 1, S. 84). Ein Schritt weiter und sie ist verloren. In Nietzsches
Sprache scheint das Apollinische allmählich in das Sokratische überzugehen, indem
das Dionysische überwältigt wird. Es sei kein Zufall, wird in der Geburt der Tragödie
betont, dass das delphische Orakel – das des Apollo – Sokrates zum weisesten,
Euripides zum zweitweisesten ernannt habe. Als Dritter wurde Sophokles genannt,
„der sich gegen Aeschylus rühmen durfte“, „und zwar, weil er w i s s e , was das Recht
sei“ (GT 13, KSA 1, S. 89). Es war ferner Euripides‘ Versuch, „das Drama allein auf das
Apollinische zu gründen“, der zum Sieg des „a e s t h e t i s c h e n S o k r a t i s m u s “ führte
(GT 12, KSA 1, S. 85). Ohne Dionysos wird also auch Apollo zum Sokrates. Der Gegensatz des Dionysischen und Sokratischen ist „der neue Gegensatz“ (GT 12, KSA 1, S. 83),
und doch scheint er aus dem alten Gegensatz, ja aus dem Bruderbund aus Dionysischem und Apollinischem geboren zu sein. Nietzsche erkennt dies an, indem er sagt:
Haben wir also sogar eine schon vor Sokrates wirkende antidionysische Tendenz anzunehmen,
die nur in ihm einen unerhört grossartigen Ausdruck gewinnt: so müssen wir nicht vor der Frage
zurückschrecken, wohin denn eine solche Erscheinung wie die des Sokrates deute: die wir doch
nicht imstande sind, angesichts der platonischen Dialoge, als eine nur auflösende negative
Macht zu begreifen […] so zwingt uns eine tiefsinnige Lebenserfahrung des Sokrates selbst zu der
Frage, ob denn zwischen dem Sokratismus und der Kunst n o t h w e n d i g nur ein antipodisches
Verhältniss bestehe und ob die Geburt eines ‚künstlerischen Sokrates‘ überhaupt etwas in sich
Widerspruchsvolles sei. (GT 14, KSA 1, S. 95 f.)
Vielleicht steht das Dionysische, nicht als Urphänomen der Natur und als deren
Kunsttrieb, sondern als Kunstphänomen betrachtet, nicht notwendig im Gegensatz
zum Sokratischen? Vielleicht ist das Sokratische selbst aus dem Dionysischen geboren
und erst im zweiten Schritt zu seinem Todfeind geworden?225
Diese Fragen bzw. dieser Zweifel am eigenen Pathos ist in der Geburt der Tragödie
nicht deutlich ausgesprochen, sondern nur angedeutet. Sie sind jedoch dafür ver-
S. 14 ff. In unserem Fall wäre sie das Produkt einer Vereinfachung des Kunstphänomens durch die
Griechen.
225 Vgl. die These, dass „der Sokratismus gerade als Verneinung des Tragischen selbst [als] eine
(gesteigerte) Form des Dionysischen“ zu verstehen ist (Peter Köster, Die Renaissance des Tragischen,
S. 207).
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
201
antwortlich, dass die Abgrenzung von aufeinanderfolgenden Etappen – der dionysischen, der dionysisch-apollinischen und der sokratischen – misslingt. Versucht man
die Unterscheidungen auf einen historischen Zeitpunkt oder auf einen konkreten
Namen eines griechischen Tragödiendichters zu beziehen, stellt sich heraus, dass sie
nicht wirklich den beschriebenen Etappen entsprechen. Die Geschichte von Verfall
und Wiederaufleben der Kunst sowie die Invektiven gegen die „Verderbnis“ in ihr
überdeckten so Nietzsches Gedanken vom „ewigen Kampf zwischen d e r t h e o r e t i s c h e n und d e r t r a g i s c h e n W e l t b e t r a c h t u n g “ (GT 17, KSA 1, S. 111), aus deren
Auseinandersetzung die Kunst, die Moral und die Wissenschaft, ja die ganze europäische Kultur erwachsen ist.226
Das Phänomen des ästhetischen Sokratismus, in die Perspektive der ewigen
Spaltung des Kunstphänomens und des daraus entstehenden ewigen Kampfes zweier Tendenzen innerhalb der Kultur gestellt, lässt eindeutige Einschätzungen nicht
mehr zu.227 Aber wenn es auch keinen absoluten Gegensatz des Dionysischen und
des Sokratischen geben kann, wenn sie also nicht in ihrer reinen Form anzutreffen
sind, ist die Gegnerschaft zwischen ihnen mit einem Namen verbunden, und zwar
mit dem Namen desjenigen, der sich „des Sokrates bedient“, „als einer Art Semiotik“
(EH Bücher 3, KSA 6, S. 320), als einer Maske (vgl. JGB 190, KSA 5, S. 111): mit dem
Namen Platons, der die Kunst bekanntlich als Bedrohung seines Staates betrachtete
und sie zur bloßen Nachahmerin und Unterhalterin herabwürdigte – im Gegensatz
zu vernünftigem Wissen und bürgerlichen Tugenden. Auch hier gilt für Nietzsche
das, was er später vom historischen Zarathustra sagen wird: Derjenige, der den
„verhängnissvollsten Irrthum, die Moral“, schuf, soll „auch der Erste sein, der ihn
e r k e n n t “ (EH Schicksal 3, KSA 6, S. 367). Er soll derjenige sein, der der Gefahr, die
Willkürlichkeit eigener Wertschätzungen einzusehen, viel näher ist, als ihm selbst
recht wäre. Es ist kein Zufall, dass Platons Kunstphilosophie sich in diesem Punkt
von allen neueren Kunstphilosophien grundsätzlich unterscheiden lässt, die Kunst
und Moral in grundsätzlicher Eintracht sehen wollen. Platon tut nichts dergleichen. „Plato g e g e n Homer: das ist der ganze, der ächte Antagonismus […]“ (GM III,
25, KSA 5, S. 402 f.).
Tatsächlich wirft Platon der Kunst vor, sie stelle für die Aufgabe, die „viel höher
als es wohl gemeinhin scheint“ stehe, eine Bedrohung dar, nämlich
226 Vgl. in Über Wahrheit und Lüge die Beschreibung der fortwährenden Auseinandersetzung der
begrifflichen Sprache mit der Sprache der Kunst (WL 2, KSA 1, S. 887). Sie scheinen stets aufeinander
angewiesen zu sein.
227 Die immer neuen Interpretationen von Nietzsches Kunstphilosophie, die sie als eine widersprüchliche bzw. auf einem bewussten Selbstwiderspruch aufgebaute Theorie verstehen, stoßen m. E. auf
diese Beweglichkeit des Kunstphänomens, die schon vom jungen Nietzsche tiefgreifend erfasst wurde.
Darum laufen aber alle Widersprüchlichkeitsvorwürfe ins Leere. S. dazu ausführlicher die schon
zitierte Rezension der Neuerscheinungen zum Thema: Stegmaier, Nietzsches Philosophie der Kunst,
bes. S. 363 f.
202
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
darum zu kämpfen, ob man gut werde oder schlecht, so daß man sich weder durch Ehren noch
durch Geld noch durch irgend welche Herrschermacht, noch vollends gar durch die Dichtkunst
verführen lassen darf, die Gerechtigkeit und die übrige Tugend zu vernachlässigen.228
So streicht der platonische Sokrates aus dem homerischen Epos die Zeilen, die seines
Erachtens diesem Ziel im Wege stehen, nicht etwa weil sie unpoetisch seien, sondern
weil sie gerade durch ihre poetische Kraft von den wichtigen Dingen wegführen, ja
Bürger seines Staates verführen können.229 Der Schluss, die Dichter aus dem Staat
auszuweisen, folgt konsequent aus dem Verständnis der Kunst als nutzloser Tätigkeit,
deren Zweck ein bloßes Vergnügen sei. Wenn die Dichtkunst nicht verboten wird
(außer „Gesänge an die Götter und Loblieder auf die Tugendhaften“, die erlaubt
werden können),
dann werden Lust und Schmerz im Staate die Herrscher sein statt des Gesetzes und desjenigen,
was stets gemeinhin für das Beste gehalten ward, die Vernunft nämlich.230
Aber das Argument der Nutzlosigkeit ist nicht das einzige, vielmehr ist es nur noch ein
Nebenargument. Denn der wichtigste Einwand, der Kern der ganzen Argumentation,
gegen die Kunst liegt tiefer: Die Kunst scheint einen Anspruch zu erheben, mit der
Philosophie selbst in Konkurrenz zu stehen und sich ihr gegenüber sogar im Recht zu
befinden.231 Denn, so muss der Künstlerfeind Sokrates (oder vielleicht Platon selbst)
zugestehen, auch den Philosophen kann die Poesie ein wahres Vergnügen sein, weil
auch
wir selbst ihre Reize recht wohl kennen; aber was man für wahr erachtet, das darf man nicht
preisgeben, wenn man nicht zum Sünder werden will.232
Für Nietzsche war dieses Eingeständnis Platons, das eines „typische[n] hellenische[n]
Jüngling[s]“, der sich „mit aller inbrünstigen Hingebung seiner Schwärmerseele“ vor
dem Bild seines Lehrers „niedergeworfen“ hat (GT 13, KSA 1, S. 91), ein kostbares
Zeugnis dafür, dass der Kampf des intuitiven und des theoretischen Menschen auch
bei Platon selbst nicht zu einem Ende gekommen war. Dieser innere Kampf wurde
auch durch die Furcht vor dem mächtigen Einfluss des Mythos und der Tragödie,
228 Platon, Der Staat, S. 409 (Politeia, 608 b).
229 Platon, Der Staat, S. 88 (Politeia, 387 b).
230 Platon, Der Staat, S. 407 (Politeia, 607 a).
231 In der Politeia gibt Sokrates „zum Troste“ der Poesie, die, auf die Forderung der Vernunft hin, des
Staates verwiesen werden musste, zu, dass „zwischen Philosophie und Dichtkunst ein alter Streit
besteht“ (Platon, Der Staat, S. 408 (Politeia, 607 b)). Diesen Streit hat laut Nietzsche auch Aristophanes
gespürt, welchem dafür „die tiefsten Instincte“ zugesprochen werden (GT 13, KSA 1, S. 88).
232 Platon, Der Staat, S. 408 (Politeia, 607 c).
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
203
durch seine Besorgnis nicht nur um die Tugend der Bürger, sondern auch um die
Philosophie sichtbar.
In seinem Angriff auf Homer nennt Platon ihn kaum zufällig (zumindest aus
Nietzsches Sicht) „Anführer“ der Tragödie. Er sei die erste unbestrittene Autorität in
der Kunst, und als tragischer Dichter beanspruche er, wie man hört, sich „mit allen
Künsten, mit allem Menschlichen, was sich auf Tugend und Laster bezieht, wie auch
mit dem Göttlichen“ genau auszukennen.233
Denn notwendig müsse der gute Dichter, wenn er seinen dichterischen Stoff gut behandeln will,
als ein Kundiger dichten, widrigenfalls er gar nicht imstande sei zu dichten.234
Deshalb sollte an seinem Beispiel gezeigt werden, warum die Kunst nicht nur nutzlos,
sondern auch schädlich für die Philosophie ist.
Was stellt sich durch das sokratische Nachfragen heraus? Homer könnte selbst
wohl kaum einen Krieg führen, einen Staat regieren oder einen Menschen erziehen. Er
beschreibt diese Dinge nur, ohne sie wirklich zu kennen, denn er selbst ist weder
Krieger noch Staatsmann noch Erzieher.235 Er ist damit „der Verfertiger eines bloßen
Bildes“,236 der Schöpfer des Scheins. Doch es geht Platon hier nicht bloß um das
berühmte Nachahmungsargument gegen die Kunst. Es entsteht vielmehr die Frage,
ob diejenigen, die den Dichtern größtmögliches Wissen über das Göttliche und das
Menschliche zuschreiben,
ob sie bei Betrachtung ihrer Werke nicht merken, dass diese um drei Stufen vom Seienden
abstehen und leicht herzustellen sind auch für einen, der der Wahrheit nicht kundig ist […].237
Und was zeigt sich dabei? Die Menschen lassen sich betrügen, sie genießen gerade
diesen Betrug der Kunst. Sie wissen genau, Homer oder Aischylos schaffen keine
wahren Helden, kein wahres Sein, sondern lediglich Illusionen, nur scheinbare
Leidenschaften. Aber sie genießen es trotzdem und brechen in Tränen aus, wenn der
Held vor ihren Augen scheinbar untergeht. Die Nachahmung, auf der die dramatische
Kunst fußt, ist damit ein freiwilliger Selbstbetrug. Mehr noch: Sie verführt den Zuschauer zu etwas, was aus dem platonischen Staat ausgeschlossen sein soll, – zu
einer gewissen Verdoppelung der Rolle im Leben. Der gute Bürger sollte dennoch
Schuhmacher, Richter, Kriegsmann, Bauer sein, ohne noch etwas anderes sein zu
wollen.238
233
234
235
236
237
238
Platon, Der Staat, S. 394 (Politeia, 598 e).
Platon, Der Staat, S. 394 (Politeia, 598 e).
Vgl. Platon, Der Staat, S. 395 f. (Politeia, 599 c–600 e).
Platon, Der Staat, S. 397 (Politeia, 601 b).
Platon, Der Staat, S. 394 (Politeia, 598 e–599 a).
Platon, Der Staat, S. 103 f. (Politeia, 397 e).
204
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Es sind also nicht einfach die Nachahmung eines Scheinbildes („drei Stufen vom
Seienden abstehen“) und die Nutzlosigkeit, die die Kunst zum Erzfeind der Philosophie machen, auch nicht, dass sie die Sinne bloß täuscht und Leidenschaften vermehrt, sondern – und dieses Zeugnis Platons war für Nietzsche besonders wertvoll –
es ist der Genuss am Schein, den sie fördert, das bewusste Sich-einer-Illusion-Ergeben.
Selbst das Sichtbar-Werden der Grenze zwischen der Bühne und den Zuschauern,
dem Schauspieler und der von ihm repräsentierten Person, der Maske und dem
Gesicht ist für die Kunst nicht schädlich, sondern nötig. Denn gerade diese Verdoppelung der Welt wird hier genossen. Die Kunst wird vom Willen zur Täuschung getragen.
Sie ist die Lüge, die sich über alle Wahrheit erhaben fühlt, die aller Wahrheitssuche
und allem Wahrheitspathos entzogen ist, die den Willen zur Wahrheit selbst verneint
und ihn als Mangel an künstlerischem Geschmack verachtet. Deshalb ist sie schädlich
für die Tugend und sollte aus dem Staat verbannt werden.
Dies ist also der eigentliche platonische Einwand gegen die Kunst: Der Künstler
stellt nicht dar, was er selbst ist; nicht einmal das, was er selbst erlebt oder gesehen
hat; er verlangt aber Vertrauen – einen Glauben, der sich bewusst der Lüge ergibt. Nach
Nietzsche ist er eben darum ein wahrer Künstler. So schreibt er, sichtlich auf Platons
Vorwürfe gegen Homer anspielend:
Man soll sich vor der Verwechselung hüten, in welche ein Künstler nur zu leicht selbst geräth […]
wie als ob er selber das w ä r e , was er darstellen, ausdenken, ausdrücken kann. Thatsächlich
steht es so, dass, w e n n er eben das wäre, er [würde] es schlechterdings nicht darstellen, ausdenken, ausdrücken; ein Homer hätte keinen Achill, ein Goethe keinen Faust gedichtet, wenn
Homer ein Achill und wenn Goethe ein Faust gewesen wäre. (GM III, 4, KSA 5, S. 343 f.)
Und wer könnte dies besser wissen als Platon selbst? Er, der als Denker
auf einem Umwege ebendahin gelangt, wo er als Dichter stets heimisch gewesen war und von wo
aus Sophokles und die ganze ältere Kunst feierlich gegen jenen Vorwurf protestirten. (GT 14,
KSA 1, S. 93)
Schließlich verraten ihn seine vornehmen Instinkte, seine schwärmerische Künstlerseele. Indem er die Welt verdoppelte und die Wirklichkeit selbst (als Gegenteil zu den
Ideen) in eine Pseudo-Wirklichkeit umdeutete, wollte er über das Gegebene hinaus.
Mehr noch: Um das neue Verhältnis dieser Realität zu der von ihm erfundenen Welt
plausibel zu machen, bediente er sich wiederum der Kunst in ihrer alten Form – der
des Mythos.239
239 Die Politeia selbst endet mit dem Mythos über die jenseitige Belohnung und Strafe (Platon, Der
Staat, S. 418 ff. (Politeia, 614 b–621 b)). Die Ideenlehre wird in der Politeia in der Form eines Höhlengleichnisses dargestellt (vgl. Platon, Der Staat, S. 269 ff. (Politeia, 514 a–517 d)). Vgl. auch den Dialog
Phaidon, in dem Sokrates, nach dem alle Argumente dargelegt sind, ein mythologisches Bild der
„eigentliche[n] Erde“ entwirft und Homer als Zeugen zitiert (Platon, Phaidon, S. 121 ff. (Phaidon, 110 b–
112 a)). Denn trotz aller Argumente sind seine Gesprächspartner, besonders Simmias, immer noch nicht
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
205
An einer anderen Stelle bei Platon, im Dialog Sophistes, wird erneut nach dem
Verhältnis von Kunst und Philosophie gefragt. Die Philosophie, die die wahre Welt
der Ideen nachahme, sei letztlich auch eine Art Kunst, die sich jedoch grundsätzlich
von einer Nachahmung des Scheinbaren, von der lügnerischen Kunst eines Sophisten, von dessen „Gaukelspiel“ unterscheiden müsse.240 Ohne tief in die platonischen
Argumentationen einzudringen, heben wir zwei wichtige Punkte hervor. Die ganze
Argumentation stammt ausnahmsweise nicht von Sokrates, sondern von einem
Fremdling, der auf eine Frage von Sokrates hin antwortet. Sokrates ist hier selbst nur
Zeuge, nur Zuschauer. Das Gesagte muss dementsprechend nicht unbedingt als seine
Meinung angesehen werden. Jedoch entspricht die Art und Weise der Argumentation
ganz seiner Methode, so dass der Leser des Dialogs sich nur wundern kann, warum
nicht, wie üblich, Sokrates die Hauptfigur spielt, es sei denn, er bediene sich hier wie
Platon selbst einer Maske – eine weitere Stufe der Semiotik.241 Aber noch viel wichtiger ist die von diesem Fremdling angesprochene Schwierigkeit, die die ganze Argumentation zugunsten des Philosophen gegen den Sophisten in die Gefahr eines
Widerspruchs bringt. Denn es wird grundsätzlich angezweifelt, ob die von Platon
erfundene Welt der Ideen tatsächlich zum Sein gehört. Dies würde bedeuten, dass das
Werden aus dem Sein ausgeschlossen bleibt und folglich auch das Denken und die
Philosophie selbst,242 was wiederum zu dem Schluss führen würde, dass der Philosoph als Wissender von dem Sophisten als Verbreiter des falschen Wissens und Nachahmer nicht zu unterscheiden ist.243 Folglich kann man die Welt der Ideen nicht als
Sein dem Empirischen als Schein entgegensetzen, ohne den Unterschied von Philosophie und Sophistik zu unterschlagen.244 Es sei denn, man könnte dies in einer
Form der Darstellung tun, in der beide – das Werden und die Welt der Ideen, dialektisches Denken und Erfindungen eines Künstler-Philosophen – sich miteinander
verflechten und einander dennoch widersprechen dürfen. Denn die neue Wahrheit
völlig überzeugt, obzwar ihnen auch keine Gegenargumente mehr einfallen. Und Sokrates selbst muss
zugestehen, man solle „die ersten Voraussetzungen“ nicht so leicht akzeptieren, „auch wenn [man]
davon überzeugt“ ist, man solle sie stattdessen genauer prüfen. Erst wenn man bis zu dem Punkte
gelangt sei, „der überhaupt für den Menschen erreichbar ist“, kann man sich „dessen ganz sicher“ sein
und „von weiterer Untersuchung ablassen“ (Platon, Phaidon, S. 117 (Phaidon, 107 b)). Doch gleich
danach erzählt Platon einen Mythos.
240 Platon, Sophistes, S. 129 (Sophistes, 268 d).
241 Auf die Distanz zwischen Platon und seinem Protagonisten und ihre tragende Bedeutung für
Nietzsches Kritik am Platonismus weist Müller hin: Die Griechen im Denken Nietzsches, S. 225 ff.
242 Platon, Sophistes, S. 88 ff. (Sophistes, 248 a–249 b).
243 Diese Schlussfolgerung wurde von Jacques Derrida als selbstmörderische Logik des Fremdlings
dargestellt. Der letztere kommt aus Elea und wird Nachfolger des Parmenides genannt, und doch stellt
er gerade seinen Grundsatz in Frage. Insofern sei seine Logik auch vatermörderisch: De la hospitalité:
Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre.
244 Die komplexe Klassifikation der Arten der Nachahmung im Sophistes setzt mehrere Unterscheidungen voraus, z. B. die der menschlichen und göttlichen Kunst, welche wiederum auf die mythologische Begründungsart hinweist (vgl. Platon, Sophistes, S. 122 ff. (Sophistes, 265 b–266 b)).
206
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
braucht die neue Kunst – die Kunst, die die Unterscheidung des Wahren und Scheinbaren zum Ausdruck bringen kann, indem sie die Illusion als solche aufdeckt, sich
ihrer aber bedient. Und Platon, sagt uns Nietzsche, schuf sie, diese neue Kunst, die
die Tragödie ablösen sollte, er schuf eine neue Kunstform, in der die Kunst bloß ein
Mittel, bloß ein Weg zum Wissen zu sein scheint:
Wenn die Tragödie alle früheren Kunstgattungen in sich aufgesaugt hatte, so darf dasselbe
wiederum in einem excentrischen Sinne vom platonischen Dialoge gelten […]. Der platonische
Dialog war gleichsam der Kahn, auf dem sich die schiffbrüchige ältere Poesie sammt allen ihren
Kindern rettete: auf einen engen Raum zusammengedrängt und dem einen Steuermann Sokrates
ängstlich unterthänig fuhren sie jetzt in eine neue Welt hinein, die an dem phantastischen Bilde
dieses Aufzugs sich nie satt sehen konnte.
Jetzt stand die Poesie
in einer ähnlichen Rangordnung zur dialektischen Philosophie […], wie viele Jahrhunderte hindurch dieselbe Philosophie zur Theologie: nämlich als ancilla. Dies war die neue Stellung der
Poesie, in die sie Plato unter dem Drucke des dämonischen Sokrates drängte. (GT 14, KSA 1, S. 93)
Jedoch war der platonische Dialog die Rettung der Poesie und der Philosophie
zugleich. Die Wahrheit der Philosophie, welche sich der Lüge der Kunst entgegensetzte, bediente sich der Kunst als ihrer letzten Begründung.
Beide, Poesie und Philosophie, bedienen sich damit der Kunst der Illusion, der
Kunst des Scheinbaren. Nur verhalten sie sich unterschiedlich zu ihr. Denn indem der
Dichter sich willig der Illusion ergibt, von der er weiß, dass sie eine Illusion ist, will der
Philosoph die von ihm erschaffene Illusion als Weg zur Wahrheit darstellen, der von der
empirischen Welt wegführt und verspricht, was er niemals erreichen kann: die Wahrheit ohne Irrtum zu erkennen, das Wesen der Dinge ohne Illusion zu zeigen, das Sein
vom Schein zu trennen. Aus der Perspektive der Kunst erscheint dieser „dialektische[ ]
Trieb zum Wissen und zum Optimismus der Wissenschaft“ (GT 17, KSA 1, S. 111) als
Verfall und Symptom absinkender Kraft. „Denn jetzt muss der tugendhafte Held
Dialektiker sein, jetzt muss zwischen Tugend und Wissen, Glaube und Moral ein
nothwendiger sichtbarer Verband sein“, und die Kunst muss selbst mit ihrer „poetischen Gerechtigkeit“ diesen neuen Bruderbund segnen und rechtfertigen (GT 14,
KSA 1, S. 94 f.).
Die Plausibilitäten eines „ästhetischen Sokratismus“ wurden in der Geburt der
Tragödie zur Sprache gebracht:
‚Tugend ist Wissen; es wird nur gesündigt aus Unwissenheit; der Tugendhafte ist der Glückliche‘:
in diesen drei Grundformen des Optimismus liegt der Tod der Tragödie. (GT 14, KSA 1, S. 94)
In ihnen ist die neue Stellung der Kunst angelegt. Nur als ancilla der Philosophie oder,
platonisch gesagt, nur noch als Nachahmerin des wahren Wissens, das gleichzeitig
tugendhaft und glücklich macht, ist sie zugelassen. Oder, in Nietzsches Sprache, sie
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
207
muss dieses Wissen, diesen Willen zur Wahrheit selbst rechtfertigen; sie muss Dienerin einer Moral aus Vernunft werden.
Die Moral aus Vernunft wird so mit den Mitteln der Kunst begründet. Sie entsteht
aus der Kunst und schließt mit ihr ein Bündnis, trotz aller Verschiedenheit ihrer
Triebe, d. h. Apollo hat jetzt einen Bund mit Sokrates geschlossen wie früher mit
Dionysos. Dennoch ist es diesmal kein Bruderbund. In ihrem gegenseitigen Kampf
kann es zur Versöhnung kommen, und das ist die Blütezeit der Kunst und der Philosophie. Aber selbst diese Höhepunkte sind durch gegenseitiges Misstrauen gekennzeichnet.245 Denn unter der Optik einer Moral aus Vernunft erscheint die Kunst als
lebensfeindliche und nutzlose Tätigkeit, als Bedrohung. Wie sieht dann die Moral aus
Vernunft unter der Optik eines Künstlers aus? Sie ist eine „tiefsinnige W a h n v o r s t e l l u n g “,
welche zuerst in der Person des Sokrates zur Welt kam, jener unerschütterliche Glaube, dass das
Denken, an dem Leitfaden der Causalität, bis in die tiefsten Abgründe des Seins reiche, und dass
das Denken das Sein nicht nur zu erkennen, sondern sogar zu c o r r i g i r e n im Stande sei. Dieser
erhabene metaphysische Wahn ist als Instinct der Wissenschaft beigegeben und führt sie immer
und immer wieder zu ihren Grenzen, an denen sie in Kunst umschlagen muss: a u f w e l c h e e s
e i g e n t l i c h , b e i d i e s e m M e c h a n i s m u s , a b g e s e h n i s t . (GT 15, KSA 1, S. 99)
Der Glaube an die Vernunft wird somit von einer Wahnvorstellung getragen. Doch ist
es auch ein vornehmer Glaube des theoretischen Menschen, denn als „edle[r] und
begabte[r] Mensch“ muss er an „Grenzpunkte“ kommen, wo der „im Wesen der Logik
verborgene[ ] Optimismus scheitert“ und er „in das Unaufhellbare starrt“ (GT 15,
KSA 1, S. 101). Der „künstlerische Sokrates“ wird so immer wieder zur dionysischen
Weisheit zurückgeführt.
Wenn er hier zu seinem Schrecken sieht, wie die Logik sich an diesen Grenzen um sich selbst
ringelt und endlich sich in den Schwanz beisst — da bricht die neue Form der Erkenntniss durch,
d i e t r a g i s c h e E r k e n n t n i s s , die, um nur ertragen zu werden, als Schutz und Heilmittel die
Kunst braucht. (GT 15, KSA 1, S. 101)
Die sich um sich selbst ringelnde Logik, die sich in den Schwanz beißt, ist eine
Metapher für die tautologische Kreisbewegung der Moral aus Vernunft, die Nietzsche
später bei Kant feststellen wird. Sokrates wird jedoch laut der Geburt der Tragödie
nicht nur von einem optimistischen Glauben getrieben, er wird auch von einer dämonischen, ihn warnenden Stimme verfolgt. Es dünkt ihm, dass er „wie ein Barbarenkönig ein edles Götterbild nicht verstehe und in der Gefahr sei, sich an einer Gottheit zu
versündigen – durch sein Nichtsverstehn“ (GT 14, KSA 1, S. 96).
245 Wenn das delphische Orakel Sokrates als weisesten Menschen anerkennt, so schenkt Sokrates
ihm kaum Vertrauen, er will es selbst überprüfen. Dafür muss er aber sich selbst und seine Weisheit in
Frage stellen.
208
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
[V]ielleicht — so musste er sich fragen — ist das mir Nichtverständliche doch nicht auch sofort
das Unverständige? Vielleicht giebt es ein Reich der Weisheit, aus dem der Logiker verbannt ist?
Vielleicht ist die Kunst sogar ein nothwendiges Correlativum und Supplement der Wissenschaft?
(GT 14, KSA 1, S. 96)
Hier spricht der junge Nietzsche eine Hoffnung aus, von der er sich auch später nicht
völlig verabschieden wird, die Hoffnung auf eine neue „Culturform“, die er mit dem
„Symbol des m u s i k t r e i b e n d e n S o k r a t e s “ kennzeichnet (GT 17, KSA 1, S. 111) –
die Form, die allein eine „Wiedergeburt der Tragödie“ möglich mache und den selbstmörderischen Zirkel der Moral aus Vernunft aufbrechen könne:
Hier nun klopfen wir, bewegten Gemüthes, an die Pforten der Gegenwart und Zukunft: wird jenes
‚Umschlagen‘ zu immer neuen Configurationen des Genius und gerade des m u s i k t r e i b e n d e n
S o k r a t e s führen? (GT 15, KSA 1, S. 102)
Dies wäre ein Symbol für das neue und unerhörte Bündnis von Dionysos und Sokrates,
der tragischen Kunst und der Philosophie.
Ziehen wir Bilanz: Nicht eine bloße Umkehrung zugunsten der Kunst, nicht bloß
die Rückkehr zum Dionysischen, was es auch sein möge (ob Weltgrund, Weisheit
eines Waldgottes oder Urquelle der Kunst), sondern eine neue Konfiguration, ein
neues Bündnis ist es, das die Wiedergeburt der Tragödie verspricht. Für dieses neue
Bündnis wird Nietzsche später eine neue Formel finden: die fröhliche Wissenschaft.
Trotz all seines Pathos gibt aber schon Nietzsches Erstlingswerk zu verstehen: Man
kann nicht zurück zu den Quellen, nicht zurück zur dionysischen Kunst, wie sie bei
Aischylos zum Ausdruck kam und schon bei ihm nicht „rein“ war. Eine solche
Rückkehr ist weder möglich noch erwünscht. Wir sind doch „nicht im Stande“, so
schon der junge Nietzsche, den ästhetischen Sokratismus, „angesichts der platonischen Dialoge, als eine nur auflösende negative Macht zu begreifen“ (GT 14,
KSA 1, S. 95 f.). Die Moral aus Vernunft, welche sich auf die edlen Instinkte Platons
und den sokratischen Optimismus gründete, ist nicht einfach zu tilgen oder durch
Kunst zu ersetzen. Sie soll sich an ihre künstlerischen Quellen erinnern, sie soll sich
von der Kunst und ihrer Lust an der durch sie geschaffenen Illusion speisen lernen.
Die Frage ist somit nicht, ob der theoretische oder der intuitive Mensch siegen wird,
sondern:
Wird das über das Dasein gebreitete Netz der Kunst, sei es auch unter dem Namen der Religion
oder der Wissenschaft, immer fester und zarter geflochten werden oder ist ihm bestimmt, unter
dem ruhelos barbarischen Treiben und Wirbeln, das sich jetzt ‚die Gegenwart‘ nennt, in Fetzen zu
reissen? (GT 15, KSA 1, S. 102)
Nicht das Dionysische, sondern die Kunst mit ihrem Willen zum Schein muss laut der
Geburt der Tragödie gerettet werden, und so auch die Wissenschaft, die Moral und die
Philosophie. Ob die neue Versöhnung erreicht werden kann oder ob der erhabene
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
209
Wahn der Wissenschaft die Kultur zerstören und die Moral aus Vernunft an ihrem
Wahrheitstrieb zugrunde gehen wird, bleibt allerdings ungewiss. Der „musiktreibende Sokrates“ ist nur ein Symbol für diesen Kampf um das Wiederbeleben, um die
Erneuerung der Kultur. Und wie der junge Nietzsche sich eingestehen musste, kann
man hier kein unparteiischer Zuschauer bleiben, denn: „Es ist der Zauber dieser
Kämpfe, dass, wer sie schaut, sie auch kämpfen muss!“ (GT 15, KSA 1, S. 102) Das neue
Bündnis von Kunst und Philosophie, das die Kultur auf die Höhe der tragischen
Erkenntnis führen soll, diese neue Versöhnung war der Traum eines Denkers, der
seinen eigenen Weg in der Philosophie erst begonnen hat.
Künstler und Schauspieler unter der Optik des Lebens
Die Geburt der Tragödie wurde von Nietzsche später nicht nur als ein „Buch für
Künstler“, sondern auch als eine Antwort auf die Frage „Was ist dionysisch?“ gedeutet.
Viel nüchterner als zuvor stellt er bei den Griechen dann eine „Neurose[ ] der G e s u n d h e i t “ fest, welche als „Wille[ ] z u m Tragischen“ „im Reichthum [der] Jugend“ vorkommt (GT, Versuch einer Selbstkritik, 4, KSA 1, S. 16). Die Frage, wie das Dionysische
zu verstehen ist bzw. was das Tragische für das Denken bedeuten kann, wird bis zu
Ecce homo allerdings immer wieder in den Vordergrund rücken. Dort bezeichnet sich
Nietzsche schließlich als „den ersten tragischen Philosophen“, dem eine „Umsetzung
des Dionysischen in ein philosophisches Pathos“ gelungen sei (EH Bücher 3, KSA 6,
S. 312), also die oben angedeutete Synthese von Kunst und Philosophie. An dieser
Stelle wird eine rückwärts gewandte Perspektive aufgeworfen: auf die Götzen-Dämmerung, in der Nietzsche sich den „letzte[n] Jünger des Philosophen Dionysos“ nannte
und seine Geburt der Tragödie als seine „erste Umwerthung aller Werthe“ in Erinnerung rief. Was ist dann das Dionysische in der Philosophie? Die Antwort wird klar und
deutlich gegeben: Es ist das „Jasagen zum Leben“ (GD Alten, 5, KSA 6, S. 160).
Doch das Leben selbst hat sich als etwas Problematisches gezeigt, das die Moral
nicht nur zum Feind hat, sondern sie auch als seine unerlässliche Bedingung kennt,
auch wenn sie bloß noch die „letzte Moral“ der Selbstüberwindung eines Kranken
sein soll. Wird die Kritik einer Moral aus Vernunft bei dem weiter nicht definierbaren
Begriff des Lebens abgebrochen, so bleibt sie unvollendet. Die Forderung, das Leben
zu bejahen, ist gerade als Forderung paradox, und die Paradoxie verdoppelt sich,
wenn diese Forderung mit der Begründung bekräftigt wird, man solle eine andauernde Selbstüberwindung anstreben. So stellt sich die Frage erneut: Woran erkennt man
die lebensbejahende Weisheit? Was bedeutet es, tragischer Philosoph zu sein, als
welcher sich schon Sokrates verstanden hatte, der er aber nicht gewesen war?246 Und
246 Bevor er in den Tod geht, vergleicht Sokrates sich selbst mit einem tragischen Helden, den „das
Schicksal ruft“ (Platon, Phaidon, S. 128 (Phaidon, 115 a)). Gerade dieses tragische Bild des sterbenden
210
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
schließlich: Was ist die tragische Erkenntnis?247 Der Begriff des Tragischen, dessen
Wert bei Nietzsche eine Plausibilität zu sein scheint, soll aus der Perspektive seines
Umgangs mit den eigenen Plausibilitäten verstanden werden und diese wiederum neu
beleuchten.
Die Kritik an der Moral aus Vernunft aus der Perspektive der Kunst ist nur
Nietzsches erster Schritt auf dem Weg zur tragischen Erkenntnis gewesen. Der zweite
sollte die Kritik an der Kunst selbst sein, eine Distanzierung von der Künstler-Perspektive. Erst dann konnte auch die genannte Synthese von Kunst und Philosophie
versucht werden. Was die Distanzierung von der „Artisten-Metaphysik“ angeht, so
vollzieht sich diese ziemlich schnell. Schon ab Menschliches, Allzumenschliches wird
die Kunst als vielfältiges Problem betrachtet. Doch erst in der Fröhlichen Wissenschaft
wird das „Problem des Künstlers“ ausführlich expliziert. Der Ausdruck selbst kommt
nur im Nachlass vor (Herbst 1885/1886, 2[78], KSA 12, S. 98), im veröffentlichten Werk
spricht Nietzsche „vom Probleme des Schauspielers“, das ihn „am längsten beunruhigt“:
[I]ch war im Ungewissen darüber (und bin es mitunter jetzt noch), ob man nicht erst von da aus
dem gefährlichen Begriff ‚Künstler‘ […] beikommen wird. (FW 361, KSA 3, S. 608)
Die Einschätzung „gefährlich“ ist jedoch bei Nietzsche nicht unbedingt negativ zu
verstehen. Vielleicht ist das Gefährliche bei einem Künstler gerade das, was ihn für
einen Philosophen, der sich selbst als Gefahr versteht, interessant macht.
Das Problem des Künstlers wird in der Fröhlichen Wissenschaft unter die Optik des
Lebens gestellt, indem Nietzsche eine Klassifikation der „Optik“ an Kunstwerken
vorschlägt:
Sokrates ist es gewesen, vor dem Platon sich, Nietzsche zufolge, niedergeworfen hat. Der Vergleich
findet sich bei Platon nach der Argumentation zur Unsterblichkeit der Seele, mit der bewiesen wird,
dass das Leben eines Philosophen nur eine Vorbereitung auf den Tod ist und es somit für ihn besser ist,
zu sterben als zu leben. Das Leben Sokrates’ sei demnach, so Nietzsches Interpretation, nur eine lange
Krankheit gewesen (GD Sokrates, 12, KSA 6, S. 73). Damit sei er aber kein tragischer Held.
247 Es ist mir bewusst, dass die Beantwortung dieser Frage eines der am meisten bearbeiteten Felder
der Nietzsche-Forschung betrifft (s. z. B. mehrere Beiträge des Sammelbandes: Duhamel, Oger (Hg.),
Die Kunst der Sprache und die Sprache der Kunst). Es fehlt nicht an Vorschlägen, wie das Tragische bzw.
das Dionysische bei Nietzsche zu verstehen ist, wobei man die anregende Kraft der Begriffe Nietzsches
nur bewundern kann. Mir scheinen die Interpretationen unzureichend, die das Tragische bloß als
Nietzsches Feststellen der Ausweglosigkeit des in eine Sackgasse geratenen Denkens des Abendlandes
darstellen bzw. als eine Art therapeutische Umwertung der europäischen Werte. So etwa Maurer,
Nietzsche und das Experimentelle, S. 9. Ähnlich wird bei Kaulbach das Tragische als Scheitern aller
Hoffnungen in Hinsicht auf die theoretische Welterkenntnis, aber auch als kantische Antinomie
gedeutet (Friedrich Kaulbach, Ästhetische und philosophische Erkenntnis beim früheren Nietzsche,
S. 70). Zur jüngsten Untersuchung des Themas s. Nuno Nabais, Nietzsche and the Metaphysics of the
Tragic; Mary Anne Frese Witt (Hg.), Nietzsche and the Rebirth of the Tragic.
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
211
W i e m a n z u e r s t b e i K u n s t w e r k e n z u u n t e r s c h e i d e n h a t . – Alles, was gedacht,
gedichtet, gemalt, componirt, selbst gebaut und gebildet wird, gehört entweder zur monologischen Kunst oder zur Kunst vor Zeugen. […] Ich kenne keinen tieferen Unterschied der gesammten Optik eines Künstlers als diesen: ob er vom Auge des Zeugen aus nach seinem werdenden
Kunstwerke (nach ‚sich‘ —) hinblickt oder aber ‚die Welt vergessen hat‘: wie es das Wesentliche
jeder monologischen Kunst ist, — sie ruht a u f d e m V e r g e s s e n , sie ist die Musik des Vergessens. (FW 367, KSA 3, S. 616)
Die „monologische Kunst“, die „auf dem Vergessen“ „ruht“, wird somit der Schauspieler-Kunst entgegengesetzt. Die letztere spaltet den Künstler gleichsam in zwei: Er
wird zum Zeugen des eigenen Schaffens, der eigenen Künstler-Welt. Aber ist es nicht
überhaupt das Wesen der Kunst, Grenzen zu ziehen – zwischen dem eigenen „Ich“
und dem Dargestellten? Homer ist kein Achill, Goethe kein Faust. Nicht nur die
theatralische Kunst, jede Kunst enthält eine Art Schauspielerei, jede Kunst braucht
einen Zuschauer. Auch wenn der Lyriker anscheinend über sich selbst redet, redet er
nicht über seine Gelüste und sein Leiden, er spielt etwas vor. Denn, wie der junge
Nietzsche selbst deutlich zu verstehen gab: „Den subjektiven Künstler“ kennen wir
„nur als schlechten Künstler“ (GT 5, KSA 1, S. 42 f.). In diesem und nur in diesem Sinn
steht seine Kunst im Gegensatz zum bloßen Vergnügen oder, um die kantische
Sprache zu benutzen, zur „sinnlichen Lust“. Die Lust eines Künstlers ist nach Nietzsche die Lust an einer Vision, an einer Vision von Lust und Leiden, die nicht „wirklich“ sind, die vorgespielt werden. So ist jeder Künstler
dem unheimlichen Bild des Märchens gleich, das die Augen drehn und sich selber anschaun
kann; jetzt ist er zugleich Subject und Object, zugleich Dichter, Schauspieler und Zuschauer.
(GT 5, KSA 1, S. 48)
Daher muss jedes Kunstwerk als solches schon immer Kunst „vor Zeugen“ sein – die
Kunst eines Schauspielers. Die „monologische Kunst“, die „Musik des Vergessens“,
wäre überhaupt keine Kunst.
Haben wir es hier wieder mit der Doppeldeutigkeit der Geburt der Tragödie zu
tun? Ja und nein. Wir haben mit derselben Schwierigkeit zu tun. Und dennoch will
uns Nietzsche zur Zeit der Fröhlichen Wissenschaft nicht, wie einst, von der Möglichkeit einer „reinen“ unverdorbenen Kunst überzeugen, sei sie nun rein dionysische
oder rein monologische genannt. Auch damals hat er eine solche Quelle nur zweideutig beschrieben und nur durch das Künstler-Pathos bestätigen können. Da er
den Künstler jetzt selbst als Problem sieht, will er die Kunst nicht mehr von ihrer
„Verderbnis“ befreien und zu ihrer reinen Urquelle zurückführen. Ihm geht es
schließlich um die Zukunft der Philosophie und nur deshalb um ihr Verhältnis zur
Kunst.
Für die Philosophie hat die „Musik des Vergessens“, oder, wie in einem weiteren
Aphorismus der Fröhlichen Wissenschaft gesagt wird, die „Musik des Lebens“, die
Bedeutung einer unerreichbaren Quelle – unerreichbar für das in Begriffen gefangene
Denken.
212
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
[…] ein ächter Philosoph hörte das Leben nicht mehr, insofern Leben Musik ist, er l e u g n e t e die
Musik des Lebens, — es ist ein alter Philosophen-Aberglaube, dass alle Musik Sirenen-Musik ist.
(FW 372, KSA 3, S. 623 f.)
Aber wenn Platon sie noch vergessen wollte und Sokrates sie leugnete, so deshalb,
weil sie ihnen als furchterregende Macht vorkam, als Sirenen-Musik, die verführt und
vom Heimweg wegführt.248 Der Schifffahrer Kants, so Nietzsches Gedanke, hatte
dagegen schon keine Angst mehr vor ihr, er hörte sie nämlich nicht mehr. Wenn die
platonische Furcht vor der Sirenen-Musik auch nur Aberglaube war, so ist es ein
Glaube mit schlechtem Gewissen gewesen, der die Instinkte dazu überreden wollte,
der Vernunft mit guten Gründen zu folgen. Er musste die „Musik des Lebens“ leugnen, denn er fürchtete sich vor ihr, wie er auch die Kunst leugnen musste, obwohl er
selber Künstler war. Der Aberglaube Kants, dass nämlich das Begrifflich-Allgemeine
immer Maßstab für das Einzelne und für den Einzelnen sein soll, dass folglich das
Wissen und der Irrtum, das Gute und das Böse radikal unterschieden werden sollen,
ist dagegen eine Lüge guten Gewissens, eine unschuldige Lüge für „eine Wendung
zum B e s s e r e n “ (AC 10, KSA 6, S. 176), die Lüge eines „chinesischen Krämers“, der
seinem eigenen Versprechen wahrhaftig glaubt. Er hat nichts zu vergessen, denn er ist
gegen die „Musik“ aus der Tiefe des Lebens taub geworden. Sein metaphysischer
Schlaf wird durch keine beunruhigenden Töne gestört.
Nietzsche sieht also das Problem der abendländischen Philosophie gerade darin,
dass die Grenze zwischen der „Musik des Lebens“ und dem Begrifflich-Allgemeinen,
der Herden-Perspektive, in uns nicht mehr zu spüren ist. Unser Glaube ist unerschütterlich geworden, der Glaube eines theoretischen Menschen, der „kein zuckendes und
bewegliches Menschengesicht“ trägt, „sondern gleichsam eine Maske mit würdigem
Gleichmaase der Züge“ (WL 2, KSA 1, S. 890). Nun glaubt er an eigene Schauspielerei,
er wird „w i r k l i c h S c h a u s p i e l e r“ (FW 356, KSA 3, S. 596). Doch nur durch Vergesslichkeit, dadurch, dass der Mensch sich „als k ü n s t l e r i s c h s c h a f f e n d e s Subjekt
vergisst“, konnte überhaupt so etwas wie sein „Selbstbewusstsein“ entstehen (WL 1,
KSA 1, S. 883). Als „vielfaches, verlogenes, künstliches und undurchsichtiges Thier“
hat er „das gute Gewissen“ und „die ganze Moral“ erfunden, „um seine Seele einmal
als e i n f a c h zu geniessen“ (JGB 291, KSA 5, S. 235). Mit dieser „beherzte[n] lange[n]
Fälschung“, mit dieser Abkürzung und Oberflächlichkeit der Gefühle und Wertschätzungen hat er sich „ein[en] Genuss im Anblick der Seele möglich“ gemacht. Und
[u]nter diesem Gesichtspunkte gehört vielleicht viel Mehr in den Begriff ‚Kunst‘ hinein, als man
gemeinhin glaubt. (JGB 291, KSA 5, S. 235)
248 In der Interpretation dieses Aphorismus folge ich der von Werner Stegmaier: „Philosophischer
Idealismus“ und die „Musik des Lebens“. Zu Nietzsches Umgang mit Paradoxien. Eine kontextuelle
Interpretation des Aphorismus Nr. 372 der Fröhlichen Wissenschaft.
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
213
Nicht nur in der Kunst, so Nietzsches Gedanke, auch in der Wissenschaft, Moral und
Religion herrscht der Wille zur Täuschung, zur Schauspielerei, zur Oberfläche, zum
optimistischen Erkenntnis-Glauben. Dem „theoretischen Menschen“, der die „Musik
des Lebens“ nicht mehr hört, ist allein eine „Z e i c h e n s p r a c h e d e r A f f e k t e“, die
Moral (JGB 187, KSA 5, S. 107), zugänglich.249 Die „Musik des Vergessens“ zu hören,
heißt dagegen, die Grenze zwischen dem unerreichbar Individuellen, Vielfältigen,
Unvernünftigen, Verschwenderischen und Widersinnigen des Lebens einerseits und
seinem Denken, seiner Sinngebung, seiner Zeichensprache andererseits wieder als
solche zu erleben – als Grenze, die der Philosoph zwar niemals überschreiten könnte,
jedoch immer neu ziehen muss. Jede Philosophie ist „Kunst“ in diesem neuen, weiteren Sinn des Wortes – eine Kunst, die an ihre Quellen erinnert werden soll.
Doch gerade in der Kunst, in der „die L ü g e sich heiligt“, hat „der W i l l e z u r
T ä u s c h u n g das gute Gewissen zur Seite“ (GM III, 25, KSA 5, S. 402). Man erkennt
hier das platonische Argument gegen die Kunst wieder: Die Kunst lehre das Lügen mit
gutem Gewissen. Der Künstler brauche einen bewussten Selbstbetrug. Nietzsche
stimmt Platon in diesem Punkt zu und wertet dieses alte Argument gleichzeitig um.
Der Künstler-Glaube ist der Glaube an eigene Dichtung, d. h. der Glaube mit dem
klaren Bewusstsein, dass der Gegenstand dieses Glaubens sein eigenes Werk ist. Der
Künstler ist somit immer gleichzeitig ein Schauspieler, weil er eine Distanz zu der von
ihm erschaffenen Illusion halten und die Grenze zwischen „Wahrheit“ des Lebens
und der „Lüge“ der Kunst immer wieder überschreiten muss. Dies ist das Bewusst-inder-Illusion-Bleiben eines Dichters, seine Liebe zum Schein, seine
Falschheit mit gutem Gewissen; die Lust an der Verstellung als Macht herausbrechend […]; das
innere Verlangen in eine Rolle und Maske, in einen S c h e i n hinein (FW 361, KSA 3, S. 608).
Damit steckt er seine ästhetisch begabten Zuschauer an – ein Effekt, über den sich
schon Platon empörte, und der bis heute eine starke Wirkung aufzeigt.250 Doch gerade
deswegen wird der Künstler für einen Philosophen bedeutsam: Er glaubt an seine
Geschichte, nicht weil er sie für wahr hält, sondern umgekehrt: Er hält sie für wahr,
weil er an sie glaubt, weil er, so wie sein ästhetischer Zuschauer, „vergessen“ kann,
249 Nicht nur die Moral, auch die Musik, wird im Nachlass als eine solche „Zeichensprache der
Affekte“ bezeichnet, welche genauso „das Trieb-System eines Musikers“ verrät wie die Philosophie die
Triebe eines Philosophen (Nachlass, Frühjahr–Sommer 1883, 7[62], KSA 10, S. 262). Vgl. die Bezeichnung der Musik als „Sprache der Affecte“ bei Kant (KU, AA 5, S. 328), der sie deshalb auf den untersten
Platz der Kunstarten verwiesen hat (KU, AA 5, S. 329): Als „Sprache der Affecte“ war sie fast das
Gegenteil zur Moralität.
250 Die zeitgenössischen Verhältnisse zwischen dem „Artisten-Glauben“, dem „R o l l e n - G l a u b e n“
eines Schauspielers und dem guten bzw. schlechten Gewissen eines Künstlers stellt Nietzsche auf
besonders komplexe Weise im Aphorismus „I n w i e f e r n e s i n E u r o p a i m m e r ‚ k ü n s t l e r i s c h e r ‘
z u g e h n w i r d“ (FW 356, KSA 3, S. 595 ff.) dar. Ferner wird in der Fröhlichen Wissenschaft festgestellt,
dass „alle grossen modernen Künstler […] am schlechten Gewissen“ leiden müssen (FW 366, KSA 3,
S. 616).
214
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
dass es sich bloß um ein Kunstwerk handelt. Insofern „ruht“ ein solches Werk
tatsächlich „a u f d e m V e r g e s s e n “. Doch als Kunstwerk soll es an dieses Vergessen
stets erinnern. Denn man darf sich der Illusion, soweit es um die Kunst geht, nicht
einfach hingeben, also nicht „auf die Bühne […] laufen und den Gott von seinen
Martern […] befreien“, sondern man soll sie als Illusion genießen. Das Werk eines
Künstlers wird so aus der „Musik des Vergessens“ geboren – und das jedes Mal, wenn
es als solches erlebt und genossen wird.
Gerade diese Fähigkeit, an das eigene Werk gleichzeitig zu glauben und nicht zu
glauben, sollen Philosophen nach Nietzsche „d e n K ü n s t l e r n a b l e r n e n “, doch „im
Uebrigen weiser sein, als sie“:
Denn bei ihnen hört gewöhnlich diese ihre feine Kraft auf, wo die Kunst aufhört und das Leben
beginnt; w i r aber wollen die Dichter unseres Lebens sein, und im Kleinsten und Alltäglichsten
zuerst. (FW 299, KSA 3, S. 538)
Der „P h i l o s o p h a l s h ö h e r e r K ü n s t l e r “251 darf nämlich nicht vergessen, dass
auch das, was er als „Leben“ versteht, eine von ihm selbst erschaffene Illusion ist, die
nur als solche, als Oberfläche, Semiotik, Dichtung und Selbsttäuschung, geglaubt und
genossen werden kann. Die Gefahr ist groß, blind gegen die Grenze zwischen der
„Kunst“ und dem „Leben“ zu werden, taub gegen die Musik aus der Tiefe. Wenn dies
geschieht, wenn man wahrhaftig an die eigene Schauspielerei glaubt, wird aus dem
Philosophen bloß ein Schauspieler im Leben.252
Mit dieser Kunstphilosophie bzw. mit der Perspektivierung des Lebens, in der die
Kunst als Wille zur Illusion und die Kunst im Leben als paradoxes Nicht-Vergessen der
„Musik des Vergessens“ gedeutet wird, wird die Frage beantwortet, die schon früher
von Nietzsche gestellt wurde und damals ohne Antwort geblieben ist: „ob man
bewusst in der Unwahrheit bleiben k ö n n e “ und ob „unsere Philosophie nicht zur
Tragödie“ werden soll (MA I, 34, KSA 2, S. 53 f.). Noch früher hatte er diese Frage für
sich in einer Nachlassnotiz als „das t r a g i s c h e P r o b l e m K a n t s “ bezeichnet, dass
es dem Menschen in seiner „lügenhafte[n] Natur“ „n u r s e h r r e l a t i v m ö g l i c h “ sei,
„ganz wahrhaftig zu sein“. Er fügte damals hinzu: „W a h r h a f t i g k e i t d e r K u n s t :
sie ist allein jetzt ehrlich“ (Nachlass, Sommer 1872–Anfang 1873, 19[104], KSA 7,
S. 453 f.). Die innere Lüge, bei der sich der Mensch gleichsam in zwei Personen ent-
251 Dies war einer von mehreren provisorischen Titeln für Nietzsches Werke, unter Ihnen „D i e n e u e
A u f k l ä r u n g“, „J e n s e i t s v o n G u t u n d B ö s e“ (Nachlass, Sommer-Herbst 1884, 26[297], KSA 11,
S. 228 f.).
252 Das antitheatralische Pathos des späten Nietzsche lässt sich aus dieser Perspektive tiefer und
nicht nur als einfache Ablehnung des Theaters bzw. als seine Auseinandersetzung mit Richard Wagner
verstehen. Vgl. „Man erräth, ich bin wesentlich antitheatralisch geartet, – aber Wagner war umgekehrt
wesentlich Theatermensch und Schauspieler, der begeistertste Mimomane, den es gegeben hat, auch
noch als Musiker!…“ (FW 368, KSA 3, 617). Vgl. auch seine Besorgnis, dass das Theater zum „H e r r [ n ]
ü b e r d i e K ü n s t e“ werde und so den guten Geschmack verderbe (WA 12, KSA 6, S. 39).
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
215
zweit, brachte nicht nur Kant, sondern früher ebenso Platon in Verlegenheit, weil
„sich selbst […] vorsätzlich zu betrügen einen Widerspruch in sich zu enthalten
scheint“ (MS, AA 6, S. 430). Diese Schwierigkeit, die bei Kant zur Grausamkeit des
schlechten Gewissens führte, wird von Nietzsche als das Können eines Künstlers, als
seine einzigartige Kunst verstanden, welche jedoch nur die Philosophie über die Grenze
der Kunst hinaus auf das Leben übertragen kann.
Nietzsches Kritik der Kunst aus der Perspektive des Lebens führt uns so wieder zu
seinem Begriff der Philosophie, die nun als „höhere“ Kunst des Lebens verstanden
werden soll. Der Wille zur Illusion ist überhaupt als „Grundwille[ ] des Geistes“ anzusehen, des Geistes, der Herr sein will, der „sich als Herrn fühlen“ will (JGB 230, KSA 5,
S. 167). „Das befehlerische Etwas“ „hat den Willen aus der Vielheit zur Einfachheit“;
„die Kraft des Geistes“ „offenbart sich in einem starken Hange“, „das Mannichfaltige
zu vereinfachen, das gänzlich Widersprechende zu übersehen oder wegzustossen“. Der
Geist genießt seinen „Willen zum Schein, zur Vereinfachung, zur Maske, zum Mantel,
kurz zur Oberfläche“, oder mit einem Wort: seine „Proteuskünste“. Aber ihnen
wirkt jener sublime Hang des Erkennenden e n t g e g e n , der die Dinge tief, vielfach, gründlich nimmt und nehmen w i l l : als eine Art Grausamkeit des intellektuellen Gewissens und
Geschmacks [meine Hervorhebung – E.P.], welche jeder tapfere Denker bei sich anerkennen wird
[…]. (JGB 230, KSA 5, S. 168)
Doch auch das sind vielleicht „schöne glitzernde klirrende festliche Worte: Redlichkeit, Liebe zur Wahrheit, Liebe zur Weisheit, Aufopferung für die Erkenntniss, Heroismus des Wahrhaftigen“ (JGB 230, KSA 5, S. 169). Man kann nämlich das intellektuelle
Gewissen selbst, diesen Wahrheitstrieb des Erkennenden, aus dem Willen zur Täuschung, aus seinen „Proteuskünste[n]“ verstehen. Sie beide, der Wille zur Wahrheit
und der Wille zur Täuschung, stehen nur in einem scheinbaren Widerspruch zueinander: Indem der Geist an seine Wahrhaftigkeit glauben will, will er sich täuschen.
Vertraut er dabei sich selbst, hat er von der Täuschung vergessen, dass sie eine ist.
Und kaum zufällig wird an dieser Stelle nochmals an die griechische Tragödie
erinnert: Denn nur „mit unerschrocknen Oedipus-Augen und verklebten OdysseusOhren“, wenn man blind gegen die Oberfläche der moralischen Deutungen der Welt
und „taub gegen die Lockweisen alter metaphysischer Vogelfänger“ geworden ist,
kann man sich zur Erkenntnis erheben – zur Erkenntnis, welche die eines tragischen
Denkers ist, eines „musiktreibenden Sokrates“, der sich der „Musik des Vergessens“
widmet und dennoch nicht verlernt hat, zu philosophieren; der die unerreichbare Tiefe
des Lebens erfuhr und dennoch nicht aufhört, die Oberfläche zu schaffen, die er seine
„Erkenntnis“ nennt. Er hört allerdings nicht auf, zu fragen, auch wenn er sich schon
„hunderte Male […] ebenso gefragt“ hat: „Warum überhaupt Erkenntnis?“ (JGB 230,
KSA 5, S. 169 f.) Auf diese Frage gibt es keine Antwort, denn derjenige, der sich die
tragische Erkenntnis ersparen will und kann, sollte dies tun, und derjenige, der sich
vor der „Sirenen-Musik“ fürchtet, sollte sich nicht auf eine Reise ins Unendliche
begeben – auf eine Reise, die weder Rückkehr noch Heimat versprechen kann.
216
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
So stellt Nietzsche nicht nur die Kunst, sondern auch seine eigene Philosophie
samt ihren „letzten“ Plausibilitäten unter die Optik des Lebens. Das „Sich-bewusstwerden des Willens zur Wahrheit“, das andauernde Misstrauen gegen sich selbst, ist
strategisch das einzige, was der Erkenntnis übrig bleibt. Aber auch dieser Wahrhaftigkeitstrieb, diese Forderung des intellektuellen Gewissens ist als „Proteuskunst“ des
Geistes zu verstehen, als sein Wille zur Oberfläche, zum Schein, als seine Schauspielerei. Es ist
jenes grosse Schauspiel in hundert Akten, das den nächsten zwei Jahrhunderten Europa’s aufgespart bleibt, das furchtbarste, fragwürdigste und vielleicht auch hoffnungsreichste aller Schauspiele… (GM III, 27, KSA 5, S. 410 f.)
Auch die äußerste Tapferkeit des Geistes sei somit ein Schauspiel, ein Vorspielen
eigener Wahrhaftigkeit. Anders ausgedrückt: Selbst die Frage, warum das Misstrauen
den „Wünsche[n] [des] Herzens“, warum die Erkenntnis einer Selbst-Täuschung vorgezogen werden soll, kann nicht anders beantwortet werden, als dass sie den Wert der
Erkenntnis und den moralischen Wert der Wahrheit schon stillschweigend voraussetzt. Warum sollte die Erkenntnis, das Misstrauen, der Verdacht sonst bestehen? Was
heißt das „Sich-bewusst-werden“, wenn das Bewusstsein selbst bloß eine Oberfläche
und in gewissem Sinn ein Kunstphänomen ist? Warum sollte der Geist nicht endgültig
Schauspieler werden und nicht von der Illusion vergessen, dass sie eine ist? Warum
soll der „Musik des Lebens“ zugehört werden, wenn sie nur paradox, nur „tragisch“
zu hören ist – als unerreichbar und begehrenswert zugleich, als Odyssee des Erkennenden, der keine Heimat kennt? Warum muss die Philosophie das schwierige Aufder-Grenze-Bleiben, das Sich-selbst-stets-Misstrauen, das Gegen-sich-Partei-Nehmen
der Schauspielerei vorziehen? Und selbst dann, wenn die Antwort auf all dies die
Selbstüberwindung sein soll, bleibt zu bedenken, ob, es sei noch einmal gesagt, das
Vertrauen selbst nicht schmerzhafter sein kann und der Glaube eventuell nicht mehr
Mut erfordert als das stetige Misstrauen, als Verzicht auf den Glauben überhaupt.
Denn selbst der Philosophie mit ihrem stetigen Misstrauen und Selbst-Misstrauen
müsste, ihrer eigenen Logik nach, kein bedingungsloser Vorteil zugesprochen werden. Wenn die Sinnlosigkeit des Daseins nicht als ontologische These Nietzsches zu
verstehen ist, sondern als seine persönliche Entscheidung zugunsten des schwierigsten und unerträglichsten Gedankens, ist schließlich auch die folgende Frage berechtigt: Würde es nicht als vornehm gelten, wenn man gerade im Gegensatz zu den
eigenen Plausibilitäten seine Kräfte anstrengt und die Selbstüberwindung versucht?
Denn die Moral, die sich auf andere Plausibilitäten gründet, kann sich, wie wir in
den nächsten Kapiteln sehen werden, ebenfalls des Mutes und der Tapferkeit rühmen, wenn sie gerade das Gegenteil von der „letzten Moral“ Nietzsches fordert – sich
nämlich auf eine Sinngebung einzulassen, die ungewiss ist; einer Hoffnung treu zu
bleiben, welche keine Bestätigung findet; einer Person zu vertrauen, die nichts garantieren kann. Wäre dies nicht eventuell auch als vornehmer Geschmack in der Moral
anzusehen?
2.3 Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens
217
Tatsächlich müssen diese Fragen bei Nietzsche ohne Antwort bleiben, denn für
die „letzten“ Plausibilitäten gibt es kein „Warum“. Dies hat Nietzsche deutlich zu
verstehen gegeben, indem er sie nicht als Frage des Gewissens, sondern als „zuletzt
eine Frage des Geschmacks“ dargelegt hat (JGB 205, KSA 5, S. 132). Doch wollte er
seinen eigenen „guten Geschmack“ der Philosophie, dem Philosophen der Zukunft,
beibringen. Dieser
lebt ‚unphilosophisch‘ und ‚unweise‘, vor Allem u n k l u g , und fühlt die Last und Pflicht zu
hundert Versuchen und Versuchungen des Lebens: — er risquirt s i c h beständig, er spielt d a s
schlimme Spiel… (JGB 205, KSA 5, S. 133)
Nicht das intellektuelle Gewissen gibt hier das Kriterium des Riskantesten und Gefährlichsten. Es ist allein das „ästhetische[ ] Gewissen“ (MA II, VM 133, KSA 2, S. 434), das
die Opfer fordert, der gute Geschmack für das Tragische, d. h. für einen unauflösbaren
Konflikt, für einen hoffnungslosen Kampf.253 Dieser Geschmack für das Tragische ist
nämlich der neue Geschmack, den Nietzsche der Philosophie beibringen will. Er ist
seine letzte „Begründung“ der eigenen Plausibilitäten, des eigenen Ideals des Misstrauens, seine Antwort auf die Frage, warum eine andauernde Selbstüberwindung das
höchste Ziel und gleichzeitig der Maßstab der Philosophie, das Kriterium ihrer Wahrhaftigkeit sein soll.
Von dem Willen zum Tragischen wurde das europäische Denken freilich immer
getragen, daher die Schwere Kants, die einzig als Zeichen der Moralität gelten soll, daher
die Grausamkeit des christlichen Gewissens, daher selbst der Wahrheitstrieb Platons.
Und dennoch behauptet Nietzsche, „d a s T r a g i s c h e e r s t e n t d e c k t “ zu haben. Sogar „bei den Griechen“ und besonders bei den griechischen Philosophen „wurde es,
dank ihrer moralistischen Oberflächlichkeit, mißverstanden“ (Nachlass, Frühjahr 1884,
25[95], KSA 11, S. 33). Die Moral aus Vernunft versprach nämlich, wie das Christentum
selbst, trotz aller Grausamkeit ihrer Forderungen und Überforderungen, eine Erlösung
von dem tragischen Konflikt des Lebens, sie rief zum Vertrauen – zum Glauben daran,
dass zumindest als intelligibler Grund, als „Reich der Wahrheit“, aus dem die Vernunft
ausgeschlossen bleibt, als unerreichbares Jenseits eine Erlösung möglich, sogar notwendig sein soll. Ihre Plausibilität – die Annahme, dass das Allgemeine als objektiver Grund aller subjektiven Triebe des Willens zu denken sei – ließ die Hoffnung auf
eine Erlösung zum Guten als möglichen, wenn auch unbegreiflichen Zweck der
menschlichen Existenz bestehen. Indem diese Moral, dieser „Glaube an die V e r n u n f t
i m L e b e n “ (FW 1, KSA 3, S. 168) unglaubwürdig wurde, führte er zur Verzweiflung,
zur Verneinung des Lebens, zur Selbstzerstörung, zum Nihilismus. Aber eine
253 Vgl. die in der Einleitung angesprochene These Simons, der erste tragische Philosoph zu sein, sei
nach Nietzsche im Sinne des Begreifens des eigenen „Befangensein[s]“ zu verstehen (Simon, Grammatik und Wahrheit, S. 1 f.).
218
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Resignation ist n i c h t eine Lehre der Tragödie! […] Sehnsucht in’s Nichts ist V e r n e i n u n g der
tragischen Weisheit, ihr Gegensatz! (Nachlass, Frühjahr 1884, 25[95], KSA 11, S. 33)
Mit dieser Resignation wurde der Zeitpunkt gekennzeichnet, an dem die Philosophie
selbst zum Unvermögen geworden war – Unvermögen zur Erkenntnis, zum Glauben
und zum Schaffen. Und Nietzsches Schlussfolgerung lautet: nur wenn sie die „Musik
des Vergessens“ wieder hört und den guten Geschmack für die Ungewissheit, die Liebe
zum Schein in sich entdeckt, kann sie auf die Höhe des Tragischen führen. Dafür muss
sie jeden Glauben, jedes Vertrauen und Selbst-Vertrauen preisgeben. Nur so wird sie
zur „Philosophie der Zukunft“: indem sie den Blick in das Tragische über das Kritische,
welches eine Art Selbstvergewisserung war, hinaus richtet; indem sie die Wege findet,
auf denen der Wahrheitshang stets überwunden werden kann, welcher in jeder Art
Glauben, außer in dem eines Künstlers, vorhanden ist; indem sie lernt, wie sie bewusst in
der Illusion bleibt.
Und nicht nur ein Glaube, sei es auch der Glaube an sich selbst und an die eigene
Kraft der Selbstüberwindung, wird dem Philosophen letztendlich als Gebot der tragischen Weisheit zugemutet. Denn diesen Weg der Philosophie, der sie über die Verlockungen der Kritik hinaus und von ihrem Heimweh wegführen soll, können, um die
alte theologische Formel wieder aufzunehmen, nur die „Werke“ eröffnen:254 Wenn
kein „musiktreibende[r] Sokrates“ und keine dionysische Philosophie möglich zu sein
scheint, so deswegen weil es noch kein philosophisches Kunstwerk gab, das diese
tragische Weisheit zum Ausdruck gebracht hätte. Ein solches Werk war noch zu
schaffen: Es sollte „ein dionysische[r] Unhold“ (GT, Versuch einer Selbstkritik, 7,
KSA 1, S. 22) erschaffen werden, der „Begriff ‚dionysisch‘“ sollte „höchste That“
werden (EH Zarathustra 6, KSA 6, S. 343). Und Nietzsche tut dies, indem er einen
Stellvertreter für sich erdichtet, eine Art Semiotik, wie vor ihm der Künstler-Philosoph
Platon, der eine neue Kunstform für seine dialektische Erkenntnis erfand und damit
der alten Kunst den Krieg erklärte. Wer für diese alte Spannung noch Geschmack hat,
für den kann Nietzsches Semiotik nicht unbemerkt bleiben, d. h.: der kann den Reden
Zarathustras als „Lehren“ Nietzsches kein Vertrauen schenken. Wer diesen Kampf
dennoch weiter kämpfen will, kann sie nicht für bloße „Dichtung“ halten. Denn in
jeder Philosophie ist so eine „Dichtung“ vorhanden. Und es ist Zeit, dass auch Philosophen, so wie es Künstler seit jeher tun, sich zu ihren „Werken“ bekennen – zu den
von ihnen erschaffenen Illusionen, welche ihre Plausibilitäten verraten und auch ihre
„letzte Moral“.
254 Vgl. den Aphorismus „Werke und Glaube“ in: M 22, KSA 3, S. 34.
2.4 Zusammenfassung
219
2.4 Zusammenfassung
Dieses Kapitel hat sich mindestens zwei Ziele gesetzt, die jetzt als erfüllt angesehen
werden dürfen. Die Untersuchung der Moralkritik Nietzsches hat zuerst die Plausibilitäten der kantischen Moralphilosophie sichtbar gemacht. Im nächsten Schritt wurde
auf Nietzsches eigene Plausibilitäten hingewiesen und sein Umgang mit den Plausibilitäten seiner „letzten Moral“ dargestellt. Ich fasse hier die für die weitere Untersuchung wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammen.
Nietzsches Kritik an Kant hat sich als Vorbereitung seiner Fragestellung zum Wert
der Moral erwiesen. Die tautologische Zirkelbewegung der Moral aus Vernunft, die
noch von Kant selbst zugestanden wurde, folgte aus der stillschweigend gemachten
Voraussetzung, die Vernunft sei als Vermögen der Prinzipien zu denken, die – wenn
die konkreten Urteile und Handlungen von allem Pathologisch-Empirischen gereinigt
werden könnten – als für jedermann gültiges Fürwahrhalten bzw. als vollkommen
moralische Maximen übrig blieben. Damit wurde ein allgemeiner, wenn auch nur als
solcher gedachter und niemals in concreto mit Sicherheit feststellbarer Maßstab für
das Erkennen und das Handeln, für das Leben selbst gesetzt. Die Grausamkeit des
schlechten Gewissens war zwar die direkte Folgerung aus dieser Denkfigur, aber
dadurch konnte noch ein für das Denken beruhigender Glaube an Erlösung gerettet
werden – an das Reich der Wahrheit, das zwar für das ästhetisch bedingte Vernunftwesen unerreichbar bleiben musste, doch für immer gesichert zu sein schien; an das
Vermögen der Vernunft, das sich auf deren Faktum gründete, wenn das letztere auch
unbegreiflich blieb; an das höchste Gut, dessen Möglichkeit von der Vernunft zwar
nicht eingesehen, doch von ihr vorausgesetzt werden durfte.
Diese grundlegenden Plausibilitäten der kantischen Moral aus Vernunft stellte
Nietzsche entschieden in Frage. Es sei wohl möglich, dass, wenn alles Individuelle
und Empirisch-Einmalige im Urteilen und Handeln weggerechnet werden könnte, der
Mensch selbst verschwinden würde; dass das Allgemeine bloß „ein n i c h t v o r h a n d e n e [r] Maassstabe“ ist, welcher nur perspektivisch zu verstehen wäre. Und die
Erkenntnis selbst, die mit diesem Verfahren der Verallgemeinerung, mit dieser „Reinigung“ vom Empirisch-Pathologischen gleichgesetzt wurde, könne nur noch eine Art
von Erkenntnis sein, und dabei eine ziemlich verengte Ansicht. Statt des Vermögens
zum Allgemeinen kann es z. B. das Vermögen zur Vergesslichkeit und Verstellung
sein, an denen die Existenz des Menschen hängt und die deswegen dennoch nicht als
wirkliche „Prinzipien“ des Erkennens anzusehen sind, sondern nur als Vermutungen,
die Gründe zum Verdacht und Selbst-Verdacht liefern: ob die Erkenntnis nicht bloß
Mittel zur Befriedigung eigener Nöte gewesen ist, die missverstanden wurden; ob das
Problem der Erkenntnis nicht immer zu eng aufgefasst wurde; und, letztlich, ob den
eigenen Plausibilitäten nicht zu schnell der höchste Wert zugeschrieben worden ist.
Der Wert eines allgemeinen Urteils, das für jedermann gültig sein soll, wurde
schon durch die lutherische Umdeutung des christlichen Glaubens behauptet, der als
Glaube an die Tatsache der Erlösung die letztere wiederum garantieren sollte. Der
220
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Glaube als Gewissheit im Fürwahrhalten musste jedoch am eigenen Anspruch auf
Wahrhaftigkeit zugrunde gehen. Kant rettete ihn für praktische Zwecke, doch nicht
ohne Paradoxien und Tautologien. Wenn auch dieser Glaube sich schließlich als
Unvermögen erwies, so führte die Sehnsucht nach Gewissheit nicht nur zur Verzweiflung an der Wahrheit, sondern auch zum moralischen Unglauben des Nihilismus. Das
Christentum selbst wird im Laufe seiner historischen Entwicklung zu „einem dauernden Selbstmorde“ der Vernunft und führt in Form des nihilistischen Unglaubens zur
verzweifelten Aufgabe der Moral. Das christliche Gewissen muss sich am Ende gegen
die eigenen Plausibilitäten wenden – es verneint die Wahrheit im Namen der Wahrheit; es verneint die Moral aus Moralität; es verneint damit sich selbst. Es wird zum
intellektuellen Gewissen, zum Gewissen „hinter [dem] ‚Gewissen‘“ und zur ungeheuren „Gewissens-Kollision“, an der die europäische Moral zugrunde geht. Aber dies
muss, nach Nietzsche, nicht die einzige Option der abendländischen Entwicklung
sein. Der kantische Zirkel der gegenseitigen Begründung von Moral und Vernunft, der
zu grausamer Überforderung und Verzweiflung führte, wird bei Nietzsche zu einer
offenen Figur der Selbstaufhebung der Moral. Sie bleibt in beide Richtungen offen: in
die ihrer genealogischen Quellen und in die ihrer Konsequenzen, nämlich des Selbstmordes oder aber der Selbstüberwindung.
Der Wert der Moral wird so durch die doppelte Figur der Selbstaufhebung der
Moral aus Moralität und der Selbstüberwindung eines Moralisten aus Wahrhaftigkeit
von Nietzsche perspektivisch gedeutet. Die Macht der herrschenden Moral samt ihren
Plausibilitäten wird durch ihre äußersten Konsequenzen, durch das Feingefühl des
intellektuellen Gewissens, gebrochen. Doch um der „Aufgabe der Vernunft für die
Vernunft“ treu zu bleiben, darf ein „freier Geist“ nicht bloß bei dem Standpunkt des
intellektuellen Gewissens stehenbleiben. Um den unlösbaren Konflikt von Wissen
und Gewissen in einen Wegweiser zur Selbstüberwindung umzudeuten und „das
Werk der Aufklärung“ immer weiter „an sich selber“ „fortzusetzen“, sollte die Philosophie nun neue Optionen für den Glauben entdecken. Das Problem der Moral soll
in einem neuen Licht erscheinen: Es sollen die moralischen Plausibilitäten gefunden
werden, die eine „fortgesetzte ‚Selbst-Überwindung des Menschen‘“, die „Erhöhung
des Typus ‚Mensch‘“ ermöglichen.
Um das Problem der Moral neu zu beleuchten und zugleich einen Weg ihrer
fortwährenden Selbstüberwindung aufzuzeigen, führt Nietzsche zwei Begriffe ein –
den Begriff der Vornehmheit und den des Geschmacks. Dies sind seine „starken
Gegen-Begriffe“, d. h. Begriffe, die nicht begründen, sondern gerade auf die Unmöglichkeit einer Begründung und Verallgemeinerung der moralischen Urteile hinweisen.
Die Vornehmheit kann bei Nietzsche als eine besondere Eigenschaft, die bestimmte
Menschen kennzeichnet, nur noch missverstanden werden. Sie ist weder bloß als
Egoismus noch einfach als Selbstlosigkeit zu verstehen, deren Gegensätzlichkeit sich
seinerseits als problematisch erweist. Sie zeigt ihren Sinn nur angesichts des überaus komplexen inneren Kampfes innerhalb eines Menschen – des Kampfes zwischen
seinen Gelüsten und Trieben, zwischen dem, was er als seinen Nutzen und seinen
2.4 Zusammenfassung
221
Verzicht auf die Nützlichkeit versteht und missversteht. Wenn der Wert einer Sache
nur daran zu messen ist, „was man für sie bezahlt“, „was sie uns k o s t e t “, dann kann
der Wert einer Moral nur dadurch fortdauernd bestätigt werden, dass sie Einen immer
mehr kostet, dass sein eigener Wert dadurch ständig wächst. Nur die Parteinahme
zugunsten des Schwierigsten und Wider(ständ)lichsten, nur das stetige Sich-Riskieren, nur ein dauerndes Sich-Misstrauen führe zur Selbst-Erhöhung und so auch zu
einem vornehmen Glauben an sich selbst. Und Nietzsche macht kein Geheimnis
daraus, für welchen Gedanken sich sein vornehmer Geschmack entscheidet, d. h.
welcher Glaube ihm am schwersten fällt und von ihm eine fortdauernde Selbstüberwindung fordert: Der Glaube an die Ungewissheit des Daseins, an die Unmöglichkeit
einer Erlösung, an die Vergeblichkeit aller Hoffnungen auf den guten Sinn alles Geschehens.
Dieser Gedanke, der in seiner furchtbarsten Form (als ewige Wiederkunft des
Gleichen) später zu Nietzsches „Lehre“ erklärt wurde, ist keinesfalls ontologisch zu
verstehen, sondern er ist eine konsequente Schlussfolgerung aus seiner moralischen
Plausibilität: Das Misstrauen gegen jede Sinngebung, der Verzicht auf den Glauben
aller Art (sei es der Glaube als Fürwahrhalten oder das bloße Vertrauen in eine
Person) fällt immer schwerer und ist unerträglicher als sein Gegenteil – der Glaube an
das, was für das Leben nötig ist, das Vertrauen in die „Wünsche seines Herzens“.
Auch wenn dieser Glaube – und dies kann als Fragezeichen verstanden werden, mit
dem Nietzsches Plausibilität selbst versehen werden könnte – bloß die Entschiedenheit implizierte, einen Sinn des Daseins anzunehmen, der ungewiss bleiben muss;
eine Hoffnung zu tragen, die keine Bestätigung findet; einer Person zu vertrauen, die
keine Garantien anbieten kann. Ob die kantische „freie Aufnahme des Willens eines
Anderen“ unter die Maximen des eigenen Willens bzw. ob die christliche Liebe „u m
G o t t e s w i l l e n “ nicht eventuell mehr Selbstüberwindung im Sinne Nietzsches fordert, lasse ich an dieser Stelle offen.
Die These, dass das fortdauernde Selbst-Misstrauen allein zur Selbstüberwindung
führe, ist eine Plausibilität, die von Nietzsche gezielt als seine persönliche Perspektive, als seine Art, moralisch zu urteilen, dargestellt wird. In der Fröhlichen Wissenschaft
wird eine besondere Strategie entwickelt, die eigenen Plausibilitäten aufzudecken,
ohne ihre Plausibilität zu leugnen. Denn auch die Parteinahme zugunsten des schwierigsten Gedankens ist schließlich einem Glauben verpflichtet – einem persönlichen
Glauben, welcher besagt, was genau als Schwierigstes und Riskantestes für den, der
diesem Glauben anhängt, gelten kann. Er lässt die Frage offen, ob dieser Glaube dabei
nicht selbst zu einer Art Beruhigung, zu festem Boden, zu einer neuen „Heimat“
geworden ist. Die „Wünschbarkeit“ ist immer und in jedem Glauben vorhanden. Als
negatives Kriterium ist sie nur paradox zu denken: Indem man die Wünschbarkeit als
unerwünscht ansieht bzw. den Wünschen des eigenen „Herzens“ Widerstand leistet,
ist man der Wünschbarkeit schuldig geworden. Die Plausibilität von Nietzsches Kritik
der Moral entzieht sich so einer Verallgemeinerung und bringt ein Kriterium ins Spiel,
das die Frage nach dem Wert für jedermann zurückweisen muss.
222
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
Trotz des Verratens und der Paradoxierung der eigenen Plausibilitäten bleiben sie
bestehen. Die Selbstüberwindung der Moral ist genauso wie „die neue Aufklärung“
der Vernunft „an sich selber“ fortzusetzen. Eine Entscheidung zugunsten des Willens
zur Ungewissheit, zugunsten des stetigen Selbst-Misstrauens, ist schließlich eine
Sache des Geschmacks – eines Geschmacks für das Riskanteste und Gefährlichste,
wie auch immer dies in einer konkreten Lebenssituation verstanden werden mag. Der
Begriff des Geschmacks steht bei Nietzsche gerade für die Undenkbarkeit des Endgültig-Allgemeinen, für die Nicht-Alternativlosigkeit jeder Plausibilität – und damit für
die Möglichkeit einer Umwertung, für das Vermögen zu einem Perspektivenwechsel.
Denn den Geschmack kann man ändern, es sei denn, man hat genug Selbstvertrauen,
um den eigenen Geschmack für den guten zu halten, um die eigenen Geschmacksurteile vor den anderen überzeugend zu vertreten. Zu einer solchen Veränderung
wäre, wie es schon von Kant angedeutet wurde, nur die Kunst fähig. Wenn es aber
auch in der Moral und Erkenntnis schließlich um den Geschmack geht, so kann eine
solche Veränderung, so Nietzsche, nur ein Philosoph vollbringen – „d e r P h i l o s o p h
a l s h ö h e r e r K ü n s t l e r “.
Nietzsche präsentiert seine Aufgabe nicht bloß als die einer Kritik, sei es auch die
Kritik an der europäischen Moral aus Vernunft, sondern vielmehr als die einer „Philosophie der Zukunft“, die mehr als Kritik und mehr als Wissenschaft im kantischen
Sinne des Wortes sein soll. Es soll der Weg gefunden werden, der über die Kritik
hinaus führt, denn letztere hatte die Philosophie zur nihilistischen Verzweiflung
verführt. An die Stelle des Willens zur Gewissheit sind dafür der Mut angesichts des
Ungewissen und die Lust am Unlösbaren zu setzen. Nur so kann der Philosoph sich
vor den beiden Gefahren des Denkens überhaupt bewahren – vor dem gutmütigen
Vertrauen in den „Herzenswunsch“ und vor der letzten Verzweiflung eines Nihilisten.
Für diese letzte Entsagung und Selbstaufopferung, die keine Erlösung, aber auch
keine Resignation kennt, muss die Philosophie den Geschmack für das Tragische in
sich entdecken. Die Plausibilität der „letzten Moral“ wird von Nietzsche als Geschmack für das Tragische dargestellt.
Das Misstrauen ist der Philosophie als guter Geschmack beizubringen; alle Erkenntnisse sind „unter die Polizei des Misstrauens“ zu stellen; jedem Glauben muss
gekündigt werden. Nur durch diese letzte Entsagung wird die Philosophie zur tragischen Erkenntnis, nur dadurch wird sie fähig, die „Musik des Lebens“ wieder zu
hören, d. h. das Unerreichbare und Einmalig-Individuelle, das Perspektivische, das in
jedem Begriff und in jedem Urteil, in allem, was bis jetzt als Erkenntnis galt, schon
immer aufgehoben und „vergessen“ wurde. Als guter Geschmack soll jedoch auch das
Tragische zum Wohlgefallen (zum Wohlgefallen am Tragischen) werden können –
zum Genuss an den eigenen Kräften des Verstellens, die als solche für das Denken
unvermeidlich bleibt. Diese Fähigkeit, das Auge für das Perspektivische des Lebens
nicht zu verlieren und dabei immer wieder Zeichen-Oberflächen zu schaffen, ist
allerdings bis jetzt, wie Nietzsche feststellt, allein den Künstlern zugänglich gewesen,
und auch nur den besten unter ihnen: Denn nur Künstler wissen, wie man bewusst in
2.4 Zusammenfassung
223
der Illusion bleiben kann. Die „Wahrheit“ ist hier zwar bloß eine von dem Künstler
selbst geschaffene Illusion, doch ihr Wert wird dadurch nicht im Geringsten vermindert. Ganz im Gegenteil: Gerade deswegen wird sie geschätzt und genossen. Mehr
noch: Man kann an sie glauben, indem man paradoxerweise vergisst, dass sie bloß
ein Kunstwerk ist, und sich an dieses Vergessen gleichzeitig stets erinnert. Ein solcher
Umgang mit dem eigenen Glauben hält Nietzsche für die Zukunft der Philosophie, die
„höhere“ Kunst sein soll, höher als die Kunst eines Künstlers. Denn sie wird die Kunst
im Leben, die Kunst des Lebens sein müssen – die Kunst, sich selbst stets zu riskieren,
sich selbst und das eigene „Für und Wider“, die eigenen „letzten“ Plausibilitäten,
stets aufzugeben, um sie dann immer wieder neu zu finden.
Dies war Nietzsches Gegenentwurf nicht nur zur kantischen Moral aus Vernunft,
sondern auch zu jenem Projekt der Philosophie, das sich von Anfang an der Kunst
gegenüber feindselig zeigte, auch wenn es selbst tief in der Kunst verwurzelt blieb —
zum platonischen, das Nietzsche auch mehrmals mit dem Christlichen gleichsetzte.
Ihm zufolge
müssen wir immer Wissende und unser Leben lang im Besitze des Wissens sein; denn das Wissen
besteht ja eben darin, daß man im Besitz einer Kenntnis bleibt, die man erlangt hat, und ihrer
nicht verlustig gegangen ist.255
Denn dem Gedanken müsse entschieden Widerstand geleistet werden,
daß weder an den Dingen noch an den Reden irgend etwas Gesundes und Sicheres ist, sondern
daß alles in der Welt schlechtweg wie im Euripos in beständig wechselndem Auf- und Abströmen
begriffen ist, ohne auch nur einen Augenblick zu beharren.256
Wenn Nietzsche behauptet, er habe das „neue Gesetz der Ebbe und Fluth“ entdeckt
(FW 1, KSA 3, S. 372), so will er dieser alten Weisheit bewusst widersprechen.257 Er will
damit sagen: Wer sich auf das „Wellenspiel“ des Unberechenbaren, des ewig Neuen,
des Ungewissen und des Unaufhellbaren des Lebens einzulassen wagt, kann vielleicht nicht nur die tragische Erkenntnis, sondern auch die neue, „fröhliche Weisheit“
erlernen – die Weisheit, die man nicht haben kann, sondern „beständig noch erwirbt
und erwerben muss, weil man sie immer wieder preisgiebt, preisgeben muss“
(FW 382, KSA 3, S. 366).
Wenn „der Glaube[ ] an die V e r n u n f t i m Le b e n “ tatsächlich seine Zeit gehabt
hat, und „die kurze Tragödie“ der „Moralen und Religionen“ „in die ewige Komödie
des Daseins“ gehört (FW 1, KSA 3, S. 372), kann die Aufgabe der Philosophie mit der
Entdeckung des Tragischen nicht als vollendet angesehen werden. Sie muss noch
andere „Höhen der Seele“ aufdecken, „von wo aus selbst die Tragödie aufhört,
255 Platon, Phaidon, S. 59 f. (Phaidon, 75 d)
256 Platon, Phaidon, S. 86 (Phaidon, 90 c).
257 Vgl. das berühmte Notat, laut dem seine Philosophie „umgedrehter Platonismus“ sei, dessen Ziel
„das Leben im Schein“ sei (Nachlass, Ende 1870 – April 1871, 7[156], KSA 7, S. 199).
224
Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft
tragisch zu wirken“ (JGB 30, KSA 5, S. 48). Das sind die Höhen des Erkennenden, der
„die n o t h w e n d i g e Ungerechtigkeit in jedem Für und Wider begreifen“ lernt; die
Höhen eines Denkers, der der „Musik des Lebens“ zuhört, aber auch Zeichen-Oberflächen zu schaffen weiß; die Höhen eines Philosophen, der den Künstler-Glauben auf
das Leben überträgt und sich zu seinen Kunstwerken – zu seinem Leben als seinem
Kunstwerk – bekennt.
Kapitel 3.
Tolstoi: Moral versus Kunst
Nietzsches Kritik an der sokratisch-kantischen Moral aus Vernunft und sein Projekt
der Philosophie als „höherer“ Kunst haben in Russland großes Interesse und einen
lebendigen Widerklang gefunden – eine Tatsache, die auch Nietzsche nicht verborgen
geblieben ist. Bevor wir uns jedoch der Auseinandersetzung Nietzsches mit der
russischen Moralkritik widmen können, soll die Letztere in den Vordergrund treten.
Dazu werden die zwei unbestreitbar größten moralischen, intellektuellen und literarischen Autoritäten Russlands ins Zentrum der Untersuchung gestellt – Lew N. Tolstoi
und Fjodor M. Dostojewski.
Tolstoi und Dostojewski waren natürlich nicht die einzigen russischen Denker,
die die Moral aus Vernunft kritisch hinterfragt haben. Ihre Antworten sind jedoch von
erstrangiger Bedeutung, nicht nur wegen ihrer Autorität für die russischen Intellektuellen bis heute, sondern auch weil ihre philosophischen Fragestellungen und künstlerischen Experimente eine enorme Wirkung auf die Renaissance in der Philosophie
und den Künsten der Jahrhundertwende zur Folge hatten – das sogenannte Silberne
Zeitalter der russischen Kultur.1 Auch im Ausland haben diese Denker mehr als alle
anderen russischen Philosophen Anerkennung gefunden, da beides – die Fremdheit
der philosophischen Denkweise und ihre schöpferische Leistung – hier besonders
auffallend war. Tolstois und Dostojewskis Moralkritik und ihre Philosophie der Kunst
müssen darum in ihrer Originalität und Komplexität dargestellt werden. Die für die
‚westliche‘ Philosophie fremde Art des Argumentierens und des Fragens darf dabei
nicht übersehen werden, genauso wenig wie eventuelle Einflüsse der ‚westlichen‘
Denker, die besonders bei Tolstoi an Bedeutung gewinnen.
Dieses Kapitel ist Tolstois Philosophie gewidmet und soll seine Ideen als Denker
und Künstler systematisch darstellen. Sie sind allerdings weder ohne Tolstois Romane
noch ohne seine Lebensumstände zu verstehen. Daher sind einige Bemerkungen zur
Biographie gleich zu Beginn vonnöten.
Lew Nikolajewitsch Tolstoi gehörte zur gebildeten Elite der russischen Gesellschaft. Seine ausgezeichneten Sprachfertigkeiten,2 u. a. seine Vertrautheit mit dem
1 Die Entstehung des philosophischen Denkens in Russland kann natürlich weiter zurückverfolgt
werden. Doch die eigenständig mächtige Strömung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert lässt
sich nicht mit den früheren religiös-didaktischen Formen des Philosophierens vergleichen. Es ist dabei
kaum möglich, die Rolle Tolstois und Dostojewskis zu überschätzen. S. dazu Василий Зеньковский
(Wasili Zenkowski), История русской философии (Geschichte der russischen Philosophie), bes. S. 390.
2 Französisch sprach er, wie der damalige Adel, als Muttersprache, auch fließend Deutsch, Englisch,
als Student der Orientalistischen Fakultät der Universität Kasan’ musste er Prüfungen in türkischer,
tatarischer und arabischer Sprache ablegen. Die Orientalistische Fakultät verließ Tolstoi für die Juridische. Zwar war er nie ein Musterstudent, jedoch wurde er von seinen Professoren für einen höchst
226
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Griechischen und Hebräischen (er setzte den traditionellen Übersetzungen des Evangeliums eigene polemisch entgegen), seine breiten, wenn auch eklektischen, Kenntnisse der Weltliteratur, der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Geschichte, der
ästhetischen und der politischen Theorien, der Musik, der Theologie und der Soziologie zeigen sich durch zahlreiche Hinweise sowohl in seinen Romanen als auch in der
Publizistik und den kritischen Aufsätzen der späten Phase seines Schaffens.3 Diese
späte Phase ist für das Verständnis von Tolstois Philosophie von entscheidender
Bedeutung. In Meiner Beichte (angefangen im Jahr 1879, vollendet im 1882)4 betonte
Tolstoi bereits selbst den Bruch, der ihn von den früheren Ansichten bzw. der eigenen
Leichtfertigkeit in der Behandlung der Grundfragen des Lebens trennte. Dennoch
wurde es schon öfters bemerkt, dass dieser angebliche Bruch eine gewaltige Übertreibung darstellt und dass Tolstoi diesen aus gewissen strategisch-didaktischen oder
auch moralischen Gründen so deutlich hervorhob.5 Tatsächlich kommen schon in
seinen früheren Werken, wie z. B. in Sevastopol’ Erzählungen, in Krieg und Frieden und
Anna Karenina, die der Schriftsteller später selbst als hinfällig tadeln wird, viele
Themen und Einsichten des späteren Tolstoi zum Vorschein. Durch die Suche seiner
Romanfiguren nach dem Weg des Lebens, durch ihre Gesinnungs- und Schicksalswendungen, auch in der Art und Weise, wie Umbrüche und spirituelle Erlebnisse
dargestellt werden, und besonders durch die entsprechende Erzählform6 deutet sich
Tolstois Philosophie des Lebens schon dort an. Doch Tolstois Überbetonung des
revolutionären Bruchs mit seiner eigenen früheren Gesinnung und künstlerischen
Einstellung ist von großer Bedeutung, um seinen Weg in der Philosophie zu verstehen, v. a. der Verzicht auf sein literarisches Werk bzw. seine neuen radikalen
Forderungen an Kunst und Künstler. Die Kunst, die ganze europäische Kunst der
begabten Studenten gehalten. S. darüber Виктор Шкловский (Wiktor Schklowski), Лев Толстой (Lew
Tolstoi), (Жизнь замечательных людей, Bd. 3 (363)), S. 76 ff.
3 U. a. war Tolstoi Korrespondent prominenter Politiker wie Mahatma Gandhi und William Lloyd
Garrison.
4 Das Traktat sollte in der Zeitschrift Russkaja Mysl’ (Russisches Denken) im Jahr 1882 erscheinen,
wurde dennoch von der Zensur im letzten Augenblick verboten und aus allen Exemplaren der Zeitschrift ausgeschnitten. Nichtsdestoweniger ist es dem russischen Publikum sehr schnell bekannt
geworden. Es erschien in Genf im Jahr 1884.
5 Tolstois Biographen warnen davor, Tolstois harter moralischer Selbstbezichtigung aufs Wort zu
glauben. S. z. B. Шкловский, Лев Толстой, S. 108 f. Der Bruch der 1880er Jahre sei eine gewaltige
Übertreibung gewesen. Denn schon im Jahr 1855 kam Tolstoi auf die Idee, eine neue Religion zu
gründen, die „Religion Christi, jedoch von Glauben und Mysteriösität gereinigt“ (Шкловский, Лев
Толстой, S. 507 f.).
6 Die Position des Erzählers lässt sich bei Tolstoi bspw. von der Dostojewskis scharf unterscheiden.
Wir kommen zu dieser Frage noch einmal im nächsten Kapitel zurück. Zur besonderen Position des
Erzählers bei Tolstoi s. z. B. Юрий В. (Juri W. Mann), Автор и повествование (Der Autor und die
Erzählung); die Verfass., Поэтика драмы и эстетика театра в романе: „Идиот“ и „Анна
Каренина“ (Die Poetik des Dramas und Ästhetik des Theaters im Roman: „Der Idiot“ und „Anna
Karenina“), S. 187–206.
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
227
gebildeten Schichten der Gesellschaft ab der Renaissance bis zu Tolstois eigenen
Werken, habe dem Leben nicht gedient und sei von nun an als Fälschung der Kunst
und als Irrweg der europäischen Kultur anzusehen. Letzterer bedeute nicht nur den
Verfall der Künste und der Kultur, sondern auch den Niedergang des Lebens, die
Sackgasse der europäischen Zivilisation. Um diese Situation zu bewältigen, musste,
so Tolstoi, etwas Ähnliches vollbracht werden, wie Galilei es mit dem Gesetz der
Himmelskörper für die Astronomie getan hatte: Die Bahn des Lebens musste neu
entdeckt werden.
Dank Tolstois Autorität als Schriftsteller und seiner aktiven Tätigkeit als Publizist
wurde seine religiös-philosophische Wendung weit über die Grenzen Russlands
hinaus bekannt. Verbote durch Zensur und kirchliche Exkommunikation im Jahr 1901
konnten seine Popularität nicht mindern.7 Auch die russischen Intellektuellen, die
Tolstois Ansichten nicht teilten und leidenschaftlich gegen ihn polemisierten, hatten
diese aus theologischer Sicht unvermeidliche Aktion der Kirche (Tolstoi verspottete
die Sakramente und predigte öffentlich gegen die Orthodoxie) mit „schmerzhafter
Empörung“ wahrgenommen.8 Seine Opponenten, wie u. a. Wasili Rosanow, die die
orthodoxe Kirche sonst heftig verteidigt hatten, sprachen ihr nun das Recht ab, über
das sonderbare Phänomen seiner Religiosität zu urteilen.9 Das Interesse für die verbotenen Schriften stieg jedoch nicht nur dank der staatlich-kirchlichen Verfolgung,
sondern auch dank der ihnen zugrunde liegenden Paradoxie: Man wollte Partei gegen
Tolstois religiöse Predigt ergreifen – für Tolstoi als Künstler, man wollte Tolstois
Kunstwerke gegen Tolstoi selbst in Schutz nehmen.10 Denn genauso wie seine Roma-
7 Die Exkommunikation hat u. a. die Meinungsverschiedenheit zwischen säkularer und kirchlicher
Gewalt hervorgerufen sowie heftige Diskussionen in der russischen Gesellschaft. Der konservative
Minister Konstantin P. Pobedonostzew, der zu dieser Zeit auch der Vorsitzende der Heiligen Synode
gewesen ist, war, entgegen der weit verbreiteten Meinungen, gegen die Exkommunikation. Die gegen
ihn kritisch eingestellten Intellektuellen waren dagegen überzeugt, es handele sich um seine Entscheidung, besonders weil von der Orthodoxen Kirche in solchen Fällen keine Unabhängigkeit zu
erwarten war. Er fürchtete dagegen, und mit Recht, dass dieser Akt der Synode ihrer Autorität schaden
und Tolstois Autorität dagegen stärken würde (vgl. Федор А. Степун (Fjodor A. Stepun), Религиозная
трагедия Льва Толстого (Die religiöse Tragödie Lew Tolstois), S. 468 f.).
8 Vgl. Зинаида Гиппиус (Zinaida Gippius), Благоухание седин (Der Brodem des Alters).
9 Vgl. Василий Розанов (Wasili Rosanow), Об отлучении гр. Л.Н. Толстого от церкви (Über die
Exkommunikation von Graf L.N. Tolstoi). Rosanow betont die Unfähigkeit der Synode, als bürokratischtote Behörde über das lebendige Phänomen Tolstois Glaubens urteilen zu können. An anderer Stelle
versuchte Rosanow dagegen, die Kirche gegenüber Tolstois Angriffen zu verteidigen: Василий
Розанов, Л.Н. Толстой и Русская церковь (L.N. Tolstoi und die Russische Kirche). Hier wird Tolstois
Kritik einerseits und die kirchliche Exkommunikation andererseits als großes gegenseitiges Missverständnis dargestellt.
10 In seinem unmittelbar vor dem Tod geschriebenen Brief an Tolstoi äußerte ein anderer berühmter
russischer Schriftsteller, Iwan S. Turgenew, eine „letzte herzliche Bitte“: „Mein Freund, kehren Sie
zurück zur Literatur! Es ist die Gabe, die von daher kommt, wie alles andere. Ah, ich wäre so glücklich,
wenn ich denken dürfte, dass meine Bitte Einfluss auf Sie haben wird! Mein Freund, großer Schrift-
228
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
ne früher die russische intellektuelle Elite begeistert hatten, wirkte nun seine Philosophie und seine Predigt der „Vereinfachung“ (опрощение) befremdend auf sie.11
Die scharfen Angriffe auf alle gesellschaftlichen Institutionen (vom Militärdienst bis
zur Armenfürsorge) erforderten nun eine Auseinandersetzung mit Tolstois Radikalität, nicht nur vonseiten der staatlichen Ideologen, sondern auch von den russischen
Intellektuellen, die große Verehrer seiner Schriftstellerkunst waren – der Kunst, mit
der Tolstoi, wiederum paradoxerweise, schon viel früher nicht selten ähnliche moralische Ansichten vertreten hatte, die nun in den Vordergrund seines Schaffens traten.
Diese inneren Widersprüche und paradoxen Folgen von Tolstois Denken spiegelten
sich auch in seinen Lebensumständen, v. a. in seinen familiären Schwierigkeiten
wider – Schwierigkeiten, die durch spätere Veröffentlichung seiner Tagebücher und
der seiner Frau Sofja Andreevna bekannt wurden.12 Kaum jemand konnte nach Tolstois Lehre leben. Auch er selbst nicht. Und doch hatte er begeisterte Anhänger, die so
genannten Tolstoianer, die seine These des Nicht-Widerstandes im Leben umsetzten,
indem sie auf das Militär und andere staatliche Dienste unter großen persönlichen
Aufopferungen verzichteten.13 In Tolstois letzten Lebensjahren wurde Jasnaja Poljana
steller Russlands, hören sie auf meine Bitte!“ (Лев Н. Толстой (Lew N. Tolstoi), Переписка с русскими
писателями. (Der Briefwechsel mit russischen Schriftstellern), Bd. 1, S. 178 f., 203). Vgl. das berühmte
Werk Schestows über Tolstoi und Nietzsche: „Man sagt von der Wandlung in Tolstois Schaffen, er sei
von der künstlerischen Betätigung zur Philosophie übergangen. Man bedauert es sehr, da man der
Meinung ist, dass Tolstoi – als Künstler genial – sich als Philosoph und Denker schlecht bewährte.“
(Leo Schestow, Tolstoi und Nietzsche. Die Idee des Guten in ihren Lehren, S. 94) Schestow selbst vertrat
allerdings eine andere Meinung und sprach Tolstoi seine Originalität als Philosoph nicht ab. Er wies
dagegen darauf hin, dass Tolstoi gerade als Künstler ein Philosoph ist.
11 Die Meinungen waren darum so unterschiedlich, wie es nur möglich ist – von der Betonung seiner
Genialität als Philosoph und seiner mächtigen logischen Kraft, die seiner Begabung als Schriftsteller
fast gleichgesetzt wurde (Семен Франк (Semjon Frank), Нравственное учение Л.Н. Толстого (Moralische Lehre L.N. Tolstois), S. 300) bis zur Herabwürdigung zu einem „banalen“ und „unbegabten
religiösen Denker“, der nur „banale, mittelmäßige Gedanken hatte“ (Н.А. Бердяев (N.A. Berdjajew),
Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Л. Толстого (Altes und Neues Testament in dem
religiösen Bewusstsein L. Tolstois), S. 244). Die letztere Behauptung ist allerdings eher polemisch zu
verstehen, denn sie widerspricht den darauf folgenden Überlegungen.
12 Софья А. Толстая (Sofja A. Tolstaja), Дневники (Tagebücher).
13 Die Bedeutung dieser religiösen Bewegung darf jedoch nicht überschätzt werden: Seine Anhänger
waren nicht besonders zahlreich (vgl. Александр С. Пругавин (Alexander S. Prugawin), О Льве
Толстом и толстовцах. Очерки, воспоминания, материалы (Über Lew Tolstoj und Tolstojaner.
Essais, Erinnerungen, Materialien)). Zu Person und Verlagstätigkeit Wladimir Tschertkows, einem der
treusten Tolstoianer, der aber auch eine der zweifelhaftesten Figuren in Tolstois Umgebung war, s. Geir
Kjetsaa, Lew Tolstoi. Dichter und Religionsphilosoph, S. 245 ff. Tolstoi selbst schrieb in seiner Antwort
auf die Verordnung der Synode, dass unter seine Nachfolger kaum 100 Menschen gezählt werden
können (Л.Н. Толстой, Ответ на постановление Синода от 20–22 февраля и на полученные мною
по этому поводу письма (Die Antwort auf das Schreiben des Synods vom 21.–22. Februar und die zu
diesem Anlass von mir erhaltenen Briefe)). Die Bauerngemeinden, die von Tolstoianern gegründet
wurden, genossen darüber hinaus nicht einmal Tolstois Unterstützung, weil er eben die Absonderung
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
229
zu einem Wallfahrtsort.14 Seine aktive öffentliche Tätigkeit, bei der er als größter
Schriftsteller Russlands gewisse Freiheit genoss,15 sein Kampf gegen die Todesstrafe,
gegen den Antisemitismus, seine Hilfe für die Opfer der Hungersnot erhoben ihn zur
unumstrittenen moralischen Autorität. Und vielleicht wurde Tolstois Flucht von zu
Hause mehr als alles andere als prophetische Geste wahrgenommen: Damit konnte er
letztendlich das erreichen, was ihm sonst nie gelungen wäre – die Freiheit von allem,
was ihn im Leben fesselte. Diese letzte Konsequenz seiner moralischen Ansichten, der
Verzicht auf alles, was dem Menschen im irdischen Leben wichtig ist – der Besitz, der
Schriftstellerruhm und schließlich die Familie – erwies sich allerdings als Verzicht auf
das Leben selbst. Denn nur zehn Tage später starb Tolstoi an einer Lungenentzündung auf der Bahnstrecke an der bis dahin noch unbekannten und ab diesem Moment
weltberühmten Zwischenstation Astapowo. Sein Tod wurde vom ganzen Land als
großes Ereignis erlebt, er verwandelte sogar Tolstois schärfste Opponenten in leidenschaftliche Verehrer.16
Trotz seines Ruhmes, es sei noch einmal betont, ist Tolstois Predigt des „wahren
Christentums“ und der „guten Kunst“ im Großen und Ganzen auf Unverständnis
gestoßen.17 Der Grund dafür war nicht etwa eine kritische Einstellung gegenüber dem
Christentum, sondern gerade umgekehrt: Tolstois Predigt der „christlichen“ Moral
wurde als Zeichen der Gottlosigkeit und als Ausdruck einer „stolzen Vernunft“ von
der russischen intellektuellen Elite, die gerade eine Renaissance der christlich-mystivon der ‚Welt‘, das Streben nach der „Reinheit der Gemeinde“ missbilligte (vgl. Шкловский, Лев
Толстой, S. 668). Ihre Zeit war auch schnell vorbei. Im Jahr 1905 bekam einer seiner Nachfolger, Pawel
Birjukow, die für die Registrierung einer religiösen Gemeinde nötigen 50 Unterschriften nicht zusammen (Шкловский, Лев Толстой, S. 762 f.).
14 Wasili Rozanow, der Tolstoi im Jahr 1907 besuchte, schrieb, dass „Russe zu sein und Graf L.N.
Tolstoi nicht gesehen zu haben, genauso traurig wäre, als wenn ein Europäer niemals die Alpen
gesehen hätte“. Er verglich Tolstoi mit Abraham und Moses und nannte ihn den „‚Montblanc‘ unseres
Lebens“ (Василий Розанов, Поездка в Ясную Поляну (Eine Reise nach Jasnaja Poljana)). Tolstoi zu
besuchen war für jeden russischen Intellektuellen am Anfang des 20. Jahrhunderts unerlässlich. Denn
Tolstoi wurde nicht nur als größter russischer Schriftsteller aller Zeiten betrachtet, sondern auch und
vor allem als größter Lehrer des Lebens. Dafür brauchte man nicht unbedingt seine Ansichten zu teilen.
Jasnaja Poljana ist zu einem in allen Hinsichten einmaligen Phänomen der russischen Kultur geworden.
15 Nur diese besondere Position rettete ihn von den repressiven Maßnahmen seitens der Regierung,
die sonst nach der Exkommunikation unvermeidlich gewesen wären. Seine Anhänger mussten dagegen schwere Verfolgungen erleiden.
16 „Bei der Nachricht über Tolstois Tod hat sich ganz Russland vor ihm als einem Märtyrer und
Verkünder des Christentums verbeugt.“ (Степун, Религиозная трагедия Льва Толстого, S. 468)
17 Vgl. die Meinung von Semjon L. Frank: „Von allen zeitgenössischen Denkern genießt Tolstoi den
größten Ruhm, dennoch, scheint es, auch die geringste Anerkennung.” (Франк, Нравственное
учение Л.Н. Толстого, S. 299). Vgl. auch bei Dmitri Merezhkowski: „Er [Tolstoi – E.P.] ist nicht klug
genug für sein Genie oder aber zu genial für seinen Intellekt“ (Дмитрий С. Мережковский (Dmitri
S. Merezhkowski), Л. Толстой и Достоевский, (L. Tolstoi und Dostojewski), Санкт-Петербург: Общ.
Польза, 1909, Bd. 2, (Die Religion), Teil. 1, S. 1.
230
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
schen Religiosität erlebte, zurückgewiesen.18 Tolstoi ging offensichtlich gegen den
Geist seiner Zeit.19 In philosophischen Kreisen20 löste seine Religions- und Moralphilosophie, auch wenn Tolstois Autorität als größter russischer Schriftsteller und Seelenkenner (sic!) als unumstritten galt, heftige Polemiken aus. Besonders bemerkenswert sind zwei Traktate von Lew Schestow, Das Gute in der Lehre von Graf Tolstoi und
F. Nietzsche (Philosophie und Predigt) und Dostojewski und Nietzsche: Philosophie der
Tragödie, in denen die moralistische Flachheit und der Rationalismus Tolstois den
religiös-mystischen Einsichten Dostojewskis und Nietzsches entgegengesetzt werden.21 Man sprach von der „Tyrannei der Moral“, die das Genuin-Religiöse bei Tolstoi
verdunkelte bzw. gegenüber dem er unsensibel blieb.22 Wladimir Solowjow, der mit
Recht zu den originellsten russischen Philosophen und Theologen gezählt wird, hat
versucht, privat sowie öffentlich gegen Tolstoi zu polemisieren. Dennoch verstanden
sich die zwei Denker kaum, so verschieden waren ihre Positionen.23 Nikolai Berdjajew
sprach Tolstoi das Christ-Sein pathetisch ab, indem er behauptete, dass „eine solche
Feindschaft gegen die Idee der Erlösung“, wie sie bei Tolstoi zu sehen sei, „die
christliche Welt nie zuvor gekannt hatte“.
18 Einer von seinen ehemaligen Anhängern, der zur Kirche zurückgekehrt ist, schrieb in einem
offenen Brief an Tolstoi: „Ihr Glaube ist abstrakt, rationalistisch, tot.“ (М.А. Новоселов (M.A. Nowosjelow), Открытое письмо графу Л.Н. Толстому (Offener Brief an Graf L.N. Tolstoi), S. 380) Es ist zum
Gemeinplatz geworden, dass Tolstoi den Glauben suchte, aber nichts außer abstrakt-rationalen Formeln gefunden hat. Doch auch in diesem Punkt ist eine paradoxe Meinungsverschiedenheit festzustellen. Vgl. Franks Deutung von Tolstois Religion als „lebendiger persönlicher innerlicher Beziehung des Menschen zur Gottheit“ (Франк, Нравственное учение Л.Н. Толстого, S. 306).
19 Zenkowski hält Tolstois Konflikt mit der Kirche für ein Missverständnis, den Konflikt mit der „Welt“
bzw. mit der säkularen Kultur dagegen für wesentlich (Зеньковский, История русской философии,
S. 391 ff.). Tolstois Religiosität bleibt dabei für Zenkowski selbst höchst irritierend.
20 Hier sind die Vertreter des sog. „neuen religiösen Selbstbewusstseins“ um die Jahrhundertwende
gemeint, die durch die Tätigkeit der religiös-philosophischen Gesellschaft, durch die berühmten
Sammelbände Проблемы идеализма (Probleme des Idealismus) (1902), Вехи (Marksteine) (1909) und
durch die Zeitschrift Путь (Der Weg) öffentlich bekannt wurden. Vgl. die spätere Einschätzung dieses
Phänomens von einem seiner aktiven Teilnehmer: Николай А. Бердяев (Nikolai Berdjajew), Русский
духовный ренессанс начала ХХ века и журнал „Путь“: (К десятилетию „Пути“) (Die russische
geistige Renaissance Anfang des 20. Jahrhunderts und die Zeitschrift „Put’“: (Zum zehnten Jubiläum von
„Put’“)).
21 Лев Шестов (Lew Schestow), Добро в учении гр. Толстого и Фр.Ницше (Философия и
проповедь) (Das Gute in der Lehre von Gr. Tolstoi und F. Nietzsche); Лев Шестов, Достоевский и
Ницше: Философия трагедии (Dostojewski und Nietzsche: Philosophie der Tragödie).
22 Auch Zenkowski hält Tolstoi für einen „tiefen, dennoch einseitigen Denker“, der alle geistigen
Kräfte der „Tyrannei der Moral“ unterworfen habe (Зеньковский, История русской философии,
S. 391 ff.).
23 S. dazu Алексей Ф. Лосев (Aleksej F. Losew), Владимир Соловьев и его время (Wladimir Solowjew
und seine Zeit), S. 499 ff. Wie viele andere russische Denker, nimmt Losew in diesem Streit ausdrücklich
Partei für Solowjew gegen die „abstrakte Moralistik” Tolstois (S. 500).
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
231
Es kann nicht derjenige ein Christ genannt werden, dem selbst die Idee der Erlösung fremd und
zuwider ist, selbst die Not der Erlösung, d. h. dem der Gedanke von Christus selbst fremd und
zuwider ist.24
Abgesehen von relativ wenigen Stimmen, die Tolstoi zum großen Erneuerer des
Christlichen erklärten,25 und den vielen Stimmen, die Tolstoi moralisierende Vereinfachung des Christlichen vorwarfen, ist seine Philosophie darüber hinaus als unchristlich-heidnische kritisiert worden. Den Anlass dazu gaben v. a. die Romane, in
denen die sinnliche Üppigkeit des Lebens dargestellt wurde.26 Die tiefgreifende Kritik
der sozialen Verhältnisse wurde dagegen positiv angenommen, vor allem von den
russischen Sozialisten und Marxisten. Sogar Lenin hat Tolstois Predigt in diesem Sinn
positiv bewertet. Die Zustimmung erfolgte jedoch auch in dieser Richtung nicht ohne
Widersprüche. Tolstois Moral des Nicht-Widerstandes, von der in diesem Kapitel die
Rede sein wird, blieb den russischen Marxisten verständlicherweise fremd.27
Von allen scharfen Einwänden der russischen Intellektuellen gegen Tolstois
Wendung zur Religion sind v. a. die Vorwürfe des unangemessenen Rationalismus für
den Zweck unserer Untersuchung von primärer Bedeutung. Gerade die Tatsache, dass
die in ihrer Übersicht beschränkte und durch ihre Not gedrängte Vernunft als Mittel
der kritischen Ergründung eigener Fähigkeiten und als Ausgangspunkt jeder moralischen Überlegung angesehen wurde, ist als frevelhafte „Verehrung“ der Vernunft
gebrandmarkt worden. Es ist allerdings bemerkenswert, dass die Philosophie des
späten Tolstoi in Russland (geschweige denn in Westeuropa) nicht besonders systematisch und nur bruchstückhaft rezipiert wurde. Und dies nicht nur wegen äußerlichen Gründen, nicht nur weil viele seiner späteren Werke verboten worden und erst
fast 50 Jahre später in der Jubiläumsausgabe erschienen sind,28 sondern vielmehr weil
24 Бердяев, Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Л. Толстого, S. 249.
25 Vgl. Николай О. Лосский (Nikolai O. Losski), Нравственная личность Толстого (Die moralische
Persönlichkeit von Tolstoi).
26 Maßgeblich ist hier vor allem das Buch von Dmitri S. Merezhkowski geworden, in dem Tolstoi als
Heide und „Hellseher des Fleisches“ („тайновидец плоти“) Dostojewski als Christ und „Hellseher des
Geistes“ („тайновидец духа“) entgegengesetzt wurde (Дмитрий С. Мережковский, Л. Толстой и
Достоевский (L. Tolstoi und Dostojewski)).
27 In der sozialistischen Epoche wurde überall die Aussage Lenins über Tolstoi zitiert, die aus Gorkis
Memoiren stammte: „Was für ein großer Klumpen, was für ein großes Stück Mensch!“ (Максим
Горький (Maksim Gorki), В.И. Ленин (W.I. Lenin)) Vgl. auch das berühmte Pamphlet Лев Толстой как
зеркало русской революции (Lew Tolstoi als Spiegel der russischen Revolution). Hier wird der NichtWiderstand als Ausdruck von Tolstois Widersprüchlichkeit und Unverständlichkeit gedeutet, seine
Kritik an den gesellschaftlichen Institutionen dagegen positiv bewertet.
28 In seinem Werk Reich Gottes ist inwendig in euch klagt Tolstoi die Zensur an, seine Werke würden
entweder verzerrt oder verboten, die Polemik gegen ihn dagegen öffentlich zugelassen. Folglich kenne
das russische Publikum seine Philosophie meistens nur aus der, öfters sehr einseitigen, Gegenargumentation (Leo N. Tolstoj, Das Reich Gottes ist inwendig in Euch, oder das Christentum als eine neue
Lebensauffassung, nicht als eine mystische Lehre, Bd. 1, S. 3).
232
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
sein Ansatz ohne den Kontext, aus dem er hervorgegangen ist, nicht zu verstehen war.
Den Kontext bildete aber die kantische Moral aus Vernunft, welche zur Kritik ihrer
selbst fähig und sogar durch innere Nötigung dazu veranlasst wird, bzw. die aufklärerische Selbstvergewisserung der Vernunft, die davon ausging, dass jeder Mensch
fähig ist (oder als dazu befähigt gedacht werden soll), aus seiner „selbst verschuldeten Unmündigkeit“ (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, AA 8, S. 35) zu
einem verantwortungsvollen Gebrauch seiner Vernunft überzugehen. Die Aufklärung
im Sinne Kants war den russischen Intellektuellen zwar nicht unbekannt, doch in
ihrer Einstellung und Zielsetzung wurde sie von ihnen als fremd und historisch überholt angesehen. Die russische Philosophie hat sich selbst als Antwort auf die Herausforderung der Aufklärung bzw. als Verteidigung des christlichen Erbes vor Angriffen
des aufklärerischen Rationalismus verstanden.29 Auch Tolstoi, der ein leidenschaftlicher Verehrer Spinozas, Rousseaus und Kants gewesen ist, hat sich selbst paradoxerweise nicht als Aufklärer verstanden, sondern als Erneuerer des Religiösen, als
Christ.30 Doch dies tat er in einem ganz anderen Sinn als Wladimir Solowjow, Nikolai
Berdjajew und Lew Schestow, die sich auch für Christen hielten. Für die Letzteren
stellte Tolstois Philosophie nicht bloß eine verspätete Apologie der Aufklärung dar
bzw. eine Apologie des bis zur äußersten Naivität getriebenen Rationalismus, sondern
darüber hinaus, ähnlich wie bei der Reformation, ihren letzten Angriff auf das
Christentum – einen Angriff, der sich nun als genuin christlich präsentierte, der aber
umso gefährlicher für die religiöse Weltanschauung sein sollte. Die Gefahr des Rationalismus Tolstois liege also gerade in seinen religiösen Ansprüchen. Nicht bloß mit
abstrakten spekulativ-philosophischen Ausführungen, aber auch nicht mit einer mystisch-religiösen Predigt trat der Schriftsteller seinen Zeitgenossen gegenüber, sondern
mit etwas, das als merkwürdiger Übergriff angesehen wurde: mit der Kritik der Vernunft aus ihren religiösen Nöten. Diese Kritik wurde von Tolstoi als die eines gesunden
Menschenverstandes präsentiert, die jeder Mensch nachvollziehen kann, die ihn
jedoch herausfordert, gerade auf das Alltäglich-Verständliche zu verzichten und den
Bezug aufs Unendliche anzunehmen, um dann das eigene Leben radikal zu ändern.
Die kantische Wende der Philosophie wurde somit, irritierend für seine russischen
29 Vgl. bspw. die Aussage von Sergei N. Bulgakow: „Die religiöse Wahrheit steht über dem Verstand
und ist deswegen antinomisch. Das Christentum führt zu einer Reihe von Verstandesantinomien,
deswegen hat das rationalistische Denken Tolstois, der den Antinomien entgehen wollte und sie nicht
erfassen konnte, ihn offensichtlich vom Christentum entfernt.“ (С.Н. Булгаков (S.N. Bulgakow),
Простота и опрощение (Einfachheit und Vereinfachung), S. 287) Bulgakow wusste natürlich, dass die
Antinomien ein wesentlicher Punkt der kantischen Kritik der Vernunft waren, durch die die metaphysischen Ansprüche der Vernunft zurückgewiesen wurden. Nichtsdestoweniger verwendet er selbst die
Antinominität der Vernunft, um ihren metaphysisch-dogmatischen Gebrauch zu rechtfertigen, und das
mit einem Hinweis auf Dostojewski und seine Kritik der „‚euklidischen‘ Vernunft“, die ich im nächsten
Kapitel analysieren werde.
30 Tolstoi nannte allerdings Spinoza, dem er vielleicht, wie ich weiter zeigen werde, nicht weniger als
Kant zu verdanken hatte, „einen wahren Christen“ (TGA 39, S. 20).
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
233
Zeitgenossen, von Tolstoi auf der Höhe der Zeit wiederaufgenommen – in der Zeit, in
der die Not des Einzelnen als einzige Plausibilität verstanden wurde. Das war die Not
des gegen die eigenen Ansprüche misstrauisch gewordenen „Ichs“, das sich seines
Unvermögens zum Glauben bewusst ist und den Abgrund des Nihilismus durchschaut.
Bis heute wird Tolstoi in Russland als „merkwürdiger Leser“ Kants verstanden.31
Sicherlich war er dies nach den Verhältnissen seiner Zeit.32 Denn an der Kritik der
reinen Vernunft, die er schon Ende der 1860er Jahre las, hat ihn am meisten die
Methodenlehre interessiert. Fast alle Randbemerkungen befinden sich in den Kapiteln
zur Disziplin, zum Kanon, zur Architektonik und Geschichte der reinen Vernunft.33
Die Notizen sprechen dafür, dass seine Einschätzung, er habe in der Kritik der reinen
Vernunft „fast nichts verstanden“ (TGA 69, S. 24), nicht stimmte. Es scheint fast so, als
hätte er trotz fehlender Fach- bzw. Terminologiekenntnisse viel mehr verstanden als
viele seiner Zeitgenossen.34 Aber zum begeisterten Anhänger Kants ist Tolstoi erst
geworden, nachdem er die Kritik der praktischen Vernunft gelesen hatte. So schrieb er
20 Jahre nach seiner ersten Kant-Lektüre:
Ich hatte geglaubt, dass der Alte [Kant – E.P.] gelogen hätte, dass sein Mittelpunkt die Negation
sei. Ich habe 20 Jahre mit dieser Überzeugung gelebt. […] Ein solches Verhältnis Kant gegenüber
ist das gleiche, als wenn man die Baugerüste um das Gebäude herum für das Gebäude selbst
halten würde. Ist es mein persönlicher oder ein allgemeiner Fehler? Es scheint mir, dass hier ein
allgemeiner Fehler vorliegt.35
Als Beispiele dieses allgemeinen Fehlers werden Max Weber, Fichte, Schelling und
Hegel genannt. Sehr herabwürdigend ist an dieser Stelle auch Tolstois Erwähnung
Schopenhauers, dem er seiner früheren Einschätzung nach das Verständnis der ersten
Kritik Kants verdankte.36 Kants zweite Kritik veränderte nun alles. Sie war das „Ge31 Alexej N. Krouglov, Leo Nikolaevič Tolstoj als Leser Kants. Zur Wirkungsgeschichte Kants in Russland, S. 365. Der Aufsatz liefert viele historisch-philologische Information zu Tolstois Kant-Rezeption.
Im Folgenden stütze ich mich auf seine Ergebnisse.
32 In Tolstois Bibliothek befinden sich die gesammelten Werke Kants, die gründlich durchgearbeitet
wurden. Sie zeigen eindeutig, dass Tolstoi mit Kants Philosophie von seinen vorkritischen Schriften bis
zum Nachlass sehr gut vertraut war. S. Александр Ф. Архангельский (Alexander F. Archangelski)
(Hg.), Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание
(Die Bibliothek von Lew Nikolajewitsch Tolstoi in Jasnaja Poljana), S. 553 ff.
33 In vielen seiner Randbemerkungen lobt er Kant. Dennoch gibt es auch solche: „Was für ein
Quatsch“, „Dumm“ (Krouglov, Leo Nikolaevič Tolstoj als Leser Kants, S. 365 f.). U. a. hat Tolstoi Kants
Unterscheidung von Meinen, Wissen und Glauben für „dumm“ befunden. Wir werden sehen, dass ihm
tatsächlich nur noch ein Modus des Fürwahrhaltens sinnvoll vorkam: der des Glaubens.
34 Das ist auch die Meinung Krouglovs (Krouglov, Leo Nikolaevič Tolstoj als Leser Kants, S. 367).
35 Brief an N.N. Strachow vom 16. Oktober 1887 (TGA 64, S. 105 f.).
36 Tolstois Verhältnis zu Schopenhauer erinnert stark an das von Nietzsche. Auch Tolstois philosophische Laufbahn beginnt mit der Begeisterung für Schopenhauer. Er preist ihn als „genialsten unter
den Menschen“ (Brief an A.A. Fet vom 30. August 1869 (TGA 61, S. 219)). Über ihn liest er Kant. Vgl.
234
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
bäude“, alles andere war nur noch ein „Baugerüst“. Die Kritik der reinen Vernunft sei
nur noch als Einleitung für die zweite Kritik bedeutsam. Auf dieser Meinung besteht
Tolstoi bis zum Schluss. Er setzt Kant, aber auch Spinoza, Rousseau und Schopenhauer dem Deutschen Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) scharf entgegen. Letzterer
habe die genuin philosophische Frage vernachlässigt, nämlich die Frage „Was soll ich
tun?“. Sie sei durch ein zielloses „Erforschen“ von dem „was ist“ ersetzt worden, was
eine „Subsumption unter eine im voraus aufgestellte Theorie“ bedeute (TGA 62,
S. 183).37 Nachdem Tolstoi dann Kants Religionsschrift gelesen hatte, steigerte sich
seine Begeisterung noch weiter. Allen russischen Kritikern zum Trotz behauptet er in
seinem Tagebuch:
Kant gilt als abstrakter und weltfremder Philosoph, er ist dennoch ein großer religiöser Lehrer.
(TGA 56, S. 51)
Nicht nur die Philosophie Kants, auch die Persönlichkeit des königsbergischen Philosophen hat Tolstoi zutiefst interessiert.38 In seinem späten Denken wird Kant zum
Vorbild eines Lehrers vom Sinn des Lebens. Und wenn Tolstois Philosophie am Ende
stark von den kantischen Aufgaben abweicht, so glaubte der russische Schriftsteller,
sie sollte es tun, um seiner Grundintention gerade treu zu bleiben.
Die letzten 27 Jahre seines Lebens bringt Tolstoi eine Reihe von philosophischreligiösen Werken hervor, die seine tiefsten persönlichen Erfahrungen bei der Suche
nach dem Sinn des Lebens ausdrücken sollten. Von Meine Beichte bis zum späten
Reich Gottes ist inwendig in euch und Was ist Kunst? entfaltet Tolstoi seine Ideen der
wahren Religion, der guten Kunst und des sinnvollen Lebens. Er sammelt die Gedan-
seine spätere Erwähnung: „Ich habe Kant gelesen und fast nichts verstanden, und habe nur dann
etwas verstanden, als ich angefangen habe, Schopenhauer zu lesen und von neuem zu lesen, für den
ich mich eine Zeit lang begeistert habe.“ (Brief an G.A. Rusanow, 16. Januar 1896 (TGA 69, S. 24))
Dennoch kommt ziemlich schnell die Enttäuschung. Schopenhauer wird der „begabte Schmierfink“
(TGA 64, S. 105) genannt, der Kants Grundgedanken nur noch verdunkelte. Allerdings verschwindet
Schopenhauer nicht völlig aus Tolstois Denken. Das Bild Schopenhauers hängt bis heute in Tolstois
Arbeitszimmer in Jasnaja Poljana.
37 So hat Tolstoi noch 1870 Schopenhauers Bedeutsamkeit darin gesehen, dass er uns über Fichte,
Schelling und Hegel hinaus an die Fragestellungen und philosophischen Verfahren Platons, Descartes,
Spinozas und Kants erinnerte, welche, so Tolstoi, „unabhängige, arbeitsame und weltfremde Denker
gewesen sind“ (TGA 48, S. 126). Zu Hegel und den Hegelianern ist Tolstois Verhältnis immer negativ
geblieben. Auch hier ging Tolstoi bewusst gegen den Zeitgeist. Denn als er Kant so gründlich studierte,
herrschte in Russland eine allgemeine Begeisterung für Hegel und Schelling. Kant und Spinoza waren
dagegen vielmehr in den Hintergrund getreten und wurden als überholt angesehen. Zu Tolstois
Rezeption von Kant, Hegel, Schelling und Fichte s. Robert Quiskamp, Die Beziehungen L.N. Tolstojs zu
den Philosophen des Deutschen Idealismus.
38 Vgl. TGA 64, S. 102. Die Lebensweise Kants hat Tolstoi geradezu fasziniert (vgl. auch den Brief vom
17. März 1904 an L.P. Nikiforow (TGA 75, S. 60)). Eine der Quellen Tolstois war das Buch Kuno Fischers
über Kant (vgl. Krouglov, Leo Nikolaevič Tolstoj als Leser Kants, S. 382 f.).
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
235
ken von Schriftstellern und Philosophen, die er besonders ersprießlich und überzeugend findet und für die tägliche Lektüre einem breiten Kreis seiner Leser (nicht nur
dem gebildetem Publikum, sondern auch den einfachen Bauern und deren Kindern,
für die er ein besonderes Lehrprogramm erarbeitete und eine Schule auf seinem
Landgut in Jasnaja Poljana eröffnete) empfiehlt. So entstand Die Alltagslektüre, die er
später in Für jeden Tag und Der Weg des Lebens systematisierte.39 Auf diese Weise
wurde ein großer Dialog der Denker verschiedener Epochen und Kulturen inszeniert,
die zum „heutigen Zeitpunkt“, hier und jetzt, für Lew Tolstoi präsent und wegweisend
geworden sind.
In der Tat sind seine breiten Kenntnisse der Philosophie, von den griechischen
und chinesischen Denkern bis zu Schopenhauer, Emerson und sogar, wenn auch nur
sehr wenig, Nietzsche, in dieser Sammlung auffallend. Am häufigsten sind Auszüge
aus den Stoikern (Mark Aurel, Seneca, Epiktet), Cicero, den französischen Aufklärern
(Voltaire, Rousseau, Montesquieu), Pascal, John Ruskin, Spinoza, aber auch Zitate der
östlichen Denker wie z. B. Konfuzius anzutreffen. Eine besondere Stellung haben
Schopenhauer und selbstverständlich Kant,40 die beide häufiger als das Evangelium
zitiert bzw. frei wiedergeben werden. In dieser Sammlung der wichtigsten Gedanken
aller Zeiten sind allerdings erstaunlich wenige russischsprachige Autoren zu finden.
Dies kann als indirekte Bestätigung der These betrachtet werden, dass Tolstois religiöse Wende v. a. durch den kritischen Ansatz der kantisch-abendländischen Moral aus
Vernunft ihren Anstoß bekam. Darauf, auf der zur Kritik des eigenen Vermögens
genötigten Vernunft, wollte Tolstoi seine Religion, seine Kunsttheorie und die ganze
Konstruktion seines Denkens aufbauen.
Ein weiterer wichtiger Punkt darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Trotz
seiner konsequenten Einhaltung der philosophischen Fragestellung strebte Tolstoi
niemals ein kohärentes philosophisches System an. Vielmehr bemühte er sich immer
wieder darum, auf dringende Fragen der Moderne für ihn selbst befriedigende Antworten zu finden. Dementsprechend sind innerhalb fast eines Vierteljahrhunderts
gewisse Verschiebungen und sogar Diskrepanzen zwischen seinen früheren und
39 Es ist manchmal äußerst schwer festzustellen, woher die Auszüge in diesen Sammlungen stammen. Nicht nur die Tatsache, dass Tolstoi die Quelle nicht immer angab, sondern dass er oft nur
Gedanken wiedergibt, mit einem allgemeinen Hinweis, wie z. B. „nach Kant“, „nach Schopenhauer“,
tragen zu dieser Schwierigkeit bei. In den Vorreden zu jeder Ausgabe wiederholte Tolstoi, dass es nicht
sein Ziel war, genau zu übersetzen, sondern sich den großen fruchtbaren Gedanken verschiedener
Autoren zu bedienen, die „die besten Gedanken und Gefühle erregen“, und sie möglichst vielen
zugänglich zu machen. Er bat dabei alle zukünftigen Übersetzer, sich nicht um die Quellen zu
bemühen und, „falls jemand sie [die Gedanken – E.P.] in eine andere Sprache übertragen wollte, kein
Original aufzusuchen, sondern aus meinigem zu übersetzen“ (TGA 41, S. 9). Die Abweichungen vom
Original sind in Tolstois freier Wiedergabe der philosophischen Gedanken seiner Vorgänger hoch
interessant. Sie festzustellen wäre eine Aufgabe für sich.
40 Auszüge aus Kants Werken hat Tolstoi noch als Sonderauflage publiziert: Мысли Иммануила
Канта, выбранные Л.Н. Толстым (Die von L.N. Tolstoi ausgewählten Gedanken von Immanuel Kant).
236
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
späteren Gedanken eingetreten. Obwohl Tolstois Entwicklung selbst ein großes Thema ist, dürfen diese Veränderungen als wegweisende Zeugnisse der lebendigen Entwicklung nicht übersehen werden, auch wenn sie im Rahmen dieser Arbeit nicht
ausführlich dargestellt werden können. Der innere Kern, der Ansatz der kritischen
Vernunft, der von den eigenen Nöten gedrängt zur eigenen Version der Moral und
Religion kommt, blieb jedoch unantastbar. Dieser Ansatz wird in seiner Originalität
und in seiner philosophischen Bedeutsamkeit im Folgenden dargestellt.
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird Tolstois Begriff der Vernunft untersucht,
die trotz der deklarierten Einheit und Gleichheit bei allen Menschen am Ende als sehr
beschränkt und perspektivisch-bedingt erscheint. Im zweiten Abschnitt soll Tolstois
Moralphilosophie in ihrer Differenz v. a. zur kantischen Moral aus Vernunft und in
ihrer Annäherung an Nietzsches Gedankengänge, die Tolstoi eventuell dem Einfluss
Schopenhauers und Spinozas verdankte, dargestellt werden. Im dritten und letzten
Abschnitt wird dann, wie auch im vorigen Kapitel, die Moralphilosophie in den
Zusammenhang mit der Philosophie der Kunst gestellt und Tolstois Idee der „guten
Kunst“ als die eines großen Künstlers und die eines seinen Weg in der Philosophie
suchenden Denkers dargelegt. Die Plausibilitäten von Tolstois Denken sollen auf
diese Weise ans Licht kommen.
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
Der Sinn des Lebens
Der Ausgangspunkt der Überlegung und Anschlusspunkt aller Gedankengänge ist für
Tolstoi die Sinnlosigkeit des Lebens. So steht in Meine Beichte:
Dieses Leben ist nichts als ein dummer, böser Spaß, den sich jemand mit mir erlaubt hat.
Obgleich ich einen ‚Jemanden‘, der mich erschaffen hätte, nicht anerkannte, war doch diese Form
der Vorstellung, daß jemand sich mit mir einen bösen und dummen Spaß gemacht hätte, als er
mich in die Welt setzte, mir die allernatürlichste Form der Vorstellung.41
Die mehrmals gestellten Fragen „Wozu?“, „Was wird daraus kommen?“ und „Was
kommt danach?“ haben alle Zwecke (die Vermehrung des Besitzes, die Karriere, das
literarische Schaffen, das Wohl der Familie, die Zukunft der Kinder) in Unsinn verwandelt. Am Ende steht der Tod, die Vernichtung, das Nichts. Keines der menschlichen Ziele kann angesichts des Todes sinnvoll erhalten werden. „Alles ist eitel, alles
ist nichtig. Der Mensch stirbt dahin und es bleibt nichts von ihm übrig; und das ist
dumm.“ Dies ist der Schluss Salomons, auch der Buddhas, Sokrates’ und Schopenhauers:
41 Leo N. Tolstoi, Meine Beichte, S. 40.
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
237
Alles ist eitel. Glücklich, wer nicht geboren ist. Der Tod ist besser als das Leben; man muß sich
von diesem befreien.42
Diese einfache und konsequente Schlussfolgerung wird bei Tolstoi mit aller schriftstellerischen Kraft und Überzeugung dargestellt. Die Beschreibung, wie es zu dieser
Revolte, zu diesem „Stillstand des Lebens“43 gekommen ist, wird u. a. in einer der
besten und berühmtesten späten Erzählungen, Der Tod von Iwan Iljitsch, als Beschreibung einer physischen Krankheit geschildert. In Meine Beichte wird dieser Prozess
metaphorisch als tödliche Krankheit der Seele dargestellt:
Es ging mir, wie es jedem ergeht, der an einem inneren Leiden erkrankt. Erst erscheinen geringfügige Anzeichen einer Unpäßlichkeit, denen der Kranke keine Aufmerksamkeit schenkt, dann
wiederholen sich diese Anzeichen immer häufiger und häufiger und fließen zu einem zeitlich
unteilbaren Leiden zusammen. Das Leiden wächst, und der Kranke hat kaum Zeit, sich zu
besinnen, da erkennt er schon, daß das, was er für eine Unpäßlichkeit gehalten hat, das ist, was
ihm das Bedeutungsvollste in der Welt ist – der Tod.44
Die „Unpässlichkeit“ resultierte aus der Frage nach dem „Wozu?“, die zum Abscheu
gegen das Leben führte und zum Widerstand aufrief. Das Leben sei ein böser Spaß. Es
liege jedoch in unserer Macht, diesen zu beenden.
Der Gedanke an Selbstmord kam mir ebenso natürlich, wie mir früher die Gedanken an die
Verbesserung meines Lebens gekommen waren.45
Das Leben vollzieht sich so als Dasein angesichts des Todes,46 es ist „ein immer
aufgeschobener Tod“.47 Als solches kann es in sich keinen Sinn tragen. Wenn seine
Sinnlosigkeit jedoch eingesehen wird, kann es nicht weitergeführt werden. „Glücklich, wer nicht geboren ist“. Das ist das Beste für den Menschen, „das Zweitbeste“ ist
„bald zu sterben“. Diese Weisheit des Waldgottes aus einem der ersten Kapitel der
Geburt der Tragödie (GT 3, KSA 1, S. 35) war Tolstoi wahrscheinlich unbekannt. Und
42 Leo N. Tolstoi, Meine Beichte, S. 69.
43 Leo N. Tolstoi, Meine Beichte, S. 34.
44 Leo N. Tolstoi, Meine Beichte, S. 35.
45 Leo N. Tolstoi, Meine Beichte, S. 39.
46 Ein den Rahmen dieser Arbeit weit überschreitender Vergleich von Tolstois und Heideggers Philosophie könnte ein Schlüssel zur enormen Popularität Heideggers in Russland sein. In Sein und Zeit
erwähnt Heidegger Tolstois Erzählung Der Tod von Iwan Iljitsch gerade im Kontext seiner Deutung des
Daseins als „Dasein zum Tod“ (Martin Heidegger, Sein und Zeit, S. 337). Zum Unterschied zwischen
Tolstoi und Heidegger s. z. B. Jens Kulenkampff, Der Tod des Iwan Iljitsch. Sterblichkeit und Ethik bei
Heidegger und Tolstoi; Татьяна Щитцова (Tatjana Schitzowa), „Слово о радости“: антиномичность
хайдеггеровской трактовки бытия к смерти („Ein Wort über Freude”: zur Antinomie von der
Heideggerschen Deutung des Daseins zum Tode).
47 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1, S. 427.
238
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
doch stimmte er in diesem Punkt mit der vom jungen Nietzsche hervorgehobenen
antiken Weisheit völlig überein. Sie ist der Abgrund des ‚heiteren‘ Volks von Athen,
aber auch die Einsicht Salomons gewesen. Auf die Frage des Lebens geben die
weisesten Menschen eine Antwort, die das Leben unmöglich und unerträglich macht.
Das Leben sei nichts Wert. Allein die tierischen Triebe zwingen uns dazu, die Sinnlosigkeit des Lebens einige Zeit zu ertragen und uns täuschen zu lassen. Die Täuschung muss jedoch eines Tages zu einem Ende kommen, und zwar wenn man seine
Lebensbemühungen nach ihrem Sinn und Ziel befragt.
Die törichte Jagd nach Vergnügungen findet so in der Frage nach dem Endzweck
dieser Jagd ihren Halt. Wie ein Mensch, der von einem Ungeheuer zum Abgrund
gedrängt wird und, sich an einem dünnen Zweig festhaltend, über ihm hängt, merkt
man jedoch, dass der Zweig unaufhaltsam und unerlässlich von zwei Mäusen, einer
schwarzen und einer weißen, zernagt wird. Die beiden Mäuse – Tag und Nacht –
bringen ihn einem Drachen, der in der Tiefe auf ihn wartet, dem Tod, immer näher.
Daneben tröpfelt süßer Honig herab, und der zum Tode Verurteilte sehnt sich danach,
diese süßen Tropfen zu kosten, um den Drachen und die Mäuse zu vergessen. So sieht
Tolstois Bild vom Genuss des Lebens aus.48 Der süße Honig, dessen letzte Tropfen den
Narren den Tod vergessen lassen, ist alles, was das Leben zu bieten hat. Dieser Sinn
ist die Verhöhnung des Herzens und der Vernunft des Menschen.
Die Natur der Vernunft
Durch die Frage nach dem Sinn wird die tiefste Not verursacht, die das Leben
unerträglich macht. Unter der Bedingung der Sinnlosigkeit des Begehrens und des
Leidens (des Strebens, das Leiden zu vermeiden, eingeschlossen) ist das Leben für
den Menschen nicht möglich. Vor allem nicht, wie Tolstoi hinzufügt, „für einen
vernünftigen Menschen“, d. h. für einen solchen, für den „die Vernunft zu seiner
Natur gehört“ (TGA 35, S. 159). Das sind alle Menschen, soweit sie dem Rausch des
Genusses und den tierischen Vergnügungen entkommen und sich die Frage einmal
selbst vor Augen führen, denn nach den Zielen eigener Bemühungen zu fragen (sei es
die Bemühung ums eigene Überleben oder um das Wohl der Menschheit), ist Tolstoi
zufolge das Menschliche schlechthin.
Der Verdacht, dass es sich um einen normativen Begriff der Vernunft handelt,
wäre hier genauso unberechtigt, wie er in Bezug auf Kants kritische Vernunft unberechtigt ist. Zwar gibt Tolstoi mehr Anlass dazu, z. B. in seinem Werk Was ist die
Religion und worin besteht ihr Wesen?, in dem es zu Beginn u. a. um eine Entgegensetzung von Tieren und Menschen als Instinkt- und Vernunftwesen geht (TGA 35,
48 Tolstoi, Meine Beichte, S. 42 f. Seine eigenen süßen „Tropfen“ waren, so Tolstoi, seine Liebe zur
Familie und seine Schriftstellerkunst.
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
239
S. 160 f.). Doch gerade die Vernunft sage dem Menschen, er sei bloß ein Tier unter
Tieren (TGA 35, S. 161). Die Vernunft wird somit als identisch mit der Einbildungskraft
gedeutet, die für Unruhe bei einem nach dem eigenen Glück strebenden Wesen sorgt.49
Der Unterschied zwischen der Vernunft und dem Instinkt bleibt insofern quantitativ:
Die Tiere handeln, um ihre unmittelbaren, jetzigen Bedürfnisse zu befriedigen; der
Mensch weiß dagegen, dass die Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnissen mittelbare Folgen haben kann, die die Befriedigung der anderen Bedürfnisse verhindern und
für ihn gar schädlich sein können. Deswegen sei seine Vernunft nichts anderes als das
Fragen selbst – das Fragen nach dem Kriterium des Handelns, das zu seinem Wohl
führen soll. Der Mensch wünscht sich das Gute, doch weiß er nicht, worin es besteht.
Dies ist die eigentliche Tat der Vernunft: eine Verlegenheit zu verursachen, welche aus
der Suche nach einem Kriterium für das bessere Handeln entsteht. Das Kriterium muss
allerdings für immer unsicher bleiben, es sei denn, es könnte aus dem Ganzen des
Lebens hergeleitet werden, d. h. aus dem Verhältnis des Endlichen des einzelnen
Lebens zu der „in Raum und Zeit unendlichen Welt“ (TGA 35, S. 161).
Bis jetzt hatten wir mit Gedanken zu tun, die wir aus Kants Moralphilosophie gut
kennen. Die Unlösbarkeit der Aufgabe, eigene Glückseligkeit aus der „Totalität einer in
der That unendlichen Reihe von Folgen“ (GMS, AA 4, S. 419) zu bewirken, machte nach
Kant das Prinzip der Klugheit für die Vernunft untauglich und nötigte sie zur Suche
nach einem anderen Prinzip, das uneingeschränkt gut ist. Dies war einer der wichtigsten Wendepunkte der Kritik: Das Gute wird nicht vorher definiert, um an ihm die
Handlungen zu messen, es wird dagegen aus dem Begriff der praktischen Vernunft
gewonnen. Am Anfang steht die Frage nach dem Prinzip des spezifisch-menschlichen
bzw. vernünftigen Handelns: Wenn ein solches Prinzip denkbar sein soll, so ist es
allein auf den Begriff des Willens zu gründen, der als vernünftiger Wille, als Wille eines
vernünftigen Wesens zu denken ist. Es stellte sich bei Kant weiter heraus, dass allein
ein guter Wille als ohne Einschränkungen gut bzw. vernünftig angesehen werden
kann, d. h. der Wille, der dem allgemeinen Gesetz als seinem obersten Prinzip folgt.
Nur so wird er selbstbestimmend, nur so wird er vernünftig. Wenn eine Selbstbestimmung für ihn nicht möglich wäre, so wäre jede Frage nach dem Zweck einer Handlung
dagegen nur bedingt zu beantworten, d. h. jeder Zweck wäre relativ gegenüber etwas
anderem, jede Handlung wäre im Grunde sinnlos. Wenn Tolstoi auch manchmal verwirrende Formulierungen verwendet, um das Prinzip des menschlichen Handelns zu
fassen, folgt er im Ganzen ziemlich genau der Argumentation Kants – in Allem bis auf
den Schluss, der nicht mehr im Sinne Kants zu verstehen ist: Das Vernunftprinzip sei
ohne den Bezug des Endlichen auf das Unendliche selbst ohne Sinn.50
49 Vgl. bei Kant: Die „Glückseligkeit“ sei „nicht ein Ideal der Vernunft“, „sondern der Einbildungskraft“ (GMS, AA 4, S. 418).
50 Schon hier sind allerdings über Kant hinaus nicht nur mehrere Annäherungen an Spinoza, den
Tolstoi sehr hoch schätzte, sondern auch an Hegel, den er relativ schlecht kannte und gegen den er
massive Vorurteile hatte (vgl. z. B. Tolstoi, Meine Beichte, S. 27) festzustellen.
240
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Was für ein Bezug kann das jedoch sein, wenn das Leben angesichts der unvermeidlichen Vernichtung des Einzelnen keinen Sinn hat? Je weiter der Mensch nach
den Folgen seiner Tätigkeit fragt, desto näher kommt er der Sinnlosigkeit, der Vergeblichkeit seines Strebens nach dem fortdauernden Genuss des Lebens, dem Tod.
Die Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse wird so selbst zur Tor- und Blindheit.
Aus der Perspektive der Sinnlosigkeit verlieren sogar tierische Gelüste für den Menschen ihren Geschmack. Sie sind nicht verwerflich, sie sind bloß wertlos, wie das gute
Essen für einen zum Tode Verurteilten. Der Mensch ist somit gegenüber den Tieren
benachteiligt. Er erkrankt an seiner überentwickelten Einbildungskraft, er ist (die
Übereinstimmung mit Nietzsche ist an dieser Stelle auffallend) ein krankhaftes Tier.
Was für ein Ausweg bleibt so einem Tier überhaupt? Tolstoi gibt auf diese Frage nicht
nur keine beruhigende Antwort, sondern er zeigt, dass jeder Versuch, eine solche
Antwort zu geben, zum Scheitern verurteilt ist, weil alle möglichen Zwecksetzungen,
z. B. Kinder, Fortschritt, Frieden, das Wohl der Menschheit, immer aus den Bedingungen des Lebens herausgenommen und von der Not des Einzelnen abstrahiert werden.
Auch die Autonomie des eigenen Willens kann keine befriedigende Antwort sein. Das
kantische „Wenn“ („Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als praktische
allgemeine Gesetze denken soll […]“ (KpV, AA 5, S. 27, meine Hervorhebung – E.P.))
ist nun bei Tolstoi definitiv im Sinne eines Bezweifelns zu verstehen. Höchstwahrscheinlich gibt es kein Prinzip der Prinzipien. Und auch wenn es eins gäbe, so wäre es
keine Befriedigung der Not des Einzelnen, der verstehen will, wonach er, er allein, in
einer konkreten Lebenssituation streben soll, warum er überhaupt leben soll, wenn
ihn am Ende die Vernichtung all seines Tuns erwartet. Statt dieses Prinzip im autonomen Willen zu suchen, dessen Begriff, wie wir weiter sehen werden, für Tolstoi
höchst problematisch geworden ist, will er die nach dem Sinn des Lebens fragende
Vernunft selbst in Frage stellen. Was bedeutet die Vernunft als Antrieb, das Leben
nach seinem Sinn zu hinterfragen? Ist sie nicht gerade das Raubtier aus Tolstois
Gleichnis, das den Wanderer in den Abgrund treibt?
Tatsächlich ist schon der Begriff der Vernunft paradox, wenn sie sich nicht als
von der Sinnlichkeit unabhängige Instanz, sondern als bloßes Fragen nach dem
Besseren versteht. Durch ihre Fragerei versagt sich die Vernunft einerseits das unvernünftig-tierische Streben, um jeden Preis zu leben. Sie versagt sich jeden Lebensgenuss. Andererseits scheitert sie jedoch selbst an diesem Fragen. Das Leben hört bei
den Menschen auf, wenn die Vernunft ins Spiel kommt, und dies deshalb, weil sie
scheitert. Sie scheitert aber eben da, wo das Leben bzw. die Befriedigung der Bedürfnisse beginnt. Die Vernunft kehrt sich gegen das Leben (der Wunsch des Selbstmordes), weil das Leben die Vernunft verneint (der Tod). Das Leben ist unmöglich
ohne Sinn, aber gerade das Verlangen nach Sinn macht es unerträglich. So schreibt
Tolstoi in der späten Schrift Mein Leben:
Die Vernunft, diese höchste Fähigkeit des Menschen, die für sein Leben unentbehrlich ist,
die ihm, dem nackten, hilflosen Menschen, inmitten der ihn vernichtenden Naturkräfte, die
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
241
Mittel zur Existenz und die Mittel zum Genuß gibt, eben diese Fähigkeit vergiftet sein Leben.51
Es ist bemerkenswert, dass Tolstoi sich wohl bewusst ist, dass viele Menschen ohne
diesen Sinn auskommen können, ohne sich zu töten oder zu verzweifeln. Als Schriftsteller hat er ihr Leben selbst mehrmals in aller Üppigkeit geschildert. Um seine
Metapher aufzunehmen, viele genießen den Honig, solange die Mäuse ihre Arbeit
noch nicht vollendet haben. Das sind, so Tolstois Erklärung in Meine Beichte,
meistens junge Frauen oder Menschen, die mit einer besonderen „Stumpfheit der
Phantasie“ gekennzeichnet sind.52 Später wird Tolstoi in diesem Stumpfsinn keine
Dummheit, sondern einen cleveren Selbstbetrug erkennen, der zum Fundament der
Verlogenheit und der Grausamkeit der modernen Gesellschaft geworden ist. Zu diesem (un‑)bewussten Selbstbetrug müssen wir noch mehrmals zurückkehren. Doch es
ist eine Konstante in Tolstois Denken geblieben, dass der vorübergehende und unsichere Genuss des Lebens keine Vernunftbedingungen erfüllt und insofern nicht als
Grund des menschlichen Lebens gelten kann. Die Plausibilität dieses Ausgangspunkts wird allerdings nur aus der persönlichen Erfahrung bestätigt53 und ist in
Tolstois Werken, von Krieg und Frieden bis zur Erzählung Drei Tode, mit der ganzen
künstlerischen Kraft als Erfahrung handelnder Personen angesichts des Todes dargestellt. So bestätigen letztendlich nur einzelne Erfahrungen, d. h. die von Tolstoi und
die seiner erdachten literarischen Figuren, dass es die Natur der menschlichen Vernunft ist, nach dem Sinn des Lebens zu suchen.54 Wenn das Vermögen zur Vernunft
vorhanden ist, kann das Nachfragen weder unterlassen noch beliebig abgebrochen
werden. Jedoch ist dieses Vermögen unmittelbar von der Produktivität der Einbildungskraft abhängig, die die Folgen und Folgen der Folgen schildert, und kann durch
deren „Stumpfheit“ wiederum verstummen. Ihre Produktivität, wie das Vernunftvermögen selbst, ist kein Segen, keine Anlage zum Guten. Sie ist eher als Fluch zu
verstehen. Denn am Versuch, eine Einheit zwischen den unendlichen Optionen seines
Handelns herzustellen, muss der Mensch scheitern, und dies gerade als vernünftiges
Wesen. Das ist seine Not, die Not des einzelnen Menschen, die durch die Natur seiner
Vernunft verursacht wird.
Die Vernunft wird demnach von Anfang an von Tolstoi perspektivisch gedeutet.
„Wenn es keine höhere Vernunft gibt (und es gibt keine und sie kann durch nichts
bewiesen werden)“, so bleibt es bloß bei der eigenen Vernunft, die „für mich der
51 Leo N. Tolstoi, Das Leben, S. 72.
52 Tolstoi, Meine Beichte, S. 72.
53 „[…] [D]iesen Menschen konnte ich es nicht nachtun. Da ich nicht die Stumpfheit ihrer Phantasie
besaß, konnte ich sie nicht künstlich in mir hervorrufen.“ (Tolstoi, Meine Beichte, S. 72.)
54 Dabei wird nicht behauptet, dass die Vernunft tatsächlich in der Lage ist, die Folgen der Handlung
zu berechnen bzw. ihre Zwecke zu verfolgen. Sie ist nur eine Nötigung, nach den Zwecken und Folgen
zu fragen.
242
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Schöpfer des Lebens“ sein soll.55 Die erste Behauptung wird mit dem Hinweis auf
Kant bestätigt: „[…] Kant hat mir bewiesen, und ich [habe] vollkommen begriffen […],
daß man es nicht beweisen könne“.56 Es wird jedoch nicht die Ungewissheit allein
(denn ungewiss heißt nicht widerlegt), sondern auch die Untauglichkeit des GottesGedanken für die Vernunft des Einzelnen betont: Eine für mein Leben äußere, eine
meine Vernunft übersteigende Perspektive, die höchste Vernunft, wäre für mich, wenn
es sie gäbe, genauso gut wie die Unvernunft, weil ich sie mit meiner Vernunft nicht
verstehen könnte. Und was ich nicht verstehen kann, das kann ich auch nicht
wissen,57 das geht mich also nichts an oder es ist, wie Tolstoi sich über die Dreifaltigkeitsdogmen äußert, „zu nichts nütze“.58 Nur meine Vernunft könnte mir die Möglichkeit des Lebens wieder eröffnen. Die Frage, die in der Natur der Vernunft liegt – „Was
ist der Endzweck meines Lebens?“ –, muss aus der Vernunft und mit ihren Mitteln
beantwortet werden, d. h. es muss ein Endzweck des Lebens gefunden werden, der
befriedigend für meine Vernunft, d. h. der für mich vernünftig wäre. Die Antwort auf
die Frage des Lebens kann dementsprechend nicht unverständlich (irrational) ausfallen. Der religiös-mystische Trost des Jenseits ist damit von vornherein als untauglich zurückgewiesen und wird zuerst sogar außer Acht gelassen.
Es ist die Wissenschaft, die vernünftige Antworten gibt, deswegen wendet Tolstoi
sich zuerst dieser zu. Aber die verschiedenen Wissenschaften stehen nicht im gleichen
Verhältnis zur Frage des Lebens. Die Naturwissenschaften ignorieren sie einfach. Sie
postulieren den unendlichen Raum in der unendlichen Zeit, in der „sich [alles]
entwickelt und vervollkommnet […], kompliziert und differenziert“. Diese Antwort der
positivistisch geprägten Wissenschaften verwirft Tolstoi aus einem einfachen Grund:
Es sind Worte ohne Bedeutung, denn im Unendlichen gibt es weder Kompliziertes noch Einfaches, weder ein Vorn noch ein Hinten, weder ein Gut oder Schlecht.59
Eine Antwort auf die Frage des Lebens sei hier nicht zu finden, weil die Frage verkannt
wird. Die kausalen Beziehungen der materiellen Welt, auch wenn es die Eigenschaft
dieser Materie wäre (Tolstoi weiß sehr wohl, dass eine solche Annahme weit hinter
der Philosophie Humes und Kants zurückbleibt), können nichts über Zwecke und
Endzwecke dieser Entwicklung vermitteln. Ähnlich sei es in den „Halbwissenschaften“, zu denen Tolstoi Geschichte, Psychologie und alle Sozialwissenschaften zählt.
Diese seien in ihren Schlussfolgerungen gar unredlich. Ohne die Frage des Lebens zu
beantworten, meinen sie, die Entwicklung der Menschheit und ihre Zwecke beschrei-
55 Tolstoi, Meine Beichte, S. 75.
56 Tolstoi, Meine Beichte, S. 108.
57 Vgl. „Man kann nicht an etwas glauben, was unverständlich ist, und die Kenntnis über das
Unverständliche ist mit der Unkenntnis identisch.“ (TGA 24, S. 17)
58 Leo N. Tolstoj, Kritik der dogmatischen Theologie, Bd. 1, S. 145.
59 Tolstoi, Meine Beichte, S. 51.
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
243
ben zu können und reden sogar von Fortschritt (oder Rückschritt) dieses rätselhaften
Ganzen, das aus allen Menschen aller Zeiten besteht. Die Unredlichkeit ihrer Art der
Schlussfolgerung bestehe nicht nur darin, dass sie von den partikularen Beobachtungen auf das Ganze schließen, sondern auch in der törichten Voraussetzung, dass, um
sein eigenes Leben zu begreifen, der Einzelne zuerst „diese ganze geheimnisvolle
Menschheit“ begreifen muss, „die aus ebensolchen Menschen besteht wie er, die sich
selbst nicht begreifen.“60 Eine solche Wissenschaft ignoriert eben die Frage des
Einzelnen. Sie tut dabei das, was von Tolstoi in einer weiteren religiös-philosophischen Schrift, Was ist mein Glaube?, als Unredlichkeit des „durchschnittlichen Menschen“ gedeutet wird, der auf die Frage nach dem Sinn seines Lebens gar keine
Antwort habe und deshalb „an der Stelle der persönlichen Frage […] eine allgemeine“
stelle, sei es die des wirtschaftlichen Wohlstandes des eigenen Landes oder die der
„Glückseligkeit“ der ganzen Menschheit.61 An dieser Stelle kommt einer der wichtigsten Ausgangspunkte von Tolstois radikal persönlicher Fragestellung deutlich zum
Ausdruck: Alle Ideale, auch die des friedlichen Zusammenlebens als Endzweck der
historischen Entwicklung der Menschheit, können die von persönlicher Not getriebene Vernunft weder befriedigen noch trösten. Denn durch diese wird der Einzelne zu
einem bloßen Mittel herabgewürdigt, zu einem Mittel für die Zwecke, die für ihn selbst
nicht brauchbar sein können.
Die Naturwissenschaften können also keine Antwort auf die Frage des Lebens
bieten. Sie erforschen bloß die materielle Welt und brauchen dafür nur die kausalen
Grund-Zweck-Verhältnisse festzustellen. Stellen sie aber die Frage nach dem Endzweck, wird alles absurd. Die Sozialwissenschaften stellen dagegen die Frage nach
dem Endzweck, müssen sie jedoch zugleich von der Frage nach dem Sinn des
einzelnen Lebens trennen und werden somit ebenfalls absurd. Während die Naturwissenschaften in Fragen der Vernunft inkompetent sind, seien die Sozialwissenschaften, die die endlichen und unendlichen Zwecke verwechseln, sogar nur Pseudowissenschaften. Schon in Krieg und Frieden zeigte sich dieser Gedanke in Tolstois
Verspottung der Historiker der Napoleonischen Kriege, die Napoleons launische Entscheidungen für den Grund der Bewegung von Millionen von Menschen hielten und
den historischen Ereignissen, jeweils nach eigenen Vorstellungen, Zweckmäßigkeit
unterstellten.62
Dennoch gibt es eine Wissenschaft, die die Frage nach dem Endzweck sinnvoll
aufrechterhalten kann. Das ist die Philosophie. Nur die Philosophie, so Tolstoi,
erkennt die Frage als berechtigt an und ist im Stande, das Leben des Einzelnen zu
betrachten, ohne die Frage nach dem Endzweck aus der Sicht zu verlieren. Sie stellt
die Frage richtig und beantwortet sie sogar klar und deutlich: „Was wird Sinnvolles
60 Tolstoi, Meine Beichte, S. 54.
61 Leo N. Tolstoi, Mein Glaube, S. 297.
62 Tolstois Verwerfung der „Pseudo-“ bzw. „Halbwissenschaften“ wird für uns im nächsten Abschnitt
wichtig, in dem seine Idee der Willensfreiheit interpretiert werden soll.
244
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
aus meinem Leben?“ – „Nichts.“; „Wieso soll ich dann leben?“ – „Ich weiß es nicht.“
Das seien gerade die einzig möglichen redlichen Antworten vonseiten der Wissenschaft. Mit dem Hinweis auf Sokrates, Kant und Schopenhauer wird dieser Schluss der
Philosophie bei Tolstoi bestätigt. Auch in „ihrer ethischen Abteilung“, so Tolstoi,
beantwortet sie die Frage nicht sinnvoller:
Der geniale Kant nennt ganz naiv die sittlichen Erscheinungen kategorischer Imperativ; aber als
strenger Denker sagt er nicht ein Wort darüber, was dabei herauskomme und wozu so zu handeln
sei. Schopenhauer erklärt diese Erscheinungen durch das Mitleid, aber gerade das, was allein ich
zu wissen brauche, kann er mir nicht sagen, was nämlich für mich dabei herauskommt […].63
Es gibt also keinen Sinn, der über die vergebliche Suche nach dem Sinn hinausgeht.
Die Antwort, die Tolstoi die Antwort Salomons und Schopenhauers, aber auch die
Antwort der „Kritik der Vernunft“ nennt,64 ist wenigstens klar und konsequent. Die
einzige Antwort der Vernunft auf die Frage, die ihr durch ihre Natur auferlegt ist, ist
die Verleugnung des Lebens.
Vernunftglaube aus dem Lebenstrieb
Die Vernunft kann sich aber mit dieser Verleugnung des Lebens nicht zufriedengeben,
weil es die Verleugnung ihrer selbst wäre.
Die Vernunft hatte ihre Arbeit getan; aber es hatte auch noch anderes gearbeitet, das ich nicht
anders nennen kann als den Lebenstrieb.65
Deswegen ist der Fehler oder, um den Ausdruck aus Anna Karenina zu verwenden, die
„Dummheit der Vernunft“, die „Mogelei der Vernunft“ sichtbar geworden.66 Die philosophische Überlegung gebe eigentlich keine Antwort auf die Frage des Lebens, ihre
Antwort sei bloß tautologisch: „Das Leben, das der Vernunft keinen Sinn darbietet, ist
sinnlos“ oder „das Endliche ist endlich“, d. h. „Nichts ist Nichts“ oder „0=0“. Die
Antwort hätte nicht anders ausfallen können, weil wir nach dem Bezug des Endlichen
(Einzelleben) zur Endlichkeit (Wohl des Einzelnen) gefragt haben. Wir sahen uns bloß
mit einer mathematischen Gleichung konfrontiert, die immer A=A sein wird. Damit
die Antwort nicht tautologisch ausfällt, muss das Leben des Einzelnen in Bezug auf
die Unendlichkeit hinterfragt werden. Die Notwendigkeit eines solchen Bezugs er-
63 Tolstoi, Meine Beichte, S. 57. Dies sind die Vorbereitungsnotizen zu Meine Beichte, im veröffentlichen Text fehlt diese Passage.
64 Tolstoi, Meine Beichte, S. 91.
65 Tolstoi, Meine Beichte, S. 79.
66 Dies ist eine genauere Übersetzung für „плутовство ума“ (TGA 19, S. 379) als „Büberei“ oder
„Bubenstück“ (Leo Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 576).
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
245
kennt die Philosophie zwar an, weil er das eigentliche Verlangen der Vernunft ist. Sie
kann darauf aber nur mit „Ich weiß es nicht“ antworten.
An dieser Stelle bezieht sich Tolstoi wieder auf Kant, um seinen Gedanken eine
neue Richtung zu geben.
Die Ursache, sagte ich mir, ist nicht eine Kategorie des Denkens wie Raum und Zeit. Wenn ich
bin, so hat das eine Ursache und eine Ursache aller Ursachen.67
Diese Überlegung scheint gerade in Bezug auf Kant philosophisch naiv zu sein.
Riskieren wir aber die Vermutung, dass das, was Tolstoi hier meinte, vielleicht von
ihm nicht sehr genau ausgedrückt wurde, jedoch im Sinne Kants ganz konsequent
verstanden werden kann. Es geht an dieser Stelle vielleicht nicht so sehr um die
kausalen Beziehungen (dies sei Sache der Naturwissenschaften), sondern um die
causa finalis, um den Begriff des Zwecks, der sich tatsächlich von den Kategorien des
Verstandes und den Formen der Anschauung grundsätzlich unterscheiden lässt. Die
Zweckmäßigkeit der Welt ist natürlich nur eine Idee der Vernunft, aber eine unerlässliche, ohne die überhaupt keine Tätigkeit, d. h. weder Erkennen noch Handeln möglich
wäre. Insofern ist der Zweckbegriff für Kant keine Kategorie des Verstandes, sondern
er ist der Leitfaden der Urteilskraft – die unerlässliche Voraussetzung in den theoretischen, moralischen und ästhetischen Urteilen, d. h. in Wissenschaft, Moral und Kunst.
Mit anderen Worten: Ohne die Voraussetzung der Zweckmäßigkeit ist kein Denken,
keine menschliche Tätigkeit, kein Leben möglich. Den Endzweck alles menschlichen
Handelns bzw. das Reich der Zwecke als praktischen Glauben anzunehmen, ist, wenn
auch nur in praktischer Absicht, der Vernunft geboten. Eben dieser Endzweck könnte
von Tolstoi mit dieser „Ursache“ gemeint sein. Doch der Begriff der Ursache führt ihn
zu einer anderen, ihn selbst verwirrenden Idee eines Urhebers der Welt.
Und diese Ursache aller Dinge ist das, was man Gott nennt. Bei diesem Gedanken machte ich Halt
und bemühte mich, mit meinem ganzen Wesen der Existenz dieser Ursache bewußt zu werden.
Und sobald mir bewußt wurde, daß es eine Kraft gebe, in deren Macht ich mich befinde, fühlte
ich gleich die Möglichkeit zu leben.68
Diese „Ursache aller Ursachen“ in einen metaphysischen Trost umzudeuten, erweist
sich, wie zu erwarten war, für Tolstoi dennoch als unmöglich:
Aber niemand erbarmte sich meiner, und ich fühlte, daß mein Leben stillstand.69
Es ist nicht bloß die Unfähigkeit zu glauben. Ein Gott wäre, wie schon gesagt, eine
fremde Vernunft, die der eigenen nichts geben kann. Man würde einem solchen Gott
67 Tolstoi, Meine Beichte, S. 108.
68 Tolstoi, Meine Beichte, S. 108 f.
69 Tolstoi, Meine Beichte, S. 109.
246
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
schlicht vertrauen und somit die Unsicherheit verdoppeln. Diese doppelte Unsicherheit droht aber, so Tolstoi, den Fragenden wieder allein in einer grauen Welt zurückzulassen, noch einsamer und unglücklicher als je zuvor. Dennoch wird die Vernunft
gerade durch ihre Unzufriedenheit zu einem weiteren kritischen Schritt befähigt. Sie
wird zum Beobachter der eigenen Zustände und Grenzen.
Da aber prüfte ich mich selbst, prüfte, was in mir vorging und rief mir all die Hunderte Fälle des
Hinsterbens und Auflebens in meiner Brust ins Gedächtnis zurück, daß ich nur dann lebte, wenn
ich an Gott glaubte. Wie früher war es auch jetzt: Ich brauchte nur Gott zu denken, und ich lebte
auf; ich brauchte ihn nur zu vergessen, nicht an ihn zu glauben, und das Leben schwand. Was ist
nun dieser Zustand der Wiederkehr des Lebens und des Hinsterbens? Ich lebe ja nicht, wenn ich
den Glauben an das Dasein Gottes verliere; ich hätte ja längst meinem Leben ein Ende gemacht,
wenn ich nicht die dunkle Hoffnung hätte, ihn zu finden. Ich lebe doch, wirklich lebe ich doch
nur dann, wenn ich ihn fühle und ihn suche. Warum also suche ich noch? rief eine Stimme in
meinem Innern. Er ist also. Er ist das, ohne das man nicht leben kann. Um Gott wissen und leben
ist ein und dasselbe. Gott ist das Leben.
Lebe, indem du Gott suchst, dann gibt es kein Leben ohne Gott. Und stärker denn je wurde
alles licht in mir und um mich her, und dieses Licht verließ mich nicht mehr. So wurde ich vom
Selbstmord gerettet.70
Denselben Gedanken hat Tolstoi früher in Anna Karenina folgenderweise ausgedrückt:
Ich habe nichts Neues entdeckt. Mir ist nur zum Bewußtsein gekommen, was ich weiß. Ich habe
erkannt, welche Macht mir nicht nur in der Vergangenheit das Leben gegeben hat, sondern mich
auch jetzt am Leben erhält. Ich habe mich von einer Täuschung befreit, habe jetzt den Urheber
erkannt.71
Diese Auszüge sind für Tolstois Philosophie zentral. Auf den ersten Blick wirken sie
jedoch befremdlich und haben viel Erstaunen und sogar Spott hervorgerufen: Das ist
der Sinn des Lebens? Das ist der Beweis Gottes? Das ist der Glaube? Versuchen wir
aber Tolstois Antwort genauer zu verstehen.
„Wenig zwar – aber sicher“, antwortete Tolstoi auf solche Einwände.72 Er hat
immer an dieser Lösung der Frage des Lebens, an seiner Erlösung aus der Bedrängnis
der Vernunft festgehalten. Doch was für eine Lösung ist das? Man kann nicht übersehen, dass dies keine richtige Antwort auf die gestellte Frage ist: Sie bietet keinen
konkreten Endzweck, sie offenbart keinen Sinn des Lebens, der vorher verdeckt blieb.
Im Gegenteil: das Verlangen nach dem metaphysischen Glauben dieser Art wird
radikal zurückgewiesen. Aber es wird ein wichtiger Schritt zur Befriedigung der
grundlegenden Not der Vernunft gemacht. Gerade um dieser Not willen müssen die
70 Tolstoi, Meine Beichte, S. 111 f.
71 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 574.
72 „Dies ist aber so wenig im Vergleich mit jenem erhabenen religiösen Glauben an ein zukünftiges
Leben! Wenig zwar – aber sicher“ (Tolstoi, Mein Glaube, S. 207).
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
247
metaphysische Neugier und die Lust an Mythen, welche die Vernunft in den Rausch
der verschiedenen Weltreligionen versetzen, geopfert werden. Der „Lebenstrieb“
selbst muss als einzige Plausibilität der sich selbst bedrängenden Vernunft angenommen werden.
Der Gedanke ist folgender. Die Bedingung der Möglichkeit für mich, das Leben
weiterzuführen, ist gleichzeitig die Bedingung der Möglichkeit meines Lebens. Wenn
ich nur unter der Bedingung der Vernünftigkeit leben kann, dann zeigt mein „Lebenstrieb“ selbst, dass mein Leben vernünftig ist. Gerade dies ist mit der Formulierung
gemeint: Gott suchend zu leben und nicht ohne ihn zu leben, ist einerlei. Wenn ich
ohne Gott nicht leben kann, ist Gott dadurch der Anfang und die Quelle meines
Lebens. Er ist damit allerdings keine äußere sinngebende Instanz, sondern bloß der
Grund, an dem der Mensch sich festhält, der ihm das Leben ermöglicht. Er ist damit
auch Endzweck des einzelnen Lebens. Ferner kann der nach dem Sinn seines Lebens
fragende Mensch einen anderen Begriff Gottes nicht gebrauchen. Er ist die praktische
Bedingung für die Zwecke seines einzelnen Lebens und alles, was über die Bedürfnisse seiner Vernunft hinausgeht, geht ihn eigentlich nichts an und ist „zu nichts
nütze“. Die ontologisch-metaphysische Frage entsteht auf diese Weise gar nicht. Sie
hat sich als schädlich für die Bedingung des Lebens, für die Vernunft erwiesen, indem
sie zu deren Ohnmacht führte. Eine solche Fragestellung muss für die Vernunft daher
sinnlos bleiben.
Hier wird allerdings nicht nur, wie es zunächst scheinen mag, die Abgrenzung
des praktischen Gebrauchs vom theoretischen vollzogen oder das Primat des praktischen behauptet, obgleich Tolstoi, der in seinen Überlegungen immer wieder zu Kant
zurückkehrt, sie so darstellen will. Seine praktische Lösung lässt, anders als bei Kant,
keine Hoffnung auf die für die Vernunft des Einzelnen vollendende und richtende
Instanz bzw. Intelligenz zu. Denn der Begriff Gottes selbst hat sich verändert. Er ist
einerseits ein leerer Begriff. Denn anstelle von „Gott“ könnte auch „das Leben“ stehen
oder „die Unendlichkeit“. Andererseits ist Gott hier im Sinne der bewussten Annahme
des Lebensnotwendigen zu verstehen. Er wird auf diese Weise auch begriffen. Das
wiederum ist nicht die kantische Nötigung zur Annahme des Unbegreiflichen. Dieses
Begreifen ist bei Tolstoi eher im Sinne der Annahme einer lebensnotwendigen Illusion
Nietzsches zu verstehen, der keine Wahrheit entgegentreten kann, denn eine Wahrheit, die dem „Lebenstrieb“, dem „Bewusstsein des Lebens,“73 widerspricht, kann für
die Vernunft nicht brauchbar sein. Diese Illusion ist die Wahrheit in einem neuen
Sinn. Sie ist das, was das Leben des Einzelnen ermöglicht, das, was sein Leben rettet.
Der Bezug auf das Unendliche wurde somit nicht mit Hilfe einer äußeren Bedingung
bzw. eines Prinzips, sondern allein im „Lebenstrieb“ gefunden, und der Zweifel an der
73 Die Übersetzung des Ausdrucks als „Lebenstrieb“ (Tolstoi, Meine Beichte, S. 79) ist etwas ungenau.
Im Original steht „сознание жизни“ (TGA 23, S. 31), was genau „das Bewusstsein des Lebens“
bedeutet.
248
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Möglichkeit eines solchen Bezugs wurde als Betrug und Mogelei der Vernunft zurückgewiesen.
Der Betrug bestand in der Voraussetzung, dass das Denken aus den Bedingungen
des Lebens herausgenommen und zur richtenden Instanz erklärt werden kann, sei es
in Bezug auf Erkenntnis oder Handlung, sei es im theoretischen, moralischen oder
ästhetischen Gebrauch.74 Und dies, als ob das Denken selbst, das die eigenen Prinzipien untersucht, über dem Leben schwebte und zu einer abstrakt-äußeren Perspektive, die das Leben „erklärt“, fähig wäre. Die Sorge Kants, das Praktische der Vernunft,
das Handeln bzw. die Lebensfähigkeit von den Angriffen der spekulativen Vernunft
fernzuhalten, um die Vernunft zu erhalten und vor dem Absturz zu retten, ist für
Tolstoi keine Aufgabe, die durch Prinzipien bewältigt werden soll. Sondern es ist der
unerlässliche Anfang des Denkens, der selbst im „Lebenstrieb“ verwurzelt ist. Die
elementare Tatsache, dass ich lebe, macht den Ausgangspunkt des Denkens und die
Bedingung seiner Möglichkeit aus. Das Leben bedingt die Möglichkeit der Vernunft.
Deswegen muss auch das Umgekehrte wahr sein: die Vernunft muss das Leben
ermöglichen, sonst ist sie keine Vernunft. Sie muss dann in ihren kindlich-schädlichen Ansprüchen zurückgewiesen werden.
Wäre es nicht so entsetzlich, es wäre lächerlich, mit welchem Hochmut und welcher Selbstgefälligkeit wir wie die Kinder die Uhr auseinandernehmen, die Feder herauslösen, sie als Spielzeug
benutzen und uns dann wundern, daß die Uhr nicht mehr geht.75
Mit dem lächerlichen Wissensdrang, d. h. mit der Fragerei über die uns nicht nur
unzugänglichen, sondern auch unbrauchbaren metaphysischen Wahrheiten, kann
die Not, das Leben fortzusetzen, in keiner Konkurrenz stehen. Der „Lebenstrieb“ hat
ausdrücklich Vorrang vor der Vernunft und verweist sie in ihre Grenzen.
Der Einfluss Schopenhauers, nicht der Kants, ist in dieser immer wieder bei
Tolstoi vorkommenden Betonung der Schwäche der Vernunft und ihrer Abhängigkeit
vom Lebenstrieb, den sie niemals beherrschen kann, deutlich spürbar. Dennoch lässt
sich der grundlegende Unterschied auch zu Schopenhauer nicht übersehen. Denn die
Forderung der Vernunft wird bei Tolstoi, anders als bei Schopenhauer, in ihrer
Bedeutung für das Leben des einzelnen Menschen als berechtigt anerkannt. Die
Vernunft muss das Leben ermöglichen, denn nicht der unersättliche Wille, sondern
die Vernunft hat den Menschen zur leidensvollen Verzweiflung geführt. Deshalb soll
74 Vgl. das Gleichnis über eine Mühle am Anfang von Das Leben. Indem der Müller sich von dem
„guten“ Mehl ablenken lässt und beginnt, den Fluss zu beobachten und zu erforschen, kommt er zu
paradoxen Schlüssen, die logisch unwiderlegbar sind. Seine Mühle gerät jedoch völlig in Unordnung.
„Das einzige Mittel, ihn von seinem Irrtum zu befreien, besteht darin, ihm zu zeigen, daß bei jeder
Überlegung die Überlegung an sich nicht so wichtig ist, wie der Ort, den man ihr anweist […].“ (Tolstoi,
Das Leben, S. 17 f.)
75 Tolstoi, Meine Beichte, S. 91.
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
249
und kann nur die Vernunft es wieder gut machen. Tolstoi will also keinesfalls die
Vernunft verleugnen (eine solche Verleugnung wäre „größte Gotteslästerung“ und
diene dem Betrug (TGA 39, S. 157 f.)), sondern sie erneut aus der Gefahr in die
Bedingung des Lebens umdeuten. Denn nur als sinnvoll und vernünftig kann das
Leben für ein vernünftiges Wesen erträglich sein. Anders gesagt: Wer angefangen hat
zu fragen, muss eine Antwort bekommen, denn das Leben wird für ihn sonst unerträglich. Nur darf er dabei nicht die Bedingung seines Fragens vergessen. Wenn das Leben
die unerlässliche Bedingung des Fragens ist, so ist dessen Sinn für die Vernunft
unentbehrlich und deswegen wahr. Tolstoi formuliert diesen Gedanken folgenderweise:
All das, an was die Menschen wahrhaftig glauben, muß Wahrheit sein.76
Auch hier haben wir es nicht nur mit dem kantischen Glaubensbegriff zu tun, sondern
v. a. mit dem Nietzsches. Denn diesem subjektiv notwendigen Fürwahrhalten steht
kein, wenn auch bloß gedachtes und für die Vernunft unzugängliches, objektives
gegenüber. Dieser Glaube verzweifelt weder an mangelnden Garantien noch begünstigt er jenseitige Hoffnungen. Er ist eine Illusion, die zur Wahrheit erklärt wird und
sich stets als einzig brauchbare Wahrheit erweist. Die unerlässliche Bedingung des
Lebens ist wahr, und einen anderen Begriff der Wahrheit kann die Vernunft nicht
sinnvoll gebrauchen.77 Oder: Das Leben, das nur unter der Bedingung seiner Vernünftigkeit (als sinnvoll) geführt werden kann, ist wirklich sinnvoll und vernünftig.
Die Tatsache der lebendigen Welt der Menschen, die Kraft des Lebens beweisen
unumgänglich, dass dessen Bedingungen erfüllt sind. Das Leben hat seinen Sinn, und
zwar im wahren Glauben der Menschen.
Wie die Frage des Lebens nur angeblich eine ontologische Frage nach dem letzten
Grund gewesen ist, so ist auch die Frage nach der Wahrheit des Glaubens keine
metaphysische Frage. Nicht nur könne die Frage, wie bei Kant, keine Antwort bekommen, weil das Vermögen der Vernunft nicht so weit reicht, sondern auch die Frage
selbst mache laut Tolstoi keinen Sinn. Denn die Antwort, wenn es eine gäbe, könne
für den Fragenden niemals brauchbar sein. Die Antwort zur Frage nach der allgemeinen Wahrheit – der Wahrheit, die frei von der „besonderen Beschaffenheit des Subjekts“ gewesen wäre – kann dem Einzelnen weder nützlich noch sinnvoll vorkommen.
76 Tolstoi, Meine Beichte, S. 118.
77 Vgl. bei Kant: „Ein jedes Wesen, das nicht anders als u n t e r d e r I d e e d e r F r e i h e i t handeln
kann, ist eben darum in praktischer Rücksicht wirklich frei, d. i. es gelten für dasselbe alle Gesetze, die
mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, eben so als ob sein Wille auch an sich selbst und in der
theoretischen Philosophie gültig für frei erklärt würde.“ (GMS, AA 4, S. 448). Es ist eine Formel für die
Freiheit, die laut der Kritik der Urteilskraft als einzige unter den Ideen zur „scibilia“ mit gerechnet
werden muss (KU, AA 5, S. 468).
250
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Nur die Frage nach den Bedingungen des eigenen Lebens kann die endliche Vernunft
sinnvoll erhalten. Das Kriterium der Wahrheit ist die Not des Lebens.
Das wahre Kriterium der Vernunft ist somit die Erfüllung der Bedingungen des
Lebens, weil die Vernunft selbst unter diesen Bedingungen steht. Diese Schlussfolgerung bei Tolstoi kann u. a. als Ablehnung bzw. Umkehrung der cartesianischen These betrachtet werden. Der kantische Begriff des Vernunftglaubens scheint
dagegen wesentlich an Bedeutung zu gewinnen. Allein an dem eigenen Bedürfnis
könne und müsse die Vernunft Anhaltspunkte für ihre Lebensorientierung finden
(vgl. Was heißt: Sich im Denken orientiren?, AA 8, S. 136). Tolstoi folgt Kant auch
weiterhin, indem er den Glauben zum eigentlichen Gebrauch der Vernunft des zu
Handlungen genötigten Menschen erklärt und seine Unterscheidung zwischen Glauben und Vertrauen mit der kantischen Unterscheidung von Überzeugung und Überredung in Einklang bringt. Dennoch ist es bei Tolstoi keine bloße Wiederholung eines
aufklärerischen Klischees: Man dürfe sich nicht auf die Autorität, sei es die der Bibel,
der Kirche, des Staates, der Wissenschaft oder Gottes, verlassen, sondern soll sich
immer der eigenen Vernunft bedienen. Vielmehr ist es eine besondere Deutung des
Glaubens:
Der Glaube ist das Bewusstsein der eigenen Lage in der Welt, das den Menschen zu gewissen
Taten verpflichtet. (TGA 35, S. 170)
Der kantische „Probirstein“ im Urteilen ist somit nach Tolstoi ungültig,78 weil es keine
„Stufen des Fürwahrhaltens“ gibt und folglich auch keinen Prüfstein derselben geben
kann, keine äußere Perspektive, kein Urteil einer fremden Vernunft. Der Grund des
Fürwahrhaltens ist immer derselbe: Mein wahrer Glaube ist die Bedingung meines
Lebens. Man braucht ihn nicht mitzuteilen, denn er kann nur an sich selbst, d. h. am
eigenen Leben überprüft werden. An anderer Stelle interpretiert Tolstoi das Vertrauen
in die fremde Vernunft bzw. in die eigenen früheren Meinungen als notwendige
Ökonomie der Kräfte. Es sei jedoch einem Kunstgriff ähnlich, „welchen die Ärzte
Hypnose nennen“ (TGA 35, S. 165). Aber nur als das Hier-und-Jetzt, nur als das immer
wieder gewonnene Bewusstsein der eigenen Position in der Welt kann die Vernunft
zur Bedingung des Lebens werden – d. h. nur als Glaube, der keine Alternativen und
keinen Zweifel kennt.
In einem Brief aus dem Jahr 1875 schreibt Tolstoi, dass unter Kants Zentralfragen
nur die Frage nach dem „Was dürfen wir hoffen?“ sein eigentliches Interesse genießt.
Diese Behauptung darf nicht irreführen, denn es stellt sich weiter heraus, das alle drei
bzw. vier kantischen Fragen für ihn auf die folgende Frage hinauslaufen: „Was ist
78 Dem Kapitel „Über Meinen, Wissen und Glauben“ in der Kritik der reinen Vernunft steht Tolstois
Randbemerkung „Was für ein Quatsch“ gegenüber. Dem Wetten als Probierstein des Glaubens gab er
jedoch eine positive Bewertung. (S. dazu Krouglov, Leo Nikolaevitč Tolstoj als Leser Kants, S. 366)
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
251
mein Leben, was bin ich selbst?“ (TGA 62, S. 219 f.).79 Es ging Tolstoi sicherlich nicht
um den jenseitigen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele bzw. an Gott als Vergelter, sondern nur darum, was die Vernunft von sich selbst zu erwarten hat, was für
eine Befriedigung der eigenen Not von ihr zu erwarten ist. Eins von seinen späten
Werken trug den Titel Was sollen wir denn tun?.80 Gerade die Vernachlässigung dieser
Frage warf Tolstoi, wie bereits erwähnt, der nachkantischen Philosophie vor. Diese
zwei Fragen – nach dem Sinn, der Hoffnung schenkt, und nach dem Glauben, der
diesen Sinn wirklich macht – sind für Tolstoi identisch. Die Hoffnung besteht darin,
dass das eigene Leben sinnvoll sein kann, und es ist eine Pflicht, diese lebendige
Hoffnung zu erhalten. Sie ist der eigentliche Glaube der Vernunft, und ein anderer
wäre für sie nicht brauchbar.
Das Unbegreifliche als Wohl der Vernunft
Die Vernunft ist zuverlässig und ihre Bedürfnisse sind wahr. Der Sinn ist im einzelnen
Leben schon immer vorhanden, weil das letztere in das Unendliche des Lebens eingeschrieben ist. Dennoch lässt eine solche Antwort auf die Frage des Lebens gewiss
Unzufriedenheit übrig. Denn es ist immer noch unklar, was für ein Sinn hier gemeint
ist, auch wenn seine Unerlässlichkeit schon bewiesen wurde. Wenn Gott oder das
Leben oder der Bezug auf das Unendliche als Antworten genannt wurden, so sind das
alles noch leere Begriffe, die sich nur tautologisch bestätigen: Der Sinn ist sinnvoll; der
wahre Glaube ist wahr. Der Optimismus des gefundenen Glaubens droht somit in
äußersten Pessimismus umzuschlagen. Denn der Mensch ist offensichtlich nicht geneigt, sich mit solchen Antworten zufrieden zu geben. Daher entstehen alle „Betrügereien des Glaubens“ und „Mogeleien der Vernunft“. Die Vernunft will mehr und dieser
Wunsch führt sie zur Verleugnung des Lebens, zum Nihilismus.81 Der Glaube an Nichts
ist die Rache der Vernunft an sich selbst. Es ist ihre Selbstbestrafung. Die Frage nach
dem Sinn durfte jetzt also, da dieser Sinn als unumgänglich anerkannt wurde, nicht
bloß tautologisch beantwortet werden. „Jene einzige Kenntnis vom Sinn des Lebens“
und Gott selbst als anderer Name des Unendlichen müssten in ihrem Bezug auf mein
Leben, wenn nicht verstanden, so in ihrer Unbegreiflichkeit begriffen werden.
Man muß sie vorsichtig, aufmerksam prüfen, um sie zu begreifen – freilich nicht begreifen wie
ich Thesen einer Wissenschaft begreife. Ich suche das nicht und kann es nicht suchen, da ich die
79 Das ist der Brief an Nikolai N. Strachow vom 30. November 1875, der uns im Folgenden noch
beschäftigen wird. Denn in ihm formulierte Tolstoi, wie es später auch Dostojewski in einem Brief tat,
seine „profession de foi“ (TGA 62, S. 220).
80 Leo Tolstoi, Was sollen wir denn tun?.
81 Am Anfang von Mein Glaube sagt Tolstoi, er habe 35 Jahre „als Nihilist gelebt“ (Tolstoi, Mein
Glaube, S. 13).
252
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Eigentümlichkeit der Erkenntnis des Glaubens kenne. Ich werde nicht die Erklärung des Ganzen
suchen. Ich weiß, die Erklärung des Ganzen muß, wie der Urquell aller Dinge, in der Unendlichkeit verborgen sein. Ich will es aber soweit begreifen, daß ich bis zu dem unvermeidbar Unerklärlichen gelange; ich will, daß alles das, was unerklärlich ist, es sei, nicht weil die Forderungen meines Verstandes unrichtig sind (sie sind richtig und außerhalb ihrer kann ich nichts
begreifen), sondern weil ich die Grenzen meines Verstandes erkenne. Ich will es so begreifen, daß
jede unerklärliche These sich mir als ein Postulat eben dieses Verstandes darstellt und nicht als
die Pflicht zu glauben.82
Es geht also keinesfalls um die Erklärung des Lebens im Sinne einer Wiederherstellung der kausalen Beziehungen oder der Feststellung seines Endzweckes, sondern um
das Auffinden der Bedingungen, unter denen allein das Leben den Sinnforderungen
der Vernunft entsprechen kann – der Bedingungen des sinnvollen Lebens. Dem Unbegreiflichen, dem Stocken und dem Halt der Vernunft kann man dabei nicht entkommen, weil man die Frage nach dem Sinn nicht unendlich weiter stellen kann. Aber es
muss ein Weg gefunden werden, die „Mogelei“ und den „Betrug“ vom Unerklärlichen
des Lebens zu unterscheiden. Die Annahme dessen, was nicht erklärt werden kann,
kann nur unter der Bedingung gerechtfertigt werden, dass eine solche Annahme die
eigentliche Not bzw. das Bedürfnis des Einzelnen tatsächlich befriedigt. Das Unerklärliche als Nötigung der Vernunft anzunehmen hieße dann, das Unerklärliche als
Beschränkung der eigenen Vernunft wiederum zu erklären. Die letzte paradoxe Formulierung aus Meine Beichte scheint mit dem Ende der Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten übereinzustimmen und vielleicht sogar direkt darauf hinzuweisen:
Und so begreifen wir zwar nicht die praktische unbedingte Nothwendigkeit des moralischen
Imperativs, wir begreifen aber doch seine U n b e g r e i f l i c h k e i t , welches alles ist, was billigermaßen von einer Philosophie, die bis zur Grenze der menschlichen Vernunft in Principien strebt,
gefordert werden kann. (GMS, AA 4, S. 463)
Das Faktum des kategorischen Imperativs, das moralische Gesetz als Triebfeder der
Handlungen wurde von Kant zum Unbegreiflichen und zur eigentlichen Grenze der
Vernunft erklärt. Die Vermutung liegt also nahe, dass diese Grenze auch für Tolstoi im
Moralischen besteht. Doch denkt man die Fragestellung Tolstois nach dem Sinn des
einzelnen Lebens und nach der Befriedigung seiner eigentlichen Not konsequent zu
Ende, wird klar, dass dies kaum seine Lösung sein kann. Denn für Tolstoi war, wie
oben zitiert, gerade diese Lösung Kants, wenn auch streng konsequent, so doch naiv
und unbefriedigend. Sie gebe keine Antwort darauf, „was dabei herauskomme und
wozu so zu handeln sei“.83 Ihm selbst ginge es dagegen nicht um das Notwendige der
Vernunft, sondern allein um das Unerlässliche des Lebens für den Einzelnen. Als
82 Tolstoi, Meine Beichte, S. 136 f. Das Wort „ум“, das von Tolstoi verwendet wird und mit „Verstand“
bzw. „Vernunft“ übersetzt wird, steht auf Russisch für das allgemein intellektuelle Vermögen und
entspricht eher dem „Gemüt“ oder ggf. dem „Geist“.
83 S. Anmerk. 63.
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
253
Grenzpunkt des Vernunftglaubens wurde dementsprechend kein unbedingtes, kein
kategorisches Gebot, sondern eine hypothetische Frage nach der erfüllten Bedingung
des Lebens gesetzt: Was soll ich tun, damit mein Leben angesichts des unvermeidlichen Todes sinnvoll bzw. vernünftig bzw. erträglich (es sind für Tolstoi alles Synonyme) wird? Der Unterschied zu Kant ist in einer solchen Fragestellung zwar subtil,
jedoch unverkennbar. Nicht die unbedingte moralisch-vernünftige Forderung, die an
den Einzelnen gerichtet wird, sondern die bedingte Forderung, die vom Einzelnen
ausgeht, ist das Faktum seiner Vernunft schlechthin. Folglich kann die Vernunft nur
die Forderung akzeptieren, die den Bedingungen des eigenen Lebens entspricht. Das
bedeutet aber, dass die eigentliche Grenze aller möglichen Fragestellungen bzw. alles
Begreiflichen für Tolstoi nicht in der Vernunft, sondern im Leben selbst liegt. D. h.: Die
einfache Tatsache, dass ich lebe, ist mein Ausgangspunkt bzw. das Unbegreifliche, an
dem meine Vernunft die eigene Bedingtheit demütig anerkennen muss. Nur eins folgt
mit Sicherheit aus der unbegreiflichen Tatsache meines Lebens: dass ich mein eigenes
Leben durch meine Vernunft retten will und soll. Jede Pflicht und jedes Sollen muss
selbst aus diesem „Faktum“ erklärt und gerechtfertigt werden. Sie dürfen nicht unbegreiflich sein.
Es durfte bereits gegen die in der Tolstoi-Rezeption angenommene Sicht klar
geworden sein, dass Tolstois Moralphilosophie keine normative Ethik ist, noch weniger als es bei Kant der Fall war. Tolstois Ansatz ist kritisch und diese kritische
Einstellung gilt nicht nur für seine Behandlung der Wissenschaft oder, später, der
Kunst, sondern vor allem für seine „Lehre über das Leben“. Letztere darf nicht zum
„unvermeidlich Unerklärlichen“ gezählt werden, was die Vernunft einfach akzeptieren müsste. Der Leitfaden der persönlichen Not geht keinesfalls verloren, wenn es um
eine Begründung der Moral geht, weil, wie sich schon gezeigt hat, nicht das Gute,
sondern das Leben zum Grund aller Gründe erklärt wurde. Das Gute kann und muss
als für den Einzelnen unmissverständlich und als durch seine eigene Vernunft
begreiflich dargestellt werden. Ob dies Tolstoi gelingt oder nicht, er macht es sich zu
seiner Aufgabe. Aus der Perspektive des Lebens hat das Moralische weder Privilegien
gegenüber der fragenden Vernunft des Einzelnen noch darf es Geheimnisse vor ihr
behalten.
Die Frage nach dem Sinn soll also so beantwortet werden, dass das Leben dem
Einzelnen als sinnvoll erscheint und für ihn als vernünftiges bzw. fragendes Wesen
möglich wird. Dieser Sinn muss dann als das Gute, d. h. als das eigentliche Wohl
seiner Vernunft, angenommen werden. Tolstois Formulierung ist wiederum verblüffend:
Um den Sinn des Lebens zu begreifen, ist es vor allem nötig, daß das Leben nicht sinnlos und
schlecht sei; dann ist uns schon die Vernunft verliehen, es zu begreifen.84
84 Tolstoi, Meine Beichte, S. 102.
254
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Oder, wie es die Schlusspassage in Anna Karenina zum Ausdruck bringt:
[…] mein Leben, mein ganzes Leben ist nicht mehr sinnlos wie bisher, sondern hat unabhängig
von allen äußeren Begebenheiten in jedem Augenblick den unumstößlichen Sinn des Guten zum
Inhalt, den darin hineinzulegen in meiner Macht steht!85
Die letztere Formulierung ist auffallend paradox: Das Leben trage in sich den „Sinn
des Guten“; es stehe jedoch in meiner Macht, es ihm zu geben. Dem Leben den Sinn
zu geben und diesen Sinn im Leben zu finden sei somit einerlei. Die Unterscheidung
des „wirklichen“ und „erfundenen“ Sinns ist hier selbst ohne Sinn. In seiner Not hört
der Mensch einen für ihn unbegreiflichen und jedoch völlig verständlichen Imperativ
des Lebens, der ihm gebietet, „den unumstößlichen Sinn des Guten“ in seinem Leben
zu suchen und ihn in dieses „hineinzulegen“, um überhaupt leben zu können.
Die Suche nach dem „Sinn des Guten“, der die Not des Lebens befriedigen soll,
brachte Tolstoi gerade zu seiner religiösen Wende. In Anna Karenina (zwischen 1873
und 1877) wurde dieser Sinn noch anders gedeutet als in Tolstois Spätwerk (ab 1882).
Die Veränderung betraf den Kern seiner Moralphilosophie und u. a. seine Einstellung
zu Kant. Es waren feine Verschiebungen, welche mehrmals zu Fehldeutungen und
Missverständnissen in der Tolstoi-Rezeption führten, wovon in der Einleitung zu
diesem Kapitel schon die Rede war. Doch wenn man sie aufmerksam verfolgt, zeigen
sie m. E. nicht etwa die Inkonsequenz Tolstois, sondern seine Suche nach der eigenen
Fragestellung in der Philosophie, die Suche nach der Antwort auf die Fragen, die
tatsächlich seiner persönlichen Not entsprangen. Tolstois spätere Interpretation des
Guten, seine eigene originelle Sicht auf den „Sinn des Guten“, soll im nächsten
Abschnitt dieses Kapitels dargestellt werden. An dieser Stelle verdient noch die Veränderung seiner Formulierungen unsere Aufmerksamkeit.
In Anna Karenina wird der Sinn des Lebens von einer der Hauptfiguren des
Romans, Konstantin Lewin, gefunden, der dadurch dem Selbstmord und der Verzweiflung entgeht.86 Er findet diesen Sinn in den einfachen Worten eines Bauern:
Nicht „für sein leibliches Wohl“,87 sondern „für Gott“ bzw. „wie es recht sei und
gottgefällig“ solle man leben. Lewin ist wie von einem Blitz getroffen, das Licht der
85 In der deutschen Übersetzung ist Tolstois Formulierung etwas abgeschwächt und entparadoxiert
(Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 606), weshalb ich eine eigene Übersetzung angebe (vgl. TGA 19,
S. 399).
86 Lewin wurde schon immer von der literarischen Kritik mit Tolstoi selbst identifiziert, u. a. von
Dostojewski, dessen scharfe Kritik am letzten Teil von Anna Karenina uns im folgenden Kapitel
beschäftigen wird. Schon der Name (Lew – Lewin) gab einen Hinweis darauf, dass die persönliche
Sympathie des Autors dieser Figur gehört. Es ist mir dennoch keine Untersuchung bekannt, in der der
Unterschied zwischen Lewins Ansichten und denen des späteren Tolstoi von den Kritikern analysiert
wird. Dieser ist subtil und leicht zu übersehen, genauso wie der Unterschied zu Kants kritischem
Ansatz. Letzterer ist gerade äußerst hilfreich, um den ersten zu erkennen.
87 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 571 f. Das Russische „для брюха“ heißt wörtlich „für seinen
Bauch“.
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
255
Wahrheit ist ihm durch die Worte des Bauern aufgegangen. Dennoch, als er versucht,
diese Wörter zu verstehen, fragt er sich:
„Kann etwas vernunftwidriger sein als das, was er da gesagt hat? Er sagt, man dürfe nicht für
seine eigenen Bedürfnisse leben, das heißt also, man soll nicht für das leben, was wir verstehen,
was uns anzieht und was wir besitzen möchten, sondern für etwas Unverständliches, für einen
Gott, den niemand verstehen und dessen Wesen kein Mensch erklären kann […].
Das Gute, das allen Bedürfnissen entgegensteht, scheint ihm unverständlich zu sein.
Die Idee des Guten ist dennoch irgendwie einleuchtend. Er versucht den Gedanken
weiterzuentwickeln:
Fjodor sagt, der Herbergswirt Kirillow lebe für sein leibliches Wohl. Das ist begreiflich und
vernünftig. Wir alle, alle vernünftigen Lebewesen, können nicht anders leben als für unser
leibliches Wohl. Und plötzlich erklärt derselbe Fjodor, es sei schlecht, für das leibliche Wohl zu
leben, man müsse ein rechtschaffenes, gottgefälliges Leben führen – und ich verstehe schon auf
die bloße Andeutung hin, was er meint! Ich und Millionen anderer Menschen, solche, die vor
Jahrhunderten gelebt haben, und solche, die jetzt leben, Bauern, Einfältige und Weise, die drüber
nachgedacht und geschrieben haben und in ihrer unklaren Sprache dasselbe sagen – wir alle
sind uns in dieser Frage einig: wozu man leben muß und was gut ist. Ich und alle anderen
Menschen wissen nun dieses eine mit voller Klarheit und Bestimmtheit und ohne jeden Zweifel,
aber dieses eine kann nicht durch die Vernunft erklärt werden; es liegt außerhalb der Vernunft,
hat keine Gründe und kann keine Folgen haben.
Wenn das Gute einen Grund hat, dann ist es nicht mehr etwas Gutes, wenn es Folgen hat –
eine Belohnung –, dann ist es ebenso wenig etwas Gutes. Das Gute ist folglich mit keinen
Gründen und keinen Folgen verknüpft.
Und dieses Gute eben kenne ich und kennen wir alle.
Ich habe nach Wundern gesucht und habe bedauert, daß ich kein Wunder fand, das mich
überzeugt hätte. Und hier ist nun dieses Wunder, das einzig mögliche, das immer vorhanden ist
und mich von allen Seiten umgibt – und ich habe es solange nicht bemerkt!88
Es handelt sich also um ein Faktum, das als Wunder, d. h. als Unbegreifliches und
dennoch Gegebenes, als Sinn des Guten jedem Menschen nicht nur zugänglich,
sondern notwendig mitgegeben ist. Das Gute wird dabei nicht durch Vernunft offenbart, denn es ist unvernünftig und für die Vernunft verblüffend sinnlos:
Doch wer hat dies entdeckt? Nicht die Vernunft. Die Vernunft hat den Kampf ums Dasein
entfesselt und den Grundsatz aufgestellt, daß man jeden umbringen muß, der uns bei der
Befriedigung unserer Wünsche behindert. Das lehrt die Vernunft. Denn auf den Gedanken, daß
man den anderen lieben solle, konnte die Vernunft nicht kommen, weil es vernunftwidrig ist.89
Nicht die Vernunft, sondern das Unbegreifliche eines Faktums bestätigt also den
„Sinn des Guten“, der zugleich das größte Wunder des Lebens ist.
88 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 572 f.
89 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 576.
256
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Abgesehen von der Begrifflichkeit (statt „unvernünftig“ würde Kant „für die Vernunft unbegreiflich“ sagen) ist das Verhältnis von radikal-moralischen und pragmatischen Geboten bei Tolstoi dem bei Kant an dieser Stelle nicht nur ähnlich, sondern sie
sind tatsächlich identisch.90 Für den Autor von Anna Karenina ist das Gute das Unbegreifliche, das einem Wunder gleicht und dessen Akzeptanz die Vernunft in ihre
Grenzen verweist, wo sie es als Faktum demütig akzeptieren muss. Sie akzeptiert
dabei, dass sie dieses Faktum, als im menschlichen Leben immer präsenter Imperativ,
niemals begreifen bzw. begründen könnte. Diese Erkenntnis „wurde mir wie allen
Menschen gegeben, einfach gegeben, weil ich sie selbst von nirgendwo nehmen
konnte.“91 Um seine Übereinstimmung mit Kant hervorzuheben und noch zu vervollständigen, bringt Tolstoi Lewin zu einer Analogie:
Weiß ich etwa nicht, daß die Sterne nicht wandern? fragte er sich, während er auf einen hellen
Fixstern blickte, der seine Stellung zu der Wipfelspitze einer Birke inzwischen verändert hatte.
[…] Und ebenso wie die Ermittlungen der Astronomen eitel und haltlos wären, wenn sie sich nicht
auf die Beobachtung dessen gründeten, wie sich der Himmel von einem bestimmten Meridian
und einem bestimmten Horizont aus darstellt, genauso eitel und haltlos wären meine Erkenntnisse, wenn sie sich nicht auf jene Auffassung des Guten gründeten, die für alle Menschen zu
allen Zeiten die gleiche gewesen ist und bleiben wird, die sich mir durch das Christentum
offenbart hat und über deren Vorhandensein in meiner Seele ich mich jederzeit vergewissern
kann.92
Der bestirnte Himmel wird von Lewin als Analogon zum Wunder des Guten gedeutet.
Ihm stimmt der Erzähler zu.
Bei jedem Aufleuchten eines Blitzes verschwanden zusammen mit der Milchstraße auch die
hellen Sterne, um jedoch, sobald der Blitz erloschen war, gleich wieder, wie von einer geschickten Hand hingeworfen, aufs neue an den gleichen Stellen zu erscheinen.93
Es ist bemerkenswert, dass wir hier nicht nur mit einem klaren Hinweis auf Tolstois
Quelle (Kants Bewunderung des Unbegreiflich-Erhabenen des Himmels und des
moralischen Gesetzes), sondern mit ihrer gewagten Interpretation zu tun haben.94 Die
Zuverlässigkeit der Erfahrung außer mir, die ich niemals begreifen könnte und nur aus
90 Tolstoi lässt Lewin u. a. philosophische Werke von Platon, Spinoza, Kant, Schelling, Hegel und
Schopenhauer lesen. Als Widerlegung anderer Lehren kommen sie ihm plausibel vor. Doch, soweit er
von seiner Lektüre zum Leben zurückkam, „fiel“ auch ihr „kunstvolle[r] Bau plötzlich wie ein Kartenhaus zusammen“ (Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 561).
91 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 576.
92 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 604 f.
93 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 603 f.
94 Den berühmten Satz Kants über das moralische Gesetz und den bestirnten Himmel, die beide das
Gemüt mit Bewunderung und Ehrfurcht erfüllen, nutzte Tolstoi später als Motto für seine Schrift Über
das Leben (TGA 26, S. 313). Er unterstrich ihn in seinem Exemplar der Kritik der praktischen Vernunft
(Krouglov, Leo Nikolaevitč Tolstoj als Leser Kants, S. 375). Es ist bemerkenswert, dass dieser „Beschluß“
von Kants zweiter Kritik Tolstoi offensichtlich schon zu Zeiten von Anna Karenina bekannt war. Das
3.1 Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens
257
meiner Perspektive (im Verhältnis zum angeblich unbewegten Horizont) beobachten
kann, kommt für Tolstoi wie für Kant dem Wunder des moralischen Gesetzes gleich.
Tolstoi führt diese Analogie allerdings weiter: Nach dem wirklichen, von meiner
Beobachtung unabhängigen Gang der Himmelskörper zu fragen, ist genauso sinnlos,
wie den Sinn des Guten auf seine Gründe und seine „Wirklichkeit“ hin zu befragen.
Und er setzt dabei den Akzent nicht so sehr auf die unaufhebbare Beschränktheit des
Beobachters, sondern in beiden Fällen – in der Astronomie und in der Moral – auf die
Notwendigkeit der Illusion. Das Gute in mir ist in seiner Unbegreiflichkeit dem Anschein der Bewegung der Himmelskörper gleich. Es ist unvernünftig und widerspricht
sogar der Vernunft. Letztere gebietet, eben für sich selbst zu leben und die unmittelbaren egoistischen Bedürfnisse zu befriedigen, genauso wie sie den Menschen überredet, den Augenschein als objektive Wahrheit anzunehmen. Es ist vernünftig, „für
sein leibliches Wohl“ zu leben, sei es der Profit von heute oder der ewige Lohn im
Himmel. Was Kant die „Bescheidenheit der Vernunft“ nennt, die ihre eigene Grenze
begreifen soll, was Nietzsche später als „hinterlistige Selbstdemütigung“ der Vernunft
in Anerkennung ihrer eigenen Verbannung aus dem „Reich der Wahrheit“ angriff,
legt Tolstoi als Unvernunft schlechthin aus: Das Gute ist unvernünftig, weil es weder
erklärt noch in seiner Wirklichkeit begriffen werden kann. Es widerspricht der Vernunft, denn es wird nicht mit deren Bescheidenheit, sondern mit einer unerlässlichen
Illusion gleichgesetzt, mit dem Horizont, der niemals, auch nicht in Gedanken, überschritten werden kann. Diese Formulierung zeigt dennoch, dass Tolstoi zur Zeit von
Anna Karenina noch nicht zu seinem eigentlichen Ausgangspunkt gekommen ist – zu
der Forderung an die Vernunft, das Leben des Einzelnen zu ermöglichen.
Nach seinem späteren Verständnis der Vernunft als Vermögen, das Leben auf
einen Sinn hin zu befragen, hielt Tolstoi eine Entgegensetzung der Vernunft und des
Guten für unzulänglich. Wenn das Wohl des Einzelnen der Vernunft widerspricht,
musste die Vernunft selbst aus dem Verlangen nach dem Wohl neu verstanden
werden. Das Wohl des Lebens konnte nicht mehr unvernünftig sein. Man könnte diese
Veränderung in Tolstois Formulierung als kantische Wende auslegen: Nicht eine
egoistisch begrenzte, tierische Nötigung, sondern allein die unbegreifliche Forderung
des Guten wird nun als Stimme der Vernunft gedeutet. Doch Tolstoi wird noch einen
Schritt weitergehen, der ihn von Kants Fragestellung (und diesmal nicht nur in der
Formulierung) wegführt. Denn die Forderung des Guten sollte nicht als unbegreifliches Faktum verstanden, sondern gerade begriffen und ergründet werden. Für den
Glauben an dieses Faktum seien keine metaphysischen Annahmen nötig. Nötig sei
bloß das Verständnis der Lage, in der man sich befindet, nämlich, dass Habgier und
Furcht vor dem Tod die eigentliche Unvernunft sind. „Vernünftig“ heißt nun nach
Tolstoi befriedigend für den Einzelnen in seiner Not.
ganze Werk las er dennoch, so die Forschung, erst zehn Jahre später (Krouglov, Leo Nikolaevitč Tolstoj
als Leser Kants, S. 374).
258
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Wenn also der „Sinn des Guten“ als eigentliches Wohl der Vernunft von Tolstoi
auch später behauptet wird, so wird er gerade die für Kant grundlegende Unterscheidung einer moralischen und einer pragmatischen Forderung stillschweigend außer
Kraft setzen. Mit diesem Wohl wird nicht mehr (wie noch zur Zeit von Anna Karenina)
das gemeint, was Kant als „Interesse der Vernunft“ bezeichnete. Genauer gesagt,
nicht ganz, denn Tolstoi hat sich auch in seiner Spätphase als Nachfolger Kants
verstanden. Doch Tolstoi wird die Forderung des Guten jetzt vernünftig nennen, nicht
weil er wie Kant sein Prinzip von den Bedürfnissen eines Einzelnen abstrahiert,
sondern gerade aus dem umgekehrten Grund: weil jede Sinnsuche in den Bedürfnissen
des Einzelnen verwurzelt und die Forderung der Vernunft nur scheinbar kategorisch
ist. Die kantische Plausibilität, dass das Allgemein-Vernünftige als Rest nach der
Reinigung des Pathologisch-Empirischen übrig bleiben soll, wird somit ungültig. Für
die Vernunft des Einzelnen, der nach dem Wohl des eigenen Lebens fragt, sind solche
Annahmen nicht plausibel, nicht einmal eines Widerspruchs wert. Seine Vernunft
versteht sich als Suche nach dem Besseren, in der das Gute und das Wohl zusammenfallen. Nicht nur das Gefundene und Erfundene, auch das Moralische und das Pragmatische und, noch mehr, das Allgemeine und das Besondere lassen sich bei dieser
Suche nicht mehr unterscheiden. Der Imperativ des Guten kann für den späten Tolstoi
nicht mehr unbegreiflich sein. Er ist gerade der Punkt, an dem die Vernunft des
Einzelnen dem einzig Unbegreiflichen eine Antwort schuldet – dem Leben, das ihn
hervorgebracht hat.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
„Widerstehe nicht dem Bösen“
„Der Sinn des Guten“, den dem Leben zu geben „in meiner Macht steht“, wäre also
das eigentliche Wohl der Vernunft, wenn er ihre Not tatsächlich befriedigen könnte.
Die Vernunft des einzelnen Menschen, der, von der Not des Lebens getrieben, nach
den Bedingungen der Möglichkeit eines vernünftigen Lebens sucht, kommt so zur
Forderung des Guten. Was ist nun unter dem Guten im tolstoischen Sinne zu verstehen? Trägt das Leben immer den Sinn des Guten in sich, den ich ihm geben kann?
Steht es auch in meiner Macht, dem Leben den Sinn zu nehmen?
Das Gute wurde bis jetzt als bloße Forderung gedeutet, nicht nach egoistischtierischen Bedürfnissen zu leben. Andere Ausdrücke dafür waren: „gottgefällig“,
„für die Seele leben“ und freilich auch „den anderen lieben“. Es bleibt jedoch
immer noch unklar (und so blieb es in Anna Karenina stehen), was genau als das
göttliche Gesetz zu verstehen ist, oder was es heißt, wie der späte Tolstoi formulierte, über sich hinaus zu gehen und den Bezug auf das Unendliche im Endlichen zu
finden. In seinem Spätwerk versucht Tolstoi das Gute nicht nur näher zu bestimmen, sondern auch als einzig mögliche Antwort der Vernunft auf die Frage des
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
259
Lebens darzulegen bzw. es aus der Not des Lebens, aus der Not des einzelnen Menschen, herzuleiten.
Wie auch in vielen anderen Fällen geht Tolstoi zuerst von einer schlichten Überlegung aus.95 Das ‚Auf-der-Hand-Liegende‘ der Vernunft ist der Kampf gegen die
anderen, v. a. gegen die anderen Menschen – „der Kampf ums Dasein“.96 In diesem
Kampf versucht der Einzelne, sein Leben zu sichern. Es sei betont, dass Tolstoi an
dieser Stelle nicht moralisiert. Der Wunsch, das Leben zu behalten, ist höchst berechtigt und kann nie getadelt werden, weil es keinen das Leben übersteigenden Maßstab
des Guten geben kann. Und doch ist dieser Wunsch aus einem einzigen Grund das
Übel: Er ist trügerisch, denn der Kampf kann nicht das bringen, was er verspricht. Der
Einzelne, wie geschickt und mächtig er auch sein mag, kann sein Leben niemals
retten. Zweifellos und absolut zuverlässig ist gerade das Gegenteil seiner Bemühungen: die unvermeidliche Vernichtung seines Selbst. Gerade das sagt ihm seine Vernunft, und je klüger er ist und je mehr er von ihr Gebrauch macht, desto klarer wird
ihm diese Schlussfolgerung der Vernunft.
Es ist jedoch nicht nur diese Unmöglichkeit und Vergeblichkeit aller Bemühungen um das einzelne Leben, nicht nur das Betrügerische des Kampfes, der gegen diese
Bemühungen spricht, sondern gerade der Kampf selbst. Tolstoi modifiziert die These
vom „Kampf ums Dasein“ daher folgenderweise: Jedes lebendige Wesen lebt auf
Kosten der anderen. Kein Mensch und auch kein anderes Lebewesen könne allein
überleben. Daraus folgt aber ein für die Vernunft des Einzelnen beunruhigender
Schluss. Denn allein bedeutet er gar nichts. Er ist in keiner Hinsicht causa sui.97 Er ist
95 Bemerkenswert ist dabei die absichtlich zugespitzte sprachliche Einfachheit von Tolstois religiösphilosophischen Schriften. Vgl. Tolstois Äußerung über Kant, den er sonst hoch schätzte, er habe in
„seltsamer und schlechter Sprache“ geschrieben, genauso wie Spinoza, der seine von Tolstoi ebenso
hoch geschätzten Gedanken mit der „Form einer mathematischen Schrift bekleidete“. In seinem
Traktat Для чего люди одурманиваются? (Wozu berauschen sich die Menschen?) interpretiert Tolstoi
den unnötig schweren Schreibstil als Rausch und Folge des „Sich-Berauschens“, und dies im wörtlichen Sinn – als Folge davon, dass beide, Kant und Spinoza, rauchten (TGA 27, S. 277; 547).
96 Tolstoi hielt Darwins Theorie für „eine große Entdeckung unserer Zeit“. Aber gleichzeitig erschienen ihm die heftigen Diskussionen darüber als übertrieben und leer (TGA 30, S. 236). Es war die
Entdeckung der Vernunft, aber der, die an der Sinnlosigkeit des Lebens verzweifelt. Zum Thema
„Tolstoi und Darwin“ ist gleich nach dem Tod Tolstois ein höchst tendenziöse Broschüre erschienen:
Александр А. Тихомиров (Alexander A. Tichomirow), Самообман в науке и искусстве (Ч. Дарвин и
гр. Толстой) (Der Selbstbetrug in der Wissenschaft und in der Kunst (Ch. Darwin und Graf Tolstoi)). Hier
werden Tolstoi und Darwin als Feinde Christi (und als Feinde der Wahrheit) gedeutet.
97 Den Einfluss Spinozas, der für Tolstoi eine unumstrittene philosophische Autorität war, kann ich,
wie schon angedeutet, nur gelegentlich ansprechen. Er wird in der folgenden Darlegung immer
deutlicher. Die Übereinstimmungen zeigen allerdings, genauso wie bei Kant, die Diskrepanzen. Denn
der Ausgangspunkt, die Not des Einzelnen, der seine Endlichkeit als Verhöhnung seiner Vernunft und
das Überleben als Unmöglichkeit erfährt, weicht stark von dem Spinozas ab. Doch die Einsicht in die
Notwendigkeit als Befreiung von dieser Not, das Perspektivische von Gut und Böse, sind, wie ich zeigen
werde, gerade die Gedanken, die Tolstoi stark in die Nähe Spinozas bringen. Schließlich versucht er
260
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
mit seiner Vernunft abhängig, ja sogar den Generationen von Menschen, die sein
Leben ermöglichten, völlig verpflichtet. Seine untilgbare Verschuldung vor den anderen kann niemals ausgeglichen werden. Mehr noch, ob er will oder nicht, er wird sein
Leben, das ihm wie ein Pfand, nur auf Zeit zugeteilt wurde, ebenfalls weitergeben
müssen und sich so den anderen Lebenden opfern – nicht um damit die Schulden zu
bezahlen, weil das auf keinen Fall möglich wäre, sondern nur, weil ihm keine
Alternative bleibt. Die unvermeidliche Selbstaufopferung ist die einzig sinnvolle Verbindung mit der Welt außer mir, die zu brechen nicht in meiner Macht steht.
Für Tolstoi gibt es nun zwei Möglichkeiten, zwei Optionen des Lebens. Zum einen
die Suche nach einem möglichst langen sowie leidlosen Verharren im Leben, das
unvernünftig, weil vergeblich ist, zum anderen die Selbstaufopferung des Einzelnen.
Diese beiden Optionen, das ist wichtig zu betonen, sind keinesfalls als Alternativen zu
verstehen, sondern beide sind immer schon da. Jedes Lebewesen strebt nach Selbsterhaltung, aber allein der Mensch weiß, dass dieses Streben sein Ziel am Ende immer
verfehlt.98 Deshalb und nur deshalb ist es vernünftig, sich dem Ganzen bzw. den
anderen Lebewesen zu opfern – für denjenigen, der versteht, dass das Leben nicht
dem Einzelnen gehört. Töricht wäre es jedenfalls, dieses Opfer als Verdienst zu
betrachten oder gar einen Lohn dafür zu verlangen. Noch törichter wäre es aber, hier
nach Gerechtigkeit zu fragen oder das Leben zu beklagen. Das Verständnis der untilgbaren Verschuldung weist diese Anklagen und Forderungen kompromisslos zurück.
Nicht der Tod, sondern das Leben ist ein Rätsel und eine Gabe, die keiner verdienen
oder ausgleichen kann. Weder gehört das Leben dem Einzelnen noch kann vermieden
werden, dass es weitergegeben wird. Das Sich-Aufopfern erfolgt also keineswegs aus
Pflicht, sondern aus einer klaren Formel heraus, die lautet:
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. (Mt. 16; 25)
Die Fremdheit der Denkweise des russischen Schriftstellers gegenüber der sokratischkantischen Ethik zeigt sich in diesem Punkt auf entscheidende Weise. Der Imperativ
des Guten wird bei ihm von seinem rätselhaften Charakter bzw. von seiner „Unbegreiflichkeit“ befreit, weil er eigentlich nicht mehr moralisch zu verstehen ist. Um
diesem Imperativ zu gehorchen, braucht man keine in ihrer Herkunft geheimnisvolle
Achtung. Denn zum Guten gibt es keine Alternative. Das Gute ist sowohl das Bessere
Spinoza durch Schopenhauer zu verstehen und dann eine gewisse Synthese mit Kants Moralphilosophie hervorzubringen.
98 Dies ist Tolstois Bruch mit einer der grundlegenden Plausibilitäten der europäischen Philosophie –
mit der Idee der Selbsterhaltung. Zur Rolle der Letzteren für die Rationalität des Abendlandes s. Hans
Blumenberg, Selbsterhaltung und Beharrung. Zur Konstitution der neuzeitlichen Rationalität; Wilhelm
Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation. Abhandlungen
zur Geschichte der Philosophie und Religion, bes. S. 283–292; auch Hans Ebeling (Hg.), Subjektivität und
Selbsterhaltung: Beiträge zur Diagnose der Moderne.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
261
für den Einzelnen als auch das für ihn Unvermeidliche schlechthin. Das Böse – der
Wunsch, sein eigenes Leben für sich zu behalten – ist nur Betrug, der allerdings
ebenso unvermeidlich ist, weil er der Begrenztheit des Einzelnen entspringt. Für das
Leben gibt es das Böse somit nicht, sondern nur für die einzelnen Lebewesen, die
einander in ihrem unersättlich-trügerischen Streben nach der Dauer ihres persönlichen Lebens widerstehen. Dieser Widerstand ist das Mittel, dessen der Betrug des
einzelnen Lebens sich bedient, um dem fortdauernden Leben, dem Leben des Ganzen,
zu schaden. Doch umsonst. Denn auch der Betrug des Kampfes dient schließlich dem
Leben selbst. Nichts kann seinen siegreichen Fortgang aufhalten.
Der Betrug des Bösen und das Gute des Lebens können einander also nicht als
moralische Werte radikal entgegengesetzt werden. Tolstois Philosophie aus der Not
des Einzelnen führt von der kantischen Moral aus Vernunft, der sie eigentlich folgen
will, tatsächlich weg, da sie ihre Aufgaben und – noch wichtiger – ihre grundlegenden
Voraussetzungen nicht teilt. Das Gute und das Böse sind bei Tolstoi voneinander bis
zu dem Grad abhängig gedacht, wie sie es nach Kant trotz aller Paradoxien niemals
sein konnten. Sie sind nun bloß als zwei Perspektiven zu verstehen. Die eine, die des
Guten, ist die Perspektive des Lebens, die für den Einzelnen unbegreiflich bleibt, in die
er aber schon immer mit seinem einzelnen Leben eingeschrieben ist. Die andere, die
des Bösen, ist seine Perspektive, seine Beschränktheit, die er niemals verlassen, mit
der er sich aber als vernünftiges Wesen auch niemals aussöhnen kann. Das Gute, die
siegreiche Fortsetzung des Lebens, ist unvermeidlich, so auch die menschliche Beschränktheit, das Böse. Der Widerstand, der Kampf, das Leben auf Kosten der anderen
und die untilgbare Verschuldung sind nicht nur unumgänglich, sondern sie sind auch
die Bedingung des einzelnen Lebens. Es ist ein Vertrag, den wir jeden Tag abschließen,
den die Menschen „mit jeder Stunde ihres Lebens, während der sie das Leben annehmen“, „befestigen“ – ein Vertrag zwischen ihnen einerseits und „dem Leben und
dessen Uranfang“ andererseits.99 Laut diesem Vertrag hat der Schuldner keine Wahl:
Er kann seinen Schulden weder ausweichen noch sie bezahlen. Das Recht-Haben ist
ihm schon mit dem Faktum seiner Geburt für immer untersagt.100 Es steht keinem frei,
dem Weg des Bösen fernzubleiben. Was aber den Menschen nicht möglich ist, ist allein
dem möglich, was Leben verleiht – dem Leben selbst, das immer gerecht und für
immer gerechtfertigt ist, das göttlich ist, das Gott ist.
Halten wir fest: Der Widerstand gegen das Leben als lebendiges Ganzes, der sich
durch den Willen zum Beharren und zur Ausbeutung anderer Lebewesen zeigt, ist
unvernünftig, weil er aussichtslos ist. Doch dieser Widerstand ist für den Einzelnen
99 Tolstoi, Mein Glaube, S. 186.
100 Vgl. dagegen bei Kant den Gedanken, Kinder seien für Leben, Ernährung und Erziehung niemandem verpflichtet: „Denn frei geboren ist jeder Mensch, weil er noch nichts verbrochen hat, und die
Kosten der Erziehung bis zu seiner Volljährigkeit können ihm auch nicht als eine Schuld angerechnet
werden, die er zu tilgen habe.“ (MS, AA 6, S. 283) Dieser Freispruch von jeglicher Verschuldung wird
allerdings bloß pragmatisch begründet.
262
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
das Leben selbst. Dass wir es hier nicht mit einem logischen Widerspruch, sondern
mit einer gezielten Paradoxie zu tun haben, können wir nur dann sehen, wenn wir auf
die bestimmten grundlegenden Unterscheidungen verzichten, nämlich einerseits das
Gute dem Bösen, andererseits das moralisch Gute dem egoistisch-pragmatisch verstandenen Wohl entgegenzusetzen. Die Unterscheidung trifft hier nicht die Werte,
sondern die Perspektiven. Der vergebliche Widerstand des Einzelnen, des für sich
sorgenden und dem Tode ausweichenden Lebewesens ist gleichzeitig das Böse und
die Bedingung der Möglichkeit des Guten. Er ist die Suche nach dem „Besseren“ des
Lebens. Der Einzelne kann jedoch in diesem Kampf niemals Recht haben und niemals
siegen. Schon deshalb nicht, weil das Böse des Einzeln-Seins in die Bedingungen
seiner Suche nach dem Guten eingeschlossen ist. Indem er für das Gute kämpft,
bestätigt er das Böse. Aber auch umgekehrt: Da das Böse als Widerstand dem Unvermeidlichen gegenüber betrügerisch und vergeblich ist, kann der Kampf sich nur als
Betrug erweisen und damit auch den Sinn des Guten bestätigen, dass es nämlich aus
der Perspektive des Lebens das Böse nicht geben kann.
Das Gute als eine jedes Verständnis übergreifende Perspektive des Lebens bleibt
also für den Menschen immer unerreichbar. Dennoch ist die Forderung, den „Sinn des
Guten“ in sein Leben hineinzulegen, die Forderung, die gerade an den Einzelnen
gerichtet ist, deswegen nicht sinnlos und nicht leer. Wie der Vergleich mit dem
Augenschein des Himmelhorizonts zeigen sollte, ist die lebensnotwendige Illusion
durchaus ernstzunehmen – als Bedingung des Begreifens schlechthin. Was wäre
dann das Gute aus der beschränkten Perspektive des Einzelnen, der gegenüber dem
Leben nur im Unrecht sein kann? Was wäre das „Bessere“ des einzelnen Lebens?
Tolstois Antwort auf diese Frage ist wohl bekannt: Es wäre der Nicht-Widerstand dem
Bösen gegenüber, der nach Tolstoi den Kern der christlichen Lehre ausmacht. Wäre
das konsequenterweise nicht der Verzicht auf das eigene Leben? Ist das Gute für den
Einzelnen überhaupt möglich?
Das Gebot des Nicht-Widerstandes ist der Schlüsselpunkt von Tolstois Moralphilosophie. Er ist ohne Tolstois Auslegung des Evangeliums nicht zu verstehen. Ich
beschränke mich auf die entscheidenden Aspekte.
Im Anfang war das Verständnis des Lebens. Und das Verständnis wurde statt Gott. Und das
Verständnis wurde Gott. Es wurde zum Anfang von Allem statt Gott. (TGA 24, S. 25)101
Dies ist der berühmte Anfang von Tolstois Übersetzung des Johannesevangeliums.102
Sein Umgang mit dem Original war mehr als locker. Die Lüge habe sich mit der
101 Das Wort „разумение“ („Verständnis“) hat im Russischen dieselbe Wurzel wie das Wort „Vernunft“. Es ist, wie Tolstoi in seiner Übersetzung erklärt, die Tat der Vernunft („nicht nur die Vernunft,
sondern auch die Wirkung der Vernunft“ – „не только разум, но и действие разума“) (TGA 24,
S. 26).
102 Diese Übersetzung versuchte Tolstoi erst gar nicht in Russland zu veröffentlichen. Seine Verleger
im Ausland hat er gewarnt, dass diese Arbeit ihn selbst nicht zufriedenstellt, doch die Publikation hat
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
263
Wahrheit von Anfang an vermischt und solle jetzt von ihr getrennt werden. Tolstois
Kriterium ist dabei bezeichnenderweise nicht, wie bei dem Begründer der Reformation, eine historisch-philologische Überprüfung (welcher sich der russische Schriftsteller auch gern bediente, aber nur dann, wenn sie ihm behilflich war), sondern
allein, was vernünftig bzw. nützlich sein kann. Das Vernünftige im Evangelium aufzufinden sei eine Frage des Überlebens:
Wie seltsam sie [die Glaubenslehre – E.P.] mir auch bei meinem alten, harten Verstand vorkommt, sie ist die einzige Hoffnung auf Rettung.103
Das Kriterium für das Vernünftige sei ferner die Übereinstimmung aller Menschen.
Denn die Interpretation eines Textes, der Millionen von Menschen das wahre Leben
verschafft hat, kann nur die sein,
in der alle mit einander übereinstimmen. Übereinstimmen können dennoch alle nur dann, wenn
die Interpretation vernünftig ist. Wir alle, trotz der Unterschiede, stimmen einander zu nur darin,
was vernünftig ist.104
Tolstois Pathos über den allgemeinen Sinn des Guten, in dem alle Menschen in allen
Zeiten miteinander übereinstimmen, darf uns jedoch nicht irreführen. Denn es wird
sofort auf sich selbst beschränkt. Tolstoi will in den Evangelien aufsuchen, was ihm
„verständlich ist, denn keiner kann an das Unverständliche glauben“ (TGA 24, S. 17).
So steht seiner eigenen freien Auslegung der Weg offen, die Tolstoi als wahres
Christentum darstellen will, wobei „wahr“ wie immer „für meine Vernunft notwendig“
bedeutet. Alles, was außerhalb dieses Verständnisses des Notwendigen liegt, kann
niemals für mich brauchbar sein. Warum braucht man dann überhaupt Evangelien?
Weil das Verständnis des Lebens, so sieht es Tolstoi nach seiner Überprüfung, seinen
Sitz in einem Menschen gefunden hat, der nach ihm lebte und nach ihm starb. Darin
war dieser Mensch nicht der Einzige. Es gab auch zahlreiche andere, die das Licht des
Verständnisses in sich trugen. Doch in solcher Reinheit und Deutlichkeit wie bei
diesem Menschen hat sich das Verständnis nie gezeigt. Er war das Verständnis und
Sohn des Verständnisses. Er verkündete den Menschen, dass sie alle Söhne des
Verständnisses sind, wenn sie verstehen.105 Dieser Mensch ist Jesus Christus.
er am Ende erlaubt. Der Grund der Unzufriedenheit war, dass er seine Interpretation manchmal zu
offensichtlich dem übersetzten Text aufzwang (TGA 24, S. 8). Sein programmatisches und viel breiter
bekanntes Werk Mein Glaube enthielt nur noch Auszüge aus diesem fast dreimal so großen Werk, die
Tolstoi selbst als am besten gelungene Stellen betrachtete. Doch die Aufgabe, die Fälschung der frohen
Botschaft Christi zu enthüllen, zeigt sich in seiner Übersetzung, die eigentlich Auslegung ist, am
deutlichsten und ist in vielen Hinsichten systematischer durchgeführt. Tolstois polemische Einstellung
spitzt sich hier bis zum Äußersten zu.
103 Tolstoi, Meine Beichte, S. 136.
104 Tolstoi, Meine Beichte, S. 136
105 Ich bediene mich bewusst tautologisch-paradoxer Formulierungen, um Tolstois Gedanken wiederzugeben. Tolstois Tautologien sind kein stilistischer Mangel, sondern eine gezielt gewählte Form
264
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Was ist nun dieses Verständnis, das die Menschen zu Söhnen Gottes macht und
selbst göttlich ist? Was hat der Sohn des Verständnisses den Menschen offenbart? Nur
das, was sie selbst immer schon gewusst haben: Der Kampf um die Fortsetzung des
individuellen Lebens ist unvernünftig, und er ist das Böse. Mehr noch: Das Böse gibt
es nicht, außer jemand hält einen anderen für das Böse bzw. für eine Bedrohung des
eigenen Lebens. Folglich, wenn man das Böse überwinden will, gibt es nur einen
Weg – auf den Widerstand gegen das Böse zu verzichten. Nur dies wäre das Gute –
aus der begrenzten Perspektive eines Wesens heraus, das seine Endlichkeit und seine
unendliche Verschuldung vor dem Leben begriffen hat. Dieses Wesen sollte aufhören,
dem Betrug des Bösen zu dienen – dem Betrug, der die Selbsterhaltung durch den
Kampf verspricht.
Wenn es um einen Kampf gegen das nicht-radikale, sondern gegen das perspektivische Böse geht, so darf man nicht vergessen, dass kein tadelloser unschuldiger Held
diesen Kampf aufnimmt, sondern ein Schuldner, der selbst in den Betrug des Bösen
schon immer verwickelt ist. Es gibt für ihn keine Spontaneität, keinen Neuanfang –
auch nicht im Sinne des kantischen „als ob“. Für Tolstoi sind solche Annahmen nicht
mehr nötig, er will den radikalen Gegensatz von Gut und Böse nicht retten. Wenn der
Mensch den anderen Menschen widersteht und sie wie das Böse behandelt – das sie
ja tatsächlich sind, doch genauso wie er selbst –, bestätigt und bekräftigt er nur den
Betrug des Bösen, das Umsonst des Kampfes. In diesem Kampf kann es weder
Gerechte noch Ungerechte geben, es gibt keine Unschuldigen. Jeder, der ihn kämpft,
ist immer im Unrecht („Niemand ist gut als nur einer, Gott“ (Mk. 10; 18)).
Der Widerstand gegen das Böse sei hoffnungslos, weil er gerade der Seite die
Kräfte verleiht, die er bekämpfen will. Wie in einem Märchen bekommt das Ungeheuer
statt eines Kopfes, den der mutige Held abhackt, drei. Aber wie soll es möglich sein,
den Widerstand aufzugeben? Wäre das nicht gerade der sichere Tod? Gehört der
Widerstand selbst nicht zu den Bedingungen des Lebens? Ist das Böse ins Gute nicht
für immer und ewig eingeschrieben? „Für Gott ist nichts unmöglich.“ Diese Worte
Jesu, wie viele andere, wurden, so Tolstoi, auf erstaunliche Weise missverstanden und
im Sinne einer übernatürlichen Hilfe gedeutet, wo der klare irdische Sinn auf der
Hand liege. Um das Böse zu bekämpfen, soll der Mensch göttlich werden; er soll sein
einzelnes Schicksal, sein Leben und seinen Tod, aus der Perspektive des einzig
gerechten und wahren sehen können – aus der Perspektive des Lebens, das göttlich,
d. h. immer und ewig siegreich und gerecht ist.
Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. (Mt. 5; 48)
Durch das „Verständnis“ wird das Gute auch für den Einzelnen möglich. Der Mensch,
der sein Leben als Leben auf Pfand durchschaut, wird unvermeidlich die einzige
der Schriftstellerei. Sie entsprechen der ersten Tautologie: Der Sinn des Lebens kann nur dann dem
Leben gegeben werden, wenn das Leben sinnvoll ist.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
265
Wahrheit sehen: Es gibt weder das Böse noch den Tod. Seine eigene Vergänglichkeit,
die ihm ungerecht und bedauernswert vorkommt, wird dann von ihm als das Unvermeidlich-Gute „verstanden“ und gerechtfertigt. Und noch mehr wird er begreifen.
Nämlich, dass es nur der Widerstand gegen den eigenen Tod und der sich immer
vervielfachende Widerstand gegen den Widerstand im Kampf mit den Anderen ist, der
den Betrug des Bösen bestätigt. Aber gerade durch den Widerstand, der einem
widerfährt, kann man erfahren, inwieweit man von anderen Lebewesen abhängig ist.
Der Nicht-Widerstand wäre dementsprechend keine Verdoppelung des Widerstandes
und auch kein Kampf gegen den Betrug, sondern nur das Verständnis, dass eine
Unterscheidung von Gut und Böse aus der Perspektive des Lebens keinen Sinn macht.
Tolstois Philosophie wurde schon zu seiner Zeit als „die Philosophie des NichtWiderstandes“ bzw. als „die Lehre des Nicht-Tuns“ von seinen Kritikern bezeichnet.106 Und tatsächlich ist sie negativ-einschränkend: Das Gute bestehe immer in
einem unvollständigen Verzicht auf das Böse. Alle Gebote Jesu deutet Tolstoi im Sinne des Nicht-Tuns: Nicht-Widerstehen, Nicht-Kämpfen, Nichts-Für-Sich-Verlangen,
Nicht-Richten. Er wählt die „fünf Regeln“, die als Wegweiser für ein christliches Leben
dienen sollen. Sie sind alle negativ formuliert, nämlich als Verbote: „zürne nicht“
(kein Mensch verdient den Namen „raka“, „wahnsinniger“), „treibe keine Unzucht“
(der sexuelle Verkehr ist die Quelle aller Streitigkeiten und Habgier), „schwöre nicht“
(Verbot des Militärdienstes und aller Zivildienste, bei dem ein Mensch dem anderen
seine Verantwortung überlässt), „richte nicht“ (Verbot jeder Teilnahme an staatlicher
Gewalt) und „liebe die Feinde“.107 Das letzte Gebot scheint positiv zu sein und kein
Verbot zu enthalten. Doch Tolstoi fragt, wie früher Kant, wie die Liebe als Pflicht
gefordert werden kann. Wenn die Liebe ein Gefühl ist und als solche nicht geboten
werden kann, was bedeutet es, dass ich die Feinde lieben soll, wenn doch die Feinde
gerade die Menschen sind, die ich hasse? Wie an mehreren anderen Stellen löst Tolstoi
die Schwierigkeit durch die Entgegensetzung des Evangeliums und des Alten Testaments, d. h. des wahren Christentums und der Religion eines „partikularen Gottes“,
um einen neuen und „vernünftigen“ Sinn zu gewinnen. Die Feinde seien Feinde
des Volkes, der Nächste ist dagegen der Mensch aus demselben Volk. Eben diesen
Unterschied, der jedem jüdischen Schriftgelehrten klar war, habe der Gründer des
Christentums abgeschafft. Der eigentliche Sinn der fünften Regel lautet nach Tolstoi:
unterscheide nicht zwischen Völkern und Rassen, jeder Mensch kann dein Nächster
sein. Somit ist auch die letzte Regel, wie die anderen vier, negativ zu verstehen.
106 Vgl. Tolstois Aufsatz Неделание (Das Nicht-Tun) aus dem Jahr 1893. Eben dieses negative Verständnis des Guten haben russische Philosophen als erheblichen Mangel von Tolstois Denken getadelt,
denn „[…] er kennt nur das negative Gute, weiß, was es nicht ist, und weiß nicht, was es ist“, schreibt
einer der am mystischsten eingestellten russischen Philosophen, Nikolai F. Fjodorow (Николай
Ф. Федоров, Что такое добро? (Was ist das Gute?)).
107 Tolstoi, Mein Glaube, S. 146 f.
266
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Diese negativen Regeln Jesu zeigen, wie das Gebot des Nicht-Widerstehens nach
Tolstoi zu verstehen ist. Man darf gewisse Dinge nicht tun, wie nützlich sie für das
eigene Wohl auch scheinen mögen. Denn dieser Augenschein trügt. Wenn man aber
doch etwas „in einer schwachen Stunde“ getan hat, was nicht völlig zu vermeiden ist,
müsse man dies nicht bereuen, sondern dürfe nur nicht versuchen, es hinterher mit
guten Absichten auszuschmücken. Man solle bloß den Fehler anerkennen und ihn,
wo es möglich ist, korrigieren. Die Korrektur erfolge wiederum negativ, als NichtWiederholen-Wollen. Es gibt allerdings noch eine positive Regel bzw. eine christliche
Formel des Guten, die viel bekannter ist als das Gebot des Nicht-Widerstandes – die
sog. „goldene Regel“:
Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. (Mt. 7; 12)
oder:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. (Mt. 22; 39)
Doch auch sie lässt sich nach Tolstoi sehr wohl negativ reformulieren: Tue den
anderen nicht das, was du dir nicht wünschst. D. h.: tue nichts, was den Betrug des
individuellen Lebens bekräftigt; lass dich nicht von den scheinbaren Vorteilen des
Kampfes betrügen. Da in den anderen das Licht des Verständnisses leuchtet, seid ihr
eins, wie Gott und sein Sohn, wie das Verständnis und der Sohn des Verständnisses
eins sind.
Es ist hier äußerst wichtig, den Unterschied zwischen Tolstois Interpretation der
„goldenen Regel“ und dem kantischen kategorischen Imperativ nicht zu übersehen,
aber auch nicht zu übertreiben. Denn der Unterschied ist, wie fast immer bei Tolstoi,
subtiler, als er auf den ersten Blick erscheinen mag, und er könnte in gewissem Sinn
sogar aufgehoben werden. Die Gemeinsamkeiten sind bedeutend. Erstens ist in beiden Fällen bloß das Kriterium des Handelns gegeben, welche Folgen dieses für den
Handelnden auch haben mag. Zweitens sind beide negativ-einschränkend. Auch der
kategorische Imperativ lässt sich sehr wohl negativ reformulieren: Man darf nichts
tun, was man als allgemeines Gesetz nicht will, d. h. man darf bei sich keine Ausnahme
machen.108 Dennoch scheint das Kriterium für die „goldene Regel“ im Unterschied
zum kategorischen Imperativ empirisch zu sein. Es darf (nicht) getan werden, „was du
dir selbst (nicht) wünschst“ – und nicht: „was du als allgemeines Gesetz (nicht)
wollen kannst“. Im ersten Fall haben wir ein empirisches Kriterium der Selbstliebe, im
zweiten das vernünftige Kriterium der Allgemeinheit. Doch ist der Unterschied auch
in dieser Hinsicht nicht so radikal, wie es scheinen mag. In beiden Fällen geht es
108 Man kann z. B. nur lügen, wenn die Wahrhaftigkeit als allgemeine Regel erwartet wird. Die Lüge
kann nur Ausnahme sein.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
267
eigentlich um mein vernünftiges Wollen, um die nicht-beliebige, aber auch um die die
eigene Beschränktheit niemals überschreitende Perspektive des Einzelnen. Im Kapitel
zu Kant wurde es ausgeführt: Nur das, was ich als Allgemeines wollen kann, gilt als
Kriterium für meine Maxime. Wie ich jedoch meine Maxime formuliere, wie ich die
niemals tadellos durchführbare Prozedur der Reinigung von allem Empirischen in
Gedanken vollziehe, ist immer mit dem Wollen verbunden, das sich zwar als vernünftiges Wollen versteht, doch dies nur aus der ästhetisch-beschränkten Perspektive
des Handelnden.109 Am Ende muss die sich selbst richtende Vernunft zum härtesten
aller Richter werden – im Gewissen, dessen Richtschnur Kant wiederum nur negativ
formulierte: Keine Handlung darf unternommen werden, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie ungerecht sei. Diese Möglichkeit ist jedoch immer vorhanden.
Die Wünschbarkeit ist also in beiden Fällen – in dem des kategorischen Imperativs und in dem der „goldenen Regel“ – das Kriterium des Guten, solange die Entscheidung mit einem Standpunkt in einer konkreten Situation verbunden bleibt. Das
kantische vernünftige Wollen schließt sie genauso wenig aus wie das evangelische
Für-Sich-Wollen, aber mit einem, wenn auch subtilen, jedoch entscheidenden Unterschied: Der kategorische Imperativ gebietet sie möglichst auszuschließen; die goldene
Regel tut es nicht. Im kategorischen Imperativ ist die möglichst vollständige Reinigung
von allem Empirischen geboten und angestrebt, die goldene Regel sieht sie als unmöglich und überflüssig an. Die kantische Plausibilität gilt hier nicht. Tolstoi, der von
anderen Plausibilitäten ausgeht, sucht allerdings eine Versöhnung zwischen den
beiden Moralprinzipien – eine Versöhnung, die die Differenzen zwischen ihnen ans
Licht bringt. Wenn das vernünftige Wollen immer auch pragmatisches Wollen ist,
wenn die Vernunft kein spontanes Vermögen, sondern das Verlangen nach dem Sinn
des eigenen Lebens zum Ausdruck bringt, so muss auch der Unterschied zwischen
dem Kriterium der vernünftig gewollten Allgemeinheit und dem der Selbstliebe verschwinden. Genauer gesagt, der Unterschied wird beweglich, er wird zu einem perspektivischen Unterschied: Das Allgemeine sei ein Wunsch des Einzelnen – ein Wunsch,
der nur dann gut ist, wenn er aus der Perspektive seiner eigentlichen Not Befriedigung
verspricht. Das Allgemeine, das frei von der besonderen Beschaffenheit des Einzelnen,
frei von seinen Nöten und Wünschen wäre, lässt sich nicht mehr denken.
109 Am klarsten wird es am vierten Beispiel Kants in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, nach
dem man den anderen die Hilfe nicht verweigern dürfe. Kant sieht dabei wohl ein: Es „könnte
allerdings, wenn eine solche Denkungsart [jeder ist nur auf sich selbst angewiesen – E.P.] ein allgemeines Naturgesetz würde, das menschliche Geschlecht gar wohl bestehen und ohne Zweifel noch
besser, als wenn jedermann von Theilnehmung und Wohlwollen schwatzt“ (GMS, AA 4, S. 423).
Dennoch könne eine solche Maxime nicht als moralisch betrachtet werden: „Aber obgleich es möglich
ist, daß nach jener Maxime ein allgemeines Naturgesetz wohl bestehen könnte: so ist es doch
unmöglich, zu w o l l e n, daß ein solches Princip als Naturgesetz allenthalben gelte.“ (GMS, AA 4,
S. 423) Und das aus einem einfachen Grund: Weil dann der Mensch „sich selbst alle Hoffnung des
Beistandes, den er sich wünscht, rauben würde“. Das letzte Kriterium ist also das Kriterium des
Wollens, die Wünschbarkeit.
268
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Der allgemeine Maßstab wird somit von Tolstoi, der durch seine Formulierungen
manchmal verwirrt, nur scheinbar anerkannt, wenn auch immer wieder angedeutet:
Alle Menschen müssen in der Vernunft übereinstimmen; das Gute verstehe man immer
gleich. Diese Deklarationen dürfen uns, wie schon oben gesagt, nicht irreführen, da
wir uns sonst in Widersprüche verwickeln, wie schon mehrere Opponenten Tolstois,
die entweder das Christentum vor Tolstoi oder Tolstoi vor dem Christentum verteidigten bzw. entweder Tolstois Ansichten als Tyrannei der Moral oder aber als unmoralisch
und gottlos angriffen. Widersprüche zeigen sich bei Tolstoi wirklich. Sie lassen jedoch
erkennen, wie sein Denken sich zwischen den von ihm anerkannten philosophischen
Autoritäten bewegt. Durch sie wird ersichtlich, dass Tolstois Gedanken etwas andeuten, was aus seinen Quellen nicht stammen, sondern nur aus seinem eigenen originellen Denkansatz folgen konnte – dem Ansatz, den der russische Schriftsteller wiederum
nicht als den seinigen, sondern als den von vielen anderen Denkern aller Zeiten und
Völker darstellen wollte. Es ist für unsere Aufgabe äußerst wichtig, Tolstois grundlegende Gedanken nicht misszuverstehen: Die Not des Einzelnen, der nach dem Sinn
fragt, kann nicht durch die allgemeine Forderung befriedigt werden; die Vernunft, die
ohne Sinn nicht auskommen kann, drängt sich nicht im gleichen Maß bei allen Menschen
auf; das Gute verstehen Menschen immer unvollkommen; die gefundene Wahrheit des
Lebens ist keine allgemeine, sie ist nicht einmal mitteilbar.110
Das Problem der Allgemeinheit behandelte Tolstoi unmittelbar am Beispiel desselben Cajus, dessen Sterblichkeit schon lange vor ihm zum Modell eines einzelnen
Urteils wurde, das aus dem allgemeinen Prinzip gewonnen wird. Tolstoi betrachtet
den Fall als Schriftsteller und als solcher findet er einen ‚Fehler‘ in der strengen Logik
der Philosophen. So empfindet ein Mensch, der vor seinem eigenen Tod steht:
Jenes Beispiel eines Vernunftschlusses, das er in der Logik von Kiesewetter gelernt hatte: Cajus
ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, folglich ist Cajus sterblich, war ihm sein Leben lang
richtig erschienen, aber nur im Bezug auf Cajus, durchaus nicht im Bezug auf sich selber. Jener
war der Mensch Cajus, ein Mensch im allgemeinen, und das war vollkommen gerecht; aber er war
nicht Cajus und nicht ein Mensch im allgemeinen, er war stets ein ganz, ganz besonderes Wesen,
anders als alle anderen gewesen; er war doch Wanja gewesen, mit Mama, mit Papa, mit Mitja und
Wolodja, mit seinem Spielzeug, mit dem Kutscher, der Kinderfrau, dann später mit Katenka, mit
allen Freuden, Kümmernissen, Wonnen der Kindheit und der Jugend. […]
Und Cajus war wirklich sterblich, und folglich mußte er sterben, aber für mich, für Wanja,
für Iwan Iljitsch, mit all meinen Gefühlen, Gedanken – für mich ist das etwas ganz anderes. Und
es kann nicht sein, dass ich sterben muß. Das wäre zu schrecklich.111
110 Vgl. „Nein, ich werde ihr [seiner Frau – E.P.] nichts sagen, beschloß er [Lewin – E.P.] […]. Es ist ein
Geheimnis, das nur für mich etwas bedeutet und von Wichtigkeit ist und sich nicht in Worten
ausdrücken läßt.“ (Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 606) Dass das Verständnis, das hier erreicht
wurde, weder mit der eine Mitteilbarkeit anstrebenden Urteilskraft Kants noch mit der Einsicht
Spinozas gleichgesetzt werden kann, dürfte schon klar geworden sein.
111 Leo Tolstoi, Der Tod des Iwan Iljitsch, Bd. 2, (Späte Erzählungen 1886–1910), S. 88 f.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
269
Dieses Sich-Widersetzen gegen die Logik der Allgemeinheit, von der der berühmte
Cajus nur noch ein Sonderfall war, klingt zwar unvernünftig, jedoch überzeugend.
Aber nur wenn der Fall von Cajus auf die eigene Person angewandt wird. Nur angesichts des eigenen Todes, so Tolstoi, wird jeder Mensch verzweifelt ausrufen: Das ist
aber Cajus, und für ihn ist es auch richtig und gerecht, doch nicht für mich! Das
allgemeine Prinzip bricht zusammen, weil ich für mich kein Sonderfall einer Regel,
sondern ein Einzelfall bin, eine einzigartige Beziehung des Endlichen zur Unendlichkeit. Auf die Frage, warum ich mich dem Allgemeinen opfern muss, kann also
unmöglich eine Antwort gegeben werden: „Du darfst dir keine Ausnahme machen“ –
weil ich für mich schon immer eine Ausnahme bin. Nur Cajus in seiner standardisierten Lebenssituation kann unzähligen anderen hypothetischen Menschen gleichgestellt werden. Jeder meiner Gedanken, jeder meiner Wünsche, jede Bewegung
meiner Seele, jede Entscheidung, die ich treffe und natürlich auch jede Tat, die ich
begehe, ist dagegen unwiderruflich einmalig. Mit der Abstraktion „der Mensch“
haben sie nichts gemeinsam.112
Das Allgemeine kann damit kein Kriterium des Moralischen bzw. Vernünftigen
sein. Aber auch die Liebe zum Nächsten als bloße Neigung und Gutmütigkeit wäre
noch nicht das Gute. Wenn es Tolstoi selbst vielleicht nicht immer klar war, so ging es
ihm doch nicht um die Stellung gegenüber den anderen im Sinne der Wohltätigkeit
oder des Mitleides, sondern allein um die Stellung zum eigenen Leben und Tod, zum
eigenen Leiden und Begehren. Die Erfahrung angesichts des Todes, wie spät das
Verständnis auch kommen mag, sei deshalb immer wichtiger als das, was man im
Leben schuf. Als Andrei Bolkonski oder der viel weiter vom Verständnis entfernte
Iwan Iljitsch die Vergeblichkeit der Sorgen um das Wohl der Familie und des Widerstandes gegen den Tod erkennen, entgehen sie der Verzweiflung.
Und der Tod? Wo ist er? Er suchte seine frühere gewohnte Angst vor dem Tode und fand sie nicht
mehr. Wo war der Tod? Es war keine Furcht mehr vorhanden, weil auch der Tod nicht mehr
vorhanden war.
Anstatt des Todes sah er ein helles Licht.
‚Also so ist es!‘ sagte er plötzlich laut. ‚Welche Freude!‘ […]
‚Es ist zu Ende!‘ sagte jemand über ihm. Er hörte diese Worte und wiederholte sie in seiner
Seele. ‚Der Tod ist zu Ende‘, sagte er sich. ‚Er ist nicht mehr da.‘ Er zog die Luft in sich ein, hielt
mitten im Atemzug inne, streckte sich und starb.113
Ja, der Tod ist ein Erwachen, blitzte es plötzlich in ihm auf und der Vorhang, der ihm das
Unbekannte bis jetzt verhüllt hatte, hob sich vor seinem geistigen Blick.114
112 Gerade diese Betonung des Individuellen und seiner unwiderruflichen Einmaligkeit wirkte irritierend auf Tolstois Zeitgenossen. Vgl. „Sie können den Zauberkreis des eigenen ‚Ich‘ niemals verlassen.“
(Новоселов, Открытое письмо графу Л.Н. Толстому, S. 381)
113 Tolstoi, Der Tod des Iwan Iljitsch, S. 114.
114 Lew Tolstoi, Krieg und Frieden, Bd.Bd. 2, S. 490.
270
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Dies ist das Erwachen von dem Betrug des persönlichen, einzelnen, auf Widerstand
gebauten Lebens, das erreichte Verständnis angesichts des Todes und damit auch die
Rettung aus der Not. Sie kann niemals zu spät kommen.
Die Metapher des Erwachens weist deutlich auf Tolstois buddhistische Quellen,
aber auch auf Schopenhauer und auf Sokrates hin. Jedoch unterscheidet sich Tolstois
Schluss von all diesen Quellen.115 Das Leben, auch das eines Einzelnen, ist nicht das
Böse, es scheint nur so zu sein, wenn dieser das Leiden und den Tod als das Böse
empfindet.116 Das Wiedererwachen ist natürlich auch kein Erwachen im Jenseits, denn
Tolstoi wies, viel radikaler als Kant, jede Art des Glaubens an das Jenseits bzw. an das
höchste Gut nicht nur als Triebfeder, sondern auch als Hoffnung entschieden zurück.
Es ist ein Erwachen des Verständnisses, dass es weder den Tod noch das Böse geben
kann. Wer dies verstanden hat, kann zum Betrug des Bösen – zum Kampf um das
Überleben – nicht mehr zurück.
Man missversteht Tolstoi also grundsätzlich, wenn man seine Ausführungen im
Sinne des gutmütigen Predigens der Nicht-Gewalt und gegenseitiger Hilfe deutet, wie
etwa das Mitleid bei Schopenhauer, das Tolstoi gerade als unzureichend und sogar
widersinnig zurückwies.117 Es ging ihm überhaupt nicht darum, dem anderen in
seinen leiblichen Nöten, d. h. ihm zu einem Verharren im Leben zu verhelfen und
damit den Betrug des Widerstandes auf den anderen zu übertragen. Alle Einwände,
dass man die Schwachen verteidigen müsse, sind auf Tolstois Unverständnis gestoßen. Der Sinn des Lebens wäre sicherlich verfehlt, wenn wir Tod und Leiden immer
noch für die eigentlichen Übel gehalten hätten.118 Dennoch oder gerade deswegen
darf der Einzelne nicht zum Mittel des Allgemeinen, sei es durch das friedliche
Zusammenleben oder das allgemeine Gesetz, herabgesetzt werden.
Das persönliche Leben kann keinen Sinn haben, denn es vergeht. Der Kampf um
das Dasein ist vergeblich. Alles, was bleibt, ist das Nicht-Tun, d. h. nicht zu kämpfen,
dem Bösen und dem Tod nicht zu widerstehen. Die Liebe zum Nächsten in tolstoischer
Interpretation ist das Aufgeben des Kampfes, das im Interesse des Einzelnen wurzelt. Sie
ist vernünftig, doch nur weil das Gegenteil sicherlich sinnlos wäre, weil der Wider-
115 Ich verweise an dieser Stelle auf eine anschlussreiche Untersuchung der mythologischen und
sozialethischen Quellen Tolstois: Christian Bartolf, Ursprung der Lehre vom Nicht-Widerstehen. Über
Sozialethik und Vergeltungskritik bei Leo Tolstoi.
116 Vgl. in der Alltagslektüre die Stelle, an der Tolstoi Schopenhauers Gedanken wiedergibt, der Tod
sei Freude und Erlösung für den, der auf den Willen zum Leben willig verzichte. Am Rand seines
Exemplars schreibt Tolstoi: „Wie gut! Ich würde dennoch die Wörter: ‚[verzichtet auf] den Willen zum
Leben‘ – mit den Wörtern – ‚verzichtet auf das persönliche Leben‘ ersetzen“ (TGA 45, S. 476). Nur das
eigene Einzel-Sein solle verleugnet werden.
117 Vgl. Tolstois Zurückweisung des Gedankens, dass Jesus Mitleid mit den Schwestern von Lazarus
hatte: „es ist etwas Nicht-Göttliches“ (TGA 24, S. 496).
118 Diese klare These wird in Reich Gottes ist inwendig in euch ausgeführt und hat für große moralische Empörung unter den russischen Philosophen gesorgt. Vgl. Владимир С. Соловьев (Wladimir S.
Solowjow), Три разговора (Drei Gespräche).
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
271
stand bloß eine Dummheit ist.119 Schließlich ist Tolstois Antwort auf die persönliche
Frage des Lebens verblüffend, weil sie entweder tautologisch oder paradox (oder
beides zugleich) klingt: Den Sinn seines Lebens findet der Mensch nur dann, wenn er
versteht, dass es gerade als einzelnes Leben keinen Sinn haben kann, wenn er den
Kampf um seine Selbsterhaltung aufgibt. Je näher man also dem Tod ist, desto vollkommener kann der Sinn des Lebens verstanden werden.
Für die Untersuchung der Plausibilitäten sind aber nicht die letzten paradoxen
Schlussfolgerungen (und in der letzten Konsequenz wird vielleicht jede Philosophie
paradox), sondern die Voraussetzungen von Bedeutung. Diese wurden bereits angedeutet: die Not des Einzelnen als einziges Kriterium des wahren Glaubens, die NichtRadikalität des Guten und Bösen, das Perspektivische der nach dem Sinn fragenden
Vernunft, die Legitimität der Wünschbarkeit. Im Gebot des Nicht-Widerstandes wird
das negative Kriterium von Tolstois Moral aus Vernunft zum Ausdruck gebracht und
das Primat des Einzelnen vor jeder allgemeinen Forderung der Moral festgelegt.
Für gewöhnlich folgte die gegen Tolstoi und seine Lehre des Nicht-Widerstandes
gerichtete Argumentation ungefähr derselben Logik: Was wird aus der Gesellschaft,
wenn keiner dem Bösen widersteht? Wäre es nicht der Weltuntergang, der Zusammenbruch des friedlichen Menschenlebens? Wenn man wirklich den anderen unter keinen
Umständen das zufügen darf, was man für sich nicht will, würde das nicht den
Verzicht auf das organisierte Zusammenleben bedeuten: man dürfe niemanden töten,
einsperren, vor Gericht anklagen oder gar in seinen Forderungen zurückweisen, und
das ohne Rücksicht auf Umstände oder Konsequenzen? Gerade dies wollte Tolstoi
durchsetzen, indem er offen und konsequent gegen alle gesellschaftlichen Institutionen vorging, von der Familie bis zur Armee, und alles, was zur Kultur gehört – Staat,
Kirche, Wissenschaft, Gerichte –, zu den leblosen Götzen zählte: „Christus aber spricht
gerade gegen diese.“120 Auf den Einwand, dass das Böse durch den Nicht-Widerstand
gerade begünstigt wird, entgegnete Tolstoi im Sinne des moralischen Gesetzes Kants,
das nun in die Perspektive eines einzelnen nach dem Sinn des eigenen Lebens verlangenden Menschen gestellt wurde: Nicht nur, dass die Folgen kein Argument gegen
das Gesetz sein können, das dem Leben Sinn verleiht, sondern – noch viel wichtiger –
diese Art Argumentation ist selbst betrügerisch. Denn sie setzt voraus, dass der
Einzelne durch den Widerstand gegen das Böse etwas erreicht bzw. sein Leben
absichert.121 Sie ist darüber hinaus nach ihrer eigenen Logik nichtig. Denn wenn
119 Vgl. „Christus lehrt die Menschen keine Torheiten zu begehen.“ (Tolstoi, Mein Glaube, S. 255)
120 Tolstoi, Mein Glaube, S. 67 f.
121 So führen die schon angedeuteten Diskrepanzen mit Spinoza zu einem entscheidenden Unterschied. Denn indem Spinoza die Unterscheidung von Gut und Böse ebenso perspektivisch deutet,
gründet er die Tugend auf den Wunsch zum Verharren bzw. der Selbsterhaltung, der nach ihm
vernünftig sei. Als Folge werden die staatliche Gewalt und das Richten, obwohl es nichts für sich
Gerechtes und Ungerechtes geben kann, gerade gerechtfertigt (Baruch de Spinoza, Die Ethik nach
geometrischer Methode dargestellt, S. 222 f. (Teil IV, Lehrsatz 37, Anm. 2)).
272
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
tatsächlich alle Menschen das Böse als Betrug und Beschränktheit der eigenen Sicht
verstünden und den Widerstand aufgäben, würde ewiger Friede bzw. das Reich Gottes
auf Erden anbrechen und gar kein Böses mehr sein. Das Problem entsteht nur, wenn
einige Widerstand leisten und andere eben nicht, d. h. wenn nicht alle den Widerstand
gegen das Böse aufgeben. Indem man gegen die Lehre des Nicht-Widerstandes argumentiert, heuchelt man also, es ist wieder eine „Mogelei der Vernunft“. Man will
Garantien für das eigene Wohl für den Fall, dass sich nicht alle Menschen dem Guten
anschließen, und vergisst dabei, dass dieses Wohl durch nichts garantiert werden
kann, außer durch den Nicht-Widerstand selbst bzw. durch das negative Wohl, das
nur dem Verständnis entspringt.122 Man will im Grunde etwas Widersprüchliches
herausfinden. Ungefähr so, als ob man gefragt hätte: Kann der Nicht-Widerstand als
allgemeines Gesetz von mir gewollt werden, wenn ihm nicht alle folgen werden? Die
Antwort wird immer negativ sein, aber nur weil die Frage falsch gestellt wurde. Ganz
anders kann die Antwort auf die Frage „Kann ich es als allgemeines Gesetz wollen?“
oder, nach Tolstoi, „Kann ich es für mich als Einzelnen wünschen, dass der Widerstand dem Bösen gegenüber aufgegeben wird?“ immer nur positiv ausfallen. Mehr
noch: Es ist das einzige allgemeine Gebot, das mit dem Wunsch des Einzelnen tatsächlich zusammenfällt. Denn jeder leidet sowohl am Widerstand vonseiten der anderen
als auch am eigenen Widerstand den anderen und dem Tod gegenüber.
Die Argumentation zugunsten der Möglichkeit des Nicht-Widerstandes, die Tolstoi wegen mehrerer Angriffe immer wieder neu herausarbeiten musste, führte ihn so
am Ende zu folgendem Schluss: Von der Not des Einzelnen her, der das Umsonst des
Kampfes und die eigene Vergänglichkeit begriffen hat, sieht das Gebot des NichtWiderstandes nach der einzig sinnvollen Formulierung des moralischen Gesetzes aus,
d. h.: nach der einzig sinnvollen Anwendung des kategorischen Imperativs.123 Es ist auch
die einzig denkbare Moral, die gleichzeitig absolut und perspektivisch ist. Obzwar die
Strenge der eigenen moralischen Forderung nicht relativiert wird, kann man sich
selbst aus ihr heraus niemals als gut und gerecht verstehen und die anderen für böse
erklären. Denn bezeichnet man den anderen als böse, wird man selbst zum Bösen. Ein
Christ kann darum den anderen – den Bösen – nur dadurch helfen, dass er sie zum
Verständnis führt.
Und darum, je mehr Übel diese Menschen einem Christen zufügen, um so weiter sind sie von der
Wahrheit entfernt, um so unglücklicher sind sie und um so notwendiger ist für sie die Erkenntnis
der Wahrheit. Den Menschen die Erkenntnis der Wahrheit übermitteln kann aber der Christ nicht
anders, als daß er sich jeder Verirrung enthält, in der sich die Menschen befinden, die ihm Böses
zufügen, und Böses mit Gutem vergilt. Und darin allein besteht die ganze Pflicht des Christen und
122 Vgl. „Ist es denn nicht sinnlos, sich um etwas zu mühen, was trotz allen Fleißes nie vollendet
werden kann? Immer wird der Tod früher eintreten, als der Turm eines weltlichen Glücks vollendet sein
wird.“ (Tolstoi, Mein Glaube, S. 180 f.)
123 Vgl. Tolstois Lob von Kants Genie und des kategorischen Imperativs in Die Religion und die
Sittlichkeit (TGA 39, S. 20 f.).
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
273
die ganze Bedeutung [der ganze Sinn – E.P.] seines Lebens, die selbst durch den Tod nicht
vernichtet werden kann.124
Dieses perspektivisch-negative Gut ist das einzige, was nach Tolstoi dem Einzelnen
zugänglich ist und gleichzeitig seinem eigentlichen Interesse, dem Interesse seiner
Vernunft, entspricht. Es ist die Moral aus Vernunft, jedoch aus einer Vernunft, die nun
angesichts der Not des einzelnen Lebens die eigene Beschränktheit begreift und aus
ihr heraus unersättlich nach dem eigenen Wohl strebt.
Die Freiheit und der Endzweck des Lebens
Die Diskrepanzen zwischen Tolstois und Kants Gedankengängen sind nun, trotz der
Gemeinsamkeiten, ans Licht gekommen. Nicht das Prinzip des vernünftigen Willens
wird zum Maßstab des Guten erklärt, sondern allein die Einsicht in die eigene
Abhängigkeit und Vergänglichkeit bzw. das Verständnis, dass der Widerstand gegen
das Böse keinen Sinn macht. Damit entfällt eine wichtige Voraussetzung der kantischen Moralphilosophie: die Idee der Autonomie der Vernunft bzw. der Freiheit des
Willens. Gerade diese Annahmen würden nach Tolstoi der einzigen Bedingung widersprechen, unter der die Vernunft überhaupt zu gebrauchen ist, – der Nötigung, den
Bezug zum Unendlichen im eigenen Leben herzustellen. Das Vergessen der eigenen
Abhängigkeit ist das, was die Not verursacht und das Leben hindert. Diese Vergesslichkeit wird gerade durch den Betrug des freien Willens begünstigt – des Willens, der
angeblich willkürlich zwischen Gut und Böse wie zwischen gleich möglichen Alternativen wählt und sich jede Handlung nachträglich zuschreibt.
Der Bruch mit der Grundlage der praktischen Philosophie Kants, der Idee der
Freiheit des Willens, hatte unmittelbare Konsequenzen nicht nur für Tolstois Moralphilosophie, sondern auch für seine Deutung des Rechts.125 Eine der bekanntesten
Folgen von Tolstois religiöser Wende war gerade sein leidenschaftliches Auftreten
gegen Institutionen des staatlichen Rechts. Durch das Richten und durch die Gewalt
im Namen des Allgemeinwohls sei das Übel in dem Maße verbreitet worden, wie es nie
124 Tolstoi, Mein Glaube, S. 335 f.
125 Wie weit Tolstois Deutung der Frage von Kants entfernt ist, wird erstaunlicherweise oftmals
übersehen. Z. B. sieht Krouglov keinen radikalen Unterschied zwischen Tolstois und Kants Deutung der
Willensfreiheit und stellt bloß manche Ungenauigkeiten in Tolstois Kant-Interpretation fest, die er dem
Einfluss Schopenhauers zuschreibt (Krouglov, Leo Nikolaevitč Tolstoj als Leser Kants, S. 371). Er
beachtet dabei nicht, dass Tolstoi seine Idee, der freie Wille sei der Grundirrtum und die Einsicht in die
eigene Abhängigkeit sei die eigentliche Erlösung von der Not, v. a. Spinoza zu verdanken hatte. Die
Idee der Freiheit im Verständnis der eigenen Gebundenheit und der Vergeblichkeit des Widerstandes
führte jedoch bei Tolstoi, anders als bei Spinoza, zur Ablehnung der auf der Idee der Freiheit des
Willens begründeten Institutionen des Staates und des Rechts. Der Einzelne sieht sich bei Tolstoi
genötigt, aus seinem Verständnis Konsequenzen zu ziehen, wie gefährlich sie auch sein mögen.
274
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
durch die Verbrechen, die bekämpft werden sollen, erreicht werden könnte. Ein Christ
dürfe deshalb weder Richter noch Soldat sein. Die christliche Lehre verbiete ausdrücklich das Richten und die gegenseitige Vernichtung. Es geht hier jedoch nicht, wie man
vermuten könnte, bloß um eine besondere Situation des russischen Reiches gegen
Ende des 19. Jahrhunderts (die, wie wir sehen werden, von Dostojewski viel positiver
eingeschätzt wurde), sondern um die grundlegenden Plausibilitäten in Tolstois Moralphilosophie. Die Institutionen des Staates und des Rechts sind in zweierlei Hinsicht als
das Böse anzusehen: weil sie zum einen den Einzelnen zum Mittel des Allgemeinwohls
herabsetzen, indem sie „an Stelle der persönlichen Frage […] eine allgemeine“ stellen,126 und zum anderen, weil sie den Widerstand gegen das Böse zum Prinzip dieses
Wohls erklären. Der Einzelne wird dadurch nicht nur jeder Verantwortlichkeit für das
Böse, an dem er teilhat, enthoben, sondern hält dieses für das Gute, als handle es sich
um das Gemeinwohl bzw. um die allgemein-notwendigen Normen des Zusammenlebens. Nur durch die Befreiung von dem doppelten Betrug der mit den anderen
geteilten Verantwortung für den Widerstand gegen das wie auch immer verstandene
Böse kann der Einzelne das Wohl des eigenen Lebens wiederentdecken.
Das mächtigste Mittel des Betrugs ist gerade die Idee des freien Willens bzw. der
aus diesem Willen entstehenden Kausalität. Der Betrug liege nicht bloß in der Voraussetzung der Freiheit (denn ihre Realität kann auch schon nach Kant bezweifelt
werden), sondern in ihrem Begriff.
Die Freiheit des Willens, sagt unsere Philosophie, ist eine Illusion, und ist stolz auf die Kühnheit
dieser Behauptung. Die Freiheit des Willens ist aber nicht nur eine Illusion, sie ist ein Wort ohne
alle Bedeutung, ein Wort, das Theologen und Kriminalisten erfunden haben und dieses Wort
widerlegen heißt gegen Windmühlen kämpfen.127
Am Beispiel der großen historischen Ereignisse zeigt Tolstoi mit der ganzen Kraft
seines künstlerischen Talents, wie nichtig alle Ausführungen sind, die ein Geschehen
aus dem Willen eines Menschen erklären wollen. So steht in Krieg und Frieden:
Was bewirkte diesen außerordentlichen Vorgang? Welches waren seine Ursachen? Die Historiker
geben mit naiver Sicherheit folgende Ursachen an: das dem Herzog von Oldenburg zugefügte
Unrecht, die Durchbrechung der Kontinentalsperre, Napoleons Machtgier, Alexanders Unbeugsamkeit und die Fehler der Diplomaten. […] Man kann es verstehen, daß sich dem Blick der
Zeitgenossen diese und noch ungezählte ähnliche Umstände als Kriegsursachen darstellten,
Umstände, deren unübersehbare Menge der unübersehbaren Menge menschlicher Standpunkte
und Auffassungsmöglichkeiten entspricht; uns Nachgeborenen aber, die wir die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs in ihrem ganzen Umfang zu überschauen vermögen und seine furchtbare, klar
zutage liegende Bedeutung erkennen, müssen die angeführten Umstände samt und sonders als
unzulänglich erscheinen. Wir können es nicht verstehen, daß Millionen von Christenmenschen
einander nur deswegen getötet und gequält haben sollen, weil Napoleon machtgierig, Alexander
126 Tolstoi, Mein Glaube, S. 297.
127 Tolstoi, Mein Glaube, S. 164.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
275
unbeugsam, die englische Politik verschlagen war oder weil der Herzog von Oldenburg in seinen
Rechten verletzt wurde. […] Wir Nachgeborenen, die wir keine Historiker sind und die wir unseren
gesunden Menschenverstand bei Betrachtung dieses Vorgangs von keiner Forscherbegeisterung
umnebeln lassen, erkennen eine unübersehbare Menge von Ursachen […] Nichts hätte geschehen
können, wenn auch nur eine einzige dieser Ursachen ausgeblieben wäre.128
Merken wir uns diese „gesunde“ Position, aus deren Perspektive man „Milliarden von
Ursachen“ sieht, von denen keine als Grund des Geschehens verstanden werden
kann, am allerwenigsten aber das Wollen eines Menschen. Indem Napoleon oder
Alexander beanspruchen, dass der Krieg nach ihrem Willen angefangen wurde, sind
sie gerade, so Tolstoi an dieser Stelle, „Sklaven der Geschichte“.
Später wird Tolstoi der Pseudowissenschaft Geschichte vorwerfen, dass sie, ohne
nach dem Sinn des Lebens zu fragen, jeder Ereignisreihe ein Grund-Zweck-Verhältnis
unterstellt. Um die unendliche Reihe der kausalen Verhältnisse abzuschließen, setzt
sie dann den letzten Grund im Willen eines Menschen an. Der Einzelne wird dabei aus
den Lebensbedingungen herausgenommen und beliebig (weil es kein Kriterium für so
eine willkürliche Annahme geben kann) zu der rein spontanen Quelle der Bewegungen der Lebenswelt erhoben, d. h. er wird vergöttlicht, denn sein Wille entspringe
gleichsam aus dem Nichts und schöpfe neue Welten. Der Mensch sei dagegen in
Wirklichkeit selbst in eine unendliche Reihe von Bedingungen verwoben, die für ihn
weder durchschaubar noch verfügbar sein können.
Die Handlungen Napoleons und Alexanders, von denen es anscheinend abhing, ob das Geschehen seinen Lauf nahm oder nicht, waren ebenso wenig von ihrem Willen bestimmt wie die
Handlungen jedes beliebigen Soldaten, der in den Krieg ging, weil ihn das Los zum Militärdienst
bestimmt hatte oder weil er ausgehoben worden war.129
Man kommt in der Geschichte um den Fatalismus nicht herum, wenn man nach Erklärungen
für unvernünftige Erscheinungen sucht, das heißt für Erscheinungen, deren Vernünftigkeit wir
nicht zu begreifen vermögen.130
Die Geschichte ist dieses Fatum, worin der Mensch zum „Werkzeug“ und seine
scheinbar willkürlichen und freien Handlungen zu etwas „[V]orausbestimmte[m]“
werden.131 Ob dieses Fatum nun Gott, Schicksal oder zufälliges Zusammentreffen
genannt werden soll, blieb in Krieg und Frieden offen.
128 Tolstoi, Krieg und Frieden, Bd. 2, S. 8 f. Zur Zeit von Krieg und Frieden ist Tolstoi dennoch der
Überzeugung, dass er Kant und Schopenhauer in seiner Deutung der Willensfreiheit folgt. Beide haben
„das letzte Wort der Philosophie in der Stellung und Auflösung dieser Frage gesprochen“. Dies wird in
den Entwürfen zum Roman deutlich (TGA 15, S. 245 ff.). In der endgültigen Version lässt Tolstoi
allerdings die Namen beider Philosophen sowie entsprechende Überlegungen zur dritten Antinomie
weg.
129 Tolstoi, Krieg und Frieden, Bd. 2, S. 9.
130 Tolstoi, Krieg und Frieden, Bd. 2, S. 10.
131 Tolstoi, Krieg und Frieden, Bd. 2, S. 10.
276
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Schon in dieser früheren Darlegung der Geschichte der napoleonischen Kriege
wurde die Vernünftigkeit mit dem Fatum gleichgesetzt. Die Vernünftigkeit der für uns
unbegreiflichen Ereignisse bleibe vor uns verborgen, doch sie sei auch unabwendbar.
Worin besteht nun diese Vernünftigkeit? Die Antwort auf diese Frage gibt der späte
Tolstoi: Für Gott als „Hauswirt des Lebens“ gebe es das Böse nicht. Alles – Kriege,
Gewalt und gegenseitige Ausbeutung der Lebewesen – ist in das Leben eingeschrieben. Ihm, der die Samen des Verständnisses in die Menschen hineinlegt, ist es
gleichgültig, welcher dieser Samen überlebt und ob er überlebt. Darin besteht die
Vernünftigkeit des Lebens, die dem Einzelnen, solange er auf seinem Einzel-Sein
besteht, wie Übel und Ungerechtigkeit vorkommt. Die Gleichgültigkeit des Lebens
gegenüber dem Tod der Millionen ist seine Vernunft und seine rettende Tat für jene,
die verstehen. Derjenige, der nicht versteht, bleibt dagegen ohne Sinn und Trost. Die
einzige Strafe besteht allerdings im Nicht-Verstehen, in der Verzweiflung an der Sinnlosigkeit des Lebens. Dies allein stehe also den Menschen frei: das ewig siegreiche
Leben als Vernunft zu akzeptieren oder im Wahn des Widerstandes zu verzweifeln.
Deshalb ist das Aufgeben des Widerstandes bzw. des Wunsches, im Leben zu verharren, die eigentliche Befreiung. Es bleibt weder Platz für die Willkür noch für die
Wahl. Ob du es willst oder nicht, du wirst Gott lieben, und das heißt auch deinen
Nächsten wirst du lieben (vgl. TGA 24, S. 622); ob du es willst oder nicht, du wirst zur
Quelle des Lebens zurückkehren und dein „Ich“, das dir so lieb ist, wird sich auflösen,
damit andere an deiner Stelle leben können.132
Freiheit des Willens ist somit „ein Wort ohne alle Bedeutung“. Jedoch nicht die
Vernunft:
Die Vernunft aber, die unser Leben erhellt und uns veranlaßt, unsere Handlungen zu ändern, ist
keine Illusion und sie läßt sich auf keine Weise ableugnen.133
Die Vernunft als Gebot des Lebens, dem Unausweichlichen nicht zu widerstehen, als
Ruf zum glücklichen Erbe ist die eigentliche frohe Botschaft, welche abzulehnen nicht
in der Macht eines Menschen steht. Sie ist deshalb seine einzige Freiheit – eine
allmähliche Befreiung vom Betrug des einzelnen Lebens, eine Befreiung zum Tod.
Diese Freiheit ist, wie das Gute selbst, im Leben immer unvollkommen. Sie ist nur
noch als Grenze des Lebens, als sich immer entziehender Horizont zu denken, als das
132 Vgl. die scharfsinnige Bemerkung von O.W. Kirjazew, nach Tolstoi solle man so handeln, als ob
man seinen Nächsten tatsächlich liebt (О.В. Кирьязев, Предтеча цивилизационного синтеза (Der
Vorläufer einer zivilisatorischen Synthese), S. 167). Damit ist stillschweigend eine vollständige Umkehrung von Kants Moralphilosophie vollzogen, die sich ausschließlich auf die Triebfeder bezog. Das war
auch vorhersagbar. Denn wenn die Freiheit des Willens nicht bloß als Illusion, sondern als widersinniger Begriff zurückgewiesen wird, so darf auch die Unterscheidung von Handlungen und Absichten, von Absichten und Maximen nicht mehr gelten.
133 Tolstoi, Mein Glaube, S. 164.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
277
unvermeidliche Ereignis des eigenen Todes, das niemals begriffen und wirklich
akzeptiert werden kann. Die Freiheit des Willens sei dagegen bloß ein Betrug, das
Vergessen-Wollen dieser Abhängigkeit. Man müsse sich von diesem Betrug und
Selbstbetrug allmählich befreien, das heißt, „die nicht existente Freiheit ablehnen
und die von uns nicht empfundene Abhängigkeit anerkennen“.134
Der Endzweck des einzelnen Lebens ist somit das vollkommene Verständnis der
eigenen Abhängigkeit, das Verständnis, das nur im Tod erreicht werden kann. Alle
Bemühungen um das positiv verstandene Gut, alle positiven Ziele dienen dagegen
dem Betrug und nehmen den Menschen ihre wahre Freiheit, besonders die Bemühungen um die irdische Gerechtigkeit. Keine von Menschen ausgeübte Gerechtigkeit
könne mit der Gerechtigkeit des Todes und keine rechtlich hergestellte Gleichheit
könne mit der Gleichheit angesichts des Todes verglichen werden. Diese Gleichheit
bestehe jedoch darin, dass der Mensch „gar keine Rechte auf das Leben“ hat.135 Jede
richtende Instanz, jeder Versuch, dem Bösen zu widerstehen, sei es vonseiten der
gesellschaftlichen Institutionen oder des Einzelnen, entspringt dem unzweckmäßigen
Gebrauch der Vernunft: dem Gebrauch der Vernunft gegen die Vernunft, dem Willen
zum Guten, der gegen das Gute gerichtet wird.
Weder eine moralische noch eine rechtlich richtende Instanz ist somit möglich.
Konsequenterweise verweigert Tolstoi seine Unterstützung nicht nur allen irdischen
Institutionen des Zusammenlebens, sondern auch der Idee eines jenseitigen Richters.
Nicht nur Gott als Richter, sondern auch die kantische Idee des höchsten Guts scheint
ihm unmoralisch zu sein. Denn das Versprechen der persönlichen Glückseligkeit ist
nur ein weiterer Betrug. Das Ziel des eigenen Lebens, die Selbstaufopferung zugunsten der anderen Lebenden, kann nicht verfehlt werden. Auch die Glückswürdigkeit ist
deshalb ein Unding. Das Aufgeben des Widerstandes, das Verständnis, ist kein Verdienst, sondern die Rettung selbst. Danach zu fragen, was ich dafür bekomme, wäre
ungefähr so, als wenn ein Mensch, der in den Abgrund rutscht, fragen würde, ob er
eine Belohnung bekommt, wenn er sich am rettenden Seil festhält.136 Eine solche
Frage würde nur zeigen, dass er den Ernst seiner Lage nicht versteht oder dass er gar
ohne Verstand ist. Meist sind es Kinder, die für die Verfolgung des eigenen Wohls eine
Belohnung von Erwachsenen erwarten. Es gibt also weder Schuld noch Strafe, genauso wenig wie es Spontaneität und Freiheit der Willkür geben kann. Das Einzige, was
einem Menschen offensteht, ist als Sohn oder als Sklave das Unvermeidliche anzunehmen.137 „In die Freude deines Herrn“ einzugehen (Mt. 25; 21) bzw. zum freien
134 Tolstoi, Krieg und Frieden, Bd. 2, S. 788.
135 Tolstoi, Mein Glaube, S. 177.
136 Tolstoi, Mein Glaube, S. 212.
137 Vgl. Tolstois Interpretation des Gleichnisses (Mt. 20; 1–16) über den Hausherrn, der alle Arbeiter gleich belohnt – die, die nur eine Stunde und die, die den ganzen Tag gearbeitet haben (TGA 24,
S. 512).
278
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Sohn des Verständnisses zu werden, kann das alleinige Ziel des einzelnen Lebens
sein, das dem Einzelnen immer vorenthalten bleibt.
Das Aufgeben des Widerstandes trage in sich schon seine Belohnung. Es kann
deshalb nicht wirklich schwer fallen. „Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist
leicht.“ (Mt. 11; 30) So spricht der Sohn des Verständnisses. Die Schwierigkeiten
scheinen an dieser Stelle gravierend zu sein. Sie sind aber keinesfalls neu. Tolstoi
gerät in einen Widerspruch, der sich bereits in der sokratisch-kantischen Moral
abzeichnete (dem aber auch Spinoza nicht entging): Das Gute zu kennen und es zu
tun sei einerlei. Denn wenn es um das Verständnis geht, darf dem Einzelnen das
Verfolgen des eigenen Wohls nicht schwer fallen. Wie kommt es aber dazu, dass die
Vernunft gegen die Vernunft gebraucht wird, so dass sie von ihrem eigentlichen Wohl
abweicht?138 Tolstoi spürt diese Schwierigkeit und scheint sie ganz traditionell zu
lösen:
Weshalb habe ich denn bisher diese Lehre nicht erfüllt, die mir Heil, Erlösung und Freude
verleiht, und habe im Gegenteil gerade das getan, was mich unglücklich gemacht hat? Und es
gab darauf nur eine Antwort: Ich hatte die Wahrheit nicht gekannt, sie war mir verborgen
geblieben.139
Weshalb wissen die Menschen dennoch nicht, was zu ihrem eigentlichen Wohl gehört
und ihrem Leben immer schon eingeschrieben ist? Wegen des Betrugs und SelbstBetrugs. Tolstoi fügt an dieser Stelle allerdings noch etwas hinzu, das über die
sokratische Idee des Guten aus Vernunft, das nur vom Nicht-Verstehenden verfehlt
werden kann, aber auch über die kantische Idee des angeborenen Hanges zum Bösen
hinausgeht. Nur wegen des gesellschaftlich-institutionellen Netzes des Betruges sei
der Irrtum des Einzelnen möglich – der Irrtum, der das sinnlose Leiden zur Folge hat,
d. h.: nur wegen des Betrugs des Allgemeinwohls, wegen des Betrugs der Allgemeinheit.
Denn die Menschen, die keinen Sinn des Lebens suchen, sind Sklaven der herrschenden Lehre, der Lehre der mächtigen Mehrheit, d. h. sie werden gezwungen, sich für
das zu opfern, was für sie niemals brauchbar sein kann. Das, was diese Lehre, die
„Lehre dieser Welt“, als Gut verheißt, kann für den Einzelnen nur böser Betrug und
die Quelle des Leidens sein. Sie, diese Lehre, ist „die Religion der Unterwerfung unter
138 Auch Kant berief sich auf das Wort des Evangeliums, dass das Gute leicht sein soll (RGV, AA 6,
S. 179). Er erklärte es aber in dem Sinn, dass „leicht“ als „nicht beschwerlich“ zu verstehen sei, weil das
„Joch“ des moralischen Gesetzes, das „jedermann obliegt, als von ihm selbst und durch seine eigene
Vernunft ihm auferlegt betrachtet werden kann“. Doch das Gute fällt den Menschen überhaupt nicht
leicht. Mehr noch: Die Schwere sei das einzige Zeichen dafür, dass das Gute zur Triebfeder geworden
ist. Um diesen Widerspruch zu lösen, musste Kant ferner den Hang zum Bösen dem Menschen in seiner
Gattung beilegen. Spinoza, der das Gute ebenso als vernünftig und als eigentliches Wohl der Menschen
ansah, ließ dagegen diese Schwierigkeit (die Menschen folgen nicht ihrem eigentlichen Wohl) ungelöst, indem er am Ende seiner Ethik bloß auf die Erfahrung hinwies: Das Gute solle schwer sein, weil es
selten vorkomme (Spinoza, Die Ethik, S. 296 (Teil V, Lehrsatz 42, Anm.)).
139 Tolstoi, Mein Glaube, S. 273.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
279
die bestehende Macht“140 und damit der eigentliche Widerstand gegen den Willen des
„Vaters des Lebens“.141
Die „Lehre dieser Welt“ sei gerade die Macht, die den Einzelnen zwingt, dem
Allgemeinwohl Opfer zu bringen, z. B. die wertvolle Gegenwart einer fiktiven Zukunft
zu opfern. Der Einzelne wird so zum Märtyrer für die Werte, die für ihn keinen Wert
haben können. Die Verzweiflung angesichts des Todes, die Tolstoi als Schriftsteller so
gut zu schildern wusste, zeigte dies am besten. Die „Lehre des Menschensohnes“ sei
dagegen nicht schwer. Denn sie befreie von den leeren Sorgen um das Gemeinwohl,
um die Zukunft der Familie und um das eigene Verharren im Leben. Die Freiheit des
Einzelnen, die mit dem Bewusstsein der eigenen Abhängigkeit zutiefst verbunden ist,
wäre deshalb auch die Freiheit von allen Sorgen um das Überleben und so auch die
Freiheit von der Macht der Allgemeinheit – die Freiheit von alldem, was Tolstoi als
das Böse der Welt bezeichnet:
Die durch Täuschung miteinander verbundenen Menschen bilden gleichsam eine geschlossene Masse. Die Geschlossenheit dieser Masse ist eben das Böse der Welt. Die ganze vernünftige Tätigkeit des Menschen ist auf die Zerstörung dieser Verkettung der Täuschung gerichtet.142
Die Freiheit von dem Bösen der Welt ist die Freiheit des Erbsohnes, der die Ziele des
Vaters des Lebens „versteht“ und in seine Maximen aufnimmt – der ihn also liebt.
Es ist die Liebe zum Leben, die zum Verständnis führt, nicht die Liebe zum Nächsten
und nicht die Liebe zur Menschheit.143 Diese Liebe ist kein Gefühl, so ist sie nur
negativ zu verstehen: als der Verzicht, dem Leben eigene Zwecke zu unterstellen, als
das Aufgeben aller partikularen Zielsetzungen. Denn jeder Versuch, das Gute des
Lebens zu definieren, ist zum Scheitern verurteilt. Die Formel „das Gute ist das
Leben“ wäre nach Tolstoi falsch, denn nur das Umgekehrte gilt: „Das Leben ist das
Gute“.
Das Gute ist dasjenige, was von niemand definiert werden kann, was aber alles übrige definiert.144
140 Tolstoi, Mein Glaube, S. 299.
141 Erstaunlicherweise wurde Tolstois Philosophie, gerade umgekehrt, mehrmals als Befürworter der
Allgemeinheit gegen den sog. Individualismus interpretiert. Vgl. die Entgegensetzung von Tolstoi und
Kierkegaard in: Л.З. Немировская (L.Z. Nemirowskaja), Религия в духовном поиске Толстого (Die
Religion in der geistigen Suche von Tolstoi), S. 32 ff.
142 Tolstoi, Mein Glaube, S. 336.
143 In dieser Deutung der Liebe nähert Tolstoi sich wieder dem spinozistischen Begriff Gottes an.
Dennoch wird der Letztere von ihm öfters als „Vater“ bezeichnet, der seinen Sohn in die Welt schickt
und dessen Wille unbegreiflich bleibt. Die Unentschiedenheit, ob Gott als lebenspendende unpersönliche Bewegung des Lebens oder aber als persönliche Kraft zu deuten ist, blieb bei Tolstoi immer
vorhanden (vgl. z. B. die Erzählung Das Taufkind).
144 Leo N. Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 99.
280
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Das Gute des Lebens kann nicht mit Begriffen erörtert werden. Genausowenig wie
seine Wahrheit:
Die Wahrheit kann man nicht beweisen. Sie beweist alles Andere. (TGA 24, S. 504)
So ist die Wahrheit des Guten keine bewiesene allgemeine Wahrheit (nicht „истина“),
sondern sie ist das unbegreifliche Gesetz des Lebens, das geheimnisvolle Rätsel des
Geboren-Seins und des Sterben-Müssens – das Einzige, was apodiktisch gewiss ist
(„правда“).145 Wenn der Einzelne dies versteht, kann er in Übereinstimmung mit der
Wahrheit leben, er kann sein Leben nach dem Guten ausrichten.
Im Widerstand, in der Aufteilung der Menschen in Gute und Böse, in Gerechte
und Ungerechte, im Richten, zeigt sich dagegen immer wieder das Unverständnis. Das
Gebot, nicht zu richten, ist somit die Kehrseite des Gebots, dem Bösen nicht zu
widerstehen. Nur im Bewusstsein der eigenen Grenzen und der eigenen Ungerechtigkeit kann der Mensch sich auf die Vollkommenheit zubewegen. Die Letztere ist jedoch
Gott allein vorbehalten – aber nicht als einem Richter, sondern gerade als seinem
Gegenteil, als demjenigen, der völlig auf das Richten verzichten kann:
Denn er läßt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und läßt regnen über Gerechte und
Ungerechte. (Mt. 5; 45)
Das ganze Evangelium, sagt Tolstoi, zeigt, wie ein Mensch sich um so eine göttliche
Vollkommenheit bemühte. Mit seinem Leben gab er ein anschauliches Beispiel des
Nicht-Widerstandes, des Nicht-Richtens, des Verständnisses. Doch er selbst war
nicht ohne Makel und nicht unschuldig, wie es die christliche Tradition immer
behauptete. Sein Leben war eine unablässige Bewegung des Über-Sich-Hinausgehens, die erst im Tod vollendet wurde. Das Unbegreifliche und Unbeschränkte des
Lebens konnte auch in seiner beschränkten Perspektive nicht völlig aufgehen und
erfasst werden, so wie der Sohn den Vater, der allein „den Tag kennt“ (Mt. 24; 36),
nicht vollkommen verstehen kann.146 Auch seine Perspektive war die Perspektive der
Erkenntnis des Guten und des Bösen, die Perspektive der angeblichen Freiheit. Darin
besteht die ewige Unvollkommenheit des Einzelnen, der nur im Tod den Endzweck
145 Der lexikalische Unterschied zwischen den zwei Begriffen („истина“ und „правда“) ist hier von
Bedeutung. Der erste wird für die wissenschaftliche und hohe metaphysische Wahrheit (bspw. im Satz
„Gott ist die Wahrheit“) als Gegensatz zum Irrtum benutzt. Der zweite ist eher umgangssprachlich.
Jedoch wird er auch im höheren Sinn verwendet – als das Moralisch-Gerechte, das zugleich alltäglich
ist und sich in einer konkreten Lebenssituation zeigt. „Правда“ ist etwas, was nur in der Praxis des
Lebens vorkommen kann. Die metaphysische und die moralisch-praktische Wahrheit werden damit
sprachlich unterschieden.
146 Auch Jesus habe „Fehler“ gemacht. Laut Tolstois Evangelium wollte er sich „mit den Schwertern“
der Verhaftung durch die Soldaten widersetzen (TGA 24, S. 704).
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
281
seines Lebens erreicht: im Verständnis, dass es keinen Tod, kein Böses, keine Sünde,
keine Freiheit gibt. Dieser Zweck ist die gesteigerte Paradoxie des bereits gefundenen
Sinns des Lebens: Das Ziel des einzelnen Lebens besteht darin, zu verstehen, dass
das Leben des Einzelnen keine Ziele haben kann, dass alle Ziele, die er seinen
einzelnen Handlungen und seinem Leben setzt, nur scheinbare sind. Dies sollte das
Verständnis sein, das allein die Ruhe des Herzens, das Nicht-anders-haben-Wollen
und die wahre Glückseligkeit verspricht.147 Denn es ermöglicht, Leben und Tod ohne
Angst und ohne Hoffnung anzunehmen – als das Unvermeidliche, als das Gute
schlechthin.
Die wahre Religion versus Geschichten
Die „Lehre des Menschensohnes“, die Lehre Gottes, steht nach Tolstoi der „Lehre
dieser Welt“, der Lehre der mächtigen Mehrheit immer entgegen, so wie das Wohl des
Einzelnen dem Allgemeinwohl nur entgegengestellt werden kann. Beide Lehren sind
ferner als Religion zu verstehen. Sie sind die Lehren über das Leben, sie lehren den
Bezug des Endlichen eines Einzellebens auf die Unendlichkeit. Die Religion im
traditionellen Sinn des Wortes tut dies jedoch nur betrügerisch. Denn das Unendliche,
das sie lehrt, sei es das Gemeinwohl des Menschengeschlechts oder die jenseitige
Glückseligkeit, ist nicht wirklich unendlich. Sie muss deshalb Vertrauen verlangen,
d. h. den blinden Glauben daran, dass das endliche Wohl einen unendlichen Sinn hat.
In seinen Angriffen auf den statutarischen Kirchenglauben folgte Tolstoi Kants
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft und ging darüber hinaus.
Wenn der deutsche Philosoph vorsichtig die Ausführung der üblichen Gottesdienste
als Erinnerungs- und Erziehungsmittel zulässt, wenn er sogar eine Offenbarung
Gottes als Möglichkeit, die in ihrer Rechtmäßigkeit durch die Vernunft immer überprüfbar sein muss, nicht ganz ausschließt,148 so ist Tolstoi in seiner Verwerfung jeder
Art von Offenbarung und „Geschichten“ radikal. Mehr noch: Ihm scheint jede Art der
Hoffnung auf die äußere Ergänzung der eigenen Unvollkommenheit verwerflich und
nutzlos. Man habe es bei der traditionellen christlichen Religion mit einer Art des
Glaubens zu tun, dem der Vernunftglaube entgegenzusetzen ist (TGA 55, S. 186 f.) –
dem Glauben an einen persönlichen Gott und die persönliche Unsterblichkeit, an die
147 Der Unterschied zum schopenhauerschen Zur-Ruhe-Kommen des Willens dürfte jetzt ersichtlich
sein. Tolstois Friede ist zwar auch das Nicht-anders-haben-Wollen, er ist jedoch in erster Linie der
Friede der Vernunft, d. h. ihre Versöhnung mit sich selbst.
148 Auch die positiv-doktrinelle Religionsausübung ist für Kant nicht völlig nutzlos. Die Religion
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft kann die Religion außerhalb dieser Grenzen für die nicht
rein vernünftigen Wesen nicht ausschließen. Die analogisch-symbolische Verdeutlichung bleibt für die
Menschen notwendig. Vgl. Kap. Die Religion außerhalb des Systems praktischer Vernunft in: Simon,
Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 524 ff.
282
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Auferstehung der Toten.149 Der Gott Jesu sei dagegen kein persönlicher Gott, kein
Gott, der mitleidig, eifersüchtig oder zornig sein kann. Wenn Tolstoi vom Willen
Gottes spricht, so können diesem Willen keine Zwecke unterstellt werden – weder die
Gerechtigkeit, noch der Friede, noch die Erhaltung des Menschengeschlechts.150 Er ist
ein negativer Begriff, ein Gegen-Begriff. Der Glaube an ihn sei die wahre Religion, weil
sie allein die Vernunft befriedigen kann. Die Suche nach diesem Gott ist ein Weg und
eine Sehnsucht, sie bedeutet andauernde Arbeit. Sie ist stetige Unruhe und Kampf –
die Unruhe, die nach Ruhe strebt, der Kampf um das Aufgeben des Kampfes.
Als Bewegung ist dieser Kampf jedoch zeitlich und vollzieht sich durch die
Geschichte der Menschheit. Es ist ein Kampf gegen „eine geschlossene Masse“, gegen
den Betrug der Zivilisation, der in vielerlei Gestalten bzw. Idolen vorkommt – als
Bildung, als Kunst, als Staat und besonders als Kirche. Hier zeigt sich hinter dem
tolstoischen anarchistischen Pathos sein Gedanke zur Nicht-Radikalität des Bösen.
Denn alle Instrumente des Betrugs, v. a. die Kirche, sind nicht als solche das Böse,
wenn sie auch auf schärfste Art und Weise angegriffen werden, sondern das Böse von
heute – das, was zum Bösen geworden ist. Auch die Kirche hat ihren Dienst erfüllt,
indem sie das Evangelium vermittelt hat. „Der Faden, der die Welt mit der Kirche
verband“, stellt für sie jedoch jetzt „nur noch ein Hindernis“ dar.151 Die Quelle des
Lebens wird durch die Kirche nur noch verschmutzt und die Wahrheit verdreht.
Tolstois Hervorhebung des Standpunktes „unserer Zeit“ wollen wir uns merken.
Es ist ein Zeichen für seinen Perspektivismus, der trotz des Pathos’ der allgemeinen
Wahrheit für die Beweglichkeit seiner Gedanken sorgt, welche gerade in seinem Spätwerk fasziniert. Ebenso steht es mit den anderen pathetischen Vereinfachungen, z. B.
mit Tolstois Lob des armen Volkes bzw. des „natürlichen“ Menschen, der dem Bösen
am besten entgehen könne, weil er von der Zivilisation weniger betroffen sei. Immer
wieder weist Tolstoi unermüdlich auf die Erfahrung der einfachen Menschen hin, die
von ihrer Arbeit leben und das unweigerliche Leiden und den Tod gütig akzeptieren
können. Von einem Bauer („Moujik“) empfing Lewin seinen Glauben. Das arme Volk
stehe der Quelle des Lebens viel näher als jene ausgebildete hohe Gesellschaft, die in
ihrem Wahnsinn (одурение) jede Kenntnis vom Sinn des Lebens verloren hat.152 So
149 Vgl. „Die Lehre über die Auferstehung widerspricht direkt der Lehre Christi.“ (TGA 24, S. 792)
Außerdem werden alle Stellen über Wunder und Prophezeiungen Jesu in den Evangelien von Tolstoi
ungefähr so kommentiert: „Diese Verse sind ohne Bedeutung und können weggelassen werden.“
(TGA 24, S. 140)
150 In der Kreutzersonate spitzt Tolstoi diesen Gedanken zu: „‚Wenn sich alle das [die Enthaltsamkeit – E.P.] zum Gesetz machen wollten, würde das Menschengeschlecht aufhören zu bestehen‘. […]
‚Weshalb muß es denn fortgepflanzt werden?‘ […] ‚Weshalb? Sonst wären wir ja nicht da.‘ ‚Und wozu
sollen wir dasein?‘“ (Leo N. Tolstoi, Die Kreutzersonate, S. 144).
151 Tolstoi, Mein Glaube, S. 303.
152 Tolstoi selbst versuchte bekanntlich, ein möglichst bäuerliches Leben zu führen und schließlich
auf seinen Besitz und seine Privilegien völlig zu verzichten, was zu unendlichen Streitigkeiten in der
Familie und schließlich zu seiner Flucht von zuhause führte (s. die Einleitung zu diesem Kapitel).
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
283
weit entfernte sich Tolstois Deutung der wahren Religion letztendlich von Kants
Intentionen: Nicht die Bildung, nicht der Wohl- und Rechtszustand, nicht der Staat
und die Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft, sondern die Armut und das einfache
Leben von der Arbeit für das tägliche Brot ist der Weg der Vernunftreligion – der
Lehre, wie man leben und wie man sterben soll. Nur sie verspricht den ewigen
Frieden – die Ruhe des Herzens, die Versöhnung mit sich selbst.
Tolstoi eine naive Idealisierung des Volkes vorzuwerfen, wäre dennoch voreilig.153 Als Künstler machte er deutlich, dass die Korruption des Bösen bis hier
vorgedrungen ist.154 An dieser Stelle zeigt sich noch einmal die Ausgangsparadoxie
des Guten bei Tolstoi. Auch wenn der einfache, „natürliche“ Mensch der Quelle des
Guten näher zu sein scheint, so ist auch für ihn, solange er lebt, das Böse unvermeidlich. Es kann nur vermindert oder möglichst vermieden, jedoch nicht ausgerottet
oder vernichtet werden, weil es in das Gute des Lebens eingeschrieben bleibt.
Vielleicht, so die Vermutung des späten Tolstoi, sind die Menschen mit ihrer ewigen
Unzufriedenheit nicht die wahren Söhne Gottes, sondern können von anderen Lebewesen noch etwas lernen – z. B. wie man stirbt. Tolstoi versucht, anders als z. B. Emile
Zola, nicht nur zu zeigen, wie Menschen, sondern auch wie Tiere und Pflanzen
sterben, um zu fragen, ob dies nicht auch für den Menschen das Beste wäre – sein
Leben in einer an Gleichgültigkeit grenzenden Gelassenheit ohne Bedauern und ohne
Angst aufzugeben, wenn die Zeit gekommen ist.155
Doch das arme Volk, die Bettler, die Wanderer, die Armen im Geiste sind die, die
dem Sinn des Lebens am nächsten stehen – nicht die Gelehrten, nicht die Gebildeten,
nicht die Weisen. Besonders diejenigen, die die Lehre des Lebens vermitteln sollten,
sind zu ihren Feinden bzw. zu Dienern des Betrugs geworden. Sie, die Schriftgelehrten
(Tolstoi verwendet das Wort i. w. S.), verführen das Volk weg von der Lehre über das
Leben zu Geschichten, denen es schlicht vertrauen soll. Wiederum wird hier Tolstois
Entwicklung von Anna Karenina zu Was ist mein Glaube?, zu Die Auferstehung und zu
153 Tolstois Annäherung an Rousseau fällt an mehreren Stellen auf. S. dazu den wegweisenden
Aufsatz: Михаил Н. Розанов (Michail N. Rozanow), Руссо и Толстой (Rousseau und Tolstoi). Dennoch
wäre es voreilig, seine Lehre der Vereinfachung (опрощение) nur im Sinne Rousseaus zu sehen (so
etwa: П. Попов (P. Popow), Иностранные источники трактата „Что такое искусство?“ (Die
fremdsprachigen Quellen vom Traktat „Was ist Kunst?“),bes. S. 127). Tolstoi, der sich seiner Abhängigkeit von manchen Ideen Rousseaus durchaus bewusst war, distanzierte sich zugleich von ihm. Sein
Argument gegen Rousseau ist vielsagend: Der ideelle Mensch Rousseaus sei eine Fiktion. Man könne
die Zivilisation nicht leugnen, denn es sei falsch, über das, was geschieht, im Sinne von Gut und Böse
zu urteilen. Das Leben sei immer im Recht, auch wenn es sich um eine Fehlentwicklung handle
(TGA 13, S. 145).
154 Vgl. bspw. das Drama Die Macht der Finsternis.
155 Vgl. die Erzählung von Emile Zola Wie Menschen sterben und Tolstois Erzählung Die drei Tode.
Gerade die dritte Geschichte, in der ein Baum stirbt und sein Tod als vollkommen dargestellt wird,
war für die Zeitgenossen eher unverständlich und irritierend. S. dazu Tolstois Erklärungen: TGA 60,
S. 265 f.
284
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
allen späteren Werken bedeutsam. Damals, als er den Sinn des Lebens dank den
Worten eines einfachen Bauern gefunden hat, sagte Lewin:
Ja, alles das, was ich weiß, habe ich nicht durch die Vernunft ermittelt, sondern es ist mir
gegeben worden, es hat sich mir offenbart, und ich weiß es mit dem Herzen, durch den Glauben
an jenes Wichtigste, das die Kirche lehrt.
Und er
glaubte nun erkannt zu haben, daß es kein einziges kirchliches Dogma gebe, das dem Wichtigsten widerspräche […].156
Später sieht Tolstoi die Kirche selbst als Quelle des Betrugs an, denn sie führt von der
Lehre über das Leben weg zum äußersten Pessimismus, zum Verlust des Sinns des
Lebens. Statt des Verständnisses wird ein Märchen, ein Mythos, eine Geschichte
erzählt, die zumindest heute keiner mehr glauben kann. Man kann nämlich einer
Geschichte nicht im oben beschriebenen Sinne „wahrhaftig glauben“, sondern ihr nur
vertrauen, d. h. sie bloß „mit den Lippen […] wiederholen“.157 Dies betrifft alle Geschichten – von der schon in Krieg und Frieden von Tolstoi verspotteten Geschichtsschreibung bis hin zu den biblischen Erzählungen.
In seiner Kritik der dogmatischen Theologie greift Tolstoi alle kirchlichen Geschichten gnadenlos an – vom Sündenfall im Paradies bis zur Auferstehung Christi, besonders
aber die, die das Selbstverständnis der Kirche betreffen. Die Kirche soll die Gemeinschaft aller Gläubigen sein, d. h. aller Menschen, die nach dem Sinn des Guten suchen. Stattdessen schließt sie als Institution immer jemanden aus und teilt die Menschheit in Gläubige und Nicht-Gläubige, in Gerechte und Ungerechte, in Gute und Böse.
Es muss betont werden, dass Tolstoi, genauso wie Kant, keine besonderen konfessionellen Unterschiede macht und in jedem Fall keine der Konfessionen bzw. Weltreligionen im Verhältnis zur Vernunftreligion privilegiert. Zwar kann der Betrug
gröber oder feiner sein, es bleibt trotzdem Betrug, sofern es um eine Gemeinschaft
geht, die für ihr normatives Geschichtenerzählen Vertrauen verlangt. Werden die
Geschichten als Offenbarung Gottes verstanden, führen sie zu unendlichen Streitigkeiten. Es könne jedoch gar keine Offenbarung Gottes geben. Das Wohl der Menschheit kann, so Tolstois Argumentation, nicht von der Zuverlässigkeit und Überzeugungskraft einer Erzählung abhängig sein. Eine Geschichte könne darum niemals die
Wahrheit des Lebens enthalten. Denn die Geschichten verlegen alle Fragen des
Glaubens „in das phantastische Gebiet“ und berauben die Glaubenslehre „jener einzigen Grundlage, auf die sie sich fest stellen kann“.158 Ein solcher Glaube könne nicht
gut sein, außer für Machtgier und gegenseitige Verfolgung.
156 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 578 f.
157 Tolstoj, Kritik der dogmatischen Theologie, Bd. 1, S. 91.
158 Tolstoj, Kritik der dogmatischen Theologie, Bd. 1, S. 193.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
285
Auch das Christentum sei zu einer Geschichte, zu einem Märchen herabgewürdigt
worden. Durch die Jahrhunderte sei der Sinn der frohen Botschaft durch die erste
„kleine“ Lüge über die Wunder Jesu und seine Auferstehung, die die Lehre nur noch
bekräftigen sollte und deshalb von seinen Jüngern geduldet und verbreitet wurde,
verdunkelt worden. Einen entscheidenden Schritt in diese Richtung – und dieser
Gedanke wird in Nietzsches Tolstoi-Lektüre zentral – machte der Apostel Paulus, der
Pharisäer bzw. ein leidenschaftlicher Anhänger des Glaubens an einen partikularen
Gott gewesen ist. Da er nichts von der Lehre Christi verstanden hatte, habe er den
hässlichen Brauch des Abendmahls erfunden sowie Belohnung und Strafe in der
zukünftigen Welt und viel anderen Irrglauben in seinem Namen gelehrt. Doch das
Schlimmste von allem sei, dass er den Glauben selbst missdeutete, indem er ihn als
„eine Verwirklichung dessen, was man hofft“, und „ein Überführtsein von Dingen,
die man nicht sieht“ (Hebr. 11; 1), definierte. Der wahre Glaube ist für Tolstoi weder
das eine noch das andere. Er ist, wie bereits gesagt, die Einsicht in die Lage, in der
man sich befindet. Der Unglaube ist bloß ein Missverständnis, der dem paulinischen
bzw. kirchlichen Betrug entspringt. Der Glaube sei ein Überzeugt-Sein von einer
Tatsache bzw. von einer Geschichte. In den groben Vorstellungen von Gott nach dem
Vorbild eines irdischen Herrschers, eines Tyrannen, der die Menschen für ihre Schuld
verdammt, die er vorhersieht, der seinen Sohn opfert, in allen diesen Dummheiten
und Grausamkeiten ließe sich jedoch eine kluge Strategie bemerken. Denn das eigentliche Ziel dieses Fälschers des Evangeliums sei gewesen, die herrschende Ordnung
der Dinge zu bestätigen, um zu sagen:
Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten Mächten! Denn es ist keine Macht außer von Gott,
und die bestehenden sind von Gott verordnet. (Rom. 13; 1)
Dies ist die These, der sich staatliche und kirchliche Herrscher bedienten und worauf
sie die Welt des Jenseits gründeten, in der die Sinnlosigkeit dieser angeblich göttlichen Ordnung noch zusätzlich verewigt wurde. Diese Quasi-Religion, die sich mit
dem Namen des Christentums schmückt (der aber am wenigsten zu ihr passt), sei in
Wirklichkeit das Ende der Religion, ihre Vernichtung.
Es stellt sich natürlich die Frage, warum sich die Mächtigen für ihren groben
Betrug der am wenigsten dazu passenden Lehre Christi bedienten. Tolstoi sieht diese
Schwierigkeit. Seine Antwort ist überraschend und gewagt: Gerade deswegen, weil in
der Lehre Christi die Wahrheit des Lebens am reinsten und am deutlichsten zu sehen
war, gerade wegen ihrer außerordentlichen Gefährlichkeit für den Betrug des staatlich-institutionellen Lebens sollte letzterer sich all seiner Kräfte bedienen, um auch
die reinsten Quellen zu verschmutzen, um das hellste Licht zu verdunkeln – um es mit
den Worten Jesu zu sagen: „Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß
die Finsternis!“ (Mt. 6; 23) Die Verfolgungen konnten die Lehre nicht besiegen, nur
bestätigen. So habe sich das Böse des gröbsten und auch frechsten Betrugs in der
Geschichte bedient, indem eine christliche Institution – die Kirche – und später noch
286
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
der christliche Staat gegründet wurde. Die angeblichen Christen haben im Namen
Christi den Betrug bestätigt und die Gewalt gesegnet – „das Licht wurde zur Dunkelheit“. Es war der Sieg der Welt über das Christentum – die paulinische Wende und die
konstantinische Bekehrung. Seit Kaiser Konstantin diene die Kirche der irdischen
Macht, um die bestehende staatliche Ordnung und den Betrug der allgemeinen
Normen zu heiligen.
Die Folge dieser gewagten Fälschung des Christentums sei sehr schädlich gewesen und habe mit der Zeit zu einer wahren Katastrophe geführt. Die Frage nach dem
Sinn des eigenen Lebens sei verloren gegangen. Man lebe „in der festen Überzeugung,
daß von allen müßigen Beschäftigungen die müßigste das Suchen nach der Wahrheit
sei, welche das menschliche Leben lenkt“.159 Man lebe in der „naive[n] Überzeugung“, „von jeder Religion frei zu sein“.160 Das Zeitalter des Nihilismus bricht an.
Gerade das, so Tolstoi, zeigt die moderne russische Gesellschaft: die Feindschaft
gegen jeden Glauben, die passive oder aktive Verneinung jeder Art von Sinn, die
Zuneigung zu Grausamkeit und Wahn – von den Kriegen bis zum Spiritismus. Der
Zusammenbruch der Menschenwelt ist nahe, weil der Mensch ohne Religion, ohne
eine Lehre über das Leben nicht leben kann. Es ist die Selbstaufhebung der Menschenwelt.
Diese warnende Stimme eines Denkers, der die Katastrophe einer Zivilisation
vorhersagt, die tatsächlich nur sieben Jahre nach seinem Tod in Russland ausbrach,
wurde von den Zeitgenossen paradoxerweise als Stimme eines Nihilisten und als
Angriff auf die europäische Kultur verstanden. Dennoch sah Tolstoi in der Moderne
nicht nur den Verfall bzw. die Verdunkelung der Wahrheit, sondern auch das Entgegengesetzte: die Morgenröte der Vernunft. Genauso wie seine Vorgänger im Zeitalter der Aufklärung hatte er eine optimistische, fortschrittsorientierte Perspektive im
Auge: Das Verständnis könne niemals wirklich untergehen, gerade umgekehrt könne
nichts seine Steigerung verhindern. Durch Heilige und Ketzer, durch Sonderlinge und
Ausgestoßene sei es immer weitergegeben worden und habe immer neue Söhne des
Verständnisses zu ihrem Erbe geführt. Und die Zeit ist, so Tolstois Hoffnung, nicht
fern, wenn die Menschheit sich vom Wahn des Kirchenglaubens, aber auch von dem
ihm entspringenden Nihilismus befreit und zur wahren Religion übergeht – zur Religion als Lehre über das Leben. Die Zeit der Geschichten ist vorbei, die Zeit des
Verständnisses ist gekommen.
In diesem grandiosen Bild der Menschheitsgeschichte, das dem Leser den Kampf
des Guten und des Bösen kunstvoll schildert, fallen zwei Gedanken besonders auf, die
für unsere Suche nach Tolstois Plausibilitäten wichtig sind: seine Argumentationen
gegen die Belehrung und gegen die Geschichten. Sie sind tief miteinander verbunden.
Denn die Geschichten müssen gelehrt werden und jede Lehre vermittelt Geschichten
159 Tolstoi, Mein Glaube, S. 231.
160 Tolstoi, Mein Glaube, S. 298.
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
287
bzw. verlangt Vertrauen gegenüber der eigenen Weltanschauung. Sie dienen damit
laut Tolstoi beide dem Betrug des Bösen. Nur aus der eigenen Not heraus und nur
durch die eigene Vernunft könne der Mensch sich dagegen den Verflechtungen des
Bösen widersetzen und zur Quelle des Lebens zurückkehren. Er solle sich deshalb
jeder Art des Glaubens, außer dem seiner Vernunft, verweigern – sei es der Glaube an
eine Erzählung oder das Vertrauen in einen Menschen. Wenn „ein Blinder einen
Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen.“ (Mt. 15; 14) Keiner könne dabei
dem anderen behilflich sein, und wenn jemand es will, so ist er Betrüger oder Opfer
des Betrugs. Der wahre Glaube an den Sinn des Lebens sei die einzige Gewissheit, die
dem Einzelnen niemand rauben kann. Das Gute des Nicht-Widerstandes müsse weder
gelehrt noch durch Geschichten bestätigt werden.
Es stellt sich nun die Frage, ob Jesus nicht selbst lehrte161 und, ferner, ob Tolstoi
dies nicht ebenso tut, wenn er behauptet:
Nicht auslegen will ich Christi Lehre; nur eines möchte ich verbieten, daß sie ausgelegt werde.162
Da die Göttlichkeit Jesu für Tolstoi bloß in seinem besonders reinen Verständnis liegt
und er für sich keine Ausnahme beanspruchen kann, ist die Lehre des Evangeliums,
wie Tolstois eigene Lehre, nur paradox zu verstehen. Denn sie verbietet gerade das,
was sie macht – das Lehren. Sie lehrt, dass nicht gelehrt werden soll. Andererseits
spiegelt sich im Gebot, nicht zu lehren, das Gebot wider, dem Bösen nicht zu widerstehen. Beide gehen ineinander über. Wenn das Böse bedeutet, dem Bösen zu widerstehen, und nur der Nicht-Widerstand das Böse vernichtet, so kann nur das NichtLehren, der Verzicht auf das Lehren, die Lehre sein. Denn jede andere Lehre würde
positiv sagen wollen, wie das Böse bekämpft werden soll, und wird so, früher oder
später, selbst zur Quelle des Bösen. Die Lehre Christi bzw. die Lehre Tolstois vermittelt
dagegen nur das Verständnis der eigenen Unvollkommenheit. Sie ist keine Belehrung,
auch nicht im Sinne der sokratischen Mäeutik oder des rousseauistischen Glaubens
an die Güte und Aufrichtigkeit der menschlichen Natur.163 Der Sinn des Lebens, den
Tolstoi lehrt, und das Ziel des Lebens, das er predigt, sind selbst, wie oben gezeigt
wurde, paradox und letzten Endes nur als das Aufgeben des Sinns und des Ziels zu
verstehen. Alles andere wäre eine Beschränkung und eine Verleugnung des Lebens,
dessen Sinn unbegreiflich und dessen Ziele unfassbar bleiben müssen.
161 Vgl. im Evangelium: „Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es.“
(Joh. 13; 13)
162 Tolstoi, Mein Glaube, S. 14. An einer anderen Stelle sagt Tolstoi, dass jetzt eine Auslegung nötig
sei, jedoch nur, weil es die kirchliche Auslegung bereits gibt. Sie sei somit nur noch negativ und solle
zeigen, wie künstlich alle Auslegungen sind (TGA 24, S. 13).
163 In dieser Hinsicht ist Tolstoi wiederum näher an Kant als an anderen Denkern. Zwar teilt er Kants
Begeisterung für Rousseau, muss aber die These über die ursprünglich gute Natur des Menschen, wie
früher auch Kant, zurückweisen.
288
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Das wahre Christentum darf folglich nichts mit der Metaphysik, nichts mit den
Geschichten gemeinsam haben. Es sei ihnen gegenüber gleichgültig. Dass manche
Christen gerade die Metaphysik für das Wichtigste halten, d. h. das, worüber sich die
Menschen niemals einigen können, zeige nur ihr Unverständnis.
Für einen Christen gibt es keine komplexe Metaphysik und es kann sie gar nicht geben. Das
Einzige, was in der christlichen Lehre Metaphysik genannt werden kann, ist der einfache und
einleuchtende Lehrsatz, dass alle Menschen Kinder Gottes und Brüder sind, und deshalb sollen
sie den Vater und ihre Brüder lieben und als Folge den Anderen das tun, was man wollte, dass
die Anderen ihm tun.164
Doch ist es tatsächlich eine reine Form der Religion, die alle in sich aufnehmen und
versöhnen kann? Ist es möglich, bei dem Minimum des paradoxen Glaubens an den
sinnlosen Sinn und an das ziellose Ziel zu bleiben? Sind die „Geschichten“ wirklich
entbehrlich? Die Behauptung, dass Menschen Brüder seien und Gott ihr Vater sei, ist
schließlich (Tolstoi räumt das selbst ein) auch eine Art Metaphysik. In seinem späten
Traktat Die Christliche Lehre, in dem er seine Lehre positiv in Form eines aus Lehrsätzen zusammengestellten „Katechismus“ darstellt, macht Tolstoi noch einen Schritt
in die Richtung einer metaphysischen Erzählung über die Welt. In der Christlichen
Lehre kommt er zu seiner Metaphysik, zu seinem Mythos, zu seiner Geschichte.165
Hier wird von Gott als Vernunft des Lebens und als Kraft der Liebe gesprochen.
Die Vernunft wird dabei nicht nur als fragende Vernunft eines einzelnen Menschen
gedeutet, der nach Sinn verlangt, sondern v. a. als sein Streben nach dem Besseren,
nach dem Wohl. Gott selbst sei der Wunsch nach dem Wohl, sei es das Wohl eines
Einzelwesens oder das Wohl aller Seienden. Das Umgekehrte stimme freilich auch:
Der Wunsch nach dem Wohl ist Gott, der in jedem Lebewesen vorhanden ist, der die
Liebe zum Leben selbst ist, der die Liebe zur Liebe, die Liebe zu sich selbst ist.
Dieser pantheistisch-spinozistische Gott ist somit als Einheit zu verstehen, deren
Teil der Einzelne ist – als Einheit von Vernunft und Liebe.166 Alle Fragen scheinen
164 Лев Николаевич Толстой (Lew Nikolajewitsch Tolstoi), Соединение и перевод четырех
Евангелий (Zusammenfügung und Übersetzung der vier Evangelien), S. 280. Vgl. wie Tolstoi am Ende
von Mein Glaube allen „metaphysischen Lehren“ die Lehre Christi als die empfehlt, die mit ihnen nicht
„über die Weltanschauung“ richtet, sondern ihnen eben das gibt, was ihnen fehlt: die Lehre über das
Leben (Tolstoi, Mein Glaube, S. 310 ff.).
165 Die Christliche Lehre wurde zwischen 1895 und 1897 geschrieben und von Tolstoi als Darlegung
der christlichen Weltanschauung, als eine Art „Katechismus“ (ursprünglicher Titel) konzipiert. „Eine
Absicht, die beinahe zu hochmütig und wahnsinnig ist“, wie Tolstoi selbst zugestand. Wie mehrere
seiner späten Werke erschien die Christliche Lehre im Ausland. Im Vorwort äußerte Tolstoi seine
Unzufriedenheit mit dem eigenen Text (Graf Leo Tolstoi, Die christliche Lehre, S. 7 f.). S. die Publikation
der Verfass.: Leo N. Tolstoi, Christliche Lehre. Im Folgenden greife ich auf diese Publikation zurück.
166 Mehrere philosophische Ansätze werden in Tolstois „Katechismus“ synthetisiert, und trotzdem
lassen sich seine Gedanken von diesen Quellen deutlich unterscheiden. So ist der Gott Tolstois im
Unterschied zu dem Spinozas als Streben und Sehnsucht zu verstehen. Dieser „Wunsch“ nach dem
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
289
damit beantwortet zu sein. Denn der Sinn des Lebens für das einzelne Lebewesen
kann nun offensichtlich nur darin bestehen, dass es als Teil des göttlichen Ganzen zur
ursprünglichen Einheit zurückkehrt; dass es sein Getrennt-Sein vom Ganzen überwindet. Eine Frage lässt sich dennoch nicht zurückweisen:
Wenn der Mensch in seinem abgesonderten Körper sich des geistigen und untrennbaren Wesens
Gottes bewusst wird und denselben Gott in allem Lebendigen sieht, dann kann er nicht anders,
als zu fragen, weshalb Gott, das geistige, einheitliche und untrennbare Wesen, sich in die
getrennten Körper mehrerer Wesen, in den Körper eines Einzelwesens eingeschlossen hat.
Wozu sollte sich ein geistiges und einheitliches Wesen gleichsam in sich selbst zerteilen?
Wozu ist das göttliche Wesen in die Bedingungen der Einzelheit und Leiblichkeit eingeschlossen?
Wozu ist das Unsterbliche im Sterblichen eingeschlossen und mit ihm verbunden?
Die Antwort kann nur sein: Es ist der höchste Wille, dessen Ziele dem Menschen verborgen
bleiben. Und dieser Wille brachte den Menschen und alles Seiende in die Lage, in der sie sich
jetzt befinden. Dieser Grund allen Lebens, dieser Wunsch nach dem Wohl alles Seienden, diese
Liebe, die aus einem dem Menschen verborgenen Grund sich in die von der übrigen Welt
getrennten Wesen eingeschlossen hat, ist derselbe Gott, dessen der Mensch sich in sich selbst
bewusst ist und den er jetzt außer sich erkennt.
So ist Gott nach christlicher Lehre dasjenige Wesen des Lebens, das der Mensch sowohl in
sich als auch in der ganzen Welt erkennt als Wunsch nach Wohl, und zugleich der Grund dafür,
dass dieses Wesen sich in die Bedingungen der leiblichen Einzelwesen einschließt.
Gott ist nach christlicher Lehre der Vater, der, wie es im Evangelium geschrieben steht,
seinen gleichartigen Sohn in die Welt gesandt hat, um seinen Willen zu erfüllen, das Wohl alles
Seienden.167
An dieser Stelle wird unmissverständlich klar: Tolstoi erzählt einen Mythos, dem man
einfach vertrauen soll. Es ist eine Geschichte, die man nur immer wieder erzählen
muss. Wenn dieser Mythos auch nicht ganz Tolstois Erfindung ist, sondern durch
seine umfangreiche Lektüre vorbereitet wurde, so entwickelt Tolstoi ihn noch weiter,
indem er eine Vermutung äußert:
Man könnte sich vorstellen, dass das, was unseren Körper bildet, der uns jetzt als Einzelwesen
erscheint und den wir vorzugsweise mehr als alle anderen Wesen lieben, irgendwann in einem
früheren, niedrigeren Leben bloß eine Sammlung von geliebten Gegenständen war, die die Liebe
so zu einem Ganzen vereinte, dass wir dieses Ganze in diesem Leben schon als unser Selbst
empfinden; und genauso wird unsere gegenwärtige Liebe zu dem, was uns zugänglich ist, im
künftigen Leben ein einheitliches Wesen sein, das uns genauso nahe ist wie jetzt unser Körper.
(Im Haus eueres Vaters gibt es viele Wohnungen.)168
Besseren ist ferner schon deshalb von dem Willen Schopenhauers zu unterscheiden, weil er deutlich
positiv als Ursprung des Lebens und Freude am Leben, als Liebe gedeutet wird.
167 Tolstoi, Christliche Lehre, S. 70 f.
168 Tolstoi, Christliche Lehre, S. 73. Ohne diesem Bildnis des einzigen Körpers bei Tolstoi genealogisch
nachzugehen, verweise ich auf die von Tolstoi hochgeschätzte Quelle, nämlich auf Spinozas Ethik:
„[…] nichts wertvolleres, sage ich, können die Menschen zur Erhaltung ihres Seins wünschen, als dass
alle in allem dergestalt übereinstimmen, dass die Seelen und Körper alle zusammen gleichsam eine
290
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Ohne die Verwurzelung von Tolstois Philosophie im Denken des Orients,169 den
Einfluss Schopenhauers oder den Spinozas und sogar eine gewisse Eklektik in deren
Zusammenfügung im geringsten zu bestreiten,170 wollen wir bei unserer Fragestellung bleiben: Was bedeutet dieser Mythos über das nach der Wiedervereinigung
suchende göttliche Ganze aus der Perspektive der tolstoischen Moral aus Vernunft,
die doch beim Einzelnen und seiner Not angesetzt hat? Tolstoi bestand doch so
entschieden auf dieser Not, auf dieser Berechtigung des Einzelnen, dass jeder Hinweis
auf das Gemeinwohl als unmoralisch, unvernünftig und gar widersinnig von ihm
abgelehnt wurde. Die Welt, wie sie dem Einzelnen vorkommt, die Ansprüche seiner
Vernunft an das Leben seien doch keine Illusionen. Hier zeigt sich Tolstois Plausibilität. Der Einzelne ist keine Illusion, aber auch keine Wirklichkeit. Er ist weder das Gute
noch das Böse, sondern eine Bewegung auf das Unvermeidlich-Gute hin. Er ist überhaupt nicht, er wird. Sein Selbst ist heterogen und beweglich – genauso wie Gott, wie
die göttliche Liebe, wie die Vernunft.
Tolstois Rede über die göttliche Einheit des Ganzen birgt somit eine Lehre über
das Werden des Ich. Nur wenn der Einzelne zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem
Sinn seines einzelnen Lebens fragt, ist diese Lehre paradox: Das individuelle „Ich“
muss dem eigenen „Ich“ abschwören, wenn es sich erhalten will, d. h.: wenn es sich
erhalten will, wird es sich verlieren. Wenn diese Lehre verzeitlicht wird, wenn sie also
zu einer Geschichte wird, wird sie entparadoxiert:
Der innere Wunsch des im Menschen geborenen geistigen Wesens ist nur eins: Steigerung der
Liebe. Diese Steigerung der Liebe ist allein das, was zu dem Werk beiträgt, das sich in der Welt
vollzieht: die Herstellung von Einheit und Eintracht anstelle von Trennung und Kampf. Das ist
das, was in der christlichen Lehre die Errichtung des Reichs Gottes genannt wird. […]
Die Liebe in jedem Menschen und in der Menschheit gleicht dem Dampf, der in einen Kessel
gepresst ist. Der Dampf, indem er nach Ausweitung strebt, drückt die Kolben und vollbringt so
sein Werk. Und so wie die Wände als Hindernisse für das Werk notwendig sind, das der Dampf
einzige Seele und einen einzigen Körper bilden […].“ (Spinoza, Die Ethik, S. 205 f. (Teil IV, Lehrsatz 18,
Anm.))
169 Die These, Tolstois Lehre des Nicht-Widerstandes und des Nicht-Tuns sei direkt aus buddhistischhinduistischen mythologisch-philosophischen Quellen abzuleiten (vgl. Bartolf, Ursprung der Lehre
vom Nicht-Widerstand, S. 47 ff.), scheint allerdings übertrieben zu sein. Tolstoi selbst zieht die Grenze
zum Buddhismus: „Die Vorstellung vom Nirwana hebt alles Grobe auf, verstößt aber dennoch gegen
die Forderung der Vernunft, gegen die Forderung der Vernünftigkeit des Daseins.“ (Tolstoi, Christliche
Lehre, S. 86) Mehrere Quellen kämen hier in Frage, z. B. die Lehre Empedokles. Dennoch um Tolstois
Lehre nicht misszuverstehen, ist es äußerst wichtig, trotz seiner vielfältigen, oft leicht erkennbaren
Quellen seine eigene Intention nicht aus den Augen zu verlieren.
170 Eine weitere Quelle soll hier nicht unerwähnt bleiben. „Die Anziehung der Elemente brachte die
körperliche Form der Natur zustande. Die Anziehung der Geister, ins Unendliche vervielfältigt und
fortgesetzt, müßte endlich zur Aufhebung jener Trennung führen, oder (darf ich es aussprechen,
Raphael?) Gott hervorbringen. Eine solche Anziehung ist die Liebe.“ (Friedrich Schiller, Philosophische
Briefe, S. 174)
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
291
vollbringt, so sind auch die Schranken des Einzelwesens für die Liebe notwendig, die in ihm
eingeschlossen ist, um ihr Werk zu vollbringen.171
Diese Liebe, diese rätselhafte Kraft des Lebens, dieser Wunsch nach dem Wohl oder
mit einem Wort: dieser Gott, bleibt sich selbst nicht gleich, sondern wächst. Insofern
kann man, solange man lebt, niemals behaupten, man habe den höchsten Punkt
dieses Prozesses erreicht. Als wir nach den ethischen Schlussfolgerungen von Tolstois
christlicher Lehre gesucht haben, wurden wir mit einer Situation konfrontiert, die für
einen Ethiker höchst verblüffend sein muss: Das Gute erweise sich für den Menschen
als unerreichbar, solange er lebt, aber sein ganzes Leben bestehe darin, den Weg zum
Guten zu suchen. Jetzt, in Tolstois „Katechismus“, wird diese Schlussfolgerung in
Form einer positiven Lehre bestätigt und erläutert: Das Ich ist ein Übergang, eine
Geburt, ein stetiges Über-Sich-Hinaus-Gehen – das Gott-Werden.
Aber nur als Geschichte entgeht diese Lehre allen vorher angesprochenen Paradoxien und wird positiv, d. h. sie unterstellt dem Leben, der göttlichen Liebe, dem
Ganzen bestimmte Ziele und gibt Antworten auf die Frage nach dem Sinn und Zweck
allen Geschehens. Und, wie immer, wenn man sich auf Geschichten einlässt, kann
die fragende Vernunft des Einzelnen weitere Fragen stellen: Sie fragt u. a. nach der
Zukunft des rätselhaften Ganzen, zu dem sie selbst gehört:
Ob dieses Wesen wieder unter den Bedingungen der Trennung handeln wird? Ob die Zunahme
der Liebe wieder eine neue Trennung verursachen wird?172
Hier muss die Vernunft jedoch in ihre Grenzen verwiesen werden. Der einzelne
Mensch kennt nur eine Geschichte, nämlich seine eigene. Die Frage nach dem Endzweck des Ganzen ist somit sinnlos, denn jede Antwort wäre für ihn nicht verständlich:
Denn die Frage ist falsch gestellt. Die Vernunft des Menschen, die nur unter den Bedingungen
von Raum und Zeit bestehen kann, sucht Antwort auf die Frage, was außerhalb dieser Bedingungen geschieht.173
Das „Ich“ von „Wanja, Iwan Iljitsch, mit all [s]einen Gedanken und Gefühlen“, seinen
Wünschen und Ängsten, ist ohne diese Gedanken und Gefühle bzw. außerhalb seiner
Erfahrung in Raum und Zeit, außerhalb seiner persönlichen Geschichte, nicht zu
denken. Deshalb ist es unvernünftig zu fragen, ob sein „Ich“ eine Illusion ist und was
mit ihm außerhalb seiner Grenzen geschehen wird. Das Rätsel des Lebens kann man
171 Tolstoi, Christliche Lehre, S. 72, 75.
172 Tolstoi, Christliche Lehre, S. 86.
173 Tolstoi, Christliche Lehre, S. 86.
292
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
zwar in eine Geschichte verwandeln, doch nicht wirklich enträtseln. Die Lehre über
das Leben muss deshalb unbegreiflich bleiben. Als Lehre verlangt sie jedoch schließlich Vertrauen, zumindest negativ: Man darf keine weiteren Fragen stellen, man soll
darauf vertrauen, dass weitere Fragen nur schädlich sein können.
In dem oben zitierten „philosophischen“ Brief an Nikolai Strachow, ein bekannter
russischer Publizist und Literaturkritiker, der nicht nur mehrere Jahre Korrespondent
und Gesprächspartner von Tolstoi, sondern auch von Dostojewski gewesen ist, äußerte Tolstoi seine Sicht auf den Status der philosophischen Begriffe und Argumentationen:
Die Gegenstände selbst, mit denen die Philosophie sich beschäftigt, das Leben, die Seele, der
Wille und die Vernunft, können nicht geteilt und bestimmte Aspekte von ihnen nicht getilgt
werden […] das Leben als Gegenstand der Philosophie ist das Leben in voller Ganzheit, d. h. das,
was alles Lebendige von sich selbst weiß. […] Bei den philosophischen Ausführungen ist es daher
unmöglich, die Begriffe neu zu definieren, aus denen philosophische Erkenntnis besteht, es ist
unmöglich, diese Begriffe zu zergliedern, man muss sie als Einheiten stehen lassen, weil man
diese Begriffe nur unmittelbar gewinnen kann. Deshalb ist es auch unmöglich, eine logische
Kette aufzubauen, die, wenn auch nur im Geringsten, notwendig wäre. Alle diese Begriffe
unterliegen keinem der schopenhauerschen Grundsätze von dem hinreichenden Grund. Alle
diese Begriffe unterliegen auch keinen logischen Schlussfolgerungen, sie sind einander gleich
und durch keine Logik verbunden. Deshalb gewinnt eine philosophische Lehre ihre Überzeugungskraft nicht aus den logischen Schlüssen, sondern durch ein harmonisches Zusammenführen aller dieser unlogischen Begriffe, d. h. sie wird in einem Augenblick erreicht, ohne Schlussfolgerungen und Beweise. Als Bestätigung bitte ich Sie, an die Unwirksamkeit der philosophischwissenschaftlichen Theorien zu denken und an die Wirksamkeit und Überzeugungskraft der
Religionen, und das, wie Sie wissen, nicht nur für die groben und unausgebildeten Gemüter […]
Die Philosophie in einem persönlichen Sinne ist die Kenntnis, die die bestmöglichen Antworten
auf die Fragen über das menschliche Leben und den Tod gibt. (TGA 62, S. 223 ff.)174
Unter den Religionen, deren Überzeugungskraft anerkannt wird, ist hier gerade der
Glaube an Geschichten gemeint (das Wort „Religion“ steht im Plural). „Ein harmonisches Zusammenführen aller dieser unlogischen Begriffe“ oder „die Philosophie in
einem persönlichen Sinne“ ist eine Geschichte, die den philosophisch-wissenschaftlichen Theorien entgegensteht. Obwohl dieser Gedanke Tolstois noch zur Zeit von
Anna Karenina ausgesprochen wurde, d. h. früher als er zu seiner Moral aus Vernunft gekommen ist, wurde er damals als seine „profession de foi“ bezeichnet
(TGA 62, S. 220) und später durch seinen „Katechismus“ bestätigt: Die wahre Religion, die alle Menschen versöhnen sollte, erwies sich als eine Geschichte, die nur „im
persönlichen Sinne“, als Geschichte des Gott-Werdens des eigenen Ich überhaupt
Sinn macht.
174 Vgl. den Schluss, den Simon aus Kants Philosophie zieht: „Die ästhetische Deutlichkeit kann also
in der Philosophie nur Surrogat der logischen sein. In dieser Funktion ist sie ihr jedoch unentbehrlich.“
(Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, S. 111)
3.2 Das Gute in der Perspektive des Lebens
293
Der Mythos über die Steigerung der Liebe krönte so die Bemühungen der Vernunft
um den Sinn des Lebens, wenn er auch nur eine persönliche Vermutung, einen
persönlichen Wunsch zum Ausdruck brachte. Die Liebe, die im Gebot des NichtWiderstandes nur negativ und paradox zu denken war, konnte jetzt geboten werden;
die Lehre, die nicht gelehrt werden durfte, konnte jetzt als eine Geschichte erzählt
werden und Vertrauen verlangen. Die These des Nicht-Widerstandes und die negative
Forderung des Nicht-Tuns kamen dagegen in Tolstois „Katechismus“ als solche nicht
mehr vor. Sie wurden nur noch positiv, als Erzählung dargelegt: als eine Geschichte
über die Liebe, deren Wunsch nach dem Wohl des Seienden alle Lebewesen vereinigen wird. Denn weder die Steigerung der Liebe als das Ziel des Lebens noch die
Verbrüderung der Menschen durch Vernunft könnten logisch ergründet werden. Stattdessen mussten sie, gerade umgekehrt, in einer Geschichte entfaltet werden, der man
entweder vertrauen oder aber sein Vertrauen verweigern kann. Im letzteren Fall bliebe
man bei den Paradoxien des sinnlosen Sinns und des ziellosen Ziels, die jedoch ohne
„Wirksamkeit und Überzeugungskraft“ wären, d. h.: Sie wären nicht plausibel. Wenn
man aber der positiven Lehre über die immer wachsende göttliche Liebe Glauben
geschenkt hat, könnte man diesen Glauben nicht als den allgemeingültigen betrachten, sondern bloß als sein auf Zeit geltendes Verständnis des paradoxen Sinns des
Guten. Ein solches Verständnis wäre plausibel, aber nur weil es die eigene Not
befriedigen kann.
Aber auch die Not des Lebens – der Ausgangspunkt der ganzen Überlegung und
der einzige sichere Punkt Tolstois – war, wie er selbst als Schriftsteller mehrmals
zeigte, den anderen nicht zuzumuten. Sie blieb von dem Grad ihrer Empfindlichkeit
gegen die Frage des Lebens abhängig. Wie könnte man einem Menschen mit einer
„verstumpften Einbildungskraft“, der das Leben gerade wegen seiner Vergänglichkeit
und Sinnlosigkeit zu genießen weiß, Tolstois Gebot des Nicht-Widerstandes plausibel
machen? Nicht nur „die Philosophie in einem persönlichen Sinne“, sondern auch das
paradoxe Minimum, das durch den Verzicht auf jede Art von Metaphysik gewonnen
wurde, ließ sich nicht ohne einen gravierenden Selbstwiderspruch verallgemeinern,
d. h. nicht lehren. Die allgemeingültige Lehre, ob in Form einer Geschichte oder aber
als Vernunftreligion, konnte keine Plausibilität mehr für sich beanspruchen. Auch als
denkbarer Horizont aller Bemühungen des Einzelnen, als sein bloßes Verlangen nach
dem Sinn des eigenen Lebens war das Allgemeine nicht mehr vorhanden. Es sei gerade
die Hinterlist und „Mogelei der Vernunft“, sich als die Vernunft, als letzten Grund, als
Autonomie, als gesetzgebende Kraft zu verstehen, um die eigene Verschuldung vor
dem Leben, das eigene Werden zu vergessen und zu verleugnen. Alles, wozu die
Vernunft dann fähig ist, ist eine tautologische Gleichung: 0=0, „das Leben, das mir
als Nichts vorkommt, ist Nichts“.175 Wenn dagegen solche Begriffe wie Leben, Gott,
175 Die Übersetzung dieser Stelle von Raphael Löwenfeld ist sehr ungenau, deshalb gebe ich eine
eigene. Vgl. „[Ж]изнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто.“ (TGA 23, S. 34)
294
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Wille und Vernunft zur „Philosophie in einem persönlichen Sinne“ zusammengeführt
werden, wird ihre Harmonie „in einem Augenblick erreicht, ohne Schlussfolgerungen
und Beweise“. Denn sie gehören nicht in das Reich der Logik, sondern in eine Philosophie, die erzählt werden muss. Sie gehören in eine Geschichte.
3.3 Die gute Kunst
Das Gute und das Schöne
Die das eigene Wohl suchende Vernunft, die aus der von ihr selbst verursachten Not
zum guten Sinn des Lebens getrieben wird und sich im Namen dieses Guts das
Vertrauen in die Geschichten untersagt, kommt so am Ende zu ihrer eigenen Geschichte, zu ihrem eigenen Mythos. Es stellt sich heraus, dass sie sich selbst nur in
Form einer Geschichte begreifen kann, die ihr ihre eigene Grenze zeigt – die Grenze
einer vernünftigen Erklärung, die Grenze ihrer Fähigkeit zu verstehen. Obgleich die
Ziele des Lebens und dessen Gut nicht von der unter den Bedingungen des Lebens
stehenden Vernunft sinnvoll hinterfragt werden können, erwies sich die Vorstellung,
dass das Leben uns verborgene Ziele besitzt (oder, wie Tolstoi sagt, dass der Wille des
Herrn des Lebens akzeptiert werden soll), als für die Vernunft genauso unumgänglich
wie die am Anfang von Tolstois Überlegung stehende „allernatürlichste Form der
Vorstellung“, dass das Leben „ein dummer, böser Spaß“ sei, „den sich jemand mit
mir erlaubt hat“. Der nächste Schritt scheint nun unvermeidlich zu sein: Dem „Hauswirt des Lebens“ unterstellt man nun auch ein bestimmtes Ziel – nämlich die brüderliche Einigung der Menschen in der Liebe, die daher selbst göttlich ist, die Gott ist. Die
Einheit aller Menschen kann dann ihrerseits nur durch die Lehre über die Einheit der
Vernunft plausibel gemacht werden.
Dieser konkret-mythologische Inhalt der Moral aus Vernunft ist nach Tolstoi „ein
höchstes Verständnis vom Sinn des Lebens“ oder „das religiöse Bewußtsein einer
gewissen Zeit und Gesellschaft“.176 Eine Lehre über das Leben ist, wie es im Traktat
Was ist Kunst? steht, das „Kennzeichen jenes, den erleuchtetsten Menschen der
jeweiligen Gesellschaft und der jeweiligen Zeit zugänglichen Verständnisses des
Lebens“.177 Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Menschheit in Zukunft „noch
neue, höhere Ideale“ entdecken wird.178 Bei Tolstois Christentum handelt es sich
somit nicht um eine absolute, endgültige, alternativlose Wahrheit, sondern um eine
Wahrheit, die an der Zeit ist. Sie ist nicht unmittelbar plausibel und kann nicht logisch begründet werden, sondern muss – wie jede Geschichte – verbreitet und über-
176 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 224.
177 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 80.
178 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 304.
3.3 Die gute Kunst
295
liefert werden. Dafür ist, so Tolstoi, den Menschen ein mächtiges Mittel gegeben: die
Kunst.
Die Kunst steht für Tolstoi nicht nur unter den Bedingungen des Lebens, sondern
ist selbst eine solche Bedingung. Ihr Verhältnis zum Sinn des Guten aufzuklären, ist
deswegen eine Aufgabe, die Tolstoi als seine persönliche Not versteht. Als das Leben
für ihn seinen Sinn verloren hatte, so schreibt er in Meine Beichte, wurde die Kunst
ihm zu „eine[r] Verschönerung des Lebens, eine[r] Anlockung zum Leben“.179 Die
eigenen Kunstwerke brandmarkte er damals als sinnlos und leer. Schriftsteller zu
sein, wie er es war, bedeute, „die Menschen zu lehren, ohne selbst zu wissen
was.“180 Jetzt, in seiner neuen Position eines Lehrers der wahren Religion, will er die
Frage nach der Kunst neu klären und die Kunst selbst vor den Richtstuhl der Vernunft bringen. Ist die Kunst tatsächlich für das Menschenleben notwendig? Wie steht
sie zur Lehre über das Leben? Gibt es vielleicht auch „schlechte“ Kunst, die Kunst
nämlich, die ihre Ziele verfehlt? Wie ist diese dann von der „guten“ zu unterscheiden? Dies sind die zentralen Fragen, mit denen sich einer der größten Künstler am
Ende seines Lebens beschäftigte. Und die Kunstphilosophie, die aus diesen Fragen
entstand, erschreckte das russische Publikum nicht weniger als seine moralische
Predigt. Denn Tolstois Ablehnung aller Kunstwerke der letzten 400 Jahre der europäischen Geschichte, seine eigenen Werke mit eingeschlossen, schien eine Verleugnung der Kunst zu sein – eine Verleugnung der Kunst im Namen der Moral aus
Vernunft.181
Fünfzehn Jahre untersuchte Tolstoi das Problem der Kunst unter der Optik seiner Lehre über das Leben.182 Als Ergebnis entstand zuerst die programmatische
Abhandlung Was ist Kunst?,183 fünf Jahre später das Werk Von Shakespeare und
Drama, in dem nicht nur Shakespeare, sondern auch Beethoven, Mozart, Wagner,
Baudelaire, Mallarmé und viele andere anerkannte Künstler als schlecht und ihre
179 Tolstoi, Meine Beichte, S. 44.
180 Tolstoi, Meine Beichte, S. 26. Dieser Angriff auf die Künstlerwelt und die eigenen früheren Vorstellungen von der Kunst ist u. a. bei Tolstoi als Kritik am Begriff des Genies zu verstehen. Denn das Genie
bringe, auch nach Kant, gerade das den anderen bei, was es selbst nicht versteht, d. h. was sich nicht in
Begriffe und Erkenntnisse verwandeln lässt.
181 Erst in den 60er-70er Jahren erfolgt eine positive Bewertung seiner Kunstphilosophie. Vgl.
Е.Н. Купреянова (E.N. Kuprejanova), Эстетика Л.Н. Толстого (Die Ästhetik von L.N. Tolstoi);
К.Н. Ломунов (К.Н. Ломунов), Эстетика Льва Толстого (Die Ästhetik von Lew Tolstoi). Vgl. auch
die tiefgreifende Untersuchung von Rimvydas Šilbajoris (Tolstoy’s Aesthetics and his Art), in der
überzeugend gezeigt wird, dass zwischen Tolstois Kunstphilosophie, seinen moralphilosophischen
Ansichten und seiner Künstlerpraxis eine tiefe Kontinuität bestand, die durch sein ganzes Werk zum
Ausdruck kam und sich nicht nur auf die spätere Phase seines Schaffens reduzieren lässt. Tolstois
Suche nach der „wahren Kunst“ habe lange vor seinen theoretischen Studien der Ästhetik begonnen.
182 Zu einer detaillierten Darstellung von Tolstois kunstphilosophischen Schriften und deren Auswirkung s. Magdalene Zurek, Tolstojs Philosophie der Kunst.
183 Zur Geschichte der Entstehung des Traktats s. Paul H. Dörr, Nachwort.
296
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Werke als Kennzeichen der Verderbnis der Kunst dargestellt wurden. Aber nicht nur
diese ungeheuren Ergebnisse aus Tolstois kunsttheoretischer Arbeit, sondern auch ihr
Ausgangspunkt war überraschend und abstoßend zugleich. Denn am Anfang stand
die Frage: „[…] ist es wahr, dass dies die Kunst ist und daß die Kunst solch eine
wichtige Sache ist […]?“184 Die Frage „Was ist Kunst?“ könne nur zusammen mit der
Frage „Warum ist die Kunst nötig?“ sinnvoll gestellt werden. Schon in dieser, wenn
auch gezielt vereinfachten, Formulierung kam Tolstoi einem Philosophen nahe, den
er nur als „bösen Wahnsinnigen“ kannte und dessen Popularität er bei den russischen
Intellektuellen für ein Zeichen ihres Wahnsinns hielt (TGA 54, S. 77) – zu Friedrich
Nietzsche.
Dies ist nicht die erste Annäherung:185 die Perspektivität der Not des Einzelnen,
die, wenn auch ungewollt, zur Paradoxierung aller Gegensätze der Werte führte; das
„Ich“ als Werden, als heterogene undurchschaubare Bewegung; die Deutung der
Wahrheit als eine nur auf Zeit geschaffene und geglaubte Sinngebung, die einer
Illusion nicht entgegengesetzt werden kann – das sind nur einige der Übereinstimmungen. In der Frage nach dem Sinn und Wesen der Kunst wird die Übereinstimmung
ebenso auffallend. Man denke nur an Nietzsches radikalen Zweifel, „dass die Kunst
überhaupt zwecklos, ziellos, sinnlos, kurz l’art pour l’art – ein Wurm, der sich in den
Schwanz beisst“, sein könnte:
[…] was thut alle Kunst? lobt sie nicht? Verherrlicht sie nicht? wählt sie nicht aus? zieht sie nicht
hervor? Mit dem Allen stärkt oder schwächt sie gewisse Werthschätzungen … (GD Streifzüge, 24,
KSA 6, S. 127)
Die Kunst müsse in ihrem Wert hinterfragt werden: Was bedeutet es, sie als Problem
zu sehen? Was macht sie zum Problem für das Leben? Auch Tolstoi sieht die Aufgabe
einer Kunstphilosophie darin, diese Fragen zu beantworten.186 Auch für ihn ist die
Kunst zu einem persönlichen Problem geworden.
Wie auch früher Nietzsche, richtet Tolstoi seine Kunstphilosophie bewusst gegen
andere Theorien der Kunst. So eröffnete er sein Traktat zur Kunst mit einer kritischen
Behandlung ästhetischer Theorien, die er im Laufe von fünfzehn Jahren gründlich
studiert hatte. Dazu zählten die von Baumgarten, Kant, Schelling, Schiller, Fichte,
Winckelmann, Lessing, Hegel, Schopenhauer und Hartmann, aber auch die neuesten
184 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 21.
185 Nietzsche und Tolstoi werden einander in der Forschungsliteratur meistens bloß entgegengesetzt.
Die Stichwörter sind dabei „der Moralist“ und „der Immoralist“. Vgl. eine solche Entgegensetzung
gerade bezüglich der Frage nach der Bestimmung der Kunst: Л.З. Немировская, Религия в духовном
поиске Толстого, S. 41 ff.
186 Tolstoi sah in Nietzsche dagegen gerade einen Vertreter der l’art pour l’art. In seinen kunsttheoretischen Werken wird Nietzsche einige Male erwähnt, doch immer bloß negativ als Anführer der
Theorie der elitären Kunst, der Kunst „nur für die Übermenschen“, und als Verehrer Wagners, der den
schlechten Geschmack in der Musik verbreitet (Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 109).
3.3 Die gute Kunst
297
Ästhetiker seiner Zeit, wie die von Cousin, Kralik, Knight, Lévêque, Schasler.187 Tolstois Aufgabe ist dabei ausdrücklich, gegen metaphysische Kunstinterpretationen aller
Art zu kämpfen. Er zitiert darum ein „gute[s] Buch über die Ästhetik“ von dem
französischen Schriftsteller Véron:
Il n’y a pas de science, […] qui ait été de plus, que l’esthétique, livrée aux rèveries des métaphysiciens.188
Die Hartnäckigkeit der Behauptungen und die Starrsinnigkeit der Dogmatisierung im
Bereich des Ästhetischen werden von Tolstoi mit dem religiösen Dogmatismus verglichen. Doch am erstaunlichsten sei, dass der Zweck der Kunst im Ausdruck des
Schönen gesetzt wird, dessen „mystischer“ Begriff sich nicht näher definieren lässt.
Das Schöne als Inhalt der Kunst bilde gerade den Stein des Anstoßes für alle Ästhetiker, weil sich eine Definition als unmöglich erweist. Im Grunde, sagt Tolstoi, gibt es
nur zwei Definitionen der Schönheit: die eine – die objektive, mystische, die diesen Begriff mit
der höchsten Vollkommenheit, mit Gott, verbindet – eine phantastische, durch nichts begründete
Definition; die zweite dagegen – eine sehr einfache, begreifliche, subjektive, die das als Schönheit bezeichnet, was einem gefällt.189
Als Vertreter der ersten Theorie werden Hegel, Schelling und ihre französischen Nachfolger genannt. Zwar ist sie sehr wohl erhaben, merkt Tolstoi ironisch an, aber leider
zu unklar und gar unbegründet. Die „subjektive“ Definition enthält dagegen ein
klares Kriterium des Vergnügens, das jedoch die Frage nach dem, was Kunst ist und
was sie nicht ist, völlig aufhebt. Denn was einem gefällt, kann einem anderen missfallen. Also wird die Frage nach der Kunst zur Frage nach dem Geschmack. Aber auch
die erste, objektive Definition muss sich am Ende auf das Gefallen bzw. den Geschmack beziehen, weil die Erscheinungen des Absoluten den Menschen nur dann als
schön vorkommen, wenn sie ihnen gefallen. Aus der Perspektive eines wahrnehmenden Subjekts (und das ist für Tolstoi die einzig sinnvolle Fragestellung) kann sich das
Schöne nur durch das Gefühl des Gefallens zeigen. Also ist „die objektive Definition
nichts weiter […] als die anders ausgedrückte subjektive“.190 Die metaphysische
Erklärung der Erscheinung des Absoluten ändert nichts an der Antwort, dass die
Kunst sich durch das Gefallen zeigt. Alle Ästhetiker sind sich, so Tolstoi, in ihrer
187 Victor Cousin, Du vrai du beau et du bien; Richard Kralik, Weltschönheit: Versuch einer allgemeinen
Ästhetik; William Angus Knight, The philosophy of the beautiful; Jean Charles Lévêque, La science du
beau: étudiée dans ses principes, dans ses applications et dans son histoire; Max Schasler, Kritische
Geschichte der Aesthetik: Grundlegung für die Aesthetik als Philosophie des Schönen und der Kunst.
Abt. 1. Von Plato bis zum 19. Jahrhundert.
188 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 34 f.
189 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 61.
190 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 63.
298
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Antwort einig: Das Schöne ist das, was gefällt. Das bedeutet, Tolstoi wird wiederum
ironisch, dass „der Genuß deshalb gut sei, weil er Genuß ist“.191
In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, wie Tolstoi Kants Definition des
Schönen darstellt. Im Unterschied zu den Fragen der Moral und der Vernunftreligion
sucht er in diesem Fall keine Unterstützung bei seinen großen Vorgängern. Ganz im
Gegenteil. Schopenhauers Definition beispielsweise, die sich zwar gegen die hegelsche richtet, wird von Tolstoi zur objektiv-mystischen gezählt und als solche zurückgewiesen.192 Als Vertreter der zweiten, subjektiven Richtung der Ästhetik gilt Kant mit
seiner Definition des Schönen: Das Schöne sei, was ohne Interesse gefällt. Den Ausdruck „ohne Interesse“ lässt Tolstoi als überflüssig wegfallen. Diese Vereinfachung
von Kants Kritik des Schönen ist im Vergleich zu Tolstois übriger Kant-Rezeption
erstaunlich und wirft den Verdacht auf, dass er Die Kritik der Urteilskraft entweder
sehr oberflächlich gelesen hat oder gar nur aus zweiter Hand kannte.193 Eine kurze
Zusammenfassung von Kants dritter Kritik in Was ist Kunst? stammte, worauf Tolstoi
selbst hinweist, aus demselben Buch Schaslers, das Tolstoi als Quelle für Hegels und
Schopenhauers Ästhetik verwendete.194 Ästhetische Ideen als Produkt des freien
Spiels aller Erkenntnisvermögen, der Anspruch auf die Allgemeingültigkeit bzw. die
Voraussetzung der Mitteilbarkeit und des Gemeinsinns in Geschmacksurteilen oder
das Schöne als Symbol des Sittlich-Guten werden von Tolstoi nicht einmal erwähnt.
Erstaunlich ist darüber hinaus, dass der Ausdruck „ohne Interesse“ nicht im Sinne
Kants, d. h. als Gleichgültigkeit „in Ansehung der Existenz des Gegenstandes“ (KU,
AA 5, S. 205), sondern bloß als selbstlose Freude dargelegt wird, was einen offensichtlichen Widerspruch enthält: Die Freude als Genuss kann nicht völlig selbstlos sein.
Abgesehen von der Frage, inwieweit Tolstoi mit Kants Analytik des Schönen
vertraut war, ist die Verschiedenheit seiner Intention und der Kants nicht zu verkennen. Tolstoi wollte die Frage nach der Kunst neu stellen und fühlte sich in diesem
Bereich viel kompetenter als seine Lehrer in der Philosophie. Wie im ersten Kapitel
gezeigt wurde, konstruierte Kant seinen Begriff des Schönen analog zum Guten, aber
auch in Abgrenzung zu ihm. Wenn der kategorische Imperativ gebietet, jedem Menschen die Vernünftigkeit bzw. die Fähigkeit zum Guten zu unterstellen und dement-
191 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 69.
192 Vgl. in Tolstois Tagebuch: „Habe gerade Schopenhauers Ästhetik gelesen: was für eine Leichtsinnigkeit und Verwirrung.“ (TGA 50, S. 122)
193 Auch Krouglov ist dieser Meinung (Krouglov, Leo Nikolaevič Tolstoj als Leser Kants, S. 381).
Allerdings gibt es in Für jeden Tag, Tolstois Sammlung seiner Exzerpte von verschiedenen Autoren,
Auszüge aus der Kritik der Urteilskraft, besonders zum Verhältnis von Kunst und Moral (TGA 44, S. 42).
Ein anderer Forscher meint, Tolstoi habe Kants Kunstphilosophie mit Absicht vereinfacht (А.С.
Полтавцев (A.S. Poltawtsew), философское мировоззрение Л.Н. Толстого (Die philosophische Weltanschauung von L.N. Tolstoi), S. 113). Zu einer systematischen Auseinandersetzung von Tolstois und
Kants Kunstphilosophie s. Валентин Ф. Асмус (Walentin F. Asmus), Немецкая эстетика XVIII века
(Die deutsche Ästhetik des 18. Jahrhunderts), S. 180 ff.
194 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 42.
3.3 Die gute Kunst
299
sprechend zu handeln, so kann der gute Geschmack bei manchen Menschen eventuell
auch fehlen. Die Empfindlichkeit zum Schönen ist schließlich für das Handeln nicht
notwendig. Das Interesse der Vernunft, das sie an der Moral nimmt, wird so von dem
interesselosen Spiel abgegrenzt, in welches das Gemüt durch die Naturschönheit und
die Produkte der schönen Kunst versetzt wird. Für Tolstoi, für den die Grenze der
Vernunft nicht in der unbegreiflichen Nötigung zum Guten, sondern in der Unbegreiflichkeit des Lebens liegt und die Nicht-Autonomie der Vernunft markiert, ist eine
Entgegensetzung der interesselosen Unterstellung des Gemeinsinns und der interessierten Unterstellung der Vernünftigkeit selbst ohne Sinn. Die Frage nach der Bestimmung der Kunst wäre durch eine solche Entgegensetzung verloren gegangen, weil es
gerade die Frage nach dem mit der Kunst verbunden Interesse gewesen ist: Was
bedeutet die Kunst für das Menschenleben? Sie dürfe nicht von dem Sinn des Guten
bzw. der Not des Lebens abgegrenzt werden. Sie sei kein freies Spiel und ihr Ziel ist
kein interesseloses Wohlgefallen. Denn jedes Spiel verbirgt Regeln. Nur für den
äußeren Beobachter ist es regellos, nutzlos und überflüssig. Für einen Künstler – und
dies ist Tolstois Perspektive im Unterschied zu der Kants – sind die Fragen nach der
Nützlichkeit der Kunst, d. h. nach dem Sinn, der durch die Kunst vermittelt wird, und
nach ihrem Bezug auf den Sinn des Lebens die dringendsten Fragen überhaupt. Ohne
sie zu beantworten, kann er nichts schaffen.
Es ist, so Tolstoi, die beliebig gesetzte Verbindung zwischen dem Schönen und
der Kunst, die die ästhetischen Theorien in die Sackgasse führt und die Kunst zu einer
vom Leben abgetrennten, entbehrlichen Tätigkeit herabwürdigt, deren Ziel bloß Vergnügen sei. Das Schöne erweist sich dann als undefinierbar, so auch die Kunst. Diese
Theorien sind v. a. unfähig, die Frage nach dem Kriterium zu beantworten: Wie
unterscheidet man das Schöne von dem Nicht-Schönen bzw. die Kunst von NichtKunst? Da diese Frage auf dem von den Ästhetikern gewählten Weg nicht zu beantworten ist, verwickeln sie sich bloß in eine unfruchtbare Geschmacksdebatte und
vollziehen eine Verschiebung: Statt eine Definition der Kunst zu versuchen, sprechen
sie von einem Kanon der ausgewählten Kunstwerke, der zum Maßstab des guten
Geschmacks geworden ist. Der logische Fehler einer solchen Kunstdefinition ist
genauso offensichtlich wie der bei der Begründung der religiösen Dogmen (die Ähnlichkeit ist keinesfalls zufällig), jedoch unumgänglich, wenn der Begriff der Schönheit
als Leitfaden für die Definition der guten Kunst (bzw. der Begriff der Kirche für die
Definition der wahren Religion) angenommen wurde.
Besonders heftig sind Tolstois Angriffe auf Alexander Baumgarten, der „mit der
den Deutschen eigenen äußerlichen pedantischen Ausführlichkeit und Symmetrie“
eine „merkwürdige Theorie erdacht und dargestellt“ hat, nämlich die der „Dreieinigkeit“ des Wahren, des Guten und des Schönen. Sie ist, so Tolstoi, genauso verwunderlich und widersinnig wie die Lehre über die heilige Dreieinigkeit.195 Das Gute ist
195 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 96 ff.
300
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
dagegen, so Tolstoi, von dem Schönen und das Schöne von dem Wahren nicht nur zu
unterscheiden, sondern sie sind einander entgegenzusetzen. Das Schöne, das uns
gefällt, entspricht nicht unbedingt dem Guten, sondern kann, wie das Vergnügen
selbst, unseren Interessen, unserem wahren Wohl widersprechen (Tolstoi bedient sich
hier eines Vergleichs mit der Nahrung, bei der das Vergnügen nicht als wahres Maß
des Nutzens gelten kann). Das unmittelbare Wohlgefallen am Schönen ist also vom
mittelbaren Wohl zu unterscheiden. Das Gleiche gilt für das Wahre. Es zerstört öfters
gerade die Illusion, aus der das Schöne besteht.196 Insofern fällt das Letztere keineswegs mit dem Wahren zusammen, sondern wirkt als sein Gegenmittel:
Und nun diente die willkürliche Vereinigung dieser drei unvergleichbaren und einander fremden
Begriffe als Grundlage jener merkwürdigen Theorie, […] nach der eine der niedrigsten Äußerungen der Kunst, die Kunst nämlich nur für den Genuß, diejenige, vor der alle Lehrer der Menschheit die Menschen gewarnt hatten, als die höchste Kunst betrachtet wird. Und die Kunst wurde
nicht zu jener wichtigen Sache, die sie zu sein bestimmt ist, sondern ein leerer Zeitvertrieb
müßiger Menschen.197
Die Kunst, genauso wie die Religion, kann nach Tolstoi nur dann wieder zu einer
„wichtigen Sache“ werden, wenn sie sich von den metaphysischen Träumereien
entschieden absondert und eine unumstößliche Grundlage für sich findet. Diese
unumstößliche Grundlage, dieser einzig sichere Leitfaden kann für die Kunst, wie für
jede andere menschliche Tätigkeit, nur die Nötigung des Lebens sein. Das Leben des
Einzelnen mache nur dann Sinn, wenn er den Bezug auf die Welt außer ihm finden
kann. So auch die Kunst. Sie sei nur dann sinnvoll, wenn sie einen Menschen mit
einem anderen verbinden kann. Denn der Mensch kann allein nicht überleben und
muss seine Gedanken und Kenntnisse mitteilen. Er braucht dafür die Sprache und die
Wissenschaft. Aber auch das Wichtigste seines Lebens, sein Verständnis des Guten,
das, wie es sich am Ende von Anna Karenina herausstellte, „sich nicht in Worten
ausdrücken“ bzw. nicht mitteilen lässt, muss der Mensch irgendwie mitteilen – als
persönliche Geschichte, als Lebenskraft, die ihn trägt, als eigener Kunstgriff, das
Leben zu ertragen. Dafür hat er die Kunst.
Merken wir uns an dieser Stelle eine Schwierigkeit, die Tolstois Theorie der
Kunst von Anfang an mit einem Widerspruch bedroht. Die paradoxe Wahrheit über
den Sinn des Lebens war nicht mitteilbar; aber das Erlebnis, das der Mensch durch
seine persönliche Geschichte gewinnt, soll mitteilbar sein. Er müsse „die Wahrheit
aus dem Gebiet des Verstandes in das Gebiet des Gefühls […] übertragen“, die Wahrheit nämlich, dass „das Wohl der Menschen auf ihrer Einigung untereinander be196 Erstaunlich ist hier wiederum die Übereinstimmung mit Nietzsche: „An einem Philosophen ist es
eine Nichtswürdigkeit zu sagen: das Gute und das Schöne sind Eins: fügt er gar noch hinzu ‚auch das
Wahre‘, so soll man ihn prügeln. Die Wahrheit ist häßlich: w i r h a b e n d i e K u n s t, damit wir nicht an
der Wahrheit zu Grunde gehn.“ (Nachlass, Frühjahr–Sommer 1888, 16[40], KSA 13, S. 500)
197 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 100 f.
3.3 Die gute Kunst
301
ruhe“.198 Die „Bestimmung der Kunst“ „in unserer Zeit“ sei es, dieses Ideal als „das
höchste Ziel des Lebens“ zu vermitteln. Sie allein könne es nicht als Gedanke, sondern
als „Gefühl“ mitteilen, d. h. so, dass es ganz selbstverständlich erscheint. Eben das sei
die Aufgabe der Kunst. Durch sie wird die Vernunft zum Instinkt, die Achtung vor dem
Guten wird zur Neigung zum Guten, eine Lehre wird zur Plausibilität. Und vielleicht
kann der Mensch nur so aus dem Netz des Bösen befreit werden, das ihn veranlasst,
die eigenen Interessen zu verkennen. Die Kunst ist also weder nutzlos noch ist sie
Mittel des Genusses.
Um die Kunst genau zu definieren, muß man vor allem aufhören, sie als Mittel zum Genuß
anzusehen, und muß sie vielmehr als eine der Bedingungen des menschlichen Lebens betrachten. Wenn wir die Kunst so betrachten, sehen wir, daß sie eines der Mittel für die Einigung der
Menschen untereinander ist.199
Die Kunst wird sinnvoll, wenn sie dem dient, was das tiefste Interesse aller Menschen,
ihr eigentliches Wohl ist – der Verwirklichung des Reichs Gottes auf Erden.
„Der Geist des Bösen und des Betrugs“: das Theater
Die Bestimmung und die Aufgabe der Kunst sind damit definiert: Die Kunst muss zur
Bedingung des Lebens werden, indem sie die Menschen verbindet. Tolstoi drückt
diesen Gedanken mit ganz einfachen Worten aus: Die Kunst ist nur dann Kunst, wenn
ein Mensch einen anderen mit seinen Gefühlen ansteckt.200 Damit ist das Gefühl
selbst der erste Schritt zur Kunst. Freilich, um Kunst zu sein, muss noch die Geschicklichkeit, dieses Gefühl mitzuteilen, hinzukommen.
Wie primitiv eine solche Definition auch scheinen mag, sie darf, genauso wie bei
der religiösen Fragestellung, nicht unterschätzt werden. Die Einfachheit ist bei Tolstoi
ein gezieltes und wichtiges Mittel gegen die „nebelhafte“, metaphysische Verwirrung
und die daraus folgende Dogmatisierung. Eine einfache Definition zeigt vor allem in
der klarsten Art und Weise, was sie ausschließt. Es ist die herrschende Überzeugung,
dass ein Kunstwerk sehr gut, aber auch unverständlich sein kann, dass Ausbildung
und besondere Belehrung vonseiten der anderen für die Wahrnehmung der Kunst
nötig sind oder, anders ausgedrückt, dass der Geschmack der ausgebildeten Elite der
Gesellschaft, die sich an den Kunstkanon hält, für die Kunst maßgebend sein soll. Als
198 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 304.
199 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 72. An dieser Stelle und im Weiteren spricht Tolstoi von dem Mittel der
Kommunikation („общение“) zwischen den Menschen – ein Wort, das der deutsche Übersetzer mal
mit „Einigung“, mal mit „Gemeinschaft“ wiedergegeben hat. Dies scheint eine nicht besonders glückliche Ausdrucksweise zu sein, da Tolstoi am Ende, wie wir sehen werden, auch von der Einigung
(„единение“) der Menschheit spricht, zu der die Kommunikation durch die Kunst führen soll.
200 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 73.
302
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Sprachrohr dieser ausschließenden Tendenz der Kunst für wenige bzw. für die „Übermenschen“ nennt Tolstoi wiederum Nietzsche.201 Sein Angriff auf den Geschmackskanon ist jedoch gegen alle „Ästhetiker“ gerichtet, u. a. auch gegen Kant, der darauf
verzichtete, die Kriterien der Kunst aufzufinden und sie zu definieren. Im Kapitel zu
Kant wurde gerade dieser Verzicht als Kants größter Verdienst und als ein neuer
Schritt in der Kunstphilosophie dargestellt. Für Tolstoi, der nicht vom wahrnehmenden, sondern vom schaffenden Subjekt, d. h. vom Künstler her denkt, ist es gerade der
Mangel, der auszufüllen ist. Er sieht es als seine Aufgabe an, den Künstler vom
Glauben an einen Kunstkanon zu befreien, genauso wie er den Christen vom Glauben
an den Kanon der dogmatischen Lehre der Kirche befreien wollte.
Das Kriterium der Kunst zu finden, erweist sich jedoch als schwierig. Es ist zuerst
bloß negativ. Die Unverständlichkeit der Kunst sei ein negatives Zeichen – aus einem
klaren Grund: Wenn die Kunst in der Vermittlung der Gefühle und Instinkte besteht,
gibt es in ihr nichts, was erklärt werden sollte bzw. könnte. Sie ist keine Wissenschaft.
Es gibt keine Kenntnisse, die das ästhetische Gefühl schulen könnten, es gibt keine
Wissenschaft der Kunst:
Die Werke eines Künstlers kann man nicht deuten. Wenn man mit Worten das erklären könnte,
was der Künstler sagen wollte, hätte er es auch mit Worten gesagt. Er hat es aber mit seiner Kunst
gesagt, weil man auf eine andere Weise das Gefühl, das er empfunden hat, nicht wiedergeben
konnte. Die Erläuterung eines Kunstwerkes durch Worte beweist nur, daß der, der es deutet,
nicht fähig ist, die Kunst nachzuempfinden.202
An einer anderen Stelle sagt Tolstoi, dass der grundlegende Gedanke eines Kunstwerkes im „Zusammenschluss“ besteht, dessen Sinn nicht direkt mit Worten wiedergegeben werden kann, sondern nur indirekt, indem der Künstler menschliche Gestalten, Handlungen und Lebenssituationen schildert (TGA 62, S. 268 f.). In diesem Punkt
ist eine Übereinstimmung mit Kant festzuhalten, für den nur eine Kritik und keine
Wissenschaft des Schönen möglich ist (KU, AA 5, S. 304). Aber gerade die Kritik
zeigte, dass ein Kriterium der Kunst undenkbar ist und dass eine Unterscheidung
zwischen guten und schlechten Kunstwerken nur der Gegenstand von Einzelurteilen
sein kann, d. h. nur eine Sache des Geschmacks. Der Geschmack selbst entsteht aber
dank der Kunstwerke. So ist die Idee eines Kunstkanons für Kants Kunstphilosophie
nicht nur zulässig, sondern unentbehrlich. Wenn Kant die Kunst als Kunst des Genies
201 Außer Nietzsche weist Tolstoi auch auf die Romantiker hin, die das Urteilen über die Kunst allein
den „ausgewählte[n] schöne[n] Geister[n]“ vorbehalten. Wahrscheinlich wird dabei in erster Linie
Schiller gemeint sein. S. Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 109.
202 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 170. Aus der Perspektive der modernen Kunst gilt dies gerade als
widerlegt. Für Tolstoi wäre sie, in dem Grad, in welchem sie auf die Deutungen angewiesen ist und
ohne Erklärungen und Hintergrundkenntnisse nicht wahrgenommen werden kann, gerade keine
Kunst. Seine Beispiele zeigen, dass er diese Tendenz am Anfang des 20. Jh. im Auge behielt und ihr mit
seiner Kunstphilosophie gerade Widerstand leisten wollte.
3.3 Die gute Kunst
303
definierte, so bedeutete das, dass kein Kriterium der Kunst angegeben werden kann.
Denn die exemplarischen Produkte der Kunst bilden den Geschmack aus, der wiederum über neue exemplarische Werke urteilt.
Tolstoi verwirft den Begriff des Genies scharf und entschieden.203 Er tritt damit
nicht nur gegen die Ästhetik als Wissenschaft der Kunst an, sondern auch gegen den
Geschmack der herrschenden Elite, d. h. gegen die „mächtige Mehrheit“, die das Ziel
ihres Lebens in einem möglichst großen Vergnügen sehe und deshalb eine entsprechende Lehre verbreite – die Lehre dieser Welt, die Lehre der Allgemeinheit. Diejenigen, die sich mit Hilfe dieser Lehre, aber auch mit Hilfe eines Kunstkanons zu „einer
geschlossenen Masse“ des Bösen vereinigen, verlangen für beide schlicht Vertrauen.
Die Situation in der modernen Kunst sei mit der in der Religion identisch. Es wird
nicht gefragt, was sinnvoll und was gut für die Menschen ist, sondern was gewissen
Überlieferungen und dogmatischen Vorstellungen entspricht. Und was einmal kanonisiert wurde, wird für alle Zeiten geheiligt und als Maßstab des Guten bzw. der Kunst
gesetzt.204 Wie für die Religion, so sei auch für die Kunst eine Kanonisierung gewisser
Meinungen jedoch nur schädlich. Man könne die so ausgelegten göttlichen Wahrheiten weder verstehen noch gebrauchen, man müsse sie einfach „mit den Lippen […]
wiederholen“. Man könne die hohe Qualität der Kunstwerke weder nachvollziehen
noch erklären, man müsse sich nur an sie gewöhnen und sich ihnen mit seinem
eigenen Geschmack anpassen. Um sich nicht zu blamieren und keinen schlechten
Geschmack zu zeigen, traue sich keiner, gegen den Kunstkanon zu sprechen. Gerade
das will jedoch Tolstoi, einer der größten Schriftsteller, tun. Er will den Kanon der
Kunstwerke in Frage stellen. Dazu greift er zuallererst einen der bekanntesten Künstler an, der ein anerkanntes Genie ist und dessen Werke zum Musterbild der dramatischen Kunst geworden sind – William Shakespeare. Die Frage nach der Kunst wird,
wie ungefähr zehn Jahre früher für Nietzsche, auch für Tolstoi zur Frage nach dem
Sinn und der Bestimmung der Tragödie.
Tolstoi wählt Shakespeares King Lear aus, um an dessen Beispiel zu zeigen, dass
es sich um ein Stück „schlechter“ Kunst handelt.205 Eine Szene nach der anderen
203 Nicht nur in der Kunst, sondern in allen Bereichen der menschlichen Tätigkeit ist, so Tolstoi, der
Begriff des Genies ohne Sinn. Vgl. seine Umdeutung vom Genie Napoleon in Krieg und Frieden (vgl.
Tolstoi, Krieg und Frieden, Bd. 2, S. 743 ff.).
204 In derselben Lage befindet sich nach Tolstoi die moderne Wissenschaft. Es wird der Glaube an
eine „unfehlbare Wissenschaft verbreitet“, die genauso wie die unfehlbare Kirche als Kriterium für die
Wahrheit gelten muss. In Wirklichkeit stelle die moderne Wissenschaft jedoch nichts anderes als
Befriedigung der zufälligen Neugier und Besserwisserei dar. „L’art pour l’art“ korrespondiere mit der
Theorie „die Wissenschaft für die Wissenschaft“. Beide stehen nicht mehr im Dienste des Lebens
(Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 290).
205 Die stark negative Meinung über Shakespeare, die Tolstoi in Zusammenhang mit der Frage nach
der Bestimmung der dramatischen Kunst äußerte, wurde mehrmals zum Gegenstand der Forschung.
Vgl. die Verfass., Поэтика драмы и эстетика театра в романе, S. 282–289 (s. dort die entsprechenden Literaturhinweise).
304
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
unterwirft er seiner gnadenlosen Kritik und zeigt mit ironischer Prägnanz, dass Shakespeares „Genie“ nicht im Stande war, eine einzige „natürliche Szene“ oder einen
„natürlichen Charakter“ zu schaffen. Das Wort „unnatürlich“ wird mehrmals verwendet. Die handelnden Personen seien ohne Charakter, ihre Handlungen unmotiviert und widersprüchlich. Die Handlung selbst sei durchaus konstruiert und die
Reden unpassend. Die Tragödie stelle insgesamt etwas Inkommensurables, Übertriebenes und Konstruiertes dar. „Man sieht die Absicht, und man wird verstimmt“,
zitiert Tolstoi Goethe.206 Um es mit Kants Worten zu sagen: Die Kunst sollte zur Natur werden. Bei Shakespeare ist dagegen, so Tolstois Kritik, „[i]n allem […] etwas
gewollt Gekünsteltes zu erkennen“, und es ist zu spüren, dass es ihm „gefällt, mit
Worten zu spielen“.207 Dieses Gekünstelte (z. B. Lear vertraut nicht seiner jüngsten
Tochter, die er am meisten liebt, und kann Kent, den er sehr gut kennt, nicht wiedererkennen) lasse keine Möglichkeit, die Gefühle der handelnden Personen ernst zu
nehmen.
[…] die Aufmerksamkeit des Lesers oder Zuschauers wird abgelenkt, der Leser erblickt den Autor,
der Zuschauer den Schauspieler, die Illusion schwindet […].208
Das Schlimmste von allem sei aber, dass das Tragische bei Shakespeare von leichtsinnigen Witzen und unangemessenem Geschwätz begleitet wird: „[H]e is not in
earnest“.209 Die Bestandteile der Komödie, die in jeder Tragödie Shakespeares vorhanden sind, zerstören die tragische Stimmung und machen die Tragödie unglaubwürdig.210 Shakespeare, so Tolstois Fazit, lässt keine Möglichkeit, die Gefühle der
handelnden Personen, das Tragische, ernst zu nehmen. Er spielt mit der Illusion und
verspielt sie, indem er auf die Grenze zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum
immer wieder, ob wegen seiner Ungeschicklichkeit oder gezielt, aufmerksam macht.
Wie schon im Zusammenhang mit Nietzsches Kunstphilosophie gezeigt wurde,
wird die Frage nach der von der Kunst erschaffenen Illusion nicht zufällig zum
Problem des Theaters und des Schauspielers, „von da aus“ könne man am besten
„dem gefährlichen Begriff ‚Künstler‘ beikommen“ (FW 361, KSA 3, S. 608).211 Denn
das Theater, in dem die Grenze zwischen zwei Welten – der des Kunstwerkes und
206 Lew Tolstoi,Über Shakespeare und das Drama, S. 258.
207 Lew Tolstoi,Über Shakespeare und das Drama, S. 281.
208 Lew Tolstoi,Über Shakespeare und das Drama, S. 272.
209 Lew Tolstoi,Über Shakespeare und das Drama, S. 281.
210 Zur literaturtheoretischen Frage nach dem Verhältnis des Komischen und des Tragischen im
Drama, u. a. in der literaturhistorischen Perspektive, s. die Verfass., Поэтика драмы и эстетика
театра в романе, S. 167 ff., 248.
211 Es ist bemerkenswert, dass Tolstoi in der Frage nach Shakespeares Weltanschauung sich auf das
Buch von Georg Brandes (William Shakespeare) beruft, der lange Zeit Korrespondent Nietzsches
gewesen ist und dem der Letztere seine ersten Eindrücke von den russischen Romanen mitteilte.
3.3 Die gute Kunst
305
der der Lebenswelt – sichtbar ist, stellt eine besondere Herausforderung an den
Künstler und an den Zuschauer. Der Künstler soll Vertrauen erwecken, und der
Zuschauer muss ihm dort sein Vertrauen schenken, wo der Betrug besonders auffällig
ist, wo es also am schwierigsten ist, zu glauben, wo jede „Natürlichkeit“ notwendig
fehlt.
Das Theater als komplexes und ambivalentes Phänomen hat auch Tolstoi sein
ganzes Leben beunruhigt, noch lange vor der Zeit seines theoretischen Traktats über
die Kunst. Sein Interesse für das Theater lässt sich bereits in den frühen Jugendjahren
spüren, von dramatischen Improvisationen zuhause bis hin zu den eigenen Versuchen, für das Theater zu schreiben.212 Tolstoi kannte die französische, russische,
englische und deutsche Dramaturgie sehr gut. Er war Stammgast des Theaters und
persönlich mit den berühmtesten Schauspielern (Schepkin, Gorbunow, Martynow)
und den bedeutendsten Regisseuren seiner Zeit (Stanislawski, Nemirowitsch-Dantschenko) bekannt.213 Zwischen 1856 und 1864 schrieb er zwei Komödien Зараженное
семейство (Die kranke Familie) und Нигилист (Der Nihilist) (beide sind verloren
gegangen). Letzteres wurde für das Haustheater bestimmt, ersteres wollte Tolstoi
dagegen auf die Bühne des Maly Theaters bringen. Er wurde jedoch durch die gnadenlose Kritik des berühmtesten russischen Dramaturgen, Alexej Ostrowski, von diesem
Wunsch abgebracht. Später war Tolstoi ihm für seine Offenheit dankbar. Dieser erste
Misserfolg, so könnte man vermuten, war kein Zufall. Denn seine Forderung nach
Natürlichkeit und Unmittelbarkeit der Gefühle, die den Zuschauer und Schauspieler
einigen sollten, war für das professionelle Theater, im Unterschied zum improvisatorischen Haustheater oder den rauhnächtlichen Volksspielen, nicht erfüllbar. Die Überzeugung wuchs, dass die theatralische Kunst der Forderung der Natürlichkeit nicht
entsprechen kann.
Die letztere Tendenz war bei Tolstoi tatsächlich immer schon vorhanden. Die
ersten Eindrücke vom professionellen Theater waren eher negativ. Sein Erlebnis, das
er als Kind mit der theatralischen Aufführung machte, hat er in einem Märchen beschrieben:
Schaut, Kinder, da ist die Bühne, hat die Mutter gesagt […]. Die Kinder schauten hin und sie
mochten es nicht. (TGA 5, S. 225)
Das Theater als etwas Unnatürliches und Gefälschtes, als pervertierte Wirklichkeit ist
später in Tolstois Romanen zu einem besonderen Thema geworden. Das Theatralische
sei nicht nur widernatürlich und falsch, es sei auch schädlich für das Leben. Für die
handelnden Personen in seinen Romanen stellt das Theater in einer kritischen Situa212 S. Елена Полякова (Elena Poljakova), Театр Льва Толстого: Драматургия и опыты ее
прочтения (Theater von Lew Tolstoi: Die Dramaturgie und ihre Deutungen), S. 12 ff. S. dort weitere
Literaturhinweise.
213 S. Елена Полякова (Elena Poljakova), Театр Льва Толстого, S. 19 ff.
306
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
tion eine besondere Gefahr dar. Die Neigung zur „Vorstellung“, zu einer „Rolle“
erweist sich als negativ und zerstörend. Das berühmteste Beispiel dafür ist der Besuch
des Theaters von Natascha Rostowa in Krieg und Frieden. Sie geht mit kindischer
Naivität und rührender Unschuld ins Theater und kann gerade deswegen dem Theaterstück nicht folgen:
Natascha war lange Zeit auf dem Lande gewesen und befand sich in einer recht ernsten
Stimmung, und so kam ihr dies alles merkwürdig und erstaunlich vor. […] Natascha wußte
freilich, was das alles bedeuten sollte, aber es war alles so gekünstelt, so unnatürlich und falsch,
daß sie sich bald für die Schauspieler schämte, bald über sie amüsierte.214
Aber es sind nicht nur die Darstellungen auf der Bühne, sondern auch die Lügen und
die Heuchelei der Zuschauer der höheren Gesellschaft, auf die sie im Theater trifft (der
Besuch von Hélène in ihrer Loge). Sie verändert gleich danach ihren Standpunkt
hinsichtlich der Aufführung:
Natascha kehrte zu ihrem Vater zurück, bereits ganz im Banne der Welt, in der sie sich jetzt hier
befand. Alles, was um sie her vorging, auf der Bühne und im Zuschauerraum, kam ihr schon
völlig natürlich vor und alles, was sie früher beschäftigt hatte, alle Gedanken an ihren Bräutigam,
an Prinzessin Marja, an das Leben auf dem Lande, das alles kam ihr überhaupt nicht mehr in den
Sinn, als läge es weit, weit hinter ihr. […]
Dort, in diesem riesigen, hellerleuchteten Saale, wo Duport mit nackten Beinen in einem
kurzen, bunten Flitterjäckchen unter den Klängen der Musik auf den feuchten Brettern umhergehüpft war, wo junge Mädchen und alte Herren und die halbnackte Hélène mit ihrem ruhigen
und stolzen Lächeln ihr begeistertes ‚Bravo!‘ geschrienen hatten, dort, im Schatten dieser Hélène,
war das alles einfach und klar gewesen […].215
Die Pervertiertheit der Welt des Theaters betrifft nicht nur die Schauspieler, sondern
auch die Zuschauer. Für Natascha sind die Folgen der Schauspielerei erschreckend
schädlich. Denn unmittelbar danach ruinierte sie die Liebe ihres Lebens, sie verließ
den Fürsten Andrej, den sie liebte, für Anatol, einen bekannten Wüstling, der sie nur
betrügen wollte. Die Welt der Bühne, so Tolstois Gedanke, ist nicht, wie die elitäre
Kunst will, von der realen Welt zu trennen. Wenn die Kunst für nutzlos erklärt wird,
wird sie schädlich. Denn die Macht der Kunst ist von solcher Art, dass sie, wenn sie
dem Leben nicht dient, das Leben zerstört. Das Theater vereinigt die Schauspieler und
die Zuschauer im Bösen bzw. im Betrug und Selbstbetrug. Es veranlasst auch „natürliche“ Menschen wie Natascha, ihre wahren Gefühle zu verleugnen, indem sie sich
dem allgemeinen Betrug, „einer geschlossenen Masse“ des Bösen und der Religion
einer „mächtigen Mehrheit“ unterwerfen. Sie verlieren dadurch sich selbst. Die theatralische Bühne, die dem Betrug dient, ist eine Bedrohung für das Leben, eine Gefahr
für das Leben des einzelnen Menschen.
214 Tolstoi,Krieg und Frieden, Bd. 1, S. 730.
215 Tolstoi,Krieg und Frieden, Bd. 1, S. 737 f.
3.3 Die gute Kunst
307
In Anna Karenina wird die verderbende Kraft des Theaters zu einer noch wichtigeren Komponente des Sujets, zu einem Schlüsselpunkt.216 Schon zu Tolstois Zeit
wurde mehrmals die Meinung geäußert, dass die zwei Linien des Sujets, die von
Anna Karenina und die von Konstantin Lewin, von einander unabhängig und gar
schlecht miteinander verknüpft seien. Tolstoi war dieser Einwand wohl bekannt, und
er hat ihn definitiv zurückgewiesen. Die innere Verbindung zweier Linien gehöre
gerade zu dem, was durch den Roman mitgeteilt werden soll.217 Sie gründet sich
nicht, um es wiederum mit Kant zu sagen, auf den in Begriffen aufgefassten Gedanken, sondern auf eine ästhetische Idee, die zum Nachdenken anregt bzw. eine Reihe
von mehreren Interpretationen eröffnet. Diese innere Verbindung zeigt sich formal
im harmonischen Aufbau des Sujets: Eine Verschärfung der Kollision in einer Linie
wird von einer Entspannung in der zweiten begleitet. Aber genauso verhält es sich
z. B. mit dem Motiv der Lüge und des Schauspiels. Alle handelnden Personen –
Anna, Wronski, Lewin, Kitti, sogar Karenin – sind gegen alle Erwartungen zur
Redlichkeit und „Natürlichkeit“ der Gefühle, aber ebenso zur Lüge und zum Selbstbetrug fähig. Bei jedem von ihnen kommt es, früher oder später, zu einer, wenn auch
auf den ersten Blick ganz unschuldigen, Rolle im Leben, der ein „natürlicher“ Standpunkt entgegengesetzt wird. So ist z. B. die Position von Dolly, die Anna in ihrer
schwierigen Lage besucht (Anna wohnt mit Wronski zusammen, ohne eine Scheidung von ihrem Mann bekommen zu haben) und bei der sie eine fröhliche Gesellschaft findet:
Um indessen nicht die allgemeine Stimmung zu verderben und irgendwie die Zeit zu verbringen,
beteiligte sie sich […] wieder am Spiel und gab sich den Anschein, Freude daran zu haben. Während dieses ganzen Tages hatte sie das Gefühl, mit ihr überlegenen Schauspielern in
einem Theaterstück mitzuwirken und durch ihr schlechtes Spiel der ganzen Vorstellung zu
schaden.218
Anna selbst ist immer „einfach und natürlich“, doch kann sie dem Geist der Schauspielerei, der Lüge nicht widerstehen:
Anna sagte, was ihr gerade einfiel, und war, während sie sich sprechen hörte, selbst erstaunt, wie
geschickt sie sich verstellen konnte. Wie ungezwungen und natürlich klangen ihre Worte […] Sie
hatte das Gefühl, mit einem undurchdringlichen Panzer der Lüge angetan zu sein. Es schien ihr,
daß irgendeine unsichtbare Macht ihr beistehe und ihr Kraft verleihe.219
216 Da ich diesem Thema eine gesonderte Untersuchung gewidmet habe, werde ich hier nur die
Ergebnisse anführen, die für diese Arbeit wichtig sind (die Verfass., Поэтика драмы и эстетика
театра в романе, S. 187–253).
217 Vgl. Tolstois Äußerung: „Ich bin dagegen gerade darauf stolz, wie sie miteinander verknüpft sind,
so dass man keinen Knoten sehen kann. Ich habe mir dafür viel Mühe gegeben. Die Verknüpfung ist
nicht auf der Fabel, sondern auf der inneren Verbindung aufgebaut.“ (TGA 62, S. 377)
218 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 319.
219 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 1, S. 233 f.
308
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Doch jedesmal wenn er [ihr Mann, Karenin – E.P.] ein paar Worte mit ihr gesprochen hatte, fühlte
er, daß der Lug und Trug erfüllte Geist, der sich ihrer bemächtigt hatte, auch auf ihn selbst
übergriff, und er sagte ihr etwas ganz anderes und in einem ganz anderen Ton, als er es
beabsichtigt hatte. Ohne es selbst zu merken, verfiel er im Gespräch mit ihr in seinen üblichen,
scherzhaft-spöttischen Ton, der immer so klang, als mache er sich über jemand lustig, der im Ernst
so sprechen würde. Dieser Ton aber eignete sich nicht dazu, das zu sagen, was er zu sagen
hatte.220 (meine Hervorhebungen – E.P.)
Der „scherzhaft-spöttische[ ] Ton, der immer so klang, als mache er sich über jemand
lustig, der im Ernst so sprechen würde“ ist das Schauspiel im Leben, das ansteckend
ist. „Der Geist des Bösen und des Betrugs“221 wird dadurch immer mächtiger. Er
bestimmt das Leben von Anna und das von den mit ihr verbundenen Menschen. Die
zwei Besuche des Theaters, die im Roman geschildert werden, vollenden Annas Übergang in die Welt der Lüge und Schauspielerei und den Sieg des „Geistes des Bösen
und des Betrugs“, der zur Katastrophe führt. In den letzten Minuten vor dem Selbstmord wird klar gezeigt, dass Anna sich diesem Geist völlig unterworfen hat. Sie
verliert die Möglichkeit, die Welt anders zu sehen als „bei dem durchdringenden
Licht, in dem sich ihr der Sinn des Lebens und der Beziehungen der Menschen
zueinander offenbarte“:
Alles ist Getue, alles ist Lug und Trug, ist Bosheit!222
In diesem Licht wird das Leben unmöglich und unerträglich. Annas Untergang ist
unabwendbar. Das Gleichgewicht wird im Roman erst nach ihrem Tod wiederhergestellt,223 indem Lewin eine andere Möglichkeit zu leben sucht und findet: das Leben
nach der Wahrheit, den guten Sinn des Lebens.
Der „Geist des Bösen und des Betrugs“ ist der theatralische Geist, ist der Geist des
Schauspiels. Für den Menschen, so Tolstoi in seinen Romanen, lässt er zwei Möglichkeiten: die Unterwerfung, die den Untergang bedeutet, oder die Rettung, die im
Übergang zur Wahrheit, in der ständigen Suche nach dem Guten besteht und selbst
die Wahrheit des Lebens ist. Der Betrug ist eben deswegen das Böse, weil er für das
Leben schädlich ist. Das Leben rächt sich selbst gegen den, der seine Wahrheit
verlässt, der sich jeder Art von Betrug durch Rausch und Betäubung unterwirft, es sei
der Rausch der Freude oder des Schmerzes, der Angst oder der Hoffnung auf zukünf-
220 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 1, S. 239.
221 So lautet die genaue Übersetzung des Ausdrucks „дух зла и обмана“ (vgl. TGA 18, S. 157).
222 Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 2, S. 525.
223 Ich meine hier das Gleichgewicht des Weltbildes, das in der Literaturwissenschaft traditionell
dem Epos und nur teilweise dem Roman zugeschrieben wird. Die Romane von Tolstoi werden
allerdings in der Forschungsliteratur epische Romane genannt. S. die Verfass.,Поэтика драмы и
эстетика театра в романе, S. 15 ff. (zur Literaturtheorie über Epos und Drama), S. 190 ff. (zur
epischen Situation in Anna Karenina).
3.3 Die gute Kunst
309
tiges Glück.224 Die Wahrheit des Lebens widersteht dem Betrug, dem Bösen und dem
Geist des Theaters. Letzteres gehört nicht etwa in eine besondere Welt der Kunst,
sondern ist eine Kraft, die im Leben tätig ist und eine Bedrohung für das einzelne
Leben werden kann. Denn ein Betrug auf der Bühne ruft einen Betrug im Leben
hervor. Eine besondere Welt, die aus den Bedingungen des Lebens ausgenommen
wäre und einen Wert für sich hätte, die Welt der Kunst, gibt es nicht.
Es war also kein Zufall, dass Tolstoi die theatralische Kunstart ins Zentrum des
Problems der Kunst stellte. Mit seiner Kritik am Theater konfrontierte er sich mit einer
der Kunst innewohnenden Paradoxie, die uns schon aus Nietzsches Kunstphilosophie, aber auch aus der Platons bekannt ist: Das Theater, wie die Kunst selbst, baut
auf eine Illusion und kann nur durch diese Illusion leben. Die Kunst und besonders
die theatralische Kunst fordert eine bewusste Einschränkung des Horizontes oder, wie
im Kapitel zu Nietzsche festgestellt wurde, eine bewusste Annahme der Illusion. Tolstois Schluss ist deshalb nicht nur gegen das Theater gerichtet, sondern auch gegen die
Kunst überhaupt. Da ein bewusster Betrug nur noch zum Betrug im Leben verführen
kann, sei das Theater selbst und damit auch die von ihm geprägte Kunst für das Leben
schädlich.225 Tolstois Fazit ist folgendes:
Ich habe dieses Getue beobachtet und dachte mir: Man sollte doch dagegen kämpfen. Zu viel
Routine, die die Wahrheit verdeckt!226
Der Geist des Theaters ist überall eingedrungen und hat die Kunst verdorben. Die
Kunst der Moderne diene nicht dem Leben, sondern der Unterhaltung von „reichen
müßigen Menschen“227 und „ausschweifenden Handwerkern“228.
Erstaunlich ist, wie Tolstois Invektiven gegen die „Verderbnis“ der Kunst durch
den „Geist des Theaters“ mit denen von Nietzsche übereinstimmen.229 Tatsächlich war
keiner weiter als Nietzsche davon entfernt, in der Kunst ein Mittel der Unterhaltung
224 Nur so kann das Motto des Romans („Die Rache ist mein“ (Tolstoi, Anna Karenina, Bd. 1, S. 7))
verstanden werden, ohne die übliche Frage zu stellen, warum Anna so hart bestraft wird – die Frage,
die die russischen Leser immer wieder beunruhigte. Es ist keine Strafe, sondern die unabwendbare
Folge für den, der den Sinn des Lebens verneint.
225 Das Traktat Was ist Kunst? eröffnete Tolstoi mit der Beschreibung einer Theaterprobe, wobei die
Aufführung auf der Bühne durch die äußerlichen Umstände, z. B. durch die Lebensumstände der
Schauspieler und durch die persönlichen Verhältnisse zwischen dem Direktor und der Truppe, beschrieben wird. So richtete Tolstoi seine Aufmerksamkeit gerade auf die Grenze, die die Zuschauer von
der Bühne trennt. Sie wird zum Argument gegen das „abscheuliche Schauspiel“ (Tolstoi, Was ist
Kunst?, S. 19).
226 Петр А. Сергеенко (Pjotr Sergeenko), Как живет и работает гр. Л.Н. Tолстой (Wie lebt und
arbeitet Graf L.N. Tolstoi) S. 32.
227 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 247.
228 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 21.
229 Vgl. z. B. „die d r e i F o r d e r u n g e n“ an die Kunst in: WA 12, KSA 6, S. 39.
310
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
bzw. ein interesseloses Wohlgefallen zu sehen. Gerade als Bedingung des Lebens, als
metaphysische Rechtfertigung des Lebens bei den Griechen kam die Kunst in seinem,
Tolstoi offensichtlich unbekannten, Erstlingswerk vor. Selbst in der Einschätzung
zeitgenössischer Kunstphänomene stimmt Tolstoi Nietzsche zu, z. B. in der Einschätzung der Musik Richard Wagners.230 Doch das Feststellen der Übereinstimmungen
wäre für die Untersuchung der Plausibilitäten noch unzureichend. Denn es ist nicht
auszuschließen, dass sie ganz verschiedenen Ausgangspunkten entsprangen, deren
Differenz bedeutsam ist. Versuchen wir diese Differenz näher zu bestimmen.
Die Beschreibung der befremdenden Wirkung von Shakespeares Drama bei Tolstoi ruft eine weitere Parallele zur Geburt der Tragödie in Erinnerung. So stellt der
russische Schriftsteller sein Unverständnis gegenüber dem angeblichen Genie Shakespeares dar, dessen Dramen ihm unnatürlich und moralisch verwerflich, v. a. dem
gesunden Menschenverstand widersprechend vorkamen:
Man erhob keine Einwände, wenn ich auf Shakespeares Mängel hinwies, brachte nur sein
Bedauern über mein Unverständnis zum Ausdruck und wollte mir einreden, ich müsse doch die
außerordentliche, übernatürliche Größe Shakespeares anerkennen, erläuterte mir aber nicht,
worin die Schönheit Shakespeares bestehe, begeisterte sich vielmehr nur unbestimmt und in
übertriebener Weise am ganzen Shakespeare und pries dabei einige besonders beliebte Stellen
[…].231
Die Situation, in der ein kritischer Zuschauer die Tragödie nicht versteht, deren tiefen
Sinn ihm die anderen, obwohl sie die alten Meister bewundern, nicht erklären können, wurde auch von Nietzsche beschrieben. Schritt für Schritt unterwarf dieser
Nicht-Verstehende die alte Tragödie der kritischen Analyse und sah, von dem „misstrauischen Lächeln“ der anderen begleitet, nur das, was seiner Vernunft widerspricht.
Ich gebe die Stelle vollständig wieder, denn sie kann praktisch unverändert als
Portrait des Kunst-Theoretikers Tolstoi gelesen werden – statt „Euripides“ sollte bloß
„Tolstoi“ und statt „Aeschylos“ „Shakespeare“ stehen:
Mit dieser Begabung, mit aller Helligkeit und Behendigkeit seines kritischen Denkens hatte
Euripides im Theater gesessen und sich angestrengt, an den Meisterwerken seiner grossen Vorgänger wie an dunkelgewordenen Gemälden Zug um Zug, Linie um Linie wiederzuerkennen. Und
hier nun war ihm begegnet, was dem in die tieferen Geheimnisse der aeschyleischen Tragödie
Eingeweihten nicht unerwartet sein darf: er gewahrte etwas Incommensurables in jedem Zug und
in jeder Linie, eine gewisse täuschende Bestimmtheit und zugleich eine räthselhafte Tiefe, ja
Unendlichkeit des Hintergrundes. Die klarste Figur hatte immer noch einen Kometenschweif an
sich, der in’s Ungewisse, Unaufhellbare zu deuten schien. Dasselbe Zwielicht lag über dem Bau
des Drama’s, zumal über der Bedeutung des Chors. Und wie zweifelhaft blieb ihm die Lösung der
ethischen Probleme! Wie fragwürdig die Behandlung der Mythen! Wie ungleichmässig die Vertheilung von Glück und Unglück! Selbst in der Sprache der älteren Tragödie war ihm vieles
230 Vgl. Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 188 f.
231 Tolstoi, Über Shakespeare und das Drama, S. 281 f.
3.3 Die gute Kunst
311
anstössig, mindestens räthselhaft; besonders fand er zu viel Pomp für einfache Verhältnisse, zu
viel Tropen und Ungeheuerlichkeiten für die Schlichtheit der Charaktere. So sass er, unruhig
grübelnd, im Theater, und er, der Zuschauer, gestand sich, dass er seine grossen Vorgänger nicht
verstehe. Galt ihm aber der Verstand als die eigentliche Wurzel alles Geniessens und Schaffens,
so musste er fragen und um sich schauen, ob denn Niemand so denke wie er und sich gleichfalls
jene Incommensurabilität eingestehe. Aber die Vielen und mit ihnen die besten Einzelnen hatten
nur ein misstrauisches Lächeln für ihn; erklären aber konnte ihm Keiner, warum seinen Bedenken und Einwendungen gegenüber die grossen Meister doch im Rechte seien. (GT 11, KSA 1,
S. 80 f.)
Es war Euripides „a l s D e n k e r , nicht als Dichter“, der die alte Tragödie nicht verstand. „[I]n diesem qualvollen Zustande fand er d e n a n d e r e n Z u s c h a u e r , der die
Tragödie nicht begriff und deshalb nicht achtete“ (GT 11, KSA 1, S. 80 f.) – Sokrates, der
sich der Kunst furchtlos annäherte, um sie mit einem neuen moralisch-vernünftigen
Maßstab zu messen. Tolstoi, der als Denker seine eigenen genialen Kunstwerke verwirft, zeigt so eine überraschende Ähnlichkeit mit diesen zwei Figuren (Sokrates und
Euripides), die von Nietzsche „errathen“ wurden – als ob beide Figuren jetzt in Tolstoi,
der über die Kunst und seine eigene Kunstwerke kritisch nachdenkt, vereint wären.
Dies ist keinesfalls ein Zufall. Als Denker strebte Tolstoi tatsächlich eine Annäherung an Sokrates an, den er sehr hoch (fast wie Christus selbst) schätzte.232 Dennoch,
und dies ist äußerst wichtig für seine Kunstphilosophie, war er nicht wirklich ein
Nicht-Verstehender, er spielte nur einen. Auch indem er die Kunst als Betrug brandmarkte, konnte er Shakespeare eine gewisse „Unterhaltsamkeit“ und seine meisterhafte Szenenführung nicht völlig absprechen.233 Er, der die härtesten, einen wahren
Ekel erregenden Worte gegen die Musik zu finden wusste, wie seine Kreutzersonate
zeigt, hatte bekanntlich selbst eine musikalische Begabung und einen tiefen musikalischen Sinn. Er konnte die Musik, wie wenige, genießen. Wenn er also auch Sokrates
ist, so ist er einer, der der Anziehungskraft der Musik widerstehen will und vielleicht
dies nicht kann. Mehr noch: Es handelt sich nicht bloß um die Musik, sondern um
die „Musik des Lebens“ im Sinne Nietzsches. Gerade Tolstoi als Schriftsteller wurde
traditionell die Kunst zugeschrieben, die sinnliche Üppigkeit des Lebens in ihrem
Reichtum meisterhaft dargestellt zu haben. Wie schon am Anfang erwähnt, wurde er
von Dmitri Merezhkowski „Hellseher des Fleisches“ genannt.234 Er ist damit Sokrates,
der die „Musik des Lebens“ hört, der Sokrates, den sie zu stark anlockt.
Wenn Tolstoi also einen Krieg gegen die Kunst führt, so ist es der Krieg gegen
einen mächtigen Gegner, der einen zu großen Einfluss auf die Seele haben kann. Er
nähert sich damit einem anderen Künstler-Philosophen an – Platon (und dies ganz
bewusst, denn er kennt seinen großen Vorgänger ausgezeichnet), der Homer gerade
232 Vgl. Tolstois Lebensbeschreibung von Sokrates (TGA 25, S. 429–461).
233 Es gelinge ihm sogar, „die Bewegung der Gefühle“ zu zeigen (Tolstoi, Über Shakespeare und das
Drama, S. 280).
234 Мережковский, Л.Толстой и Достоевский, Bd. 1, (Das Leben und das Werk), S. 309.
312
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
wegen seiner poetischen Kraft aus seinem Staat verbannen wollte.235 Doch als Künstler wurde Tolstoi paradoxerweise immer wieder gerade mit Homer verglichen.236
Indem Tolstoi als Denker gegen die Kunst kämpft, kämpft er also auch gegen sich
selbst – als Künstler.
Tolstois Kampf ist also der gleiche Kampf gegen das Dionysische, den Platon
führte und zu dem sich auch der junge Nietzsche (für die Kunst und gegen den
„ästhetischen Sokratismus“) so leidensvoll bekannte. Doch wird dieser Kampf jetzt
von dem Schaffenden her, vom Künstler her, neu bedacht. Auch als Denker stimmt
Tolstoi seinem großen Vorgänger nicht einfach zu, sondern weist auf einen grundlegenden Fehler jeder moralisch geprägten Kunstfeindschaft hin. Platon (wie auch die
ersten Christen) habe zwar Recht, indem er in der Kunst eine Bedrohung für die
Sittlichkeit bzw. für das Leben sah, und seine Feindschaft gegenüber der Kunst sei
angesichts der großen Gefahr sogar gerechtfertigt, jedoch habe er falsche Schlussfolgerungen daraus gezogen.237 Die Kunst ist eine notwendige Bedingung des Lebens
der Menschen. Sie kann nicht beseitigt werden. Der Widerstreit der sokratisch-christlichen Moral und der Kunst ist für Tolstoi ein Missverständnis, das nur deswegen
entstand, weil beide sich in ihrer wahren Bestimmung lange Zeit im Irrtum befanden
und ihre gemeinsame Abstammung vergaßen – die mächtige Forderung des Lebens,
das Streben der Menschheit zum Besseren, zum Wohl.
Trotz seines antitheatralischen Pathos ging es Tolstoi also nicht bloß darum, das
Theater, wie die Kunst selbst, zu tadeln. Den negativen Einfluss der theatralischen
Kunst auf die europäische Kultur hat er vielmehr als Herausforderung angenommen,
das Theater zu verbessern, um gegen das „Getue“ mit den Mitteln der Kunst zu
kämpfen und selbst für die Bühne zu schreiben. In den 80er Jahren schrieb er dann
seine berühmten Dramen, Die Macht der Finsternis, Früchte der Bildung, Der lebende
Leichnam, und diesmal mit Erfolg, wenn er auch wieder auf große Schwierigkeiten
stieß, die vielsagend sind: Feine Seelenbewegungen und psychologische Tiefe, die
Tolstois Stärke als Romancier ausmachten, erwiesen sich hier als Schwäche.238 So
beschreibt Tolstoi sie in seinem Tagebuch:
235 Es ist der Gemeinplatz der Forschungsliteratur, dass Tolstois sittlich-religiöse Forderungen an die
Kunst eine Annäherung seiner Position an die platonische Politeia zeigt. S. z. B. Gerhard Dudek, Lew
Tolstoi – künstlerische Entdeckung und ästhetische Herausforderung, S. 15. Ich bemühe mich um eine
differenziertere Darstellung.
236 Schon Gontscharow machte diesen Vergleich, indem er Krieg und Frieden als „die russische Ilias“
bezeichnete. (Л.Н. Толстой (L.N. Tolstoi), Собрание сочинений, (Gesammelte Werke), Bd. 7, S. 460)
Zum Vergleich der epischen Darstellung bei Tolstoi und Homer s. George Steiner, Tolstoy or Dostoevsky.
An Essay in Contrast, S. 73 ff.
237 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 78.
238 Die Begabung, die feinsten Bewegungen der Gefühle auf der Bühne wiederzugeben, schreibt man
traditionell einem anderen bekannten russischen Schriftsteller zu, Anton P. Tschechow. Seine Dramen hat Tolstoi allerdings als „Langeweile“ bezeichnet (Ю. Беляев, (J. Beljajew), В Ясной Поляне (In
Jasnaja Poljana)).
3.3 Die gute Kunst
313
Man stimmt immer darüber überein, dass Handlung im Drama wichtiger sein soll als Gespräche.
Aber wenn das Drama kein Ballett sein soll, müssen handelnde Personen sich durch ihre Reden
ausdrücken. Doch wer gut redet, handelt schlecht, deshalb kann der Protagonist sich gar nicht
mit Worten ausdrücken. Je mehr er redet, desto weniger Vertrauen schenkt man ihm. Wenn aber
andere reden werden, wird die Aufmerksamkeit auf sie gerichtet und nicht auf ihn. Die Komödie – ein komischer Held – ist möglich, aber die Tragödie ist bei dem heutigen Psychologismus
ungeheuer kompliziert geworden. (TGA 48, S. 344)
Die größte psychologische Schwierigkeit bestand so gerade darin, dass der Zuschauer
dem Protagonisten vertrauen sollte. Sie ist nicht bloß als Forderung der psychologischen Überzeugungskraft zu verstehen, sondern als Kritik an der theatralischen Konvention als solcher.
Doch Tolstoi, sei es noch einmal betont, predigt nicht gegen das Theater überhaupt, sondern gegen das Theater „unserer Zeit“. Wenn das moderne Theater zur
Quelle des Bösen in der Kunst geworden ist, wenn es dem Betrug dient, wenn es zum
Mittel der Trennung bzw. Absonderung der Elite geworden ist, so sei es deshalb so
schädlich für das Leben, weil gerade die dramatische Kunst den Höhepunkt der
künstlerischen Tätigkeit der Menschen darstelle. Wie in der Religion gerade die
reinste Form des Verständnisses verschmutzt und verwirrt werden sollte, um dem
Betrug Kraft zu verleihen, so geschah es auch in der Kunst. Die dramatische Kunst, die
zu allen Zeiten der Ausdruck des religiösen Lebens gewesen ist, ist zur leeren und
schädlichen Unterhaltung entartet. Zu Beginn der Neuzeit, so Tolstoi, wurde die
Quelle der Kunst durch den Verlust des Lebenssinns getrübt, was auch dadurch
gekennzeichnet wurde, dass eine merkwürdige Wissenschaft der Kunst, die früher
nicht vorhanden und nicht nötig war, entstanden ist – die Ästhetik.239 Der Glaube an
den Kunstkanon und die Unverständlichkeit der Kunstwerke haben in der Kunst der
Décadence den Höhepunkt erreicht und zeigen genauso wie „alle verworrenen, unbegreiflichen Theorien der Kunst“, dass die Kunst sich auf dem „falschen Weg“ befindet.240 Das Drama, wie die Kunst überhaupt, hat jedoch zu allen Zeiten und bei allen
Völkern dem Leben gedient, d. h. es hat den Sinn des Lebens von Generation zu
Generation vermittelt. Wenn sie ihre hohe Bestimmung in dieser Mitteilung wiederfinden könnte, so würde sie wieder zu dem, was die wahre Kunst sein soll: zur
Bedingung des Lebens der Menschen. Dann, so Tolstois Hoffnung, würde sie sich
wieder auf die Religion gründen, die der bis heute erreichten Vorstellung vom Leben
entspricht – auf dem wahren Christentum, auf der Idee der Einheit aller Menschen.
239 Vgl. Tolstois These, dass es keine Lücke von fünfzehn Jahrhunderten zwischen den alten Griechen
und der modernen Ästhetik gibt, wie man so oft meint, sondern dass es vor der Neuzeit gar keine
Ästhetik gab, d. h. keine Theorie der Kunst, die von der Lehre über das Leben getrennt wäre. Die
Ästhetik als verwirrende Quasi-Wissenschaft entstehe gerade, weil Menschen vergessen, wozu die
Kunst da ist (Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 94 f.).
240 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 104.
314
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Die Kunst im Dienste des Lebens: die Einigung der Menschheit
Die wahre Kunst soll Tolstoi zufolge, im Unterschied zu der zeitgenössischen elitären
Kunst, die Menschen einigen, sie soll Gefühle vermitteln und mit ihnen „anstecken“.
Und sie soll von dem Betrug befreit werden, sie muss wahrhaftig erlebt und geglaubt
werden. Wie ist das jedoch möglich? Gerade das Drama baut auf der Illusion auf, der
bewusste Selbstbetrug ist die unerlässliche Bedingung der Kunst. Wäre die Forderung, die Wahrheit des Lebens zu vermitteln, nicht das Ende der Kunst?
Betrachten wir Tolstois Definition der Kunst genauer:
Die Kunst fängt dann an, wenn ein Mensch in der Absicht, den anderen Menschen das von ihm
empfundene Gefühl mitzuteilen, dasselbe von neuem in sich hervorruft und es durch gewisse
äußere Zeichen ausdrückt.241
Hier wird es deutlich: Eine Definition, die bei den Gefühlen ansetzt, kann der Doppelsinnigkeit des Kunstphänomens, die im Theatralischen zu gravierenden Paradoxien
führte, nicht entgehen. Der Begriff des Gefühls darf nicht psychologisch missverstanden werden. Tolstoi meint damit offensichtlich keine unmittelbare Emotion, keinen
Nervenreiz.242 Es ist nicht das Erlebnis selbst, sondern das wiederholte Erlebnis, das
Mit-Absicht-wieder-Erlebte, das die Kunst ausmacht. Es soll dennoch „wahrhaftig“
wieder erlebt werden. Es muss also ein beabsichtigtes Erlebnis im Erlebnis sein, ein
Gefühl, das perspektiviert und so „verstanden“ wird und deswegen auch einem
anderen Menschen, dem Leser oder Zuschauer, das Erlebte vermittelt. Man begegnet
hier wieder dem Phänomen des Theatralischen, das der junge Nietzsche als „Verderbnis“ der Kunst, aber auch als Ursprung des Kunstphänomens beschrieb: Das
Vorgespielte liege im Hintergrund jeder Kunst. Allerdings wird für die Alltagslektüre
nicht Nietzsche, sondern Schopenhauer exzerpiert. In der Kunst werden nicht bloß
die Dinge gezeigt, sondern auch ihre Sichtbarkeit: „Die Kunst ist Schauspiel im
Schauspiel, die Bühne auf der Bühne, wie in ‚Hamlet‘“ (TGA 41, S. 464).243 Die Ver-
241 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 73.
242 Der „krankhafte Nervenreiz“ bzw. „ein gemischtes Gefühl aus dem Mitleid mit einem anderen und
meiner Freude, daß ich nicht leide“, das das Publikum für das ästhetische Gefühl hält, sei keine
Wirkung der Kunst. „[I]n dieser Erregung liegt nichts Ästhetisches […] es ist dem Gefühl ähnlich, das
wir beim Anblick einer Hinrichtung empfinden, oder das die Römer bei ihren Zirkusveranstaltungen
empfanden.“ (Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 160)
243 Bei Schopenhauer heißt es: „Ist die ganze Welt der Vorstellung nur die Sichtbarkeit des Willens,
so ist die Kunst die Verdeutlichung dieser Sichtbarkeit, die Camera obscura, welche die Gegenstände
reiner zeigt und besser übersehn und zusammenfassen lässt, das Schauspiel im Schauspiel, die Bühne
auf der Bühne im ‚Hamlet‘“ (Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1, S. 372). Im
Unterschied zu dieser Bemerkung Schopenhauers wird seiner metaphysischen Definition der Kunst als
„Erkenntnisart“, welche unmittelbarer und adäquater Objektivität fähig ist bzw. die platonischen
Ideen betrachtet (vgl. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1, S. 265), in Was ist Kunst?
keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die These, die Kunst sei als „Werk des Genius“ zu verstehen, „der
3.3 Die gute Kunst
315
doppelung der Welt ist ihr Schicksal. Sie ist damit immer schon das Nicht-Wahre, das
Wiederholte, das Verdoppelte. Sie ist das Zeichen, das für etwas anderes steht, was
nicht die Kunst ist und was sie auch nicht sein kann.
Das Pathos über die theatralische „Verderbnis“ in der Kunst ist zwar bei Tolstoi
sehr stark, wird jedoch von Anfang an in seiner Zweideutigkeit anerkannt. Die Grenzziehung ist notwendig, die Distanz zwischen dem Autor und seinem Kunstwerk,
zwischen Erlebtem und Vorgespieltem, zwischen Schauspieler und Zuschauer ist
unumgänglich. Bei Nietzsche, aber auch bei Schopenhauer war dies gerade die
rettende Tat der Kunst. Sie lässt den Schleier der Illusion über die Sinnlosigkeit des
Daseins fallen. Dennoch, so Nietzsche, aber auch Platon, darf die Illusion gerade nicht
als solche, d. h. als Schauspiel, als Weg-Schauen, als bewusster Selbstbetrug völlig
vergessen werden. In der platonischen Feindschaft gegen die Kunst wurde gerade
dieses merkwürdige Merkmal der Kunst zum Ausdruck gebracht. Es war der Kampf
eines Künstlers nicht bloß gegen die Illusion, sondern gegen das Bewusst-in-derIllusion-Bleiben – der Kampf im Namen einer Illusion, die sich als Weg zur Wahrheit
darstellt.
Tolstoi sieht die Ambivalenz des Kunstphänomens. Die Illusion muss aufrechterhalten werden, darf aber kein Betrug, keine bloße Nachahmung oder Fälschung
sein. Diese Schwierigkeit konnte nur im tolstoischen moralisch-religiösen Sinn gelöst
werden: Das, was dem Leben dient, kann nicht unwahr sein. Der Wahrheit des Lebens
kann, auch wenn sie eine Illusion ist, keine objektive Wahrheit entgegengestellt
werden. Mit anderen Worten: Die Illusion, die dem Leben dient, ist die Wahrheit; die,
die es verleugnet, ist Betrug. Das Vorgespielte und das „wirklich“ Erlebte können in
der Perspektive des wahren Glaubens, der der Not des Lebens entspringt, nicht sinnvoll unterschieden werden. So wie es sinnlos wäre, die Wahrheit frei von dieser Not zu
suchen, so wäre es auch sinnlos, die Kunst wegen der von ihr geforderten Illusion
abzulehnen bzw. eine illusionsfreie Wahrheit vom Künstler zu verlangen. Dennoch
soll diese Illusion sowohl von dem, der sie schafft und vermittelt, wahrhaftig geglaubt
werden als auch von dem, der sie wahrnimmt. Der Schriftsteller und der Leser, der
Schauspieler und der Zuschauer sollen sich in diesem Glauben vereinigen – in dem
wahren Glauben an die Illusion der Kunst. Gerade das ist von Tolstoi mit dem merkwürdigen Begriff „anstecken“ gemeint. Dieser Glaube ist eine Krankheit, von der der
Kranke sein Selbst nicht wirklich distanzieren kann, mit der er aber die anderen
anstecken kann.244
Wann ist aber ein solcher Glaube tatsächlich wahr? Wie unterscheidet man die
wahre Kunst von ihrer geschickten Nachahmung? Wo beginnt der Verfall der Künste,
gewöhnliche Mensch, diese Fabrikware der Natur“, sei dagegen dazu „nicht anhaltend fähig“ (Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1, S. 268), konnte schon gar nicht Tolstois Unterstützung genießen.
244 Man kann auf Russisch nicht nur mit einer Krankheit, sondern auch bspw. mit Lebensfreude oder
mit Lachen anstecken.
316
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
und wie können sie wieder zu ihrer wahren Bestimmung geführt werden? Als Nietzsche mit diesem Problem konfrontiert wurde, sah er sich genötigt, eine doppelte
Bewegung von dem Geist der Musik zur Tragödie und von der „Musik des Lebens“
zum Geist des Theaters zu schildern, die sich nur sehr schwer in eine historische
Reihenfolge bringen ließ. Auch Tolstoi versucht eine Historie als Geschichte über den
Verfall der Künste darzustellen und sucht nach einem Zeitpunkt der Katastrophe, des
Umbruchs bzw. des Versagens der Lehre über das Leben in der Neuzeit. Die Kunst
habe den Bruch mit dem Kirchenglauben und den Sprung zum wahren Christentum
nicht verkraftet. Die neue Ära des wahren Christentums bzw. des sinnvollen Verständnisses des Lebens hätte auch eine neue Kunst hervorbringen müssen, die diesem
Verständnis entspräche. Doch das ist nicht geschehen. Und so blieb man bei der
„rückständigen“ Kunst, die den neuen religiösen Vorstellungen nicht entsprach.
Nur das Christentum kann also aus der Perspektive der geschilderten Historie den
religiösen Anhaltspunkt der „guten“ Kunst ausmachen: die Lehre über die Brüderlichkeit in der Liebe, über die Gleichheit aller Menschen in der Vernunft. Nur das wahre
Christentum als Lehre über die Einigung aller Menschen kann der Kunst einen festen
Boden geben. Mehr noch: die Kunst, solange sie keine Fälschung ist, dient schon
immer dieser Einigung, indem sie religiöse Gefühle bzw. wahren Glauben erregt und
vermittelt. Die wahre Kunst sei folglich nicht nur immer religiös, sondern auch immer
christlich. Aber auch umgekehrt: Jedes Gefühl, das die Menschen eint und das „wahrhaftig“ erlebt und geglaubt wird, sei für ein Kunstwerk tauglich und das religiöse bzw.
christliche Gefühl schlechthin. Die „gute“ Kunst habe, genauso wie das wahre Christentum, immer Menschen vereint. Die „schlechte“ Kunst wäre dagegen die Kunst, die
trennt. Denn sie vermittelt ausschließliche Gefühle und verlangt das Vertrauen in den
Wert bestimmter Kunstwerke, die von der Elite als solche anerkannt worden sind. Als
Beispiele gibt Tolstoi die patriotische und die alte kirchliche Kunst an. Wie die rückständige Religion, so gründet sich auch die „schlechte“ Kunst auf eine abgesonderte
Tradition oder Überlieferung, die nur eine Gruppe von Angehörigen versteht. Die
Letztere verlangt das Vertrauen, sei es an den Kunst- oder Religionskanon, und
bezichtigt die Nicht-Gläubigen, wenn es auch bloß eine Bezichtigung des schlechten
Geschmacks ist. Die „schlechte“ Kunst wird damit, genauso wie „die Lehre dieser
Welt“, zum Mittel des Betrugs, denn sie ist für diejenigen nicht verständlich, die mit
dem gewissen Kanon nicht vertraut sind. Genauso wie die falsche Religion verlangt
eine solche Kunst das Vertrauen, statt mit Glauben „anzustecken“.
Hier zeigt sich dennoch das Problematische von Tolstois doppelter Unterscheidung der „wahren“ und „falschen“ bzw. „guten“ und „schlechten“ Kunst (diese zwei
Unterscheidungen werden u. a. von Tolstoi nicht deutlich auseinandergehalten).245
245 Genauso versucht Tolstoi, christliche und allgemeine menschliche Gefühle, die auch für die
„gute“ Kunst tauglich sein können, zu unterscheiden. Jedoch bleibt die Grenze zwischen ihnen unklar
(vgl. Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 275).
3.3 Die gute Kunst
317
Wie auch früher bei Nietzsche, scheint Tolstoi eine klare Trennung zwischen der
„wahren“ Kunst einerseits und ihrem Verfall, ihrer Fälschung, ihrer Nachahmung,
ihrer Entartung andererseits nicht wirklich zu gelingen. Denn die ausschließlichen
Gefühle, die mit Hilfe von „Hypnose“ bzw. „Unterhaltsamkeit“ von der „schlechten“
Kunst vermittelt werden, sind auch „ansteckend“. Auch in diesem Fall findet eine
gewisse Einigung der Menschen, eine Kommunikation der Gefühle, statt. Umgekehrt:
Die „gute“ Kunst kann auch sehr wohl die Zuschauer in Verstehende und NichtVerstehende trennen. Tolstoi erkennt dies an. Eine Aufführung von Shakespeare wird
auf einige Menschen eine größere Wirkung haben als z. B. ein Theaterstück „bei dem
wilden Volk der Wogulen“, das er selbst als „wahre“ Kunst preist.246 Tolstois Erklärung dafür ist der „verdorbene[ ] ästhetische[ ] Geschmack“ der Menschen, die sich an
den Kanon halten.247 Die Menschen „mit verdorbenem und atrophiertem Gefühl“ für
die Kunst verkennen die Bestimmung der Kunst, so wie sie den wahren Sinn des
Lebens verleugnen. Zu diesen Menschen, die an der Verkehrtheit des Geschmacks
leiden, zählt Tolstoi sich allerdings selbst – als Künstler. Die ganze neuzeitliche
europäische Kunst sei ein Vorbild des schlechten Geschmacks, der Verirrung des
Geschmacks.248 Die Ausnahme bilden nur wenige Kunststücke (darunter wird Dostojewski genannt, „vorzugsweise sein Totenhaus“,249 und zwei eigene Erzählungen Gott
sieht die Wahrheit und Der kaukasische Gefangene250). Tolstoi fügt allerdings hinzu:
Wenn ich Beispiele für die Kunst, die ich für die beste halte, anführe, messe ich meiner Auswahl
keinen besonderen Wert bei, da ich […] dem Stand der Menschen angehöre, die vermöge der
falschen Erziehung einen verdorbenen Geschmack haben.251
Wie die ethische Regel, so funktioniert auch Tolstois Kriterium der Kunst nur negativ:
Man kann sich nur sicher sein, was sicherlich nicht zur Kunst gehört.
Hier sollte man eines der wichtigsten Ergebnisse unserer Untersuchung zu Tolstois moralischen Plausibilitäten in Erinnerung rufen. Die Lehre über das Leben kann,
so haben wir festgestellt, nicht anders als in paradoxen Formeln des Nicht-Widerstandes und des Nicht-anders-haben-Wollens vermittelt werden. Sie ist eine Art AntiLehre, die nicht gelehrt werden kann. Wenn sie mitgeteilt werden muss, wenn der
Sinn des Lebens als Verständnis, das weder Gefühl noch Vernunftidee ist, vermittelt
werden soll, dann nur durch die Kunst: nicht als Lehre, sondern als Geschichte, z. B.
als Geschichte über wachsende Liebe, die in sich getrennt ist und eine Wiedervereinigung anstrebt. Diese Wahrheit ist somit selbst die Wahrheit eines Mythos – eine
246 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 214.
247 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 153.
248 Als krassestes Beispiel der „schlechten“ Kunst wird die neunte Symphonie von Beethoven
genannt (vgl. Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 248 f.).
249 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 239.
250 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 244 f.
251 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 244.
318
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Wahrheit auf Zeit, der dennoch keine überzeitliche Wahrheit entgegensteht. Denn
ihre Wahrheit besteht darin, dass sie dem Leben dient und es ermöglicht.
Auch Tolstois Historie über den Verfall der Kunst ist eine Geschichte – eine
Geschichte über die Vermittlung der Lehre, die nicht gelehrt, d. h. nicht vermittelt
werden kann. Ihre Vermittlung soll dennoch möglich sein. Denn der Mythos selbst,
den sie zum Ausdruck bringt, spricht von der Möglichkeit der Verständigung unter
den Menschen – in der Liebe, die zur Vernunft gekommen ist, die die Vernunft selbst
ist. Tolstois Definition der Kunst als Mittel zur Kommunikation und Einigung der
Menschen ist somit die Kehrseite dieses Mythos und seine Rechtfertigung zugleich:
Die Kunst diene der Einigung aller Menschen; die „Einheit des Menschensohnes“
könne sich nur durch die Kunst mitteilen. Man darf nur nicht vergessen, dass diese
Zirkelbewegung jeder Zeit abgebrochen werden kann. Denn auch dieser Mythos ist
nur eine Geschichte, nur eine Lehre, die „auf dem Niveau des Wissens unserer Zeit“
gelehrt wird.252 Und jede Lehre über das Leben, die gelehrt und zu einer Geschichte
umgestaltet wird, kann zum „Netz des Betruges“ werden, durch das die Menschen
vielleicht viel enger verbunden werden als durch eine Anti-Lehre, die keine Geschichte vermittelt und sich in ihrer Wahrheit nur einem Einzelnen eröffnet.
So kommt durch das ganze Pathos in Tolstois Kunstphilosophie ein Gedanke zum
Ausdruck, der dieses Pathos zumindest teilweise relativiert. Nicht jedes Bündnis,
nicht jede Einigung der Menschen ist erstrebenswert. Vielleicht ist es gerade umgekehrt: Jedes Bündnis, das wir kennen, ist das des Bösen und des Betrugs. Das Bündnis
der Menschen mit verkehrtem Geschmack ist offensichtlich viel sicherer als jene
angestrebte Einigung der Menschheit durch die „gute“ Kunst. Tolstoi ist sich im
Klaren: So wie es Menschen mit einer „verstumpften Einbildungskraft“ gibt, die der
herrschenden Lehre über das Leben anhängen, gibt es auch Verehrer von Shakespeare und Wagner. Gerade das Bündnis des Bösen scheint unzerbrechlich zu sein.
Das Ziel der „guten“ Kunst sollte dann darin bestehen, diesem Bündnis entschiedenen
Widerstand zu leisten. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass man nach Tolstois
Evangelium gerade dem Bösen nicht widerstehen darf. Somit darf es auch kein
Bündnis gegen „eine geschlossene Masse“ des Bösen geben. Wenn die Macht des
Bösen in der Verehrung der Lehre der „mächtigen Mehrheit“ bzw. des Kunstkanons
liegt, wenn es sich bei jedem allgemeinen Maßstab nur um einen Betrug handeln
kann, der durch das unpersönliche „Alle“ vertreten wird, so soll das gute Bündnis
bzw. die neue Einigung der Menschheit gerade nicht bei diesem „Alle“, sondern bei
den Einzelnen ansetzen. Es handelt sich somit nicht um eine „gute“ Einigung gegen
eine „böse“. Das Ziel der „guten“ Kunst ist, wie auch das der Lehre des NichtWiderstandes, eine Einigung, die den Einzelnen von der Macht jedes Bündnisses
unabhängig machen bzw. ihn von der Macht der Allgemeinheit befreien wird. So
besteht nach Tolstoi kein Zweifel daran, dass
252 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 268.
3.3 Die gute Kunst
319
jede wahrhaftig moralische Tat, die die Moralität zur Steigerung bringt, immer einen Bruch mit
den Gewohnheiten der Gesellschaft bedeutet (TGA 39, S. 23).
Und
[d]ie ganze vernünftige Tätigkeit des Menschen ist auf die Zerstörung dieser Verkettung der
Täuschung gerichtet.253
Dennoch, wenn die Menschen „meinen, durch Zerschlagung dieser Masse die Masse
selbst zu vernichten“, „schmieden sie sie nur noch fester zusammen“.254 Durch den
Widerstand, durch die Einigung gegen das Böse kann man nichts erreichen.
Tolstois Pathos der Allgemeinheit in der Kunst darf uns also wiederum, wie auch
sein Pathos über die Gleichheit aller Menschen in der Vernunft, nicht irreführen. So
schlicht ist seine Formulierung:
Den Inhalt der zukünftigen Kunst werden nur die Gefühle bilden, die die Menschen zur Einigkeit
führen oder die, die sie gegenwärtig vereinigen; die Form der Kunst aber wird eine solche sein,
die allen Menschen zugänglich ist. Und daher wird das Ideal der Vollkommenheit in der Zukunft
nicht die Exklusivität des Gefühls, das nur einigen zugänglich ist, sondern im Gegenteil seine
Allgemeinheit sein.255
Aber neben den zwei Merkmalen der wahren Kunst – der Klarheit in der Darstellung
bzw. der unmittelbaren Verständlichkeit und der Wahrhaftigkeit bzw. dem „inneren
Bedürfnis“, „das Gefühl“ zum Ausdruck zu bringen – wird in Was ist Kunst? noch
ein drittes genannt, das Tolstois Pathos der Allgemeinheit direkt widerspricht – die
„Eigenart des Gefühls“:
Da aber kein Mensch dem anderen gleich ist, so wird das Gefühl auch für jeden anderen eigenartig
sein und umso eigenartiger, je tiefer der Künstler schöpfen wird, je herzlicher, aufrichtiger er sein
wird. (meine Hervorhebungen – E.P.)256
Denn, so überrascht Tolstoi seine Leser, „[d]ie Mannigfaltigkeit der Gefühle, die aus
dem religiösen Bewußtsein entstehen, ist unendlich“. Dagegen seien die Gefühle, die
aus dem „Verlangen des Genusses entstehen“, immer die gleichen, sie seien „längst
schon gekostet und geäußert“257. Die „wahre“ Kunst solle also da ansetzen, wo die
Menschen einander nicht gleich sind, wo sie sich am stärksten unterscheiden. Nur ein
Gefühl, das einmalig und einzigartig ist, kann für die anderen interessant bzw. „anste-
253 Tolstoi, Mein Glaube, S. 336.
254 Tolstoi, Mein Glaube, S. 336.
255 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 284.
256 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 221. Zu Tolstois Deutung der Merkmale der wahren Kunst s. Zurek,
Tolstojs Philosophie der Kunst, S. 330 ff.
257 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 113.
320
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
ckend“ sein. Ein solches Gefühl, d. h. der erlebte Sinn des Lebens, „die Philosophie in
einem persönlichen Sinne“ und aus persönlicher Not, kann nur das Gefühl sein, das,
wenn es sich vermitteln will, alle Menschen, aber nur als eigenartige Einzelne, nicht als
ihnen inhärente Allgemeinheit, vereinigen bzw. „anstecken“ kann. Der letztere Begriff
ist gerade ein Gegen-Begriff gegen das Allgemeine. Das „Anstecken“ ist in dem Sinne
pathologisch, dass es die Möglichkeit des Nicht-Pathologischen, des Rein-Allgemeinen ausschließt. Dieses „eigenartige“ Gefühl kann, wie eine persönliche Geschichte
über den gefundenen Sinn des Lebens, auch bei nur zwei Menschen niemals „gleich“
sein. Denn auch die Liebe bleibt sich niemals gleich. Sie muss immer weiter steigen
und darum zwingt sie den Einzelnen, sein Verständnis des Lebens, das individuell
und einmalig ist, den anderen mitzuteilen. Wie unvermeidlich er über sich hinausgehen soll, um seine persönliche und einmalige Not zu stillen und den Bezug auf das
Unendliche in seiner Selbst-Aufopferung für den anderen zu suchen, so kann er auch
den von ihm gewonnenen Sinn des Lebens nicht nur für sich behalten. Sein individueller Ansatz, sein Standpunkt, seine einmalige Perspektive des Lebens, seine persönliche Sinngebung und Rechtfertigung des eigenen Daseins muss sich als bejahende
Liebe zu anderen in einer Mitteilung ausdrücken lassen. Doch dieses „Muss“ darf
wiederum nicht verallgemeinert werden. Es ist kein Imperativ an alle. Er muss es tun,
aber nur wenn er es kann, wenn er Künstler ist. Und das heißt: wenn er im Stande ist,
einer von ihm erschaffenen Illusion wahrhaftig zu glauben; die Lehre über das Leben
in eine Geschichte umzuwandeln; die Kraft der steigernden Liebe als Harmonie „in
einem Augenblick“, „ohne Schlussfolgerungen und Beweise“ darzustellen.
So geht Tolstoi zwar von den allgemeinverständlichen Gefühlen in der Kunst aus,
wie er früher von der Gleichheit aller Menschen in der Vernunft ausging, doch führt
ihn sein besonderer Ausgangspunkt – der Standpunkt des Einzelnen, der hier und
jetzt nach dem Sinn seines eigenen Lebens fragt – weit weg von seinen ersten
Annahmen. Nicht durch den Widerstand des Guten gegen die „geschlossene Masse“
des Bösen, nicht durch die Sorge um das Allgemeine wird die Forderung des Lebens
an die Kunst und den Künstler erfüllt, sondern gerade durch das Gegenteil: durch ein
individuelles Verständnis, dass nur der Widerstand gegen das Böse das Böse ist, dass
die Vereinigung aller Menschen als einzigartige und einmalige Wesen, d. h. nur ihre
Einigung als besondere Einzelwesen, als paradoxes „Anstecken“ mit der Gesundheit,
der Weg des Lebens sein kann. Die Kunst, die dieses Verständnis vermittelt, ist, so
Tolstoi, der Ausdruck „einer sich neu gestaltenden Beziehung des Menschen zu der
Welt“,258 die immer durchaus perspektivisch, zeitlich und räumlich begrenzt bleibt
und letztendlich selbst eine Geschichte ist. Ein wahres Kunstwerk ist somit
eine Offenbarung des neuen Verständnisses des Lebens, die sich nach für uns unergründbaren
Gesetzen in der Seele eines Künstlers vollzieht und dessen Ausdruck den Weg der Menschheit
erleuchtet (TGA 30, S. 225).
258 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 113.
3.3 Die gute Kunst
321
Deshalb ist sie immer neu und einmalig, deshalb gibt es für einen wahren Künstler
keinen Kanon, so wie es für einen wahren Christen kein Dogma, keine Lehre, keine
Regeln geben kann.259
Die Frage nach dem Kriterium der „wahren“ Kunst wird somit geklärt. Die
Geschichte über das Werden des Ichs soll immer wieder so vermittelt werden, dass sie
den anderen neu und gleichzeitig bekannt vorkommt, sodass sie ihr „wahrhaftig“
glauben, als ob dieser Sinn des Lebens von ihnen erlebt wurde, als ob er tatsächlich
für jeden Menschen derselbe sein sollte. Die flüssige und instabile innere Welt (nach
dem berühmten Ausdruck aus dem Roman Auferstehung: „[d]ie Menschen sind Flüssen vergleichbar“)260 in den Ausdruck der Vernunft oder, wie Tolstoi an anderer Stelle
sagt, in die „vernünftige Liebe“261 umzuwandeln, ist die Berufung des Künstlers, seine
Aufgabe. Wenn er sie erfüllt, wird er zu einem wahren Künstler. Seine Gefühle (der
von ihm erlebte Sinn des Lebens) sind damit einzigartig, er selbst ist anders als andere
Menschen. So formuliert Tolstoi diesen Gedanken in seiner Alltagslektüre mit Berufung auf Emerson:
Ein Mensch, der nur noch übliche Gefühle hat, richtet seine Gedanken nach den Dingen; ein
Künstler richtet die Dinge nach seinen Gedanken. Ein gewöhnlicher Mensch hält die Natur für
etwas für immer Gefestigtes und Hartes; ein Künstler sieht sie als flüssig und schillernd, er legt
seinen eigenen Abdruck in sie hinein. Für ihn ist die fessellose Welt gefesselt und nachgiebig; er
bekleidet Asche und Steine mit menschlichen Eigenschaften und verwandelt sie in die Ausdrücke
der Vernunft. (TGA 41, S. 464)
Dieser Ansatz des schaffenden und sinngebenden Einzelnen ist nicht der sokratischkantische Ansatz der allgemeinen Menschenvernunft, wenngleich Tolstoi ihm auch
immer wieder eigene Gedanken unterordnete. Es ist der Ansatz eines Denkers, der die
Illusion, welche die Kunst, aber auch das Leben ausmacht, durchschaut und dennoch
beide nicht verleugnen kann, weil ihm das letzte Kriterium dafür fehlt. Es ist der
Ansatz eines Künstlers, der nur durch neue Perspektiven und neue Geschichten die
Not des Lebens begreifen und ertragen kann.
259 Tatsächlich kommt Tolstoi, der sein ganzes Leben unermüdlich nach den Regeln suchte, am Ende
zu dem Schluss, dass die Erfüllung der Lehre Christi in der „Bewegung auf Gott“ besteht, und dafür
„kann es gar keine definitiven Gesetze und Regeln geben“ (TGA 28, S. 79).
260 Lew Tolstoi, Auferstehung, S. 243. An dieser Stelle seines letzten Romans widerspricht Tolstoi,
nebenbei bemerkt, direkt seiner früheren Autorität, nämlich Schopenhauers Lehre von dem unveränderlichen Charakter jedes Menschen.
261 Tolstoi, Christliche Lehre, S. 86.
322
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
3.4 Zusammenfassung
Fassen wir die wichtigsten Ergebnisse dieses Kapitels zusammen. Es sei zuerst hervorgehoben, dass diese Darlegung von Tolstois Philosophie eine Systematisierung
anstrebte, die eine nicht zu vermeidende Selektion impliziert. Wie im Kapitel mehrmals angedeutet wurde, unterstützt Tolstois Pathos nicht immer die hier vertretene
Interpretation und widerspricht ihr sogar an mehreren Stellen. Mein Ziel war es jedoch
nicht, Tolstois Gedankengänge, die nicht ohne gewisse Widersprüche zum Ausdruck
kamen, in ihrer Vollständigkeit darzustellen, sondern seinen Ansatz in der Moral- und
Kunstphilosophie bzw. deren Verbindung nach den ihnen inhärenten Plausibilitäten
zu untersuchen. Erst in Tolstois Idee der „guten“ Kunst wird deutlich, inwiefern sein
Ausgangspunkt – die Not des Einzelnen, der die Forderung der Allgemeinheit als
Gewalt und Betrug erlebt – ernst zu nehmen ist, auch wenn er diesem selbst nicht in
all seinen Äußerungen folgte. Die individuelle Not der nach dem Sinn des eigenen
Lebens fragenden Vernunft des Einzelnen, die von diesem aufdringlichen Hinterfragen selbst nicht zu unterscheiden ist, ist in ihrem Berechtigt-Sein die einzige unerschütterliche Plausibilität von Tolstois Denken geblieben.
Der Wunsch nach dem Guten, nach dem Besseren des eigenen Lebens erwies sich
ferner als eigentliches Merkmal, als das Zeichen der Vernünftigkeit. Dieser Wunsch
kann, aus welchem Grund auch immer, nicht nur nicht getadelt werden, sondern
seine Verkennung ist dem Leben immer schädlich und deshalb selbst das Böse. Die
Wünschbarkeit ist hier allerdings kein unersättlicher Wille im Sinne Schopenhauers.
Sie entspricht eher dem „deus“, den Nietzsche als Gegen-Prinzip zu allen Prinzipien
des vernünftigen Wollens setzte. Die Illusion, die den „Wünschen [des] Herzens“
entspringt, wird von Tolstoi zur Wahrheit des Lebens erklärt, denn ihr kann keine
andere überpersönliche, allgemeine Wahrheit auch bloß in Gedanken sinnvoll entgegengesetzt werden. Eine solche Wahrheit wäre für die Vernunft nicht brauchbar, sie
wäre gerade trügerisch. Der Glaube dagegen, der sich auf dieser Wahrheit gründet,
kann nur der wahre Glaube sein. Er ist als Kraft des Lebens dankbar anzunehmen,
denn nur aus ihm heraus kann der Einzelne den Sinn seines Einzellebens begreifen.
Dieser Sinn besteht allerdings darin, dass das Leben des Einzelnen keinen Sinn
haben kann und seine Selbst-Aufopferung zugunsten der anderen Lebenden unvermeidlich ist. Wer das versteht, kann nicht mehr zum Betrug der Selbsterhaltung
zurück. Denn das Leben kann weder behalten noch in irgendeiner Weise abgesichert
werden. Wer dies begriffen hat, kann den Kampf ums Überleben, den Widerstand
gegen das Unvermeidliche nur als das Böse, d. h. als Betrug betrachten. Er versteht
dabei auch, dass nur sein Widerstand gegen das Böse das Böse ist, das dennoch nicht
wirklich ist, sondern in das Gute des Lebens eingeschrieben bleibt. Es ist nur aus
seiner beschränkten Perspektive das Böse, aus der er sein Leben als etwas betrachtet,
was ihm als Eigentum gehört (doch was wäre er dann selbst?). Aus der Perspektive
des Lebens gibt es dagegen weder das Böse noch den Tod. Ein Maßstab, mit dem das
Leben selbst gerichtet werden könnte, fehlt wesentlich.
3.4 Zusammenfassung
323
Das Gebot des Nicht-Widerstandes, der Kern von Tolstois Moralphilosophie, hebt
so die wichtigsten Unterscheidungen der sokratisch-kantischen Moral auf, der Tolstoi
jedoch folgen wollte (die Widersprüche und Diskrepanzen in Tolstois Denken können
größtenteils auf diese Weise erklärt werden) – den Gegensatz von Instinkt und Vernunft, von gewolltem und moralisch gebotenem Handeln und, besonders wichtig,
von dem Subjektiv-Pathologischen und Vernünftig-Allgemeinen. In Tolstois Deutung
der goldenen Regel wird die letztere von den Plausibilitäten der kantischen Moralphilosophie befreit. Der allgemeine Maßstab der Moral aus Vernunft wird hier ignoriert, dagegen werden neue Plausibilitäten ins Spiel gebracht: Das Gute und das Böse
können einander nicht als zwei Optionen des Handelns aus Prinzipien entgegengesetzt werden; sie sind nicht radikal, sondern gehören beide zu dem Einzigen, was
allein uneingeschränkt gut sein kann – zum Leben, zum rätselhaften Geboren-Sein
und Sterben-Müssen, dessen Geheimnis die Vernunft niemals begreifen könnte. Wenn
sie jedoch dessen Unbegreiflichkeit begriffen hat, so wird sie auch die eigene NichtSpontaneität, die eigene untilgbare Verschuldung gegenüber allen Lebenden begreifen, sie wird zur demütigen Akzeptanz der eigenen Abhängigkeit von dieser geheimnisvollen Kraft geführt, welche sie, ohne sie zu fragen, in diese Welt geschickt hat und
sie genauso aus dieser Welt wieder nehmen wird. Das Verständnis dieses Geheimnisses allein macht den Menschen zum Sohn und Erben der Kraft, die sich ihm in ihrer
Unbegreiflichkeit als Wille Gottes zeigt – als Wille des „Vaters des Lebens“.
Tolstois Gottesbegriff ist allerdings zweideutig. Einerseits ist er kein persönlicher
Gott, sondern mit dem Leben selbst identisch, und er nähert sich Spinozas Gottesvorstellung an, andererseits gebietet er aber etwas, was der Mensch als das Gute
akzeptieren muss. Tolstoi spricht ausdrücklich von seinem Willen. Diesem Willen darf
man jedoch keine Zwecke unterstellen – weder das Fortbestehen des Menschengeschlechts noch das des Lebens selbst ist sein Ziel. Denn dies wäre wiederum nur eine
beschränkte Perspektive, die, indem sie sich absolut setzt, zur Gewalt der Allgemeinheit führen würde, welche den Einzelnen ihren Zielen unterwirft und ihn zum bloßen
Mittel herabwürdigt. Sie würde zum Widerstand aufrufen, sie würde also zum Bösen.
Das einzige Gebot von Tolstois Gott ist die Liebe zu ihm, d. h. die Aufnahme seiner uns
unzugänglichen Ziele (und nicht etwa Wohltätigkeit, Mitleid oder gegenseitige Hilfe).
Sein Wille kann allerdings nicht verfehlt werden. Das Gerecht-Sein, die kantische
Glückswürdigkeit bleibt zwar für den Menschen wegen seiner Einschränkung unerreichbar, jedoch wird ihm die wahre Glückseligkeit, die Erfüllung des Willens
Gottes, immer vorbehalten. Im Tod wird er unvermeidlich dieses Ziel erreichen, das in
dem Über-Sich-Hinausgehen, in der Aufopferung für die anderen Lebenden besteht.
Die Erlösung ist immer schon da, soweit man versteht. Sie ist auch da, wenn man
noch nicht verstanden hat. Das gesuchte Ziel des Einzellebens ist nur paradox zu
deuten: Das Verständnis wird niemals vervollkommnet, solange man lebt. Das Ziel zu
erreichen bedeutet gleichzeitig das Ende des Lebens.
Das ganze Leben wird so zur Suche nach Gott, zur Suche nach dem Bezug des
endlichen Einzelwesens auf die Unendlichkeit der Welt, der in diesem Leben immer
324
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
schon vorhanden ist, der aber nur im Tod vollendet wird. Die Liebe zu diesem Gott,
das Verständnis, dass nur der Widerstand gegenüber dem Bösen das Böse ist, die
Akzeptanz der eigenen von uns nicht empfundenen Abhängigkeit entspricht, so
Tolstoi, den tiefsten Wünschen jedes Lebewesens, das nach dem Sinn des eigenen
Lebens fragt. Der Glaube an diesen Gott ist mit dem Streben nach dem Wohl identisch.
Beide sind unvermeidlich und natürlich für die Vernunft. Dennoch neigt die Vernunft
bei vielen, wie Tolstoi auch bei sich selbst feststellt, zur „Mogelei“ bzw. zum Betrug.
Tolstoi konfrontiert sich dabei mit der Schwierigkeit, der jede Moral aus Vernunft
ausgeliefert ist, nicht nur die von Kant, sondern auch die von Sokrates und auch die
von Spinoza. Wenn die Moral der Forderung der Vernunft entspricht, wie ist es
möglich, dass die Vernunft ihre wahren Interessen verkennt und gegen die moralischen Forderungen verstößt, sei es die des kategorischen Imperativs, die der goldenen Regel oder die des Nicht-Widerstandes? Tolstoi geht mit dieser Schwierigkeit so
um, dass man, so wie es häufig geschieht, seine Lösung für eine ganz traditionelle, im
Sinne einer sokratisch-kantischen Moral aus Vernunft, halten kann, die sie aber nicht
ist. Das Gute ist vernünftig und gleichzeitig die Grenze, an der die Vernunft zur
demütigen Akzeptanz des Unbegreiflichen genötigt wird. Doch nicht die Forderung
eines moralischen Gesetzes, sondern allein die mächtige Forderung des Lebens und
die Not des Einzelnen sind nach Tolstoi bedingungslos anzunehmen. Die Vernunft
selbst ist keine spontane Instanz mehr. Sie hat keine andere Richtschnur außer ihrer
Not, sie ist bloßes Hinterfragen nach dem Besseren des eigenen Lebens. Deshalb kann
sie dem Guten des Lebens auch ausweichen und sich über ihr wahres Wohl irren, wie
ein Kind, das sich selbst Schaden zufügen kann. Besonders die Illusion der eigenen
Freiheit, der eigenen Spontaneität, der Kausalität aus dem Willen wird zum Mittel des
Betrugs, denn die Vernunft will damit ihre unendliche und untilgbare Verschuldung
leugnen und sich als Grund ihrer selbst, als causa sui verstehen. Sie will die Selbsterhaltung. Aber für dieses Verkennen der Bedingungen des Lebens rächt sie sich an
sich selbst. Denn ihre Endlichkeit wird ihr zum Verhängnis und Fluch, ihre Not wird
ihr zum Beweis der Sinnlosigkeit und Wertlosigkeit des Daseins. Sie wird zur nihilistischen Vernunft, die das Leben verneint. Das einzelne Lebewesen, das den Bezug auf
die Unendlichkeit verliert, ist zur Verzweiflung verurteilt. Dies ist sein Schicksal, aber
auch der Wendepunkt, an dem es zum „Bewusstsein des Lebens“ zurückkehren muss,
so wie Tolstoi selbst seinen eigenen späteren Einschätzungen zufolge nach 50 Jahren
des sinnlosen Lebens zur Sinnfrage zurückgekehrt war.
Es sei hier nochmals betont, dass Tolstoi weder einen extremen Pessimismus
noch eine Verleugnung der Vernunft wollte. Er wollte gerade ein Mittel gegen den
schopenhauerschen Pessimismus finden, der auch sein eigener Ausgangspunkt gewesen ist und der ihn beinahe zum Selbstmord geführt hatte. Es war die „Mogelei“ der
Vernunft, ihr Betrug und kein unersättlicher blinder Wille, der ihn in den Abgrund der
Verzweiflung gestürzt hat. Die Vernunft wurde dabei zum Werkzeug des Bösen und
des Betrugs. Sie kann aber auch zum Werkzeug des Guten werden. Jedoch kann sie
dies nicht im Sinne Kants, nicht als gesetzgebende Kraft, nicht als autonomes Ver-
3.4 Zusammenfassung
325
mögen, nicht als Wille, der, von allem Pathologisch-Empirischen frei, dem eigenen
Gesetz gehorcht, sondern gerade umgekehrt: Die Vernunft wird nur zum Guten, wenn
sie sich dem zuwendet, was sie nicht ist, dem Guten, das sie niemals vollkommen
akzeptieren und dessen Ziele sie niemals völlig unter ihre Maximen aufnehmen kann.
Gerade ihr Streben nach Vollkommenheit zwingt sie zum Betrug. Sie will das Gute in
ihre Perspektive einschreiben und selbst die unabhängige Quelle des Guten werden.
Sie bringt dafür eine Norm, eine Regel hervor und erhebt sich zur Formel der vollkommenen Gerechtigkeit, zum Richter. Sie überredet sich, dass das Endliche nicht
wirklich endlich ist, dass das Überleben ihr eigentliches Wohl ist und dass dieses
Wohl durch allgemeine Normen versichert werden kann. Sie setzt die allgemeinen
Maßstäbe für jedermann und das Gemeinwohl als ihr Ziel. So entstehen Institutionen,
die diese Quasi-Unendlichkeit garantieren und die Vernunft des Einzelnen in ihrem
Selbst-Betrug durch den Betrug vonseiten der anderen bekräftigen. Sie geben dem
Einzelnen das, was er sonst nicht haben könnte: Die Überzeugung, dass er die freie
Quelle des Guten ist, dass er gerecht sein kann. Alle Institutionen des Richtens und
Strafens, Gerichte, Gefängnisse, Armee, Staat – und dies ist keine Kritik am Missbrauch, sondern die radikalste Kritik der europäischen Zivilisation, die es je gegeben
hat – dienen diesem Betrug. Es entsteht das, was Tolstoi „eine geschlossene Masse“
des Bösen nennt. In dem gemeinsamen Wahn der modernen Europäer, den Tolstoi mit
der Kraft eines großen Künstlers schildert, ist die Lehre über das Leben kaum mehr
wahrzunehmen. Die Welt hat über die Lehre Gottes – eine Lehre, die durch den „Sohn
des Verständnisses“ (Christus) vermittelt und mit seinem ganzen Leben bestätigt
wurde – völlig gesiegt. Jedoch hat sie das nur scheinbar, denn die Not des Einzelnen,
ob sie sich in der Blütezeit des Lebens (wie bei Tolstoi selbst) oder erst angesichts des
Todes meldet, ist nicht zu verkennen. Wenn sie einmal da war, wird ihre Stimme nicht
mehr verstummen.
Tolstois Idee der Moral aus Vernunft bzw. der wahren Religion ist nur als negativeinschränkend, als Lehre des Nicht-Widerstandes, des Nicht-Tuns, des Nicht-Teilnehmen-Wollens zu verstehen, nicht etwa als Befürwortung des Mitleids, selbst nicht als
die der Nächstenliebe. (Letztere ist nach Tolstoi nichts anderes als Verzicht auf den
Widerstand dem anderen gegenüber.) Und wenn er lehrt, dass man das Gute tun soll,
so ist dieses Gute gleichzeitig absolut und perspektivisch. Es ist durchaus ernstzunehmen, könnte aber niemals zum Anlass werden, auf die eigene Gerechtigkeit stolz zu
sein, oder aber zu einem Mittel, andere zu bezichtigen. Wie moralisch rein eine
konkrete, eine positive Forderung auch aussehen mag, wie wenig das Moralisch-Gute
aus der Perspektive des Einzelnen auch bezweifelt werden kann, es ist niemals vollkommen und darf deshalb nicht verallgemeinert, nicht zum Maßstab des Richtens
erhöht werden. Denn dann wird es zum Bösen, zum Mittel, dessen sich das Bündnis
des Bösen bedient. Die Aufgabe desjenigen, der eine solche Lehre lehrt, besteht
dagegen gerade darin, die „Geschlossenheit dieser Masse“ zu zerstören.
Tolstoi setzt seine Lehre, die christliche Lehre, allen anderen Lehren entgegen.
Die Lehre Gottes, die Lehre über das Leben ruft zum Verständnis des Einzelnen, zu
326
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
seinem Glauben auf. Die „Lehre dieser Welt“ fordert umgekehrt sein Vertrauen und
erzwingt es durch Bildung, durch gesellschaftliche Institutionen, durch Gewalt seitens der „mächtigen Mehrheit“. Es wird das Vertrauen in eine Überlieferung, das
Vertrauen in Erzählungen, das Vertrauen in Geschichten gefordert. Tolstois Invektiven sind deshalb gegen alle überlieferten Geschichten gerichtet. Mit ihnen wird die
Sinnlosigkeit des Endlichen noch verewigt und der Betrug bestätigt. Aber jede Lehre,
die gelehrt wird, ist in Gefahr, zu einem solchen Betrug zu werden, indem sie vermittelt wird. Auch die reinste Quelle, die Lehre Christi, wurde, so Tolstoi, mit der
„Lehre dieser Welt“ verschmutzt, zuerst von Paulus und dann von allen christlichen
Kirchen. Sie wurde bloß zu einer Geschichte, in die zu vertrauen verlangt wird.
Tolstoi konfrontiert sich auf diese Weise mit der Paradoxie der Lehre, die nicht
gelehrt werden darf, und mit der des Sinns, der nicht mitteilbar ist, die jedoch beide
verkündigt werden sollen. Die Not des Lebens kann nicht durch eine Lehre vermittelt
werden, schon deshalb nicht, weil sie nicht bei allen vorhanden ist. Der gefundene
Sinn ist nur als persönlicher Glaube und als Ruhe des Herzens in Romanen und
Traktaten darzustellen. Dann wird die Lehre jedoch wieder positiv, sie wird selbst zu
einer Geschichte. Tolstoi tut damit etwas, was er nicht tun sollte: Er lehrt. Mehr noch:
Er will seine Lehre positiv als Katechismus zusammenfassen. Ihre Paradoxien verwandeln sich dabei in eine Geschichte über die Einheit der Vernunft, die die Liebe ist,
die sich, in sich selbst getrennt, immer weiter steigern will, die eine Wiedervereinigung von allem Geteilten begehrt, die stets wächst. Selbst das „Ich“ des Einzelnen,
das an die Bedingungen von Raum und Zeit gebunden ist und sein Verharren vergeblich anstrebt, sei nichts außerhalb seiner in Raum und Zeit verlaufenden Geschichte. Es ist nicht, es wird. Diese Verzeitlichung der Paradoxien des sinnlosen Sinnes und
des ziellosen Ziels des Einzellebens, die Positivierung des Nicht-Widerstandes als
Liebe, die ihr Ziel in der Vereinigung der Menschheit hat, ist eine Geschichte, ein
Mythos, eine „Philosophie in einem persönlichen Sinne“, die, wie Tolstoi früher in
einem Brief anerkannte, viel wirksamer als jede abstrakte Theorie sein kann. Sie zeigt
aber noch eine Plausibilität auf, der Tolstoi keine besondere Aufmerksamkeit schenken wollte und die er nur gelegentlich und nebenbei andeutete, denn sie hat ihn
selber vielleicht in Verlegenheit gebracht: Nicht für immer und ewig, nicht im Sinne
einer überzeitlichen Wahrheit wurde das Christentum, die Lehre über die Einheit aller
Menschen, der Menschheit gegeben, sondern nur auf Zeit. Sie ist das zu „unserer Zeit“
am höchsten erreichte Verständnis des Lebens, und es ist nicht ausgeschlossen, dass
die Menschheit „noch neue, höhere Ideale“ in der Zukunft entdecken soll.262 Auch
diese Lehre, indem sie zu einer Geschichte, zu einem Mythos über die Einheit der
Vernunft wird, verrät ihr Beschränkt-Sein und – wollen wir diesen Gedanken fortsetzen – auch sie kann zum Mittel des Betrugs und des Bösen werden, falls sie verallgemeinert und als Maßstab für jedermann gesetzt werden sollte.
262 Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 304.
3.4 Zusammenfassung
327
Damit ist die Perspektivierung der Vernunft vollendet und an ihre Grenzen
gebracht. Es ist die Vernunft des Einzelnen, die zu einer Geschichte kommt und diese
jedoch gleichzeitig relativiert. Sie begreift dabei, dass es auch ihre persönliche Not ist,
aus ihrem Verständnis eine Geschichte zu machen. Auch diese Not, wie auch das
Verlangen nach dem Sinn, kann nicht verallgemeinert werden. Denn es ist die Not
und gleichzeitig das Können desjenigen, der die Lehre über das Leben mitteilen, der
an die Illusion wahrhaftig glauben und sein Verständnis in ein Gefühl verwandeln
kann, mit dem er, wie Tolstoi sagt, die anderen „ansteckt“ – dies ist das Können eines
Künstlers. Gerade die Kunst ist das mächtigste Mittel zur Einung der Menschen. Sie
hebt den Gegensatz zwischen Gefühl und Gedanke, dem Intuitiven und Diskursiven,
dem Einzelnen und Allgemeinen auf. Sie steckt Menschen mit Gefühlen an, die die
Lehre über das Leben vermitteln. Und sie tut dies ohne Argumente und ohne Gewalt –
wie eine Krankheit, die von einem kranken Organismus nicht unterschieden und doch
auf einen anderen Organismus übertragen werden kann.
Dennoch kann die Kunst, genauso wie die Religion, selbst zum Mittel des Betrugs
bzw. zur Fälschung werden. Mit seiner Unterscheidung der „wahren“ und „falschen“
bzw. der „guten“ und „schlechten“ Kunst wollte Tolstoi, der, für das russische
Publikum schockierend, fast die ganze europäische Kunst samt seinen eigenen Kunstwerken verwarf, die Aufgabe der Kunst neu bestimmen. Sie ist kein bloßes Analogon
zur Moral aus Vernunft, aber auch nicht ihre Rivalin. Sie kann mit ihr zusammen zu
einer Dienerin des Lebens werden. Sie kann auch, ebenso wie die Moral, dem Leben
schaden. Wenn die Kunst zu einem bloßen Betrug wird, so wird sie zu einer lebensbedrohlichen Kraft, die, wie „der Geist des Bösen und des Betrugs“ in Anna Karenina
und die Schauspielerei in Krieg und Frieden, die Menschenwelt in den Abgrund stürzt.
Sie ist jedoch – und hier widerspricht Tolstoi seinem großen Vorgänger Platon, der die
Kunst aus dem Staat verbannen wollte – als mächtigstes Mittel der Menschenkommunikation nicht zu tilgen. Stattdessen soll der Künstler selbst, so Tolstois Aufgabe
am Ende seines Lebens, vom Betrug des Bösen, von allen Kunst- und Glaubenskanons, befreit werden. Der herrschenden Lehre der Mehrheit darf niemals Vertrauen
geschenkt werden. Denn wie sie Gehorsam gegenüber der für den Einzelnen leeren
Forderung der institutionellen Allgemeinheit verlangt, so gebietet sie ihm auch,
seinen Geschmack den für ihn unverständlichen Kunstwerken zu unterwerfen. Das
Gefühl, mit dem der wahre Künstler die anderen ansteckt, ist jedoch einmalig und nur
deshalb wahr. Es ist keine Emotion, kein krankhafter Nervenreiz, auf den die neuesten
Künstler (die Beispiele sind Beethoven und Wagner) mit ihren Kunstwerken zielen. Es
ist aber auch keine bloße Belehrung, keine abstrakt-logische Idee, sondern „die
Philosophie in einem persönlichen Sinne“, die als Wahrheit des eigenen Lebens, als
einzigartiger Bezug des Endlichen auf die Unendlichkeit von dem Künstler selbst
„wahrhaftig“ geglaubt wird und die nur deshalb auch den anderen glaubwürdig
vorkommt. Ein solcher Glaube vereinigt den Schauspieler und den Zuschauer, den
Schriftsteller und seinen Leser auf besondere Weise: Diese Vereinigung ist gerade das
Mittel, den Einzelnen aus der „Verkettung“ des Bösen, aus der Gewalt der „mächtigen
328
Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst
Mehrheit“ zu befreien. Die wahre Kunst, wie Tolstoi sie versteht, ist kein Mittel für ein
Bündnis, das gegen andere Bündnisse geschlossen wird, sondern das Gegenteil von
jedem Bündnis. Sie widersetzt sich der Macht der Allgemeinheit, indem sie die Wahrheit vermittelt, die nur eine persönliche Wahrheit, nur die von einem Menschen
gelebte Wahrheit sein kann. Sie schenkt Freiheit, die die Freiheit eines Künstlers ist,
der den von ihm gefundenen Sinn des Lebens lehren will, obwohl er genau weiß, dass
dies nur ein Sinn auf Zeit sein kann, d. h. nur „die Philosophie in einem persönlichen
Sinne“, mit der er das Unbegreifliche, das Flüssige des Lebens in einen Ausdruck der
Vernunft verwandelt.
Kapitel 4.
Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Dostojewskis philosophische Stärke hat sich durch die enorme Wirkung seiner Ideen
gezeigt, und dies nicht nur in Russland. Nur wenige Jahre nach den russischen
Veröffentlichungen erschienen Übersetzungen seiner Werke, zunächst überwiegend
französische und deutsche. Die Eigenartigkeit seiner Romanwelten und die Kühnheit
im Ausdruck seiner Ideen wirkten beeindruckend und gleichzeitig befremdend. Durch
Dostojewski wird Russland neu gesehen, als eine fremde Welt, in der extreme Leidenschaften toben und die wichtigsten Fragen des Lebens, die der Schriftsteller selbst
„verfluchte Fragen“ genannt hat, radikale Lösungen finden.1 Um einen anderen Ausdruck Dostojewskis zu verwenden, es war ein „neues Wort“, das Russland durch ihn
vor Europa aussprach, das aber noch lange nicht verstanden werden konnte. Wie kein
anderer fühlte Dostojewski, der zu einem der populärsten Schriftsteller Europas
werden sollte, wie fremd Russland Europa war. Im Jahr 1877 machte er in seinem
Tagebuch eines Schriftstellers die folgende Bemerkung in Klammern:
Doch leider wissen wir, daß, wieviel wir auch reden und vorweisen wollten, Europa unsere
Schriftsteller noch lange nicht lesen wird, oder selbst wenn man es dort täte, so würde man uns
doch lange nicht verstehen und nicht schätzen. Und die Europäer sind ja auch noch gar nicht
imstande, uns zu verstehen, nicht etwa aus Mangel an Geist, sondern weil wir für sie eine ganz
andere Welt sind, als wären wir vom Monde auf die Erde versetzt, weshalb sie sogar die Tatsache,
daß wir doch immerhin existieren, gar nicht zugeben möchten.2
Diese Einschätzung wird nur zehn Jahre vor Nietzsches Entdeckung der Russen
geäußert, die er gerade seiner Dostojewski-Lektüre verdankte. Und aufgrund dieser
Lektüre, der wir uns im letzten Kapitel widmen werden, meldet sich eine Frage: Hat
das extrem Exotische an Dostojewskis Schriften bei seinen europäischen Lesern bloß
eine Mischung von Abneigung und Neugier geweckt, oder aber wurde seine besondere Perspektive auf grundlegende philosophische Fragen, so neu und fremd wie sie
war, tatsächlich mit in die Diskussion aufgenommen? Für Nietzsche beispielsweise
1 In Russland hat man Dostojewski dagegen oftmals vorgeworfen, er zeige kein „wirkliches Leben“,
sondern irreale Extreme. Dostojewski wies diesen Vorwurf seiner Kritiker mit Nachdruck zurück. Vgl.
den Brief an Konstantin Pobedonostsew vom 19. Mai 1879 (DGA 30 (Teil I), S. 66). Für ihn war eher
Tolstoi ein Schriftsteller, der das Leben der Ausnahmen schilderte, auch wenn er selbst überzeugt war,
das Leben der Mehrheit darzustellen. Vgl. einen Auszug aus Dostojewskis Notizheft: В.А. Богданов
(Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве (Dostojewski über die Kunst), S. 450.
2 Fjodor M. Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers. Notierte Gedanken, S. 395 f. Vgl. auch S. 232.
Diese Publikation enthält eine Auswahl von den Texten, die Dostojewski von 1873 bis 1881 unter dem
Titel Tagebuch eines Schriftstellers publizierte. Die Texte, die in dieser Publikation dagegen nicht
vorkommen, werden in meiner Übersetzung nach der Dostojewski-Standardausgabe zitiert (s. dazu die
Einleitung).
330
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
wäre beides richtig. In dieser „seltsamen und kranken Welt“3 hat er für sich etwas
Neues entdeckt, eine fremde Logik und fremde Plausibilitäten, die dennoch erlaubten, gerade das in Frage zu stellen, was vielleicht seit Sokrates nicht in Frage gestellt
wurde.
Unter den Dostojewski-Biographen ist die Meinung sehr verbreitet, dass es Dostojewski an Bildung, insbesondere an der philosophischen Bildung, fehlte. Dem widerspricht z. B. Semjonow-Tjan-Schanski, der Dostojewski nicht nur als „belesenen,
sondern auch als einen gut ausgebildeten Menschen“ kannte. Er habe „eine ausgezeichnete Vorbildung“ schon von seinem Vater, einem Militärmediziner, bekommen und beherrschte Französisch und Deutsch, im Mündlichen nicht perfekt (obwohl
er sich sehr wohl verständlich machen konnte), doch „genug, um den genauen Sinn
eines schriftlichen Textes zu verstehen“.4 Nachdem Dostojewski zu Hause eine Bildung genoss, die viel Lektüre – von antiken Autoren bis zu zeitgenössischer Literatur – einschloss, trat er in die Bauhochschule ein, an der er höhere Mathematik und
Physik gründlich studierte. Diese profunden, professionellen Kenntnisse werden für
ihn als Schriftsteller und Denker später eine besondere Rolle spielen. Es war zwar eine
spezielle, jedoch eine viel systematischere Ausbildung als die von Tolstoi, der gar
nicht danach strebte, sein Universitätsstudium ordentlich abzuschließen. Auch in
seiner Kenntnis der schöngeistigen Literatur war Tolstoi ihm kaum überlegen. Nicht
nur russische und europäische Belletristen, sondern auch Historiker, wie Karamzin,
Tiere, Minieu oder Lui Blanc, gehörten zur Lieblingslektüre vom jungen Dostojewski.
Besonders viel bedeutete ihm theatralische Kunst, Schiller und Shakespeare müssen
dabei besonders hervorgehoben werden. Seine ersten schriftstellerischen Versuche
waren für die Theaterbühne.5
Was die Philosophie anbetrifft, so war seine philosophische Lektüre tatsächlich
eher unsystematisch und einseitig. In seiner Jugend haben ihn Saint-Simon und
Fourier sehr beeinflusst sowie Cours de philosophie positive von Auguste Comte.
Dieses Interesse führte ihn im Jahr 1847 (als Schriftsteller ist er zu dieser Zeit durch
seine ersten Probewerke gerade in engen Kreisen bekannt geworden) zu einer revolutionären Geheimorganisation, dem sog. Petraschewski-Kreis (петрашевцы) – ein
Schritt, der beinahe zu einem tragischen Ende führte, das die Welt um einen ihrer
größten Schriftsteller beraubt hätte. Als die Petraschewski-Gruppe vom Geheimdienst
entdeckt wurde, enthüllte dieser eine revolutionäre Verschwörung gegen den Zaren,
an der Dostojewski höchstwahrscheinlich nicht beteiligt war. Ihm wurde v. a. die
Verbreitung eines Briefes des Literaturkritikers Wissarion Belinski vorgeworfen, der
für seine sozialistisch-revolutionären Ansichten bekannt gewesen ist und dessen
3 Dies ist Nietzsches Ausdruck, mit dem er die Welt von Dostojewskis Romanen im Vergleich zu der
der Evangelien beschreibt (AC 31, KSA 6, S. 201). Dies wird im fünften Kapitel ausgeführt.
4 П.П. Семенов-Тянь-Шанский (P.P. Semjonow-Tjan-Schanski), Образование Достоевского (Dostojewskis Bildung), S. 506 ff.
5 S. dazu die Verfass., Поэтика драмы и эстетика театра в романе, S. 257–273.
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
331
Rolle in Dostojewskis Schicksal kaum zu überschätzen ist. Nach Verhören wurde
Dostojewski zusammen mit den anderen „Petraschewtsi“ zum Tode verurteilt, aber in
letzter Minute (unmittelbar vor dem Schafott) begnadigt und zu vier Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt. Diese vier Jahre (1850–1854) härtesten Lebens unter Ausgestoßenen sowie die erschütternde Erfahrung der Nähe des Todes haben nicht nur
seine Ansichten, sondern auch seinen Weg als Schriftsteller verändert. Aufzeichnungen aus einem Totenhaus war das erste Werk, mit dem Dostojewski neu in die Literatur
eintrat, das Werk, von dem Nietzsche später so sehr fasziniert war.6 Es waren neue
philosophische Horizonte, die sich Dostojewski eröffneten.
Doch war Dostojewski mit seinen philosophischen Kenntnissen denen von Tolstoi
tatsächlich unterlegen. Höchstwahrscheinlich hat er weder Kant noch Spinoza oder
Nietzsche gelesen.7 Auch wenn Dostojewski schon berühmt geworden war, war er
nicht in der Lage, seine Bildung zu erweitern, wie es Tolstoi das ganze Leben lang tat.
Er konnte sich nicht fünfzehn Jahre auf einen Aufsatz vorbereiten wie Tolstoi, der alle
ihm zugänglichen ästhetischen Theorien studierte, um Was ist Kunst? zu schreiben,
oder Griechisch lernte, um das Evangelium besser zu verstehen. Wenn es Tolstois
größtes Problem war, seinen Besitz loszuwerden, stand Dostojewski immer unter dem
Druck seiner Kreditoren, die ihm mit dem Schuldengefängnis drohten.8 Seine Hauptwerke wurden unter äußerstem Zeitdruck geschrieben. Meistens war ihre Veröffentlichung schon im Gange, obwohl er immer noch nicht wusste, wie es mit dem Sujet
weitergehen sollte. Vieles in seinen Werken war deswegen für ihn selbst nicht befriedigend. Oftmals drückt er in seinen Briefen die Angst aus, seine Ideen verschwenderisch, d. h. unreif und deshalb nicht überzeugend genug, dargestellt zu haben.
Auch seine spätere Philosophie entwickelte sich, wie mehrere Exzerpte und Entwürfe
zeigen, nicht aus neuen Kenntnissen, sondern aus ihrer inneren Logik und aus
Erfahrungen, die den jungen Dostojewski mit sozialistischem Gedankengut in Berüh6 Seine ersten Werke, wie Бедные люди (Arme Leute) (1845), waren als Ausdruck der sozialen
Tendenzen in der schönen Literatur von den russischen Sozialisten, die meistens der liberal-atheistischen Weltanschauung anhingen, begeistert angenommen worden, v. a. von dem schon erwähnten
Wissarion Belinski, der als Literaturkritiker und Sprachrohr dieses Lagers enorme Autorität genoss.
Später wird Dostojewski selbst sein Treffen mit Belinski als wichtigsten Moment seines Lebens
beschreiben. Aber schon mit dem nächsten Werk Двойник (Der Doppelgänger) (1846) hat er seine
sozialistisch-atheistisch geprägten Freunde sehr enttäuscht.
7 In einem Brief an seinen Bruder aus dem Jahr 1854 bat Dostojewski ihn um Zusendung der Kritik der
reinen Vernunft und „unbedingt Hegel, insbesondere Hegels Philosophiegeschichte“. Er fügte vielsagend hinzu: „Meine Zukunft ist davon abhängig!“ (DGA 28, S. 173) Ob er jedoch diese Bücher erhalten
hat, ist zweifelhaft. S. dazu DGA 28, S. 184; 455; 460. Vgl. die Meinung von einem Zeitgenossen
Dostojewskis, dem berühmten russischen Dichter Afanasi Fet, dass es Dostojewski trotz seiner Scharfsinnigkeit und Beobachtungsgabe an Kenntnis von Platon, Kant und Schopenhauer genauso fehlte wie
einem Mathematiker, der Euklids, Pythagoras’ und Newtons Fragen und Antworten nie gekannt haben würde (Афанасий А. Шенин (Фет), Письмо к Л.Н. Толстому от 16 марта 1877 г. (Brief an
L.N. Tolstoi vom 16. März 1877), S. 223.
8 Vgl. z. B. den Brief an Wrangel vom 18. Februar 1866 (DGA 28 (Teil II), S. 150).
332
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
rung gebracht hatten. Dennoch, trotz des Mangels an Kenntnissen, war der Schriftsteller erstaunlich empfindlich gegen die gängigen Ideen seiner Zeit. Wie kein anderer
hat er seine Zeit erlebt als „so sehr instabil, als Übergangs- und Wendezeit, die so
reich an Wechseln ist und kaum für jemanden befriedigend sein kann“ (DGA 25,
S. 127), aber auch als „die Zeit des Glaubens“.9 An diese Epoche, die Epoche der
Umwandlungen und des Nihilismus, aber auch die des Glaubens, hat er seine Antwort
gerichtet, die Antwort, die in ihrer dialektischen Stärke nicht nur dem Denken Tolstois, sondern auch dem Kants und Nietzsches kaum nachsteht.
Was in dieser kurzen Einleitung nicht unerwähnt gelassen werden darf, ist die
Form, die seine Ideen annahmen, und die daraus resultierenden Schwierigkeiten für
philosophische Interpretationen. Dostojewski hat sich nicht, zumindest viel weniger
als Tolstoi, direkt als Philosoph geäußert. Er hat keinen definitiven Anspruch erhoben, eine eigene Philosophie oder ein eigenes Verständnis der Religion darzulegen.
Als Publizist und Kämpfer für bestimmte Ideen trat er in der Zeitschrift seines Bruders
Эпоха (Epoche) (1861–1866) und seinem Tagebuch eines Schriftstellers (1873–1881)
hervor.10 Und hier liegt gerade die Schwierigkeit. Seine neuen Ansichten als die eines
patriotischen Staatsbürgers und orthodoxen Christen äußert er in dieser publizistischen Form häufiger, wenn nicht in direkten Widersprüchen, so doch wesentlich
anders als in seinen Romanen. Zum Teil erstaunlich flache Slawophilie, bis zum
Chauvinismus und Antisemitismus zugespitzter Patriotismus, leidenschaftliche und
häufig ungerechte Verspottung der Gegner im Tagebuch eines Schriftstellers zeigen
einen sonderbaren Kontrast zu der Tiefe und Vielseitigkeit der verwandten Gedanken,
die von seinen Romanfiguren vertreten werden. Die Tendenz der Forschungsliteratur,
die im Tagebuch geäußerte Position als Dostojewskis ‚eigentliche‘ Philosophie zu
deuten, ist verständlich. Jedoch wird im Weiteren ein Versuch unternommen, gerade
dieser Tendenz entschiedenen Widerstand zu leisten.
Die Widersprüche zwischen dem Tagebuch und den anderen Werken sind durchaus bemerkenswert. Einer der wichtigsten unter ihnen betrifft den bedeutsamen
Punkt dieser Arbeit. Es geht um die Beschreibung der Gewissenlosigkeit der Verbrecher, die Nietzsche als psychologische Wahrheit bei Dostojewski so sehr faszinierte. In Aufzeichnungen aus einem Totenhaus wird es so beschrieben:
Ich kannte unter ihnen Mörder, die immer heiter und niemals nachdenklich waren, und man
hätte wetten können, daß ihr Gewissen ihnen noch keinen einzigen Vorwurf gemacht hatte.
[…] ganz als ob die Benennung ‚Sträfling‘ tatsächlich ein Rang und Titel gewesen wäre,
womöglich noch ein besonderer Ehrentitel. Kein einziges Anzeichen von Scham und Reue!
9 Федор М. Достоевский (Fjodor M. Dostojewski), Ряд статей о русской литературе (Aufsätze
über die russische Literatur), S. 83.
10 Das Tagebuch wurde als Zeitschrift monatlich herausgegeben. Dostojewski war ihr einziger Autor
und Herausgeber. Zwischen 1873 und 1874 war Dostojewski auch Redakteur der konservativen Zeitschrift Гражданин (Staatsbürger).
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
333
[…] denn es ist kaum anzunehmen, daß auch nur einer von ihnen sich seine Schuld innerlich
eingestand.11
Dagegen wird im Tagebuch eines Schriftstellers die innere Welt eines Verbrechers ganz
anders dargestellt:
Ich war im Zuchthaus und habe viele Verbrecher gesehen. Wie gesagt, das war eine lange
Lehrzeit. Keiner von ihnen hatte aufgehört, sich für einen Verbrecher zu halten. Dem Aussehen
nach waren es schreckliche und grausame Menschen. […] Es gab aber wohl keinen einzigen unter
ihnen, kann ich versichern, dem ein langer seelischer Schmerz im Innern erspart geblieben wäre,
ein läuternder und den Menschen innerlich festigender Schmerz. […] oh, glauben Sie mir, nicht
einer von ihnen hat sich in seiner Seele für schuldlos gehalten!12
Solche Widersprüche sind zahlreich und deswegen kaum zufällig. Dostojewski wollte
sie offensichtlich nicht beseitigen. Wie der größte Dichter Russlands es einmal zum
Ausdruck brachte:
Ließ sehr viel Widersprüche stehen,
Zu ändern fand ich nicht Geduld.
So zahl ich der Zensur die Schuld
Und geb den Kritikern zum Gaffen
Die neuste Arbeit meiner Hand:
Verzieh dich denn zum Newastrand
Du Versgebilde, neuerschaffen,
Und wirb mir dort des Ruhms Tribut:
Missdeutung, Schimpf und Lärm und Wut!13
Diesen zweifelhaften Tribut des Ruhmes eines Schriftstellers hat Dostojewski seinem
Lieblingsdichter folgend auch für sich beansprucht. Seit Puschkin durfte sich ein
Schriftsteller widersprechen, er sollte es sogar, um der Wahrheit des Lebens treu zu
bleiben, weil das Leben voller Widersprüche ist.14
In der Einleitung habe ich die beiden russischen Romanciers Künstler-Philosophen genannt. Das war die Philosophie der Denker, die sich als Künstler verstanden
haben. Die tiefsten und teuersten Gedanken von Dostojewski ziehen so von seinem
Tagebuch und seinen Briefen in seine Romane ein. Sie verwandeln sich dabei in eine
merkwürdige Mischung aus tiefstem Ernst der „verfluchten Fragen“ des Lebens einer-
11 Fjodor M. Dostojewski, Aufzeichnungen aus einem Totenhaus und drei Erzählungen, S. 21, 25.
12 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 35 f.
13 Alexander Puschkin, Eugen Onegin, S. 37.
14 S. dazu Юрий М. Лотман (Juri M. Lotman), Роман А.С. Пушкина „Евгений Онегин“.
Комментарий (Roman von A.S. Puschkin „Eugen Onegin“. Ein Kommentar), S. 117, 174; Юрий
М. Лотман (Juri M. Lotman), Роман в стихах А.С. Пушкина „Евгений Онегин“. (Roman in Versen von
A.S. Puschkin „Eugen Onegin“, S. 24 ff.)
334
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
seits und komisch-leichtsinniger, frevelhafter Parodie andererseits. So sprach Dostojewski in seinen Notizheften mit größtem Ernst vom „Schmelzofen der Zweifel“, durch
welchen sein „Hosianna ging“, mit einem Hinweis auf den Teufel aus seinem Roman,
dessen „Hosianna“ eine Parodie dieses Ernstes darstellte.15 So sprach der „freiwillige
Narr“ Lebedjew seine Lieblingsideen aus dem Tagebuch aus und der wahnsinnige
Kirillow stimmte mit dem kranken Myschkin in den Punkten überein, mit denen
Dostojewski selbst seine größten Hoffnungen verbunden hat. Dostojewski war offensichtlich geneigt, seine Ideen von verschiedenen, u. a. herabwürdigenden Blickwinkeln aus zu betrachten. Gerade an dieser Art der Darstellung ernsthafter Themen stieß
sich Tolstoi. Sie war ihm ebenso zuwider wie die von Shakespeare.16 So z. B. seine
Einschätzung von Dostojewskis Brüder Karamasow, eines Romans, den er trotz alledem hoch geschätzt hat:
[…] das weitschweifige und wenig komische Gewitzel stört. Die Gespräche sind unmöglich, völlig
unnatürlich. (TGA 58, S. 117)17
Zur Frage über das Natürliche in jenem Roman und inwiefern Dostojewski sie im
Unterschied zu Tolstoi interpretierte, werden wir später zurückkommen. Dass das
Tragische in seinen Romanen mit den Elementen der Komödie vermischt wird, ist
nicht zu bestreiten. Es gibt praktisch keine einzige Idee, die Dostojewski selbst am
Herzen läge, die dieser Art der Parodierung und Herabsetzung entginge. Alles, was
ihm selbst heilig war, wollte er als Schriftsteller in ein Lachen erregendes Karikaturbild umwandeln. Aufgrund dieser Tatsache allein lassen sich die Ideen aus dem
Tagebuch nicht ohne weiteres als Dostojewskis eigentliche Philosophie verstehen.
Dostojewskis Tagebuch ist das Tagebuch eines Schriftstellers, und der Schriftsteller als
15 Богданов (Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве, S. 465 f. Vgl. im Roman: „Ohne Kritik gäbe es
nur das Hosianna. Aber für das Leben ist das Hosianna zu wenig, das Hosianna muß durch den
Schmelzofen der Zweifel gehen…“ (Fjodor Dostojewski, Die Brüder Karamasow. Roman in vier Teilen
mit einem Epilog, Bd. 2, S. 495)
16 Vgl. „Ich habe angefangen zu lesen, kann aber die Abstoßung wegen des Antikünstlerischen,
Leichtsinnigen und Unangemessenen im Behandeln der wichtigen Themen nicht überwinden.“ (TGA
89, S. 229) In der Einschätzung von Shakespeares dramatischer Technik waren sich Tolstoi und
Dostojewski jedoch einig. Auch Dostojewski, obwohl begeisterter Verehrer Shakespeares, hielt die
Nachlässigkeit in Shakespeares Sprache für einen großen Nachteil („so viel ungeheure Geschmacklosigkeiten“) (Fjodor M. Dostojewski, Gesammelte Briefe. 1833–1881, S. 144). Der andere Künstler, dem
die beiden russischen Schriftsteller ästhetischen Wert abgesprochen haben, war Richard Wagner. Vgl.
den Ausdruck aus Dostojewskis Notizheft: „die langweiligste deutsche Kanaille trotz seines ganzen
Ruhms“ (Богданов (Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве, S. 438).
17 Im Jahr 1883 sagte Tolstoi, er könne den Roman nicht zu Ende lesen (Николай Н. Гусев (Nikolai
Gusew), Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого (Chronik von Tolstois Schaffen), Bd. 1, S. 561).
Später jedoch gefällt ihm der Roman sehr, besonders die Kapitel zu Starets Sossima (TGA 84, 167). Zu
Tolstois Auswertung von Die Brüder Karamasow s. Константин Н. Ломунов (Konstantin N. Lomunow)
(Hg.), Л. Толстой об искусстве и литературе (L. Tolstoi über die Kunst und Literatur.), Bd. 2, S. 181 ff.
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
335
solcher kann seine Ideen nicht direkt und unmittelbar aussprechen, sondern nur
mittelbar, durch handelnde Personen und durch das Ganze seiner Kunstwerke. Seine
Stimme und sein Ernst, wenn sie auch direkt an den Leser gerichtet zu sein scheinen,
sind literarische Konstrukte. Tolstoi, der sich direkt aussprechen wollte, verzichtete
auf sein literarisches Werk. Und die Tagebücher, die er schrieb, waren weder zur
Veröffentlichung noch für fremde Augen bestimmt. Als Prediger bleibt Tolstoi zwar
immer noch Künstler, jedoch ein Künstler, der eine Lehre über das Leben lehrt, der
seine schöpferische Kraft in den Dienst dieser Lehre stellt. Dostojewski tut nichts
dergleichen. Er bleibt Schriftsteller, sogar wenn er sich mit seinem Tagebuch ans
Publikum wendet. Seine Aussagen dürfen dementsprechend nicht bloß als Predigt
eigener Ansichten behandelt werden.
Dennoch darf auch die umgekehrte Gefahr nicht außer Acht gelassen werden.
Man darf nämlich auch die Ideen, die in den Romanen ausgesprochen werden, nicht
als Dostojewskis eigentliche Philosophie betrachten. Schon deshalb nicht, weil sie
vielfältig sind und weil sie einander widersprechen. Jedem Gedanken steht ein Gegengedanke gegenüber, jede These stößt auf eine Gegenthese. Zwar hat Dostojewski
selbst oftmals betont, dass es seine Ideen sind, nicht seine Werke, die er für wichtig
hält,18 doch vertritt er definitiv nicht die Ideen seiner Protagonisten. Nicht, um einen
Gedanken in einem Roman wie ein Bild in einem schönen Rahmen zu präsentieren,
hat er seine Romanfiguren, seine Helden, erdacht, die von den Ideen besessen sind
und an ihnen zugrunde gehen. Vielmehr wird das Ganze des Romans zur Widerlegung
der Argumentationen der Romanfiguren, zur Antwort auf die von ihnen kommende
Herausforderung.19 Die Romane Dostojewskis, indem sie vielfältige Optionen demonstrieren, die dem Schriftsteller für die Darstellung eines Gedankens zur Verfügung stehen, geben reiches Material zum Nachdenken. Seine Gedanken sind, wie
die ästhetischen Ideen im Sinne Kants, mit bestimmten Begriffen nicht zu fassen. Sie
können nicht logisch in „Punkte“ zergliedert, sondern nur indirekt in einem „Kunstbild“ angedeutet werden.20 Einen Gedanken, der im Roman ausgesprochen wird, als
18 Vgl. den Brief an Nikolai Strachow vom 10. März 1869: „Ich stehe nicht hinter dem Roman, sondern
hinter der Idee.“ (Dostojewski, Gesammelte Briefe, S. 303)
19 Vgl. in Dostojewskis Notizheft: „Die Kanaillen verspotteten mich wegen meines unaufgeklärten und
rückständigen Glaubens an Gott. Diese Dumpfköpfe haben von solcher Kraft der Gottesverneinung
noch gar nicht geträumt, wie sie in meinem Inquisitor und in den vorhergehenden Kapiteln dargelegt
wurde, auf welche Verneinung hin die Antwort durch den ganzen Roman gegeben wird.“ (Богданов
(Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве, S. 462)
20 Vgl. den Brief vom 5. September 1879 an Konstantin P. Pobedonostsew, den Oberprokurator der Hl.
Synode und Zensor von Die Brüder Karamasow, der für seine ultra-orthodoxen, staatlich-zentralistischen und antiwestlichen Ansichten bekannt war (eine Art ‚graue Eminenz‘ des russischen Hofes):
„Ihre Meinung über den Anfang von Karamasow ist für mich sehr schmeichelhaft. […] Denn die
Antwort auf diese negierende Seite soll in dem sechsten Kapitel Ein russischer Mönch kommen, das
wird am 31. August erscheinen. Und deshalb habe ich Angst um das Kapitel, in dem Sinn, ob es eine
hinreichende Antwort sein wird. Besonders weil die Antwort nicht direkt gegeben wird, nicht auf die
336
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Dostojewskis eigene Philosophie zu verstehen, wäre also aus zweierlei Gründen
falsch. Erstens, weil sie immer nur durch Selektion und Abkürzung zu gewinnen
wäre – durch Weglassen der begleitenden Gegenargumente und Widersprüche (Widersprüche zwischen dem Tagebuch und den Romanen eingeschlossen); zweitens,
weil seine eigene Idee als die eines Schriftstellers sich auf einer anderen Ebene
bewegt: auf der Ebene dieses widersprüchlichen Ganzen. Sie ist damit nicht bloß eine
ästhetische, sondern auch eine dialektische Idee, sie ist beides zugleich: Ihre Dialektik kann nur ästhetisch, wiederum nur in einem „Kunstbild“ erfasst werden. Auch
in dem Tagebuch eines Schriftstellers könnten solche Ideen geäußert worden sein.
Hier ergibt sich eine weitere Schwierigkeit. Dostojewskis ästhetische Idee, die nur
durch ein Bild vermittelt werden kann, die zugleich ästhetisch und dialektisch ist,
muss in diesem Kapitel einer philosophischen Interpretation unterworfen werden.
Dies kann nur dann legitim sein, wenn es gelingt, sie nicht bloß als einen in Begriffen
aufgefassten Gedanken, sondern als gewisse Strategie des Künstlers darzustellen:
Letztere ist keine einfache Summe oder ein Extrakt aus den vielfältigen Ideologien,
die Dostojewskis Romanfiguren bzw. er selbst in seinem Tagebuch vertritt, sondern
sein besonderer Umgang mit ihnen, der ihm gerade als Schriftsteller eigen ist. Diese
Strategie, als Dostojewskis Beitrag zur europäischen Philosophie, verdient eine ernsthafte philosophische Interpretation.
Dostojewskis originelle Form der philosophischen Schriftstellerei wurde von
Michail Bachtin als literarische Polyphonie – als Mehrstimmigkeit – bezeichnet.21 Bis
heute ist in der russischsprachigen Forschungsliteratur die Meinung verbreitet, Nietzsche könne nur eine weitere Stimme in Dostojewskis polyphoner Welt beanspruchen – als ob er selbst bloß eine handelnde Person Dostojewskis wäre.22 Diese
Meinung hat gewisse Gründe. Nietzsche selbst hat mit seiner Begeisterung angesichts
bestimmter Ideen von Kirillow, Schatow und Werchowenski Material dazu geliefert.
Dennoch, nicht nur Nietzsche, sondern auch Tolstoi23 sowie, was noch merkwürdiger
zu sein scheint, Christus und, noch bemerkenswerter, Dostojewski selbst mit seinem
Tagebuch sind solche „handelnden Personen“, sie könnten alle seine Romanfiguren
sein. Diese Art eines dramatischen Zusammenstoßes mehrerer Figuren als Dostojewskis Strategie hat Nietzsche gerade gespürt, indem er uns die rätselhafte Überschrift in seinen Exzerpten aus Die Dämonen hinterlassen hat: „Theatromanie“. Was
Punkte, die früher angesprochen wurden (in dem Großinquisitor und vorher), sondern nur noch
indirekt. Hier soll etwas Gegenteiliges zu der vorher dargelegten Weltanschauung erscheinen, aber
wiederum nicht thesenhaft, sondern sozusagen in einem Kunstbild.“ (DGA 30 (Teil I), S. 121 f.)
21 S. Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Проблемы поэтики Достоевского (Probleme von
Dostojewskis Poetik).
22 Es handelt sich dabei selbstverständlich bloß um ein Gedankenexperiment: Höchstwahrscheinlich
war Dostojewski der Name Nietzsches unbekannt.
23 Es ist kein Zufall, dass gerade Myschkin Lew Nikoljewitsch heißt. Davon wird noch im fünften
Kapitel die Rede sein.
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
337
diese Theatromanie für den russischen Schriftsteller auch bedeuten mochte, ihre
Rolle ist für eine philosophische Interpretation seines Denkens insbesondere im
Zusammenhang mit Nietzsche von großer Bedeutung.24
Dostojewski stellte in vielen Hinsichten, als Schriftsteller und Denker, das Gegenteil zu Tolstoi dar, so dass die beiden literarischen und moralischen Autoritäten
häufig als Antipoden betrachtet wurden, wobei keiner dem anderen in etwas nachsteht.25 Ihre literarischen, religiösen und politischen Einsichten waren tatsächlich
größtenteils verschieden. Dostojewski liebte z. B. leidenschaftlich Shakespeare und
die deutschen Romantiker, besonders Friedrich Schiller. Er hat sich immer und nachdrücklich zur russischen Orthodoxie bekannt. Im Unterschied zu Tolstoi, der jede
Äußerung des Nationalstolzes als schädliche Beschränkung und sündhaften Hochmut ansah, war Dostojewski um die Rolle Russlands in der internationalen Politik
sehr besorgt und hat seine Außenpolitik ausdrücklich unterstützt. Als Publizist sprach
Dostojewski viel und leidenschaftlich über die zukünftige Rolle Russlands als politische Macht in der Welt. Der Hass und die bis zum Ekel gesteigerte Verachtung, die er
in Europa gegen Russland sah, waren für ihn ein tragisches und vorübergehendes
Missverständnis. Das Misstrauen gegen das „barbarische Land“ deutete er als Angst
gegen das „ungehörte Wort“ Russlands,26 als Ressentiment der alten und veralteten
Welt gegen die neue, junge Macht, die geistige Selbständigkeit anstrebte, um dann
neue Erscheinungen von „Genies, Führer der Menschheit von der Bedeutung eines
Aristoteles, Bacon, Kant hervorzubringen“.27 Die Neuartigkeit dieses „Wortes“, dieser
russischen „Idee“ habe sich schon teilweise durch das Genie Puschkins und Gogols
gezeigt. Und im Vergleich mit Puschkin könne Tolstoi nur als brillanter Schriftsteller
zweiten Ranges angesehen werden. Diese Einschätzung kommt nach Krieg und Frieden, aber vor Anna Karenina.28 Nach Anna Karenina ändert Dostojewski seine Meinung über Tolstoi: Zwar ist Puschkin auch jetzt als direkte Quelle Tolstois zu sehen,29
24 Diese Überschrift wird im nächsten Kapitel interpretiert. Dort wird auch Nietzsches Versuch näher
betrachtet, Jesus so zu verstehen, als ob er eine Figur aus einem Roman Dostojewskis wäre.
25 Diese Entgegensetzung fängt mit dem im vorigen Kapitel zitierten Buch von Dmitri Merezhkowski
(Мережковский, Л. Толстой и Достоевский) an. Auch spätere Forschung knüpft an diesen Ausgangspunkt immer wieder an. Im großen Dialog über den Nihilismus wird Tolstoi öfters mit Schopenhauer und Dostojewski mit Nietzsche in Verbindung gebracht, wie bspw. bei Juri Dawydow: Юрий
Давыдов, Этика любви и метафизика своеволия (Проблемы нравственной философии) (Die
Ethik der Liebe und die Metaphysik des Eigenwillens (Fragen der Moralphilosophie)). Der Verfasser
argumentiert allerdings gegen die scharfe Entgegensetzung von Tolstoi und Dostojewski (8). Er neigt
vielmehr dazu, die beiden russischen Denker am Ende Nietzsche mit seinem Immoralismus (als bloße
Feindschaft gegen die Moral verstanden) entgegenzusetzen.
26 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 387.
27 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 588.
28 Vgl. den Brief an Nikolai N. Strachow vom 5. April 1870, in: Dostojewski, Gesammelte Briefe, S. 344.
29 Vgl. „‚Anna Karenina‘ ist, was die Idee des Werkes betrifft, gewiß nichts Neues, wenigstens bei uns
nichts Neues. Statt dieses Werkes könnten wir Europa natürlich ebensogut die Quelle selbst nennen,
das heißt Puschkin als den grellsten, stärksten und unwiderlegbarsten Beweis für die Selbständigkeit
338
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
dennoch gibt Dostojewski diesmal zu, dass Tolstois Roman „als Kunstwerk etwas
Vollkommenes“ ist. Er fügt darüber hinaus hinzu, dass es „gerade zur rechten Zeit
erschienen ist“ und ihm „die europäischen Literaturen der Gegenwart nichts Gleichwertiges gegenüberstellen können“. Damit schreibt Dostojewski dem Werk Tolstois
das zu, was er so leidenschaftlich vor Europa verteidigte, nämlich das,
was unsere Besonderheit vor der ganzen europäischen Welt ausmacht, und ist somit unser
nationales ‚neues Wort‘ oder wenigstens der Anfang desselben – ein Wort, das in Europa
niemand zu sagen versteht, dessen aber gerade Europa ungeachtet seines ganzen Stolzes so
dringend bedarf.30
Die Aufgabe, der europäischen Welt das nationale, russische „Wort“ zu verkünden,
war für Dostojewski, so erscheint es in seinem Tagebuch eines Schriftstellers, das Maß,
mit dem er die russische Kultur und ihre höchsten Erscheinungen, wie Puschkin und
Tolstoi, messen wollte. „Neues Wort“ sollte nun erklingen. Aber Tolstoi, zwar „einer
der beliebtesten Schriftsteller für das russische Publikum aller Schattierungen“, der
„das Positiv-Schöne“ zum Ausdruck brachte (DGA 25, S. 27), stellte ihn nicht zufrieden. Seine hohe Einschätzung von Anna Karenina verwandelte sich nach der Veröffentlichung des letzten (philosophischen) Teils in eine scharfe Kritik. Die These des
Nicht-Widerstandes war nicht das, was Dostojewski als nationales „Wort“ Russlands
ansehen wollte. Vielleicht durfte es überhaupt keine These sein.
Der Autor von ‚Anna Karenina‘, ungeachtet seines enormen Talents, ist eines von den russischen
Gemütern, die nur das deutlich sehen können, was direkt vor ihren Augen ist und sich deshalb
immer auf einen Punkt richten. Sie sind offensichtlich nicht im Stande, ihren Hals nach rechts
oder nach links zu drehen, um auch das zu sehen, was sich abseits befindet: Dafür sollten sie sich
vollständig, mit ihrem ganzen Körper umdrehen. Dann werden sie wahrscheinlich gerade das
Gegenteil behaupten, weil sie jedenfalls immer streng aufrichtig sind. (DGA 25, S. 175)
Strenge Aufrichtigkeit war für Dostojewski zwar eine respektable Eigenschaft, jedoch
kein Merkmal der philosophisch-künstlerischen Tiefe, denn sie erlaubte es nicht,
mehr als nur eine Perspektive wahrzunehmen.31 Diese russische Eigenschaft (eines
von den „russischen Gemütern“) hat er in seinen Romanen als Mangel dargestellt und
der Tolstoi zugeschriebenen Unfähigkeit äußerste Vielseitigkeit in der Darstellung
seiner Gedanken entgegengesetzt. Sein eigenes „neues Wort“ durfte nicht direkt aus-
des russischen Genies und sein Anrecht auf die größte universale, allmenschliche und allvereinende
Bedeutung in der Zukunft.“ (Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 395)
30 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 396.
31 Trotzdem hatte Dostojewski großes Interesse daran, Tolstoi persönlich kennen zu lernen. Tolstoi
hat ihn als „privater Mensch“ sehr interessiert. Vgl. den Brief an N.N. Strachow vom 9. Juni 1870 (DGA
29 (Teil I), S. 125 f.). Trotz den Bemühungen von Freunden, besonders Nikolai Strachows, der eine enge
Bekanntschaft mit beiden Schriftstellern genoss und lange Zeit ihr Korrespondent gewesen ist, fand ein
Treffen nicht statt.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
339
gesprochen werden. Jedes Licht brachte Schatten mit sich. Jedes „Hosianna“ sollte
„durch den Schmelzofen der Zweifel“ gehen, und auch danach durfte es nicht ohne
weiteres, ohne Schattierungen und parodierende Burlesken ausgesprochen werden.
Seine große Entdeckung war, dass ein direkt ausgesprochenes „Hosianna“ nur der
Idee selbst schädlich sein kann. Weil „das Leben voll von Komik ist“, und es immer
„abgedroschene Seiten“ in ihm gibt, ist es „erhaben nur im inneren Sinn“.32 Dieser
„innere Sinn“, der ohne Parodie nicht dargestellt werden konnte, ist allein das, was
mit Recht Philosophie eines Künstlers wie Dostojewski genannt werden kann.
Im Folgenden wird, wie auch im vorigen Kapitel, die Philosophie Dostojewskis
auf ihre Plausibilitäten und den Umgang mit ihren Plausibilitäten hin untersucht.33
Im ersten Teil soll, überwiegend anhand des letzten Romans Die Brüder Karamasow,
die Dialektik der von den handelnden Personen vertretenen Ideen dargestellt werden, unter besonderer Berücksichtigung der von Nietzsche gelesenen Werke, v. a. der
Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Die Verwandlung dieser Dialektik in Dostojewskis
originelle Moralphilosophie, besonders seine Behandlung des Problems der Schuld
und der Freiheit, soll im zweiten Abschnitt des Kapitels dargelegt werden. Hier tritt
neben den Brüdern Karamasow der frühere Roman Verbrechen und Strafe in den
Vordergrund. Wie Tolstoi, so hat auch Dostojewski viel über sein Künstlerwerk als
solches reflektiert, ebenso über die Bestimmung der Kunst. Seine Künstler-Methode
wird im dritten und letzten Abschnitt dieses Kapitels mit seiner Deutung der Schönheit als einer erlösenden und zerstörenden Kraft v. a. im Roman Der Idiot konfrontiert.
Wenn Dostojewski die Rolle eines Predigers auf sich nahm, so wies dieser Prediger bei
ihm wiederum auf den Künstler hin. Der letzte Ernst seines Denkens kann somit nur
noch als ihre Auseinandersetzung begriffen werden – als Strategie eines Künstlers,
der zum Prediger wurde und dennoch ein Künstler blieb.
4.1. „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
Revolte gegen Gott und Natur
Die Ideen sind der eigentliche Gegenstand der Kunst Dostojewskis. Sie werden allerdings durch ihre Wirkung auf Menschen dargestellt. Eine den Menschen beherrschende Idee kann zu seinem Schicksal werden und ihn zum Untergang bestimmen.
Im Tagebuch eines Schriftstellers wird diese Wirkung so beschrieben:
32 Brief an Konstantin P. Pobedonostsew vom 5. September 1879 (DGA 30 (Teil I), S. 122).
33 Dabei wird, wie auch in drei vorigen Kapiteln, keine Vollständigkeit in der Darstellung aller
Aspekte von Dostojewskis Philosophie angestrebt. Solche Versuche sind zahlreich, auch in der deutschen Dostojewski-Forschung. S. z. B. Reinhard Lauth, „Ich habe die Wahrheit gesehen“. Die Philosophie
Dostojewskis in systematischer Darstellung.
340
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Bei uns fällt eine Idee plötzlich auf einen Menschen wie ein Riesenstein und drückt ihn halb
nieder. Er krümmt sich unter ihm, kann sich aber nicht befreien. (DGA 23, S. 24)
Die Idee wird darüber hinaus mit mehreren anderen Ideen konfrontiert, die mitunter ihre eigenen Variationen oder ihre Doppelgänger sind. Durch diese Auseinandersetzungen werden sie am Ende alle in ihren absoluten Ansprüchen zurückgewiesen – auch die, die durch den Autor selbst bzw. durch seine Stimme im Roman
vertreten werden. Insofern dürfen Ideen bei Dostojewski nicht isoliert betrachtet
werden.
In diesem Kapitel sollen einige Verflechtungen der Ideen, die Dostojewski als
„verfluchte Fragen“ bezeichnete, dargestellt werden, d. h. nicht bloß die Ideen, sondern ihre Kontroversen. Diese erreichen ihre größte dialektische Kraft in seinem
letzten Roman, Die Brüder Karamasow. Deshalb darf dieser Roman die zentrale Stelle
im ersten Abschnitt beanspruchen. Die indirekte Antwort auf diese Kontroversen
durch das Ganze des Romans zu verstehen, wäre dann der nächste Schritt. Auch der
Kontext dieser Ideen, z. B. im Tagebuch eines Schriftstellers, darf dabei nicht unbeachtet bleiben, ebenso wie die wichtigsten Variationen dieser Ideen in den vorhergehenden Schriften.
In seinem letzten Roman Die Brüder Karamasow kommt Dostojewski zum wichtigsten Punkt seiner Philosophie, zur Darstellung der „höheren Idee“, ohne die
„weder ein Mensch noch eine Nation in der Welt bestehen kann“. Sie ist „nur eine“,
und „die übrigen höheren Lebensideen“ haben „alle ihren Ursprung nur in dieser
einen Idee“: Dies sei die Idee der persönlichen Unsterblichkeit. So wird die These im
Tagebuch eines Schriftstellers ausgesprochen.34 Im Roman vertritt sie Iwan Karamasow in der folgenden Formulierung:
Es gibt keine Tugend, wenn es keine Unsterblichkeit gibt.
[…] demnach brauche man in der Menschheit nur den Glauben an ihre Unsterblichkeit
auszutilgen, und sogleich werde in ihr nicht nur die Liebe versiegen, sondern überhaupt jede
wirkende Kraft, dank der das Leben in gütlicher Gemeinschaft weiterbestehen könnte.35
Ohne den Glauben an die eigene persönliche Unsterblichkeit gäbe es nicht nur keine
Tugend, sondern auch nichts Unmoralisches. „Alles ist erlaubt“ – dies ist die ebenso
berühmte wie auch brisante Formel von Iwan Karamasow.
Diese These („Alles ist erlaubt, wenn es keine Unsterblichkeit gibt“) wird im
Roman weiter ausgeführt, indem jeder von den Brüdern durch den Mord an ihrem
Vater mit ihr konfrontiert wird. Im Tagebuch finden wir eine Variation der These. Es
wird, „ohne zu begründen“, behauptet,
34 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 266 f. (alle Hervorhebungen stammen von Dostojewski – E.P.)
35 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 112 f.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
341
daß die Liebe zur Menschheit sogar vollkommen undenkbar, unverständlich und unmöglich ist
ohne den Glauben an die Unsterblichkeit der Menschenseele.36
An dieser Stelle seines Tagebuchs beschreibt Dostojewski einige immer häufiger vorkommende Fälle, in denen ganz junge Menschen ohne äußerliche Gründe ihr Leben
abgebrochen haben. Er nennt sie „Selbstmörder aus Langeweile“37 und „logische[ ]
Selbstmörder“.38 In der bemerkenswerten Schrift Ein Todesurteil, die als Bestandteil
des Tagebuchs veröffentlicht wurde, wird die Logik von einem dieser Selbstmörder
rekonstruiert als Logik „eines Materialisten“, der nicht leben kann, weil er keine
Gründe dafür findet. Hier ist ein Auszug, der u. a. seinen Willen zeigt, die letzten
Konsequenzen aus dem Glaubensverlust zu ziehen und vor den Schlussfolgerungen
nicht zu zögern, selbst wenn sie Selbstmord bedeuten:
Man wird vielleicht einwenden, daß man sein Nest auch auf vernünftigen, wissenschaftlichen
einwandfreien sozialen Prinzipien aufbauen könne […]. Möglich, aber ich frage: Wozu? Wozu
erwerben und bauen und sich soviel Mühe geben, um sich in der Gesellschaft der Menschen
richtig, um sich vernünftig und sittlich, kurz – gerecht einzurichten? Darauf vermag mir natürlich
niemand eine Antwort zu geben. Alles, was man mir darauf wohl antworten könnte, wäre: ‚um
sich Genuß zu verschaffen‘. Ja, wenn ich eine Blume oder eine Kuh wäre, dann gäbe es für mich
vielleicht auch einen Genuß. Indem ich mir aber, wie jetzt, unaufhörlich Fragen [meine Hervorhebung – E.P.] vorlege, kann ich nicht glücklich sein, nicht einmal im höchsten und unmittelbarsten Glück der Liebe zum Nächsten und der Liebe der Menschheit zu mir, denn ich weiß, daß
morgen schon dies alles nicht mehr sein wird, sowohl ich wie dieses ganze Glück und die ganze
Liebe und die ganze Menschheit, – daß wir uns in ein Nichts verwandeln werden oder wieder in
das anfängliche Chaos. Unter einer solchen Bedingung aber kann ich keinerlei Glück annehmen,
um keinen Preis, – nicht aus Unlust, es anzunehmen, nicht aus Eigensinn um eines Prinzips
willen, sondern einfach deshalb, weil ich weder glücklich sein kann noch sein werde, solange ich
weiß, daß mich morgen das Nichtsein erwartet. Das ist eine Gefühlssache, ein ganz unmittelbares
Gefühl [meine Hervorhebung – E.P.], das ich nicht bewältigen kann. Nun gut, wenn ich allein
sterben, und wenn dafür die Menschheit an meiner Statt ewig weiterleben würde, dann wäre ich
vielleicht immerhin getröstet. Aber unser Planet ist doch nicht ewig, und die Lebensdauer der
ganzen Menschheit ist im Verhältnis zur Ewigkeit genau solch ein Augenblick wie mein Einzelleben. Und wie vernünftig, wie herrlich, wie gerecht und heilig die Menschheit auf Erden sich
auch immer einrichtete – es wird morgen doch alles dieselbe Null sein. Und wenn das auch alles
da aus irgendeinem Grunde notwendig ist, infolge irgendwelcher allmächtiger, ewiger und toter
Naturgesetze, so ist doch, glauben Sie mir, in diesen Gedanken eine gewisse allertiefste Nichtachtung der Menschheit enthalten, die für mich tief beleidigend und um so unerträglicher ist, als
es hier keinen Schuldigen gibt.39
Dieser Auszug aus dem Todesurteil zeigt u. a. eine tiefe Übereinstimmung mit Tolstoi
sowie den grundlegenden Unterschied zwischen den beiden russischen Denkern. Der
36
37
38
39
Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 268.
Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 255.
Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 264.
Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 256 f.
342
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Ausgangspunkt ist derselbe: das Verlangen eines Einzelwesens nach Sinn, das unaufhörlich Fragen stellt und die Sinnlosigkeit nicht ertragen kann. Wie auch später
Tolstoi (dessen Kenntnis dieses Textes nicht auszuschließen ist), stellt Dostojewski
hier die Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz so radikal wie möglich. Und
es stellt sich heraus, dass gerade dieses Hinterfragen, d. h. die Vernunft, ein Fluch ist:
„Ich bin mit Erkenntnisfähigkeit erschaffen und habe diese Natur erkannt“, nämlich
dass sich morgen alles „in ein Nichts verwandeln wird.“ Und da die Natur diese
Tatsache vor dem Bewusstsein des Menschen nicht verborgen hat,
wie sie es einer Kuh verbirgt, – so kommt einem unwillkürlich ein überaus komischer, aber auch
unerträglich trauriger Gedanke: ‚Nun, wie aber, wenn der Mensch nur so als ein unverschämter
Versuch in die Welt gesetzt worden ist, nur um zu sehen, ob sich ein solches Geschöpf auf der
Erde wird einleben können oder nicht?‘ Das Traurige dieses Gedankens besteht hauptsächlich
darin, daß es wiederum keinen Schuldigen gibt, es ist niemand da, der den Versuch anstellt,
somit kann man niemanden verfluchen, denn es ist alles infolge toter Naturgesetze entstanden,
die für mich vollkommen unbegreiflich sind und mit denen sich meine Erkenntnis unter keinen
Umständen abfinden kann.40
Es sei daran erinnert, dass auch Tolstoi von einem „dummen, bösen Spaß, den sich
jemand mit mir erlaubt hat“, redete, obwohl er schon im nächsten Atemzug die
Existenz des Schuldigen leugnete. Es gäbe niemanden, den man dafür verantwortlich
machen könne. Dieser Gedanke führt zum Selbstmord.41 Es sei denn, man könne sich
an Tolstois Mythos über die in sich getrennte, sich immer steigernde Liebe festhalten.
Und hier zeigt sich ein erheblicher Kontrast zwischen den zwei Denkern: Die Unglaubwürdigkeit der persönlichen Unsterblichkeit ist nach Dostojewski ein Mangel, den
kein „Sinn des Lebens“, kein Mythos über die Liebe erstatten kann, weil
die Liebe zur Menschheit im allgemeinen und als Idee eine der für den Menschenverstand unfaßbarsten Ideen ist. Gerade als Idee.42
Wie will man hier das Gefühl von der Idee unterscheiden? Die Idee der Sinnlosigkeit
wird, so Dostojewski, selbst zu einem „unmittelbaren Gefühl“, das die Liebe unmöglich macht.
40 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 258.
41 Nicht nur im Todesurteil wird ein Selbstmord aus Glaubensverlust geschildert, sondern auch später
in Die Dämonen. Es wird allerdings vom Glauben an Gott gesprochen: „Gott ist unentbehrlich und
darum muß er sein. […] Aber ich weiß, daß es ihn nicht gibt und nicht geben kann. […] Begreifst du
denn wirklich nicht, daß ein Mensch mit zwei solchen Gedanken nicht leben bleiben kann?“ (Fjodor
M. Dostojewski, Die Dämonen. Roman, S. 903). Diese Idee hat Kirillow „verschlungen“, und er tötet sich
selbst um ihretwillen. Dasselbe tat der „logische Selbstmörder“.
42 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 269.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
343
Nur das Gefühl allein kann sie rechtfertigen. Doch dieses Gefühl ist eben nur mit der gleichzeitigen Überzeugung von der Unsterblichkeit der Menschenseele möglich.43
Die Liebe als Gefühl wird so durch die Idee (der Sinnlosigkeit dieser Liebe) vernichtet.
Das Gute ist, sei es Liebe als Neigung oder als Wohltat, somit sinnlos, sogar
widersinnig, weil nichts die Endlichkeit und das Leiden sinnvoll machen kann, wenn
es keinen gibt, der dafür verantwortlich wäre und es wieder gut machen könnte.
Durch diese „Erkenntnisfähigkeit“, durch dieses Bewusst-Werden der Sinnlosigkeit
all seiner Bemühungen um das Bessere, sei es das eigene Wohl oder das Wohl
anderer, wird der Mensch zum eigenen Richter, der der härteste aller Richter ist.
Nichts auf das Risiko hin zu wagen, dass es unrecht sei bzw. dass es als Naturgesetz
erwünscht sein könnte, war der Leitfaden des Gewissens nach Kant. Für Dostojewskis
„logischen Selbstmörder“ kann in diesem Sinn das Leben selbst bzw. das Fortsetzen
des Lebens weder gerecht noch erwünscht sein. Dies ist die Schlussfolgerung seines
Gewissens, denn er wird dabei, wie der Mensch Kants, zu Angeklagtem und Richter in
einer Person. In seiner „fraglosen Eigenschaft als Kläger und Beklagter, als Richter
und Angeklagter“ befindet Dostojewskis „Materialist“ die Natur, die ihn hervorgebracht hat, für schuldig und verurteilt
diese Natur, die mich so rücksichtslos und unverschämt zum Leiden erschaffen hat, zugleich mit
mir zur Vernichtung… Da ich aber die Natur nicht vernichten kann, so vernichte ich mich allein,
einzig weil es mich langweilt, eine Tyrannei zu ertragen, bei der es keinen Schuldigen gibt.44
Dieser härteste Spruch des Richters, der zugleich auch der Angeklagte ist, bedeutet
sein Todesurteil für die schlimmste und einzige Schuld in der sinnlosen Welt – die
Schuld des Bewusstseins,45 das unfähig zur Liebe und zum Leben macht. Dies ist der
Schluss des „logischen Selbstmörders“, „denn mit der Logik läßt es sich gar nicht
widerlegen“.46 „Wo liegt nun der Fehler, worin hat er sich geirrt?“, wird im Tagebuch
gefragt. Und die Antwort ist: „Der Fehler, meine ich, liegt einzig in dem Verlust des
Glaubens an die Unsterblichkeit“.47 Der Schluss ist somit:
Mit einem Wort, die Unsterblichkeitsidee ist das Leben selbst, das lebendige Leben, eine endgültige Formel und die Hauptquelle der Wahrheit und der richtigen Erkenntnis für die Menschheit.48
43 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 269.
44 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 259.
45 Statt des Wortes „Erkenntnis“ in der deutschen Übersetzung steht im Original überall „Bewusstsein“ und „Bewusstwerden“ („сознание“, „осознание“) (vgl. z. B. DGA 23, S. 147).
46 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 275.
47 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 267.
48 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 270. Hier steht im Original wieder statt „Erkenntnis“
das „Bewusstsein“ (vgl. DGA 24, S. 49 f.).
344
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Die Verzweiflung an Sinn und Ziel verwandelt dagegen „die Liebe zur Menschheit in
Haß gegen die Menschheit“.49 In den Brüdern Karamasow wagt der Mensch, der den
Glauben an die Unsterblichkeit der Seele verloren hat, die letzten Konsequenzen aus
diesem Verlust zu ziehen:
[…] ein Egoismus, der bis zu Mord und Totschlag reicht, müsse dem Menschen nicht nur erlaubt
sein, sondern sogar in seiner Lage als notwendiger, vernünftigster und geradezu höchst anständiger Ausweg anerkannt werden.50
Dass der Glaube an die persönliche Unsterblichkeit die unumgängliche Bedingung
der Liebe zu Menschen (als Idee und als Neigung) ist, bleibt jedoch eine These. In den
Brüdern Karamasow gibt es auch eine Antithese. Diese wird ebenso von Iwan Karamasow entwickelt. Sie wird mit einer berühmten Metapher zum Ausdruck gebracht: Die
Eintrittskarte in das Himmelsreich wird Gott „aufs ehrerbietigste“ zurückgegeben.51
Die Antithese lautet ungefähr so: Wenn die Unsterblichkeit und Gott, wenn die
höchste Gerechtigkeit und vollkommene Glückseligkeit wirklich wären, würde der
Mensch auf sie trotzdem verzichten müssen – gerade im Namen der Liebe zur Menschheit. Die Unsterblichkeit war die unerlässliche Bedingung für Moralität. Jetzt wird sie
aus Moralität abgelehnt. Das fünfte Buch des Romans, in dem diese Kontroverse
dargestellt wird, wird „Pro et contra“ genannt. Sie stellt einen gewissen Höhepunkt
des Romans dar, dessen Sinn, wie Dostojewski es in einem Brief schrieb, „Blasphemie“ und „Widerlegung der Blasphemie“ sei.52
Die Blasphemie besteht nicht in der philosophischen Widerlegung des Daseins
Gottes, sondern in der Ablehnung seiner Welt – der Ablehnung im Namen der Liebe,
für die dieses Dasein so bitterlich nötig ist. Iwans Philosophie besteht somit aus zwei
Thesen, die einander gegenüber stehen und einander widerlegen, die beide jedoch, so
Dostojewskis Gedanke, für die menschliche Vernunft so unumgänglich sind, dass der
Verzicht auf eine von ihnen dem Verzicht auf die Vernunft selbst entspräche. Um
diesen Gedanken zum Ausdruck zu bringen, gebraucht er wiederum eine Metapher:
die Metapher der parallelen Linien, die sich nach dem Axiom der euklidischen Geometrie nicht schneiden können. Sie ist es wert, genauer betrachtet zu werden.
Dostojewski hatte profunde Kenntnisse der nichteuklidischen Geometrie Nikolai
Lobatschewskis, in der durch den Ersatz eines einzigen Axioms wichtige Veränderungen in der Raumvorstellung verursacht werden. Er verwandelte dieses Axiom in eine
Metapher, wodurch es plausibel und gleichzeitig relativiert wurde. So beginnt Iwan
Karamasow seine Beichte gegenüber seinem Bruder Aljoscha mit einer Überlegung,
die an den Anfang der ersten Kritik Kants erinnert: Die menschliche Vernunft ist
geneigt (insbesondere bei den Russen, so Iwan), eine Hypothese für ein Axiom zu
49
50
51
52
Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 268.
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 112.
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 393.
S. den Brief an Konstantin P. Pobedonostsew vom 19. Mai 1879 (DGA 30 (Teil I), S. 66).
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
345
halten. Um dieser Gefahr zu entgehen, will Iwan selbst keine Hypothesen annehmen.
Was die menschliche Vernunft nachvollziehen kann, ist, dass die Vorstellung einer
dreidimensionalen Welt für sie eine unerlässliche Bedingung aller Erkenntnisse ist.
Und, was die Fragen nach Gott und Unsterblichkeit angeht, so können sie niemals
beantwortet werden:
Für alle diese Fragen ist unser Verstand einfach nicht gemacht, er ist geschaffen mit dem Begriff
von lediglich drei Dimensionen.53
Jedes Denken setzt bei dem irdischen „euklidischen Verstand“ an. Und deshalb kann
es auch manche Fragen weder stellen noch beantworten, auch die wichtigsten unter
ihnen nicht, nämlich die nach dem Sinn des Leidens, nach dem „Warum“ der
menschlichen Existenz. Das Denken muss nur noch feststellen,
daß es das Leiden gibt und keine Schuldigen, daß alles fließt und sich ausgleicht; aber das ist
eben nur euklidisches dummes Zeug – ich weiß es und kann mich doch nicht bereit finden,
danach zu leben! Was hilft es, daß es keine Schuldigen gibt und ich das weiß; ich brauche
Vergeltung, sonst zerstöre ich mich selbst.54
Die menschliche Vernunft, so Dostojewskis Gedanke, kann diese Fragen weder beantworten noch unbeantwortet lassen. Dennoch ist das nicht das eigentliche Problem. Das
Problem bestehe darin, dass, wenn sie sie beantworten könnte, diese Antwort für sie
unbrauchbar wäre. Die Vergeltung und die ewige Harmonie sind für sie wie „zwei
Parallelen, die nach Euklid auf Erden nie und nimmer zusammenkommen könnten“.
Aber wenn sie „vielleicht doch irgendwo im unendlichen zusammenkommen“, wird
dieses Ereignis dem irdischen Verstand nichts sagen können.55 Wenn es höchste
Gerechtigkeit, wenn es eine Erklärung für das Leiden der Welt gäbe, kann der Mensch,
Iwan Karamasow, auch diese Erklärung nicht akzeptieren, er will sie nicht akzeptieren:
Solange ich auf Erden bin, beeile ich mich, meine Vorkehrungen zu treffen. Siehst du, Aljoscha,
es kann doch wirklich so kommen, daß ich, wenn ich selbst bis zu jenem Augenblick lebe oder
wenn ich dann auferweckt werde, damit ich ihn sehe – daß dann auch ich wohl mit ihnen allen
angesichts der Mutter, die den Peiniger ihres Kindes umarmt, rufen werde: ‚Gerecht bist du,
Herr!‘, aber ich will nicht, daß ich es dann rufe. Solange noch Zeit ist, beeile ich mich, einen Wall
um mich zu bauen, und darum weise ich die höchste Harmonie ganz und gar zurück.56
53 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 376.
54 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 390.
55 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 374. Streng genommen ist dieses Prinzip bei Lobatschewski etwas anders formuliert. Sein Axiom besagt, dass durch einen nicht auf einer Geraden
liegenden Punkt mindestens zwei Geraden gehen, die mit dieser in einer Ebene liegen und sie nicht
schneiden. Zu dieser Metapher bei Dostojewski s. die Verfass., „Параллельные линии“ Ивана
Карамазова (Логика одной идеи) („Parallele Linien“ von Iwan Karamasow (Die Logik einer Idee)).
56 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 392.
346
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
So ist es gleichgültig, ob man die Frage nach Gott und Unsterblichkeit beantworten
kann oder nicht. Die Antwort wäre jedenfalls für die menschliche Vernunft unbrauchbar. Und für den Fall, dass sie sie irgendwie akzeptieren wird, sind jetzt, solange man
noch bei dem „euklidischen dummen Zeug“ bleibt, Sicherheitsmaßnahmen nötig: Die
Eintrittskarte in das Paradies wird jetzt zurückgegeben und es wird feierlich deklariert, man wolle diese Harmonie, diese Vollendung allen Geschehens nicht:
[…] die Welt Gottes – sie akzeptiere ich nicht, ich kann mich nicht bereitfinden, sie zu akzeptieren.57
Der „euklidische Verstand“ will keine andere Welt, auch wenn diese Welt mit ihrem
Leiden und ihren unlösbaren Widersprüchen, mit ihrer Sinnlosigkeit für ihn unerträglich ist:
Mögen sogar Parallelen aufeinandertreffen, und mag ich selbst das sehen – ich werde es sehen
und sagen, sie sind aufeinandergetroffen, und trotzdem akzeptiere ich es nicht.58
Die Metapher der Parallelen, die sich in der Unendlichkeit treffen, zeigt so die tiefsten
Kontroversen der Vernunft: Als irdische, „euklidische“ Vernunft kann sie keine letzte
Gerechtigkeit, keine Unsterblichkeit, keinen Gott akzeptieren. Sie kann diese Ideen
nicht akzeptieren, weil sie bei ihrer Zeitlichkeit, bei ihrer Beschränkung bleiben muss:
Das Leiden, das schon stattgefunden hat, kann niemals ausgeglichen, niemals getilgt
werden. Das höchste Gut, das überzeitlich sein soll, eine ewige Harmonie, kann es
nicht wiedergutmachen.
Sie ist es nicht wert, weil die Tränen des Kindes ungesühnt geblieben sind. Sie müssen gesühnt
werden, weil sonst auch keine Harmonie sein kann. Aber womit, womit wirst du sie sühnen? Ist
es denn möglich? Etwa damit, daß sie gerächt werden? Aber was soll mir solche Rache, was soll
mir die Hölle für die Peiniger, was kann die Hölle da korrigieren, wenn die Opfer schon gemartert
sind [meine Hervorhebung – E.P.]? Und was ist es für eine Harmonie, wenn es die Hölle gibt – ich
will doch verzeihen, ich will umarmen, ich will nicht, daß weiter gelitten wird? Und wenn die
Leiden der Kinder zum Erreichen jeder Leidenssumme gedient haben, die notwendig war, die
Wahrheit zu erkaufen, so erkläre ich mit Nachdruck von vornherein, daß die ganze Wahrheit
diesen Preis nicht wert ist.59
Das zeitliche Bedingt-Sein der menschlichen Vernunft verbietet es ihr, das höchste
Gute der göttlichen Gerechtigkeit auch nur als Möglichkeit anzunehmen, wie deren
Räumlichkeit den Verstand zum Widerstand gegen die nichteuklidische Geometrie
57 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 392.
58 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 376 f.
59 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 392.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
347
aufruft. Sei es, dass das Gute siegt und alles Böse der Welt bestraft und alles Leiden
ausgeglichen wird, sei es, dass die Parallelen – z. B. die Glückseligkeit und die Glückswürdigkeit – tatsächlich zusammentreffen, trotz alledem wird die menschliche Vernunft Iwan zufolge dieses höchste Gute nicht billigen können. Sie wird bei dem ihr
unerträglichen Tatbestand bleiben müssen – dass es das Leiden gibt, dass das, was
schon geschehen ist, niemals wiedergutgemacht werden kann.
Die Anknüpfungspunkte an die kantische Moralphilosophie müssen an dieser
Stelle besonders hervorgehoben werden.60 Es waren drei Ideen, worauf „die Spekulation der Vernunft im transzendentalen Gebrauche zuletzt hinausläuft“: Freiheit, Unsterblichkeit und Gott (KrV A 798/B 826). Erstere ist das, was die Vernunft praktisch
macht, denn „praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist“ (KrV A 800/
B 828). Insofern lässt sie sich „in der Erfahrung darthun“ (KU, AA 5, S. 468). Die zwei
Letzteren dagegen sind für die Erfahrung unzugänglich. Wird nach ihrer objektiven
Realität gefragt, so versetzt sich die Vernunft in einen unendlichen Streit mit sich
selbst, in die Dialektik. Sie sind damit bloß regulativ, denn sie bieten der Vernunft die
für sie notwendige Totalität der Bedingungen im Unbedingten an. Im Praktischen
werden sie dagegen konstitutiv. Sie werden in einer Vorstellung vereinigt, die die
60 Hier darf die in Russland ebenso berühmte wie umstrittene Untersuchung von Jakow Golosowker
Dostojewski und Kant. Überlegungen eines Lesers über den Roman „Die Brüder Karamasow“ und Kants
Traktat „Kritik der reinen Vernunft“ (Яков Э. Голосовкер, Достоевский и Кант. Размышления
читателя над романом „Братья Карамазов“ и трактатом Канта „Критика чистого разума“)
nicht unerwähnt gelassen werden. Wie Aleksej Krouglov in seinem im vorigen Kapitel zitierten Aufsatz
überzeugend argumentiert, gründet Golosowker seine Argumentation auf die höchst zweifelhafte
Annahme, Dostojewski habe Kants erste Kritik nicht nur gelesen, sondern auch gründlich studiert
(Krouglov, Leo Nikolaevič Tolstoj als Leser Kants, S. 361 f.; vgl. Голосовкер, Достоевский и Кант, S. 3,
96 f.). Deshalb dürfe Dostojewskis letzter Roman als „enträtselter Kant“ interpretiert werden
(Голосовкер, Достоевский и Кант, S. 101). Abgesehen von den historisch-philologischen Fragen,
scheint eine systematische Auseinandersetzung der Künstler-Philosophie Dostojewskis und der Dialektik Kants allerdings eine sehr anspruchsvolle, jedoch durchaus sinnvolle Aufgabe zu sein. Doch ist
Golosowker in seinen Schlüssen nicht immer überzeugend. Denn einerseits wird behauptet, Dostojewski habe Kants Dialektik zu Gunsten der moralischen Bedürfnisse gelöst und sei so den KantMoralisten eigentlich gefolgt (S. 69), andererseits aber kämpfe Dostojewski einen Todeskampf gegen
Kant (S. 87). Dieser Widerspruch kann teilweise dadurch erklärt werden, dass Golosowker Kants
eigentliche Errungenschaft bloß in der Erkenntnistheorie sieht (S. 100 f.) und ein „verhängnisvolles
Verschweigen über das intellektuelle Gewissen“ (S. 100) bei Kant behauptet. So wird der Teufel (Iwans
Alptraumvision) zum eigentlichen Helden der dialektischen Vernunft erklärt (S. 91). Er müsse Gott und
die Unsterblichkeit leugnen, obwohl er genau weiß, dass es sie wirklich gibt (S. 78). Um ihn zu
besiegen, müsse man nach Dostojewski die Vernunft selbst in den Abgrund stürzen. Es handle sich
somit bei Dostojewski um eine „Tragödie der Vernunft“ (S. 95), um „die Hölle der Vernunft“ (S. 92). Zu
diesem russischen Klischee, dass Kant durch seine Kritik der Vernunft als Befürworter des Teufels zu
verstehen sei, kommen wir noch einmal im fünften Kapitel zurück. An dieser Stelle versuche ich,
Dostojewskis und Kants Ideen mit Hilfe einer feineren Differenzierung als der von Golosowker zusammenzubringen und beanspruche dabei nicht, die Behauptung zu untermauern, Dostojewski habe Kant
enträtselt oder gar widerlegt.
348
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Totalität der Bedingungen darstellt: in der Idee des höchsten Guts, des Zusammentreffens von Glückseligkeit und Glückswürdigkeit. Sie ist die Antwort auf die Frage
„Was darf ich hoffen?“, sie ist auch der „letzte[ ] Zweck[ ] der reinen Vernunft“
(KrV A 804/B 832 ff.), d. h. wenn es nur auf die Vernunft ankäme, würde sie nach Kant
das höchste Gut, die moralische Ordnung in der Natur errichten.61 Für diese Vorstellung, für diese Hoffnung sind die drei höchsten Ideen der Vernunft unumgänglich:
Ohne Freiheit ist die Glückswürdigkeit, ohne Gott die Glückseligkeit und ohne Unsterblichkeit ihr Zusammentreffen für den einzelnen Menschen nicht denkbar. Die
Moral aus Vernunft lässt so nach Kant nicht nur die Hoffnung auf dieses höchste Gut
zu, sondern gebietet den praktischen Glauben daran.62 Die Religion anzuerkennen
bzw. an Gott als Richter und Gebieter zu glauben, ist insofern nach Kant eine moralische Pflicht.
Dostojewski kannte Kants Architektonik der Vernunft höchstwahrscheinlich
nicht.63 Er konstruierte seine eigene Dialektik der Vernunft ähnlich und dennoch
anders als Kant. Als Ausgangspunkt gilt gerade die Idee des höchsten Guts, das auch
Gott und Unsterblichkeit voraussetzt. In ihrer dialektischen Bewegung kommt es
dennoch zum Widerstreit gerade zwischen dieser Idee und der Moral, die sich als
unverträglich mit ihr erweist. Es geht also um einen viel dramatischeren Widerstreit
als bei Kant – um einen Widerstreit zwischen der Vernunft und ihrer höchsten Idee. Das
Böse kann nicht vergolten werden, das höchste Gute ist nicht bloß unwahrscheinlich,
es ist nutzlos, sogar verwerflich für die Vernunft, wie die nicht-dreidimensionale
Welt für den „euklidischen Verstand“. Die Vernunft, die sich zur Revolte erhebt,
muss bei der „ganze[n] kränkende[n] Komik der menschlichen Widersprüche“ bleiben.64 Sie verzichtet auf jede Art Harmonie und Erlösung, weil sie weiß, dass
„manches Unsinnige nur zu notwendig […] auf Erden“ ist.65 Die These, dass der
Glaube an die persönliche Unsterblichkeit für die Liebe zur Menschheit notwendig
sei, und die Antithese, dass diese Unsterblichkeit gerade nicht akzeptiert werden
könne, können nicht versöhnt werden. Sie können nicht in der Idee des höchsten
Guts aufgehoben werden. Auch sie sind zwei parallele Linien, die sich nach dem
Axiom der euklidischen Geometrie niemals schneiden können, auch nicht in der
Unendlichkeit.
61 Die Idee des höchsten Guts zeigt u. a., dass es Kant zumindest in der ersten Kritik noch um ein
System im strengen Sinne ging, das aus einem Prinzip hergeleitet werden kann (vgl. bes. KrV A 801/
B 829). Auch in der Kritik der praktischen Vernunft wird der Idee des höchsten Guts eine systembildende
Rolle zugeschrieben. In ihr wird das moralische Gesetz mit der Natur, wenn auch nur als Idee der
praktischen Vernunft, verknüpft (vgl. KpV, AA 5, S. 43). Erst nach der drittenKritik wird, wie im KantKapitel gezeigt wurde, klar, dass die zwei Prinzipien unabhängig voneinander bleiben müssen.
62 Zur Idee des höchsten Guten als Sinnhorizont sittlicher Praxis bei Kant s. Bielefeldt, Kants Symbolik, S. 86 ff.
63 S. Krouglow, Leo Nikolaevič Tolstoj als Leser Kants, S. 361 f.
64 Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 376.
65 Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 389.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
349
Es sei noch einmal betont, dass Iwan die Existenz Gottes nicht ablehnt. Es ist gar
nicht die Wahrscheinlichkeit bzw. Unwahrscheinlichkeit dieser Hypothese, die im
Zentrum seiner Dialektik steht – nicht die Dialektik der theoretischen, sondern die der
praktischen Vernunft. Die höchste Gerechtigkeit, sogar wenn es sie gäbe, ist für ihn
nicht bloß unbegreiflich, sie ist unakzeptabel. Die Vernunft will bei ihrer Dialektik
bleiben. Weder ihre Forderung nach Glück noch die Forderung nach Liebe kann befriedigt werden.
Auch Kant wies auf die Dialektik der praktischen Vernunft hin: Die Glückseligkeit
und Glückswürdigkeit scheinen einander auszuschließen. Und doch würde das moralische Gesetz ohne Glauben an ihre Vereinbarkeit unmöglich sein:
Ist also das höchste Gut nach praktischen Regeln unmöglich, so muß auch das moralische
Gesetz, welches gebietet, dasselbe zu befördern, phantastisch und auf leere eingebildete Zwecke
gestellt, mithin an sich falsch sein. (KpV, AA 5, S. 114, meine Hervorhebung – E.P.)
Ohne diesen Glauben an den Endzweck aller Bemühungen um die Moral kann also
auch nach Kant die Moral nicht glaubwürdig sein.66 Sie wäre dann „phantastisch“.
Und fantastisch ist etwas anderes als unbegreiflich: Fantastisch ist das Gesetz,
das leere und eingebildete Zwecke verfolgt. Es ist etwas Eingebildetes, etwas
Falsches. Auf den Begriff des Fantastischen bei Dostojewski kommen wir im dritten Teil dieses Kapitels zurück. Für Dostojewski erweist sich dieser Begriff als
zentral, wenn es um die Darstellung der Welt geht, in der der Glaube an das höchste
Gut untergegangen ist. Kant wollte jedenfalls das Moralische vor dem Fantastischen
retten. Er löste die Schwierigkeit durch den Begriff der „S e l b s t z u f r i e d e n h e i t “
bzw. durch die intellektuelle, „unveränderliche[ ] Zufriedenheit“ als „negatives
Wohlgefallen“ an der eigenen „U n a b h ä n g i g k e i t v o n N e i g u n g e n“ (KpV, AA 5,
S. 117 f.).67
Ein unveränderlicher Zustand könnte jedoch für Iwan kein Ziel, keinen Maßstab
des Praktischen ausmachen. Die sich in der Unendlichkeit schneidenden Linien, die
sich in der Ewigkeit treffende Glückseligkeit und Glückswürdigkeit können für die
irdische Vernunft keine Befriedigung, kein Trost sein. Gott ist für ihn nicht einfach
„eine viel zu extreme Hypothese“, wie es Nietzsche einmal zum Ausdruck brachte
66 Vgl. die Definition der Glückseligkeit als „Zustand eines vernünftigen Wesens in der Welt, dem es
im Ganzen seiner Existenz alles nach Wunsch und Willen geht“ (KpV, AA 5, S. 124). Der Begriff des
Glücks ist allerdings selbst nicht unproblematisch. S. dazu Beatrix Himmelmann, Kants Begriff des
Glücks.
67 Diese Schwierigkeit, die mit der Idee des höchsten Guts verbunden ist, die dem Moralischen
Abbruch zu tun scheint, wurde in der Kant-Rezeption mehrmals besprochen. Schon für Schopenhauer
war diese Idee verdächtig, weil sie dem Egoismus wiederum eine Hintertür zu öffnen schien. Zur
späteren Debatte dazu s. Michael Albrecht, Kants Antinomie der praktischen Vernunft; Klaus Düsing,
Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer Philosophie; Marc Zobrist, Kants Lehre vom
höchsten Gut und die Frage moralischer Motivation.
350
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
(Nachlass, Sommer 1886–Herbst 1887, 5[71], KSA 12, S. 212). Als Hypothese könnte er
sie gerade akzeptieren, denn:
nicht das ist seltsam, nicht das wäre wunderbar, daß Gott wirklich existierte, nein, wunderbar ist,
daß dieser Gedanke, der Gedanke der Notwendigkeit Gottes, einem so wilden und bösartigen
Tier, wie es der Mensch ist, in den Sinn hat kommen können, da er doch so heilig ist, so rührend,
so weise und dem Menschen soviel Ehre macht.68
Dennoch solle der Mensch sich gerade diesem weisen und rührenden Gedanken
verweigern. Die Vernunft Iwans ist in Raum und Zeit gefangen. Das Intelligible, sei es
Gott oder seine persönliche Unsterblichkeit oder das höchste Gut, ist für sie kein
Anhaltspunkt mehr.
Iwan verkörpert die Dialektik zweier Thesen und somit den Widerstreit der Vernunft mit sich selbst, d. h. er verkörpert nicht bloß eine Idee, sondern die Antinomien
der Vernunft. Im Roman wird dies von Staretz Sossima als Segen Gottes gedeutet:
Aber danken Sie dem Schöpfer dafür, daß er Ihnen ein hohes Herz gegeben hat, ein Herz, das
fähig ist solcher Mühe und Qual, zu suchen, was droben ist, und zu trachten nach dem, was
droben ist, denn unsere Heimat ist im Himmel.69
Iwans Dialektik führt allerdings dahin, dass das moralische Gesetz, nach dem Ausdruck Kants, „phantastisch“ wird. Die Unerreichbarkeit und Undenkbarkeit des
höchsten Guts kompromittiert das Moralische auf tiefste Weise, demnach wären das
Gute und das Böse in ihrem Wert radikal zu relativieren:
Wozu dieses teuflische Gute und Böse erkennen, wenn es so teuer zu stehen kommt?70
Die Antwort auf diese Frage wird ihm im Roman gegeben, im selben Buch, direkt nach
der Darlegung seiner Dialektik, als er sich dem von ihm verachteten „Lakaien“
Smerdjakow unterwirft, der seine Maxime „Alles ist erlaubt“ ernst genommen und in
die Tat umgesetzt hat. Nur wenige Seiten weiter, nach dem Gespräch mit Aljoscha und
der Darlegung seiner Philosophie, sagt Iwan: „Ich bin ein Schuft!“71 Später wird er
noch behaupten, er sei bloß ein Mörder,72 und sich nach einer Moral richten, die er
nicht anerkennt.
Iwans Dialektik wird so vom Leben widerlegt, ohne Argumente und ohne Begründungen. Aber die zwei Thesen bleiben trotzdem bestehen: Die Liebe zu den Menschen, der Höhepunkt der Moralität, ist nur durch den Glauben an ihre Unsterblichkeit, an die ewige Harmonie möglich; dennoch wird gerade dieser Glaube für den
68
69
70
71
72
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 374.
Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 114.
Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 387.
Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 449.
Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 2, S. 564.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
351
Menschenfreund verwerflich, weil er seiner Liebe, seiner irdischen Fähigkeit zu lieben
widerspricht.
An einer Stelle im Tagebuch eines Schriftstellers, gerade da, wo er vom Standpunkt
seines „logischen Selbstmörders“ her argumentierte, sprach Dostojewski von dem
„Gesetz der Reflexion der Ideen“.73 Aus der Liebe zur Menschheit wird Hass gegen sie,
aus der Suche nach dem Sinn die Lust an der Sinnlosigkeit. Wie die Protagonisten, so
haben auch die Ideen ihre Doppelgänger. Die Idee von Iwan Karamasow, der Gott
annimmt, aber seine Welt aus Liebe zur Menschheit zurückweisen muss, ist bei dem
„logischen Selbstmörder“ zur gleichen Figur, nur ohne Gott, geworden: Es ist gleich,
ob es sich um Gottes Plan der ewigen Harmonie oder um „tote Gesetze der Natur“, ob
es sich um „einen unverschämten Versuch“ oder um die höchste und gütigste Vorsehung handelt. Die Antwort auf die Frage, warum Tränen eines unschuldigen Kindes
„zum Erreichen jener Leidenssumme gedient haben“, die für die ewige Harmonie
notwendig war, oder warum „die Natur infolge irgendwelcher ihrer trägen Gesetze es
nötig hatte, den Menschen Jahrtausende lang zu quälen“,74 d. h.: ob dabei dann doch
die ewige Glückseligkeit oder ein absolutes Nichts herauskommt, ob dieses Leiden
sinnvoll oder sinnlos war, macht keinen Unterschied. Gott und die „trägen Gesetze
der Natur“ erwirken dieselbe Antwort: Sie werden radikal abgelehnt.
Die parallelen Linien treffen sich in diesem Sinn: Ob es Gott gibt oder nicht, ob es
einen Sinn des Leidens gibt oder nicht – die Welt, das Leben selbst kann nicht akzeptiert werden. Es sind keine Paradoxien der Moral aus Vernunft, die, wie bei Kant, durch
die tätige, ästhetisch-bedingte Liebe aufgehoben werden, sondern ihre schärfsten
Kontroversen: Die Liebe ergänzt die Unvollkommenheit der Moralität nicht, sie widerspricht der Moralität, sie widerspricht auch der Vernunft. Es ist Iwan gleichgültig, ob er
recht hat oder nicht, d. h.: ob diese Ablehnung der Gotteswelt bzw. der toten Natur samt
der Ablehnung der Liebe selbst moralisch ist. Denn was könnte hier noch moralisch
bzw. vernünftig sein? Es ist nur noch ein „unmittelbares Gefühl“, das hier spricht:
Ich will nicht die Harmonie, aus Liebe zur Menschheit will ich sie nicht. Ich will lieber bei
ungerächten Leiden bleiben. Lieber bleibe ich bei meinem ungerächten Leiden und meiner
ungestillten Entrüstung, mag ich auch unrecht haben.75
Aber auch das „unmittelbare Gefühl“ der Liebe wurde durch die Dialektik Iwans
unmöglich. Und so muss auch er schließlich eingestehen:
Ich muß dir ein Geständnis machen […] Ich habe niemals begreifen können, wie es möglich ist,
seine Nächsten zu lieben. […] Ich meine, die Liebe Christi zu den Menschen, das ist ein in seiner
Art auf Erden unmögliches Wunder.76
73
74
75
76
Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 268.
Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 257.
Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 392 f.
Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 378.
352
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
„Wie wirst du denn leben, wie wirst du […] denn lieben?“,77 fragt Aljoscha traurig
seinen Bruder. Für einen Rebellen gegen Gott und die Natur ist die Liebe weder als
Gefühl noch als Ergänzungsstück der Moralität möglich. Er, der von der Liebe zu den
Menschen gequält wird, indem er sie über alles schätzt, befindet sich in einem unlösbaren Widerstreit nicht nur mit seiner Vernunft, sondern auch mit seiner Neigung –
der Neigung zur Liebe und zum Leben.78 Die Idee, so Dostojewski, kann auch Gefühle
vernichten, v. a. die, die zum Leben notwendig sind. Nicht ein Widerstreit der Ideen,
sondern der Widerstreit der Vernunft mit dem Leben wird in Dostojewskis letztem
Roman geschildert. Der Rebellierende wird zum Mörder – zu einem, der dem anderen
das Leben nimmt. Aber auch wenn er jemand anderen tötet, tötet er, wie wir weiter
sehen werden, vor allem sich selbst. Er wird zu einem „logischen Selbstmörder“, zum
Selbstmörder aus der Dialektik der Vernunft.
Das vernünftige Zusammenleben und die Logik der Willkür
Die dialektische Stärke Iwans und des „logischen Selbstmörders“ versperrt die Liebe
und macht das Gute „phantastisch“ im kantischen Sinne. Sie macht das Leben unmöglich, sie zerstört es. Die Kontroversen sind zu mächtig, weswegen nicht zu
erwarten ist, dass sie einfach gelöst würden. Die Antinomien der Vernunft können
auch nicht aus Notwendigkeit als Paradoxien angenommen werden. Im Namen der
Liebe wird die Vernichtung gefordert, aus dem Verlangen nach Glück das Leben
verneint. Diese Dialektik, die das Leben versperrt, wird allerdings als Krankheit der
Vernunft gedeutet. Und tatsächlich werden in den Romanen die Vernunftkontroversen durch Erkrankungen der handelnden Personen begleitet (das Nervenfieber, an
dem Iwan, wie auch früher Raskolnikow, leidet). Die dialektische Stärke ist so
zugleich die Lebensschwäche. Dies ist die Antwort auf die „mit der Logik unwiderlegbare“ Dialektik.
Trotz alledem erreicht diese Dialektik ein Ziel: Sie erschüttert die Selbstgewissheit
der an den eigenen Ideen hängenden Vernunft und den Wert ihres Ideals – das des
höchsten Guts. Selbst das Verlangen eines Einzelwesens nach der Liebe ist, anders als
bei Tolstoi, keine wirkliche Konstante, kein fester Anhaltspunkt. Es stellt sich jedoch
eine Frage. Vielleicht sollte die in der Zeit gefangene Vernunft das Unbedingte nicht
über alles schätzen bzw. aufhören, nach dem Endzweck zu fragen, und stattdessen
lernen, sich mit dem Irdisch-Vorübergehenden abzufinden? Vielleicht könnte der
77 Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 421.
78 Das Thema der Liebe wird bei Iwan dramatisch aufgeladen. Es ist nicht nur die Nächstenliebe,
sondern auch die Liebe zu einer Frau (Katerina Iwanowna), aber auch im Sinne von „in Ausschweifung
versinken“ (Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 421). Es ist allerdings auch die Liebe zum
Leben („die klebrigen Blättchen“ (Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 421)) und zu seinem
Bruder Alexej (Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 374).
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
353
Mensch das Vergängliche gerade wegen seiner Vergänglichkeit lieben und sich mit
dem Minimum eines möglichst langen Verharrens im Leben und eines möglichst
guten Zusammenlebens begnügen? Gerade weil nichts anderes gegeben ist, gerade
weil der Augenblick der menschlichen Existenz das einzig Gegebene ist.
Die Fragen „über die Umgestaltung der ganzen Menschheit, über eine neue Ordnung“ sind, so Iwan Karamasow, „dieselben Fragen“ wie die nach Gott und Unsterblichkeit, „bloß vom andern Ende her“.79 Auf die Frage nach dem irdischen Reich, nach
der Möglichkeit eines Zustands der fortdauernden Zufriedenheit für die größtmögliche
Zahl der Menschen werden bei Dostojewski mehrere Antworten gegeben, die ebenso
(und dies sollte nicht überraschen) zu den Kontroversen und zur Dialektik der Vernunft führen. Die berühmteste unter ihnen ist die Antwort Iwans bzw. der von ihm als
Dichter erschaffenen Figur des Großinquisitors. Das Kapitel Der Großinquisitor folgt
unmittelbar nach dem Kapitel Rebellion80 und setzt seine Dialektik fort. Hier wird die
Position eines eigenartigen Menschenfreundes dargestellt, der Christus und sein
Reich aus Liebe zur Menschheit ablehnt und das irdische Reich des Friedens und des
Glücks für alle seinem Reich der Auserwählten entgegensetzt. Das Christentum und
der Sozialismus, das Himmelsreich und das irdische Reich, die Kirche und der Staat,
die Gnade und das Gesetz81 werden hier auf schärfste Weise miteinander konfrontiert.
Aber bevor wir diese berühmteste Episode des Romans und vielleicht der Schriften
Dostojewskis überhaupt näher betrachten, müssen wir uns noch seinen früheren
Variationen des Themas zuwenden, in denen die Suche nach einer Lösung der sozialen Probleme der Gegenwart allmählich in die existentiellen Fragen nach dem Sinn
des Irdischen übergeht. Die Trennung von den Sozialisten, wie z. B. von Belinski, die
die Idole seiner Jugend gewesen waren, ist nicht mit einem Mal geschehen. Von den
Aufzeichnungen aus einem Totenhaus zu Die Dämonen und Die Brüder Karamasow
führte ein langer Weg, auf dem die sozialen Ideale und die ihnen entsprechenden
Ideen sorgfältig geprüft werden sollten.
Den wichtigsten Meilenstein auf diesem Weg stellen die Aufzeichnungen aus dem
Kellerloch dar – das Werk, das Nietzsche so sehr faszinierte, dass er Dostojewski den
einzigen Psychologen nannte, von dem er selbst „Etwas zu lernen“ hat (GD Streifzüge,
45, KSA 6, S. 147). Diese Psychologie geht u. a. auf unsere Fragestellung nach dem
Sinn des irdischen Reichs zurück und kommt der Dialektik Iwans zuvor. Ich werde
möglichst kurz auf sie eingehen.
79 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 373.
80 Die Übersetzung „Empörung“ (Dostojewski, Die Brüder Karamsow, Bd. 1, S. 378) finde ich nicht
zutreffend. Es handelt sich nicht bloß um ein Gefühl, sondern um den Aufstand gegen die Welt Gottes
(„бунт“).
81 Diese Entgegensetzung geht sehr weit in der altrussischen Literatur zurück und ist stets im
kulturellen Bewusstsein präsent. Schon in einem der frühen russischen Schriftdenkmäler, Das Wort
über die Gnade und das Gesetz des Metropoliten Ilarion aus dem 11. Jh., wurde sie ausdrücklich
thematisiert.
354
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Der Ausgangspunkt im Errichten aller irdischen Reiche, die Plausibilität oder,
wie Dostojewskis Kellerlochmensch sagt, das Axiom, das am Anfang jeder sozialen
Theorie steht, ist die Überzeugung, dass alle zu lösenden Probleme der Menschheit
aus dem Konflikt zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen und aus der Unvereinbarkeit des unterschiedlichen Nutzens resultieren – der Eigennutz gegen den Nutzen der anderen, eigenes Glück gegen fremde Glückseligkeit. Darin sind sich alle
Denker einig, die die Menschheit beglücken wollen.82 Von hier an scheiden sich
die Geister. Denn manche Theoretiker des allgemeinen Glücks setzen die Moralität
dem Eigennutzen entgegen, manche dagegen behaupten, das Moralische erfolge
aus dem Wohlstand oder vice versa. Der eigentliche Konflikt bestehe jedenfalls
nicht zwischen dem Allgemein-Nützlichen und der Moral, sondern zwischen den
Arten der Nützlichkeit. Um ihn zu lösen, müsse der Eigennutzen mit dem Allgemein-Nützlichen harmonisiert bzw. ihm untergeordnet werden; so würde schließlich eine Gesellschaftsordnung errichtet werden, in der der Egoismus des einen mit
dem Egoismus der anderen am besten und mit den geringsten Aufopferungen
vereinbar sein könnte. Im Tagebuch wird dieser Gedanke folgendermaßen ausgedrückt:
Wie können die Menschen sich so vereinigen, dass jeder sich weiter über alles lieben könnte,
dabei keinen anderen gestört hätte und auf diese Weise alle miteinander leben könnten, als ob es
eine einträchtige Gesellschaft wäre. (DGA 25, S. 117)
Da der Einzelne von den anderen Menschen abhängig ist, müsse er früher oder später
einsehen, dass das Gebäude des Gemeinwohls der sicherste Weg zu seiner eigenen
Glückseligkeit ist. Denn nur weil der Mensch seine wahren Interessen verkennt, könne
er das Böse tun bzw. das Gemeinwohl schädigen. Wenn er in diesem Sinne aufgeklärt
wird, werde er sofort zum Guten übergehen. Diese Logik war auch Kant nicht fremd:
Nur die selbst verschuldete Unmündigkeit mache den Menschen zum logischen,
moralischen und ästhetischen Egoisten. Er verkenne dabei das wahre Interesse seiner
Vernunft sowie auch seine Bestimmung als Staatsbürger und Bürger im Reich der
Zwecke. Sein wahres Interesse, das Interesse seiner Vernunft, liege bei dem Allgemeinen und er würde, wenn es nur auf seine Vernunft ankäme, nicht nur die eigene,
sondern ebenso die fremde Glückseligkeit anstreben; es würde keinen Konflikt zwischen ihnen geben, auch wenn letzterer für die ästhetisch bedingten Vernunftwesen
unlösbar zu sein scheint.
Gerade an diesem Punkt setzt der Kellerlochmensch ein. Er weist direkt auf die
erste Plausibilität dieser Ausführungen hin:
O sagen Sie mir doch, wer war der erste, der die Behauptung aufstellte und die Lehre verkündete,
der Mensch begehe nur deswegen Schlechtigkeiten, weil er seine wahren Interessen nicht kenne;
wenn man ihn darüber aufkläre, ihm die Augen über seine wahren, normalen Interessen öffne,
82 Dostojewski denkt dabei primär an Fourier und Saint-Simon.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
355
dann werde der Mensch sogleich aufhören, Schlechtigkeiten zu begehen, und sogleich gut und
edel werden; denn wenn er über seinen wahren Vorteil aufgeklärt sei und diesen verstehe, so
werde er im Guten seinen eigenen Vorteil erkennen; nun könne aber bekanntlich kein Mensch
wissentlich gegen seinen eignen Vorteil handeln; folglich werde er mit Notwendigkeit anfangen,
das Gute zu tun. O du Säugling! O du reines, unschuldiges Kind!83
Nicht nur das aufklärerische Pathos Kants, auch Nietzsches Verdacht gegen die
Triebfeder der Uneigennützigkeit ist somit überboten. Denn nicht nur die Moral verkennt dem Kellerlochmenschen nach ihre Triebfeder, sondern auch der Egoismus. Er
ist immer noch zu vernünftig gedacht. Aber nicht im Sinne Nietzsches, nämlich dass
immer mehrere Bedürfnisse im Spiel sind, die aneinander reiben und zur Zerstörung
führen können. Auch dies wäre für Dostojewskis Protagonisten eine viel zu vernünftige, d. h. eine naive, Erklärung. Vielleicht ist es über den Gegensatz des Moralischen
und des Pragmatischen hinaus möglich, auch gegen die eigenen Bedürfnisse, gegen
das eigene Interesse zu wollen. Vielleicht ist nicht nur die fremde Glückseligkeit ein
scheinbares Ziel und ihre Verfolgung eine bloße Heuchelei, sondern auch die eigene.
Die eigene Glückseligkeit wird nicht bloß verkannt, sondern sie ist ein scheinbares, vom Menschen selbst verachtetes Ziel. Dem binären Gegensatz zwischen der
Selbstliebe und der Moral, den Nietzsche genealogisch relativierte, setzt Dostojewskis
Mensch einen trinären entgegen: Vielleicht kann man gegen den eigenen Nutzen
etwas wollen, aber das dennoch nicht im Namen der Vernunft und des höchsten Guts
aus Vernunft:
Warum haben sie sich gerade die Vorstellung zurechtgemacht, daß der Mensch unbedingt ein
vernünftiges, vorteilhaftes Wollen brauche? Was der Mensch braucht, ist einzig und allein ein
selbstständiges Wollen, was auch immer diese Selbstständigkeit kosten und wohin auch immer
sie führen mag.84
Dostojewski übersetzt dabei dieses unvernünftige, vernunftwidrige, aber auch unnütze Wollen ironisch in die Sprache der Bedürfnisse:
Das ist es eben, meine Herren: Gibt es nicht tatsächlich etwas, was fast jedem Menschen teurer ist
als seine besten Vorteile, oder (um nicht gegen die Logik zu verstoßen) gibt es einen vorteilhafteren Vorteil […], der wichtiger und vorteilhafter ist als alle anderen Vorteile, und um deswillen der
Mensch nötigenfalls bereit ist, gegen alle Gesetze zu handeln, das heißt gegen Vernunft, Ehre,
Ruhe, Wohlleben, kurz, gegen alle diese schönen, nützlichen Dinge, wenn er nur diesen uranfänglichen, vorteilhaftesten Vorteil erlangt, der ihm teurer ist als alles?85
Dieser „vorteilhafteste Vorteil“ ist nur paradox zu denken, weil die Vorteilhaftigkeit in
diesem Fall gar nicht eingesehen werden kann. Mit dieser Übersetzung in die Sprache
83 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 33 f.
84 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 42.
85 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 36.
356
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
der Bedürfnisse wird die Idee der Nützlichkeit selbst paradoxiert: Die größte Nützlichkeit besteht vielleicht darin, etwas gegen den eigenen Nutzen zu wollen. Nichts kann
dem Willen, der diesen neu entdeckten Vorteil verfolgt, als Leitfaden dienen. Es soll
nicht unbedingt der Wille zur Zerstörung sein, obwohl er sich gewöhnlich gerade
durch Zerstörungssucht äußert. Ihr einziges Prinzip ist, sich allem Erklärbaren zu
widersetzen, sei es eine Erklärung durch das Bedingte oder durch das Unbedingte,
durch tierische Neigung zur Selbsterhaltung oder durch das Interesse der Vernunft. Es
ist der Wille zum Eigenwillen, zur Torheit einer Marotte, d. h. das Verlangen nach
einer „Garantie“, dass „das eigene Belieben“ immer möglich bleibt, um „erforderlichenfalls danach handeln zu dürfen“.86 Es ist die Willkür, die weder die Befriedigung
einer empirischen Neigung sucht noch das Interesse eines vernünftigen Wollens. Sie
sucht die Freiheit von beidem. Sie ist die Freiheit eines unvernünftigen Wollens. Und
diese Freiheit ist der Endzweck, sie setzt sich um ihrer selbst willen, „um nur auf [dem
eigenen] Willen zu bestehen“.87
In dieser Torheit der Willkür und nicht im Folgen der Stimme der Vernunft, so
der Kellerlochmensch, zeigt sich die wahre Anlage zur Menschheit. Denn der Verdacht ist zu groß, dass auch durch die Vernunft, die kategorisch gebietet, der Mensch
zu einem bloßen Werkzeug, zu einem Mittel herabgewürdigt wird, sei es als Mittel zur
ewigen Harmonie oder auch zur eigenen Glückseligkeit. Sein Wollen ist mit dieser
Vernunft offensichtlich nicht identisch. Dennoch ist dieses Wollen keinesfalls etwa
der Wille im Sinne Schopenhauers, kein vernunftloser Drang zur Befriedigung der
Bedürfnisse und zur Selbsterhaltung. Der Eigenwille des Kellerlochmenschen widersetzt sich der Logik der Bedürfnisse, wie die Vernunft Iwan Karamasows sich der
Logik des höchsten Guts zu widersetzen wusste. Die ganze Menschheitsgeschichte
zeige, dass
der Mensch immer und überall, wer es auch gewesen ist, es geliebt hat, so zu handeln, wie er
wollte, und durchaus nicht so, wie es ihm die Vernunft und der Vorteil befahlen.88 (meine Hervorhebung – E.P.)
Die Unterscheidung von Handlung aus Vernunft und Handlung aus Neigung wird
somit radikal außer Kraft gesetzt, nicht indem sie in einem Dritten versöhnt bzw. die
eine auf die andere reduziert, sondern indem sie mit dem Dritten konfrontiert wird:
mit der Handlung aus Eigenwillen. Letzteres folgt nur einem negativen Prinzip –
einem Gegenprinzip, das alle Gründe des Willens leugnet, seien es die der vernünftigen oder der vernunftwidrigen Willkür. Die Menschheit selbst, um den kantischen
Ausdruck zu verwenden, bestehe nicht mehr in der Vernünftigkeit, sondern gerade
umgekehrt im Recht auf Unvernünftigkeit:
86 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 55.
87 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 50.
88 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 41.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
357
der Mensch wird absichtlich verrückt werden, um keine Vernunft zu haben und auf seinem
Willen zu bestehen.89
Die Wünschbarkeit ist somit auch für Dostojewski, wie für Nietzsche, der eigentliche
„deus“ der Menschheit, aber nur in dem Sinne, dass sie das einzig Wertvolle ist, dass
sie als Gott verehrt wird und dass ihr alles aufgeopfert werden soll – auch die Vernunft, auch das eigene Wohl und die eigene Glückseligkeit.
Das Recht auf Unvernunft, das die Menschheit in jedem Menschenwesen ausmacht, muss allerdings stets bewiesen werden, v. a. sich selbst. Mehr noch: Dostojewskis Mensch behauptet, dass
alles menschliche Tun, wie es scheint, tatsächlich nur darin besteht, daß der Mensch alle Augenblicke sich selbst den Beweis liefert, daß er ein Mensch und kein Walzenstift sei!90
Der Mensch muss sich beweisen, dass er keine „Klaviertaste“ ist,91 was es ihn auch
kosten mag – die Zerstörung, die Selbstzerstörung, die Grausamkeit gegen andere und
gegen sich selbst, aber auch die Selbstaufopferung. Er fühlt sich gezwungen, seine
Eigenwilligkeit stets zu demonstrieren bzw. die volle Unberechenbarkeit seiner Willkür andauernd nachzuweisen, weil – und dies ist für den Psychologen Dostojewski
äußerst wichtig – er seiner Sache selber gar nicht so sicher ist. Er hat nämlich sich
selbst gegenüber den steten Verdacht, dass auch dieser Eigenwille irgendwie erklärt
werden bzw. dass die Logik seiner Willkür aufgrund irgendeines Prinzips kalkulierbar
sein kann. Dieser Gedanke allein ist ihm unerträglich. Denn die Logik ist „kein
Leben“, „sondern der Anfang des Todes“.92
Der Kellerlochmensch paradoxiert somit die Selbstliebe. Statt nach Glück zu
streben, strebt man nach Leiden und „liebt“ es, „manchmal ganz außerordentlich,
leidenschaftlich“,93 viel mehr als jene Glückseligkeit, deren Fortdauer ihm nach Kant
garantiert werden sollte. Denn: „Das Leiden, das ist ja die einzige Ursache der
Erkenntnis“,94 d. h. sein einziger Stolz, das Teuerste, das Menschlichste an ihm. Dies
ist aber, das darf man nicht vergessen, die These von einem Menschen, der im Untergrund, in einem Kellerloch, lebt, der, wie die Erzählung Dostojewskis zeigt, gar nicht
mehr glücksfähig ist, der die Zusammenstöße mit dem Leben nicht ertragen kann.
89 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 50.
90 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 50.
91 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 50.
Dieser Ausdruck ist eine Anspielung auf Denis Diderots Le rêve de d’Alembert, in dem die Wirkungen
der Natur auf die Menschen und deren Auseinandersetzungen mit dem Anschlagen von Klaviertasten
verglichen wurden.
92 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 54.
93 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 55.
94 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 41.
358
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Vom Kellerloch her kommt er zu dem Schluss, der schon zu erwarten ist: Das Gebäude
des auf Vernunft gegründeten Gemeinwohls der Menschheit – wenn es auch möglich
wäre, eines zu errichten – ist ihm unerwünscht. Er weiß, dass er sich damit „persönlich kompromittiert“.95 Aber Dostojewskis Protagonist kompromittiert, genauso
wie Nietzsche, durch die von ihm vertretene These seine Leser, die an die Nützlichkeit
glauben, d. h. das Leben nur auf nackten Nutzen gründen wollen.96
In Aufzeichnungen aus dem Kellerloch wie auch an vielen Stellen im Tagebuch
eines Schriftstellers finden wir Dostojewskis Lieblingsmetapher für ein harmonisches
Zusammenleben – „ein bewundernswürdiges Gebäude […], dessen Bauart ewig unverändert bleibt: de[r] Ameisenhaufen.“97 Aber der Mensch ist keine Ameise. Das
„Kristallene[ ] Schloß“ der berühmten Utopisten, die auch menschliche Leidenschaften „in der Tabelle ausgerechnet“98 zu haben meinen und so das Gemeinwohl und
das friedliche Zusammenleben versichern wollen, ist deshalb nichts anderes als „ein
Hühnerstall“ oder „eine Mietskaserne […] mit Wohnungen für arme Leute“.99 Sie
können dem Ideal aus einem einfachen Grund nicht entsprechen:
Die Ameise kennt die Formel ihres Ameisenbaues […], aber der Mensch kennt seine Formel
nicht.100
Das Gute des Ameisenhaufens bedeutet, bloß „das nackte Leben zu retten“. Und so
steht in Dostojewskis Tagebuch:
Aber das ‚Retten des eigenen Lebens‘ ist von allen Ideen, die die Menschen zu vereinigen suchen,
die schwächste und letzte, in jeder Beziehung. Sie ist schon der Anfang vom Ende, ist die Vorahnung des Endes.101
Für den Menschen gäbe es keinen Zustand, mit welchem er, wie es Kant wollte,
zufrieden wäre, und schon gar keine Gewissheit für eine solche Zufriedenheit. Die
Glückseligkeit habe keinen Maßstab. Die Utopisten seien schon deshalb immer im
95 Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 37.
96 Vgl. bei Nietzsche die „Religion der Behaglichkeit“ der modernen Menschen (FW 338, KSA 3,
S. 567). Vgl. eine Nachlassnotiz aus der Zeit, zu der Nietzsche Dostojewski liest: „Man will nicht sein
‚Glück‘; man muß Engländer sein, um glauben zu können, daß der Mensch immer seinen Vortheil
sucht“ (November 1887–März 1888, 11[89], KSA 13, S. 42).
97 Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 53.
98 Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 40.
99 Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 58. Die „Kristallschlösser“ sind ein Bezug auf
Was tun?, einem berühmten zeitgenössichen Roman von Tschernyschewski. Die „in der Tabelle
ausgerechneten“ Leidenschaften sind eine Anspielung auf Fouriers „Phalanstères”, wo aus zwölf
Leidenschaften und ihren Kombinationen 810 verschiedene Charaktere gefolgert werden, woraus die
friedliche Zusammenarbeit und das Zusammenleben der jeweils 1620 Menschen resultieren sollte (s.
dazu Ahlrich Meyer, Frühsozialismus: Theorien d. sozialen Bewegung 1798–1848, S. 59–94).
100 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 539.
101 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 542.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
359
Unrecht. Weder die Vernünftigkeit noch die Nützlichkeit bieten eine Formel des Gemeinwohls. Der Mensch ist ein doppelter Aufrührer: Er strebt nicht nur nicht nach der
fremden Glückseligkeit bzw. dem Gemeinwohl („[D]ie Welt möge untergehen, wenn
ich nur immer meinen Tee trinken kann“102), er will auch nicht sein eigenes Wohl. Das
Glück ist nicht sein höchstes Ziel, nicht einmal sein persönliches Glück.103 Auch die
eigene Glückseligkeit kann er einer fantastischen Marotte, der Unvernunft seiner
Eigenwilligkeit, zum Opfer bringen.
Mit dem Bild eines riesigen Ameisenhaufens drückt Dostojewskis Mensch seinen
Widerwillen gegen das vernünftige Zusammenleben, gegen den sozialen Wohlstand
als höchstes Ideal der Menschheit aus. Wenn das höchste Gut im Jenseits für die
irdische Vernunft verwerflich sein soll, ist das aus ihr entstandene soziale Ideal immer
unzureichend, ja ihr in gewissem Sinn entgegengesetzt. Alles Streben nach dem
Gemeinwohl gründet sich auf die Berechenbarkeit der menschlichen Interessen, auf
mathematisch kalkulierbaren Profit, auf eine Versicherung, dass jedem sein Wille,
jedoch nur der vernünftige Wille, garantiert wird. Das „zweimal zwei ist vier“ ist zwar
„ein Gesetz der Logik“, aber noch lange kein „Gesetz der Menschheit“.104 Es ist das
Gegengesetz zu dem ihrer Eigenwilligkeit:
Ach, meine Herren, was ist das dann noch für ein eigener Wille, wenn die Sache schon bis zur
Tabelle und bis zur Mathematik gediehen ist und nur noch der Satz: ‚Zweimal zwei ist vier‘ gilt?
Zweimal zwei wird auch ohne meinen Willen vier sein. Kann man da überhaupt noch von freiem
[eigenem – E.P.] Willen reden?105
Das Glück, wie das Leben selbst, lässt sich nicht in eine Formel zwingen. Die von
den sozialistischen Utopisten, darunter Fourier, Saint-Simon und vor allem Auguste
Comte, gesuchte Formel „wie können die Menschen sich so vereinigen, dass jeder
sich über alles lieben könnte“ (DGA 25, S. 117), kann es dementsprechend gar nicht
geben. Wie sollte man das Gemeinwohl erreichen, wenn dem nicht der Eigennutz,
nicht der Egoismus, sondern eine fantastische Marotte im Wege steht? In Die Dämonen, dem Roman, dessen Pathos gegen die sozialistische Bewegung gerichtet war,
wird der Fourierist Schigaljow eine solche Lösung darbieten. Von ihm sagt der
Sozialist-Terrorist Werchowenski, er sei „ein Genie […] à la Fourier, aber kühner
als Fourier, stärker als Fourier“.106 Die Lösung sei allein folgendermaßen mög-
102 Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 189.
103 Auf das Glücklich-Sein als höchstes, nicht weiter hinterfragbares Ziel wies schon Sokrates bei
Platon ohne Weiteres hin (Symposion, 205a). Ihm ging es darum, zu beweisen, dass das Gute bzw. das
Gerecht-Sein gerade das Glück ausmacht. Zum Verhältnis dieses „eudämonischen“ Gedankens bei
Platon und Kant s. Hermann Weidmann, Kants Kritik am Eudämonismus und die Platonische Ethik.
104 Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 52.
105 Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 51. Die Übersetzung ist von mir korrigiert:
DGA 5, S. 117.
106 Dostojewski, Die Dämonen, S. 581.
360
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
lich:107 Das fantastische Element, die Eigenwilligkeit, die der irdischen Harmonie im
Wege steht und das Gebäude des Gemeinwohls immer wieder zerstört, ist nur durch
eine neue Tyrannei zu bewältigen. Das bedeutet vor allem, wie Werchowenski andeutet, Vernichtung der Talente:
Cicero wird die Zunge ausgeschnitten, Kopernikus werden die Augen ausgestochen, Shakespeare
wird gesteinigt, das ist Schigalewismus!108
Der nächste Schritt ist die Tilgung aller „aristokratischen“, d. h.: ungewöhnlichen,
unpraktischen Bedürfnisse, wie das Bedürfnis nach Bildung, Langeweile und das
Streben nach Auszeichnung:
Wir bringen ihn um, diesen Wunsch: wir verbreiten Trunksucht, Klatsch, Anzeigerei; wir verbreiten unerhörte Demoralisation, jedes Genie wird schon in der Kindheit ausgelöscht. Alles wird
auf einen Nenner gebracht, um der vollständigen Gleichheit willen. ‚Wir haben ein Handwerk
erlernt und sind ehrliche Leute, das genügt uns‘, das war vor kurzem die Antwort englischer
Arbeiter. ‚Notwendig ist nur das Notwendige‘, das wird von nun an der Wahlspruch des Erdballs
sein.109
Die Befriedigung der gemeinen Bedürfnisse muss dagegen möglichst begünstigt werden – als ein Minimum, das für das Überleben notwendig ist. V. a. aber soll die Idee
verbreitet werden, dass die Befriedigung der durchschnittlichen Bedürfnisse die einzige Freiheit des Menschen, seine einzige Bestimmung sei; und noch wichtiger ist,
dass dieses Minimum der Bedürfnisse bei allen Menschen gleich ist, dass derjenige,
der mehr will, als Ausgestoßener, als Feind behandelt werden soll. Schigaljow gibt
eine Formel dieses zukünftigen Gemeinwohls an:
Jeder gehört allen und alle jedem. Alle sind Sklaven und in der Sklaverei einander gleich.110
Er kommt dabei zu einer gravierenden Paradoxie:
Nachdem ich von unbeschränkter Freiheit ausgegangen bin, komme ich zum Schluß zu unbeschränktem Despotismus.111
Dies ist nach Dostojewski die unumstößliche Paradoxie der Idee des Gemeinwohls:
Die Freiheit wird immer als Ausgangspunkt vorausgesetzt, um dann bedingungslosen
Gehorsam zu verlangen.
107 Vgl. „[…] [I]ch muß hinzufügen, daß es außer meiner Lösung des Problems der sozialen Formel
eine andere Lösung überhaupt nicht geben kann.“ (Dostojewski, Die Dämonen, S. 560)
108 Dostojewski, Die Dämonen, S. 581.
109 Dostojewski, Die Dämonen, S. 582.
110 Dostojewski, Die Dämonen, S. 581.
111 Dostojewski, Die Dämonen, S. 560.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
361
Die Idee eines fortdauernden bzw. versicherten Gemeinwohls wird so bei Dostojewski, genauso wie die Idee des höchsten Guts, tief kompromittiert. Die Despotie ist
ihr Schicksal und die einzig denkbare Erlösung der Welt. Aber nicht nur sozialistische
Atheisten vertreten dieses Ideal. Es sei gar nicht so neu und revolutionär wie man
annimmt. In ihren Träumen über die „Kristallschlösser“, im Ideal eines riesigen
Ameisenhaufens treffe man, so Dostojewski, eigentlich das alte christliche Ideal, das
des römischen Katholizismus. Im Unterschied zu Kant und besonders zu Tolstoi zieht
Dostojewski eindeutig eine konfessionelle Grenze, ohne die nicht nur seine Deutung
des Christentums, sondern auch seine moralischen Ansichten unverständlich bleiben müssen. Der Westen habe Christus verraten, nur noch im Osten sei das wahre
Christentum bewahrt.
Es ist Dostojewskis bekannteste und für die russische Philosophie einflussreichste
These gewesen, dass die Kirche des Westens
der dritten Versuchung des Satans nicht widerstanden habe, und daß Rom, wenn es alle Welt
lehrt, Christus könne ohne Erdenreich auf Erden nicht bestehen, damit den Antichrist verkünde
und die ganze westliche Welt zugrunde gerichtet habe.112
Die dritte Versuchung Christi bestand gerade im Angebot des Satans, ihm das irdische
Reich zu Füßen zu legen. Die Kirche des Westens sei dieser Versuchung verfallen,
indem sie die Aufgabe, ein irdisches Reich zu errichten, übernommen oder, wie
Dostojewski es ausdrückt, einen riesigen Ameisenhaufen, einen Palast des irdischen
Gemeinwohls zu ihrem Ziel gemacht habe. Sie diene damit schon lange nicht mehr
Christus, sie verkünde den Antichristen – den Christus, der sich vor Satan gebeugt
hat.
[…] und nun sei er, der Papst selber, bereit, […] Christus zu opfern, und statt an Ihn, gleichfalls an
den menschlichen Ameisenhaufen zu glauben. Der römische Katholizismus (das ist schon allzu
klar) bedarf nicht Christi, sondern der Weltherrschaft […]113
Sie verkünde jedoch damit gerade das sozialistische Ideal. Eigentlich ist es ihr eigenes
Ideal. Auch die sozialistische Bewegung Europas ist nur noch eine verspätete Folge
ihres fortdauernden Willens zur irdischen Herrschaft.114
112 Dostojewski, Die Dämonen, S. 342.
113 Dostojewski,Tagebuch eines Schriftstellers, S. 370. Die Idee des Westens sei immer die des Menschengottes gewesen, dagegen habe die Orthodoxie den Gottmenschen, Christus, verkündigt (Dostojewski,Tagebuch eines Schriftstellers, S. 547). Diese Idee Dostojewskis wird zur Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert zum Leitfaden u. a. für den Schriftsteller Dmitri Merezhkowski, der Verfasser der
Trilogie Christus und der Antichrist.
114 Vgl. Dostojewskis Gespräch mit Belinski. Christus würde sich, wenn er zu unserer Zeit erschienen
wäre, nach Belinski entweder „als der unauffälligste und gewöhnlichste Mensch erweisen“ oder er
„würde sich der Bewegung anschließen und sich an ihre Spitze stellen“ (Dostojewski, Tagebuch eines
Schriftstellers, S. 22).
362
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Es sei hier nicht unerwähnt gelassen, dass Dostojewski mit seiner Philosophie der
Geschichte in diesem Punkt Nietzsches Figur der Selbstaufhebung des Christentums
sehr nahe kommt. Es handelt sich bei ihm allerdings nur um Westeuropa: Durch die
Reformation werde die Verlogenheit des Katholizismus offenbart, der Protestantismus
selbst sei jedoch nur noch eine Vorstufe des Atheismus und schließlich des Nihilismus. Die eigentliche Macht sei und bleibe darum die römische Kirche. Und sie sei gar
nicht so schwach wie man am Ende des 19. Jahrhunderts glaube.115 Auch zu Zeiten der
historischen Niederlage dürfe man die innere Kraft des Reichs des Antichristen nicht
unterschätzen. Zwar erscheint die Kirche selbst nicht mehr als glaubwürdig, aber die
von ihr eingesetzte Kraft sei immer noch im Gang – in der sozialistischen Bewegung,
die sich für ihren Rivalen und Konkurrenten hält und sich selbst dabei missversteht.
Die Letztere sei deshalb viel schwächer als das Christentum des Westens, das sie
hervorgebracht hat. Denn sie verkenne nicht nur ihre Grundlage, sondern sei von
einem oberflächlichen Optimismus gekennzeichnet. Was die Utopisten (nicht der
geniale Schigaljow, der stärker und kühner als Fourier ist) in ihrer Naivität, in ihrem
Glauben an die gute Natur der Menschen nicht berücksichtigen, ist die Willkür, der
Wille zur Unvernunft, die fantastische Marotte, der „vorteilhafteste Vorteil“ der Eigenwilligkeit. Sie meinen ihn entweder mit Bedürfnis-Kalkulationen bzw. mit Vorteilsnachweisen oder aber im Notfall mit grober Gewalt beseitigen zu können. Der römische Katholizismus dagegen gehe damit viel klüger um, darum sei seine Macht
unumstößlich: Die Freiheit der Willkür muss dem Menschen zuerst genommen werden, um ihn glücklich zu machen. Doch dies soll auf eine Art und Weise getan
werden, dass ihm die Illusion bleibt, es geschehe nach seinem eigenen Willen. Nur
durch einen Betrug kann das Gemeinwohl, der Ameisenhaufen, vollendet werden.
Der Großinquisitor (die von Iwan Karamasow erfundene Figur) setzt gerade bei
dem „vorteilhaftesten Vorteil“, bei der Willkür, ein. Letztere ist eine unheimliche
Bürde – die Bürde der Menschheit. Ihr Prinzip ist bloß negativ: Der Mensch hegt
immer wieder den Verdacht, man habe ihn seiner Freiheit beraubt. Er muss es sich
selbst stets beweisen, indem er alle „Kristallschlösser“ und sich selbst zerstört. Er sei
damit ein schwacher Rebell, d. h.: er rebelliere stets, aber aus Schwäche, aus dem
Unglauben an die eigenen Kräfte, aus dem Misstrauen gegen sich selbst. Er sei somit
unglücklich, so der Großinquisitor:
Der Mensch ist geschaffen zum Aufrührer; können denn Aufrührer glücklich sein?116
Dieses Unglück, diese Herausforderung des eigenen unvernünftigen Wollens, wird
auf Dauer unerträglich, denn man erreicht niemals sein Ziel – die garantierte, bewie-
115 Vgl. den ganzen Abschnitt: „Sie sind böse, aber auch stark“ (Dostojewski,Tagebuch eines Schriftstellers, S. 365 ff.).
116 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 402.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
363
sene Freiheit. Paradoxerweise mündet die Verzweiflung an den eigenen Kräften im
entgegengesetzten Streben, nämlich darin, die eigene Willkür loswerden zu wollen.
Daher all die Träume um „Kristallschlösser“ und all das Bemühen um den Ameisenhaufen. Als „schwächlicher Aufrührer“117 befinde sich der Mensch immer zwischen
zwei Trieben: zwischen dem Willen zur uneingeschränkten Freiheit und zum bedingungslosen Gehorsam.
Es gibt keine anhaltendere und quälendere Sorge für den Menschen als die, daß er, frei geworden, so rasch wie möglich den fände, den er anbeten würde.118
Was der Mensch „auf Erden zu erreichen sucht“, ist
einen zu finden, den er anbetet, dem er sein Gewissen aushändigt, und zu erfahren, auf welche
Weise sich schließlich alle zu einem unbestreitbaren allgemeinen und einträchtigen Ameisenhaufen vereinigen würden.119
Der Großinquisitor Iwans kennt somit allein den sicheren Weg zum Gemeinwohl, er
kennt die „menschliche Formel“, nämlich
das anzubeten, was schon unbestritten ist, so unbestritten, daß alle Menschen sogleich bereit
sind, es gemeinsam anzubeten […] unbedingt alle gemeinsam. […] Der Mensch hat keine quälendere Sorge, als den zu finden, dem er so schnell wie möglich jene Gabe der Freiheit, mit der dieses
unglückselige Wesen geboren wird, überlassen könnte. Herrschaft über die Freiheit der Menschen erlangt aber nur der, der ihr Gewissen beruhigt.120
Gerade dies wäre die Tat der wahren Liebe, weil sie Millionen gescheiterter Rebellen
Glück, sicheres Glück verschafft.
Die Ruhe des Gewissens ist notwendig, um den Ameisenhaufen zu vollenden.
Aber diese Ruhe ist auf dem Weg der Freiheit niemals möglich. So ist die Position des
Inquisitors noch radikaler als das, was Iwan vorher vertreten hat. Nicht nur die Liebe
zu den Menschen widerspricht der Idee der ewigen Harmonie bzw. Gott und der
Unsterblichkeit. Sie steht auch der dritten Idee der Vernunft, der der Freiheit, entgegen. Wer frei ist, muss nämlich auf eigene Gefahr und eigenverantwortlich zwischen Gut und Böse entscheiden. Aber diese Bürde ist dem Menschen viel zu schwer,
der Richterspruch des Gewissens ist viel zu hart. Die Leiden des Gewissens sind ein
Fluch, das Leiden an der eigenen Freiheit ist unerträglich. Die Wohltat des Großinquisitors besteht gerade darin, diesen „Fluch der Erkenntnis des Guten und des
Bösen“ der gehorsamen Herde abzunehmen – den Fluch des Gewissens, den Fluch
117
118
119
120
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 408.
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 406.
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 412.
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 406 f.
364
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
der unerträglichen Bürde der Freiheit. Wenn es ein Betrug ist, so ist es einer, der
glücklich macht – ein Beruhigungsmittel der Willkür, ein Betäubungsmittel des Gewissens. Für die, die einem solchen Betrug verfallen, gibt es keine Rebellion mehr,
keine Dialektik der Vernunft, keinen Wunsch der Selbstvernichtung. Aber natürlich
auch keine Freiheit, die als geheimnisvolle Alternative zur Wahrheit des Großinquisitors angedeutet wurde.
Das Glück ist nur ohne Freiheit möglich. Indem er alle drei Versuchungen des
„fruchtbare[n] und kluge[n] Geist[es]“121 ablehnte, indem er auf den Ameisenhaufen
verzichtete, hat Christus dagegen so gehandelt, als ob er die Menschen gar nicht
liebte:
Und Du, statt fester Grundlagen, die erlaubt hätten, das menschliche Gewissen ein für allemal zu
beruhigen, wähltest Du alles, was es an Ungewöhnlichem, Rätselhaftem und Unbestimmten gibt,
wähltest alles, was die Kräfte der Menschen übersteigt, und darum hast Du so gehandelt, als
liebtest Du sie überhaupt nicht […] Statt Dich zum Herrn über die menschliche Freiheit zu
machen, hast Du sie noch vermehrt, und mit ihren Qualen hast du das Seelenreich des Menschen
für alle Zeiten belastet. […] Nicht gezwungen von dem starren überkommenen Gesetz, nein, mit
freiem Herzen sollte der Mensch künftig selbst entscheiden, was gut und böse ist, und sich lenken
und leiten zu lassen, hätte er einzig Dein Bild vor sich; aber hast Du denn gar nicht daran gedacht,
daß er schließlich sogar Dein Bild und Deine Wahrheit verwerfen und bestreiten wird, wenn man
ihn mit einer so furchtbaren Last peinigt, wie es die Freiheit der Wahl ist?122 (meine Hervorhebung – E.P.)
Christus habe das Gewissen nur weiter beunruhigt und die Torheit der Eigenwilligkeit
zum Ausgangspunkt der neuen Freiheit erhoben, zum Zeichen der Göttlichkeit. Nur
die Kirche, genauer gesagt die römische Kirche und, noch genauer, die Inquisition,
habe diese Anti-Erlösungstat wiedergutgemacht. Denn die Freiheit Christi, diese unheimliche Bürde, die er den Menschen auferlegte, sei nur einigen Auserwählten
erträglich, den „Söhnen der Freiheit“, die ihm auf diesem härtesten aller Wege frei
folgen wollen. Dem Rest der Menschheit, der Mehrheit, werde diese neue Freiheit
dagegen ein noch viel größeres Leiden bereiten: das Leiden der schwachen Rebellen,
die die Freiheit nicht ertragen können, die ihre Willkür loswerden müssen, um glücklich zu sein. Diese Freiheit sei der Fluch der Menschheit und das Geheimnis, das von
der Kirche bewahrt wird. Es ist ihr Verrat an Christus („Wir sind nicht mit Dir, sondern
mit ihm – das ist unser Geheimnis!“123), aber auch oder gerade deswegen ist es eine
Tat der Liebe. Denn nur so könne der Friede auf Erden wirklich gestiftet werden. Alle
Scheiterhaufen, alle Grausamkeiten der Inquisition seien nichts im Vergleich mit
dieser durch sie bewirkten Wohltat. Denn dem Wert des Gemeinwohls, dem Wert des
Glücks der Menschheit könne nichts entgegengesetzt werden.
121 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 403.
122 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 408.
123 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 412.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
365
Mit der Figur des Großinquisitors zeigt sich am prägnantesten das, was in der
Einleitung zu diesem Kapitel betont wurde: Die Gedanken, die im Tagebuch eines
Schriftstellers sehr direkt ausgesprochen werden und übertrieben zu sein scheinen,
werden in seinen Romanen vertieft und gewinnen gewaltig an dialektischer Kraft. So
ist die Idee des irdischen Reichs, die im Katholizismus und seinem atheistischen
Zwillingsbruder Sozialismus verkörpert wird, in dem Drama Iwans nicht bloß unwiderlegbar, sondern ihre Anziehungskraft ist kaum der Wahrheit von Staretz Sossima und Aljoscha, der Wahrheit Christi, unterlegen. Es ist nicht bloß der Wille zur
„Weltherrschaft“, wie es im Tagebuch steht. Aljoscha äußert diese Vermutung,
jedoch weist Iwan sie als viel zu flache Interpretation zurück. Wenn es wirklich nur
um die Macht und das Verlangen nach den „schmutzigen irdischen Gütern“ ginge,124 wäre der Katholizismus nicht so mächtig. Genauso ist der Sozialist-Terrorist
Pjotr Werchowenski nicht einfach nur ein Schwindler, sondern er hat eine ‚Idee‘, er
ist „ein Enthusiast“.125 Dies ist die Idee der irdischen Harmonie, des irdischen
Reichs, die der Inquisitor in den Brüdern Karamasow in aller Stärke zum Ausdruck
bringt.
In einem Privatgespräch hat Tolstoi der Erinnerung von Sergi Bulgakow nach
Dostojewski vorgeworfen, dass bei ihm unklar bleibt, wer Recht behält: Christus oder
der Inquisitor. „Und ich kann beweisen, wie zweimal zwei vier ist, dass das Christentum vernünftig ist, dass es praktisch ist“, sagte er.126 Gegen dieses Zweimal-zwei-istvier hat der Kellerlochmensch rebelliert. Die Kraft eines „mathematischen“ Beweises
ist im letzten Roman Dostojewskis gerade auf der Seite des Großinquisitors:
Es wird Tausende von Millionen glücklicher Säuglinge geben und hunderttausend Dulder, die
den Fluch des Wissens um Gut und Böse auf sich genommen haben. Jene werden still sterben,
still erlöschen in Deinem Namen, und nichts als der Tod wird jenseits des Grabes ihr Teil sein. Wir
aber werden das Geheimnis hüten und um ihres Glückes willen sie locken mit himmlischem und
ewigem Lohn. Denn gesetzt auch den Fall, es gäbe etwas im Jenseits, so doch natürlich nicht für
solche, wie sie es sind.127
Das „Banner“ Christi – die Liebe zur Menschheit – wird gegen ihn erhoben.128 Aus der
Perspektive des irdischen Wohls, des irdischen Reichs ist diese Liebe selbst unmoralisch, sie ist keine wirkliche Liebe („als liebtest Du sie überhaupt nicht“). Vor dem
höchsten Gericht sieht der Großinquisitor sich nicht bloß gerechtfertigt. Er sieht sich
124 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 418.
125 Dostojewski, Die Dämonen, S. 335. Werchowenski sagt, er habe die Welt dem Papst geben wollen
und dass er sich erst später für einen Usurpator in Person von Stawrogin entschieden hat: „Der Papst
mag im Westen regieren, bei uns aber, bei uns – Sie!“ (Dostojewski, Die Dämonen, S. 583)
126 Булгаков, Простота и опрощение, S. 294.
127 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 416.
128 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 414.
366
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
selbst als Richter, vor dem der Schöpfer der Menschen sich rechtfertigen soll. Er
fordert ihn heraus.129
Aber dann werde ich aufstehen und Dich auf die Tausende von Millionen glücklicher Säuglinge
weisen, die von keiner Sünde wissen. Und wir, die wir die Sünden der Menschen um ihres
Glückes willen auf uns genommen haben, wir werden vor Dich treten und sagen: ‚Richte uns,
wenn Du kannst und darfst!‘130
Die Heldentat Christi, die rätselhaft bleibt, und die Heldentat des Inquisitors, die auf
die Opfer aus Liebe verweist, stehen in diesem grandiosen Bild einander gegenüber:
Erstere geheimnisvoll, Letztere dagegen mit klaren Argumenten ausgerüstet, aber
keine von ihnen ist der anderen überlegen. Das wird durch die ganze Struktur des
Poems bestätigt – von den ersten Ereignissen an, als Christus die Menschen heilt und
von ihnen verehrt wird, dann aber durch die Inquisition verhaftet wird, bis hin zum
Finale, als der Großinquisitor, der seinen Häftling zum Tod auf dem Scheiterhaufen
verurteilt hatte, ihn plötzlich frei lässt. Das ganze Poem besteht aus einem Monolog
des Großinquisitors. Christus schweigt. Sein Gegner macht ihm schwerste Vorwürfe,
er sei derjenige, der den Scheiterhaufen am meisten verdiene. Dennoch klingt die
lange Rede des Inquisitors eher wie eine Verteidigungsrede vor Gericht. Er spricht so,
als ob Christus ihm stets widersprochen hätte. Er fühlt sich offensichtlich durch die
Wahrheit Christi angegriffen, obwohl dieser sich nicht verteidigt. Die rätselhafte
himmlische und die logisch begründbare irdische Wahrheit stehen gegeneinander,
sie kämpfen miteinander, so scheint es zumindest dem Großinquisitor. Diese Szene
kann allerdings nicht nur als ein unversöhnlicher Kampf, sondern auch als ein Streit
von Verbündeten angesehen werden. Gerade ihr Schluss drückt diese für Tolstoi so
irritierende Unentschiedenheit aus: Christus küsst den Großinquisitor und dieser lässt
ihn gehen, obgleich mit den Worten „Geh, und kehr nie wieder… kehr überhaupt nicht
wieder … niemals, niemals!“131 Das letzte Wort in ihrem Streit bleibt unausgesprochen, zwei Wahrheiten stehen gegeneinander und werden nicht in einer dritten aufgehoben. Die Liebe kennt keinen Maßstab, kein mehr oder weniger, deswegen ist
das Opfer des Großinquisitors dem Opfer Christi nicht unterlegen. Es ist Liebe gegen
Liebe, Heldentat gegen Heldentat.
So endet das Poem von Iwan. Es bringt die zweitgrößte Idee der Menschheit
neben der der Unsterblichkeit der Seele zum Ausdruck: „die Idee einer universalen
Vereinigung (всемирного единения) der Menschen.“132 Der unumstößlichen, mathematischen Wahrheit des Großinquisitors, die das Glück der ganzen Menschheit verspricht, steht nur noch die geheimnisvolle Gestalt Christi mit seiner geheimnisvollen
129 Dies meinte wahrscheinlich Dostojewski, als er von der Blasphemie und der unerhörten Kraft der
Verleugnung Gottes in seinem Inquisitor sprach.
130 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 416.
131 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 421.
132 Dostojewski,Der Tagebuch eines Schriftstellers, S. 355.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
367
Bürde der unbeschränkten Freiheit in der Erkenntnis von Gut und Böse entgegen – als
Aufruf zur letztmöglichen Freiheit, als Aufruf an die Menschheit, gegen diese Art von
Kalkül zu rebellieren.
Und tatsächlich setzt sich hier eine ganz andere „Mathematik“ in Gang. So stellt
Iwan an seinen Bruder Aljoscha die folgende Frage:
Stell dir vor, du selber wärst es, der das Gebäude des menschlichen Schicksals errichtet mit dem
Ziele, im Finale die Menschen glücklich zu machen, ihnen schließlich Ruhe und Frieden zu
geben, dafür aber wäre die unerläßliche, unersetzliche Bedingung, daß nur eines, ein einziges so
kleines, winziges Geschöpf gemartert würde, […] und auf seine ungerächten Tränen wäre dann
dieses Gebäude zu gründen – würdest du dich bereit finden, unter diesen Bedingungen Architekt
des Gebäudes zu sein? […] Und kannst du den Gedanken gelten lassen, daß die Menschen, für die
du das Gebäude errichtest, selbst bereit wären, ihr Glück anzunehmen, wenn es sich auf das
frevelhaft vergossene Blut eines gemarterten kleinen Kindes gründete, und daß sie, wenn sie es
angenommen hätten, auf ewig glücklich wären?133
Aljoschas Antwort war zu erwarten gewesen. Ein solches Wesen, auf dessen Leiden
das Gebäude gebaut werden kann, ist Christus selbst. Er allein „kann alles verzeihen,
allen und jedem und für alles“.134Auf ihn, wie Aljoscha sagt, „gründet sich doch das
Gebäude“. Diese Worte bleiben an dieser Stelle des Romans rätselhaft, wie die
angedeutete uneingeschränkte Freiheit, wie die Gestalt Christi. Die Antwort auf die
mit Argumenten nicht widerlegbare Logik wird nicht direkt, sondern nur indirekt in
einem „Kunstbild“ gegeben. Und Dostojewski war sich, wie oben zitiert, gar nicht
sicher, dass es eine „hinreichende Antwort“ gewesen ist. Es ist kaum zufällig, dass
Aljoscha, der im Roman für diese Antwort steht, Iwan am Ende des Gesprächs küsst,
wie Christus den Großinquisitor in Iwans Poem küsste.135 Die Kontroversen der Liebe,
es sei noch einmal betont, müssen, wie die der Vernunft, unaufgehoben bleiben.
Iwan Karamasow verkörpert die Dialektik der Vernunft jedoch nicht nur als
Denker, sondern auch als Schriftsteller. Er hat sich nicht nur ein, sondern zwei Poeme
ausgedacht, oder eher: Den Großinquisitor hat er seinem Bruder erzählt, der Geologische Umbruch wird ihm erzählt – in einer krankheitsbedingten Vision, in der ihm der
Teufel erscheint, von dem er selbst sagt: „Und er, das bin ich, Aljoscha, ich selbst.
Alles, was an mir niedrig ist, alles Gemeine und Verächtliche!“136 Am Anfang des
Großinquisitors sprach Iwan von der Kunst der mittelalterlichen Mysterien, in denen
es Sitte war, „in poetischen Werken die Mächte herabzuholen“.137 Sein Teufel führt
ihn selbst, jetzt als Protagonist, in das von ihm erdachte Drama hinein. Sein Sujet darf
nicht unerwähnt bleiben.
133 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 393.
134 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 394.
135 „‚Literarischer Diebstahl!‘ rief Iwan mit plötzlicher Begeisterung. ‚Das hast du aus meinem Poem
gestohlen! Trotzdem, ich dank dir.‘“ (Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 422)
136 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 512.
137 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 394 f.
368
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Die Idee Iwans im Geologischen Umbruch lässt sich am besten mit Nietzsches
Worten ausdrücken: „Gott ist tot“. Nachdem der Glaube an Gott untergegangen ist,
nachdem die Moral, die auf diesen Glauben gegründet wurde, unglaubwürdig wurde,
muss etwas geschehen, gleichsam eine neue geologische Ära anfangen: die Epoche des
Menschengottes. Die Menschen werden dann verstanden haben, dass sie selbst göttlich
sind, dass sie Götter sind. Der Mensch wird von nun an, „allstündlich schrankenlos die
Natur bezwingend, mit seinem Willen und der Wissenschaft“ „ebendadurch allstündlich so hohe Wonne empfinden, daß diese ihm alle früheren Hoffnungen auf himmlische Wonnen ersetzt.“ Es werden neue Menschen sein, sie werden stolz und gütig sein
und keine Erlösung wollen, sondern „den Tod stolz und gelassen hinnehmen wie ein
Gott.“138 Sie werden „im Bedarfsfalle leichten Herzens jegliche frühere moralische
Schranke des früheren Sklaven-Menschen [meine Hervorhebung – E.P.] überspringen“.
Denn: „Für einen Gott bestehen keine Gesetze! Wo sich ein Gott hinstellt, das ist Gottes
Platz!“139 Die Liebe zueinander wird nicht aus dem Glauben an die Unsterblichkeit,
sondern aus dem Bewusstsein des augenblicklichen, vorübergehenden Vergnügens
entspringen, das nichts versichern, nichts rechtfertigen kann, das keine Rechtfertigung
braucht. Denn die Göttlichkeit des neuen Menschengottes kennt nur ein Gesetz: „Alles
ist erlaubt“. Diesen Zustand der göttlichen Glückseligkeit der Sterblichen habe Iwan, so
der Teufel, in seinem Poem beschönigt. Sein Schlussgedanke war besonders bemerkenswert: Da die Menschheit vielleicht lange nicht, vielleicht auch niemals zu dieser
Wahrheit kommen wird, so könne und müsse derjenige, der diese neue Wahrheit
kennt, schon jetzt nach der Formel „Alles ist erlaubt“ leben. Er wird damit zum Verkünder der neuen Ära, er wird damit unmittelbar zu einem Menschengott.
Das Poem, ebenso wie das ganze Gespräch mit dem Teufel, zeigt keineswegs
zufällig eine Annäherung an Nietzsche. Die Übereinstimmung wurde schon mit mehreren vorhergehenden Gedankengängen vorbereitet, von der Idee des „vorteilhaftesten Vorteils“ bis zur Figur der Selbstaufhebung des Christentums, der Hervorhebung
des Willens zur Gehorsamkeit und der Rolle der Kirche in der Beruhigung der Menschenherde. Der Menschengott Iwans steht dem Übermenschen Zarathustras erstaunlich nahe. Auch die Formel „Alles ist erlaubt“ wird bei Nietzsche, unabhängig von
seiner Dostojewski-Lektüre, verwendet. Gerade in Also sprach Zarathustra kommt sie
vor: „Nichts ist wahr, Alles ist erlaubt“ (Z IV, KSA 4, S. 340).140 Auch der Teufel Iwans
kommt zu dieser neuen Wahrheit des Menschengottes, zum Gesetz eines Immoralisten. Aber dabei stellt er noch folgende Frage:
Nun, wenn er auf Spitzbübereien aus ist, wozu – möchte man fragen – braucht er noch die
Sanktion der Wahrheit?141
138
139
140
141
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 507.
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 508.
Vgl. GM III, 24, KSA 5, S. 399.
Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 508.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
369
Der Teufel wirft Iwan somit das vor, was man auch öfters, jedoch mit Unrecht, Nietzsche vorgeworfen hat: Dass es auch eine Wahrheit sei, nämlich eine immoralistische,
der er, aus welchem Grund auch immer, gehorcht. Allerdings sollte aus dem Kapitel
zu Nietzsches Moralkritik schon klar geworden sein, dass dieser Einwand von ihm
vorhergesehen wurde. So steht in einer Nachlassnotiz, die als Vorbereitung zu Zarathustra entstand:
[…] ‚nichts ist wahr, alles ist erlaubt‘, so redet ihr? ach! Also ist auch diese Rede wahr, was liegt
daran, daß sie erlaubt ist! (Nachlass, Herbst 1884–Herbst 1885, 31[51], KSA 11, S. 384)
Die Ironie Nietzsches gegen diejenigen, die noch Wahrheit bzw. Erlaubnis zum
Immoralismus brauchen, stimmt mit der vom Teufel Iwans überein:
Aber so ist nun mal unser modernes russisches Menschlein, – ohne die Sanktion entschließt er
sich nicht mal zur Spitzbüberei, so lieb geworden ist ihm die Wahrheit…!142
In seinem kranken Zustand findet Iwan keine Argumente gegen diese ironische
Bemerkung, außer einem: Er wirft „das Lutherische Tintenfaß“ auf den Teufel.
Das Bild des Paradieses auf Erden ohne Gott, in dem die Menschen einander
gerade wegen ihrer Sterblichkeit lieben und die eigene Endlichkeit und Sinnlosigkeit
des Irdischen stolz und willig akzeptieren, tauchte bei Dostojewski einige Male auf.
Das war eine Utopie, die meistens in einem Traum oder in einer Krankheit als letzte
Vision der gottlosen Welt auftauchte, als Alternative zur ewigen Harmonie, die durch
eine gegen die Gotteswelt revoltierende Vernunft zurückgewiesen wurde, aber auch
als Alternative zur Sklaverei des irdischen Glücks. Diese Utopie war Dostojewskis
Gegen-Vision wider die Utopien Pjotr Werchowenskis und des Großinquisitors. Denn
das stolze Glück der Menschen-Götter hat keinen Betrug mehr nötig. Sie können die
Sinnlosigkeit der Welt, ihre eigene Vergänglichkeit und Einsamkeit ertragen. Sie sind
keine „schwächlichen Aufrührer“, keine gescheiterten Rebellen, keine Sklaven. Besonders interessant ist in dieser Hinsicht Der Traum eines tollen Menschen – eine kurze
Erzählung, die im Tagebuch erschienen ist.143 Neben ihr sei auch der Traum Wersilows
über die irdische Harmonie nach dem Tod Gottes in Der Jüngling erwähnt. Doch nur in
den Brüdern Karamasow kommt es zur Dramatisierung dieser Idee: Sie wird durch die
Kontroverse zwischen Iwan und seinem Teufel entfaltet. Denn Iwan erträgt die Wiedergabe seiner eigenen Dichtung nicht, ebenso wie er seine immoralistische These
nicht erträgt. Seine Schwäche, die Schwäche eines Menschengottes, wird durch das
ironische Geschwätz des Teufels offenbart: Wenn es keinen Gott und keine Unsterblichkeit gibt, wenn es keinen Maßstab für das Gute, keine letzte Instanz geben kann,
wofür braucht Iwan noch eine Begründung, noch ein Prinzip, auch wenn es ein
142 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 508.
143 Noch einmal fallen Nietzsches und Dostojewskis Ansichten erstaunlicherweise zusammen. Auch
sein „toller Mensch“ verkündigte den Tod Gottes, aber auch die neuen Hoffnungen, die mit diesem Tod
verbunden sind (vgl. FW 125, KSA 3, S. 480 ff.).
370
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
immoralistisches, ein sinnverneinendes Prinzip ist? Wozu sich noch alles erlauben,
wenn alles schon, da es keine äußere Instanz, keinen Gott, keine Wahrheit gibt, für
immer und ewig erlaubt ist? Iwans Wut zeigt, dass er keine Antwort auf diese Frage
hat. Durch diesen dramatisch ausgespielten Selbstbezug wird die letzte Formel Iwans
selbst paradox: Die These „Alles ist erlaubt“ ist eine „Sanktion der Wahrheit“, die der
neue Mensch braucht. Er braucht die Wahrheit, um die Wahrheit zu verneinen, wie er
die Liebe brauchte, um die Liebe zu verwerfen. An diesem Paradoxon der Wahrheit
und der Liebe, so Dostojewski, muss er scheitern. Es ist seine Selbstaufhebung, die
Selbstaufhebung des Menschen, seine Seelenkrankheit und sein Wahn.
In diesem berühmten Gespräch mit dem Teufel,144 in diesem Selbst-Gespräch,
kommt es zu noch einer erstaunlichen Übereinstimmung mit Nietzsche. Da diese
Parallele zu Nietzsche meines Wissens bis jetzt überraschenderweise unbemerkt
blieb, gebe ich hier das volle Zitat wieder:
Du denkst immer nur an unsere jetzige Erde! Dabei hat sich die Erde, wie sie heute ist, vielleicht
selber eine Billion Mal wiederholt; na, sie alterte, vereiste, barst, zerfiel, zerlegte sich in ihre
Elemente, dann war da wieder Wasser, ‚Wasser über der Feste‘, dann wieder ein Komet, wieder
eine Sonne, wieder eine Erde aus der Sonne – diese Entwicklung, sie wiederholt sich vielleicht
schon unendlich viele Male, und immer in ein und derselben Gestalt, aufs I-Tüpfelchen genau. Eine
höchst unanständig langweilige Sache.145 (meine Hervorhebung – E.P.)
Der Gedanke der ewigen Wiederkehr, der „schwierigste Gedanke“, den zu ertragen es
allein übermenschliche Kräfte erfordert, wird von Dostojewski als teuflische Seite von
Iwans Dialektik, als ihre letzte ‚ontologische‘ Begründung dargelegt. Nach dem Tod
Gottes solle der Menschengott auch diese Sinnlosigkeit der ewigen Wiederholung der
Sinnlosigkeit mit Stolz und Mut ertragen können. Dies sei gerade die angestrebte
„Sanktion der Wahrheit“, die Wahrheit der Sinnlosigkeit – die Wahrheit des Teufels.
Aljoscha, der Bruder Iwans, sieht in seiner Krankheit, in seiner Teufels-Vision gerade
den Kampf zweier Wahrheiten – der Wahrheit Gottes und der Wahrheit des Teufels,
deren Kampf noch nicht entschieden ist. In diesem Kampf geht es dennoch nicht um
die großen metaphysischen Fragen, auch nicht um das höchste Gut bzw. um die Liebe
zur Menschheit. Bemerkenswert ist, dass Iwan selbst gleich danach (nachdem sein
Bruder Aljoscha ihn aus dem Alptraum aufgeweckt hat) das ganze Gespräch mit dem
Teufel uminterpretiert, und zwar so, als ob in ihm nur von einem Punkt die Rede war,
von einer ganz konkreten Entscheidung: ob er seine Schuld morgen vor Gericht
bekennen wird und warum er dies tun soll. Dennoch wurde in diesem Gespräch davon
so gut wie nichts gesagt. Nur gleich am Anfang sagte der Teufel:
144 Dieses Gespräch hat z. B. Thomas Mann inspiriert. Es spiegelte sich in seinem Doktor Faustus
wider.
145 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 499. Nietzsche war dieser Roman Dostojewskis
höchstwahrscheinlich unbekannt. Die Idee der ewigen Wiederholung allen Geschehens könnte allerdings in den wissenschaftlichen Ideen der Zeit eine gemeinsame Quelle haben.
4.1 „Pro et contra“: Dialektik der Vernunft
371
Du wirst die ganze Nacht sitzen und dich fragen: Gehen oder nicht gehen? Aber du wirst trotzdem
gehen, und du weißt, daß du gehen wirst, du weißt selbst, daß die Entscheidung, wie immer du
dir selber antworten wirst, nicht mehr von dir abhängt. Du gehst, weil du nicht wagst, nicht zu
gehen.146
Iwan jedoch verbot ihm, darüber weiter zu sprechen: „‚Sprich du mir nicht von dem
Entschluß!‘ – schrie Iwan ingrimmig.“147 Nur nachträglich stellt sich heraus, dass bei
allen abstrakten metaphysischen Fragen nur diese Entscheidung im Mittelpunkt des
Gesprächs stand – als eigentliche Prüfung der ganzen Dialektik, als Prüfstein aller
Prinzipien, aller Ideale der Vernunft. Wenn Iwan selbst die ihnen entspringende
Moral nicht ertragen, ihr nicht folgen kann, so sind sie damit widerlegt, obzwar ihm
diese Widerlegung rätselhaft bleiben muss.
Bleiben wir noch für einen Augenblick bei der Idee einer irdischen Harmonie
ohne Gott. Sie wird u. a. von Kirillow in dem Roman Die Dämonen vertreten. Auch er
sagt, dass, um dem großen Ereignis des Todes Gottes gerecht zu werden, der Mensch
selbst Gott werden solle, zu einem Menschengott. Der Mensch wird die Stelle des
Gottmenschen Christus einnehmen müssen.148 Das einzige Attribut dieses neuen
Gottes wird gerade die Willkür, die Eigenwilligkeit sein, die keine Gesetze und keine
Grenzen kennt. Aber wenn die Tat der göttlichen Liebe die Erschaffung des Menschen
gewesen ist, wenn die Gabe des Gottmenschen die unheimliche Bürde der Freiheit
war, so ist die erste Tat des Menschengottes die Zerstörung dieser Welt der Sinnlosigkeit:
Ich verstehe nicht, wie bisher ein Atheist wissen konnte, daß es keinen Gott gibt, und sich doch
nicht sofort tötete?149
Kirillow müsse sich töten, weil es der „höchste Punkt“150 der neuen Freiheit des
Menschengottes ist. Er sehe sich gezwungen, diese äußerste Konsequenz aus der
neuen Freiheit zu ziehen, um sie den anderen zu verkünden.
Weiter gibt es keine Freiheit; hierin ist alles und weiter nichts. Wer sich selbst zu töten wagt, der
ist Gott.151
146 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 515.
147 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 489.
148 Zu dieser Entgegensetzung des Ideals des irdischen Ameisenhaufens und der himmlischen Vollkommenheit vgl. DGA 26, S. 169. Später wird Wladimir Solowjow diese Entgegensetzung wieder, u. a.
in Bezug auf Nietzsche, aufnehmen, dessen Übermensch als Menschengott dem Gottmenschen Christus gegenüber steht. Vgl. Владимир Соловьев (Wladimir Solowjow), Идея сверхчеловека (Die Idee
des Übermenschen).
149 Dostojewski, Die Dämonen, S. 908.
150 Dostojewski, Die Dämonen, S. 906.
151 Dostojewski, Die Dämonen, S. 155.
372
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Und dennoch dämmert auch ihm, dass es keine Freiheit ist, sondern ihr Gegenteil –
die äußerste Unfreiheit. Denn er fühlt sich zum Selbstmord verpflichtet:
Ich bin erst noch unfreiwillig Gott und bin unglücklich, denn ich bin verpflichtet, autonomen
Willen [Eigenwillen – E.P.] zu bezeugen.152
Kirillow verzweifelt an diesem Gedanken, an dieser Tat. Er ist unglücklich und krank.
In seinem letzten Brief vor dem Selbstmord, der aus anderen Gründen vollzogen wird,
nämlich aus dem Unglauben an alle Prinzipien und Zwecke, schreibt Stawrogin:
Der hochherzige Kirilloff hat die Idee nicht ertragen und hat sich erschossen; aber ich sehe doch,
daß er deshalb hochherzig war, weil er nicht bei gesundem Verstande war.153
Die „Hochherzigkeit“, die Vornehmheit des Menschengottes ist eigentlich der Wahn,
der ihn zur Selbstzerstörung zwingt. Sie ist kein Leben, sie ist die Selbstaufhebung des
Lebens.
So wird die Vernunft durch ihre Dialektik selbstzerstörerisch: Sie verneint die
Wahrheit im Namen der Wahrheit, sie kämpft gegen das Gute im Namen des Guten,
sie will ihre Freiheit beweisen, obwohl sie genau weiß, dass gerade dieses Beweisen-Wollen die Unfreiheit zeigt. Alle ihre Ideale, das der himmlischen und das der
irdischen Harmonie, sind von ihr zurückgewiesen worden. Wenn das höchste Gut der
ewigen Harmonie für die menschliche Vernunft verwerflich ist und die irdische
Harmonie nur die Vision eines kranken Verstandes zu sein scheint, so bleibt für die in
Kontroversen gefangene Vernunft nur noch der stolze Ausweg des Menschengottes
offen, der durch die höchste Tat seiner Willkür, den Selbstmord (der „logische Selbstmörder“ und Kirillow), oder aber durch ihre „niedrigste“ Tat, den Mord (Werchowenski, Smerdjakow, Raskolnikow),154 sich selbst seine eigene Göttlichkeit, das eigene
Recht auf unbegrenzte Freiheit beweisen muss.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
Das Böse der Unfreiheit
Die Idee des Menschengottes wurde durch Dostojewskis Romanfiguren, vor allem
durch Iwan Karamasow, verkörpert. Sie veranschaulichte die höchste Kraft der Verneinung, des Unglaubens und der Revolte gegen Gott und die Welt. Die Ideen der
Vernunft sind dadurch kompromittiert worden. Gott und die Unsterblichkeit sind nicht
widerlegt, sie sind nicht akzeptabel. Die dritte Idee der Vernunft, die der Freiheit,
152 Dostojewski, Die Dämonen, S. 908.
153 Dostojewski, Die Dämonen, S. 989.
154 Diese Unterscheidung macht Kirillow (vgl. Dostojewski, Die Dämonen, S. 906).
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
373
wurde allerdings noch nicht in ihrer dialektischen Tiefe dargestellt. Die Freiheit der
Willkür war bloß die Freiheit zur Selbstzerstörung. Es blieb aber noch die Freiheit in
einem anderen Sinn offen, die Freiheit in der Erkenntnis des Guten und Bösen, die
Bürde Christi, die als rätselhafte Alternative zur Logik des Großinquisitors und Iwans
gedacht werden sollte. Auf sie wollen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit richten und so
zum Kern von Dostojewskis Moralphilosophie kommen. Die Freiheit Christi, die Freiheit des Gottmenschen als Alternative zur selbstzerstörerischen Willkür sollte den Weg
des Lebens zeigen – den Weg jenseits der Dialektik der Vernunft.
Aber zuerst sollen solche Begriffe wie „Schuld“, „Verantwortung“ und „Strafe“
bei Dostojewski analysiert werden, sowie die moralisch-rechtliche Differenz, die sich
bei Kant von der für die Moral grundlegenden Unterscheidung zwischen Handlung
und Maxime der Handlung speiste und für die Aufteilung der Metaphysik der Sitten in
Rechts- und Tugendlehre sorgte. Es ist wichtig, zu betonen, dass Dostojewski, anders
als Tolstoi, den rechtlichen Fragen große Bedeutung zuschrieb, wie auch der Freiheit
selbst, die Tolstoi bloß als „Erfindung der Theologen und Kriminalisten“, als „Wort
ohne Bedeutung“ verwarf. Das Problem des Rechts in seinem Bezug auf die moralischen Kontroversen, es sei hier schon vorweggenommen, verlieh der Idee der
Freiheit bei Dostojewski eine neue, positive Bedeutung.
Dostojewski zeigte lebhaftestes Interesse an den Gerichtsfällen seiner Zeit. Kriminalfälle und Verbrechen aller Art kommen direkt aus den Zeitungen in das Tagebuch
eines Schriftstellers. Der Schriftsteller nahm leidenschaftlich an Diskussionen über das
Verfahren von Geschworenengerichten, über die Taktik von Anwälten und Anklägern
teil, mischte sich in konkrete Fälle ein, besuchte Angeklagte und verurteilte Verbrecher. Wie er oftmals betonte, war die Wirklichkeit fantastischer als jeder Kriminalroman und barg Überraschungen, die sich kein Künstler auszudenken vermag.155 Das
Thema des Verbrechens, das in allen großen Romanen Dostojewskis vorkommt, wird
zum Leitmotiv des Sujets in Verbrechen und Strafe und in Die Brüder Karamasow.
Diese zwei Romane rücken jetzt ins Zentrum unserer Untersuchung.
Der Titel von Verbrechen und Strafe ist gezielt kriminalistisch.156 Die Handlung
setzt ein während die Hauptfigur Rodion Raskolnikow einen Mord plant, den er später
begeht. Er wird dann stets von einem Untersuchungsrichter verfolgt, der von seiner
Schuld überzeugt ist, aber seine Überzeugung nur psychologisch begründen kann.
Am Ende des Romans bekennt Raskolnikow sich selbst zur Tat und wird mit Zwangsarbeit in Sibirien bestraft. Dieses Bekenntnis versteht man für gewöhnlich als einen
Schritt des Gewissens – des Gewissens, das ihn hart verurteilt und so zur Selbstbestrafung zwingt.
155 Vgl. den schon zitierten Brief an Nikolai Strachow vom 10. März 1869, in: Dostojewski, Gesammelte Briefe, S. 302. Die Idee der fantastischen Wirklichkeit wird uns im dritten Abschnitt dieses Kapitels
noch beschäftigen.
156 Deswegen scheint mir die andere Variante der deutschsprachigen Übersetzung des Titels, Schuld
und Sühne, nicht gerechtfertigt.
374
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Bemerkenswert ist allerdings, dass Raskolnikow, obwohl er zur Selbstbestrafung
durch öffentliche Buße und Zwangsarbeit bereit ist, seine moralische Schuld gerade
nicht anerkennt:
‚Verbrechen? Was für ein Verbrechen?‘ rief er in einem irgendwie unerwarteten Wutausbruch.
‚Etwa, daß ich eine widerliche, bösartige Laus totgeschlagen habe, eine alte Wucherin, die
niemand brauchte, für deren Vernichtung einem vierzig Sünden erlassen werden müßten, die
den Armen das Blut aussaugte – das soll ein Verbrechen sein? Daran verschwende ich keinen
einzigen Gedanken und habe auch nicht vor, es abzuwaschen.‘ […] ‚Niemals, niemals fühlte ich
mich sicherer und überzeugender als jetzt!..‘157
Seine Buße ist somit eine Unterwerfung unter das Gesetz, das er nicht anerkennt. Diese
scheinbare Inkonsequenz wird uns in diesem Kapitel nicht nur einmal beschäftigen.
Aber es ist schon hier, durch die Buße von Dostojewskis bekanntestem Verbrecher,
klar, dass die moralisch-rechtliche Differenz von Dostojewski sich anders darstellt, als
wir es aus Kants Philosophie kennen. Die moralische Forderung, die Schuld anzuerkennen, kommt von den anderen Menschen: Raskolnikow geht – obwohl er sein
Verbrechen nicht anerkennt – zur Kriminalpolizei mit der ausdrücklichen Unterstützung der ihn liebenden Frauen, Sonja und Dunja. Die Selbstbestrafung ist somit
moralisch äußerlich erzwungen.158 Dieses Schuldbekenntnis kann darüber hinaus
kein besonderer Verdienst sein, denn sein Untersuchungsführer Porfiri hatte ihm
dafür Strafmilderung versprochen. Dennoch versucht Raskolnikow dadurch nicht
einfach etwas zu gewinnen bzw. lässt sich nicht bloß von den anderen leiten. Auch
für Dostojewski, wie für Kant, wäre damit die moralische Bedeutung seiner Buße
nichtig. Raskolnikows Triebfedern sind vielfältiger und viel komplexer als die bloße
Angst vor Strafe oder die Liebe zu Sonja.159 Eine innere Not, ein innerer Zwang ist
dabei im Spiel. Und es entsteht der Eindruck, Raskolnikow habe keine andere Wahl
gehabt und die rechtliche Strafe sei seine Rettung vor etwas noch viel Schlimmerem
gewesen.
Raskolnikow ist, wie fast alle Hauptfiguren von Dostojewski, ein Mensch, der eine
Idee hat, und das heißt: den eine Idee beherrscht. Diese Idee wird zum roten Faden
des ganzen Romans. Es handelt sich um das „Recht auf Verbrechen“.160 Einige
Menschen, so Raskolnikow in einem Zeitungsartikel und später im Gespräch mit dem
Untersuchungsrichter, können und müssen allgemeine Normen des Zusammenlebens
überschreiten. So dürften große Wissenschaftler, wie Kepler oder Newton, und große
157 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 701 f., 703.
158 Vgl. den Moment, als er, ohne Bekenntnis abzulegen, weggehen will. Nur weil Sonja ihn ansieht,
kehrt er zurück (Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 719).
159 Raskolnikow will auf eine ihm angebotene Strafmilderung verzichten (Fedor M. Dostoevskij,
Verbrechen und Strafe, S. 621). Man kann auch nicht behaupten, er liebe Sonja, zumindest nicht vor
dem Epilog.
160 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 349.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
375
Eroberer, wie Napoleon, sich das „Blutvergießen aus Gewissen“ erlauben,161 wenn es
für ihre großen Taten erforderlich ist. Es sei eine klare mathematische Kalkulation
(sic!), die besagt, dass das Leben einer „alte[n] Wucherin, die niemand brauchte, für
deren Vernichtung einem vierzig Sünden erlassen werden müßten, die den Armen das
Blut aussaugte“, kein Wert haben kann. Oder wie in einem Gespräch, dem Raskolnikow zuhört, gesagt wurde:
‚Auf der einen Seite ein dummes, unnützes, nichtswürdiges, böses, krankes altes Weib, das kein
Mensch braucht und das, im Gegenteil, alle schädigt, das selbst nicht weiß, wozu es lebt und
morgen sowieso sterben wird […]. […] Auf der anderen Seite junge, frische Kräfte, die einfach
zugrunde gehen, weil es für sie keine Hilfe gibt, und zwar zu Tausenden, und überall! Hunderte,
Tausende von guten Werken und Plänen könnte man in Angriff nehmen und in die Tat umsetzen
mit dem Geld der Alten […]. […] Ein Leben als Preis für Tausende von Leben, die vor Verfall und
Fäulnis gerettet werden – ein Tod gegen hundert Leben – das ist doch Arithmetik! [meine Hervorhebung – E.P.] Und was bedeutet überhaupt auf der allgemeinen Waage [meine Hervorhebung – E.P.] das Leben dieser schwindsüchtigen, beschränkten und bösen alten Frau? Kaum
mehr, als das Leben einer Laus, einer Küchenschabe, ja, nicht einmal soviel, weil diese alte Frau
Schaden anrichtet. […]‘
‚Natürlich ist sie nicht wert zu leben‘, bemerkte der Offizier, ‚aber so ist es eben in der
Natur.‘
‚Ach was, die Natur muß eben korrigiert und dirigiert werden, sonst würden wir in Vorurteilen ertrinken. Sonst würde es keinen einzigen großen Mann geben, man redet von ‚Pflichten
und Gewissen‘, ich habe ja nichts gegen Pflicht und Gewissen – aber was verstehen wir darunter?‘
Diese unumstößliche, mathematisch begründete Logik wurde dennoch schon in diesem von Raskolnikow zufällig überhörten Gespräch plötzlich mit einer Frage abgebrochen:
Jetzt bist du deiner Sache sicher und führst große Reden, aber sag mir eines: Würdest du selbst
die alte Frau umbringen oder nicht?
Und obwohl der andere Offizier Anhänger des mathematischen Kalküls in Gewissensangelegenheiten ist, lehnt er erwartungsgemäß dessen Folgen ab:
Natürlich nicht! Mir geht es nur um Gerechtigkeit… Von mir ist gar nicht die Rede…
Sein Gesprächspartner sieht aber seinen Standpunkt damit als widerlegt an:
Wenn du dich nicht dazu entschließen kannst, dann kann meiner Meinung nach auch von
Gerechtigkeit nicht die Rede sein!162
Die Widerlegung ist also praktisch im Sinne Kants: Ist diese Überzeugung für die
Handlung nicht brauchbar, so ist sie kein Glaube, sondern bloß eine Meinung, die
161 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 356.
162 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 90 f.
376
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
somit für das Gewissen nicht taugt. Dennoch darf dabei nicht übersehen werden,
dass Dostojewski die Logik des kategorischen Imperativs umkehrt: Wenn du selbst
nicht so handeln kannst, ist deine Maxime unbrauchbar und du darfst sie nicht als
allgemeines Gesetz wollen. Der Einzelfall wird hier zum Maßstab des Allgemeinen
und verneint das, was als allgemein richtig anerkannt wurde. Es ist das umgekehrte
moralische Gesetz: Als allgemein kann nur das gewollt werden, was man selbst tun
kann. Dies kann allein „gerecht“ sein. So wurde es von einem im Roman bloß einmal
vorkommenden Offizier beurteilt, aber nicht von Raskolnikow. Er hat dagegen in
dem zufällig gehörten Gespräch nicht bloß „genau dieselben Ideen“ gesehen, die
ihm durch seinen eigenen Kopf gingen, sondern auch eine „Vorbestimmung“, einen
„Fingerzeig“.163 Er wollte der „Gerechtigkeit“ dienen, die ihm arithmetisch richtig vorkam, er wollte sie in die Tat umsetzen: Wenn es allgemein richtig ist, so
muss es auch im Einzelfall von ihm getan werden. Wenn sein moralisches Kalkül,
sein kategorischer Imperativ, einen Mord fordert, so muss er auch begangen werden.164
Raskolnikow handelt im Roman mehrmals uneigennützig: So gibt er z. B. sein
letztes Geld denen, deren Leid und Not ihm vor Augen geführt wird. Er denkt nicht an
sich, er ist unegoistisch. Das Leben im Roman Dostojewskis zeigt allerdings, dass
diese Selbstlosigkeit immer eine Kehrseite hat, z. B. für seine Mutter und seine
Schwester.165 Dennoch geht es ihm dabei nicht bloß um die Wohltätigkeit, sondern
(ganz im kantischen Sinn) um ein Prinzip: Nicht der Wunsch, hunderte guter Taten zu
vollbringen, war sein Beweggrund, sondern der Gehorsam gegenüber der Idee der
Gerechtigkeit.
Nicht um meiner Mutter helfen zu können, habe ich gemordet – Unsinn! Ebensowenig habe ich
gemordet, um mir die Mittel und die Macht zu verschaffen, später ein Wohltäter der Menschheit
zu werden. Unsinn! Ich habe einfach gemordet; um meinetwillen, einzig und allein um meinetwillen […]. […] Ich mußte etwas Bestimmtes in Erfahrung bringen, etwas Bestimmtes führte meine
Hand: Ich wollte damals in Erfahrung bringen, und zwar so schnell wie möglich, ob ich eine Laus
bin wie alle anderen oder ein Mensch! Ob ich imstande bin, eine Grenze zu überschreiten, oder
nicht! Ob ich es wage, mich zu bücken und etwas aufzuheben, oder nicht. Ob ich eine zitternde
Kreatur bin oder das Recht habe …
163 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 92.
164 Raskolnikows Gewissen, kantisch geredet, irrt sich in diesem Punkt subjektiv nicht, denn es
betrachtet die Maxime als moralisch richtig. Er sollte jedoch den nächsten, von der kantischen Moral
geforderten Schritt machen und seine moralische Urteilskraft als objektiv irrend ansehen. Stattdessen
tut er das, was die kantische Moral eigentlich ausschließt. Er ist somit derjenige, den Kant als moralischen Egoisten bezeichnen würde.
165 Vgl. die Worte von Raskolnikows Mutter, die sich sicher war, dass er sich für seine seltsame Braut,
die nur Mitleid erregen konnte und früh gestorben war, auch über alle Hindernisse, sogar Leiden und
Tod seiner Angehörigen, „seelenruhig“ hinweggesetzt hätte (Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und
Strafe, S. 292).
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
377
Und es ist nicht bloß „das Recht aufs Verbrechen“, sondern das Recht, eigenen Ideen
zu folgen, das Mensch-Sein:
Ich wollte, Sonja, ohne alle Kasuistik morden, um meiner selbst willen morden, nur um meiner
selbst willen!166
Es war eine Probe und eine Überprüfung der eigenen Kräfte. Er hat die Probe allerdings nicht bestanden. Und dieses Versagen war für ihn eine härtere Strafe als die
Zwangsarbeit in Sibirien.
Die Probe kommt unabwendbar wie das Schicksal. Raskolnikow hört das Gespräch der Offiziere, als er sich seiner Idee über „das Recht aufs Verbrechen“ schon
unterworfen hat. Er nimmt das Gespräch selbst als Zeichen. Alles, was ihm geschieht,
betrachtet er als Schicksalsfügung.
Auch später noch neigte er stets dazu, in dieser ganzen Sache etwas Seltsames, Geheimnisvolles
zu sehen, gleichsam das Wirken besonderer Einflüsse und Zufälle.167
Besonders den Zufall, dank dem er erfuhr, dass die alte Frau, die er töten sollte, an
einem Abend allein zuhause bleibt. Nach dem zufällig gehörten Gespräch fühlt er sich
zur Tat verurteilt – wie zum Tod:
Er betrat seine Kammer wie ein zum Tode Verurteilter. Er überlegte nicht mehr und war völlig
außerstande nachzudenken, aber mit seinem ganzen Wesen fühlte er plötzlich, daß er nicht mehr
länger über die Freiheit des Verstandes noch über die des Willens verfüge und alles plötzlich
entschieden sei.168
Für ihn ist es nicht einfach eine glückliche Gelegenheit. Im Gegenteil: Die äußeren
Umstände rauben ihm jede Hoffnung darauf, er könne sich der Nötigung zur Tat
entziehen. Jetzt kann er der Forderung seines Gewissens, der Herausforderung, seine
Idee in die Tat umzusetzen, nicht mehr ausweichen. Er muss seine Idee auf die Probe
stellen, wenn er keine „zitternde Kreatur“, sondern ein Mensch sein will. Jetzt steht
nichts mehr zwischen dem gebietenden Gesetz und seiner eigenen Handlung, das
Allgemein-Richtige muss in die Tat umgesetzt werden. So ist er vor der Tat der Entscheidungsfreiheit beraubt.
Es ist bemerkenswert, dass in Raskolnikows Aufsatz über „das Recht auf Verbrechen“ letzteres als eine Art Krankheit dargestellt wird. Und wahrhaftig leidet
166 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 566 f.
167 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 87.
168 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 86. Doch die Information, dass die Schwester der
Alten an diesem Abend weg sein würde, erwies sich als falsch. Sie kam zu früh nach Hause und musste
auch ermordet werden. Dass Raskolnikow diesem zweiten Mord keine Bedeutung zuschreibt, zeigt
gerade, dass es ihm nur ums Prinzip geht.
378
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Raskolnikow im Moment des Mordes und unmittelbar danach, genauso wie später
Iwan, an einem Nervenfieber. Diese Theorie, dass ein Mörder seine Tat immer im
„Affekt“ begeht, war zu Dostojewskis Zeit sehr in Mode. Genauso wie die Theorie des
„Milieus“, das einen Menschen notwendig zum Verbrecher macht. Dostojewski hat in
seinem Tagebuch eines Schriftstellers gegen beide leidenschaftlich argumentiert.169 In
seinen Romanen kehrt er ihre Logik um. Das Verbrechen resultiert nicht aus einer
Krankheit, sondern das Verbrechen ist eine Krankheit, eine für den gesunden Menschenverstand unerträgliche Tat. „Die Ausführung des Verbrechens“ ist deshalb
„stets von einer Krankheit begleitet.“170 So beschreibt Raskolnikows Arzt Sossimow
seinen Zustand:
Ein durchaus bekanntes Phänomen […] die Ausführung einer Handlung ist zuweilen meisterhaft,
raffiniert, aber Steuerung und Antrieb sind gestört und hängen von allen möglichen krankheitsbedingten Eindrücken ab. Ähnlich wie im Traum.
Dennoch gibt es keine klare Grenze zwischen dem Zustand eines „kranken“ Verbrechers und dem eines „gesunden“ Menschen:
[…] in diesem Sinne sind wir tatsächlich alle, und zwar recht häufig, beinahe geisteskrank, mit
dem kleinen Unterschied, daß die ‚Kranken‘ um ein geringes verrückter sind als wir […].171
So dient der Gedanke der Geisteskrankheit eines Verbrechers, was die Tat betrifft,
weder zur Rechtfertigung noch zur Aufhebung der Verantwortung, wie von Raskolnikow in seinem Aufsatz, obschon mit einem anderen Ziel, ausgeführt wurde.172 Die
‚Krankheit‘, die bei einem Verbrecher nur stärker als bei den anderen ausgeprägt ist,
ist die Macht seiner Idee, gegen welche er hilflos ist, der er sich gegen seinen Willen
unterwirft. Er trennt sich damit von den anderen, „gesunden“ Menschen, die die
Distanz zu ihr zu halten vermögen, wie der Offizier aus dem von Raskolnikow
gehörten Gespräch, der niemals töten würde, auch wenn er dies für gerecht hielt.
Tatsächlich trennt das Verbrechen Raskolnikow von allen Menschen, auch von
denen, die er geliebt hatte, für dessen Wohl er den Mord angeblich begehen wollte.173
Er wird zu einem Aussätzigen: Er könnte sich „niemals mehr, mit keiner Seele, über
was auch immer, […] aussprechen“.174 Seine Idee über „das Recht auf Verbrechen“,
169 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 25 ff.
170 Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 349.
171 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 305.
172 Die Krankheit, die das Verbrechen begleitet, wurde in Raskolnikows Aufsatz als Genialität interpretiert. Diesen Gedanken, dass die Genialität häufig mit einer Krankheit verbunden ist, wird Thomas
Mann v. a. in Doktor Faustus in Bezug auf Dostojewski weiterentwickeln.
173 Der äußerliche Grund war, der Mutter und der Schwester aus der erniedrigenden Armut herauszuhelfen.
174 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 309.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
379
die mathematische Kalkulation des Allgemein-Guten, hat ihn zur Einsamkeit verurteilt: „Ich will allein sein, allein, allein, allein!“175
Raskolnikow folgt seiner Idee des Guten in aller Redlichkeit und Konsequenz,
abgesehen von seinen Wünschen und den äußeren Umständen, wie ein Held oder ein
Märtyrer – der Märtyrer für die Idee der Menschheit. Denn er will schließlich herausfinden, „ob [er] eine Laus [ist] wie alle anderen oder ein Mensch“. Er kann sich dem
von ihm anerkannten Prinzip nicht widersetzen, ohne sich selbst das Mensch-Sein
abzusprechen. Dieses Mensch-Sein, das er sich selbst beweisen soll, ist jedoch etwas,
was ihn zur Ausnahme macht. Es ist eine Herausforderung, dass er die Gerechtigkeit
in die Tat umsetzt, um des Wohls der anderen Menschen willen, die für diese Tat zu
kleinlich sind. Auch später, auch unmittelbar vor dem Schuldbekenntnis, erscheint
ihm diese Logik unumstößlich, obwohl er zugestehen muss, dass sie ihn in den
Abgrund gestoßen hat, sie war sein Todesurteil:
Habe ich die Alte ermordet? Mich selbst habe ich ermordet und nicht die Alte! Mit einem Schlag
habe ich mir den Garaus gemacht, einmal für immer! …
Und diese Alte hat der Teufel ermordet, nicht ich …176
Der letzte Satz klingt wie einer von Dostojewskis Witzen, die so irritierend auf Tolstoi
wirkten. Dennoch wissen wir, dass der Teufel in Dostojewskis Romanen eine handelnde Person, ein Doppelgänger des Protagonisten sein kann, der sein „Inneres“ offenbart, wie es Iwan Karamasow andauernd wiederholt. („Nein, du bist nicht du, du bist
ich, du bist ich und nichts weiter!“177) Der Teufel steht für das, was er selbst hasst und
dennoch nicht loswerden kann,178 für seine tiefste Unfreiheit, also für die Unfreiheit
gegen sich selbst. Aus dieser Unfreiheit wird Raskolnikows Tat gerade begangen: „[…]
ich weiß ja selbst, daß mich der Teufel dorthin geschleppt hat.“179 Die Tat, die seine
Idee der Gerechtigkeit befürwortete, ja kategorisch forderte, ist somit eine Tat aus
Unfreiheit gewesen. Er war hilflos gegen seine Moral, gegen seine Idee der Menschheit.
Raskolnikow büßt für die Idee, nicht für die Tat. Die moralisch-rechtliche Reihenfolge (die moralische Beurteilung der Maxime kommt vor der Tat, die rechtliche
Einschätzung der Handlung folgt ihr) wird bei Dostojewski umgekehrt: Man verantwortet die Maxime, jedoch rechtlich, nicht moralisch. Moralisch wird, nach dem
umgekehrten moralischen Gesetz, gerade die Tat verantwortet. Das Gewissen verurteilt zur Tat und lässt dem Willen keine Freiheit. Aber indem man sich dem Recht
bzw. der äußerlich erzwungenen Buße unterwirft, wird man von der Macht der
175 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 209.
176 Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 567.
177 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 496 f.
178 „Ich gäbe viel, wenn ich dich vertreiben könnte!“ (Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2,
S. 503)
179 Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 565.
380
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
eigenen Moral befreit. Gerade dafür wird Buße getan: um der Erlösung willen, für die
Erlösung von dem tödlichen moralischen Gesetz, für die Erlösung des in sich selbst
gefangenen Gewissens.180 Denn Raskolnikow leidet an seiner Idee wie an einer todbringenden Krankheit. Die Unerträglichkeit der von ihr geforderten Tat zeigt, dass sie
kein Leben ist, dass sie gegen das Leben gerichtet ist. Sein erneutes Aufleben beginnt
gerade da, wo das Leben aufzuhören scheint, im sibirischen Gefängnis. Hier wird er
schließlich seine „Dialektik“ los:
An die Stelle der Dialektik war das Leben getreten, und in seinem Kopf wollte etwas völlig anderes entstehen.181
Seine Wiedergeburt, die Erneuerung seines Lebens wird allerdings im Roman nicht
gezeigt:
Aber hier beginnt eine neue Geschichte, die Geschichte der allmählichen Erneuerung eines Menschen, die Geschichte seiner allmählichen Wiedergeburt, des allmählichen Übergangs aus einer
Welt in eine andere, der Entdeckung einer neuen, bisher gänzlich ungekannten Wirklichkeit. Das
könnte das Thema der neuen Geschichte werden – aber unsere jetzige Geschichte ist zu Ende.182
Fassen wir zusammen. Für seine Idee wird Raskolnikow mit der Unfreiheit der Tat
bestraft und zu der Tat wie zum Tode verurteilt; indem er sich zu seiner ihm unverständlichen Schuld bekennt, wird er mit der äußerlich erzwungenen Strafe wieder
frei. In Verbrechen und Strafe wird somit nicht die Freiheit, sondern gerade die
Unfreiheit zum Grund der Verantwortung in einem neuen, befremdlichen Sinne: Der
Mensch trägt die Schuld für seine Moral, für seine Unterscheidung von Gut und Böse; er
wird mit der Tat für sie bestraft und durch die Strafe von ihr erlöst. Die rechtliche Strafe
selbst ebenso wie der moralische Druck vonseiten der anderen Menschen sind für ihn
gleichsam eine Erlösung – eine Erlösung von der eigenen Logik, von der Macht seiner
Idee, die ihn zur Tat verurteilte. Den letzteren Gedanken drückt gerade sein Untersuchungsrichter aus, der ihn zum Schuldbekenntnis bewegen will: „Schätzen Sie das
Leben nicht zu gering!“183 und „Sie sind auf uns angewiesen.“184 Das Schuldbekenntnis und die Strafe machen das Leben wieder möglich.
180 Eine interessante Parallele dazu stellt der hegelsche Begriff des Rechts des Verbrechers auf Strafe
dar, durch den er als freies und vernünftiges Wesen gewürdigt wird (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse,
S. 190 ff.)). Bei allen Differenzen würde Dostojewski dieser These zustimmen. Nur durch die Strafe kann
der Verbrecher mit sich selbst und der Welt versöhnt werden. Tolstoi, der die hegelsche Philosophie
immer verwerflich fand, sah dagegen im Recht nur einen äußerlichen Zwang und das Unrecht schlechthin.
181 Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 744.
182 Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 745.
183 Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 621.
184 Dostoevskij, Verbrechen und Strafe, S. 624.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
381
Wie mehrere andere Leitmotive bekommt auch das Thema der tödlichen Unfreiheit gegenüber der eigenen Idee seinen letzten Schliff in den Brüdern Karamasow. Es
handelt sich auch hier um das Recht, dem eigenen Maßstab in der Moral, der eigenen
Unterscheidung von Gut und Böse konsequent zu folgen – bis zum Mord. Auch der
Dialektiker Iwan Karamasow, der diese Freiheit für sich beansprucht, steht für seine
Idee der Gerechtigkeit, aber, wie der Offizier aus dem von Raskolnikow gehörten
Gespräch, nur bis zu dem Moment, wo sie in die Tat umgesetzt werden soll. So versichert er seinem Bruder:
Du kannst sicher sein, ich werde ihn [den Vater – E.P.] immer verteidigen. Aber meinen Wünschen
lasse ich im gegebenen Falle freien Lauf.185
Doch geht es dabei nicht bloß um das Wünschen, sondern um das Recht auf Wünschen. Der andere Bruder, Alexej, bezweifelt gerade dieses Recht:
Hat denn wirklich jeder Mensch das Recht, zu entscheiden, wer von den anderen Menschen wert
ist zu leben und wer des Lebens eher unwert ist?
Und so antwortet ihm Iwan:
[…] wer hätte nicht das Recht, etwas zu wünschen? […] Sogar den Tod – warum nicht? Warum
sollte man sich selbst belügen, da doch alle Menschen so leben und wohl auch gar nicht anders
leben können.186
Iwan beruft sich somit nicht bloß auf die Spontaneität seiner Wünsche (etwas zu
wünschen oder nicht zu wünschen steht dem Menschen schließlich nicht frei),
sondern auf das Recht, ihnen freien Lauf zu lassen. Seine These „alles ist erlaubt“
reicht jedoch nur bis dahin – sie betrifft nur das Prinzip, nicht die Handlungen. Denn
Iwan will, es sei noch einmal betont, den gewünschten Mord nicht in die Tat
umsetzen, obwohl er seinen Wunsch und das ihm zugrunde liegende Prinzip für
völlig gerechtfertigt hält. Er meint in diesem Punkt, in dem Distanz-Halten zwischen
Maxime und Handlung, frei zu sein. Und hier tritt wiederum das umgekehrte moralische Gesetz in Kraft: Wenn du das selbst nicht tun kannst, so ist es auch allgemein
nicht richtig. In den Brüdern Karamasow wird aber dieser Gedanke darüber hinaus
noch weiterentwickelt: Wenn du auf die Idee selbst nicht verzichten kannst, wenn du
ihre Umsetzung in die Tat nur noch wünschst, so wirst du die Tat begehen, auch
dann, wenn du es nicht willst, wenn dir die Durchführung unmöglich zu sein scheint.
So meint Iwan, es stehe ihm frei, beim bloßen Wunsch bzw. bei seiner Idee „Alles ist
erlaubt“ zu bleiben. Das Leben widerlegt diese Meinung als Einbildung: Der Mord
185 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 226, 230.
186 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 230.
382
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
wird begangen, und zwar von ihm, obwohl er dies nur nachträglich, nach dem Mord,
erfährt.
Die Figur des potentiellen Opfers, dessen Leben nicht nur unnütz, sondern
schädlich ist, kommt in Die Brüder Karamasow erneut vor. Es ist ein „lasterhafte[r]
Lüstling, ein[ ] durch und durch schäbige[r] Komödiant[ ]“,187 den einer seiner Söhne
ein „Scheusal“ nennt und über den ein anderer fragt: „Warum lebt so ein Mensch?“188
Die beiden werden vor Gericht erscheinen, nachdem der Mord tatsächlich begangen
worden ist. Und das Gericht wird total irregeführt. Einerseits gibt es den „mathematischen Beweis“ der Schuld des ältesten Bruders Dmitri,189 der seinem Vater dazu noch
mehrmals öffentlich mit dem Tod gedroht hat. Andererseits beschuldigt Iwan, der
seinen Verstand völlig verloren zu haben scheint, den vierten Bruder, den Lakaien
Smerdjakow. Dabei zeigt er den Teufel als seinen Komplizen an und bezeichnet sich
selbst als Hauptmörder. Am Ende wird Dmitri schuldig gesprochen und zu einer der
härtesten Strafen in Sibirien verurteilt. Das ist ein „Justizirrtumsvorfall“: Das harte
Urteil gründet sich auf die Evidenz bzw. auf einen Beweis von Dmitris Schuld, die
gerade nicht vorhanden ist.
Der Leser bekommt ein anderes Bild des Mordes als das Gericht. Den Mord hat in
der Tat Smerdjakow begangen. Weder Iwan noch Dmitri waren daran beteiligt. Nur in
ihren Wünschen waren sie sich beide mit Smerdjakow einig. Beide haben sich den
Tod des Vaters gewünscht und, besonders Iwan, einen Mord für richtig und gerechtfertigt gehalten. Für diesen Wunsch, für diese „Hässlichkeit“ der eigenen Wünsche
will Dmitri bestraft werden und ist bereit, sich dem Justizirrtum zu unterwerfen.190
Auch Iwan bekennt sich zu dieser ihm selbst unklaren Schuld und erkrankt daran.
Allein Smerdjakow, der eigentliche Täter, verneint seine Schuld und beschuldigt
einen anderen – Iwan:
Sie haben gemordet, Sie vor allem sind der Mörder, wahrhaftig, ich bin nur Ihr Handlanger
gewesen, Ihr treuer Diener Litscharda, und auf Ihr Geheiß hab ich’s vollbracht.
Nach Recht und Billigkeit sind Sie, ja, Sie der Mörder!191
Aber auch er selbst kann mit dieser von ihm nicht anerkannten Schuld nicht weiterleben. Er verurteilt sich zum Tode, er erhängt sich.
Was Iwan angeht, so wollte er nicht nur den Tod des Vaters, sondern auch den
Mord:
187 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 119.
188 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 120.
189 Ein Brief, in dem er schrieb, er habe vor, den Mord zu begehen (Dostojewski, Die Brüder
Karamasow, Bd. 2, S. 458 f.).
190 Vgl. den Brief an Nikolai A. Ljubimow vom 16. November 1879 (DGA 30 (Teil I), S. 130).
191 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 465, 471.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
383
‚Das verhüt Gott!‘ rief Aljoscha aus. ‚Warum sollte er’s verhüten?‘ preßte Iwan mit boshaft verzerrtem Gesicht, noch immer flüsternd, hervor. ‚Ein Scheusal frißt das andre auf, beiden geschieht’s recht.‘192
Er wünschte sich also, dass sein Bruder zu einem Mörder wird. „Soll ich etwa meines
Bruders Dmitri Hüter sein?“193 fragen beide, Iwan und Smerdjakow. Die Antwort, die
Kain über seinen Bruder Abel an Gott richtete (Gen. 4; 9), wird so zum Leitfaden
des Verbrechens: Nicht bloß der Mord, sondern der Mord, der von einem anderen,
von seinem Bruder, begangen wird, wird von Iwan gewollt. Dennoch, von Schuld
im juristischen Sinn kann hier kaum die Rede sein. Für Wünsche kann man nicht
bestraft werden. Denn aus der Sicht des Rechts sind Wünsche frei von jeglicher
Verantwortung.
Für Iwan ist diese Verantwortung jedoch unumstößlich, wenn sie auch rätselhaft
ist:
Sollte nicht Dmitri, sondern Smerdjakow den Mord begangen haben, so bin ich natürlich sein
Mittäter – als der, der ihn angestiftet hat. Ob ich ihn angestiftet habe, das weiß ich noch nicht.
Gesetzt aber den Fall, daß er getötet hat, nicht Dmitri, so bin natürlich auch ich ein Mörder.194
Aus juristischer Sicht wäre gerade das Umgekehrte richtig: Nur wenn Dmitri und nicht
Smerdjakow der Mörder wäre, dann wäre Iwan vielleicht indirekt am Mord mitschuldig. Denn er wusste, dass Dmitri dem Vater mehrmals mit dem Tod gedroht hatte.
Dass er Smerdjakow „angestiftet“ hat, kann man dagegen nicht behaupten (Iwan ist
sich darüber selbst nicht im Klaren), denn hierüber wurde kein offenes Wort verloren.
Was die These „Alles ist erlaubt“ angeht, so wurde sie nur abstrakt ausgesprochen. Er
konnte schließlich nicht wissen, dass sie eine solche Wirkung auf Smerdjakow haben
wird. Und dennoch bekennt sich Iwan zu dieser für ihn undurchschaubaren Schuld.
Die Unfreiheit gegenüber der eigenen Idee wird dabei gegenüber der von Raskolnikow
verdoppelt: Denn nicht Iwan selbst, sondern ein anderer wird zu der Tat wie zum Tode
verurteilt und muss sich danach das Leben nehmen. Iwan ist dabei derjenige, der die
Tat nicht wagt, der sich vor den letzten Konsequenzen seiner Idee scheut. Nach der
Tat verachtet Smerdjakow ihn als einen Feigling, der zu der Tat, die aus seiner Idee
resultierte, nicht fähig war und immer noch an seinem Gewissen leidet.195 Er zieht
192 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 226, 230.
193 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 370. Iwan stellt die Frage direkt, er spielt mit
Absicht auf die Bibelgeschichte an. Smerdjakow tut dies dagegen so indirekt, dass es unklar bleibt, ob
ihm das bewusst ist: „Inwiefern könnte ich über Dmitri Fjodorowitsch unterrichtet sein? Bin ich etwa
bei ihnen zum Wächter bestellt?“ (Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 36).
194 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 456.
195 Vgl. „Damals waren Sie doch so kühn, ‚alles ist erlaubt‘, sagten Sie, gewiß, Herr, und jetzt, da sind
Sie so erschrocken! Nichts wagen Sie – und taten früher doch so kühn!“ (Dostojewski, Die Brüder
Karamasow, Bd. 2, S. 467, 481).
384
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
damit die logische Schlussfolgerung aus der Alles-ist-Erlaubt-These, die Iwans Teufel
so formuliert:
Das Gewissen! Was ist es schon, das Gewissen? Ich mache es selber. Wozu quäle ich mich? Aus
Gewohnheit. Aus einer Gewohnheit, an der seit siebentausend Jahren die ganze Menschheit
hängt. Legen wir die Gewohnheit ab, seien wir Götter.196
Eben dies versucht Smerdjakow, und als Menschengott begeht er die Tat der letzten
Verzweiflung, einen Selbstmord. Ein Schuldbekenntnis wird dabei nicht abgelegt,
weil er weder an Schuld noch an das Gute glaubt. Iwan tut etwas anderes: Er
unterwirft sich dem Gesetz, an das er nicht glaubt, er bekennt seine Schuld vor Gericht, obwohl ihm natürlich keiner glaubt.
In dem Moment des Schuldbekenntnisses offenbart sich Iwan die tödliche Kraft
seiner Idee, seines Teufels. Sie ist wie eine Krankheit, die alle Menschen herum
ansteckt, die alles verdirbt. Die Schuld kennt keine Grenzen: „Alle wünschen den Tod
des Vaters.“ Und dann, wie häufig bei Dostojewski, wird diesem pathetisch übertriebenen Gedanken sofort eine herabwürdigend-realistische Bedeutung beigelegt:
Das Publikum genießt die Katastrophe als eine Art Spektakel. „Wäre da kein Vatermord, würden sie alle wütend und gingen böse auseinander…“197
Dieser Gedanke über die allumfassende Wirkung des Bösen ist für Dostojewski
grundlegend. In den Dämonen wurde er so formuliert:
Jeder, der sündigt, sündigt damit schon immer gegen alle und jeder ist irgendwie an der fremden
Sünde mitschuldig. Eine einzelne Sünde gibt es nicht. (DGA 11, S. 26)198
Das Böse ist somit nicht individuell – weder in dem Sinne, dass es der Spontaneität
des Einzelnen entspringt, noch in dem Sinne, dass es nur vom „Täter“ allein zu
verantworten ist. Die Freiheit als Autonomie wird somit doppelt relativiert: Sie erweist
sich als äußerste Unfreiheit und sie betrifft die anderen Menschenwesen. Wenn man
keine Freiheit gegenüber seiner eigenen Idee finden kann, ist man zum Bösen aus
Unfreiheit verurteilt; man verurteilt damit auch die anderen Menschen, die einem
begegnen und die durch diese Idee bzw. die ihr entsprungene Tat versklavt werden.
Die Idee kennt somit keine individuellen Grenzen, und so auch nicht die Schuld. Dostojewskis Mensch trägt die Verantwortung für die Unfreiheit der Tat, die nicht er,
sondern ein anderer begangen hat. Er trägt die Verantwortung für seine eigene Unfreiheit und für die Unfreiheit des anderen.
Die Freiheit nannte Kant eine besondere Art der Kausalität. Sie solle anders
gedacht werden als die Kausalität aus Natur. Nur durch die Freiheit wird die Vernunft
196 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 513. In Iwans Vision sagte der Teufel diese Worte
nicht. Die schreibt ihm Iwan selbst nachträglich zu.
197 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 564.
198 Diese Stelle fehlt in der deutschen Übersetzung.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
385
praktisch, d. h. sie wird zum Vermögen zur Handlung. Nur so kann auch eine Handlung – moralisch und rechtlich – verantwortet werden. Diese Verbindung stellte
Nietzsche, wie im zweiten Kapitel schon angedeutet, in Frage:
Ihr d ü r f t nicht strafen, ihr Anhänger der Lehre vom ‚freien Willen‘, nach euern eigenen Grundsätzen nicht! (MA II, WS 23, KSA 2, S. 558)
Die Moral aus Vernunft, die sich auf die Annahme der Freiheit stützt und in ihr den
letzten Grund der Handlung sieht, wird unvermeidlich paradox. Denn gerade als freie
bzw. vernünftige könne Letztere nicht verwerflich sein; als unfreie dürfe sie nicht
bestraft werden. Die Strafe wird somit, so Nietzsche, bloß zur Rache für das Geschehen – das Geschehen, dem nachträglich eine Motivation bzw. die Kausalität aus
Freiheit zugeschrieben wird. Der Verbrecher wird zum „bleichen Verbrecher“, der sich
der Strafe willig unterwirft, der in ihr eine Erlösung von der Unvernünftigkeit seiner
Tat findet (Z I, Die Reden Zarathustra’s, KSA 4, S. 45 ff.). Gerade dies geschah mit
Raskolnikow. Dennoch ist ein Schuldbekenntnis für Dostojewski deshalb nicht bedeutungslos, es ist kein Selbst-Missverständnis. Die Verantwortung für die Tat wird
keineswegs verneint, nur die individuellen Grenzen dieser Verantwortung.
Wiederum sieht man hier, wie Dostojewski Nietzsches Kritik an der Moral aus
Vernunft antizipiert, jedoch dabei andere Ziele verfolgt, andere Ideale ins Spiel bringt
und schließlich die Plausibilitäten dieser Kritik selbst in Frage stellt. Schon der Kellerlochmensch wusste, dass die Logik der Moral aus Vernunft paradox, letztendlich
trügerisch ist, dass es zwischen Wünschen und Handlungen, zwischen Schuld und
Strafe keine vernünftige Verbindung zu geben scheint. Sein Fluch bestand darin, dass
er zu viel durchschaute und folglich an zu wenig glauben konnte – am wenigsten an
die Gerechtigkeit.
Der Mensch rächt sich, weil er die Rache für einen Akt der Gerechtigkeit ansieht. Also hat er eine
uranfängliche Ursache gefunden, nämlich die Gerechtigkeit. […] Ich dagegen sehe darin keine
Gerechtigkeit, und eine Tugend finde ich darin ebenfalls nicht; folglich, wenn ich anfange mich
zu rächen, so tue ich es höchstens aus Bosheit. […] Die Bosheit unterliegt bei mir, wieder infolge
dieser verdammten Gesetze der Erkenntnis, einem chemischen Zersetzungsprozeß. Man sieht:
Der Gegenstand verflüchtigt sich, die Gründe verdampfen, ein Schuldiger ist nicht zu finden, die
Beleidigung stellt sich nicht als Beleidigung, sondern als Fatum heraus, als etwas im Genre der
Zahnschmerzen, an denen niemand die Schuld trägt […].199
Für die Handlung sei eine Beschränkung, eine Art Dummheit nötig.
Denn die direkte, regelmäßige, unmittelbare Frucht der Erkenntnis [des Bewusstseins – E.P.] ist
die Untätigkeit, das heißt das bewußte Dasitzen mit den Händen im Schoße. […] Ich übe mich im
Denken, und folglich zieht bei mir jede uranfängliche Ursache sofort eine andere noch tiefer
199 Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 29 f.
386
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
liegende Ursache hinter sich her, und so weiter bis ins Unendliche. Darin besteht eben das Wesen
aller Erkenntnis und allen Denkens.200
Nur aus Mangel an Denkfähigkeit sei es möglich, die Tat sich oder einem anderen
zuzurechnen, als ob sie unmittelbar aus Freiheit entspränge.
Doch auch wenn der Mensch Dostojewskis sehr wohl weiß, dass die Tat rätselhaft
ist und unendlich vielfältige Gründe hat, sodass es keine direkte Verbindung zwischen der Tat und ihrem Beweggrund, keine Spontaneität aus Freiheit geben kann, ist
für ihn seine Verantwortung für das „Hässliche“ in ihr unumstößlich, ebenso wie die
Strafe für sie unabwendbar ist. Der letzte Grund scheint das Fatum zu sein, und
dennoch wird er für sein Fatum bestraft und muss es mit seinem Leben verantworten.
Wenn die Freiheit als Spontaneität und Selbstgesetzgebung sich als bloße Einbildung
erweist, so ist die Unfreiheit offensichtlich tödlich. Der Dialektiker Iwan, der eine
unbegrenzte moralische Freiheit („alles ist erlaubt“) beansprucht, wird von dem
„Lakaien“ Smerdjakow versklavt.201 Das Böse, das sich durch die Tat eines anderen
Menschen ergeben hat, verbreitet ihre Macht auf alle, es wird allmächtig. Das Wort
des Evangeliums, dass die schlimmste Sünde diejenige sei, durch die „einem dieser
Kleinen“ „Anlaß zur Sünde“ gegeben wird (Mt. 18; 6), wird mitsamt dem Wort des
Alten Testaments (Kains Antwort an Gott) zum härtesten Urteil für alle Beteiligten.
Dieses Böse, so Dostojewski, tötet nicht nur das Opfer, sondern auch den Täter, es
verführt nicht nur die „Kleinen“, sondern auch die „Großen“. Der Mensch wird zu
Kain – zu dem, der, indem er nicht der „Hüter“ seines Bruders sein will, ihn ermordet.
Die Macht dieses Bösen, diese allumfassende Unfreiheit, scheint unbegrenzt zu sein.
Und doch, wie Alexej, der einzige am Mord unschuldig gebliebene Bruder, sagte,
kann Gott noch siegen.202 Das Gute siegt in dem Moment, in dem der Mensch sich zu
seiner Schuld aus Unfreiheit bekennt, auch wenn er dabei dem dient, woran er nicht
glaubt, woran er in seiner Unfreiheit nicht glauben kann.
Schuld als Befreiung
Dostojewski wollte, anders als Nietzsche, keine Erschütterung der Grundlage der
Moral und, anders als Tolstoi, keine Verleugnung des Rechts. Dennoch war die
Abgrenzung des Moralischen und Pragmatischen auch für ihn nicht länger plausibel,
auch er stellte die Unterscheidung von Gut und Böse in die Perspektive des Lebens:
Das Böse ist das, wodurch das Leben unmöglich wird, wodurch es zur Krankheit wird.
200 Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, S. 28 f. Hier steht im Russischen statt „Erkenntnis“ „Bewusstsein“ („сознание“) (DGA 5, S. 108 f.).
201 Iwan ist unangenehm überrascht, als er noch vor dem Mord herausfindet, dass Smerdjakow eine
Art Macht über ihn hat (Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 448).
202 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 516.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
387
Es ist zwar nicht radikal, aber dafür alternativlos, keine Sache der freien Entscheidung.203 Es entspringt einer Idee, die einem nicht frei steht, sondern einen zur Tat
zwingt.204 Diese Unfreiheit allein ist dem Menschen unerträglich, sie versperrt ihm
das Leben. Alle Verbrecher Dostojewskis sind dementsprechend unglücklich und
krank. Ihre Strafe beginnt lange bevor eine Gerichts- und Bestrafungsinstanz ins Spiel
kommt. Und, wie ungerecht Letztere auch sein mag, sie ist nichts im Vergleich zu dem
Bösen, das der Tat entspringt – zu dem Bösen des Leidens an dem eigenen Verbrechen, zu dem Bösen der Unfreiheit.
Das Wort „Fatum“ wurde schon ausgesprochen – als Schlussfolgerung, zu der der
Kellerlochmensch in seiner Kritik einer vernünftigen Moral gekommen ist. Dennoch
lag in diesem Stichwort ein Einwand gegen das Leben. Denn mit ihm wurde gerade
der Eigenwille verneint, der als das Menschliche schlechthin präsentiert worden ist.
In dieser inneren Spannung zwischen dem Fatum-Gedanken und der Unmöglichkeit,
sich mit ihm abzufinden, ist Dostojewskis Mensch, wie in einem Kellerloch, gefangen.
Er leidet unter jedem Versuch, sich der Wirklichkeit um ihn herum zu stellen – und
kann von diesem Versuch doch nicht lassen, wie der zweite Teil der Aufzeichnungen
aus dem Kellerloch zeigen sollte. Wenn es eine Freiheit von dieser Dialektik gäbe, die
das Leben wieder möglich machen könnte, so wäre dies eine Freiheit jenseits der
eigenen Willkür, das Gegenteil zur Besessenheit von der Idee der eigenen Menschheit.
Die Freiheit, die das Leben ermöglicht, wäre dann keine Freiheit der Spontaneität und
der Selbstgesetzgebung, vielleicht auch keine Freiheit von dem Bösen, wenn sie auch
gegen das Böse gerichtet werden soll. Als rätselhafte Freiheit wurde sie schon angedeutet und muss jetzt erläutert werden – die Freiheit in der Erkenntnis des Guten und
des Bösen, die Freiheit Christi.
Es dürfte allerdings schon klar geworden sein, dass diese Freiheit nicht darin
bestehen kann, der eigenen Moral zu gehorchen, sondern eher umgekehrt darin,
gegenüber der eigenen Moral frei zu sein. Das Letztere erwies sich gerade als äußerste
Unfreiheit, als Unfreiheit gegenüber der eigenen Idee, die mit der Tat bestraft wird.
War aber nicht gerade diese Freiheit als „Erkenntnis des Guten und des Bösen“ in
Iwans Poem Der Großinquisitor angedeutet? Sollte der Mensch nicht entscheiden
dürfen, „was gut und böse ist“? Allerdings sollte er es „mit freiem Herzen“ tun, das nur
von dem einzigen „Bild“, d. h. von der Gestalt Christi, geleitet wird. Wie ist dies zu
verstehen? Um Dostojewskis Deutung der Freiheit Christi zu verstehen, müssen wir
näher betrachten, wie er diese Gestalt dargestellt hat. Der erste Versuch wird im
203 Auch lexikalisch ist diese Unterscheidung im Russischen nicht so radikal wie im Deutschen. Das
Adjektiv „злой“ (böse) kann auch im Sinne „плохой“ (übel, schlecht) benutzt werden: „злая судьба“
(böses Schicksal).
204 Keiner von Dostojewskis großen Verbrechern tötet bloß aus Eigennutz. Wer dies, wie Smerdjakow, auch zu tun wähnt, irrt sich gewaltig. Er wird auf den Gewinn sehr bald selbst verzichten. So wird
das Geld zurückgegeben: „‚Ich brauche es überhaupt nicht‘, sagte Smerdjakow mit zitternder Stimme
und winkte ab.“ (Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 479).
388
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Roman Der Idiot unternommen. Aber gelungen, es sei schon jetzt vorweggenommen,
ist es ihm, wenn überhaupt, erst in Die Brüder Karamasow. Wenden wir uns zuerst
diesem ersten, gescheiterten Versuch des großen Künstlers zu.205
In einem Brief schrieb Dostojewski zu Der Idiot:
Die Idee des Romans ist die alte und von mir immer bevorzugte; sie ist aber so schwierig, daß ich
bisher noch nie den Mut hatte, sie auszuführen; wenn ich sie jetzt doch in Angriff nehme, so
geschieht es nur, weil meine Lage verzweifelt ist. Die Grundidee ist die Darstellung eines wahrhaft vollkommenen und schönen Menschen. Und dies ist schwieriger als irgend etwas in der
Welt, besonders aber heutzutage. […] Es gibt in der Welt nur eine einzige positiv-schöne Gestalt:
Christus […].206
So wird die Projektion auf Christus und der Versuch, das Gute in einer menschlichen
Gestalt aufzuzeigen, zum zentralen Moment im Roman Der Idiot – der Roman, der
vermutlich Nietzsches Verständnis vom „Typus des Erlösers“ zu der Zeit von Der
Antichrist geprägt hat. Und tatsächlich wird der Fürst Myschkin in Notizen zum
Roman „Fürst-Christus“ genannt. Aber diese Benennung ist bereits ambivalent, weil
als Fürst dieser Welt (und dies ist für einen russischen Leser besonders auffallend)
nicht Christus, sondern der Antichrist bezeichnet wird. Die Projektion auf das Evangelium ist allerdings an mehreren Stellen des Romans offensichtlich: Man denke nur
an die schweizerische Geschichte mit Marie wie auch an die mit Nastassja Filippowna.
Auch das in der Mitte des Romans vorkommende Bild von Hans Holbein, mit dem die
Leiche Christi geschildert wird, kann nicht anders denn als Projektion auf Myschkin
und als dunkle Vorhersage seines Schicksals verstanden werden. Und dennoch wird
gerade durch diese Bilder und Projektionen der grundlegende Gedanke Dostojewskis
als Künstler offenbart: Sein Myschkin ist vielleicht kein Christus. Er ist eher als sein
Gegenteil zu verstehen.
Schauen wir uns genauer an, wie das Gute von Myschkin in der Welt umgesetzt
wird. Er erweist sich in jeder Situation als jemand, der alles „versteht“. Er könne die
Menschen „durchdringen“, „durch und durch wie ein Pfeil“.207 Er scheint die ganze
Dialektik der Unfreiheit auf tiefste und vertraulichste Weise zu kennen. Denn je tiefer
er in die Menschen hineinschaut, desto klarer wird ihm, dass die Menschen nicht
205 Gemeint ist das Scheitern gegenüber der ursprünglichen Intention, mit Myschkin ein Ideal darzustellen. Dieser wird am Ende doch krank. Vgl. dazu Tolstoi: „Wenn er [Myschkin – E.P.] gesund wäre,
seine herzliche Naivität und Reinheit hätten auf uns rührend gewirkt. Aber um ihn gesund zu
schildern, fehlte es Dostojewski an Mut“ (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников (L.N. Tolstoi
in Erinnerungen seiner Zeitgenossen), Bd. 2, S. 388). Dennoch wird im nächsten Abschnitt dieses
Kapitels gezeigt, dass sich gerade durch dieses „Scheitern“ die Stärke von Dostojewskis Talent zeigte,
nämlich seine Konsequenz in der Darstellung der dramatisch gespaltenen, allen Idealen fremden
modernen Welt. In der oben schon angegebenen Untersuchung von mir ist diesem Thema ein Kapitel
gewidmet (die Verfass., Поэтика драмы и эстетика театра в романе, S. 238 ff.).
206 Brief an S.A. Iwanowa vom 13. Januar 1868, in: Dostojewski, Gesammelte Briefe, S. 251 f.
207 Fjodor M. Dostojewskij, Der Idiot, S. 449.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
389
wirklich schuld, sondern bloß unglücklich sind. Überall sieht er schuldmindernde
Gründe, und d. h.: die Unfreiheit der Täter. Zum Beispiel sagt er zu Nastassja Filippowna:
Gerade wollten Sie sich selbst zerstören, unwiederbringlich, denn Sie hätten es sich später
niemals verziehen: Aber Sie trifft überhaupt keine Schuld. […] Sie sind stolz, Nastassja Filippowna, aber möglicherweise bereits so unglücklich, daß Sie sich für schuldig halten.208
Es gebe keine Schuld, nur Unglück, das besonders darin bestehe, dass der Mensch
sich für schuldig hält. Wenn bei Nastassja Filippowna diese Einschätzung zutreffend
zu sein scheint, so ist sie im Bezug auf Rogoschin, der einen Mordanschlag auf
Myschkin selbst versuchte, viel weniger verständlich:
‚Und ich sage dir, daß ich nur jenen Parfjon Rogoschin kenne, mit dem ich an jenem Tag die
Kreuze getauscht habe und der mein Bruder geworden ist; […] Ich sage dir, daß ich alles, was
damals geschah, für bloßen Wahn halte […] Was du dir eingebildet hast, ist nie gewesen und
konnte niemals sein. Warum sollte dann unsere Bosheit sein?‘ […]
‚Wärest du damals nicht in einem Zustand gewesen, in dem du nur eines denken konntest,
dann hättest du vielleicht überhaupt nicht das Messer gegen mich gezückt.‘209
Das Argument ist wiederum ganz im Sinne des Kellerlochmenschen: Den letzten
Grund gibt es nicht. Die Tat ist der Krankheit entsprungen, sie ist selbst eine Krankheit. Dennoch nimmt Rogoschin dies als Erklärung nicht wirklich an, zumindest nicht
als Entschuldigung.
Vielleicht hab’ ich meine Tat seitdem noch keinmal bereut, du aber sendest mir schon dein
brüderliches Vergeben.210
Diese brüderliche Geste ist durchaus paradox: Sie ist die Vergebung der Schuld, die
nicht als solche anerkannt wird. Als Entlastung von der Schuld ist sie eine Rechtfertigung, die einem Schuldigen unglaubwürdig, ja lächerlich und wirkungslos vorkommt.
Merkwürdigerweise halten sich alle Menschen, die Myschkin auf diese Weise
rechtfertigt, weiter für schuldig. Obwohl Myschkin sie für unschuldig erklärt (Nastassja Filippowna wird, was immer sie tut, von Myschkin als „die Wahnsinnige“ bezeichnet211), ändert dies nichts an ihrem Verhalten. Und so kommt es bei ihnen allen, vor
allem aber bei Myschkin selbst, zum Zusammenbruch, zur Katastrophe. Das Bild von
Hans Holbein, das Bild eines verwesenden, zerrissenen Körpers, kann, wie er selbst
sagt, nur den Verlust des Glaubens veranlassen. Es ist das Bild Christi, das den
208
209
210
211
Fjodor M. Dostojewskij, Der Idiot, S. 245.
Fjodor M. Dostojewskij, Der Idiot, S. 527 f.
Fjodor M. Dostojewskij, Der Idiot, S. 528.
Fjodor M. Dostojewskij, Der Idiot, S. 531.
390
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Glauben an ihn vernichtet, denn es zeigt – so ein anderer Epileptiker und Menschengott –, dass
die Naturgesetze auch diesen Einmaligen nicht verschont, mit ihrem eigenen Wunderwerk kein
Erbarmen gehabt haben und auch Ihn gezwungen haben, inmitten der Lüge zu leben und für
Lüge zu sterben.212
Und so wird dieses Bild zur mächtigsten Prophezeiung im Roman: Auch Myschkin
wird von den Menschen, die er liebt und denen er helfen will, zerrissen, auch seine
Wahrheit erweist sich als Lüge. Sein gütiges Wort der Versöhnung, sein vernünftiges
Wort des Verständnisses kann keinem helfen. So vermerkt Dostojewski für sich die
folgenden Gedanken für einen künftigen Roman:
NB. Der Fürst berührte nur ihr Leben. Aber alles, was er tun, alles, was er unternehmen könnte,
das alles starb mit ihm. Russland wirkte allmählich auf ihn. Seine Einsichten. (DGA 9, S. 242)
Trotz all seiner Einsichten, all seiner Vernunft und Herzensgüte zeigt „der schöne
Mensch“ sich gegenüber der Welt ohnmächtig. Myschkin ist so der Christus, der von
der Welt überwältigt wird. Es gibt keinen Sieg, keine Auferstehung für ihn. Das Gute
aus Vernunft, das durch den „schönen Menschen“ verkörpert wird, ist in dieser Welt
zur Ohnmacht und zum Kollaps verurteilt. Der gute Mensch wird zum Idioten.
Das Idiot-Sein wird Myschkin mehrmals zugesprochen, v. a. negativ, indem die
anderen sich wundern, warum er ein Idiot genannt wird.213 Viele sagen, dass „der
Fürst außerordentlich klug ist“ und es keinen gäbe, der klüger wäre.214 Einige kommen, um ihm ihr Leben zu beichten. Und er ist nicht nur klug, sondern er liebt die
Menschen. Er liebt die Menschen zu sehr, um ihnen das Joch der Schuld aufzuhalsen.
Myschkin zieht damit die letzten Konsequenzen der Kritik einer Moral aus Vernunft:
Die offensichtliche Unmöglichkeit, die Handlung als spontan und berechenbar zu
betrachten, bedeutet, man solle die Menschen von ihrer Schuld freisprechen. Er
glaubt selbst daran und bewegt die anderen dazu, an das Fatum zu glauben, das das
Leben der Menschen beherrscht.215 Die Schuld sei bloß das Unglück, das einem
widerfährt. Er ist somit der Apostel der äußersten Unfreiheit, die gegen das Leben
gerichtet ist.216
212 Dostojewski, Die Dämonen, S. 908.
213 Vgl. z. B. Dostojewskij, Der Idiot, S. 199, 451.
214 Fjodor M. Dostojewskij, Der Idiot, S. 84. Aglaja hat den Verdacht, dass er glaubt, „klüger als
andere leben“ zu können. Und er leugnet es nicht (Fjodor M. Dostojewskij, Der Idiot, S. 91).
215 Der Fatum-Gedanke wird im Roman mit mehreren Prophezeiungen angedeutet, die sich alle
erfüllen. S. dazu die Verfass., Поэтика драмы и эстетика театра в романе, S. 101 ff.
216 Die hier vorgelegte Interpretation wendet sich bewusst gegen die in der Forschung vorherrschende Meinung, Myschkin sei als Dostojewskis Ideal und Apostel Christi in der gottlosen Welt zu verstehen; er besitze sogar gewisse Ähnlichkeit mit Dostojewski selbst und sei deshalb als sein Sprachrohr
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
391
Myschkin tötet niemanden. Aber seinetwegen wird Nastassja Filippowna getötet,
Rogoschin wird zum Mörder. Er selbst stürzt in die Finsternis geistiger Umnachtung.
Und wenn er im Roman mehrmals als Idiot bezeichnet wird, so erweist sich diese
Benennung schließlich nicht als Ausdruck des Unverständnisses, nicht als Metapher
der Ungeschicklichkeit und der kindlichen Naivität, sondern als medizinische Diagnose, als endgültiges Urteil seines Arztes. Sein geistiger Zusammenbruch ist der
Schluss und das Fazit des Romans, der durch die ganze Handlung vorbereitet wurde.
Was dieser Idiotismus genau bedeutet, kann erst im nächsten Abschnitt dieses Kapitels ausgeführt werden. An dieser Stelle ist es wichtig, dass Myschkin, trotz all seiner
Unschuld, den anderen nicht helfen kann, dass er, indem er all den von ihm so sehr
geliebten Menschen die Schuld absprach, sie zum Untergang verurteilt hat.
Was aber ist so schädlich an dem, was Myschkin, der „schöne Mensch“, der
„Fürst Christus“ macht? Eine eindeutige Antwort scheint schwer zu geben zu sein.
Dennoch ist sie nicht ganz unklar. Seine Ohnmacht ist die Ohnmacht einer Moral aus
Vernunft in ihrer letzten Konsequenz – dem Fatum-Gedanken, der alle Menschen von
der Schuld freispricht. Denn für die Unfreiheit kann man nicht bestraft werden, das
Fatum kann man nicht verantworten. Jede Schuld muss als bloßes Missverständnis
und sogar als Grausamkeit gegenüber den Beschuldigten verstanden werden. Dieses
Absprechen der Schuld im Namen der Menschenliebe ist das Credo des „schönen
Menschen“. Die Menschen sind unfrei und unglücklich. Und alles, was einem Menschenfreund bleibt, ist, ihnen in diesem Unglück beizustehen und mit ihnen zusammen zugrunde zu gehen.
Dies kann, zumindest aus Dostojewskis Sicht, jedoch nicht der Weg Christi sein.
Dostojewski selbst hat niemals behauptet, es gäbe für einen Christen kein Verbrechen,
keine Schuld und keine Verantwortung für die Tat. Ganz im Gegenteil: Gerade da, wo
der Ausweg aus der totalen Herrschaft des Bösen gesucht wird, muss von Schuld und
Verbrechen gesprochen werden. Das russische Volk, schreibt er in seinem Tagebuch
eines Schriftstellers, bezeichnet zwar den Verbrecher immer als Unglücklichen und
wirft ihm sein Verbrechen niemals vor, aber es verleugnet dabei weder seine Schuld
noch das Verbrechen.217 Es sei keine Inkonsequenz, sondern impliziere andere Begriffe der Schuld und Verantwortung als diejenigen, die wir von der abendländischen
Moralphilosophie her kennen. Der „schöne Mensch“ folgt u. a. dem kantischen Gebot
der Liebe: Er unterstellt jedem frei, von allen äußeren Umständen abgesehen, die
Vernünftigkeit und Moralität, die Menschheit. Und er tut dies im Sinne der „Liebe mit
sehenden Augen“ von Nietzsches Zarathustra, im Sinne der „Gerechtigkeit, die Jeden freispricht, ausgenommen den Richtenden“ (Z I, Die Reden Zarathustras, KSA 4,
anzusehen. S. z. B. Zenta Maurina, Dostojewskij. Menschengestalter und Gottsucher, S. 197 ff. Myschkins
Idiotismus wird von Maurina im Anschluss an Wladimir Solowjew als Höhe seines Ideals, als seine
Güte gedeutet. Er sei ein Idealist, ein Träumer und Führer der Menschheit. Dennoch muss auch sie am
Ende den Misserfolg seiner Mission feststellen (S. 206).
217 Vgl. Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 35 f.
392
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
S. 88). Er geht sogar weiter: Auch einen Richtenden (z. B. Ewgeni Pawlowitsch) bezichtigt er nicht, sondern ruft ihn nur dazu auf, auf das Richten zu verzichten. Das
Böse der Unfreiheit verbreitet sich jedoch durch diese Gutmütigkeit gewaltig. Es ist
offensichtlich, dass Myschkins Güte, seine wohltätige Liebe kein Weg des Lebens ist,
sondern gerade der Weg des Todes.
Wie sähe dann der andere Weg aus, der des Lebens? Indem wir zu dieser Frage
gekommen sind, wissen wir schon, was die Antwort ausschließt: Die Freiheit vom
Bösen kann nicht im Willen gefunden werden, der eine spontane Handlung aus einer
moralischen Maxime hervorbringt; es ist aber auch kein Absprechen von Schuld, kein
Fatum-Gedanke. Das Gute ist auf dem Weg der Moral aus Vernunft, wie tiefgreifend
sie auch sein mag – ob sie dem Willen die Spontaneität zuspricht oder sie, umgekehrt,
gerade verneint –, nicht zu finden. In diesem Punkt nimmt Dostojewski Nietzsches
Argument vorweg, weist es aber schließlich zurück: Es kann sein, dass es keine
Freiheit in der Verbindung zwischen Tat und Absicht, zwischen Tun und Wollen,
zwischen den vielfältigen Ursachen einer Handlung und den ihr nachträglich zugeschriebenen Triebfedern wie auch ihren Folgen gibt. Es kann auch sein, dass man
gegenüber den anderen, gegenüber der Herden-Moral, gerade am unfreisten ist. Dem
Menschen die Schuld abzusprechen und ihn aufzurufen, nur seinen eigenen Wünschen zu folgen, bedeutet jedoch keine Freiheit des Geistes und keine Erlösung,218 es
bedeutet nur noch die Unfreiheit der dialektischen Vernunft, wie beim Kellerlochmenschen oder bei Iwan Karamasow, und den Wahn eines gutmütigen Idioten, wie
bei Myschkin. Nicht durch das Absprechen der Schuld, sondern auf dem gerade umgekehrten Weg ist die Freiheit vom Bösen zu finden: in einem persönlichen Schuldbekenntnis für die nicht individuelle Schuld und in einer nicht bloß moralischen, sondern
öffentlichen und zu einer öffentlichen Strafe führenden Schulderklärung.219
Dostojewskis Gedanke folgt einer Art apagogischem Beweis, mit Mitteln, die nur
einem Künstler zur Verfügung stehen. Zwar kann es keinen richtigen Beweis dafür
geben, aber ein „Kunstbild“ hat sehr wohl die Ohnmacht der Güte Myschkins demonstriert. Das Böse hat sich hier, durch das Absprechen der Schuld aus durchaus vernünftigen und moralisch überzeugenden Gründen, als stetig wachsende Bedrohung
für das Leben gezeigt. Eine Verleugnung der Schuld hat dem Bösen der äußersten
Unfreiheit auch noch gedient. Die Moral, die diese Verleugnung befürwortete, hat sich
somit für den Schriftsteller Dostojewski als ohnmächtig erwiesen, ihre Plausibilitäten
als unplausibel. Genauso wie die Moral der individuellen Verantwortung für die Tat,
die angeblich der Freiheit entspringt, war sie unrealistisch, sie wurde durch das Leben
selbst widerlegt. Dadurch wird der Unterschied hervorgehoben – der Unterschied
218 Vgl. z. B. GD Irrthümer, 8, KSA 6, S. 96. Hier ist von der neuen Erlösung die Rede, die in der
Befreiung vom Schuld-Gedanken besteht.
219 Auch Nietzsche war dieser Gedanke, zumindest in seinem Zarathustra, nicht fremd: „So erfindet
mir doch die Liebe, welche nicht nur alle Strafe, sondern auch alle Schuld trägt!“ (Z I, Die Reden
Zarathustra’s, KSA 4, S. 88).
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
393
zwischen dem „Fürst-Christus“, der jeden rechtfertigt und zugrunde richtet, und dem
Christus der Evangelien, der die Sünde vergibt und die Menschen von ihrer Schuld erlöst,
indem er sich selbst für die Schuld der Welt bestrafen lässt. Dostojewski versucht,
diesen Unterschied in seinem letzten Roman auf eine Formel zu bringen. Das Absprechen der individuellen Schuld, wie gerecht es auch aussieht, ist kein Ausweg, keine
Lösung. So muss man das Umgekehrte versuchen: Nicht nur muss die Schuld, die
eigene und die der anderen, anerkannt, auch die Strafe für die allumfassende Schuld
muss auf sich genommen werden. So kommt es zu einer neuen paradoxen Formel in
den Brüdern Karamasow:
Jeder von uns ist vor jedem in allem schuldig, und ich am meisten.220
Diese Formulierung ist u. a. eine klare Anspielung auf das Wort des Apostels Paulus
(„Das Wort ist gewiß und aller Annahme wert, daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der erste bin“ (1.Tim. 1; 15)), der von
Nietzsche als Urheber der christlichen Moral und auch bei Tolstoi als Urvater der
kirchlichen Lehre getadelt wurde. Der Satz wird von Staretz Sossima als Berufung
eines Mönchs und eines jeden Menschen dargestellt und erläutert:
Wenn er [ein Mönch – E.P.] nun erkennt, daß er nicht nur schlechter ist als alle Weltlichen,
sondern auch vor allen Menschen für alle und jeden die Schuld trägt, für alle Sünden, die der
Welt und die der einzelnen Menschen, dann erst wird das Ziel erreicht, um dessentwillen wir
hier beisammen sind. Denn wisset, meine Lieben, jeder einzelne von uns trägt zweifellos die
Schuld für alle und jedes auf Erden, nicht nur weil wir teilhaben an der allgemeinen Schuld der
Welt, nein, jeder als Person trägt die Schuld für alle Menschen und für jeden Menschen auf dieser Erde. Solche Einsicht krönt den Weg des Mönches, überhaupt eines jeden Menschen auf
Erden.221
Daraus ergibt sich der folgende Schluss:
Dich selber retten kannst du da nur auf eine Weise: Raff dich auf und mach dich selbst verantwortlich [zu einem Angeklagten – E.P.] für alle Menschensünde. Freund, dies ist wahrhaftig so; denn sobald du dich aufrichtig verantwortlich gemacht hast für alles und für alle, wirst
du einsehen, daß dies eben die Wahrheit ist und daß du, ja, du, schuldig bist für alle und für
alles.222
220 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 462. Dieser Satz wurde als Schlüssel zu Dostojewskis Moralphilosophie von Emmanuel Lévinas hervorgehoben. Darauf hat besonders Werner Stegmaier aufmerksam gemacht. S. Werner Stegmaier, Lévinas, S. 161 ff. Die durch diesen Satz implizierte
Moral der unbegrenzten Verantwortung interpretiert Stegmaier als Berührungspunkt zwischen Dostojewski, Nietzsche und Lévinas.
221 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 262.
222 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 514.
394
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Wichtig ist, dass es sich nicht um bloße moralische Verantwortung handelt. Der rechtliche Terminus „ответчик“ (der Angeklagte) nimmt hier eine Schlüsselfunktion ein:
Rechtlich muss man die Schuld der anderen wie seine eigene verantworten; man soll das
Leiden auf sich nehmen, das Leiden an dem, was die Menschen als ihre Gerechtigkeit
bezeichnen und was erst durch dieses willige Leiden tatsächlich die Gerechtigkeit wird –
wie Christus es einmal getan hat.223 Und diese auf sich genommene Schuld im Sinne
einer Bestrafung ist nicht etwa als Heldentat zu verstehen, sondern als einziger
Ausweg aus dem Reich des Bösen, das eine unbegrenzte Macht über den Menschen zu
haben scheint.
Die Fremdheit dieser Lösung für die abendländische Moral aus Vernunft wird von
Dostojewski auf entscheidende Weise betont. Dabei wird ihrer grundlegenden Plausibilität widersprochen, dem Denken vom Einzelnen her und vom Allgemeinen als bloßer
Summe der Einzelnen, die das Allgemeine als Pflicht frei bzw. vernünftig anerkennen
oder ablehnen können. Dementsprechend können die Einzelnen nur für die eigenen
Handlungen bzw. für die eigene Maxime verantwortlich gedacht werden. Die Grenzen
zwischen ihnen sind gleichzeitig die Grenzen ihrer Verantwortung. Und so bleiben sie,
wenn sie das Allgemeine durch ihre Maximen nicht verletzen, moralisch, wenn sie
gegen das Allgemeine durch ihre Handlungen nicht verstoßen, rechtlich gerechtfertigt.
Nur noch die Ungewissheit der Triebfeder, der „Fensterladen des Herzens“ lässt dem
Gewissen keine Ruhe und nicht die Schuld der anderen Menschen. Dass das Böse über
die Welt herrscht, kann keine Rechtfertigung sein, aber auch kein Anlass zu Gewissensbissen, denn ebenso wenig wie der Einzelne sich durch einen anderen Menschen in
seiner eigenen Schuld vertreten lassen darf, kann er für die anderen verantwortlich
sein. Nur noch als gemeinsames Ziel eines auf Vernunft gegründeten Zusammenlebens
soll die Moralität der anderen äußerlich gefördert werden. Von einer nicht individuellen
Schuld kann nicht die Rede sein. Und noch ein Lieblingsgedanke Dostojewskis sollte
sehr befremdlich wirken: Der Mensch könne (so bspw. Iwan Karamasow) sich niemals
glücklich fühlen, wenn sein Glück auf dem Unglück und Leiden eines anderen errichtet
wurde.224 Da diese Möglichkeit jedoch immer vorhanden ist, scheint es unumgänglich
zu sein, der Idee der Verantwortung eine Grenze zu setzen: Das Wohl der Mehrheit ist
nicht ohne Aufopferungen möglich und letztere dürfen, sofern sie als vernünftig gelten,
akzeptiert werden. Diesen ‚westlichen‘ Kompromiss zwischen der Idee der Gerechtigkeit und der der Nützlichkeit225 weist Dostojewski entschieden zurück.
223 Auch einem anderen Satz von Paulus, der für Tolstoi so irritierend war, nämlich dass es „keine
Macht außer von Gott“ gibt (Röm. 13; 1), kommt in diesem Sinn eine neue Deutung zu: Die Strafe kann
nicht ungerecht sein, auch wenn sie von den ungerechten, „bösen“ Machthabenden kommt. Sie ist die
welterlösende Kraft.
224 Vgl. Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 393.
225 Vgl. z. B. die im ersten Kapitel ausgeführte These Kants, dem Übel eines möglichen ungerechten
Gerichtsurteils könne man zwar nicht abhelfen, man solle es jedoch als nicht zu vermeidenden Fehler
akzeptieren, wegen des größeren Wohls, das durch die Rechtsinstitutionen gesichert wird.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
395
Die Aufhebung des Gegensatzes zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen
betonte Dostojewski immer wieder, indem er darauf bestand, dass es „eine einzelne
Sünde“ nicht geben kann (DGA 11, S. 26). In seinem Notizheft stellte er an seine
‚westlichen‘ Opponenten folgende Frage:
Versucht, euch zu trennen, versucht zu bestimmen, wo endet eure Persönlichkeit und beginnt
eine andere? Definiert ihr es mit eurer Wissenschaft! […] Im Christentum ist die Frage selbst
undenkbar.226
Das ist das, so Dostojewski, was die abendländische Wissenschaft immer vergeblich
suchte. Ihre Prinzipien waren: „Chacun pour soi et Dieu pour tous“ und, in einer
anderen Version, „Après moi le déluge“.227 Sie sollten im Westen das Gebot der
Nächstenliebe ersetzen.228 Gott ist damit zu einem bloßen Namen der Allgemeinheit
geworden und wurde mit dem Maßstab dieser Allgemeinheit selbst gerichtet. „Chacun
pour soi et Dieu pour tous“ ist die Formel des Sozialismus, der der Aufstand gegen das
Reich Christi ist, und des Katholizismus, der den Verrat an Christus verkörpert. Es ist
eine Formel der „Einsamkeit“ für eine Zeit, in der „das Verschlossensein gegen die
anderen“ zum Gesetz geworden ist.229 Das Problem liegt somit nach Dostojewski, wie
nach Tolstoi, in der falsch gedeuteten Allgemeinheit, die zur „geschlossenen Masse“
des Bösen wird. Dennoch ist Dostojewskis Kritik an dem Prinzip der Allgemeinheit
auch an die Idee des daraus gezogenen Einzellebens gerichtet, an die ebenso missverstandene Vereinzelung des Menschen. Eine vereinzelt verstandene Schuld macht
keinen Sinn, weil die Grenzen zwischen den Menschen bzw. zwischen ihnen und der
Welt nicht absolut sind. Sie stehen nicht fest:
[A]lles ist wie ein Ozean, alles strömt, eines grenzt ans andere, du klopfst an einer Stelle, und das
Echo kommt zu dir vom anderen Ende der Welt.230
Dostojewski macht somit noch einen weiteren Schritt in die Richtung Nietzsches,
indem er, wie auch früher Tolstoi, die Menschenseele als flüssig versteht, indem er die
Grenzen des Individuellen als äußerst instabil darlegt. Auch Moral gehört in diesen
226 Богданов (Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве, S. 460. Vgl. Dostojewskis Plädoyer gegen die
„positive Wissenschaft“, die beansprucht, „die moralischen Grenzen zwischen den Persönlichkeiten
der Einzelnen wie der Nationen zu bestimmen“ (Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 310).
Später wird diese Ablehnung der grundlegenden Plausibilität des abendländischen Denkens bei Philosophen wie Wladimir Solowjew und Nikolai Berdjajew in die Idee der All-Einheit („соборность“)
bzw. des mystischen Leibes aufgenommen und weiterentwickelt. Dostojewskis Entgegensetzung von
Gottmensch und Menschgott spielt dabei eine entscheidende Rolle. S. dazu z. B.: Wolfgang Dietrich
(Hg.), Russische Religionsdenker: Tolstoi, Dostojewski, Solowjew, Berdjajew.
227 Vgl. DGA 25, S. 84; DGA 25, S. 101; DGA 26, S. 90.
228 Als dritte Variante dieser Formel des Westens wird hier „ein wissenschaftliches Axiom“, „der
Kampf ums Dasein“, genannt (DGA 26, S. 90).
229 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 487.
230 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 513 f.
396
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
instabilen, immer werdenden Ozean der Menschenwelt. Heraklits These als Alternative des sokratisch-abendländischen Denkens wird in dieser Kritik an der Moral aus
Vernunft, wie bei Nietzsche, aktuell. Dostojewski geht aber weiter als Nietzsche: Nicht
nur die allgemeine Moral, die den Einzelnen als einen bloßen Sonderfall der Allgemeinheit betrachtet, auch die individuelle Moral des Einzelnen ist ein Unding, als solche ist
sie immer noch Unfreiheit gegen die eigenen moralischen Vorstellungen. Denn der
Mensch mit seiner Moral ist nicht von den anderen abgesondert, er ist keineswegs
spontan. Gerade als Einzelner ist er hilflos gegenüber sich selbst und seinen eigenen
Wünschen, er ist als Einzelner gegen seine eigene Moral äußerst unfrei.
Nach Nietzsche kann der Einzelne, wie wir im zweiten Kapitel festgestellt haben,
die höchste Selbstüberwindung vollziehen, indem er sich nicht bloß der Herdenmoral
widersetzt, sondern auch den eigenen Wünschen, den Wünschen des „Herzens“. Das
„amor fati“, die Ablehnung jeder Wünschbarkeit, ist somit die „letzte“ Tugend der
„letzten“, vornehmen Moral. Aus Dostojewskis Sicht ist auch diese „letzte Moral“ bloß
die Konsequenz einer Moral aus Vernunft. Auch sie macht eine Annahme, die nicht
mehr akzeptabel ist. Denn die „Wünsche [des] Herzens“ stehen einem gerade nicht
frei, gerade ihnen kann man keineswegs Widerstand leisten. Dies kann nur noch eine
Täuschung sein, eine Selbstblendung, die nicht zur Selbstüberwindung, sondern zur
Selbstaufhebung, zur Krankheit und zum geistigen Kollaps führt. Aus diesem Teufelskreis kann der Mensch, so Dostojewski, nicht herauskommen, wenn er auf seiner
Vereinzelung besteht, wenn er sich weiter für ein freies Individuum hält. Denn
Wünsche sind nicht individuell. Nicht nur die Moral, auch das Wünschbare kommt
von den anderen her. Nietzsche hat diesen Verdacht selbst ausgesprochen – einen
Verdacht gegen das Herdentier, welches der Mensch ist, der zur Vornehmheit kaum
fähig ist (vgl. FW 1, KSA 3, S. 369 ff.). Dostojewski deutet nun diese Einsicht in das
Menschliche positiv um. Wenn Wünsche und Handlungen wirklich nur etwas Allgemeines zum Ausdruck bringen können, so ist das Individuelle nur dadurch wiederzugewinnen, dass die Verantwortung für die anderen, ja für alle übernommen wird.
Aber diesmal nicht moralisch, nicht bloß als Leitfaden einer „letzten Moral“ (die als
solche sich über die eigenen Gründe wiederum nur täuschen kann), nicht als Glaube,
sondern äußerlich, als Tat, als erlösende Strafe des Leidens, die den Sieg des Guten
ankündigt. So hat der einzige Unschuldige die Strafe der Welt, ihre Schuld und ihr
Leiden auf sich genommen – Christus, der nicht wie der „Fürst Christus“ Myschkin vom Leben überwältigt wurde, sondern wie der „Herr des Lebens“ den Tod besiegte.231
231 Die Idee der unbegrenzten Verantwortung, wie sie bei Dostojewski aufgefasst wird, wurde in einer
Untersuchung von Silvio Pfeuffer in die Perspektive der Moralkritik Nietzsches, aber auch der Philosophie des Anderen von Emmanuel Lévinas gestellt (Silvio Pfeuffer, Die Entgrenzung der Verantwortung. Nietzsche – Dostojewskij – Levinas). Mit dieser Perspektive auf Dostojewski entgeht der Autor u. a.
den üblichen Fehlgriffen der Dostojewski-Interpretation, wonach Myschkin bloß als Dostojewskis
Ideal eines gutherzigen Menschen dargestellt wird. Dass Myschkin gerade wegen seiner Gutherzigkeit
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
397
Zu Dostojewskis Formel des Guten kommen mehrere Formulierungen seiner Protagonisten hinzu. Dmitri Karamasow (er kommt auf sie ganz unabhängig von Staretz
Sossima232) will z. B. für das nicht von ihm begangene Verbrechen bestraft werden.
Und nicht nur für den Vatermord, sondern für jede Schuld, die die Welt überkommt.
In einem Traum sieht er ein weinendes Kind und seine wegen eines Brands verarmte
und verhungernde Mutter. So wird indirekt eine Projektion auf Iwans Revolte gegen
die Welt Gottes aufgeworfen. Die ungerächten Tränen können gesühnt werden, aber
nicht durch die Forderung nach Gerechtigkeit. Denn den Maßstab der Gerechtigkeit
hat der Mensch nicht, sei es, so Dmitri, ein Russe, ein Chinese oder ein Europäer, sie
werden niemals darin übereinstimmen können. Die gerechte Strafe kann die Schuld
nicht sühnen und zerstört nur die Liebe. Nur wenn der Liebende die fremde, ihm
undurchschaubare Schuld und so auch die Schmerzen und die Strafe für sie auf sich
nimmt, kann eine Versöhnung und so das Gute in die Welt kommen.
Eine andere Formulierung stammt von Staretz Tichon aus den Dämonen, vor dem
der „große Sünder“ Stawrogin seine größtmögliche Schuld beichtet – die Verführung
„eins dieser Kleinen“: Er hat ein zehnjähriges Mädchen misshandelt, wodurch es zum
Selbstmord kam.233 So äußert sich Tichon, nachdem er seine Beichte gelesen hat:
Eine einzelne Sünde gibt es nicht. Ich bin selbst ein großer Sünder, und vielleicht mehr als Sie.
(DGA 11, S. 26)
Wenn die Unfreiheit in der Verführung des anderen besteht, dann soll auch die
Befreiung in der Bestrafung für die anderen liegen. Der Gerechte, wie Tichon, muss
sich zur fremden Schuld noch mehr bekennen als der Sünder zu seiner eigenen. Es
klingt übertrieben und künstlich, was Stawrogin gleich mit Ironie bemerkt: Es ist
nichts weiter als eine von den „mönchischen Redensarten“. Dennoch, wenn es
tatsächlich keine bloß individuelle Schuld geben kann und es sich nicht um einen
kurzsichtigen Rache-Instinkt, welcher sofort einen Schuldigen findet, sondern um die
mehrmals scheitert und den Herausforderungen des Lebens nicht gewachsen ist, sieht Pfeuffer sehr
wohl ein (bes. S. 150 f.). Dennoch scheint sein Schluss, Myschkin „scheitert, weil er keinen souveränen
Umgang mit den allgemeinen Normen und Werten entwickelte“ (S. 155), eine wesentliche Verkürzung
zu sein. Da Pfeuffer Myschkin v. a. von dem „Typus Jesus“ Nietzsches her interpretieren will, lässt er
die andere Perspektive praktisch unbeachtet, die für Dostojewski die wichtigste gewesen ist: die von
Christus, und zwar dem der Evangelien, dem, der die Welt überwunden und den Tod besiegt hat. Aus
dieser Perspektive kann ein souveräner Umgang mit der allgemeinen Moral nur am eigenen Anspruch
scheitern.
232 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 416. Vgl. auch Dostojewski, Die Dämonen, S. 945.
233 Dostojewski, Die Dämonen, S. 629. Der Roman Die Dämonen ist aus einem Plan entstanden,
dessen ursprünglicher Titel Das Leben eines großen Sünders war. Das Kapitel Bei Tichon ist in der
endgültigen Redaktion aus dem Roman entfallen. Die Gründe dafür waren nicht nur, wie man
mutmaßt, mögliche Schwierigkeiten mit der Zensur. S. dazu die Verfass., Образ Ставрогина в
системе персонажей романа Ф.М. Достоевского Бесы (Stawrogin unter den Figuren im Roman von
F.M. Dostojewski „Die Dämonen“).
398
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
„Liebe mit sehenden Augen“, um die willige Übernahme der Schuld der Welt handelt,
so ist es nur konsequent, dass der Unschuldigste die größte Strafe tragen muss. Ein
weiterer Gedanke Zarathustras wird somit umgekehrt: Die „Guten und Gerechten“
sind diejenigen, die nicht, wie es Zarathustra sagte, „den Einsamen“ „hassen“ (Z I,
Die Reden Zarathustra’s, KSA 4, S. 82), sondern diejenigen, die sich für ihn schuldig
fühlen, die sich für ihn strafen lassen. Und so lautet schließlich Dostojewskis These:
Wer die Menschen am meisten liebt, spricht sie nicht von jeder Schuld frei, sondern
trägt sie auf seinen Schultern.
Diese These verweist nicht einfach auf eine mystische Vision des Autors, auf den
Sieg Gottes, wie er am Ende der Evangelien dargestellt wurde. Sie tut dies vielleicht
in seinem Tagebuch. Aber nicht in den Romanen. Hier wird sie „realistisch“: Indem
ein Mensch sich zu dieser Wahrheit der allgemeinen Schuld bekennt, stellt sich
heraus, dass es sich tatsächlich so mit seiner eigenen Schuld und der Gerechtigkeit
seiner Strafe verhält.234 Um plausibel zu sein, sollte auch sie in ein „Kunstbild“
verwandelt werden. Darum ging es Dostojewski vorwiegend in seinem letzten Roman – um zu zeigen, dass „dies […] wahrhaftig so“ ist, „dass dies eben die Wahrheit
ist“.235 Dmitri Karamasow ahnt nicht einmal, wie sehr er, indem er sich für die Tränen
der Kinder verantwortlich macht, tatsächlich Recht hat. Die scheinbar unbedeutende
Episode mit dem kleinen Iljuschechka und seinem Vater, den Dmitri, nicht ohne
Gründe (auch er war schuld an einer Missetat), verletzt und gedemütigt hat, sollte
dieses Thema latent zum Ausdruck bringen. Es ist wahrscheinlich, dass Iljuschechka
durch Dmitris Schuld stirbt, und so ist Dmitri tatsächlich indirekt am Tod eines
kleinen Kindes schuldig. Aber die „Genealogie“ des Bösen kann weiter verfolgt
werden. Auch Iljuschechka selbst ist an einer Grausamkeit gegen einen Hund schuld.
Er ist auch schuldig gegenüber Aljoscha, den er ohne Gründe angriff. Dostojewski
vermeidet volle Klarheit, er zeigt dennoch, wie sich das Böse vermehrt, wie vielfältig
seine Ursachen und seine Folgen sind: Der Tod von Iljuschechka ist nicht nur durch
Dmitri, sondern auch durch die Grausamkeit anderer Kinder verursacht worden, die
wiederum vielfältige Gründe in den Handlungen anderer Menschen haben. Sie müssen nicht aufgeklärt werden. Denn durch das Wort der Versöhnung werden sie
nichtig gemacht. Mit dem Tod und Begräbnis von Iljuschechka wird der Roman
abgeschlossen. Das Versprechen, sich daran ewig zu erinnern, wird von allen zusammen am Grab ausgesprochen. Dies ist die Tat von Alexej Karamasow, des neuen
vollkommenen, „schönen Menschen“, der die neue Wahrheit der unbegrenzten Verantwortung anerkennt und die Strafe für die Schuld der Welt nach dem Wort von
Staretz Sossima auf sich nehmen will. Er, mit seiner bloßen Anwesenheit, ohne
234 Ein realistische Herabsetzung dieses Gedankens erfolgt z. B. in den Brüdern Karamasow, in der
Situation mit dem Leichnam des Staretz Sossima, in der, wie es im Roman gesagt wird, „der Gerechte“
„dem boshaften Spott und Hohn der Menge“ ausgeliefert wird (Dostojewski, Die Brüder Karamasow,
Bd. 2, S. 28).
235 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 514.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
399
Argumente und moralische Forderungen, verwandelt die Feindschaft und bitterliche
Not in Treue und Liebe.
Es ist kaum zu bestreiten, dass Alexej Karamasow der neue Held, der positive
Mensch Dostojewskis ist.236 Er ist dies aber nicht bloß als Unschuldiger, nicht wie
Myschkin. Tatsächlich scheint er, während jeder der anderen drei Brüder an dem
Mord des Vaters beteiligt war, völlige Unschuld zu bewahren. Er hatte keine bösen
Gedanken und ließ böse Wünsche nicht zu. So sollte er völlig unschuldig und rein von
allem Bösen sein. Und dennoch ist es nicht das, was Dostojewski in seinem Roman
zeigen will. Auch er ist ein Karamasow, wie mehrmals wiederholt wird, auch er ist von
den Versuchungen betroffen, auch er erhebt sich zur Revolte gegen Gottes Welt. In
dem Moment, als sein geliebter Staretz nach seinem Tod dem Schimpf preisgegeben
wird, sehnt auch er sich nach höchster Gerechtigkeit und rebelliert so gegen Gott. Erst
wenn Alexej diese letzte Versuchung überwindet, Gerechtigkeit für den geliebten
Staretz von Gott zu fordern, erst wenn er sich nicht als Richter, sondern als „Letzter unter den Angeklagten“ versteht,237 wird er von einem „schwache[n] Jüngling“ zu
einem „fürs ganze Leben gefestigte[n] Kämpfer“. Erst dann kommt er durch eine
Vision des göttlichen Mahls zur neuen Einsicht:
Es drängte ihn, zu vergeben, allen und für alles, und um Vergebung zu bitten, oh, nicht für sich,
sondern für alle, für alles und jedes, und ‚für mich werden andere bitten‘, tönte es wieder in
seiner Seele.238
So begreift er, dass er nur deshalb vergeben kann, weil er selbst Vergebung braucht.
Und als er das versteht, wird ihm wiederum auch klar, dass er tatsächlich mitschuldig ist. Auch Alexej hat, wenn auch auf latente Weise, die Rolle Kains gespielt.
Wegen seiner Trauer über den Tod Staretz Sossimas, wegen seiner Empörung über die
Ungerechtigkeit Gottes hat er das Wichtigste außer Acht gelassen:
[…] plötzlich schoß ihm der Gedanke an seinen Bruder Dmitri durch den Kopf, aber sein Bild
zuckte nur auf, und obgleich Aljoscha sich dadurch an etwas gemahnt fühlte, an etwas Dringendes, das er keine einzige Minute mehr aufschieben dürfte, an eine Schuldigkeit [meine Hervorhebung – E.P.], eine schreckliche Pflicht, drang diese Erinnerung nicht tiefer in ihn, sie erreichte
nicht sein Herz, löste nichts aus, verflüchtigte sich und wurde vergessen.
Diese Schuld ist bei ihm auch später im Hintergrund präsent:
Doch lange danach kam Aljoscha dies wieder in den Sinn.239
236 Die Kontinuität zwischen Myschkin und Alexej Karamasow sowie den Kontrast zwischen beiden
Figuren betont auch z. B. Maurina (Maurina, Dostojewskij, S. 206 f.)
237 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 52.
238 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 64.
239 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 31.
400
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Er ist in der schwierigsten Stunde nicht bei seinen Brüdern gewesen, um den Mord zu
verhindern. Er hat somit das Gebot seines geliebten Staretz nicht erfüllt, bei den
Brüdern zu sein, ihr Hüter zu sein. Ganz unbeteiligt an der Schuld der anderen ist er
somit nicht. Denn wenn es kein Tun ist, so ist es das Unterlassen, woran er wahrhaftig
schuldig ist. Sein Versuch, den Brüdern die Schuld abzusprechen, scheitert dementsprechend, genauso wie die Versuche Myschkins. In dem Moment seines allumfassenden Schuldbekenntnisses offenbart sich ihm die Wahrheit seines verstorbenen Staretz
auf neue und tiefere Weise: Alle brauchen Vergebung und er selbst braucht sie am
meisten. Als wahrer Held des Romans wird Alexej erst dann zum Kämpfer für das
Gute, als er den einzigen Weg der Erlösung für die Welt findet – um die Vergebung für
die Schuld der anderen zu bitten und ihre Sünde als die eigene zu sühnen.240
Dostojewski hat dieses Schuldbekenntnis für die Sünde der Welt, die allein den
Weg der Versöhnung und der Liebe öffnet, die „Lebenswahrheit“ genannt. Im Tagebuch eines Schriftstellers erscheint sie im Zusammenhang mit der zentralen Szene in
Anna Karenina, in der der betrogene Ehemann und der Liebhaber sich vor dem Todesbett der geliebten Frau treffen. Dostojewski hat diese Szene so verstanden:
Alle verziehen einander und gaben dem anderen recht. […] Es gab keine Schuldigen: jeder beschuldigte bedingungslos sich selbst, und somit waren sie alle gerechtfertigt.241
Die „Lebenswahrheit“ bestand gerade darin: Wenn jeder seine Schuld bzw. das Unrecht der eigenen Wahrheit anerkennt, erst dann kann man nicht mehr von Schuld
sprechen.242 Das ist aber gerade das Gegenteil davon, was Myschkin, der „Fürst
Christus“, getan hat. Nicht das Absprechen der Schuld, sondern ihre volle Anerkennung überwindet das Reich des Bösen:
Auf daß aber der Mensch nicht umkomme vor Verzweiflung und womöglich in der Überzeugung
untergehe, daß das Böse von geheimnisvoller und verhängnisvoller Unvermeidlichkeit sei, ist
dem Menschen eben ein Ausweg gezeigt.243
Dieser Ausweg war aber nur einmal in voller Kraft den Menschen gezeigt worden,
durch eine einzelne Gestalt – durch Christus.
Halten wir fest: Mit seiner Formel des Guten stellt Dostojewski nicht nur die
Plausibilität der Moral aus Vernunft, sondern auch die einer „letzten“ Moral Nietzsches in Frage – die Vereinzelung des Menschen, die Souveränität seiner Wünsche,
240 Das weitere Sujet ist wegen Dostojewskis Tod unklar geblieben. Bekannt ist nur, dass Alexej alle
Versuchungen des Bösen durchstehen sollte. In den Brüdern Karamasow wird nur der Moment gezeigt,
als Alexej zum „gefestigten Kämpfer“ wird.
241 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 317.
242 Die Figur, die uns hier begegnet, ist in Hegels Phänomenologie des Geistes vertreten. Gemeint ist
der durch das Eingeständnis des Bösen bzw. das Wort der Versöhnung („Ich bin’s“) „erscheinende Gott
mitten unter“ uns (Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 490, 494).
243 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 399.
4.2 Ohnmacht des Guten aus Vernunft
401
seiner Gedanken und besonders seiner Unterscheidung von Gut und Böse, seiner
Moral. Sie ist nicht plausibel, weil – und dies kann als Dostojewskis eigene negative
Plausibilität verstanden werden – die für diese Unterscheidung getragene Verantwortung die Grenzen der Individuen weit überschreitet. Diese negative Plausibilität führt
den russischen Schriftsteller zu einer neuen Deutung der Liebe: Sie ist die freie Übernahme der Verantwortung eines anderen Menschen. Sie kennt nur das Gesetz, bei dem
sie für einen Verstoß selbst büßt. Diese Liebe ist deswegen befreiend, weil das Gegenteil, das Bestehen auf den Grenzen menschlicher Verantwortung, nur noch äußerste
Unfreiheit bedeuten kann. Dennoch ist sie keineswegs spontan und selbstgesetzgebend, denn sie folgt einer menschlichen Gestalt, die ihr allein den Maßstab geben
kann – der Gestalt einer vollkommenen Menschheit.
Durch die Anerkennung der eigenen rechtlichen Verantwortung für die moralische Schuld der anderen wird eine neue Freiheit erreicht – die Freiheit gegen die
eigene Unterscheidung von Gut und Böse, die Freiheit gegen die eigene Moral. Sie wurde
die Freiheit in der Erkenntnis von Gut und Böse genannt. Und es dürfte klar werden,
dass diese Erkenntnis mit keinem Urteil zum Ausdruck gebracht werden kann. Und sie
strebt auch nicht die Wahrheit eines Urteils an. Sie ist keine Erkenntnis im Sinne eines
Begründens. Sie mündet nicht in eine allgemeine Regel, in eine begründete Norm.
Eben diesen Anspruch auf die Erkenntnis von Gut und Böse hält Dostojewski für die
Blindheit Europas:
[…] das Gesetz ist gegeben, niedergeschrieben, formuliert, ist in Jahrtausenden ausgearbeitet. Gut
und Böse sind festgestellt, gewogen, die Maße und Grade sind historisch von den Weisen der
Menschheit in unermüdlicher Arbeit an der Menschenseele und in höherer wissenschaftlicher
Untersuchung der Gesetze des menschlichen Zusammenlebens festgestellt. Diesem ausgearbeiteten Kodex ist ein jeder blinden Gehorsamkeit schuldig. Wer das nicht tut und jene Gesetze
übertritt, der bezahlt buchstäblich und unmenschlich.244
Aber da die „endgültige Formel der Menschheit“ nicht gefunden wurde, ist dieses
Gesetz „sowohl blind wie unmenschlich und unmöglich“.245 Dostojewskis eigene
Formel, die er als christliche versteht, fordert keine Subsumtion des Einzelnen unter
das Allgemeine. Sie bietet keine Erkenntnis im Sinne Kants, aber auch keine im Sinne
Nietzsches: weder das allgemein gültige Urteil für jedermann noch den stetigen Verdacht gegen die eigene Wünschbarkeit. Als negative Erkenntnis ist sie die Verneinung
aller Grenzen, die die Menschen voneinander trennen, und auch aller Prinzipien, die
diese Trennung legitimieren. Sie hat nur noch einen Leitfaden – die Gestalt eines
Unschuldigen, der die Liebe verkündet und gleichzeitig die Schuld der Welt gegen
diese Liebe auf sich nimmt und sich dafür bestrafen lässt. Wenn sie Erkenntnis des
Guten und des Bösen ist, so ist sie es nicht im Sinne des zu erwerbenden und zu
244 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 396 f.
245 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 396 f.
402
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
behaltenden Wissens, sondern nur allein im Sinne des Kennenlernens, im Sinne einer
immer tieferen Bekanntschaft mit einer sie vollkommen vertretenden Persönlichkeit.
4.3. Die Schönheit als Erlösung der Welt
Das Ideal der Schönheit als „sichtbarer Ausdruck sittlicher Ideen, die den Menschen
innerlich beherrschen“, in einem konkreten musterhaften Bild sinnlich darzustellen,
war nach Kant das Privileg des Künstlers – eines Genies, das selbst ein „Glücksfall“
der Natur ist. Durch ihn wird Natur zu Kunst, die Welt der Erscheinungen zum Ausdruck des Übersinnlichen. Das Unvollkommene und Unvollständige wird in ein vollkommenes Muster verwandelt, wofür es jedoch keinen Maßstab, kein vorhergehendes
Kriterium geben kann, weil die Regel dieser Verwandlung erst durch das Kunstwerk
des Genies geschaffen wird. Das Kunstwerk beansprucht damit zwar nicht, die objektive Realität des Guten, und sei es durch einen „Wink“, nachzuweisen oder über
moralische Werte zu belehren, aber das Werk des Genies verführt zu einem von ihm
erzeugten Ideal der Schönheit als einem Musterbild der Vollkommenheit. Und die
Vollkommenheit kommt in der Kunst als Bild der menschlichen Schönheit, als musterhafte symbolische Verbindung des Schönen und des Guten im Menschen, als Bild
eines schönen Menschen vor. So ergänzt die Kunst nach Kant das, was in der Moral
notwendig unvollendet und ohne Vollendung „phantastisch“ bleiben muss: Das
Kunstwerk allein kann „die Welt als schönes moralisches Ganze[s] in ihrer ganzen
Vollkommenheit“ darstellen.
Dostojewski scheint in diesem Punkt mit Kants Kunstphilosophie übereinzustimmen. Auch für ihn ist es die Aufgabe der Kunst gewesen, die Welt als schönes,
moralisches Ganzes darzustellen – mit Hilfe einer menschlichen Gestalt, die die Idee
der Vollkommenheit verkörpert. Im Unterschied zum späten Tolstoi stimmte Dostojewski dabei der europäischen Kunstphilosophie zu: Die Bestimmung der Kunst
bestehe darin, das Ideal der Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Er polemisierte
leidenschaftlich gegen die Anhänger der demokratisch-sozialistischen Bewegung, die
von der Kunst bloß das Nützliche verlangten.246 Das Kriterium des pragmatischen
Nutzens deutete Dostojewski entschieden um: „Die Schönheit ist nützlich, weil sie die
Schönheit ist.“247 Die Kunst, die die Schönheit für die Menschen veranschaulicht, sei
nützlicher als alle Ideen der Gerechtigkeit – gerade für die Menschen, die diese Ideen
246 Dostojewski mischt sich dabei in den alten Streit über die Bestimmung der Kunst ein, der
zwischen den Anhängern der bürgerlichen Rechte, die von der Kunst propagiert werden sollen, und
den Anhängern der Theorie l’art pour l’art schon längst im Gang war. Vgl. das berühmte Gedicht:
Nikolai Alexejewitsch Nekrassow, Dichter und Bürger, und die ebenso berühmte wie auch brisante
Formel Pisarews „Puschkin oder Stiefel“ (Дмитрий И. Писарев (Dmitri I. Pisarew), Пушкин и
Белинский (Puschkin und Belinski)). Dostojewski schätzte beide Richtungen als einseitig ein.
247 Достоевский, Ряд статей о русской литературе, S. 93.
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
403
vertreten. Denn ohne Wissenschaft, ohne bürgerliche Ideale könne die Menschheit
noch auskommen, „nur ohne Schönheit könnte sie nicht leben“.
Selbst die Wissenschaft könnte ohne Schönheit nicht einen Augenblick bestehen […].248
Dies behauptet Stepan Werchowenski, der durch seine Ästhetik zu einer komischen
Figur wird.249 Außerdem wird er sich in seinem letzten Glaubensbekenntnis als Lügner bezeichnen.250 Aber gerade dieser Lügner und Ästhet, diese durchaus komische
Figur wird unmittelbar vor seinem Tod zur letzten und höchsten Offenbarung des
Romans fähig: zur Vision der Erlösung des kranken Russlands von den quälenden
Dämonen, zu denen er sich am Ende selbst zählt. So ist die Schönheit ambivalent mit
der Komik und mit der Lüge, aber auch oder gerade deshalb mit dem letzten Ernst von
Dostojewskis Philosophie verbunden.
In seinem literarischen Werk versucht Dostojewski immer wieder, eine musterhafte bzw. maßgebende Verbindung zwischen Schönheit und Gutem herzustellen. In Der
Idiot war dies sein eigentliches Ziel, seine „Grundidee“: ein Bild eines „positivschönen“ Menschen zu schaffen, das das ‚Kennenlernen‘ des Ideals im oben angedeuteten Sinne ermöglichen sollte. Diese Aufgabe sei „unendlich schwer“:
Alle Dichter, nicht nur die unsrigen, sondern auch die europäischen, die die Darstellung des
Positiv-Schönen versucht haben, waren der Aufgabe nicht gewachsen […].
Das Schöne ist das Ideal, das Ideal steht aber bei uns wie im zivilisierten Europa noch lange
nicht fest.251
Als mehr oder weniger gelungene Versuche erwähnt Dostojewski nur noch Don
Quijote, Pickwick und Jean Valjean, die jedoch nur deshalb sympathisch seien, weil
sie Lachen oder Mitleid erregen. Auch sein Idiot zeigte nur noch die Ohnmacht des
„schönen Menschen“, der allgemein ausgelacht wird und der das Leiden nicht mindern, sondern nur noch vermehren kann.
„Ein schöner Mensch“ klingt auf Russisch doppeldeutig: „Прекрасный“ ist
gleichzeitig Superlativ von „schön“ (красивый) und von „gut“ (хороший). In Myschkin trafen sich so die Schönheit und das Gute und brachten die Menschenwelt zum
Einsturz. Aber gerade in diesem Roman findet sich Dostojewskis berühmte These, die
Schönheit allein könne die Welt erlösen.252 Diese These vertrat Dostojewski auch
248 Dostojewski, Die Dämonen, S. 719.
249 Diese Komik ist ihm selbst bewusst. Vgl. z. B. seinen Brief an Darja Pawlowna: Dostojewski, Die
Dämonen, S. 728.
250 Dostojewski, Die Dämonen, S. 956 f.
251 Dostojewski, Gesammelte Briefe, S. 251. Das ist der oben schon zitierte Brief an Sofia A. Iwanowa
vom 13. Januar 1868, in dem es um das Konzept des Idioten geht.
252 Dostojewskij, Der Idiot, S. 554. Die These wird freilich nicht von Myschkin, sondern als seine
Behauptung von Ippolit wiedergegeben, die der Letztere dadurch erklärt, dass Myschkin verliebt ist.
404
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
später, z. B. im Roman Die Dämonen.253 Sie wurde bei ihm immer wieder polemisch
gegen die von den positivistischen Wissenschaften geprägte Weltanschauung, aber
auch gegen die Moral aus Vernunft gerichtet. Die Aufgabe, einen „schönen Menschen“, einen positiven Helden zu schaffen, der das siegreiche Gute verkörpert und
der Welt zur vollendenden Erlösung verhilft, stand dem russischen Schriftsteller
allerdings immer noch bevor. Sie wurde in Der Idiot nicht erfüllt. In seinem letzten
Roman Die Brüder Karamasow versuchte er erneut, das Ideal der menschlichen Vollkommenheit in einem „Kunstbild“ darzustellen.
Das Problem der Schönheit und somit auch der Bestimmung von Kunst tritt so
immer weiter in den Vordergrund von Dostojewskis Denken. In diesem letzten Abschnitt des Kapitels soll Dostojewskis These zur Erlösung der Welt durch die Schönheit im Zusammenhang mit seiner Moralphilosophie erläutert werden. Hier müssen
wir Dostojewskis Methode als Künstler näher betrachten, um zu sehen, wie die
Schönheit in seinen Romanen dargestellt und interpretiert wird und wie sie sich zu
seinem moralischen Ideal verhält. Der Roman Der Idiot, dessen Aufgabe die Darstellung eines „schönen Menschen“ mit seiner These über die welterlösende Schönheit
gewesen ist, kann hier mit Recht eine zentrale Stelle beanspruchen. Dennoch, wie aus
den vorhergehenden Ausführungen klar sein dürfte, war dieser Roman nicht das
„letzte“ Wort Dostojewskis.
Die fantastische Wirklichkeit
Der Idiot kann nicht bloß als ein Scheitern in der Darstellung des Ideals verstanden
werden. Ein Jahr nachdem der Roman vollendet war, schrieb Dostojewski:
Ist denn mein phantastischer ‚Idiot‘ nicht die alltäglichste Wirklichkeit? Gerade heutzutage muß
es in unseren Gesellschaftsschichten, die von der Scholle losgelöst sind, in den Schichten, die
in der Tat phantastisch [meine Hervorhebung – E.P.] zu werden anfangen, solche Charaktere
geben. […] In meinem Roman ist vieles in Eile geschrieben, vieles in die Länge gezogen und mißlungen, aber es ist auch vieles gut geraten. Ich stehe nicht hinter dem Roman, sondern hinter der
Idee.254
Diese Idee, es sei noch einmal betont, ist die eines Künstlers und deswegen notwendig
eine ästhetische Idee und nicht der Gedanke, der im Roman geäußert und von den
Romanfiguren vertreten wird. Sie äußert sich durch die Darstellung einer fantasti-
253 Dostojewski, Die Dämonen, S. 719.
254 Brief an Nikolai N. Strachow vom 10. März 1869, in: Dostojewski, Gesammelte Briefe, S. 302 f. Der
Ausdruck „von der Scholle losgelöst“ bezieht sich auf das sog. „Bodentum“ „почвенничество“, eine
intellektuelle Bewegung, die nicht ganz die Positionen der Slawophilen teilte und sich dennoch der
westlich-orientierten Bewegung der „Westler“ („западничество“) entgegensetzte. Dostojewski war
einer der wichtigsten Ideologen des „Bodentums“.
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
405
schen Welt, die gerade als fantastische wirklich ist, sogar wirklicher als jede andere
Wirklichkeit. So steht in einem Entwurf zum Nachwort des Romans:
Ich habe einen fantastischen Roman geschrieben, aber niemals gab es wirklichere Charaktere
[…]. (DGA 9, S. 199)
Das Fantastische im Roman beansprucht, Realität und darüber hinaus alltägliche
Realität zu sein. Doch auch die Wirklichkeit selbst, wie es im Tagebuch eines Schriftstellers oftmals wiederholt wurde, ist aus der Sicht des Künstlers fantastisch. Durch
ihre Fantastereien fühlt er sich stets übertroffen:
Was kann fantastischer und unerwarteter als die Wirklichkeit sein? Was kann unwahrscheinlicher als die Wirklichkeit sein? Niemals könnte ein Romancier sich solche Unmöglichkeiten
vorstellen, welche die Wirklichkeit uns jeden Tag zu Tausenden vor Augen führt, als ganz
alltägliches Zeug. Man würde nie solche Fantasien erfinden können. Und was für ein Vorteil
gegenüber einem Roman! (DGA 22, S. 91)
Die Idee der fantastischen Wirklichkeit ist kein abstrakter Gedanke oder gar nachträgliche Selbstrechtfertigung eines Schriftstellers, der immer viel zu künstliche Charaktere darstellt und merkwürdige Schicksalsfügungen schildert. Sie betrifft den Kern
von Dostojewskis Methode, seine Einzigartigkeit als Schriftsteller, dessen Kunst den
Roman als Genre der schöngeistigen Literatur veränderte. Die Frage wurde von der
Literaturwissenschaft gründlich untersucht. Deswegen folgen hier nur noch einige
Stichpunkte.
Der Roman entwickelte sich als Genre der schöngeistigen Literatur relativ spät,
erst in der Neuzeit. Und von Anfang an ist er, wie Michail Bachtin in seinen aufschlussreichen Untersuchungen gezeigt hat, zum nichtkanonischen, zum antikanonischen Genre avanciert: Er hatte keine festen Regeln und war schon immer an
Innovationen orientiert.255 Auch thematisch spielt das wesentlich Neue im Roman
eine wichtige Rolle: Die Spannung, die Neugier, die Lust am Unerhörten ist in den
Erwartungshorizont eines Romans immer eingeschrieben. Dadurch wurde der Roman
von Anfang an zu einem Sonderling in dem kanonisch streng organisierten System
der schöngeistigen Literatur. Das Antikanonische des Romans beschreibt Bachtin vor
allem als Spiel mit allen vorhandenen Formen, mit allen Merkmalen anderer Genres,
die er in sich „aufsaugt“ und mehr oder weniger erschließt, seien es die Merkmale
von Elegien, Novellen, Tragödien oder Komödien, welche als erkennbare „Sprachen“
durcheinandergebracht und gegeneinander ausgespielt werden. So werden die kanonischen Grenzen aller Genres beobachtbar, was sie mit der Zeit wiederum beein-
255 S. z. B. Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Роман воспитания и его значение в истории
реализма (Erziehungsroman und seine Bedeutung in der Geschichte des Realismus). Vgl. auch Михаил
М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса (Das Schaffen von François Rabelais und die Volkskultur des Mittelalters und der Renaissance).
406
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
flussen sollte; die Grenzen zwischen ihnen werden flüssig und instabil. Die Epoche,
in welcher der Roman zum Hauptgenre der schöngeistigen Literatur wird, ist eine
nichtkanonische, antikanonische Epoche. Sie relativiert alle Regeln der Kunst, die
frühere Epochen für fest und unerlässlich hielten. Unter mehreren Kunstformen hat
der Roman allerdings dem Theater besonders viel zu verdanken, weil gerade dem
improvisierenden Volkstheater im Prozess der Entkanonisierung der Literatur eine
besondere Rolle zukommt. Gerade hier, auf der Theaterbühne des mittelalterlichen
Marktplatzes, sieht Bachtin den Ursprung des Romans. Das Argument ist uns nicht
unbekannt: Im Theater wird die Grenze zwischen Illusion und Wirklichkeit sichtbar.
Aber nur das Volkstheater des Marktplatzes, so Bachtin, wagte es, mit dieser Grenze
zu spielen. Sie sei immer wieder in die eine oder in die andere Richtung hin übertreten worden. In der Aufführung eines Pulchinello konnte man die Zuschauer ansprechen, man konnte sie verspotten und so in die Welt des Theaters einbeziehen.
Die Stimme des Erzählers, der von seinen Figuren spricht, wurde dabei zu einer Art
Vermittlungsinstanz zwischen zwei Welten – der der Bühne und der des Zuschauerraums. Dieser Instanz war viel gestattet, ihr war sogar erlaubt, die sakrale Welt zu
verspotten. So entstand auf der Bühne gleichsam eine besondere Welt, für die
Bachtin einen neuen Begriff fand – „das theatralische Chronotopos“, d. h. eine räumlich und zeitlich abgesonderte Darstellungsform, die eine Zwischeninstanz voraussetzte, nämlich eine quasi göttliche Stimme hinter dem Geschehen, die das Geschehen erläutern und sogar vorhersehen kann, die es also aus der Distanz betrachtet.
Dieser Darstellungsform bediente sich später der Roman, indem er das „Chronotopos“ eines Erzählers entwickelte, dem damit eine Art Sonderexistenz, das AndersSein in Distanz zum Geschehen zugesprochen wurde.256 Der Roman erreichte dabei
eine bisher ungekannte Flexibilität in der Perspektivierung der Welt. Denn das
Erzähler-Chronotopos ließ mehrere Möglichkeit eines Anders-Seins, eines Daseins
auf der Grenze der dargestellten Wirklichkeit zu: von der Position Gottes, der die
Übersicht über die Welt hat und die ‚richtige‘ Position behält, bis zu einer irrenden
und irreführenden Stimme einer in die Handlung verwickelten Person. Dazwischen
lagen mehrere Mischpositionen.257 Dank der vielfachen Optionen der Darstellung der
Standpunkte und Weltperspektiven verdoppelte, verdreifachte, ja vervielfachte der
Roman, so Bachtin, die Grenze zwischen dem Darstellenden und dem Dargestellten,
zwischen der Theaterbühne und den Zuschauern, zwischen der Kunst und dem
Leben. Und zugleich reflektierte er über diese Verdoppelung: Jede gezeigte Grenze
konnte nun selbst zum Gegenstand der Reflexion, jedes direkt an den Zuschauer bzw.
256 Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Формы времени и хронотопа в романе (Die Formen
der Zeit und Chronotopos im Roman), S. 311 ff. S. dazu Натан Д. Тамарченко (Natan D. Tamartschenko), “Театральный хронотоп” в романе (М.М. Бахтин и П.А. Флоренский) („Das theatralische
Chronotopos“ im Roman (M.M. Bachtin und P.A. Florenski)).
257 Das breite Spektrum von möglichen Erzählformen hat ein anderer bedeutender Theoretiker des
Romans, Franz Stanzel, ausführlich untersucht (Franz Stanzel, Typische Formen des Romans).
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
407
Leser gerichtete Wort selbst zu einer Stimme unter vielen werden. Der Autor bekam
so die früher nicht vorhandene Möglichkeit, die Welt nicht als Einheit, sondern als
ein in Stimmen und Lebensperspektiven pluralistisch-gespaltenes Ganzes zu zeigen,
das sich gerade nicht von einem Standpunkt aus erfassen lässt. An diesem Punkt
seiner Entwicklung angelangt, wird der Roman zu einem Genre der Literatur, das
keine Position, keine Stimme als privilegiert betrachtet, das jeden Anspruch, die Welt
‚richtig‘ zu beschreiben, relativieren kann. Er wird zum polyphonen Roman bei Dostojewski. Und das heißt auch: Bei Dostojewski erreicht der Roman als Genre die
Spitze seiner Entwicklung.
Tatsächlich wurde vielmals bemerkt, dass das Theater, das Theatralische als
Thema bei Dostojewski eine besondere Rolle spielt.258 Das Theatralische wird in seinen
Romanen so auffallend, dass es sogar zu den Nachteilen in Dostojewskis Kunst
gerechnet werden kann.259 Nicht nur die handelnden Personen reden von sich als
Schauspielern und verwenden dabei Wörter wie „Szene“, „Theater“, „Tragödie“ und
„Komödie“, sondern die Handlung selbst wird nach dramatischen Regeln aufgebaut:
In Dostojewskis Romanen gibt es immer zumindest eine Szene, in der alle handelnden
Personen versammelt werden, was zu einer dramatischen Kulmination bzw. zur Auflösung des Konflikts führt. Spezifisch dramatische Kunstgriffe, wie z. B. das zufällige
Zusammentreffen aller Beteiligten, werden bei Dostojewski so oft verwendet, dass der
Vorwurf, eine künstlich-konstruierte Welt darzustellen, nicht ganz unberechtigt erscheint. Darüber hinaus gibt es bei ihm einen besonderen Typus der handelnden
Personen, die sog. „freiwilligen Narren“. Sie erinnern an den Hanswurst und den
Possenreißer im Volkstheater. Und diese Assoziation wird durch ihre Reflexionen der
eigenen Rollen bekräftigt.
Die theatralischen Elemente der Darstellung sind in Dostojewski Romanen sehr
auffallend. Was jedoch noch auffallender ist, ist die Tatsache, dass die handelnden
Personen die Konstruktion selbst durchschauen können, d. h., dass sie sich der Unwahrscheinlichkeit ihrer Geschichte, des merkwürdigen Zusammentreffens bewusst
sind. Das, was vor ihnen abläuft, erscheint ihnen selbst unglaubwürdig, fast irreal.
Sie bezeichnen es als „Phantasmagorie“. Die wichtigsten Lebensereignisse werden
also nicht bloß dramatisch entwickelt, sondern ihre Teilnehmer haben stets den
Verdacht, dass es sich um eine Inszenierung handelt. Und manchmal stimmt es
tatsächlich: Das fantastische Zusammenfallen wird durch ein Komplott vorbereitet,
besonders oft durch einen der sog. „freiwilligen Narren“. Dies ist ein Merkmal der
Komödie: Die Intrige eines Hanswurstes ist eine der wichtigsten Triebfedern der Fabel.
258 Dazu s. einen Sammelband, in dem das Thema in mehreren Hinsichten von renommierten
Dostojewski-Forschern betrachtet wurde: А.А. Нинов (A.A. Ninow), Достоевский и театр. Сборник
статей (Dostojewski und das Theater. Ein Sammelband).
259 Z. B. von Nabokow, einem der wichtigsten Kritiker Dostojewskis als Schriftsteller (Владимир
Набоков (Wladimir Nabokow), Лекции по русской литературе (Vorlesungen über die russische
Literatur), S. 212).
408
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Bei Dostojewski werden diese Intrigen aber darüber hinaus noch als solche dargestellt. Vgl. z. B.:
‚Zweifellos! […] Das war ja alles ein abgekartetes Spiel, und dazu mit weißem Faden zusammengenäht, und obendrein noch schlecht gespielt.‘ […] ‚Aber wissen Sie auch, daß es absichtlich mit
weißem Faden zusammengenäht war, damit es die merkten… die es merken sollen?‘260
Die Welt erscheint als inszenierte Wirklichkeit und die Inszenierung ist hochgradig
auffällig. Das Komplott will sich nicht verstecken. Ganz im Gegenteil: Es will bemerkt
werden.
In Der Idiot hat Dostojewskis Theatralisierung des Romans den Höhepunkt erreicht. Die Handlung steigert sich als Serie von Szenen mit mehreren Kulminationen
und deren Auflösungen. Unter den handelnden Personen gibt es zwei freiwillige
Narren, deren Intrigen zu Triebfedern der spannendsten Szenen werden. Und mehr
denn je wird hier die Welt als fantastisch erlebt, und das Unglaubwürdige, das
Unmögliche wird wahr.
Der allerphantastischste Traum war plötzlich in grelle und scharf umrissene Wirklichkeit umgeschlagen.261
Es gibt aber im Roman einen Protagonisten, der von dem Theatralischen nicht
betroffen ist, der die Inszenierung zwar „einsieht“, denn er ist ein kluger Mensch,
dennoch alles zu „ernst nimmt“ und die anderen immer direkt, offen und unkünstlich
ansprechen will, der „einfach“ ist. Das ist der Fürst Myschkin. So spricht er über sich
selbst:
Ich fürchte immer, durch mein lächerliches Auftreten meine Gedanken und die Hauptidee zu
kompromittieren. Ich habe die Geste nicht. Ich habe stets die verkehrte Geste, und das ist zum
Lachen und erniedrigt die Idee. Mir fehlt auch das Gefühl für Maß […].262
Er ist derjenige, der nach den Regeln einer theatralischen Welt immer unpassend
handelt. Er sieht, dass die Wirklichkeit inszeniert wird. Er sieht, dass man ihn betrügt. Nichtsdestoweniger will er den Menschen vertrauen. („Wissen – und vertrauen! […] Freilich, bei dir muß das so sein.“263) Er wäre damit ein idealer Zuschauer
und er will tatsächlich nur Zuschauer dieses Theaterstücks bleiben. Aber er ist keiner.
Denn plötzlich findet er sich in diese fantastisch konstruierte Welt hineingezogen. Er
darf nicht bloß beobachten, er muss handeln. Er darf nicht bloß Zuschauer bleiben,
auch er ist jetzt Schauspieler. Die Position des Schauspielers ist gegenüber der Grenze
des Theatralischen aber eine andere als die des Zuschauers. Auch der Schauspieler weiß um das Inszenierte, um das Vorgespielte. Dennoch muss er daran teilneh260
261
262
263
Dostojewski, Die Dämonen, S. 294.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 819.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 798.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 463.
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
409
men und zwar so, als ob er daran glauben würde, als ob es für ihn die einzige Realität wäre.
Myschkin ist verliebt und will heiraten. Er wird von zwei Frauen geliebt und muss
zwischen den beiden wählen. Er hat einen Rivalen und wird somit auch in anderen
Hinsichten mit mehreren Teilnehmern des großen Schauspiels konfrontiert, das von
ihnen zwar als solches erlebt, jedoch völlig ernst genommen wird. Bei jedem von
Myschkins Auftritten ist jedoch klar, dass er von der theatralischen Wirklichkeit überfordert ist: Er kann weder, wie die anderen, zugleich ein Zuschauer und Schauspieler
sein, noch kann er auf seine Zuschauer-Position verzichten. Er ist ein Zuschauer, der
wie zufällig auf der Bühne gelandet ist. Damit provoziert er Gelächter. Doch kann er
die Bühne nicht verlassen, bevor das Stück zum Ende gekommen ist, er muss mit all
seiner Unangemessenheit an ihm teilnehmen. Und obwohl er eine komische Figur ist,
wird er am Ende zu einem tragischen Helden. Der unlösbar-tragische Konflikt betrifft
hier jedoch nicht die Protagonisten mit ihren Lebenswahrheiten, wie in der klassischen Tragödie, und nicht die Ideen, wie in anderen Romanen Dostojewskis. In Der
Idiot betrifft er die Standpunkte. Es ist der Konflikt zweier Positionen, zweier Perspektiven – der des Teilnehmers und der des Zuschauers bzw. der Position innerhalb des
Geschehens und der, die den Anspruch erhebt, außerhalb der Wirklichkeit zu stehen,
um sie zu beobachten und ‚richtige‘ bzw. unparteiische Urteile über sie zu treffen.
Durch das Zusammentreffen dieser zwei Perspektiven im „schönen Menschen“ verwandelt sich die Komödie in eine Tragödie, die Inszenierung in fantastische Wirklichkeit.
So gibt gerade Dostojewskis Kunst, seine ästhetische Idee, die Antwort auf die
Frage, warum ein guter und vernünftiger Mensch, der allen sein Herz öffnet und sich
für alle aufopfert, der dabei auch jeden „versteht“, nur noch ein zum Scheitern
verurteilter Idiot ist. Myschkin musste als „positiv-schöner“ Mensch gerade das Unmögliche tun. Sein Standpunkt muss einerseits notwendig ein äußerer sein, damit
er, wie er will, „alles verstehen“, alle Gründe einsehen und so alles verzeihen, alle
versöhnen könnte. Dafür braucht er die göttliche Position ‚über‘ der Welt. Und er
beansprucht sie, indem er mehrmals das Spiel der anderen abbricht, indem er sich
gegen das Fantastische und Inszenierte stellt. Aber selbst ist er nicht „über“, sondern
„innerhalb“ dieser Welt. Als Teilnehmer kann er sich nicht auf seine Zuschauerprivilegien berufen, er muss sich für eine Rolle entscheiden. Daran scheitert er. Er scheitert
in dem Moment, in dem er zur Handlung genötigt wird. Seine Einsichten in das
Schauspiel zeigen deshalb nur noch seine Unangemessenheit, sein Unvermögen, den
Herausforderungen des Lebens zu begegnen:
Er aber war wahrscheinlich außerstande, die ganze Gewalt dieser Herausforderung zu ermessen,
man könnte sogar sagen: bestimmt außerstande.264
264 Dostojewskij, Der Idiot, S. 827.
410
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Im Unterschied zu Tolstois theatralischer Welt lässt die fantastische Wirklichkeit
Dostojewskis so keine Möglichkeit offen, den Weg der Wahrheit zu betreten. Die
Wahrhaftigkeit des schönen Menschen, seine Einsichten werden ihm zum Verhängnis.265 Durch Myschkin wird die Grenze zwischen der Welt der inszenierten Wirklichkeit und dem äußeren Beobachter nicht bloß selbst beobachtbar (sie wird es oft auch
bei den anderen handelnden Personen Dostojewskis), sondern sie wird tragisch umgedeutet: Myschkin muss in der Illusion bleiben, von der er weiß, dass sie eine ist.
Immer klarer wird das harte Urteil des Romans: Er ist weder Gott noch steht er „über“
der Welt, er ist bloß ein Mensch, der zwar in der Welt ist, jedoch den Anspruch erhebt,
sich in die Position Gottes zu versetzen. Er ist bloß Idiot.
Myschkin stellt allerdings gerade das Gegenteil von dem dar, was Nietzsche als
Kants Idiotismus bezeichnete: Er versucht immer – und dies gelingt ihm sogar –, die
anderen in ihrem Verhältnis zum Guten und zum Bösen nicht zu verurteilen (z. B. im
Falle von Burdowski). Er kann jedem das Seine zugestehen, was Zarathustra für
höchste Gerechtigkeit hielt, die für die Menschen aber unmöglich sei. Myschkin kann
es – als Freispruch von jeder Schuld, als Verständnis für jedes Unglück. Seine Moral
ist durch und durch perspektivisch. Aber – und dies sollte auch für die Moralkritiker
ein Rätsel bleiben – seine Einsichten können keinen Menschen von seiner Schuld
erlösen, stattdessen zerbricht sein eigener Verstand an diesem Verständnis. Denn, so
Dostojewskis Gedanke, die Allwissenheit und die Güte des Herzens sind nicht genug,
um die Welt zu retten. Myschkins tragischer Untergang ist, so Dostojewskis endgültige
Entscheidung, zu der er erst im Schreiben kam, wie auch der Mord von Nastassja
Filippowna, von vornherein durch seine Position gegenüber der fantastischen Wirklichkeit vorbestimmt.266
Der Roman endet mit dem Untergang eines „schönen“ Menschen, der trotz all
seiner Güte und all seinen Einsichten ein Idiot ist und die Wirklichkeit nicht ertragen
kann. Es ist bemerkenswert, dass der Erzähler im Roman selbst als höchst unzuverlässiger Zeuge hervortritt. Er kann bloß Gerüchte sammeln und ist nicht besser
informiert als ein vollkommen Fremder, der die handelnden Personen nicht persönlich, sondern nur vom Hören-Sagen kennt. Die göttliche Position des Allwissenden –
die Erzählform, die meistens von Tolstoi bevorzugt wurde – wird in Der Idiot durch die
Stimme des Autors nicht vertreten. Es ist Myschkin mit seinen tiefen Einsichten, der
diese Rolle übernimmt. Ihm vertraut Dostojewski sogar seine Lieblingsgedanken an
(z. B. zum Katholizismus als Verrat an Christus). Aber er lässt ihn auch stets spüren,
dass er seine hohen Ideen andauernd kompromittiert. Das sind seine wichtigsten
265 Wichtig ist, dass dieser Untergang durch den Konflikt der Perspektiven bei Myschkin vorbestimmt
ist, genauso wie der von Anna Karenina. Aber eine Alternative lässt die fantastische Welt Dostojewskis
nicht zu. Ausführlich dazu die Verfass., Поэтика драмы и эстетика театра в романе, S. 147–176.
266 Vgl. in Dostojewskis Notizen: „[…] dieser 4. Teil und sein Finale sind das Wichtigste im Roman,
d. h. der ganze Roman wurde fast nur für das Finale des Romans geschrieben und erdacht“ (DGA 28
(Teil II), S. 318). Vgl. den Kommentar dazu: DGA 9, S. 383 f.
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
411
Eigenschaften als „schöner Mensch“ – nicht bloß das Lächerliche, sondern das Kindlich-Rührende und das Peinliche zugleich. So notiert Dostojewski für sich:
Der Held des Romans, der Fürst, ist nicht lächerlich, hat aber eine andere sympathische Eigenschaft, er ist unschuldig!267
Die Unschuld sowie der Größenwahn seiner Position (denn auch darin ist er unschuldig-naiv) zeigen sich im „schönen Menschen“ als seine Ohnmacht, als sein Idiotismus.
Nicht die Unschuld und nicht das Den-Anderen-die-Schuld-Absprechen ist nach Dostojewski die die Welt erlösende Kraft. Bei einem Menschen zeigt diese Haltung bloß die
Unfähigkeit, den Herausforderungen des Lebens entgegenzutreten. Nicht nur kann er
die Welt nicht retten, sondern auch in ihr zu handeln ist ihm unmöglich. Er, der die
Position Gottes einnahm, ist von der Wirklichkeit mit ihrem fantastischen Element, mit
der Schuld und dem Bösen des menschlichen Herzens überfordert. Er ist unfähig, diese
Welt wieder in Ordnung zu bringen. Als „positiv-schöner“ Mensch und Idiot zugleich
ist er ohnmächtig, die Welt in ein „schönes moralisches Ganze[s]“ zu verwandeln.
Die Schönheit des Bösen
Myschkin ist dennoch nicht der einzige „schöne Mensch“ im Roman. Das Thema der
Schönheit ist bei Dostojewski vielfältig. Bis jetzt haben wir es nur im Sinne des
„schönen Herzens“ eines „schönen Menschen“ behandelt. Im strengen Sinne des
Wortes geht es aber im Roman um die Schönheit einer Frau, Nastassja Filippowna, in
die Myschkin sich gleich am Anfang verliebt, in dem Moment, in dem er ihr Portrait zu
Gesicht bekommt. Es handelt sich um eine die passionierte Liebe erregende Schönheit. Diese ästhetische Schönheit ist gerade „rätselhaft“ und verdutzt denjenigen, der
die Menschen sonst durchschaut, der sie sonst „versteht“.
Schönheit ist schwer zu beurteilen […] Schönheit – das ist ein Rätsel.268
Auch die andere schöne Frau, Aglaja, ist Myschkin ein Rätsel. Er kann gerade sie
beide, die zwei schönen Frauen, deren Liebe ihn zu Grunde richten wird, nicht
verstehen. Ob ihre Schönheit das Gute oder das Böse verbirgt, ob sie Leiden oder
Glück bedeutet, kann er nicht sagen. So spricht Myschkin, als er das Portrait von
Nastassja Filippowna zum ersten Mal erblickt:
[…] ich weiß nicht, ob sie gut ist? Ach wäre sie doch gut! Dann wäre alles gerettet!269
267 Богданов (Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве, S. 456. Auch Nastassja Filippowna sagt über
Myschkin: „Ein solches Kind zugrunde richten?“ (Dostojewskij, Der Idiot, S. 246)
268 Dostojewskij, Der Idiot, S. 114.
269 Dostojewskij, Der Idiot, S. 53.
412
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Und noch ein wichtiges Detail ist nicht zu übersehen. Die Schönheit der schönen
Frauen, in die er verliebt ist, bringt Myschkin kein Wohlgefallen. Ganz im Gegenteil:
Sie erregt Furcht. So spricht Myschkin zu Aglaja:
Sie sind so schön, daß man Angst hat, Sie anzusehen.270
Und über Nastassja Filippowna:
Diese blendende Schönheit war sogar unerträglich […].271
Später wird Myschkin, schon als Nastassja Filippownas Bräutigam, ein Bekenntnis
ablegen:
‚[…] ich kann Nastassja Filippownas Gesicht nicht ertragen […] Ich konnte es schon am Vormittag
als Portrait nicht ertragen… […] ich… ich fürchte mich vor ihrem Gesicht‘, fügte er ausgesprochen
ängstlich hinzu.272
Ein anderer Verehrer von Aglaja fragt ihn:
Sie heiraten also aus Angst? Das ist einfach nicht zu verstehen…273
Was das Gesicht von Nastassja Filippowna so unerträglich macht, wird folgendermaßen erklärt: Es ist ein Kontrast, den ihr Gesicht verbirgt, das Gegenteil von „unermeßliche[m] Stolz und Hochmut, beinahe Haß“, „zugleich aber auch ein Zutrauen und
eine erstaunliche Gutherzigkeit“.274 Dies sei der Kontrast, den der Verstand nicht
ertragen kann, ohne in Wahnsinn zu verfallen. Das gerade geschieht mit Myschkin,
der sich, bis zum letzten Moment, das Unerträgliche des Gesichts von Nastassja
Filippowna mit ihrem Wahnsinn erklärt. Was am Ende kommt, ist gerade sein Wahnsinn, sein Absturz in die mentale Finsternis. Die Schönheit, die er nicht verstehen
kann, der er dennoch sofort sein Verständnis der mitleidigen freisprechenden Liebe
anbietet, richtet die Vernunft des „schönen Menschen“ zugrunde.
Der „schöne Mensch“ scheitert also, indem er versucht, die Schönheit zu durchschauen. Als Rätsel kommt sie ihm bedrohlich vor. Aber auch seine eigene Liebe ist
ihm rätselhaft. Er will sie heiraten, doch nicht weil er auf Glück hofft:
Glücklich? O nein! Ich will nur so heiraten.275
270
271
272
273
274
275
Dostojewskij, Der Idiot, S. 113.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 117.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 843.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 843.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 117.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 842.
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
413
Er versichert seinem Rivalen Rogoschin, dass er sie „nicht aus Liebe lieb[t], sondern
aus Mitleid“.276 Es ist zweifelhaft, ob dieses Mitleid aus Furcht überhaupt Liebe ist,
auch für Myschkin selber:
‚Wissen Sie was, mein armer Fürst: Es wird wohl so sein, daß Sie weder die eine noch die andere
je geliebt haben!‘ ‚Ich weiß nicht… vielleicht, vielleicht.‘277
Myschkins Liebe ist vom Mitleid, aber auch von der Furcht nicht zu unterscheiden. Es
ist kein Wunder, dass keine von den beiden ihn liebenden Frauen damit zufrieden ist.
Aus Herzensgüte zieht Myschkin die unglücklichere der beiden Frauen vor, um
sie vor der Katastrophe zu bewahren. Seine Liebe ist die wohltätige Liebe für diejenige, die sie am meisten braucht. Nastassja Filippowna ist unglücklicher, weil sie sich
für schuldig hält. Er aber will für sie wie für eine Kranke sorgen und ihren Untergang
verhindern. Er handelt somit moralisch und vernünftig. Er verlangt dafür auch von
ihrer Rivalin Verständnis:
Oh, wenn Aglaja wüßte, wenn Sie alles wüßte … das heißt, wirklich alles! Denn hier muß man
alles wissen, das ist die Hauptsache! Warum ist es unmöglich, alles über den anderen zu wissen,
wenn es nötig ist, wenn dieser andere schuld ist! …278
Das ist Myschkins Glaubensbekenntnis: Wer alles weiß, könne alles verstehen und
vergeben oder würde vielmehr verstehen, dass es keine Schuld gibt. Auch Myschkin
deutet dabei das allumfassende Schuldbekenntnis an, das zehn Jahre später in den
Brüdern Karamasow zur Formel des Guten wird:
O ja, ich bin schuld! Wahrscheinlich bin ich an allem schuld! Ich kenne meine Schuld noch nicht,
aber ich bin schuld…279
In Der Idiot bringt diese Formel jedoch keine Erlösung. Denn sie wird von Myschkin
anders gedeutet als später von Staretz Sossima und Dmitri Karamasow. Myschkin ist
auch hier v. a. ein ‚vernünftiger‘ Mensch, er will seine Schuld „verstehen“. Er meint,
wenn man „wirklich alles“ verstehen könnte, würde man (und in erster Linie die von
ihm verlassene Frau, Aglaja) verstehen, dass er überhaupt nicht schuldig gewesen ist
und sogar im Recht war, indem er die unglücklichere der beiden Frauen vorgezogen
hat. Die Menschen seien nicht schuldig an dem, was sie tun, es gebe immer Gründe
und Gründe von Gründen, die sie zu diesem Tun zwingen. Sie seien bloß Opfer dieses
Tuns und seiner Folgen, und wenn man alles wissen könnte, würde man alle von ihrer
Schuld freisprechen. So ist Myschkins Schuldbekenntnis keine Übernahme der Schuld
276
277
278
279
Dostojewskij, Der Idiot, S. 301.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 844.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 843.
Dostojewskij, Der Idiot, S. 843 f.
414
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
der anderen, es ist bloß eine Bitte um Verständnis, schließlich ist es die Leugnung der
Schuld. Myschkin kann, so Dostojewski, keinen einzigen Menschen damit retten,
auch sich selbst nicht.
Myschkin träumt von dem Unmöglichen: Wenn die zwei Rivalinnen „alles“ wissen könnten, würden sie sich versöhnen und auf die egoistische Liebe verzichten. Sie
würden dann, genau wie Myschkin, die Entscheidung, eine von ihnen zu heiraten, für
nichtig halten. Genauso wie er selbst alle Handlungen Nastassja Filippownas und
später auch den Mord, den Rogoschin begeht, bloß für ein Unglück und eine Krankheit hält. Das ist aber nur ein Traum eines „schönen Herzens“, nicht der eines
gesunden Verstandes. Denn Myschkin rechnet „gewissermaßen mit dem Paradies“.
Aber, wie ein anderer Protagonist sagt:
[…] das Paradies auf Erden ist nicht leicht zu erreichen; […] das Paradies ist etwas Schwierigeres,
lieber Fürst, etwas viel Schwierigeres, als Ihr schönes Herz glaubt.280
Myschkins „schönes Herz“ macht ihn somit schutzlos gegen die bedrohliche und
zerstörerische Kraft, welche durch die Schönheit repräsentiert wird und als unlösbares Rätsel seinen Verstand zugrunde richtet. Zwar will Myschkin mit seiner Großherzigkeit jedem helfen, aber er hilft keinem: Denn beide Frauen können Myschkin
seine Herzensgüte nicht verzeihen, obwohl sie ihn gerade dafür lieben, was im Roman
mehrmals betont wird. Sie wollen kein Mitleid, sondern Liebe, d. h. das ästhetisch
bedingte Wohlgefallen, das Vorziehen der einen gegenüber der anderen, wodurch
keine moralische Handlung, sondern bloß das egoistische Glück instandgesetzt würde. Damit haben wir es in Der Idiot nicht nur mit einem Konflikt der Positionen zu tun
bzw. mit dem Konflikt der göttlichen und der menschlichen Position, der des Zuschauers und der des Schauspielers. Es ist auch der Konflikt des Moralischen und des
Ästhetischen, des Guten und des Schönen. Myschkin strebt ihr Zusammentreffen an,
und er wird mit dem Leben bzw. mit dem Ganzen des Romans als „schöner Mensch“
widerlegt.
Die Schönheit tritt im Roman als ebenso unerträgliche wie unwiderstehliche Kraft
hervor. So sagt die künstlerisch begabte Schwester von Aglaja, die das Portrait ihrer
Rivalin sieht:
Eine solche Schönheit – das ist eine Kraft […] mit einer solchen Schönheit kann man die Welt
ändern!281
Sie erregt nicht nur Liebe aus Mitleid, wie bei Myschkin, sondern auch leidenschaftliche Liebe, wie bei Rogoschin, die vom tödlichen Hass schwer zu unterscheiden ist. Sie
280 Dostojewskij, Der Idiot, S. 494.
281 Dostojewskij, Der Idiot, S. 119.
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
415
ist eine Kraft, die in den Wahnsinn stürzt. Selbst die Güte eines Unschuldigen kann
dieser Kraft nicht widerstehen. Die Schönheit ist somit eine mächtige Rivalin der
Moral. Im krassen Widerspruch mit der von Dostojewski selbst und seinen Protagonisten vertretenen These, rettet die Schönheit die Welt in seinem Roman nicht, sie
stürzt sie stattdessen hinab in den Abgrund. Hier stellt sich die Frage: Wollte Dostojewski diese These gegen sein „Kunstbild“ stellen? Wollte er die Vernunftidee gegen
die ästhetische Idee ausspielen?
Schauen wir uns den Begriff der Schönheit noch einmal näher an. Worin besteht
die Kraft der Schönheit, die die Welt umstürzt? Was verleiht ihr ihre unwiderstehliche
Kraft? Ein anderer zwischen zwei schönen Frauen hin- und hergerissener Protagonist,
Dmitri Karamasow, gibt ihr eine neue Definition:
Schönheit – eine furchtbare, schreckliche Sache! Schrecklich, weil sie unbestimmbar ist, und sie
zu bestimmen ist nicht möglich, weil Gott da nichts als Rätsel aufgibt. Da fließen linkes und
rechtes Ufer in eins, da leben alle Gegensätze miteinander. […] Entsetzlich viele Geheimnisse! Zu
viele Rätsel drücken auf Erden den Menschen nieder. Rate herum, so gut du kannst, und steig
trocken aus dem Wasser. Die Schönheit! Ich werde zudem nicht damit fertig, daß mancher
Mensch, sogar mancher mit hohem Herzen und hohem Geist, vom Ideal der Madonna ausgeht
und beim Ideal Sodoms endet. Noch schrecklicher, wenn einer schon mit dem Ideal Sodoms in
der Seele auch das Ideal der Madonna nicht aufgibt und wenn dieses bewirkt, daß sein Herz
brennt, ja, in Wahrheit, in Wahrheit brennt wie in den makellosen Jugendjahren. Nein, ein weites
Gefäß ist der Mensch, sogar ein zu weites – ich würde ihn enger machen. Ist doch wirklich eine
teuflische Sache! Was dem Geiste sich als Schande darstellt, ist dem Herzen Schönheit durch und
durch. Ist in Sodom Schönheit? Glaub mir, eben in Sodom, da ist für weitaus die meisten
Menschen die Schönheit – kanntest du dieses Geheimnis? Furchtbar, daß die Schönheit nicht nur
eine schreckliche, sondern auch eine geheimnisvolle Sache ist. Da kämpft der Teufel mit Gott,
und die Herzen der Menschen sind das Schlachtfeld.282
Der Gedanke Myschkins, er könne den Kontrast nicht ertragen, den das schöne
Gesicht verbirgt, dieses Rätsel sei ihm unerträglich, bekommt so in den Brüdern
Karamasow eine neue Wendung. Nicht nur die Vernunft, auch die Schönheit wird
hier dialektisch: Das Gute erweist sich durch sie als von dem Bösen unzertrennlich,
als ihr geheimnisvolles Zusammentreffen. Hier kreuzen sich die parallelen Linien.
Das kann der „euklidische Verstand“ nicht akzeptieren, es richtet ihn zugrunde: In
der Schönheit treffen sich das Gute und das Böse, das Leben und die Selbstzerstörung, die Heldentat und die Grausamkeit. In ihr und nur in ihr sind es keine
einander ausschließenden Gegensätze. Sie ist somit mit dem Guten keinesfalls
notwendig verbunden, nicht einmal symbolisch. Oder sie ist vielmehr symbolisch
genauso mit dem Guten wie auch mit dem Bösen verbunden. Sie kann der Ausdruck
des Bösen werden, und zwar nicht so, dass sie als das Gute erscheint, sondern
gerade als das Böse bewundert und geliebt wird. Die rätselhafte Kraft des Schönen
282 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 174.
416
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
löst die Unterscheidung von Gut und Böse nicht auf, aber sie lehrt, beide als Extreme
zu lieben. So, wie es ein anderer Protagonist mit schönem Gesicht, Nikolai Stawrogin,283 getan hat:
Und ist es wahr, daß Sie versichert haben, Sie wüßten keinen Schönheitsunterschied zwischen
einer beliebigen wollüstigen, tierischen Extravaganz und gleichviel welch einer Heldentat, und
wäre es selbst die Hingabe des Lebens für die Menschheit? Ist es wahr, daß Ihrer Ansicht nach
an dem einen wie an dem anderen, dem entgegengesetzten Pol die gleiche Schönheit und der
gleiche Genuß zu finden seien?284
Die Schönheit ist die Kraft, die die Welt genauso retten wie in den Abgrund stürzen
kann.
Die Verbindung der Schönheit mit dem Guten erscheint somit bei Dostojewski,
wie auch früher bei Tolstoi, nicht als Plausibilität, sondern eher als bedenkliche
Vereinfachung. Das Schöne war für Kant das Symbol des Sittlich-Guten wegen einer
Analogie: wegen des interesselosen Wohlgefallens. Die Interesselosigkeit wies Dostojewski jedoch in beiden Fällen ausdrücklich zurück. Das Interesse, das mit der
Schönheit verbunden ist, besteht gerade darin, dass sie das Gute, ebenso wie das Böse
als liebenswürdig darstellen kann. Sie kann „Schönheit der Lüge“ (DGA 25, S. 115)
oder Kunststück der Grausamkeit sein. Mehr noch: Auch in Zerstörung und Hass sucht
der Mensch vor allem die Schönheit. Es ist der Mangel an Schönheit, der das Verbrechen verächtlich macht, nicht das Böse an ihm. So sagt der Staretz Tichon, der
Stawrogins Schuldbekenntnis gelesen hat:
Es gibt wirklich häßliche Verbrechen. Welcher Art die Verbrechen auch wären, je mehr Blut,
desto mehr Entsetzen, desto eindrucksvoller, sozusagen bildhafter sind sie. Aber es gibt auch
schändliche, gemeine Verbrechen, jenseits des Entsetzens, sozusagen schon gar zu geschmacklose …285
Nur letzterer schämen sich die Menschen wirklich. Auch der Teufel Iwans verspottet
ihn für seine ästhetischen Erwartungen:
In Wahrheit zürnst du mir deshalb, weil ich dir nicht im roten Feuerschein erschienen bin, ‚mit
Blitz und Donner‘, mit versengten Flügeln, statt dessen in so bescheidener Gestalt vor dir stehe.
Du bist verletzt, erstens in deinen ästhetischen Empfindungen, zweitens im Stolz. Du sagst dir:
Wie das, zu einem so bedeutenden Mann kommt so ein ordinärer Teufel?286
283 Bei Stawrogin wird seine Schönheit immer betont, er hat ein schönes Gesicht, das allerdings als
Maske abschreckend wirkt. „Er war ein sehr schöner junger Mann […] man sollte meinen, ein bildschöner Mann, und doch war diese Schönheit gleichsam auch abstoßend. Manche sagten, sein Gesicht
erinnere an eine Maske […]“ (Dostojewski, Die Dämonen, S. 59 f.).
284 Dostojewski, Die Dämonen, S. 349.
285 Dostojewski, Die Dämonen, S. 628.
286 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 504.
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
417
So wird von dem Teufel selbst Schönheit erwartet – die Schönheit des Bösen. Auch
der Sozialist und Terrorist Pjotr Werchowenski verehrt sein Idol, den schönen Stawrogin:
Stawrogin, Sie sind schön! […] Und ich, ich liebe Schönheit. Ich bin Nihilist, aber ich liebe
Schönheit. Lieben denn Nihilisten das Schöne etwa nicht? Die lieben doch bloß Abgötter nicht,
ich aber, nun, ich liebe einen Abgott! Sie… Sie sind mein Abgott!287
Das Ideal der Schönheit wird so auch aus der Tiefe des nihilistischen Unglaubens
geliebt – nicht weniger als von jedem anderen Glauben her. Durch die sozialistische
Bewegung
ist nur eines geschehen: die Ziele haben sich geändert, die eine Schönheit ward durch eine
andere ersetzt!288
Es sei die Sehnsucht nach Schönheit, die Sozialisten und Nihilisten bewegt, die die
Zerstörung und den Terror ins Leben ruft. Ohne Schönheit wäre auch jene lebensfeindliche Bewegung ohne Kraft und der Schurke Werchowenski bloß ein „Kolumbus
ohne Amerika“.289 Die Liebe zur Schönheit entfaltet sich so auch durch die Zerstörung, die selbst oder gerade dann reizend wirkt, wenn sie Hass und Furcht erregt,
wenn sie das Leben bedroht. Auch das Verbrechen kann man lieben,290 auch in dieser
Liebe sind Ideale gegenwärtig.
Und noch mehr: Das Wohlgefallen an der Schönheit des Bösen zählt Dostojewskis
Mensch zu seiner Menschheit. Nicht die Fähigkeit zum Moralisch-Guten, sondern
gerade zur Bewunderung der rätselhaften und geheimnisvollen Kraft der ästhetischbedingten, egoistisch-wollüstig angestrebten Schönheit ist das, was den Menschen zu
einem besonderen Wesen macht. Auch in der schrecklichsten Grausamkeit äußert
sich eine artistische Seite, seine Künstlernatur:
Wenn man es sich recht überlegt – da spricht man oft von der tierischen Grausamkeit eines
Menschen, und das ist doch furchtbar ungerecht, man beleidigt damit die Tiere; ein Tier kann
niemals so grausam sein wie der Mensch, so raffiniert, so kunstvoll grausam.291
Nur der Mensch ist zum „kunstvollen“ Bösen, zur artistischen Grausamkeit privilegiert, wie er zur Erschaffung des Teufels privilegiert ist. „[W]enn der Teufel nicht
existiert, also der Mensch ihn geschaffen hat, so hat ihn der Mensch nach seinem
287 Dostojewski, Die Dämonen, S. 583. Werchowenskis Liebe zu Stawrogin steht allerdings dem Hass
und dem Wahn sehr nahe.
288 Dostojewski, Die Dämonen, S. 719.
289 Dostojewski, Die Dämonen, S. 584.
290 Vgl. „‚Es gibt Augenblicke, da lieben die Menschen das Verbrechen‘, bemerkte Aljoscha nachdenklich.“ „‚Alle sagen, sie hassen das Schlechte, im stillen aber lieben sie es.‘“ (Dostojewski, Die
Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 402)
291 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 381.
418
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Bilde geschaffen“, sagt Iwan und bekommt die Antwort seines Bruders: „Und das
hieße auch: genau wie der Mensch Gott geschaffen hat“.292 Das Gute und das Böse,
Gott und Teufel, treffen sich so durch die Liebe zur Schönheit im Herzen eines
Menschen. Die Schönheit wird zum Schlachtfeld der Kräfte, die der Mensch beide
stark lieben und begehren kann, gerade als Extreme, als unversöhnliche Gegensätze.
In beiden Polen dieses unheimlichen Kampfes zwischen Gott und Satan sieht er die
Schönheit, von der sein „Herz brennt“. Als nicht nur moralisch-vernünftiges, sondern
auch ästhetisch-begabtes Wesen ist der Mensch zu diesem Kampf verurteilt – als
Zuschauer und Akteur zugleich. Er muss in diesem Kampf zwischen Gott und Satan,
Gott und Abgott, mitkämpfen, auch wenn er weiß, dass er sein Leben, seine letzte
Hoffnung auf Glück, nur noch zerstören kann, dass er, wie Myschkin, an diesem
Kampf höchstwahrscheinlich zugrunde gehen wird.
Die rettende Kunst
Die Schönheit bietet also nach Dostojewski keine symbolische Verdeutlichung des
Guten, wie die Liebe auch keine Ergänzung der Moralität darstellt. Sie spiegelt die
Kontroversen der in der eigenen Dialektik gefangenen Vernunft wider, die, wie bei
Iwan Karamasow, das Gute im Namen der Liebe, aber auch die Liebe im Namen des
Guten verleugnet.293 Lieben kann man deshalb auch das Böse, auch das Böse ist ein
Ideal, das durch eine menschliche Gestalt vertreten wird. Was kann hier noch als
Erlösung verstanden werden? Wie kann die Schönheit die Welt erlösen, wenn sie die
Welt gerade in Gut und Böse spaltet, die sie beide lieben lehrt? Was wollte Dostojewski uns mit dieser These als Denker sagen und was sagte er als Künstler? Die
Vermutung liegt auf der Hand: Die Schönheit kann den Menschen erlösen, gerade weil
sie allein die Welt so radikal in Extreme spaltet, weil sie sowohl das Gute als auch das
Böse als liebenswürdig vorstellt. Sie erlöst ihn zu einer neuen Freiheit, die als Freiheit
Christi in Dostojewskis letztem Roman dargestellt wurde. Letztere fordert eine Entscheidung heraus, „was gut und böse ist“, die frei von allen Argumenten, von allen
„Pros“ und „Contras“, selbst frei von dem „Interesse der Vernunft“ gedacht werden
kann. Die Freiheit kann diesmal als solche bezeichnet werden, nicht bloß weil das
Gegenteil von ihr die Unfreiheit bedeutet, sondern weil sie tatsächlich die Erkenntnis
in dem oben beschriebenen Sinne sein kann: die Erkenntnis des Guten und des Bösen,
292 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 381 f.
293 Iwan Karamasow wies u. a. auch auf den unlösbaren Konflikt der ästhetisch-bedingten und der
vernünftig-moralischen Liebe hin. Es sei gerade unmöglich, die Nächsten zu lieben, weil man immer
schon eine ästhetische Vorstellung von dem Guten und Liebenswürdigen hat, der ein konkreter
Mensch niemals entspricht. „Damit man einen Menschen liebt, muß dieser sich versteckt halten; er
braucht nur sein Gesicht zu zeigen, so ist es um die Liebe geschehen.“ (Dostojewski, Die Brüder
Karamasow, Bd. 1, S. 379)
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
419
die der Spaltung durch eine geliebte menschliche Gestalt und einer persönlichen
Beziehung mit diesem Menschen entspringt. Liebe und Hass, das Folgen und Verfolgen sind jetzt nicht mehr begründbar, nicht kalkulierbar: Sie sind freie Entscheidungen des Herzens, die einzig mögliche Freiheit in der Welt Dostojewskis. Um der
Unfreiheit gegen die eigene Moral zu entgehen, gibt es nur einen Weg: Den tiefsten
Wünschen des eigenen Herzens zu folgen und jeder Art Moral, die diesen Wünschen
widerspricht, entschieden Widerstand zu leisten.
Dostojewski hat sich in einem privaten Brief „ein Kind dieser Zeit, ein Kind des
Unglaubens und der Zweifelsucht“ genannt. Und dennoch habe er, wie er gleich
danach schreibt, „in solchen Augenblicken“, die ihm „Gott zuweilen“ „schenkt“, nämlich wenn er „lieb[t]“ und „glaub[t], auch geliebt zu werden“, sein eigenes Glaubensbekenntnis „aufgestellt“, in dem seine persönliche Entscheidung zum Ausdruck
kam – eine Entscheidung, die mit keinem Argument begründet und dennoch oder
gerade deshalb für ihn unwiderlegbar („klar und heilig“ und „höchst einfach“) ist,
sein „Glaubenssymbol“:
Dieses Glaubensbekenntnis ist höchst einfach, hier ist es: Ich glaube, daß es nichts Schöneres,
Tieferes, Sympathischeres, Vernünftigeres, Männlicheres und Vollkommeneres gibt als den Heiland; ich sage mir mit eifersüchtiger Liebe, daß es dergleichen nicht nur nicht gibt, sondern auch
nicht geben kann. Ich will noch mehr sagen: Wenn mir jemand bewiesen hätte, daß Christus
außerhalb der Wahrheit steht, und wenn die Wahrheit tatsächlich außerhalb Christi stünde, so
würde ich es vorziehen, bei Christus und nicht bei der Wahrheit zu bleiben.294
Eine Variation zu diesem Gedanken finden wir im Roman Die Dämonen, in dem der
in seinen Ansichten rätselhaft vielseitige Stawrogin von Schatow, der die religiöse
Slawophilie vertritt, gefragt wird:
Aber waren Sie nicht der, der zu mir sagte, wenn man Ihnen mathematisch bewiese, daß die
Wahrheit nicht in Christus sei, Sie dennoch lieber mit Christus als mit der Wahrheit zurückblieben?295
Dieses Glaubensbekenntnis steht in erheblichem Widerspruch zu Tolstoi, der gerade
betonte, dass er vor allem die Wahrheit sucht und in seiner Antwort auf die kirchliche
Exkommunikation das entsprechende Zitat von Samuel Coleridge ausgesucht hat:
Wer Christus mehr als die Wahrheit liebt, endet damit, seine Kirche und dann nur noch sich
selbst zu lieben. (TGA 34, S. 252 f.)
Dostojewskis Glaubensbekenntnis widerspricht aber nicht nur Tolstoi, sondern es
verstößt gegen den Kern der sokratisch-kantischen Moral aus Vernunft. Die hypothetische Situation des Wählens zwischen dem Ideal der Vollkommenheit und der Wahr-
294 Brief an Natalja D. Fonwisina vom 20. Februar 1854, in: Dostojewski, Gesammelte Briefe, S. 86 f.
295 Dostojewski, Die Dämonen, S. 342.
420
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
heit lässt eine für die abendländische Moral ganz befremdliche Vermutung zu – dass
Gott nicht die Wahrheit, dass die Wahrheit nicht das Gute par excellence sei, zumindest nicht das Gute, das man lieben kann; und, als Folge, dass Gott jenseits der
Frage nach der Wahrheit geliebt werden kann. Was wählt man in der unmöglichen
Situation der Entscheidung zwischen dem Ideal der Vollkommenheit und der wissenschaftlich bewiesenen, „tatsächlichen“ Wahrheit? Nicht die Wahrheit, nicht das Unpersönliche, das Unumstößliche, das Bewiesene, sondern die Person, Christus, den
Unbewiesenen, den Widerlegten, der nicht nur keine Sicherheit garantieren kann,
sondern fordert, mit jeder Sicherheit bzw. mit allen Garantieforderungen zu brechen.
Dostojewski, „ein Kind des Unglaubens und der Zweifelsucht“, ein Kind des
19. Jahrhunderts, stellt somit fest: Die wissenschaftlich-beweisbare Wahrheit ist gegen Christus, sie scheint ihn zu widerlegen. Ein einzig mögliches Argument für ihn ist
jedoch die Liebenswürdigkeit seiner Persönlichkeit. Durch sie werden alle GegenArgumente ohne Widerlegung zurückgewiesen. Sie sind unbrauchbar. Denn über die
Schönheit kann schließlich nichts gesagt werden, sie ist ein Rätsel, eine Sache der
Liebe, eine Sache des Geschmacks.
Dostojewski kehrt somit wiederum die ganze Logik der Moral aus Vernunft um,
ohne es vielleicht selbst zu merken, diesmal in seiner Deutung ihrer Ergänzungsstücke – der Liebe und des Schönen. Die Umkehrung des moralischen Gesetzes, das
in Verbrechen und Strafe vollzogen wurde (Wenn du selbst nicht das tun willst, was du
für vernünftig und moralisch gut hältst, kann es auch nicht im Allgemeinen gerecht
sein), wird von Dostojewski immer radikaler vertreten. Im direkten Widerspruch zu
Kant, der die Gebote Gottes von denen des Gewissens abhängig machte, behauptet
Dostojewski gerade das Gegenteil:
Das Gewissen ohne Gott ist ein Alptraum, es kann sich irren bis zur tiefsten Unmoralität. Es reicht
nicht, die Moralität als Übereinstimmung mit den eigenen Überzeugungen zu bestimmen. Man
solle stets für sich die Frage anregen: Sind meine Überzeugungen richtig? Der Maßstab ist nur
eins – Christus.296
Als Folge wird die Umkehrung in der Frage nach dem Verhältnis der Schönheit und
des Guten vollzogen:
Nur das ist moralisch richtig, was mit eurem Gefühl des Schönen übereinstimmt, und mit dem
Ideal, in dem ihr es darstellet.297
Erst die Liebe und das Gefühl (sic!) des Schönen schaffen Ideale, für die es keine
weiteren Kriterien gibt, die aber selbst als Kriterien gelten können. Der Maßstab für
296 Богданов (Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве, S. 464.
297 Богданов (Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве, S. 464. Dem Guten, so widerspricht Dostojewski dem den Sinn des Lebens suchenden Tolstoi, geht die Liebe zum Leben voraus. So muss man
„das Leben mehr liebgewinnen als seinen Sinn“, „unbedingt so, liebgewinnen vor aller Logik, […] denn
erst dann werde ich auch den Sinn begreifen“ (Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 1, S. 368).
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
421
das Gute wie für das Böse werde erst durch die Liebe bestimmt. Diese Liebe könne
sich vor dem Richterstuhl der Vernunft mit ihrer Wahrheit nicht rechtfertigen, sie
brauche aber auch nicht gerechtfertigt zu werden. Denn nicht das sei gut, was im
Interesse der Vernunft liegt, sondern was dem Gefühl des Schönen eines Einzelnen
entspricht.
Dennoch ist die Schönheit, wie oben dargestellt, eine rätselhafte, lebensbedrohliche und zerstörerische Kraft. Sie kann die Schönheit des Bösen, der Lüge, des Verbrechens sein. Die Schönheit des eigenen Ideals als liebenswürdig darzustellen, ist
nicht bloß eine Aufgabe, sondern eine Herausforderung. Es ist, hier drückt Dostojewski seine eigenen Erfahrungen aus, eine Herausforderung an einen Künstler. An
dieser Herausforderung, einen „positiv-schönen Menschen“ zu zeigen, kann er allerdings gerade als Künstler scheitern. Denn es kann durchaus sein, dass seine
Künstler-Optik dazu nicht taugt, diese Schönheit als in die Welt passend darzustellen,
dass die Entscheidung seines Herzens auch in einem „Kunstbild“ nicht nachgewiesen, nicht begründet werden kann, dass seine Antwort auf die Dialektik der Moral aus
Vernunft immer unzureichend bleiben muss.
Im Tagebuch eines Schriftstellers findet sich Dostojewskis Formulierung der Aufgabe der Kunst:
Das wußte ich schon seit dem Jahr 46, als ich zu schreiben anfing, vielleicht sogar länger, – und
diese Tatsache setzte mich oft in Erstaunen und ließ mich an der Nützlichkeit der Kunst angesichts dieser ihrer anscheinenden Schwäche zweifeln. Und in der Tat: Verfolgen Sie nur
manche auf den ersten Blick gar nicht besonders grelle Tatsache des wirklichen Lebens, und
wenn Sie nur imstande dazu sind und den Blick dafür haben, so werden Sie darin eine Tiefe
finden, wie Sie sie bei Shakespeare nicht finden. Aber das ist ja die ganze Frage: auf wessen Blick,
und wer dazu imstande! Denn nicht nur das Schaffen und Schreiben von Kunstwerken, sondern
auch das Sehen einer Tatsache erfordert einen Künstler in seiner Art. Für manchen Beobachter
verlaufen alle Erscheinungen des Lebens in einer rührenden Einfachheit und sind dermaßen
verständlich, daß man gar nicht nachzudenken braucht, und daß es sich auch gar nicht lohnt, sie
anzuschauen. Einen anderen Beobachter aber versetzen die gleichen Erscheinungen manchmal
in solche Sorge, daß er (was gar nicht selten vorkommt), außerstande, sie zu verallgemeinern, zu
vereinfachen und zu einer geraden Linie zu strecken und sich dabei zu beruhigen, zur einer
Vereinfachung ganz anderer Art greift und sich ganz einfach eine Kugel durch den Kopf schießt,
um seinen müdegequälten Geist zugleich mit allen Fragen auszulöschen. Das sind nur zwei
Gegensätze, aber zwischen ihnen liegt die ganze vorhandene menschliche Erkenntnis.298
Die Bedeutung dieses Abschnittes aus dem Tagebuch kann für Dostojewskis Kunstphilosophie in Hinblick sowohl auf Kant als auch auf Nietzsche kaum überschätzt
werden. Die „ganze vorhandene menschliche Erkenntnis“ wird hier umrissen und
zwischen zwei Polen aufgespannt: zwischen der einfachen Annahme des Wahrnehmbaren als einziger Realität, die keine Fantasie, keine Idee zulässt, einerseits und dem
Zusammenbruch, der von der Überkomplexität der Wirklichkeit verursacht wird, die
298 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 252.
422
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
keine Abkürzung, keine Vereinfachung anerkennt, andererseits. Auch Kant äußerte
einmal die Sorge, dass die „Erweiterung des Erkenntnisses“ zu einer Überlastung
führen könnte, die eine verkürzende Fassung unter wenige Ideen erforderlich macht.
Wer diese Aufgabe erfüllen kann, „macht sich […] um die Geschichte wie ein Genie
verdient“ (Logik, AA 9, S. 43 f.). So ist die in der Kritik der Urteilskraft dem Wissenschaftler abgesprochene Möglichkeit, ein Genie zu sein, in den Vorlesungen zur Logik
wieder eingeräumt worden. Bei Nietzsche spielt die Kunst der Abkürzung eine besondere Rolle: Die Wissenschaft wird im Nachlass „Abkürzungskunst“ genannt
(Nachlass, Sommer 1886–Herbst 1887, 5[16], KSA 12, S. 190) und die Moral als „Zeichensprache der Affekte“ bezeichnet, die dem Erkennenden ein kostbares Material
liefert (JGB 187, KSA 5, S. 107).299 Zu verallgemeinern und zu vereinfachen ist auch
nach Dostojewski die Aufgabe, die dem Bunten, Unregelmäßigen, Gewalttätigen und
Ungerechten der Wirklichkeit einen Sinn verleiht und so einen „müdegequälten
Geist“ von seinem Leiden am Fantastischen befreit – dem Fantastischen auch im
Sinne Kants, im Sinne der Undenkbarkeit des Guten. Doch nach Dostojewski sei dies
die eigentliche Aufgabe der Kunst: Sie ist die vor den beiden Extremen – der vereinfachten Faktizität des in den Alltag versinkenden Verstandes und der aus der unerträglichen Komplexität resultierenden Selbstvernichtung – rettende Kraft.
Der Künstler erforscht, so Dostojewski, die Wirklichkeit mit dem Leitfaden seines
Ideals:
Ein Porträtist lässt beispielsweise jemanden sich setzen, um sein Portrait zu malen, bereitet sich
vor, schaut ihn genauer an. Warum tut er das? Weil er aus Erfahrung weiß, dass ein Mensch sich
selbst nicht immer ähnlich ist, er sucht deshalb die ‚Hauptidee seiner Physiognomie‘, den Augenblick, wenn das Subjekt sich selbst am meisten ähnelt […] Was tut folglich hier ein Künstler? Tut
er etwas anderes als seiner Idee (seinem Ideal) mehr Vertrauen zu schenken als der vorhandenen
Wirklichkeit? Sein Ideal ist doch auch die Wirklichkeit, genauso berechtigt wie die Alltagswirklichkeit. (DGA 21, S. 75)
Der Künstler, der so an die Wirklichkeit herangeht, vollzieht etwas Paradoxes. Er will
die „Hauptidee [einer] Physiognomie“ finden, die von ihm erst erschaffen werden
soll. Er will so das in der Wirklichkeit finden, was er allein ihr geben kann. Wer diese
Kraft, das Ideal im Alltag zu sehen, diesen „Blick“ für die „Hauptidee“ der Wirklichkeit hat, ist ein Künstler, d. h. derjenige, der sich zwischen dem Auf-der-Hand-Liegenden und dem völlig Unbegreiflichen zurechtzufinden weiß. Er zeigt damit die „Hauptidee [der] Physiognomie“ der Wirklichkeit auf und wandelt sie in das Ideal um, das
für ihn deshalb und nur deshalb der Maßstab des Richtigen und des Falschen, des
Guten und des Bösen ist. Es ist seine Aufgabe, sie als Extreme darzustellen und
damit nicht bloß das Ideal, sondern auch die Wirklichkeit in ihrer „Wahrheit“ zu
bestimmen.
299 S. dazu Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 284 f.
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
423
Die Kunst fordert so eine Entscheidung für das von ihr erschaffene Ideal der
Schönheit, die die Entgegensetzung des Guten und Bösen erst ermöglicht. Als Künstler wollte Dostojewski gerade dies tun. Aber der „schöne Mensch“, der „Fürst-Christus“, zeigte sich als ohnmächtig, er – und mit ihm sein Schöpfer – war ein gescheiterter ‚Vereinfacher‘ der Wirklichkeit, der von ihrer Komplexität überwältigt wurde.
Diese Verkörperung des Ideals brachte Dostojewski in Verlegenheit: Wer das Gute
wollte, schuf nur noch das Böse; wer selbst schön war, vernichtete nur noch die
Schönheit. Der Künstler widersprach somit der Liebe zum Ideal, zu dem sich Dostojewski als Privatmensch leidenschaftlich bekannte. Dieses Ideal blieb damit immer
noch fantastisch und „von der Scholle losgelöst“. In seinem letzten Roman wollte
Dostojewski wieder das versuchen, was ihm bisher nicht gelungen war, nämlich die
Schönheit seines Ideals als die die Welt erlösende Kraft darzustellen und somit das
Schöne und das Gute, die Liebe und die Moral, das Ideal und die fantastische Wirklichkeit zur Versöhnung zu bringen.
In den Brüdern Karamasow werden die Kontroversen der Vernunft durch Iwan
Karamasow verkörpert, die Kontroversen der Schönheit durch seinen Bruder Dmitri.
Ihre Versöhnung sollte in der Person des dritten Bruders dargestellt werden – in der
Person von Alexej Karamasow, der der neue schöne Mensch war,300 der sich zur
allumfassenden Schuld bekannte und alle Versuchungen des Bösen durchstehen
musste.301 Er ist der eigentliche Held, und doch wird nur noch die „Vorgeschichte“
seiner Heldentaten erzählt, nur der erste Schritt, nur noch der Anfang des Weges, wo
er einem wahren Heiligen begegnet und ihn, seinen „geliebten Staretz“, verliert.
Auch im letzten Roman wird kaum zufällig das Ideal der unbegrenzten Verantwortung – die Schönheit von Gottes Sohn, der die Schuld der Welt auf sich nimmt und
jedem ihn Liebenden Kraft gibt, sich zum „Angeklagten“ für alles Böse und alles
Leiden zu machen – nur indirekt gezeigt. Es ist bloß eine Spur, ein Ziel, das unruhig
macht, das keine Möglichkeit lässt, Recht zu haben, gerecht zu sein, das Gute in
eigener Person zu vertreten. Auch hier bleibt Dostojewski ein „Kind des Unglaubens
und der Zweifelsucht“, er bleibt ein Künstler der pluralistisch gespaltenen fantastischen Welt. Seine ästhetische Idee scheint sich seinen persönlichen Gedanken auf
tiefster Ebene zu widersetzen. Das Glück der Heiligen, das Glück, das aus Liebe zum
Ideal der Vollkommenheit kommt, scheint gerade mit den Mitteln von Dostojewskis
Kunst nicht vertretbar zu sein.302 Und dennoch: Die Gegenwärtigkeit des Ideals ist in
300 Auch äußerlich ist er schön und wird von allen geliebt.
301 Auch Die Brüder Karamasow sind wie Die Dämonen aus dem großen Plan entstanden, dessen
ursprünglicher Titel Das Leben eines großen Sünders gewesen ist.
302 Die Formel des Guten bzw. das allumfassende Schuldbekenntnis wird im Roman auch nicht direkt
ausgesprochen, sondern in eine Erzählung eingerückt, in die Aufzeichnungen des Staretz Sossima, die
von Alexej Karamasow herausgegeben wurden (doppelte Distanzierung). „Als ob der Satz unglaubwürdig und unerträglich wäre, wenn jemand unmittelbar sich zu ihm bekennen würde.“ (Stegmaier,
Lévinas, S. 161) Diese Distanzierung kann man allerdings auch in dem Sinn verstehen, dass dieser Satz
424
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
diesem Roman zum ersten Mal deutlich spürbar, wenn auch nur negativ – es zeigt
sich, indem sich alle anderen Ideale als nichtig erweisen. Das Ideal ist als Herausforderung präsent – als Herausforderung, nicht bloß die Schuld der Welt auf sich zu
nehmen, sondern auch und vor allem keinem anderen Ideal Vertrauen und Liebe zu
schenken.303
Das Ideal der ästhetischen Vollkommenheit bleibt nur negativ präsent – als
Ablehnung der in der Dialektik gefangenen Vernunft und der im eigenen Gerecht-Sein
verschlossenen Moralität, aber auch als Willkür eines Künstlers, als sein Eigenwille,
seinem Ideal um jeden Preis treu zu bleiben. Den Anspruch, das Gute schlechthin zu
vertreten, erhebt in Dostojewskis letztem Roman nicht ein Mensch, sondern der Teufel
bzw. die teuflische Seite eines Menschen, der von der Dialektik der Vernunft, von den
Kontroversen zwischen der Vernunft und ihrer höchsten Idee gequält wird. So spricht
der Teufel Iwans:
Als Mephistopheles sich dem Faust präsentierte, gab er über sich selbst das Zeugnis, er wolle das
Böse und tue nur das Gute. Mag er’s halten, wie er will, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin
vielleicht der einzige Mensch [meine Hervorhebung – E.P.] in der ganzen Natur, der die Wahrheit
liebt und aufrichtig das Gute zu tun wünscht.304
Die Wahrheit selbst wird durch diesen Anspruch gespalten: Es gibt zwei Wahrheiten:
Nein, solange das Geheimnis nicht enthüllt ist, gibt es für mich zwei Wahrheiten: die von dort,
ihre Wahrheit [der Teufel meint hier die Wahrheit Gottes – E.P.], die mir einstweilen unbekannt ist, und die andere ist meine Wahrheit. Noch steht nicht fest, welche von beiden die reinere
ist …305
Diese gespaltene Wahrheit lässt sich nicht vereinigen. Die Welt „als schönes moralisches Ganze[s]“ ist undenkbar geworden. Sie ist als Ganzes nicht mehr gegeben, wie
das moralische Ideal nicht mehr gegeben, nicht mehr plausibel zu sein scheint. Aber
nicht direkt, als Forderung an den anderen, ausgesprochen werden durfte. Er impliziert eine Moral, die
nicht geboten sein kann, sondern die Liebe zu dem von ihr vertretenen Ideal erwecken soll.
303 Der Schlussfolgerung Pfeuffers, Dostojewski zeige, dass der christliche Typus nicht überlebensfähig ist (Pfeuffer, Entgrenzung der Verantwortung, S. 167), kann man, v. a. was Der Idiot angeht, nur
zustimmen. Jedoch versuchte Dostojewskis immer wieder, diesen Typus als lebendig und in dieser
Welt wirkend darzustellen. Auch wenn die wirklichen Menschen diesem Ideal nie vollkommen entsprechen können, sollte seine erlösende Kraft im letzten Roman behauptet werden. Diese Kraft lag
nach Dostojewski nicht bloß in der Betonung des Individuellen gegen das Allgemeine und nicht nur in
der Asymmetrie der Verantwortung im Sinne Lévinas’ (vgl. Pfeuffer, Entgrenzung der Verantwortung,
S. 175), sondern in der Verneinung der individuellen Grenzen dieser Verantwortung. Das Moralische
als solches, sei es das Zu- oder Absprechen der Schuld, sollte sich dagegen als ohnmächtig erweisen.
In diesem negativen Sinne wurde der christliche „Typus“ gerade als einzig überlebensfähiger aufgezeigt.
304 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 504.
305 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Bd. 2, S. 505.
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
425
gerade deshalb, gerade weil nichts mehr plausibel ist, bleibt nach Dostojewski die
Möglichkeit offen, das Ideal der Schönheit zu lieben und ihm mit „freiem Herzen“ zu
folgen. Dieser Gedanke Dostojewskis oder vielmehr diese ästhetische Idee kann in der
Terminologie dieser Arbeit als Zurückweisen aller moralischen Plausibilitäten gedeutet
werden – aller bis auf die, welche durch die unbegründbaren und durchaus alternativreichen „Wünsche seines Herzens“ vertreten werden. Die „lebendige Gestalt“ der von
ihm selbst geliebten Wahrheit, von der Dostojewski, wie sein „toller Mensch“, sagen
könnte, sie habe „seine Seele für immer erfüllt“,306 verteidigte der Schriftsteller auch
gegen sich selbst, als Künstler. Er stellte sie sogar gezielt gegen seine eigene KünstlerVision: als eine Herausforderung an die perspektivisch gespaltene Welt, die sich
einem „schönen Menschen“ als fantastische Wirklichkeit widersetzt. Aber auch in
diesem Fall wurde, nach dem berühmten Ausdruck Bachtins, das „letzte Wort“ nicht
ausgesprochen. Denn wenn die Welt nicht in ein „schönes moralisches Ganze[s]“
umgestaltet werden kann, so kann sie diese Herausforderung nach Dostojewski auch
niemals ablehnen.
Aber was Dostojewski als Künstler nicht konnte, versuchte er wiederum als
Publizist. Oder vielmehr: Er versuchte, als Publizist und Künstler zugleich, die Wirklichkeit zu bestimmen, sie zu vereinfachen, das Ideal als wirklich darzustellen. In
seinem Tagebuch spricht der Schriftsteller immer wieder und immer leidenschaftlicher von der Rolle Russlands, das alle Länder bzw. die ganze Welt mit seinem Wort
der Liebe, mit seinem christlichen Ideal zur Versöhnung bringen wird. Durch größte
Selbstaufopferung, durch seinen „russischen Christus“, wird es der Welt, besonders
der europäischen Welt, eine große moralische Idee verkünden, die sie nicht kennt,
die sie verloren hat.307 Es sei das vollkommene Christentum, das die ganze Welt
freiwillig akzeptieren solle, wie sie auch der führenden Rolle Russlands in der internationalen Politik (denn Dostojewski meint auch reale politische Ereignisse, u. a.
auch Kriege, wobei Russland natürlich nur gerechte und befreiende Kriege führe)
willig zustimmen werde. Dostojewski verwendet dabei seine ganze Redekunst, um
diese Zukunft als nahe und seine politische Vorhersage als Prophezeiung darzustellen. Sein Stil wird hochbiblisch, seine Invektiven gegen Gegner und Skeptiker immer
spitzer und böser. Er tadelt die Ungläubigen, er fordert den Glauben an sein Ideal.308
Und doch, so lautet meine These, kann das Pathos seiner prophetischen Verheißun-
306 Diese Worte finden sich am Ende der ErzählungDer Traum eines tollen Menschen, die im Tagebuch
veröffentlicht wurde (DGA 25, S. 118).
307 Iwan nennt Europa den „allerehrwürdigsten Friedhof“, einer mit den großen Geistern Europas
und ihrem „leidenschaftlichen Glauben an die eigene Tat, an die eigene Wahrheit, an den eigenen
Kampf, an die eigene Wissenschaft“. Für Iwan bleiben nur noch die Grabstätten dieser Leidenschaften,
dieses Glaubens übrig. Diese „Steine“ will er „küssen und über ihnen weinen“ (Dostojewski, Die Brüder
Karamasow, Bd. 1, S. 368). Der Tod Gottes, der von Nietzsches „tollem Menschen“ verkündet wurde,
wird bei Dostojewski als Tod Europas gedeutet.
308 U. a. tadelt er gnadenlos Tolstoi (Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 386 ff.).
426
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
gen über die Rolle Russlands in der europäischen Welt nur in dem Kontext seiner
Idee der rettenden Kraft der Kunst sinnvoll verstanden werden. Als einer der größten
russischen Schriftsteller sah Dostojewski sich verpflichtet, die Komplexität der fantastischen Wirklichkeit zu verkürzen und ihr einen Leitfaden, einen leitenden Sinn zu
geben. Denn:
Jedes große Volk glaubt und muß glauben, wenn es nur lange am Leben bleiben will, daß in ihm,
und nur in ihm allein, die Rettung der Welt liegt, daß es bloß lebt, um an die Spitze aller Völker
zu treten, sie alle in das eigene Volk aufzunehmen und sie, in harmonischem Chor, zum
endgültigen, ihnen allen vorbestimmten Ziel zu führen.309
Diese Idee nennt Dostojewski in seinem Tagebuch eine „Versöhnungsmöglichkeit
außerhalb der Wissenschaft“. In den Dämonen wird sie dialogisiert und dem Zweifel
ausgesetzt, indem Stawrogin im Gespräch mit Schatow, der die Idee über das große
Schicksal Russlands leidenschaftlich vertritt, den Letzteren darauf hinweist, dass das
Ideal als „bloßes Attribut der Nationalität“ wiederum nicht überzeugend sein kann.310
Das Ideal wird im Roman nicht verwirklicht. Gerade sein Gegenteil wird hier gezeigt:
Das gespaltene und in Nihilismus versinkende Land, das sich von seinen „Göttern“
abkehrt, das den Dämonen überlassen wird und das rettende Wort des Gottmenschen
nicht hören kann. Das Ideal musste also auch hier fantastisch bleiben, auch hier war
es nur in den Erwartungshorizont eingeschrieben, nur als Hoffnung oder aber, um
mit Kant zu sprechen, nur als „süßer Traum“ präsent. Nichtsdestoweniger versuchte
Dostojewski, es, trotz all seiner Unglaubwürdigkeit, als wirklich darzustellen, sein
eigenes Ideal dem russischen Volk als Leitfaden für die Wirklichkeit zu geben. Denn,
so wird es in den Dämonen und im Tagebuch gesagt, das Volk, das an die eigene
Größe nicht mehr glaubt, das sich nicht als rettende Kraft der Welt versteht, hat keine
Zukunft.
In seiner berühmten Puschkin-Rede erreichte Dostojewskis prophetisches Pathos
die Spitze. Das Publikum war entzückt, es wurde vereint – vereint im Glauben an eine
Welt, die das Ideal verwirklicht. Nach der Rede wurde Dostojewski ein Lorbeerkranz
aufgesetzt. Er fühlte sich durch diese Ehrung zutiefst berührt. Im Gegensatz zu
Tolstoi, der mit seiner Predigt nur noch auf Unverständnis gestoßen war, wurden
seine Ideale und Einsichten wahrhaftig anerkannt. Es war allerdings sein Lob eines
anderen Künstlers, das zu dieser Aufregung und Würdigung führte. Da Dostojewski
selbst das „letzte Wort“ Russlands gerade als Künstler nicht aussprechen konnte,
wies er in seiner tiefbewegenden, pathetischen Rede auf einen anderen Künstler hin:
auf den unumstritten ersten Dichter Russlands, in dem er „die Universalität und
Allmenschlichkeit seines Genies“ rühmte, in dem er, nach seinem eigenen Ausdruck,
309 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 303.
310 Vgl. Schatows Antwort: „Ich hätte Gott bis zu einem Attribut der Nationalität herabgezogen? […]
Im Gegenteil, ich hebe das Volk bis zu Gott empor.“ (Dostojewski, Die Dämonen, S. 345)
4.3 Die Schönheit als Erlösung der Welt
427
die Grundlage für seinen „phantastischen Glauben“ sah – für die Vision des alle
Widersprüche der menschlichen Existenz versöhnenden Russlands:
Ein echter, ein ganzer Russe werden, heißt vielleicht nur (das heißt: im letzten Grunde, vergessen
Sie das nicht) – ein Bruder aller Menschen werden, ein Allmensch, wenn Sie wollen. […] Und ich
baue fest darauf, daß wir in Zukunft, das heißt natürlich nicht wir, sondern die zukünftigen
russischen Menschen, bereits alle ohne Ausnahme begreifen werden, daß ein echter Russe sein
nichts anderes bedeutet als sich bemühen, die europäischen Widersprüche in sich endgültig zu
versöhnen, der europäischen Sehnsucht in der russischen allmenschlichen und allvereinenden
Seele den Ausweg zu zeigen, in dieser Seele sie alle in brüderlicher Liebe aufzunehmen und so
vielleicht das letzte Wort der großen, allgemeinen Harmonie, des brüderlichen Einvernehmens
aller Völker nach dem evangelischen Gesetz Christi auszusprechen.311
Dieses christliche Ideal Russlands habe Puschkin durch die von ihm erschaffenen
Gestalten mehrfach gezeigt, aber wiederum nicht das Ideal selbst, sondern nur seine
Grundlage. Die Figur von Tatjana aus Puschkins Roman Eugen Onegin ist dafür
besonders bedeutend. Die Protagonistin verzichtet bekanntlich am Ende des Romans
auf ihr eigenes Glück, weil, so Dostojewskis Interpretation, sie dadurch einen anderen
Mensch unglücklich machen würde. So fand Dostojewski seine Idee, man könne das
Glück niemals annehmen, wenn es mit dem Unglück der anderen verbunden ist, bei
Puschkin wieder. Sie war für ihn eine Grundlage der Idee des allumfassenden Schuldbekenntnisses; aber auch nur eine Grundlage. Das volle Geheimnis dieses Ideals und
seiner Wirkung in der Welt habe auch Puschkin nicht offenbart, es bleibe immer noch
ein Geheimnis, das Unverständnis und sogar Befremdung hervorruft. Denn um es zu
enträtseln und das Ideal zu zeigen, fehlte ihm die Zeit:
Wäre Puschkin nicht so jung gestorben, hätte er uns vielleicht noch große und unsterbliche
Gestalten der russischen Seele offenbart, die unseren europäischen Brüdern bereits verständlicher sein, die sie uns näher bringen würden als sie uns jetzt stehen. Er hätte ihnen vielleicht die
ganze Wahrheit unserer Bestrebungen erklärt, und sie würden uns jetzt besser verstehen, hätten
es leichter, unser Wesen zu deuten, und sie würden eher aufhören, so mißtrauisch und hochmütig auf uns herabzusehen, wie sie es jetzt tun und noch lange tun werden. Hätte Puschkin
länger gelebt, dann gäbe es vielleicht auch zwischen uns Russen weniger Mißverständnisse
und Streitigkeiten als es ihrer jetzt zwischen uns gibt. Aber Gottes Ratschluß war anders.
Puschkin starb in der Blüte seiner Jahre und seines Könnens und hat fraglos ein großes Geheimnis ins Grab mitgenommen, so daß wir jetzt versuchen müssen, dieses Geheimnis ohne ihn zu
enträtseln.312
Mit diesem Hinweis auf einen anderen Künstler ergänzte Dostojewski als Publizist
und Prediger das, was er als Schriftsteller, als Künstler, offenlassen musste. „Die Welt
als schönes moralisches Ganze[s] in ihrer ganzen Vollkommenheit“ war nicht mehr
bloß eine nur negativ gezeigte Idee, sondern eine Vision, und wenn auch nicht seine
311 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 504 f.
312 Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 506.
428
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
eigene, so doch die des größten Künstlers Russlands, der die Seele des Volkes auf
mysteriöse Weise immer noch vertritt und dessen Geheimnis bewahrt.
4.4 Zusammenfassung
Die Künstler-Idee Dostojewskis war laut Bachtin die ästhetische Idee einer pluralistisch
gespaltenen Welt, in der das „letzte“ Wort nicht ausgesprochen werden kann und jeder
seine „Wahrheit“ behält, aber diese auch durch Lebenszusammenhänge und Schicksalsfügungen auf die Probe stellen muss. Nur „indirekt“, nur in einem „Kunstbild“
konnte sich deswegen das Ideal des Künstlers, seine Vision der Vollkommenheit zeigen,
um dann auf die Probe gestellt zu werden: ob sie seiner Künstler-Optik entsprechen und
in der Romanwelt wirklich werden könnte. Und wenn Dostojewskis Kunst die Welt nicht
als ein einheitliches Ganzes darstellen konnte, so deutete der Schriftsteller sein eigenes
Ideal in die Vision eines anderen um – in die Puschkins, des größten russischen
Dichters, der das unerreichbar hohe Ideal eines Künstlers für alle Zeiten bleibt.
Weder das Ideal des Gottmenschen noch die ihm innewohnende Moral der unbegrenzten Verantwortung, die von Dostojewski leidenschaftlich vertreten wurden,
konnten sich dabei auf eine vernünftige Begründung berufen. Sie beide implizierten
eine Entscheidung jenseits jeder Begründung, jeder Rechtfertigung, jeder Plausibilität. So deklarierte Dostojewski, er bekenne sich zur Gestalt des Erlösers, wenn der
Letztere auch außerhalb der Wahrheit stünde. Als Künstler demonstrierte er stets,
dass eine Moral, die dieser Gestalt fremd bleibt, zerstörerisch ist, dass die Wirklichkeit, die sie nicht zum Ausdruck bringt, fantastisch bleiben muss. Seine KünstlerOptik zeigte zwar nur diese fantastische und unerlöste Welt, sie erhielt aber (besonders in seinem letzten Roman Die Brüder Karamasow) die Hoffnung am Leben, dass
sie noch immer erlöst werden kann.
Wenn das Ideal nicht als siegend, nicht in der Gestalt eines Vollenders und
Erlösers gezeigt werden konnte, so wurde es von Dostojewski indirekt und negativ
immer wieder angedeutet: durch mehrere Gestalten, die ihm nicht entsprechen und
deswegen unvollkommen bleiben müssen. Es war nicht bloß der Gedanke über die
ewige Unvollkommenheit der Welt, sondern ein Verdacht, dass die vollkommene
Übereinstimmung mit dem Ideal in dieser Welt vielleicht nicht wirklich erwünscht ist,
wie das Glück, aber auch die Wahrheit. So schon der Kellerlochmensch:
Allerdings tut der Mensch weiter nichts, als daß er dieses ‚Zweimal zwei ist vier‘ sucht, bei diesem
Suchen Ozeane durchschwimmt und sein Leben opfert; aber es zu finden, es wirklich zu finden,
davor fürchtet er sich gewissermaßen, wahrhaftig. […] Das Streben liebt er, aber die Erreichung
nicht besonders, und das nimmt sich freilich furchtbar komisch aus. Kurz, der Mensch ist
komisch eingerichtet; es steckt in alldem offenbar ein Witz.313
313 Dostojewski, Aufzeichungen aus dem Kellerloch, S. 54.
4.4 Zusammenfassung
429
Diese komische Seite des Menschlichen wird als Kehrseite des Tragischen bei Dostojewski immer wieder offenbar. Gerade sie machte den Menschen zu einem fantastischen Wesen, das bei der „kränkenden Komik der menschlichen Widersprüche“
bleiben will. Und wenn er auch ein Ideal für sich gefunden hat, so kann er nicht
vergessen, dass es noch andere Ideale gibt, dass auch andere Wege offen stehen.
Dostojewskis moralisches Ideal bot somit keine Garantien. Dennoch konnte der
Schriftsteller mit ihm alle Plausibilitäten der abendländischen Moral aus Vernunft
zurückweisen, v. a. diejenigen, die fast zu derselben Zeit von Nietzsche kritisiert
wurden, wie der Wert des Willens zur Wahrheit, die Idee des höchsten Guts oder des
ewigen Friedens. Durch die Dialektik der Vernunft (v. a. die der praktischen Vernunft,
durch den Widerstreit der Vernunft mit ihrer höchsten Idee) wurde sie bei Dostojewskis Mensch selbstzerstörerisch: Sie verneinte die Wahrheit im Namen der Wahrheit, sie kämpfte gegen das Gute im Namen des Guten, sie wollte ihre Freiheit
beweisen, obwohl sie genau wusste, dass gerade dieses Beweisen-Wollen die eigene
Unfreiheit verrät. Alle ihre Ideale, das der irdischen und das der himmlischen Harmonie, wurden somit aufgehoben – im Sinne Nietzsches: Die von ihnen implizierten
Plausibilitäten wurden durch ihre äußerste Konsequenz unplausibel. Die Figur des
Teufels in den Brüdern Karamasow parodierte u. a. die cartesianische These: Er sei
sich seiner eigenen Existenz gewiss, weil er denke. Dennoch, da er in seinem Denken
mit Iwan einig ist, steht seine Existenz gerade in Frage; er ist vielleicht bloß eine
kranke Vision Iwans, deren Realität von diesem leidenschaftlich bestritten wird. Das
Kriterium der Existenz liegt so nicht im Denken, wie das der Moral nicht bloß im
Folgen der eigenen Moral liegen kann. Denn der Teufel Iwans, der sich zum einzigen
„Menschen“ erklärt, der „die Wahrheit liebt und aufrichtig das Gute zu tun wünscht“,
kehrte nicht nur die Logik von Descartes, sondern auch die von Goethes Mephistopheles und der kantischen Moral um: Wenn derjenige, der das Böse will, eventuell das
Gute tun kann, so stimmt das Umgekehrte auch – wer wahrhaftig gut sein will, tut
häufig nur das Böse. Die Geschlossenheit in den eigenen moralischen Vorstellungen,
v. a. der Eigendünkel der Vernunft, sie sei autonom, wird nach Dostojewski zur Quelle
des Bösen umgedeutet – als Trugbild der von den anderen Lebewesen abgesonderten
Individualität, als Lüge der individuellen Freiheit und der individuellen Verantwortung.
Auch die die letzten Konsequenzen ziehende Moralkritik, auch die „letzte“ Moral,
die eine Umwertung der Werte unternimmt, wäre somit nach Dostojewski (der Nietzsches Werke höchstwahrscheinlich nicht kannte) in den grundlegenden Plausibilitäten dieser Tradition verhaftet: im europäischen Glauben an die Grenzen des Individuellen, an den Gegensatz des Einzelnen und des Allgemeinen, an das Kriterium des
Moralischen, welches durch den Widerstand gegen die Wünsche des eigenen „Herzens“ gewonnen wird. Diesem Glauben ist der Begriff des selbstgesetzgebenden
Willens von Kant verpflichtet wie auch die sich selbst gegenüber ständig Verdacht
erregende Forderung der Selbstüberwindung Nietzsches. Die äußerste Unfreiheit der
in der eigenen Dialektik hoffnungslos gefangenen Vernunft und der von jeder Schuld
430
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
freisprechenden Moral sollte gerade dies als negative Plausibilität vor Augen führen:
Die Grenzen der getragenen Verantwortung für die Unterscheidung von Gut und Böse
haben immer schon die Grenzen der Individuen überschritten; die Freiheit, sei es auch
Freiheit eines „freien Geistes“, ist auf dem Weg der individuellen Moral nicht zu
finden, nur äußerste Unfreiheit, nur Wahn und Selbstzerstörung.
Den Gegensatz des Einzelnen und des Allgemeinen als bloße Summe der gegeneinander kämpfenden Individuen bestreitet Dostojewski leidenschaftlich als Publizist
und bietet dazu als Künstler immer neue Gegenbeweise. Die einzelne Schuld sei ein
Unding. Die moralischen Vorstellungen, die Gedanken, insbesondere die Wünsche,
stehen einem nicht frei. Nichtsdestoweniger: Indem der Mensch ihnen verfällt, beeinflusst er die Welt auf geheimnisvolle Weise und kann sich der Verantwortung für das
Böse, dessen Quelle nicht in seinem Willen, auch nicht im Gebrauch seiner Willkür
liegt, nicht entziehen. Das Böse ist (und dies ist eine interessante Parallele zu Tolstoi)
„ansteckend“, wie eine Krankheit. Es lässt keine Möglichkeit, nur bei dem Guten zu
bleiben. Ein Wunsch genügt, um das Gewissen für immer zu beunruhigen. Nicht nur
die Handlungen sind pathologisch bedingt, sondern auch die Maximen bzw. die
praktischen Vernunftprinzipien stehen einem nicht einfach zur Verfügung. Das Böse
zeigt sich gerade darin: durch die Unfreiheit der Tat, durch die Unverfügbarkeit der
Folgen von den durch einen Menschen vertretenen Prinzipien, von seiner Moral, von
der ihn beherrschenden Idee des Guten. Auch wenn man, wie Iwan Karamasow, die
Freiheit gegenüber der eigenen Moral bewahren, d. h. sie nicht in die Handlung umsetzen will, kann man es nicht verhindern, dass es ein anderer tut, dass ein anderer
Mensch diese Schuld auf sich nehmen wird (wie sein unehelicher Bruder Smerdjakow,
der dadurch zum Vatermörder wird). Dann muss man aber die doppelte Verantwortung tragen – nicht nur die eigene, sondern auch die fremde Schuld. Wie Iwan
Karamasow erfährt man nachträglich, dass man der eigentliche Täter ist, auch wenn
man nicht derjenige ist, der die Tat vollbracht hat, auch wenn man von ihr nichts
wissen konnte.
Das Kriterium in Dostojewskis Unterscheidung von Gut und Böse war damit von
vornherein perspektivisch. Das Böse äußert sich durch die Unfreiheit – die Unfreiheit
gegenüber den Folgen der eigenen Unterscheidung von Gut und Böse, die Unfreiheit
gegenüber der eigenen Moral. Dostojewskis Mensch ist zur Tat aus Unfreiheit wie zum
Tode verurteilt – zu einer Tat, die, wie bei Raskolnikow und Iwan Karamasow, seiner
Idee entspringt, welche ihn beherrscht und von ihm den bedingungslosen Gehorsam
verlangt. Die immer wieder von Dostojewskis Protagonisten beanspruchte Freiheit der
Willkür ist somit einerseits als Protest gegen alle Anmaßungen der Moral aus Vernunft
zu verstehen, andererseits aber wird dadurch der stetige Verdacht zum Ausdruck
gebracht, dass auch diese Rebellion bloß die Unfreiheit verrät, dass auch die immoralistische These „Alles ist erlaubt“ eine „Sanktion der Wahrheit“ nötig hat. Eine solche
„Sanktion“ kann jedoch nur noch eine quasi-ontologische „Begründung“ bekommen:
die Vorstellung von der sinnlosen Wiederholung von allem, was geschieht. Der
schwerste Gedanke Nietzsches, der Gedanke der ewigen Wiederkehr, wird bei Dosto-
4.4 Zusammenfassung
431
jewski als teuflische Seite und gleichzeitig letzte Konsequenz der Moral aus Vernunft
gedeutet. Die Freiheit von dieser Vision sowie die Freiheit gegenüber der Verschlossenheit in den eigenen moralischen Vorstellungen wird dem Einzelnen nur dann
gewährt, wenn er sich als Stätte des Bösen anerkennt und sich zu einem „Angeklagten“ für die Schuld der Welt macht. So wird der Einzelne zum Angelpunkt des Allgemeinen, dessen Schicksal von seiner Entscheidung abhängig ist. Und nur deshalb,
nur weil er sich zur nicht-individuellen Schuld bekennt, kann er den Weg zu sich
selbst finden.
Um den Weg des Guten antreten zu können, muss der Mensch, so Dostojewskis
„Kunstbild“, sich zur Schuld bekennen, die er nicht versteht, an die er in seiner
Unfreiheit nicht glauben kann. Die Strafe muss man auf sich nehmen, auch wenn die
Moral, die dies fordert, von den anderen ausgeht und für den Bestraften keine
Plausibilität ist, ja, keinen Sinn macht. Man kann dementsprechend das Recht und die
Moral, wie das Äußere der Tat und das Innere der Maxime, bei Dostojewski nicht
einander entgegensetzen – nicht wie bei Kant. Die Tat wird moralisch, die Moral
rechtlich verantwortet. Das heißt, dass die Strafe staatlicher Institutionen, wie ungerecht sie auch sein mögen, das Mittel ist, das Moralisch-Böse zu überwinden. Die
Ungerechtigkeit des irdischen Urteils (und dies geht direkt gegen Tolstois moralische
Ablehnung der institutionellen Gewalt) ist relativ und so gut wie unbedeutend, weil
es aus der Perspektive der nicht-individuellen Schuld keine Unschuldigen gibt und
nicht geben kann. Nicht bloß die Ungerechtigkeit des Leidens zu erdulden, sondern
vielmehr sie als gerechte Strafe für die Schuld der Welt auf sich zu nehmen, dies ist
der Ausweg aus der unerträglichen Situation der äußersten Unfreiheit gegenüber der
eigenen Idee, gegenüber der eigenen Moral, die einen zur Tat verurteilt hat. Diese
höchste Gerechtigkeit („праведность“) unterscheidet sich zwar grundsätzlich von
der irdischen („справедливость“), was auf lexikalischer Ebene im Russischen zum
Ausdruck kommt, bedient sich ihr aber.314 Nicht bloß die eigene moralische Verantwortung anzuerkennen, sondern auch die Strafe für den Verstoß gegen das Gute auf
sich zu nehmen, wäre die Tat der freien Liebe: der Liebe, die eine freie Übernahme der
Verantwortung fremder Schuld sein will. Sie ist frei, weil sie dies abgesehen von den
Folgen und abgesehen von der eigenen Einsicht in die „wirkliche“ Schuld tut, aber
auch weil alle Versuche, diesem Weg zu entgehen, die äußerste Unfreiheit bedeuten –
die Unfreiheit gegenüber der eigenen Moral und ihren Folgen. Der Weg der Vollkommenheit wird nur dem geöffnet, der die Schuld der Welt anerkennt und sich als erster
für sie bestrafen lässt.
314 Die Differenz zwischen den zwei Wörtern „праведность“ und „справедливость“ ist im Deutschen schwierig wiederzugeben. Das erste Wort bezieht sich auf Gott und die Menschen, die vor ihm
gerecht sind; das zweite auf die gesellschaftliche Gerechtigkeit, die die Menschen untereinander
ausüben. Diese grundlegende lexikalische Differenz lässt eine weittragende Bedeutung für die russische Kultur im Bezug auf das Thema der sozialen Gerechtigkeit vermuten.
432
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Dostojewski betont diese Formel viel zu oft, als dass wir sie im Sinne dieser Arbeit
für seine Plausibilität halten könnten. Sie ist gerade unplausibel, sie kann es nicht sein.
Sie verweist bloß auf die menschliche Gestalt von Gottes Sohn, zu dem Dostojewski
sich öffentlich bekennt – gegen die Wahrheit, gegen die Moral, gegen all die von ihm
zurückgewiesenen Ideale. Seine einzige Begründung ist die Schönheit dieses Ideals
und die Liebe zu ihm, die keiner Argumente bedarf und alle Gegen-Argumente als
unbrauchbar zurückweist. Als Folge dieser Hervorhebung der Liebe zur Schönheit des
eigenen Ideals gegen alle Plausibilitäten der Moral aus Vernunft wird bei Dostojewski
eine radikale Umkehrung der Logik dieser Moral vollzogen – eine Umkehrung des
moralischen Gesetzes, wie es in Verbrechen und Strafe zum Ausdruck kam: Der Mensch
solle stets überprüfen, ob er selbst das tun will, was er für richtig hält; und wenn er
seine Maxime nicht in die Handlung umsetzen kann, so sei sie auch nicht moralisch
gerecht. Diese Umkehrung führt zu einer weiteren Umkehrung des ästhetisch-moralischen Verhältnisses im Befolgen des Ideals: Das Gewissen ohne Gott könne sich nur
irren; die Moral solle stets mit dem Ideal der Schönheit überprüft werden; die Liebe, die
„Wünsche [des] Herzens“, seien der wahre Prüfstein für die Unterscheidung von Gut
und Böse. Die neue Freiheit angesichts der Unmöglichkeit, sich als spontanen Anfang,
als Urgrund, sei es der eigenen Maximen, Absichten, Wünsche oder der Handlungen,
zu deuten, wird nur dadurch möglich, dass man sich als Kampfplatz der Ideale versteht, als Schlachtfeld von Gott und Satan, die beide den Menschen, gerade als
ästhetisch-pathologisches Wesen, durch seine Liebe zur Schönheit, bewegen können.
Das Ideal der Schönheit fordert eine Entscheidung, die frei, d. h. abgesehen von allen
Argumenten, allen Forderungen der Moral und der Vernunft, getroffen werden müsste,
die sich niemals rechtfertigen könnte, und wenn, dann nur noch durch ein „Kunstbild“, welches, als Werk eines Künstlers, die Welt gewaltsam in den Ausdruck seines
Ideals umdeutet, welches den Sieg dieses Ideals in dieser Welt vor Augen stellt.
Und vielleicht besteht eben darin das größte Geheimnis des künstlerischen Schaffens, so dass
das Bild der Schönheit, das es hervorbringt, zu einem Idol wird, und das bedingungslos.315
Ein Ideal wird zu einem Götzen, dessen Dämmerung nur noch das Aufgehen eines
neuen Ideals, eines neuen Idols, bedeuten kann. So lautet Dostojewskis früh ausgesprochenes Verständnis der eigenen Berufung:
Die Philosophie darf nicht als eine einfache mathematische Gleichung betrachtet werden, in der
die Natur das Unbekannte ist… Merke Dir [so Dostojewski an seinen Bruder Michail – E.P.], dass
der Dichter im Augenblick der Inspiration Gott errät, folglich die Aufgabe der Philosophie erfüllt.
Folglich ist die poetische Erregung nichts anderes als philosophische Erregung… Folglich ist die
Philosophie nichts anderes als Poesie, bloß die höchste Stufe der Poesie!..316
315 Достоевский, Ряд статей о русской литературе, S. 80.
316 Brief an Michail M. Dostojewski vom 31. Oktober 1838 (DGA 28 (Teil I), S. 54). In diesem frühen
Brief an seinen Bruder versucht Dostojewski, ihm seine Sicht auf die Philosophie beizubringen, d. h.
4.4 Zusammenfassung
433
Seinen Gott zu erraten und als Ideal der Schönheit in den Maßstab der Wirklichkeit
umzudeuten, ist nach Dostojewski die gemeinsame Aufgabe der Kunst und der Philosophie.
Mit seiner Schriftstellerkunst versucht Dostojewski, sein Ideal als wirklich bzw.
als in der Welt wirkend darzustellen. Er versucht, einen wahrhaftig „positiv-schönen
Menschen“ zu schaffen, der die Welt von der Schuld und dem Leiden erlösen kann,
der somit das Antlitz Christi zeigen kann – des Unschuldigen, der die Schuld der Welt
als gerechte Strafe für alle Missetaten, für alles Leiden und Unglück auf sich genommen hat, der deshalb allein alle Schuld vergeben kann. Dostojewskis Myschkin war
ein solcher Versuch, das Ideal in einem „Kunstbild“ darzustellen. Er ließ ihn dennoch
in jeder Hinsicht scheitern. Denn indem Myschkin zwei Positionen – die göttliche, alle
Gründe durchschauende und alles vergebende, die Position eines Zuschauers, einerseits und die Position eines zur Handlung herausgeforderten Menschen andererseits –
in sich vereinbaren wollte, brachte er die Welt und v. a. seinen eigenen Verstand zum
Absturz. Für einen Menschen, sogar wenn er äußerst vernunftbegabt ist (und das ist
der Fürst Myschkin tatsächlich, was im Roman mehrmals betont wird), erwies sich der
Anspruch auf die alles vergebende Position, die gütige und durchaus vernünftige
Einsicht in die Gründe und Gründe der Gründe für alle Missetaten, für alle Vergehen
nur noch als Größenwahn und Einbildung eines Idioten – eine Einbildung, Gott zu
sein, eine Anmaßung, man müsse die Herausforderung des Lebens nicht ernst nehmen, wie Myschkin die Herausforderung der Liebe nicht ernst nahm. Denn er dachte,
er könne zwei Frauen „mit zwei […] verschiedenen Lieben“ lieben – einer moralischvernünftigen, die die Unglücklichere vorzieht, und einer ästhetisch bedingten, die
auch ihre Rivalin nicht loslassen will und Verständnis von ihr verlangt. Indem
Myschkin alle „versteht“ und allen Mitleid entgegenbringt, macht er sich also der
äußersten Grausamkeit schuldig – ein Gedanke, welcher im Finale des Romans deutlich zum Ausdruck kommt. Indem dieser „Fürst-Christus“ (eine paradoxe Benennung
in Dostojewskis Notizen zum Roman) allen ihre Schuld abspricht und ihnen verzeiht,
vermehrt sich das Böse, bis es zum Mord und zum Wahnsinn kommt. Die fantastische
Welt im Sinne Dostojewskis (d. h. im Sinne der fantastisch-inszenierten und dennoch
völlig ernst zu nehmenden Wirklichkeit), aber auch im Sinne Kants (d. h. die Welt, in
der die Idee des Guten eine „phantastisch“-irreale Zumutung wäre) bleibt somit
unerlöst. Die „Liebe mit sehenden Augen“, die jeden von Schuld freispricht (nach der
Nietzsches Zarathustra suchte), ist nach Dostojewski kein Weg des Lebens. Die Güte
des Herzens sei nicht genug, um die Welt zu erlösen. Als Künstler zeigte er, dass der
„positiv-schöne“ Mensch bloß ein Idiot ist, ein falscher Gott, ein Anti-Christus. Wie
der Menschgott, der aus Iwans Dialektik entstand, oder wie Kirillow aus den Dämonen, der sich seine Göttlichkeit durch den Selbstmord beweisen musste, stellte
vor allem nicht „im Sinne der heutigen Philosophie“ mit ihren „sinnlose[n] philosophische[n] Systeme[n]“.
434
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
Myschkin das Ideal nur negativ dar: Auf diesem Weg kann die Welt niemals zu „einem
schönen moralischen Ganze[n]“ gebracht werden.
Der unlösbare Konflikt dieser zwei Positionen, der göttlichen und der menschlichen, erwies sich darüber hinaus als Konflikt des Guten und des Schönen. In der
Gestalt des „positiv-schönen“ Menschen trafen sie sich und richteten die Schönheit
zugrunde (die das gütige Mitleid und die leidenschaftliche Liebe erregende schöne
Frau). Die Herausforderung, die von der Schönheit ausging und laut Myschkin die
Welt erlösen sollte, zeigte sich dabei bedrohlich und zerstörerisch. In einer pluralistischen, aufgespaltenen Welt, angesichts der Unbegründbarkeit des eigenen Ideals,
konnte das Schöne nicht mehr als Symbol des Sittlich-Guten gedeutet werden. Die
Schönheit bot nach Dostojewski keine symbolische Verdeutlichung der Moral aus
Vernunft an, wie die Liebe keine Ergänzung der Moralität. Das „Kunstbild“ zeigte
nicht bloß ein Ideal, es sollte den dramatischen Kampf der Ideale aufzeigen, in dem
die Schönheit des Guten der Schönheit des Bösen gegenübersteht, die man beide
lieben und begehren kann. Mehr noch: Die Schönheit allein, so Dostojewski in
seinem letzten Roman Die Brüder Karamasow, spaltet die Welt in das Gute und das
Böse. Gerade dadurch ermöglicht sie aber eine „freie Erkenntnis des Guten und des
Bösen“, eine freie Entscheidung für ein Ideal der Schönheit, das Alternativen hat.
Denn nur wenn das Gute und das Böse als Gegensätze gegeben sind, wenn sie den
„Wünschen [des] Herzens“ als zwei Extreme und zugleich als verlockende Optionen
offenstehen, kann man zwischen ihnen frei entscheiden. Es ist nicht mehr die
Metaphysik, sondern die Schönheit, die die Welt verdoppelt und zum Kampf aufruft. Die Wirklichkeit wird durch sie selbst zu einer „Zeichensprache“, die den Gott
des Künstlers erraten lässt. Die Schönheit wird zum Zeichen der Erlösung vom Bösen der Unfreiheit, von Wahnsinn und Selbstzerstörung, sie wird zum Zeichen des
Lebens.
Das ist nach Dostojewski das Privileg eines Künstlers, den Weg zwischen der
bloßen Faktizität und der unerträglichen Komplexität zu bahnen, die Wirklichkeit zu
vereinfachen, d. h. zu einer Ordnung zu bringen, die sie in die Zeichensprache der
Ideale verwandelt. Der Künstler trennt damit das, was im Leben nicht zu trennen ist:
die Illusion und das Wahre, das Fantastisch-Inszenierte und die Wirklichkeit.
Das Phantastische muss die Realität so nahe berühren, dass Sie ihm fast glauben werden.317
In diesem „fast“ besteht die Bestimmung des Künstlers. Die Freiheit, die jenseits der
Dialektik der Vernunft und der Logik der Willkür liegt, ist die Freiheit eines Künstlers
zur schöpferischen Umdeutung eines Ideals in den Sinn der Wirklichkeit. Aber in
jedem Menschen lebt so ein Künstler, der sich selbst als Kunstwerk betrachtet. Denn,
so Dostojewski in seinem Notizheft:
317 Brief an J.F. Abas vom 15. Juni 1880 (DGA 30 (Teil I), S. 192).
4.4 Zusammenfassung
435
Der Mensch lebt sein ganzes Leben nicht einfach, sondern er erdichtet sich, er erdichtet sich
selbst.318
Die Erkenntnis des Guten und des Bösen, zu der die Kunst eines solchen Künstlers
aufruft, ist nicht als ein erworbenes Wissen zu verstehen, sondern nur noch im Sinne
eines Kennenlernens – eines immer neuen Antreffens des geliebten Ideals der Schönheit, das durch die anderen Menschen, aber auch durch das eigene Leben repräsentiert oder aber verfehlt werden kann.
Dostojewski bestimmte die Aufgabe der Kunst so im Sinne Nietzsches, aber auch
anders als er. Es ist das Tragische, zu dem der Künstler und der Philosoph privilegiert
sind, sie beide müssen die „kränkende Komik der menschlichen Widersprüche“
ertragen können. Aber bewusst in der Illusion bleiben kann man nach Dostojewski
nur in einem Fall: Wenn diese Illusion seine tiefste Liebe ist, wenn man also nichts zu
ertragen hat, sondern gerade den tiefsten „Wünschen seines Herzens“ vertrauen
kann. Dostojewski weist so nicht nur die Ideale der Moral aus Vernunft, sondern auch
Nietzsches Selbstüberwindung als Kriterium eines Ideals zurück. Für die Liebe gibt es
kein Kriterium, denn durch sie werden erst alle Kriterien erschaffen. Sie widersetzt
sich allen Plausibilitäten, auch den Plausibilitäten der „letzten Moral“. Oder vielmehr:
Sie errät unter ihnen auch noch ein Ideal, ein Idol, eine Liebe. Und wenn die Optik des
Künstlers seiner eigenen Liebe widerspricht, so will er den Gegenstand der letzteren
zumindest negativ darstellen: als Zurückweisen aller anderen Plausibilitäten, als
seine persönliche unbegründete Hoffnung, dass diesem Ideal die Zukunft gehört.
Dostojewski weist immer wieder auf seine Vision des allversöhnenden Russlands
hin, das gerade durch die Extreme seiner Leidenschaften, aber auch durch seinen
Glauben an den „russischen Christus“ die Welt erlösen wird – und dies nur noch
durch die Kraft der Liebe, durch die Schönheit seines Ideals. Dies wird sein Schicksal
sein, wenn es selbst an dem von ihm ausgetragenen Kampf nicht zugrunde geht,
wenn die schlimmsten Abgründe der nihilistischen Selbstzerstörung das Land nicht
verschlucken werden. Dieses „wenn“ bleibt bei allem Pathos Dostojewskis bestehen.
Denn als Künstler konnte er den Zweifel nicht völlig unterdrücken, dass auch diese
Vision bloß eine Hoffnung bleiben muss, dass auch dieses Ideal „phantastisch“ ist.
Kaum zufällig nannte er sich „Dichter des Kellerlochs“.
Die Ursache des Kellerlochs ist der Untergang des Glaubens an allgemeine Regeln. ‚Es gibt nichts
Heiliges‘.
Diese Kraft ist eine russische Kraft, in Europa sind die Menschen geradliniger, bei uns aber
sind sie Schwärmer und Schufte. (DGA 16, S. 330)
Diese Kraft, so steht weiter in Dostojewskis Notizbuch, zwinge die ernsthaftesten
Menschen zu „lügen und den Hanswurst zu spielen“. Dies stimme z. B. für einen an-
318 Богданов (Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве, S. 461.
436
Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft
deren großen russischen Schriftsteller, Nikolai Gogol, mit dem Dostojewski sich
gerade als Künstler, d. h. in dem, was seine Künstler-Optik angeht, viel tiefer verbunden fühlte als mit dem von ihm so sehr geliebten Puschkin.319 Auch ein Künstler,
so Dostojewskis tiefster Verdacht, ist vielleicht ein solcher „Schwärmer und Schuft“.
Denn wenn er sich auch öffentlich zu seinem Ideal bekennt, demonstriert seine
„Optik“ zugleich, dass es kein „letztes“ Wort gibt, keine letzten Plausibilitäten geben
kann.
319 Vgl. die Reaktion von der größten literaturkritischen Autorität Russlands, Wissarion Belinski, auf
Arme Leute. Er nannte Dostojewski „den neuen Gogol“ – eine Einschätzung, die für Dostojewski auch
später, ungeachtet der ideologischen Kontroversen mit Belinski, als höchstes, ermutigendes Lob in
bester Erinnerung blieb (s. dazu bspw. Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, S. 19 f.). Seine
Puschkin-Rede begann Dostojewski mit einem Zitat Gogols (DGA 26, S. 136).
Kapitel 5.
Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
Die Untersuchung der vier Autoren, die sich mit der Begründung der Moral aus
Vernunft und mit ihrer Kritik beschäftigten, darf jetzt als abgeschlossen betrachtet
werden. Nun soll ein Blick auf die historisch nachweisbaren Verhältnisse geworfen
werden, um auch sie für die Interpretation der entsprechenden Differenzen fruchtbar
zu machen. Die Plausibilitäten des jeweiligen Autors, wie bereits mehrfach betont,
werden nur aus einer anderen Perspektive sichtbar. Die Rezeption, die, wie bei Nietzsche, die Entdeckung der tiefsten Seelenverwandtschaft und gleichzeitig die Feststellung der grundlegenden Fremdheit bedeutete, bringt gerade die von uns erforschte Differenz der Plausibilitäten deutlich zum Ausdruck.
Es ist bemerkenswert, dass Nietzsches Entdeckung der russischen Autoren und
die Entdeckung Nietzsches in Russland praktisch zur gleichen Zeit stattfanden. Die
enorme Popularität Nietzsches in Russland ist dabei nur noch mit der Popularität von
Marx vergleichbar. Der Kontrast zu Kant ist auffallend. Wenn Kant in Russland auch
aufmerksamer als Nietzsche gelesen wurde, so blieb er der russischen Grundeinstellung doch bis zu dem Grad fremd, dass eher von einem Anti-Kantianismus die Rede
sein muss. Diese zwei merkwürdigen Phänomene – die begeisterte Nietzsche-Rezeption vonseiten der russischen religiösen Denker und die Ablehnung Kant gegenüber
vonseiten der Moralphilosophen – verdienen zweifelsohne besondere Aufmerksamkeit und wurden mehrmals zum Gegenstand gründlicher Untersuchungen. Hier können nur die Ergebnisse kurz skizziert werden.
Im Jahr 1794 wurde Kant zum Ehrenmitglied der Petersburger Akademie der
Wissenschaften gewählt.1 Manche russische Intellektuelle, wie der Schriftsteller und
Historiker Nikolai M. Karamzin, haben Kant in Königsberg besucht und begeistert
1 Zum Thema „Kant und Russland“ sind v. a. folgende Untersuchungen zu beachten: Nelly Motroschilowa, Kant in Rußland. Bemerkungen zur Kant-Rezeption und -Edition in Rußland anläßlich des Projekts
einer deutsch-russischen Ausgabe ausgewählter Werke Immanuel Kants; Захар А. Каменский (Zachar
A. Kamenski), Кант в русской философии начала XIX в. (Kant in der russichen Philosophie am Anfang
des 19. Jh.); Захар А. Каменский (Zachar A. Kamenski), Кант в России (конец XVIII – первая
четверть XIX в.) (Kant in Russland (Ende des 18.–erstes Viertel des 19. Jh.)); Захар А. Каменский
(Zachar A. Kamenski), (Hg.), Кант и философия в России (Kant und die Philosophie in Russland).
Besonders repräsentativ ist die folgende kommentierte Sammlung: Александр И. Абрамов, Владимир
А. Жучков (Aleksandr I. Abramow, Wladimir A. Zhutschkow) (Hg.), Кант: Pro et contra. Рецепция
идей немецкого философа и их влияние на развитие русской философской традиции. Антология
(Kant: Pro et contra. Die Rezeption der Ideen des deutschen Philosophen und ihr Einfluss auf die Entwicklung der russischen philosophischen Tradition. Anthologie). S. bes. den Kommentar von Zhutschkow
(S. 828–924). Zu den philosophisch bedeutsamen Untersuchungen des Themas s. Анатолий В. Ахутин
438
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
dem russischen Publikum von ihren Gesprächen berichtet.2 Dennoch, schon 1805, ein
Jahr nach Kants Tod, erschien das Buch von Alexander Lubkin Briefe über die kritische
Philosophie, das eine scharfe und größtenteils sehr oberflächliche Kritik an Kant zum
Ausdruck brachte. Erst danach folgten tiefgreifendere Wiedergaben und Analysen
von Kants Philosophie, wie z. B. die des russischen Philosophiehistorikers Aleksander
Galitsch,3 dem wegen seiner aufklärerischen Ansichten das Unterrichten untersagt
wurde. Später wurden solche Untersuchungen immer zahlreicher.4 Was die Übersetzungen von Kants Werken betrifft, so kam es erst in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zum Durchbruch. In ungefähr dieselbe Zeit fällt auch der Aufschwung
der russischen Kant-Forschung.
Die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die Epoche, in der die russische Philosophie den Anspruch auf Selbstständigkeit erhebt und sich vom ‚westlichen‘ Einfluss zu emanzipieren sucht,5 zeitigte eine scharfe Kontroverse mit Kants kritischer
Philosophie. Freilich gab es auch russische Kantianer, wie Aleksander I. Wwedenski
und Iwan I. Lapschin. Aber im Großen und Ganzen darf man von einer „besonderen
Idiosynkrasie“ des russischen Denkens gegenüber Kants Philosophie sprechen, wobei
ihre positive Aneignung den Rahmen der Schulphilosophie nicht überschritten hat.6
Dies trifft allerdings nicht auf den Neukantianismus zu, der gerade um die Jahrhundertwende besondere Popularität unter den russischen Intellektuellen genossen hat. Die Werke von Hermann Cohen, Paul Natorp und Heinrich Rickert werden
nicht nur für Philosophen, sondern auch für Künstler maßgebend. Mehrere russische
Intellektuelle strömen nach Marburg und Baden, unter ihnen solche berühmten
Dichter wie Boris Pasternak und Andrej Bely.7 Der Letztere hielt sich selbst wie auch
(Anantoli W. Achutin), София и Черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики),
(Sophia und Teufel (Kant angesichts der russischen religiösen Metaphysik)).
2 S. dazu z. B. Арсений Гулыга (Arseni Gulyga), Кант (Kant), S. 190 ff.
3 Gemeint ist seine Geschichte der philosophischen Systeme, nach den ausländischen Unterweisungen
zusammengestellt (1818–1819).
4 Erwähnenswert sind z. B. die gründlichen Untersuchungen kantischer Philosophie des russischen
Philosophen und Vertreter des philosophischen Theismus Pamphil D. Jurkevitsch. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts verdient die Darlegung von Kants Moral- und Rechtsphilosophie durch den russischen
Philosophen und Rechtswissenschaftler Pawel I. Nowgorodtsew Aufmerksamkeit.
5 Diese Epoche hat auch den Namen des Silbernen Zeitalters der russischen Kultur bekommen.
Tatsächlich war es die Blütezeit der Künste und der Philosophie.
6 Diese Meinung wird im Beitrag Achutins philosophisch fundiert. Vgl. Ахутин, София и Черт, S. 51.
Historische Studien zu der Frage bestätigen diese Einschätzung (s. die Literaturhinweise oben).
7 Der russische Neukantianismus ist ein weiteres Thema. Zu den Neukantianern sind nicht nur solche
für die russische Kultur bedeutsamen Figuren wie Andrej Bely, Sergej I. Gessen, Iwan I. Lapschin,
Fjodor A. Stepun zu rechnen, sondern auch einer der brillantesten Interpreten der Antike, der Philosoph Aleksej F. Losew. Zum wichtigsten Blatt des russischen Neukantianismus wurde die Zeitschrift
Logos, die in den Jahren 1910 bis 1914 erschien. Das Ziel dieser Ausgabe war die Entwicklung und
Verbreitung der neukantianischen Ideen, ihr Schwerpunkt wurde als Philosophie der Kultur definiert.
Sie enthielt auch u. a. eine scharfe Polemik gegen die Vertreter der russischen religiösen Philosophie,
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
439
die anderen Vertreter des sog. Symbolismus in der Poesie für eines der „durch
Schopenhauer und Nietzsche legitimen Kinder des großen Königsbergschen Philosophen“.8 Dieser Hinweis auf zwei weitere Figuren der deutschen Philosophie war
allerdings für die russische Kant-Rezeption vielsagend.9 Wie ein anderer Nachfolger
Kants bemerkte, gebe es in Russland keine „rechtgläubigen Kantianer“, denn Kants
Philosophie habe eine Besonderheit: Jeder, der „mit ihrem Geist erfüllt wird, wird
auch mit einem Wunsch erfüllt, über sie hinauszugehen“.10 Und dies taten die
russischen Rezipienten Kants vielleicht viel zu schnell. Sein Denken betrachteten sie
bestenfalls als eine Art Brücke zu neuen Horizonten.11 Im schlimmeren Fall fungierte
er als Wegweiser in eine Sackgasse, als ein negativer Hinweis, der bezeugte, dass man
sich in eine andere Richtung bewegen soll. Derselbe Andrej Bely, der sich zum Kind
des Königsbergschen Philosophen erklärt hatte, hat Kant nur einige Jahre später „die
Stummheit unter der Maske der Worte, eine böse Maske“12 genannt und den ganzen
Neukantianismus als „Idiotie“13 bezeichnet.
Was war aber so irritierend für die russischen Denker und Dichter, dass sogar
begeisterte Anhänger am Ende zu scharfen Gegnern Kants geworden sind?14 Oder,
anders gefragt, warum wurde gerade Kant zum Gegner, an dessen Beispiel die russische Philosophie ihre eigene Selbstständigkeit nachweisen wollte? Was machte sein
die sich um eine andere Zeitschrift, Put’ (Der Weg), gruppiert haben. S. dazu Александр И. Абрамов
(Aleksandr I. Abramow), О русском кантианстве и неокантианстве в журнале „Логос“ (Über den
russischen Kantianismus und Neukantianismus in der Zeitschrift „Logos“). Nach Abramow ist allein
Wwedenski konsequenter Kantianer geblieben (S. 762). S. auch Н.А. Дмитриева (N.A. Dmitrijewa),
Кантианство на рубеже XIX–XX веков: К истории неокантианских школ в России (Der Kantianismus um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: Zur Geschichte der neukantianischen Schulen in
Russland); Л.И. Филиппов (L.I. Filippow), Неокантианство в России (Der Neukantianismus in Russland).
8 Андрей Белый (Andrej Bely), Критицизм и символизм (Kritizismus und Symbolismus), S. 556.
9 Später, im Jahr 1915, wird Wladimir F. Ern Kant in Beziehung zum deutschen Militarismus setzen
und dabei behaupten, Kants Philosophie sei eine „Predigt des Willens zur Macht“ gewesen (Владимир
А. Жучков (Wladimir A. Zhutschkow), Комментарии и примечания (Kommentar und Anmerkungen),
S. 919).
10 Павел И. Новгородцев (Pawel I. Nowgorodtsew), Кант как моралист (Kant als Moralist), S. 553.
11 Die Forschung betont die Rolle Kants z. B. in der Überwindung des Marxismus bei Philosophen, wie
Pjotr Struwe, Nikolai Berdjajew, Sergej Bulgakow und Semjon Frank. S. dazu: Абрамов, О русском
кантианстве и неокантианстве, S. 764; С.А. Чернов (S.A. Tschernow), Критицизм и мистицизм
(Kritizismus und Mystizismus), S. 821 ff.
12 Андрей Белый (Andrej Bely), Искусство (Die Kunst), S. 241.
13 Андрей Белый (Andrej Bely), Круговое движение. Сорок две арабески (Zirkelbewegung. Zweiundvierzig Arabesken). Nicht mehr Kant, sondern der Anthroposoph Rudolf Steiner wird zu seinem ‚Vorfahren‘, seine Begeisterung für Nietzsche lässt allerdings nicht nach.
14 Achutin zeigt überzeugend, dass diese Kritik die Grenzen einer wissenschaftlichen Polemik weit
überschritten hat, indem Kant buchstäblich dem Teufel selbst gleichgesetzt wurde. Man denke dabei
nicht zuletzt an den Teufel aus den Brüdern Karamasow, der dem Dialektiker Iwan als Fieberphantasie
erschien (Ахутин, София и Черт, S. 52 f.).
440
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Denken zum Prüfstein einer solchen Selbstständigkeit? Die Einwände gegen Kant sind
im Laufe eines Jahrhunderts fast dieselben geblieben. Als Vertreter des ‚westlichen‘
Rationalismus, der an die Vernunft glaube und das Leben zu einer logischen Konstruktion herabsetze, wolle Kant den Menschen ins Gefängnis der Phänomene „einkerkern“15 und das Leben nicht als „organisches Ganzes“ betrachten, sondern in zwei
Welten (die der Noumena und die der Phaenomena) spalten.16 Diese Spaltung trage
Kant auch in den Menschen hinein, indem er ihn, als erkennendes und handelndes
Subjekt, zwei unterschiedlichen und einander widersprechenden Prinzipien unterwirft. Stattdessen berufen sich die russischen Philosophen auf das „lebendige Bewusstsein“ des Menschen (Wladimir Solowjew),17 auf eine „lebendige Intuition“
(Nikolai Losski),18 die nicht bloß zur Erkenntnis der Natur (dies ist für die russischen
religiösen Denker zu Beginn des 20. Jahrhunderts keine dringende Aufgabe), sondern
zur Erkenntnis Gottes und der eigenen göttlichen Bestimmung führt. Mehr noch: Dem
Rationalismus Kants wurden direkt Gottlosigkeit und latenter bzw. hinterlistiger
Atheismus vorgeworfen.19 Dieser Vorwurf ist auf bemerkenswerte Weise die Umkehrung von der uns schon bekannten Einschätzung Nietzsches, Kant sei ein hinterlistiger Theologe gewesen, der das Christentum, indem er es anscheinend angriff, gerade
rettete – zur Freude der protestantischen Theologen des Tübinger Stifts, die sich als
Philosophen ausgegeben haben (JGB 11, KSA 5, S. 24 f.). Nach Nietzsche konnte die
Reformation allerdings selbst als Vorstufe zur Selbstaufhebung des Christentums
betrachtet werden – durch ihre Forderung der Wahrhaftigkeit und der Hervorhebung
des Gewissens als letzter richtender Instanz. Die russischen Denker folgen Nietzsche
15 Vgl. Василий Н. Карпов (Wasili N. Karpow), философский рационализм новейшего времени
(Der philosophische Rationalismus der Neuzeit), und Николай А. Бердяев (Nikolai A. Berdjajew),
Опыт эсхатологической метафизики (Ein Versuch über die eschatologische Metaphysik).
16 Dieses Argument, wie das erste, wird in der russischen Philosophie mehrmals variiert. Vgl.
z. B. den Enzyklopädiebeitrag aus dem Jahr 1886 von Сильвестр С. Гогоцкий (Silwestr Gogotski),
философский лексикон. Кант (Philosophisches Lexikon. Kant). Manche russische Philosophen behaupten dabei die Möglichkeit der Erkenntnis der „Dinge an sich“. Vgl. z. B. Лев М. Лопатин (Lew
M. Lopatin), Учение Канта о познании (Kants Lehre über die Erkenntnis).
17 Владимир С. Соловьев (Wladimir S. Solowjew), Кант (Kant).
18 Nikolai Losski ist der Autor einer renommierten Übersetzung der Kritik der reinen Vernunft ins
Russische. Als Schüler von Aleksander Wwedenski war er einer der größten Kant-Kenner Russlands.
Seine Kritik an Kant ist tiefgreifend und vielschichtig. S. z. B. Николай О. Лосский (Nikolai O. Losski),
Гносеологический индивидуализм в новой философии и преодоление его в новейшей философии
(Der gnoseologische Individualismus in der Philosophie der Neuzeit und seine Überwindung in der Philosophie der Neuesten Zeit). Die Intuition als „ahnendes Bewusstsein“ wurde auch von den weniger
berühmten Denkern als Vermögen zur Erkenntnis der objektiven Wahrheit behauptet. Vgl. Александр
И. Боркович (архиепископ Никанор) (Aleksander I. Borkowitsch (Erzbischof Nikanor)), Критика на
„Критику чистого разума“ (Kritik an der „Kritik der reinen Vernunft“).
19 Der Vorwurf galt auch Descartes, wobei man sich öfters auf Platon, aber auch auf Leibniz, Hegel
und besonders auf Schelling als Alternative zu diesem Rationalismus berufen hat. Kant wird als
Vollender und Vervollkommner des Rationalismus betrachtet.
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
441
in diesem Punkt, wenn auch in einer anderen Absicht. Solche Vertreter der russischen religiös-orthodoxen philosophischen ‚Renaissance‘ wie Wladimir Solowjew,
Lew Schestow, Nikolai Fjodorow oder Pawel Florenski betrachten den Protestantismus als Weg zum Atheismus bzw. zu einer rational-verkürzten, subjektivistischen
Auffassung des Menschen, die ihn gegen die metaphysischen Herausforderungen am
Ende völlig verschließt. Kant wird dementsprechend eine protestantische Beschränktheit in der Deutung der religiösen Fragen vorgeworfen, die am Ende zur Gottlosigkeit
führen muss. Die Vernunft, als autonome Instanz verstanden, könne sich nur irren.
Denn (und man erkennt in diesem Argument u. a. die Thesen Schopenhauers und
Nietzsches) sie sei selbst bloß ein Werkzeug, das in seinem Größenwahn seine
Abhängigkeit, seine sekundäre Natur verkennt. Die Vernunft sei sekundär, weil das
erkennende Subjekt von dem Ganzen der Welt, u. a. von dem eigenen Leib, vom
Leiden und Begehren, von den Hoffnungen und von der Liebe nicht zu trennen ist.
Das Getrennt-Sein von der Welt und von den anderen Lebewesen, so die russische
Philosophie, sei eine Einbildung und ein Mangel, zu dessen Überwindung der Mensch
berufen ist. Dies war, wie oben dargetan wurde, die Ansicht Dostojewskis, aber auch
(nicht ohne seinen Einfluss) die Nikolai Berdjajews. Dies war auch die Grundlage der
russischen Idee „Sobornost’“, die von den Vertretern der sog. Slawophilie, Alexej S.
Chomjakow und Iwan W. Kireewski, vorgetragen wurde. Die sündhafte Tendenz, die
Einseitigkeit des Rationalismus, des Individualismus und des Atheismus, sei nur
durch die Idee der kirchlichen Gemeinschaft zu überwinden.20 Nicht Kant, sondern
Hegel und merkwürdigerweise Schopenhauer und Nietzsche wurden hier als Alliierte
betrachtet.
Weder die kopernikanische Wende noch die Maxime der Aufklärung scheinen
somit für die russische Kultur aktuell zu sein. Kants Bemühungen, den dogmatischen
Ansprüchen der Vernunft Grenzen zu setzen und die Vernunft des Einzelnen auf ihre
ästhetische Beschränkung aufmerksam zu machen, werden in Russland, wenn nicht
völlig übersehen, so doch als historisch überholt angesehen, wobei oft bloß ein Rückfall der russischen Denker in den Dogmatismus festzustellen ist. Die ästhetische
Distanz zwischen meiner und der fremden Vernunft haben sie einerseits philosophisch
ignoriert, indem die Möglichkeit eines bloß objektiven Fürwahrhaltens behauptet
wurde, andererseits wurde Kant gerade dieses Ignorieren vorgeworfen. Freilich gab es
auch unter den russischen Kant-Gegnern diejenigen, die Kant gründlich studiert und
verstanden haben, wie z. B. Wladimir Solowjew, der in seiner Kritik an Kant keines-
20 Der Begriff „Sobornost’“ stammt von dem Wort „Konzil“ (собор). Er implizierte allerdings nicht nur
die Idee der Einheit der kirchlichen Gemeinde, sondern auch die der russischen Bauerngemeinschaft,
d. h. die Sitten und den Ethos der traditionell-patriarchalen russischen Gemeinden, die dem ‚westlichen‘ Individualismus entgegengesetzt wurden. Der Begriff stand für die besondere Einheit des
russischen Volks. Zum Thema gibt es umfangreiche Literatur. S. z. B. Сергей С. Хоружий (Sergej
S. Choruzhi), После перерыва. Пути русской философии (Nach dem Umbruch. Die Wege der russischen Philosophie).
442
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
falls oberflächlich war, sondern Kants Grundannahmen einer kritischen Untersuchung unterwarf. Eine weitere bemerkenswerte Ausnahme unter den Stimmen, die
Kant für seinen Dualismus und Rationalismus tadelten, stellt der in den vorigen
Kapiteln mehrmals erwähnte russische Publizist und Literaturkritiker Nikolai N. Strachow dar, der Mitarbeiter Dostojewskis (in den Zeitschriften Die Zeit und Die Epoche)
und mehrere Jahre naher Korrespondent Tolstois gewesen ist. Seine Deutung der
Philosophie Kants äußerte er nur in manchen kritischen Aufsätzen, in denen er sich
freilich meistens einer metaphorisch-bildlichen Sprache und keiner klaren und konsequenten Argumentation bediente. Dennoch bezeugen diese Ausführungen sein
tiefes Verständnis von Kants ‚Wende‘ in der Philosophie, v. a. von der Aufgabe der
Vernunft, die sich als Mittelpunkt der Kritik versteht. Bei Kant habe sich, so Strachow,
das Denken befreit, indem es zum Gegenstand der Untersuchung gemacht worden
war. Damit sei das wahre Rätsel des Daseins zum ersten Mal zum Ausdruck gekommen: Die Welt ist nicht das Produkt des Subjekts, aber ebenso wenig ist das Subjekt
das Produkt der Welt. In dieser Beschreibung der rätselhaften conditio humana und
nicht in einer ‚Erkenntnistheorie‘ liege der größte Verdienst Kants als Philosoph.21
Stimmen wie die von Strachow waren in der russischen Kultur immer präsent,
aber sie waren stets schwächer als die von Kants Gegnern. Nicht nur Kants ‚Erkenntnistheorie‘ bzw. seine Zerstörung der Metaphysik22 irritierte die russischen Denker.
Auch Kants Moralphilosophie lieferte weitere Angriffspunkte zu seinem ‚Rationalismus‘.23 Kants Geständnis aus der zweiten Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft, er
„mußte […] das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“ (KrV B XXX),
haben die russischen religiösen Philosophen freilich ohnehin als Entscheidung zugunsten des religiösen Glaubens interpretiert. Dennoch redeten die schärfsten (und
parteiischsten) unter ihnen von Unmoralität und sogar von Moralitätswidrigkeit des
kategorischen Imperativs sowie der Moral in Kants Auffassung überhaupt.24 Gute
Kant-Kenner, wie Lew Lopatin, waren zwar vorsichtiger im Ausdruck und tiefgreifender in ihrer Analyse, äußerten im Prinzip aber dieselbe Meinung: Kant sei an der
21 Vgl. Николай Н. Страхов (Nikolai N. Strachow), Философские очерки. Главная черта
мышления (Philosophische Essays. Hauptzug des Denkens).
22 Nicht nur die Zerstörung der Metaphysik, auch die Zerstörung der Vernunft wurde Kant mehrmals
vorgeworfen. So behauptete schon Lubkin, Kant wolle alles zerstören, ohne etwas zu schaffen. Lubkin
hat dabei für Kant eine Bezeichnung verwendet, die von Moses Mendelssohn stammte – „Alleszermalmer“. Vgl. Александр С. Лубкин (Aleksander S. Lubkin), Рассуждение о том, возможно ли
нравоучению дать твердое основание, независимо от религии (Abhandlung über die Frage, ob eine
feste Begründung der Sittenlehre ohne Religion möglich ist), S. 17.
23 S. dazu Надежда С. Доронина (Nadezhda S. Doronina), Проблема веры. Этический аспект:
И. Кант и русская философия всеединства (Das Problem des Glaubens. Ethischer Aspekt: I. Kant und
die russische Philosophie der Alleinheit).
24 Vgl. Жучков, Комментарии и примечания, S. 829, 877. Manche, wie der oben zitierte Ern oder
z. B. Karpow, setzten sogar Kants ‚Unmoralität‘ in Zusammenhang mit dem deutschen Militarismus
(Жучков, Комментарии и примечания, S. 919; 842).
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
443
Begründung der Moral gescheitert, indem er sie zu eng konzipierte und radikal von
der Religion trennte.25 Diese Position wird in den bereits erwähnten Werken von
Lubkin, Karpow, Lopatin, aber auch von Nikolai Losski, Lew Schestow und mehreren
anderen russischen Denkern vertreten. Hier gewinnt der Atheismus-Vorwurf wieder
an Bedeutung. Besonders deutlich kam er bei Pawel Florenski zum Ausdruck. In der
Vorrede zu seiner Dissertation und seinem Hauptwerk Der Pfeiler und die Grundfeste
der Wahrheit (1908) sagt er direkt, um den „Pfeiler der Wahrheit“ zu festigen, solle
man dem „Pfeiler der gottwidrigen Bosheit“ abschwören, auf dem „das antireligiöse
Denken unserer Zeit ruht“, nämlich Kant.26
In diesem Zusammenhang verdient wiederum Solowjew bzw. sein berühmtes
Werk Rechtfertigung des Guten (1897) besondere Aufmerksamkeit. Kants Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten wurde hier einer gründlichen philosophischen Analyse
unterworfen, v. a. das Problem der Freiheit in ihrem Verhältnis zum Guten und zum
Bösen. Trotz aller feinen Differenzierungen stellt jedoch auch dieses Werk schließlich
eine Ablehnung der Grundlage von Kants Moralphilosophie dar. Das Gute wird hier
nicht bloß gerechtfertigt, sondern gegen Kants Idee der Freiheit verteidigt. Solowjew
stößt dabei auf die Paradoxien des Guten und des Bösen, die nach Kant beide der
Freiheit entspringen sollen. Die Paradoxien wurden im ersten Kapitel detailliert dargestellt – als unlösbare Schwierigkeiten, mit denen sich Kant in seiner Religionsschrift auseinandersetzen musste. Die Paradoxien blieben bei Kant bestehen, denn sie
entsprangen den Grundannahmen der Kritik. Für Solowjew waren diese Paradoxien
bloße Widersprüche. Darum musste er gerade dem guten Willen die Freiheit absprechen und die objektive Notwendigkeit des Guten behaupten. Die Willensfreiheit (und
hier stimmt Solowjew ungewollt mit Luther überein) sei somit nur die Freiheit zum
Bösen.27
Solowjews Lösung des Freiheits-Dilemmas war allerdings nicht die einzige. Umgekehrt verteidigten Berdjajew und Schestow die Freiheit gegen Kants moralisches
Gesetz, das die Freiheit der Willkür und somit auch das Individuelle angeblich vernichtet. Kants Denken, so Berdjajew, sei eine Art „Polizeiphilosophie“,28 es leugne die
individuelle Freiheit, d. h. das Menschliche schlechthin. Schestow bezeichnete Kants
Philosophie als die der „Allgemeinerei“ („всемство“) und fügte hinzu, Kant sei der
Name für die Sehnsucht nach Allgemeinheit, er habe von dem „Mensch überhaupt“
25 Vgl. z. B. Лев М. Лопатин (Lew M. Lopatin), Нравственное учение Канта (Kants sittliche Lehre).
26 Павел А. Флоренский (Pawel A. Florenski), Столп и утверждение истины (Der Pfeiler und die
Grundfeste der Wahrheit), Bd. 1 (II), S. 820 f. Florenskis Position gegenüber Kant war keine bloß odiöse
Ablehnung zugunsten des dogmatischen Glaubens. Als ernsthafter Denker musste er sich philosophisch mit Kant auseinandersetzen. Diese komplexe Frage kann hier nicht behandelt werden. S. dazu
Жучков, Комментарии и примечания, S. 891 ff.; Frank Haney, Pavel Florenskij und Kant – eine
wichtige Seite der russischen Kant-Rezeption. S. dort auch die entsprechenden Literaturhinweise.
27 Владимир Соловьев (Wladimir Solowjew), Оправдание добра (Rechtfertigung des Guten), S. 111 ff.
28 Николай А. Бердяев, Философия свободы (Philosophie der Freiheit), S. 18.
444
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
her gedacht.29 Beide, Berdjajew und Schestow, setzten ihm Dostojewski entgegen, der
nach seinem eigenen berühmten Ausdruck „in einem Menschen den Menschen“
immer zu finden wusste.30 Der Ausdruck wies (von beiden unbemerkt) gerade auf das
Allgemeine hin.
Diese Beispiele, nämlich wie die Idee der Freiheit und der Maßstab des Allgemeinen gegen Kants Grundlage der Moral ausgespielt wurden, zeigen u. a., dass es weder
Einheit unter den prominentesten russischen Kant-Kritikern noch Konsequenz in
ihren Angriffen auf die kantische Philosophie gegeben hat.31 Indem sie den Einzelnen
mit seiner Individualität und seiner Freiheit gegen Kants Forderung der Allgemeinheit
in Schutz nehmen wollten, schrieben sie ihm das Vermögen zur objektiven Erkenntnis
zu, das bei allen Menschen gleich sei, oder sprachen ihm die Freiheit des Willens
zugunsten des objektiven Guts ab, das diese Freiheit irgendwie garantieren sollte.
Doch trotz dieser widersprüchlichen Einwände stimmten die russischen Denker in
mehreren Punkten sowie in ihrer allgemeinen Einstellung gegenüber Kant miteinander überein. Die Ableitung der Gut-Böse-Unterscheidung aus dem moralischen Gesetz
(und nicht umgekehrt), die Formalität des kategorischen Imperativs, das Gewissen als
letzte Instanz der sich selbst richtenden Vernunft – all das war für sie nicht akzeptabel. In all ihren Kontroversen war Kant als Vertreter des ‚westlichen‘ Denkens präsent – als Beispiel eines Philosophen, der die wahre Bestimmung des Menschen
verkannt hatte.32
Diese anti-kantische Stimmung der russischen Philosophie, die nur wenige Ausnahmen kennt, steht, wie oben gesagt, in einem erheblichen Kontrast zu ihrer Einstellung gegenüber Nietzsche. Nach dem berühmten Ausdruck eines modernen russischen Forschers kann Nietzsche als „russischster“ unter den westlichen Philosophen
bezeichnet werden.33 Tatsächlich war die fruchtbarste Epoche der russischen Kultur –
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert – die Zeit der größten Popularität Nietzsches
in Russland. Werfen wir noch einen Blick auf diese Epoche und das Phänomen der
russischen Nietzsche-Rezeption.34
29 Лев Шестов (Lew Schestow), На весах Иова (Auf der Waage Hiobs), S. 44 f.
30 Diesen Ausdruck hat Dostojewski selbst in einer Notiz verwendet (DGA 27, S. 65).
31 Im gleichen Atemzug griff bspw. Schestow Kants Philosophie der „Allgemeinerei“ und Solowjews
Idee der „All-Einheit“ (всеединство) an. Vgl. Шестов, На весах Иова, S. 44 f.
32 Bis heute ist diese Richtung des russischen Philosophierens lebendig geblieben, z. B. bei dem
Philosophen Sergej Choruzhi, der dem Rationalismus Kants und Descartes’ eine neue ‚synergetische‘ Anthropologie entgegensetzt. Vgl. Сергей Хоружий (Sergej Choruzhi), Кризис классической
европейской этики в антропологической перспективе (Der Krise der klassischen europäischen Ethik
in der antropologischen Perspektive); Сергей Хоружий (Sergej Choruzhi), К феноменологии аскезы
(Zur Phänomenologie des Asketismus).
33 Борис Гройс (Boris Groys), Поиск русской национальной идентичности (Die Suche nach der
russischen Nationalidentität), S. 45.
34 In dieser kurzen Übersicht über die Nietzsche-Rezeption in Russland folge ich in erster Linie den
grundlegenden Arbeiten von Julija Sineokaja: Юлия В. Синеокая, Восприятие идей Ницше в России:
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
445
Die russische Diskussion über Nietzsches Philosophie wird mit dem Beitrag von
Wasili Preobrazhenski Friedrich Nietzsche: Kritik der Moral des Altruismus eröffnet,
der in der renommierten Zeitschrift Die Fragen der Philosophie und Psychologie 1892
erschienen ist. Die Redaktion der Zeitschrift hat sich allerdings von dieser Publikation
distanziert. Im Kommentar zu Preobrazhenskis Beitrag wurde Nietzsche als ein
Wahnsinniger dargestellt, der für seine Gottlosigkeit (er habe sich selbst für Gott
gehalten) eine gerechte Strafe erhalten hat. Man habe entschieden, eine Darlegung
seiner Philosophie nur darum zu veröffentlichen, um zu zeigen, was für Extreme in
der modernen westeuropäischen Philosophie möglich sind, und welche Lektionen
man daraus entnehmen kann. Aber der Beitrag selbst stand in erheblichem Widerspruch zu dieser eindeutigen Beurteilung, die höchstwahrscheinlich zur Beruhigung
der Zensur notwendig war. Er bot dem Leser dagegen eine tiefgreifende, scharfsinnige Analyse der Moralkritik Nietzsches. Eine lebhafte Polemik zu diesem Beitrag fand
man schon in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift.35 Danach folgten mehrere Darlegungen, Interpretationen und Übersetzungen. Im Jahr 1900 erschien die erste Ausgabe der Gesammelten Werke in acht Bänden, in den Jahren 1902–1903 die zweite
Ausgabe in neun Bänden, im Jahr 1909 wurde mit der Publikation der Gesamtausgabe begonnen.36 Die russischen Intellektuellen besuchten Weimar und dort das
berühmte Nietzsche-Archiv. Erste Versuche, dorthin zu gelangen, fielen in das Jahr
1899, als Nietzsche noch lebte. Zugelassen wurden sie aber erst später – von der
Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche, die ihnen von Nietzsches Begeisterung für
russische Literatur erzählte und u. a. über seine Bekanntschaft mit Turgenjew. Eine
„höchst unglaubwürdige“ Geschichte, wie ein moderner Forscher bemerkt.37 Jeden-
Основные этапы, тенденции, значение (Die Rezeption der Ideen Nietzsches in Russland: die wichtigsten Etappen, Tendenzen, Bedeutung); Юлия В. Синеокая, Российская ницшеана (Der russische Nietzscheanismus); Юлия В. Синеокая, Три образа Ницше в русской культуре (Drei Bilder Nietzsches in
der russischen Kultur). Sineokaja kann, ohne dabei zu übertreiben, als die erste Spezialistin in diesem
Bereich betrachtet werden. Im Jahr 2009 habilitierte sie mit einer umfassenden Schrift Философия
Ницше и духовный опыт России (конец XIX – начало XXI в.) (Die Philosophie Nietzsches und das
geistige Leben Russlands (Ende des 19.–Anfang des 21. Jh.), in der, wie der Titel besagt, die Gesamtgeschichte der Nietzsche-Rezeption in Russland untersucht wird. Seit 2005 ist sie Präsidentin der
Russischen Nietzsche-Gesellschaft. S. auch zum Thema Maria Deppermann, Nietzsche in Russland;
Bernice Glatzer Rosenthal (Hg.), Nietzsche in Russia.
35 Zwei Philosophen und Professoren der Moskauer Universität, der uns schon bekannte Kant-Interpret Lew Lopatin und ein anderer Kritiker des Rationalismus, Nikolai Grot, legten dort eine kritische
Auseinandersetzung mit dem Beitrag Preobrazhenskis bzw. mit der Philosophie Nietzsches vor (Лев
М. Лопатин (Lew M. Lopatin, Больная искренность (Die kranke Offenheit)); Николай Я. Грот
(Nikolai J. Grot), Нравственные идеалы нашего времени (Фридрих Ницше и Лев Толстой) (Moralische Ideale unserer Zeit (Friedrich Nietzsche und Lew Tolstoi))).
36 Aber nur die ersten vier Bände sind erschienen. S. dazu Синеокая, Восприятие идей Ницше в
России, S. 21. Die Publikation der Gesamtausgabe ist in Russland bis heute unvollendet geblieben.
37 Zu diesem Thema s. ausführlich К.М. Азадовский (K.M. Azadowski), Русские в „Архиве Ницше“
(Die Russen im „Nietzsche-Archiv“), S. 117.
446
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
falls wusste man von der Begeisterung Nietzsches für die „Russen“ schon aus seinen
Werken. Und der Schwester des großen Philosophen, der die Bedeutung Russlands
für die abendländische Kultur erkannte, wurde der tiefste Respekt erwiesen sowie
Vertrauen geschenkt.
Bei der Feststellung der allgemein positiven Einstellung der russischen Intellektuellen zu Nietzsches Philosophie darf eine wichtige Tatsache nicht unerwähnt
bleiben: Trotz der Kontakte zum Archiv und zur Schwester des Philosophen38 und,
noch wichtiger, trotz der Bemühungen der russischen Zensur, die häufig mehrere
Passagen aus Nietzsches Werken herausließ oder diese sogar mit anderen Wörtern
und Sätzen ersetzte (der Text, der dadurch entstand, konnte deshalb in breiteren
Kreisen des russischen Publikums nicht anders denn als Werk eines Wahnsinnigen
gelesen werden, der sich selbst ständig widerspricht), trotz all dieser Rezeptionsstörungen ist es den russischen Interpreten Nietzsches zu dieser Zeit gelungen, der
Gefahr der Ideologisierung und Schematisierung seiner Philosophie zu entgehen. Als
der oben bereits erwähnte Vertreter der sog. russischen Slawophilie Wladimir Ern
im Jahr 1915 nicht nur Kants Philosophie, sondern in erster Linie Nietzsches ‚Lehre‘
über den Willen zur Macht als Vorbereitung des deutschen Militarismus darstellte,
kam sofort scharfer Protest vonseiten der prominentesten Philosophen auf, z. B. von
Nikolai Berdjajew:
Ich kenne nichts Abscheulicheres und seines tiefsten Wesens nach Lügnerischeres als diesen
Wunsch, Nietzsche mit dem modernen militaristischen Deutschland in Verbindung zu setzen.39
Auch die These der Widersprüchlichkeit konnte sich in Russland nicht festsetzen.
Schon Preobrazhenski redete von scheinbaren Widersprüchen bei Nietzsche und
bemühte sich darum, dessen Konsequenz in der Behandlung moralischer Fragen
nachzuweisen. Die besten unter den Nietzsche-Interpreten haben in seiner Philosophie nicht eine Predigt des äußersten Egoismus, des Willens zur Macht bzw. der
Vernichtung der Moral gesehen, sondern die Verkündung einer neuen Epoche, die die
Epoche des Nihilismus ablösen soll, den Wegweiser zur Überwindung der größten
Krise der europäischen Geschichte.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschienen in Russland mehrere profunde Untersuchungen der Philosophie Nietzsches, die gründliche Analysen unterschiedlicher
Aspekte seines Denkens vorlegten. Auch die fremdsprachige Literatur zu Nietzsche,
z. B. das Buch von Georg Brandes Aristokratischer Radicalismus: Eine Abhandlung über
Friedrich Nietzsche und Erinnerungen wie die von Lou Andreas-Salomé wurden ins
38 Von Elisabeth Förster-Nietzsche erhielt die Redaktion der Zeitschrift Новый путь (Ein neuer Weg)
den „Aufsatz“ Nietzsches Die Kritik der höchsten Werte, der eine Kompilation aus dem Nachlass
darstellte und der Tolstois Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
39 Николай Бердяев (Nikolai Berdjajew), Ф. Ницше и современная Германия (F. Nietzsche und das
moderne Deutschland), zit. nach: Синеокая, Российская ницшеана, S. 26.
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
447
Russische übersetzt.40 Noch mehr Anerkennung als seine Erkenntnis- und Moralkritik
findet Nietzsches Philosophie der Kunst. In der schöngeistigen Literatur, unter Schriftstellern und Dichtern, entsteht der besondere menschliche Typus eines russischen
Nietzscheaners bzw. einer russischen Nietzscheanerin. Manche Schriftsteller, wie
Dmitri Merezhkowski, der Autor der berühmten Trilogie Christus und der Antichrist
(1890–1904), bekannten sich öffentlich zu Nachfolgern Nietzsches. Mehrere Philosophen beanspruchten den Ehrentitel eines ‚russischen Nietzsche‘, z. B. Wasili Rosanow
mit seiner Bezeichnung des Christentums als Religion des Todes. Manche russische
Denker werden als ‚Nietzsche avant la lettre‘ interpretiert – nicht nur Dostojewski,
sondern auch Michail Lermontow, Alexander Herzen (eine enge Freundin Nietzsches,
Malwida von Meysenbug, hat die Familie von Herzen gut gekannt und einige seiner
Werke ins Deutsche übersetzt) und Konstantin Leontjew.41 Die russischen Dichter des
Symbolismus, wie Andrej Bely, Wjatscheslaw Iwanow oder Waleri Brjusow, hielten
Nietzsches Werke für eine Quelle der Inspiration und seine Philosophie für die theoretische Grundlage einer neuen Kunst. Besonders beeindruckend für die russischen
Literaten war die Idee der „Duplicität“ der zwei Gottheiten, Apollo und Dionysos,
deren Wettbewerb zur Blüte der Kunst führt. Diese Duplizität, so stand es in einem
Nekrolog auf Nietzsche in der Zeitschrift für den russischen Symbolismus Die Welt der
Kunst, sei identisch mit dem ewigen Kampf „im Herzen der russischen Literatur, von
Puschkin bis Tolstoi und Dostojewski“. Darum sei Nietzsche nicht tot, er lebe weiter,
indem man die Position „für“ oder „wider“ ihn annimmt und annehmen muss.42
Die Aufgabe der Überwindung des ästhetischen Sokratismus wurde von russischen Künstlern sehr persönlich genommen – als ob Nietzsche sich mit diesem Ruf
direkt an sie gewandt hätte. Sogar der politische und kulturelle Zusammenbruch des
Jahres 1917 hat diese Richtung von Nietzsches Einfluss auf die russische Kultur nicht
völlig vernichten können. Trotz des offiziellen Verbots der Werke Nietzsches und der
Brandmarkung seiner Philosophie aus ideologischen Gründen bleibt Nietzsche in der
sowjetischen Kultur präsent – nicht nur dank solcher Dichter wie Wladimir Majakowski und Alexej Gorki (der Nietzsche sogar in seinem Aussehen ähneln wollte),
sondern auch bei den Ideologen des Bolschewismus wie Wolski, Trotzki oder Bogdanow, und bei den Ideologen der sozialistischen Kunst, wie Lunatscharski.43 Mehrmals
40 In den Jahren 1888–1889 hatte Brandes geplant, Vorlesungen über Nietzsche in Russland zu halten.
Wegen des Zensurverbots seines Buchs Die Literatur des 19. Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen,
das 1888 ins Russische übersetzt wurde, musste er diese Pläne verwerfen.
41 S. dazu Синеокая, Российская ницшеана, S. 20.
42 Zit. nach Синеокая, Восприятие идей Ницше в России, S. 18.
43 Sineokaja stellt fest, dass der wachsende Einfluss des Marxismus auf die russische Kultur vom
Abnehmen von Nietzsches Einfluss begleitet wurde. Doch wurden Nietzsches Ideen von den russischen
Marxisten umgedeutet und mit in den russischen Marxismus aufgenommen. Die ‚Lehren‘ vom Willen
zur Macht, vom Übermenschen und vom Tod Gottes wurden zum politischen Programm. S. Синеокая,
Российская ницшеана, S. 28 f.
448
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
wurde bemerkt, dass die sozialistische Propaganda die Gemeinplätze der vulgarisierten Nietzsche-Rezeption übernommen hat, wie z. B. das Pathos eines neuen Menschen, der alle Ketten der Moral zerbrechen und eine helle Zukunft, frei vom GötterAberglauben, erobern soll.44 In Form einer optimistischen Predigt des Übermenschen
hat Nietzsches Denken bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts in der russischen Kultur überlebt – bis zu seiner philosophischen Wiederentdeckung, mit der
man auch heute noch nicht fertig geworden ist.45
Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts kann Nietzsches Philosophie also als Hintergrund der russischen Kultur betrachtet werden. Aber schon früher lässt sich eine
gewisse Vorbereitung der Nietzsche-Rezeption in Russland feststellen. Diese Vorbereitung findet v. a. in der Literatur statt – durch ihre Behandlung der, nach dem berühmten Ausdruck Dostojewskis, „verfluchten Fragen“ des Menschenlebens, durch ihr
Misstrauen gegen die wissenschaftliche Wahrheit, die öffentlich vertretene Moral, die
Gerechtigkeit der Gesellschaftsordnung. Das Misstrauen gegen die offizielle Religion
darf dabei nicht unerwähnt gelassen werden. Der Atheismus fasst in Russland viel
früher Fuß, schon lange vor dem Bekanntwerden der Kritik Nietzsches am Christentum.46 Das bedeutet nicht einfach, dass Nietzsches Immoralismus von den russischen
Denkern schon lange vertreten wurde. Vielmehr erschien er als Alliierter im Kampf,
den man selbst seit einiger Zeit geführt hatte, doch vielleicht mit einer anderen
Absicht, z. B. um die ‚westliche‘ Kultur als Sackgasse der Geschichte darzustellen,
welche durch das wahre, ursprüngliche Christentum zu überwinden ist.47 Die russische Begeisterung für Nietzsche wird somit zu einem merkwürdigen Phänomen.48
Denn trotz allen Übereinstimmungen musste die russische Nietzsche-Rezeption in
ihren Konsequenzen zu schärfsten Kontroversen führen. Die russischen NietzscheAnhänger stellten sich Aufgaben, die in mehreren Hinsichten als Gegenteil seiner
Aufgaben zu verstehen sind. Besonders trifft dies für die religiösen Philosophen zu,
die, wie Berdjajew und Frank, den Marxismus überwunden haben und von ihm zu
einem sog. Neuidealismus übergegangen sind. Nietzsches Verkündigung vom Tod des
alten Gottes war für sie die Eröffnung des Weges zu einer neuen Form der Religiosität.
44 S. zum Thema Bernice Glatzer Rosenthal (Hg.), Nietzsche and Soviet Culture: Ally and adversary.
45 S. dazu Boris W. Markow, Das neue Nietzsche-Bild in Russland, seine Chancen und Risiken.
46 Man denke nur an atheistische Materialisten, wie Nikolai Dobroljubow und Nikolai Tschernyschewski, beide Priestersöhne, wie Nietzsche.
47 Vgl. die kurz vor dem Tod ausgesprochene These Solowjews, dass die Hauptlinie der Weltgeschichte zu einem Ende kam (angegeb. nach Юлия Синеокая (Julija Sineokaja), В мире нет ничего
невозможного? (Л. Шестов о философии Ницше) (Es gibt nichts Unmögliches in der Welt? (L. Schestow über die Philosophie Nietzsches)), S. 75).
48 Die aktuelle Forschung stellt darum die These Boris Groys’ in Frage. Vgl. В.Ф. Пустарнаков
(W.F. Pustarnakow), Был ли Фридрих Ницше „самым русским“ из западных философов? (Ist Friedrich Nietzsche der „russischste“ unter den westlichen Philosophen gewesen?). Pustarnakow geht so weit,
zu sagen, die Begeisterung der russischen Intellektuellen für Nietzsche sei von der Forschung stark
übertrieben worden, und das Verhältnis der russischen Kultur zu Nietzsche sei eher negativ gewesen.
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
449
In seinem Dionysos haben sie Christus gesehen, aber den Christus, der von den
‚westlichen‘ Missverständnissen gereinigt wurde – nicht den Gott der Philosophen,
der als tote Konstruktion die Lücken der positivistischen Wissenschaften ausfüllen
und ihre Wahrheit garantieren sollte, sondern den lebendigen Gott Israels, den Gott,
der Mensch geworden ist und das Todesurteil der Menschen angenommen hat – aus
Liebe zu ihnen, weil er selbst die Liebe ist.49 Nietzsche habe diesen Gott Abrahams und nicht den sokratischen Gott der hellenisierten westlichen Theologie gesucht, so z. B. Schestow, der neben Nietzsche Kierkegaard für einen neuen Propheten
Gottes hielt. Und wenn er den Letzteren bekämpft und besiegt habe, so habe er den
Weg zum Ersteren aufgezeigt, obwohl er diesen Gott selbst am Ende doch nicht
gefunden hat.
Nietzsche wird somit von den religiösen Denkern Russlands als großer Lehrer und
Prophet angesehen, der den tragischsten Konflikt in der Geschichte der Menschheit
zum Ausdruck brachte – den Konflikt zwischen den metaphysischen Bedürfnissen
des Menschen und der sie nivellierenden Gesellschaft, zwischen der Sehnsucht nach
Selbst-Erhöhung und der utilitaristischen Forderung der Herdenmoral. Doch sei er
selbst am Ende zum Opfer dieses Konflikts geworden. Denn indem er gegen die
falsche Idee Gottes, gegen Götzen kämpfte, meinte er, gegen Gott selbst zu kämpfen;
er habe das Vornehme, das Aristokratische der christlichen Geistigkeit (so z. B. Berdjajew) verkannt, indem er ihre Herabwürdigung zur Moral der Mehrheit ablehnte. Die
russische „Gottessuche“ (богоискательство) fand allerdings in Nietzsches Kritik des
Christentums nicht bloß ein persönliches Missverständnis des deutschen Philosophen, sondern das grundlegende Missverständnis des ‚Westens‘ den Quellen seiner
geistigen Kultur gegenüber, seine Selbst-Verkennung. Auch Russland sei den daraus
folgenden Exzessen und Katastrophen nicht entgangen. Dennoch habe es einen Vorteil gegenüber der von der Welle des Nihilismus überschwemmten abendländischen
Kultur: In Russland sei immer eine Distanz zu geistigen Strömungen Europas gehalten
worden, nicht nur im religiösen Sinn, sondern auch im philosophischen – zum
Positivismus und zum Utilitarismus des 19. Jahrhunderts, und, früher, zum Rationalismus Descartes’ und zum Formalismus Kants. Darum bliebe es für die Fragen offen,
für die der ‚Westen‘ taub geworden ist. Nietzsches Pathos der Umwertung aller Werte
habe ihn zum Katalysator der tiefsten Prozesse der nihilistischen Selbstzerstörung
europäischer Kultur gemacht, die ohnehin schon in Gang waren. Seine Stimme sei
darum als „tragischer Schrei einer lebendigen Seele“ hörbar geworden, die durch „die
gottlose Welt und unmenschliche Gesellschaft gekreuzigt wird“.50
49 Das stimmt ebenso für die russischen Dichter, besonders für die Vertreter des Symbolismus. Vgl.
die These Belys „Allein Christus und Nietzsche kannten die ganze Kraft und Größe des Menschen“,
dem ein Zitat aus dem Zarathustra unmittelbar folgt (Андрей Белый (Andrej Bely), Фридрих Ницше
(Friedrich Nietzsche), S. 885).
50 Михайло Михайлов (Michailo Michailow), Великий катализатор: Ницше и русский неоидеализм (Der große Katalysator: Nietzsche und der russische Neuidealismus), S. 198.
450
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
In mehreren Variationen wird dieses Verständnis der Rolle Nietzsches nicht nur in
der Philosophie, sondern auch in der Weltgeschichte dargelegt – von den begeisterten
Anhängern der neuen „dionysischen“ Religion51 bis zu den Gegnern Nietzsches, die,
wie Solowjew, seinem Übermenschen den Gott-Menschen Christus entgegensetzen.52
Wenn Kants Moral aus Vernunft einen maskierten Atheismus darstellte, so brachte der
Atheismus Nietzsches die leidenschaftliche Suche nach Glauben zum Ausdruck – eine
Suche, die ihr Ziel zwar nicht erreichte, aber zum Zeichen der Menschlichkeit geworden ist, die vom ‚westlichen‘ Rationalismus ignoriert und verleugnet wurde. Mehrmals
wird in diesem Zusammenhang auf die Paradoxien von Nietzsches Kritik des Christentums hingewiesen, v. a. auf die Spannung zwischen dem äußersten philosophischen
Pessimismus und dem optimistischen Pathos der Selbstüberwindung. Laut Trubezkoi
habe Nietzsche den Atheismus philosophisch am tiefsten und am gründlichsten
durchdacht, da er sich jedem Glauben verweigerte. Die daraus folgenden unlösbaren
Schwierigkeiten („das Labyrinth der Widersprüche“) sind unvermeidliche Konsequenzen, zu denen allein Nietzsche den Mut hatte. Er habe damit die globale Unzufriedenheit des modernen Menschen und seine Vorahnung einer nahen Katastrophe zum
Ausdruck gebracht.53 Nietzsches positives Pogramm, seine ‚Lehren‘, die die Rezeption
seiner Philosophie in Deutschland für ein halbes Jahrhundert bestimmt haben, wurden dagegen mehrmals als Verrat an sich selbst, als Inkonsequenz Nietzsches gegenüber seiner radikalkritischen Einstellung angesehen.54
Ein anschauliches Beispiel einer existentiellen Interpretation der Philosophie
Nietzsches, die das Pathos der radikalsten Umwertung der Werte in der abendländischen Geschichte würdigte und dieses im Sinne eines unlösbaren Konflikts des
‚Westens‘ darlegte, stellten zwei Schriften von Lew Schestow dar: Das Gute in der Lehre
51 Besonders Wjatscheslaw Iwanow hat die Idee der neuen, lebendigen, dionysischen Religion als
Mysterium des Übermenschen vertreten und sie in direkte Verbindung mit dem Christentum gestellt.
Nach Iwanow habe Nietzsche Christus erraten, indem er von Dionysos sprach. S. Вячеслав И. Иванов
(Wjatscheslaw I. Iwanow), Ницше и Дионис (Nietzsche und Dionysos); Die hellenistische Religion des
leidenden Gottes, zit. nach Юлия В. Синеокая (Julija W. Sineokaja), Примечания (Ein Kommentar),
S. 1055 (s. dort auch die weiteren Literaturhinweise).
52 Vgl. Владимир С. Соловьев (Wladimir S. Solowjew), Словесность или истина? (Literatur oder
Wahrheit?); Владимир С. Соловьев (Wladimir S. Solowjew), Идея сверхчеловека (Die Idee des Übermenschen). Zur Auseinandersetzung der russischen Denker (Solowjew, Berdjajew, Iwanow, Fjodorow
und Lew Tolstoi) mit Nietzsches Idee des Übermenschen und ihren religiösen Interpretationen s. Юлия
В. Синеокая (Julija W. Sineokaja), Рубеж веков: Русская судьба сверхчеловека Ницше (Die Jahrhundertwende: Das russische Schicksal des Übermenschen Nietzsches).
53 Евгений Н. Трубецкой (Ewgeni N. Trubezkoj), философия Ницше. Критический очерк (Die
Philosophie Nietzsches. Eine kritische Abhandlung).
54 Vgl. Николай К. Михайловский (Nikolai K. Michajlowski), Еще о Ф. Ницше (Noch einmal über
F. Nietzsche). Freilich gab es auch Interpretationen dieser ‚Lehren‘ im Sinne der Paradoxien Nietzsches,
der als Kritiker der Metaphysik die kühnsten metaphysischen Ideen hervorgebracht habe. Vgl. Петр
Б. Струве (Pjotr B. Struwe), Miscellanea. К характеристике Ницше как мыслителя и художника
(Zum Charakteristikum Nietzsches als Denker und Künstler).
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
451
von Graf Tolstoi und F. Nietzsche (Philosophie und Predigt) (1900) und Dostojewski und
Nietzsche: Philosophie der Tragödie (1903). Zwar stimmte Schestow in diesen berühmten Abhandlungen mit der Hauptströmung der russischen religiösen Nietzsche-Interpretation überein, doch hat er hier nicht nur seine Tendenzen auf radikalste Weise
zum Ausdruck gebracht, sondern selbst die schärfsten Kritiker des ‚Westens‘ übertroffen. Unter anderem stellte er Tolstoi als religiösen Gegner Nietzsches dar. Dies tat
freilich schon Nikolai Grot, der Nietzsches Immoralismus Tolstoi als Christ entgegensetzte und die ‚Fehler‘ beider Denker auf den kantischen Rationalismus zurückführte.
Schestow ging jedoch viel weiter. Er spitzte den Gegensatz extrem zu und kehrte ihn
um: Während Nietzsche Gott suche, verehre Tolstoi die sokratisch-abendländische
Gottheit der Moral aus Vernunft. Denn die These „Gott ist das Gute“ verwandle den
lebendigen Gott Abrahams in einen Abgott der Sittlichkeit bzw. in den Götzen der
abendländischen Philosophie. Man drücke damit nur seine Angst aus – die Angst vor
der unbegrenzten Macht des Schöpfers. Nietzsches Intuition hingegen war richtig, Gott
sei nur jenseits von Gut und Böse zu finden. Er habe die Macht der „sokratischen
Zauberei“ damit gebrochen. Aber nicht endgültig, denn sein „amor fati“ sei ebenfalls
ein letzter Ausdruck der sokratischen Weisheit gewesen, die weg von Erlösung,
Freiheit und Gott in das „Labyrinth der Vernunft“ hineinführt. Nietzsche habe den
Ausgang aus diesem Labyrinth nicht gefunden. Ihn habe – und diese Meinung Schestows klingt seltsam vor dem Hintergrund unserer Analyse des Begriffs des Tragischen
bei Nietzsche – die tragische Philosophie abgeschreckt. Folglich habe auch er sich der
„Macht des Nichts“ unterworfen, der die sokratisch-kantische Philosophie immer
gedient hatte. Dies wurde jedoch bei Nietzsche zu seiner persönlichen Tragödie, die,
so Schestow, viel wichtiger als all sein „Für“ und „Wider“ sei. Sie soll in die Perspektive der wahren Philosophie der Tragödie gestellt werden – in die von Dostojewski, der
Gott jenseits von Gut und Böse, Gott, dessen Macht mit keiner Moral aus Vernunft zu
ermessen ist, erraten und verkündigt hat.55
Ziehen wir eine vorläufige Bilanz. Die russische religiöse Philosophie beruft sich
ständig auf Nietzsche, indem sie den philosophischen Pessimismus Kants überwindet
und einen Weg aus der Sackgasse des Nihilismus sucht. In Nietzsches Umwertung der
Werte meint sie ein Zeichen des neuen Zeitalters wahrzunehmen – des Zeitalters des
wahren Christentums. Nicht Tolstoi oder Dostojewski, sondern Nietzsche hat den
russischen Denkern diese Hoffnung gebracht. Mehr noch: Er hat ihnen die Hoffnung
gegeben, dass Russland „die e i n z i g e Macht Europas“ ist, die in diesem Sinn „Etwas
noch versprechen kann“ (GD Streifzüge, 39, KSA 6, S. 141). Diese Worte eines der
prominentesten Philosophen des Abendlandes stimmten nicht nur mit dem prophetischen Pathos Dostojewskis überein, sondern auch mit den „Wünschen [des] Herzens“
55 Die Ansichten Schestows können hier nicht ausführlich dargestellt werden. Hier habe ich die zwei
im vorigen Kapitel schon angegebenen Schriften nur kurz zusammengefasst. Zur Auslegung des „amor
fati“ als Nietzsches ungewollte Wiederholung des sokratischen Prinzips s. auch Лев Шестов (Lew
Schestow), Афины и Иерусалим (Athen und Jerusalem).
452
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
der russischen Philosophen, die die eigene Zeit für die „Morgenröte“ einer neuen
Philosophie, Kunst und Religion gehalten haben. Auch wenn diese Hoffnungen offensichtlich gescheitert sind und die Epoche des sozialistischen Nihilismus angebrochen ist, hat die russische Kultur sich nicht von Nietzsche getrennt. Sie hat stattdessen
sein Denken in das ideologisch-messianische Pathos der neuen Ära verwandelt. Man
kann, so denke ich, mit einiger Sicherheit behaupten, dass Nietzsche selbst es nicht
so gern gesehen hätte, auf diese Weise „missverstanden, verkannt, verwechselt, verleumdet, verhört und überhört zu werden“. Aber, wie er selbst sagte:
Eben das ist unser Loos — oh für lange noch! sagen wir, um bescheiden zu sein, bis 1901 —
(FW 371, KSA 3, S. 622)
In Russland (und nicht nur in Russland) hat dieses „Missverständnis“ viel länger
angedauert. Aber trotz aller Missverständnisse oder vielleicht dank ihnen ist Nietzsche auch heute noch einer der in Russland beliebtesten Philosophen geblieben, der
viel ‚russischer‘ zu sein scheint, als es von anderen Denkern des Abendlandes je
behauptet werden könnte.
Etwas abseits von all diesen Strömungen des Anti-Kantianismus und Nietzscheanismus steht jedoch ein Denker, der zuerst als Literaturwissenschaftler in die Geschichte der russischen Kultur eingegangen ist und erst später als Philosoph entdeckt
wurde. Er verdient es darum, in dieser Übersicht erwähnt zu werden. Michail Bachtin
ist gleichsam eine Brücke zwischen der russischen Kant- und Nietzsche-Rezeption
einerseits und der Interpretation von Tolstois und Dostojewskis philosophischen Leistungen andererseits. Seine Theorie des polyphonen Romans wurde schon im vorigen
Kapitel dargestellt. Jetzt soll sie in seine Philosophie der Kunst eingeordnet werden.
Bekanntlich übte Bachtins Interesse für Kant und besonders für den Neukantianismus einen starken Einfluss auf seine Ästhetik des „Wortkunstschaffens“ aus. Die
Form-Inhalt-Unterscheidung wurde zur Grundlage seiner Theorie der „ethisch-kognitiven“ und „ästhetischen Tätigkeit“.56 Während die Dichter und Theoretiker des Symbolismus wie z. B. Bely Kants dialektische These, das Schöne sei Symbol des SittlichGuten, in einer ontologisierten Ästhetik aufgehoben haben, stellte Bachtin die Frage
nach der Grenzziehung zwischen der Erkenntnis und der Ethik einerseits sowie der
Ästhetik andererseits.57 Diese Grenzziehung sei selbst das Produkt der Kunst: Indem
der Mensch ein Kunstwerk hervorbringt, wird er zu einem Gott, der über die Welt
herrscht, aber nur über die von ihm selbst erschaffene Welt seines Kunstwerks. Das
Verhältnis, das zwischen ihm und den von ihm erdichteten menschlichen Figuren
56 S. dazu Michael Holquist, Katerina Clark, The influence of Kant in the early work of Bakhtin.
57 Zur Auseinandersetzung Bachtins mit Bely einerseits und mit Kant andererseits s. Натан
Д. Тамарченко (Natan D. Tamarchenko), „Эстетика словесного творчества“ Бахтина и русская
религиозная философия („Ästhetik des Wortkunstschaffens“ von Bachtin und die russische religiöse
Philosophie), S. 77 ff.
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
453
entsteht (und jede Kunst verbirgt nach Bachtin, wenn auch nur latent, eine menschliche Gestalt), sei allerdings nicht beliebig. Die Optionen dieser Beziehung stehen ihm
nicht bloß zur Verfügung, sondern bilden das, was Bachtin die „Geschichte der künstlerischen Wahrheit“ nennt.58 Wie im Kapitel zu Dostojewski ausführlich dargestellt
wurde, bildet nach Bachtin der Roman, genauer gesagt die Romane Dostojewskis, den
Gipfel in der Entwicklung der ästhetischen Idee einer pluralistischen Welt. Diese
Kunst behaupte eine neue Wahrheit, nämlich dass es keine letzte Wahrheit geben
könne, dass weder der Autor (Gott) noch der Held (Mensch) im Besitz der Wahrheit
sei. Sie tut dies nur indirekt – durch komplexe Schicksalsfügungen und stilistische
Vielschichtigkeit. Aber auch die umgekehrte Tendenz sei nicht zu übersehen – die
Entwicklung monologischer Wortkunst wie der Tolstois, die allmählich in die Predigt
übergeht. Der Künstler, der in seinen Kunstwerken Gottes Sprachrohr spielen und
dessen letzte Wahrheit verkünden will, verstoße gegen die Grenze der Kunst – gegen
die Grenze zwischen der unvollendeten Welt, in der allein moralisches Handeln
möglich ist, und ihrem ästhetischen Jenseits, das als Bedingung ihrer Vollendung
stets mitgedacht werden soll, das Jenseits von Wahr und Falsch, von Gut und Böse.59 Beide Tendenzen – die zugespitzt monologische und die übertrieben polyphone
Entwicklung – bringen die „Krise der Autorschaft“ in die schöngeistige Literatur.60
Tolstoi und Dostojewski seien die zwei größten Erscheinungen, was ihre literarischen
Methoden betrifft, aber auch die Kennzeichen dieser Krise. Die „Geburt der Autorschaft“ aus dem „Geist der Musik“ bzw. aus dem allgemeinen, alle Stimmern vereinigenden „Chor“, der dann in eine stilistische Polyphonie zerfällt, sei dagegen mit
dem oben beschriebenen Prozess der Grenzziehung eng verbunden, der die Kunst
jahrtausendelang ermöglichte.61
Die letzteren Ausdrücke weisen offenkundig auf Nietzsches Philosophie der
Kunst hin. Und tatsächlich ist es kaum möglich, die Wichtigkeit zweier Passagen –
einer aus der Geburt der Tragödie zum Verhältnis zwischen der Tragödie, dem platonischen Dialog und dem Roman (GT 14, KSA 1, S. 89) und einer aus der Fröhlichen
58 В.Н. Волошинов (W.N. Woloshinov), Марксизм и философия языка (Marxismus und Sprachphilosophie), S. 485. An dieser Stelle verwendet Bachtin allerdings nicht das Wort „истина”, sondern
„правда”. Auf diesen lexikalischen Unterschied wurde im Kapitel zu Tolstoi hingewiesen (s. Kapitel 3,
Anm. 145).
59 Die neueste systematische Untersuchung der Frage nach der Bedeutung der ästhetisch-ethischen
Differenz für die Grenzziehung der Kunst bei Bachtin, u. a. im Zusammenhang mit seiner NietzscheRezeption, erfolgt in: Натан Д. Тамарченко (Natan D. Tamarchenko), „Эстетика словесного
творчества“ Бахтина и русская философско-филологическая традиция („Ästhetik des Wortkunstschaffens“ von Bachtin und die russische philosophisch-philologische Tradition), bes. S. 136 ff., 164 ff.
60 Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Автор и герой в эстетической деятельности (Autor
und Held in der ästhetischen Tätigkeit), S. 258.
61 Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Автор и герой в эстетической деятельности (Autor
und Held in der ästhetischen Tätigkeit), S. 231; vgl. auch Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin),
Проблема текста (Das Problem des Textes), S. 322.
454
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Wissenschaft zur Unterscheidung der Kunstwerke (FW 367, KSA 3, S. 616) – für
Bachtins Theorien zu überschätzen.62 Bachtin erwähnt Nietzsche allerdings nur selten. Die interessanteste dieser Erwähnungen betrifft die sog. „hybriden und nicht
reinen Formen des Ästhetischen“.63 Diesen „Formen“ (als Beispiele werden Nietzsche
und „teilweise Schopenhauer“ genannt) liege eine „lebendige Beziehung des Autors
zur Welt, die der Beziehung des Künstlers zu seinem Helden gleicht“, zugrunde.64
Diese Art „ästhetisierter Philosophie“, so Bachtin an einer anderen Stelle, gleicht
einem „Tanzen im langsamen Tempo“. Denn das „Innere“ und das „Äußere“ wollen hier zusammentreffen: „[D]as Innere will zum Äußeren und das Äußere zum
Inneren werden“.65 Ein solches „ästhetisiertes“ Denken (und Bachtin ist weit davon entfernt es deshalb nicht ernst zu nehmen) stelle ein Gegenstück zur „Krise
der Autorschaft“ dar. Es sei das Kennzeichen für die grundlegende „Krise des
Lebens“ und die globale Krise der Kultur – „eine Revision der Stellung der Kunst im
Ganzen der Kultur, im Ereignis des Daseins“.66 Es kennzeichne den Moment der
Geschichte, in dem das Leben zur Tragödie wird – „zur Tragödie ohne Chor und ohne
Autor“.67
Die Kunstphilosophie Bachtins brachte deutlich zum Ausdruck, dass die Auseinandersetzung der russischen Philosophen mit Kant und Nietzsche vor dem Hintergrund der moralischen, philosophischen und literarischen Autorität Tolstois und
Dostojewskis erfolgte. Dies dürfte aus dem kurzen Exkurs in die zeitgenössische und
nachträgliche Geschichte der Nietzsche-Rezeption in Russland ebenfalls ersichtlich
geworden sein. Für die Zwecke dieser Untersuchung war v. a. wichtig festzustellen,
dass Nietzsches lebendiges Interesse zu den beiden großen Schriftstellern nicht zufällig gewesen ist. Es war ein Zeichen der tiefen Berührung Nietzsches mit der
russischen Kultur – eine Tatsache, die durch deren ebenso lebendiges Interesse
gegenüber dem deutschen Philosophen bestätigt worden ist.
In diesem letzten, abschließenden Kapitel soll Nietzsches Rezeption der russischen Künstler-Philosophen in den Mittelpunkt gerückt werden. Die historischen
Aspekte dieses Themas sind allerdings bereits gründlich erforscht worden, und die
Ergebnisse dieser Bemühungen scheinen ganz zuverlässig zu sein, wenn auch einzel-
62 S. dazu ausführlich den schon erwähnten Aufsatz der Verfasserin „Ästhetische Vollendung“. Zur
philosophischen Ästhetik Nietzsches und Bachtins. Zum Einfluss Nietzsches auf Bachtin s. auch James
M. Curtis, Michael Bakhtin, Nietzsche, and Russian Pre-Revolutionary Thougt. Auf die Komplexität dieses
Verhältnisses weist dagegen Matthias Freise hin: Matthias Freise, Michail Bachtins philosophische
Ästhetik der Literatur, S. 51 f., 135 f.
63 Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Проблема содержания, материала и формы в
словесном художественном творчестве (Das Problem des Inhalts, des Materials und der Form im
Wortkunstschaffen), S. 22.
64 Бахтин,Автор и герой в эстетической деятельности, S. 86.
65 Бахтин,Автор и герой в эстетической деятельности, S. 223.
66 Бахтин,Автор и герой в эстетической деятельности, S. 258.
67 Бахтин,Автор и герой в эстетической деятельности, S. 261.
5.1 Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick)
455
ne philologische Fragen vielleicht immer noch zusätzliche Aufmerksamkeit verdienen. Darum muss in diesem Kapitel, wie in der Darstellung von Nietzsches KantRezeption, keine besondere Stellungnahme zu einzelnen philologisch-historischen
Fragen geäußert werden, wie z. B. zur Frage nach Nietzsches Bekanntschaft mit dem
jeweiligen Werk Dostojewskis68 oder zu seinen Quellen des Nihilismus-Begriffs.69
Vielmehr wird auf der Grundlage des heutigen Forschungsstands der Versuch unternommen, Nietzsches Tolstoi- und Dostojewski-Lektüre als eine Interpretation darzulegen – eine Interpretation der fremden Denkweise, die Nietzsches eigene Plausibilitäten eventuell in Frage stellen konnte, die aber gerade als Alternative zu ihnen ihm
faszinierend erschien.
Im Fokus dieses Kapitels wird Nietzsches Spätwerk, vor allem Der Antichrist,
stehen – als sein Versuch, eine Alternative zum abendländischen Denken aufzuzeigen, indem seine Grundlage, das Christentum, an dessen Quellen angegriffen und
umgedeutet wird. Die vorbereitenden Notate zu diesem Werk, dem ursprünglich der
Untertitel „Versuch einer Kritik des Christenthums“,70 später aber „Fluch auf das
Christenthum“ gegeben wurde, sind dabei von erstrangiger Bedeutung, weil sich
gerade unter ihnen das wichtigste Zeugnis der Bekanntschaft Nietzsches mit Dostojewski und Tolstoi befindet – die Exzerpte aus dem Roman Die Dämonen und dem
Traktat Was ist mein Glaube? Nietzsches Auseinandersetzung mit diesen zwei Werken
kann insofern mit Recht die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Erwäh-
68 Zur Bekanntschaft Nietzsches mit Dostojewski s. primär Charles Anthony Miller, Nietzsches “Discovery” of Dostoevsky; Charles Anthony Miller, The Nihilist as Tempter-Redeemer: Dostoevsky’s „ManGod“ in Nietzsche’s Notebooks; Renate Müller-Buck, „Der einzige Psychologe, von dem ich etwas zu
lernen hatte“: Nietzsche liest Dostojewskij. Vgl. weitere Literatur zum Thema: Wolfgang Gesemann,
Nietzsches Verhältnis zu Dostoevskij auf dem europäischen Hintergrund der 80er Jahre. Merkwürdigerweise befindet sich heute keiner der russischen Romane bzw. keiner der bei Nietzsche erwähnten
russischen Autoren in seiner Bibliothek. Vgl. Campioni, D’Iorio, Fornari, Fronterotta, Orsucci, MüllerBuck (Hg.), Nietzsches persönliche Bibliothek.
69 S. dazu ausführlich und mit entsprechenden Literaturhinweisen Elisabeth Kuhn, Nietzsches Quelle
des Nihilismus-Begriffs. Wie Kuhn zeigt, taucht der Nihilismus-Begriff bei Nietzsche sehr früh (schon im
Sommer 1880) im Zusammenhang mit Luther und Schopenhauer auf, viel früher also als er Dostojewski
für sich entdeckte. Als Quelle von Nietzsches Nihilismus-Begriff wird v. a. Iwan Turgenjews Roman
Väter und Söhne angegeben, vermittelt durch Paul Bourgets Essais de psychologie contemporaine, aber
auch durch Zeitungsberichte über russische Attentate bzw. die europäischen Diskussionen darüber. Im
Deutschen gilt allerdings Friedrich Heinrich Jacobi als Erfinder des Nihilismus-Begriffs. S. dazu Dieter
Arendt (Hg.), Der Nihilismus als Phänomen der Geistesgeschichte in der wissenschaftlichen Diskussion
unseres Jahrhunderts, bes. Beiträge von Theobald Süß (Der Nihilismus bei F.H. Jacobi) und Otto Pöggeler
(Hegel und die Anfänge der Nihilismus-Diskussion). Es ist nicht auszuschließen, dass der Begriff von
Turgenjew selbst Jacobi entnommen wurde. Zu weiteren Aspekten von Nietzsches Nihilismusbegriff
s. Elisabeth Kuhn, Friedrich Nietzsches Philosophie des europäischen Nihilismus.
70 Mit diesem Untertitel wurde Der Antichrist als erster Teil eines größeren Werkes Umwerthung aller
Werthe von Nietzsche konzipiert. Vgl. Nachlass, Anfang 1888–Januar 1889, 19[8], KSA 13, S. 545; 22[14],
KSA 13, S. 589.
456
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
nung Dostojewskis im Zusammenhang mit der Bezeichnung Jesu als eines Idioten
sowie die gleiche Benennung Kants können dabei nicht unbeachtet bleiben.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels betrachten wir Ausdrücke Nietzsches wie
„Bosheit“, „sehr fremde[ ], sehr undeutsche[ ] Musik“, „beherzte[r] Fatalismus ohne
Revolte“ und „neuentdecktes Russisches Nihilin“ als Schwerpunkte seiner Interpretation Russlands, um sie in einen Zusammenhang mit seinem eigenen philosophischliterarischen Experiment in Ecce homo zu bringen und um schließlich auf die Differenz
der Plausibilitäten von Nietzsches „letzter Moral“ und der Moralphilosophie der russischen Dichter-Philosophen zu kommen. Die passionierte Rezeption, gegenseitige Irritationen sowie produktive Missverständnisse liefern reiches Material dafür. Doch nur
auf der Grundlage einer systematischen Untersuchung lässt sich ihre wahre Bedeutsamkeit zeigen – die Bedeutsamkeit der Plausibilitäten, die in ihrer scheinbaren Alternativlosigkeit als Grundlagen des Denkens vielleicht immer noch aktuell sind.
5.2 Nietzsches Entdeckung der Russen
Wie die Forschung zeigt, hat Nietzsche ziemlich viele russische Autoren rezipiert.
Schon als Jugendlicher stößt er auf Puschkins Gedichte,71 später liest er mit besonderem Interesse Väter und Söhne, den berühmten Roman Turgenjews über den russischen Nihilismus. Durch seine Bekanntschaft mit „einer jungen Russin“, Lou von
Salomé, gewinnt Russland für Nietzsche weiter an Bedeutung (EH Zarathustra 1, KSA
6, S. 336). Dieses „ungeheure[ ] Zwischenreich[ ]“ (JGB 208, KSA 5, S. 139), das immer
mehr Aufmerksamkeit für sich beanspruchte, wird bei ihm schließlich zu einer Metapher, zur Metapher für „die einzige Macht“ Europas, die noch „Dauer im Leibe hat,
die warten kann, die Etwas noch versprechen kann“ (GD Streifzüge, 39, KSA 6, S. 141),
aber auch zur Bühne für das Drama des europäischen Nihilismus und zum Versuchsfeld seines Heilmittels – des „beherzten Fatalismus ohne Revolte“ (GM II, 15, KSA 5,
S. 321).72
Dostojewski wurde von Nietzsche bekanntlich zufällig und ziemlich spät entdeckt. In einem berühmten, von der Forschung viel zitierten Brief an Franz Overbeck
vom 23. Februar 1887 sprach er begeistert von dem „Instinkt der Verwandtschaft“ und
dem glücklichsten Zufall seines Lebens, der nur noch mit der Entdeckung von Schopenhauer und Stendhal vergleichbar sei (KSB, 8, S. 27 f.). Der Glücksfall betraf die
Lektüre von L’esprit souterrain,73 und diese Tatsache liefert gute Argumente, um von
71 S. Curt Paul Janz, Die Kompositionen Friedrich Nietzsches, S. 180.
72 Zur philosophischen Bedeutsamkeit der Russland-Metapher bei Nietzsche s. Hartwig Frank, Die
Metapher Russland im Denken Nietzsches. Weitere Literatur zu Nietzsches Russland-Bild: Fritz Ernst,
Friedrich Nietzsche und die Russen. Zur Geschichte der deutschen Russophilie; Theo Meyer, Nietzsches
Rußlandbild: Protest und Utopie.
73 Theodor Dostoïewsky, L’esprit souterrain.
5.2 Nietzsches Entdeckung der Russen
457
einem anfänglichen Missverständnis zu sprechen. Dieses Missverständnis, das mit der
von Nietzsche verwendeten französischen Übersetzung von Dostojewskis Werk verbunden war, wurde in der Forschung detailliert dargestellt: Nicht die originalen
Aufzeichnungen aus dem Kellerloch hat Nietzsche gelesen, sondern eine merkwürdige
Kompilation aus diesem späteren, reifen Werk (1864) Dostojewskis und seiner frühen,
noch vor Sibirien geschriebenen Erzählung Die Zimmerwirtin (1847).74 Von den ursprünglichen Aufzeichnungen aus dem Kellerloch ist in der von Nietzsche benutzten
französischen Ausgabe nur noch der zweite Teil übrig geblieben, der Teil mit dem
Titel Lisa (По поводу мокрого снега (Bei nassem Schnee)). Was Die Zimmerwirtin
angeht, so ist diese romantisch geprägte, pathetisch-exaltierte Geschichte von Dostojewski selbst und seinen russischen Kritikern nur wenig geschätzt worden. Mit Recht
bemerkte Miller dazu:
It is difficult to believe he [Dostoevsky – E.P.] would have chosen to be ‚discovered‘ through this
particular piece.75
Zwei ganz verschiedene Figuren Dostojewskis erschienen dabei als ein und dieselbe
Person: einerseits ein romantischer Träumer, ein „Künstler in der Wissenschaft“, der
gegen mystisch-dunkle Mächte um die Seele einer schönen Frau kämpft und diesen
Kampf verliert, und ein „Paradoxalist“ andererseits, der an Selbsterkenntnis leidet
und eine Prostituierte beleidigt, weil er selbst beleidigt wurde und zu keiner Liebe
fähig ist. Nietzsche soll, der französischen Ausgabe folgend, die zweite Geschichte als
Zukunft dieses Anti-Helden verstanden haben und die erste als Vorgeschichte dazu.
Im zweiten Teil hat er darüber hinaus den Begriff „ressentiment“ gefunden, dem im
Russischen das Wort „Bosheit“ entsprach, und gerade in dem Sinne, wie Nietzsche
ihn selbst benutzte: Die Bosheit des Kellerlochmenschen ist die Sehnsucht nach
Rache und die Unfähigkeit zu ihr.76
Nietzsche berichtet mehrfach fasziniert von der entdeckten tiefen psychologischen Seelenverwandtschaft zum russischen Schriftsteller. Zwei Wochen nach
74 Vgl. Miller, Nietzsches “Discovery” of Dostoevsky; Müller-Buck, „Der einzige Psychologe“, S. 93 ff.
75 Miller, Nietzsches “Discovery” of Dostoevsky, S. 213. Miller weist dabei auf das Paradoxon hin, dass
in dieser Erzählung Dostojewskis gerade das zum Ausdruck kam, was Nietzsche als deutsche Romantik
schon in der Morgenröte verurteilte: „Der Cultus des Gefühls“, „die Künstler des Unsichtbaren,
Schwärmerischen, Märchenhaften, Sehnsüchtigen“ (M 197, KSA 3, S. 171 f.). Der Forscher bemüht sich
trotzdem darum, Nietzsches Faszination für diese romantisch-sentimentale Erzählung Dostojewskis in
die Perspektive seiner psychologischen Einsichten in das Christentum zu stellen.
76 Vgl. die französische Übersetzung (Dostoïewsky, L’esprit souterrain, S. 168) und die Stelle bei
Dostojewski (DGA 5, S. 104). Vgl. auch Dostoïewsky, L’esprit souterrain, S. 288. An dieser Stelle
beschreibt das Wort „ressentiment“ die Gefühle der Prostituierten Lisa, die allerdings nichts mit Rache
zu tun haben, sondern nur Beleidigt-Sein bedeuten (DGA 5, S. 174). (Auf die Tatsache, dass das Wort
„ressentiment“ in der französischen Übersetzung Dostojewskis zweimal vorkommt, wurde ich durch
einen Hinweis von Paolo Stellino aufmerksam gemacht).
458
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
dem Brief an Overbeck über seinen „zufällige[n] Griff in einem Buchladen“ schreibt
Nietzsche mit der gleichen Begeisterung für Dostojewski an Köselitz.77 Aber, wie
schon von der Forschung bemerkt wurde, diese Bekanntschaft ist kaum ein Zufall
gewesen. Der Name Dostojewskis müsste Nietzsche bereits früher bekannt gewesen
sein.78 Genauso hat er vielleicht die Zufälligkeit der Bekanntschaft mit Schopenhauer übertrieben.79 Jedenfalls lobte Nietzsche Dostojewski immer wieder, und stets für
sein psychologisches Genie. Nicht nur Die Zimmerwirtin, sondern auch andere frühe
romantisch geprägte Werke Dostojewskis faszinierten ihn, wie der Roman Erniedrigte und Beleidigte, welcher von noblen, ungeschickten Träumern und zynischen
Bösewichten handelt und in dem ein starker Einfluss Schillers zu spüren ist.80 Ob
Nietzsche durch diese Lektüre eine richtige Vorstellung von Dostojewski gewinnen
konnte, bleibt eine Streitfrage. Am meisten geschätzt wurden von ihm neben diesem Frühwerk Dostojewskis jedoch auch die Aufzeichnungen aus einem Totenhaus,
die Nietzsche „eins der ‚menschlichsten‘ Bücher, die es giebt“, genannt hat (Brief
vom 7. März 1887 an Köselitz, KSB, 8, S. 41). Nicht nur in Briefen, sondern auch in
seinen Schriften wies Nietzsche auf dieses Werk hin. So steht in der Götzen-Dämmerung:
Für das Problem, das hier vorliegt [das Problem der Psychologie eines Verbrechers – E.P.], ist das
Zeugniss Dostoiewsky’s von Belang — Dostoiewsky’s, des einzigen Psychologen, anbei gesagt,
von dem ich Etwas zu lernen hatte: er gehört zu den schönsten Glücksfällen meines Lebens, mehr
selbst noch als die Entdeckung Stendhal’s. (GD Streifzüge, 45, KSA 6, S. 147)
77 Vgl. den Brief vom 7. März 1887, KSB 8, S. 41 f. Beide Briefe werden uns noch einmal im dritten
Abschnitt dieses Kapitels beschäftigen, im Zusammenhang mit der Musik-Metapher.
78 Das ist die Meinung von Renate Müller-Buck. Sie weist dabei nicht nur auf Nietzsches früheres Lob
der russischen psychologischen Einsicht hin (MA I Vorrede 8, KSA 2, S. 22), sondern auch auf eine
negative Rezension von Jenseits von Gut und Böse (J. V. Widmann, Nietzsches gefährliches Buch, Berner
Bund vom 16./17. September 1886, 37, Nr. 256, angeg. nach: Müller-Buck, „Der einzige Psychologe“,
S. 91), der Nietzsche viel Aufmerksamkeit geschenkt hat und die er „einen starken Aufsatz“ nannte
(Brief vom 20. September 1886 an Köselitz, KSB 7, S. 251). Der Rezension wurde ein Motto aus Dostojewskis Roman Der Jüngling vorangeschickt, d. h. Nietzsche wurde hier zum ersten Mal, obgleich
indirekt, mit einer handelnden Person Dostojewskis (einem sehr negativ dargestellten Protagonisten,
Lambert) verglichen. Später wird diese Betrachtungsweise, besonders unter den russischen Forschern,
immer häufiger vertreten.
79 S. dazu Johann Figl, Nietzsches Begegnung mit Schopenhauers Hauptwerk. Unter Heranziehung eines
frühen unveröffentlichten Exzerptes. Figl zeigt überzeugend, dass Nietzsche Schopenhauers Die Welt als
Wille und Vorstellung schon zu seiner Bonner Studienzeit bei Schaarschmidt gekannt haben müsste.
Nietzsches Beschreibung seiner „Entdeckung“ Schopenhauers im Leipziger Antiquariat war, so Figl,
eher eine literarische Stilisierung.
80 Theodor Dostoïewsky, Humiliés et offensées. Den Roman hat Nietzsche auf die Empfehlung Overbecks hin gelesen, „mit dem größten Respekt vor dem K ü n s t l e r“ (Brief an Köselitz vom 7. März 1887,
KSB, 8, S. 42). Gleich danach erhielt er von Köselitz einen Reclam-Band mit anderen frühen Erzählungen Dostojewskis, diesmal auf Deutsch: F.M. Dostojewskij, Erzählungen von F.M. Dostojewskij.
5.2 Nietzsches Entdeckung der Russen
459
Diesem Problem und diesem Zeugnis werden wir uns noch am Ende des Kapitels
zuwenden müssen. Die Psychologie des Verbrechers ist einer (wenn auch nicht der
einzige) der Schwerpunkte von Nietzsches Dostojewski-Rezeption gewesen.
Die weitere Bekanntschaft Nietzsches mit den Werken Dostojewskis ist weniger
gut dokumentiert und bleibt Gegenstand der Diskussion. Höchstwahrscheinlich erhielt er zumindest „Kunde“81 von Dostojewskis großen Romanen – Verbrechen und
Strafe82 und Der Idiot83. Der Roman Die Brüder Karamasow ist ihm wahrscheinlich
unbekannt geblieben.84 Was wir allerdings genau wissen, ist die Tatsache, dass
Dostojewskis tragischster Roman, Die Dämonen (Les Possédés85), von Nietzsche sehr
aufmerksam gelesen wurde. Er hat diesen Roman nicht nur gelesen, sondern auch
lange Exzerpte herausgeschrieben, die in seinem Notizheft unter den Vorbereitungsnotaten zu Der Antichrist zu finden sind. Dostojewskis Roman ist jedoch nicht das
einzige Werk der russischen Literatur, dessen Lektüre in diesem Notizheft nachgespürt werden kann. Betrachten wir diese Nachlassnotate etwas genauer.
Die Exzerpte aus dem Roman Die Dämonen macht Nietzsche mindestens ein
halbes Jahr nach seiner Entdeckung des tiefsten „Psychologen“, von dem er selbst
„Etwas zu lernen hatte“, d. h. sie sind in gewissem Sinne ein Fazit seiner DostojewskiLektüre.86 Zu ungefähr derselben Zeit macht er eine weitere Entdeckung, die in seinen
veröffentlichten Werken so gut wie gar nicht erwähnt wird – die Entdeckung von Leo
81 Vgl. Gesemann, Nietzsches Verhältnis zu Dostoevskij, S. 136.
82 V. a. der Brief an Overbeck vom 13. Mai 1887 spricht dafür (KSB 8, S. 74 f.). Zu weiteren Hinweisen in
Briefen und im Nachlass s. Müller-Buck, „Der einzige Psychologe“, S. 111 f. Es gibt allerdings keine
direkte Bestätigung dieser Bekanntschaft. Bei allen Übereinstimmungen kann es sich durchaus um
einen Zufall bzw. konsequentes Durchdenken derselben Probleme handeln. So hält Gerigk das Urteil
Zarathustras über den „bleichen Verbrecher“ für die „beste Zusammenfassung von Schuld und Sühne“
(H.-J. Gerigk, Dostojewskij, der „vertrackte“ Russe. Die Geschichte seiner Wirkung im deutschen Sprachraum vom Fin de siècle bis heute, S. 27). Zeitlich konnte diese „Zusammenfassung“ jedoch keine Folge
der Bekanntschaft sein, denn Zarathustra ist vor der „Entdeckung“ Dostojewskis geschrieben worden.
83 Dafür kann man als Beleg mehrere Erwähnungen Dostojewskis im Zusammenhang mit der
Deutung Jesu als Idiot in Der Antichrist und besonders in den Nachlassnotaten angeben (s. bes.
Frühjahr 1888, 15[9], KSA 13, S. 409). Diese Deutung wird uns weiter beschäftigen. Die Frage, ob es sich
in diesem Fall um das bei Nietzsche so oft vorkommende konsequente Weiterdenken handelt oder um
eine tatsächliche Bekanntschaft mit dem Roman, wird in der Forschung größtenteils im letzteren Sinne
beantwortet. Nach Sommer dürften Nietzsche „die Charakteristika des Fürsten Myschkin zumindest
sekundär zur Kenntnis gebracht worden sein“ (Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches „Der
Antichrist“, „Ecce homo“, „Dionysos-Dithyramben“, „Nietzsche contra Wagner“. Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken, S. 162; vgl. auch Andreas Urs Sommer, Kommentar zu
Nietzsches „Der Fall Wagner“, „Götzen-Dämmerung“. Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich
Nietzsches Werken, S. 187 f. S. dazu auch Paolo Stellino, Jesus als ‚Idiot‘. Ein Vergleich zwischen Nietzsches „Der Antichrist“ und Dostojewskijs „Der Idiot“.
84 Der Roman wurde jedoch schon im Jahr 1884 ins Deutsche und 1888 ins Französische übersetzt.
85 Theodore Dostoïevsky, Les Possédés (Bési).
86 Die Exzerpte finden sich in einem zwischen November 1887 und März 1888 geführten Notizheft: 11
[331–348], KSA 13, S. 141–152; KGW IX/7, S. 41–51. In der weiteren Darstellung dieser Exzerpte wird die
460
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Tolstoi und seiner Lehre des ‚wahren‘ Christentums.87 Nicht als Schriftsteller, sondern
als Prediger, als Übersetzer und Interpret der Evangelien, als Christ bekommt Nietzsche Tolstoi zu Gesicht. Und, wie wichtig diese Bekanntschaft auch sein mochte, er
inszeniert diesmal keine Begeisterung und keine zufällige Entdeckung – aus Gründen, die noch zu klären sind. Was mit Sicherheit behauptet werden kann, ist, dass es
keinesfalls die Unbedeutsamkeit war, die ihn davon abhielt, von Tolstoi als seiner
Quelle zu sprechen.
Tatsächlich ist man erstaunt, wenn man Nietzsches Vorbereitungsnotizen zu Der
Antichrist genauer betrachtet: Die Auszüge aus dem Traktat Was ist mein Glaube? und
die Kommentare dazu (Nachlass, November 1887 – März 1888, 11[239–295], KSA 13,
S. 93–117; KGW IX/7, S. 87–106) nehmen mindestens doppelt so viel Platz ein als die
Auszüge aus Dostojewskis Roman und gehen letzteren voraus. Die Themen, die dabei
angesprochen und mit Zitaten von Tolstoi bestätigt werden, lassen sich sehr gut in Der
Antichrist wiedererkennen. Sie sind alles andere als unwichtig. Hier sind einige von
ihnen: die ursprüngliche „A b o l i t i o n d e s S t a a t e s “ und der Gesellschaft im Christentum (11[239; 252; 273]); die Kirche als Verrat am Christentum und als sein Gegenteil
(11[243; 280; 294]); Paulus als Verfälscher des Christentums Jesu (11[281; 282]); der
Nicht-Widerstand gegen das Böse als Schlüssel zur frohen Botschaft, die durch Jesus
allein vertreten und schon von seinen Jüngern missverstanden wurde (11[246–250]);
die Verleugnung des persönlichen Lebens durch das Christentum Jesu (11[256; 279]);
die Lüge der Kirche über die persönliche Unsterblichkeit als Mittel, die Menschen vom
Leben wegzulocken und eine Priester-Herrschaft zu errichten (11[262–263; 266–267;
276]); die Religion und die europäische Wissenschaft als Fälschung des Lebens „auf
gleiche[m] Boden“ (11[264–265]); das Reich Gottes in der Lehre Jesu nicht als Zukunft,
nicht als Lohn und Strafe, sondern als Friede des Herzens und Sinn des Irdischen
(11[268–270]); der Glaube an das Jenseits als Absurdität und Mangel an intellektueller
Einsicht (11[271]); der Glaube an die Erlösung durch den Glauben als höchste Absurdität und am weitesten entfernt vom ursprünglichen Christentum (11[275]); das Tun, die
Praxis, nicht ein metaphysisch-fantastischer Glaube an die Erlösung und Vergeltung
als wahrer Sinn des Christlichen (11[261; 269–270; 273; 295]). Diese Liste könnte noch
weitergeführt werden. Erstaunlich ist, wie Nietzsche manche für Tolstoi vielleicht
topographische Wiedergabe von Nietzsches Notizheften in der neunten Abteilung der Kritischen
Gesamtausgabe (KGW IX) besonders berücksichtigt.
87 Dass Nietzsche Tolstoi viel weniger als Dostojewski erwähnt, ist die Erklärung für das erstaunlich
geringe Interesse an Nietzsches Tolstoi-Lektüre vonseiten der Nietzsche-Forschung. Eine Ausnahme
stellt nur noch ein von der sozialistischen Ideologie belasteter Aufsatz von Peter Kessler dar (Peter
Kessler, Tolstoj-Studien des späten Nietzsche). Im umfassenden Kommentar zu Der Antichrist von
Sommer ist diese wichtige Quelle zwar erwähnt und in ihrer Bedeutung für Nietzsches „Typus des
Erlösers“ erkannt worden, doch ist ihr auch hier vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt
worden (Andreas Urs Sommer, Friedrich Nietzsches „Der Antichrist“. Ein philosophisch-historischer
Kommentar, S. 282–284; vgl. auch Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches „Der Antichrist“,
„Ecce homo“, „Dionysos-Dithyramben“, „Nietzsche contra Wagner“, S. 105, 153 f.).
5.2 Nietzsches Entdeckung der Russen
461
selbst noch nicht ganz klare Schwerpunkte zur Zeit von Was ist mein Glaube? hervorhebt, die später beim russischen Schriftsteller immer mehr an Bedeutung gewinnen sollten, besonders das, was den „Frieden des Herzens“ und das „Reich Gottes“
„inwendig in euch“ angeht. Offensichtlich ist ihm Tolstois Intention nicht nur klar,
sondern auch aus dem Kontext seiner weiteren Lektüre immer wichtiger geworden,
z. B. als Gegensatz zu Renans Deutung Jesu, aber auch im Zusammenhang mit dem
Roman Dostojewskis. Tolstoi war allerdings kein bloßer Einfluss, denn in den Nachlassnotaten und viel deutlicher in Der Antichrist ist nicht zu übersehen, wie Nietzsche
Tolstois Ideen des ‚ursprünglichen‘ Christentums transformiert, wie er sie umdeutet
und anpasst – an seine „letzte Moral“. Mit dieser Umdeutung wird allerdings auch die
„letzte Moral“ selbst transformiert und – für uns besonders wichtig – ihre Plausibilitäten werden dadurch sichtbar. Was Tolstois Lehre betrifft, so wird sie am Ende, in Der
Antichrist, zwar sehr wohl wieder erkennbar, sie wird dort jedoch an einem anderen
Maßstab gemessen – an dem der Künstlerwelt Dostojewskis. Und dieses Zusammenfügen zweier fremder Stimmen wird in den Dienst eines neuen, ihnen selbst fremden
Ziels gestellt: in den Dienst der Umwertung aller Werte des christlichen Abendlandes.
Nur einige Seiten in Nietzsches Notizheft trennen die Auszüge aus Was ist mein
Glaube? von denen aus den Dämonen. Die dazwischen behandelten Themen sind
vielfältig, lassen sich aber als, wenn auch indirekte, Vorbereitung zu Der Antichrist
verstehen, z. B. die Beschreibung verschiedener menschlicher „Typen“ (stoisch, christlich, buddhistisch) (11[297]) oder die Deutung der Liebe als äußerstem Egoismus (11
[303; 307]). Es finden sich allerdings auch mehrere Ausführungen zur Kunst, besonders zum Theater und zur Musik (11[304; 311–312) und zu Wagner (11[314–322]), die
aller Wahrscheinlichkeit nach zum Fall Wagner gehören. Nietzsche beschäftigt sich
weiter mit dem Thema der Kirche und ihren „M i s s v e r s t ä n d n i s s e [ n ] “ (11[324]) und
entwirft das berühmte „T a g e b u c h d e s N i h i l i s t e n “ (11[327–328]). Zur Illustration
seiner „Phasen der Verachtung“ und der ihnen folgenden „K a t a s t r o p h e “ (11[327],
KSA 13, S. 139; KGW IX/7, S. 54) wird gerade der Roman Dostojewskis genutzt.
Nietzsche exzerpiert Die Dämonen vom Ende her, genauso wie er seine Notizhefte
füllt. Als erstes kommt so der letzte, vor dem Selbstmord geschriebene Brief von
Stawrogin. Dieses Geständnis eines Selbstmörders, der allerdings behauptet, er sei
auch zu einem Selbstmord nicht fähig, steht somit für die nihilistische Katastrophe
bzw. für die letzte Phase der Verachtung: die Verachtung „selbst gegen die Verachtung“ (11[327], KSA 13, S. 139; KGW IX/7, S. 54). Stawrogin ist derjenige, der selbst zu
Hass und Vernichtung nicht fähig ist. Denn er glaubt an nichts mehr. Das ist „nur eine
N e g a t i o n o h n e G r ö ß e u n d o h n e K r a f t “ (11[331], KSA 13, S. 142; KGW IX/7, S. 51),
so Nietzsches Hervorhebung. Er sieht darin „das Verehrungswürdigste am Menschen“, die „Folgerichtigkeit“, aber auch „de[n] letzte[n] Hunger nach ‚Wahrheit‘“ (11
[332], KSA 13, S. 142 f.; KGW IX/7, S. 48). So wird die Figur Stawrogins als Material „zur
Psychologie des Nihilisten“ gedeutet. „Die Logik des Atheismus“ wird durch Kirillow
mit seinem Gott-Menschen vertreten, der seine Göttlichkeit ebenso durch einen Selbstmord beweisen muss. Zwei Übersetzungsungenauigkeiten sorgten dabei dafür, dass
462
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
der von Dostojewski intendierte Sinn bei Nietzsche etwas verzerrt ankam. In Nietzsches Notizen sagt Stawrogin von Kirillow:
Der großherzige Kiriloff ist durch einen Gedanken besiegt worden: er hat sich erschossen. Ich
sehe die Größe seiner Seele darin, dass er den Kopf verloren hat. (11[331], KSA 13, 142; KGW IX/7,
S. 51)
Im Russischen steht dagegen wörtlich:
Великодушный Кириллов не вынес идеи и – застрелился; но ведь я вижу, что он был
великодушен потому, что не в здравом рассудке. (Der großzügige Kirillow ist durch einen
Gedanken besiegt worden und – hat sich erschossen. Dennoch sehe ich nur zu gut, dass er bloß
deshalb großzügig war, weil er verrückt gewesen ist.) (DGA 10, S. 514)
Eine weitere Ungenauigkeit ist das Wort „Unabhängigkeit“ (11[331], KSA 13, S. 144;
KGW IX/7, S. 49), die von Kirillow zum Attribut der neuen Gottheit erklärt wurde. Bei
Dostojewski steht an dieser Stelle das Wort „своеволие“ (der Eigenwille). Das Verrückte der fantastischen Marotte, von der auch in den Aufzeichnungen aus dem Kellerloch die Rede war, ist Nietzsche in beiden Fällen als Leser der Dämonen entgangen.
Aus seiner Sicht wollte Kirillow seinen „Unglauben“ „affirmiren“ (11[331], KSA 13,
S. 144; KGW IX/7, S. 49). Hingegen wird er von Dostojewski gerade als Gläubiger
dargestellt, der „Alles anbetet“ (DGA 10, S. 189). Wie Stawrogin selbst, der einen
Selbstmord begeht, nachdem er sich zu einem Selbstmord unfähig erklärt hat, ist auch
Kirillow schließlich inkonsequent. Mehr noch: Seine Sehnsucht nach der äußersten
Konsequenz und Redlichkeit ist für Dostojewski ein Kennzeichen dafür, dass er nicht
bei Verstand ist.
Diese Nuancen sorgen für weitere Verschiebungen. Als Nächstes taucht in Nietzsches Notizen der Sozialist und Provokateur Werchowenski auf – mit seiner Idee der
totalen Spionage, der totalen Gleichheit und Unfreiheit im Namen der Freiheit. Nietzsche übernimmt fast die ganze enthusiastische Rede dieses typischen Anti-Helden
Dostojewskis, der Enthusiast und Schuft zugleich ist. Er lässt weder seine Gleichsetzung der Ziele des Papsttums mit denen der sozialistischen Bewegung noch seine
Hassausrufe gegen alles Aristokratische und seine leidenschaftlichen Plädoyers für
Anarchie und Sklaverei aus, auch nicht die Ausdrücke seiner Bewunderung der
Schönheit, seiner Liebe zur Schönheit. Diese schreibt Nietzsche doppelt aus – auf
Deutsch und noch einmal auf Französisch:
Ich bin Nihilist, aber ich liebe die Schönheit – je suis nihiliste, mais j’aime la beauté. Lieben die
Nihilisten sie nicht? Das was sie nicht lieben, das sind Götzenbilder: ich, ich liebe Götzenbilder
und Sie sind das meinige! (11[341], KSA 13, S. 149; KGW IX/7, S. 42)
Diese umfangreiche Passage schließt Nietzsche in seinen Notizen mit der rätselhaften
Überschrift „Die Theatromanie“ und einer weiteren – „ceci tuera cela“ (in Anführungszeichen) – ab (11[342–343], KSA 13, S. 150; KGW IX/7, S. 43). Es bleibt allerdings
noch eine Position zu erörtern – Schatows Idee vom Volk als „Leib Gottes“. Auf den
5.2 Nietzsches Entdeckung der Russen
463
Vorwurf Stawrogins („[…] dass Sie Gott bis zu einem bloßen Attribut der Nationalität
herabgezogen haben…“) reagiert Schatow aufbrausend: „Ich hätte Gott bis zu einem
Attribut der Nationalität herabgezogen? […] Im Gegenteil, ich hebe das Volk bis zu
Gott empor.“88 Diese Formulierung, und nur sie, streicht sich Nietzsche als Hauptthese an (KGW IX/7, S. 41). Dostojewskis Bedenken, ob eine Religion überhaupt ihren
Sinn behalte, die Gott als Metapher des eigenen Nationalstolzes benutzt, bleibt somit
unerörtert. Dies waren die Bedenken, die Dostojewski nur indirekt, nur in einem
„Kunstbild“ angedeutet hat – dem Kunstbild, das seinem Pathos als Publizist, der
gerade an die große Zukunft Russlands glaubte, direkt widersprach. In diesem Pathos
stimmte Dostojewski als Visionär und Prediger (nicht als Künstler) mit seinem Schatow überein. Und Nietzsche scheint nur an diesem Pathos interessiert zu sein. Es ist in
seinem Sinn, im Sinne von Der Antichrist gewesen, dass das Volk, das nicht an die
eigene Göttlichkeit und Ausschließlichkeit seiner Vorherbestimmung glaubt, das sich
seine eigenen Begriffe von Gut und Böse nicht schaffen kann, notwendig zugrunde
gehen wird. Wenn die Religion nicht mehr der Ausdruck des Willens zur Macht sein
kann, werde sie zu Gift; indem Gott sich in einen Kosmopoliten verwandelt, werde
er zum Décadence-Gott, zum Ausdruck der „Ohnmacht zur Macht“ (AC 16, KSA 6,
S. 183).
Tatsächlich ist an dieser Stelle der These zuzustimmen, Nietzsche habe Dostojewski „in erster Linie als großen Psychologen rezipiert […] und erst danach als
Künstler“.89 Denn die handelnden Personen Dostojewskis sind für ihn gleichberechtigte Stimmen, bloße Ideen. Dass Kirillow verrückt ist und dass Schatows Idee durch
bestimmte Ereignisse im Roman relativiert wird, dass die beiden, wie auch Werchowenski, nicht selbst auf ihre Ideen gekommen sind, sondern sie alle von Stawrogin
erhalten hatten, scheint Nietzsche als Leser überhaupt nicht wichtig zu sein. Die
Gedanken der handelnden Personen Dostojewskis werden von ihm in der gleichen
Weise behandelt wie die Tolstois und die Renans. Es ist dennoch wichtig, nicht zu
vergessen, dass wir es hier mit Nachlassnotaten zu tun haben, die nicht für Leser
bestimmt waren, sondern die Nietzsche nur „für sich“ niedergeschrieben hat. Die
Ideen und ihr Kontext im Roman beschäftigten ihn dabei als Material und als Vorbereitung zu seinem eigenen Werk. Deshalb darf eine Selektion kaum verwundern.
Aber auch mit dieser Einschränkung scheint der Vorwurf, Nietzsche habe das Künstlerische in Dostojewskis Roman übersehen, nicht ganz berechtigt zu sein.90 Denn
Nietzsche war gerade für die künstlerisch-stilistischen Nuancen seiner Lektüre besonders sensibel. Wie er in einem Brief betonte, hatte er den „größten Respekt vor dem
K ü n s t l e r Dostoiewsky“ (Brief an Köselitz vom 7. März 1887, KSB 8, S. 42). Er be-
88 Dostojewski, Die Dämonen, S. 345.
89 Müller-Buck, „Der einzige Psychologe“, S. 90.
90 Bei Müller-Buck ist diese These keinesfalls als Vorwurf zu verstehen. Sie betrachtet jedoch die
Nachlassnotate Nietzsches als Beleg dafür, dass Dostojewskis Bedeutsamkeit für ihn primär „psychologischer“ und nicht künstlerischer Art war.
464
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
schrieb dort seinen Eindruck von Dostojewskis Werken mit Hilfe einer Musik-Metapher: „eine Art unbekannter Musik“ (KSB 8, S. 41). Seine Exzerpte könnten zwar kaum
wiedergeben, wieviel er von der „Kunst“ Dostojewskis mitbekommen hat, doch geben
sie Hinweise für ein tieferes Verständnis – die „Theatromanie“, das Fantastisch-Theatralische der Roman-Welt Dostojewskis. Was diese „Theatromanie“ bei Dostojewski
bedeutet, wurde im vorigen Kapitel ausgeführt. Die mehrstufige Reflexion über die
Lage, in der sich Dostojewskis Helden befinden, ihr Entsetzen über die Inszenierungen, deren Urheber sie selbst sind, die irritierende Mischung des Tragischen und des
Komischen – das alles ist Nietzsche keinesfalls entgangen und wurde von ihm als
Besessenheit (eine Manie) vom Theater gedeutet.91 So riss Nietzsche, indem er das
Wort „Theatromanie“ als Überschrift benutzte,92 die Welt des Nihilismus in einem Zug
um – die Welt, die im Roman des russischen Schriftstellers als Tragödie in mehreren
Akten und in Der Antichrist als europäische Tragikomödie geschildert wird. Das
Thema des Theaters und der „Theater-Leidenschaften“ (11[311], KSA 13, 131; KGW IX/
7, S. 69) in Nietzsches Nachlass, so lässt sich mit guten Gründen vermuten, gehörte
somit nicht nur in den Fall Wagner, sondern auch in den Antichrist. Denn in Der
Antichrist sprach Nietzsche von einem „schmerzliche[n], ein[em] schauerliche[n]
Schauspiel“, von dem er den „Vorhang“ wegzuziehen hatte (AC 6, KSA 6, S. 172) –
vom Schauspiel des europäischen Christentums.
Auch die zweite Überschrift – „ceci tuera cela“ – hob gerade die Kunst als große
Kraft im verhängnisvollen Kampf um die europäischen Werte hervor. Es war der Titel
eines Kapitels aus dem Roman Nôtre-Dame de Paris von Victor Hugo, welches vom
Zugrundegehen der Kunst im großen Stil – der Kirche – durch die Kunst des Buchdrucks handelte. So wurde dieser Satz im Roman kommentiert:
C’était d’abord une pensée de prêtre. C’était l’effroi du sacerdoce devant un agent nouveau,
l’imprimerie. C’était l’épouvante et l’éblouissement de l’homme du sanctuaire devant la presse
lumineuse de Gutenberg. […] Cela signifiait qu’une puissance allait succéder à une autre puissance. Cela voulait dire: La presse tuera l’église.
Mais sous cette pensée, la première et la plus simple sans doute, il y en avait à notre avis une
autre, plus neuve, un corollaire de la première moins facile à apercevoire et plus facile à
contester, une vue, tout aussi philosophique, non plus du prêtre seulement, mais du savant et de
l’artiste. […] elle signifiait qu’un art allait détrôner un autre art. Elle voulait dire: L’imprimerie
tuera l’architecture.”93
Man denke nur daran, was Nietzsche selbst über die Kirche als „de[n] letzte[n]
Römerbau“ (FW 358, KSA 3, S. 602) sagte, welcher u. a. durch die Philologen-Arbeit
vernichtet wurde (FW 358, KSA 3, S. 603; AC 47, AC 6, S. 226). Die Kirche des Westens
war die Kunst des großen Stils; auch wenn sie auf einer Lüge aufgebaut worden war,
91 Ob Nietzsche dabei Dostojewskis Figuren oder den russischen Schriftsteller als Künstler selbst
meint, bleibt unklar.
92 Dank der topographischen Ausgabe ist dies deutlich zu sehen: KGW IX/7, S. 45.
93 Victor Hugo, Nôtre-Dame de Paris, S. 174 f.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
465
so war es die Lüge der Kunst. Dieser über Jahrtausende währenden Lüge wollte er jetzt
den Krieg erklären. Und die Lektüre der russischen Autoren sollte ihm dabei helfen. Ob es in deren Sinne war oder nicht – sie sollten ihm helfen, das europäische
Christentum in seinen Grundfesten zu erschüttern. Aber auch der zweite, feinere,
philosophische Sinn der Sentenz aus dem Roman Hugos („une vue, tout aussi philosophique, […] du savant et de l’artiste“) dürfte Nietzsche aufgefallen sein, nämlich
dass jede Kunst, sei es auch die Kunst zu lügen, nur durch eine andere Art von Kunst
verdrängt werden kann, sodass man sich schließlich weiterhin auf dem Boden der
Kunst bewegt, wenn man der alten Lüge den Krieg erklärt.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
Nietzsches Werk Der Antichrist, das aus den analysierten Notaten im Jahr 1888 (im
letzten Schaffensjahr Nietzsches) entstanden ist, gehört zweifelsohne zu seinen kämpferischsten Schriften. Schon der Untertitel gibt dies zu verstehen: „Fluch auf das
Christentum“. Das Buch, das zunächst als erster Teil einer umfangreichen Schrift
Umwerthung aller Werthe gedacht wurde, wird am Ende selbst zu einer solchen
Umwertung, zu einer selbstständigen Schrift,94 mit der Nietzsche ein vorläufiges Fazit
seines Lebenswerks zieht. Denn zu einer endgültigen Bilanz kommt er dann in Ecce
homo, in dem Werk, in dem er sich selbst u. a. wieder als Antichrist bezeichnet (EH
Bücher 2, KSA 6, S. 302). In Der Antichrist wurde das Fazit in Form einer äußerst
scharfen Entgegensetzung zum Ausdruck gebracht – nicht bloß der von Nietzsches
eigener Person und der Person Christi, sondern von seinem eigenem Denken, seinen
Wertschätzungen, seinem Geschmack einerseits und der Geschichte der abendländischen Philosophie, der zweitausendjährigen Geschichte der abendländischen intellektuellen Kultur andererseits. Schon das Vorwort, schon die ersten Sätze weisen auf
diesen Gegensatz hin:
Dies Buch gehört den Wenigsten. Vielleicht lebt selbst noch Keiner von ihnen. […] was liegt am
R e s t ? – Der Rest ist bloss die Menschheit. (AC Vorwort, KSA 6, S. 167 f.)
„Erst das Übermorgen“ gehöre vielleicht diesem Buch. Dieses Übermorgen solle aber
jetzt erobert werden. So, dass man eines Tages eine neue Zeitrechnung ab diesem
verhängnisvollen Moment der Geschichte beginnen wird – nicht ab dem ersten Tag
des Christentums, sondern ab seinem letzten Tag, ab Nietzsches Umwertung aller
Werte.
Schon dieser gleich am Anfang des Buches deklarierte und am Ende desselben
noch einmal bestätigte ungeheure Anspruch sorgt für die Abweisung eines unvor-
94 S. dazu KSA, 14, 434 f. Zur Entstehung des Werkes als erstem Teil der Umwerthung aller Werte s.
Sommer, Friedrich Nietzsches „Der Antichrist“, S. 40 ff.
466
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
bereiteten Lesers. Und die Irritation kann bei der weiteren Lektüre nur noch zunehmen: Das ganze Buch ist voll von kämpferischen Angriffen und scharfen Verurteilungen, von herabwürdigenden Einschätzungen der Gegner und vorgreifenden
Verspottungen eines jeden, der ihm widersprechen sollte. Es ist alles andere als
„anständig“ und „bescheiden“, obwohl es sich gerade diese Eigenschaften zuschreibt – mit einer fast unanständig unbescheidenen Hartnäckigkeit (vgl. AC 13, KSA
6, S. 179; AC 60, KSA 6, S. 250). Noch schlimmer: Sein Pathos selbst (denn das Buch
ist in einem sehr pathetischen, fast exaltierten Ton geschrieben) scheint an mehreren
Stellen die einzige Begründung der vorgetragenen Gedanken, ihr einziger ‚Beweis‘ zu
sein.95 Und diese Gedanken, diese „Umwertung“ selbst – ist sie nicht eine bloße
Umkehrung dessen, was dieses Buch angreift? So behauptete Tolstoi einmal, höchstwahrscheinlich gerade über Nietzsches Der Antichrist:
Turgenjew hat scharfsinnig bemerkt, dass es umgekehrte Gemeinplätze gäbe, die meistens von
talentlosen Menschen verwendet werden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. […]
Genauso weiß die ganze Welt, dass die Tugend in der Unterdrückung der Leidenschaften, in
der Selbstlosigkeit besteht. Das weiß nicht allein das Christentum, gegen das Nietzsche angeblich
einen Krieg führt, sondern das ist ein ewiges Gesetz, bis zu dem die Menschheit gereift ist – im
Brahmanismus, Buddhismus, Konfuzianismus und in der alten persischen Religion. Und nun
erscheint plötzlich jemand, der deklariert, er habe herausgefunden, dass die Selbstlosigkeit,
Sanftmut, Demut und die Liebe Laster sind, an denen die Menschheit zugrunde geht (er meint
das Christentum und vergisst dabei andere Religionen). Es ist verständlich, dass eine solche
Behauptung zuerst verblüfft. Dann aber, nach einer kurzen Überlegung und da keine Beweise
dieses seltsamen Lehrsatzes in dem Buch zu finden sind, wird jeder vernünftige Mensch es
wegwerfen und sich nur noch wundern, dass es zu unserer Zeit keine solche Dummheit gibt, die
einen Verleger nicht finden könnte. (TGA 35, S. 184)96
Diese harte Beurteilung sieht für den Antichrist nicht gänzlich unbegründet aus. Es
scheint, als habe Nietzsche hier alle Nuancierung weggelassen und seine eigenen
komplexen Auslegungen moralischer Phänomene vergessen, die bspw. seiner Fröhlichen Wissenschaft, besonders ihrem letzten Buch, philosophische Tiefe und Bedeutsamkeit verliehen hatten.97 Hier scheint er dagegen zu glauben, man könne von einer
95 Vgl. Collis Einschätzung der letzten Schaffensjahre Nietzsches als Zeit der überhobenen Ansprüche, der Ermüdung und Wiederholungen, der „Niederlage“ und der „Ohnmacht“ – der „Ohnmacht des
Jägers, der seine Pfeile verschossen hat“. Und sogar: „Hier kommt das Pathologische ins Spiel.“
(Giorgio Colli, Nachwort (KSA 6, 456)) Gegen diese Herabsetzung der philosophischen Bedeutung der
letzten Schriften Nietzsches entwirft Werner Stegmaier eine philosophische Interpretation: Werner
Stegmaier,Nietzsches Kritik der Vernunft seines Lebens.
96 Der Ausdruck „umgekehrte Gemeinplätze“ ist in Turgenjews Roman Väter und Söhne zu finden:
Иван С. Тургенев, Отцы и дети, S. 217.
97 Vgl. das Urteil van Tongerens: „Nietzsche’s Anti-Christ is a strange book and probably not one of
his best written.” (van Tongeren, Reinterpreting Modern Culture, S. 262) Dennoch zeigt van Tongeren in
seiner Darstellung des Werkes, dass es sich nicht bloß um „a cry of hatred“ (S. 269) handelt, sondern
auch um eine nuancierte Analyse des Christentums.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
467
„V e r d o r b e n h e i t des Menschen“ „m o r a l i n f r e i “ reden (AC 6, KSA 6, S. 172), und
dies, weil man wisse, was „Realität“, was „Wirklichkeit“, was „Natur“ ist, was das
Leben und was gesundes Leben sein soll und was, umgekehrt, als „Lüge“, was als
„Verbrechen an der Menschheit“ (AC 49, KSA 6, S. 228), als „Verbrechen am Leben“
(AC 47, KSA 6, S. 47) zu verstehen ist. Hier sind nur einige Stellen:
Man hatte aus der Realität eine ‚Scheinbarkeit‘ gemacht; man hatte eine vollkommen e r l o g n e
Welt, die des Seienden, zur Realität gemacht … (AC 10, KSA 6, S. 177)
Weder die Moral noch die Religion berührt sich im Christenthum mit irgend einem Punkte
der Wirklichkeit (AC 15, KSA 6, S. 181)
[…] jene ganze Fiktions-Welt hat ihre Wurzel im H a s s gegen das Natürliche ( — die Wirklichkeit! —) […] (AC 15, KSA 6, S. 181 f.)
In Gott dem Leben, der Natur, dem Willen zum Leben die Feindschaft angesagt! (AC 18,
KSA 6, S. 185)
Die Liebe ist der Zustand, wo der Mensch die Dinge am meisten so sieht, wie sie n i c h t sind.
(AC 23, KSA 6, S. 191)
[…] dieser Preis war die radikale F ä l s c h u n g aller Natur, aller Natürlichkeit, aller Realität,
der ganzen inneren Welt so gut als der äusseren. (AC 24, KSA 6, S. 191)
Die Geschichte Israels ist unschätzbar als typische Geschichte aller E n t n a t ü r l i c h u n g der
Natur-Werthe […] Ursprünglich, vor allem in der Zeit des Königthums, stand auch Israel zu allen
Dingen in der r i c h t i g e n , das heisst der natürlichen Beziehung. (AC 25, KSA 6, S. 193)
Der Gottesbegriff gefälscht; der Moralbegriff gefälscht […]. (AC 26, KSA 6, S. 194)
Auch der Priester weiss, so gut es Jedermann weiss, dass es keinen ‚Gott‘ mehr giebt, keinen
‚Sünder‘, keinen ‚Erlöser‘, – dass ‚freier Wille‘, ‚sittliche Weltordnung‘ L ü g e n sind […]. (AC 38,
KSA 6, S. 210)
In der Vorstellungs-Welt des Christen kommt Nichts vor, was die Wirklichkeit auch nur
anrührte […]. (AC 39, KSA 6, S. 212)
Nichts war mehr vorhanden, als dieser Falschmünzer aus Hass [Paulus – E.P.] begriff, was
allein er brauchen konnte. N i c h t die Realität, n i c h t die historische Wahrheit!… (AC 42, KSA 6,
S. 216)
Die grosse Lüge von der Personal-Unsterblichkeit zerstört jede Vernunft, jede Natur im
Instinkte. (AC 43, KSA 6, S. 217)
Nietzsches Kriterien des „Natürlichen“, des „Wirklichen“ scheinen dabei ziemlich
flach zu sein: „die Zeugung […], das Weib, die Ehe“ (AC 56, KSA 6, S. 240) plus
kriegerische Instinkte, die Nietzsche als Männer-Instinkte würdigt (vgl. AC 19, KSA 6,
S. 249). Alles, was diese Instinkte nicht fördert, solle scharf verurteilt und gnadenlos
bekämpft werden – als „Bedürfnis der Schwäche“ (AC 54, KSA 6, S. 236), als SelbstTäuschung, als Rache am „wirklichen“ Leben. Alles, was ihnen nicht entspricht, ist
Lüge, Fälschung, Verrat an der Natur.
Tatsächlich gab Nietzsche vielleicht nirgendwo mehr als mit seinem Antichrist
Anlass zu behaupten, er habe den alten Werten ein bloß biologistisches Menschenbild
entgegensetzt und den Begriff des Lebens als bloße Umkehrung der alten Metaphysik
vorgetragen: Man müsse an einer flach verstandenen Realität festhalten und allein
aus den tierischen (sehr eng und normativ verstandenen) Instinkten heraus leben;
alle Vorstellungen von Werten, Moral, Tugend oder Liebe seien bloß Illusionen, mit
468
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
denen man dem wahren Leben schadet. Der Anspruch, im Besitz eines Kriteriums für
die Realität, für die Wahrheit des Lebens zu sein, weist dabei nicht nur auf einen
banalen Selbstwiderspruch hin, sondern bringt die schon längst überholten Voraussetzungen zum Ausdruck – diejenigen, die Nietzsche selbst in seinen früheren Werken (Jenseits von Gut und Böse, Die fröhliche Wissenschaft, Zur Genealogie der Moral)
als metaphysischen Glauben destruierte. Jetzt scheint er sich zu diesem Glauben
selbst zu bekennen. Er scheint sogar den „U r s a c h e n - S i n n des Menschen“ zu
behaupten, den „gesunde[n] Begriff von Ursache und Wirkung“ (AC 49, KSA 6,
S. 228), nämlich den physikalisch-mechanischen. Er spricht für die „Gesetze der
Natur“ (AC 43, KSA 6, S. 217). Und – noch erstaunlicher – er behauptet, es gebe
„Thatsachen“, die man ablesen kann, „o h n e sie durch Interpretation zu fälschen“
(AC 52, KSA 6, S. 233; vgl. AC 59, KSA 6, S. 248). Dafür solle man bloß „rechtschaffen
sein in geistigen Dingen“ (AC Vorwort, KSA 6, S. 167) und sich nicht täuschen lassen.
Mit der Unterscheidung der Wahrheit und des Glaubens, „dass Etwas wahr sei“,
scheint Nietzsche in Der Antichrist seine ganze Kritik am Wahrheits-Begriff zunichte
gemacht zu haben. Denn, wie er selbst früher sagte:
Eine ‚wissenschaftliche‘ Welt-Interpretation, wie ihr sie versteht, könnte folglich immer noch eine
der dümmsten, das heisst sinnärmsten aller möglichen Welt-Interpretationen sein: dies den
Herrn Mechanikern in’s Ohr und Gewissen gesagt, die heute gern unter die Philosophen laufen
und durchaus vermeinen, Mechanik sei die Lehre von den ersten und letzten Gesetzen, auf denen
wie auf einem Grundstocke alles Dasein aufgebaut sein müsse. (FW 373, KSA 3, S. 626)
Und noch deutlicher:
Man sieht, auch die Wissenschaft ruht auf einem Glauben, es giebt gar keine ‚voraussetzungslose‘ Wissenschaft. […] Dieser unbedingte Wille zur Wahrheit: was ist er? Ist es der Wille, s i c h
n i c h t t ä u s c h e n z u l a s s e n ? Ist es der Wille, n i c h t z u t ä u s c h e n ? […] Aber warum nicht
sich täuschen lassen? […] Was wisst ihr von vornherein vom Charakter des Daseins, um entscheiden zu können, ob der grössere Vortheil auf Seiten des Unbedingt-Misstrauischen oder des
Unbedingt-Zutraulichen ist? Falls aber Beides nöthig sein sollte, viel Zutrauen und viel Misstrauen: woher dürfte dann die Wissenschaft ihren unbedingten Glauben, ihre Ueberzeugung
nehmen, auf dem sie ruht, dass Wahrheit wichtiger sei als irgend ein andres Ding, auch als jede
andre Ueberzeugung? […] Folglich bedeutet ‚Wille zur Wahrheit‘ n i c h t ‚ich will mich nicht
täuschen lassen‘, sondern — es bleibt keine Wahl — ‚ich will nicht täuschen, auch mich selbst
nicht‘: — u n d h i e r m i t s i n d w i r a u f d e m B o d e n d e r M o r a l . (FW 344, KSA 3, S. 575 f.)
Diese Passage aus dem fünften Buch der Fröhlichen Wissenschaft, die mit Recht den
wichtigsten Platz in unserer Untersuchung von Nietzsches Umgang mit seinen
Plausibilitäten einnahm – wie viel feiner und tiefgreifender klingt sie als alle Invektiven von Der Antichrist gegen die Verfälschung des Lebens zugunsten der Schwachen und Missratenen, als sein Plädoyer für die Wahrheit einer wissenschaftlichen
Welt-Interpretation, für ein moralfreies „gesundes“ Leben! Der Wille, sich nicht zu
täuschen, sagt uns Die fröhliche Wissenschaft, ist keinesfalls frei von Voraussetzungen moralischer Art, er lässt sich nicht aus einem Nützlichkeits-Kalkül herleiten,
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
469
seine Wahrheit ist die Wahrheit einer wesentlich moralischen Welt-Auslegung.
Selbst der Erkennende, der Adept einer fröhlichen Weisheit, kann in diesem großen
Schauspiel, in diesem Drama der Welt-Interpretation nicht unbefangen bleiben. Im
Unterschied zu denjenigen, die ihm vorangegangen sind, im Unterschied zu den
großen Kritikern der Vergangenheit, weiß er doch, dass es keinen Maßstab für das
Leben geben kann – weder Wahrheit noch Nützlichkeit, weder Gesundheit noch
Krankheit, weder die „Wünsche [des] Herzens“ noch heroischer Widerstand ihnen
gegenüber. Es gibt keinen Leitfaden der Wirklichkeit, der zur Befreiung von der
Illusion führt, es gibt keine Erlösung zur Realität. So steht in der Götzen-Dämmerung:
Die wahre Welt haben wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig? die scheinbare vielleicht? …
Aber nein! m i t d e r w a h r e n W e l t h a b e n w i r a u c h d i e s c h e i n b a r e a b g e s c h a f f t ! (GD
Fabel, KSA 6, S. 81)
Die „Wahrheit“ und die „Illusion“, die „Wirklichkeit“ und die „Fälschung“ sind von
nun an nicht mehr als einander ausschließende Alternativen anzusehen. Indem man
von solchen Gegensätzen ausgeht, bringt man den Willen zum Ausdruck – den moralischen Willen, nicht zu täuschen, „auch mich selbst nicht“. Man versucht damit eine
Welt-Auslegung, die niemals Text sein kann, denn den Text ohne Auslegung, den
Fußsteig der Wahrheit – „den Weg nämlich, den giebt es nicht“ (Z III Schwere 2,
KSA 4, S. 245).
Wie ist es denn möglich gewesen, dass Nietzsche wenige Jahre später, nachdem
er so klar und deutlich von „n u r ein[em] perspektivische[n] Sehen“ und „n u r ein[em]
perspektivische[n] ‚Erkennen‘“ gesprochen hat (GM III, 12, KSA 5, S. 365), sich auf die
Seite einer flachen biologistisch-mechanischen Welt-Interpretation stellte und letztere
als illusionsfreie, lebensfreundliche Wahrheit rühmte, als ob er jetzt selbst an den
Gegensätzen der Werte festhielte – dass nämlich die „Wahrheit“, die „Realität“, die
„Wirklichkeit“ von der „Illusion“ und „Lüge“ befreit werden können, dass das „Natürliche“ im Menschen von der „Verdorbenheit“ gereinigt werden solle, dass die
Rückkehr in den Zustand der natürlichen Unschuld möglich sein müsse, dass schließlich die Moral für die Menschen entbehrlich, ja zufällig und schädlich sei? Man solle
diese „unterirdischste Verschwörung“ der Priester bekämpfen und zunichte machen, und „Gesundheit, Schönheit, Wohlgerathenheit, Tapferkeit, Geist, G ü t e der
Seele, […] d a s Le b e n s e l b s t “ (AC 62, KSA 6, S. 253) werden in ihrer Blüte erscheinen; man solle nur die Fundamente des Christentums erschüttern, um der Menschheit
ihre Gesundheit, ihr Glück wiederzugeben, um das neue Zeitalter zu eröffnen – das
Zeitalter eines göttlichen Menschen, eines Übermenschen.98
In der Einleitung zu dieser Untersuchung der Plausibilitäten der Moralkritik habe
ich die Probleme der Nietzsche-Interpretation hervorgehoben und Stellung dazu
98 Vgl. AC 4, KSA 6, S. 171.
470
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
genommen. Man kann Nietzsche gewiss als einen Autor ansehen, der sich ständig
selbst widerspricht, der bloß literarisch-pathetisch den Leser zu gewinnen sucht, der
sehr tendenziös, voreingenommen und ungerecht mit der vorherigen philosophischreligiösen Tradition umgeht. Ich werde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es Anlass
für ein solches Nietzsche-Verständnis gibt, besonders aufgrund seines Spätwerks.
Versuchen wir dennoch, eine der tiefsten Einsichten Nietzsches zu behalten, nämlich
dass jedes Verständnis genauso ein Missverständnis ist und dass jede Interpretation
nur eine weitere Interpretation sein kann und nicht der Text, so dürfte ein NietzscheInterpret nicht bloß in der Unterscheidung „richtig – falsch“ verhaftet bleiben, er
sollte vielmehr fragen, ob eine bestimmte Interpretation philosophisch bedeutsam
oder dagegen philosophisch leer und historisch überholt ist. Eine Interpretation
Nietzsches als Verfechter des Vitalismus, als Verteidiger der groben kämpferischsexuellen Instinkte, als bloßer Umkehrer der alten Werte und Leugner der Moral
scheint gerade unter letzteres Charakteristikum zu fallen: Sie ist philosophisch uninteressant. Die Frage, ob Nietzsche in seinem Antichrist tatsächlich bloß ein Vernichter der Moral und des Christentums zugunsten eines groben vitalistischen Ideals
sein wollte, soll dementsprechend durch eine andere Fragestellung abgelöst werden:
nämlich ob Der Antichrist nicht eine tiefere und vielleicht auch widerspruchsfreie
Interpretation anbieten kann; oder, anders formuliert, ob die Widersprüche, die man
mit Recht in diesem Werk feststellt, sich nicht als eine Art Anweisung zu einer
komplexeren Auslegung interpretieren lassen. Wie es Thomas Mann einmal zum
Ausdruck brachte:
Durch Nietzsches Ästhetizismus, der eine rasche Verleugnung des Geistes ist zugunsten des
schönen, starken und ruchlosen Lebens, die Selbstverleugnung eines Menschen also, der tief am
Leben leidet, kommt etwas Uneigentliches, Unverantwortliches, Unzuverlässiges und Leidenschaftlich-Gespieltes in seine philosophischen Ergüsse, ein Element tiefster Ironie, woran das
Verständnis des schlichteren Lesers scheitern muß. Was er bietet, ist nicht nur Kunst, – eine
Kunst ist es auch, ihn zu lesen, und keinerlei Plumpheit und Geradheit ist zulässig, jederlei
Verschlagenheit, Ironie, Reserve erforderlich bei seiner Lektüre. Wer Nietzsche ‚eigentlich‘
nimmt, wörtlich nimmt, wer ihm glaubt, ist verloren. Mit ihm wahrhaftig steht es wie mit Seneca,
den er einen Menschen nennt, dem man immer sein Ohr, aber niemals ‚Treu und Glauben‘
schenken sollte.99
Es scheint mir, Der Antichrist kann gerade als Prüfstein einer solchen Lektüre angesehen werden, d.h.: Das „Uneigentliche[ ], Unverantwortliche[ ], Unzuverlässige[ ] und
Leidenschaftlich-Gespielte[ ]“ soll hier philosophisch interpretiert werden – als Nietzsches „Kunst“ und als Kunst, „ihn zu lesen“, die von uns gefordert wird, wenn wir
sein Buch aufschlagen. Eine solche Interpretation möchte ich jetzt versuchen, wenn
auch nur unter einem einzigen Blickwinkel: Nietzsches Antichrist vor dem Hintergrund seiner Lektüre der Russen zu lesen – und damit kehren wir zu unserem Thema
99 Thomas Mann, Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung, S. 47.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
471
zurück –, kann sich als fruchtbares Anliegen erweisen, wenn es dadurch gelingt,
einen anderen, tieferen, philosophischen Sinn dieser bilanzierenden Schrift Nietzsches zu zeigen.
Bemerkenswert ist schon der äußerst harmonische Aufbau der ganzen Schrift, der
unmissverständlich auf ihr Zentrum zeigt: das „Errathen“ des „Typus des Erlösers“.100
Und noch wichtiger ist, wie die von Nietzsche erratene „Wahrheit“ präsentiert wird.
Denn er spricht nicht nur nachdrücklich von der wahren Wirklichkeit und deren
Verleugnung durch die ganze Geschichte des Abendlandes, sondern er erzählt auch
dessen „echte“ Geschichte – die Geschichte über das Volk Israel, den Begründer des
Christentums und der Kirche, die in seinem Namen die Welt eroberte. Er enthüllt den
jahrtausendelang bestehenden Betrug. Erstaunlich ist dabei nicht bloß die Willkür,
mit der Nietzsche sich die Historie aneignet (alle Quellen seien verfälscht worden,
deshalb dürfe man sich auf keine von ihnen verlassen), nicht bloß sein Anspruch auf
das richtige Verstehen dessen, was mehrere Jahrtausende zurückliegt und von keinem
außer ihm auch nur annähernd verstanden wurde.101 Bedeutsam ist, dass keine
historisch-philologische Begründbarkeit dieses Anspruchs behauptet wird. Er kann
nicht historisch, sondern einzig und allein philosophisch und nur noch negativ
begründet werden – als Befreiung von den alten Denkmustern, als Misstrauen gegen
alle vorhandenen Quellen:
— Erst wir, wir f r e i g e w o r d e n e n Geister, haben die Voraussetzung dafür, Etwas zu verstehn,
das neunzehn Jahrhunderte missverstanden haben, — jene Instinkt und Leidenschaft gewordene
Rechtschaffenheit, welche der ‚heiligen Lüge‘ noch mehr als jeder andren Lüge den Krieg macht
… Man war unsäglich entfernt von unsrer liebevollen und vorsichtigen Neutralität, von jener
Zucht des Geistes, mit der allein das Errathen so fremder, so zarter Dinge ermöglicht wird […]
(AC 36, KSA 6, S. 208).
100 Das „Errathen“ wird in den Abschnitten 27 bis 35 dargestellt, d. h. genau in der Mitte des ganzen
Werkes, das aus 62 Abschnitten besteht. Paul van Tongeren nennt diese acht Kapitel (nach meiner
Strukturierung neun, denn das Kapitel 27, wo Jesus als „heilige[r] Anarchist“ und „politischer Verbrecher“ (AC 27, KSA 6, S. 198) charakterisiert wird, gehört m. E. auch dazu) „the ‚hinge‘ of this
construction“ (van Tongeren, Reinterpreting Modern Culture, S. 263).
101 Allein der Gedanke, Paulus habe als erster von der Auferstehung Christi, von der Erlösung und
von der jenseitigen Belohnung und Strafe gesprochen, Paulus habe Evangelien verfälscht und das
kirchliche Christentum erfunden (vgl. AC 42, KSA 6, S. 215 ff.), widerspricht allen vorhandenen Quellen
und der historischen Reihenfolge, z. B. der Tatsache, dass Paulus zuerst die Jünger Jesu gerade wegen
der Lehre über seine Auferstehung verfolgt hatte – eine Tatsache, der Nietzsche nicht die geringste
Aufmerksamkeit schenkt. In Der Antichrist entsteht der Eindruck, Paulus sei der eigentliche Autor bzw.
Verfälscher nicht nur der Evangelien, sondern auch der Briefe von Petrus und Johannes und selbst der
Offenbarung. Ähnlich steht es mit der Darstellung der Geschichte Israels: Das Thema der Sünde
erscheint nicht erst später, wenn das „Macht-Bewusstsein“ des Volkes nachgibt, wie Nietzsche behauptet (vgl. AC 25, KSA 6, S. 193), sondern durchwirkt das ganze Alte Testament vom Buch Genesis an
bis zu den Propheten-Büchern. Hier geht es Nietzsche also wiederum um das „Errathen“ davon, wofür
es keinen Beleg gibt.
472
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Die ganze Menschheit, die besten Köpfe der besten Zeiten sogar – (Einen ausgenommen, der
vielleicht bloss ein Unmensch ist –) hat sich täuschen lassen. (AC 44, KSA 6, S. 219)102
Dahinter hört man eine andere Stimme – die Stimme Tolstois:
Dennoch konnte ich mich lange nicht an den eigentümlichen Gedanken gewöhnen, daß nach
einem 1800 Jahre langen Bekennen des Gesetzes Christi von Milliarden von Menschen, nachdem
Tausende von Menschen ihr Leben der Erforschung dieses Gesetzes gewidmet hatten, ich jetzt
plötzlich das Gesetz Christi als etwas Neues entdecken musste. Wie sonderbar das aber auch war,
es war so […]. Und ich fragte mich: Woher konnte das kommen? Es mußte in mir irgendeine
irrtümliche Vorstellung über die Bedeutung der Lehre Christi gewesen sein, die mich das Wahre
zu erkennen hinderte. Diese irrtümliche Vorstellung war da.103
Diese falsche Vorstellung, die vor Tolstoi die Lehre Christi, das wahre Christentum
versteckte und verdunkelte, war die Lehre der Kirche über den persönlichen Gott und
die persönliche Unsterblichkeit. Erst nachdem er diese Vorstellung verworfen hatte,
hat er den Begründer des Christentums ‚richtig‘ verstanden, wie ihn sogar seine
Jünger und seine ersten Nachfolger, besonders der Verfälscher des Evangeliums par
excellence, der Apostel Paulus, nicht verstehen konnten. Dieser Anspruch auf ein
richtiges Verstehen ist bei Tolstoi zumindest am Anfang philologisch-historischer Art
gewesen. Deshalb wollte er das Evangelium neu übersetzen, deshalb hat er die alten
Sprachen gelernt. Wie einst Luther glaubte er, an die historische Wahrheit durch
Lektüre der heiligen Texte kommen zu können, und erst später hat er verstanden,
dass diese Arbeit, eine historische Wahrheit zu suchen, nicht vollendet werden kann.
Nietzsche dagegen verzichtete von Anfang an auf diese Art der Feststellung der
‚Wahrheit‘:
Was gehen mich die Widersprüche der ‚Überlieferung‘ an? Wie kann man Heiligen-Legenden
überhaupt ‚Überlieferung‘ nennen! (AC 28, KSA 6, S. 199)
Nicht philologisch, sondern nur philosophisch könne man an „so zarte Dinge“ wie die
„P s y c h o l o g i e d e s E r l ö s e r s“ herankommen. Es handle sich somit nicht um eine
Rekonstruktion, sondern um eine philosophische Re-Interpretation der Geschichte, um
eine neue ‚Wahrheit‘ also, die erst als solche präsentiert werden muss, um Wahrheit
zu werden, um als Wahrheit zu siegen.
Schon der Anfang von Der Antichrist gibt das indirekt zu verstehen. Wenn das
Vorwort von möglichen bzw. unwahrscheinlichen Lesern spricht, so geht es im ersten
Kapitel um den Autor oder, genauer gesagt, um die Autoren dieses Buches. Denn
102 Diese Stelle ist nicht ganz klar. Nach Sommer meint Nietzsche hier sich selbst als den Antichristen
(Sommer, Friedrich Nietzsches „Der Antichrist“, S. 418).
103 Tolstoi, Mein Glaube, S. 76.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
473
Nietzsche benutzt hier plötzlich, nachdem er schon von sich selbst als Verfasser des
Buches gesprochen hat („mein[ ] Zarathustra“), den Plural:
Wir sind Hyperboreer […]. Wir haben das Glück entdeckt, wir wissen den Weg […]. (AC 1, KSA 6,
S. 169)
Dies ist noch nicht ungewöhnlich, schließlich machte Nietzsche das auch schon
früher, indem er sich an „u n b e k a n n t e [ ] Freunde (– denn noch w e i s s ich von
keinem Freunde)“ (GM III, 27, KSA 5, S. 410) wendete, die seine Verbündeten, seine
Gleichgesinnten seien.104 Interessant ist, dass dieses „Wir“ im Vorwort diesmal unmissverständlich auf eine Inszenierung der pluralen Autorschaft hinweist. Denn nicht
nur von seinen Lesern lebt vielleicht noch keiner, sondern auch von den Erfindern des
neuen „Glücks“, von diesen Entdeckern des „Weges“, des „Ziels“. Selbst der Schöpfer
Zarathustras könnte es nicht sein, denn gerade in dessen Mund hatte er die Leugnung
„des Weges“ gelegt. Nichtsdestoweniger müssen diese Wissenden, diese Glücksentdecker, sich nun „ins Gesicht“ sehen und von ihrem Weg, von ihrem Ziel einander
berichten. Für einen aufmerksamen Leser kann dies nur das Folgende bedeuten: Das,
was hier als „u n s e r Leben, u n s e r Glück“ vorgetragen wird, ist etwas, was höchstwahrscheinlich noch nie dagewesen ist, sondern erst zu erfinden und vorzuspielen
ist – als ob es schon zur „Stauung der Kräfte“ gekommen, als ob das „Fatum“ schon
zur „Formel unsres Glücks“ geworden wäre (AC 1, KSA 6, S. 169). Das Buch verspricht
so paradoxerweise von Anfang an das als siegreiche Kraft zu zeigen, was es erst
schaffen muss.105
Wiederum scheint Nietzsche dieses Ziel jedoch mit ziemlich groben Mitteln zu
verfolgen. Schon im zweiten Abschnitt werden klare Definitionen gleich Axiomen
formuliert, deren Annahme notwendige Voraussetzungen für den weiteren „Weg“
ausmachen, selbst aber keine Beweise nötig zu haben scheinen:
Was ist gut? — Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im
Menschen erhöht.
Was ist schlecht? — Alles, was aus der Schwäche stammt.
Was ist Glück? — Das Gefühl davon, dass die Macht w ä c h s t , dass ein Widerstand überwunden wird.
N i c h t Zufriedenheit, sondern mehr Macht; n i c h t Friede überhaupt, sondern Krieg; n i c h t
Tugend, sondern Tüchtigkeit […]
Was ist schädlicher als irgend ein Laster? — Das Mitleiden der That mit allen Missrathnen
und Schwachen — das Christenthum … (AC 2, KSA 6, S. 170)
104 Vgl. mehrere Aphorismen aus dem fünften Buch der Fröhlichen Wissenschaft: FW 343, 344, 371,
372, 375, 377, 378, 381, 382; auch: GM Vorrede 1, KSA 5, S. 247 f.
105 Auf die performative Aufgabe des Anfangs von Der Antichrist, der das „Wir“, das er proklamiert,
gerade schaffen will, macht Sommers Kommentar aufmerksam (Sommer, Friedrich Nietzsches „Der
Antichrist“, S. 77 ff.).
474
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
So werden, in der Terminologie dieser Arbeit, alle Plausibilitäten gleich am Anfang
nicht etwa indirekt verraten, sondern möglichst deutlich (eindeutig in abstoßender
Weise) ausgesprochen.106 Ihre Funktion ist auch äußerst klar: Sie sind dem Leser
gewaltsam auferlegt und derjenige, der sich von ihnen schockiert fühlt, soll aus der
Lektüre von Nietzsches Buch gleich aussteigen; wer es aber weiter lesen will, darf sich
keine Hoffnungen auf Beweise machen. Denn dies sind alles bloß Voraussetzungen,
sie müssen als eine Art Optik angenommen werden – als Optik, die keinesfalls
alternativlos ist, denn sie hat gerade die herrschende Perspektive gegen sich. Die
Aufgabe des vorliegenden Buches wird dementsprechend formuliert:
Nicht, was die Menschheit ablösen soll in der Reihenfolge der Wesen, ist das Problem, das ich
hiermit stelle (— der Mensch ist ein E n d e —): sondern welchen Typus Mensch man z ü c h t e n
soll, w o l l e n soll, als den höherwerthigeren, lebenswürdigeren, zukunftsgewisseren. (AC 3,
KSA 6, S. 170)
Nicht auf eine Untersuchung der Psychologie des Menschen, nicht, und dies ist
wichtig zu betonen, auf „eine Reihenfolge der Wesen“ bzw. der historischen „Typen“
und ihre wahre Geschichte, sondern allein auf Wirkung und Wirksamkeit hat es
Nietzsche mit dem Buch abgesehen. Er versteckt sich nicht vor der eigenen Wünschbarkeit, er will gerade den menschlichen Typus als wertvoll darstellen, der ihm als
wünschenswert erscheint, der seinen Hoffnungen und seinem Geschmack entspricht.
Bemerkenswert ist auch, wie das Wort „Typus“ hier einen besonderen Sinn
bekommt (im Vergleich z. B. zu dem früheren psychologistischen Sinn in Menschliches, Allzumenschliches). Es steht für ein Ideal und sogar für einen Imperativ: Man
solle ihn züchten und wollen, man solle Partei gegen seine Gegner ergreifen, man
solle den Geschmack zu seinen Gunsten ändern. Denn der entgegensetzte Typus, „das
Hausthier, das Heerdenthier, das kranke Thier Mensch, – der Christ“ (AC 3, KSA 6,
S. 170), und sein „ästhetischer Geschmack“ (AC 13, KSA 6, S. 179) haben bisher
geherrscht. Seinen Willen zum Leben als „nihilistische[n] Wille[n]“ „zur Macht“ zu
verurteilen und als Feindschaft, als Verschwörung gegen das Leben zu enthüllen, sei
der Ausdruck einer neuen, „u n s r e [ r ] Art Menschenliebe“ (AC 7, KSA 6, S. 174) – der
des „Wir“ Nietzsches, des „Wir“ der Philosophen.
Das Pathos des Buches scheint von Anfang an definitiv auf der Seite der Philosophie gegen die Theologen und Priester, auch gegen die „litterarische[ ] und
artistische[ ] décadence von St. Petersburg bis Paris, von Tolstoi bis Wagner“ (AC 7,
KSA 6, S. 174) und natürlich auch gegen den „modernen Menschen“ zu sein. Nur die
Philosophie eröffne die Möglichkeit, den „fremden“ und „zarten“ Geschichten der
Vergangenheit näher zu kommen sowie die „Wahrheit“ zu „errathen“, die noch keiner
106 Sommer vergleicht die rhetorisch-sprachliche Form dieses Paragraphen mit der der protestantischen Katechismus-Bücher und stellt erstaunliche Ähnlichkeiten fest: Sommer, Friedrich Nietzsches
„Der Antichrist“, S. 88. Wie Tolstoi in seiner Christlichen Lehre versucht Nietzsche hier eine Art
Katechismus.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
475
kennt. Gerade Philosophen werden dennoch gleich für den „Mangel an intellektuellem Gewissen“ und „intellektuelle[r] Rechtschaffenheit“ (AC 12, KSA 6, S. 178) angegriffen, v. a. die deutschen Philosophen – „die Schwaben“ und auch Kant. Mit
seiner Moral-Formel, mit seinem Begriff der Tugend „bloss aus einem RespektsGefühle vor dem Begriff ‚Tugend‘“ habe er „geradezu das R e c e p t zur décadence,
selbst zum Idiotismus“ gegeben.
Kant wurde Idiot. […] Der fehlgreifende Instinkt in Allem und Jedem, die Widernatur als Instinkt,
die deutsche décadence als Philosophie – d a s i s t K a n t ! (AC 11, KSA 6, S. 177 f.)
Mit dieser Verurteilung Kants eröffnet Nietzsche weitere scharfe Ausführungen zu
theologisch-philosophischen Begriffen – „praktische Vernunft“ (AC 12, KSA 6, S. 178),
„Gott“, „Seele“, „Geist“, „der freie Wille“ (AC 15, KSA 6, S. 181). Mit diesen Begriffen
haben die Philosophen das Leben vergiftet, die „Fi k t i o n s -Welt“ auf Kosten der
Realität gepriesen, dem Christentum ein langes Leben geschenkt. Und überhaupt sei
die Philosophie bisher vielleicht nur eine hinterlistige Theologie gewesen. In ihrem
Verhältnis zum Christentum lässt sich die Philosophie allerdings nicht auf die deutsche Décadence-Philosophie, nicht einmal auf Nietzsches Hyperboreer-Philosophie
reduzieren. Wie Nietzsche schon früher behauptete: „auch Götter philosophiren“ (JGB
295, KSA 5, S. 238). In Der Antichrist wird dieser Gedanke erläutert:
Aus der Höhe gesehn, bleibt diese fremdartigste aller Thatsachen, eine durch Irrthümer nicht nur
bedingte, sondern nur in schädlichen, nur in leben- und herzvergiftenden Irrthümern erfinderische und selbst geniale Religion [das Christentum – E.P.] ein S c h a u s p i e l f ü r G ö t t e r , — für
jene Gottheiten, welche zugleich Philosophen sind […]. […] das erbärmliche kleine Gestirn, das
Erde heisst, verdient vielleicht allein um d i e s e s curiosen Falls willen einen göttlichen Blick,
eine göttliche Antheilnahme… (AC 39, KSA 6, S. 212 f.)
Wenn Götter philosophieren, philosophieren sie über die Religion, in der sie ein
Schauspiel sehen, das für sie gespielt wird. Aus dem Finale zu Jenseits von Gut und
Böse wissen wir, wen Nietzsche als „Versucher-Gott“, als „geborene[n] Rattenfänger
der Gewissen“, als „Genie des Herzens“ würdigt – den Gott Dionysos, dem es „nicht
nur an Scham“ fehle, sondern der auch von Grund auf „unmenschlich“ sei (JGB 295,
KSA 5, S. 237 ff.) – der Gott der Tragödie, der Inbegriff der tragischen Philosophie.
Eine tragische Selbst-Überwindung des „menschlichen, allzumenschlichen“ in der
Geschichte durch die Philosophie, wenn das überhaupt möglich sein sollte, wäre sein
Werk, es wäre das Werk eines göttlichen Zuschauers. Und durch all das positivvitalistische Pathos gibt Der Antichrist dies indirekt zu verstehen: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Philosophie, die von Menschen betrieben wird, die Philosophie
der Philosophen, zu dieser Überwindung nicht fähig ist. In der Perspektive des Lebens betrachtet, kann sie vielleicht nur schädlich sein. Das am Ende des Buches
vorgetragene „Gesetz wider das Christenthum“, das das neue Zeitalter eröffnen und
die „falsche Zeitrechnung“ in jedem Sinn ablösen soll, verbietet nicht nur Priester,
476
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Gottesdienste, Gebete und die Predigt der Keuschheit, es verbietet auch die Philosophie:
Das Verbrecherische im Christ-sein nimmt in dem Maasse zu, als man sich der Wissenschaft
nähert. Der Verbrecher der Verbrecher ist folglich der P h i l o s o p h . (AC, Gesetz wider das
Christenthum, KSA 6, S. 254)
Die Philosophie allein ermöglicht das neue Verständnis des Christentums, aber alle
Philosophie, die wir kennen, dient dem Christentum und verdient so selbst den Fluch,
den sie gegen das Christentum richtet. Sie verflucht damit sich selbst.
Vom Anfang bis zum Ende von Der Antichrist ist diese Art des Rückbezuges der
Einwände gegen das Christentum auf diese Einwände selbst latent präsent. Das Buch
Nietzsches sollte ein „Fluch auf das Christenthum“ sein, und somit auch ein Fluch auf
jede Décadence-Moral und jeden Ausdruck der Rache. Aber ihm selbst ist die Rache
nicht fremd. In der Terminologie der Genealogie der Moral ist „ihre Aktion […] von
Grund aus Reaktion“ (GM I, 10, KSA 5, S. 271). Denn das Buch wird von dem „Einen
grossen Fluch“, von dem „Einen grossen Instinkt der Rache“ des Christentums „gereizt“ (AC 62, KSA 6, S. 253) und will sich seinerseits rächen, es will verfluchen, es
spricht den Fluch gegen den Fluch aus. Dies würde einen markanten Selbstwiderspruch bedeuten, der alle Vorurteile gegen Nietzsche bestätigen könnte,107 wäre der
Begriff „das Christenthum“ zum Ende von Der Antichrist hin eindeutig geblieben. Aber
gerade das Umgekehrte ist der Fall: An mehreren Stellen scheint Nietzsche gerade das
zu verteidigen, was er als Christentum angreift – das, was „evangelisch“ ist, was im
Sinne des Evangeliums „Gerechtigkeit“, was Demut sein soll.108 Er wirft den Christen
gerade vor, sich nicht an diese Werte gehalten zu haben, und zitiert das Evangelium
mehrmals als Beweis dafür, dass es seiner eigenen Intention nicht treu geblieben
107 Bekanntlich bemühte sich Jörg Salaquarda in seinem programmatischen Aufsatz zum Thema
darum, diesen Fluch und die Re-Aktion als Aktion zu bewerten bzw. einen positiven Sinn in NietzschesAntichrist herauszuarbeiten. Er sei kein Ausdruck des Ressentiments, keine Reaktion und
Rache, weil sein Fluch gegen den ursprünglichen Fluch des Christentums gerichtet wird. Seine
Invektiven und Angriffe seien nur zum Zweck der Verherrlichung des Lebens und der dionysischen
Bejahung desselben zu deuten (Jörg Salaquarda, Der Antichrist). Doch scheint es problematisch, eine
Verneinung der Verneinung als Bejahung zu deuten. Ebenso problematisch bleibt der äußerst verengte Begriff des zu bejahenden Lebens. Salaquardas Interpretation geht allerdings weiter, indem
Nietzsches Antichrist „als die ‚Umwertung‘ von Schopenhauers ‚Fluch‘ gegen ‚den Antichrist‘“ gedeutet wird (S. 128). Dieser Standpunkt wird von Yannick Souladié bestritten, indem überzeugend
dargelegt wird, dass Nietzsches Begriff des Antichristen eher auf seine Dämonen-Lektüre als auf
Schopenhauers Parerga hinweist. S. Yannick Souladié, Dostojewskis Antichrist. Besonders dem Ausgangspunkt dieses Aufsatzes ist zuzustimmen, Der Antichrist sei nicht so sehr im Sinne einer
atheistisch-physikalischen Weltanschauung, sondern vielmehr als Problematisierung der Kulturphänomene zu deuten (S. 327).
108 Vgl. den ganzen Abschnitt 45, in dem Nietzsche einer Zitatauswahl aus dem Neuen Testament
seinen Kommentar beilegt (AC 45, KSA 6, S.221).
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
477
ist.109 Und als Rätsel, als Herausforderung an alle eindeutigen Interpretationen erklingen die Worte:
[…] ein Leben so wie der, der am Kreuze starb, es l e b t e , ist christlich … Heute noch ist ein
s o l c h e s Leben möglich, für g e w i s s e Menschen sogar nothwendig: das echte, das ursprüngliche Christenthum wird zu allen Zeiten möglich sein … (AC 39, KSA 6, S. 211)
Hüten wir uns allerdings davor, in dieser Passage einen Beleg für die These zu sehen,
Nietzsche sei ein Verfechter des ursprünglichen Christentums gegen seinen Missbrauch gewesen. Denn auch in dieser Verteidigung der „echten“ christlichen Intention ist Nietzsches Pathos keinesfalls eindeutig.110 Die „Ironie“ und „Reserve“, von
denen Thomas Mann gesprochen hat, sind bei der Lektüre von Der Antichrist besonders erforderlich. Denn bei jeder Einschätzung, bei jedem persönlichen Bekenntnis
darf das „Uneigentliche“, und, um einen anderen Ausdruck Manns zu verwenden, das
„Leidenschaftlich-Gespielte“ von Nietzsches Pathos nicht unbeachtet bleiben. Durch
alle Invektiven gegen den Priester-Betrug und den nihilistischen Willen zur Macht,
gegen Kant als Idiot und gegen die deutsche Philosophie als „Hemmschuh“ der
intellektuellen Rechtschaffenheit kommen Nietzsches fein differenzierende Überlegungen über komplexe Zusammenhänge und Auswirkungen des historischen Christentums, über seine vielfältigen Auslegungsmöglichkeiten und, nicht zuletzt, über
den Status der eigenen leidenschaftlichen Verneinung aller bisher herrschenden
Werte, über den „Fall“ des Philosophen, der dem Christentum den Krieg erklärt, zum
Ausdruck.
Die Würdigung „unsrer liebevollen und vorsichtigen Neutralität“ (AC 36, KSA 6,
S. 208), die Behauptung einer philosophischen Distanz, die diese „Objektivität“ erst
ermöglicht, wechselt sich in Der Antichrist stets mit den leidenschaftlich-persönlichen
Invektiven und Forderungen einer persönlichen Stellungnahme zu dem Problem ab.
Das „Errathen“ der wahren Geschichte des Christentums sei bisher gerade deshalb
unmöglich gewesen, weil „der Freigeisterei unsrer Herrn Naturforscher und Physiologen“ „die Leidenschaft in diesen Dingen, das L e i d e n an ihnen“ hoffnungslos fehlte.
109 Vgl. „Ein solcher Glaube zürnt nicht, tadelt nicht, wehrt sich nicht: er bringt nicht ‚das Schwert‘, –
er ahnt gar nicht, in wiefern er einmal trennen könnte.“ (AC 32, KSA 6, S. 203) Vgl. im Evangelium die
Worte Christi: „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert.“ (Mt. 10; 34);
„Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage: Nein, sondern
Zwietracht.“ (Lk. 12; 51)
110 Zur Deutung dieses angeblichen Widerspruchs bei Nietzsche bzw. zur These, er habe das alte
Ideal verehrt und nur Missbräuche desselben angegriffen, ist im zweiten Kapitel schon genug gesagt
worden. Dieser Standpunkt ist nicht bloß wenig überzeugend, sondern scheint dazu beizutragen,
philosophisch bedeutsame Fragen der Nietzsche-Forschung zu überspringen. Nietzsche als konsequenten Christen zu deuten, wäre gerade eine für den Antichrist irrelevante Interpretation. S. bspw.
die Kritik an Jaspers Deutung von Der Antichrist in: Souladié, Dostojewskis Antichrist, S. 328 ff. Mit Recht
wird hier die folgende These hervorgehoben: „Nietzsches Angriffe zielen unmittelbar auf das christliche Ideal, nicht auf die Unangemessenheit von dessen irdischer Verwirklichung.“ (S. 332)
478
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Ihre Freigeisterei war in Nietzsches Augen bloß „ein S p a a s s “ (AC 8, KSA 6, S. 174).
Es ist also das Leiden an diesen Dingen (Nietzsche hebt das Wort hervor), an dieser
zweitausendjährigen Geschichte Europas und keine interesselose Betrachtung, die
Nietzsche zu seinen Entdeckungen führte. Hier bietet Nietzsches Antichrist wieder
zwei Möglichkeiten: Wir können dieses persönliche Bekenntnis als Widerspruch zur
behaupteten Neutralität ansehen oder aber als Selbstbezug, als Ausdruck tiefster
Ironie gegen jeden Anspruch auf eine äußere Zuschauer-Position, auf eine „wahre“
Perspektive in der Geschichte der menschlichen Irrtümer. Man denke nur daran, was
Nietzsche selbst einige Seiten weiter sagt:
A b e r d a m i t i s t A l l e s e r k l ä r t . Wer allein hat Gründe sich w e g z u l ü g e n aus der Wirklichkeit? Wer an ihr l e i d e t . Aber an der Wirklichkeit leiden heisst eine v e r u n g l ü c k t e Wirklichkeit
sein … (AC 15, KSA 6, S. 182)
Dies wird vom Priester-Betrug gesagt, der die Wirklichkeit verfälschte. Das „Weglügen“ verrate das „Missbehagen am Wirklichen“; das Leiden an der wie auch immer
verstandenen Realität führe zur Wünschbarkeit. Das Leiden macht, so Nietzsche,
ungerecht, parteiisch und rachsüchtig. Dies soll für jedes Leiden, für jede Leidenschaft gelten, auch für eine zur „Leidenschaft gewordene Rechtschaffenheit“ (AC 36,
KSA 6, S. 208). Aber ohne leidvolle Anteilnahme ist es überhaupt unmöglich, etwas zu
verstehen: „Man muss das Verhängniss [welches von dem „Theologen-Blut“ kommt –
E.P.] aus der Nähe gesehn haben, noch besser, man muss an ihm fast zu Grunde
gegangen sein“ (AC 8, KSA 6, S. 174), um ihm etwas entgegensetzen zu können: das
Leiden gegen das Leiden, die Leidenschaft gegen die Leidenschaft.111
Das Leiden beweist aber nichts, außer dass man an der wie auch immer verstandenen Wirklichkeit gerade leidet. Es ist kein Beweis der Wahrheit. Es ist, wie
Nietzsche selbst bemerkt, „der Schluss aller Idioten, Weib und Volk eingerechnet“,
dass das Martyrium, d. h. das Zugrunde-gehen im Namen der Wahrheit, ein Beweis für
letztere sein kann. Nur ein christlicher Märtyrer mit einem „niedrige[n] Grad intellektueller Rechtschaffenheit“, mit seiner „S t u m p f h e i t für die Frage Wahrheit“ habe
damit gerechnet, „sein Für-wahr-halten der Welt an den Kopf“ werfen zu können.
Man braucht einen „Märtyrer nie zu widerlegen“ (AC 53, KSA 6, S. 234 f.). Das Leiden
beweist nichts. Aber auch die „L u s t “ war niemals „Beweis der Wahrheit“. „Der
Glaube macht selig: f o l g l i c h lügt er…“ (AC 50, KSA 6, S. 229 f.) Weder Lust noch
Unlust können Kriterium der „Wahrheit“ sein. Dennoch behauptet Nietzsche immer
wieder, ohne tiefste leidvolle Anteilnahme, „ohne tief persönliche Wahl, ohne L u s t
arbeiten, denken, fühlen“ zu wollen, sei gerade „das R e c e p t zur décadence, selbst
zum Idiotismus“ (AC 11, KSA 6, S. 177).
111 Vgl. „Die ‚Selbstlosigkeit‘ hat keinen Werth im Himmel und auf Erden; die grossen Probleme
verlangen alle die g r o s s e L i e b e […]“ (FW 345, KSA 3, S. 577). So ist auch die „liebevolle[ ] Neutralität“
keinesfalls unpersönlich, sie schließt die Leidenschaft nicht aus.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
479
Hätten wir es hier wiederum bloß mit einer Widersprüchlichkeit zu tun bzw. mit
dem uns schon bekannten Problem der Forderung nach intellektueller Redlichkeit, so
würde Nietzsche es vielleicht dabei belassen: Seine Leidenschaft, sein Leiden an der
europäischen „E n t n a t ü r l i c h u n g der Natur-Werthe“ (AC 25, KSA 6, S. 193), an der
Geschichts-Fälschung, an der „heiligen Lüge“ sei ein Leiden von anderer Qualität als
das christliche Martyrium um der Wahrheit willen; seine Lust an historischen Entdeckungen sei etwas anderes als der Glaube, der „selig macht“. Dem tiefsten Gedanken der Genealogie der Moral wäre damit widersprochen – dem Gedanken der Selbstaufhebung, dass nämlich „in uns jener Wille zur Wahrheit sich selbst a l s P r o b l e m
zum Bewusstsein gekommen“ sei, dass das „Sich-bewusst-werden des Willens zur
Wahrheit“ „jenes grosse Schauspiel in hundert Akten“ sei, „das den nächsten zwei
Jahrhunderten Europa’s aufgespart bleibt, das furchtbarste, fragwürdigste und vielleicht auch hoffnungsreichste aller Schauspiele“ (GM III, 27, KSA 5, S. 410 f.). Das
Leiden an der „Wahrheit“, das in Der Antichrist gefordert und gepriesen wird, die
leidenschaftliche Suche nach der „Objektivität“ kann folglich keine privilegierte
Position für sich beanspruchen. Nietzsche tut dies nicht, oder vielmehr: Er tut es sehr
auffällig und lässt die Widersprüche stehen, die das ganze Pathos gerade unglaubwürdig machen. Der aufmerksame Leser muss sich bei dieser Lektüre unvermeidlich
die folgende Frage stellen: Wenn das Leiden an der Wirklichkeit das negative Kriterium für diese Wirklichkeit sein soll, wenn die Wünschbarkeit als Hinweis auf die
Selbsttäuschung und den Irrtum anzusehen ist, wenn die Philosophie selbst immer
nur dieses Leiden und diese Wünschbarkeit zum Ausdruck brachte, wie kann man
einem Philosophen vertrauen, der sich so offen zu seinem Leiden an der vorgetragenen „Wahrheit“ bekennt und der seinen Wunsch, die Realität von der Lüge der
Jahrtausende zu befreien, so deutlich ausspricht? Äußert sich vielleicht gerade dadurch keine Überheblichkeit, sondern eine Art Bescheidenheit – wenn er so offensichtlich demonstriert, dass er keiner göttlichen Position fähig ist, dass er ein Teilnehmer des großen „schmerzlichen“ und „schauerlichen“ Schauspiels bleibt, auch
wenn er den Anspruch erhebt, „den Vorhang weg von der V e r d o r b e n h e i t des
Menschen“ zu ziehen (AC 6, KSA 6, S. 172)?
Die Metapher des Schauspiels verdient in Der Antichrist besondere Aufmerksamkeit. Sie zieht sich durch das ganze Buch und taucht immer wie zufällig auf, wenn es
um „das Schauspiel des Christen“ (AC 39, KSA 6, S. 212) geht: Es ist das „schauspielerische[ ] Genie[ ]“ von Paulus (AC 24, KSA 6, S. 192), aber auch die „Meisterschaft“, mit
welcher im „B u c h d e r U n s c h u l d “, im Evangelium, „geschauspielert worden ist“
(AC 44, KSA 6, S. 219), und, nicht zuletzt, „ein Schauspiel, so sinnreich, so wunderbar
paradox zugleich, dass alle Gottheiten des Olymps einen Anlass zu einem unsterblichen Gelächter gehabt hätten — C e s a r e B o r g i a a l s P a p s t“, „die Überwindung
des Christenthums an seinem S i t z “ (AC 61, KSA 6, S. 251). Was hat jedoch dieses
vielfältige Schauspiel der Christen so fruchtbar gemacht, dass es noch immer nicht zu
Ende ist und sogar göttliche Anteilnahme verdient? Darauf gab uns schon Jenseits von
Gut und Böse einen Hinweis. Es war
480
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
der lange geistige Wille, Alles, was geschieht, nach einem christlichen Schema auszulegen und
den christlichen Gott noch in jedem Zufalle wieder zu entdecken und zu rechtfertigen, – all dies
Gewaltsame, Willkürliche, Harte, Schauerliche, Widervernünftige hat sich als das Mittel herausgestellt, durch welches dem europäischen Geiste seine Stärke, seine rücksichtslose Neugierde
und feine Beweglichkeit angezüchtet wurde […] (JGB 188, KSA 5, S. 109).
Dank diesem grandiosen, vielfältigen und mehrdeutigen Spiel sind alle Dinge entstanden, um „dessentwillen es sich lohnt, auf Erden zu leben“,
zum Beispiel Tugend, Kunst, Musik, Tanz, Vernunft, Geistigkeit, – irgend etwas Verklärendes,
Raffinirtes, Tolles und Göttliches (JGB 188, KSA 5, S. 109).
An dieser Stelle hat Nietzsche sich auf die Erfahrung der Künstler berufen. Denn
[j]eder Künstler weiss, wie fern vom Gefühl des Sich-gehen-lassens sein ‚natürlichster‘ Zustand
ist, das freie Ordnen, Setzen, Verfügen, Gestalten in den Augenblicken der ‚Inspiration‘ […].
(JGB 188, KSA 5, S. 108)
Dieses Vorgehen eines Künstlers, dessen Begriff Nietzsche vom Schauspieler herleitete, dieser Kampf gegen etwas „Schwimmendes, Vielfaches, Vieldeutiges“, der am
Ende als „natürlicher“ Zustand, als Unschuld der ersten unwillkürlichen Bewegung,
als göttliche „Inspiration“ erscheinen soll, ist für das Verständnis des schauerlichsten
aller Schauspiele unschätzbar und somit auch für Nietzsches Deutung des Christentums.
In Der Antichrist erscheint das Christentum als dynamisches Schauspiel, als
bewegliches Künstler-Werk, als mächtige Umwertung, „als K u n s t , heilig zu lügen“
(AC 44, KSA 6, S. 219), nicht bloß als Fälschung und Verdorbenheit. Selbst der Begriff
„Natur“, den Nietzsche als Argument gegen das Christentum verwendet, sei durch
das Christentum erst „erfunden“ worden, „als Gegenbegriff zu ‚Gott‘“ (AC 15, KSA 6,
S. 181), und damit ist auch zum ersten Mal der Gegensatz ‚Gott – die Welt‘, ‚Gott – die
Wirklichkeit‘ ins Spiel gebracht worden, welchen Nietzsche in seiner Rolle eines
Antichristen jetzt gegen das Christentum selbst ausspielen will. Wenn er die „Natur“
bzw. die „Wirklichkeit“ in Schutz hätte nehmen wollen, dann wären seine Aufgabe
und seine Bewertungen bloß widersprüchlich. Wenn aber diese Begriffe selbst das
Resultat der jahrtausendelang vollzogenen Umwertung darstellen, so könnte man
jetzt eine Umwertung dieser Umwertung versuchen. Mit seinem leidenschaftlichen
Pathos gegen die „Fälschung“ gibt Nietzsche seinem Leser so indirekt zu verstehen,
was er viel früher von seiner Vision des musiktreibenden Sokrates sagte, nämlich
dass es „der Zauber dieser Kämpfe“ sei, „dass, wer sie schaut, sie auch kämpfen
muss“ (GT 15, KSA 1, S. 102). Nur Götter können hier Zuschauer bleiben. Der Antichrist Nietzsches ist aber kein Gott, er ist nur ein Philosoph, der das Christentum
umwerten will.
Die Umwertung des Christentums vollzieht Nietzsche in mehreren Schritten und
Umkehrungen der Begrifflichkeiten und der historischen Perspektiven. Gleich die
erste grobe Perspektive ist auffallend: Das Christentum entstamme dem Instinkt der
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
481
Rache der Schwachen und der Missratenen gegenüber dem Leben, der Wirklichkeit,
den den Christen selbst misslungenen Ausdrücken von Macht und Lebensfreude. Wie
ist es zu diesem „corruptesten Gottesbegriffe“ gekommen (AC 18, KSA 6, S. 185)?
Zuerst stand auch das Volk Israel „zu allen Dingen in der r i c h t i g e n , das heisst der
natürlichen Beziehung“, denn es „hielt als höchste Wünschbarkeit jene Vision eines
Königs fest, der ein guter Soldat und ein strenger Richter ist“. „Aber jede Hoffnung
blieb unerfüllt“. Die Enttäuschung, die Unzufriedenheit und der Wille, um jeden Preis
an Gott festzuhalten, waren daran schuld, dass er zum „Gott, der f o r d e r t “, entartete
(AC 25, KSA 6, S. 193 f.). Es sei eine gewaltige Umwertung vollzogen worden: Alles,
was nicht gelingt, wurde als Strafe für die Sünde gedeutet; der Wohlstand dagegen
als Belohnung für den Gehorsam gegen den Willen Gottes. Dies hatte auch die
radikalste Umdeutung der ganzen Geschichte des Volkes zur Folge. Alles, was geschah, wurde an einem Maßstab gemessen, der selbst fantastisch, ja niemals überprüfbar sein konnte – an dem Willen Gottes, an der Treue gegenüber dem mit ihm
geschlossenen Bündnis. Alle Realität, alles Geschehen wurde damit zu einer symbolischen Sprache, zu einer Zeichensprache, die von den Priestern gedeutet werden
sollte, nach der „Idioten-Formel ‚Gehorsam o d e r Ungehorsam gegen Gott‘“ (AC 26,
KSA 6, S. 196).
Auf diesem „f a l s c h e n Boden“, fährt Nietzsche fort, „wuchs das C h r i s t e n t h u m
auf, eine Todfeindschafts-Form gegen die Realität“ (AC 27, KSA 6, S. 197). Wenn man
die Geschichte des Volks Israel als Ausdruck der größten Feindschaft gegen die Wirklichkeit verstanden hatte, so irrte man sich. Denn das Christentum habe es in allen
Hinsichten übertroffen: Es verneinte „die letzte Form der Realität“, „die j ü d i s c h e
Realität“, das „heilige Volk“ Israels, das seine Fälschung nur mit einem Zweck vollbrachte: damit es sich trotz allem Missgeschick weiter als Volk der Auserwählten
empfinden konnte – nach dem Ausdruck Dostojewskis (genauer gesagt – Schatows
aus den Dämonen), den Nietzsche hier ohne Quellenhinweis wiedergibt: „Ein Volk,
das noch an sich selbst glaubt, hat auch noch seinen eigenen Gott“ (AC 16, KSA 6,
S. 182). Mit seiner noch „u n r e a l e r e n Vision der Welt, als sie die Organisation einer
Kirche bedingt“, hat „der jüdische Instinkt“ noch einmal im Christentum gesiegt und
dennoch den ursprünglichen Symbolismus der Juden aufgehoben. Gott wurde zum
Gott des Guten, d. h. zum „Gott für Jedermann“, zur Verneinung Israels. Als solcher
war er auch Verneinung der kirchlichen Hierarchie:
Das Christentum v e r n e i n t die Kirche. (AC 27, KSA 6, S. 197)
So wird das Christentum in Der Antichrist aus dem Gegensatz zur Kirche gedeutet. Es
handelt sich allerdings zuerst nur um den „Aufstand gegen die jüdische Kirche, Kirche
genau in dem Sinn genommen, in dem wir heute das Wort nehmen“, bemerkt Nietzsche. Er weiß dabei sehr genau, dass dieser Sinn des Wortes „Kirche“ gerade nicht der
Sinn ist, mit dem das Wort jahrtausendelang verwendet wurde. Er entwickelt seinen
Gedanken dahingehend weiter:
482
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Es war ein Aufstand gegen ‚die Guten und Gerechten‘, gegen ‚die Heiligen Israels‘, gegen die
Hierarchie der Gesellschaft — n i c h t gegen deren Verderbniss, sondern gegen die Kaste, das
Privilegium, die Ordnung, die Formel; es war der U n g l a u b e an die ‚höheren Menschen‘, das
Nein gesprochen gegen Alles, was Priester und Theologe war. (AC 27, KSA 6, S. 198)
Diese Deutung des Christentum-Kirche-Gegensatzes, diese Idee der Verneinung aller
Gesellschafts- und Hierarchie-Ordnungen und besonders der „höheren Menschen“,
der Priester-Kaste durch das Christentum, sein politisches oder vielmehr antipolitisches Programm also, weist unmissverständlich auf Nietzsches Quelle hin: auf Tolstois christlichen Anarchismus. Und damit die russischen Quellen dieser Umdeutung
des christlich-jüdischen historischen Verhältnisses nicht völlig unbemerkt bleiben,
erwähnt Nietzsche nebenbei, dass ein solches politisches Verbrechen „gegen die
herrschende Ordnung“ „auch heute noch nach Sibirien führen“ würde.112 Dies sei ein
politisches Verbrechen „in einer a b s u r d - u n p o l i t i s c h e n Gemeinschaft“ gewesen.
Dafür sei der Gründer des Christentums zum Tod am Kreuz verurteilt worden, für
seine eigene Schuld gegen das „heilige Volk“ (AC 27, KSA 6, S. 198).
Tolstois Gedanken sind in diesem ersten Schritt von Nietzsches ChristentumInterpretation zwar sehr wohl wieder erkennbar, jedoch sind auch die feinen Differenzen nicht zu übersehen. Letztere liegen nicht nur in der Bewertung. Denn den Christen
mit dem Anarchisten gleichzustellen ist aus Nietzsches Perspektive gar kein Lob,
sondern ein hartes Urteil (vgl. AC 57–58, KSA 6, S. 244 f.). Tolstoi hat dagegen gerade
das Antipolitische, den Aufstand gegen alle Kasten-Privilegien als großen Verdienst
des Christentums hervorgehoben. Ein viel wichtigerer Unterschied zwischen den
beiden Deutungen des Gegensatzes ‚Christentum – Kirche‘ ist jedoch, dass Nietzsche
ihn im Sinne seiner Figur der Selbstaufhebung deutet: Das Christentum habe das
Judentum dadurch verneint, dass es sein Prinzip zu Ende führte und die letzten
Konsequenzen daraus zog. Der Symbolismus des Judentums, seine Feindschaft gegenüber der „Realität“ sei durch die christliche Umdeutung auf das Judentum selbst
angewandt und negiert worden. Nicht nur die Idee des Symbolismus, sondern auch
die Behauptung einer solchen Kontinuität wäre Tolstoi ganz befremdlich erschienen,
denn für ihn stand der ursprünglich-christliche Anarchismus eindeutig im Gegensatz
zur jüdischen Gesellschaftsordnung.
Man sieht, wie die erste grobe Perspektive durch Nietzsches philosophische
Hermeneutik und seinen Bezug auf eine fremde Christentums-Interpretation verfeinert und in ein vielfältiges Geflecht von Deutungen und Einschätzungen umgewandelt wird. Jetzt dürfte man allmählich den tieferen Sinn von Nietzsches Realitätsrede,
112 Dies kann nicht nur ein Hinweis auf Dostojewski sein, wie diese Stelle üblicherweise interpretiert
wird, sondern auch auf Tolstoi. Was ist mein Glaube? wurde von der russischen Zensur nicht nur
verboten, sondern seine Verbreitung wurde in Russland als politisches Verbrechen betrachtet, und
Tolstois Nachfolger wurden dafür nach Sibirien geschickt. Nietzsche könnte dies durchaus bekannt
gewesen sein.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
483
von seinem Pathos der Wirklichkeit verstehen können: Die „Realität“ ist hier als
Gegen-Begriff zur Zeichensprache, zum Symbolismus, zu jeder Art Hermeneutik zu verstehen, v. a. der biblischen, welche alles Geschehen als Beweis, als Fingerzeig, als
Argument für die eigene Welt-Interpretation ansieht.113 Dass Nietzsche selbst auch
eine Hermeneutik, ein Entziffern der Realität versucht, soll dabei keinesfalls unbemerkt bleiben, sondern wird gerade betont: Es ist das „Errathen“ vom „Typus des
Erlösers“, das ihn zum Antichristen macht – „auf griechisch, und nicht nur auf
griechisch“ (EH Bücher 2, KSA 6, S. 302), d. h. zu dem, der ‚danach‘ kommt, der
vertritt, der aber auch bekämpft, der überbietet, der dafür nicht bloß Gegner, sondern
auch Sieger auf dem gleichen Boden sein muss.114 Nur so kann er zu seiner Herrschaft
kommen: indem er in das Schauspiel eintritt, welches zweitausend Jahre lang in der
europäischen Geschichte aufgeführt wurde.
Die „P s y c h o l o g i e d e s E r l ö s e r s “ (AC 28, KSA 6, S. 198) wird in Der Antichrist
selbst als Problem dargestellt. Es sei „in den Evangelien enthalten“, „trotz den Evangelien“ (AC 29, KSA 6, S. 199). In der Tat geben die Evangelien wenige Hinweise auf
eine solche Deutung, die Nietzsche darlegt. Vielmehr widersprechen sie ihr. Nietzsche
weiß das, er versucht nicht einmal, gegen die heiligen Texten zu polemisieren. Seine
Quellen sind anderer Art. Es ist z. B. Renan, der Jesus missverstanden hat, oder
Dostojewski, der ihn verstanden haben könnte, hätte er zu seiner Zeit gelebt. All diese
Quellen sind somit negativ: Entweder sind sie falsch oder sie stimmen nur hypothetisch. Das „Errathen“ läuft über einen anderen Weg: Man müsse einen Schlüssel zur
ganzen Geschichte finden. Und er wird gefunden:
[…] ‚widerstehe nicht dem Bösen‘ das tiefste Wort der Evangelien, ihr Schlüssel in gewissem
Sinne […] (AC 29, KSA 6, S. 200)
„In gewissem Sinne“ ist hier kein unnötiger Zusatz, keine Ausdrucksmilderung. Es ist
in einem ganz bestimmten Sinne der Schlüssel und das wahre Wort des Erlösers, das
trotz aller Fälschungen in den Evangelien stehen geblieben ist: im Sinne Tolstois. Das
zeigen folgende Passagen unmissverständlich, deren Übereinstimmung mit Tolstois
Predigt des ‚wahren‘ Christentums auf der Hand liegt:
Die F o l g e eines solchen Zustandes projicirt sich in eine neue Praktik, die eigentlich evangelische P r a k t i k . Nicht ein ‚Glaube‘ unterscheidet den Christen: der Christ handelt, er unterscheidet sich durch ein a n d r e s Handeln. […] Dass er dem, der böse gegen ihn ist, weder durch
Wort, noch im Herzen Widerstand leistet. Dass er keinen Unterschied zwischen Fremden und
Einheimischen, zwischen Juden und Nichtjuden macht (‚der Nächste‘ eigentlich der Glaubensgenosse, der Jude) Dass er sich gegen Niemanden erzürnt, Niemanden geringschätzt. Dass er
sich bei Gerichtshöfen weder sehn lässt, noch in Anspruch nehmen lässt (‚nicht schwören‘)
113 Zu Nietzsches nichtontologischem Gedanken des Zeichens, u. a. im Zusammenhang mit seiner
Interpretation des „Typus Jesus“, s. Werner Stegmaier, Nietzsches Zeichen bes. S. 57 ff.
114 Zur Bedeutung von „anti“ in Der Antichrist s. Stegmaier,Nietzsches Kritik der Vernunft seines
Lebens, S. 176 f.
484
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Dass er sich unter keinen Umständen, auch nicht im Falle bewiesener Untreue des Weibes, von
seinem Weibe scheidet. […]
Das Leben des Erlösers war nichts andres als d i e s e Praktik, — sein Tod war auch nichts
andres… Er hatte keine Formeln, keinen Ritus für den Verkehr mit Gott mehr nöthig — nicht
einmal das Gebet. Er hat mit der ganzen jüdischen Buss- und Versöhnungs-Lehre abgerechnet; er
weiss, wie es allein die P r a k t i k des Lebens ist, mit der man sich ‚göttlich‘, ‚selig‘, ‚evangelisch‘,
jeder Zeit ein ‚Kind Gottes‘ fühlt. N i c h t ‚Busse‘, n i c h t ‚Gebet um Vergebung‘ sind Wege zu Gott:
die e v a n g e l i s c h e P r a k t i k a l l e i n führt zu Gott, sie eben ist ‚Gott‘ — Was mit dem Evangelium a b g e t h a n war, das war das Judenthum der Begriffe ‚Sünde‘, ‚Vergebung der Sünde‘,
‚Glaube‘, ‚Erlösung durch den Glauben‘ — die ganze jüdische K i r c h e n -Lehre war in der ‚frohen
Botschaft‘ verneint.
Der tiefe Instinkt dafür, wie man l e b e n müsse, um sich ‚im Himmel‘ zu fühlen, um sich
‚ewig‘ zu fühlen […]. – Ein neuer Wandel, n i c h t ein neuer Glaube … (AC 33, KSA 6, S. 205 f.)
Das ‚Himmelreich‘ ist ein Zustand des Herzens — nicht Etwas, das ‚über der Erde‘ oder ‚nach
dem Tode‘ kommt. […] (AC 34, KSA 6, S. 207)
W e n verneint denn das Christenthum? w a s heisst es ‚Welt‘? Dass man Soldat, dass man
Richter, dass man Patriot ist; dass man sich wehrt; dass man auf seine Ehre hält; dass man seinen
Vortheil will; dass man s t o l z ist … Jede Praktik jedes Augenblicks, jeder Instinkt, jede zur T h a t
werdende Werthschätzung ist heute antichristlich […] (AC 38, KSA 6, S. 211)
Nicht ein Glauben, sondern ein Thun, ein Vieles-n i c h t-thun vor Allem, ein andres S e i n …
(AC 39, KSA 6, S. 211)
Die Stellen, die in Der Antichrist eindeutig auf Tolstois ‚wahres‘ Christentum hinweisen, sind zahlreich. Sie betreffen das Christentum als Praxis des Lebens und als
Frieden des Herzens, als klare „Regeln Jesu“, die von Tolstoi formuliert und mit
dem Nicht-Widerstands-Gebot gekrönt wurden, die Forderung eines gewissen Tuns
oder, vielmehr, eines Nicht-Tuns. Denn Tolstois christlicher Anarchismus, wie im
Tolstoi-Kapitel erwähnt, wurde von den Zeitgenossen (und von Tolstoi selbst)
gerade als Predigt des „Nicht-Tuns“ (неделание) bezeichnet. Ob Nietzsche diese
Bezeichnung bekannt war oder nicht, ist schwer zu sagen. Er hat jedenfalls die
wichtigsten Züge von Tolstois Christentum mitbekommen und sie in Der Antichrist
zusammengefasst – als eine bestimmte Lebenspraxis, als instinktive Abneigung
gegenüber jeder Form des gesellschaftlichen Lebens. Manche von den eben zitierten
Passagen stellen direkte Zitate aus Was ist mein Glaube? dar. Besonders eindeutig
ist in diesem Sinn die Beschreibung des „anderen“ Handelns eines Christen: nicht
zu schwören, ein Weib nicht zu verlassen usw. Das letztere Verbot gibt Tolstois
Polemik gegen die von der russischen Kirche angenommene falsche Übersetzung
dieser Stelle aus der Bergpredigt wieder, der der russische Schriftsteller seine
eigene entgegensetzte.115 Besonders aber wird bei Nietzsche Tolstois Gleichsetzung
der jüdischen Priesterschaft und der christlichen (orthodoxen) Kirchenhierarchie
115 Vgl. Tolstois Ausführungen zum Verbot des Zürnens (Mt. 5; 21–26) und zur Unauflösbarkeit der
Ehe (Mt. 5; 31–32) und besonders zu dem s. E. falschen Zusatz „es sei denn wegen Ehebruchs“ (Tolstoi,
Mein Glaube, S. 101 ff., 111 f.). Diesen Einschub gibt es auch in der Luther-Übersetzung.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
485
hervorgehoben, wie auch die Missverständnisse vonseiten der Jünger Jesu, die,
teilweise weil ihnen die Fähigkeit fehlte, ihn richtig zu verstehen, teilweise um der
„Propaganda“ willen, die „u n ve r s c h ä m t e Lehre von der Personal-Unsterblichkeit“ und dem „L o h n “ im Himmel zugelassen haben, deren Erfindung beide,
Tolstoi und Nietzsche, Paulus zuschreiben. Die Lehre über die Erlösung durch das
Todesopfer des Erlösers sei die „rabbinerhafte[ ] Frechheit“ (AC 41, KSA 6, S. 215)
gewesen in der Wiederherstellung all dessen, was durch die Lehre Jesu gerade
abgeschafft worden war.116
Die Quelle dieser Passagen zum „echten“ bzw. ursprünglichen Christentum wird
besonders klar, wenn man sie mit den Vorbereitungsnotaten zu Der Antichrist vergleicht, die oben bereits beschrieben wurden. Diesmal schreibt Nietzsche Tolstois
Text jedoch nicht bloß ab. Denn er will dem von Tolstoi beschriebenen Gegensatz des
wahren und falschen Christentums einen neuen Sinn verleihen, indem er ihn durch
einen anderen Gegensatz deutet – durch den von der Realität und der Zeichenrede
bzw. indem er ihn in die Perspektive seiner Geschichte Israels stellt. Was daraus folgt,
ist eine weitere Vermehrung und Verfeinerung der Perspektiven. Die Gegensätze
werden erneut in Bewegung gebracht. Bei Tolstoi war diese Unterscheidung klar und
eindeutig: jede Kirche als Institution, die auf gewissen Formeln, auf Hierarchie und
Lehre aufgebaut ist, stehe dem Christentum als Praxis seines Urhebers entgegen, jede
Geschichtenerzählung und jenseitige Hoffnung verstoße gegen den Frieden des Herzens und das „Reich Gottes“; die jüdische Kirche (Tolstoi benutzt gezielt dasselbe
Wort für beide – jüdische und christliche – Institutionen, er nennt die Pharisäer z. B.
die orthodoxen Hierarchen) habe sich durch Paulus revanchiert; die „Welt“ habe das
Christentum mit Hilfe der Kirche besiegt. Bei Nietzsche ist eine solche Eindeutigkeit
undenkbar. Denn das Christentum als „Todfeindschaft gegen die Realität“ ist nicht
nur der Rivale, sondern auch die Weiterentwicklung des Judentums. Indem Paulus
„e i n e G e s c h i c h t e d e s e r s t e n C h r i s t e n t u m s“ „e r f a n d “, „fälschte“ er „die
Geschichte Israels nochmals um“ (AC 42, KSA 6, S. 216). Doch auch das Christentum
Jesu war nicht bloß der Gegensatz zum jüdischen Verhältnis zur Welt, sondern seine
äußerste Konsequenz. Das Judentum selbst ist nicht bloß die „Welt“, die durch das
Christentum verneint wird, sondern auch der Feind dieser Welt. Indem Paulus das
ursprüngliche Christentum verfälschte, blieb er ihm so in gewissem Sinn treu: Er
verwandelte die instinktive Abneigung Jesu gegen die Realität in eine Lehre, die diese
Realität verneint.
116 Nietzsche hat wiederum die Idee der jenseitigen Belohnung ausschließlich dem Apostel zugeschrieben, um Jesus und Paulus einander entgegenzusetzen, was sich jedoch textuell nicht begründen lässt. Denn der Jesus der Evangelien spricht ausdrücklich von der Belohnung und Strafe im
Jenseits (vgl. z. B. Mt 25; 31–46). Ausführlicher zu Nietzsches Darstellung von Paulus s. Daniel Havemann, Evangelische Polemik: Nietzsches Paulusdeutung. Havemann weist u. a. darauf hin, dass die
Entgegenstellung Jesu und Paulus bei Nietzsche erst in Der Antichrist vorkommt. Die Paulusdeutung
wird dabei immer negativer (S. 182).
486
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Nietzsches Deutung der ursprünglichen „e c h t e [ n ] Geschichte des Christentums“
als „Missverständniss“ (AC 39, KSA 6, S. 211) demonstriert so noch einmal das, was
über die Figur der Selbstaufhebung schon gesagt wurde: Sie ist (entgegen allem
eindeutig-flachen Pathos der Besserwisserei) offen in beide Richtungen – in Richtung
der Quellen und in die der Folgen. Man kann diese Geschichte immer neu und immer
anders verstehen. Sie ist „interessant“ im Sinne Nietzsches: Sie verdient Aufmerksamkeit und Anteilnahme, besonders vonseiten derjenigen, die nicht nur Zuschauer,
sondern auch Mitkämpfer sein wollen. Die Geschichte des Christentums, wie die von
allen „grossen Dinge[n]“ auf der Erde, die „durch einen Akt der Selbstaufhebung“,
„durch sich selbst“ „zu Grunde“ gehen (GM III, 27, KSA 5, S. 410), kann dementsprechend nicht in eine gerade Entwicklungslinie gezwungen werden. Solche „Dinge“
sind selbst voller Widersprüche und ihr Untergang kann Jahrhunderte, vielleicht
sogar Jahrtausende dauern. Wenn ihr Zugrunde-Gehen eine Aufgabe ist (und das ist
es für Nietzsche), so soll eine philosophische Interpretation, die diese Aufgabe verfolgt, gerade die Widersprüche zum Ausdruck bringen. Und Nietzsche tut dies sehr
auffallend, so auffallend, dass sie nicht unbemerkt bleiben können. Es wird einerseits
behauptet, es gäbe „nur Einen Christen, und der s t a r b am Kreuz. Das ‚Evangelium‘
starb am Kreuz“ und gleich danach: „[D]as echte, das ursprüngliche Christenthum
wird zu allen Zeiten möglich sein…“ (AC 39, KSA 6, S. 211). Es wird behauptet, Jesus
sei als „Anti-Realist“ (AC 32, KSA 6, S. 203) jeder Art von Rachsucht gegen die Welt
enthoben und ahnte nichts von der Welt, dem Staat oder der Kultur; seine Praktik sei
gerade das Heilmittel gegen das Ressentiment gewesen. Und doch sei sein Erscheinen
selbst der Ausdruck des Ressentiments, der „Todfeindschafts-Form“ gegen das Leben,
des Nihilismus der Tat, der Décadence – genauso wie die russische Auslegung des
Christentums, wie die Tolstois, der erstaunlicherweise kaum mehr als nebenbei und
nur noch als Vertreter des christlichen Mitleids in Der Antichrist erwähnt wird (AC 7,
KSA 6, S. 174).
Die Offenheit und Beweglichkeit der Perspektiven wird noch hervorgehoben,
indem Nietzsche sein „Errathen“ als Erfindung des Unmöglichen präsentiert:
[…] ein solcher Typus konnte aus mehreren Gründen nicht rein, nicht ganz, nicht frei von
Zuthaten bleiben. (AC 31, KSA 6, S. 201)
Und dies nicht nur, weil man ihn grob deuten, ja verkennen musste, „um überhaupt
Etwas davon zu verstehn“, sondern weil er vielleicht nicht wirklich so eindeutig
gewesen ist:
Ein letzter Gesichtspunkt: der Typus k ö n n t e , als décadence-Typus, thatsächlich von einer
eigenthümlichen Vielheit und Widersprüchlichkeit gewesen sein: eine solche Möglichkeit ist
nicht völlig auszuschliessen. (AC 31, KSA 6, S. 202)
Es handelt sich also, es sei noch einmal betont, nicht um eine Annäherung an die
historische Wahrheit. Wer Nietzsche so verstanden hat, ist, nach dem Ausdruck von
Thomas Mann, „verloren“. Derjenige kann nur noch auf die Widersprüche zeigen und
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
487
das Buch verärgert zuschlagen. Wer aber gerade am Vielfältigen, „Uneigentlichen“,
„Leidenschaftlich-Gespielten“ Lust hat, der wird sich fragen müssen, ob es überhaupt
möglich ist, von einem solchen „Typus“ und auch von dem Wert-Gegensatz, der durch
Nietzsches „Psychologie“ angedeutet wird, ohne Widersprüche zu reden. Denn es
handelt sich nicht bloß um eine „Zeichensprache religiös-moralischer Idiosynkrasie“,
wie bei der „F i k t i o n s - W e l t “ der jüdischen Priester, die „die Wirklichkeit fälscht,
entwerthet, verneint“ (AC 15, KSA 6, S. 181), sondern um einen reinen Symbolismus –
um „ein ganz in Symbolen und Unfasslichkeiten schwimmendes Sein“ (AC 31, KSA 6,
S. 202). Wäre ein solches Sein möglich, wäre alle Realität für den, der so lebt, bloß ein
Zeichen, „eine Zeichenrede, eine Semiotik, eine Gelegenheit zu Gleichnissen“ (AC 32,
KSA 6, S. 203). Eine solche ‚Realität‘ wäre die Verneinung aller Gegensätze, der Gegensätzlichkeit selbst, v. a. der von Realität und Illusion, von Wahrheit und Lüge. Denn
die Spannung zwischen mehreren Lebensinterpretationen wäre einem solchen „Typus“ völlig fremd, ja unbekannt.
Eine solche Lehre k a n n auch nicht widersprechen, sie begreift gar nicht, dass es andre Lehren
giebt, geben k a n n , sie weiss sich ein gegentheiliges Urtheilen gar nicht vorzustellen … Wo sie es
antrifft, wird sie aus innerstem Mitgefühle über ‚Blindheit‘ trauern, — denn sie sieht das ‚Licht‘ —,
aber keinen Einwand machen … (AC 32, KSA 6, S. 204 f.)
Dies kann als ein gewisses Fazit des befriedenden Angebots Tolstois an alle „Gläubigen“ (den „gläubigen Juden, Buddhisten, Mohammedanern“, ebenso den Christen
„eines beliebigen Bekenntnisses“, den „ungläubige[n] Philosoph[en]“ und einem
„Durchschnittsmensch[en], halb gläubig und halb ungläubig, der keine Zeit hat, sich
in die Bedeutung des menschlichen Lebens zu vertiefen“117) verstanden werden,
denen das Christentum nicht widerspreche, sondern nur noch das gebe, was sie selbst
nicht haben – die Lehre, wie man leben soll. Hier geht Nietzsche jedoch wieder über
Tolstoi hinaus. Denn diese Friedlichkeit (der Tolstoi selbst keinesfalls treu geblieben
ist, da er gerade gegen die vorhandenen Lehren leidenschaftlich argumentierte)
könnte selbst nur in einem Fall rein von allem Ressentiment sein, nur in einem Fall
könnte sie Ausdruck wirklichen Friedens sein und nicht der einer verfeinerten und
verlogenen Rachsucht, der „Todfeindschafts-Form gegen die Realität“: Wenn sein
Vertreter tatsächlich nichts von der Realität geahnt hätte, wenn seine „Flucht in’s
‚Unfassliche’, in’s ‚Unbegreifliche‘“ von ihm selbst nicht als Flucht verstanden würde,
wenn er also bloß ein „Idiot“ wäre.
Die Bezeichnung Jesu als Idiot (AC 29, KSA 6, S. 200), die entgegen allen
anderen Interpretationen als Held, als Wunder-Täter, als Genie, als Aufrührer in
Der Antichrist vorgetragen wird, ist gewiss nicht freundlich gemeint. Sie ist bewusst beleidigend und sie will verletzten, v. a. diejenigen, die sich heute noch nicht
117 Vgl. Tolstoi, Mein Glaube, S. 310 ff.
488
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
schämen, Christen zu heißen.118 Gerade sie sollten Nietzsche zufolge aus mehreren
Gründen verlegen sein. Schon deshalb, weil „[j]ede Praktik jedes Augenblicks, jeder
Instinkt, jede zur Th a t werdende Werthschätzung […] heute antichristlich“ ist. Sie
sind es im Sinne Tolstois (noch ein Sinn des Antichristlichen!): „Der moderne
Mensch“ dient der ‚Welt‘, indem er Soldat, Richter oder Patriot wird. Wenn er sich
dabei Christ nennt, ist er „eine M i s s g e b u r t v o n F a l s c h h e i t “, bestenfalls ein
Selbst-Missverständnis (AC 38, KSA 6, S. 211). Ein unschuldiger Selbstbetrug ist hier
kaum noch möglich.
Doch ist das Beleidigt-Sein eine Reaktion, die Nietzsches Buch einem im Sinne
von Thomas Mann „schlichteren Leser“ vorbehält. Was v. a. Aufmerksamkeit verdient, ist, dass die Bezeichnung „Idiot“ zuerst nicht auf Jesus, sondern auf Kant
bezogen wurde, im Sinne seines „fehlgreifende[n] Instinkt[es]“, seiner „Widernatur
als Instinkt“ (AC 11, KSA 6, S. 178). Kaum zufällig wird in der Deutung des psychologischen „Typus des Erlösers“ von der Flucht ins „Unbegreifliche“ gesprochen –
also wird ein kantischer Letztbegriff der praktischen Philosophie verwendet (und
auch noch in Anführungszeichen), um den „Instinkt-Hass gegen j e d e Realität“ zu
beschreiben (AC 29, KSA 6, S. 200). Ein weiterer Hinweis ist literarisch-philosophischer Art und noch deutlicher. Er wurde von sämtlichen Interpreten von Der Antichrist immer wieder hervorgehoben – der Hinweis auf Dostojewskis Roman-Welt,
genauer gesagt auf seinen Roman Der Idiot, der einen „positiv-schönen Menschen“
zeigen sollte. Der Letztere lässt sich, wie im Dostojewski-Kapitel detailliert dargestellt wurde, leicht auf die Christus-Figur projizieren, obzwar er gleichzeitig seine
Ohnmacht gegenüber der ‚Welt‘ und das Fantastische dieses Ideals demonstriert.
Der Roman zeigte das Scheitern eines „schönen Menschen“, eines „Fürst-Christus“,
der bloß ein Zuschauer der Wirklichkeit sein will, er zeigte sein Scheitern an der
Realität.
Abgesehen von der Frage, ob der Roman Dostojewskis Nietzsche nur dem Titel
nach bekannt war, ist es kaum möglich, die Bedeutsamkeit Dostojewskis für den
Antichrist überhaupt und für seine Deutung des „Typus des Erlösers“ im Besonderen
zu überschätzen. Dostojewskis Ideen werden stets ins Spiel gebracht. Nicht nur die
bereits erwähnte Idee des Volkes, dessen Kraft sich in der Verehrung eines eigenen
Gottes bzw. durch das eigene Verständnis von Gut und Böse äußert, auch die Idee der
Kirche, die einen Verrat am Christentum zugunsten der ‚Welt‘ darstellt, stammte aus
Nietzsches Dostojewski-Lektüre. Nach Dostojewski habe die ‚westliche‘ Kirche (die
katholische ebenso wie die von ihr abhängige protestantische Bewegung) der dritten
Versuchung des Satans (Macht über die Welt zu erlangen) nachgegeben und sei
antichristlich, sie predige jetzt nur noch den Antichristen (eine weitere Bedeutung des
118 Dennoch oder vielleicht gerade deswegen hat Nietzsches Deutung des „Typus des Erlösers“ ein
lebendiges Interesse und eine lebhafte Auseinandersetzung vonseiten der Theologie hervorgerufen. S.
dazu Ulrich Willers, „Aut Zarathustra aut Christus“. Die Jesus-Deutung Nietzsches im Spiegel ihrer
Interpretationsgeschichte: Tendenzen und Entwicklungen von 1900–1980.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
489
Antichristlichen!).119 Schließlich spricht Nietzsche direkt von Dostojewski als demjenigen, der dem „Typus“ näher kommen könnte, von
[j]ene[r] seltsame[n] und kranke[n] Welt, in die uns die Evangelien einführen – eine Welt, wie aus
einem russischen Romane, in der sich Auswurf der Gesellschaft, Nervenleiden und ‚kindliches‘
Idiotenthum ein Stelldichein zu geben scheinen.
Und noch deutlicher:
Man hätte zu bedauern, dass nicht ein Dostoiewsky in der Nähe dieses interessantesten décadent
gelebt hat, ich meine Jemand, der gerade den ergreifenden Reiz einer solchen Mischung von
Sublimem, Krankem und Kindlichem zu empfinden wusste. (AC 31, KSA 6, S. 201 f.)
Was den Roman Der Idiot angeht, darf man, wie gesagt, einen Zufall nicht ausschließen bzw. ein Vorhersehen oder ein konsequentes Nachdenken. Auch in den Dämonen könnte einem die Welt als eine „Mischung von Sublimem, Krankem und Kindlichem“ erscheinen. Wenn Nietzsche jedoch wirklich den Idioten meinte, so würde ein
weiteres interessantes philologisches Detail unsere Aufmerksamkeit verdienen. Denn
Myschkin heißt bekanntlich Lew Nikolajewitsch – ein Name, der im Russischen
deutlich auf Tolstoi verweist, auf was etwa Lou von Salomé Nietzsche aufmerksam
gemacht haben könnte. Tatsächlich wäre ein solcher Hinweis bedeutsam: Denn das
Christentum, das durch Myschkin im Roman vertreten und gepredigt wird, samt
seinen Ausführungen zum kirchlichen (in diesem Fall nur noch katholischen) Verrat
am ursprünglichen Christentum, zur kirchlichen Predigt des Antichristen, kam Tolstois Einsichten in die wahre Lehre Jesu erstaunlich nahe. Myschkins Leben konnte der
Letzteren eine anschauliche Illustration geben: Denn er leistete dem Bösen keinen
Widerstand und ging an seinem liebevollen Mitleid, an seiner Sucht, Frieden zu
stiften, und, nicht zuletzt, an der Verleugnung jeglicher Schuld zugrunde. Sein Idiotismus, seine Unfähigkeit, der Realität zu begegnen, seine Unmännlichkeit (darauf
gibt es im Roman mehrere Hinweise) waren lebensfeindlich ganz im Sinne Nietzsches:
Er ruinierte nicht nur sein Leben, sondern auch das Glück der anderen. Hier haben wir
es aber wiederum mit einer erstaunlichen Vorwegnahme zu tun. Denn als Dostojewski
seinen Roman schrieb, konnte er von Tolstois Lehre noch so gut wie nichts wissen.120
119 Eben dieser Sinn des Antichristlichen wird in dem schon angegebenen Aufsatz von Souladié
hervorgehoben: Nietzsche ergreife Partei für den Katholizismus, der laut Schatow (und auch dem
Tagebuch eines Schriftstellers) den Antichristen predigt und Christus um der Weltherrschaft willen
verraten hat (Souladié, Dostojewskis Antichrist, S. 333). Doch scheint diese Perspektive, die für Nietzsche keineswegs unbedeutsam war, nur eine von den in Der Antichrist vorgetragenen Deutungen des
Antichristlichen zu sein.
120 Der Idiot ist 1867 geschrieben worden. Tolstois erste religionsphilosophische Schriften erschienen
im Jahr 1882. Dennoch, wie bereits hervorgehoben wurde, hat Tolstoi den Bruch in seiner Weltanschauung stark übertrieben. Auch aus Tolstois früheren Werken, wie die Sevastopol’ Erzählungen (1855) und
Die Kosaken (1861–1862), die Dostojewski sicherlich wohlbekannt waren, konnte er eine erste Vor-
490
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Nichtsdestoweniger fühlte sich Tolstoi von Dostojewskis Christus-Interpretation betroffen. Nachdem er den Großinquisitor gelesen hatte, erklärte er sich bereit, zu beweisen, dass das Christentum „vernünftig“ und „praktisch“ sei. Was den Idioten
betrifft, so sagte Tolstoi, habe es Dostojewski an Mut gefehlt, Myschkin gesund zu
schildern.121
Wie in der Einleitung zu dieser Arbeit erwähnt wurde, erkannte Tolstoi in der
durch eine dreifache Übersetzung (aus dem Russischen ins Französische, aus dem
Französischen ins Deutsche und wieder ins Russische) transformierten Publikation
der Nachlassnotate Nietzsches seine eigenen Gedanken wieder.122 Entgegen seiner
voreingenommen-negativen Meinung über Nietzsche hat er dessen Deutung des
Christentums Recht gegeben. Bemerkenswert ist, dass diese Publikation eine weitere
Entstellung durchlaufen musste: die der russischen Zensur. An allen Stellen, die
in Nietzsches Notizen von der Kirche handelten, wurde statt „Kirche“ „katholische
Kirche“ gedruckt, wie es auch bei den wenigen in Russland erlaubten Publikationen
der Kirchen-Kritik Tolstois gemacht wurde. Dadurch wollte man die Kritik entschärfen: Es sei nur die Kirche des Westens, nicht die russisch-orthodoxe Kirche kritisiert
worden. Obwohl man diesen Trick der Zensur-Behörde erahnen konnte, war es nicht
nur für Tolstoi, sondern auch für das russische Publikum augenscheinlich, dass Nietzsches Kritik an der Kirche des Westens gerade in dieser verzerrten Version Dostojewskis Invektiven gegen den Katholizismus erstaunlich nahekam.123 Es war wiederum Myschkin, der die Idee, der Katholizismus (im Unterschied zur Orthodoxie) sei
die Predigt des Antichristen, in Dostojewskis Roman ausgesprochen hat. Diese Idee
war nun bei Nietzsche, in seiner von der russischen Zensur und durch die Übersetzung
veränderten Version, wiederzufinden. Das Schicksal Myschkins, der am Ende des
Romans dem Wahnsinn verfällt, passte dabei nur zu gut zu allem, was Tolstoi über
Nietzsches Leben wusste, den er ohnehin als „bösen Wahnsinnigen“ bezeichnete,
und konnte diese Parallele nur bestätigen.124
Der große ‚Dialog‘ scheint somit auf kommunikative Störungen angewiesen
gewesen zu sein. Denn wenn es keine Fehler der Übersetzer und keine Eingriffe der
Zensur gegeben hätte, wenn Nietzsche, Tolstoi und Dostojewski die Ideen voneinan-
stellung von Tolstois moralischen Ansichten bekommen, die freilich noch nicht so radikal waren wie
sie dann ab Anna Karenina (1877–1878) vertreten wurden.
121 S. Kapitel 4, Anm. 126 und 205.
122 Es handelt sich um die schon erwähnte Kompilation Die Kritik der höchsten Werte, die 1904 in der
Zeitschrift Новый путь erschien.
123 Tolstoi verstand dies als Widerspruch Nietzsches: Einerseits setze er dem Katholizismus das
wahre Christentum entgegen, andererseits aber behaupte er, das Christentum sei bloß Sklaverei.
Nichtsdestoweniger bemerkte Tolstoi: „Es ist, als stammten manche Ausdrücke direkt von mir…“
(TGA 42, S. 622)
124 Vgl. bei Tolstoi (TGA 54, S. 77). An einer anderen Stelle spricht Tolstoi von der „bubenhaften
Originalitätshascherei“ des „halbwahnsinnigen Nietzsche“. Seine Popularität in Russland sei ein
Zeichen dafür, dass die russische Gesellschaft „verdummt und vertiert“ (TGA 35, S. 183).
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
491
der besser gekannt hätten, wäre er vielleicht weniger intensiv gewesen. Die scharfen
Kontroversen und die Begeisterung über die Seelenverwandtschaft sind dank dieser
Missverständnisse entstanden, die wie Kreuzungen ihre Wege zusammenführten, um
sie dann auseinander laufen zu lassen. Ob diese mehrfachen Reflexionen zwischen
den zwei russischen Denkern und Nietzsche einer direkten Rezeption oder einem
konsequenten Nachdenken zu verdanken sind, lässt sich allerdings nicht eindeutig
entscheiden und ist m. E. auch nicht von erstrangiger Bedeutung. Wichtig ist, dass die
Bezeichnung Jesu als „Idiot“ bei Nietzsche nicht nur aus der schon reichlich komplexen Verflechtung heraus zu interpretieren ist – aus dem „Instinkt-Hass“ gegen die
Realität (letztere als Gegen-Begriff zur Zeichenrede), aus dem Décadence-Begriff, aus
dem Gegensatz von paulinischer Kirche und moderner Welt. Dieses Charakteristikum
weist darüberhinaus unmissverständlich darauf hin, dass es sich nicht um die „e c h t e
Geschichte“ des ursprünglichen Christentums handelt, nicht um eine angebliche
Annäherung an die „wirkliche“, von allen „falschen“ Interpretationen und Lügen
gereinigte Geschichte, sondern um eine Auslegung im Sinne eines Romans, und
genauer eines russischen Romans. Denn solche Figuren wie der Erlöser der Menschheit gehören nicht in die Geschichte. Sie gehören in die schöne Literatur. Und das
heißt – wir wissen es bereits, nicht nur von Nietzsche, sondern auch von Dostojewski
und vielleicht auch, und sei es nur indirekt, von Tolstoi –: die ‚Wahrheit‘ und die
‚Lüge‘ sind hier von einem Künstler geschaffen, der, wie Nietzsche es einmal bemerkte, mit einem Schauspieler verwandt ist: Er verlangt Vertrauen in die von ihm erschaffene Realität, zugleich aber weist er darauf hin, dass es sich bloß um sein Werk
handelt. Er bedarf dabei eines Lesers, der deshalb die Illusion genießen und ihr
vertrauen kann, weil er ihr nicht glaubt, weil er weiß, dass sie eine Erfindung ist. Mehr
noch: Indem der Leser zwischen dem Vertrauen und Misstrauen balanciert, soll er
auch seiner eigenen Phantasie freien Lauf lassen und seine eigene Schöpfungskraft
entfalten, er soll ein Mitschöpfer, ein Künstler werden. Einen solchen künstlerisch
begabten Leser wünscht sich auch Der Antichrist, indem hier die „echte“ Geschichte
erzählt und der „Typus des Erlösers“ über die zweitausendjährige Geschichte hinweg
„errathen“ wird.
Nietzsches Re-Interpretation des „Typus des Erlösers“ mit Hilfe der schönen
Literatur bedeutete jedoch nicht, dass es sich ‚nur‘ um eine erdichtete bzw. beliebig
erfundene Geschichte handelte, die nur dem Kriterium der Unterhaltsamkeit unterliegt. Im zweiten Kapitel (besonders im Abschnitt 2.3) wurde Nietzsches Sicht auf das
Problem des Künstlers als philosophisches Problem bereits dargestellt. Die Philosophie als die Kunst eines „höheren Künstlers“ sollte es wagen, alle Plausibilitäten als
solche zu durchschauen, jede Unterscheidung als Entscheidung anzusehen und in
jeder ‚Wahrheit‘ einen erst durch sie erschaffenen Gegensatz von Wahrheit und
Illusion aufzudecken. Einem Philosophen der Zukunft stellte Nietzsche somit die
Aufgabe, bewusst in der Illusion zu bleiben oder, in der Terminologie dieser Arbeit,
die eigenen Plausibilitäten zu verraten, ihre Alternativen stets zu bedenken und sich
gegenüber der Wünschbarkeit in jeder Weltauslegung, besonders aber in der eigenen,
492
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
einen Verdacht offenzuhalten. Nietzsches Begriff der tragischen Philosophie steht
somit, so haben wir dort festgestellt, für den unlösbaren Konflikt zwischen Realität
und Wünschbarkeit, der den alten Gegensatz von Wahrheit und Illusion ablösen soll,
und der als Konflikt aufrechtzuerhalten ist. Dieser Konflikt soll allerdings nicht bloß
tragisch angenommen und ertragen werden, er sollte vielmehr zeigen, wie die „Musik
des Lebens“ über jede „Zeichenrede der Affekte“ hinaus wieder gehört werden kann,
für welche gerade die Philosophen „taub“ geworden sind. Nietzsches „Errathen“ des
„Typus des Erlösers“, seine Umwertung der Geschichte des Christentums, die sich
bewusst als Erfindung präsentiert und sich sogar einer Entlehnung, einer Art Plagiat
nicht schämt (Tolstois Nicht-Widerstands-These und Dostojewskis Idee eines Gottes
als Volks-Attribut ohne Autorschaftshinweise), soll nun in die Perspektive seines
Entwurfs der tragischen Philosophie gestellt werden. Und eines darf dabei vorausgesetzt werden. Der Antichrist zielte nicht bloß auf eine Desavouierung der alten
Geschichte. Wenn es so wäre, wäre dieses Werk Nietzsches nur einer unter mehreren
Versuchen dieser Art, deren Urheber ihre Überlegenheit gegenüber der Tradition mit
einer weiter verbesserten Evangelien-Übersetzung oder Quellenforschung beweisen
wollten. Mit seiner „Umwerthung aller Werte“ strebte Nietzsche jedenfalls nicht an,
an diesem Wettbewerb der historischen Interpretationen teilzunehmen. Viel mehr als
danach, eine ‚wahre‘ Geschichte aufzudecken, strebte er, die Möglichkeit einer Alternative zu zweitausendjährigen Wertschätzungen zu zeigen. Und wenn die Werke der
Kunst dafür besseres Material anboten als historische Quellen, so sollte man sich auf
sie berufen – auf eine bestimmte Erfahrung, nicht auf den Beweis der historischen
‚Wahrheit‘.
Fassen wir zusammen, was Nietzsche zum „Typus des Erlösers“ sagt, der in der
Mitte von Der Antichrist als Höhepunkt aller Umwertungen erscheint, die vom jüdischen Volk vollzogen wurden – als ihr Fazit, aber auch als ihr Gegensatz. Er sei ein
„Anti-Realist“ gewesen, bei dem die Realität verschwand, dem nur noch „eine Zeichenrede, eine Semiotik“ zur Realität wurde (AC 32, KSA 6, S. 203). Dieser „interessanteste[ ] décadent“ mit seinen „peinlich-fremden Züge[n] und Idiosynkrasien“
(AC 31, KSA 6, S. 202) habe nichts von dem Gegensatz der Zeichenrede und der
Realität gewusst, wie er auch nichts von der Herausforderung geahnt habe, welche
seine Predigt an die bestehende Priestermacht richtete. Er ahnte nichts von den
Gegensätzen, nichts von der Rivalität. Seine Erfahrung war „das Innerste“, er behandelte „die ganze Realität, die ganze Natur, die Sprache selbst“ als „Gelegenheit zu
Gleichnissen“ (AC 32, KSA 6, S. 203 f.). Mehr noch: Man könne nicht von seinem
„Glauben“ sprechen, wenn darunter „Wort, Formel, Gesetz, […] Dogma“ zu verstehen
sind. „Das Christ-sein, die Christlichkeit“ kann hier nicht „auf ein Für-wahr-halten“
(AC 39, KSA 6, S. 212) zurückgeführt werden. Sein Glaube war kein kantisch-lutherisches Überzeugt-Sein von der Wahrheit eines Urteils, er war überhaupt „kein erkämpfter Glaube“ (AC 32, KSA 6, S. 203), sondern bloß das Gelebte, eine in einer
einzigen inneren Perspektive geschlossene Lebensform, die es nicht nötig hat, sich zu
begründen und noch weniger an sich zu zweifeln. Dieser gelebte Glaube, diese
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
493
„Praktik“ kennt keine Alternativen und deswegen auch keine Feinde, nur noch die
Nichtverstehenden, die Unglücklichen. Er dagegen macht selig, wenn er da ist. Man
kann ihn sich jedoch nicht verschaffen, man kann nicht nach ihm streben. Denn er
negiert gerade jedes Streben, jedes Ringen, jede Wünschbarkeit.
Der „Typus Jesus“ Nietzsches, wenn es ihn in seiner reiner Form gegeben hätte
(und das war bei Jesus selbst, so Nietzsche, vielleicht nicht der Fall), würde somit
nichts von der Distanz ahnen – die zwischen Zeichenrede, Symbolik, Worten und
Gleichnissen einerseits und Leben, „Welt“, Natur und Geschichte andererseits, zwischen der eigenen Perspektive, die nur einer begrenzten Lebenserfahrung entspringt,
und den anderen Perspektiven. Er würde niemals für eine Weltinterpretation kämpfen
können, weil es für ihn nur eine geben kann. Die „Wünsche seines Herzens“ wären
ihm die einzige Realität. Wer diesen Glauben hätte, würde wirklich selig sein, aber
nur, weil er nicht wüsste, dass es ihm anders gehen kann, dass er etwas anderes
wollen kann.
Das Thema der Wünschbarkeit wird so durch Nietzsches Deutung der „Psychologie des Erlösers“ wieder aufgenommen. Seine „Flucht in’s ‚Unfassliche‘, in’s ‚Unbegreifliche‘“ könnte tatsächlich die Freiheit von diesem „deus“ bedeuten – von der
Wünschbarkeit, auf deren Boden das Ressentiment, die Rachsucht und die Lebensfeindschaft blühen. Man könnte, bemerkt Nietzsche, „mit einiger Toleranz im Ausdruck, Jesus einen ‚freien Geist‘ nennen“ (AC 32, KSA 6, S. 204). Man könnte vielleicht,
setzen wir diesen Gedanken fort, ihn sogar als denjenigen ansehen, dem, im Unterschied zu den Philosophen (die, wie Kant, das „Unbegreifliche“ begehren), die „Musik
des Lebens“ gerade nicht fremd ist, dessen Leben, wie es in der Fröhlichen Wissenschaft gesagt wurde, „a u f d e m V e r g e s s e n “ „ruht“ bzw. von der „Musik des Vergessens“ bestimmt wird. Denn er kennt keine Distanz zu sich selbst und er kann „nach
seinem werdenden Kunstwerke (nach ‚sich‘)“ niemals „vom Auge des Zeugen aus“
„hinblicken“.125 Das unbegrenzte Vertrauen in die eigene Perspektive des Lebens, die
bedingungslose Akzeptanz der Realität der eigenen Idiosynkrasien, bedeutet tatsächlich die Freiheit vom Ressentiment, von der Rachsucht, von der Wünschbarkeit, dennoch
bedeuten sie auch den Idiotismus, wie ihn Nietzsche im Zusammenhang mit Kant
interpretierte: Es ist schließlich die Unfähigkeit, andere Perspektiven wahrzunehmen,
Alternativen zur eigenen ‚Realität‘ zu vermuten. Derjenige, der von der Erdichtung,
Täuschung oder Illusion nichts weiß, kann gerade die „Musik des Lebens“ als Musik
nicht hören. Mit anderen Worten: Er kann nicht das „vergessen“, was er niemals
wusste, von dem er niemals die geringste Ahnung hatte. Er ist zu dem paradoxen
Nicht-Vergessen der „Musik des Vergessens“ nicht fähig. Insofern ist er kein Künstler,
125 Diese Ausdrücke stammen aus der Fröhlichen Wissenschaft (FW 367, KSA 3, S. 316). Sie wurden im
zweiten Kapitel (Abschnitt 2.3) im Sinne einer beweglichen Differenz zwischen den unerreichbaren
Quellen des Lebens, der unverfügbaren Realität einerseits und der „Zeichensprache der Affekte“
andererseits interpretiert.
494
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
kein Genie,126 er ist bloß ein Idiot, der die Distanz zwischen den eigenen Empfindungen, Wünschen und Idiosynkrasien einerseits und der unverfügbaren Realität andererseits nicht kennt.
Der von Nietzsche erfundene „Typus des Erlösers“ steht somit nicht bloß für
Tolstois paradoxe These des Nicht-Widerstandes, sondern auch für Nietzsches eigene
Paradoxien – für die der Wünschbarkeit, die des Glaubens, die der „Musik des
Lebens“ und schließlich die der tragischen Philosophie. Der so verstandene „Jesus“
bietet eine Möglichkeit ihrer Entparadoxierung, aber nur indem er ihre Kontroversen
bloß negiert: Man müsste nicht gegen die eigene Wünschbarkeit ankämpfen, man
müsste nicht verzweifelt um den Glauben ringen und nach den Gründen des Fürwahrhaltens suchen, wenn die „Wünsche [des] Herzens“ die einzige Realität wären, wenn
der Glaube mit der „Praktik“ selbst identisch wäre. Es wäre kein ‚Anders-habenwollen‘, weil überhaupt kein Wollen mehr vorhanden wäre. Diese Umwertung wäre
die letzte Umwertung der Moral aus Vernunft, diese Befreiung die letzte „Freiheit vom
Ressentiment“, die endgültige „Aufklärung über das Ressentiment“ (EH weise 6,
KSA 6, S. 272) – wenn sie tatsächlich möglich wäre, wenn sie wirklich zur Lebenspraxis
geworden wäre.
Der „Typus“ widerspricht somit den Ausgangsaxiomen von Der Antichrist: „Gut“
ist nicht nur „alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst
im Menschen erhöht“; das „Glück“ ist nicht nur „das Gefühl davon, dass die Macht
w ä c h s t “ (AC 2, KSA 6, S. 170), wie Gott selbst nicht nur „Wille zur Macht“ eines
Volkes sein muss. Man könnte auch ein anderes Gut, ein anderes Glück, einen
anderen Gott denken, wie es vom „Typus Jesus“ her angedeutet wird — das vollständige Fehlen jeder Art von Rivalität, jeder Art des Nach-Oben-Strebens, jeder
Machtsucht, jedes Ideals. Denn alle „Ideale“ sind von der Wünschbarkeit her bestimmt (vgl. Nachlass, November 1887–März 1888, 11[278], KSA 13, S. 105 f.). Die Möglichkeit eines solchen Typus würde den Willen zur Macht als Lebensprinzip in Frage
stellen. Umgekehrt: Wenn die Welt der „‚Wille zur Macht‘ und nichts außerdem“
(JGB 36, KSA 5, S. 55) wäre, dann wäre gerade ein solcher „Typus“ unmöglich.127 Er
wäre eine bloße Konstruktion, eine philosophische Fantasie. Sie würde darüber
hinaus noch die Unzufriedenheit eines Philosophen mit dem Leben zum Ausdruck
bringen und somit wiederum dem alten „deus“ die Ehre erweisen, der der Inbegriff
der unersättlichen Wünschbarkeit ist.
In seiner Rolle des Antichristen, der den Krieg gegen das Christentum führt,
konfrontiert sich Nietzsche schließlich mit „Jesus“ selbst, nicht nur mit dem der
Evangelien oder dem der paulinischen Propaganda und der kirchlichen Dogmen. Sie
126 Nietzsche besteht darauf, dass die Bezeichnung „Genie“ zu Jesus am wenigsten passt (AC 29,
KSA 6, S. 199).
127 Zur Begründung dieser These sowie zum komplexen Verhältnis von Nietzsches Lehre vom Willen
zur Macht und seiner Deutung des „Typus Jesus“ s. Werner Stegmaier, Nietzsches Kritik der Vernunft
seines Lebens, bes. S. 165, 172 ff.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
495
wären für ihn viel zu schwache Gegner, schon deshalb, weil sie zu dem Zeitpunkt, als
Nietzsche seinen „Fluch auf das Christentum“ ausspricht, bereits mehrere Niederlagen erlitten haben. Am Ende des 19. Jahrhunderts, besonders in Deutschland,
klänge der Angriff auf die dogmatische Lehre der Kirche und die moralischen Vorwürfe, ihre Lehre sei nicht „evangelisch“ genug, gar zu überzeugend. Selbst die letzte
Radikalisierung dieser Entgegensetzung der Lehre Jesu und der kirchlichen Tradition
bei Tolstoi, der auch den ersten Jüngern und v. a. Paulus misstraute, konnte keine
Originalität für sich beanspruchen. Um das Christentum selbst, das christliche Ideal
als solches anzugreifen, versucht Nietzsche jedoch tatsächlich etwas Neues. Er denkt
den christlichen „Typus“ konsequent zu Ende, oder vielmehr: Er erfindet ihn als seinen
Gegner, aus dem Gegensatz zu den eigenen ‚Lehren‘ – zur Lehre über die Welt als „Wille
zur Macht“ und zu seiner „letzten Moral“, die das paradox-negative Kriterium der
Wünschbarkeit ins Spiel gebracht hat.128 Und wenn Nietzsche sich selbst als Antichristen bezeichnet, so ist er einer, der diesem „Typus“ entgegensteht, der ihn bekämpft, der ihn überbieten will.
Ziehen wir Bilanz. In Der Antichrist bringt Nietzsche alle vier von uns analysierten
Perspektiven zusammen – die von Kant, Tolstoi, Dostojewski und schließlich seine
eigene Idee der „letzten Moral“. Er tut dies mit Hilfe einer Erfindung, indem er eine
Figur erschafft, die das Gegenteil seiner eigenen philosophischen Intentionen darstellt und dabei eine gewisse Synthese der anderen drei Positionen zum Ausdruck
bringt. Als erster wird Kant („als M o r a l i s t “) ein Idiot genannt. Diese Bezeichnung
wird wenige Seiten weiter auf den „Typus Jesus“ übertragen – auf den Typus, der der
russischen Romanwelt entsprungen zu sein scheint. Kants Ideal der vollkommenen
Menschheit sei „geradezu das R e c e p t zur décadence, selbst zum Idiotismus“ (AC 11,
KSA 6, S. 177).129 Denn es soll dem Leiden und der Lust, den Leidenschaften und dem
Begehren enthoben werden. Dieses Ideal zeigt bloß, so lautete Nietzsches Einwand
gegen Kant als Philosoph, ein Unvermögen zum Perspektivenwechsel, ein Unvermögen, den tautologischen Zirkel der Selbstlegitimation zu verlassen. Aber auch die
128 Insofern muss ich der schon zitierten These von Souladié wieder Recht geben: „Nietzsches
Angriffe zielen unmittelbar auf das christliche Ideal, nicht auf die Unangemessenheit von dessen
irdischer Verwirklichung“ (Souladié, Dostojewskis Antichrist, S. 332). Aber dieses Ideal ist nicht etwas,
was Nietzsche bloß der Tradition entnimmt, auch keine bloß produktive Kompilation der Ideen Dostojewskis und Tolstois, sondern seine eigene, philosophisch bedeutsame Re-Interpretation desselben.
129 In der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft hat Kant deutlich zu verstehen gegeben,
dass er Jesus als „Lehrer des Evangeliums“ für das Ideal der Vollkommenheit hielt (vgl. RGV, AA 6,
S. 63 f.): Im Gegensatz zur Lehre der jüdischen „Kirche“ habe er „den Fronglauben (an gottesdienstliche Tage, Bekenntnisse und Gebräuche) für an sich nichtig“ (RGV, AA 6, S. 128 ff.) erklärt. Die
Bräuche der christlichen Kirchen stellte Kant ferner als „Afterdienst Gottes“ dar und setzte ihnen den
moralischen Glauben ihres Urhebers entgegen. Man kann hier wiederum von den deutsch-russischen
Reflexionen sprechen. Denn, wie im dritten Kapitel gezeigt wurde, war Tolstoi von dieser Schrift Kants
besonders begeistert und hatte deren Gedanken in seine eigene Lehre aufgenommen und uminterpretiert, auf die dann wiederum Nietzsche aufmerksam geworden ist.
496
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Gestalt eines „schönen“ Menschen, das Ideal, zu dem sich Dostojewski und Tolstoi
bekannten – als eine gewisse Synthese ihrer Ansichten und ihrer Künstlerwelten –,
führte Nietzsche zur selben Bezeichnung: Auch ein solcher „Jesus“, wie er in einem
russischen Roman vorkommt, wäre bloß ein Idiot, auch er wäre „Widernatur als
Instinkt“. Der Unterschied zwischen diesen „Idiotien“ ist zwar gravierend, aber er
liegt auf einer anderen Ebene als Nietzsches Überlegungen. Nicht der Gegensatz von
Allgemeinem und Individuellem gibt dem Antichrist seine kämpferische Kraft. (Das
wäre ja auch nichts Neues.) Wenn das kantische Ideal laut Nietzsche tatsächlich die
„Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit – Hirngespinnste“ für den Maßstab des
Guten hielt, machte der Jesus Dostojewskis und Tolstois gerade das Gegenteil: Er
brachte das Allerpersönlichste ins Spiel. Bei Dostojewski wurde der allgemeingültigen
Wahrheit (der Gewissheit im Fürwahrhalten) direkt widersprochen, seine Entscheidung wurde als Entscheidung eines Künstlers zugunsten des seiner Fantasie entsprungenen Ideals dargestellt. Auch Tolstoi mit seiner These des Nicht-Widerstandes
verneinte jede allgemeine Forderung, die das Böse bekämpft und deshalb paradoxerweise selbst zum Bösen wird. Nietzsches Antichrist macht in seiner Einschätzung
jedoch keinen Unterschied. Denn in beiden Fällen (im Falle Kants und im Falle der
„Russen“, im Streben zum Allgemeinen um jeden Preis und in der Geschlossenheit
innerhalb der eigenen beschränkten Erfahrung) herrscht schließlich eine einzige
Perspektive, die als „Erlösung“ von der Not des Lebens alternativlos zu sein scheint.
In beiden Fällen werden die „Wünsche [des] Herzens“ für die einzige Realität gehalten. Wenn Kant „die deutsche décadence als Philosophie“ (AC 11, KSA 6, S. 178)
darstellt, so bringt der „Typus des Erlösers“ die russische décadence in der Kunst zum
Erscheinen. Beide sind innerhalb der eigenen Lebensperspektive gefangen, beide
verehren die Idiotie als Gipfel der Vollkommenheit.
Dennoch, wie fast immer bei Nietzsche, trifft eine eindeutige Einschätzung auch
in diesem Fall nur eine Schicht seines vielschichtigen Werks. Tatsächlich ist das
Gefangen-Sein in der „inneren Realität“ ein Zeichen der „Idiotie“, so wie die Unfähigkeit, die eigene Perspektive als solche anzusehen bzw. zwischen den „Wünschen [des]
Herzens“ und der Realität zu unterscheiden, ein Zeichen der Ohnmacht gegenüber
dem Leben ist. Aber sie können als „Zeichen“ wiederum uminterpretiert werden. Denn
der „Typus Jesus“ bietet eine Möglichkeit, die von der tragischen Erkenntnis her nicht
gegeben ist – eine Möglichkeit der „E n t m o r a l i s i r u n g “130 der Welt, welche nicht nur
über Kant, sondern auch über Nietzsches eigene „letzte Moral“ hinausführen kann.
Wer die Realität völlig in Zeichen aufhebt, lügt unschuldig. Und das heißt: Er lügt
nicht, sein Wort erschafft die Wahrheit, es gestaltet die Realität. Er ist somit kein
Künstler (kein „Genie“) und kein tragischer Held, auch kein Philosoph, er ist etwas
anderes: Er ist Gott. Seine „P r a k t i k “ „eben i s t ‚Gott‘“ (AC 33, KSA 6, S. 206). Nietz-
130 Der Begriff kommt im Nachlass z. Zt. von Der Antichrist und Nietzsches Russen-Lektüre zwei Mal
vor: Nachlass, Herbst 1887, 10[57], KSA 12, S. 485; Anfang 1888, 12[1], KSA 13, S. 203.
5.3 Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen
497
sches Antichrist wendet sich somit nicht nur gegen die historischen Figuren der
Propheten, Prediger und Apostel, nicht bloß gegen die Priester-Kaste und ihren Betrug, sondern gegen Gott selbst. Er bekämpft Gott – als tragischer Held, der den
hoffnungslosen Kampf eingeht, um darin seinen Untergang zu finden.
Der tragische Philosoph, der leidenschaftlich den Krieg gegen das Christentum in
all seinen Gestalten führt, muss sich so zugestehen, dass er von dessen Begründer
übertroffen wird, obzwar er ihn als Idioten herabsetzte. Der Gegner ist mächtiger als
es scheint. Er soll verflucht und verhöhnt werden, er soll vergessen werden, wenn
dafür auch eine neue Zeitrechnung angefangen werden muss. Aber indem er den
„Typus des Erlösers“ als Romanfigur und gleichzeitig als seinen persönlichen Gegner
darstellt, braucht er selbst eine erfundene Figur, eine Maske, eine Art Semiotik, wie
sie einst auch Platon brauchte. Er nennt sich selbst den Antichristen und unter dieser
Maske kündigt er Gott nicht seinen Glauben, sondern seine Zuneigung auf. Er tut dies
wiederum mit einem literarischen Hinweis – auf eine Künstlerwelt, auf Dostojewskis
Glaubensbekenntnis. Hätte ihm jemand bewiesen, dass Christus sich irrte, würde er –
so lautete Dostojewskis „profession de foi“ – nichtsdestoweniger bei Christus bleiben
wollen.131 So spricht der Antichrist Nietzsches:
Das ist es nicht, was u n s abscheidet, dass wir keinen Gott wiederfinden, weder in der Geschichte, noch in der Natur, noch hinter der Natur, — sondern dass wir, was als Gott verehrt wurde,
nicht als ‚göttlich‘, sondern als erbarmungswürdig, als absurd, als schädlich empfinden, nicht
nur als Irrthum, sondern als V e r b r e c h e n a m L e b e n … Wir leugnen Gott als Gott… Wenn man
uns diesen Gott der Christen b e w i e s e , wir würden ihn noch weniger zu glauben wissen. (AC 47,
KSA 6, S. 225)
Mit diesem neuen Glaubensbekenntnis werden alle Plausibilitäten noch einmal bloßgestellt: Der Gott der Christen widerspreche nicht der Realität, sondern den „Wünschen [des] Herzens“ – nicht nur der moralische Gott („deus, qualem Paulus creavit“),
sondern auch der Gott, zu dem sich Dostojewski bekannte, der Gott der Dichter, die,
wie es vom dichtenden Zarathustra gesagt wurde, „zuviel lügen“ (Z II Dichtern, KSA
4, S. 163). Denn sie lügen nicht unschuldig. Sie wissen genau, dass es bei ihren
Idealen nicht um die „Wahrheit“ geht, sondern um eine Semiotik, um eine Kunst.
Aber der Erfinder Zarathustras und des Antichristen ist auch ein Dichter. Für seine
Philosophie als „höhere Kunst“ braucht auch er erdichtete Figuren, mit denen er die
Geschichte wie einen Kampfplatz betritt, um andere Dichtungen zu bekämpfen.
Für den Philosophen, der gegen den von ihm bzw. von den russischen Schriftstellern erfundenen „Typus des Erlösers“ Krieg führt, wird die Grenze zwischen der
Dichtung und dem Wirklichen beweglich. Er kann die Bühne nun selbst betreten,
auch wenn er, wie Dostojewskis „Fürst-Christus“, das Schauspiel durchschaut. Mehr
131 Dieses Glaubensbekenntnis kommt u. a. in dem von Nietzsche aufmerksam gelesenen Werk Die
Dämonen vor. Vgl. Dostojewski, Die Dämonen, S. 342.
498
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
noch: Durch vielfache Widerspiegelungen des „Errathens“ des „ursprünglichen“,
„echten“ christlichen Ideals wurden alle vier Denker – Kant, Tolstoi, Dostojewski und
schließlich Nietzsche selbst – zu Romanfiguren, zu Helden der eigenen Geschichten,
wie Lew Nikolajewitsch Myschkin von Dostojewski, der Lew Nikolajewitsch Tolstoi so
sehr irritierte und gleichzeitig an Nietzsches Schicksal denken ließ. Nicht nur die alte
Geschichte über den Erlöser der Menschheit, auch die Philosophie verbirgt, wie Nietzsche es einmal sagte, „eine leidenschaftliche Seelen-Geschichte“, in der ein „Roman“
bzw. „Krisen, Katastrophen und Todesstunden zu errathen“ sind (M 481, KSA 3,
S. 285). Einem Philosophen ist es nicht gewährt, bloß Zuschauer des großen Spiels der
Weltreligionen zu bleiben. Als Zuschauer bzw. „Errater“ von deren Geschichte ist er
zugleich ein Kämpfer, ein tragischer Held, der mit den Göttern ringt. Wenn er, wie
Kant, keine gute Romanfigur ist, so fehlt es ihm „an Breite und Macht“, es fehlt ihm
an „Charakter“ wie es seiner Philosophie an „Geschichte“ fehlt. In diesem Sinne ist
Nietzsche selbst nicht nur Anti-Christ, sondern auch „A n t i - K a n t “ (Nachlass, April–
Juni 1885, 34[82], KSA 11, S. 445). Als erster tragischer Philosoph und als letzter Jünger
des Philosophen Dionysos führt er den Krieg gegen beide Gegner – gegen das bisher
herrschende Ideal der Kunst und gegen das der Philosophie.
In seinem letzten Buch, Ecce homo, wird Nietzsche sich ein Schicksal nennen und
von seiner eigenen Göttlichkeit sprechen, die freilich nicht unbefleckt bleibt.132 Nicht
der Antichrist, sondern der „Versucher-Gott“ Dionysos, dessen Jünger er selbst sei,
wird hier dem „Gekreuzigten“ entgegengesetzt (EH Schicksal 9, KSA 6, S. 374).133 Im
Gegensatz zum Gott der Philosophen und zum Gott der „evangelischen Praktik“ des
„Erlösers“ ist Dionysos der Inbegriff für das Leiden und Begehren.134 Aber auch als
Leidender kann er „die ewige Komödie des Daseins“ (FW 1, KSA 3, S. 372) durchschauen, welche den Menschen wie eine Tragödie „der Moralen und Religionen“
(FW 1, KSA 3, S. 370) vorkommt. Er ist ein göttlicher Zuschauer, der „dies Schauspiel
nöthig hat – und nöthig macht“ (JGB 56, KSA 5, S. 75), und gleichzeitig der tragische
Held, der auf der Bühne immer wieder untergehen muss, um danach neu und
lebendig zu erscheinen. Als solcher ist er allerdings eine Erfindung des Philosophen,
der jeden Gott leugnet, jeden bis auf einen – bis auf den Gott, der philosophiert.
132 Befleckt sei sie durch die Verwandtschaft mit Mutter und Schwester (EH weise 3, KSA 6, S. 268).
Die persönliche Geschichte sowie die Selbstironie werden auch hier zum Bestandteil der Philosophie.
133 Zu dieser Entgegensetzung als ‚Agon‘, als Wettkampf zwischen Dionysos und dem bisher herrschenden Ideal s. Gerd Schank, Dionysos gegen den Gekreuzigten. Eine philologische und philosophische
Studie zu Nietzsches „Ecce homo“.
134 S. dazu Stegmaier, Nietzsches Kritik der Vernunft seines Lebens, S. 178 ff.
5.4 Die „Bosheit“ der Russen
499
5.4 Die „Bosheit“ der Russen
Die tiefste Schicht von Der Antichrist birgt somit, wie auch Nietzsches „letzte Moral“,
nicht bloß die Umwertung der für die Moral aus Vernunft grundlegenden Differenz
von Allgemeinem und Individuellem (diese wurde oft als Nietzsches Entgegensetzung
des zur Sklaverei geborenen Herdenmenschen und des heroischen Individualisten
missverstanden), sondern vielmehr das Problem der Selbst-Distanzierung, die bewegliche Zuschauer-Schauspieler-Differenz „innerhalb Einer Seele“ (JGB 260, KSA 5,
S. 208). In Der Antichrist durchdenkt Nietzsche dieses Problem in all seinen Variationen – von den „Hirngespinsten“ der kantischen Moral bis zu den russischen „Idiosynkrasien“. Er stellt dabei fest, dass seine Lösungen immer unbefriedigend gewesen
sind, dass es noch keine philosophische Lösung dafür gegeben hat. In seinem Spätwerk bleibt er somit bei der Aufgabe, die er früher den Philosophen der Zukunft
gestellt hat: Ihr eigenes „werdende[s] Kunstwerk“ als solches, sich selbst als so ein
„Kunstwerk“ anzusehen, nicht taub gegenüber der „Musik des Lebens“ zu sein und
sie dabei als Musik (als Kunst) hören zu können – das wäre die Philosophie als
„höhere“ Kunst, die Philosophie, die gegenüber der Realität offen ist und offen bleibt.
Das tiefe Bedenken, ob die Philosophen zu einer solchen Selbst-Distanzierung fähig
sein können bzw. ob einem Menschen es je möglich wäre, über die eigenen Wünsche
und Idiosynkrasien hinaus die Pluralität der Lebensperspektiven wahrzunehmen,
äußerte sich u. a. in den ‚Widersprüchen‘, die so irritierend wie zahlreich in seinem
Antichrist vorkommen, aber auch in dem (auffallend sogar für Nietzsches Spätwerk)
überheblichen Ton in Ecce homo und schließlich in der Figur des von ihm erfundenen
göttlichen Philosophen Dionysos – in der Figur eines Gottes, der, wie alle Götter, das
den Menschen Unmögliche möglich macht, indem er zugleich Zuschauer und Held
der eigenen Geschichte ist.
In Ecce homo wird ein weiteres philosophisches Experiment unternommen –
eine Selbst-Distanzierung, die erlauben sollte, sich selbst als Problem und die
Moral als eigenes persönliches Problem wahrzunehmen (EH klug 9, KSA 6, S. 294).
Denn:
Das Problem ist nicht gerade einfach: man muss es aus der Kraft heraus und aus der Schwäche
heraus erlebt haben. (EH weise 6, KSA 6, S. 272)
Nietzsche beschreibt dabei seine Schwierigkeiten als die eines Kranken, der die
„Freiheit vom Ressentiment“ anstrebt, und verrät etwas über seine persönlichen
Kunstgriffe, also wie man gegen den mächtigen und „natürlichste[n] Hang“ zum
Ressentiment zu kämpfen hat. Man bekämpfe ihn, indem man gegen ihn gerade nicht
kämpft, indem man jedes „Wollen“, jedes „Streben“, jeden „Zweck“ und jeden
„Wunsch“ aufgibt. Kaum zufällig folgt diese Paradoxie des Nicht-Kämpfens der Logik
der uns schon bekannten Formel des Nicht-Widerstandes, die laut Tolstoi und Nietzsche den Schlüssel zum Evangelium darstellt. Nietzsche bestätigt diese Assoziation,
indem er vom „russischen Fatalismus“ als „Ein[em] grosse[n] Heilmittel“ redet (EH
500
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
weise 6, KSA 6, S. 272) und sich selbst die Züge des von ihm „erratenen“ „Typus Jesus“
zuschreibt:
[…] es ist kein Zug von R i n g e n in meinem Leben nachweisbar, ich bin der Gegensatz einer
heroischen Natur. (EH klug 9, KSA 6, S. 294)
Nietzsches Buch Ecce homo darf jedoch, wie die Forschung überzeugend gezeigt hat,
nicht als autobiographische Schrift betrachtet werden, so als ob Nietzsche hier dem
Leser bloß etwas Persönliches über sich selbst mitteilen wollte.135 Eine solche Lesart
wird wiederum nur einem „schlichteren“ Leser vorbehalten, der keinen Geschmack
für Nietzsches „geheime Arbeit und Künstlerschaft“ (EH klug 9, KSA 6, S. 294) hat und
somit seine Geständnisse nur noch im Sinne von Widersprüchen zu allem früher
Gesagten verstehen kann. Denn die Offenheit, mit der Nietzsche hier über seine
Schwierigkeiten und Kunstgriffe spricht, steht tatsächlich manchmal im direkten
Widerspruch zu seinem uns aus den früheren Schriften bekannten Pathos der Selbstüberwindung und Selbst-Erhöhung. Ob diese neue Maske eines Kranken, der das
Ringen nicht kennt und das Ressentiment nur wegen seiner physiologischen Schädlichkeit vermeidet, der autobiographischen Realität mehr entspricht, als es von den
anderen Masken, wie der Zarathustras oder der des „freien Geistes“, behauptet
werden kann, ist zwar keine unbedeutende Fragestellung, aber eher eine für eine
biographische Untersuchung zum Leben Friedrich Nietzsches. Eine Interpretation, die
seine „Kunst“ philosophisch zu verstehen sucht, setzt voraus, dass es in all diesen
Fällen um Masken geht und somit um ein philosophisches Experiment, d. h. um eine
Suche nach mehreren Optionen einer „Aufklärung über das Ressentiment“, über die
Moral und über die Vernunft. Die „g r o s s e V e r n u n f t “ des „r u s s i s c h e n F a t a l i s m u s “, „jene[s] Fatalismus ohne Revolte, mit dem sich ein russischer Soldat, dem der
Feldzug zu hart wird, zuletzt in den Schnee legt“ (EH weise 6, KSA 6, S. 272 f.), bot die
Möglichkeit, das Problem der Wünschbarkeit zu lösen und somit auch das Problem
der Moral. Denn:
[…] so redet n i c h t die Moral, so redet die Physiologie. (EH weise 6, KSA 6, S. 273)
Mit dieser quasi-offenherzigen Erzählung über das eigene „persönliche[ ] Verhalten“
und die eigene „I n s t i n k t - S i c h e r h e i t in der Praxis“ wird in Ecce homo das Thema
von Der Antichrist wieder aufgenommen. Denn die „Seligkeit in Frieden“, die der
Moral des Ressentiments fremd bleibt, wurde dort als „P r a k t i k “ des „Erlösers“
gedeutet. Gerade diesen Zustand eines „Kindes Gottes“ bezeichnete Der Antichrist
„mit der Strenge des Physiologen“ als Idiotie (AC 29, KSA 6, S. 200). Indem Nietzsche
in Ecce homo seine „Göttlichkeit“ auf diese Weise beschreibt, stellt er sich selbst in
135 Wie in dem schon mehrmals angegebenen Aufsatz von Stegmaier gezeigt wurde, versucht Nietzsche hier „eine Kritik der Vernunft seines Lebens“, welche ihrerseits ein philosophisches Experiment
darstellt (Stegmaier, Nietzsches Kritik der Vernunft seines Lebens, S. 167 f.).
5.4 Die „Bosheit“ der Russen
501
diesem Sinn – physiologisch – gezielt dem „Typus Jesus“ gleich, dem russischen Ideal
eines Menschen also, dem das Gebot des Nicht-Widerstandes nicht zu schwer fällt,
der das Ressentiment als Gefahr der Selbstzerstörung vermeidet.
Dennoch bieten auch in diesem Fall Nietzsches Begriffe Möglichkeiten für feinere
Differenzierungen an. Der „russische Fatalismus“ kann anders als im Sinne einer
kindlichen Idiotie verstanden werden. Er ist sogar das Gegenteil davon, wie der
„Erlöser“ das Gegenteil eines Helden gewesen ist. Gerade Dostojewski hat dies demonstriert, indem er als Künstler die Psychologie der „von der Strafe ereilten ÜbelAnstifter“ so gut zu schildern wusste – jenen
beherzten Fatalismus ohne Revolte, durch den zum Beispiel heute noch die Russen in der Handhabung des Lebens gegen uns Westländer im Vortheil sind (GM II, 15, KSA 5, S. 321).
Diese „beherzte Art, mit dem Nothwendigen fertig zu werden“, so notiert Nietzsche für
sich, ist etwas, was beide, Dostojewski und Tolstoi, den russischen Bauern, den
„Moujik’s“, zuschrieben, die „philosophischer in der Praxis“ sind – philosophischer
als Philosophen (Nachlass, Frühjahr 1888, 14[129], KSA 13, S. 312). Die philosophische
„Praxis“ des „beherzten Fatalismus ohne Revolte“ ist die mutige Akzeptanz des
Notwendigen, das russische „amor fati“.136 Sie ist gerade das Gegenteil von der
„Praktik“ des „Erlösers“ mit seiner kindlichen Unfähigkeit, das Bedrohende des
Lebens wahrzunehmen. Indem Nietzsche seine Lebenspraktik mit dem Begriff des
„russischen Fatalismus“ beschreibt, stellt er sich selbst – psychologisch – dem „Typus
Jesus“ entgegen.
Die Spannung zwischen „Physiologie“ und „Psychologie“ eröffnet die Möglichkeit, sich dem „Erlöser“ gleichzustellen oder aber seiner „Praktik“ die eigene „Praxis“
entgegenzusetzen – mit Hilfe von denjenigen Figuren, die wie er ebenfalls den russischen Romanen entstammen, den russischen Bauern, Soldaten und Kriminellen. Für
diese Spannung findet Nietzsche einen Begriff, den er als seinen Gegen-Begriff zur
Moral aus Vernunft verwenden konnte, denn er wies auf ihre Kehrseite hin – die
„Bosheit“. Sie sei u. a. die Bezeichnung für den politischen „Willen“ Russlands, das
den „Gegensatz-Begriff zu der erbärmlichen europäischen Kleinstaaterei und Nervosität“ darstelle. Dort sei man „antiliberal bis zur Bosheit“ (GD Streifzüge, 39, KSA 6,
S. 141). Der letztere Ausdruck kann als Hinweis auf Dostojewskis politische Ansichten
verstanden werden, zumindest würde er eine gute Beschreibung dieser ausmachen,
wenn sie Nietzsche denn tatsächlich bekannt waren. Die Bezeichnung „Bosheit“
benutzt Nietzsche allerdings nicht nur für die Politik, sondern auch für die „Typen“,
die ihm die russische Literatur lieferte. Er redet von den „Russen“ als „böse[n]
Menschen“ in einer Weise, als ob dies selbstverständlich, ja allgemein anerkannt
136 Zur Bedeutung des „beherzten Fatalismus“ s. Frank, Die Metapher Russland im Denken Nietzsches,
S. 351. Zum Thema des Fatalismus in seinen vielfältigen Variationen (der Fatalismus „ohne Revolte“
und „mit Ergebung“) und zu Nietzsches „Vollendung des Fatalismus“ s. die Verfass., „Beherzter
Fatalismus“. Das (Anti-)Christliche in der Perspektive des russischen Denkens.
502
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
wäre. Er bietet sogar einen ‚Beweis‘ dafür, warum eine solche Bezeichnung zutreffend sei: die russischen Lieder, die russische Musik. Als Beispiel „s e h r fremder, sehr
u n deutscher Musik“ gilt gerade der erste Teil der Aufzeichnungen aus dem Kellerloch bzw. Die Zimmerwirtin Dostojewskis.137 Als „Musik“ ist Dostojewskis Werk etwas, was den deutschen Ohren fremd, ja völlig unbekannt vorkommt. Die Fremdheit der russischen „Musik“ wird in der Götzen-Dämmerung interpretiert. Sie ist die
Widerlegung der alten These, dass Bosheit und Kunst nicht übereinkommen können:
‚Böse Menschen haben keine Lieder.‘ — Wie kommt es, dass die Russen Lieder haben? (GD Sprüche, 22, KSA 6, S. 62)138
Eine Stelle aus dem Nachlass liefert eine weitere Erklärung dazu:
Die russische Musik bringt mit einer rührenden Einfalt die Seele des moujik, des niederen Volks
ans Licht. Nichts redet mehr zu Herzen als ihre heiteren Weisen, die allesamt traurige Weisen
sind. Ich würde das Glück des ganzen Westens eintauschen gegen die russische Art, traurig zu
sein. — Aber wie kommt es, daß die herrschenden Classen Rußlands nicht in seiner Musik
vertreten sind? Genügt es zu sagen ‚böse Menschen haben keine Lieder‘? — (Nachlass, Juli–
August 1888, 18[9], KSA 13, S. 535)
Mit dieser doppelten Frage weist Nietzsche nicht bloß auf eine weitere Lüge der
Dichter hin (böse Menschen können sehr wohl Lieder haben), er will vielmehr die
Bosheit der Russen behaupten – die „Bosheit“, wie sie u. a. in der Genealogie der
Moral gedeutet wurde – als genealogischer Hintergrund der einst vollzogenen Umwertung von Gut und Böse. Die russische „Bosheit“ sei die Alternative zu „unserer“
zweitausendjährigen Geschichte der Wertschätzungen, aber Alternative in einem
zweifachen Sinn: Einerseits ist sie als ihre Vorgeschichte zu verstehen, denn sie weiß
nichts von der paradoxen Komplexität der Moral aus Vernunft; die „rührende Einfalt“
ihrer „Musik“ geht allen Aufspaltungen in Gut und Böse, allen Wertschätzungen
voraus. Aber diese „Bosheit“ kann auch als Nachgeschichte der europäischen Moral
137 Den ersten Teil der französischen Ausgabe, nämlich Die Zimmerwirtin, nennt Nietzsche ein „Stück
Musik, s e h r fremder, sehr u n deutscher Musik“, den zweiten Teil, nämlich den Auszug aus den
Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, „ein[en] Geniestreich der Psychologie“ (Brief an Overbeck vom
23. Februar 1887, KSB 8, S. 28). Ähnlich äußert er sich über „zwei Novellen“ im Brief an Köselitz vom
7. März 1887: „die erste eine Art unbekannter Musik, die zweite ein wahrer Geniestreich der Psychologie“ (KSB 8, S. 41).
138 Vgl. „Wo man singet, laß dich ruhig nieder,
Ohne Furcht, was man im Lande glaubt;
Wo man singet wird kein Mensch beraubt:
Bösewichte haben keine Lieder.“
(Johann Gottfried Seume, Werke, Bd. 2, S. 502) Zur Interpretation dieser Stelle bei Nietzsche s. die
Verfass., Die „Bosheit“ der Russen: Nietzsches Deutung Russlands in der Perspektive russischer Moralphilosophie.
5.4 Die „Bosheit“ der Russen
503
aus Vernunft gedeutet werden – als eine immer noch schlummernde Kraft, die auf
ihre Zeit wartet, die „etwas noch versprechen kann“, z. B. eine neue Umwertung.
Nietzsche verwendet so noch einmal die Musik-Metapher, um auf eine Alternative
des gegen die „Musik des Lebens“ taub gewordenen abendländischen Denkens hinzuweisen. Die „Bosheit“ der Russen, so nimmt Nietzsche es in den russischen Weisen
wahr, lehrt, die Realität ganz anders zu erleben als es von der Moral aus Vernunft
geboten wird. Sie lehrt, das Leben bedingungslos anzunehmen – als heiter und
traurig zugleich. In diesem Charakteristikum erkennt man Nietzsches Einschätzung
der Griechen wieder. Ihr Pessimismus zeigte sich als Heiterkeit, die dem modernen
Europäer wie ein Rätsel vorkommt. Sie waren „oberflächlich – a u s T i e f e “ (FW Vorrede, 4, KSA 3, S. 352). Auch die „Bosheit“ der Russen, so Nietzsche, vereinigt das,
was für „uns Westländer“ jahrtausendelang getrennt blieb, und zeigt die Abgründe
des Daseins, die „wir“ nicht mehr wahrnehmen können. Für einen Philosophen, der
die Möglichkeit dieser Wiederentdeckung des Tragischen sucht, wird der russische
Kunstgriff „in der Handhabung des Lebens“ selbst zur Musik, die dem Leben treu
bleibt.139 Aber im Unterschied zu allen anderen Kunstgriffen dieser Art, z. B. den
griechischen, wird in der russischen „Musik“ auch der Sieg über den „deus“ der
Wünschbarkeit gefeiert. Denn in ihrer heiteren Traurigkeit äußert sich nicht nur die
nicht-revoltierende Akzeptanz des Lebens, nicht nur das russische Nicht-andershaben-Wollen, sondern auch die radikalste Verneinung des Willens – die Bosheit, die
nichts verschont, die Lust an Zerstörung verkündigt. Diese „Musik“ sei „undeutsch“,
denn sie stehe im Gegensatz zu allen „Errungenschaften“ der deutschen Philosophie – zu dem Pessimismus Schopenhauers, welcher in der Musik die Erlösung von
der „Tortur“ des Lebens sucht (GM III, 6, KSA 5, S. 349), und zu der „verschmitztklugen Skepsis“ Kants (AC 10, KSA 6, S. 176), welche dem alten Ideal einen Schleichweg freilässt und der Musik den letzten Platz unter den Kunstarten zuweist.140 Für die
westlichen Ohren klingt diese Musik wie „ein böses bedrohliches Geräusch“, wie
„Dynamit des Geistes“,
ein neuentdecktes Russisches Nihilin, ein Pessimismus bonae voluntatis, der nicht bloss Nein
sagt, Nein will, sondern – schrecklich zu denken! Nein t h u t (JGB 208, KSA 5, S. 137).
Indem der nihilistische „gute Wille“ seine letzten Konsequenzen zieht, wird er zu
einem „bösen“ Willen – oder vielmehr: er kommt den „Westländern“ als solcher vor.
Denn die Bezeichnung „Bosheit“ erhält ihren Sinn nur perspektivisch. Sie stößt den
Leser ab, um ihn zur Umkehrung der gewohnten Perspektiven herauszufordern: Nur
die Moral aus Vernunft kann diesen Willen zum Nichts moralisch als „böse“ ver139 Vgl. „ein Wort für die ausgesuchtesten Ohren“, das Nietzsche in Ecce homo ausspricht: Die Musik
solle „heiter und tief“ sein. Eine solche Musik sei jedoch nicht deutsch (EH klug 7, KSA 6, S. 290 f.).
140 Der Grund dafür war, dass die Musik „bloß mit Empfindungen spielt“. Zugleich gehöre der Musik
unter den Künsten, die „nach ihrer Annehmlichkeit geschätzt werden“, der oberste Platz (KU, AA 5,
S. 329).
504
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
urteilen; als traurige „Musik“ kennt er selbst gerade keine Unterscheidung von Gut
und Böse.
Die russische Literatur mit ihren „Typen“ zeigt nach Nietzsche die ganze Palette
dieser „Bosheit“, die einem Europäer mit seiner Moral aus Vernunft bedrohlich
erscheint – von dem Kellerlochmenschen, den Bewohnern eines „Totenhauses“ und
den russischen Terroristen, die, wie in Die Dämonen, das „Nein tun“, bis zur Selbstauflösung des Willens im „‚Wozu?‘, ‚Umsonst!‘, ‚Nada!‘“ der „Petersburger Metapolitik“ und des „Tolstoi’sche[n] ‚Mitleid[s]‘“ (GM III, 26, KSA 5, S. 406). Das Wort „Mitleid“ schreibt Nietzsche in Anführungszeichen. Denn auch in Tolstois Verehrung des
christlichen Ideals feierte der nihilistische „gute Wille“ seinen Sieg über den moralischen Willen zum Guten aus Vernunft. Das Böse zu tun und dem Bösen nicht zu
widerstehen, das „Nein“-Tun und das „Nicht-Tun“ sind Gegenpole, die sich, wie
andere Extreme, in Russland treffen müssen – in der philosophischen „Praxis“ der
russischen Bauern. Die russischen Dichter (die „herrschenden Classen“ Russlands,
die in der russischen „Musik“ nicht vertreten sind141) wollen diese „Bosheit“ beschönigen und den nihilistischen Willen zähmen – durch das Ideal des „Erlösers“ mit
seiner kindlich-kranken Idiotie. Tolstoi meinte sogar, dem alten sokratisch-kantischen moralischen Ideal damit ein neues Leben zu schenken. Dostojewski dachte, mit
dem „russischen Christus“ Europa das Ideal des Guten zu geben, das es verloren hatte
und nun bitterlich brauchte. Aber gerade durch ihre Schriftstellerkunst zeigte sich, so
Nietzsche, die ‚prähistorische‘ „Bosheit“ der russischen Bauern und Kriminellen mit
ihrem „beherzten Fatalismus“ und „Pessimismus bonae voluntatis“. Diese „Bosheit“
sei antichristlich im tiefsten Sinne des Wortes – sie akzeptiert weder die Moral noch
die „Praktik“ des Christentums; sie verneint „das Glück des ganzen Westens“ durch
ihre „Art, traurig zu sein“.
Nietzsches Perspektivierung der beweglichen Differenzen zwischen der Vor- und
Nachgeschichte der Moral aus Vernunft bzw. zwischen der „Praktik“ des Christentums, seiner Umwertung durch die Moral aus Vernunft und der „Praxis“ des russischen Nihilismus scheint allerdings auf eine psychologische Typisierung angewiesen
zu sein, die in der russischen Literatur eine unerschöpfliche Quelle gefunden hat. Und
tatsächlich betont Nietzsche immer wieder die Wichtigkeit der Psychologie, die als
„Weg zu den Grundproblemen“ zur „Herrin der Wissenschaften“ werden solle (JGB 23,
KSA 5, S. 39). Als einen großen Psychologen, von dem er selbst „Etwas zu lernen
hatte“, hat er gerade Dostojewski gewürdigt. Die Aufzeichnungen aus dem Kellerloch
wurden von ihm als ein „Geniestreich der Psychologie“ (KSB 8, 28; KSB 8, S. 41)
bezeichnet. Diese Würdigung, direkt und indirekt, zieht sich weiter durch das gan-
141 Diese Behauptung Nietzsches löst Verwunderung aus. Denn die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist gerade die Blütezeit der russischen klassischen Musik gewesen. Man denke nur an Pjotr
Tschaikowski, Modest Mussorgski oder Nikolai Rimski-Korsakow.
5.4 Die „Bosheit“ der Russen
505
ze Spätwerk Nietzsches.142 So steht in der späteren Vorrede zu Menschliches, Allzumenschliches:
Aber wo giebt es heute Psychologen? In Frankreich, gewiss; vielleicht in Russland; sicherlich
nicht in Deutschland. (MA I Vorrede 8, KSA 2, S. 22)
Das psychologische „Genie“ bestehe dabei in dem „Erraten“, das an Nietzsches
eigenes Erraten des „Typus des Erlösers“ denken lässt. Vgl. im Fall Wagner:
[…] in Sankt-Petersburg! wo man Dinge noch erräth, die selbst in Paris nicht errathen werden.
(WA, KSA 6, S. 22)
In der Götzen-Dämmerung spricht Nietzsche noch deutlicher von diesem „Erraten“,
das Dostojewski zu einem großen Psychologen und seinem Lehrer macht:
Dieser t i e f e Mensch [Dostojewski – E.P.], der zehn Mal Recht hatte, die oberflächlichen Deutschen gering zu schätzen, hat die sibirischen Zuchthäusler, in deren Mitte er lange lebte, lauter
schwere Verbrecher, für die es keinen Rückweg zur Gesellschaft mehr gab, sehr anders empfunden als er selbst erwartete — ungefähr als aus dem besten, härtesten und werthvollsten Holze
geschnitzt, das auf russischer Erde überhaupt wächst. (GD Streifzüge, 45, KSA 6, S. 147)
Die Erwähnung von Dostojewskis Geringschätzung der Deutschen darf als Hinweis
auf eine besonders gute Bekanntschaft mit Dostojewskis Ideen interpretiert werden,
denn sie kommt bei Dostojewski nur indirekt und gelegentlich in den Romanen und
Erzählungen zum Ausdruck (direkt nur im Tagebuch eines Schriftstellers, das Nietzsche kaum bekannt sein konnte). An dieser Stelle der Götzen-Dämmerung handelt es
sich allerdings um die Aufzeichnungen aus einem Totenhaus, und Dostojewskis Zeugnis wird hier als Beweisstück für Nietzsches eigene These verwendet:
Der Verbrecher-Typus, das ist der Typus des starken Menschen unter ungünstigen Bedingungen,
ein krank gemachter starker Mensch. […] und weil er immer nur Gefahr, Verfolgung, Verhängniss
von seinen Instinkten her erntet, verkehrt sich auch sein Gefühl gegen diese Instinkte – er fühlt
sie fatalistisch. Die Gesellschaft ist es, unsre zahme, mittelmässige, verschnittene Gesellschaft, in
der ein naturwüchsiger Mensch, der vom Gebirge her oder aus den Abenteuern des Meeres
kommt, nothwendig zum Verbrecher entartet. (GD Streifzüge, 45, KSA 6, S. 146 f.)
Diese Deutung der Psychologie des Verbrechers bietet ein anschauliches Beispiel
dafür, wie Nietzsche Dostojewskis Namen (an dieser Stelle wird Dostojewski direkt
genannt) als Illustration, als Material für Ideen benutzte, die dem russischen Schriftsteller fremd sein mussten. Man kann hier kaum von einem Missverständnis sprechen,
vielmehr von einer Aneignung und Umwertung der fremden Ideen und Wertschät-
142 Die Psychologie ist ein großes Thema bei Nietzsche, das von mir nur im Zusammenhang mit der
Bezeichnung Dostojewskis als Psychologen berührt wird. Es wurde v. a. von Walter Kaufmann gründlich untersucht. Vgl. Walter Kaufmann, Nietzsche als der erste große Psychologe.
506
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
zungen. Die tiefgreifende Differenz in der Deutung des Verbrechens zwischen Nietzsche und Dostojewski ist dabei nicht weniger auffallend als Nietzsches Faszination
gerade für die frühesten, romantischen Werke Dostojewskis. Trotz der Übereinstimmung ihrer psychologischen Beobachtung sind die daraus gezogenen Schlüsse gerade gegenteilig. Tatsächlich nehmen Dostojewskis Verbrecher den Konflikt zwischen
ihren „Gefühlen“ (die moralischer Art sind) einerseits und ihren Instinkten andererseits „fatalistisch“ an. Dennoch kann von einer „Entartung“ zum Verbrecher wegen
der Verfolgung und Bestrafung vonseiten der Gesellschaft bei Dostojewski kaum die
Rede sein. Gerade umgekehrt: Der Verbrecher ist für ihn nur dann der Unglückliche,
der „Entartete“, wenn er seine Schuld nicht anerkennt; wenn er sich hingegen für sie
willig bestrafen lässt, wird er zum Erlöser und zum Erlösten. Hier ist das Zeugnis eines
anderen Psychologen von Bedeutung:
Dostojewskis Sympathie für den Verbrecher ist in der Tat schrankenlos, sie geht weit über das
Mitleid hinaus, auf das der unglückliche Anspruch hat, erinnert an die heilige Scheu, mit der das
Altertum den Epileptiker und den Geistesgestörten betrachtet hat. Der Verbrecher ist ihm fast wie
der Erlöser, der die Schuld auf sich genommen hat, die sonst die anderen hätten tragen müssen
[meine Hervorhebung – E.P.]. Man braucht nicht mehr zu morden, nachdem er bereits gemordet
hat, aber man muß ihm dafür dankbar sein, sonst hätte man selbst morden müssen. Das ist nicht
gütiges Mitleid allein, es ist Identifizierung auf Grund der gleichen mörderischen Impulse […].143
Abgesehen von den typisch freudschen Konnotationen („gleiche mörderische Impulse“, „Gewissensbelastung durch die Absicht des Vatermordes“144), ist diese Beobachtung scharfsinnig und zutreffend. Was Dostojewskis Selbstidentifikation mit den Verbrechern (vier Jahre in Sibirien) angeht, so sollte seine Idee der „heiligen Scheu“, die
mit Epilepsie (Dostojewski bekam diese Krankheit im Gefängnis) und mit Geistesstörungen verbunden war, Nietzsche bekannt gewesen sein.145 Das Thema der Epilepsie, der „Epilepsoïden“ (AC 21, KSA 6, S. 188), der „Epileptiker des Begriffs“ (AC 54,
KSA 6, S. 237) wird von Nietzsche mehrmals aufgenommen. Wenn Dostojewskis
Künstler-Optik die tiefsten Abgründe der Psychologie des russischen Verbrechers
zeigte, war die Welt, die sich dadurch auftat, aus Nietzsches Sicht eine kranke Welt –
die Welt des Ressentiments, der décadence, des Christentums. Diese Welt war von der
Sehnsucht nach Erlösung besessen. Den Verbrecher, der an seinem schlechten Gewissen leidet und von der Gesellschaft bestraft wird, stellte der russische Schriftsteller nicht als „Entartung“, sondern, gerade umgekehrt, als höchsten Menschen-Typus
dar.
143 Sigmund Freud, Dostojewski und die Vatertötung, S. 414.
144 Sigmund Freud, Dostojewski und die Vatertötung, S. 411. Aus dieser Gewissensbelastung erklärt
Freud Dostojewskis Gottesglauben und all seine Ansichten, die Staat, Kirche und Weltgeschichte
betreffen, sogar seine Spielsucht.
145 S. dazu den bereits angegebenen Brief an Köselitz vom 7. März 1887 (KSB 8, S. 41).
5.4 Die „Bosheit“ der Russen
507
Auf einen Brief von Georg Brandes, der Nietzsches Begeisterung für Dostojewski
abkühlen wollte, indem er den russischen Schriftsteller als Verkörperung aller der
Eigenschaften darstellte, die Nietzsche für verachtungswürdig hielt (als exaltierten
Christen im Sinne der „Apostel[ ] und Disciplen des ersten christlichen Zeitalters“,
„ganz christlich in seinem Gefühlsleben und zugleich ganz sadique“, als Vertreter von
dem, was Nietzsche „Sklavenmoral getauft“ hatte), gab dieser die folgende Antwort:
Ihren Worten über Dostoiewsky glaube ich unbedingt; ich schätze ihn andererseits als das werthvollste psychologische Material, das ich kenne, – ich bin ihm auf eine merkwürdige Weise,
dankbar, wie sehr er auch immer meinen untersten Instinkten zuwider geht. Ungefähr mein
Verhältniß zu Pascal, den ich beinahe liebe, weil er mich unendlich belehrt hat: der einzige
l o g i s c h e Christ… (Brief an Georg Brandes vom 20. November 1888, KSB 8, S. 483)
So wird Dostojewski schließlich aus einem „tiefen Menschen“ und Psychologen, der
selbst Nietzsche belehren konnte, zu dem „werthvollsten psychologischen Material“.
Nun wird er nicht mehr mit Stendhal oder Schopenhauer, sondern mit Pascal verglichen. Es handelt sich jedoch, das muss betont werden, nicht um eine Stimmungsschwankung bei Nietzsche oder eine plötzliche Wendung in seinem Verhältnis zu dem
russischen Schriftsteller unter dem Einfluss von Brandes. Dostojewskis Geschmack sei
immer, so Nietzsche, seinen „untersten Instinkten zuwider“ gegangen, und dafür
sei er ihm besonders dankbar. Dostojewski mit seiner Psychologie sei selbst bloß
ein psychologischer „Typus“, der philosophisch zu interpretieren ist – als logischer
Christ, als vollkommener Typus eines Christen.
Bemerkenswert ist, dass Dostojewski sich definitiv in dem Sinn äußerte, dass er
nicht als Psychologe bezeichnet werden will. Eine in der Dostojewski-Forschung viel
zitierte These aus seinem Notizheft lautet:
Man nennt mich einen Psychologen: das ist nicht wahr, ich bin nur ein Realist im höheren Sinne,
d. h. ich schildere alle Tiefen der menschlichen Seele. (DGA 27, S. 65)
Diese scharfe Entgegensetzung „Psychologie – Realismus“ kann verwundern, insbesondere wenn es um die „Tiefen der menschlichen Seele“ geht.146 Sie wird jedoch
verständlich, wenn wir an Dostojewskis Deutung des Realismus in der Kunst als
Spannung zwischen dem Ideal und der Wirklichkeit denken. Denn das Ideal, das die
„Seele“ bewegt, ist nach Dostojewski auch „real“, es kann wirklicher als die Wirklichkeit selbst werden, wenn man die Kraft eines Künstlers besitzt, wenn also das Ideal
als tiefste Schicht der fantastischen Wirklichkeit dargestellt werden kann. Eine ge-
146 Zur Interpretation dieser Aussage Dostojewskis im Zusammenhang mit Nietzsches Bezeichnung
Dostojewskis als Psychologen s. Charles Anthony Miller, Nietzsches „Soteriopsychologie“. Den Realismus bei Dostojewski deutet Miller im Sinne der überindividuellen Wirkkräfte, die über den einzelnen
Menschen herrschen. Millers Analyse der Differenzen zwischen Dostojewski und Nietzsche scheint mir
allerdings unzureichend zu sein, besonders hinsichtlich der „stark ‚biologistisch‘ gefärbten Anthropologie von Nietzsches letzter Schaffenszeit“ (S. 133).
508
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
naue psychologische Beobachtung, eine detaillierte Untersuchung des ‚Faktischen‘
ist folglich nicht genug, weil, wie Dostojewski einmal sagte, „ein Mensch sich selbst
nicht immer ähnlich ist“ (DGA 21, S. 75). Um die „Tiefen“ des Menschlichen zu zeigen,
braucht man viel mehr als Psychologie. Gerade als Dichter müsse man dafür die
„Aufgabe der Philosophie erfüll[en]“, die Dostojewski als „Erraten“ eines „Gottes“
beschrieben hat.147
Auf dieses „Erraten“ der Götter zielt auch Nietzsches „Psychologie“, d. h. ihr Ziel
ist keine bloße Typisierung und genaue Beobachtung, wie es auch nicht das Ziel von
Dostojewskis „Realismus“ gewesen ist. Die erratenen „Typen“ sind Fluchtpunkte
mehrerer Perspektiven auf das Leben, mehrerer Kunstgriffe, die das Leben erträglich
machen. Die kühnste unter ihnen ist die Kunst. Sie ist „das große Stimulans des
Lebens, zum Leben“ (Nachlass, Frühjahr 1888, 14[26], KSA 13, S. 230). Auch ein
Künstler, der sich, wie Dostojewski oder Tolstoi, zum Christentum bekennt und dabei
ein „Realist“ bleiben will (die Bezeichnung steht traditionell für diese beiden russischen Schriftsteller in der Literaturwissenschaft), ist schließlich so ein „Typus“, er
offenbart die tiefsten Abgründe der „menschlichen Seele“ – der Seele eines Künstlers.
Aber dieser „Typus“ ist schwieriger zu erraten als alle anderen. Denn als Dichter
„lügt“ er „zuviel“, wie es schon in Also sprach Zarathustra und von Zarathustra selbst
behauptet wurde. Er will die „Wünsche seines Herzens“ als die einzige Realität verkaufen. Und je tiefer seine „Psychologie“ eindringt, desto kühner wird sein Betrug,
desto sicherer verführt er die anderen zu seinem „Gott“.
Der Dichter legt seine Plausibilitäten offen, er verrät sie selbst und entzieht der
Kritik ihren Boden. Mit seiner „Lüge“ übertrifft er so den „chinesischen Krämer“ Kant,
der die eigene Wahrhaftigkeit bezeugte, um damit besser betrügen zu können. Die
Künstler dagegen geben die Unwahrheit ihrer Ideale zu und behaupten dabei, sie
seien die höchste Realität. Sie schämen sich nicht für ihre Lüge bzw. für ihren „bösen“
Willen zum Betrug und zum Selbstbetrug. So hat Dostojewski seinen Christus in der
Gestalt eines Idioten dargestellt und behauptete zugleich, dass er sich für ihn entscheiden würde, auch wenn er nichts mit der Wahrheit, ja selbst nichts mit der
Wirklichkeit zu tun hätte, auch wenn dieses Ideal sich als zerstörerisch erwiesen
hätte. So deutete Tolstoi sein Ideal aus dem paradoxen Gebot des Nicht-Widerstandes
und lehrte, dass ein solches Christentum niemals gelehrt werden könnte, dass es nur
deshalb die „Wahrheit des Lebens“ sei, weil eine solche Wahrheit sonst nirgendwo zu
finden ist, dass es nur deshalb das Gute sei, weil es keinen das Leben übersteigenden
Maßstab des Guten geben kann. Ein „harmonisches Zusammenführen“ der „unlogischen Begriffe“, deren Überzeugungskraft Tolstoi mit Erstaunen feststellen musste,
wurde ihnen beiden zur Richtschnur der Wirklichkeit. Diese russische „Logik“, die
von beiden russischen Schriftstellern vertreten wurde (Tolstoi mit seiner Formel des
Nicht-Widerstandes sei auch, wie Dostojewski, ein „logischer Christ“ gewesen), ging
147 S. Kapitel 4, Anm. 316.
5.4 Die „Bosheit“ der Russen
509
nicht bloß in ihren Einschätzungen Nietzsches „untersten Instinkten zuwider“, sondern lieferte ihm ein „wertvolles psychologisches Material“ für eine Distanzierung
von den „Künstlern“ wie auch von allen von ihm „erratenen“ „Typen“. Von Dostojewski als „Psychologe“ und Künstler zugleich wollte Nietzsche somit das lernen, was
man, wie er früher selbst gesagt hatte, allein „d e n K ü n s t l e r n a b l e r n e n “ kann:
eine Distanz zu den Dingen zu halten, und zwar dort, „wo die Kunst aufhört und das
Leben beginnt“ (FW 299, KSA 3, S. 538).
Dostojewskis realistische „Psychologie“ lehrt, sich der Moral aus Vernunft bereits
auf der tiefsten Ebene zu widersetzen: Sie sei, so Nietzsche, „ein schreckliches und
grausames Stück Verhöhnung des γνώθι σαυτόν, aber mit einer leichten Kühnheit
und Wonne der überlegenen Kraft hingeworfen“ (KSB 8, S. 41). Auch hier zeigt sich
die „Bosheit“ des russischen Künstlers: Sie öffnet die Abgründe des Menschlichen
und so das Umsonst jeder Selbsterkenntnis. Indem Nietzsche Dostojewski als seinen
Lehrer in der Psychologie angibt, setzt er auch seine eigene Psychologie „in einem
excentrischen Grade“ in den Gegensatz zur Selbstbeobachtung,
weil uns die Selbstbeobachtung als eine E n t a r t u n g s f o r m des psychologischen Genies gilt, als
ein Fragezeichen am Instinkt des Psychologen: so gewiß ein Maler-Auge entartet ist, hinter dem
der W i l l e steht, zu sehn, um zu sehn (Nachlass, Frühjahr 1888, 14[27], KSA 13, S. 231).148
Das „Problem der Psychologie“, so Nietzsche, sei von ihm schon in der Geburt der
Tragödie gestellt worden. Einen „neuen Typus des Pessimismus“, ein Gegenstück zum
„k l a s s i s c h e n “, stellte nun die russische Verhöhnung des Triebes zur Selbsterkenntnis dar. Eine solche „Psychologie“ wie die russische verstößt bewusst gegen das Gebot
der beiden griechischen „Gottheiten“ – Apollo und Sokrates.149 Sie gehorcht dagegen
dem „Versucher-Gott“ der Philosophen, Dionysos, der gebietet, „stärker, böser und
tiefer; auch schöner“ zu werden (JGB 295, KSA 5, S. 239). Auch Dostojewski als „tiefer
Mensch“ mit seiner Psychologie der starken und bösen „Typen“, mit seiner tragischen
Kunst und seiner Vorliebe für das Theater („Die Theatromanie“) habe, so Nietzsche,
diesem Gott der griechischen Tragödie gedient, wenn er sich auch immer wieder zum
christlichen Gott bekannte. Trotz dieser Glaubensbekenntnisse hat seine Kunst die
Schönheit des Bösen offenbart. Und auch umgekehrt: Das christliche Ideal wurde
dank ihr fantastisch und unglaubwürdig; die Moral aus Vernunft erschien zerstörerisch und lebensfeindlich.
Die „Psychologie“, die Nietzsche von Dostojewski als Künstler „ablernen“ will,
ist eine „fast“ „u n n a t ü r l i c h e [ ] Wissenschaft“ (FW 355, KSA 3, S. 594 f.). Sie will das
„Nicht-Fremde“, das eigene Selbst, „als Objekt“ nehmen. Denn:
148 Indem Nietzsche an dieser Stelle von den „Psychologen der Zukunft“ als von einem neuen „Wir“
redete, stellte er sie der wissenschaftlichen Psychologie seiner Zeit gerade entgegen (Nachlass, Frühjahr 1888, 14[27], KSA 13, S. 230).
149 Der Knecht des Kellerlochmenschen heißt Apollo.
510
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Der grosse Dichter schöpft n u r aus seiner Realität – bis zu dem Grade, dass er hinterdrein sein
Werk nicht mehr aushält… (EH klug 4, KSA 6, S. 287)
Doch das Ziel dieser Selbsterkenntnis sollte schließlich eine Distanzierung von sich
selbst sein.150 Eine solche Distanz wurde mit dem Untertitel von Ecce homo angedeutet: Indem man zeigt, „wie man wird, was man ist“, weist man auf die andauernde
Selbst-Distanzierung hin – eine Distanzierung, die mehr als bloße Selbstbeobachtung
impliziert, wie das „Jenseits“ der Moral mehr als bloße Bosheit zum Ausdruck bringt.
Um das zu werden, was man ist, soll man fortwährend über sich selbst hinausgehen
und, im Unterschied zu den Künstlern, das eigene „Werk“ stets aushalten. Bei dieser
Aufgabe konnten weder Künstler noch die von ihnen dargestellten „Typen“ mehr
behilflich sein. Sie zeigten zwar die physiologisch-psychologischen Gefahren für den,
der „Philosoph als höherer Künstler“, der Philosoph als „Dichter [seines] Lebens“ sein
will. Doch ein solcher Philosoph sucht weder physiologische Klugheit noch einen
psychologischen Kunstgriff, der das Leben erträglich macht, sondern allein eine
„Erhöhung des Typus ‚Mensch‘“, eine Selbstüberwindung, die, wie das Werk der
Aufklärung, nur „an sich selber“ „fortzusetzen“ ist.
Der „Typus ‚Mensch‘“, dessen Erhöhung Jenseits von Gut und Böse forderte, gibt
allen anderen „Typen“ Nietzsches einen Maßstab vor und bietet eine übergreifende
Perspektive für alle weiteren Typisierungen an, auch wenn er selbst niemals definiert
werden könnte. Denn sein einziges Merkmal ist die Distanzierung von allen anderen
„Typen“, die Entgrenzung ihrer Lebensperspektiven. Dieser Typus in seinen höheren
Erscheinungen wurde in dem Hauptstück Was ist vornehm? aus dem „P a t h o s d e r
D i s t a n z “ gedeutet – aus der aristokratischen „Rangordnung und Werthverschiedenheit von Mensch und Mensch“. Es ging Nietzsche dabei wiederum nicht darum (der
ganze Aphorismus bringt das deutlich zum Ausdruck), die aristokratische Gesellschaft bzw. die Sklaverei zu befürworten. Der Wert von einem solchen „Pathos der
Distanz“ liege nicht in ihm selbst, sondern in einer Vorbereitung, in einer von ihm
geleisteten Vorarbeit:
Ohne das P a t h o s d e r D i s t a n z , wie es aus dem eingefleischten Unterschied der Stände […]
erwächst, könnte auch jenes andre geheimnissvollere Pathos gar nicht erwachsen, jenes Verlangen nach immer neuer Distanz-Erweiterung innerhalb der Seele selbst [meine Hervorhebung –
E.P.], die Herausbildung immer höherer, seltnerer, fernerer, weitgespannterer, umfänglicherer
Zustände, kurz eben die Erhöhung des Typus ‚Mensch‘, die fortgesetzte ‚Selbst-Überwindung des
150 Nach einer scharfsinnigen Bemerkung von Müller-Lauter bestehe der „höhere Realismus“ Dostojewskis gerade darin: „Es bleibe immer eine Distanz“. Gemeint wird eine Distanz zum eigenen Glauben
und zum eigenen Ideal. In der „Nichtidentität des Menschen“ stellt Müller-Lauter mit Berufung auf
Bachtin einen gemeinsamen Punkt bei Dostojewski und Nietzsche fest, wobei die Möglichkeit einer
„psychologischen Selbstdurchschauung“ grundsätzlich bezweifelt wird (Miller, Nietzsches „Soteriopsychologie“, S. 152).
5.4 Die „Bosheit“ der Russen
511
Menschen‘, um eine moralische Formel in einem übermoralischen Sinne zu nehmen. (JGB 257,
KSA 5, S. 205)
Dieser „übermoralische Sinn[ ]“ einer moralischen Formel ist gerade das, was wir als
Plausibilität von Nietzsches „letzter Moral“ ausgelegt haben. Der Wert der Distanz zu
den „Wünschen seines Herzens“, der Wert des Misstrauens gegenüber dem eigenen
Wahrheitstrieb, gegenüber dem eigenen „Für“ und „Wider“, wird in dieser Würdigung der „Distanz-Erweiterung innerhalb der Seele selbst“ schon vorausgesetzt.
Denn, so stellt Nietzsche in einem für sich gemachten Notat fest,
[d]as Pathos der Distanz, das Gefühl der Rangverschiedenheit liegt im letzten Grunde aller Moral.
(Nachlass, Herbst 1885–Frühjahr 1886, 1[10], KSA 12, S. 13)
Eine philosophische Distanz zu den eigenen Wertschätzungen und Idiosynkrasien,
zur eigenen Wünschbarkeit und Vorliebe wird von Nietzsches „letzter Moral“ geboten – ein „Jenseits“ vom eigenen Gut und Böse. Diese Distanz soll immer wieder
erobert werden, denn sie geht immer wieder verloren. Es handelt sich, es sei noch
einmal betont, um ein philosophisches Experiment, nicht um eine psychologische
Selbst-Beobachtung bzw. Selbsterkenntnis. Die russischen „Typen“ – die des „Erlösers“, des Verbrechers, des Bauern und schließlich der des russischen Künstlers –
boten das wertvollste Material für dieses Experiment an. Ihre Fremdheit, ihre seltsame
„Musik“ konnten als Zeichen einer anderen Denkweise und einer anderen Lebenspraxis interpretiert werden, als Alternative zur jahrtausendelangen Geschichte des
christlichen Abendlandes, für deren Gipfel und Erbe sich Nietzsche selbst hielt, der er
sich aber auch gleichzeitig entgegensetzte. Diese Geschichte abzulösen und ihre
Ideale zu bekämpfen, hieße auch, eine Distanz zu der eigenen „letzten Moral“ zu
finden – die Selbst-Distanzierung eines Philosophen, der die eigenen Plausibilitäten
stets bedenkt und in Frage stellt. Aber, indem er dies tut, indem er eine „immer neue[ ]
Distanz-Erweiterung innerhalb [seiner] Seele“ sucht, bleibt er diesen Plausibilitäten
treu. Denn auch im Selbst-Verdacht, in der andauernd gesuchten Distanz zu sich
selbst, äußert sich der unersättliche Trieb nach göttlicher Vollkommenheit – der
Trieb, der von der Moral aus Vernunft als „guter Wille“ gewürdigt und geboten
wurde.
Die letztere Paradoxie seiner „letzten Moral“ kommt bei Nietzsche nur gelegentlich zur Sprache. Doch gerade sie sorgt für die Beweglichkeit all seiner Differenzierungen und Einschätzungen. Sie bleibt sein eigenes „ungeheures Fragezeichen“, seine
psychologische Selbst-Verhöhnung und philosophische Selbst-Herausforderung. In
seinem endlosen Kampf „für“ und „wider“ die eigenen Plausibilitäten beschaut er
verwundert die russischen Künstler-Philosophen, was sich an manchen Stellen als
höchste Anerkennung und Würdigung, an manchen aber als Angriff und Warnung
äußert. Denn ihre „Logik“ stellte für ihn schließlich ein merkwürdiges Beispiel (er
war, wie er selbst sagte, ihr „auf eine merkwürdige Weise“ dankbar) dafür dar, wie
der Künstler bewusst in der von ihm selbst erschaffenen Illusion bleiben kann. Seine
512
Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph
Konfrontation mit beiden Künstlern betraf nicht ihre Plausibilitäten, sondern ihren
Umgang mit den eigenen Plausibilitäten, die ihrem Ideal Überzeugungskraft gegeben
haben. Indem sie sich beide zu diesem Ideal bekennen und ihre Plausibilitäten
offenlegen, suchen sie keine Selbstüberwindung. Stattdessen sehen sie in ihrem Ideal
die einzige Realität, obwohl sie genau wissen, dass es sich um ihre Entscheidung
handelt, zu der es durchaus Alternativen gibt – eine Entscheidung zugunsten der
geliebten Gestalt eines „Anti-Realisten“, die mit Mitteln ihrer Kunst erschaffen wurde.
Ein solcher Künstler wird selbst zu einem „Anti-Realisten“, der die Realität in „Symbolen und Unfasslichkeiten“ aufhebt. Wenn er sich dabei, wie Dostojewski, für einen
„Realisten im höheren Sinne“ hält, so werden ihm die „Wünsche seines Herzens“
nicht nur zur einzigen Realität. Sie sind auch sein „Ja“ zum Leben und – noch
wichtiger – sein „Ja“ zu sich selbst, das dem Philosophen so schwer fällt. Darin besteht
die „göttliche Bosheit“ der Dichter, ohne die „das Vollkommne“ nicht vorstellbar ist
(EH klug 4, KSA 6, S. 286).151 Der Künstler als „Realist im höheren Sinne“ kann damit
immer noch „Etwas […] versprechen“, was weder durch die Moral aus Vernunft noch
von der „letzen Moral“ aus möglich ist. Er übertrifft somit den Philosophen, der ein
„höherer“ Künstler sein will. Der Letztere soll sich jeder Art von Erlösung zur Realität
verweigern – im Namen der „Selbst-Erhöhung“, im Namen der Philosophie.
151 An dieser Stelle in Ecce homo handelt es sich um Heinrich Heine, dessen Lyrik wiederum mit der
Metapher „einer gleich süssen und leidenschaftlichen Musik“ beschrieben wird.
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
Diese Untersuchung stellte sich die Aufgabe, den philosophischen Dialog von vier
prominenten Denkern zu rekonstruieren, um so die deutsche und die russische Moralkritik aus der Perspektive der jeweils anderen zu betrachten und um die Differenzen
ihrer Plausibilitäten sichtbar zu machen. Nietzsches Ansicht, dass es kein voraussetzungsloses Denken geben kann, hat dabei unsere Forschungsstrategie bestimmt
und wurde auch auf Nietzsches Philosophie selbst angewandt. Denn indem er über
die „Vorurtheile der Philosophen“ aufklärte, hatte Nietzsche diese „Aufklärung“ auch
„an sich selber“ „fortzusetzen“. Sein Umgang mit den eigenen Plausibilitäten war
allerdings anders als bei den von ihm kritisierten Denkern. Während die stillschweigend angenommenen Prämissen Kants zwar in Paradoxien und unvorhersagbaren
Schlussfolgerungen mündeten, selbst aber nicht in Frage gestellt wurden, betrachtete
Nietzsche gerade deren Infragestellung als seine Aufgabe. So brachte er nicht nur die
kantischen, sondern auch seine eigenen Plausibilitäten zur Sprache – samt ihren
Alternativen. Damit ging er bewusst das Risiko ein, dass es in der Philosophie keinen
festen Boden mehr geben wird.
Nietzsches Kritik der philosophischen Plausibilitäten darf jedoch nicht nur als
destruktiv angesehen werden. Denn sie zielte v. a. auf ein philosophisches Experiment, das zu einem neuen Verständnis der Philosophie führen sollte. Indem Nietzsche
die Frage stellte, wie man bewusst in der Illusion bleiben kann, suchte er nach einer
Alternative zu den moralischen Plausibilitäten des christlichen Abendlandes, für
deren Erben und Schicksal er sich selber hielt, nach einer alternativen Strategie im
Umgang mit den eigenen Plausibilitäten und nach einer Distanzierung von dem
bisher herrschenden Selbstverständnis der europäischen Philosophie. Der „Philosophie der Zukunft“ stellte er daher die Aufgabe, nicht nur die unausgesprochenen
Prämissen des philosophischen Denkens aufzudecken, sondern auch einen neuen
Umgang mit Plausibilitäten zu entwickeln, der erlauben könnte, sie einer immer
wieder neuen Umwertung zu unterwerfen. Die Philosophen müssten sich nun wie
Künstler, und mehr als Künstler es je getan haben, zu ihren Werten als ihren Werken
bekennen, ohne dabei zu verlernen, neue Werte zu schaffen.
Die Frage, ob es Nietzsche gelungen ist, der Philosophie einen neuen Weg zu
weisen, kann nur aus der Perspektive der jüngeren Philosophiegeschichte und selbst
dann sehr unterschiedlich beantwortet werden. Die Aufgabe dieser Arbeit war bescheidener: die Differenz von Nietzsches eigenen Plausibilitäten zu denen der kantischen Moralphilosophie und denen des russischen Denkens philosophisch zu interpretieren. Faszinationen oder Irritationen in der gegenseitigen Rezeption, wo sie
historisch zustande kam, wurden dabei als indirekte, häufig ambivalente Hinweise
auf die grundlegende Differenz der Plausibilitäten betrachtet, die nur durch philosophische Rekonstruktion festzustellen ist, d. h. nur durch eine Untersuchung des
jeweiligen Umgangs mit den Schwierigkeiten, die den Grundannahmen entspringen.
Es war von Anfang an ersichtlich, dass eine solche Untersuchung sich bei Kant und
514
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
Nietzsche, besonders aber bei Tolstoi und Dostojewski unterschiedlicher Forschungsstrategien bedienen und sich eventuell auf verschiedenen Ebenen bewegen muss.
Denn z. B. Dostojewski räumt den unversöhnten Widersprüchen mehr Platz in seinem
Denken ein, als Kant es je getan hätte. Tolstoi, indem er sich zu bestimmten philosophischen Autoritäten (Sokrates, Spinoza, Kant) bekennt, verfolgt ganz andere,
von diesen abweichende Ziele, was für mehrere Widersprüche in seinen philosophischen Werken sorgt. Darüber hinaus haben die Kunstwerke bei den Künstler-Philosophen ein solches Gewicht, dass ihre theoretischen Traktate hinter ihnen zurücktreten. Die Letzteren wurden daher vor dem Hintergrund der Ersteren betrachtet, und
beide – Kunstwerke wie moralphilosophische Überlegungen – wurden in ihrer gegenseitigen Bezogenheit ausgelegt.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen scheinen mir folgende zu sein.
Kants systematischer Umgang mit Paradoxien, die seinen Grundannahmen entsprangen, wurde als Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung dargestellt – als Nötigung
zur Perspektivierung der Vernunft durch das individuelle Vermögen der Urteilskraft
bzw. als Nötigung zur Unterscheidung der allgemeinen Prinzipien und ihres konkreten Gebrauchs. Gerade weil das Pathologisch-Empirische nach Kant nicht vernachlässigt werden durfte, musste damit ein richtiger Umgang entwickelt werden. Der
Mensch als ein nicht bloß vernünftiges, sondern auch ästhetisch bedingtes Wesen,
das stets die eigene Unvollkommenheit bedenken muss, wurde so zum eigentlichen
Gegenstand der kritischen Philosophie. Das ästhetische Bedingt-Sein der nicht rein
vernünftigen Wesen, die zur Vollkommenheit berufen sind, nötigte weiter zur Annahme von „Ergänzungsstücken“ zur Moral aus Vernunft – der Liebe, die die Neigung
gegenüber einem konkreten Menschen zur Bedingung der Moralität erhebt, und des
ästhetischen Ideals, das durch die Kunst bzw. durch das Werk eines Genies dem
moralischen Ideal ästhetische Verdeutlichungen verschafft und sie als Muster der
Vollkommenheit präsentiert. Kants Kritik des individuellen Vermögens der Urteilskraft ließ so eine Erlösung von der Überforderung durch das moralische Gesetz und
das harte Urteil des Gewissens (der sich selbst richtenden Vernunft) zu, aber nur als
Hoffnung bzw. als Möglichkeit, deren endgültige Realisierung niemals geleugnet
werden durfte. Das war die Hoffnung, dass die empirisch-pathologischen Neigungen
nicht immer und ewig der Vernunft widersprechen müssen, dass der Einzelne den
Ansprüchen des Allgemeinen genüge tun kann, dass das Schöne dem Guten nicht nur
symbolisch entspricht. Der Wert des Allgemeinen für den Einzelnen war somit trotz
der Unvollkommenheit des Letzteren oder gerade ihretwegen über jeden Zweifel
erhaben. Es durften keine Zweifel aufkommen, dass, wenn alles Zufällig-Pathologische, Ästhetisch-Bedingte im Willen des einzelnen Menschen weggedacht werden
könnte, das Vernünftig-Allgemeine als ‚Rest‘ bleiben würde – als Bedingung der
Vollkommenheit des Einzelnen. Diese grundlegende Plausibilität Kants wurde von
ihm nicht ausgesprochen, sie galt ihm als selbstverständlich und alternativlos. Als
nicht ausgesprochene Prämisse plausibilisierte sie alle Paradoxien der Kritik, z. B. die
Paradoxie des sich für und gegen die eigene Freiheit frei entscheidenden Willens bzw.
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
515
die Paradoxie der für und gegen die Vernunft gebrauchten Vernunft. Die Paradoxien
verschoben ihrerseits alle Grundunterscheidungen der Kritik – die Unterscheidungen
vom Allgemeinen und Individuellen, vom Vernünftigen und Ästhetisch-Bedingten
und schließlich auch die vom Guten und Schönen. Im Ideal der Vollkommenheit, das
die Kunst den Sinnen bietet, wird die Welt zu einem „schönen moralischen Ganze[n]“,
das zwar nie gegeben ist, aber den Menschen, gerade als vernünftigen Wesen, immer
begehrenswert erscheint und selbst für Philosophen ein unhinterfragbares Ziel bleibt.
Die Plausibilitäten der kantischen Moralkritik, die man als Vervollkommnung der
sokratisch-christlich-abendländischen Moral aus Vernunft betrachten kann, hat
Nietzsche ans Licht gebracht, indem er eine klare Alternative zu ihnen aufzeigte:
Wenn wir alles Pathologisch-Empirische aus unserem Denken und Handeln herausrechnen, kann es sein, dass nichts zurückbleibt, d. h. nichts, was „für jedermann
gültig“ sein könnte. Durch Kant, stellt Nietzsche fest, ist das Unerreichbare zum
Maßstab der Erkenntnis, das Unbegreifliche zur Bedingung des Handelns und damit
die grausame Überforderung zur Richtschnur des Lebens geworden. Jedoch ging es
Nietzsche dabei nicht bloß darum, die kantischen Plausibilitäten zu bestreiten. Vielmehr wollte er zeigen, wovon Kant sich dabei leiten ließ – von einer bestimmten Not,
von einem Bedürfnis nach dem Glauben an eine Erlösung der Welt, nach dem Vertrauen in die „Wünsche seines Herzens“. Jeder Philosophie, die Idealen anhängt, liegt
eine Wünschbarkeit zugrunde. Die Letztere ist eine unerlässliche Bedingung des Philosophierens selbst und gleichzeitig der blinde Fleck der philosophischen Argumentation. Daher ist gerade Argwohn gegen eigene Wünschbarkeit – so Nietzsches neue
Plausibilität – das schwerste, aber auch wertvollste Erbe der europäischen Philosophie. Die dem Philosophen am schwersten fallende Parteinahme gegen seinen eigenen „Herzenswunsch“ sei ihre letzte Weisheit.
Die neue Plausibilität, die Nietzsche im Unterschied zu den kantischen ins Spiel
bringt, unterscheidet sich allerdings grundsätzlich von allen der von ihm kritisierten
Plausibilitäten. Sie ist erstens selbst paradox (die kantische Plausibilität führte zu
Paradoxien, ohne selbst paradox zu sein) und zieht darum ständig Aufmerksamkeit
auf sich; sie wird immer wieder „sichtbar“. Sie funktioniert zweitens nur als ständiger
Argwohn gegen jeden Glauben, v. a. gegen den eigenen. Sie ist ferner eine moralische
Plausibilität, die, wenn sie in Frage gestellt und bestritten wird, den Fragenden selbst
kompromittiert, d. h.: sie verrät seine Wünschbarkeiten. So präsentiert Nietzsche seine
„letzte Moral“ als Höhepunkt und letzte Konsequenz der abendländisch-christlichen
Moral und zugleich als Zeichen ihres Untergangs. Nietzsches berühmte „Formel“ der
Selbstaufhebung der Moral durch das von ihr erzeugte intellektuelle Gewissen sollte
diese doppelte Funktion der „letzten Moral“ aufzeigen: In seinem Ideal der Selbstüberwindung feiert die abendländische Moral ihre letzte Plausibilität und macht sie
damit unplausibel.
Dennoch wollte Nietzsche mehr als nur selbstkritisch diese letzte Konsequenz
ziehen. Er wollte über die Kritik hinaus neue Wege zeigen und seine neuen Plausibilitäten nicht einfach stillschweigend voraussetzen, wo er die alten bekämpfte und
516
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
verleugnete, sondern einen neuen Umgang mit eigenen Plausibilitäten entwickeln
und dadurch auch die Grenzen des Denkbaren erweitern. Denn Plausibilitäten sind
schließlich die Markierungen dieser Grenzen. Das Problem läge daher nicht so sehr in
der Undurchschaubarkeit bzw. in der Unmöglichkeit, festzustellen, inwiefern der
„deus“ der Wünschbarkeit im eigenen Denken immer schon vorhanden ist, sondern
vielmehr in der Frage, ob dieser Wille zur Aufklärung über die eigenen Plausibilitäten
selbst nicht gewissen Plausibilitäten verhaftet bleibt, die für ihn wiederum undurchschaubar bleiben – z. B. in der Voraussetzung des Wertes des Verdachtes gegen jede
Sinngebung, des Wertes eines ständigen Misstrauens sich selbst gegenüber und
schließlich des Wertes der tragischen Erkenntnis, die an der Unlösbarkeit des Konflikts zwischen Realität und Wünschbarkeit festhält. Die Entscheidung zugunsten des
schwierigsten und unerträglichsten Gedankens kann selbst – darüber ist Nietzsche
sich völlig im Klaren – nicht begründet werden. Nur deshalb ist sie eine Entscheidung.
Nietzsche bringt sie als solche zur Sprache und verrät damit bewusst seine eigenen
Plausibilitäten – mit Hilfe von Begriffen, die nur als „Gegen-Begriffe“ sinnvoll sein
können, z. B. dem des Geschmacks und dem der Vornehmheit. Sie stehen für einen
immer noch möglichen Perspektivenwechsel, eine sich immer neu vollziehende Umwertung.
Das Sich-Widersetzen gegen den Willen zum Endgültig-Allgemeinen, zum NichtPerspektivischen, zum Alternativlosen konnte, wenn es nicht im performativen Widerspruch enden sollte, nur eine Aufgabe sein, der man sich immer wieder neu stellen
muss. Um zur tragischen Erkenntnis und gleichzeitig zur fröhlichen Weisheit zu
werden, sollte die Philosophie nach Nietzsche sich vor beiden Gefahren schützen –
vor der Sehnsucht nach Erlösung, welche zum gutmütigen Vertrauen in die „Wünsche
[des] Herzens“ führt, und vor der Resignation des Willens. Der Letztere als ein Wille
zum Nichts wird ebenso vom Wunsch nach Erlösung von der wie auch immer verstandenen Realität getragen. Nietzsche sucht dabei nach Alternativen nicht nur zu
den kantischen Plausibilitäten, sondern auch zu denen der eigenen „letzten Moral“.
Auch den Wert der tragischen Erkenntnis musste er experimentell bezweifeln, wenn
er nicht blind gegenüber den eigenen Plausibilitäten bleiben wollte. Er treibt so den
Willen zum Ungewissen bis zur äußersten Konsequenz. Er will alle Plausibilitäten in
Frage stellen, er will auch noch den Wert dieses Willens zum Fragen in Frage stellen.
Dafür brauchte er eine neue Perspektive, eine irritierend-fremde, merkwürdig-andere
Sicht auf die grundlegenden Probleme der Moral aus Vernunft. Als junger Philologe
und Anfänger in der Philosophie fand er diese andere Perspektive bei den Griechen,
oder vielmehr: erfand er sie als den von der griechischen Tragödie einst gefeierten
Augenblick einer Weltanschauung, die von der Moral aus Vernunft nicht betroffen
war. Er fand sie erneut in seinen letzten Schaffensjahren, als er die russischen
Künstler-Philosophen für sich entdeckte, die, ohne die Moral aus Vernunft zu leugnen, ihren Ausgangsplausibilitäten fremd blieben.
Tolstoi und Dostojewski wollten die Grundlagen der abendländischen Moral nicht
erschüttern. Vor allem Kant wurde von Tolstoi immer wieder als großer Lehrer und als
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
517
Autorität gepriesen. Indem Dostojewski nach dem „neuen Wort“ Russlands suchte,
meinte er nur die in Vergessenheit geratenen Ideale des abendländischen Christentums wiederzuentdecken. In den Kapiteln zu Tolstoi und zu Dostojewski hat die
Analyse ihres Denkens jedoch gezeigt, dass ihre Ausgangspunkte ebenso wie ihr
Umgang mit den eigenen moralischen Plausibilitäten den Grundeinstellungen der
abendländischen (sokratisch-kantischen) Moralphilosophie nicht entsprachen. Die
Plausibilitäten der russischen Denker blieben gegenüber denen der ‚westlichen‘ philosophischen Autoritäten different, was in der Geschichte oft nicht bemerkt oder gar
geleugnet wurde. Die Schwierigkeit, die Differenzen aufzudecken, lag u. a. darin, dass
die Philosophie der beiden Schriftsteller nicht direkt zum Ausdruck kam, sondern
indirekt, in „Kunstbildern“, die, zumal bei Dostojewski, den direkt ausgesprochenen
Gedanken widersprechen. Diese Widersprüche habe ich als Zeichen eines grundlegenden Konflikts interpretiert – eines Konflikts auf der Ebene der Plausibilitäten,
denen ein Künstler trotz seiner Künstler-Optik anhängt. Bei Dostojewski kommt er als
Konflikt zwischen den „Wünschen seines Herzens“ und der „fantastischen Wirklichkeit“ auf dramatischste Weise zum Ausdruck. Auch bei Tolstoi, der viel mehr als
Dostojewski eine systematische Darstellung seiner philosophisch-religiösen Ansichten anstrebte, findet man Gedankengänge, die unvermeidlich zu Paradoxien führen,
deren Entparadoxierung jedoch wiederum der Kunst vorbehalten bleibt. Die Not des
Einzelnen, der die Forderung der Allgemeinheit nur als Gewalt und Betrug erleben
kann, die Wahrheit der lebensnotwendigen Illusionen, die keine Alternative kennt,
das Gute des Lebens, worüber niemals gerichtet werden kann – das sind die Plausibilitäten der beiden russischen Denker, die die Wünschbarkeit in jeder Weltauslegung
nicht nur legitimieren; vielmehr können alle Prinzipien und Normen des Menschenlebens nur durch die Wünschbarkeit legitimiert werden. Dostojewski vollbringt dabei
eine gewagte Umkehrung der kantischen Begründungsstrategie: Nur das, was man
selbst tun will, kann als allgemein richtig anerkannt werden; nur das ist moralisch
gerechtfertigt, was mit dem persönlichen Ideal der Schönheit übereinstimmt bzw. was
geliebt werden kann. Bei Tolstoi wird das Prinzip, dem Bösen nicht zu widerstehen,
als einzig sichere Anwendung des kategorischen Imperativs angesehen, und die
„goldene Regel“ im Sinne eines persönlichen Wunsches, der das Richtmaß des Allgemeinen bestimmt, gedeutet. Die Erlösung von der Not des Lebens wird von beiden
russischen Denkern darüber hinaus nicht in Form allgemeiner Normen, sondern als
Anerkennung der eigenen untilgbaren Schuld gegenüber dem Leben gedacht. Die
Grundlagen der Moral aus Vernunft werden auch in den weiteren Schlussfolgerungen
erschüttert: Das Gute ist für den Menschen unerreichbar und dennoch in jedem
Augenblick möglich; es kann mit keinem menschlichen Maß gemessen werden; die
Grenzen zwischen den Individuen sind nicht die Grenzen ihrer Verantwortung. Das
Richtmaß des Guten wird bei Tolstoi im paradoxen Prinzip des Nicht-Tuns gefunden;
im Verzicht auf den Widerstand, obwohl dieser Widerstand mit dem Leben selbst
identisch ist; im „Verständnis“, dass nur der Widerstand gegen das Böse das Böse ist,
dass man immer nur sich selbst für das Böse halten darf. Bei Dostojewski wird das
518
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
Gute gerade in der Distanz zur eigenen Moral gefunden, es führt zum Bekenntnis einer
allumfassenden Schuld – der unergründbaren Schuld für das Böse dieser Welt, von
der sich keiner frei machen kann.
Die Plausibilitäten der beiden russischen Schriftsteller führen somit, wie auch bei
Kant und Nietzsche, zu Paradoxien, die nun aber stark auffallen. Bei Tolstoi geht es
um eine Lehre, die nicht gelehrt werden kann – die Lehre über den Sinn des einzelnen
Lebens, nämlich dass es gerade als einzelnes Leben keinen Sinn macht. Bei Dostojewski geht es um die Paradoxie der unbegrenzten Freiheit in der Erkenntnis von Gut
und Böse, die zur Anerkennung des allgegenwärtigen Bösen bzw. der allumfassenden
Unfreiheit führt; die Befreiung ist schließlich nur durch die Unterwerfung unter eine
ungerechte Strafe für diese unergründliche Schuld der Welt möglich. Aber nicht diese
Schlussfolgerungen (die nicht nur für Kant befremdlich gewesen wären, sondern
selbst gegen Nietzsches „Geschmack“ gingen oder, wie er selbst sagte, seinen „tiefsten Instinkten zuwider“ waren) stellten für Nietzsche ein wertvolles „Material“ dar,
sondern – es sei noch einmal betont – der Umgang mit eigenen Plausibilitäten, den
nur Dichter sich erlauben können. Sie legen ihre Plausibilitäten offen, ohne dabei
aufzuhören, sich an sie zu halten. Die beiden russischen Dichter bekannten sich zu
den „Wünschen [ihres] Herzens“ als zu der einzigen Realität. Mehr noch: Die Realität,
die diesen „Wünschen“ fremd blieb, wussten sie als „fantastisch“ darzustellen. Der
Kunst und den Künstlern haben sie (bei aller Verschiedenheit ihrer Ansichten zur
Kunst) das Privileg vorbehalten, die Überkomplexität der Wirklichkeit zu vereinfachen und andere Menschen mit ihrer Liebe zum unbegründeten Ideal der Vollkommenheit wie mit einer Krankheit „anzustecken“. Diese durch die Kunst allein übertragbare, „ansteckende“ Gesundheit war für beide die Kraft, die den Einzelnen von
der Macht der „geschlossenen Masse“ des Bösen, von der Macht des unergründbaren
und allgegenwärtigen Übels der Welt befreien kann – den Einzelnen samt seinen
Vorlieben, samt seinen „Wünschen“ und Idealen. Diese Befreiung sei die Fähigkeit
eines Künstlers, der allein die Welt in ein „schönes moralisches Ganze[s]“ verwandeln
kann, obwohl er genau weiß, dass es, wie bei Dostojewski, bloß seine Sehnsucht nach
dem Ideal ist, oder, wie bei Tolstoi, nur sein persönliches, nur ein auf Zeit erreichtes
Verständnis über das Wohl des eigenen Lebens. Das Ideal der Vollkommenheit wird
von dieser Kunst selbst hervorgebracht, aber nicht als symbolische Verdeutlichung
des Unerreichbaren, sondern als die einzige Realität, die der Künstler kennt. Und
wenn seine Plausibilitäten unplausibel sind, so scheint er sich davon wenig stören zu
lassen. Denn er weiß, dass der von ihm erschaffenen Illusion nichts entgegentreten
kann, dass die Welt, die sich seinen Blicken eröffnete und durch seine „Optik“
geschildert wurde, nur deshalb die „wahre“ ist, weil sie den tiefsten „Wünschen
seines Herzens“, seiner tiefsten Not entspricht.
In seinem Spätwerk setzt Nietzsche seine Experimente mit den Plausibilitäten
der abendländischen Philosophie fort. Er sucht nach einem Weg in der Philosophie,
auf dem die „Musik des Lebens“ über die Wünschbarkeit hinaus bzw. jenseits des
Anders-haben-Wollens, jenseits des Ressentiments wieder zu hören wäre. Er kommt
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
519
dabei immer wieder auf die Erfahrung der Künstler zurück, die allein ein Auge für das
Perspektivisch-Einmalige, für das Flüssige des Lebens zu haben scheinen und die
allein deshalb „Ja“ zum Leben sagen können. Sie scheinen auch zu wissen, wie man
bewusst in der Illusion bleiben kann und dabei nicht verlernt, Zeichen-Oberflächen zu schaffen. So fragt Nietzsche, wie man diese Weisheit der Künstler über die
Grenze der Kunst hinaustragen kann, d. h. wie „wir“ als Philosophen „Dichter unseres
Lebens“ werden können.
Die Antwort auf diese Frage implizierte jedoch nicht, dass man sich als Philosoph
den Künstlern einfach anschließen soll. Man könne ihnen gewiss etwas Wichtiges
„ablernen“, denn bei ihnen sei viel Philosophisches zu finden, aber auch viel Schauspielerisches und wenig von der intellektuellen Strenge in der Behandlung eigener
Ideale, sehr wenig von der Wahrhaftigkeit des Erkennenden. Man darf auch nicht
vergessen, dass der Schauspieler als genealogischer Vorgänger des Künstlers Nietzsche im Laufe der Zeit immer mehr irritierte. Die „Praktik“ der Künstler, die keine
Distanz zu den „Wünschen [ihres] Herzens“ bewahren und sie für die einzige Realität
erklären, wirkte auf den Philosophen, der eine fortdauernde Selbstüberwindung
suchte, ebenso irritierend. Jedoch sollte er, wenn er die „grosse Gesundheit“ jenseits des Ressentiments anstrebte, auch diese Irritation hinter sich lassen, er sollte
auch diese irritierende Künstler-Erfahrung für die Philosophie fruchtbar machen, um
sich dann, wie Nietzsche es einmal für sich notierte, „als höhere[n] Künstler“ zu
verstehen.
Gerade die Irritation, die vonseiten der Kunst ausging, samt der Einsicht in die
eigenen Plausibilitäten und in die ihnen zugrunde liegenden Paradoxien, nötigte
Nietzsche immer wieder dazu, sein eigenes Projekt der „Philosophie der Zukunft“ zu
revidieren. Die Gedankenanstöße dafür fand er u. a. in der russischen Literatur bzw. in
den russischen „Typen“ der Fatalisten und Nihilisten, für deren Bezeichnung er
wiederum einen Gegen-Begriff erfand: Die „Bosheit“ der Russen sei es, die Russland
als „einzige Macht Europas“ kenntlich macht, die „Etwas noch versprechen kann“,
z. B. eine Alternative zur europäischen Selbstaufhebung, aber vielleicht auch zum
europäischen Willen zur Selbstüberwindung. Die russischen „Typen“ eröffneten die
Möglichkeit einer neuen Perspektivierung der Moral aus Vernunft und selbst der
„letzten Moral“ Nietzsches. Indem er sich selbst als den letzten tragischen Philosophen darstellte, suchte Nietzsche somit nicht bloß die Unterstützung gegen die Moral
aus Vernunft seitens der russischen Künstler-Philosophen. Vielmehr wollte er sein
Experiment mit den Plausibilitäten weiterführen. Doch diesmal war es nicht bloß das
Experiment mit den Plausibilitäten kantischer Moralkritik, sondern das mit seinen
eigenen ‚letzten‘ Plausibilitäten, die auf ihren Wert für das Leben geprüft werden
sollten. Dafür brauchte er einen Gegner, dessen „Praktik“ seine eigenen Plausibilitäten tatsächlich in Frage stellen konnte.
Die Darstellung des „Typus des Erlösers“ in Der Antichrist war das Ergebnis von
Nietzsches genealogischer Suche nach den Quellen mehrerer Umwertungen, die in
der Geschichte vollzogen wurden, und der Höhepunkt seiner eigenen Umwertung des
520
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
abendländischen Christentums. Sie war aber auch ein Experiment mit den eigenen
Plausibilitäten und der Versuch, ihre Alternativen konsequent zu durchdenken. Der
„Typus“ wird dabei bewusst als Erfindung präsentiert: Er könne aus einem russischen
Roman gekommen sein. Als Synthese der Künstler-Welten Dostojewskis und Tolstois,
als das aus ihren Plausibilitäten entstandene Ideal, wird der „Erlöser“ zwar zum
Idioten erklärt, dennoch ist sein Idiotismus dem kantischen (von dessen Idiotismus in
Der Antichrist auch die Rede ist) gerade entgegenzusetzen: Ihm werden die „Wünsche
seines Herzens“ tatsächlich zur einzigen Realität, für ihn gibt es wahrhaftig keine
Distanz zwischen ihnen und der ihnen sich widersetzenden Wirklichkeit; alles wird
ihm zum Zeichen, nichts gibt Anlass zur Unzufriedenheit mit dem Leben, nichts gibt
ihm Anlass zur Rache am Leben. Er allein hätte folglich keine Moral nötig, nicht
einmal die „letzte Moral“ Nietzsches. Denn wer die Realität völlig in Zeichen aufhebt,
braucht keine Selbstüberwindung, keinen inneren Kampf gegen den „deus“ der
Wünschbarkeit. Das „Pathos der Distanz“ ist ihm vollkommen fremd, er kennt keinen
Argwohn gegen sich selbst. Es bleiben dann nur noch zwei Möglichkeiten, wie man
einen solchen „Typus“ interpretieren kann: Entweder nimmt er nichts von der Realität
wahr oder aber seine Wahrnehmung ist die Realität, entweder bleibt er taub gegen die
„Musik des Lebens“ oder seine „Praktik“ ist diese „Musik“ selbst, entweder ist er ein
Idiot oder er ist Gott.
Diesem Gegner, der alle seine Plausibilitäten in Frage zu stellen scheint, setzte
Nietzsche seinen eigenen, von ihm noch früher erfundenen Gott Dionysos entgegen –
„de[n] Versucher-Gott und geborene[n] Rattenfänger der Gewissen, dessen Stimme bis
in die Unterwelt jeder Seele hinabzusteigen weiss“. Im Unterschied zum „Erlöser der
Menschheit“ sei er ein Genie, aber nicht bloß ein Genie im Sinne der Kunstphilosophie, sondern „das Genie des Herzens“, welches „voll neuen Willens und Strömens“,
aber auch „voll neuen Unwillens und Zurückströmens“ ist (JGB 295, KSA 5, S. 237).
Denn die Einsicht in das paradoxe Geflecht der Wünschbarkeit ist seine Spezialität. Er
allein kennt seine Gesetze, sein „Gesetz der Ebbe und Fluth“, das Wechselspiel
zwischen dem Willen und dem Unwillen, zwischen dem „Herzenswunsch“ und dem
Argwohn ihm gegenüber. Doch ist er, im Unterschied zum alten Gott, nicht bloß
Zuschauer dieses Spiels. Er ist auch Teilnehmer der „ewigen Komödie des Daseins“,
wenn er auch als tragischer Held an dem von ihm entdeckten Gesetz zugrunde gehen
muss – doch nur um danach wieder neu und lebendig zu erscheinen. Nietzsche
ernennt ihn nun zu einem Philosophen-Gott, zu dem Gott, der philosophiert. Im
Unterschied zum Gott der Philosophen wolle er die Menschen „stärker, böser und
tiefer; auch schöner“ sehen. Diesen Gott, der die Bosheit und die Schönheit zusammenfallen lässt, haben – so sieht es zumindest aus Nietzsches Sicht aus – die russischen Künstler-Philosophen „erraten“, auch wenn sie sich zu einem anderen Gott
bekannt haben, der gerade dank ihrer Kunst unplausibel geworden ist – zum Gott
ihrer Wünschbarkeit.
Der „russische“ Umgang mit Plausibilitäten sollte einem Philosophen, der eine
fortdauernde Selbstüberwindung anstrebt und sich leidenschaftlich zu seinem „Ver-
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
521
sucher-Gott“ bekennt, ein Rätsel bleiben. Doch konnte auch er nicht bestreiten, dass
ihre „Praktik“, die eigene Wünschbarkeit für die einzige Realität zu halten, gerade die
von ihm gesuchte Freiheit vom Ressentiment bedeutet. Insofern fühlte er sich von
ihnen bzw. von dem von ihnen vertretenen Ideal übertroffen. Er musste es als seinen
eigentlichen Gegner verehren. Er musste den russischen Schriftstellern als Künstlern
etwas „ablernen“, z. B. die nicht-revoltierende, „beherzte“ Akzeptanz des Lebens,
welche die Illusion als solche annimmt, ohne das Leben anders haben zu wollen, als
es einem Künstler gerade vorkommt. Durch diese Perspektivierung wurden die eigenen „Wünsche“ immer wieder sichtbar; dank ihr wurde eine immer neue SelbstDistanzierung möglich, u. a. eine Distanzierung von dem Prinzip, das Nietzsche als
seine „Moral“ (Nachlass, Herbst 1881, 15[20], KSA 9, S. 643), seine „Liebe“ (FW 276,
KSA 3, S. 521) und seine „innerste Natur“ (EH Bücher 4, KSA 6, S. 363) definierte – vom Prinzip des „amor fati“, das nun, im „russischen Fatalismus“, seine eigene
nihilistische „Widernatur“ entdecken musste. Die Letztere kennzeichnete die physiologisch-psychologischen Gefahren für den, der „jedem Glauben, jedem Wunsch
nach Gewissheit den Abschied giebt“ (FW 347, KSA 3, S. 583). So lernte der Philosoph sich auch von dem „G l a u b e n a n d e n U n g l a u b e n “ „nach Petersburger
Muster“ zu distanzieren, auch in ihm die eigenen Wünsche und Idiosynkrasien
schließlich aufzudecken und über den eigenen „deus“ der Wünschbarkeit immer neu
zu siegen.
Die „Russen“ wiesen so auf eine Alternative zur Moral aus Vernunft hin – auf die
„Bosheit“, die die Grundannahmen dieser Moral nicht anerkennt. Der „Realismus im
höheren Sinne“, den Dostojewski dem psychologisierenden Erkenntnistrieb entgegensetzte, eröffnete die Möglichkeit einer vollständigen „Entmoralisierung“ der
Welt, ihrer vollständigen Befreiung vom Ressentiment. Aber gerade deswegen strebte
dieser „Realismus“ auch weder den Widerstand gegen den „deus“ der Wünschbarkeit
noch die „Erhöhung des Typus ‚Mensch‘“ an. Dies war nicht nur die Alternative zur
sokratisch-kantisch-christlichen Moral aus Vernunft, nicht nur die Alternative zu ihrer
Selbstaufhebung, sondern auch die zur „Selbstüberwindung des Moralisten in seinen
Gegensatz“ – in Nietzsche (EH Schicksal 3, KSA 6, S. 367). Der von den russischen
Dichtern inspirierte „Typus des Erlösers“ wurde schließlich zum Anti-Helden Nietzsches, zum Gegenteil von allem, worauf er selbst Wert legte. Obwohl die russischen
Künstler-Philosophen Nietzsche weiterhin faszinierten, war er weit davon entfernt, in
der russischen „Handhabung des Lebens“ ein Heilmittel für das am Christentum bzw.
am Nihilismus erkrankte Europa zu sehen. Aus der Perspektive der europäischen
Philosophie, die den langen Weg der Moral aus Vernunft gegangen ist – den Weg, der
zur Selbstkritik und über sie hinaus zur Selbstaufhebung führte –, sah die russische
„Logik“ (Dostojewski und Tolstoi als „logische Christen“) gerade wie der äußerste
Nihilismus aus. Die göttliche Naivität des „Typus des Erlösers“, wie sie in der russischen Kultur von Nietzsche wahrgenommen und interpretiert wurde, war für den
Denker, der die Versuchungen des Ressentiments aus eigener Erfahrung kannte und
eine fortdauernde Selbstüberwindung als die tiefste eigene Not erkannte, weder
522
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
erreichbar noch erwünscht. Denn jene von Nietzsche ständig gesuchte Distanz zu sich
selbst – sein „Pathos der Distanz“ – war gerade seinen russischen ‚Gesprächspartnern‘ fremd. Ihre Künstler-Erfahrung bot zwar das „wertvollste psychologische Material“, musste aber als philosophische Position letztlich zurückgewiesen werden. Als
Philosoph konnte man nach Nietzsche nur dann bewusst in der Illusion bleiben, wenn
man sie als solche immer wieder entdeckte, um sich von seinen Illusionen immer
wieder neu zu distanzieren. Ohne das „Pathos der Distanz“ wäre nicht nur die Moral,
sondern auch die Philosophie nicht mehr möglich, zumindest die Philosophie, wie
Nietzsche sie verstand – als andauernder Verdacht gegen die eigenen „Wünsche“, als
fortgesetzte „Distanz-Erweiterung innerhalb der Seele selbst“ und schließlich als
unerlässliche Erhöhung der eigenen Vorstellung über das, was als Erhöhung gelten
soll. Nur auf diese Weise könnte ein Philosoph zum „höhere[n] Künstler“, zum
„Dichter [seines] Lebens“ werden: Indem in ihm „Eins“ immer wieder „zu Zwei“ wird,
und ein Zarathustra, der seine Gedanken in eine positive Lehre umgestaltet, an ihm
„vorbei“ geht (FW, Sils-Maria, KSA 3, S. 649).
Literatur
Günter Abel, Nietzsche contra ‚Selbsterhaltung‘. Steigerung der Macht und ewige Wiederkehr, in:
Nietzsche-Studien 10/11 (1981/1982), S. 366–384.
Günter Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, Berlin, New
York: Walter de Gruyter, 1984, (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 15).
Rainer Adolphi, Moralische Integration. Über eine Lücke in Hegels Theoriebildung und die Nietzscheanischen Versuchungen der Antwort, in: Andreas Arndt, Paul Cruysberghs, Andrzej Przylebski
(Hg.), Hegel-Jahrbuch 2009. Hegels politische Philosophie, Berlin: Akademie Verlag, 2009,
S. 34–47.
Theodor W. Adorno, Kants „Kritik der reinen Vernunft“, hg. v. R. Tiedemann, Frankfurt a/M: Suhrkamp,
1995, (Nachgelassene Schriften, Abteilung IV, Bd. 4).
Jörg Albertz (Hg.), Kant und Nietzsche – Vorspiel einer künftigen Weltauslegung?, Hofheim: FA, 1988.
Jörn Albrecht, Nietzsche und das „Sprachliche Relativitätsprinzip“, in: Nietzsche-Studien 8 (1979),
S. 225–244.
Michael Albrecht, Kants Antinomie der praktischen Vernunft, Hildesheim: Olms, 1978.
Michael Albrecht, Kants Maximenethik und ihre Begründung, in: Kant-Studien 85 (1994), 129–146.
Henry E. Allison, Kant’s Theory of Freedom, New York: Cambridge University Press, 1990.
Henry E. Allison, Kant’s Theory of Taste: A Reading of the Critique of Aesthetic Judgment, Cambridge,
New York: Cambridge University Press, 2001.
Karl Ameriks, New Views on Kant’s Judgement of Taste, in: Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s
Aesthetics, L’esthétique de Kant, S. 431–447.
Dieter Arendt (Hg.), Der Nihilismus als Phänomen der Geistesgeschichte in der wissenschaftlichen
Diskussion unseres Jahrhunderts, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974.
Markus Arnold, Die harmonische Stimmung aufgeklärter Bürger. Zum Verhältnis von Politik und
Ästhetik in Immanuel Kants „Kritik der Urteilskraft“, in: Kant-Studien 94 (2003), S. 24–50.
Babette Babich (Hg.), Habermas, Nietzsche, and Critical Theory, New York: Humanity Books, 2004.
Tom Bailey, Nietzsche’s Engagements with Kant, in: Ken Gemes, John Richardson (Hg.), The Oxford
Handbook of Nietzsche, Oxford: Oxford University Press, 2011.
Christian Bartolf, Ursprung der Lehre vom Nicht-Widerstehen. Über Sozialethik und Vergeltungskritik
bei Leo Tolstoi, Berlin: Gandi-Informations-Zentrum, 2006.
Wolfgang Bartuschat, Zum systematischen Ort von Kants Kritik der Urteilskraft, Frankfurt a/M:
Klostermann, 1972.
Hermann Baum, Kant: Moral und Religion, Sankt Augustin: Academia, 1998.
Alexander Gottlieb Baumgarten, Theoretische Ästhetik. Die grundlegenden Abschnitte aus der
„Aesthetica“ (1750/58), lat.-dt., hg. v. H.R. Schweitzer, Hamburg: Meiner, 1988.
Lewis White Beck, Kants „Kritik der praktischen Vernunft“, München: Fink, 1974.
Reinier Franciscus Beerling, Hegel und Nietzsche, in: Hegel-Studien 1 (1961), S. 231–233.
Ernst Behler, Nietzsche und die frühromantische Schule, in: Nietzsche-Studien 7 (1978), S. 59–87.
Ernst Behler, Die Sprachtheorie des frühen Nietzsche, in: Borsche, Gerratana, Venturelli (Hg.),
„Centauren-Geburten“, S. 99–111.
Sven Bernecker, Kant zur moralischen Selbsterkenntnis, in: Kant-Studien 97 (2006), S. 163–183.
Ruben Berrios, Nietzsche’s Vitalistic Aestheticism, in: Nietzsche-Studien 32 (2003), S. 78–102.
Heiner Bielefeldt, Kants Symbolik. Ein Schlüssel zur kritischen Freiheitsphilosophie, Freiburg,
München: Alber, 2001.
Walter Biemel, Die Bedeutung von Kants Begründung der Ästhetik für die Philosophie der Kunst, Köln:
Kölner Universitäts-Verlag, 1959.
Joshua Billings, Misreading the Chorus: A Critical Quellenforschung into Die Geburt der Tragödie, in:
Nietzsche-Studien 38 (2009), S. 246–268.
524
Literatur
Eugen Biser, Das Desiderat einer Nietzsche-Hermeneutik, in: Nietzsche-Studien 9 (1980), S. 1–37.
Eugen Biser, „Gott ist tot“. Nietzsches Destruktion des christlichen Bewußtseins, München: Kösel,
1962.
Eugen Biser, Nietzsche – Zerstörer oder Erneuerer des Christentums?, Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2002.
Rüdiger Bittner, Nietzsches Begriff der Wahrheit, in: Nietzsche-Studien 16 (1987), S. 70–90.
Rüdiger Bittner, Conrad Cramer (Hg.), Materialien zu Kants „Kritik der praktischen Vernunft“,
Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1975.
Gerhard Blum, Zum Begriff des Schönen in Kants und Schillers ästhetischen Schriften, Fulda: VfA,
1988.
Hans Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1998.
Hans Blumenberg, Selbsterhaltung und Beharrung. Zur Konstitution der neuzeitlichen Rationalität,
Mainz: Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Wiesbaden: Steiner, 1970.
Gernot Böhme, Kants Kritik der Urteilskraft in neuer Sicht, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1999.
Jochen Bojanowski, Kant über das Prinzip der Einheit von theoretischer und praktischer Philosophie
(Einleitung I – V), in: Höffe (Hg.), Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 23–39.
Tilman Borsche, Federico Gerratana, Aldo Venturelli (Hg.), „Centauren-Geburten“. Wissenschaft,
Kunst und Philosophie beim jungen Nietzsche, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1994,
(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 27).
Beate Bradl, Der intuitive Verstand, ein Prinzip der ästhetisch reflektierenden Urteilskraft? Zu Hegels
Rezeption von Kants Kritik der Urteilskraft, in: Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s Aesthetics,
L’esthétique de Kant, S. 721–736.
Beate Bradl, Die Rationalität des Schönen bei Kant und Hegel, München: Fink, 1998, (Studien und
Editionen zum deutschen Idealismus und zur Frühromantik, Abt. 2, Bd. 2).
Georg Brandes, William Shakespeare, Paris, Leipzig, München: Langen, 1896.
Reinhard Brandt, Die Schönheit der Kristalle. Überlegungen zu Kants Kritik der Urteilskraft, in:
Giuseppe Riconda, Giovanni Ferretti, Andrea Poma (Hg.), Giudizio e Interpretazione in Kant,
Genova: Marietti, 1992, (Università degli Studi di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di Lettere
e Filosofia, Bd. 63), S. 117–137.
Reinhard Brandt, Die Urteilstafel. Kritik der reinen Vernunft A 67–76; B 92–101, Hamburg: Meiner,
1991.
Reinhard Brandt, Der Zirkel im dritten Abschnitt von Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in:
Oberer, Seel (Hg.), Kant. Analysen – Probleme – Kritik, S. 169–191.
Reinhard Brandt, Zur Logik des ästhetischen Urteils, in: Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s Aesthetics,
L’esthétique de Kant, S. 229–245.
Thomas Brobjer, Nietzsche as German Philosopher: His Reading of the Classic German Philosophers,
in: Nicholas Martin (Hg.), Nietzsche and the German Tradition, Oxford, Berne: Peter Lang, 2003,
S. 39–83.
Thomas Brobjer, Nietzsche’s Philosophical Context: An Intellectual Biography, Urbana, Illinois:
University of Illinois Press, 2008.
Karl Brose, Nietzsches Verhältnis zu John Stuart Mill. Eine geisteswissenschaftliche Studie, in:
Nietzsche-Studien 3 (1974), S. 152–174.
Konstantin Bröse, Nietzsches Verhältnis zur antiken und modernen Aufklärung, in: Reschke (Hg.),
Nietzsche. Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer?, S. 231–238.
Klaus-Detlef Bruse, Die griechische Tragödie als „Gesamtkunstwerk“ – Anmerkungen zu den
musikästhetischen Reflexionen des frühen Nietzsche, in: Nietzsche-Studien 13 (1984),
S. 156–176.
Marco Brusotti, Erkenntnis als Passion. Nietzsches Denkweg zwischen Morgenröthe und der Fröhlichen Wissenschaft, in: Nietzsche-Studien 26 (1997), S. 199–225.
Literatur
525
Marco Brusotti, Die Leidenschaft der Erkenntnis. Philosophische und ästhetische Lebensgestaltung
bei Nietzsche von Morgenröthe bis Also sprach Zarathustra, Berlin, New York: Walter de Gruyter,
1997, (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 37).
Marco Brusotti, Wille zum Nichts, Ressentiment, Hypnose. ‚Aktiv‘ und ‚reaktiv‘ in Nietzsches Genealogie der Moral, in: Nietzsche-Studien 30 (2001), S. 107–132.
Giuliano Campioni, Auflösung der Gemeinschaft zur Bejahung des ‚Freigeistes‘, in: Nietzsche-Studien
5 (1976), S. 83–112.
Giuliano Campioni, Paolo D’Iorio, Maria Cristina Fornari, Francesco Fronterotta, Andrea Orsucci,
Renate Müller-Buck (Hg.), Nietzsches persönliche Bibliothek, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003, (Supplementa Nietzscheana, Bd. 6).
Ernst Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen: Mohr, 1932.
Hermann Cohen, Kants Begründung der Aesthetik, Berlin: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung,
1889.
Hermann Cohen, Kants Begründung der Ethik, in: Rüdiger Bittner, Conrad Cramer (Hg.), Materialien zu
Kants „Kritik der praktischen Vernunft“, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1975.
Hermann Cohen, Das Urteil der Allheit, in: Hermann Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, Berlin:
Cassirer, 1902.
Ted Cohen, Paul Guyer (Hg.), Essays in Kant’s Aesthetics, Chicago, London: The University of Chicago
Press, 1982.
Victor Cousin, Du vrai du beau et du bien, 7. ed., Paris: Didier, 1858.
Claudia Crawford, The Beginnings of Nietzsche’s Theory of Language, Berlin, New York: Walter de
Gruyter, 1988, (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 19).
Claudia Crawford, „The Dionysian Worldview“: Nietzsche’s Symbolic Languagues and Music, in:
Journal of Nietzsche Studies 13 (1997), S. 72–80.
Donald W. Crawford, Kants’s Aesthetic Theory, Madison: University of Wisconsin Press, 1974.
Luca Crescenzi, Verzeichnis der von Nietzsche aus der Universitätsbibliothek in Basel entliehenen
Bücher (1869–1879), in: Nietzsche-Studien 23 (1994), S. 388–442.
Dirk L. Couprie, „Hätte die Welt ein Ziel, […] so wäre es […] mit allem Werden längst zu Ende“, in:
Nietzsche-Studien 27 (1998), S. 107–118.
James M. Curtis, Michael Bakhtin, Nietzsche, and Russian Pre-Revolutionary Thought, in: Rosenthal
(Hg.), Nietzsche in Russia, S. 331–354.
Iris Därmann, Rausch als „ästhetischer Zustand“: Nietzsches Deutung der Aristotelischen Katharsis
und ihre Platonisch-Kantische Umdeutung durch Heidegger, in: Nietzsche-Studien 34 (2005),
S. 124–162.
Friedhelm Decher, Nietzsches Metaphysik in der „Geburt der Tragödie“, in Nietzsche-Studien 14
(1985), S. 110–125.
Friedhelm Decher, Wille zum Leben – Wille zur Macht. Eine Untersuchung zu Schopenhauer und
Nietzsche, Würzburg: Königshausen & Neumann, 1984.
Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris: Presses Universitaires de France, 1962.
Maria Deppermann, Nietzsche in Russland, in: Nietzsche-Studien 21 (1992), S. 211–252.
Jacques Derrida, La dissémination, Paris: Éd. du Seuil, 1972.
Jacques Derrida, De la hospitalité (Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre), Paris:
Calmann-Lévy, 1997.
Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Paris: Éd. de Minuit, 1972.
Jacques Derrida, Positionen. Gespräche mit Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy
Scarpetta, aus dem Französ. v. Dorothea Schmidt, Graz, Wien: Böhlau, 1986.
Jacques Derrida, L’Éperon: les styles de Nietzsche, Paris: Flammarion, 1968.
William Desmond, Kant and the Terror of Genius: Between Enlightenment and Romanticism, in: Parret
(Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s Aesthetics, L’esthétique de Kant, S. 594–614.
526
Literatur
Claus Dierksmeier, Zum Status des religiösen Symbols bei Kant, in: Michael Städtler (Hg.), Kants
„ethisches Gemeinwesen“. Die Religionsschrift zwischen Vernunftkritik und praktischer Philosophie, Berlin: Akademie Verl., 2005, S. 75–85.
Wolfgang Dietrich (Hg.), Russische Religionsdenker: Tolstoi, Dostojewski, Solowjew, Berdjajew,
Gütersloh: Kaiser, 1994.
Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften, Bd. 4, (Die Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus), hg. v. Hermann Nohl, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1963.
Wilhelm Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation.
Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie und Religion, in: Wilhelm Dilthey, Gesammelte
Schriften, Bd. 2, Leipzig, Stuttgart: Teubner, 1991.
Mihailo Djurić, Das nihilistische Gedankenexperiment, in: Nietzsche-Studien 9 (1980), S. 142–173.
Mihailo Djurić, Josef Simon (Hg.), Zur Aktualität Nietzsches, Würzburg: Königshausen & Neumann,
1984.
Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, Frankfurt a/M: Insel Verlag, 1988.
Fjodor M. Dostojewski, Aufzeichnungen aus einem Totenhaus und drei Erzählungen, übers. von
E.K. Rahsin, München, Zürich: Piper, 2004.
F.M. Dostojewsky, Die Brüder Karamasow, Leipzig: Grunow, 1884.
Fjodor Dostojewski, Die Brüder Karamasow. Roman in vier Teilen mit einem Epilog, aus dem Russ.
v. Werner Creutziger, Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1981, (Gesammelte Werke, hg. v. Gerhard
Dudek und Michael Wegner).
Fjodor M. Dostojewski, Die Dämonen. Roman, aus dem Russischen v. E.K. Rahsin, Nachwort von
Aleksandar Flaker, München, Zürich: Piper, 2008.
F.M. Dostojewskij, Erzählungen von F.M. Dostojewskij, frei nach dem Russischen von Wilhelm Goldschmidt, Leipzig: Reclam, 1886.
Theodor Dostoïewsky, L’esprit souterrain, traduit et adapté par E. Halpérine-Kampinsky et Ch. Morice,
Paris: Librairie Plon, 1886.
Fjodor M. Dostojewski, Gesammelte Briefe. 1833–1881, übersetzt u. herausg. v. Friedrich Hitzer,
München, Zürich: Piper, 1986.
Theodor Dostoïewsky, Humiliés et offensées, traduit par E. Humert, Paris, 1884.
Fjodor M. Dostojewskij, Der Idiot, aus dem Russischen v. Swetlana Geier, Frankfurt a/M: S. Fischer, 1999.
Theodor Dostoïevsky, Les Possédés (Bési), traduit par Victor Dérély, Paris, 1886.
Theodor Dostoïevsky, Souvenirs de la maisons des morts, traduit par M. Neyroud, Paris, 1886.
Fjodor M. Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers. Notierte Gedanken, aus dem Russ. v. E.K.
Rahsin, mit einem Nachwort v. Aleksandar Flaker, München, Zürich: Piper, 2001.
Fedor M. Dostoevskij, Verbrechen und Strafe. Roman, übers. von Swetlana Geier, Zürich: Ammann
Verlag, 1994.
Paul H. Dörr, Nachwort, in: Tolstoi, Was ist Kunst?, S. 316–325.
Tsarina Doyle, Nietzsche’s Appropriation of Kant, in: Nietzsche-Studien 33 (2004), S. 180–204.
Gerhard Dudek, Lew Tolstoi – künstlerische Entdeckung und ästhetische Herausforderung, Berlin:
Akademie Verl., 1981, (Sitzungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Bd. 122, Heft 2).
Roland Duhamel, Erik Oger (Hg.), Die Kunst der Sprache und die Sprache der Kunst, Würzburg:
Königshausen & Neumann, 1994, (Nietzsche in der Diskussion).
Klaus Düsing, Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer Philosophie, in: Kant-Studien 62
(1971), S. 5–42.
Wolfgang Düsing, Ästhetische Form als Darstellung der Subjektivität. Zur Rezeption Kantischer
Begriffe in Schillers Ästhetik, in: Klaus L. Berghahn (Hg.), Friedrich Schiller. Zur Geschichtlichkeit
seines Werkes, Kronberg: Scriptor-Verl., 1975, S. 197–239.
Literatur
527
Julius Ebbinghaus, Die Formeln des kategorischen Imperativs und die Ableitung inhaltlich bestimmter Pflichten, in: Prauss (Hg.), Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln,
S. 274–291.
Hans Ebeling (Hg.), Subjektivität und Selbsterhaltung: Beiträge zur Diagnose der Moderne, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1976.
Jürgen Eiben, Von Luther zu Kant – Der deutsche Sonderweg in die Moderne. Eine soziologische
Betrachtung, Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 1989.
Erasmus von Rotterdam, De libero arbitrio διατριβή sive collatio. Gespräch oder Unterredung „Hyperaspistes“ gegen den „Unfreien Willen“ Martin Luthers, übers., eingel. und mit Anmerk. v. Winfried Lesowsky, in:Erasmus von Rotterdam, Ausgewählte Schriften, hg. von Werner Welzig, Bd. 4,
Darmstadt: Wiss. Buchges., 1995, S. 1–195.
Fritz Ernst, Friedrich Nietzsche und die Russen. Zur Geschichte der deutschen Russophilie, in:
Fritz Ernst, Aus Goethes Freundeskreis und andere Essays, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1955,
S. 210–226.
Andrea Esser (Hg.), Autonomie der Kunst? Zur Aktualität von Kants Ästhetik, Berlin: Akademie Verlag,
1995.
Andrea Esser, Kunst als Symbol. Die Struktur ästhetischer Reflexion in Kants Theorie des Schönen,
München: Fink, 1997.
Ferdinand Fellmann, Der Geltungsanspruch des ästhetischen Urteils. Zur Metapsychologie der ästhetischen Erfahrung, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 34/2 (1989),
S. 155–173.
Rudolf Fietz, Am Anfang ist Musik. Zur Musik und Sprachsemiotik des frühen Nietzsche, in: Borsche,
Gerratana, Venturelli (Hg.), „Centauren-Geburten“, S. 144–166.
Günter Figal, Nietzsche. Eine philosophische Einführung, Stuttgart: Reclam, 1999.
Günter Figal, Nietzsches Philosophie der Interpretation, in: Nietzsche-Studien 29 (2000), S. 1–11.
Johann Figl, Interpretation als philosophisches Prinzip. Friedrich Nietzsches universale Theorie der
Auslegung im späten Nachlaß, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1982, (Monographien und
Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 7).
Johann Figl, Nietzsche und die philosophische Hermeneutik des 20. Jahrhunderts. Mit besonderer
Berücksichtigung Diltheys, Heideggers und Gadamers, in: Nietzsche-Studien 10 /11 (1981/1982),
S. 408–430.
Johann Figl, Nietzsches Begegnung mit Schopenhauers Hauptwerk. Unter Heranziehung eines frühen
unveröffentlichten Exzerptes, in: Schirmacher (Hg.), Schopenhauer, Nietzsche und die Kunst,
S. 89–100.
Johann Figl, ‚Tod Gottes‘ und die Möglichkeit ‚neuer Götter‘, in: Nietzsche-Studien 29 (2000),
S. 82–101.
Norbert Fischer, Zur Kritik der Vernunfterkenntnis bei Kant und Lévinas. Die Idee des transzendentalen
Ideals und das Problem der Totalität, in: Kant-Studien 90 (1999), S. 168–190.
Norbert Fischer, Dieter Hattrup, Metaphysik aus dem Anspruch des Anderen. Kant und Lévinas,
Paderborn: Schöningh, 1999.
Michel Foucault, Der Gebrauch der Lüste (Michel Foucault, Sexualität und Wahrheit, übers. v. Ulrich
Raulff und Walter Seitter, Bd. 2), Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1990.
Michel Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire, in: Suzanne Bachelard (Hg.), Hommage à Jean
Hyppolite, Paris: Presses Universitaires de France, 1971, S. 145–172.
Hartwig Frank, Die Metapher Russland im Denken Nietzsches, in: Nietzsche-Studien 36 (2007),
S. 344–353.
Hartwig Frank, Nietzsche und Kant, in: Nietzsche-Studien 35 (2006), S. 312–320.
Ursula Franke (Hg.), Kants Schlüssel zur Kritik des Geschmacks: ästhetische Erfahrung heute. Studien
zur Aktualität von Kants „Kritik der Urteilskraft“, Hamburg: Meiner, 2000.
528
Literatur
Ursula Franke, Nach Hegel. Zur Differenz von Ästhetik und Kunstwissenschaft(en). 100 Jahre „Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft“, in: Josef Früchtl, Maria Moog-Grünewald
(Hg.), Ästhetik in metaphysikkritischen Zeiten, Hamburg: Meiner, 2007, (Sonderheft 8),
S. 73–91.
Matthias Freise, Michail Bachtins philosophische Ästhetik der Literatur, Frankfurt a/M, Berlin, Bern:
Peter Lang, 1993, (Slavische Literaturen. Texte und Anhandlungen, hg. v. Wolf Schmid, Bd. 4).
Sigmund Freud, Dostojewski und die Vatertötung, in: Sigmund Freud, Gesammelte Werke, Bd. 14,
(Werke aus den Jahren 1925–1931), Frankfurt a/M: Fischer, 1999, S. 397–418.
Christel Fricke, Kants Theorie der schönen Kunst, in: Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s Aesthetics,
L’esthétique de Kant, S. 660–673.
Josef Früchtl, Ästhetische Erfahrung und moralisches Urteil. Eine Rehabilitierung, Frankfurt a/M:
Suhrkamp, 1996.
Josef Früchtl, Getrennt-vereint. Zum Verhältnis zwischen Ästhetik und Ethik bei Immanuel Kant, in:
Greiner, Moog-Grünewald (Hg.), Etho-Poietik, S. 15–29.
Hans-Friedrich Fulda, Rolf-Peter Horstmann (Hg.), Hegel und die Kritik der Urteilskraft, Stuttgart:
Klett-Cotta, 1990.
Hans-Georg Gadamer, Das Drama Zarathustras, in: Nietzsche-Studien 15 (1986), S. 1–15.
Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen: Mohr, 1972.
Volker Gerhardt, Artisten-Metaphysik. Zu Nietzsches frühem Programm einer ästhetischen Rechtfertigung der Welt, in: Djurić, Simon (Hg.), Zur Aktualität Nietzsches, Bd. 1, S. 81–98.
Volker Gerhardt, Immanuel Kant. Vernunft und Leben, Stuttgart: Reclam, 2002.
Volker Gerhardt, Die kopernikanische Wende von Kant und Nietzsche, in: Albertz (Hg.), Kant und
Nietzsche – Vorspiel einer künftigen Weltauslegung?, S. 157–182.
Volker Gerhardt, Macht und Metaphysik. Nietzsches Machtbegriff im Wandel der Interpretation, in:
Nietzsche-Studien 10/11 (1981/1982), S. 193–209; Diskussion, S. 210–221.
Volker Gerhardt, Sensation und Existenz. Nietzsche nach hundert Jahren, in: Nietzsche-Studien 29
(2000), S. 102–135.
Volker Gerhardt, Vom Willen zur Macht. Anthropologie und Metaphysik der Macht am exemplarischen
Fall Friedrich Nietzsches, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1996, (Monographien und Texte
zur Nietzsche-Forschung, Bd. 34).
Horst-Jürgen Gerigk, Dostojewskij, der „vertrackte“ Russe. Die Geschichte seiner Wirkung im deutschen Sprachraum vom Fin de siècle bis heute, Tübingen: Attempto, 2000.
Hans-Martin Gerlach, Friedrich Nietzsche und die Aufklärung, in: Reschke (Hg.), Nietzsche. Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer?, S. 19–32.
Wolfgang Gesemann, Nietzsches Verhältnis zu Dostoevskij auf dem europäischen Hintergrund der
80er Jahre, in: Welt der Slaven 6 (1961), S. 131–146.
Hannah Ginsborg, Kant on the Subjectivity of Taste, in: Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s Aesthetics,
L’esthétique de Kant, S. 448–465.
Piero Giordanetti, Das Verhältnis von Genie, Künstler und Wissenschaftler in der Kantischen
Philosophie, in: Kant-Studien 86 (1995), S. 406–430.
Georges Goedert, Dionysische Bejahung statt „Resignation“. Zur „Umwertung“ des Tragischen in
Nietzsches ‚Geburt der Tragödie‘, in: Duhamel, Oger (Hg.), Die Kunst der Sprache und die
Sprache der Kunst, S. 172–189.
Georges Goedert, Nietzsche und Schopenhauer, in: Nietzsche-Studien 7 (1978), S. 1–15.
George Goedert, Paul Valadier, Nietzsche et la critique du christianisme, Paris, 1974, Rezension, in:
Nietzsche-Studien 5 (1976), S. 384–391.
Johann Wolfgang Goethe, Werke, hg. im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen, IV. Abteilung:
Goethes Briefe, Weimar 1887–1912, Bd. 10.
Jean Granier, Le problemè de la vérité dans la philosophie der Nietzsche, Paris, 1966.
Literatur
529
Gerd-Günther Grau, Kritik des absoluten Anspruchs: Nietzsche – Kierkegaard – Kant, Würzburg:
Königshausen & Neumann, 1993.
Gerd-Günther Grau, Sublimierter oder realisierter Wille zur Macht?, Diskussion, in: Nietzsche-Studien
10/11 (1981/1982), S. 254–277.
Michael Steven Green, Nietzsche and the Transcendental Tradition, Urbana: University of Illinois
Press, 2002.
Bernard Greiner, Die Geburt der ästhetischen Erziehung aus dem Geist der Resozialisation. Schillers
Verbrecher aus verlorener Ehre, in: Greiner, Moog-Grünewald (Hg.), Etho-Poietik, S. 31–50.
Bernhard Greiner, Maria Moog-Grünewald (Hg.), Etho-Poietik. Ethik und Ästhetik im Dialog: Erwartungen, Forderungen, Abgrenzungen, Bonn: Bouvier, 1998, S. 31–50.
Boris Groys, Russland auf der Suche nach seiner Identität, in: Boris Groys, Die Erfindung Russlands,
München, Wien: Hanser, 1995, S. 19–36.
Paul Guyer, Kant and the Claims of Taste, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,
1979.
Paul Guyer, The Symbols of Freedom in Kant’s Aesthetics, in: Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s
Aesthetics, L’esthétique de Kant, S. 328–355.
Jürgen Habermas, Moralität und Sittlichkeit. Treffen Hegels Einwände gegen Kant auch auf die Diskursethik zu?, in: Wolfgang Kuhlmann (Hg.), Moralität und Sittlichkeit. Das Problem Hegels und
die Diskursethik, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1986, S. 16–37.
Jürgen Habermas, Nachwort, in: Friedrich Nietzsche, Erkenntnistheoretische Schriften, Frankfurt a/M:
Suhrkamp, 1968, S. 237–261.
Werner Hamacher (Hg.), Nietzsche aus Frankreich, Frankfurt a/M: Ullstein, 1986.
Johann Georg Hamann, Metakritik über den Purismus der Vernunft, in: Johann Georg Hamann, Werke,
hg. von Josef Nadler, Bd. 3, (Schriften über Sprache, Mysterien, Vernunft: 1772–1788), Wien:
Herder, 1951, S. 281–289.
Frank Haney, Pavel Florenskij und Kant – eine wichtige Seite der russischen Kant-Rezeption, in: KantStudien 2001 (92), S. 81–103.
Daniel Havemann, Evangelische Polemik: Nietzsches Paulusdeutung, in: Nietzsche-Studien 30 (2001),
S. 173–186.
Urs Heftrich, Nietzsches Auseinandersetzung mit der „Kritik der ästhetischen Urteilskraft“, in: Nietzsche-Studien 20 (1991), S. 238–266.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1970, (Werke, hg. v. Eva Moldenhauer
und Karl Markus Michel, Bd. 7).
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1970,
(Werke, hg. v. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 3).
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine
Stelle in der praktischen Philosophie, und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaften, in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte Werke, hg. von Hartmut Buchner und Otto
Pöggeler, Hamburg: Meiner 1968, Bd. 4, S. 417–485.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über Ästhetik I, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1970, (Werke,
hg. v. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 13).
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion I: Begriff der Religion,
hg. von Georg Lasson, Hamburg: Meiner, 1966.
Hegel-Studien, hg. v. Walter Jaeschke und Ludwig Siep, zusammen mit der Hegel-Kommission der
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bonn: Bouvier, 1961 ff.; Hamburg:
Meiner, 1998 ff.
Martin Heidegger, Holzwege, Frankfurt a/M: Klostermann, 1963.
Martin Heidegger, Nietzsche, Pfullingen: Neske, 1961.
530
Literatur
Martin Heidegger, Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht als Erkenntnis, Freiburger Vorlesung
Sommersemester 1939, hg. von Eberhard Hanser, Frankfurt a/M: Klostermann, 1989.
Martin Heidegger, Nietzsches Wort ‚Gott ist tot‘, in: Martin Heidegger, Holzwege, Frankfurt a/M:
Klostermann, 1963.
Martin Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den „Humanismus“, Bern:
Francke, 1954.
Martin Heidegger, Sein und Zeit, Frankfurt a/M: Klostermann, 1977, (Gesamtausgabe, hg. v. FriedrichWilhelm von Herrmann, Bd. 2).
Martin Heidegger, Überwindung der Metaphysik, in: Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze, 2. Aufl.,
Pfullingen: Neske, 1959.
Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze, Pfullingen: Neske, 1959.
Erich Heintel, Philosophie und organischer Prozeß, in: Nietzsche-Studien 3 (1974), S. 61–104.
Peter Heller, Nietzsches Kampf mit dem romantischen Pessimismus, in: Nietzsche-Studien 7 (1978),
S. 27–58.
Wolfhart Henckmann, Über das Moment der Allgemeingültigkeit des ästhetischen Urteils in Kants
Kritik der Urteilskraft, in: Lewis White Beck (Hg.), Proceedings of the Third International Kant
Congress, Dordrecht: D. Riedel Publishing Co., 1972, S. 295–306.
Dieter Henrich, Aesthetic Judgment and the Moral Image of the World. Studies in Kant, Stanford:
Stanford University Press, 1992.
Dieter Henrich, Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in: Prauss
(Hg.), Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln, S. 223–254.
Dieter Henrich, Bewußtes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und Metaphysik,
Stuttgart: Reclam, 1999.
Dieter Henrich, Deduktion und Dialektik. Vorstellung einer Problemlage, in: Dieter Henrich (Hg.), Kant
oder Hegel?, S. 15–23.
Dieter Henrich, Hegels Theorie über den Zufall, in: Dieter Henrich (Hg.), Hegel im Kontext, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1971, S. 157–186.
Dieter Henrich, Die Identität des Subjekts in der transzendentalen Deduktion, in: Oberer, Seel (Hg.),
Kant. Analysen – Probleme – Kritik, S. 39–70.
Dieter Henrich (Hg.), Kant oder Hegel? Über Formen der Begründung in der Philosophie, Stuttgarter
Hegel-Kongreß 1981, Stuttgart: Klett-Cotta, 1983.
Johann Gottfried Herder, Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, Berlin: Aufbau-Verlag, 1955.
R. Kevin Hill, Nietzsche’s critiques: the Kantian foundations of his thought, Oxford: Oxford University
Press 2003.
Reinhard Hiltscher, Stefan Klingner, David Süß (Hg.), Die Vollendung der Transzendentalphilosophie
in Kants „Kritik der Urteilskraft“, Berlin: Duncker & Humblot, 2006.
Beatrix Himmelmann, Kant, Nietzsche und die Aufklärung, in: Beatrix Himmelmann (Hg.), Kant und
Nietzsche im Widerstreit, S. 29–46.
Beatrix Himmelmann, Kants Begriff des Glücks, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003, (Kantstudien-Ergänzungshefte, 142).
Beatrix Himmelmann (Hg.), Kant und Nietzsche im Widerstreit. Internationale Konferenz der Nietzsche-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Kant-Gesellschaft. Naumburg an der Saale,
26.–29. August 2004, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005.
Beatrix Himmelmann, Nietzsche und Kant als Aufklärer, in: Reschke (Hg.), Nietzsche. Radikalaufklärer
oder radikaler Gegenaufklärer?, S. 221–230.
Norbert Hinske, Zur Geschichte des Textes, in: Immanuel Kant, Erste Einleitung: Faksimile und Transkription, hg. von Norbert Hinske, Wolfgnag Müller-Lauter, Michael Theunissen, Stuttgart-Bad
Cannstatt: Frommann (Holzboog), 1965, S. III–XII.
Emanuel Hirsch, Nietzsche und Luther, in: Jahrbuch der Luther-Gesellschaft 2/3 (1920/21), S. 61–106.
Literatur
531
Emanuel Hirsch, Die Reich-Gottes-Begriffe des neueren europäischen Denkens: Ein Versuch zur
Geschichte der Staats- und Gesellschaftsphilosophie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1921.
Karl Holl, Luther und Calvin, in: Karl Holl, Kleine Schriften, hg. von Robert Stupperich, Tübingen:
Mohr, 1966, S. 67–81.
Karl Holl, Was verstand Luther unter Religion?, in: Karl Holl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, Bd. 1: Luther, Tübingen: Mohr, 1927, S. 1–110.
Michael Holquist, Katerina Clark, The influence of Kant in the early work of Bakhtin, in: Joseph
P. Strelka (Hg.), Literary theory and criticism: Festschrift Presented to René Wellek in Honor of His
Eightieth Birthday, Part I: Theory, Frankfurt a/M, New York: Peter Lang, 1985, S. 299–313.
Helmut Holzhey, Die praktische Philosophie des Marburger Neukantianismus. Versuch einer moralischen Bilanz, in: Orth, Holzhey (Hg.), Neukantianismus, S. 136–155.
Helmut Hoping, Freiheit im Widerspruch. Eine Untersuchung zur Erbsündenlehre im Ausgang von
Immanuel Kant, Innsbruck, Wien: Tyrolia-Verlag, 1990, (Innsbrucker theologische Studien,
Bd. 30).
Hans Gerald Hödl, Der letzte Jünger des Philosophen Dionysos. Studien zur systematischen Bedeutung von Nietzsches Selbstthematisierung im Kontext seiner Religionskritik, Berlin, New York:
Walter de Gruyter, 2009, (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 54).
Hans Gerald Hödl, Interesseloses Wohlgefallen. Nietzsches Kritik an Kants Ästhetik als Kritik an
Schopenhauers Soteriologie, in: Himmelmann (Hg.), Kant und Nietzsche im Widerstreit,
S. 186–195.
Hans Gerald Hödl, Nietzsches frühe Sprachkritik: Lektüren zu Nietzsches „Über Wahrheit und Lüge im
außermoralischen Sinne“ (1873), Wien: WUV-Univ.-Verl., 1997.
Hans Gerald Hödl, Nietzsches lebenslanges Projekt der Aufklärung, in: Reschke (Hg.), Nietzsche.
Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer?, S. 179–191.
Otfried Höffe (Hg.), Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, Frankfurt a/M: Klostermann, 1993.
Otfried Höffe, Immanuel Kant, 3. Aufl., München: Beck, 1992, (Beck’sche Reihe 506).
Otfried Höffe (Hg.), Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Berlin: Akademie Verlag, 2008, (Klassiker
auslegen).
Otfried Höffe, Kants kategorischer Imperativ als Kriterium des Sittlichen, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 31 (1977), S. 354–384.
Thomas Sören Hoffmann, Gewissen als praktische Apperzeption. Zur Lehre vom Gewissen in Kants
Ethik-Vorlesungen, in: Kant-Studien 93 (2002), S. 424–443.
Michael Hölzl, Die Kunst der Übertretung, in: Fuge. Journal für Religion und Moderne 4 (2009),
(Der Schein des Unendlichen), S. 27–34.
Adrian Hsia/Chiu-yee Cheung, Nietzsche’s Reception of Chinese Culture, in: Nietzsche-Studien 32
(2003), S. 296–312.
Henning Hufnagel, „Nun, Schifflein! Sieh’ dich vor!“ – Meerfahrt mit Nietzsche. Zu einem Motiv der
Fröhlichen Wissenschaft, in: Nietzsche-Studien 37 (2008), S. 141–159.
Victor Hugo, Nôtre-Dame de Paris, in: Victor Hugo, Nôtre-Dame de Paris, Les Travailleurs de la mer.
Textes établis, présentés et annotés par Jacques Seebacher et Yves Gohin, Paris: Gallimard,
1975, S. 1–500.
Paolo D’Iorio, La Superstition des Philosophes Critiques. Nietzsche et Afrikan Spir, in: NietzscheStudien 22 (1993), S. 257–94.
Curt Paul Janz, Die Kompositionen Friedrich Nietzsches, in: Nietzsche-Studien 1 (1972), S. 173–184.
Karl Jaspers, Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens, Berlin, Leipzig: Walter
de Gruyter, 1936.
Karl Jaspers, Nietzsche und das Christentum, Hameln: Seifert, 1938.
532
Literatur
Christian Jung, Nietzsche und die Theologie. Neue Standpunkte zu einem verhältnislosen Verhältnis,
in: Nietzsche-Studien 38 (2009), S. 486–493.
Carl Junge, Das intellektuelle Gewissen bei Nietzsche, Essen: Die Blaue Eule, 2000.
Andreas Kablitz, Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur, in: Höffe (Hg.), Immanuel Kant:
Kritik der Urteilskraft, S. 151–171.
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1. Aufl. 1781 (A); 2. Aufl.
1787 (B).
Immanuel Kant, Vorlesungen über die philosophische Religionslehre, hg. von K.H.L. Pölitz, 2. Aufl.,
Leipzig: Taubert, 1830.
Immanuel Kant, Werke, hg. von der Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlin,
1900 ff.
Kant-Studien. Philosophische Zeitschrift der Kant-Gesellschaft, begr. v. Hans Vaihinger, weitergeführt
v. Paul Menzer und Gottfried Martin, hg. v. Manfred Baum, Bernd Dörflinger, Heiner F. Klemme
und Thomas M. Seebohm, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1896 ff.
Walter Kaufmann, Nietzsche als der erste große Psychologe, in: Nietzsche-Studien 7 (1978),
S. 261–275; Diskussion, S. 276–287.
Walter Kaufmann, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, Princeton: Princeton University
Press, 1974.
Walter Kaufmann, Nietzsches Philosophie der Masken, in: Nietzsche-Studien 10/11 (1981/1982),
S. 111–131.
Friedrich Kaulbach, Ästhetische und philosophische Erkenntnis beim früheren Nietzsche, in: Djurić,
Simon (Hg.), Zur Aktualität Nietzsches, Bd. 1, S. 63–80.
Friedrich Kaulbach, Autarkie der perspektivischen Vernunft bei Kant und Nietzsche, in: Simon (Hg.),
Nietzsche und die philosophische Tradition, Bd. 2, S. 90–105.
Friedrich Kaulbach, Nietzsche und der monadologische Gedanke, in: Nietzsche-Studien 8 (1979),
S. 127–156.
Friedrich Kaulbach, Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie, Köln, Wien: Böhlau, 1980.
Friedrich Kaulbach, Philosophie des Perspektivismus, Teil 1: Wahrheit und Perspektive bei Kant,
Hegel, Nietzsche, Tübingen: Mohr (Paul Siebeck), 1990.
Friedrich Kaulbach, Das Prinzip Handlung in der Philosophie Kants, Berlin, New York: Walter de
Gruyter, 1978.
Katsutoshi Kawamura, Spontaneität und Willkür. Der Freiheitsbegriff in Kants Antinomienlehre und
seine historischen Wurzeln, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1996, (Forschungen
und Materialien zur deutschen Aufklärung, hg. v. Norbert Hinske, Abt. 2, Bd. 11).
Salim Kemal, Ivan Gaskell, Daniel W. Conway (Hg.), Nietzsche, Philosophy and the Arts, Cambridge:
Cambridge University Press, 1998.
Mathieu Kessler, Nietzsche ou le dépassement esthétique de la métaphysique, Paris: Presses Universitaires de France, 1999.
Peter Kessler, Tolstoj-Studien des späten Nietzsche, in: Zeitschrift für Slawistik 23 (1978), S. 17–26.
Jochen Kirchhoff, Zum Problem der Erkenntnis bei Nietzsche, in: Nietzsche-Studien 6 (1977),
S. 16–44.
Siegfried Kittmann, Kant und Nietzsche. Darstellung und Vergleich ihrer Ethik und Moral, Frankfurt a/M, Bern, Nancy, New York: Peter Lang, 1984.
Geir Kjetsaa, Lew Tolstoi. Dichter und Religionsphilosoph, aus dem Norwegischen v. Ute Hempen,
Gernsbach: Casimir Katz Verlag, 2001.
Heiner F. Klemme, Das „angeborene Recht der Freiheit“. Zum inneren Mein und Dein in Kants Rechtslehre, in: Volker Gerhardt, Rolf-Peter Horstmann, Ralf Schumacher (Hg.), Kant und die Berliner
Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Berliner Kant-Kongresses, Berlin, New York: Walter de
Gruyter, 2001, S. 108–188.
Literatur
533
Heiner F. Klemme, Die Freiheit der Willkür und die Herrschaft des Bösen. Kants Lehre vom radikalen
Bösen zwischen Moral, Religion und Recht, in: Heiner F. Klemme, Bernd Ludwig, Michael Pauen,
Werner Stark (Hg.), Aufklärung und Interpretation. Studien zu Kants Philosophie und ihrem
Umkreis, Würzburg: Königshausen und Neumann, 1999, S. 125–151.
Heiner F. Klemme, Immanuel Kant, in: Georg Lohmann, Arnd Pollmann (Hg.), Handbuch Menschenrechte. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart: Metzler, 2012, S. 44–51.
Heiner F. Klemme, Kant und die Paradoxien der Kritischen Philosophie, in: Kant-Studien 98 (2007),
S. 40–56.
Heiner F. Klemme, Das rechtstaatliche Folterverbot aus der Perspektive der Philosophie Kants, in:
Karsten Altenhain, Nicola Willenberg (Hg.), Die Geschichte der Folter seit ihrer Abschaffung,
Göttingen: V & R unipress, 2011, S. 39–53.
William Angus Knight, The philosophy of the beautiful, London: Murray, 1898–1903.
Sarah Kofman, Nietzsche et la métaphore, Paris: Payot, 1972.
Sarah Kofman, Nietzsche und die Dunkelheit des Heraklit, in: Sigrid Bauschinger, Susan L. Cocalis
und Sara Lennox (Hg.), Nietzsche heute. Die Rezeption seines Werks nach 1968, Bern, Stuttgart:
Francke Verlag, 1988, S. 75–104.
Georg Kohler, Geschmacksurteil und ästhetische Erfahrung: Beiträge zur Auslegung von Kants „Kritik
der ästhetischen Urteilskraft“, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1980, (Kant-Studien Ergänzungshefte, 3).
Peter Köster, Das Fest des Denkens. Ein polemisches Motto Heideggers und seine ursprüngliche
Bedeutung in Nietzsches Philosophie, in: Nietzsche-Studien 4 (1975), S. 227–262.
Peter Köster, Die Problematik wissenschaftlicher Nietzsche-Forschung. Kritische Überlegungen zu
Wolfgang Müller-Lauters Nietzschebuch, in: Nietzsche-Studien 2 (1973), S. 31–60.
Peter Köster, Die Renaissance des Tragischen, in: Nietzsche-Studien 1 (1972), S. 183–209.
Richard Kralik, Weltschönheit: Versuch einer allgemeinen Ästhetik, Wien: C. Konegen, 1894.
Hans Krämer, Das Verhältnis von Ästhetik und Ethik in historischer und systematischer Sicht, in:
Greiner, Moog-Grünewald (Hg.), Etho-Poietik, S. 1–13.
Richard Kroner, Von Kant bis Hegel, Tübingen: Mohr, 1921.
Alexej N. Krouglov, Leo Nikolaevič Tolstoj als Leser Kants. Zur Wirkungsgeschichte Kants in Russland,
in: Kant-Studien 99 (2008), S. 361–386.
Robert Kudielka, Urteil und Eros, Erörterungen zu Kants Kritik der Urteilskraft, Tübingen: Universitäts
Verlag, 1977.
Wolfgang Kuhlmann (Hg.), Moralität und Sittlichkeit. Das Problem Hegels und die Diskursethik, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1986.
Elisabeth Kuhn, Friedrich Nietzsches Philosophie des europäischen Nihilismus, Berlin, New York: de
Gruyter, 1992, (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 25).
Elisabeth Kuhn, Nietzsches Quelle des Nihilismus-Begriffs, in: Nietzsche-Studien 13 (1984),
S. 253–278.
Jens Kulenkampff, Kants Logik des ästhetischen Urteils, Frankfurt a/M: Klostermann, 1978.
Jens Kulenkampff (Hg.), Materialien zu Kants „Kritik der Urteilskraft“, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1974.
Jens Kulenkampff, Der Tod des Iwan Iljitsch. Sterblichkeit und Ethik bei Heidegger und Tolstoi, in:
Ludwig Siep (Hg.), Sterblichkeitserfahrung und Ethikbegründung. Ein Kolloqium für Werner Marx,
Essen: Verlag Die Blaue Eule, 1988, S. 164–179.
Jens Kulenkampff, „Vom Geschmacke als einer Art von sensus communis“ – Versuch einer Neubestimmung des Geschmacksurteils, in: Esser (Hg.), Autonomie der Kunst?, S. 25–48.
Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart,
Iserlohn: Baedeker, 1865, 2., verbess. und verm. Auflage, Iserlohn: Baedeker, 1873/75.
Reinhard Lauth, „Ich habe die Wahrheit gesehen“. Die Philosophie Dostojewskis in Systematischer
Darstellung, München: R. Piper & Co., 1950.
534
Literatur
Gérard Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique: essai sur la critique de la faculté de juger, Paris:
A. Colin, 1970.
Gerhard Lehmann, Zur Analyse des Gewissens in Kants Vorlesungen über Moralphilosophie, in:
Gerhard Lehmann, Kants Tugenden. Neue Beiträge zur Geschichte und Interpretation der Philosophie Kants, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1980, S. 27–58.
Jean Charles Lévêque, La science du beau: étudiée dans ses principes, dans ses applications et dans
son histoire, Paris: Durand, 1860.
Hilmar Lorenz, Die Gegebenheit und Vollständigkeit a priori der Kantischen Urteilstafel, in: KantStudien 88 (1997), S. 386–405.
Kuno Lorenz, Art. Antinomie, in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, hg. v. Jürgen
Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler, 1995, Bd. 1, S. 131 f.
Frieder Lötzsch, Vernunft und Religion im Denken Kants. Lutherisches Erbe bei Immanuel Kant, Köln,
Wien: Böhlau, 1976.
Karl Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen (1935), in: Karl Löwith,
Sämtliche Schriften, Stuttgart: Metzler, 1987, Bd. 6, S. 100–385.
Karl Löwith, Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts, 4. Aufl.,
Stuttgart: Kohlhammer, 1958.
Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1992.
Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische
Gefährdungen einstellen?, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1986.
Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung, in: Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung 1. Aufsätze
zur Theorie der sozialen Systeme, 8. Aufl., Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2009,
S. 83–115.
Niklas Luhmann, Tautologie und Paradoxie in den Selbstbeschreibungen der modernen Gesellschaft,
in: Niklas Luhmann, Protest. Systemtheorie und soziale Bewegungen, hg. von Kai-Uwe Hermann,
Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1996, S. 79–106.
Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des deutschen Irrationalismus von Schelling bis
Hitler, Berlin: Aufbau-Verlag, 1954.
Martin Luther, Thesen für fünf Disputationen über Römer 3, 28 (1535–1537), in:Martin Luther, Lateinisch-Deutsche Studienausgabe in 3 Bänden, hg. v. Wilfried Härle, Johannes Schilling, Günther
Wartenberg, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006, Bd. 2, (Christusglaube und Rechtfertigung), S. 401–441.
Martin Luther, Vom unfreien Willensvermögen, in: Martin Luther, Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, hg. v. Wilfried Härle, Johannes Schilling, Günther Wartenberg, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006, Bd. 1, (Der Mensch vor Gott), S. 219–661.
Matthias Lutz-Bachmann (Hg.), Über Friedrich Nietzsche. Eine Einführung in seine Philosophie, Frankfurt a/M: Knecht, 1985.
Jean-François Lyotard, Die Analytik des Erhabenen. Kant-Lektionen, Kritik der Urteilskraft, §§ 23–29,
aus dem Franz. von Christine Pries, München: Fink, 1994.
Bernd Magnus, „Eternal Recurrence“, in: Nietzsche-Studien 8 (1979), S. 362–377.
Bernd Magnus, Nietzsche’s Existential Imperative, Bloomington, London: Indiana University Press,
1978.
Stefan Majetschak (Hg.), Klassiker der Kunstphilosophie. Von Platon bis Lyotard, München: Beck,
2005.
Rudolf A. Makkreel, Sublimity, Genius and the Explication of Aesthetic Ideas, in: Parret (Hg.), Kants
Ästhetik, Kant’s Aesthetics, L’esthétique de Kant, S. 615–629.
Thomas Mann, Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung, Berlin: Suhrkamp, 1948.
Reinhard Margreiter, Ontologischer Paradigmenwechsel – Anmerkungen zu Kant und Nietzsche, in:
Albertz (Hg.), Kant und Nietzsche – Vorspiel einer künftigen Weltauslegung?, S. 111–132.
Literatur
535
Boris W. Markow, Das neue Nietzsche-Bild in Russland, seine Chancen und Risiken, in: NietzscheStudien 29 (2000), S. 355–368.
Reinhart Maurer, Nietzsche und das Experimentelle, in: Djurić, Simon (Hg.), Zur Aktualität Nietzsches,
Bd. 1, S. 7–28.
Reinhart Maurer, Nietzsche und die Kritische Theorie, in: Nietzsche-Studien 10/11 (1981/ 1982),
S. 34–58; Diskussion, S. 59–79.
Zenta Maurina, Dostojewskij. Menschengestalter und Gottsucher, 5. Aufl., Memmingen: Maximilian
Dietrich, 1997.
Fritz Mauthner (Hg.), Wörterbuch der Philosophie: Neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache, 2. Aufl.,
Leipzig: Meiner, 1923 f.
Verena Mayer, Das Paradox des Regelfolgens in Kants Moralphilosophie, in: Kant-Studien 97 (2006),
S. 343–368.
Ralf Meerbote, The Singularity of Pure Judgements of Taste, in: Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s
Aesthetics, L’esthétique de Kant, S. 415–430.
W.P. Mendonça, Die Person als Zweck an sich, in: Kant-Studien 84 (1993), S. 167–184.
Ahlrich Meyer, Frühsozialismus: Theorien d. sozialen Bewegung 1798–1848, Freiburg, München:
Alber, 1977.
Theo Meyer, Nietzsche und die Kunst, Tübingen, Basel: Francke, 1993.
Theo Meyer, Nietzsches Rußlandbild: Protest und Utopie, in: Mechthild Keller (Hg.), Russen und
Rußland aus deutscher Sicht. 19./20. Jahrhundert: Von der Bismarckzeit bis zum Ersten Weltkrieg, München: Fink, 2000, S. 866–903.
Walter Meyer, Das Kantbild Schopenhauers, Frankfurt a/M, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter
Lang, 1995.
Charles Anthony Miller, Nietzsches „Discovery“ of Dostoevsky, in: Nietzsche-Studien 2 (1973),
S. 202–257.
Charles Anthony Miller, Nietzsches „Soteriopsychologie“ im Spiegel von Dostojewskijs Auseinandersetzung mit dem europäischen Nihilismus, in: Nietzsche-Studien 7 (1978), 130–149; Diskussion,
S. 150–157.
Charles Anthony Miller, The Nihilist as Tempter-Redeemer: Dostoevsky’s „Man-God“ in Nietzsche’s
Notebooks, in: Nietzsche-Studien 4 (1975), S. 165–226.
Jürgen Mittelstraß, Spontaneität. Ein Beitrag im Blick auf Kant, in: Prauss (Hg.), Kant. Zur Deutung
seiner Theorie von Erkennen und Handeln, S. 62–72.
Jürgen Mohr, Nietzsches Deutung des Gewissens, in: Nietzsche-Studien 6 (1977), S. 1–15.
Mazzino Montinari, Nietzsches Nachlass von 1885 bis 1888 oder Textkritik und Wille zur Macht, in: Jörg
Salaquarda (Hg.), Nietzsche, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, S. 323–348.
Nelly Motroschilowa, Kant in Rußland. Bemerkungen zur Kant-Rezeption und -Edition in Rußland
anläßlich des Projekts einer deutsch-russischen Ausgabe ausgewählter Werke Immanuel Kants,
in: Kant-Studien 91 (2000), S. 73–95.
Enrico Müller, „Ästhetische Lust“ und „dionysische Weisheit“, in: Nietzsche-Studien 31 (2002),
S. 134–153.
Enrico Müller, Die Griechen im Denken Nietzsches, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005,
(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 50).
Ulrich Müller, Objektivität und Fiktionalität. Überlegungen zur Kritik der Urteilskraft, in: Kant-Studien
77 (1986), S. 203–223.
Renate Müller-Buck, „Der einzige Psychologe, von dem ich etwas zu lernen hatte“: Nietzsche liest
Dostojewskij, in: Horst-Jürgen Gerigk (Hg.), Dostoevsky Studies. The Journal of the International
Dostoevsky Society 6 (2002), S. 89–118.
Wolfgang Müller-Lauter, Begrüßung der Tagungsteilnehmer, in: Nietzsche-Studien 10/11 (1981/1982),
S. 1–5.
536
Literatur
Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze seiner
Philosophie, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1971.
Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsche und Heidegger als nihilistische Denker. Zu Gianni Vattimos
‚postmodernistischer‘ Deutung, in: Nietzsche-Studien 27 (1998), S. 52–81.
Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht, in: Nietzsche-Studien 3 (1974),
S. 1–60.
Wolfgang Müller-Lauter, Der Organismus als innerer Kampf. Der Einfluss von Wilhelm Roux auf
Friedrich Nietzsche, in: Nietzsche-Studien 7 (1978), S. 189–223; Diskussion, S. 224–235.
Wolfgang Müller-Lauter, Das Willenswesen und der Übermensch. Ein Beitrag zu Heideggers NietzscheInterpretationen, in: Nietzsche-Studien 10/11 (1981/1982), S. 132–177; Diskussion, S. 178–192.
Wolfgang Müller-Lauter, „Der Wille zur Macht“ als Buch der ‚Krisis‘ philosophischer Nietzsche-Interpretation, in: Nietzsche-Studien 24 (1995), S. 223–260.
Nuno Nabais, Nietzsche and the Metaphysics of the Tragic, Madison, Teaneck: Fairleigh Dickinson
University Press, 2006.
Nikolai Alexejewitsch Nekrassow, Dichter und Bürger, in: Nikolai Alexejewitsch Nekrassow, Gedichte
und Poeme, aus dem Russischen v. Lieselotte Remané, Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1965,
S. 179–188.
Hjördis Nerheim, Zur kritischen Funktion ästhetischer Rationalität in Kants Kritik der Urteilskraft,
Frankfurt a/M: Peter Lang, 2001.
Friedrich Nietzsche, Kritische Gesamtausgabe: Briefe (KGB), hg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1975–2004.
Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe (KSA), hg. v. Giorgio Colli und
Mazzino Montinari, Berlin, New York, München: Walter de Gruyter, dtv, 1980.
Friedrich Nietzsche, Werke: Kritische Gesamtausgabe (KGW), hg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari, weitergeführt v. Volker Gerhardt, Norbert Miller, Wolfgang Müller-Lauter, Karl Pestalozzi,
Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1967 ff., Abteilung IX: Der handschriftliche Nachlaß ab
Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase, Michael Kohlenbach, hg.
v. Marie-Luise Haase, Martin Stingelin, in Verbindung mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001 ff.
Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, hg. v. Ernst Behler, Mazzino
Montinari, Wolfgang Müller-Lauter, Heinz Wenzel, weitergeführt v. Günter Abel, Josef Simon,
Werner Stegmaier, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1972 ff.
Kiyoshi Nishigami, Nietzsches Amor fati: der Versuch einer Überwindung des europäischen Nihilismus, Frankfurt a/M, Berlin, Bern: Lang, 1993.
Harliof Oberer, Gerhard Seel (Hg.), Kant. Analysen – Probleme – Kritik, Würzburg: Königshausen &
Neumann, 1988.
Ernst Wolfgang Orth, Die Einheit des Neukantianismus, in: Orth, Holzhey (Hg.), Neukantianismus,
S. 13–30.
Ernst Wolfgang Orth, Helmut Holzhey (Hg.), Neukantianismus. Perspektiven und Probleme, Würzburg:
Königshausen & Neumann, 1994.
Henning Ottmann, Nietzsche und die philosophische Tradition, in: Simon (Hg.), Nietzsche und die
philosophische Tradition, Bd. 2, S. 9–33.
Henning Ottmann, Philosophie und Politik bei Nietzsche, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1999,
(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 17).
Luigi Pareyson, L’Estetica di Kant, Milano: U. Mursia, 1968.
Herman Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s Aesthetics, L’esthétique de Kant, Berlin, New York: Walter
de Gruyter, 1998.
Günther Patzig, Die logischen Formen praktischer Sätze in Kants Ethik, in: Prauss (Hg.), Kant. Zur
Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln, S. 207–222.
Literatur
537
Bernard Pautrat, Versions du soleil. Figures et système de Nietzsche, Paris: Éd. du Seuil, 1971.
Charles Sanders Peirce, Ein vernachlässigtes Argument für die Realität Gottes, in: Charles Sanders
Peirce, Religionsphilosophische Schriften, hg. u. übers. v. Hermann Deuser, Hamburg: Meiner,
1995, S. 329–359.
Karl Pestalozzi, Nietzsches Wiederkunft, in: Nietzsche-Studien 36 (2007), S. 1–21.
Silvio Pfeuffer, Die Entgrenzung der Verantwortung. Nietzsche – Dostojewskij – Levinas, Berlin,
New York: Walter de Gruyter, 2008, (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 56).
Platon, Sämtliche Dialoge, hg., übers. u. angeleit. von Otto Apelt, Hamburg: Meiner, 1993.
Ekaterina Poljakova, „Ästhetische Vollendung“: zur philosophischen Ästhetik Nietzsches und
Bachtins, in: Nietzsche-Studien 33 (2004), S. 205–236.
Ekaterina Poljakova, „Beherzter Fatalismus“, Das (Anti-)Christliche in der Perspektive des russischen
Denkens, in: Volker Gerhardt, Renate Reschke (Hg.), Nietzsche und Europa – Nietzsche in Europa,
Berlin: Akademie Verlag, 2007, (Nietzscheforschung, Bd. 14), S. 171–182.
Ekaterina Poljakova, Die „Bosheit“ der Russen: Nietzsches Deutung Russlands in der Perspektive
russischer Moralphilosophie, in: Nietzsche-Studien 35 (2006), S. 195–217.
Ekaterina Poljakova, Ein Bote des Unendlichen, in: Fuge. Journal für Religion und Moderne 4 (2009),
(Der Schein des Unendlichen. Epiphanie I), S. 89–101.
Otto Pöggeler, Hegel und die Anfänge der Nihilismus-Diskussion, in: Arendt (Hg.), Der Nihilismus als
Phänomen der Geistesgeschichte in der wissenschaftlichen Diskussion unseres Jahrhunderts,
S. 307–349.
Maria Antonietta Pranteda, Il legno storto. I significati del male in Kant, Firenze: L. S. Olschki, 2002.
Gerold Prauss, Kant über Freiheit als Autonomie, Frankfurt a/M: Klostermann, 1983.
Gerold Prauss (Hg.), Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln, Köln: Kiepenheuer
& Witsch, 1973.
Gerold Prauss, Kants Problem der Einheit theoretischer und praktischer Vernunft, in: Kant-Studien 72
(1981), S. 286–303.
Alexander Puschkin, Eugen Onegin, aus dem Russ. übers. v. Johannes von Guenther, in: Alexander
Puschkin, Ausgewählte Werke, Berlin: Aufbau-Verlag, 1949, S. 9–213.
Robert Quiskamp, Die Beziehungen L.N. Tolstojs zu den Philosophen des Deutschen Idealismus,
Emsdetten: Lechte, 1930.
Josef Ratzinger (Benedikt XVI.), Jesus von Nazareth, Teil 1: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung,
Freiburg, Basel: Herder, 2007.
Birgit Recki, Die Dialektik der ästhetischen Urteilskraft, in: Höffe (Hg.), Immanuel Kant: Kritik der
Urteilskraft, S. 189–210.
Birgit Recki, Das Schöne als Symbol der Freiheit. Zur Einheit der Vernunft in ästhetischem Selbstgefühl und praktischer Selbstbestimmung bei Kant, in: Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s
Aesthetics, L’esthétique de Kant, S. 386–402.
Klaus Reich, Die Vollständigkeit der Urteilstafel, Berlin: Schoetz, 1932.
Renate Reschke (Hg.), Nietzsche. Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer? Internationale
Tagung der Nietzsche-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Kant-Forschungsstelle Mainz und
der Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen vom 15.–17. Mai 2003 in Weimar, Berlin:
Akademie Verlag, 2004, (Nietzscheforschung, Sonderband 2).
Paul Ricoeur, Freud and Philosophy, New Haven, London: Yale University Press, 1970.
Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Bernice Glatzer Rosenthal (Hg.), Nietzsche and Soviet Culture: Ally and adversary, Cambridge:
Cambridge University Press, 1994.
Bernice Glatzer Rosenthal (Hg.), Nietzsche in Russia, Princeton: Princeton University Press, 1986.
Georg Römpp, Schönheit als Erfahrung von Freiheit. Zur transzendentallogischen Bedeutung des
Schönen in Schillers Ästhetik, in: Kant-Studien 89 (1998), S. 428–445.
538
Literatur
Georg Römpp, Die Sprache der Freiheit. Kants moralphilosophische Sprachauffassung, in: KantStudien 95 (2004), S. 182–203.
Heinz Röttges, Nietzsche und die Dialektik der Aufklärung, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1972,
(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 2).
Andreas Rupschus, Werner Stegmaier, „Inconsequenz Spinoza’s“? Adolf Trendelenburg als Quelle von
Nietzsches Spinoza-Kritik in Jenseits von Gut und Böse 13, in: Nietzsche-Studien 38 (2009),
S. 299–308.
Jörg Salaquarda, Der Antichrist, in: Nietzsche-Studien 2 (1973), S. 91–136.
Jörg Salaquarda, Fröhliche Wissenschaft zwischen „Freigeisterei“ und neuer „Lehre“, in: NietzscheStudien 26 (1997), S. 163–183.
Jörg Salaquarda, Nachwort zu Emanuel Hirsch, Nietzsche und Luther, in: Nietzsche-Studien 15 (1986),
S. 431–439.
Jörg Salaquarda, Nietzsche und Lange, in: Nietzsche-Studien 7 (1978), S. 236–260; Diskussion,
S. 254–260.
Jörg Salaquarda, Nietzsches Kritik der Transzendentalphilosophie, in: Matthias Lutz-Bachmann (Hg.),
Über Friedrich Nietzsche. Eine Einführung in seine Philosophie, Frankfurt a/M: Knecht, 1985,
S. 27–61.
Lou Andreas-Salomé, Friedrich Nietzsche in seinen Werken: mit 2 Bildern und 3 faksimilierten Briefen
Nietzsches, Wien: Konegen, 1894.
Gerd Schank, Dionysos gegen den Gekreuzigten. Eine philologische und philosophische Studie
zu Nietzsches „Ecce homo“, Bern, Berlin, Frankfurt a/M., New York, Paris, Wien: Peter Lang,
1993.
Max Schasler, Kritische Geschichte der Aesthetik: Grundlegung für die Aesthetik als Philosophie des
Schönen und der Kunst. Abth. 1. Von Plato bis zum 19. Jahrhundert, Berlin: Nicolai, 1872.
Brigitte Scheer, Das Verhältnis von Ästhetik und Ethik im Denken Nietzsches, in: Greiner, MoogGrünewald (Hg.), Etho-Poietik, S. 51–68.
Arnulf von Scheliha, Luther und Nietzsche. Verborgene Kontinuität in der Sicht Paul Tillichs und
Emanuel Hirschs, in: Christian Danz, Rochus Lenardt (Hg.), Erinnerte Reformation: Studien zur
Luther-Rezeption von der Aufklärung bis zum 20. Jahrhundert, Udo Kern zum 65. Geburtstag,
(Theologische Bibliothek Töpelmann, Bd. 143), Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008,
S. 281–303.
Leo Schestow, Tolstoi und Nietzsche. Die Idee des Guten in ihren Lehren, aus dem Russischen v.
Nadja Strasser, München: Matthes & Seitz, 1994.
Friedrich Schiller, Kallias-Briefe, in: Jens Kulenkampff (Hg.), Materialien zu Kants „Kritik der Urteilskraft“, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1974, S. 145–185.
Friedrich Schiller, Philosophische Briefe, in: Friedrich Schiller, Werke, hg. von Herbert G. Göpfert,
München: Hanser, 1966, Bd. 1.
Friedrich Schiller, Über Anmut und Würde, in: Friedrich Schiller, Werke. Vollständige, historischkritische Ausgabe in 20 Teilen, hg. von Otto Güntter und Georg Witkowski, Leipzig: Hesse &
Becker, 1911, Teil 17.
Wolfgang Schirmacher (Hg.), Schopenhauer, Nietzsche und die Kunst, Wien: Passagen-Verl., 1991,
(Schopenhauer-Studien 4 (1991)).
Holger Schmid, Nietzsches Gedanke der tragischen Erkenntnis, Würzburg: Königshausen und Neumann, 1984.
Alfred Schmidt, Zur Frage der Dialektik in Nietzsches Erkenntnistheorie (1963), in: Jörg Salaquarda
(Hg.), Nietzsche, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, (Wege der Forschung,
Bd. 521), S. 124–140.
Arthur Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, Bd. 4., Wiesbaden: Brockhaus, 1946,
(Sämtliche Werke, hg. v. Arthur Hübscher).
Literatur
539
Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 3. Aufl., Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1991,
(Sämtliche Werke, hg. v. Wolfgang Frhr. von Löhneysen).
Winfried Schröder, Moralischer Nihilismus: Typen radikaler Moralkritik von den Sophisten bis Nietzsche, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 2002.
Christoph Schulte, Radikal böse. Die Karriere des Bösen von Kant bis Nietzsche, München: Fink, 1991.
Oswald Schwemmer, Philosophie der Praxis. Versuch zur Grundlegung einer Lehre vom moralischen
Argumentieren in Verbindung mit einer Interpretation der praktischen Philosophie Kants, Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1971.
Oswald Schwemmer, Die reine Vernunft des Immanuel Kant. Zum utopischen Gehalt einer philosophischen Weltrekonstruktion, in: Albertz (Hg.), Kant und Nietzsche – Vorspiel einer künftigen
Weltauslegung?, S. 61–80.
Oswald Schwemmer, Vernunft und Moral. Versuch einer kritischen Rekonstruktion des kategorischen
Imperativs bei Kant, in: Prauss (Hg.), Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und
Handeln, S. 255–273.
Martin Seils, Glaube, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1996, (Handbuch systematischer Theologie, hg. v. Carl Heinz Ratschow, Bd. 13).
Johann Gottfried Seume, Werke in 2 Bänden, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker-Verlag, 1993.
Herman Siemens, Umwertung: Nietzsche’s „War-Praxis“ and the Problem of Yes-Saying and NoSaying in „Ecce homo“, in: Nietzsche-Studien 38 (2009), S. 182–206.
Rimvydas Šilbajoris, Tolstoy’s Aesthetics and his Art, Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1991.
Christoph Simm, Kants Ablehnung jeglicher Erbsündenlehre, Münster: Literatur Verlag, 1991.
Georg Simmel, Das individuelle Gesetz. Ein Versuch über das Prinzip der Ethik, in: Georg Simmel,
Das individuelle Gesetz. Philosophische Exkurse, hg. v. Michael Landmann, Frankfurt a/M:
Suhrkamp, 1987.
Josef Simon, Aufklärung im Denken Nietzsches, in: Jochen Schmidt (Hg.), Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart,
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989, S. 459–474.
Josef Simon, Der Begriff der Aufklärung bei Kant und Nietzsche, in: Reschke (Hg.), Nietzsche. Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer?, S. 113–122.
Josef Simon, Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, Berlin, New York: Walter de
Gruyter, 2003.
Josef Simon, Ein Geflecht praktischer Begriffe. Nietzsches Kritik am Freiheitsbegriff der philosophischen Tradition, in: Simon (Hg.), Nietzsche und die philosophische Tradition, Bd. 2, S. 106–
122.
Josef Simon, Grammatik und Wahrheit. Über das Verhältnis Nietzsches zur spekulativen Satzgrammatik der metaphysischen Tradition, in: Nietzsche-Studien 1 (1972), S. 1–26.
Josef Simon, Die Krise des Wahrheitsbegriffs als Krise der Metaphysik. Nietzsches Alethiologie auf
dem Hintergrund der Kantischen Kritik, in: Nietzsche-Studien 18 (1989), S. 242–259.
Josef Simon, Moral bei Kant und Nietzsche, in: Nietzsche-Studien 29 (2000), S. 178–198.
Josef Simon, Das neue Nietzsche-Bild, in: Nietzsche-Studien 21 (1992), S. 1–9.
Josef Simon (Hg.), Nietzsche und die philosophische Tradition, Bd. 2, Würzburg: Königshausen &
Neumann, 1985.
Gerhard Seel, Über den Grund der Lust an schönen Gegenständen. Kritische Fragen an die Ästhetik
Kants, in: Oberer, Seel (Hg.), Kant. Analysen – Probleme – Kritik, S. 317–356.
Michael Skowron, Nietzsches „Anti-Darwinismus“, in: Nietzsche-Studien 37 (2008), S. 160–194.
Reinhard Slenczka, Glaube, in: Gerhard Müller (Hg.), Theologische Realenzyklopädie, Berlin,
New York: Walter de Gruyter, 1984, Bd. 13, S. 275–365.
Andreas Urs Sommer, Friedrich Nietzsches „Der Antichrist“. Ein philosophisch-historischer Kommentar, Basel: Schwabe & Co. AG., 2000, (Beiträge zu Friedrich Nietzsche, Bd. 2).
540
Literatur
Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches „Der Antichrist“, „Ecce homo“, „Dionysos-Dithyramben“, „Nietzsche contra Wagner“, Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches
Werken, hg. v. der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Bd. 6/2, Berlin, Boston: De
Gruyter, 2013.
Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches „Der Fall Wagner“, „Götzen-Dämmerung“, Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken, hg. v. der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Bd. 6/1, Berlin, Boston: De Gruyter, 2012.
Manfred Sommer, Die Selbsterhaltung der Vernunft, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog,
1977.
Yannick Souladié, Dostojewskis Antichrist, in: Andreas Urs Sommer (Hg.), Nietzsche – Philosoph der
Kultur(en)?, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008, S. 325–333.
Baruch de Spinoza, Die Ethik nach geometrischer Methode dargestellt, übers. von Otto Baentsch,
Hamburg: Meiner, 1989.
Heinz Spremberg, Zur Aktualität der Ästhetik Immanuel Kants. Ein Versuch zu Kants ästhetischer
Urteilstheorie mit Blick auf Wittgenstein und Sibley, Frankfurt a/M, Berlin, Bern, New York, Paris,
Wien: Peter Lang, 1999.
George J. Stack, Lange und Nietzsche, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1983, (Monographien und
Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 10).
Franz Stanzel, Typische Formen des Romans, 4. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1969.
Michael Städtler (Hg.), Kants „ethisches Gemeinwesen“. Die Religionsschrift zwischen Vernunftkritik
und praktischer Philosophie, Berlin: Akademie Verlag, 2005.
Pirmin Steckeler-Weithofer, Kultur und Autonomie. Hegels Fortentwicklung der Ethik Kants und ihre
Aktualität, in: Kant-Studien 84 (1993), S. 185–203.
Werner Stegmaier, Hegel, Nietzsche und die Gegenwart, in: Nietzsche-Studien 26 (1997),
S. 300–318.
Werner Stegmaier, Hegel, Nietzsche und Heraklit. Zur Methodenreflexion des Hegel-NietzscheProblems, in: Mihailo Djurić, Josef Simon (Hg.), Nietzsche und Hegel, Würzburg: Königshausen &
Neumann, 1992, (Nietzsche in der Diskussion), S. 110–129.
Werner Stegmaier, Heideggers Auseinandersetzung mit Nietzsche, in: Nietzsche-Studien 30 (2001),
S. 527–528.
Werner Stegmaier, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, in: Werner Stegmaier, unter Mitarbeit von
Hartwig Frank, Hauptwerke der Philosophie. Von Kant bis Nietzsche, Stuttgart: Reclam, 2005,
S. 95–135.
Werner Stegmaier, Leib und Leben. Zum Hegel-Nietzsche-Problem, in: Hegel-Studien 20 (1985),
S. 173–198.
Werner Stegmaier, Lévinas, Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2002.
Werner Stegmaier, Nach Montinari. Zur Nietzsche-Philologie, in: Nietzsche-Studien 36 (2007),
S. 80–94.
Werner Stegmaier, Nietzsche. Also sprach Zarathustra, in: Werner Stegmaier, unter Mitarbeit von
Hartwig Frank, Hauptwerke der Philosophie, S. 402–447.
Werner Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2012.
Werner Stegmaier, Nietzsches Begriffe, Paradoxien und Antinomien, in: Nietzsche-Studien 38 (2009),
S. 445–454.
Werner Stegmaier, Nietzsches „Genealogie der Moral“. Werkinterpretation, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994.
Werner Stegmaier, Nietzsches Kritik der Vernunft seines Lebens, in: Nietzsche-Studien 21 (1992),
S. 163–183.
Werner Stegmaier, Nietzsches Lehren, Nietzsches Zeichen, in: Renate Reschke (Hg.), Zeitenwende –
Wertewende. Internationaler Kongreß zum 100. Todestag Friedrich Nietzsches vom
Literatur
541
24.–27. August 2000 in Naumburg, Berlin: Akademie Verlag, 2001, (Nietzscheforschung,
Sonderband 1), S. 77–96.
Werner Stegmaier, Nietzsches Neubestimmung der Wahrheit, in: Nietzsche-Studien 14 (1985),
S. 69–95.
Werner Stegmaier, Nietzsches Philosophie der Kunst und seine Kunst der Philosophie. Zur aktuellen
Forschung und Forschungsmethodik, in: Nietzsche-Studien 34 (2005), S. 348–374.
Werner Stegmaier, Nietzsches und Luhmanns Aufklärung der Aufklärung, in: Reschke (Hg.), Nietzsche.
Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer?, S. 167–178.
Werner Stegmaier, Nietzsches Zeichen, in: Nietzsche-Studien 29 (2000), S. 41–69.
Werner Stegmaier, Nietzsche zur Einführung, Hamburg: Junius, 2011.
Werner Stegmaier, Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1992, (Neue Studien zur Philosophie, Bd. 4).
Werner Stegmaier, Philosophie der Orientierung, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008.
Werner Stegmaier, „Philosophischer Idealismus“ und die „Musik des Lebens“. Zu Nietzsches Umgang
mit Paradoxien. Eine kontextuelle Interpretation des Aphorismus Nr. 372 der Fröhlichen Wissenschaft, in: Nietzsche-Studien 33 (2004), S. 90–128.
Werner Stegmaier, Schicksal Nietzsche? Zu Nietzsches Selbsteinschätzung als Schicksal der
Philosophie und der Menschheit (Ecce Homo, Warum ich ein Schicksal bin 1), in: NietzscheStudien 37 (2008), S. 62–114.
Werner Stegmaier, Wolfgang Müller-Lauters Nietzsche-Interpretation, in: Nietzsche-Studien 30 (2001),
S. 474–487.
Werner Stegmaier unter Mitarbeit von Hartwig Frank, Hauptwerke der Philosophie. Von Kant bis
Nietzsche, Stuttgart: Reclam, 2005.
Klaus Steigleder, Kants Moralphilosophie. Die Selbstbezüglichkeit reiner praktischer Vernunft, Stuttgart, Weimar: Metzler, 2002.
George Steiner, Tolstoy or Dostoevsky. An Essay in Contrast, London: Faber & Faber, 1959.
Michael Steinmann, Die Ethik Friedrich Nietzsches, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2000,
(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, Bd. 43).
Paolo Stellino, Jesus als ‚Idiot‘. Ein Vergleich zwischen Nietzsches Der Antichrist und Dostojewskijs
Der Idiot, in: Volker Gerhardt, Renate Reschke (Hg.) Nietzsche und Europa – Nietzsche in Europa,
Berlin: Akademie Verlag, 2007, (Nietzscheforschung. Jahrbuch der Nietzsche-Gesellschaft,
Bd. 14), S. 203–210.
Paolo Stellino, Der Verbrecher bei Nietzsche und Dostojewskij, in: Nietzsche im Film, Projektionen
und Götzen-Dämmerung, Berlin: Akademie-Verlag, 2009, (Nietzscheforschung, Bd. 16),
S. 221–229.
Bettina Strangneth, „Kants schädliche Schriften“. Eine Einleitung, in: Immanuel Kant, Die Religion
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Hamburg: Meiner, 2003, S. IX–LXXV.
Theobald Süß, Der Nihilismus bei F.H. Jacobi, in: Arendt (Hg.), Der Nihilismus als Phänomen der
Geistesgeschichte in der wissenschaftlichen Diskussion unseres Jahrhunderts, S. 65–78.
Bernhard Taureck, Macht, und nicht Gewalt, in: Nietzsche-Studien 5 (1976), S. 29–54.
Christian Thiel, Art. Paradoxie, in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, hg. v. Jürgen
Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler, 1995, Bd. 3, S. 40 f.
Sigridur Thorgeirsdottir, Vis Creativa. Kunst und Wahrheit in der Philosophie Nietzsches, Würzburg:
Königshausen & Neumann, 1996.
Rainer Thurnher, Sprache und Welt bei Friedrich Nietzsche, in: Nietzsche-Studien 9 (1980),
S. 38–60.
Paul Tillich, Gesammelte Werke, Bd. 7: Der Protestantismus als Kritik und Gestaltung, Schriften zur
Theologie I, Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1962.
Leo Tolstoi, Anna Karenina, aus dem Russ. v. Hermann Asemissen, Berlin: Rütten & Loening, 1962.
542
Literatur
Lew Tolstoi, Auferstehung, aus dem Russ. v. Hermann Asemissen, Bd. 1, Berlin, Weimar: AufbauVerlag, 1983.
Graf Leo Tolstoi, Die christliche Lehre, hg. v. Eugen Heinrich Schmitt, Berlin: Steiniz Verl., 1899.
Leo N. Tolstoi, Christliche Lehre, übers. aus dem Russ. von Ekaterina Poljakova, in: Fuge. Journal für
Religion und Moderne 4 (2009), (Der Schein des Unendlichen. Epiphanie I), S. 63–87.
Leo N. Tolstoi, Die Erzählungen, Düsseldorf, Zürich: Artemis & Winkler, 2001, Bd. 2, (Späte Erzählungen 1886–1910).
Lew Tolstoi, Krieg und Frieden, in: Lew Tolstoi, Gesammelte Werke in 20 Bänden, Bd. 4–5, übers. v.
Werner Bergengruen, 8. Aufl., Berlin: Rütten & Loening, 1987, Bd. 1, 2.
Leo N. Tolstoj, Kritik der dogmatischen Theologie, übers. v. Carl Ritter, Leipzig: Eugen Diederichs Verl.,
1904.
Leo N. Tolstoi, Das Leben, aus dem Russischen von Raphael Löwenfeld, München: Eugen Diederichs
Verl., 1990, (Leo N. Tolstoj, Religions- und gesellschaftskritische Schriften, hg. v. Paul H. Dörr,
Bd. 5).
Léon Tolstoi, Ma religion, Paris, 1885.
Leo N. Tolstoi, Meine Beichte, aus dem Russischen von Raphael Löwenfeld, München: Eugen Diederichs Verlag, 1990, (Leo N. Tolstoj, Religions- und gesellschaftskritische Schriften, hg. v. Paul
H. Dörr, Bd. 1).
Leo N. Tolstoi, Mein Glaube, aus dem Russischen von Raphael Löwenfeld, München: Eugen Diederichs
Verl., 1990, (Leo N. Tolstoj, Religions- und gesellschaftskritische Schriften, hg. v. Paul H. Dörr,
Bd. 2).
Lew Tolstoi, Über Shakespeare und das Drama. Kritische Skizze, in: Lew Tolstoi, Ästhetische Schriften, aus dem Russischen v. Günter Dalitz, Berlin: Rütten & Loening, 1984.
Leo N. Tolstoi, Was ist Kunst?, aus dem Russischen von Michail Feofanov, München: Eugen Diederichs
Verl., 1993, (Leo N. Tolstoj, Religions- und gesellschaftskritische Schriften, hg. v. Paul H. Dörr,
Bd. 6).
Leo Tolstoi, Was sollen wir denn tun?, aus dem Russ. von Raphael Löwenfeld, München: Eugen
Diederichs Verlag, 1990, (Leo N. Tolstoj, Religions- und gesellschaftskritische Schriften, hg. v.
Paul H. Dörr, Bd. 3, 4).
Paul van Tongeren, Die Moral von Nietzsches Moralkritik: Studie zu „Jenseits von Gut und Böse“,
Bonn: Bouvier, 1989.
Paul van Tongeren, Nietzsches Hermeneutik der Scham, in: Nietzsche-Studien 36 (2007),
S. 131–154.
Paul J.M. van Tongeren, Reinterpreting Modern Culture. An Introduction to Friedrich Nietzsche’s
Philosophy, West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2000.
Paul van Tongeren, Gerd Schank, Herman Siemens u. Nietzsche Research Group (Nijmegen) (Hg.),
Nietzsche-Wörterbuch, Bd. 1: Abbreviatur – einfach, Berlin, New York: Walter de Gruyter,
2004.
Ernst Topitsch, Die Voraussetzungen der Transzendentalphilosophie. Kant in weltanschauungsanalytischer Beleuchtung, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1992.
Andreas Heinrich Trebels, Einbildungskraft und Spiel, Bonn: Bouvier, 1967.
Serge Trottein, Esthétique ou philosophie de l’art?, Parret (Hg.), Kants Ästhetik, Kant’s Aesthetics,
L’esthétique de Kant, S. 674–689.
Ulrich Tschierske, Vernunftkritik und ästhetische Subjektivität. Studien zur Anthropologie Friedrich
Schillers, Tübingen: Niemeyer, 1988, (Studien zur deutschen Literatur, Bd. 97).
Hans Vaihinger, Nietzsche als Philosoph, Berlin: Reuther & Reichard, 1916.
Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen
Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit einem Anhang über
Kant und Nietzsche, Berlin: Meiner, 1920.
Literatur
543
Gianni Vattimo, Heideggers Nihilismus: Nietzsche als Interpret Heideggers, in: Walter Biemel, Friedrich-Wilhelm v. Hermann (Hg.), Kunst und Technik. Gedächtnisschrift zum 100. Geburtstag von
Martin Heidegger, Frankfurt a/M: Klostermann, 1989.
Jürgen Villers, Kant und das Problem der Sprache. Die historischen und systematischen Gründe für
die Sprachlosigkeit der Transzendentalphilosophie, Konstanz: Verlag am Hockgraben, 1997,
(Reflexionen zur Sprachtheorie, Bd.1).
Albert Vinzens, Friedrich Nietzsches Instinktverwandlung, Basel: Schwabe & Co., 2000.
Gerhard Vollmer, Kognitive und ethische Evolution und das Denken von Kant und Nietzsche, in:
Albertz (Hg.), Kant und Nietzsche – Vorspiel einer künftigen Weltauslegung?, S. 81–109.
Wilhelm Vossenkuhl, Die Norm des Gemeinsinns, in: Esser (Hg.), Autonomie der Kunst?, S. 99–123.
Wilhelm Vossenkuhl, Schönheit als Symbol der Sittlichkeit. Über die gemeinsame Wurzel von Ethik
und Ästhetik bei Kant, in: Philosophisches Jahrbuch 99 (1992), 1. Halbband, S. 91–104.
Wilhelm Vossenkuhl, „Von der äußeren Grenze aller praktischen Philosophie“, in: Otfried Höffe (Hg.),
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, Frankfurt a/M: Klostermann, 1993, S. 299–313.
Wahrig digital – Deutsches Wörterbuch: der deutsche Wortschatz in über 260.000 Stichwörtern,
Anwendungsbeispielen und Redewendungen, München: United Soft Media, 2007.
Hermann Weidmann, Kants Kritik am Eudämonismus und die Platonische Ethik, in: Kant-Studien 92
(2001), S. 19–37.
Holger Weiniger, Vernunftkritik bei Nietzsche und Horkheimer/Adorno. Die Problemstellung in „Zur
Genealogie der Moral“ und in der „Dialektik der Aufklärung“, Dettelbach: Röll, 1998.
Silker Weller, Buchbesprechungen (Andrea Esser, Kunst als Symbol. Die Struktur ästhetischer Reflexion in Kants Theorie des Schönen, München, 1997), in: Kant-Studien 90 (1999), S. 474–477.
Klaus Wellner, Methode und Einheit im Philosophieren Kants und Nietzsches, in: Albertz (Hg.), Kant
und Nietzsche – Vorspiel einer künftigen Weltauslegung?, S. 9–45.
Christian Helmut Wenzel, Gemeinsinn und das Schöne als Symbol des Sittlichen, in: Hiltscher,
Klingner, Süß (Hg.), Die Vollendung der Transzendentalphilosophie in Kants „Kritik der Urteilskraft“, S. 125–139.
Christian Helmut Wenzel, Das Problem der subjektiven Allgemeingültigkeit des Geschmacksurteils bei
Kant, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2000, (Kantstudien-Ergänzungshefte, 137).
Josef Viktor Widmann, Nietzsches gefährliches Buch, in: Berner Bund vom 16./17. September 1886,
37, Nr. 256.
Wolfgang Wieland, Urteil und Gefühl. Kants Theorie der Urteilskraft, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2001.
Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff, Zukunftsphilologie! eine erwidrung auf Friedrich Nietzsches (ord.
professors der classischen philologie zu Basel) „geburt der tragödie“, in: Karlfried Gründer (Hg.),
Der Streit um Nietzsches „Geburt der Tragödie“, Hildesheim: Olms, 1989, S. 27–55.
Ulrich Willers, „Aut Zarathustra aut Christus“. Die Jesus-Deutung Nietzsches im Spiegel ihrer Interpretationsgeschichte: Tendenzen und Entwicklungen von 1900–1980, in: Theologie und Philosophie 60 (1985), S. 418–442; 61 (1986), S. 236–249.
Ulrich Willers, Friedrich Nietzsches antichristliche Christologie. Eine theologische Rekonstruktion,
Innsbruck, Wien: Tyrolia-Verlag, 1988.
Reiner Wimmer, Kants kritische Religionsphilosophie, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1990,
(Kantstudien-Ergänzungshefte, 124).
Aloysius Winter, Der andere Kant. Zur philosophischen Theologie Immanuel Kants, mit einem Geleitwort von Norbert Hinske, Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms, 2000.
Mary Anne Frese Witt (Hg.), Nietzsche and the Rebirth of the Tragic, London: Continuum, 2007.
Ludwig Wittgenstein, Werkausgabe, Bd. 8, (Bemerkungen über die Farben. Über Gewißheit. Zettel.
Vermischte Bemerkungen), Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1984.
544
Literatur
Günter Wohlfart, „Die Aufklärung haben wir jetzt weiterzuführen […]“, in: Reschke (Hg.), Nietzsche.
Radikalaufklärer oder radikaler Gegenaufklärer?, S. 123–132.
Michael Wolff, Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel. Mit einem Essay über Freges Begriffsschrift, Frankfurt a/M: Klostermann, 1995, (Philosophische Abhandlungen, Bd. 63).
Julian Young, Nietzsche’s Philosophy of Art, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Claus Zittel, Ästhetisch fundierte Ethiken und Nietzsches Philosophie, in: Nietzsche-Studien 32
(2003), S. 103–123.
Claus Zittel, Selbstaufhebungsfiguren bei Nietzsche, Würzburg: Königshausen & Neumann, 1995.
Marc Zobrist, Kants Lehre vom höchsten Gut und die Frage moralischer Motivation, in: Kant-Studien
99 (2008), S. 285–311.
Magdalene Zurek, Tolstojs Philosophie der Kunst, Heidelberg: Winter, 1996.
Александр И. Абрамов (Aleksandr I. Abramow), О русском кантианстве и неокантианстве в
журнале „Логос“ (Über den russischen Kantianismus und Neukantianismus in der Zeitschrift
„Logos“), in: Абрамов, Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 759–783.
Александр И. Абрамов, Владимир А. Жучков (Aleksandr I. Abramow, Wladimir A. Zhutschkow) (Hg.),
Кант: Pro et contra. Рецепция идей немецкого философа и их влияние на развитие русской
философской традиции. Антология (Kant: Pro et contra. Die Rezeption der Ideen des deutschen
Philosophen und ihr Einfluss auf die Entwicklung der russischen philosophischen Tradition.
Anthologie), Санкт-Петербург: Русский Христиан. гуман. академия, 2005.
К.М. Азадовский (K.M. Azadowski), Русские в „Архиве Ницше“ (Die Russen im „Archiv Nietzsches“),
in: Синеокая (Hg.), Фридрих Ницше и философия в России, S. 109–128.
Александр Ф. Архангельский (Alexander F. Archangelski) (Hg.), Библиотека Льва Николаевича
Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание (Die Bibliothek von Lew Nikolajewitsch Tolstois in Jasnaja Poljana), Москва: Книга, 1972.
Валентин Ф. Асмус (Walentin F. Asmus), Немецкая эстетика XVIII века (Die deutsche Ästhetik des
18. Jahrhunderts), Москва, 1960.
Анатолий В. Ахутин (Anatoli W. Achutin), София и Черт (Кант перед лицом русской религиозной
метафизики), (Sophia und Teufel (Kant angesichts der russischen religiösen Metaphysik)), in:
Вопросы философии, 1990, № 1, S. 51–69.
Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Автор и герой в эстетической деятельности (Autor und Held
in der ästhetischen Tätigkeit), in: Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Собрание сочинений
в 7 томах, Bd. 1, (Философская эстетика 1920-х годов (Die philosophische Ästhetik der
1920-er Jahre)), S. 69–263.
Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Вопросы литературы и эстетики (Fragen der Literatur und
Ästhetik), Москва: Худож. лит., 1975.
Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Проблемы поэтики Достоевского (Probleme von Dostojewskis Poetik), in: Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Собрание сочинений, 2002, Bd. 6,
S. 5–300.
Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Проблема содержания, материала и формы в словесном
художественном творчестве (Das Problem des Inhalts, des Materials und der Form im Wortkunstschaffen), in: Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Вопросы литературы и эстетики,
Москва: Худож. лит., 1975, S. 6–71.
Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Проблема текста (Das Problem des Textes), in: Михаил
М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Собрание сочинений в 7 томах, Bd. 5, (Работы 1940-х – начала
1960-х годов (Werke von 1940-Anfang 1960-er Jahre)), S. 306–326.
Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Роман воспитания и его значение в истории реализма
(Erziehungsroman und seine Bedeutung in der Geschichte des Realismus), in: Михаил
М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Эстетика словесного творчества, Москва: Искусство, 1986,
S. 199–249.
Literatur
545
Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Собрание сочинений (Gesammelte Werke), hg. v. S.G.
Bocharow, Москва: Руссие словари, Языки славянских культур, 1996 ff.
Михаил М. Бахтин (Michail M. Bachtin), Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса (Das Schaffen von François Rabelais und die Volkskultur des
Mittelalters und der Renaissance), Москва: Худож. лит., 1990.
Андрей Белый (Andrej Bely), Искусство (Die Kunst), in: Андрей Белый (Andrej Bely), Символизм как
миропонимание, zusammengest. v. L.A. Sugaj, Москва: Республика, 1994, S. 238–243.
Андрей Белый (Andrej Bely), Критицизм и символизм (Kritizismus und Symbolismus), in: Абрамов,
Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 553–564.
Андрей Белый (Andrej Bely), Круговое движение. Сорок две арабески (Zirkelbewegung. Zweiundvierzig Arabesken), in: Труды и дни, 1912, № 3–4, S. 51–73.
Андрей Белый (Andrej Bely), Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche), in: Синеокая (Hg.), Ницше:
Pro et contra, S. 878–903.
Ю. Беляев, (J. Beljajew), В Ясной Поляне (In Jasnaja Poljana), in: Новое время, 1903, 24. April,
№ 9746.
Николай А. Бердяев (Nikolai A. Berdjajew), Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Л.
Толстого (Altes und Neues Testament in dem religiösen Bewusstsein L. Tolstois), Исупов (Hg.),
Толстой: Pro et contra, S. 243–263.
Николай А. Бердяев (Nikolai A. Berdjajew), Опыт эсхатологической метафизики (Ein Versuch über
die eschatologische Metaphysik), in: Абрамов, Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 687–709.
Николай А. Бердяев (Nikolai A. Berdjajew), Русский духовный ренессанс начала ХХ века и журнал
„Путь“: (К десятилетию „Пути“) (Die russische geistige Renaissance Anfang des 20. Jahrhunderts und die Zeitschrift „Put’“: (Zum zehnten Jubiläum von „Put’“)), in: Путь (Weg), Paris, 1935,
№ 49, S. 3–22.
Николай А. Бердяев (Nikolai A. Berdjajew), Философия свободы (Philosophie der Freiheit), in:
Николай А. Бердяев, Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма, Москва:
Сварог и К, 1997.
В.А. Богданов (W.A. Bogdanow) (Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве (Dostojewski über die Kunst),
Москва: Искусство, 1973.
Александр И. Боркович (архиепископ Никанор) (Aleksander I. Borkowitsch (Erzbischof Nikanor)),
Критика на „Критику чистого разума“ (Kritik an der „Kritik der reinen Vernunft“), in: Абрамов,
Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 266–316.
В.Н. Волошинов (W.N. Woloshinov), Марксизм и философия языка (Marxismus und Sprachphilosophie), in: М.М. Бахтин под маской (M.M. Bachtin unter der Maske), Фрейдизм. Формальный
метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи, Москва: Лабиринт,
2000, S. 349–486.
С.Н. Булгаков (S.N. Bulgakow), Простота и опрощение (Einfachheit und Vereinfachung), in: Исупов
(Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 274–298.
Зинаида Гиппиус (Zinaida Gippius), Благоухание седин (Der Brodem des Alters), in: Исупов (Hg.),
Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 124–129.
Сильвестр С. Гогоцкий (Silvestr S. Gogotski), Философский лексикон. Кант (Philosophisches Lexikon. Kant), in: Абрамов, Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 202–250.
Яков Э. Голосовкер (Jakow E. Golosowker), Достоевский и Кант. Размышления читателя над
романом „Братья Карамазов“ и трактатом Канта „Критика чистого разума“ (Dostojewski und
Kant. Überlegungen eines Lesers über den Roman „Die Brüder Karamasow“ und Kants Traktat
„Kritik der reinen Vernunft“), Москва: Постскриптум, 1963.
Алексей В. Горин (Alexej W. Gorin), Философия в темных лучах метафоры. „Океан метафизики“,
„страна истины“ и горизонты трансцендентальной философии Канта (Die Philosophie in den
dunklen Strahlen der Metapher. Der „Ozean der Metaphysik“, das „Land der Wahrheit“ und die
546
Literatur
Horizonte der Transzendentalphilosophie Kants), in: Д.Н. Разеев (Hg.), Актуальность Канта:
Сборник статей, Санкт-Петербург, 2005.
Максим Горький (Maksim Gorki), В.И. Ленин (W.I. Lenin), in: Максим Горький (Maksim Gorki),
Воспоминания. Рассказы. Заметки, Берлин: Kniga, 1927.
Борис Гройс (Boris Groys), Поиск русской национальной идентичности (Die Suche nach der russischen Nationalidentität), in: А.Я. Шаров (Hg.), Россия и Германия: опыт философского
диалога, Москва: Медиум, 1993, S. 30–52.
Николай Я. Грот (Nikolai J. Grot), Нравственные идеалы нашего времени (Фридрих Ницше и Лев
Толстой) (Moralische Ideale unserer Zeit (Friedrich Nietzsche und Lew Tolstoi)), in: Вопросы
философии и психологии, 1893, № 16, S. 129–154.
Арсений Гулыга (Arseni Gulyga), Кант (Kant), Москва: Молодая гвардия, 2005.
Николай Н. Гусев (Nikolai Gusew), Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого (Chronik von Tolstois
Leben und Schaffen), Москва: Гослитиздат, 1958–1960.
Юрий Давыдов (Juri Dawydow), Этика любви и метафизика своеволия (Проблемы нравственной
философии), (Die Ethik der Liebe und die Metaphysik des Eigenwillens (Fragen der Moralphilosophie)), Москва: Молодая гвардия, 1982.
Н.А. Дмитриева (N.A. Dmitrijewa), Кантианство на рубеже XIX–XX веков: К истории
неокантианских школ в России (Der Kantianismus um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert:
Zur Geschichte der neukantianischen Schulen in Russland), in: В.С. Степин, Н.В. Мотрошилова
(Hg.), Иммануил Кант: наследие и проект, Москва: Канон+, 2007, S. 585–592.
Надежда С. Доронина (Nadezhda S. Doronina), Проблема веры. Этический аспект: И. Кант и
русская философия всеединства (Das Problem des Glaubens. Ethischer Aspekt: I. Kant und die
russische Philosophie der All-Einheit), Автореферат на соиск. степени кандид. филос. наук,
Санкт-Петербург: Изд. Санкт-Петербургского ун-та, 2000.
Федор Михайлович Достоевский, Полное собрание сочинений, в 30 томах (Gesammelte Werke, in
30 Bd.), Ленинград: Наука, 1972–1990.
Федор М. Достоевский (Fjodor M. Dostojewski), Ряд статей о русской литературе (Aufsätze über die
russische Literatur), in: Богданов (Hg.), Ф.М. Достоевский об искусстве, S. 55–113.
Ф.М. Достоевский в работе над романом „Подросток“ (F.M. Dostojewski bei der Arbeit an dem
Roman „Der Jüngling“), in: Литературное наследство, Bd. 77, Москва: Наука, 1965.
Владимир А. Жучков (Wladimir A. Zhutschkow), Комментарии и примечания (Kommentar und
Anmerkungen), Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 828–924.
Василий Зеньковский (Wasili Zenkowski), История русской философии (Geschichte der russischen
Philosophie), Paris: YMCA press, 1948.
Вячеслав И. Иванов (Wjatscheslaw I. Iwanow), Ницше и Дионис (Nietzsche und Dionysos), in:
Синеокая (Hg.), Ницше: Pro et contra, S. 794–804.
К.Г. Исупов (K.G. Isupow) (Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et contra. Личность и творчество Льва Толстого в
оценке русских мыслителей и иследователей. Антология (Lew N. Tolstoi: Pro et contra. Die
Persönlichkeit und das Schaffen Lew Tolstois in den Einschätzungen der russischen Denker
und Forscher. Eine Anthologie), Санкт-Петербург: Изд-во Русского Христ. Гуманит. Ин-та,
2000.
Захар А. Каменский (Zachar A. Kamenski), Кант в России (конец XVIII – первая четверть XIX в.)
(Kant in Russland (Ende des 18. – erstes Viertel des 19. Jh.)), in: Т.И. Ойзерман(Hg.), Философия
Канта и современность, Москва: Мысль, 1974, S. 289–328.
Захар А. Каменский (Zachar A. Kamenski), Кант в русской философии начала XIX в. (Kant in der
russischen Philosophie am Anfang des 19. Jh.), in: Вестник истории мировой культуры, 1960,
№ 1, S. 49–64.
Захар А. Каменский (Zachar A. Kamenski) (Hg.), Кант и философия в России (Kant und die Philosophie in Russland), Москва: Наука, 1994.
Literatur
547
Василий Н. Карпов (Wasili N. Karpow), Философский рационализм новейшего времени (Der
philosophische Rationalismus der Neuzeit), in: Абрамов, Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra,
S. 80–128.
О.В. Кирьязев (O.W. Kirjazew), Предтеча цивилизационного синтеза (Der Vorläufer einer zivilisatorischen Synthese), in: А.А. Гусейнов (Hg.), Этическая мысль, Москва: РАН, 2004, Bd. 5, S. 143–171.
Елизавета Н. Купреянова (Elisaweta N. Kuprejanova), Эстетика Л.Н. Толстого (Die Ästhetik von
L.N. Tolstoi), Москва – Ленинград, 1966.
Владимир И. Ленин (Ульянов) (Wladimir I. Lenin (Uljanow), Лев Толстой как зеркало русской
революции (Lew Tolstoi als Spiegel der russischen Revolution), in: Владимир И. Ленин
(Ульянов) (Wladimir I. Lenin (Uljanow), Полное собрание сочинений (Gesammelte Werke),
Москва: Издательство политической литературы, 1952, 2. Aufl., Bd. 15, S. 179–186, (1. Aufl.
in: Пролетарий 35 (1908)).
Константин Н. Ломунов (Konstantin N. Lomunow) (Hg.), Л. Толстой об искусстве и литературе
(L. Tolstoi über die Kunst und Literatur), Москва: Совет. писатель, 1958.
Константин Н. Ломунов (Konstantin N. Lomunow), Эстетика Льва Толстого (Die Ästhetik von Lew
Tolstoi), Москва, 1972.
Лев М. Лопатин (Lew M. Lopatin), Больная искренность (Заметка по поводу статьи В.
Преображенского „Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма“) (Die kranke Offenheit
(Bemerkung zum Anlass des Artikels von W. Preobrazhenski „Friedrich Nietzsche. Kritik der
Moral des Altruismus“)), in: Вопросы философии и психологии, 1893, № 16, S. 109–114.
Лев М. Лопатин (Lew M. Lopatin), Нравственное учение Канта (Kants sittliche Lehre), in: Абрамов,
Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 470–483.
Лев М. Лопатин (Lew M. Lopatin), Учение Канта о познании (Kants Lehre über die Erkenntnis), in:
Абрамов, Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 484–497.
Алексей Ф. Лосев (Aleksej F. Losew), Владимир Соловьев и его время (Wladimir Solowjew und seine
Zeit), Москва: Прогресс, 1990.
Николай О. Лосский (Nikolai O. Losski), Гносеологический индивидуализм в новой философии и
преодоление его в новейшей философии (Der gnoseologische Individualismus in der Philosophie der Neuzeit und seine Überwindung in der Philosophie der Neuesten Zeit), in: Абрамов,
Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 565–573.
Николай О. Лосский (Nikolai O. Losski), Нравственная личность Толстого (Die moralische Persönlichkeit von Tolstoi), in: Исупов (Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 229–242.
Юрий М. Лотман (Juri M. Lotman), Культура и взрыв (Kultur und Explosion), Москва: Гнозис, 1992.
Юрий М. Лотман (Juri M. Lotman), Роман А.С. Пушкина „Евгений Онегин“. Комментарий (Roman
von A.S. Puschkin „Eugen Onegin“. Ein Kommentar), Ленинград: Просвещение, 1980.
Юрий М. Лотман (Juri M. Lotman), Роман в стихах А.С. Пушкина „Евгений Онегин“. (Roman in
Versen von A.S. Puschkin „Eugen Onegin“), Tartu, 1975.
Александр С. Лубкин (Aleksander S. Lubkin), Рассуждение о том, возможно ли нравоучению дать
твердое основание, независимо от религии (Abhandlung über die Frage, ob eine feste Begründung der Sittenlehre ohne Religion möglich ist), in: Абрамов, Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra,
S. 11–18.
Юрий В. Манн (Juri W. Mann), Автор и повествование (Der Autor und die Erzählung), in: Павел
А. Гринцер (Hg.), Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного
сознания, Москва: Наследие, 1994, S. 431–480.
Дмитрий С. Мережковский (Dmitri S. Merezhkowski), Л. Толстой и Достоевский, (L. Tolstoi und
Dostojewski), Санкт-Петербург: Общ. Польза, 1909.
Михайло Михайлов (Michailo Michailow), Великий катализатор: Ницше и русский неоидеализм
(Der große Katalysator: Nietzsche und der russische Neuidealismus), in: Иностранная
литература, 1990, № 4, S. 197–204.
548
Literatur
Николай К. Михайловский (Nikolai K. Michajlowski), Еще о Ф. Ницше (Noch einmal über F. Nietzsche), in: Синеокая (Hg.), Ницше: Pro et contra, S. 133–179.
Нелли В. Мотрошилова (Nelli W. Motroschilowa), Юлия В. Синеокая (Julija W. Sineokaja) (Hg.),
Фридрих Ницше и философия в России. Сборник статей (Friedrich Nietzsche und die Philosophie in Russland. Beiträge), Санкт-Петербург: Русс. Христ. гуманит. ин-т, 1999.
Владимир Набоков (Wladimir Nabokow), Лекции по русской литературе (Vorlesungen über die
russische Literatur), Москва: Независ. газ., 1996.
Л.З. Немировская (L.Z. Nemirowskaja), Религия в духовном поиске Толстого (Die Religion in der
geistigen Suche von Tolstoi), Москва: Знание, 1992.
А.А. Нинов (A.A. Ninow), Достоевский и театр. Сборник статей (Dostojewski und das Theater. Ein
Sammelband), Ленинград: Искусство, 1983.
Павел И. Новгородцев (Pawel I. Nowgorodtsew), Кант как моралист (Kant als Moralist), in: Абрамов,
Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 542–554.
М.А. Новоселов (M.A. Nowosjelow), Открытое письмо графу Л.Н. Толстому (Offener Brief an Graf
L.N. Tolstoi), in: Исупов (Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 375–385.
Дмитрий И. Писарев (Dmitri I. Pisarew), Пушкин и Белинский (Puschkin und Belinski), Москва,
Петроград: Гос. изд., 1923.
А.С. Полтавцев (A.S. Poltawtsew), Философское мировоззрение Л.Н. Толстого (Die philosophische
Weltanschauung von L.N. Tolstoi), Харьков, 1974.
Екатерина А. Полякова (Ekaterina Poljakova), Образ Ставрогина в системе персонажей романа
Ф.М. Достоевского „Бесы“. (Stawrogin unter den Figuren im Roman von F.M. Dostojewski „Die
Dämonen“), in: С.Н. Бройтман u. a. (Hg.), Аспекты теоретической поэтики. К 60-летию Натана
Давидовича Тамарченко, Москва, Тверь: Изд. Тверского ун-та, 2000, S. 204–211.
Екатерина Полякова (Ekaterina Poljakova), „Параллельные линии“ Ивана Карамазова (Логика
одной идеи) („Parallele Linien“ von Iwan Karamasow (Die Logik einer Idee)), in: Mark G. Altshuller (Hg.), Graduate Essays on Slavic Languages and Literatures, Pittsburgh: Centre for Russian
and East European Studies University of Pittsburgh, 1993, Vol. 6, S. 21–27.
Екатерина Полякова (Ekaterina Poljakova), Поэтика драмы и эстетика театра в романе: „Идиот“ и
„Анна Каренина“ (Poetik des Dramas und Ästhetik des Theaters im Roman: „Der Idiot“ und
„Anna Karenina“), Москва: Изд. РГГУ, 2002.
Елена Полякова (Elena Poljakova), Театр Льва Толстого: Драматургия и опыты ее прочтения
(Theater von Lew Tolstoi: Die Dramaturgie und ihre Deutungen), Москва: Искусство, 1978.
П. Попов (P. Popow), Иностранные источники трактата „Что такое искусство?“ (Die fremdsprachigen Quellen vom Traktat „Was ist Kunst?“), in: П.Н. Сакулин (Hg.), Эстетика Льва Толстого,
Москва, 1929, S. 123–152.
Василий П. Преображенский (Wasili P. Preobrazhenski), Фридрих Ницше: Критика морали
альтруизма (Friedrich Nietzsche: Kritik der Moral des Altruismus), in: Вопросы философии и
психологии, 1892, № 15, S. 115–160.
Александр С. Пругавин (Alexander S. Prugawin), О Льве Толстом и толстовцах. Очерки,
воспоминания, материалы (Über Lew Tolstoi und Tolstojaner. Essais, Erinnerungen, Materialien), Москва: Изд. авт., 1911.
В.Ф. Пустарнаков (W.F. Pustarnakow), Был ли Фридрих Ницше „самым русским“ из западных
философов? (War Friedrich Nietzsche irgendwann der „russischste“ unter den westlichen Philosophen?), in: Мотрошилова, Синеокая (Hg.), Фридрих Ницше и философия в России,
S. 86–108.
Василий Розанов (Wasili Rosanow), Об отлучении гр. Л.Н. Толстого от церкви (Über die Exkommunikation von Graf L.N. Tolstoi), in: Исупов (Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 423–425.
Василий Розанов (Wasili Rozanow), Поездка в Ясную Поляну (Eine Reise nach Jasnaja Poljana), in:
Исупов (Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 111–116.
Literatur
549
Василий Розанов (Wasili Rozanow), Л.Н. Толстой и Русская церковь (L.N. Tolstoi und die Russische
Kirche), in: Исупов (Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 426–436.
Михаил Н. Розанов (Michail N. Rozanow), Руссо и Толстой (Rousseau und Tolstoi), in: Отчет о
деятельности Академии Наук, Москва: АН СССР, 1927, S. 3–22.
Петр А. Сергеенко (Pjotr Sergeenko), Как живет и работает гр. Л.Н. Толстой (Wie lebt und arbeitet
Graf L.N. Tolstoi), Москва: Тип. лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898.
Юлия Синеокая (Julija Sineokaja), В мире нет ничего невозможного? (Л. Шестов о философии
Ницше) (Es gibt nichts Unmögliches in der Welt? (L. Schestow über die Philosophie Nietzsches)), in: Мотрошилова, Синеокая (Hg.), Фридрих Ницше и философия в России,
S. 75–85.
Юлия В. Синеокая (Julija W. Sineokaja), Восприятие идей Ницше в России: Основные этапы,
тенденции, значение (Die Rezeption der Ideen Nietzsches in Russland: die wichtigsten Etappen,
Tendenzen, Bedeutung), in: Мотрошилова, Синеокая (Hg.), Фридрих Ницше и философия в
России, S. 7–37.
Юлия В. Синеокая (Julija W. Sineokaja) (Hg.), Ницше: Pro et contra. Антология (Nietzsche: Pro et
contra. Anthologie), Санкт-Петербург: Русский Христ. гуманит. институт, 2001.
Юлия В. Синеокая (Julija W. Sineokaja), Российская ницшеана (Der russische Nietzscheanismus),
in: dies. (Hg.), Ницше: Pro et contra, S. 3–34.
Юлия В. Синеокая (Julija W. Sineokaja), Рубеж веков: Русская судьба сверхчеловека Ницше (Die
Jahrhundertwende: Das russische Schicksal des Übermenschen Nietzsches), in: Мотрошилова,
Синеокая (Hg.), Фридрих Ницше и философия в России, S. 58–74.
Юлия В. Синеокая (Julija W. Sineokaja), Три образа Ницше в русской культуре (Drei Bilder Nietzsches in der russischen Kultur), Москва: РАН, 2008.
Владимир C. Соловьев (Wladimir S. Solowjew), Идея сверхчеловека (Die Idee des Übermenschen),
in: Синеокая (Hg.), Ницше: Pro et contra, S. 294–302.
Владимир С. Соловьев (Wladimir S. Solowjew), Кант (Kant), in: Абрамов, Жучков (Hg.), Кант: Pro et
contra, S. 329–366.
Владимир C. Соловьев (Wladimir S. Solowjew), Оправдание добра (Rechtfertigung des Guten), in:
Владимир Соловьев, Соч., Москва: Мысль, 1990, Bd. 1.
Владимир С. Соловьев (Wladimir S. Solowjew), Словесность или истина? (Literatur oder Wahrheit?),
in: Синеокая (Hg.), Ницше: Pro et contra, S. 290–293.
Владимир С. Соловьев (Wladimir S. Solowjow), Три разговора (Drei Gespräche), in: Исупов,
Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 163–184.
Федор А. Степун (Fjodor A. Stepun), Религиозная трагедия Льва Толстого (Die religiöse Tragödie
Lew Tolstois), in: Исупов (Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 445–470.
Николай Н. Страхов (Nikolai N. Strachow), Философские очерки. Главная черта мышления (Philosophische Essays. Hauptzug des Denkens), in: Абрамов, Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra,
S. 158–170.
Петр Б. Струве (Pjotr B. Struwe), Miscellanea. К характеристике Ницше как мыслителя и художника
(Zum Charakteristikum Nietzsches als Denker und Künstler), in: Синеокая (Hg.), Ницше: Pro et
contra, S. 329–334.
Натан Д. Тамарченко (Natan D. Tamartschenko), „Театральный хронотоп“ в романе (М.М. Бахтин и
П.А. Флоренский) („Das theatralische Chronotopos“ im Roman (M.M. Bachtin und P.A. Florenski)), in: The Seventh International Bakhtin Conference, Moscow, 1955, Book 1, S. 43–48.
Натан Д. Тамарченко (Natan D. Tamarchenko), „Эстетика словесного творчества“ Бахтина и
русская религиозная философия („Ästhetik des Wortkunstschaffens“ von Bachtin und die
russische religiöse Philosophie), Москва: изд. РГГУ, 2001.
Натан Д. Тамарченко (Natan D. Tamarchenko), „Эстетика словесного творчества“ Бахтина и
русская философско-филологическая традиция („Ästhetik des Wortkunstschaffens“ von
550
Literatur
Bachtin und die russische philosophisch-philologische Tradition), Москва: изд. Кулагиной,
2011.
Александр А. Тихомиров (Alexander A. Tichomirow), Самообман в науке и искусстве (Ч. Дарвин и
гр. Толстой) (Der Selbstbetrug in der Wissenschaft und in der Kunst (Ch. Darwin und Graf
Tolstoi)), Санкт-Петербург: Улей, 1910.
Софья А. Толстая (Sofja A. Tolstaja), Дневники (Tagebücher), hg. v. N.I. Azarowa, Москва: Худ. лит.,
1978.
Лев Николаевич Толстой (Lew Nikolajewitsch Tolstoi), Мысли Иммануила Канта, выбранные
Л.Н. Толстым (Die von L.N. Tolstoi ausgewählten Gedanken von Immanuel Kant), übers. aus dem
Deutschen von S.A. Poretski, Москва: Посредник, 1906.
Лев Н. Толстой (Lew N. Tolstoi), Ответ на постановление Синода от 20–22 февраля и на полученные
мною по этому поводу письма (Die Antwort auf das Schreiben des Synods vom 21.–22. Februar
und die zu diesem Anlass von mir erhaltenen Briefe), in: Исупов (Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et
contra, S. 348–355.
Лев Н. Толстой (Lew N. Tolstoi), Переписка с русскими писателями (Der Briefwechsel mit russischen
Schriftstellern), hg. von S.A. Rosanowa, Москва: Худ. лит., 1978.
Лев Николаевич Толстой (Lew Nikolajewitsch Tolstoi), Полное собрание сочинений, в 90 томах
(Юбилейное издание) (Gesamtausgabe, Jubiläumsausgabe), 1. Aufl., Москва, Ленинград: Худ.
лит., 1935–1958, 2. Auflage, Москва: Терра, 1990.
Лев Н. Толстой (Lew N. Tolstoi), Собрание сочинений (Gesammelte Werke), Москва, 1963.
Лев Николаевич Толстой (Lew Nikolajewitsch Tolstoi), Соединение и перевод четырех Евангелий
(Zusammenfügung und Übersetzung der vier Evangelien), in: Толстовский листок, изд.
А.В. Мороз, 6 (1995).
Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников (L.N. Tolstoi in Erinnerungen seiner Zeitgenossen),
Москва, Ленинград, 1960.
Евгений Н. Трубецкой (Ewgeni N. Trubezkoi), Философия Ницше. Критический очерк (Die Philosophie Nietzsches. Eine kritische Abhandlung), in: Синеокая (Hg.), Ницше: Pro et contra,
S. 672–793.
Иван С. Тургенев (Iwan S. Turgenjew), Отцы и дети (Väter und Söhne), in: Иван С. Тургенев (Iwan
S. Turgenjew), Собрание сочинений (Gesammelte Werke), Москва: Худож. лит., 1961, Bd. 3,
S. 125–275.
Николай Ф. Федоров (Nikolai F. Fjodorow), Что такое добро? (Was ist das Gute?), in: Исупов (Hg.),
Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 188–195.
Л.И. Филиппов (L.I. Filippow), Неокантианство в России (Der Neukantianismus in Russland), in:
А.С. Богомолов (Hg.), Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции,
Москва: Наука, 1978, S. 286–316.
Павел А. Флоренский (Pawel F. Florenski), Столп и утверждение истины (Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit), Москва: Правда, 1990.
Семен Франк (Semjon Frank), Нравственное учение Л.Н. Толстого (Moralische Lehre L.N. Tolstois),
in: Исупов (Hg.), Л.Н. Толстой: Pro et contra, S. 299–308.
Сергей Хоружий (Sergej Choruzhi), Кризис классической европейской этики в антропологической
перспективе (Der Krise der klassischen europäischen Ethik in der anthropologischen Perspektive), in: В.Н. Игнатьев (Hg.), Этика науки, Москва: ИФРАН, 2007, S. 85–97.
Сергей Хоружий (Sergej Choruzhi), К феноменологии аскезы (Zur Phänomenologie des Asketismus), Москва: Изд. гуманитарной литературы, 1998.
Сергей С. Хоружий (Sergej S. Choruzhi), После перерыва. Пути русской философии (Nach dem
Umbruch. Die Wege der russischen Philosophie), Санкт-Петербург: Алетейа, 1994.
С.А. Чернов (S.A. Tschernow), Критицизм и мистицизм (Kritizismus und Mystizismus), in: Абрамов,
Жучков (Hg.), Кант: Pro et contra, S. 784–827.
Literatur
551
Афанасий А. Шенин (Фет), Письмо к Л.Н. Толстому от 16 марта 1877 г. (Ein Brief an L.N. Tolstoi vom
16. März 1877), in: Литературное наследство, Москва: ИМЛИ РАН, 1939, (37/38).
Лев Шестов (Lew Schestow), Афины и Иерусалим (Athen und Jerusalem), in: Лев Шестов, Собрание
сочинений, в 2 томах, Москва: Наука, 1993, Bd. 1, S. 317–336.
Лев Шестов (Lew Schestow), Добро в учении гр. Толстого и Фр. Ницше (Философия и проповедь)
(Das Gute in der Lehre von Graf Tolstoi und F. Nietzsche (Philosophie und Predigt)), СанктПетербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1902.
Лев Шестов (Lew Schestow), Достоевский и Ницше: Философия трагедии. (Dostojewski und Nietzsche: Philosophie der Tragödie), Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1903.
Лев Шестов (Lew Schestow), На весах Иова (Auf der Waage Hiobs), in: Лев Шестов, Собрание
сочинений, в 2 томах, Москва: Наука, 1993, Bd. 2, S. 5–22.
Виктор Шкловский (Wiktor Schklowski), Лев Толстой (Lew Tolstoi), Москва: Молодая гвардия, 1963,
(Жизнь замечательных людей, Bd. 3 (363)).
Татьяна Щитцова (Tatjana Schitzowa), „Слово о радости“: антиномичность хайдеггеровской
трактовки бытия к смерти („Ein Wort über Freude“: zur Antinomie von der heideggerschen
Deutung des Daseins zum Tode), in: Топос 1 (12) (2006), S. 67–74.
Namensregister
Aischylos 196–197, 200, 203, 208, 310
Apollo 79, 191, 196, 200, 207, 447, 509
– das Apollinische, apollinisch 145, 191–192,
195–196, 200–201
Bachtin, Michail 336, 405–406, 425, 428,
452–454, 510, 528, 537, 544–545, 549–
550
Baumgarten, Alexander Gottlieb 296, 299, 523
Belinski, Wissarion 330–331, 353, 361, 402,
436, 548
Berdjajew, Nikolai 228, 230, 232, 395,
439–441, 443–444, 446, 448–450,
526, 545
Cajus 49–50, 268–269
Calvin, Jean 43, 146–148, 150, 154, 169, 531
Comte, Auguste 330, 359
Darwin, Charles 133–134, 259, 539, 550
– Darwinismus 134
– Antidarwinismus 134, 539
Deleuze, Gilles 7, 161–162, 525
Derrida, Jacques 2, 7, 10, 102, 205, 525
Dionysos 9, 21, 26, 79, 191, 195, 198, 200,
207–209, 447, 449–450, 459–460, 475,
498–499, 509, 520, 531, 538, 540, 546
– das Dionysische, dionysisch 12, 95, 145,
191–201, 207–211, 218, 312, 450, 476, 525,
528, 535
– undionysisch, antidionysisch 197–200
Dostojewski, Fjodor VIII, X, XII, 3–5, 7, 22,
24–26, 43, 56, 64, 77, 107, 124, 156–157,
170, 225–226, 229–232, 251, 254, 274, 292,
317, 329–436, 441–442, 444, 447–448,
451–464, 476–477, 481–483, 488–492,
495–498, 501–502, 504–510, 512, 514,
516–518, 520–521, 526, 528, 533, 535, 537,
540–541, 544–548, 551
Erasmus von Rotterdam 41, 147–148, 156, 527
Euripides 191, 196–197, 200, 223, 310–311
Florenski, Pawel 406, 441, 443, 529,
549–550
Foucault, Michel 7, 72, 188, 527
Fourier, Charles 330, 354, 358–359, 362
Goethe, Johann Wolfgang 31, 41, 98, 204, 211,
304, 429, 527–528
Gogol, Nikolai 436
Hamann, Johann Georg 36, 90, 529
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich VII, 8, 10,
25–26, 29, 37, 50–52, 55, 60, 76, 89,
91, 98, 101, 104–105, 110, 122, 131–132,
134, 145, 150, 233–234, 239, 256, 296–
298, 331, 380, 400, 440–441, 455, 523–
524, 526, 528, 529–530, 532–534, 537,
540,
Heidegger, Martin 7–8, 10–13, 17, 19, 26, 95,
131, 164, 176, 178, 237, 525, 527, 529–530,
533, 536, 540, 543, 551
Heraklites 145, 176, 396, 533, 540
Herder, Johann Gottfried 25, 36, 41, 90–91, 127,
530
Jesus Christus 21, 69, 147, 150, 169, 178, 226,
231, 259, 263–266, 270–271, 280, 282,
284–288, 311, 321, 325–326, 336–337, 351,
353, 361, 364–367, 371, 373, 387–391,
393–397, 400, 410, 418–420, 423, 425,
427, 433, 435, 447, 449–450, 456, 459–
461, 465, 471–472, 477, 483–491, 493–
497, 500–501, 504, 508, 534, 537, 541,
543
Kant, Immanuel VII–XI, 1, 3–8, 10, 16–17, 20,
22, 24–26, 27–129, 131–139, 141–146, 148,
150–158, 160, 165, 167, 169–170, 174–175,
177–178, 181–182, 184–185, 190, 192, 194,
207, 215, 217, 219–223, 225, 232–236,
238–240, 242, 244–245, 247–254, 256–
261, 264–268, 270–278, 281, 283–284,
287, 292, 295–296, 298–299, 302, 304,
307, 321, 323–324, 331–332, 335, 337,
343–344, 347–350, 352, 354–359, 361,
373–376, 384, 391, 394, 401–402, 410,
416, 419–422, 426, 429, 431, 433, 437–
456, 475, 477, 488, 492–493, 495–495,
498–499, 503–504, 508, 513–521, 523–550
Luther, Martin 40–41, 100, 146–152, 154–157,
162, 169, 172, 219, 369, 443, 455 472, 484,
492, 527, 530–531, 534, 538
554
Namensregister
Müller-Lauter, Wolfgang XI, 8–13, 17, 19, 21–22,
96, 99, 141, 155, 162–164, 168, 172, 175–
177, 183, 510, 530, 533, 535–536, 541
Nietzsche, Friedrich VII–XII, 3–5, 7–26, 28–29,
33–34, 36–38, 41–43, 47, 60,72, 75, 79,
81, 84, 89–225, 228, 230, 233, 235–236,
238, 240, 247, 249, 257, 285, 296, 300,
302–304, 309–312, 314–317, 322, 329–
332, 336–337, 339, 349, 353, 355, 357–
358, 362, 368–371, 385–386, 388, 391–
393, 395–397, 400–401, 410, 421–422,
425, 429–430, 433, 435, 437–516, 518–
551
Pascal, Blaise 143, 155, 235, 507
Platon 10, 90, 92, 97–98, 114, 142, 153, 192,
193, 200–206, 208–210, 212–213, 215,
217–218, 223, 234, 256, 297, 309,
311–312, 314–315, 327, 331, 359, 440, 453,
497, 525, 530, 534, 537–538, 543
– Platoniker, Platonismus 10, 114, 137, 162,
205, 223
Puschkin, Alexander 135, 333, 337–338, 402,
426–428, 436, 447, 456, 537, 547–548
Rousseau, Jean-Jacques 63, 232, 234–235, 283,
287, 549
Saint-Simon, Henri de 330, 354, 359
Salomé, Lou von (Lou Andreas-Salomé) 187,
446, 456, 489, 538
Schestow, Lew 162, 228, 230, 232, 441, 443–
444, 448–451, 538, 549, 551
Schiller, Friedrich 25, 31, 42–43, 67, 72,
90–91, 290, 296, 302, 330, 337, 458, 524,
526, 529, 537–538, 542
Schopenhauer, Arthur 4, 12–13, 25, 30, 61, 78,
90–93, 95–96, 104–105, 107, 113, 131,
192–194, 233–237, 244, 248, 256, 260,
270, 273, 275, 281, 289–290, 292, 296,
298, 314–315, 321–322, 324, 331, 337,
349, 356, 439, 441, 454–456, 458, 476,
503, 507, 525, 527–528, 531, 535, 538–539
Seume, Johann Gottfried 502, 539
Simon, Josef 10, 17, 20, 23, 27–28, 34–36, 43,
49–50, 53, 57, 60, 62, 66, 69, 78, 82, 96–
98, 107, 117, 122, 131, 153, 155, 182, 217,
281, 292, 526, 528, 532, 535–536, 539–540
Solowjew, Wladimir 230, 232, 270, 371, 391,
395, 440–441, 443–444, 448, 450, 526,
547, 549
Sokrates 3–4, 145, 190–193, 196–197,
200–210, 212, 215, 218, 225, 236, 244, 260,
270, 278, 287, 311–312, 321, 323–324, 330,
359, 396, 419, 449, 451, 480, 504, 509,
514–515, 517, 521
– Sokratismus 196, 200–201, 206, 208, 312,
447
Sophokles 196–197, 200, 204
Spinoza, Baruch 4, 25, 35, 134, 144, 175, 232,
234–236, 239, 256, 259–260, 268, 271,
273, 278–279, 288–290, 323–324, 331,
514, 538, 540
Stegmaier, Werner VII, 1, 7–9, 11, 13, 16–17, 19,
29, 32, 45, 47–48, 60, 81, 83–84, 89, 97,
101, 104, 109, 119, 122, 127, 131, 133–134,
145, 157, 159, 176, 180, 182–183, 189, 201,
212, 393, 422–423, 466, 483, 494, 498,
500, 536, 538, 540–541
Tolstoi, Lew Nikolajewitsch VIII–IX, XII, 3–5, 7,
22, 24–26, 50, 107, 124, 157, 225–332,
334–339, 341–342, 347–348, 352, 361,
365–366, 373, 379–380, 386, 388, 393–
395, 402, 410, 416, 419–420, 425–426,
430–431, 442, 445–447, 450–455, 460–
461, 463, 466, 472, 474, 482–492, 494–
496, 498–499, 501, 504, 508, 514, 516–
518, 520–521, 523, 526, 532–533, 537–539,
541–542, 544–551
Tongeren, Paul van 9, 15, 118, 158, 162–168,
172, 174–176, 183, 199, 466, 471, 542
Wagner, Richard XII, 104, 129, 131, 193, 214,
295–296, 310, 318, 327, 334, 459–461,
464, 474, 505, 540
Zarathustra 17, 145, 170, 201, 391, 398, 410,
433, 473, 488, 497, 508, 522, 525, 540, 543
Begriffsregister
Antichrist, antichristlich XI, 3, 5, 26, 63, 103,
106–107, 124, 162, 195, 361–362, 388,
447, 455, 459–461, 463–468, 470–481,
483–492, 494–501, 504, 519–520, 532,
537–540, 541, 543
ästhetisch, ästhetische 6, 29–32, 34, 36, 38, 43,
57, 62–65, 67–74, 76–88, 91, 108, 122, 125,
158, 175, 188–191, 193, 196, 198–201, 206,
208, 210, 213, 217, 219, 226, 248, 267, 292,
296–299, 302, 312, 314, 317, 331, 334, 336,
351, 354, 411, 414, 416–418, 424, 432–433,
441, 447, 452–454, 474, 514–515, 524–529,
532–533, 535–537, 542–544
– ästhetische Idee 29, 70–72, 75–77, 80, 87,
298, 307, 335–336, 404, 409, 415, 423,
425, 428, 453
– ästhetisches Ideal 71, 81, 87–88, 514
– ästhetisches Urteil, ästhetische Urteilskraft 6,
29–32, 34, 72–74, 76, 78–83, 88, 93, 245,
524, 527, 529–530, 533, 537, 540
Aufklärung IX, 3, 33, 44, 47–48, 91, 93–94,
96–103, 106, 112–113, 115–117, 119–120,
122–123, 129, 134, 138, 155, 159, 161–162,
175, 214, 220, 222, 232, 235, 250, 286, 355,
438, 441, 494, 500, 510, 513, 516, 524–525,
528, 530–534, 537–539, 541, 543–544
Christentum 10–11, 21, 41, 63, 101, 129, 145–
146, 149, 154, 156–157, 159, 162, 169, 177,
185, 217, 220, 229, 231–232, 256, 263, 265,
268, 285–286, 288, 294, 313, 316, 326,
353, 361–362, 365, 368, 395, 425, 440,
447–451, 455, 457, 460–461, 464–467,
469–473, 475–477, 479–492, 494–495,
497, 504, 506, 508, 517, 520–521, 524,
528, 531
christlich IX, 3–4, 6, 11, 14, 21, 25, 41, 69, 106,
108, 129, 139, 143, 145–160, 162, 169–170,
177–178, 181, 195, 217, 219–221, 223, 229–
232, 262, 265–266, 274, 280–281, 285–
286, 288–291, 312, 316, 325–326, 361,
393, 401, 424–425, 427, 449, 460–461,
477–480, 482, 484–486, 492, 495, 498,
504, 507, 509, 511, 513, 515, 521, 524, 542
Chinese, chinesisch, Chinesentum 110–112,
114–115, 124, 212, 235, 397, 508, 531
Bedürfnis 2, 46, 130, 159, 167–168, 173–174,
179–181, 189, 239–240, 247, 250–252,
255, 257–258, 319, 347, 354–356, 360,
362, 449, 467, 515
das Böse X, 34, 39–43, 45, 47–48, 52–53, 58–
59, 61, 63, 110, 138–139, 212, 258, 261–262,
264–265, 270–274, 276–277, 279–280,
282–283, 285–287, 290, 301, 303, 306,
308–309, 313, 318–320, 322–327, 348,
350, 354, 363, 372, 384, 386–387, 391–392,
394–395, 398, 400–401, 411, 415–418,
421–424, 429–431, 433–435, 443, 460,
483, 489, 496, 504, 509, 517–518, 533, 539
boshaft 155, 166, 172, 187, 383, 398
Bosheit X, 148–149, 308, 385, 389, 443, 456–
457, 499, 501–504, 509–510, 512, 519–521,
537
Décadence, décadent 124, 313, 463, 474–476,
478, 486, 489, 491–492, 495–496, 506
Dialog 2–3, 5, 7, 25–26, 92, 192, 197, 200,
204–206, 208, 235, 337, 426, 453, 490,
513, 537
Dichter 8, 71, 81, 99, 188, 195, 197, 199–204,
206, 211, 213–214, 228, 311, 331, 333, 353,
402–403, 426, 428, 432, 435, 438–439,
447, 449, 452, 456, 497, 502, 504, 508,
510, 512, 518–519, 521–522, 532, 536
Dichtung, Erdichtung 69, 71, 213–214, 218, 369,
493, 497
different, Differenz, Differenzierung 2–5, 7, 13,
18–19, 21–22, 26, 29–31, 34, 37, 39, 41, 49,
53, 55–57, 64, 76, 83, 85, 92–93, 96, 136,
145, 150, 156, 159, 194, 236, 242, 267, 310,
312, 347, 373–374, 380, 431, 437, 443,
453, 456, 477, 482, 493, 499, 501, 504,
506–507, 511, 513, 517, 528
Distanz, Distanzierung 22–24, 52, 83, 93, 95,
98, 132, 166, 182–183, 193–194, 205, 210,
213, 283, 315, 378, 381, 406, 423, 441, 445,
449, 477, 493–494, 499, 509–511, 513,
518–522
Christ, das Christ-Sein 230, 231–232, 272, 274,
451, 460, 474, 476, 483, 488, 492, 507–508
Egoismus, Egoist, egoistisch IX, 10, 21, 44, 65,
86, 111, 160, 167–173, 176–177, 220,
556
Begriffsregister
257–258, 262, 344, 349, 354–355, 359,
376, 414, 417, 446, 461
Ehrlichkeit s. Wahrhaftigkeit
Erhöhung, Selbst-Erhöhung 168, 173–174,
176–177, 181, 220–221, 449, 500, 510, 512,
521–522
Erlösung X, 146, 148–156, 172, 217, 219, 221–
222, 230–231, 246, 270, 273, 278, 323,
348, 361, 364, 368, 380, 385, 392, 400,
402–404, 413, 418, 434, 451, 460, 469,
471, 484–485, 496, 503, 506, 512, 514–517
ewige Wiederkehr (Wiederkunft) 7, 8, 13–14,
16–18, 21, 102, 134, 163, 175, 178, 221, 370,
430, 523, 534, 537
fantastisch (phantastisch), das Fantastische X,
206, 284, 297, 349–350, 252, 359–360,
362, 373, 402, 404–405, 407–411, 422–
423, 425–429, 433–435, 460, 462, 464,
481, 488, 507, 509, 517–518
Fatalismus, fatalistisch 275, 456, 499–501,
504–506, 519, 521, 537
Fatum 275–276, 385–387, 390–392, 473
– amor fati 396, 451, 501, 521, 536
Gegen-Begriff 28, 131, 140, 143, 166, 185, 220,
282, 320, 480, 483, 491, 501, 516, 519
Genealogie, genealogisch 91, 123, 132–134,
142, 144, 146, 158, 161, 166, 171–172, 188,
190, 220, 289, 355, 398, 502, 519, 525, 540,
543
Genie 75–76, 78–81, 83, 87, 99, 131, 229, 272,
295, 302–304, 310, 337–338, 359–360,
402, 422, 426, 458, 475, 479, 487, 494,
496, 502, 504–505, 509, 514, 520, 528
Geschmack, Geschmacksurteil, geschmacklos
IX, 21, 24, 29, 32–34, 37, 72–74, 76, 78–
82, 84, 87, 102, 160–161, 164, 167, 172,
183–188, 192, 204, 214–218, 220–222,
240, 296–299, 301–303, 316–318, 327,
334, 416, 420, 465, 474, 500, 507, 516,
518, 527, 533, 543
Gewissen IX, 9, 11, 57–63, 66–68, 85, 108, 116,
124, 146, 148, 150–152, 154–161, 164, 171,
174, 177, 187, 212–213, 215–217, 219–220,
267, 332, 343, 347, 363–364, 373, 375–
377, 379–380, 383–384, 394, 420, 430,
432, 440, 444, 468, 475, 506, 514–515,
520, 531–532, 534–535
Glaube IX, 14, 16, 19–20, 22, 35–36, 41, 69, 99,
114, 117, 123–124, 141–143, 145–157, 159–
161, 163, 168, 170–174, 176, 178–181, 183,
206–207, 212–213, 216–221, 223, 227, 230,
233, 246, 249–252, 263, 270–271, 281–
282, 284–288, 292, 303, 313, 315, 322,
324, 326–327, 332, 335, 341–344, 348–
350, 368, 372, 375, 389, 396, 403, 413,
417, 419–420, 423, 425, 435, 442–443,
460, 468, 477–479, 483–484, 492, 494,
497, 509, 539, 542, 546
– Vernunftglaube X, 46, 56, 153, 244, 250, 253,
281
Glaubensbekenntnis (profession de foi) 251,
292, 403, 413, 419, 495, 497, 509
Gott, Gottheit, göttlich, deus X, 1, 13, 26, 42–
43, 56–57, 61, 64, 67–69, 85, 103, 114–
115, 146–150, 152–157, 160, 169–170, 174–
175, 178–179, 181, 183, 190, 195, 196–198,
203, 205, 207, 214, 221, 230–231, 234,
242, 245–247, 250–251, 254–255, 258,
261–262, 264–266, 270, 272, 275–277,
279–285, 287–294, 297, 301, 303, 317,
321–325, 335, 339, 342, 344–353, 357,
363–364, 366, 368–372, 383, 386, 394–
395, 397–400, 406, 409–411, 414–415,
418–420, 423–427, 431–434, 440, 445,
449–453, 460–463, 467, 469, 472, 475,
479–481, 484–485, 488, 492–500, 503,
508–509, 511–512, 516, 520–521, 531, 534,
537
– Tod Gottes 8, 11, 14, 16, 155, 162, 368–371,
425, 447–448, 524, 527, 530
Grenze VIII, 22, 24, 32–33, 36, 44–47, 60, 86,
89, 92, 96–97, 106, 121–122, 126, 128, 142,
151, 154–156, 158, 160, 166, 168, 181, 186,
188–190, 198–200, 204, 207, 211–216,
227, 246, 248, 252–253, 256–257, 276,
280–281, 290–291, 294, 299, 304, 309,
316, 324, 327, 361, 371, 376, 378, 384–
385, 394–395, 401, 405–406, 408, 410,
424, 429–430, 441, 453, 497, 516–517, 519,
541, 543
– Grenzziehung 33, 199–200, 315, 452–453
– Entgrenzung 199, 396, 424, 510, 537
Größe 49, 101, 103, 109–110, 140–141, 144, 162,
172, 176, 310, 426, 449, 461–462
Herden-Moral s. Sklaven-Moral
Begriffsregister
Idiot, Idiotie, Idiotismus 60, 124–125, 182–183,
390–392, 409–411, 433, 439, 456, 459,
475, 477–478, 481, 487–489, 491, 493–
497, 500–501, 504, 508, 520, 526, 541, 548
Illusion 13, 16, 183, 189, 191, 193–194, 199,
203–204, 206, 208, 213–216, 218, 223,
247, 249, 257, 262, 274, 276, 290–291,
296, 300, 304, 309, 314, 315, 320–322,
324, 327, 362, 406, 410, 434–435, 467,
469, 487, 491–493, 511, 513, 517–519, 521–
522
Kanon 79–80, 87, 118, 184, 233, 299, 301–303,
313, 316–318, 321, 327, 405–406
Kasuistik (Casuistik) 52–53, 55, 58, 61–64, 66,
68, 85, 377
Kreis s. Zirkel
Kunstwerk 38, 75–81, 84, 87, 190–191, 195,
197, 199, 210–211, 214, 218, 223–224, 227,
295, 299, 301–304, 311, 313, 315–316, 320,
327, 335, 338, 402, 421, 434, 452–454,
493, 499, 514, 524
Künstler IX, 25–26, 76–77, 81, 83–84, 87–88,
99, 118, 173, 186–190, 192, 195–196, 199–
200, 202, 204–205, 207–215, 218, 222–
228, 236, 241, 274, 283, 295, 299, 302–
305, 311–313, 315, 317, 319–321, 325, 327–
328, 333–336, 338–339, 347, 373, 388,
392, 402, 404–405, 414, 417–418, 421–
428, 430, 432–436, 438, 447, 450, 453–
454, 457, 461, 463–464, 480, 491, 493,
496–497, 500–501, 506–514, 516–522,
526, 528, 549
Legitimation 3, 32, 46, 72, 90, 99, 116, 118–119,
124–125, 129, 132, 135, 138, 141, 160, 183–
184, 186, 495
Liebe 18, 21, 23, 62–69, 71, 74–75, 83, 85–86,
88, 157, 169–170, 175, 177, 181, 184, 186,
213, 215, 218, 221, 238, 265, 269–270, 279,
288–291, 293–294, 306, 316–318, 320–
321, 323–324, 326, 337, 340–344, 348–
353, 363–368, 370–371, 374, 391–392,
397–401, 411–414, 417–421, 423–425, 427,
431–435, 441, 449, 457, 461–462, 466–
467, 507, 514, 518, 521, 546
Lüge 37, 50–51, 55, 59, 66, 110–112, 114–115,
131, 146, 153, 187, 191, 195, 204, 206, 212–
214, 262, 266, 285, 307–308, 390, 403,
557
416, 421, 429, 460, 464–465, 467, 469,
471, 479, 487, 491, 502, 508, 531
Maske, maskiert 158, 196, 200–201, 204–205,
212–213, 215, 416, 439, 450, 497, 500, 532,
545
Metapher IX, 11, 90, 97–98, 101–102, 110–111,
123, 125–129, 131, 137, 143, 207, 241, 270,
344–346, 391, 456, 458, 463–464, 479,
501, 503, 512, 527, 545
Metaphysik, metaphysisch 6, 10–13, 16–20,
27–28, 30–31, 36, 42, 55, 67, 79, 88, 90–
91, 96–97, 104, 114–116, 118–120, 125–126,
150–151, 153, 176–177, 179–180, 188–190,
192–193, 195, 198, 207, 210, 212, 215, 232,
245–249, 257, 280, 288, 293, 297, 300–
301, 310, 314, 337, 370–371, 434, 438,
440–442, 449–450, 460, 467–468, 524–
525, 527–528, 530–531, 536, 539, 543–546
Musik 29, 189, 192–193, 196, 211–216, 226,
296, 306, 310–311, 316, 453, 456, 458, 461,
464, 480, 493, 499, 502–504, 511–512, 527
– Musik des Lebens, Musik des Vergessens 211–216, 218, 222, 224, 311, 316,
492–494, 499, 503, 518, 520, 541
Nihilismus, Nihilist, nihilistisch 9–10, 12–13,
16, 19, 42, 89, 136, 145, 151–152, 154, 160,
165, 181, 217, 220, 222, 233, 251, 286, 305,
324, 332, 337, 362, 417, 426, 435, 446,
449, 451–452, 455–456, 461–462, 464,
474, 477, 486, 503–504, 519, 521, 523, 526,
533, 535–537, 539, 541, 543
Nutzen, Nützlichkeit, Eigennutz 15, 63, 100, 130,
166–170, 172, 174, 177, 181, 184–185, 202–
204, 207, 220–221, 242, 247, 249, 263,
266, 281, 299–300, 301, 306, 348, 354–
356, 358–359, 375- 376, 382, 387, 392,
402, 421, 468–469
Orientierung VIII, 1–2, 9, 29, 45, 47, 50–51, 60,
72, 78, 83, 85, 97, 127, 131, 151, 183, 250,
422, 541
orthodox, Orthodoxie 169, 227, 332, 335, 337,
361, 441, 484–485, 490
paradox, Paradoxie, Paradoxon IX, 1, 6–8, 14,
18–19, 24, 38, 40–42, 44–48, 51–52, 65,
70, 75–76, 79, 81–82, 84–85, 87–88, 111,
558
Begriffsregister
119, 127, 129–130, 138–139, 142, 144–145,
147–148, 150, 157–158, 160–161, 177–178,
180–182, 184, 188, 209, 212, 214, 216,
220–223, 227–228, 230, 232, 240, 248,
252, 254, 261–263, 271, 281, 283, 286–
288, 290–291, 293, 296, 300, 309, 312,
314, 317, 320, 323, 326, 351–352, 355–357,
360, 363, 370, 385, 389, 393, 422, 433,
443, 450, 457, 473, 479, 493–496, 499,
502, 508, 511, 513–515, 517–520, 533–535,
540–541
Pathos 10, 136, 166, 171, 178, 180–181, 189,
192, 199–200, 204, 208–209, 211, 214,
263, 282, 312, 315, 318–319, 322, 355, 359,
425–426, 435, 448–452, 463, 466, 474–
475, 477, 479–480, 483, 486, 500, 510
– Pathos der Distanz 166, 510–511, 520, 522
Perspektivismus, perspektivisch 8–10, 13, 20,
36, 84, 89, 94–95, 104, 110, 119, 124, 140–
141, 155, 158, 161, 175, 177, 182, 219–220,
222, 236, 241, 259, 264, 267, 271–273,
282, 320, 325, 410, 425, 430, 469, 503,
516, 519, 532
Plausibilität, das Plausible, plausibel III, IX, 1–
7, 11, 15, 20–26, 31, 34, 37–38, 44–45, 52,
61, 76, 85, 89–92, 94, 96, 98, 103, 121,
123–125, 127, 130, 132–133, 137, 139, 142–
143, 145, 149, 155–156, 159–162, 166, 169,
175, 178–184, 186–191, 204, 206, 210,
216–223, 233, 236, 241, 247, 256, 258,
260, 267, 271, 274, 286, 290, 293–294,
301, 310, 317, 322–323, 326, 330, 339,
344, 354, 385–386, 392, 394–395, 398,
400–401, 416, 424–425, 428–432, 435–
437, 455–456, 461, 468–469, 474, 491,
497, 508, 511–520
Praktik 163, 483–484, 486, 488, 493–494,
496, 498, 500–501, 504, 519–521
Realität 1, 13–16, 18–20, 27, 69–70, 73, 75–76,
136, 204, 274, 347, 402, 405, 409, 421,
429, 434, 467–469, 475, 478–479, 481–
483, 485, 487–489, 491–494, 496–497,
499–500, 503, 508, 510, 512, 516, 518–521,
537
Realismus 18, 405, 507–508, 510, 521, 544
Realist 507–508, 512
– Anti-Realist 486, 492, 512
Redlichkeit s. Wahrhaftigkeit
Ressentiment 129, 161, 337, 457, 476, 486–
487, 493–494, 499–501, 506, 518–519,
521, 525
Russland, Russe VII, X, 4, 7, 26, 91, 225, 227–
229, 231, 233–234, 237, 262, 286, 329,
333, 337–338, 344, 347, 390, 397, 403,
425–428, 435–437, 439–441, 444–452,
454, 456, 459, 463, 470, 482, 490, 496,
499, 501–505, 517, 519, 521, 525, 527–529,
533, 535, 537, 544, 546, 548–550
Schauspiel, Schauspieler IX, 183, 187, 195, 197,
199–200, 204, 209–214, 216, 304–309,
314–315, 327, 407–409, 414, 464, 469,
475, 479–480, 483, 491, 497–499, 519
Schiff, Schifffahrt IX, 125–128, 136–137, 206,
212, 531
schön, das Schöne, Schönheit IX-X, 29–31, 33,
37, 43, 63, 69, 71–84, 87–88, 91, 95, 100,
178, 184, 189–191, 196, 215, 294–295,
297–300, 302, 310, 329, 335, 338–339,
355, 388, 390–391, 398, 402–412, 414–
421, 423–425, 428, 432–435, 452, 457–
458, 462, 469–470, 488, 496, 504, 509,
514–515, 517–518, 520, 524, 527–528, 530,
537–539, 543
Selbstaufhebung IX, 19, 132, 138, 144–146, 149,
152, 154–155, 157, 159–161, 164–165, 220,
286, 362, 368, 370, 372, 396, 440, 479,
482, 486, 515, 519, 521, 544
selbstbezüglich, Selbstbezüglichkeit 20, 47, 58,
89–90, 119, 131, 148, 161, 541
Selbstlegitimation s. Legitimation
selbstlos, Selbstlosigkeit 109, 130, 167–170,
172, 176, 178, 184, 220, 298, 376, 466, 478
Selbstüberwindung 11, 16, 141–146, 159–161,
173–177, 179–183, 186–187, 209, 216–218,
220–222, 396, 429, 435, 450, 475, 500,
510, 512, 515, 519–521
Semiotik (Zeichenrede, Zeichensprache) 158,
166, 185, 192, 201, 205, 213–214, 218, 422,
434, 481, 483, 485, 487, 491–493, 497, 527
Sinn des Lebens IX, 234, 236, 240–241, 246,
251, 253–254, 264, 270–271, 275, 278,
281–284, 287, 289, 293–294, 299–300,
308–309, 313, 317, 320–321, 328, 342, 420
Sklave, sklavisch 62, 101, 110, 171, 181, 275,
277–278, 360, 368–369, 384, 386, 462,
490, 499, 510
Begriffsregister
– Sklavenmoral (Herdenmoral) 10, 166, 171,
392, 396, 449, 507
Symbol, symbolisch IX, 17, 69, 74–76, 77, 79,
83–84, 87, 95, 105, 152, 208–209, 281,
298, 348, 402, 415–416, 418, 434, 439,
447, 449, 452, 481–483, 487, 493, 512,
514, 518, 523, 525–527, 529, 537, 543, 545
Tautologie, tautologisch IX, 38, 47, 84–85, 88,
90, 111, 118–121, 123, 125, 129–130, 135,
138, 207, 219–220, 244, 251, 263–264, 271,
293, 495, 534
Täuschung 95, 114, 187, 204, 213–216, 238,
246, 279, 319, 396, 467, 479, 493
Theater, theatralisch X, 189, 211, 214, 226, 301,
304–317, 330, 406–410, 461, 464, 509,
548–549
– Theatromanie 336–337, 462, 464, 509
tragisch, das Tragische VIII, 18, 24, 105, 143,
160, 189, 193, 196–197, 199–201, 203,
208–210, 215–218, 222–224, 304, 330,
334, 337, 409–410, 429, 435, 449, 451,
459, 464, 475, 492, 494, 496–498, 503,
509, 516, 519–520, 528, 533, 538
Tragödie 136–137, 143–144, 150, 155, 160, 191–
192, 194, 196–203, 206, 208, 214–215, 218,
223, 227, 230, 303–304, 310–311, 313, 316,
347, 405, 407, 409, 451, 453–454, 464,
475, 498, 509, 516, 523–525, 528, 543,
549, 551
Typus Jesus, Typus des Erlösers X, 26, 124, 169,
388, 397, 424, 460, 465, 471, 483, 486–
489, 491–497, 500–501, 505, 519–521
Typus ‚Mensch‘ 173, 181, 220, 474, 506, 510,
521
Umgang 6, 9, 11, 20–21, 24–25, 88, 117, 151,
182–183, 191, 199, 210, 212, 219, 223, 262,
336, 339, 397, 468, 512–514, 516–518, 520,
541
Umwertung 3, 26, 132, 137, 144, 155, 161, 163,
170, 172, 185–186, 188, 209–210, 222, 429,
449–451, 455, 461, 465–466, 476, 480–
481, 492, 494, 499, 502–505, 513, 516, 519,
528, 539
Urteilskraft IX, 24, 28–30, 33–34, 36–38, 47–
53, 55–63, 65–74, 76, 78–81, 83–85, 87–
88, 108, 124, 153–155, 245, 268, 376, 514,
523–524, 527–538, 540, 543
559
Ungewisse, Ungewissheit 1, 13–15, 51, 65, 129,
150–151, 155–156, 160, 183, 209–210, 216,
218, 221–223, 242, 310, 394, 516
Übermensch 8, 10, 17–18, 21, 163, 183, 296,
302, 368, 370–371, 447–448, 450, 469,
536, 549
Vermögen IX, 3, 24, 27–29, 31, 34, 37, 46–48,
50–51, 61, 64, 70–71, 74–75, 79, 82–85,
89, 97, 108, 115–124, 138, 141, 143, 147–
148, 153–154, 183, 219, 222, 235, 241, 249,
252, 257, 267, 298, 385, 440, 444, 514, 534
– Unvermögen 85, 125, 150, 152, 175, 181, 218,
220, 233, 409, 495
Vision 194, 198, 200, 211, 347, 367, 369–370,
372, 384, 398–399, 403, 425, 427–429,
431, 435, 463, 480–481
vornehm, Vornehmheit IX, 21, 29, 43, 109, 153,
160, 165–168, 170–177, 179, 181, 183, 185,
204, 207, 216, 220–221, 372, 396, 449,
510, 516
Wahrhaftigkeit (Redlichkeit, Ehrlichkeit) 51, 110,
112, 114–116, 145, 149–150, 152, 154–155,
157–159, 161, 177, 214–217, 220, 266, 307,
319, 379, 410, 440, 462, 479, 508, 519
Wert, Werte IX, 3, 11–12, 19, 21, 26, 31, 45, 65,
67, 88, 90, 94–95, 104, 107, 110, 114–115,
129–132, 135–138, 142, 144–145, 149, 155,
158, 160–161, 165–166, 168, 170–177, 179–
182, 185, 188–190, 209–210, 216, 219–221,
223, 238, 261–262, 279, 296, 309, 316–
317, 334, 346, 350, 352, 364, 375, 381,
402, 429, 446, 449–451, 455, 461, 464–
465, 467, 469–470, 476–479, 487, 490,
492 510–511, 513–514, 516, 519, 521
Wille zur Macht 7–8, 11–18, 118, 162–164, 176–
177, 179, 194, 439, 446–447, 463, 473,
477, 494–495, 523, 525, 528–530, 535–536
Wille zur Wahrheit 3, 7, 19–20, 110, 117, 119,
135, 137, 149, 151, 155, 160–161, 183–184,
204, 207, 215–216, 429, 468, 479
Willensfreiheit, Freiheit des Willens 29, 120,
147–148, 156, 243, 273–277, 443–444
Willkür, willkürlich X, 25, 28, 39–42, 48, 53–54,
67–68, 76, 81–83, 87, 95, 117–118, 148,
182–183, 201, 273, 275–277, 300, 352,
356–357, 362–364, 371–373, 387, 424,
430, 434, 443, 471, 480, 532–533
560
Begriffsregister
Wirklichkeit X, 12–13, 18–19, 35, 43, 52, 63, 80,
94, 104, 150, 164, 175, 178, 204, 257, 290,
305, 373, 380, 387, 404–406, 408–411,
421–423, 425–42, 428, 433–434, 467,
469, 471, 478–481, 483, 487–488, 507–
508, 517–518, 520
Wüchbarkeit 175–178, 180, 182–183, 190,
221, 267, 271, 322, 357, 396, 401, 474,
478–479, 481, 491–495, 500, 503, 511,
515–518, 520–521
Zirkel (Kreis) IX, 3, 13, 16, 19, 46–47, 55, 84–85,
90, 116, 119–121, 125, 129–130, 136, 138–
139, 150, 160, 181, 207–208, 219–220,
269, 318, 396, 439, 495, 524, 545
Zuschauer 190, 197–199, 203–205, 209, 211,
213, 304–306, 309–311, 313–315, 317, 327,
406, 408–409, 414, 418, 433, 475, 478,
480, 486, 488, 498–499, 520542