Автор: Buchter H.
Теги: religion geschichte politik campus verlag verschwörungstheorien finanzen geheime geschichte
ISBN: 978-3-593-50458-2
Текст
Heike Buchter
Black
Rock
Eine heimliche Weltmacht
greift nach unserem Geld
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Mächtig wie kein anderes Unternehmen, doch viel zu
vielen unbekannt.
Noch nie hat es ein Imperium wie BlackRock gegeben.
Mehr als vier Billionen Dollar verwaltet der amerikanische
Vermögensverwalter. Keine Bank, kein Fonds hat
annähernd so viel Einfluss. BlackRock investiert, analysiert
und berät Großinvestoren, Finanzministerien,
Notenbanken. Längst hält die »Schattenbank«, die
unterhalb des Radars nationaler und internationaler
Bankenaufsichtsbehörden agiert, relevante Anteile der
wichtigsten Unternehmen wie Allianz, BASF, Adidas oder
der Deutschen Bank.
Gründer und Chef von BlackRock, Larry Fink, spinnt
unsichtbare Fäden in der globalen Wirtschaft, aber auch
hier, direkt vor unserer Haustür. Eine falsche Bewegung,
und die Finanzwelt könnte ins Wanken geraten. Es ist
höchste Zeit, BlackRock ins Visier zu nehmen.
Vita
Heike Buchter berichtet seit
2001 von der Wall Street.
Heute ist sie New Yorker
Korrespondentin für Die Zeit.
Sie war die Erste, die ihrer
Redaktion Anfang 2007 die
Finanzkrise vorhersagte. Und
sie ist die Erste, die BlackRock
konsequent ins Licht der
Öffentlichkeit rückt.
Für Max und Jens
Vielen Dank an Ina Lockhart für ihre Mitarbeit
Inhalt
Kapitel 1
BlackRock – der mächtigste Konzern, den keiner kennt
Mit Absicht unter dem Radar
BlackRocks Macht ist nur geliehen – es ist unser Geld
Kapitel 2
Gestatten, der neue Großeigner der Deutschland AG
Stiller Teilhaber am deutschen Alltag
Dick im deutschen Wohnungsmarkt …
… und auch bei Gewerbeimmobilien dabei:
Sahnestückchen in Freising
Der unsichtbare Über-Investor: Ein Gespenst geht um
Kapitel 3
Der Mann hinter dem Koloss – ein Loser der Wall Street
Larry Finks Blitzkarriere im Reich der Bonds
CMO – die Wunderpapiere aus der Büchse der Pandora
Finks schicksalhafter Fehler und Fall
Blackstone oder: Der Anfang im Hinterzimmer
Damit kam der Fels ins Rollen: BlackRock
Acht Freunde müsst ihr sein: Das Gründungsteam
Der entscheidende Auftrag von Neutronen-Jack
Wachsen, wachsen, wachsen
Kapitel 4
Die Finanzkrise oder auch: BlackRocks größter Segen
Planet der Affen: Fink als Überlebender
Der Schattenfinanzminister
Hinein in die Zirkel der Macht
Auf die grüne Insel: BlackRocks Sprung nach Europa
Formeln nach Athen tragen
Operation Solar: brisante Rolle im Krisenherd
Zypern: Fortsetzung der griechischen Tragödie
Auf dem Zauberberg
Der Türöffner
Der Ritterschlag der EZB
Symbiose mit den Notenbankern
Kapitel 5
Schattenbanken: Die im Dunkeln sieht man nicht
Der Ketzer: Hilfe, wir haben die Banken geschrumpft!
Was wirklich geschah
Ein Run on the Bank der neuen Art
Mutter aller Schattenbanken
Der größte Dark Pool aller Zeiten
Wie akkurat sind Aktienkurse noch?
Kapitel 6
ETF: Der Schwanz wackelt bald mit dem Hund
Schöne neue Derivatewelt
Der Prinz der iShares
Wetten auf ETFs – Das »Ein-Pferd-Rennen«
Die große Bond-Blase
BlackRock in allen Winkeln des Markts
Kapitel 7
Finanzkapitalismus 2.0
Ein Geldfürst für ein neues Zeitalter
Aufstand der Manager
Wie BlackRock der neue J. P. Morgan wurde
Shareholder Value: Die andere 68er-Revolution
Keine bleibenden Werte
Kapitel 8
Wie BlackRock die Deutschland AG lenkt
Die deutsche Version des Industriekapitalismus geht zu
Ende
Im Griff der kalifornischen Sondereinheit
Informationen in der Einbahnstraße
Finanzsurrealismus: Kapitalismus ohne Kapitalisten
Kapitel 9
Aladdin – der Dschinn in der Apfelplantage
Eins werden mit der Maschine
Cyborgs beherrschen die Märkte
Die Quants: Glauben an den Markt und die Modelle
Was ein Küchenmixer und Zinsprognosen gemeinsam
haben
Wir Nutzer im Netz von Aladdin
Die Welt durch BlackRocks Brille
Kapitel 10
Machtwechsel an der Wall Street
Unsere Altersvorsorge: Der Heilige Gral der Wall Street
Monica Lewinsky: Retterin des Rentensystems
Deutschlands Riester-Renten-Experiment
Risiko? Was für ein Risiko?
Wie BlackRocks Supermom Washington gewann
Heimlicher unheimlicher Herrscher der Welt
Kapitel Epilog:
Aber Larry Fink ist noch nicht fertig
Grafiken
Register
Kapitel 1
BlackRock – der mächtigste Konzern,
den keiner kennt
Es ist ein Pflicht-Stopp auf der Liste von New-YorkTouristen: die Wall Street. Da ist der bereits heisere
Reiseleiter, der mit einem Regenschirm fuchtelt und eine
Gruppe Chinesen vor die neoklassizistische Fassade der
New Yorker Leitbörse dirigiert. Dort sammeln sich
kichernde Teenager aus dem Mittleren Westen Amerikas
um ihren genervten Lehrer. Man hört spanisch, japanisch
und deutsch. Ständig werden Handys und iPads gezückt,
Selfies gepostet. Hier, so vermuten die Besucher, hier also
ist das Zentrum unseres Finanzsystems, hier ist die
mächtigste Institution des Kapitalismus.
Sie irren.
Die mächtigste Institution unseres Finanzsystems
befindet sich sechs Kilometer weiter nördlich, fünf
Stationen mit der grünen U-Bahn-Linie. Sie verbirgt sich in
einem jener verglasten Bürotürme, wie sie längs der
Straßenschluchten in New York zu Dutzenden in den
Himmel ragen. Wer die Straße in Midtown Manhattan
entlangeilt, muss genau hinsehen, um den Namen über den
Drehtüren zu entdecken. BlackRock.
Der mächtigste Konzern der Welt.
Eine Institution, wie es sie nie zuvor gegeben hat.
BlackRock ist ein Vermögensverwalter. Aber das ist so,
als wenn man sagen würde, Versailles sei ein Sommerhaus
oder die Pyramiden ein Haufen Grabsteine. Keine
Großbank, kein Versicherer hat diese Reichweite. Goldman
Sachs, die Deutsche Bank, die Allianz – sie alle verblassen
dagegen. Keine Regierung und keine Zentralbank hat
diesen Einblick in die Wirtschaft. Aber vor allem: Niemand
beherrscht so viel Kapital. BlackRock verwaltet 4,6
Billionen Dollar in seinen Fonds. Das übersteigt das
deutsche Bruttoinlandsprodukt um fast eine Billion Dollar.
80 Millionen Deutsche müssen länger als ein Jahr lang
arbeiten, um diese Summe zu erwirtschaften. Und das ist
längst nicht alles. Über die Analyse- und
Handelsplattformen des Unternehmens fließen über 14
Billionen Dollar. Eine Zahl mit 12 Nullen. 14 000 000 000
000 Dollar (siehe Grafik 1). Damit laufen inzwischen über 5
Prozent aller Finanzwerte weltweit – Aktien, Anleihen,
Devisen, Kreditbriefe, Derivate und Zertifikate – über die
Systeme eines einzigen Unternehmens: BlackRock.
Von dem nichtssagenden Büroturm in Midtown
Manhattan spinnt BlackRock seine Fäden über den ganzen
Globus. Wie ein Krake hat der Finanzkonzern seine
Tentakeln bis fast in den letzten Winkel der Welt
ausgestreckt. In 100 Ländern sind die Amerikaner aktiv. Zu
BlackRocks Netz gehören Büros in Bogota, in Brisbane, in
Bratislava, außerdem Niederlassungen in München,
Melbourne und Montreal, in Kapstadt, Kuala Lumpur und
Kopenhagen.
BlackRocks Vertreter gehen in Finanzministerien ein und
aus. Sie beraten die Fed, die US-Notenbank, genauso wie
die Europäische Zentralbank (EZB). Zu den Kunden zählen
Kaliforniens Calpers, mit 300 Milliarden Dollar der größte
amerikanische Pensionsfonds, genauso wie die Abu Dhabi
Investment Authority, der Staatsfonds des glitzernden ÖlReichs von Dubai, und der Investmentarm von Singapur.
BlackRocks Lobbyisten kneten die Regulierer in
Washington, DC, und auch die in Brüssel. BlackRock ist
Großaktionär bei JPMorgan Chase, Citigroup und Bank of
America – den größten Banken der Welt. BlackRock ist
zudem einer der führenden Aktionäre der Öl-Giganten
ExxonMobil und Chevron. Und auch von Apple, McDonald’s
und dem Schweizer Nestlé-Konzern. Die New Yorker sind
auch längst die größten Eigentümer der Deutschland AG.
Sie halten Anteile an jedem Dax-Unternehmen. Sie sind an
Deutschlands größtem Baukonzern Hochtief genauso
beteiligt wie an dessen kleinerem Rivalen Bilfinger.
BlackRock hält Anteile am europäischen Luft- und
Raumfahrtriesen Airbus und an der Corrections
Corporation, dem führenden Betreiber privater
Gefängnisse der USA. Am Gentechnikgiganten Monsanto
hält BlackRock genauso Anteile wie an den Rüstungsriesen
Raytheon, Lockheed Martin und General Dynamics, die alle
an der Ausstattung von US-Drohnen und den
dazugehörigen Raketen beteiligt sind. (Stand: April 2015)
Die New Yorker haben sich Immobilien von Köln bis
München gesichert. Bei Kleinanlegern ist iShares, der
Anbieter der beliebten ETF-Fonds, bekannt und beliebt –
kaum einer weiß, dass auch iShares zum BlackRockImperium gehört. 2014 erreichte das in iShares angelegte
Kapital über 1 Billion Dollar. »Wir waren die Nummer eins
der Branche mit den meisten ETF-Zuflüssen in den USA,
Europa und global«, verkündete BlackRock bei der
Präsentation der Jahresbilanz. In 41 Ländern der Welt
verwaltet BlackRock Privatkundengelder von jeweils mehr
als 1 Milliarde Dollar.
Auch im Devisen- und Rohstoffgeschäft dreht BlackRock
mit am Rad. Wenn Bergleute in Brasilien Eisenerz abbauen
oder Arbeiter in Malis Goldminen schuften, dann
profitieren am Ende BlackRocks Fonds. Evy Hambro,
Spross einer einst einflussreichen britischen Bankerfamilie,
ist verantwortlich für 20 Milliarden Dollar, die in Fonds wie
dem BlackRock World Mining Fund stecken. Wenn Hambro
spricht, so berichtete einmal der Sydney Morning Herald,
hören die CEOs und Aufsichtsräte der wichtigsten
Rohstoffkonzerne der Welt nicht nur aufmerksam zu,
sondern sie handeln auch. Hambros Fonds hält große
Aktienpakete am australisch-britischen Minenbetreiber
BHP Billiton, dem Schweizer Konglomerat Glencore und
dem Goldproduzenten Randgold Ressources sowie dem
russischen MMC Norilsk Konzern, einem der größten
Produzenten von Nickel und Palladium, und Freeport
McMoRan, dem größten Kupferproduzenten der Welt. Das
sind die Big Mining Companies und Rohstoffhersteller, die
Riesen, die praktisch die gesamte Wirtschaft rund um den
Globus mit Rohmaterial und Edelmetallen versorgen. »In
einem Land, in dem große Minenbetreiber beschuldigt
werden, die Regierung zu kontrollieren, ist es interessant
zu sehen, welchen Einfluss Hambro ausübt«, heißt es in
einem Porträt des BlackRock-Fondsmanagers im Sydney
Morning Herald aus dem Jahr 2013. Und die australischen
Zeitungsmacher fragen: Wer zieht die Fäden im
Hintergrund?
Es gibt keinen größeren Konflikt auf der Welt, bei dem
nicht auch die Interessen der New Yorker betroffen sind.
Etwa Russlands Übergriff auf die Ukraine im Jahr 2014: Da
fanden sich BlackRocks Interessen plötzlich eigentümlich
auf der Linie Wladimir Putins. Zwar kritisierte Larry Fink
den starken Mann von Moskau öffentlich. So erklärte er in
einem Interview mit der Londoner Sunday Times im März
2014, Putin könne nicht derart »herumspielen«, wenn er
westliches Kapital haben wolle. Fink verwies dabei auf den
Einbruch, den die Moskauer Börse erlitt, weil ausländische
Investoren ihr Kapital abzogen. »Die Kapitalmärkte haben
Russland vernichtet«, sagte er damals. Das konnte man als
Drohung verstehen, dass auch BlackRock sich aus Putins
Russland zurückziehen würde. BlackRock blieb jedoch trotz
der Vorgänge in der Ukraine in dem Land weiter engagiert
oder war es zumindest bis Anfang 2015. Laut einer
Beschreibung für den BlackRock Emerging Europe Fund
zählten zu dessen zehn größten Investments (zum 31.
Januar 2015) unter anderem der führende russische
Energiekonzern Gazprom sowie die Nummer zwei Lukoil
und die Nummer drei der Branche, der sibirische Öl- und
Gasförderer Surgutneftegas, der enge Beziehungen zu
Putin haben soll. (Im Mai 2015 findet sich Surgutneftegas
dann nicht mehr unter den Top 10 des Fonds.) Auch auf der
Liste der Top-Investments: Die Sberbank, die zu 50 Prozent
der russischen Zentralbank gehört, und desweiteren –
zumindest bis Anfang 2015 – war Luxoft, ein Ableger des
Moskauer Software-Unternehmens IBS, im Portfolio. Der
Fonds war bis zu dem Zeitpunkt mit über 40 Prozent seines
Anlagekapitals in Russland engagiert. BlackRock gehörte
auch zu den Investmentpartnern des staatlichen Russian
Direct Investment Fund. Von BlackRock gab es zu der
Frage, ob das Unternehmen weiter bei Russian Direct
engagiert ist, keine Antwort.
Fest steht: Es gibt kaum eine wichtige Transaktion in der
Wirtschaft, bei der die New Yorker Herren des Geldes nicht
zumindest informiert sind.
Mit Absicht unter dem Radar
Und doch kennen den Giganten nur sehr aufmerksame
Leser der Finanzseiten. Larry Fink, Gründer und CEO von
BlackRock, ist nur wenigen außerhalb der Wall Street ein
Begriff. Trotz der ungeheuren Größe und des nie
dagewesenen Einflusses haben es die New Yorker
geschafft, weitgehend unter dem öffentlichen Radar zu
bleiben. Das ist Absicht.
Während die Investmentbank Goldman Sachs sich für 2,1
Milliarden Dollar vom Stararchitekten Henry Cobb einen
Palast mit Blick auf den Hudson hinklotzen ließ und Bank of
America in einem 55 Stockwerke hohen Turm mit allen
Raffinessen moderner Technologie nahe dem Times Square
in Manhattan residiert, hat BlackRock auf einen protzigen
Repräsentationsbau verzichtet.
Wer das New Yorker Hauptquartier betritt, findet sich in
einer Einkaufspassage wieder. Dezente Klaviermusik
umfängt die Besucher. Es gibt einen Starbucks Coffeeshop
und einen Zeitungsladen, der auch Lotterielose und
Kaugummis verkauft. Der italienische Edelschneider Brioni
– Anzüge von 3 000 bis 7 000 Dollar und aufwärts – hat ein
Geschäft hier. Die Verkäuferin beim Schweizer Chocolatier
nebenan schaut verwirrt. BlackRock? Die sind im zweiten
Stock. Was das Unternehmen macht? Keine Ahnung, zuckt
sie die Schultern. »Am besten googeln Sie es!«, rät sie.
Hinweise auf BlackRocks Bedeutung finden sich auch im
zweiten Stock nicht. Hinter einem langen grauen BetonTresen fertigen zwei Empfangsleute Anzugträger ab. Selbst
die Schalterhalle der Post macht mehr her. (Im Mai 2015
befand sich die Lobby im Umbau – vielleicht war es Fink
dann doch zu bescheiden.)
Die Jungs von BlackRock haben es allerdings auch gar
nicht nötig, durch protziges Imponiergehabe zu
beeindrucken. Vor ihnen fürchtet sich die Wall Street. Denn
Larry Fink und seine Jungs können darüber entscheiden,
wer als Investmentbanker Karriere macht und wer sein
weiteres Berufsleben als Erbsenzähler irgendwo in den
Hinterzimmern der Finanzbranche fristen muss. Denn
BlackRock ist nicht nur dank der Aktienanteile, die der
Vermögensverwalter hält, Miteigentümer bei den großen
Finanzinstituten, sondern auch der Kunde Nummer eins für
die Banker. »Wenn BlackRock aus irgendeinem Grund keine
Deals mehr mit Goldman Sachs machen wollte, dann wäre
das ein Problem – für Goldman«, sagt ein Veteran der Wall
Street, der wie so viele in der Branche nur redet, wenn sein
Name nirgendwo auftaucht. Ein anderer Informant zieht
plötzlich zurück. Er habe möglicherweise ein Angebot, bei
BlackRock anzufangen. Deswegen wäre es ihm gar nicht
recht, öffentlich über deren Geschäftsgebaren zu sprechen.
Eigentlich will er gar nicht mehr über BlackRock sprechen.
Auf die Frage, was denn der in Aussicht gestellte Job bei
BlackRock sei, sagt der gestandene Banker: »Egal, was
Larry mir bietet, und wenn ich in der Cafeteria den Boden
schrubben muss.«
Bei Cocktail-Empfängen antworten Investmentbanker auf
Fragen nach BlackRock mit vielsagenden Blicken und dem
Spruch, da gäbe es viel zu erzählen, aber man wolle das
lieber nicht nach draußen tragen. Was sie nicht sagen, aber
wohl denken: Ich habe eine unbezahlte Vorstadtvilla,
Kinder auf der Privatschule, eine teure Freundin und eine
noch teurere Exfrau. Hunderte Millionen Dollar erhalten
die Banken und Brokerhäuser von BlackRock jedes Jahr.
Wer will es sich verscherzen mit so einem wichtigen
Brötchengeber?
BlackRocks Macht ist nur geliehen – es ist
unser Geld
Bei all seiner Macht ist BlackRock ein Emporkömmling. Die
Geschichte von JPMorgan Chase, der größten
amerikanischen Bank, reicht zurück auf Finanzlegende
John Pierpont Morgan und bis ins Jahr 1895. Citigroups
Vorläufer wurde 1812 gegründet und finanzierte später den
Panamakanal. Die Bank of New York Mellon, eine der
wichtigsten globalen Treuhänderbanken, kann sogar auf
Gründervater Alexander Hamilton verweisen, den ersten
Finanzminister der damals jungen Nation und Erfinder des
amerikanischen Kapitalismus. Fink hat sein Imperium
dagegen in etwas mehr als zwei Jahrzehnten
zusammengezimmert. Ein Start-up, gegründet buchstäblich
im Hinterzimmer der Private-Equity-Gesellschaft
Blackstone. Von deren Gründern Stephen Schwarzman und
Pete Peterson erhielt Larry Fink 1988 eine Kreditlinie von 5
Millionen Dollar und eine Telefonleitung – Kleingeld nach
Street-Maßstäben. Aus der Klitsche entstand BlackRock.
Ein Erfolg, der Fink selbst bei den abgebrühtesten WallStreet-Bossen den Status eines absoluten Top-Dogs gibt. Er
selbst sieht das offenbar genauso. Von der CNBCReporterin Becky Quick 2010 befragt, was sein
schlimmster Fehlgriff gewesen sei, gab Fink zur Antwort,
nach seinem Abgang bei First Boston »nicht das
Selbstvertrauen gehabt zu haben, eine eigene
Investmentfirma für Risikomanagement aufzumachen«.
Stattdessen habe er sich an Schwarzman und Peterson
gewandt. »Die glaubten mehr an mich als ich selbst. Sie
trafen die richtige Investmententscheidung, ich nicht.«
Genau, so witzelte die Wall-Street-Klatschwebseite
Dealbreaker daraufhin, Schwarzman und Peterson trafen
die richtige Entscheidung, weil sie das Genie von Fink
erkannten. Fink selbst dagegen habe den »goldenen Gott
nicht erkannt, der ihm im Spiegel entgegensah«.
Und doch: BlackRocks Macht ist eine geliehene Macht:
Sie speist sich aus unserem Geld, dem Geld von
Kleinsparern, Pensionären, den Finanzabteilungen von
Unternehmen, den Prämien von Versicherungsnehmern
und den Beiträgen privater Rentenversicherter, aus den
Spenden für wohltätige Zwecke und den Abgaben von
Steuerzahlern. OPM – damit spielt die Wall Street am
liebsten. Im Klartext: OPM oder Other People’s Money.
Dieses Geld fließt in immer größere Pools. Nicht nur
BlackRock profitiert davon. Innerhalb der nächsten fünf
Jahre, so eine Studie der Wirtschaftsprüfer von
PricewaterhouseCoopers, werden Vermögensverwalter
weltweit über 100 Billionen Dollar in ihren Konten
angesammelt haben. Das ist 25-mal so viel wie das
deutsche Bruttoinlandsprodukt (3,8 Billionen Dollar 2014
laut IWF). Geld, das vor allem aus den USA und Europa
kommen wird, aber zunehmend auch aus Asien, Afrika und
dem Mittleren Osten. Larry Fink und seine Geldeinsammler
wollen sicherstellen, dass das meiste davon in ihren
Konzern fließt. Finks erklärtes ehrgeiziges Ziel: BlackRock
soll jedes Jahr um weitere 5 Prozent wachsen. Dabei ist
sein Laden mit seinen 4 Billionen Dollar jetzt schon mit
Abstand der Branchenprimus, die Allianz mit immerhin
mehr als 2 Billionen Dollar praktisch eine abgeschlagene
Nummer zwei.
Es ist unser Geld, und doch wissen nur Eingeweihte,
wohin es fließt, was es bewegt, wen es bezahlt. Die Wall
Street, zynisch und abgebrüht wie die Jungs dort sind,
unterscheidet »smart money« und »dumb money« –
letzteres sind allzu oft die normalen Anleger. Es gibt einen
Grund, warum sich die Bezeichnungen so eingebürgert
haben. Wir geben unser Erspartes BlackRock und Co.
gegen das Versprechen von Rendite und Sicherheit. Ohne
wirklich nachzufragen, was damit geschieht. Abgeschreckt
von einem Finanzsystem, das zu kompliziert und vielleicht
auch zu langweilig erscheint, um sich als Normalbürger zu
bemühen, die Vorgänge wirklich zu verstehen. Und bei den
Machern besteht keine Veranlassung, uns zu informieren.
Und so weiß kaum jemand, was genau mit den
Geldströmen passiert. Noch brisanter ist, dass niemand
weiß, welche Risiken ein solcher Berg an Kapital birgt.
Weder Finanzexperten an den Universitäten noch
Regulierungsbeamte in ihren Amtsstuben. Politiker schon
gar nicht. Finks Argument lautet deswegen auch: Wenn
man es nicht erkennen kann, dann gibt es eben auch kein
Risiko. Doch in der Geschichte hat sich gezeigt: Die
wirklich gefährlichen Risiken sind die, die man nicht
absehen kann. Gefahren, die man sich nicht einmal
vorstellen kann. »T. B. D.« im Jargon der Risikomanager,
das steht für »There Be Dragons« – jenseits der normalen
Wahrscheinlichkeiten lauern Drachen.
Die Geschichte BlackRocks ist die Geschichte eines
Machtwechsels an der Wall Street. Es ist die Geschichte
eines brillanten Puzzle-Spielers. Es ist die Geschichte eines
Mannes, den eine Demütigung dazu treibt, den größten
Koloss der Finanzgeschichte zu bauen.
Es ist eine Geschichte, in der wir die unwissentlichen
Mitspieler waren. Bis jetzt.
Kapitel 2
Gestatten, der neue Großeigner der
Deutschland AG
Das Landschloss im Hessischen teilt das Schicksal vieler
alter Adelssitze, es ist heute, wie es so schön heißt, ein
Hotel und Tagungszentrum. In den holzgetäfelten Galerien
haben sich Gruppen von Anzugträgern zusammengefunden.
Sie nippen an Espressos und »networken«, was das Zeug
hält. Schilder weisen auf die Veranstaltungen des Tages
hin. Es geht um Themen wie »Europa, mehr als die Summe
seiner Teile« oder »Investieren im Niedrigzinsumfeld«. Im
Publikum sind in der Mehrheit Vertreter von kleineren und
mittleren Banken und Sparkassen, die aus ganz
Deutschland angereist sind. Referate von Professoren
sorgen für die nötige Gravitas. Für Fondsanbieter sind
solche Veranstaltungen das, was Verbrauchermessen für
die Verkäufer von Gemüsehobeln sind. Dort gilt es,
Werbung zu machen für sich und seine Produkte. Der
Vertreter von BlackRock ist Brite und er lässt wenig
Zweifel daran, dass er sich in der Provinz wähnt. »Als
Erstes werden Sie ja feststellen, dass ich englisch rede«,
begrüßt er einen verdatterten Teilnehmer. »Es gibt keine
sichere Rendite«, schärft der BlackRock-Vertreter seinen
Zuhörern ein. Umso wichtiger, so lässt er durchblicken,
dass man einen weltläufigen starken Partner hat.
BlackRock sei ja bekanntermaßen der größte
Vermögensverwalter. Der Mann aus London klärt die Runde
über die Überlegenheit von »Multi-Asset-Managern« auf,
Fondsmanagern, die nicht auf Aktien oder Anleihen
festgelegt sind, sondern das Geld ihrer Anleger in
verschiedene Werte stecken – je nachdem, was ihnen
attraktiv erscheint. Er selbst ist auch einer dieser
Tausendsassas der Finanzwelt. Der BlackRock-Mann ist
routiniert. Dass keine einzige Frage von den Banken- und
Sparkassenvertretern kommt, scheint ihn nicht zu stören.
Er hat eine klare Botschaft: Die Welt da draußen ist
komplex, voller Risiken. BlackRock ist groß und effizient.
Als er fertig ist, bedanken sich alle Teilnehmer artig.
Später am Abend bei Grauburgunder und SeehechtHäppchen – man ist unter sich – macht einer der deutschen
Anlageberater seinem Unmut Luft. BlackRock habe
Deutschland ja quasi übernommen. »Schauen Sie, der Dax,
der MDax – wenn BlackRock da mal aussteigt, dann pffft«,
sagt er und zeichnet mit der Hand eine steile Abwärtskurve
in die Luft. Wohin man schaue im Land, überall stecke
mittlerweile BlackRock drin.
Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit haben
Deutschlands wichtigste Unternehmen einen neuen
Großeigentümer bekommen. Längst sind die DaxUnternehmen fest in ausländischer Hand. Der Anteil der
ausländischen Investoren liegt inzwischen bei über 85
Prozent des Streubesitzes, wie der Deutsche InvestorRelations-Verband DIRK in einer Studie vom Sommer 2015
errechnete, gemeinsam mit Ipreo, einem auf
Aktionärsinformationen spezialisierten Datendienstleister.
Über ein Drittel des Streubesitzes halten dabei
nordamerikanische Fonds. Deutschen Anlegern – privaten
und institutionellen – gehören gerade noch 15 Prozent. An
sich freue man sich über das Interesse der ausländischen
Investoren an den deutschen Schwergewichten, versichert
Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut, dem
Interessenverband kapitalmarktorientierter Unternehmen,
aber er bedauert: »Der ganze Erfolg unserer DaxUnternehmen in den vergangenen Jahren ist weitgehend an
den deutschen Anlegern vorbeigegangen.«
BlackRock ist der größte Investor im Dax, dem
Aktienindex der 30 größten börsennotierten deutschen
Unternehmen. Über verschiedene Fonds sind die New
Yorker der genannten Studie zufolge mit knapp 57
Milliarden Dollar an den Dax-Unternehmen beteiligt. Damit
ist BlackRock klar die Nummer eins.
Stiller Teilhaber am deutschen Alltag
Nehmen wir einen Tag bei der Familie Normalverbraucher.
Am Frühstückstisch fragt sie ihn: »Magst du noch etwas
Jacobs Kaffee?«, und weiß vermutlich nicht, dass die
Traditionsmarke der Bremer Kaffeerösterei zu Mondelez
International gehört. Mondelez war einst als Snack- und
Genussmittelsparte Teil des US-Lebensmittelriesen Kraft
Foods (auch bei Kraft ist BlackRock einer der Top-TenAktionäre, allerdings kündigte Kraft im März 2015 an, mit
Ketchuphersteller Heinz fusionieren zu wollen). Zu den
größten institutionellen Anlegern von Mondelez gehört
BlackRock. Der Sohn nippt an seinem Nesquik, dem
Schokotrunk von Nestlé. 3,7 Prozent betrug der Anteil der
BlackRock-Fonds an dem Schweizer Konzern laut einer
Meldung im Sommer 2014 und damit ist BlackRock der
größte Einzelaktionär über der Meldegrenze von 3 Prozent.
Die Rama Margarine, die sich der Vater aufs Brot schmiert,
kommt aus dem Hause des niederländischen UnileverKonzerns, bei dem BlackRock 2013 laut einer
Reutersmeldung 3,13 Prozent gekauft hat. Die Tochter
streicht ihre mithilfe von Wellaflex frisch frisierten Haare
aus dem Gesicht und unter dem Tisch kaut die Katze an
Iam-Trockenfutter – beides Produkte von Procter &
Gamble. Auch bei dem Konsumgütermulti ist BlackRock auf
den vorderen Plätzen der Großaktionäre. Das Spielchen
lässt sich beliebig fortsetzen: Nivea-Creme und TempoTaschentücher? Am Hersteller Beiersdorf hält Aktionär
BlackRock nicht ganz 3 Prozent. Der Boss-Anzug des
Vaters? Laut einer Meldung aus dem Oktober 2014 ist
BlackRock mit knapp über 3 Prozent an den schwäbischen
Modemachern beteiligt. Der 3er-BMW, mit dem er zur
Arbeit spurtet: 3,44 Prozent BlackRock-Beteiligung an den
Bayern, so gemeldet im September 2014. Die rote Ampel,
die ihn ausbremst, ist von Siemens, auch da steckt
BlackRock mit knapp über 6 Prozent drin. Der Smart, den
seine Frau fährt, stammt aus dem Hause Daimler, auch bei
den Stuttgartern gehört BlackRock mit knapp unter 6
Prozent zu den großen Einzelaktionären. Die Fußballtreter
des Sohnes von Adidas – BlackRock ist mit 5,2 Prozent an
Bord bei den Herzogenaurachern. Sitzt der Sohn nach den
Hausaufgaben (oder statt der Hausaufgaben) vor dem
Fernseher und schaut die Simpsons oder Schlag den Raab
auf ProSieben, dann ist, zumindest als Aktionär, BlackRock
im Hintergrund dabei.
Ob Medien, Chemie, Energie, Banken oder
Versicherungen – es gibt nur wenige Branchen in
Deutschland, in denen sich BlackRocks Netz der
Beteiligungen nicht finden lässt. Mal laufen diese über
Töchter wie die BlackRock Holdco 2, mit Sitz im
amerikanischen Briefkastenfirmen-Paradies Wilmington im
Bundesstaat Delaware, oder über die BR Jersey
International Holding LP mit Sitz in St. Helier, auf der als
Steueroase bekannten Kanalinsel Jersey. BlackRock wollte
sich zu der Beteiligungsstruktur nicht äußern, aber solche
Konstrukte, von ausgebufften Steueranwälten ersonnen,
sind in der internationalen Finanzwelt gang und gäbe und
keineswegs geheim. Sie gehören inzwischen so zur
normalen Geschäftspraxis, dass BlackRocks Kunden
geradezu entsetzt wären, wenn der Vermögensverwalter
auf diese Schachtelei verzichten würde. Um die
Eigentumsverhältnisse transparenter zu machen, schreibt
die deutsche Finanzaufsicht Bafin vor, dass Großinvestoren,
deren Anteil an den Stimmrechten gewisse Schwellen
überschreitet, dieses öffentlich melden müssen. Diese
Pflichtmeldungen sind aber nur eine Momentaufnahme –
unter Insidern ist es ein offenes Geheimnis, dass Investoren
oft weit höhere Anteile halten. »Gemeldet wird zum
Beispiel das Überschreiten der Fünf-Prozent-Schwelle,
danach kann der Investor bis zu 10 Prozent noch weiter
zukaufen«, berichtet ein Fachmann eines Dienstleisters,
der solche Daten analysiert. Erst beim Überschreiten der
Zehn-Prozent-Grenze muss der Investor dieses wieder an
die Bafin melden.
Allerdings geriet BlackRock mit der Bafin wegen der
Pflichtmeldungen aneinander. Die Vorschriften sind sogar
für Profis schwierig zu verstehen. Viele Investoren, auch
namhafte, scheiterten am Stimmrechtsregime, räumt selbst
ein Bafin-Mitarbeiter ein. Jedoch sei BlackRock in
»quantitativer Hinsicht bisher ziemlich einzigartig«. Das
erklärt sicher auch, warum der Prüfungsprozess der
Behörde sich über ein Jahr hinzog und im Frühjahr 2015
mit einem Bußgeld in Höhe von 3,25 Millionen Euro endete
– die »höchste bislang verhängte Geldbuße«, wie es in der
Pressemitteilung der Bafin heißt. Im Herbst 2014 erklärte
BlackRock öffentlich, in Abstimmung mit der Bafin, die
Pflichtmeldungen bei 48 Unternehmen zu korrigieren. Aus
diesen Meldungen ergibt sich ein Schnappschuss des
BlackRock-Engagements in der deutschen Wirtschaft.
Neben den bereits genannten Unternehmen sind da
Beteiligungen an den Energieversorgern RWE und E.on, an
der Lufthansa, der Deutschen Telekom, der Deutschen
Post. An Bayer und BASF. Am niedersächsischen
Reifenhersteller Continental. Am Waldorfer SoftwareRiesen SAP. An der Deutschen Bank, der Allianz und der
Münchner Rück – dem verbliebenen Kern der deutschen
Finanzindustrie. (BlackRock war trotz mehrfacher
Anfragen nicht bereit, einen aktualisierten Stand seiner
Beteiligungen an deutschen Unternehmen zum Zeitpunkt
der Drucklegung des Buches zur Verfügung zu stellen.)
Auch im Nachbarland Schweiz ist BlackRock der
Großaktionär Nummer eins. Neben Nestlé halten die New
Yorker Anteile – meist sind es um die 3 Prozent – am
Pharmariesen Novartis, am Winterthurer Industriekonzern
Sulzer, dem Versicherer Swiss Life und den Großbanken
UBS und Credit Suisse. BlackRock sei der »schwarze Fels«
in der Brandung des Schweizer Aktienindex SMI,
formuliert es blumig die Neue Zürcher Zeitung.
Die Höhe der Anteile, die BlackRock jeweils hält,
schwankt allerdings – das kann sich täglich ändern und tut
es manchmal auch. Allein am 11. Februar 2015 etwa
meldeten gleich drei Unternehmen – Siemens, Hugo Boss
und Bayer – eine Änderung bei der Zahl der
Stimmrechtsanteile von BlackRock. In dem Fall war es bei
Siemens eine Überschreitung der Fünf-Prozent-Schwelle,
bei Bayer eine Unterschreitung. (Quelle DGAP.de) Dahinter
steckt in den seltensten Fällen eine Strategie. Denn
BlackRock agiert als Mittelsmann – als
Vermögensverwalter sammelt das Unternehmen Geld von
Anlegern ein und legt es für sie an. Bei einem kleineren Teil
entscheiden »aktive« Fondsmanager, in welche Aktien sie
das ihnen anvertraute Geld stecken wollen. Doch der
größte Teil der Anlagegelder bei BlackRock fließt in Fonds,
die Aktienindizes nachbilden, wie etwa den Dax. Ein
solcher »passiver« Dax-Fonds enthält dann
gezwungenermaßen Aktien aller 30 Unternehmen im
Deutschen Aktienindex. Es gibt in dem Fall keinen
Fondsmanager, der sich für oder gegen eine Aktie
entscheidet. Und wenn BlackRocks Kunden ihre
Fondsanteile verkaufen, dann reduzieren sich auch die DaxAktien, die BlackRock hält. Umgekehrt steigt das
BlackRock-Engagement, wenn die Anleger frisches Geld in
die Indexfonds fließen lassen. Bei den meisten großen
Aktienindexfonds, wie etwa dem Dax, bleiben die Anteile
recht stabil. Aber beispielsweise im Jahr 2014 flossen rund
15 Milliarden Dollar aus BlackRock-Dax-Fonds ab.
Trotzdem blieb BlackRock als Gruppe auch 2014 größter
Investor im Dax (siehe Grafik 2).
Dass BlackRock die Zuflüsse nicht steuern kann, heißt
jedoch nicht, dass BlackRock keinen Einfluss auf die
Unternehmen hätte. Im Gegenteil. Gerade, weil BlackRock
durch die Bindung an den Index gezwungen ist, Anteile am
Unternehmen zu halten, gehören die New Yorker zu den
langfristig engagierten Aktionären. Aktionäre, deren
Interessen der Vorstand besser berücksichtigt und die er
besser nicht gegen sich aufbringt.
Auf den ersten Blick wirken Anteile von 3 oder 5 Prozent,
die BlackRock typischerweise hält, nicht hoch. Was sind
schon 61 365 875 Stimmrechte von 1 069 837 447
stimmberechtigten Aktien insgesamt? (Das war der von
BlackRock gemeldete Anteil von 5,74 Prozent an Daimler
an jenem Bafin-Vergleichsstichtag.) Eine ganze Menge,
wenn der Großteil der anderen Aktionäre weit weniger
Stimmen auf sich vereinigen kann. Erfinden wir ein Startup, das Gummi-Entchen herstellt. Das Eigentum ist in 20
Anteilscheine aufgeteilt. Sie gehören 17 Anteilseignern. 16
haben jeweils nur einen Anteil, die restlichen 4 gehören
einem gewissen BR. Auch wenn BR mit 4 Anteilscheinen
keineswegs die Mehrheit hat, ja nicht einmal ein Viertel,
hat er doch mehr Scheine als jeder andere der restlichen
Eigentümer. Angenommen BR möchte gerne, dass die
Entchen schwarz gefärbt werden statt quietschgelb. Es
steht zu vermuten, dass der Gummi-Entchen-Gründer
zumindest über den Farbwechsel nachdenken wird.
Dick im deutschen Wohnungsmarkt …
BlackRock hat nicht nur in deutsche Aktien und
Firmenanteile investiert. Zum Portfolio gehören auch
Immobilien. Wenn man so will, ist BlackRock inzwischen,
wenn auch indirekt, einer der größten Vermieter
Deutschlands. Der größte Teil der 24 Millionen
Mietwohnungen, die das Statistische Bundesamt 2013 in
Deutschland zählte, gehören nach wie vor kleineren und
lokalen privaten Hausbesitzern. Das hat es lange für
Großinvestoren schwierig gemacht, in deutsche Immobilien
zu investieren – zu kleinteilig und aufwendig wäre das
Engagement ausgefallen. Doch Anfang der 2000er Jahre
begannen Kommunen, Länder und Konzerne ihre bis dahin
gemeinnützigen Wohnungsbestände abzustoßen.
Amerikanische und britische Private-Equity-Firmen, in
Deutschland seit einer Bemerkung des damaligen SPDVorsitzenden Franz Müntefering besser als
»Heuschrecken« bekannt, waren nur zu gerne bereit, diese
im großen Stil aufzukaufen. Die Bestände aus der einstigen
skandalverstrickten Gewerkschaftsgruppe Neue Heimat –
später Baubecon – und die städtische GSW in Berlin
wurden von der Beteiligungsgesellschaft Blackstone unter
dem Dach der Deutsche Wohnen AG zusammengeführt. Die
Deutsche Annington baute die Londoner »Heuschrecke«
Terra Firma unter anderem aus ehemaligen EisenbahnerWohnungen und einstigen Werkswohnungen der
Energieversorger E.on und RWE zusammen. Fortress, die
Konkurrenz aus New York, bediente sich derweil bei den
Beständen der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte,
der kommunalen Wohnbaugesellschaft Nileg in Hannover
und der Woba in Dresden, die sie zur Gagfah
zusammenführte. Ende 2014 fusionierten Gagfah und
Deutsche Annington zu einem Koloss: 350 000 Wohnungen
besitzt die neue Gesellschaft in über 600 Städten, mehr als
eine Million Mieter leben unter ihren Dächern. Einen
Vermieter dieser Größenordnung hat es in Deutschland nie
gegeben.
Doch das Konzept der privaten Wohnungskonzerne
bekam schnell einen schlechten Ruf. Die neuen Eigentümer
wie Fortress, Terra und die Beteiligungsgesellschaft
Blackstone »pflegten die Bilanzen und ließen die Häuser
verkommen«, wie es die Wirtschaftswoche in einem Bericht
bissig zusammenfasste. Nach dem Eigentümerwechsel
stiegen die Beschwerden der Mieter an. 2012 übergaben
Gagfah-Bewohner aus dem Hamburger Stadtteil
Wilhelmsburg der damaligen Stadtentwicklungssenatorin
Jutta Blankau eine lange Mängelliste, in der sie über
undichte Fenster, Wände und Dächer, verrottete
Treppenhäuser, kaputte Fahrstühle, marode Balkone und
heruntergekommene Außenanlagen klagten. Keine
Ausnahme offenbar. »Treppenhäuser vergammeln,
Reparaturen werden verschlampt«, klagt ein Mieter aus
einer einst für Postbeamte errichteten Anlage in der
Frankfurter Siedlung Goldstein im Mai 2011 dem Reporter
der Rhein-Main-Zeitung. Ein anderer Anwohner berichtet,
die Heizung funktioniere nicht richtig und der Aufzug falle
wochenlang aus. Die derben Flüche eines Imbiss-Besitzers
auf die Annington seien nicht zitierfähig gewesen, schreibt
der Zeitungsmann. Das Unternehmen wies die Kritik
zurück. Mit einem Aufwand von 14 Euro je Quadratmeter
Wohnfläche, die allein 2011 in die Instandsetzung investiert
würden, liege man über dem deutschen Durchschnitt, heißt
es in dem Artikel. In einem WDR-Bericht über eine
Annington-Siedlung in Bonn geht es um Schimmelbefall,
undurchsichtige Betriebskostenabrechnungen und
Mieterhöhungen. Die rot-grüne Landesregierung in
Nordrhein-Westfalen erhob sogar den Vorwurf, dass gezielt
Wohnungen von Hartz-IV-Empfängern vernachlässigt
würden – denn die Jobcenter würden zahlen, egal wie die
Wohnung aussehe. Ein Vorgehen, das die Landesregierung
als »Geschäftsmodell Hartz-IV« geißelte. Auf Nachfrage
des WDR hieß es jedoch bei der Deutschen Annington, »das
Unternehmen stehe für eine nachhaltige, langfristige
Strategie, die die Pflege der Kunden und der Bestände in
den Vordergrund rückt.« Seine Aufgabe sei es, »die Fehler
der Vergangenheit Schritt für Schritt zu beseitigen«,
erklärte Anningtons Vorstandschef Rolf Buch selbstkritisch
in einem Interview. Auch die Gagfah gelobte Besserung und
kündigte Investitionen und Sanierungen an.
Nicht ganz freiwillig vielleicht. Die »Miet-Hai AG« titelte
der Stern eine Geschichte über die Annington und berief
sich auf interne Dokumente aus dem November 2013, aus
denen angeblich hervorgehe, dass das Unternehmen einen
»reputationsrelevanten Instandhaltungsstau« mit 161
Millionen Euro angesetzt habe. So viel wäre nötig, um die
rufschädigenden Fälle von Schimmel zu bekämpfen, Dächer
zu flicken und Heizungsanlagen zu reparieren. Mit Sorge
habe der Vorstand der Annington – so der Stern – den
»Übergang von der lokalen zur überregionalen
Berichterstattung« beobachtet. Im Klartext: Es gab für den
Geschmack der Manager zu viele negative Schlagzeilen. In
einer Stellungnahme gegenüber den Stern-Reportern
erklärte das Unternehmen, der »Vorstand habe das
Instandhaltungsbudget selbst und ohne Zustimmung des
Aufsichtsrats erhöht«.
Dass die Manager der Wohnbauriesen sich um ihren Ruf
sorgen und öffentlich Besserung geloben, ist kein Zufall. Es
hat sich nämlich etwas geändert: Die »Heuschrecken«
haben Kasse gemacht und sind ausgestiegen. Terra Firma
hat die Deutsche Annington 2013 an die Börse gebracht,
die Beteiligungsgesellschaft Blackstone im gleichen Jahr
die Deutsche Wohnen AG. Fortress holte sich den Einsatz
schon viel früher an der Börse wieder: Die Gagfah war vor
ihrer Übernahme durch die Annington bereits seit 2006
gelistet. Während die »Heuschrecken« sich
verabschiedeten, stieg eine Handvoll internationaler
Großinvestoren in die frisch gebackenen
Börsengesellschaften ein. Neben dem kanadischen
Lebensversicherer Sun Life Financial sind das der
norwegische Pensionsfonds Norges Bank Investment
Management, die US-Investmentgesellschaft The Capital
Group und – last but not least – BlackRock. An der
Deutschen Annington hielt BlackRock zum Stichtag der
Bafin-Korrekturmeldung 6,79 Prozent. An der Deutsche
Wohnen waren es 7,29 Prozent und an der LEG, in der die
Wohnungen aus der Landesentwicklungsgesellschaft
Nordrhein-Westfalen privatisiert wurden, war BlackRock zu
dem Zeitpunkt sogar mit 12,70 Prozent beteiligt.
Die neuen Eigentümer sind nicht an schneller Abzocke
interessiert. Für sie lohnt sich das Investment bloß, wenn
Kurs und Dividende nachhaltig steigen. Das heißt
keinesfalls, dass sie nicht auf die Rendite schauen. Die
Fusionen in der Branche haben zu kräftigen Streichungen
bei Personal und Organisation geführt. Die Deutsche
Wohnen etwa übernahm Anfang 2014 die Berliner GSW, die
zu diesem Zeitpunkt 60 000 Wohnungen in ihrem Portfolio
hatte, in denen rund 120 000 Menschen wohnten. Nach der
Übernahme baute der neue Eigentümer fast die Hälfte der
320 Arbeitsplätze ab. Die Übernahme zahle sich für den
Wohnimmobilienkonzern aus, befand das Handelsblatt im
Mai 2014. Der für Immobiliengesellschaften maßgebliche
operative Gewinn aus der Vermietung hatte sich im ersten
Geschäftsquartal auf 59,1 Millionen Euro nahezu
verdoppelt. Geholfen bei dem satten Gewinnsprung hatten
unter anderem Mietsteigerungen von 4,2 Prozent. Für die
Mieter ist diese Methode der Renditesteigerung sicher
weniger erfreulich.
… und auch bei Gewerbeimmobilien dabei:
Sahnestückchen in Freising
Die Stadt Freising war einst Herzogssitz, dann
Gelehrtenhochburg und Bischofsstadt. Kaiser Otto III.
verlieh ihr im Jahr 996 das Marktrecht. Es ist die Ȋlteste
Stadt zwischen Regensburg und Bozen«, wie die Webseite
der 46 000-Einwohner-Stadt in Bayern versichert. Im Krieg
wurde sie schwer beschädigt. Doch in den vergangenen
Jahren kämpfte die Stadt darum, ihren historischen Kern
wiederzubeleben. Das offizielle Motto: »Die Innenstadt ist
Herz und Seele einer Stadt. Planer, Politik und Bürger
arbeiten Hand in Hand.« Doch die Städteplaner taten sich
schwer beim Hand-in-Hand mit dem Eigentümer eines der
großen Grundstücke im Zentrum. Einem »Sahnestückchen«
in dem Areal, wie es in einem Bericht der Süddeutschen
Zeitung im Januar 2014 beschrieben wurde. Das
Grundstück an der Angerbadergasse hatte einst Aldi Süd
gehört. Der Discounter verkaufte es gemeinsam mit
anderen Objekten an einen Investor. Anfang Januar 2014,
so berichtete die Süddeutsche, stand das Gebäude leer. Die
Stadt Freising hätte das Grundstück dem Discounter nun
sehr gerne abgekauft – und glaubte auch ein Vorkaufsrecht
zu genießen. Doch trotz mehrfacher Anläufe – zuletzt sogar
vor Gericht – scheiterte Freising mit diesem Vorhaben. Das
Gebäude ging in den Besitz des neuen Investors über:
BlackRock. Der hüllte sich zu der Frage, was er mit dem
Freisinger »Sahnestückchen« vorhabe, erst einmal in
Schweigen. Bis heute ist nicht klar, was dort passiert. Mitte
2014 habe man die Anteile an der Eigentümergesellschaft
verkauft, erklärt ein BlackRock-Sprecher auf Anfrage. Will
heißen, mit dem Grundstück haben die New Yorker
inzwischen nichts mehr zu tun. An der Angerbadergasse
hat sich nichts getan. Das Gebäude ist verschlossen,
immerhin können Freisings Bürger kostenlos den Parkplatz
nutzen.
Im »Kaufpark Bamlerstraße« bei Essen dagegen rückten
Mitte 2014 die Bulldozer an. Sie rissen dort den Aldi ab.
Das Einkaufszentrum, günstig an der A4 nach Bottrop
gelegen, war in die Jahre gekommen. Der neue Besitzer
hatte Pläne für einen kompletten Umbau. BlackRock hatte
in diesem Fall die Bulldozer geschickt – der »Kaufpark
Bamlerstraße« gehörte ebenfalls zum Immobilienportfolio
des Riesen. Ob sich der »Kaufpark Bamlerstraße« noch im
BlackRock-Portfolio befindet oder wieder abgestoßen
wurde – dazu wollte sich das Unternehmen auf Anfrage
nicht äußern.
Kein Zufall. BlackRock gehören an die 100 solcher
Objekte überall in Deutschland. Verschafft haben sie sich
die Amerikaner auf einen Schlag, durch die Übernahme
eines Unternehmens namens MGPA im Jahr 2013. MGPA
war bis dahin die Immobilientochter der australischen
Investmentbank Macquarie gewesen. Interessant war
MGPA für BlackRock, weil die Firma in den vergangenen
Jahren zu den aktivsten Immobilienaufkäufern in Europa
und Asien gehörte. Vor der Übernahme hatte die MGPA ein
Portfolio von über 23 Milliarden Dollar zusammengekauft.
So war auch Deutschland in den letzten Jahren zunehmend
in ihrem Visier gelandet. 2010 gelang MGPA hier ein Coup:
Sie übernahm Filialen, Grundstücke und ein
Logistikzentrum von Aldi Süd – insgesamt rund 140
Objekte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen
vereinbart. 2012 legte die MGPA nach und erwarb drei
Stadtteilzentren, ein Fachmarktzentrum, ein SB-Warenhaus
und sechs Fachmärkte. Zu den Mietern gehörten das Who’s
who des deutschen Lebensmittelhandels: Edeka, Rewe,
Penny und Aldi. Nach der Transaktion zählte das MGPADeutschland-Portfolio 175 Immobilien mit einer
vermietbaren Gesamtfläche von 340 000 Quadratmetern.
Eines der Objekte war »Kaufpark Bamlerstraße«. Einige
Monate später wurde MGPA selbst übernommen:
BlackRock kaufte den Immobilienspezialisten für einen
ungenannten Preis.
Der unsichtbare Über-Investor: Ein Gespenst
geht um
Trotz all der Beteiligungen und Engagements, die
BlackRock inzwischen in Deutschland hält, und den
Hunderten Millionen, die die New Yorker über ihre Fonds
von großen wie kleinen Anlegern in deutschen Landen
eingesammelt haben, ist es ihnen gelungen, weitgehend
unter dem Radarschirm öffentlicher Aufmerksamkeit zu
bleiben. Das Büro befindet sich zwar im repräsentativen
Opernturm im Frankfurter Bankenviertel, aber wer Prunk
in der BlackRock-Filiale erwartet, wird enttäuscht. Die
halbe Etage im 23. Stock ist vor allem funktional. Antike
Karten und Stiche von Städten rund um die Welt, die zu
Dekorationszwecken dort hängen, stammen noch aus
Beständen des Frankfurter Ablegers der Fondssparte der
Investmentbank Merrill Lynch, die von BlackRock
übernommen wurde – offenbar samt Inneneinrichtung,
erzählt jedenfalls ein Mitarbeiter. Der Deutschlandchef
Christian Staub war vorher beim Rivalen Pimco, einer
Allianz-Tochter. Er war dort Schweiz-Chef. Staub wirkt wie
ein Bilderbuch-Banker, sein Lebenslauf ist es auch:
Harvard Business School, ein Master-Abschluss an der
Elite-Uni St. Gallen. Dann Analyst und Händler bei der
Schweizer UBS, Abstecher nach Hongkong und Singapur.
Für Pimco war er auch in den USA. Staub war zu einem
Treffen in Frankfurt bereit, in dem es vor allem um die
Deutschlandstrategie und Geschäftsziele von BlackRock
ging. Allerdings teilte BlackRocks Presseabteilung später
per E-Mail mit: »Wir stimmen einer Veröffentlichung von
Auszügen dieses Gespräches in direkter oder indirekter
Form in Ihrem Buch nicht zu.«
60 Mitarbeiter hat BlackRock in Frankfurt, 60 weitere in
München. In den vergangenen Jahren wurde vor allem der
Vertrieb auf 20 Mann aufgestockt. Ihre Hauptaufgabe ist
es, in Deutschland neue Großkunden zu finden, wie
Pensionskassen und Versicherer. Mit der Betreuung der
Beteiligungen an den deutschen Unternehmen haben Staub
und sein Team nichts zu tun. Das macht alles die Londoner
Niederlassung. Selbst Finanz-Insidern gibt BlackRock
Rätsel auf. »Die wirken unscheinbar, unauffällig – obwohl
das gar nicht sein kann, denn schließlich sind sie überall
und machen alles«, wundert sich der Deutschlandchef
eines Konkurrenten. Wie unheimlich der Auftritt des
Großinvestors auch den Journalisten ist, zeigen
Schlagzeilen wie »Der Schattenmann, der die Welt regiert«
(Focus) oder »Der schwarze Riese« (FAZ), »Die Besitzer
der Welt« (Welt), »Die heimlichen Herren im Dax«
(Handelsblatt) und »Machtwechsel« (Die Zeit). Die ARD
warf BlackRock in einer Reportage mit dem Titel Geld
regiert die Welt vor, unter anderem für die Aushöhlung des
schwäbischen Traditionsunternehmens WMF
verantwortlich zu sein (der Zusammenhang ist allerdings
nicht ganz klar – BlackRock ist weder an WMF noch an
deren aktuellen Besitzerin, der Heuschrecke KKR,
beteiligt). Dem Journalisten und politischen Blogger Jens
Berger fällt in seinem Buch Wem gehört Deutschland? zu
dem Großinvestor Folgendes ein: »Im Superman-ComicUniversum ist BlackRock ein mystisches Artefakt, das
Schurken die notwendigen Superkräfte gibt, um im
epischen Kampf über die Macht die Guten zu besiegen.«
Berger rätselt, ob Fink mit der Namenswahl eine Portion
Humor bewiesen habe. (Nicht wirklich – es war eine
einfache Ableitung aus dem Namen des damaligen
Mutterkonzerns Blackstone, dazu später mehr.) Aber
Berger ist sich offenbar sicher, dass BlackRocks »mystische
Macht« in der realen Welt nicht der guten Sache dient.
BlackRock sei eine »Spinne im Netz der Beteiligungen an
den Dax-Unternehmen«. In der Welt der Blogger ist man
sich sicher, dass BlackRock Teil einer Verschwörung ist. Im
»Gelben Forum«, einer Internetplattform zu Wirtschaft und
Börse, klagt ein Teilnehmer: »Man schaue sich Firmen wie
Daimler oder Siemens an, in der Hand der Besatzer,
BlackRock, CoL und Co, selbst mit 10 Mrd. Gewinn werden
Stellen abgebaut, weil den Partyhengsten die Rendite
immer noch nicht hoch genug ist.« Ein anderer Blogger
namens The Intelligence schreibt: »Ein Gespenst geht um
im deutschen Aktienindex: BlackRock.«
Wie der BlackRock-Vertreter in jenem hessischen Schloss
erklärte: BlackRock ist groß und effizient. Aber genau das
ist es, was den schwarzen Felsen unheimlich macht. Wer ist
BlackRock wirklich – und was will das Unternehmen, das
inzwischen der größte Einzelaktionär der Deutschland AG
ist?
Kapitel 3
Der Mann hinter dem Koloss – ein
Loser der Wall Street
Selbst wer den Film nie gesehen hat: Das Bild von Gordon
Gekko, mit seinen breiten Hosenträgern, Nadelstreifenhose
und zurückgegelten Haaren, wie Michael Douglas ihn in
dem Hollywoodreißer Wall Street so überzeugend gab, so
stellt man sich einen Finanztycoon vor. Nichts an Fink
passt dazu. Der einflussreichste Mann der modernen
Finanzwelt sieht auf den ersten Blick aus wie sein eigener
Buchhalter. Er hat, was man bei Männern gerne verschämt
»hohe Stirn« nennt, graue Schläfen, randlose Brille. In
Interviews vor laufenden Kameras pflegt er das Gehabe
eines »Elder Statesman«, ein Mann, der kraft seiner
Erfahrung und seines Wissens gelassen über den Dingen
der Welt steht.
Er verströmt die Gravitas, die man von einem Chef von
12 200 Angestellten weltweit erwartet, einem CEO, der
einem Konzern mit einem Börsenwert von 60 Milliarden
Dollar vorsteht. Bescheiden erklärte er »Ich bin noch ein
Schüler«, als er 2012 zum Thema »Führung im 21.
Jahrhundert« vom Beratungsunternehmens McKinsey nach
seinem Führungsstil befragt wurde – nur um seinem
Gesprächspartner daraufhin eine ausführliche Vorlesung
über Globalisierung, Managementmotivation und die
politische Führungsschwäche weltweit zu halten. Der
Zugang der Presse zu Fink ist streng kalkuliert. In früheren
Jahren gab er nur sehr selten Interviews. Heute ist er
häufiger zu sehen, doch in seinen Botschaften hält er sich
streng an das Skript vom wohlwollenden Sachverwalter
seiner Kunden und praktisch aller Anleger. »Das ist ein
Laden, der fast schon paranoid ist, wenn es um das geht,
was nach draußen dringt«, sagt eine PR-Frau, die mit Finks
Team zusammengearbeitet hat. Kein Wunder, dass
Journalisten begeistert reagieren, wenn sie den großen
Kahuna in seinem eigenen Revier interviewen dürfen. Carol
Loomis – Finanzjournalistin und die Ghostwriterin von
Investorenlegende Warren Buffett – durfte Fink bei der
Arbeit über die Schulter schauen. Und beschreibt in ihrer
Titelgeschichte für das Wirtschaftsmagazin Fortune die
Tagesroutine Finks, wie in absolutistischen Zeiten der
Hofchronist das Lever du Roi beschrieben hätte. Finks Tag
beginnt, so erfahren wir da, um 5:15 Uhr früh in seinem
Apartment an der noblen Upper East Side Manhattans, um
5:45 holt ihn eine Limousine ab und setzt ihn wenige
Minuten später an BlackRocks Haupthaus ab. Mit dabei hat
er demnach drei Zeitungen – die New York Times, die
Financial Times und das Wall Street Journal. Dann denkt
Fink angeblich erst einmal eine Stunde lang nach. Oder er
ruft einen seiner Manager per Videoschalte an. Der sollte
dann besser in seinem Büro sitzen. Zum Frühstück gibt es
Cerealien mit Blaubeeren und Banane. Und zwischen all
seinen Terminen findet er, laut Loomis, immer noch einen
Moment, seine Frau Lori anzurufen, mit der er mehr als 40
Jahre verheiratet ist. (Er lernte sie schon als 17-Jähriger
kennen.) Um 18:30 Uhr verlässt Fink das Büro und geht
entweder nach Hause oder zu einem Abendtermin. Um
22:30 Uhr macht er das Licht aus. Loomis Artikel platzierte
die Presseabteilung an prominenter Stelle auf der
Webseite. Jedem Leser wird hier klar gemacht, dass Fink
sich für BlackRock und damit im weiteren Sinne für die
Kunden abrackert.
Bei jeder Gelegenheit erwähnt Fink, dass er um seine
hohe gesellschaftliche Verantwortung weiß. »Unsere
Kunden sind Feuerwehrleute und Lehrer«, bemerkt er
gerne und meint damit, dass BlackRock Pensionskassen für
öffentliche Angestellte verwaltet. Das verhinderte
allerdings nicht, dass BlackRock ein Konsortium seiner
besten Kunden in einen Deal hineinzog, der zu den größten
Immobilienpleiten der jüngeren Geschichte führte. (Dazu
später mehr.) Es ging um die New Yorker Wohnanlage
Peter Stuyvesant, die BlackRock und das Konsortium für
über 5 Milliarden Dollar 2006 erwarben – auf der Höhe der
Immobilienblase. Anfang 2010 platzte das Ganze –
BlackRock zog sich zurück. Zu den Kunden, denen
BlackRock zur Teilnahme geraten hatte, gehörte auch
Calpers, der größte öffentliche Pensionsfonds der USA. Die
Pensionskasse ist für die Altersvorsorge von 1,6 Millionen
öffentlicher Bediensteter in Kalifornien verantwortlich.
Calpers war zu dem Zeitpunkt schon arg gebeutelt durch
die Krise und verlor durch die Stuyvesant-Pleite noch
einmal 500 Millionen Dollar. Es nage immer noch an ihm,
dass »wir unsere Kunden enttäuscht haben«, sagte Fink
der BusinessWeek im Dezember 2010.
Das Image des Dieners einer höheren Sache fördert die
PR-Garde gerne. Da sitzt der BlackRock-CEO etwa bei
Charlie Rose und spricht gesetzt und ein wenig eintönig
über Indonesiens Erholung, Sozialversicherungen,
Aktienmärkte und demografischen Wandel. Der Moderator
hat Fink vorgestellt, als »Rad und Nabe« des
amerikanischen Kapitalismus. Für Fink ist der Auftritt eine
weitere Bestätigung, dass er es geschafft hat. Denn in das
karge kulissenlose TV-Studio von Rose wird nur eingeladen,
wer zu den Movers and Shakers gehört, den Entscheidern
und Bewegern in Washington und New York.
Wer nicht weiß, wen er vor sich hat, könnte Fink
allerdings für einen der vielen Talking Heads halten, jene
»Experten«, die ständig im TV auftauchen. Keiner
allerdings, bei dem der normale Zuschauer beim
Durchzappen des Abendprogramms hängenbleibt. Doch
wer in seiner Nähe ist, spürt etwas anderes – eine kaum
verborgene Unruhe, eine im Innern gespannte Feder. Sein
Gegenüber behält Fink genau im Auge. Auf eine kritischere
Reporternachfrage bei einer Konferenz fährt er herum und
widerspricht in einer Art, die klarmacht, dass er gewohnt
ist, das letzte Wort zu haben. Im persönlichen Umgang sei
er »intensiv« und »direkt«, so umschreiben es Insider
gerne.
»Larry ist und bleibt Trader«, sagt Larry Doyle, der als
junger Händler bei Fink angefangen hat, damals in den
1980er Jahren.
Trader – Händler – halten ständig und überall Ausschau
nach möglichen Gewinnchancen und Verlustrisiken. Das
geht ihnen in Fleisch und Blut über. »Keine Erfahrung
prägt einen so stark, wie wenn man mal ein paar Millionen
verliert«, sagt Doyle. Erfolgreiche Trader – mit dem
deutschen Wort Händler wird die Tätigkeit nur
unzureichend übersetzt – sind fasziniert von Zahlen, vor
allem, wenn diesen ein Dollarzeichen folgt. Sie drücken
aufs Tempo und sind ungeduldig: Wer zu lange auf einer
Position sitzt, bewegt kein Geld und wer kein Geld bewegt,
verdient keins. Im schlimmsten Fall verliert man welches,
weil sich der Markt gegen einen dreht. Der Markt: Trader
sprechen vom Markt mit der gleichen Achtung wie
Seeleute von der See. Ähnlich wie eine Naturkraft kann der
Markt sich gegen die wenden, deren Lebensgrundlage er
bildet. Und wie Seefahrer Wind, Wellen und Wolken, so
beobachten Trader das Auf und Ab der Kurse, Zinsen und
Ordereingänge. Wer Tradern zuhört, fühlt sich als
Außenstehender in all seinen Vorurteilen gegen die Zocker
bestätigt. Als nach der Lehman-Pleite die Kritik an der Wall
Street mal wieder ein Forte erreichte, machte ein E-MailBrief in der Branche die Runde. Der Autor fasste seine
Verteidigungsrede folgendermaßen zusammen. »Es ist
unser Job, Geld zu machen. Egal ob Rohstoffe, Aktien,
Anleihen oder irgendein hypothetisches, erfundenes Papier.
Wenn man mit Baseball-Spielkarten Profit machen könnte,
dann würden wir sogar damit handeln.« Die Profite seien
gerechtfertigt: »We eat what we kill.«
Robert Shiller, Wirtschaftsnobelpreiträger 2013, der vor
der Dotcom-Blase gewarnt und die Immobilienblase richtig
vorhergesagt hatte, hat sich mit der Rolle der Finanzen und
ihrem Nutzen für die Gesellschaft beschäftigt. Dabei
kommt er zwar zu dem Schluss, dass ohne die
Finanzindustrie unsere moderne Volkswirtschaft nicht
möglich sei. Doch die Finanzbranche biete einer Gruppe
Unterschlupf, die sich sonst mit der Integration schwertue.
3 Prozent der Bevölkerung haben soziopathische Züge,
meint der Ökonom. »Da ist es doch besser, wir setzen sie
an einer Stelle ein, an der sie unserer Gesellschaft nützlich
sein können.« Nicht jeder ist imstande, Entscheidungen zu
treffen, die Millionen kosten können – und das noch
innerhalb von Minuten, wenn nicht gar Sekunden. Oder
Risiken abzuwägen, ohne dabei moralische oder emotionale
Faktoren zu berücksichtigen.
Einmal ein Trader, immer ein Trader, heißt es an der
Street.
Solche Aussagen hört Fink gar nicht gern. Er tut sein
Möglichstes, sich von den seit der Finanzkrise verpönten
Wall-Streetern zu distanzieren. »Wir sind nicht Wall
Street«, beschied er einem Bloomberg-Reporter in einem
Interview 2013. Es sei ihm eigentlich nicht einmal recht,
die Zentrale in New York zu haben. BlackRocks
Geschäftsmodell sei zu 100 Prozent anders als das der Wall
Street. »Wir sitzen in New York und so werden wir in einen
Topf geworfen, obwohl wir da nicht reingehören.« Nicht
nur gegenüber Journalisten insistiert Fink, er habe mit der
Wall Street absolut nichts zu tun. Für das Geschäft von
BlackRock ist das Image eines unabhängigen Außenseiters
wichtig. Viele der Investoren – Pensionskassen,
Investmentfonds, Stiftungen –, für die BlackRock die
Milliarden verwaltet, sind misstrauisch gegenüber Wall-
Street-Firmen. Zu oft fühlen sie sich von den Bankern über
den Tisch gezogen. Da ist es von enormer Wichtigkeit für
Fink, seinen Laden möglichst von den üblichen
Verdächtigen zu distanzieren. Was aber womöglich noch
entscheidender ist: Regulierer sollen BlackRock unter
keinen Umständen mit den Banken und Broker-Häusern, ja
nicht einmal mit Versicherungen verwechseln. Denn bisher
ist es Fink gelungen, sein Imperium nahezu unberührt
zwischen den Hunderten von neuen Regeln und
Vorschriften durchzulavieren, die von Gesetzgebern und
Aufsehern seit dem Debakel 2008 erlassen wurden.
Larry Finks Blitzkarriere im Reich der Bonds
Eine Karriere an der Wall Street war für Laurence D. Fink
alles andere als vorgezeichnet. Anders als die meisten WallStreeter, ist Fink ein Westküsten-Typ. Er wuchs in Van
Nuys auf, einem Vorort von Los Angeles. Seine Mutter war
Lehrerin am örtlichen College, sein Vater besaß einen
Schuhladen. Larry, wie ihn heute so gut wie jeder nennt,
studierte zunächst Politikwissenschaften an der University
of California. Dann machte er seinen MBA-Abschluss an der
Anderson School of Managment, die ebenfalls zur
University of California gehört. Sein Spezialfach:
Immobilienfinanzen. 1976, gerade mal 23 Jahre alt, mit
dem Diplom in der Tasche, machte sich Fink auf den Weg
nach New York, an die Wall Street. Das war keine so
ungewöhnliche Job-Wahl. »Nur Hollywood war damals noch
ein heißeres Ticket als die Wall Street«, erinnert sich ein
Veteran der Branche. Seine Herkunft machte Fink dort
allerdings zum Außenseiter. Die meisten Rekruten für die
Topbanken kommen bis heute von den Elite-Universitäten
der Ostküste – Harvard, Yale, Princeton. Er sei bloß ein Kid
aus L. A. gewesen, das mit »Türkisschmuck und langen
Haaren ankam«, erzählte Fink selbst einmal Reportern. Ein
ehemaliger Kollege muss immer noch schmunzeln, wenn er
an Finks Marotte denkt, nach den morgendlichen
Teambesprechungen allen noch einmal zuzurufen: »Noch
eine Sache: Habt Spaß!« Doch die Ostküstenbanker waren
von dem Intellekt des Kaliforniers beeindruckt. Fink war
schon während des Studiums als heller Kopf aufgefallen. Er
nahm ein Angebot der Investmentbank First Boston an.
Dort setzte man ihn in die Bond-Abteilung. Anders als
heute, wo die Reihen in den Handelsabteilungen
ausgedünnt sind und nur noch Grauhaarige die Papiere hinund herschieben, war Bond Trading – der Handel mit
Anleihen – in den 1980er Jahren das Zentrum des
Geschehens. Die Trader saßen in den turnhallengroßen
Handelssälen, vor Reihen von Monitoren, in der Kakofonie
Hunderter Telefongespräche. Kaum jemand war älter als
Mitte 30. »Masters of the Universe« dafür hielten sie sich.
Ihre Arroganz und Exzesse hat Tom Wolf in seinem Roman
Fegefeuer der Eitelkeiten verewigt.
Die 1980er Jahre waren auch die glorreichen Jahre für
First Boston, die Bank spielte mit in der Oberliga der
Investmentbanken. Schärfster Konkurrent war Salomon
Brothers. Wer in seinem Lebenslauf heute eine Zeit als
Händler bei Salomon Brothers verzeichnen kann, hat eine
Art Prädikat vorzuweisen, das Wall-Street-Insider
garantiert beeindruckt. Die Trader von Salomon waren
gleichzeitig berühmt und berüchtigt für ihre
Gnadenlosigkeit und dafür, immer hart am Wind zu segeln.
Salomon baute den Handel mit Hypotheken zu einem
lukrativen Geschäft aus. Der führende Kopf dahinter war
Lew Ranieri, dem Michael Lewis in seinem Buch Liars’
Poker ein Denkmal gesetzt hat. Fink wurde zu Ranieris
wichtigstem Gegenspieler. Er schaffte es nicht nur, gegen
Salomon aufzuholen – dank seiner Abteilung dominierte
First Boston Mitte der 1980er Jahre den
Hypothekenhandel. Finks Findigkeit bescherte seinem
Arbeitgeber geradezu märchenhafte Gewinne – bis zu 1
Milliarde Dollar soll er mit seiner Abteilung für die Bank
eingespielt haben. Seine Karriere hob ab, mit knapp 30
Jahren wurde er zum jüngsten Managing Director der Bank
berufen – und sogar Mitglied im Führungskomitee. Die
Aussichten standen gut, in absehbarer Zeit ganz in die
erste Reihe vorzustoßen.
Doch Larry Fink war nicht nur einer von Wall Streets
jungen Wilden in den 1980er Jahren. Fink war mehr: Er
war einer der Pioniere bei der Erfindung der strukturierten
Hypothekenpapiere. Jene Papiere, die den Untergang von
Lehman Brothers und letztlich die große Rezession mit
auslösten.
CMO – die Wunderpapiere aus der Büchse der
Pandora
Bevor Hypothekenpapiere zum Zentrum der
vernichtendsten Spekulationsblase seit der Tulpenraserei
im 17. Jahrhundert wurden, galten sie als eine der
cleversten Innovationen des modernen Finanzgeschäfts.
Und Larry Fink gehörte Anfang der 1980er mit zu den
Erfindern. Um die Pionierleistung zu würdigen, muss man
auf die Zeit zuvor zurückschauen. Anders als in
Deutschland, wo Hypotheken – also Kredite, die mit
Immobilien abgesichert sind – schon seit Zeiten des Alten
Fritz als Pfandbriefe an Anleger weitergereicht werden,
gab es auf dem amerikanischen Markt lange nichts
Vergleichbares. Das Geschäft sah typischerweise so aus:
Joe Sixpack, ein amerikanischer Normalverbraucher, kauft
sich ein Haus. Er bekommt einen Kredit von der Lake
Woebegun Savings & Loan, der lokalen Bank. Die Bank
verbucht den Kredit, Joe Sixpack stottert Zins und Tilgung
über 15 oder 30 Jahre ab. Ende. Das Geld für MöchtegernHauskäufer war begrenzt durch die Finanzkraft der Bank
am Ort. Der Engpass spitzte sich zu, als Ende der 1980er
während einer großen Kreditklemme, der Savings & LoanKrise, regionale und lokale Institute zu Hunderten
dichtmachten. Grund dafür waren Zinsspekulationen und
schlichter Bilanzbetrug – die S&L-Krise hätte als
warnendes Beispiel dienen können, aber das Gedächtnis
der Welt und speziell der Wall Street ist notorisch kurz.
So standen auf der einen Seite kredithungrige
Immobilienkäufer und auf der anderen Seite große
Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen, die auf
der Suche nach sicheren und rentablen Anlagen waren.
Das rief förmlich nach einer Wall-Street-Lösung. Wie wäre
es, fragten dort die Finanzbastler, wenn wir die
Hypotheken bündeln und dann Zertifikate auf dieses
Bündel ausstellen, die Investoren das Recht auf einen Teil
der Zinszahlung aus den Krediten einräumen. Damit
wandert der Kredit aus der Bilanz der lokalen Bank Lake
Woebegun Savings & Loan in einen Pool, der
gemeinschaftlich Investoren gehört. Damit ließ sich der
Hauskredit in ein Hypothekenwertpapier verwandeln, mit
dem weit einfacher zu handeln und zu investieren war.
Doch das allein reichte nicht, den Investoren Hypotheken
schmackhaft zu machen. Für sie hatten Hypotheken
nämlich einen gewaltigen Nachteil: Wenn Joe Sixpack sein
Haus wieder verkaufte oder eine Umschuldung vornahm –
etwa um einen Kredit mit einem niedrigeren Zinssatz zu
bekommen – konnte er seinen Kredit vor der Zeit ablösen.
Das aber brachte die Kalkulation der Investoren
durcheinander. Statt wie berechnet zehn Jahre lang
regelmäßig Zinsen zu bekommen, wurde das Darlehen über
Nacht zurückgezahlt – damit fielen die künftigen
Zinszahlungen an die Investoren aus und es entstand ein
unschönes Loch in ihrer Renditekalkulation. Es war das bei
Investoren gefürchtete, weil schwer kalkulierbare Risiko
der vorzeitigen Rückzahlung. Das bereitet Pensionskassen
und Versicherern, die auf stetige Zuflüsse angewiesen sind,
erhebliche Kopfschmerzen.
Fink und sein Rivale Lew Ranieri bei Salomon Brothers
gelten als die Köpfe, die eine Lösung für dieses Problem
fanden: Collateralized Mortgage Obligations, kurz CMOs.
Dabei wird der Hypothekenpool in verschiedene Tranchen
unterteilt. Zunächst gehen alle Tilgungen an die
Investoren, die die erste Tranche halten. Wenn ein
Hausbesitzer sein Darlehen frühzeitig zurückzahlt, dann
trifft es die Investoren in dieser Tranche als Erstes. Sie
tragen den größten Teil des Risikos der dadurch
entstehenden Zinsausfälle. Erst wenn die Investoren der
ersten Tranche ihren Anteil an der Darlehenssumme
vollständig zurückbekommen haben, werden die der
zweiten Tranche bedient und schließlich ganz am Schluss
die Investoren der dritten Tranche. Diese letzte Tranche
hat das geringste Risiko, Zinsausfälle wegen frühzeitiger
Darlehensrückzahlungen zu erleiden. Die Unterteilung von
Hypothekenpools lässt sich auch nach anderen Kriterien
vornehmen – etwa nach Ausfallrisiko. Die sichersten
Tranchen bestehen dabei aus Darlehen an Kreditnehmer
mit bester Bonität, während die riskantesten Tranchen
Kredite an Wackelkandidaten enthalten. Der Vorteil dieser
Wackel-Tranche: Die Zinsraten für die Hausbesitzer mit
schlechter Bonität sind höher. Die Unterteilung machte die
Anlage in Hypotheken für Investoren plötzlich
berechenbarer – sie konnten sich nach Bedarf Tranchen mit
gewünschten Zinsraten und Risiko herauspicken.
Versicherer und Pensionskassen liebten CMOs.
Ausländische Investoren sahen einen Weg, sich auf diesem
Wege ein Stück des US-Immobilienmarkts zu sichern. Die
deutschen Landesbanken etwa gehörten zu den
begeisterten Kunden, genauso wie Staatsfonds aus Asien
und Europa. Strukturierte Hypothekenpapiere – Spielarten
des CMO – wurden zum Bestseller. Innerhalb weniger Jahre
spülten Großinvestoren Milliarden in den Markt. 1983
präsentierte Fink seinen ersten CMO-Pool dem staatlichen
Hypothekenaufkäufer Freddie Mac. Anfang der 1990er
Jahre lag das CMO-Volumen bereits bei 250 Milliarden
Dollar. Alle großen US-Banken und viele ausländische
Institute wie die Deutsche Bank stiegen mit ins Geschäft
ein. Ehemalige Mobiltelefonverkäufer und
Gebrauchtwagenhändler wurden quasi über Nacht zu
Hypotheken-Dealern – und reich.
»Als ich auf dem Parkplatz Ferraris und Porsches sah,
wusste ich, wir haben ein Problem«, erinnert sich ein
Banker, der lokale Kreditinstitute im Land besuchte. Aber
niemand wollte die Gefahr sehen, zu gut war das Geld. Von
einer beschaulichen Nische im US-Finanzmarkt schwoll das
Hypothekengeschäft so an, dass es zur Hauptbeschäftigung
des Finanzsektors wurde. 2007 war das goldene Jahr der
Wall Street, nie zuvor hatten die Banker und Broker so viel
Geld kassiert. Wie am Fließband wurden Hypotheken
ausgereicht, in Pools gepackt, Zertifikate darauf ausgestellt
und dann in alle Welt verteilt. Doch die immer größere
Nachfrage nach Hypotheken hatte zur Folge, dass die
Immobilienpreise in unhaltbare Höhen katapultiert wurden
– und dass die Kreditnehmer immer wackeliger wurden.
Zur endgültigen Implosion trugen viele Faktoren bei. Aber
Tatsache ist: Ohne die CMOs wäre eine Hypothekensause
dieser Art nie denkbar gewesen. Wie viele Ideen, die an
sich sinnvoll sind und einem nachvollziehbaren Zweck
dienen, sind auch die CMOs von den Wall-Street-Jungs so
überreizt worden, dass sie sich ins Gegenteil verkehrten.
Larry Fink steht jedenfalls weiter zu seinen CMOs. »Wir
haben geholfen, die Kosten für Wohnungseigentum zu
senken«, sagte er der Vanity Fair im April 2010. Es sei ein
erhebendes Gefühl gewesen, damals nach Washington zu
gehen und mit den öffentlich-rechtlichen
Hypothekeninstituten Fannie Mae und Freddie Mac die
neuen CMO-Instrumente vorzustellen. »Selbst in meinen
20ern wusste ich um die Dimension der Sache und wie
hilfreich sie sein würde.« Tatsache ist, dass die
Hypothekeninstrumente quasi über Nacht Hunderte
Milliarden Dollar für Hausbesitzer zur Verfügung stellten –
und viele Amerikaner sich ihren Traum vom eigenen Heim
erfüllen konnten, die bis dahin diese Möglichkeit nicht
hatten. Tatsache ist aber auch, dass die Wall Street diese
Gelegenheit nutzte, die Spielräume immer weiter
auszureizen, um ihre Gewinne zu maximieren. Und dabei
die positiven Effekte ins Gegenteil kehrte, indem
Hunderttausende Amerikaner in der größten
Immobilienkrise der modernen Finanzgeschichte ihr Heim
verloren.
Wahr ist außerdem: Für den CMO-Pionier Fink und
BlackRock schuf das spätere Debakel des
Hypothekenrauschs letztlich die Grundlage des Imperiums.
Finks schicksalhafter Fehler und Fall
Mit seinen Hypothekenpapieren hatte Fink sich in die PolePosition für den Aufstieg gebracht. »Wir haben den Markt
dominiert, First Boston, das war der 800-Pfund-Gorilla in
der Hypothekennische«, erinnert sich ein Kollege. Fink
verdiente Geld für die Firma, er galt als brillanter Kopf in
der Branche. Noch ein paar Runden und er könnte in die
Zielgerade zur Chefetage einbiegen. Das California-Kid
hatte es den East-Coast-Jungs gezeigt. Und dann, im
zweiten Quartal 1986, kam die Katastrophe. Finks
Abteilung verlor. Nicht nur ein bisschen, nicht nur der
übliche schlechte Tag oder der Ausreißermonat oder ein
besch…eidenes Quartal. Nein, Fink verlor 100 Millionen
Dollar. »Heute wäre das ja kein großes Geld mehr, aber
damals …«, sinniert Finks ehemaliger Junior-Trader Doyle.
In der First-Boston-Chefetage schrillte der Alarm. Fink und
seine Leute hatten Zinsbewegungen falsch vorhergesagt.
Die US-Notenbank überraschte im März und April jenes
Jahres mit zwei Zinssenkungen in Folge. Angesichts der
fallenden Zinsen war abzusehen, dass amerikanische
Hausbesitzer ihre alten Hypotheken mit höheren Zinsen
bald reihenweise durch neue Hypotheken mit niedrigeren
Zinsen ablösen würden. Quasi über Nacht explodierte das
gefürchtete Risiko der frühzeitigen Rückzahlung für die
Hypothekenpapiere. Und Finks Abteilung saß auf einem
Berg von Papieren, die nun niemand mehr haben wollte, die
sich nur unter massiven Verlusten losschlagen ließen. Fast
über Nacht wurde Fink vom Liebling der First-BostonBosse zum Unberührbaren. Er wurde nicht rausgeworfen,
jedenfalls nicht direkt. Es gibt an der Wall Street bis heute
subtilere Mittel und Wege, jemanden loszuwerden. Du bist
plötzlich nicht mehr bei den richtigen Meetings, wichtige
Informationen gehen an dir vorbei. Du bist auf der Do-notcall-Liste. Niemand will mehr mit dir gesehen werden,
nicht mal im Aufzug. Deine einstigen Erfolge, die Profite,
die du dem Haus beschert hast: vergessen. Du bist Gift.
Noch schlimmer kam es für Larry. Als er schließlich
aufgab und seinen »freiwilligen« Abschied einreichte,
meldete das Wall Street Journal, ein Sprecher von First
Boston habe erklärt, Fink hätte nicht die Möglichkeit
gehabt in seiner aktuellen Position zu bleiben. Nicht einmal
die Formel mit den »neuen interessanten Projekten«, die
auf den Geschassten warteten, gönnten ihm seine
Arbeitgeber. Sie traten nach. Die Wall-Street-JournalMeldung kam einer Grabsteininschrift gleich – einem
Grabstein für das abrupte Ende einer vielversprechenden
jungen Karriere. Aus Larry war Loser Larry geworden. Bis
heute sitzt der Schlag tief. Als Reporter ihn 2010 – also
mehr als 20 Jahre später – danach fragten, sei er sichtlich
betroffen gewesen. Er habe sich so heftig an seinem Sessel
festgehalten, dass die Knöchel weiß hervorgetreten seien,
berichtete die High-Society-Postille Vanity Fair von einem
Treffen mit Fink.
Immerhin könnte Larry Fink inzwischen Genugtuung
empfinden. Denn First Boston ging nicht lange nach seinem
forcierten Abschied unter. Schuld war eine Episode, die an
der Wall Street als »das brennende Bett« in die Annalen
einging. Das ging auf einen Film zurück, in dem Farrah
Fawcett eine misshandelte Ehefrau spielt, die schließlich
ihren Gatten im Bett anzündet. Der Filmtitel wurde an der
Wall Street zum Spottnamen für First Bostons letzten
großen Deal. Die Bank hatte – mitgerissen vom
Aufkauffieber – die Übernahme des Matratzenherstellers
Sealy durch eine Private-Equity-Gesellschaft, einen der
Firmenjäger, vorfinanziert. Es ging um einen traumhaften
Preis von 1,8 Milliarden Dollar. Der Kredit, den First
Boston gegeben hatte, sollte durch die Ausgabe von Junk
Bonds – Müllbonds – an Anleger zurückgezahlt werden.
Junk Bonds heißen diese Unternehmensanleihen deshalb,
weil sie höchst riskant sind. Und das zeigte sich bei der
Sealy-Transaktion in aller Brutalität: Die Junk-Bond-Blase
der 1980er platzte just zu diesem Zeitpunkt, die SealyAnleihen fanden keine Abnehmer und First Boston – eine
Institution seit 1932 – hatte plötzlich ein Milliardenloch.
Die Schweizer Banker der Credit Suisse, vorher schon
Partner der Bank, sprangen ein und übernahmen den
angeschlagenen Laden. Credit Suisse First Boston hieß,
etwas ungelenk, die kombinierte Bank. Eine Weile. Als die
Credit Suisse 2006 dann den Namen First Boston fallen
ließ, war von Finks erstem Arbeitgeber an der Wall Street
nicht einmal mehr der Name übrig.
Blackstone oder: Der Anfang im Hinterzimmer
Nach seinem spektakulären Absturz blieb Fink fast zwei
Jahre auf dem Abstellgleis bei First Boston. Dann bekam er
eine neue Chance. Im Februar 1988 meldete sich eine
Firma namens Blackstone bei ihm. Dahinter verbarg sich
ein ungleiches Paar: Steve Schwarzman und Pete Peterson.
Schwarzman war ein »Dealmaker«, ein Spezialist für
Fusionen und Übernahmen, der es bei der Investmentbank
Lehman Brothers schon in jungen Jahren zum Partner
gebracht hatte – und entsprechend selbstbewusst auftrat.
Bei Lehman hatte Schwarzman auch Peterson
kennengelernt. Peterson war ein politischer Kopf, er war
lange in Washington gewesen, bevor er an die Wall Street
wechselte, zeitweilig war er Wirtschaftsminister in Nixons
Kabinett. Aus seiner früheren Tätigkeit brachte Peterson
ein »goldenes Adressbuch« mit. Als Lehman Brothers, die
Bank, deren Untergang später die Welt beinahe mitriss,
damals schon einmal der Pleite entgegenrutschte, taten
Schwarzman und Peterson sich zusammen und starteten
ihre eigene Beteiligungsgesellschaft. Sie sahen eine
Chance in dem damals noch jungen Gebiet der
Heuschrecken, pardon, Private Equity. Firmen, die darauf
spezialisiert sind, mit günstiger Finanzierung – meist mit
besagten Müllanleihen, also Junk Bonds – Unternehmen
oder Unternehmensteile aufzukaufen. Die Unternehmen
sollten dann umstrukturiert und vor allem umfinanziert und
schließlich mit Gewinn weiterverkauft oder an die Börse
gebracht werden. Peterson mit seinem goldenen
Adressbuch hatte die Verbindungen, den Zugang zu den
Chefetagen von Corporate America und zu den
Verwaltungsräten der Pensionskassen, die in die neue
Private-Equity-Gesellschaft investieren sollten.
Schwarzman wusste, wie man den finanziellen Teil
arrangiert, sodass genügend für die Gesellschafter
hängenblieb. Auf den Namen für ihre junge Firma kamen
die beiden Gründer angeblich über ihre eigenen Namen:
Schwarzman lieferte das Schwarz, also Black. Und
Peterson übersetzte seinen Namen frei aus dem
Altgriechischen: Petros, der Stein. So wurde Blackstone
aus der Taufe gehoben.
Schwarzman und Peterson wollten ihre Investmentfirma
um weitere Geschäftszweige ergänzen, darunter etwa eine
Fixed-Income-Abteilung, die in Anleihen und Rentenpapiere
investieren würde. Fink, der von einem Kollegen empfohlen
wurde, schien trotz des Blutbads, das ihn die Karriere
gekostet hatte, der ideale Kandidat. Die Blackstone-Chefs
akzeptierten Finks Erklärung, es habe an einem
Computerfehler und schlechter Datenerfassung gelegen.
So boten die beiden Fink ein Joint Venture namens
Blackstone Financial Management (BFM) an. 50 Prozent
des neuen Unternehmens gehörten Blackstone, 50 Prozent
Larry Fink und seinem Team, das er mitgebracht hatte.
Blackstone gab Fink 5 Millionen Dollar als Kreditlinie zum
Start – ein Witz an der Wall Street – und Finks Team legte
los. Zunächst hatten sie nicht einmal eigene Räume, sie
waren Untermieter im Handelsraum der Investmentbank
Bear Stearns. (Die Bank war 2008 das erste Opfer der
großen Krise.)
Doch Schwarzman und Fink waren alles andere als ideale
Partner. Schwarzman war Investmentbanker. Er beäugte
Trader mit Misstrauen. Verluste machten ihn nervös. Und
Schwarzmans Ego ist bis heute legendär. Selbst an der Wall
Street fiel er immer wieder durch seinen Hunger nach Geld
und Status auf. »Es gibt mehr Gerüchte über seine Partys
als über seine Deals«, spottete einmal die New York Times.
Da hatte Schwarzman für seine Fete zum 60. Geburtstag
die Park Avenue Armory gebucht, eine zur
Veranstaltungshalle umgebaute Kaserne aus dem 19.
Jahrhundert, an der noblen Upper East Side. Rod Stewart
spielte ein Geburtstagsständchen und kassierte 1 Million
Dollar dafür. Die Schlange der schwarzen Luxuslimousinen
reichte um den Block, ihnen entstiegen die Chefs der
großen Banken wie Jamie Dimon von JPMorgan Chase und
Lloyd Blankfein von Goldman Sachs. Immobilien-Mogul
Donald Trump, am Arm Melania, die junge Gemahlin
Nummer drei. Auch Edward Egan, damals der Kardinal von
New York, gab sich die Ehre und Sir Howard Stringer, zu
dem Zeitpunkt Aufsichtsratsvorsitzender von Sony. Die
Armory hätte Schwarzman nur gebucht, so lautete der
Spott, weil sie intimer gewesen sei als Schwarzmans 30Millionen-Dollar-Appartment ein paar Blocks davon
entfernt. Das hatten sich Schwarzman und seine Frau wie
eine Nachbildung ihres Sommer-Palais in St. Tropez
einrichten lassen. Amüsiert wurde an der Street jene
Geschichte aus dem Wall Street Journal herumgereicht, in
der es um die Vorlieben und Abneigungen des King of Deals
ging: Er lasse sich frische Stone Crabs für 400 Dollar pro
Krebs einfliegen und seinen Butler habe er gescholten, weil
die Kreppsohlen seiner Schuhe zu laut und störend
geknarzt hätten, als Schwarzman sich am Pool seiner 1
000-Quadratmeter-Villa auf der Reicheninsel Palm Beach in
Florida zu entspannen suchte. Zudem habe er nicht die
vorschriftsmäßigen schwarzen Schuhe getragen. Weltweit
in die Schlagzeilen kam Schwarzman später, als er Obama
mit Hitler verglich. Grund war die Ankündigung des
Präsidenten, er wolle die Steuern für Wohlhabende und vor
allem für Hedgefonds- und Private-Equity-Manager
erhöhen. (Schwarzman entschuldigte sich später für den
Vergleich.)
Fink und Schwarzman gerieten bald aneinander. 1992
hatte ihr Joint Venture 8 Milliarden Dollar an
Anlegerkapital einsammeln können und warf 13 Millionen
Dollar an Gewinn ab. Fink wollte weiter wachsen.
Blackstone sollte dafür weitere Eigentumsanteile abgeben.
Diese Anteile wollte Fink dann dazu nutzen, um mehr
Talente zu BFM zu locken. Mit den Anteilen sollten neue
Partner geködert werden. Doch Schwarzman sperrte sich.
Damals habe sich Schwarzman in einem erbitterten
Scheidungskrieg mit seiner Frau Ellen befunden, so
berichten David Carey und John Morris, die eine Biografie
über Schwarzman geschrieben haben. Das habe ihn nach
Ansicht von Kollegen unnachgiebig gegenüber Fink
gemacht.
Da wollte auch Fink die Scheidung. Er fand einen
Investor, die PNC Bank in Pittsburgh, die 240 Millionen
Dollar bot. Und dann verlangte Fink, Blackstone solle die
Anteile aus dem Joint Venture an die Bank verkaufen.
Schließlich gab Schwarzman nach. Im Juni 1994 wurde
BFM, das inzwischen in BlackRock umgetauft worden war,
an PNC verkauft. Schwarzman kassierte 25 Millionen
Dollar. Genug, um seine Scheidung von Ellen
wettzumachen, die ihn laut dem Wirtschaftsmagazin
Businessweek rund 20 Millionen Dollar gekostet hatte.
Doch Schwarzman hat eingeräumt, er bereue den Verkauf
bis heute. Damit sind ihm mehr als 1 Milliarde Dollar
entgangen. Nicht, dass ihn das zum armen Mann gemacht
hat – schließlich kassierte er beim Börsengang von
Blackstone 2007 rund 700 Millionen Dollar und er ist heute
mit einem Vermögen über 10 Milliarden Dollar die reichste
»Heuschrecke«. Doch jemand wie Schwarzman verzeiht es
sich nicht, wenn ihm ein guter Deal durch die Lappen geht.
Eine Frage der Wall-Street-Ehre. Da tröstet es den PrivateEquity-König wohl kaum, dass niemand, nicht einmal Fink
selbst, hatte wissen können, welch spektakulären Aufstieg
die Firma haben würde, die einst als kleines Nebengeschäft
von Blackstone begonnen hatte.
Damit kam der Fels ins Rollen: BlackRock
Also hatte Larry nun sein eigenes Unternehmen an der Wall
Street. Das klingt eindrucksvoller, als es ist, denn viele
Banker und Trader machen sich irgendwann selbstständig.
»Hanging up your own shingle« – sein eigenes Schild
draußen an die Tür nageln, so nennt es die Branche. Lew
Ranieri etwa, Finks alter Rivale von Salomon Brothers, hat
auch seine eigene Firma. Er war 1987 bei Salomon
abserviert worden. Sein Name ist in gewissen Kreisen
immer noch ein Begriff, doch er gilt als ein Has-Been,
Vergangenheit. »Der lebt praktisch immer noch von seiner
Legende bei Salomon – und das ist bald 30 Jahre her«, sagt
ein Veteran der Hypothekenbranche, der fast genauso
lange dabei ist.
Aber Fink unterschied etwas Grundsätzliches vom Gros
der Wall-Street-Meute. Fink hatte seine Fehler nicht
vergessen. Und er lernte daraus. Die schmerzliche Episode
bei First Boston bescherte Fink sogar die Erleuchtung, die
seine Firma in einen globalen Koloss verwandeln würde.
Seine Eingebung sollte die Wall Street grundsätzlich
verändern.
Fink selbst pflegt die Legende vom Fehler, der ihn am
Ende vom Loser-Larry zum Gold-Finken gemacht hat. Dabei
geht er hart mit sich ins Gericht. Sein Fehler sei nicht erst
der 100-Millionen-Dollar-Verlust gewesen, sein Fehler seien
schon die Hunderte-Millionen-Gewinne davor gewesen.
Denn er und sein Team hätten nicht verstanden, wie diese
Gewinne eigentlich zustande kamen. Sie hätten das Risiko,
das sie mit ihren Handelstransaktionen eingingen, nicht
verstanden. Die damaligen Computerprogramme seien viel
zu grob gewesen, nicht in der Lage zu kalkulieren, was
passieren würde, wenn wichtige Variablen wie die
Zinsentwicklung sich änderten. Und deshalb seien sie von
den Verlusten überrollt worden. »Wir wussten nicht, warum
wir so viel Geld verdienten. Wir hatten nicht die
notwendigen Instrumente, um das Risiko zu verstehen, das
wir eingingen«, gestand er in einem Interview viele Jahre
später. Sein Schluss daraus: Er wollte nie wieder in eine
Position geraten, in der er die Risiken nicht abschätzen
konnte. Nie mehr. Und er und sein Team gingen daran, ein
System zu bauen, das Finks Besessenheit, alle Risiken zu
erfassen, Genüge tun würde. BlackRock verabschiedete
sich von Trader-Instinkten und versuchte sie stattdessen
durch Computermodelle zu ersetzen, die mit immer mehr
Informationen gefüttert werden. Lange schon bevor Big
Data als Begriff existierte, hatten Fink und sein Team die
Möglichkeiten im Visier, die Informationen bedeuten. Sie
seien fast schon »paranoid, wenn es um Risiko geht«, das
sagen BlackRock-Vertreter gerne mit einem überlegenen,
wissenden Lächeln. Die immer wieder angeführte
Risikoparanoia des Gründers ist bei BlackRock zum System
geworden, ein Credo, mit dem das Unternehmen heute um
Kunden wirbt.
Risikobesessenheit ist ein Teil von Finks Erfolgsgeheimnis.
Aber wie ein ehemaliger BlackRock-Mitarbeiter lästert, ist
es nicht so, als ob BlackRock als einziges Investmenthaus
Risiken erkennen kann oder entsprechende Systeme
aufgebaut hat. »Die machen gerne eine Menge Wind um
sich«, sagt er über seinen ehemaligen Arbeitgeber. Doch
auch er räumt ein, dass Fink eine Ausnahmeerscheinung im
Gewerbe sei. Was Fink auszeichnet: Er überschritt eine
jener Grenzen, die sich für Außenstehende kaum erkennbar
durch die Finanzindustrie ziehen. Die Wall Street ist wie
ein Korallenriff: Es gibt Zebrafische, Clownfische,
Anemonen und Barracudas, es gibt Haie und
Putzerfischchen, Tintenfische, Seeigel, Schnecken und
Quallen. So wie jedes Lebewesen seinen Platz in diesem
Unterwasserkosmos hat, so gibt es an der Wall Street eine
Vielfalt verschiedener Jobs. Und wie im Riff leben manche
in einer Symbiose und andere in einem Beuteschema
zusammen. Es gibt Investmentbanker, Aktienhändler und
Bondtrader, Analysten und Ökonomen, HedgefondsManager und High-Frequency-Zocker, Private-EquityMogule, Börsenaufseher und Ratingagenturen.
Aber es gibt einen Graben, der vor Fink nur selten
überbrückt wurde. Das ist der Graben zwischen der SellSide und der Buy-Side. Ganz grob ist es ein Graben
zwischen denjenigen, die Anlagen anbieten oder vermitteln,
und denjenigen, die Geld anzulegen haben. Auf der Buy-
Side finden sich alle Arten von Anlegern: Hedgefonds,
Investmentfonds, Pensionskassen, Stiftungen, Versicherer
und auch Kleinanleger. Auf der Sell-Side finden sich
Investmentbanker, die den Anlegern Unternehmensanteile
oder Bonds anbieten, Analysten, die ihnen ResearchBerichte und Kursprognosen andienen. Da sind
Handelsabteilungen, die im Auftrag der Buy-Side Aufträge
ausführen, Aktien oder Anleihen kaufen und verkaufen.
Bis zum Auftauchen von Fink ließen sich die Käufer auf
der Buy-Side – abgesehen von den Hedgefonds – von den
Anbietern auf der Sell-Side Angebote machen, sich von
ihnen informieren. Man muss sich das so vorstellen: Ein
Unternehmen, etwa Walt Disney oder McDonald’s, wird von
einer Bank bezüglich der Kapitalstruktur beraten – wie viel
Eigenkapital sollte es haben, wie viele Aktien soll es
ausgeben, wie viele Schulden soll es aufnehmen, um
möglichst rentabel zu wirtschaften? Dann arrangieren die
Banker, entsprechend neue Aktien oder Anleihen
auszugeben, und offerieren diese Papiere anschließend
Investoren, also der Buy-Side.
Doch die Sell-Side als Anbieter hat immer einen
Wissensvorsprung – schließlich sind ihre Vertreter es, die
die Deals und Transaktionen aushecken. Wer auf der SellSide arbeitet, ist vor allem gut in der Vermarktung – seines
Produkts oder seiner Dienstleistung, vor allem aber seiner
eigenen Person.
Wichtig ist auch: Was auch immer dem Kunden
angeboten wird, es sollte genug hängen bleiben für den
eigenen Laden und den eigenen Bonus oder die Provision.
Für die Buy-Side existiert auf diese Weise ein ewig
ärgerliches Ungleichgewicht an Information. Und so viele
Milliarden die Buy-Side-Vermögensverwalter auch jeweils
steuern, kein Fonds kann einen Apparat wie den einer Bank
aufziehen. Darin liegt eine Erklärung, warum
Ratingagenturen eine so große Rolle mit ihren
Bewertungen spielen – die Buy-Side sah darin zumindest
bis zur Krise 2008 einen neutralen Schiedsrichter zwischen
den beiden Seiten. Doch die Ratings reichten nicht, um das
Informationsungleichgewicht zwischen Sell- und Buy-Side
auszugleichen – zumal die Hypothekenkrise bei vielen BuySide-Investoren Zweifel an der Neutralität der Ratings
aufkommen ließ. Zu viele Hypothekenpapiere, die von den
Rating-Richtern mit der Bestnote AAA versehen worden
waren, stellten sich dann als Rohrkrepierer in den
Anlageportfolios heraus. Im Januar 2015 legte Marktführer
Standard & Poor’s eine Untersuchung des USJustizministeriums wegen angeblich unzulässiger Praktiken
bei den Ratings der Hypothekenpapiere mit einem 1,37Milliarden-Dollar-Vergleich bei. S&P erklärte, der Vergleich
sei kein Schuldeingeständnis. Beim Rivalen Moody’s
dauerten die Ermittlungen bei Drucklegung noch an.
In dem Ungleichgewicht zwischen Buy- und Sell-Side sah
Fink seine große Chance: Er – ein waschechter Vertreter
der Sell-Side – würde sein Insiderwissen der Buy-Side zur
Verfügung stellen. Er würde Computermodelle aushecken,
mit denen sich Kalkulationen anstellen ließen, wie sie die
Sell-Side vornimmt – sogar bessere Systeme. Fink würde
mit BlackRock der Buy-Side jenen Vorteil verschaffen, den
bisher nur die Jungs von der Sell-Side hatten. Was für
Außenstehende banal klingt, war für die Wall Street ein
Aha-Erlebnis.
Acht Freunde müsst ihr sein: Das
Gründungsteam
Um seine große Vision zu verwirklichen, musste Fink für
BlackRock allerdings die richtigen Leute haben. Wie
Captain America suchte sich Fink sein BlackRock-Team
zusammen. Acht Gründungspartner waren es schließlich.
Da gab es Ralph Schlosstein. Er war in den 1970ern
Wirtschaftsberater beim Erdnussfarmer-Präsidenten Carter
gewesen. Später ging er – wie so viele in DC – zum
Geldverdienen an die Wall Street und zwar zu Lehman
Brothers. Schlosstein brachte auch Susan Wagner an Bord.
Wagner, genannt Sue, war bei Lehman eine Spezialistin für
strategische Übernahmen gewesen – eine Expertise, die für
die spätere Expansion von BlackRock von maßgeblicher
Bedeutung werden sollte. Hugh Frater hatte bei Lehman
als Investmentbanker im Bereich Hypothekenfinanzierung
gearbeitet.
Keith Anderson kam aus Finks altem Stall, aus der
Hypothekenhandelsabteilung von First Boston. Barbara
Novick ebenfalls, sie hatte nach ihrem Wirtschaftsstudium
zunächst beim Prestige-Haus Morgan Stanley gearbeitet.
Auch Bennett Golub kam von First Boston, dort hatte er die
Finanzingenieure angeführt und war mit Fink in Kontakt
gekommen. Er und seine Gruppe waren in dieser Zeit für
25 Milliarden Dollar an Verbriefungen von Hypotheken zu
CMOs zuständig. Golub, der einen Doktortitel der Bostoner
High-Tech-Schmiede MIT vorweisen konnte, fiel die
Aufgabe zu, BlackRocks erste Analysesysteme zu bauen.
Zur BlackRock-Gründungslegende gehört auch, dass Golub
dafür eine Sun Microsoft Workstation kaufte und sie in der
Teeküche zwischen Kühlschrank und Kaffeemaschine
installierte. Auf diesem Computer programmierte Golub
seine ersten Modelle, um Hypothekenportfolios zu
analysieren. Als Hilfe für Golub heuerten die Gründer
Charles Hallac an, den Golub noch aus seinen Zeiten bei
First Boston kannte. Hallac war BlackRocks erster richtiger
Angestellter. Heute ist er aufgestiegen und Co-Präsident.
Überhaupt hat sich die Truppe der Acht als extrem loyal
erwiesen. Noch heute sind fünf der einstigen Gründer bei
BlackRock beschäftigt. Das ist für Wall-Street-Verhältnisse
eine Ewigkeit.
Und dann ist da Rob Kapito. Finks Partner von einst bei
First Boston. Kapito war in Finks Abteilung, als Fink seine
ersten Schritte mit den CMOs tat. Er hatte erst seine
Höhenflüge und dann seinen Absturz miterlebt. »Viele
Chefs an Finks Stelle hätten Kapito den schwarzen Peter
hingeschoben, Fink hätte das auch machen können«,
erzählt ein Mitarbeiter von damals. Doch Fink tat etwas
ganz anderes. Er nahm Kapito mit. Und machte ihn zum
Partner in seinem neuen Unterfangen. Das fundamentale
Band zwischen den beiden ist bis heute nicht abgerissen.
Während Fink das öffentliche Gesicht von BlackRock
wurde, übernahm Kapito die Rolle der grauen Eminenz. Er
ist der Mann, der die Märkte im Blick hat, der aufpasst,
dass BlackRock keine Entwicklung verpasst. Er ist es, der
die Organisation intern auf die Vision der Gründer, auf
Finks Vision trimmt.
Wie Fink kommt auch Kapito aus kleinen Verhältnissen.
Seine Familie betrieb eine Autowerkstätte in Monticello,
einem Ort in den Catskills, dem Mittelgebirge, geografisch
etwa 90 Kilometer von Manhattan entfernt und sozial so
weit weg wie der Mond. Kapitos Vater erlitt einen
Schlaganfall, als er erst 13 Jahre alt war. Er schaffte es
trotzdem, sich ein Studium zu finanzieren, sogar den
Abschluss an der elitären – und entsprechend teuren –
Wharton School der University of Pennsylvania erarbeitete
er sich. (Heute ist er dort im Stiftungsrat.) Nach dem
Studium zog es auch Kapito an die Wall Street und auch er
landete bei First Boston. Nach zwei Jahren verließ er die
Bank wieder, um an der Harvard Business School einen
MBA abzulegen. Als er mit dem Diplom in der Tasche 1983
wieder zu First Boston zurückkehrte, heuerte er im Bereich
Hypotheken an – und traf auf Larry Fink. Eine Begegnung,
die ihn Jahrzehnte später zu einem der mächtigsten
Männer der Finanzbranche machen sollte.
Der entscheidende Auftrag von Neutronen-Jack
1994 war in mehrfacher Hinsicht ein Schicksalsjahr für
BlackRock. Erst kam die Trennung von Blackstone. Und
dann der Auftrag, der die kleine Hinterzimmerfirma zur
ersten Adresse machen sollte. Es begann mit einer
Mesalliance. Auf der einen Seite, als Bräutigam sozusagen,
stand General Electric. Der Konzern, der Erfinderikone
Thomas Edison zu seinen Gründervätern zählt (GE besitzt
Edisons Schreibtisch immer noch), wird gerne als die »USWirtschaft in einer Nussschale« bezeichnet. Gemeint ist,
dass der Konzern in fast allen Sektoren der Wirtschaft
mitmischt. Buchstäblich: Von der Glühbirne, über
verschiedene Kraftwerksanlagen, Krebsfrüherkennung und
Flugzeugteile bis zum Internet der Dinge ist alles im
Portfolio. Mitte der 1980er glaubte General Electric auch
im Bereich Finanzen mitspielen zu müssen. Und kaufte
Kidder Peabody, einst ehrwürdiges Wall-Street-Haus,
gegründet von Henry P. Kidder und zwei Peabody-Brüdern
am Ende des amerikanischen Bürgerkriegs im Jahre 1865.
Doch von der alten Ehrwürdigkeit war nicht viel geblieben,
wie die Manager von GE schnell feststellen mussten. Die
Tinte auf dem Kaufvertrag war noch nicht ganz trocken, da
rückten staatliche Ermittler an. Insiderhandel lautete ihr
Vorwurf. Einer der Beteiligten wurde in Handschellen aus
seinem Büro abgeführt – eine Episode, die Oliver Stone in
seinem Hollywood-Reißer Wall Street verwendete. »Wir
hätten Kidder Peabody nicht mal mit einer zehn Fuß langen
Stange angefasst, wenn wir gewusst hätten, was für ein
Stinktier sich in der Firma befindet«, giftete Jack Welch,
GEs damaliger Vorstandschef. Kidder Peabody überlebte
die Insider-Affäre – nur um 1994 in einen neuen Skandal
verwickelt zu sein. Dieses Mal ging es um
Phantombuchungen. Joseph Jett, ein Bondtrader, hatte das
Computerprogramm so manipuliert, dass sein Handel
enorme Gewinne auswies – 350 Millionen Dollar, um genau
zu sein. Tatsächlich machte er massive Verluste. Dieses Mal
verlor Welch, der von General-Electrics-Angestellten auch
Neutronen-Jack genannt wurde, endgültig die Geduld. Er
beschloss, Kidder Peabody zu zerschlagen und die
Einzelteile zu verkaufen. Abnehmer war schließlich
PaineWebber – eine Bank, die später wiederum von der
Schweizer UBS aufgekauft wurde.
Doch bei einem 10 Milliarden schweren
Hypothekenportfolio aus Kidder Peabodys Beständen
lehnten die PaineWebber-Leute dankend ab. Das Portfolio
bestand aus CMOs – jenen Instrumenten, die Fink mit aus
der Taufe gehoben hatte. Doch es war schwer zu bewerten,
was dieser Pool aus verschiedenen Darlehen wirklich wert
war. GE war kurz davor die Papiere zu Dumpingpreisen zu
verschleudern – Hauptsache, sie waren die »Stinktiere«
endgültig los. Doch da meldete sich BlackRock und machte
einen ungewöhnlichen Vorschlag: Statt eines raschen, aber
verlustreichen Ausstiegs schlugen Fink und sein Team vor,
das Portfolio mithilfe von BlackRocks Computermodellen zu
analysieren und einen Plan zu entwickeln, wie General
Electric die Hypothekenpapiere nach und nach losschlagen
und einen besseren Preis erzielen könne. Die GE-Leute
waren interessiert. Und Finks Team ließ seine Rechner
brummen. Der Auftrag war ein voller Erfolg. Der sich
herumsprach.
»Das Kidder-Peabody-Portfolio galt damals als eines der
komplexesten Investmentpools überhaupt«, sagt Rob
Goldstein, der heute BlackRock Solutions leitet, den
Geschäftszweig der aus der GE-Erfahrung entstand. Mit
dem Auftrag des größten Konzerns der Welt kam für
BlackRock der Durchbruch. Nach dem GE-Job standen die
Interessenten Schlange. »Es war wie bei den Geisterjägern
in dem Hollywoodstreifen Ghostbusters – wer ein
undurchsichtiges Portfolio oder fragwürdige
Vermögenswerte hatte, rief bei Larry Fink und Co. an«,
sagt ein Insider.
Wachsen, wachsen, wachsen
Schon drei Jahre nach der Übernahme durch die PNC Bank
hatten sich Fink und seine Getreuen so etabliert, dass
ihnen Investoren 46 Milliarden Dollar anvertrauten. Damit
hatte sich das verwaltete Kapital seit der Übernahme durch
PNC gut verdoppelt, berichtete das Fachblatt Penions &
Investments 1997 anerkennend. Ein Jahr darauf fusionierte
der Mutterkonzern PNC – jene Banker aus Pittsburgh, die
Fink bei seiner Trennung von Blackstone geholfen hatten –
seinen Vermögensverwaltungsarm mit BlackRock. Damit
bekam Fink mit einem Schlag 108 Milliarden Dollar
zusätzliches Kapital unter seine Fittiche. Dann wollten die
PNC-Banker auch mal ein wenig Geld sehen. Sie brachten
BlackRock am 1. Oktober 1999 an die Börse und verkauften
14 Prozent ihres Anteils. Fink und seine Partner behielten
16 Prozent. (Heute hält die PNC Bank laut ihrer Webseite
noch etwa ein Viertel an BlackRock). Mit 650 Mitarbeitern
und einer Börsenbewertung von knapp 900 Millionen
Dollar war BlackRock zu Amerikas fünftgrößtem
börsennotierten Vermögensverwalter aufgestiegen. Nicht
schlecht für einen geschassten Investmentbanker. Doch
Larry Fink war noch lange nicht fertig. Noch lange nicht.
Abgesehen vom Börsengang hörte man in den 1990er
Jahren öffentlich nicht viel von BlackRock. Die DotcomEuphorie hatte die Wall Street, ja die halbe Welt ergriffen.
Das Internet und seine unendlichen Möglichkeiten lockten
Anleger, ob groß oder klein. Eine New Economy dämmerte
angeblich. Es war eine Zeit, in der es gefühlt nur Stunden
dauerte, bis eine auf einer Dunkin-Donut-Serviette
skizzierte Geschäftsidee an der Nasdaq ihr Börsendebüt
feierte. Das war nichts für Fink und seine Leute. Sie
blieben hauptsächlich ihren Anleihen treu – eine Ecke des
Kapitalmarkts, die in jenen Jahren Spinnweben anzusetzen
schien. Doch jenseits der grellen Schlaglichter der Tech-
Aktien wuchs und gedieh Finks Unternehmen. Als die Blase
Anfang der 2000er Jahre schließlich platzte, schienen die
Langweiler von BlackRock mit ihren Bonds in den Augen
gebrannter und enttäuschter Anleger plötzlich wie
Propheten. Ende 2000 – gerade als die Nasdaq in einen
ausdauernden Sinkflug abtauchte – konnte Fink 200
Milliarden Dollar an Vermögen unter BlackRockManagement melden. Um das Angebot für die Kunden –
Pensionskassen, Investmentarme von Unternehmen,
wohlhabende Privatleute – abzurunden, kaufte BlackRock
Hedgefonds dazu. 2004 übernahm BlackRock SSRM
Holdings, den Investmentarm des Lebensversicherers
MetLife. 2005 verwaltete BlackRock damit bereits über 400
Milliarden Dollar. Und damit landete das Unternehmen auf
der Liste der 20 größten Vermögensverwalter weltweit.
Doch Larry Fink war noch lange nicht fertig. Noch lange
nicht.
Erst kam jedoch ein Rückschlag. Oder zumindest lauten
so die Gerüchte an der Wall Street. Zunächst war es ein
richtiger Coup, den Fink mit Stan O’Neal diskret beim
Frühstück im »Three Guys« ausheckte. In dem
unauffälligen New Yorker Diner an der Madison Avenue,
das die üblichen Hash Browns und Rühreier zum Kaffee
serviert, vermutete bei den beiden Gästen wohl kaum
jemand zwei Finanz-Mogule, die einen Pakt schlossen.
O’Neal war der Vorstandschef von Merrill Lynch. Mother
Merrill, wie das Wall-Street-Haus liebevoll genannt wird,
gehört zu den großen Namen. Stolz war man bei Merrill auf
die »thundering herd«, die donnernde Herde der MerrillBroker, die alles, was Merrills Investmentbanker an
Anleihen oder Aktien anschleppten, in ganz Amerika
verticken konnten. Niemand an der Street verfügte über
ein so gewaltiges Vertriebsnetz. Im Logo sah man den
angriffslustigen Bullen geradezu mit den Hufen scharren
und schnauben. Einige Tage nach dem Frühstück gaben
Merrill Lynch und BlackRock bekannt, dass die
Fondssparte von Merrill mit BlackRock fusionieren würde
und im Gegenzug Merrill Lynch 49,8 Prozent der Anteile an
BlackRock übernehmen würde. Bumm! Der Deal war so
überraschend, dass ein Hedgefonds-Manager klagte, er
müsse eigentlich gegen den Verlierer bei der Transaktion
wetten, aber es sei nicht klar, wer wem die Hosen
ausgezogen habe. BlackRock hatte es jedoch geschafft, vom
No-Name-Start-up zum Partner eines der anerkanntesten
Wall-Street-Häuser zu werden. Für Stan O’Neal war es die
letzte gute Tat. Kurz darauf kam zutage, wie sehr Mother
Merrill sich bei den Hypothekenpapieren verkalkuliert
hatte. Merrill gehörte zu den Banken, die die
Wackelhypotheken selbst begeistert in ihre Portfolios
packte (andere waren schlauer und verkauften sie schnell
an Investoren – etwa an Landesbanken jenseits des
Atlantiks …). 2007 wurde O’Neal gefeuert. Und Fink wollte
ihn beerben. Das ist unstrittig. Strittig ist, wie scharf er auf
den Topjob bei Merrill war. Er behauptete in einem
Interview Jahre später, er habe es lediglich als eine Option
betrachtet. Und er habe vollen Einblick in die Bücher
verlangt, was der Merrill-Aufsichtsrat nicht zugelassen
habe. Daraufhin habe er sich aus dem Rennen genommen.
Andere kolportieren, dem Aufsichtsrat seien die
potenziellen Interessenkonflikte zu gefährlich gewesen, die
entstanden wären, hätte Fink sowohl BlackRock als auch
Merrill geleitet.
Tatsache ist, dass sich Mother Merrill für John Thain
entschied. Jetzt muss man wissen, dass Fink und Thain wie
Feuer und Wasser sind. Thain – mindestens so ehrgeizig
wie Fink – hatte erst bei Goldman Sachs Karriere gemacht
und als er da nicht auf den Topposten kam, war er an die
Spitze der New Yorker Börse gewechselt. Was genau Fink
an Thain aufregt, darüber wird nur gemunkelt. Spekuliert
wird, ob es schlicht daran liegt, dass Thain, der mit seinem
vollen dunklen Haarschopf und der Brille ein wenig wie
Supermans Alter Ego Clark Kent aussieht, im Gegensatz zu
Fink auf der Sonnenseite der Wall Street geblieben war.
Auch Thain war gleich nach dem Studium an die Wall
Street gegangen. Doch anders als Fink marschierte er ohne
größere Rückschläge in die obere Etage durch. Eine so
steile Karriere, dass ihr das Insider-Blatt Institutional
Investor einmal eine eigene Geschichte widmete. Titel:
»Die Abenteuer von SuperThain«. Selbst bei Goldman galt
Thain als eiskalt und glatt, sein Spitzname »Thain the
Humane« war ironisch gemeint. Fink selbst hält sich
bedeckt. Als ihn Reporter fragten, ob es zutreffe, dass er
den stets glattrasierten und akkurat gescheitelten Thain
gerne »John-Boy« nach der Figur aus der TV-Familiensaga
Die Waltons nenne, schmunzelte der BlackRock-Chef
angeblich nur vielsagend.
Der Chefposten bei Merrill-Lynch, damit hätte Fink
seinen First- Boston-Karriereknick von einst mehr als
ausgebügelt. Er wäre der Leitbulle der »thundering herd«
gewesen. Doch Fink fand nun andere Wege, seinen Hunger
nach Anerkennung zu stillen. Die Wall Street war ihm bald
zu klein. Im Nachhinein, mag Fink gedacht haben, war es
sogar ein Glücksfall, dass er nicht Boss bei Merrill wurde.
Denn Merrill wurde kurz nach der Episode um Finks
Chefambitionen von den Verlusten aus den
Wackelhypotheken eingeholt. Thain schaffte es auf dem
Höhepunkt der Krise gerade noch, mit einem Handschlag
an einem Samstagvormittag im September 2008 Mother
Merrill an Ken Lewis, den Vorstandschef von Bank of
America, zu verkaufen, bevor mehr als 15 Milliarden Dollar
Verlust bekannt wurden. Ken Lewis hatte – ebenfalls
geblendet von Merrills Ruf – die Bank übernommen, ohne
genauer hinzuschauen. Er selbst behauptete später, Ben
Bernanke, der damalige Chef der US-Notenbank, habe ihn
angerufen und praktisch gezwungen, die Übernahme trotz
der tiefroten Bilanzen durchzuziehen. Für Lewis, der Bank
of America im Laufe seiner Karriere vom Provinzinstitut
aus South Carolina zum zweitgrößten Finanzkonzern der
USA ausgebaut hatte, wurde der Merrill-Deal zum bitteren
Karrieretod. Er hat inzwischen ein neues Betätigungsfeld
als Filmförderer in Charlotte gefunden. Thain verlor seinen
Posten bei der Bank of America, angeblich weil er sein
Merrill-Büro in den Krisenzeiten zu teuer renoviert hatte.
Genüsslich meldete Wall-Street-Klatschreporter Charlie
Gasparino im Daily Beast Details aus internen Unterlagen
wie die Gästestühle für 87 000 Dollar und eine Kommode
für 68 000. Am meisten Furore machten allerdings die 28
000 Dollar teuren Vorhänge und ein Mülleimer für
immerhin 1 400 Dollar. »John-Boy« Thain wechselte zur
Geschäftsbank CIT, die prompt in die Pleite schlitterte. Und
die »thundering herd«, kastriert als Teil der Bank of
America, trauert immer noch ihrer Unabhängigkeit nach.
Fink aber donnerte ungebremst weiter.
Kapitel 4
Die Finanzkrise oder auch:
BlackRocks größter Segen
Kurz vor dem Läuten der Handelsglocke an jenem Freitag
im März des Jahres 2008 war die Stimmung locker auf dem
Parkett der New York Stock Exchange. Die Händler
plauderten über die Pläne fürs Wochenende auf dem
Golfplatz. Da kam die Nachricht über den Ticker: Die
Investmentbank Bear Stearns in Not! Das, was die
Marktteilnehmer in den vergangenen Wochen immer
wieder als GAU befürchtet hatten – es war passiert! Schon
über ein Jahr platzten hier und da Deals, Hedge Funds
waren in Schwierigkeiten, von Bergen fauler
Hypothekenpapiere, auf denen Banken sitzen sollten, war
die Rede. Aber jetzt war die fünftgrößte USInvestmentbank in Schieflage geraten.
Es war ein tiefer Fall für den Bären, wie die 85 Jahre alte
Institution liebevoll genannt wurde. Nicht wenige
Innovationen gingen auf das Konto der smarten Jungs von
Bear Stearns. Dabei galten sie als die Schmuddelkinder
unter Wall-Street-Häusern. Bettelarm und davon beseelt,
reich zu werden. So wünschte sich der legendäre BearStearns-Chef Alan Greenberg, genannt Ace, seine
Bewerber. »Vergiss Büroklammern, bring deinen eigenen
Stift mit und sitz auf einem Klappstuhl«, das sei die Kultur
beim Bären gewesen, lästerte einmal Dealbreaker, die
Online-Klatschseite der Wall Street. Zwei Hedge Funds von
Bear Stearns waren im Sommer zuvor wegen
Fehlspekulationen mit Hypothekenpapieren geplatzt. Ihre
Milliardenimplosion markierte den Beginn der
internationalen Kreditkrise. Während sich diese Krise
zusammenbraute, weilte der damalige Vorstandschef von
Bear Stearns Jimmy Cayne allerdings meist auf dem
Golfplatz oder bei Bridge-Turnieren, wie das Wall Street
Journal berichtete. Auch als sich die Gerüchte über eine
gefährliche Geldklemme von Bear Stearns in der zweiten
Märzwoche 2008 zuspitzten, flog Cayne laut Fortune zu
den nordamerikanischen Bridge-Meisterschaften in Detroit.
Da er damals kein Handy besaß, sei er kaum zu erreichen
gewesen. Obwohl der Aktienkurs längst im freien Fall war,
blieb Cayne in Detroit – und schaltete sich verspätet in die
hastig einberufene Krisen-Telefonkonferenz ein, weil er
zunächst das Bridge-Turnier fortsetzte. Nachdem er kein
Privatflugzeug organisieren konnte, wartete Cayne
stundenlang in Detroit. (Auf die Idee, mit einer
Linienmaschine zu fliegen, kam er offenbar nicht.) Als er
dann schließlich am Abend in New York eintrudelte, wurde
er laut den Fortune-Reportern mit folgender Botschaft im
Büro empfangen: »Wir bekommen 8 bis 12 Dollar pro Aktie.
Das ist der Deal mit JPMorgan.« (Cayne hat der
Darstellung des Wall Street Journals widersprochen und
später gegenüber Fortune erklärt, er sei in der Zeit vor
dem Untergang des Bären schwer erkrankt gewesen.)
Organisiert hatte die Rettung auf die Schnelle die New
Yorker Notenbank. Sie wollte genau den Dominoeffekt
verhindern, der später bei Lehman Brothers tatsächlich
ausgelöst wurde. Es musste ein Käufer für den Bären her,
noch vor Montag, wenn die Finanzmärkte aus dem
Wochenende zurückkamen! Doch Bear Stearns hatte ein
»vergiftetes« Portfolio von 30 Milliarden Dollar, das
potenzielle Interessenten abschreckte. Und so überlegten
die Notenbanker das Gift-Portfolio mit den möglicherweise
verlustbringenden Hypothekenpapieren selbst zu
übernehmen. Und für die Betreuung und Abwicklung hatte
der Chef der New Yorker Notenbank, Timothy Geithner,
auch schon den passenden Ansprechpartner parat: Larry
Fink.
Pikant an dem Auftrag: Der Interessent, mit dem die
Notenbank über Bear verhandelte, war JPMorgan Chase.
Und Jamie Dimon, Vorstandschef von JPMorgan, hatte sich
am Tag zuvor auch bei Fink gemeldet. Er wollte die
BlackRock-Analysten ebenfalls auf die Bear-Stearns-Bücher
ansetzen. Sie sollten ihm eine Einschätzung über den Wert
geben. Entsprechend würde sein Angebot für Bear
ausfallen.
BlackRock bekam beide Aufträge. Jamie Dimon bot 2
Dollar pro Aktie für den Bären. Ein Affront für die BearStearns-Leute. Selbst als Dimon auf 10 Dollar
nachbesserte, blieb es nach Ansicht vieler an der Wall
Street ein Spottpreis. Noch heute knirschen Ehemalige mit
den Zähnen und nennen die Übernahme ein »Verbrechen«.
Der Deal war für Dimon dazu noch versüßt worden, denn
die Notenbank übernahm die riskanten Papiere aus dem
Gift-Portfolio, das den Untergang des Bären beschleunigt
hatte. Die gebündelten Papiere gehörten fortan unter dem
Namen »Maiden-Lane«-Fonds der Notenbank – also der
Allgemeinheit. Und BlackRock übernahm auftragsgemäß
die Abwicklung. (Maiden Lane ist übrigens der Name der
Straße, die in Lower Manhattan an der Notenbank
vorbeiführt. Der Name kommt noch von den Niederländern,
die dort einst siedelten. Die nannten den Pfad, der an
einem Bach entlanglief, Maagde Paatje, weil sich dort am
lauschigen Ort die Liebespaare Neu-Amsterdams
einfanden.)
Das Verblüffende an der Bear-Stearns-Transaktion war:
Offenbar stieß sich niemand an der Tatsache, dass
BlackRock auf beiden Seiten der geplanten Transaktion,
bei Käufer und Verkäufer gleichzeitig, aktiv war. Der BearStearns-Deal sollte zum Muster werden. BlackRock
verstand es geschickt, sich als Bewertungsprofi zu
positionieren, an dessen Neutralität keiner der Beteiligten
(offen) zweifelte. Dieses Muster hat sich bis heute gehalten
und sollte später von BlackRock auch in Europa mit
enormem Erfolg angewandt werden. Aber das war im März
2008 noch in nicht absehbarer Zukunft. Der Bitte um eine
Stellungnahme zur Handhabung der Interessenkonflikte bei
den beiden Bear-Stearns-Aufträgen kam BlackRock nicht
nach.
Planet der Affen: Fink als Überlebender
Am Abend des 13. Septembers befand sich Larry Fink am
New Yorker Flughafen. Er war kurz davor, in einen Flieger
nach Singapur zu steigen. Dort wollte er Gespräche mit
asiatischen Staatsfonds führen – mögliche lukrative
Aufträge für BlackRock standen in Aussicht. Doch es ist
eine der längsten Flugrouten von der US-Ostküste nach
Asien, fast halb um den Globus. Das würde für Fink heißen,
16 Stunden unerreichbar zu sein. Und die Lage an der Wall
Street war, milde ausgedrückt, beunruhigend. Während
Fink mit gepackten Koffern am Gate stand, hatten sich
Vertreter der New Yorker Notenbank, Abgesandte des
Finanzministeriums aus Washington und die Chefs der
großen Investmentbanken in der Notenbank in Manhattans
Finanzdistrikt verschanzt. Das Gefühl der Belagerung
wurde noch verschärft durch das Äußere: Der
Sandsteinbau sieht aus wie eine Burg, nur dass er statt
einer Zugbrücke eine Tiefgarage hat. Drinnen ging es um
das Schicksal von Lehman, der viertgrößten
Investmentbank, auch Merrill Lynch, das größte
Brokerhaus und Großeigentümer von BlackRock,
schwankte unter den Milliardenverlusten aus
Wackelhypothekenpapieren. Fink telefonierte noch einmal
mit einem BlackRock-Vertreter, der bei den Besprechungen
in der Notenbank dabei war. »Kann ich fliegen?«, fragte er.
Zu dem Zeitpunkt schien es, als ob sich ein Käufer für
Lehman finden würde. »Ja, kannst du«, kam die Antwort.
Und Fink bestieg den Flieger.
So hat es Fink einer Reporterin später erzählt. (Katrina
Brooker in Fortune 29.10.2008) Während der BlackRockChef in der Luft war, ging die Wall Street, so wie sie seit
mehr als einem halben Jahrhundert existierte, unter. Als
Fink schließlich am frühen Montagmorgen Ortszeit aus
dem Flugzeug stieg, begrüßten ihn schockierende
Nachrichten: Lehman pleite, Merrill Lynch an Bank of
America verkauft und der Versicherer AIG – 1,1 Billionen
Dollar Bilanzsumme, 74 Millionen Versicherte in 130
Ländern – ein wankender Riese. »Ich kam mir vor, wie
Charlton Heston in Planet der Affen«, berichtete Fink
später. In dem Hollywoodstreifen findet ein gestrandeter
Raumfahrer, gespielt von Heston, der sich eigentlich auf
einem fremden Planeten wähnt, plötzlich die Überreste der
Freiheitsstatue am Strand und muss erkennen, dass seine
Zivilisation untergegangen ist.
Doch für Fink und seine Truppe war es der Beginn einer
Transformation. Von einem Vermögensverwalter mit einer
Vorliebe für Bonds und mit cleveren Analysten zu einem
der großen Mitspieler hinter den Kulissen von Hochfinanz
und großer Politik. Kurze Zeit nach dem Desaster meldeten
sich Finanzministerium und US-Notenbank bei Fink. Ob
BlackRock sich der toxischen Papiere in den Büchern von
AIG annehmen könne? Der damals weltgrößte Versicherer
hatte sich mit komplexen Kreditderivaten verkalkuliert.
Nun musste jemand herausfinden, wie viel diese Papiere
wert waren und sie nach und nach abwickeln. Die Beamten
und Notenbanker waren mit einer solchen Aufgabe schlicht
überfordert.
Nach Bear Stearns sollten sich die BlackRock-WertpapierForensiker nun also AIGs Giftmüll vornehmen. Die
Schwierigkeiten bei AIG kamen für Finks Spezialisten
kaum überraschend. Robert Willumstad war im Juni, ein
halbes Jahr vor dem Kollaps, von dem Versicherer als
Sanierer angeheuert worden. Der neue Vorstandschef hatte
kurz darauf BlackRock engagiert, weil er diskret
herausfinden wollte, wie schwerwiegend die Probleme in
AIGs Portfolios waren. Sein Vorvorgänger, Maurice
Greenberg, genannt Hank, hatte AIG jahrzehntelang wie
ein Feudalherrscher geführt. Greenberg war immer auf der
Suche nach neuen Geschäftsfeldern. So wollte er auch
gerne an dem Boom der verbrieften Kredite teilhaben. Sein
Favorit Joe Cassano, den der US-Journalist Matt Taibbi
später einmal als »Patient null der globalen
Wirtschaftskernschmelze« bezeichnete, präsentierte eine
scheinbar brillante Idee: Die Ratingagenturen hatten AIG
die Bestnote AAA für Kreditwürdigkeit gegeben. Warum
nicht Geld damit verdienen? So würde AIG die von Banken
zusammengestellten Kreditbündel – jene CMOs und CDOs,
die nun tausendfach unter die Anleger gejubelt wurden –
garantieren. Mit der Garantie von AIG würden auch die
Kreditbündel die Topkreditwürdigkeit erhalten. Das war
gut für die Herausgeber der Kreditbündel, weil sie sich
dann besser an Investoren verhökern ließen. Und für AIG
war es gut, weil der Versicherer für diese Ausfallgarantie
Gebühren kassieren konnte. Das Risiko schätzte Cassano
gering ein. Weil die in den Bündeln hinterlegten Kredite
zum großen Teil Hypotheken auf amerikanische Immobilien
waren und es nie eine landesweite Immobilienkrise
gegeben hatte, schien es ein narrensicheres Geschäft.
So weit, so clever. AIG gehörte bald zu den begehrtesten
Partnern im schnell expandierenden Universum der
Kreditderivate – wie diese Transaktionen genannt wurden.
Vor allem europäische Banken liebten die von AIG
garantierten verbrieften Schuldenbündel. Sie konnten
diese nämlich bei der Zentralbank als sichere
Kapitaleinlage melden und damit mussten sie weniger
teures Eigenkapital vorhalten. Es schien ein
gewinnbringendes Geschäft rundherum: für die Banken,
die die Verbriefungen vornahmen, für den Versicherer AIG,
der die Prämien für die Garantie kassierte und für die
Kunden, die ein anscheinend sicheres und dabei attraktiv
verzinstes Produkt erhielten. Doch dann begann 2007 die
Finanzkrise: Die Kreditbündel, die AIG so großzügig mit
der eigenen Kreditwürdigkeit versehen hatte, galten
plötzlich als weit riskanter als gedacht. Im Kleingedruckten
von Cassanos Verträgen stand jedoch eine Klausel, die
besagte, dass AIG bei einer solchen Abwertung der
Kreditwürdigkeit den Banken eine Summe als Sicherheit
überstellen musste, um das höhere Risiko der Papiere
auszugleichen. In Cash. Das hieß im Klartext, AIG musste
Vertragspartnern wie Goldman Sachs oder der Deutschen
Bank bares Geld überweisen. Mit jeder neuen Welle
geplatzter Kredite verlangten AIGs Vertragspartner aufs
Neue höhere Sicherheiten. Für die AIG-Manager wurde es
immer schwieriger, das nötige Geld aufzutreiben.
Greenbergs unglücklicher Nachfolger Martin Sullivan, ein
Brite, der vor allem als stolzer Sponsor des Fußballclubs
Manchester United auffiel, verstand offenbar lange Zeit
nicht, in welcher Gefahr sein Konzern schwebte. Mit jedem
neuen Zweifel an den Hypothekenkrediten pochten die
Banken bei AIG auf Nachschub.
Willumstad, der Sullivan im Sommer 2008 schließlich
ablöste, gab den Auftrag an BlackRock, Cassanos
Katastrophenderivate zu untersuchen, um die Situation zu
stabilisieren. Doch das kam zu spät. Die Forderungen der
Banken wurden unbezahlbar. Im September 2008 herrschte
in der Pine Street in Downtown Manhattan, wo AIGs Artdéco-Wolkenkratzer aufragt, nur noch nackte Panik. Da
griff Washington ein. AIG wurde verstaatlicht. Ein
eigentlich undenkbarer Schritt in Amerika, das sich als
Hort des freien Markts versteht. Aber in dieser Krise wurde
vieles Realität, das zuvor unvorstellbar gewesen war.
(Unter anderem wurde der AIG-Turm in Ultra-Luxus-
Wohnungen umgewandelt, AIG ist in bescheidenere Büros
gezogen.)
Wie sich herausstellen sollte, war der Zugriff
Washingtons aber für Fink und seine Leute nicht das Ende
des AIG-Auftrags. Im Gegenteil: BlackRock übernahm die
Analyse und Abwicklung der toxischen Portfolios von AIG
nun für die Notenbank. Und so wurden Maiden Lane II und
Maiden Lane III ins Leben gerufen. (Maiden Lane I war wie
gesagt das ehemalige Bear Stearns Portfolio.) Alle drei
Maiden-Lane-Fonds wurden nun durch BlackRock
verwaltet.
BlackRock war noch anderweitig während der
Finanzkrise für die Notenbank tätig. Um die Unternehmen
vor der Kreditklemme zu schützen, schuf die Notenbank
gleich mehrere Stützungsprogramme. Darunter auch eines
mit dem Namen »Term Asset Backed Securities Loan
Facility«, besser bekannt als TALF. Hinter dem kryptischen
Begriff steckte eine Förderaktion, bei der sich Investoren
verbilligte Kredite der Notenbank besorgen konnten –
sofern sie das Geld in Wertpapiere anlegten, die von der
Notenbank ausgewählt wurden. Die Notenbank würde
darüber hinaus alle Wertpapiere übernehmen, die im
Rahmen des Programms gekauft worden waren und deren
Wert zu tief fiel. Mit diesen Subventionen und Garantien
versuchte die Notenbank das Risiko auf dem Kreditmarkt
so zu senken, dass Marktteilnehmer sich trauten, wieder
miteinander ins Geschäft zu kommen. Böse Zungen an der
Wall Street nannten die Stützungsaktionen auch »Cash for
Trash«, Bares für Müll. BlackRock wurde angeheuert, um
die verbrieften Wertpapiere für TALF zu analysieren.
Erzrivale Pimco, eine Allianztochter, sollte die
entsprechenden Bewertungen übernehmen. Dabei gab es
jedoch einen kaum übersehbaren Interessenkonflikt:
Sowohl BlackRock als auch Pimco traten ebenfalls als
Nutzer von TALF auf. Zu BlackRock gehörige Fonds etwa
liehen sich im Rahmen des Programms von der Notenbank
2,8 Milliarden Dollar. Damit gehörte BlackRock zu den 20
größten TALF-Kreditnehmern. (Das berichtete das
Government Accountability Office, das dem
Bundesrechnungshof entspricht, in einem Bericht an den
US-Kongress im Juli 2011.)
Im Klartext: BlackRock lieferte Analysen von
Wertpapieren an das TALF-Programm. Gleichzeitig nutzten
BlackRock-Fonds TALF, um solche Wertpapiere zu
erwerben. Die TALF-Nutzung sei von einer anderen
BlackRock-Abteilung im Auftrag von Kunden getätigt
worden, erklärte BlackRock, auf Anfrage von Bloomberg.
Beide Abteilungen seien streng getrennt. Es seien keine
Vorwürfe gegen BlackRock und Pimco wegen etwaiger
Unregelmäßigkeiten bei TALF erhoben worden, heißt es in
dem Bloomberg-Bericht. Der Bitte um Stellungnahme, wie
die Interessenkonflikte im Fall der Fed-Programme
gehandhabt wurden, kam BlackRock nicht nach.
Der Schattenfinanzminister
Bear, AIG und TALF waren längst nicht alles an
Krisengeschäft, das Finks Truppe erhielt: Im Dezember
2008 unterschrieb die Notenbank erneut einen Vertrag mit
BlackRock. Dieses Mal ging es um ein verlustbringendes
Milliardenportfolio bei Citigroup. Citi musste mehrfach
vom Staat gestützt werden, sonst hätten die
Wackelhypotheken den einst größten Finanzkonzern der
Welt umgehauen. BlackRock sollte das Portfolio testen und
die größtmöglichen Verluste errechnen.
In Washington war BlackRock ebenso gefragt: Fannie
Mae und Freddie Mac sind öffentlich-rechtliche Institute,
mit dem gesetzlichen Auftrag, den US-Hypothekenmarkt zu
unterstützen, damit möglichst viele Bürger ein Eigenheim
erwerben können. Das Ziel gilt als politisch wichtig, denn
in Amerika geht man davon aus, dass Eigentümer ein weit
größeres Interesse am Funktionieren des Gemeinwesens
haben als Mieter, schließlich hängt der Wert ihrer
Immobilie davon ab. Die beiden Förderinstitute Fannie und
Freddie gehören zu den größten Aufkäufern von
Hypotheken weltweit (nach der Krise sogar noch mehr als
zuvor). Sie kaufen die Hypotheken von Banken, die diese
ursprünglich mit den Hausbesitzern abgeschlossen haben.
Doch die beiden Kolosse kauften und verbrieften zu viele
Wackelhypotheken und mussten schließlich von den USSteuerzahlern mit knapp 190 Milliarden Dollar aufgefangen
werden. Auch die Experten bei Fannie und Freddie zeigten
sich offensichtlich überfordert, als es darum ging, die
Kreditqualität der Hypotheken, die sie in den Jahren vor
der Krise erworben hatten und die nun in ihren Beständen
waren, ohne Hilfe zu überprüfen. So ging auch dieser
Analyseauftrag an einen alten Bekannten in New York:
BlackRock.
Zudem bewarb sich BlackRock im Herbst 2009 als einer
der Manager für ein weiteres Hilfsprogramm, dieses Mal
für das US-Finanzministerium. Bei diesem Auftrag sollte
BlackRock in einem so genannten Public-private
Investment Program (PPIP) mit eigenen und öffentlichen
Mitteln angeschlagene Wertpapiere etwa von Banken
aufkaufen, um deren Bilanzen von Altlasten zu befreien.
Ende 2012 löste BlackRock den Fonds auf und überwies
dem Finanzministerium 917 Millionen Dollar – 528
Millionen entsprachen dem ursprünglichen öffentlichen
Investment des Finanzministeriums und 389 Millionen
waren Gewinn für die Staatskasse. Robert Kapito,
inzwischen zum Präsidenten bei BlackRock ernannt, lobte
in einer Pressemitteilung zu der Auflösung des PPIP-Fonds,
mit dem Engagement habe BlackRock zur Stabilisierung
der Hypothekenmärkte beigetragen und gleichzeitig solide
Gewinne erwirtschaften können. Dies beweise, dass »eine
Partnerschaft zwischen Staat und Privatwirtschaft in
überzeugender Weise lohnend und profitabel sein könne«.
Dass Fink und BlackRock an allen Ecken und Enden der
Rettungsaktionen auftauchten, galt zumindest bei einigen
in Washington als ein Zeichen von großzügiger
gemeinnütziger Hilfsbereitschaft. James R. Wilkinson etwa,
die rechte Hand von George W. Bushs Finanzminister
Henry Paulson, lobte Fink in einem Interview als einen
»Patrioten«. Paulson war in der ersten Phase der
Finanzkrise für das Krisenmanagement zuständig. Zuvor
war er allerdings Goldman-Sachs-Chef gewesen und Fink
aus Wall-Street-Zeiten vertraut.
Umsonst übernahm BlackRock diese Dienste für das
Vaterland allerdings nicht. Wie viel das Unternehmen im
Einzelnen bekommen hat, ist schwer nachzuvollziehen.
Lange Zeit hielt etwa die Notenbank ihre Dokumente unter
Verschluss. Erst 2010 konnte die Finanznachrichtenagentur
Bloomberg viele der Details erstmals öffentlich machen.
Dafür hatte sie jedoch unter dem Freedom of Information
Act, der US-Bürgern das Recht auf Auskunft von
öffentlichen Stellen zusichert, eine Klage anstrengen
müssen. Laut einem späteren Bericht des US Government
Accountability Office erhielt BlackRock für die MaidenLane-Dienstleistungen insgesamt knapp 182 Millionen
Dollar. Für die Teilnahme an TALF erhielt das Unternehmen
vergleichsweise bescheidene 1,25 Millionen Dollar. Für
Beratungstätigkeit in Sachen Citigroup gab es noch einmal
12 Millionen Dollar von der New Yorker Notenbank. Für
Dienstleistungen für ein Aufkaufprogramm von
Hypothekenpapieren, bei dem BlackRock die New Yorker
Fed unterstützte, kassierte das Unternehmen rund 11
Millionen Dollar. In einem Brief an den Kongress warnte
POGO, eine Washingtoner Bürgerinitiative gegen
Korruptions- und Amtsmissbrauch: »Die finanziellen
Interessen von BlackRock sind noch unübersichtlicher als
die anderer Firmen, angesichts der Vielzahl der Verträge
und Arrangements mit der öffentlichen Hand.«
Zumindest einige Volksvertreter und Beamte in
Washington nahmen BlackRock ins Visier. Die betreffenden
Unternehmen hätten »Informationen, wann die Notenbank
Wertpapiere verkaufen und welchen Preis sie für diese
nehmen will, gleichzeitig haben diese Unternehmen
weltweit finanzielle Verbindungen«, kritisierte Charles
Grassley, ein streitbarer Senator aus Iowa, schon 2009.
»Das Potenzial für einen Interessenkonflikt ist groß und
sehr schwierig zu kontrollieren.« Neil Barofsky, der als
Generalinspekteur im Auftrag der Steuerzahler das
Bankenrettungsprogramm überprüfen sollte, nannte zwar
BlackRock und Pimco nicht beim Namen. In seinem Bericht
an den Kongress im April 2009 beschreibt er jedoch aus
seiner Sicht problematische Überschneidungen bei solchen
Partnerschaften (Seiten 147-148). »Es liegt in der Natur
und der Konstruktion dieser partnerschaftlich von Staat
und Privatwirtschaft geführten Fonds, dass deren
Transaktionen in den festgefrorenen Märkten, in denen sie
aktiv sind, eine bedeutende Auswirkung auf den Preis der
betreffenden Vermögenswerte haben. Von einem
steigenden Preis werden demnach all diejenigen
profitieren, die ebenfalls diese Vermögenswerte managen
oder halten. Das trifft auch auf die Manager der
Partnerschaftsfonds zu.«
In Folge nennt Barofsky mögliche Wege, wie die staatlich
beauftragten Fondsmanager von ihrem öffentlichen Auftrag
profitieren könnten: Der Fondsmanager kann zum Beispiel
durch seine Käufe den Wert bestimmter
Hypothekenpapiere hochtreiben. Wenn er dann genau
solche Papiere in einem weiteren Fonds hält, den er für
andere private Kunden verwaltet, dann steigt dieser Fonds
ebenfalls im Wert. Das wiederum lässt die
Managementgebühren steigen, die der Fondsmanager von
seinen privaten Kunden erhält. Der Fondsmanager könne
aber auch auf andere Weise profitieren, so Barofsky, wenn
er etwa Aktien einer Bank besitze, der er im Rahmen seines
öffentlichen Auftrags toxische Papiere abkaufe. Je höher er
diese Papiere bewerte, desto besser für die Bank. Das
wiederum ließe den Aktienkurs steigen – Kursgewinne für
den Fondsmanager, der die Bankaktien besitzt.
Bei einer Anhörung vor dem Kongress im April 2010
kündigte Barofsky an, er wolle die Rolle von BlackRock in
der Finanzkrise genauer untersuchen. Von der
Untersuchung wurde – zumindest öffentlich – nichts mehr
gehört. Ein Jahr später trat Barofsky von seinem
Inspektorenposten zurück. BlackRock wollte sich auf
Anfrage nicht dazu äußern, ob Barofsky im Zusammenhang
mit den Stützungsprogrammen TALF, PPIP, TARP oder
anderen Programmen der Fed oder des USFinanzministeriums Ermittlungen eingeleitet hat.
In seinem Buch How Washington abandoned Main Street
while Rescuing Wall Street (Wie Washington die Wall Street
auf Kosten der Allgemeinheit rettete), das er nach seinem
Rücktritt schrieb, beschreibt Barofsky seinen Kampf mit
Vertretern des Finanzministeriums in Washington. Es sei
dabei vor allem um die Notwendigkeit gegangen, »ethische
Wände zwischen den Fondsmanagern, die das PPIP-Geld
bekamen, und den anderen Abteilungen ihrer Unternehmen
einzuziehen, damit diese nicht das System austricksen und
die Preise für Wertpapiere in die Höhe treiben, die sie
bereits in ihren Portfolios halten.« Laut Barofsky weigerte
sich das Finanzministerium diese »ethischen Wände« bei
dem PPIP-Programm verpflichtend zu machen. Das einzige,
was er je in dem Zusammenhang von dem zuständigen
Vertreter aus Geithners Ministeriums bekommen habe, so
Barofsky, sei eine CD des Pink Floyd Albums The Wall
gewesen – als Gag. Barofsky arbeitet heute in einer
privaten Anwaltskanzlei in New York und vertritt private
Unternehmen. Seine Spezialität: Rechtstreitigkeiten mit
staatlichen Stellen und Behörden.
Dabei hatte bereits die Bear-Stearns-Transaktion bei
einigen Volksvertretern Fragen aufgeworfen. Im April
2008, also einen Monat nach dem Bear-Absturz, etwa
bohrte Senator Bob Casey, der Vorsitzende des
Wirtschaftsausschusses, wie die Notenbank überhaupt
dazu gekommen sei, BlackRock zu engagieren. Der
damalige Notenbankchef Ben Bernanke erklärte, man
»habe unter extremem zeitlichen Druck« gestanden.
Bernanke gab keine Details, bestätigte aber, dass in der
Eile auch vorab kein Honorar ausgemacht wurde. Die
Honorarfrage habe man auf später verschoben. Ähnlich
abwehrend reagierte Timothy Geithner auf
Nachforschungen. Geithner war während der Bear-StearnsRettung der Chef der New Yorker Notenbank gewesen, also
unmittelbar an den Entscheidungen 2008 beteiligt. Auf ein
Schreiben von Grassley, dem Senator aus Iowa, der
ebenfalls Details über den Bear-Stearns-Auftrag wissen
wollte – vor allem, warum BlackRock als Verwalter von
Maiden Lane ohne eine Ausschreibung und ohne ein im
öffentlichen Dienst sonst übliches reguläres
Bieterverfahren bestellt worden sei – gab Geithner bloß
zurück, die Umstände hätten diese Ausnahme notwendig
gemacht. Das Unternehmen, so der New Yorker
Notenbankchef, sei ausgewählt worden wegen seines
»technischen Know-hows, operativen Kapazitäten und den
nachweislichen früheren Erfolgen«. Als der Senator eine
Kopie des Vertrags mit BlackRock haben wollte, erklärte
Geithner, dazu müsse sich der Volksvertreter schon nach
New York bewegen, ein Einblick in das Dokument sei nur in
der New Yorker Notenbank und auf vertraulicher Basis
möglich.
Anders als Banken wie Goldman Sachs, Morgan Stanley
oder Citigroup hat BlackRock die Finanzkrise nicht nur
überlebt, sondern durch sie an Macht und Kapital
gewonnen. Worin lag der Unterschied? BlackRock war
besser an die neue moderne Finanzwelt angepasst, die in
den vergangenen Jahren entstanden war. Finks Zerstückeln
und Zerlegen von Hypotheken, das alles war nur ein kleiner
Teil einer weit umfassenderen Veränderung. Geld ist in den
vergangenen Jahrzehnten immer abstrakter geworden, bis
es heute blinkende Zahlen auf Monitoren, Einträge auf
Spreadsheets darstellt. Beziehungen wie einst vom
Schuldner zum Gläubiger oder von einem Land zum
anderen lassen sich in Arbitrageformeln oder in Zinssätzen
ausdrücken. Selbst wenn von Cash die Rede ist, dann ist
ganz selten ein Dollarschein oder eine Euromünze gemeint.
Ein Teil der Finanzmärkte hat sich schon früh in diese
Richtung bewegt: Nur wenige Teilnehmer an den
Terminbörsen in Chicago wollen am Ende ihres Kontrakts
einen Sack Weizen, eine Lieferung Schweinebäuche oder
einen Tank Orangensaft vor ihrer Tür finden. Zwar war das
der Ursprung des modernen Terminhandels, als sich
Farmer und Rancher des amerikanischen Mittleren Westen
an der 1848 etablierten Chicago Board of Trade gegen
einen Preisverfall ihrer Maisernte oder ihrer Rinder
absichern und Fleischfabriken und Großbäckereien sich vor
einer Teuerung bei ihren Rohmaterialien schützen wollten.
Heute werden diese Märkte zwar immer noch von diesen
Anbietern und Nachfragern genutzt, doch es gibt noch viel
mehr Marktteilnehmer, die aus ganz anderen Bedürfnissen
in Chicago Terminkontrakte auf Rinderhälften oder Mais
kaufen. Etwa Pensionsfonds, die eine steigende Inflation
fürchten und deswegen in Rohstoffe investieren. Oder
Hedgefonds, die einfach nur Spekulationsgewinne suchen.
Heute hat sich um die einstigen landwirtschaftlich
geprägten Märkte ein komplexes Geflecht von
Finanzinstrumenten gebildet. Die Terminmärkte sind nur
ein Beispiel. Doch der Sog, fundamentale Transaktionen
wie diese immer abstrakter und globaler zu machen, droht
die Schöpfer dieser neuen Finanzwelt – Banker,
Spekulanten, Investoren, Händler – zu überfordern. Wie
2008.
Für Fink und BlackRock mit seinen Rechnern und
Computermodellen war es – bisher zumindest – dagegen
die perfekte Umgebung. Und BlackRock hat es verstanden,
dies wie keine andere Organisation für sich zu nutzen. Vor
allem nach der großen Krise, als Unsicherheit und
Verwirrung bei allen Akteuren herrschte. Der Name
BlackRock taucht bei fast jeder Rettungsaktion von
Notenbanken und Regierungen auf – so häufig wie kein
anderes Unternehmen. Der Aufstieg von Fink & Co. ist so
eng mit den Finanzkrisen in den USA und in Europa und
ihren anhaltenden Folgen verwoben, dass ohne sie die
Macht und Bedeutung von BlackRock kaum denkbar ist.
Doch bis heute ist, was damals geschah, selbst für viele
Insider nicht klar. Und damit auch nicht, welche Rolle
BlackRock darin spielt.
Hinein in die Zirkel der Macht
Timothy Geithner war eine Schlüsselfigur für die Wall
Street und insbesondere für BlackRock. Als New Yorker
Notenbankchef war er eigentlich der oberste Aufseher der
Banken dort. Während der Krise 2008 wurde er ihr
oberster Retter. Danach stieg er noch weiter auf: Der
damals frisch gewählte Präsident Barack Obama berief ihn
Anfang 2009 zum Finanzminister. Es war zu dem Zeitpunkt
das wichtigste Ressort, das Obama zu besetzen hatte.
Geithners Karriere ist fast so erstaunlich, wie die des
Präsidenten selbst. Dass der schlaksige, jungenhaft
wirkende Geithner es mit Mitte 40 überhaupt zum Chef der
New Yorker Notenbank gebracht hatte, verdankt er seinem
Talent, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute
kennenzulernen. Denn Geithner war kein Banker, er hat nie
in der Finanzindustrie gearbeitet. Er war im öffentlichen
Dienst zu Hause. Als er in Washington als junger Beamter
im Finanzministerium arbeitete – eben jenem Ministerium,
dessen oberster Chef er Jahre später werden sollte –, fiel er
Anfang der 1990er Jahre Larry Summers auf. Der machte
ihn zu seinem Assistenten. Summers selbst war ein
politischer Ziehsohn von Robert Rubin, Präsident Clintons
Finanzminister. Rubin kam von der Wall Street, er hatte vor
seinem Wechsel in die große Politik Goldman Sachs
geführt. Für die Goldman-Chefs stellte der Wechsel ins
Finanzministerium inzwischen eine Art Ritterschlag dar
(siehe Ex-Goldman-Boss Henry Paulson, der den Posten
unter George W. Bush antrat). Rubin war als
Finanzminister seiner ehemaligen Branche weiter
freundlich zugetan. Als verantwortlicher Minister gilt
Rubin nicht zuletzt als entscheidende Kraft, die damals
diskutierte Regulierung für die neuartigen Derivate zu
verhindern. Derivate, wie diejenigen, die später AIG in den
Beinahe-Ruin trieben. Als Rubin das Ministeramt aufgab –
er ging zurück an die Wall Street in die Chefetage der
Citigroup –, schanzte er seinem politischen Ziehsohn
Summers den Posten zu. Und Geithner, der Dritte im
Bunde, gehörte plötzlich zum inneren Zirkel der Macht in
Washington.
Während der Asienkrise und später bei der
Rettungsaktion für den Hedgefonds Longterm Capital
Management, dessen Zusammenbruch 1998 eine globale
Krise auszulösen drohte, tauchte Geithner bei den
Verhandlungen an der Seite von Summers auf und fiel
einigen Wall-Street-Größen ins Auge. Unter anderem Pete
Peterson – genau jenem Peterson von Blackstone, der Fink
seine Chance nach dem First-Boston-Debakel gab – und der
später Aufsichtsratschef der New Yorker Notenbank wurde.
(Die großen Banken dürfen ihre Vertreter in den
Aufsichtsrat der New Yorker Fed entsenden, der Ursprung
dieses unorthodoxen Arrangements ist in der Gründung der
Federal Reserve 1913 zu suchen.) Peterson jedenfalls
suchte einen neuen Leiter für die Institution. Die New
Yorker Notenbank ist keineswegs ein Provinzableger der
Zentrale in DC. Sie erfüllt eine wichtige Funktion: Während
die Notenbankchefs in Washington für die Geldpolitik
zuständig sind, überwacht die New Yorker Fed die Wall
Street.
Eigentlich sollte jemand mit einem reichen
Erfahrungsschatz in den Märkten und einem gewissen
Status in der Branche den Posten innehaben. Geithner
besaß zu diesem Zeitpunkt weder das eine noch das
andere. Doch seine Kontakte ebneten ihm den Weg. Nach
einem kurzen Abstecher zum Internationalen
Währungsfonds (der später ein Nachspiel haben wird, weil
Geithner teilweise versäumt, Steuern auf sein IWFEinkommen zu zahlen, was der designierte Finanzminister
mit einem fehlerhaften Computerprogramm erklärt), wird
er 2003 Notenbankchef in Manhattan. Seine Fähigkeit, den
richtigen Ansprechpartner zu finden, hilft ihm auch hier:
Gerald Corrigan war selbst 20 Jahre bei der Fed, bevor er
zu Goldman Sachs wechselte. Er nahm Geithner unter
seine Fittiche. Ein freundschaftliches Verhältnis unterhielt
Geithner bald auch mit Finks Erzfeind »John-Boy« Thain,
damals noch bei Goldman, später Chef der New Yorker
Börse. Mit ihm telefoniert Geithner regelmäßig. Auch mit
Jamie Dimon, dem Boss von JPMorgan Chase, pflegt er zu
speisen. Dimon war eigentlich Geithners Vorgesetzter: Der
JP-Morgan-Chef war gleichzeitig im Aufsichtsrat der
Notenbank. Und mit Dimon fädelt Geithner auch den BearStearns-Deal ein, an dem BlackRock ebenfalls beteiligt ist.
Auch mit Fink tauscht sich der branchenfremde
Notenbankchef gerne aus. Mit BlackRock-Mitgründer
Ralph Schlosstein und dessen Frau trifft sich Geithner
schon mal zum Dinner im New Yorker In-Lokal Café Boulud
oder zum Gedankenaustausch zu Hause, wie aus Geithners
offiziellem Kalender hervorgeht. Dabei sei es aber nie um
BlackRocks Geschäfte gegangen, sondern um die
allgemeine Lage an den Märkten, versicherte Schlosstein
der New York Times. »Gespräche mit Tim waren
angemessen einseitig. Er rief an, bombardierte dich mit
Fragen, bedankte sich und legte auf.«
Die Verbindung zu Fink wird noch enger, als Geithner
nach Washington ins Finanzministerium wechselt. Denn zu
dem Zeitpunkt kann sich Geithner nicht mehr mit seinen
Bankerfreunden sehen lassen. Zu groß ist der Volkszorn
über die von der Wall Street ausgelöste Große Rezession.
Fink jedoch wird in jenen Tagen zum Consigliere für den
frischgebackenen Minister, der praktisch über Nacht vor
der Aufgabe steht, die amerikanischen Banken und die
amerikanische Wirtschaft zu retten. Mehr als jeden
anderen Vorstandschef der Finanzbranche konsultiert
Geithner den BlackRock-Mann. Allein von Anfang 2011 bis
Mitte 2012 telefonieren die beiden fast 50 Mal miteinander,
zählte die Financial Times bei einer Analyse des offiziellen
Tagebuchs von Geithner. Nummer zwei und drei auf der
Anruferliste des Ministers: die einstigen Ziehväter Robert
Rubin und Larry Summers. Fink selber kann kaum
verhehlen, wie stolz er auf seine Rolle in Washington ist.
Gerne habe Fink nonchalant fallen lassen, er habe gerade
noch einen Anruf von »Tim« bekommen, erzählt ein
leitender Finanz-Insider, der Fink in jener Zeit zu
gemeinsamen Terminen traf. Und dabei keinen Zweifel
gelassen, dass er auf Vornamensbasis mit dem wohl
wichtigsten Minister der Supermacht Amerikas sei.
Auf die grüne Insel: BlackRocks Sprung nach
Europa
Wer auch immer von Finks neuen Freunden BlackRock
empfahl: Im Herbst 2010 jedenfalls meldete sich die
Central Bank of Irland bei BlackRock. Die Iren steckten in
der Klemme. Jahrelang hatte die Wirtschaft dort vom Boom
der Finanzindustrie profitiert. Endlich schien die Insel eine
zukunftsträchtige Branche gefunden zu haben. Am Ende
waren die Bilanzen der Banken dort so aufgebläht, dass sie
ein Mehrfaches des Bruttoinlandsprodukts betrugen. Dann
kam die Krise und plötzlich drohten die mit toxischen
Papieren und faulen Krediten gefüllten Banken den Rest
des Landes mit in den Abgrund zu reißen. Es musste eine
schnelle Lösung her. Doch die Rettung überforderte den
irischen Staat. Brüssel und der Internationale
Währungsfonds – IWF – fürchteten eine Kettenreaktion im
Rest Europas. Und so bekam Dublin ein Hilfspaket von 85
Milliarden Euro. Doch zu den Bedingungen gehörte auch
ein Stresstest der irischen Banken. Gemeint war: Eine
Untersuchung der Bücher und Bilanzen der irischen
Finanzinstitute, um festzustellen, wie gefährdet die Banken
waren und wie viel frisches Kapital sie brauchen würden.
Und wen rief Patrick Honohan, der Gouverneur der Central
Bank of Irland, an? Richtig: BlackRock. Gemeinsam mit der
Boston Consulting Group und der britischen Barclays Bank
erhielten die New Yorker den Auftrag. Auch in diesem Fall,
wie schon bei der US-Notenbank, wurde BlackRock
Solutions angeheuert, ohne dass es eine öffentliche
Ausschreibung gab. In der irischen Presse wurde gelästert,
die Auftragsvergabe sei frei nach dem Motto gelaufen,
»was gut genug für die Fed war, muss gut genug für Dame
Street« sein – gemeint ist die Federal Reserve, also
BlackRocks großer Kunde, die US-Notenbank, und die
Central Bank of Ireland, die an der Dame Street in Dublin
ihren Sitz hat.
Rund 30 Millionen Dollar sollte der Auftrag das
krisengeschüttelte Irland kosten – 6,5 Millionen Dollar pro
Kopf. Im Fernsehen dazu befragt, wand sich der
Zentralbankchef und erklärte schließlich, er habe sich an
die Instruktionen von EU und IWF halten müssen. Die
hatten die Iren zwar nicht direkt angewiesen, die
Amerikaner an Bord zu holen, aber in der entsprechenden
Vereinbarung mit Irland heißt es klipp und klar: »Die
Diagnoseuntersuchung sollte nicht durch eine
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder ein
Beratungsunternehmen durchgeführt werden, die in den
vergangenen drei Jahren ihre Dienstleistungen einer der
Banken zur Verfügung gestellt haben. Die Zentralbank
sollte außerdem eine spezialisierte Firma mit der
Unterstützung der eigenen Mitarbeiter beauftragen, um die
Nachvollziehbarkeit und Integrität der Untersuchung
sicherzustellen.« Wer will, kann darin eine ziemlich genaue
Anweisung sehen, BlackRock oder ein vergleichbares
Unternehmen zu beauftragen. In dem Bericht zur
Auftragsvergabe der Central Bank of Ireland aus dem März
2011 heißt es dazu ausdrücklich: »Um ein Ergebnis für die
Stressanalyse der Kreditportfolios zu erhalten, das in den
internationalen Finanzmärkten volle Glaubwürdigkeit
erhält, hat die Zentralbank BlackRock Solutions beauftragt,
einen führenden Spezialisten bei der Analyse von
potenziellen Kreditverlusten unter Stressbedingungen.«
Tom McDonnell, ein irischer Wirtschaftswissenschaftler,
sieht den Grund dafür, dass Irlands Finanzwunder von
kurzer Dauer war und in einem Desaster endete, nicht
zuletzt in der mangelnden Distanz der Staatsdiener zur
Branche: »Es war bekannt, dass die Banker vor der Krise
regelmäßig mit den Zentralbankern Golf spielten – den
Leuten, die eigentlich die oberste Aufsicht über die Banken
hatten.« Dass bei der Rettung auch wieder bekannte
Namen eine Hauptrolle spielten, hat McDonnell nicht
überrascht. Er sieht darin eine konsequente Fortsetzung
einer globalen Cliquenwirtschaft: »Das sind immer die
gleichen Schlüsselfiguren, das Davos-Set.«
Fink jedenfalls freute sich über den Großauftrag aus
Europa. »Das ist größer als unser Einsatz bei AIG für die
Fed und es ist größer als unsere Tätigkeit in Sachen Bear
Stearns: Das ist ein gigantischer Auftrag«, schwärmte er
gegenüber Investoren, wie der Finanznachrichtendienst
Bloomberg im Januar 2011 berichtete. Seine Freude dürfte
sich noch gesteigert haben, als es gleich zwei
Folgeaufträge gab. Und das, obwohl die BlackRockBerechnungen sich als zu optimistisch erwiesen. Sie hatten
für den Zeitraum von 2011 bis 2013 Erlöse von mindestens
1,9 Milliarden Euro für die untersuchten Finanzinstitute
kalkuliert. Doch tatsächlich erwirtschafteten diese bis Juni
2012 nur schwindsüchtige 400 Millionen Euro, so
berichtete der EU Observer, ein unabhängiges Brüsseler
Medium. (BlackRock wollte sich nicht zu dem Auftrag in
Irland und den Stresstestergebnissen äußern.)
Allerdings gab es Fragen nach potenziellen
Interessenkonflikten. BlackRock hatte im Jahr 2012 über
160 Milliarden Euro an Vermögenswerten in verschiedenen
Investmentvehikeln wie etwa iShares-Fonds und
Geldmarktfonds auf der grünen Insel domiziliert und
verwaltete im Auftrag irischer Pensionskassen und
Finanzinstitute über 5 Milliarden Euro. BlackRock
entschloss sich offensichtlich, die neuen Kontakte auf der
Insel gleich zu nutzen: Im April 2012 eröffnete das
Unternehmen eine Niederlassung in Dublin. Da hatte die
irische Zentralbank gerade einen weiteren Auftrag erteilt.
Nach Abschluss der Aufträge, im Herbst 2013, erwarb eine
Abteilung von BlackRock dann rund drei Prozent an der
Bank of Irland, eine der in dem Stresstest von BlackRocks
Analysten untersuchten Banken. Der Anteil machte
BlackRock zu dem Zeitpunkt immerhin zum fünftgrößten
Einzelaktionär des Kreditinstituts.
Formeln nach Athen tragen
Der Auftrag aus Dublin lohnte sich für Fink und seine
Truppe in vielerlei Hinsicht, aber vor allem als
Eintrittskarte in die Eurozone. BlackRocks Spezialität in
der europäischen Krise wurde das Durchstöbern von
Kreditportfolios angeschlagener Finanzinstitute. Mit dieser
Aufgabe griff BlackRock direkt im Zentrum der Krise ein:
Bei den Banken. Ihre Bücher waren vollgestopft mit den
europäischen Staatsanleihen, die nun kaum besser als die
amerikanischen Wackelhypotheken waren. Dazu hatten die
Banken – angetrieben von dem billigen EZB-Geld – mit
laxer Hand Kredite vergeben, die sie nun selbst in die
Gefahr der Insolvenz brachten. Um den Staatsbankrott
abzuwenden, erhielt Griechenland Hilfen in Höhe von 240
Milliarden Euro von der EU-Kommission, der EZB und dem
Internationalen Währungsfonds, der so genannten Troika.
Auch für die maroden Banken sollte es eine Kapitalspritze
geben. Doch, ähnlich wie in Irland, sollten die Griechen
feststellen, wie tief ihre Banken im Morast steckten. Was
hatten sie in ihren Büchern an toxischen Krediten
versteckt? Das sollte nun BlackRock herausfinden. Im
August 2011 gab die griechische Zentralbank den
offiziellen Auftrag an Finks Truppe. Warum BlackRock? Mit
einem Wort: Irland. »Es war das einzige Unternehmen, das
bereits ein Bankensystem in diesem Zeitraum analysiert
hatte«, erklärte Charalampos Stamatopoulos, Mitglied der
Bank of Greece, gegenüber der New York Times.
Irland war eine Fingerübung im Vergleich zu dem
Auftrag, den Finks Zahlenumdreher aus Athen erhielten.
Eine Weile hatte es so ausgesehen, als ob die Finanzkrise
hauptsächlich die USA heimsuchen würde. Doch dann kam
2010 das große Beben in der Eurozone. Es taten sich
plötzlich Risse auf zwischen den Südländern und ihren
nördlichen Nachbarn. Was jahrelang unter dem Anschein
einer stetig zusammenwachsenden EU geschwelt hatte,
brach nun durch die Turbulenzen an den Finanzmärkten
mit Macht ans Licht. Vor allem Deutschland sah sich
plötzlich in der ungeliebten Rolle des Bürgen für die
Schuldenberge anderer Länder.
Griechenland wurde zum Brennpunkt und zum
abschreckenden Beispiel. Der Schuldenberg überstieg
längst die jährliche Wirtschaftsleistung des Landes, um
genau zu sein, er betrug 160 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts. Griechenland hatte sich schon
früher die Rechenkünste der Wall Street zunutze gemacht.
Als es im Jahr 2001 darum ging, die Haushaltsbedingungen
der EU zu erfüllen, wandte sich die Regierung in Athen an
verschiedene Banken. Goldman Sachs bekam schließlich
den Zuschlag. Die Idee war, einen Teil der Schulden
verschwinden zu lassen, indem die Regierung DerivateTransaktionen mit Goldman einging. Auf diese Weise
verschwanden 2,8 Milliarden Euro an Außenständen –
allerdings nur nach der Logik der Finanzingenieure. Die
Finanzmarktwetten, die Griechenland dabei einging,
wandten sich jedoch bald schon gegen die Griechen und
der ganze Deal kostete den geplagten griechischen
Steuerzahler über 5 Milliarden. Es sei eine »sexy Story
zwischen zwei Sündern« gewesen, so beschrieb es
Christoforos Sardelis, der in der fraglichen Zeit Chef der
staatlichen griechischen Schuldenverwaltung gewesen war
in einem Interview. Kritiker sahen darin Bilanzkosmetik auf
allerhöchster Ebene. Dank der Finanztricks hatten sich die
Griechen europareif gerechnet. (Griechenland war
übrigens nicht das einzige EU-Mitglied, das in die
Trickkiste der Wall Street griff, mit Sicherheit aber das
einzige Land, das sich dabei derartig in die Klemme
brachte.)
Operation Solar: brisante Rolle im Krisenherd
Für die BlackRock-Jungs war es eine monumentale
Aufgabe. Kaum weniger anspruchsvoll, als wenn die
Griechen gefordert hätten, die Akropolis erst ab- und dann
wieder neu aufzubauen. Es ging um Millionen Darlehen bei
18 verschiedenen Banken, insgesamt Kredite in Höhe von
255 Milliarden Euro. (In Irland waren es nur vier Banken
gewesen.) Bei den Darlehen mussten Kreditnehmer und
Sicherheiten gecheckt und das entsprechende Ausfallrisiko
kalkuliert werden. Anders als in Irland gab es eine
Sprachbarriere. Und der Zeitraum für die Prüfung war in
Monaten, nicht Jahren bemessen. Die Analyse erforderte
aber mehr als die richtigen Computerprogramme und
fleißige Mitarbeiter. Fingerspitzengefühl war entscheidend.
Denn von dem Ergebnis hing nicht zuletzt die Zukunft
Griechenlands und auch der EU ab. Setzten die BlackRockPrüfer den Kapitalbedarf der Banken zu optimistisch und
damit zu niedrig an, dann drohten die Institute bei
weiteren Kreditausfällen zusammenzubrechen und die
Krise zu verschärfen. Wenn die Prüfer jedoch den
Kapitalbedarf zu hoch ansetzten, würde es schwierig
werden, private Investoren zu finden, die den Banken die
Mittel geben wollen. Und umso mehr würde der bereits
überschuldete griechische Staat in die Banken pumpen
müssen.
Fink schickte ein Sondereinsatzkommando nach Athen.
Angesichts täglicher Berichte über Straßenschlachten,
brennende Reifen und Tränengaskanonaden zeigten sich
die sonst so abgebrühten Wall-Street-Jungs doch besorgt:
Solche Proteste gab es bei allem Unmut in den USA nie. So
sollte es eine diskrete Mission sein. Wie in einem
schlechteren Spionage-Thriller legte sich das Team einen
Codenamen zu: Projekt Solar. BlackRocks Mitarbeiter
durften beim Solar-Projekt nichts mit sich führen oder an
sich tragen, das das Logo des Unternehmens aufwies, so
berichtete die New York Times aufgeregt. Ein privater
Sicherheitsdienst bewache die amerikanischen Analysten.
In dem unauffälligen Athener Bürogebäude, in dem das
Solar-Team monatelang untergebracht war, sollten andere
Mieter offenbar davon ausgehen, es handele sich um eine
Sonnenenergiefirma. Über die Tarnung lacht Janis
Varoufakis heute noch. Varoufakis, der mit seinem
kahlrasierten Kopf, Lederjacke und kurzer Zündschnur als
frisch gebackener griechischer Finanzminister 2015
Merkel, Schäuble und die deutsche Fernsehnation
schockte, erinnert sich: »Selbst Taxifahrer in Athen
diskutierten darüber, was die BlackRock-Typen wohl aus
ihrem Auftrag machen würden.« Varoufakis selbst hatte
lange vor der Krise gewarnt, die Banken seiner Heimat
seien schlicht bankrott. Mit dieser Wahrheit, für die er die
Expertise von BlackRock nicht gebraucht habe, sei er so
unbeliebt in Athen geworden, dass er Todesdrohungen
erhielt. (Zudem verdiente er als Dozent immer weniger,
jedenfalls verließ der Experte für Spieltheorie Athen und
ging an die Universität von Texas in Austin.) Die Rolle von
BlackRock sei es auch gar nicht gewesen, tatsächlich etwas
herauszufinden, behauptet Varoufakis. »Bei solchen
Aufträgen wissen die Berater, was erwartet wird.« In dem
Fall sollten sie die faulen Kredite nicht zu hoch und nicht zu
niedrig ansetzen.
Für die griechischen Banker muss es jedenfalls ein
unangenehmer Besuch gewesen sein, wenn die Solar-,
pardon, BlackRock-Crew hereinmarschierte und Einblick in
die Unterlagen forderte. Aber am Ende blieb ihnen nichts
anderes übrig, als auf die Forderungen der ungebetenen
Gäste einzugehen, wollten sie nicht den Unmut ihrer
Zentralbank und halb Europas auf sich ziehen. Der
BlackRock-Report brachte den Griechen immerhin rund 50
Milliarden Euro von der EU, um ihre Banken zu
stabilisieren. Die Athener Auftraggeber waren so zufrieden
mit BlackRocks Ergebnis, dass sie zwei Jahre später gleich
noch einen Bankenstresstest bei den New Yorkern
orderten. Griechenland ging es nach wie vor miserabel. Die
Wirtschaft schrumpfte, die Arbeitslosigkeit lag bei 30
Prozent – bei Jüngeren sogar bei 50 Prozent. Jeder Dritte
im Land lebte laut der europäischen Statistikbehörde
Eurostat unter der Armutsgrenze. Und die Kreditausfälle
bei den Banken stiegen immer noch weiter. (Das hatte
BlackRock vorhergesagt.) Zusammen hielten die
griechischen Finanzinstitute über 70 Milliarden fauler
Kredite – das entspricht etwa einem Drittel des
Bruttoinlandsprodukts. Es wurde Zeit für eine weitere
Intervention. BlackRocks Spezialeinheit wurde erneut
angefordert. Auch dieses Mal hing eine Menge von dem
Resultat ab. Denn das Land wurde von den von der Troika
geforderten Sparmaßnahmen gelähmt. Die – aktuelle –
griechische Regierung hatte deshalb beschlossen, das Joch
der Troika abzuschütteln. Dazu wollte sie den BlackRockBericht nutzen. Laut Finks Zahlenakrobaten fehlten den
griechischen Banken rund 6 Milliarden Euro. In dem
ursprünglichen Bankenrettungsfonds befanden sich aber
noch rund 11 Milliarden Euro. Das Kalkül der Griechen: Da
der BlackRock-Bericht nur einen Bedarf von 6 Milliarden
Euro auswies, könne man den Rest der Summe aus dem
Fonds für andere Hilfsmaßnahmen umwidmen. Doch die
Troika protestierte. Ihre Erbsenzähler waren auf ein ganz
anderes Ergebnis als BlackRock gekommen. Viel zu
optimistisch hätten die BlackRock-Analysten kalkuliert.
Demnach fehlten den griechischen Banken tatsächlich
mindestens 10 Milliarden, ließ die EZB durchsickern. Die
Rechenknechte des IWF kamen gar auf über 20 Milliarden
Dollar. So jedenfalls flüsterten Insider der Financial Times
im März 2014 zu. Andere widersprachen der hohen
Summe, derart weit liege man nicht auseinander. Tatsache
ist: Monatelang stritten sich Athen, Washington, wo der
IWF zu Hause ist, und Brüssel darüber, welcher Betrag der
richtige sei. Der wahre Kern des Disputs: Das weit
niedrigere BlackRock-Ergebnis würde den Griechen den
notwendigen Spielraum verschaffen, um sich von der
Troika loszusagen. So spielte BlackRock mit seiner
Bankenanalyse hinter den Kulissen der Eurokrise das
Zünglein an der Waage.
Zypern: Fortsetzung der griechischen Tragödie
Die Eurokrise erwies sich nicht nur für BlackRock als
lukrativer Markt. Regierungen, Zentralbanken und einzelne
Banken suchten händeringend externe Experten. Meist
ging es um Bewertungen, Analysen, um das Durchrechnen
und Überprüfen von Annahmen. Es ging um Kredite, die
Banken vergeben hatten oder um komplexe Wertpapiere in
deren Portfolios, um Vermögenswerte, bei denen Zweifel
bestanden, ob es sich tatsächlich um »Werte« handelte. Ein
wichtiger Teil der Aufgabe war dabei aber immer auch,
wieder Vertrauen zu schaffen. Denn wenn es heißt, im
Krieg sterbe die Wahrheit zuerst, dann war in der
Finanzkrise das erste Opfer das Vertrauen in die
Institutionen gewesen. Konnte der Zentralbankchef oder
Finanzminister dagegen seine Einschätzung mit einem
Hunderte Seiten langen Bericht eines Unternehmens aus
New York belegen, dann konnte er zumindest hoffen, dass
seinen Angaben über den Zustand der Banken mehr
Glauben geschenkt werden würde. Für die EZB-Oberen
und die Regierungschefs der Geberländer war es ebenfalls
praktisch. Sie konnten sagen: Seht, liebe Wähler, wir haben
strenge Vorgaben, wir nehmen die Regierungen und die
Banken in die Pflicht! Neben BlackRock tummeln sich auch
die Bankberater von Oliver Wyman in dem Bereich. Dazu
die »Big 4«, wie die großen Wirtschaftsprüfer genannt
werden – also Ernst & Young, Deloitte, KPMG und
PriceWaterhouseCooper – sowie Firmen wie Alvarez and
Marsal, die unter anderem Lehman Brothers im Auftrag
des Konkursverwalters abwickelten sowie gegen stattliche
Honorare jahrelang und letztlich offensichtlich erfolglos die
rostende Detroiter Autoindustrie berieten.
Mal versuchen sich diese globalen Profiteure der Krisen
gegenseitig auszustechen, mal kooperieren sie und teilen
sich die Aufträge. Die Honorare gehen stets in die
Millionen, oft sind sie im zweistelligen Millionenbereich.
Dennoch dürfte bei den Auftragsnehmern das Geld nur ein
Teil der Attraktion sein. Fast wichtiger sind die
Verbindungen und Einblicke, die sich bei diesen Einsätzen
gewinnen lassen. Dass die meisten Kontakte weniger auf
Minister- als auf Beamtenebene stattfinden, ist dabei gar
kein Nachteil, eher im Gegenteil. Denn Beamte und
Funktionäre wissen Konkretes – und überleben meist
länger als die Regierungen, denen sie dienen.
Beim Kampf um die Aufträge geht es nicht immer
gentlemanlike zu. In Zypern etwa geriet das Gerangel
geradezu zum Polit-Thriller, auch hier komplett mit
Codenamen.
Das Drama auf der Mittelmeerinsel war eine Fortsetzung
der griechischen Tragödie. Die zypriotischen
Finanzinstitute hatten gut davon gelebt, die bei ihnen
angelegten Schwarzgelder russischer Oligarchen in
hochverzinste griechische Staatsanleihen zu stecken. Der
griechische Schuldenschnitt Anfang 2012 – der bis dahin
größte der Geschichte – machte die Staatsanleihen jedoch
zu blutroten Verlustbringern. Den größten Banken der Insel
drohte der Untergang. Schnell meldeten sich die Zyprioten
in Brüssel. Um eine erneute Ausbreitung von Panik in der
Eurozone zu verhindern, griff die Troika auch hier wieder
ein. Und auch hier forderten ihre Mitglieder – EZB, EUKommission und IWF – eine Analyse der Banken, bevor ein
Rettungsfonds kommen sollte. Panicos Demetriades,
damals der Chef der Central Bank of Cyprus, holte
entsprechend Angebote von Pimco, BlackRock, Oliver
Wyman und Clayton Euro Risk ein – alles einschlägig
bekannte Unternehmen. Obwohl BlackRock als Favorit galt,
bekam ausgerechnet Erzrivale Pimco schließlich den
Zuschlag. Doch das war noch nicht das Ende der Sache.
Ende 2012 sickerte durch, dass der Bedarf der Banken bei
erschreckend hohen 9 Milliarden Euro liegen dürfte.
Während die EU-Gläubiger, allen voran Deutschland, der
vielen bankverschuldeten Rettungsaktionen müde, harte
Forderungen begrüßten, protestierten die zypriotischen
Banker heftig und intervenierten bei Demetriades. Da tat
der Zentralbankchef etwas Ungewöhnliches: Er engagierte
die BlackRock-Analysten, denen er zuvor den Zuschlag
nicht hatte geben wollen. Sie sollten – wie beim Facharzt –
quasi eine zweite Meinung abgeben. BlackRock sollte also
den Pimco-Report überprüfen. Die Pimco-Leute schäumten.
Aber sie konnten wenig ausrichten. Wie schon in
Griechenland versuchten die BlackRock-Jungs ihre
Tätigkeit soweit wie möglich unter dem öffentlichen Radar
zu halten. So sehr, dass sie für die Beteiligten Decknamen
verwendeten, berichtete jedenfalls die New York Times
unter Berufung auf interne Dokumente. Claire war
demnach die Bezeichnung für die zypriotische Zentralbank,
Peter stand für Pimco und Ben für BlackRock.
BlackRock kam zu dem Ergebnis, ihre Konkurrenten von
Pimco hätten zu pessimistische Annahmen gemacht. Die
Prognosen für die Kreditausfälle seien zu hoch angesetzt.
Kurz: Der Finanzbedarf der Banken sei geringer als der von
Pimco und der Troika angesetzte. Sieben Monate lang ging
das Tauziehen zwischen Zypern und den europäischen
Gläubigern. Anfang 2013 schnürte die Troika das
Rettungspaket – auf der Grundlage der Pimco-Zahlen. Der
veranschlagte Finanzbedarf war von großer Bedeutung –
nicht zuletzt für die Zyprioten, von denen viele ihre
Ersparnisse verloren. Denn ihre Einlagen bei den Banken
wurden mit zur Rettung herangezogen. Anders als in
Griechenland war es dieses Mal das Außenvorbleiben des
BlackRock-Berichts, der das politische Schicksal des
Landes beeinflusste. Wenig überraschend machten die
Verluste der Sparer die zypriotische Regierung unbeliebt.
Warum der positivere BlackRock-Bericht nicht eingebracht
wurde, darüber gibt es unterschiedliche Darstellungen.
Demetriades, der auf Druck der neuen Regierung in Zypern
abgelöst worden war, behauptet, der Bericht sei zu spät
fertig geworden. Offiziell ging er tatsächlich erst im Mai
2013 bei der Zentralbank ein. Doch Insider behaupten, eine
Vorversion habe dem Zentralbankchef bereits im Januar
vorgelegen. Dieser habe aber weder die Troika, noch die
neue Regierung über die positiveren Ergebnisse darin
informiert. Wie auch immer die Vorgänge auf der
Mittelmeerinsel waren: Klar ist, dass auch hier BlackRock
mit dem Bericht seiner Analysten eine entscheidende
politische Rolle spielte. BlackRock wollte auf Anfrage zur
Tätigkeit des Hauses in Zypern nicht Stellung nehmen.
Nicht zum Zug kam BlackRock in Spanien. Zwar waren
die New Yorker angeblich kurz davor, den Zuschlag zu
bekommen, doch dann zuckte Spaniens Wirtschaftsminister
Luis de Guindos im letzten Augenblick zurück. Gegenüber
Bloomberg News erklärte er: »Glauben Sie nicht, dass
BlackRock Vermögenswerte in Spanien kaufen will? Wenn
Sie der Schiedsrichter sind und gleichzeitig kaufen Sie
diese Vermögenswerte, um die es geht, dann ist das ein
klarer Interessenkonflikt.« (Oliver Wyman und Roland
Berger bekamen stattdessen den Zuschlag.) Fink habe
geschäumt vor Wut, berichtet ein Mitarbeiter, er habe von
den Verantwortlichen in Europa wissen wollen, wie ihnen
ein solcher Auftrag durch die Lappen gehen konnte.
Spanien war die Ausnahme. Wie schon in den USA, steht
Finks Nummer auch in Europa auf der Kurzwahlliste von
Zentralbankern, Finanzministern und EU-Spitzenleuten.
(So erteilte Her Majesty’s Treasury, das britische
Schatzkanzleramt, den Amerikanern wenige Monate nach
der Absage der Spanier BlackRock den Auftrag, die
toxischen Vermögenswerte der Royal Bank of Scotland
auseinanderzunehmen.) Im Sommer 2012 gelang Fink
jedoch ein Coup, der BlackRock endgültig fest in Europa
etablierte. Aber der Reihe nach.
Auf dem Zauberberg
Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist der Traum jedes
Verschwörungstheoretikers. Jedes Jahr im Januar trifft sich
in dem Städtchen in den Schweizer Alpen die Weltelite oder
besser gesagt, diejenigen, die von den Organisatoren und
den Sponsoren dafür gehalten werden. Eingeweihte
benutzen übrigens statt Weltwirtschaftsforum oder dem
englischen Namen World Economic Forum nur die
Abkürzung WEF, das wie ein kurz dahin gebelltes »Weff«
ausgesprochen wird. Zum »Weff« gehört unbedingt die
winterliche Kulisse. Der US-Sender CNN forderte einmal
die Veranstalter auf, die Schneekanonen anzuwerfen. Die
Tannen sollten gefälligst schön eingepudert sein. Den
Einwand, dass so etwas bei zu warmen Temperaturen nicht
möglich sei, ließen die Produzenten nicht gelten.
Das »Weff« 2015 setzte neue Maßstäbe. Es kamen über 2
500 Teilnehmer aus 140 Ländern. Der Züricher Flughafen
meldete für die Zeit vom 21. bis 24. Januar rund 1 100
zusätzliche Flüge. Das lag vor allem an den Privatjets.
Zwischen der Schweizer Bankenmetropole Zürich und
der höchsten Stadt der Alpen (so bezeichnet sich die 11
000-Seelen-Gemeinde gerne selbst) sah man in den »Weff«Tagen fast nur schwere Limousinen auf der Straße. Audi,
Mercedes, BMW, SUVs – getönte Scheiben im Fond, der
Chauffeur am Steuer. Ganz Eilige nahmen den Helikopter.
Der chinesische Premierminister soll dagegen angeblich
mit der Bahn angereist sein. In der 1. Klasse der
Rhätischen Bahn liegt auf jedem Platz die jüngste Ausgabe
der Financial Times. Das zeigt schon, dass es in diesen vier
Tagen im Jahr nicht um Skifahren und die gute Luft in den
Alpen geht. Die ersten Absperrungen beginnen bereits
etwa 20 Kilometer vor Davos. Tausende Soldaten der
Schweizer Armee sind im Einsatz. Angeblich werden die
Wasserleitungen und Quellen oberhalb von Davos
regelmäßig getestet. Niemand soll schließlich die »Weff«Besucher vergiften. Auf dem Dach des Kongress-Hotels
sind Scharfschützen in weißen Tarnanzügen postiert, die
mit ihren Feldstechern die Umgebung auf Verdächtiges
absuchen. Das Gebiet um das Kongresszentrum, das an
eine überdimensionale Holzschachtel erinnert, ist komplett
abgeriegelt. Nur mit dem Sonderausweis lassen einen die
freundlichen, aber bestimmten Polizisten passieren. Dann
geht es durch den Metallscanner und schließlich durch
einen weißen Plastikschlauch bis zur nächsten Kontrolle.
Nobelpreisträger Robert Shiller kommt gerade aus dem
Tunnel gelaufen. Und dann geht das Sprachgewirr los.
Inder, Chinesen, Sudanesen, Amerikaner, Araber,
Schweizer, Italiener, Japaner, Ägypter, Ukrainer, Russen,
Deutsche. Hier, im Kongresszentrum, finden auf den
unteren Ebenen die »Power Meetings« statt. An kleinen
Kaffeetheken können sich Konferenzteilnehmer
austauschen. Journalisten lauern auf vorbeigleitende große
Fische, auf die VIPs aus Wirtschaft und Politik. Um die
Wartezeit zu überbrücken, bedienen sie sich freimütig an
den Kaffeebars mit Cappuccino, Milchkaffee, Tee,
Rüblitorte und Nusskuchen. Alles gratis! Die »Weff«-Zeit
soll schließlich so effizient wie möglich genutzt und nicht
mit dem Griff nach dem Kleingeld vergeudet werden.
Drumherum im Städtchen wird jeder Meter eingesetzt.
Der Friseursalon hat seine Räumlichkeiten an einen
Sponsor vermietet, der dort Meetings abhält.
Einheimischen, die während des »Weff« einen Haarschnitt
brauchen, bietet der Friseur stattdessen Hausbesuche an.
Die Credit Suisse hat nicht weit davon den Möbelladen
angemietet, komplett ausgeräumt und zu einer
Begegnungsstätte umgewandelt. Microsoft ist ebenfalls mit
einem Pavillon vertreten. Google soll angeblich 30 000
Schweizer Franken in der Woche für ein Apartment gezahlt
haben, so wird erzählt. In der Stadtbücherei haben sich das
Schweizer Radio und Reuters eingenistet. Auf dem Dach
des Hallenbads, gleich neben dem Kongresszentrum, haben
das Schweizer TV, der amerikanische Wirtschaftssender
CNBC und Fox News ihre Pop-up-Studios aufgebaut.
Staatschefs, Ökonomen, Wirtschaftsbosse geben sich hier
im Minutentakt für die Live-Sendungen und Interviews die
Klinke, pardon, das Mikro in die Hand. Nirgendwo auf dem
Planeten findet sich so viel Macht wie hier in diesem
überraschend uncharmanten Berg-Kaff mit seinen
zusammengewürfelten Hotelkästen.
Dass sich das »Weff« zu einer Art globalen ÜberOrganisation entwickeln würde, war nicht abzusehen. An
Ehrgeiz mangelte es dem Gründer Klaus Schwab allerdings
nicht. Schwab, Jahrgang 1938, wurde in Ravensburg im
Oberschwäbischen geboren. Als junger Mann engagierte er
sich in der europäischen Bewegung. Er studierte
Maschinenbau und Betriebswirtschaft und erhielt einen
Mastertitel in öffentlicher Verwaltung von der Harvard
University. Die Art, wie die Amerikaner sich intellektuell
mit Betriebsführung und Unternehmen auseinandersetzten,
faszinierte Schwab. Dazu gehörte etwa die Ansicht, dass
Unternehmen nicht nur den Eigentümern verpflichtet sind,
sondern auch anderen Interessen wie etwa dem Staat, den
Arbeitnehmern und den Kunden. 1971, er war inzwischen
Professor an der Universität in Genf, organisierte er ein
Europäisches Management Forum in Davos. Ihm gefielen
die Abgeschiedenheit des Orts und die Tatsache, dass er
ein Kongresszentrum hatte. Und nicht zuletzt der Nimbus
der Intellektualität, der Davos umgab. Auf der Davoser
Schatzalp spielt Der Zauberberg von Thomas Mann. Der
Bildhauer Philipp Modrow wollte dort eine
Frauenhochschule eröffnen, in der in Esperanto
unterrichtet werden sollte. Das war 1921. Die Stadtväter
lehnten dankend ab. Als 1928 tatsächlich eine Hochschule
eröffnet wurde, hielt Einstein die Ehrenrede. Im Frühjahr
darauf hielten Heidegger und Cassirer, die Gegenpole der
Philosophie des 20. Jahrhunderts, ihre legendäre
Disputation dort. Ob es nun die Alpenluft, die Skipisten
oder das Nachklingen der großen Denker war – Schwabs
Forum, das er jährlich wiederholte, zog immer mehr
Teilnehmer an, es wurde ein globales Phänomen. 1987
nannte er es entsprechend um zum World Economic Forum.
Um die Veranstaltung herum ist ein ganzes Konglomerat
aus Forschungsinstituten, Konferenzen und
Beratungsleistungen entstanden. Am Hauptsitz in Cologny,
nahe Genf, beschäftigt das WEF inzwischen etwa 500
Personen, in New York 120, in Peking 30, und 8 Personen
arbeiten im Tokioter Büro. Im Jahr 2015 betrug das Budget
250 Millionen Franken. Finanziert wird es durch
Mitgliedsbeiträge – so gut wie alle der tausend größten
Unternehmen der Welt sind dabei. So wichtig ist ihnen das
»Weff«, dass sie zwar grummelten, aber zahlten, als 2014
die Beiträge um 20 Prozent anzogen. Die 100 Mitglieder
der wichtigsten Gruppe, die so genannten Strategic
Partners, die auch über die Ausrichtung des Programms
mitentscheiden können, zahlen inzwischen 600 000
Franken pro Jahr. Zu diesen Partnern, die laut »Weff«
aufgrund ihres Engagements »den Zustand der Welt zu
verbessern« ausgewählt wurden, gehören deutsche
Unternehmen wie Audi, Burda, Henkel, Siemens und die
Deutsche Post. Dabei sind internationale Namen wie Coca
Cola, die Chemieriesen DuPont und Dow Chemical, der
Pharmariese Novartis, der amerikanische
Infrastrukturkonzern Fluor (der stark am Wiederaufbau im
Irak beteiligt war) sowie Tech-Konzerne wie Facebook,
Google und Cisco. Aber auch obskure Teilnehmer wie
SOCAR, der staatliche Ölkonzern von Aserbaidschan, oder
Bridgewater Associates sind mit von der Partie. Ray Dalio,
Gründer des 170 Milliarden Dollar schweren Hedgefonds,
schwört auf »Lebens- und Managementprinzipien« und
verlangt von seinen Mitarbeitern radikale Offenheit,
weswegen er alle Gespräche im Unternehmen aufzeichnen
lässt. Und natürlich: BlackRock.
Die Besucher in Davos mögen sich allesamt zur Elite der
Welt zählen. Doch auch hier gibt es klare Unterschiede.
Wer zu welcher Kaste gehört, zeigt sich an den
verschiedenen Ausweisen, die den Besuchern um den Hals
baumeln. An ihnen lässt sich ablesen, wer Zugang zu
welchen Veranstaltungsorten hat. Der Blick der Teilnehmer
wandert automatisch vom Gesicht des Gegenübers auf
dessen Ausweis. »Das war so oft der Fall, dass ich zum
ersten Mal verstand, wie man sich mit einem tiefen
Ausschnitt fühlen muss«, beschrieb es einmal der
(männliche) Reporter des New Yorker.
Um zum »Real Davos« vorzudringen, braucht es
allerdings mehr als den richtigen Ausweis. Die eigentlichen
Gespräche finden nicht im Konferenzzentrum oder den
Pavillons drum herum statt. In Hotels werden Suiten
gebucht, um ein regelrechtes Speed-Dating zwischen
Politikern und Wirtschaftsführern zu ermöglichen. Hier
können sie ungezwungen und unter Ausschluss der
Öffentlichkeit zusammenkommen.
Und nur wer wirklich dazugehört, geht im Hotel
Belvedere aus und ein: ein illustrer Kreis aus
Zentralbankern und sonstigen Bankern, Konzernlenkern,
Hedgefonds-Managern, Propheten und Erben aller Art,
Astrophysikern, Mönchen, Silicon-Valley-Vertretern und in
der Regel Bono. Der Lead-Sänger von U2 mit der rosa
Brille ist inzwischen »Weff«-Stammgast, weniger freundlich
könnte man ihn als Davoser Hofnarren bezeichnen. Bonos
Anwesenheit sei gut, befand 2008 das Magazin Time. Etwa,
weil er bei einer Diskussion über Armut schon mal auf die
Absurdität hinweise, dass die Diskussionsteilnehmer zu den
reichsten Menschen der Welt gehören. Solche
selbstkritischen Töne sind aber rar.
Alle »Weff«-Teilnehmer baden in gegenseitiger
Anerkennung. Rund 80 Prozent der Anwesenden sind
männlich und der größte Teil weiterhin weiß. »Das macht
die Partys etwas einseitig«, bedauert eine Insiderin, die seit
2007 dabei ist. Obwohl alles dort weit gesitteter als bei
anderen internationalen Treffen zugehe, wie sie versichert.
Die New Yorkerin berät wohlhabende und institutionelle
Anleger und für sie ist das »Weff« die wichtigste
Veranstaltung des Jahres. Dabei geht es nicht um direkte
Geschäfte, solch krude Vorgehensweise ist verpönt. Man
baue Goodwill auf, schaffe Möglichkeiten, teste Ideen.
Kurz, man schafft eine Basis, auf die man später für
konkretere Transaktionen zurückgreifen kann. Es heißt,
dass die nordamerikanische Freihandelszone Nafta in
Davos konzipiert wurde. Man spricht in bestimmten
Begriffen, einem Davos-Lingo, wie es die New Yorker
Insiderin beschreibt. »Um den zu begreifen, muss man
schon ein paarmal dabei sein.« Und man muss erst einmal
reinkommen. Es gibt keine Eintrittskarten. Egal ob
Konzernchef oder Guru – man muss eingeladen werden.
Auch das trägt zur Exklusivität bei.
Wer es einmal geschafft hat, sich im Davoser Netzwerk
zu verknoten, hat allerdings ausgesorgt. »Selbst wenn ein
Politiker sich in seinem Heimatland unmöglich gemacht
hat, seine Landsleute ihn sogar verachten, so lange er vom
Davoser Jetset hoch geschätzt ist, stehen ihm heute viele
Möglichkeiten offen – bei der EU-Kommission, dem
Internationalen Währungsfonds und so weiter. Ja, die
Verachtung der Landsleute kann sogar ein Plus sein –
schließlich zeigt sie, dass man bereit ist zu tun, was die
internationale Gemeinschaft verlangt, auch wenn es gegen
die eigenen Bürger in der Heimat gerichtet ist«, ätzt der
linksliberale amerikanische Blogger Matthew Yglesias in
seinem Essay »Die global herrschende Klasse«.
BlackRock-Boss Larry Fink ist noch nicht lange dabei. Ja,
so wird kolportiert, er habe zu denjenigen gehört, die
Davos als »viel heiße Luft« abgetan hatten – bevor er selbst
eine Einladung erhielt. Doch jetzt gehört Fink, das einstige
»California Kid«, dazu. Das hätte er sich sicher nicht
träumen lassen, während er als Junge im väterlichen Laden
Schnürsenkel sortierte und Schuhkartons einräumte. »Er
ist nicht so glatt wie Banker oder Politiker«, hat die New
Yorker Beraterin und Davos-Veteranin beobachtet. Fink sei
bei seinen Davos-Begegnungen noch sehr
»transaktionsbezogen«. So ganz kann Fink seine
Vergangenheit als Wall-Street-Trader offenbar nicht
ablegen. Ein wenig gelästert wird in Davoser Kreisen über
Finks Neigung zum Name-Dropping, er sei zudem ein
bisschen eine Klatschbase, heißt es. Egal, Larry Fink hat es
geschafft. Und so findet man ihn im Januar 2015 entspannt
auf einer jener Cocktail-Partys im Belvedere, an seiner
Seite eine Russisch-Schweizer Milliardärswitwe und ein ExNotenbanker. Wie kommt der Chef einer bis vor kurzem
obskuren New Yorker Anlagefirma, spezialisiert auf die
verwickelteren Ecken strukturierter Bond-Produkte, dahin?
Und noch wichtiger: Was macht er da?
Der Türöffner
Es war im Sommer 2012, als Fink seinen bisher dicksten
Fisch angelte. Er konnte Philipp Hildebrand anheuern.
»Wenige Führungskräfte genießen eine derartig breite
Anerkennung für ihre Expertise, ihr Urteil und ihre
Integrität«, schwärmte der BlackRock-Boss in der
Pressemitteilung zu seiner Neueinstellung. (Kurz nachdem
die Nachricht bekannt wurde, erhielt Larry übrigens einen
Anruf von seinem alten Bekannten Tim Geithner, damals
noch Finanzminister in Washington. Das geht aus Geithners
offiziellen Tagebüchern hervor. Was Obamas wichtigster
Minister mit Fink in den zehn Minuten besprach, die das
Telefonat dauerte, ist allerdings nicht bekannt.)
Gegenüber Hildebrands vorherigem Job war Finks
Angebot allerdings ein Rückschritt. Hildebrand war zuvor
der Chef der Schweizer Nationalbank gewesen. Der Herr
der Schweizer Banken. Und sein Abgang von diesem
Spitzenposten war nicht ganz freiwillig gekommen. Zum
Verhängnis war Hildebrand seine Frau geworden, Kashya
Hildebrand, die er bei seinem früheren Arbeitgeber Moore
Capital Management, einem Hedgefonds mit Sitz in New
York und London, »kennen und lieben gelernt hatte«, wie
es der Schweizer Tagesanzeiger ausdrückte. Bei Moore
verdiente Hildebrand laut Berichten ein Vermögen. Er
wechselte in die alpine Heimat zurück – arbeitete bei der
Bank Vontobel und der Genfer Union Bancaire Privée. Mit
nur 40 Jahren schaffte er es in das Direktorium der
Schweizer Nationalbank. 2010 wurde er zu deren Präsident
berufen. Das Ehepaar ließ sich in Zürich nieder und Kashya
eröffnete dort eine Kunstgalerie in einer Querstraße zur
Bahnhofstraße, wo sich Edelboutiquen an Privatbanken
reihen. Geboren in Pakistan, aufgewachsen in den USA,
spezialisierte sich die »Galeristin, die von der Wallstreet
kam«, auf Künstler aus China, Russland und den USA. Die
Klientel stammte meist aus Asien. Doch ganz kam Kashya
Hildebrand offenbar nicht von ihrer Finanzvergangenheit
los. Am 15. August 2011 orderte sie über sein Konto – laut
Hildebrands späteren Aussagen ohne dessen Wissen – 400
000 Schweizer Franken gegen 504 477 Dollar
einzutauschen. Am 6. September 2011 kündigte Hildebrand
in seiner Eigenschaft als Notenbankchef an, den Schweizer
Franken an den Euro zu binden, um den Kurs des Franken
zu drücken. Das Dollar-Geschäft seiner Frau erwies sich
dadurch als sehr vorteilhaft. Bekannt wurde es erst Monate
später, weil Bankmitarbeiter die Kontounterlagen der
Hildebrands dem Schweizer Nationalrat Christoph Blocher,
einem Rechtsaußen-Politiker und Kritiker von Hildebrand,
zuspielten. Philipp Hildebrand versicherte öffentlich, er
habe von der Transaktion vor seiner Entscheidung über die
Euro-Bindung nichts gewusst. Verschiedene externe und
interne Untersuchungen kamen alle zu dem Schluss, die
Hildebrands hätten sich keine Verstöße zuschulden
kommen lassen. Doch der Druck auf Hildebrand war zu
groß. Im Januar 2012 trat er zurück. Er habe um den Job
gekämpft wie ein Löwe, sagte er bei seinem Abgang.
Schon vor seinem Rücktritt war Hildebrand in der
Schweiz eine etwas umstrittene Figur. Angefangen hatte er
als einer der »Kofferträger« beim – wo sonst? –
Weltwirtschaftsforum, wie die Mitarbeiter genannt werden,
die für die Organisation des »Weff« sorgen. Ob er es seiner
Zeit beim »Weff« verdankt oder nicht: Hildebrand erwies
sich als Meister des Networkings. Er gilt nach wie vor als
einer der Finanzmänner, die international am besten
vernetzt und anerkannt sind. »Der Überbanker«, nannte
ihn einmal das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz. Einer,
der es mit den Briten und Amerikanern, die die
Finanzmärkte dominieren, aufnehmen konnte, der ihre
Sprache sprach. Doch Hildebrands Vertrautheit mit der
Wall Street und der City schien seinen Schweizer Kritikern
schon vor dem Skandal um den Dollarkauf unpassend für
einen Notenbanker. Der Multimillionär unterhielt nicht nur
exzellente Kontakte zu Bankern und HedgefondsManagern. Er war ein Finanzdiplomat ersten Ranges.
Hildebrand war Mitglied des Comité stratégique der
Agence France Trésor, Frankreichs Schulden- und
Vermögensverwaltung. Er wurde Vize-Vorsitzender des
Financial Stability Board, jenem internationalen Gremium
in Basel, das nach der Finanzkrise 2008 gegründet wurde,
um solche Krisen künftig zu verhindern. Vorsitzender war
zu der Zeit Ex-Goldman-Sachs-Direktor Mario Draghi, der
spätere EZB-Chef. Mit Draghi verbindet Hildebrand noch
mehr: Beide sind Mitglieder der Group of Thirty, deren 30
Mitglieder sich aus einem exklusiven Kreis von ehemaligen
und aktuellen Notenbankern, Akademikern und Bankern
rekrutieren. Zweck des Clubs, der in den 1970ern von der
Rockefeller-Stiftung gestartet wurde, ist es laut der
Webseite, das »Verständnis internationaler wirtschaftlicher
und finanzmarkttechnischer Themen zu vertiefen« sowie
»die Möglichkeiten zu untersuchen, die sich
Marktteilnehmern und Regulierern bieten«. Zu den
Mitgliedern gehören der ehemalige Fed-Chef Paul Volcker
und der ehemalige EZB-Chef Jean Claude Trichet. Auch ExBundesbankpräsident Axel Weber ist mit von der Partie
sowie Zhou Xiaochuan, der Gouverneur der People’s Bank
of China. Ach ja, und Larry Summers ist dabei, der nach
seiner Zeit als Finanzminister Bill Clintons eine Weile
Präsident der Harvard Universität war und dann zu
Obamas engstem Berater wurde. Mit Summers pflegt
Hildebrand genauso vertrauten Umgang wie mit Timothy
Geithner – Larry Finks altem Bekannten aus New Yorker
Tagen – und Ex-Präsident Bill Clinton. Ein enger Freund ist
Mark Carney, der Trauzeuge der Hildebrands war. Carney,
ein ehemaliger Goldman-Sachs-Banker, war erst
Notenbankchef in Kanada und wurde 2013 zum
Gouverneur der Bank of England ernannt.
Hildebrands Ehe mit Kashya ist inzwischen Geschichte.
Stattdessen ist jetzt Margarita Louis-Dreyfus an seiner
Seite. Die französischen Medien nennen sie »die Zarin«.
Die gebürtige Russin hat ihre eigene Aufstiegsgeschichte.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs heiratet Margarita
Bogdanova einen Schweizer. Die Ehe hält nicht lang, da
lernt sie den Franzosen Robert Louis-Dreyfus kennen. Der
ist Erbe eines Imperiums, er beherrscht den drittgrößten
Rohstoffkonzern der Schweiz. Im Juli 2009 stirbt er an
Leukämie. Die »blonde Russin mit dem Silberblick«, wie
das Schweizer Boulevardblatt Blick seine Witwe nennt,
überraschte alle, indem sie »die Zügel des Imperiums an
sich riss«, wie das Schweizer Boulevardblatt Blick es
beschreibt. So richtig gefunkt zwischen dem strategisch
denkenden Hildebrand und der Rohstoff-Milliardärin habe
es – wo sonst? – 2013 in Davos. Zwei Jahre später sind die
beiden wieder dort – als Begleiter Larry Finks auf der
besagten Cocktail-Party im Belvedere.
Mögen die Schweizer Hildebrand auch aus dem Amt
gejagt haben, seine Freunde aus der Welt von Hochfinanz
und Politik hat Hildebrand nicht verloren. In dieser Welt
haftete BlackRock mit seinem zusammengekauften
Imperium immer noch der Geruch des arriviste an, eines
Neuankömmlings ohne Stammbaum. Mit Hildebrand
öffneten sich für Fink auf einen Schlag Türen, die ihm trotz
seiner Billionen bis dahin verschlossen geblieben waren.
Der Ritterschlag der EZB
Hildebrands Verbindungen dürften kaum geschadet haben
bei dem bisher prestigeträchtigsten Auftrag in Europa, den
BlackRock 2014 an Land zog. EZB-Chef Mario Draghi –
dem Ex-Notenbanker Hildebrand wohl vertraut –
verkündete im August, ein Aufkaufprogramm für private
Kreditpapiere einrichten zu wollen. Den Aufbau dieses
Programms sollte BlackRock als Berater für die EZB
übernehmen. Befragt, ob es eine öffentliche Ausschreibung
gegeben habe, erklärt die EZB-Pressestelle, es habe ein
»wettbewerbsbasiertes Verhandlungsverfahren«
stattgefunden. Dies entspreche den EZBBeschaffungsrichtlinien nach Artikel 6.1. Über ein solches
Programm hatte Draghi zuerst öffentlich im Januar 2014
nachgedacht – und zwar in Davos, beim »Weff«. In groben
Zügen sollte das Programm die Banken der Eurozone
wieder dazu bringen, mehr Kredite an Privatleute und an
Unternehmen auszureichen. Die Banken, so der Plan,
würden Autokredite, Hypotheken und andere private
Darlehen in Pools bündeln und dann Tranchen daraus als
Wertpapiere herausgeben. Diese Wertpapiere würde ihnen
die EZB dann abkaufen. Weil sie in der EZB einen sicheren
Abnehmer hätten, würden die Banken bereitwilliger mehr
solcher Kredite herausgeben. Das frische Geld von den
Banken würde dann – so die Idee – dafür sorgen, dass
Privatleute neue Autos, Fernseher und Möbel auf Pump
kauften und so die Nachfrage steigern würden. Die
Unternehmen würden mit dem geliehenen Kapital neue
Fabriken bauen und mehr Jobs schaffen.
Klassischerweise versucht die Notenbank so etwas über
Zinssenkungen zu erreichen, die Geld billiger machen.
Doch die Zinsen in der Eurozone waren zu dem Zeitpunkt
bereits bei null. Die Wirtschaft in den südlichen Ländern
sprang trotzdem nicht an. Das Aufkaufprogramm, mit
dessen Aufbau der EZB-Chef Finks Truppe beauftragt
hatte, war aber auch aus politischen Gründen wichtig für
den Ex-Goldman-Banker Draghi. Es war ein
Fehdehandschuh, den er seinem Gegenspieler,
Bundesbankchef Jens Weidmann, hinwarf. Die beiden
stritten zu dem Zeitpunkt erbittert hinter den Kulissen.
Draghi wollte eigentlich Staatsanleihen in großem Stil
aufkaufen – nach dem Vorbild der amerikanischen
Notenbank. Die hatte mit dieser Methode – Quantitative
Easing oder kurz QE genannt – in den USA die Konjunktur
wieder angekurbelt. Wobei die wahre Wirkung des QE trotz
der scheinbaren Erfolge höchst umstritten ist. Weidmann
jedenfalls wehrte sich lange gegen QE. (Draghi setzte sich
schließlich doch durch und startete ein europäisches QE im
Frühjahr 2015.) Das Programm, mit dem Draghi BlackRock
beauftragte, ist eine Variante des QE. Eine Art QE light. Die
Auftragsvergabe an BlackRock sollte Weidmann ein für alle
Mal klarmachen: QE findet statt.
Was Draghi vorschwebt, ist im Grunde nichts anderes, als
der verzweifelte Versuch, die kaputte Geldmaschine wieder
zusammenzubauen und anzuwerfen, die im Jahr 2007
wegen der Wackelhypotheken zerborsten war und die Krise
ausgelöst hatte. Die Befürworter des Kreditpapieraufkaufs
– neben Draghi waren das, wenig überraschend, die großen
europäischen Banken wie die Deutsche Bank und ING –
argumentierten, das Problem mit der Geldmaschine sei nur
die Qualität der verbrieften Kredite gewesen. Wenn man
jedoch auf die Qualität achte, hätte die Geldmaschine das
Potenzial, die europäische Wirtschaft anzuschieben.
Ein solches Programm bietet allerdings auch eine gute
Gelegenheit für Banken, Schrottpapiere an die EZB
loszuwerden. Und damit das Ausfallrisiko an den
Steuerzahler abzuschieben. Ein Risiko, das die EZB
offenbar bereit war einzugehen. Bei der Ankündigung des
Aufkaufprogramms erklärte Benoit Coeure, Mitglied des
EZB-Verwaltungsrats, damit das anvisierte
Aufkaufprogramm sein Potenzial voll entfalten könne,
müssten die Regierungen zumindest einen Teil davon bei
Ausfällen garantieren: »Der Verbriefungsmarkt wird einen
deutlich größeren Umfang an öffentlichem Sponsoring
benötigen«, sagte er dem Finanzjournal Risk. Im Klartext:
Verluste würde der Steuerzahler übernehmen. Draghi
selbst erklärte immer wieder, er wünsche sich eine
Lockerung der Auflagen für die Kreditverbriefungen. Nur
so käme der Markt für solche Kreditpapiere, der nach der
Finanzkrise nahezu ausgetrocknet war, wieder in Gang. Die
Kombination von staatlichen Garantien und lockereren
Regeln: für Skeptiker wie Weidmann ein Horrorszenario.
Die Wahl von BlackRock birgt zusätzliche Probleme.
Denn BlackRock ist nach Berechnungen des
Finanznachrichtendienstes Bloomberg einer der größten
Investoren in europäischen Kreditpapieren, genau jenen
Papieren, die in dem EZB-Programm aufgekauft werden
sollen. Ein klarer Interessenkonflikt.
Seit dem 21. November, so erklärte die EZB auf Anfrage,
läuft das Aufkaufprogramm unter dem offiziellen Namen
Asset-Backed Securities Purchase Programme oder kurz
ABSPP. Es soll mindestens zwei Jahre durchgezogen
werden. Die EZB legt Wert darauf, dass BlackRock
Solutions den Auftrag bekommen habe, eine von
BlackRock, Inc. »unabhängige Institution«. BlackRock
Solutions sei lediglich für das »Design und Umsetzung« als
Berater tätig gewesen und habe nichts mit dem laufenden
Programm zu tun, heißt es in der Stellungnahme. Der
Vertrag zwischen EZB und BlackRock Solutions beinhalte
eine Reihe von Vorkehrungen, durch die
Interessenkonflikte »weitestgehend abgeschwächt«
werden, so die EZB. Unter anderem erhält BlackRock zur
Auflage, seine Angestellten, die für die EZB an dem ABSPP
arbeiten, von anderen Mitarbeitern zu trennen, die im
Bereich verbriefter Wertpapiere tätig sind. Externe
Auditoren würden dies prüfen. Die Namen dieser Prüfer
wollte die EZB aber nicht nennen. Im Laufe des
Beschaffungsverfahrens hätte sich gezeigt, dass BlackRock
über »große Erfahrung« und »bewährte Verfahren« beim
Managen von Interessenkonflikten verfüge, lobte die EZB.
BlackRock wollte zu dem ABSPP-Auftrag keine Stellung
beziehen.
Symbiose mit den Notenbankern
Notenbanken und Zentralbanken sind für BlackRock ganz
besondere Kunden. Vor der Krise agierten sie im
Hintergrund, die »Lords of Finance«, wie sie Liaquat
Ahamed in seinem gleichnamigen Buch über die Rolle der
Notenbanker in der Depression der 1930er Jahre nannte.
Irgendwo verortet zwischen Staat und Finanzsystem traten
sie selten öffentlich in Erscheinung. Seit sie mit Milliarden
um sich werfen, wie Narren am Rosenmontag mit Konfetti,
sind ihre Namen – Ben Bernanke, Mario Draghi, Janet
Yellen – so bekannt wie die von Politikern. Doch nach wie
vor sind die inneren Abläufe bei den Noten- und
Zentralbanken selbst für Ökonomen nicht einfach
nachzuvollziehen. Obwohl es Notenbanken nun seit
Hunderten von Jahren gibt (die schwedische Riksbank zum
Beispiel gibt es seit 1668), umwabert die Institute bis heute
eine gewisse Mystik. Gerne traf und trifft man
Entscheidungen hinter verschlossenen Türen. Die
Gründung der Federal Reserve etwa hätte als Vorlage für
einen Thriller dienen können: Die an der Planung
beteiligten Banker – Wall-Streeter zumeist – reisten im
November 1910 unter Decknamen und dem Vorwand, auf
Entenjagd zu gehen, per Bahn nach Florida und von dort in
den tiefen Süden, nach Georgia, wo sie schließlich auf
einer Privatinsel vor der Küste zusammentrafen. Aus den
geheimen Plänen wurde drei Jahre später die Fed. 20 Jahre
lang erzählte keiner der Teilnehmer ein Sterbenswörtchen
über das Treffen auf der Insel. Man fürchtete, nicht zu
Unrecht, den Widerstand des US-Kongresses, der in der
neuen Institution eine Konkurrenz um Macht und Einfluss
sah. Ganze Scharen von Spezialisten in der Finanzbranche
beschäftigen sich inzwischen mit nichts anderem, als die
Fed oder die EZB zu beobachten. Jede Rede, jeder Auftritt
eines Notenbankers erzeugt seitenlange Interpretationen.
Bei einer ihrer ersten Pressekonferenzen 2014 wurde Janet
Yellen gefragt, was unter »geraumer Zeit« zu verstehen sei.
Die Fed hatte in ihrem Protokoll angegeben, sie wolle die
Zinsen noch eine »geraume Zeit« niedrig halten. Yellen
zögerte mehrere Sekunden und stotterte dann »sechs
Monate oder so etwas«. Die Bemerkung löste umgehend
einen Einbruch an Aktien- und Anleihemärkten aus. Mit
ihrer wohl unbedachten Äußerung hatte die
Notenbankchefin plötzlich einen konkreten Termin für eine
Zinserhöhung anberaumt! Seither ist Yellen vorsichtiger
geworden, aber im Vergleich zu ihrem Vorvorgänger ist sie
von geradezu brutaler Offenheit. Alan Greenspan, Chef der
Fed von 1987 bis 2006, war ein Meister kryptischer
Äußerungen. Um wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt zu
haben, versuchte die Wall Street schließlich Greenspans
Zinsentscheidungen vorab daran abzulesen, wie gut gefüllt
die Aktenmappe war, mit der der Notenbankchef am Tag
des Fed-Treffens ins Büro kam. (Und ja, das Fernsehen war
dabei, wenn Greenspan an solchen Tagen die Treppen des
Fed-Gebäudes erklomm!)
Die Bedeutung und Rolle der Notenbanker ist in den
vergangenen Jahrzehnten gewachsen, weil sich die
Globalisierung verändert hat. Früher folgten Geldströme
den Warenströmen, heute schwappt das Geld auf der Suche
nach Investments um den Globus. Doch es war die Krise
2008, die die Notenbanker entzaubert, aber sie auch
politisiert hat. Ben Bernanke, Greenspans Nachfolger,
scheute sich nicht, bis dahin unerhörte Maßnahmen zu
ergreifen, um nach dem Schuldendebakel 2008 die
Wirtschaft in den USA wieder anzukurbeln. Bernanke habe
derart viele Notfallkreditprogramme wie etwa TALF
kreiert, dass »ein Dokument mit all den Namen und kurzen
Beschreibungen selbst kleingedruckt ein DIN-A-4-Blatt
füllen würde«, wie es Neil Irwin, der Fed-Korrespondent für
die Washington Post während der Krise, einmal
beschrieben hat. De facto betrieb und betreibt die Fed
Konjunkturpolitik. Das empfinden vor allem
republikanische Abgeordnete im Kongress als
Überschreiten des Mandats der Notenbank. Doch aus
Bernankes Sicht blieb ihm nicht viel anderes übrig, als die
Fed in diese Richtung zu lenken. Schließlich blockierten
sich der Kongress mit der Mehrheit der Republikaner und
der demokratische Präsident gegenseitig. Präsident
Obama, damals frisch gewählt, schaffte es nicht, nach
seinem ersten 800-Milliarden-Dollar-Paket, das viele
Ökonomen als zu eingeschränkt ansahen, noch einmal
nachzulegen. Die Fed wurde so zum einzigen
handlungsfähigen Akteur in Washington.
Europa steckt ebenfalls im politischen Reformstau. Die
andauernde Krise treibt die Mitgliedsstaaten auseinander,
alte und neue Gräben brechen auf. Die EZB ist dadurch zur
verbleibenden einenden Institution geworden. Mit dem
Euro, der Gemeinschaftswährung, verteidigt Mario Draghi
letztlich die Einheit, genau wie schon sein Vorgänger Jean
Claude Trichet. Draghis QE-Programm sorgt für einen
schwachen Euro und ist letztlich nichts anderes als
Exportpolitik.
So haben die Notenbanker Aufgaben übernommen, die
Politiker bei der Krisenbewältigung nicht übernehmen
können oder wollen. Und die Helfer an ihrer Seite sind
BlackRock, Pimco & Co., die mit der konkreten Umsetzung
der Maßnahmen wie Stresstests und
Anleiheaufkaufprogramme beauftragt werden. Für
BlackRock etwa zählen Zentralbanken zu den wichtigsten
Kunden. 50 Zentralbanken haben BlackRock bereits
engagiert, um unter anderem deren Reserven zu managen.
Das Engagement in dem Bereich sei einer der Gründe,
warum er einen Job bei Fink angenommen habe, erklärte
Hildebrand der Webseite centralbanking.com.
Notenbanken sind sehr interessante Kunden für
Finanzkonzerne. Dabei geht es um Prestige, um Honorare
und Aufträge. Aber Notenbanken haben auch wertvolle
Information. Besonders für Marktteilnehmer. Denn
niemand kann Märkte lenken wie sie. Ja, da sind die viel
beschworenen »Chinese Walls«, jene organisatorischen
Vorkehrungen, mit denen die Firmen verhindern sollen,
dass ihre Mitarbeiter erfahren, was sie nicht erfahren
sollen. Doch wer die »Chinese Walls« an der Wall Street
erwähnt, erntet meist ein Grinsen und ein Achselzucken.
»Geht Joe mit Harry nach der Arbeit ein Bier trinken?
Darauf kannst du wetten«, sagen Insider. Und selbst, wenn
man wollte, wie soll man Informationen, die man hat, aus
seinem Kopf bekommen? »You can’t unknow something«,
ist eine beliebte Bemerkung zu dem Thema. Man kann sich
schlecht vom Wissenden zum Unwissenden machen.
Vor dem Geflecht aus Notenbankern und ihren bezahlten
Helfern hat offenbar auch die Politik kapituliert. Befragt, ob
er nicht besorgt sei wegen der potenziellen
Interessenkonflikte, den beispielsweise der EZB-Auftrag an
BlackRock mit sich bringen könnte, erklärt ein EuropaAbgeordneter, der für seine kritische Haltung gegenüber
der Finanzbranche bekannt ist: »Für solche Aufgaben gibt
es eben nur ein paar Experten und deshalb wird es immer
Interessenkonflikte geben.« Schön sei das nicht, aber
Realität. Ein europäischer Banker, der lange in Brüssel
gearbeitet hat, kann eine gewisse Bewunderung für die
Wall-Street-Jungs nicht verbergen: »Die haben letztlich
diese ganzen komplexen Produkte und Systeme geschaffen,
für deren Management und Analyse sie jetzt unabdingbar
sind.«
Kapitel 5
Schattenbanken: Die im Dunkeln
sieht man nicht
Es könnte der Empfangsraum eines Hotels sein, wenn auch
eine Unterkunft für Geschäftsreisende mit einem
akzeptablen Spesenkonto. An den fensterlosen, etwas
düsteren Wänden findet sich moderne Kunst, nicht zu
aufregend, nicht zu bieder. Helle Sitzgruppen,
Beistelltische, auf denen die üblichen Bildbände und
Zeitungen ausliegen. Niemand traut sich jedoch, dort in die
Polster zu sinken und gemütlich zu blättern. Nicht einmal
die Besucher, die hier darauf warten, von ihren BlackRockGastgebern abgeholt zu werden. Die Sofakissen sind bunt
bestickt, wer genau hinschaut, entdeckt in den Mustern
eine Weltkarte. Vielleicht ein Einfluss von Larry Finks
Vorliebe für volkstümliche Kunst.
Das ist das Headquarter in New York, von hier aus gehen
alle Fäden um den Globus, nach Frankfurt, Zürich, London,
Shanghai, Tokyo und Hongkong. Die Büroräume hinter den
Glastüren der Lobby sind funktional, beige Textiltapete an
den Wänden, die meisten Möbel sehen aus, als könnte man
sie beim Discounter »Office Depot« bestellen. Die üblichen
»Cubicles«, der Quadratmeter, der modernen
Büroarbeitern um ihren Schreibtisch zugestanden wird. Ein
fensterloser Videokonferenzraum wird durch ein
mannshohes Triptychon aus Bildschirmen dominiert, außer
einer Uhr (analog!) an der Wand gibt es keine Dekoration.
Nicht einmal ein Kugelschreiber liegt herum. »Wir sind
professionell, wir sind effizient, wir sind konzentriert«, sagt
die Einrichtung. Weit, weit weg ist man hier von dem
Interieur etwa von Goldman Sachs’ Zwei-Milliarden-DollarDowntown-Turm, dessen Sky-Lobby die Größe eines
Konzertsaals hat, mit einer Glasfront, die einen
Panoramablick auf den Hudson freigibt und der selbst
abgebrühte New Yorker beeindruckt.
Dabei ist Goldman das nicht so heimliche Vorbild. Der
Ruf, arrogant und brillant zu sein, eilt den Goldmännern
voraus. Und die BlackRock-Vertreter bemühen sich, eine
ähnliche Aura der Unnahbarkeit und Unfehlbarkeit zu
verbreiten. BlackRock »möchte allzu gerne Goldman sein«,
stichelt ein ehemaliger Mitarbeiter in einem Online-Forum
über seinen Ex-Arbeitgeber.
Vor der Finanzkrise war »Goldman Envy«, der neidische
Blick auf die Goldman-Sachs-Banker, ein feststehender
Begriff und ein verbreitetes Leiden an der Wall Street und
in der Londoner City. Nicht allein wegen der Bezahlung –
wobei die alles andere als vernachlässigbar war: 20
Milliarden schüttete Goldman 2007 auf dem absoluten
Höhepunkt an seine Mitarbeiter aus. »Goldman hatte den
It-Faktor, den intellektuellen Reiz«, schwärmte FinancialTimes-Kolumnistin Gillian Tett. Wer würde nicht gerne zu
einer Truppe anerkannter Finanzgenies gehören, die
einerseits Derivatekonstruktionen entwarf, die einen
Kybernetiker schwindelig machen konnten, und
andererseits Hinterzimmer-Deals einfädelten, die
byzantinische Diplomaten beeindrucken würden?
Absolventen der US-Eliteuniversitäten drängten sich um
eine Chance, bei Goldman einzusteigen. Und Ministeriale
und Amtschefs kamen gerne nach ihrer Karriere in den
Hauptstädten der Welt zu »Government Sachs«, wie die
Bank im Wall-Street-Spott genannt wurde. Ein klassisches
Beispiel für die Drehtür zwischen Goldman und Washington
ist Robert Zoellick, einst stellvertretender Außenminister
unter George W. Bush, der dann einige Jahre Managing
Director bei Goldman war und schließlich Chef der
Weltbank wurde. Prominentester Drehtürnutzer aus Europa
ist sicherlich Mario Draghi, einst bei der Weltbank und dem
italienischen Finanzministerium, dann bei Goldman Sachs
und zuletzt Chef der EZB.
Zwar überstand Goldman die Finanzkrise wirtschaftlich
besser als die meisten Konkurrenten, doch der Ruf der
Unantastbarkeit ist weg. Da war Lloyd Blankfeins
Bemerkung in einem Interview, seine Bank tue »Gottes
Werk«. Ein Scherz, wie der Goldman-Vorstandschef
vergeblich versicherte. Da war der Abacus-Deal. Ein
Konstrukt aus wackeligen Hypothekenpapieren, das
Goldman für Hedgefond-Tycoon John Paulson austüftelte
und dessen Genie-Streich es war, dass Paulson dagegen
wetten wollte, also darauf, dass die Hypotheken platzen
würden. Nicht ganz so fein war es dann, so später der
Vorwurf der US-Börsenaufsicht SEC, die Anteile an Abacus
an andere Goldman-Kunden zu verkaufen und ihnen die
Paulson-Wette zu verschweigen. Paulson gewann laut SEC
1 Milliarde Dollar mit seiner Wette, aber Kunden auf der
anderen Seite von Abacus, wie etwa die deutsche IKB,
verloren 150 Millionen Dollar. Die SEC verhängte eine
Zahlung von 550 Millionen Dollar, um die Vorwürfe
beizulegen, nach Angaben der Börsenaufsicht eine
Rekordsumme für ein einzelnes Wall-Street-Haus. Wenig
förderlich war, dass Ermittlern die E-Mail eines mit Abacus
betrauten Goldman-Bankers, Fabrice Tourre, in die Hände
fiel. Darin bekannte Tourre über den Hypothekenmarkt:
»Das ganze Gebäude steht kurz davor, in sich
zusammenzufallen. Nur der Fabulöse Fab wird überleben.«
Mit dem »Fabulösen Fab« meinte er, ganz bescheiden, sich
selbst. Selbst aus den eigenen Reihen kam vernichtende
Kritik. Greg Smith, ein langjähriger Goldman-Manager in
London, reichte gleichzeitig mit seiner Kündigung bei der
Bank im Frühjahr 2012 einen offenen Brief an die New York
Times ein, in der er die Kultur bei Goldman als »toxisch
und zerstörerisch« beklagte. Kunden würden dort gerne als
»Muppets« verunglimpft, im britischen Slang ein anderes
Wort für »Idioten«. Smiths Bekenntnisse lösten eine Welle
der Empörung aus – sowie Hohn und Spott. Die Satireseite
»Funny or Die« etwa zeigte in einem hunderttausendfach
abgerufenen Video-Sketch, wie fiktive Goldman-Manager in
einer Vorstandssitzung von Koks-Exzessen und SexEskapaden mit asiatischen Praktikantinnen schwärmen und
über Kunden lästern – bis auf einmal »echte« Muppets aus
der Muppet Show hereinplatzen und die Manager wegen
»Verleumdung« angehen. Die fiktiven Goldmänner zeigen
sich unbeeindruckt. O-Ton aus dem Video: »Aus so einem
Teil wie dir lass ich mir sonst Anzüge machen«, sagt einer
der Nadelgestreiften.
Plötzlich galten die Goldmänner nicht mehr als coole
Könner, sondern als hinterlistige Abzocker.
Während sich Goldman Sachs nach der Finanzkrise im
harschen Licht unwillkommener Öffentlichkeit wiederfand,
begann der heimliche Aufstieg von BlackRock. »BlackRockNeid löst Goldman-Glanz ab«, diagnostizierte FinancialTimes-Kolumnistin Tett. Tett hat einen wissenschaftlichen
Blick auf die Entwicklung, sie ist gelernte Anthropologin,
die statt Amazonas-Indianern seit Jahren die Wall-StreetStämme beobachtet. In den Online-Foren, in denen sich
Uni-Absolventen über begehrte Einstiegsmöglichkeiten
austauschen, taucht neben Goldman nun BlackRock auf –
ein Name, den es vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten
noch nicht einmal gab. Mehr und mehr wird BlackRock
auch zur Adresse, die man nach einer politischen Laufbahn
ansteuern kann. Tom Donilon, Obamas Sicherheitsberater,
kam 2014 an Bord. Donilon beriet den Präsidenten
während des Kommandos, das Osama bin Laden tötete, und
trat nach dem Überfall auf die amerikanische Botschaft in
Benghazi zurück, bei dem der US-Botschafter ums Leben
kam. Zu den bestvernetzten Anwerbungen gehört Peter
Fisher, der in den frühen Bush-Jahren Staatssekretär im
Finanzministerium gewesen war, dann bei BlackRock
einstieg und zudem beratendes Mitglied der britischen
Finanzaufsicht war. Angeblich versuchte Fink auch Obamas
Finanzminister Geithner nach dessen Zeit als
Finanzminister zu BlackRock zu holen. Geithner entschied
sich dann aber für die »Heuschrecke« Warburg Pincus.
Vielleicht erteilte Geithner seinem Freund Fink eine
Absage, um den Eindruck zu vermeiden, der BlackRock-Job
sei der Dank für die lukrativen öffentlichen Aufträge, die
Fink während Geithners Amtszeit bekommen hat.
Und doch sind die BlackRocker Außenseiter in Manhattans
Finanzszene geblieben. Sie sind keine Banker. Keine
Hedgies. Sie sind Buy-Side – Mittelsmänner der großen und
kleinen Anleger. Aber mit den bräsig-biederen
Fondsgesellschaften wie Fidelity oder American Funds, der
traditionellen Buy-Side, verbindet sie auch nicht viel. So
bleiben sie für sich. Und sie fallen selten auf.
Auf der gefürchteten Dealbreaker-Seite, einem
Onlineklatschblatt, das genüsslich die pikantesten
Nachrichten aus Wall Streets Betten und Büros ausbreitet,
tauchen die BlackRocker so gut wie nie auf. Der bisher
spektakulärste BlackRock-Skandal, der auf Dealbreaker
lief, hatte nichts mit Sex & Drugs oder Insidertrading – den
üblichen Themen – zu tun. Es ging um Schwarzfahren.
Immerhin in großem Stil und mit System. Jonathan Paul
Burrows arbeitete als Investmentmanager in BlackRocks
Londoner Büro. Doch wie viele seiner Kollegen in der City
zog er es vor, in einem der grünen Vororte zu residieren. Er
kaufte gleich mehrere Anwesen für 4 Millionen Pfund in
East Sussex. Doch da war das Problem des Pendelns. Eine
einfache Fahrt von seiner Bahnstation in Stonegate in die
City kostet 21,50 Pfund. Zu teuer, entschied der
Anlagespezialist. Als findiger Kerl entdeckte er ein
Schlupfloch: In Stonegate gab es keine Bezahlschranke, so
konnte Burrows bis nach Cannon Station in London fahren.
Erst beim Verlassen der U-Bahn an seinem Zielort musste
er seine elektronische Bahnkarte durchziehen – doch da
wurden ihm nur die letzten Stationen innerhalb Londons
berechnet, ein Betrag von 7,20 Pfund. Diese persönliche
Fahrpreisermäßigung praktizierte Burrows offenbar über
fünf Jahre – bis ihn im Sommer 2014 ein Bahnbeamter
beobachtete und auf die Schliche kam. Insgesamt, so
kalkulierten die Verkehrsbetriebe, hatte sie der BlackRockMann um 67 000 Dollar betrogen. Burrows versuchte die
Sache durch einen Vergleich mit der Bahn still und
heimlich zu bereinigen. Doch die Transportgewerkschafter
deckten die Absprache auf und machten Burrows Namen
und Arbeitgeber publik. Es gab viel Wut unter anderen
Pendlern, aber sein Trick und die Tatsache, dass er so
lange unentdeckt blieb, trugen ihm auch Anerkennung ein.
Die Daily Mail ernannte ihn in einer Schlagzeile gar zu
»der Welt größtem Schwarzfahrer«. Die britische
Finanzaufsicht teilte die Bewunderung allerdings nicht und
verbannte ihn auf Lebenszeit aus den Chefetagen der
Finanzindustrie. Burrows trat von seinem Posten bei
BlackRock zurück. Bemerkenswert war seine Reaktion auf
die Verbannung: Er bedaure, dass er die Zeit der
Finanzaufsicht beansprucht habe, die doch sicherlich
schwerwiegendere Vergehen zu verfolgen habe als seinen
Fall. Nicht ganz der reuige Sünder, so scheint es. Im New
Yorker Headquarter dürfte Burrows Schwarzfahrerei für
einige undruckbare Flüche gesorgt haben. Das ist nicht
ganz die Art von Findigkeit, für die BlackRock bekannt sein
will.
Böser war allerdings die Sache mit Rice. Daniel Rice III,
dessen Familie im Energiebereich unternehmerisch aktiv
war. Da traf es sich gut, dass Rice Co-Fondsmanager
verschiedener BlackRock-Fonds war, die ebenfalls in dem
Sektor investierten. 2007 war Rice Mitgründer eines
Unternehmens namens Rice Energy. Eine Tochterfirma von
Rice Energy ging später ein Joint Venture mit einem Kohleund Gasunternehmen namens Alpha Natural Resources ein.
Rice wurde geschäftsführender Partner, die Posten des
Vorstandsvorsitzes sowie des Finanzchefs und des ChefGeologen übernahmen seine drei Söhne. 2011 war Alpha
die größte Aktienposition im BlackRock Energy &
Resources Fonds, den Rice managte. Rice Arbeitgeber
BlackRock hatte die Nebentätigkeit genehmigt. Leider
wurden die Investoren des Fonds nicht informiert. Eine
Tatsache, die viele von ihnen offenbar erst aus dem Wall
Street Journal erfuhren. »Ein Fondsmanager zieht
Selbstgekochtes vor«, titelte das Blatt. Die Börsenaufsicht
SEC fand die Angelegenheit nicht so witzig. Rice trat
zurück. Und im April 2015 legte BlackRock die Sache
durch einen Vergleich und die Zahlung von 12 Millionen
Dollar bei. »Als Treuhänder unserer Kunden nehmen wir
selbst den Anschein eines Interessenkonflikts extrem
ernst«, versicherte ein BlackRock-Sprecher dem Wall
Street Journal. BlackRock erklärte, der Vergleich sei kein
Schuldeingeständnis.
An Handelstagen findet jeden Morgen um acht Uhr eine
interne Lagebesprechung in BlackRocks Hauptquartier
statt. Offiziell nennt sich das »Global Daily Meeting« und es
soll laut BlackRocks Webseite unter anderem dazu dienen,
die Kollegen »über neue Denkansätze« zu informieren.
Mitarbeiter von den Außenbüros rund um den Globus sind
per Bildschirm zugeschaltet. Die Teilnehmer identifizieren
sich mit ihrer Zuständigkeit: »US-Zins« oder
»Verbriefungen« steht statt ihres Namens auf den
Schildern. So jedenfalls beschreibt Fortune das Ritual, das
eine Führungskraft als »Pflichtveranstaltung« bezeichnet.
Als Vergleich bringt er den »Kirchgang, als wir Kinder
waren«. Einem ehemaligen Mitarbeiter waren solcherlei
Gepflogenheiten suspekt. Er sei sich vorgekommen wie bei
einem »Kult«, sagt er. Ihm sei das »Getue« und der interne
»Hype«, wie er es ausdrückt, schließlich so auf die Nerven
gegangen, dass er kündigte. Er will seinen Namen
keinesfalls gedruckt sehen. Andere Ehemalige wollen noch
nicht einmal anonym etwas sagen, auch nichts Positives.
Auch Fink ist nicht unumstritten. Launisch sei der Chef –
mal gebe er sich volkstümlich und lade zum StarbucksKaffee ein, mal sei er herrisch und barsch. Es sei
vorgekommen, erzählt eine Ex-Führungskraft, dass
Kollegen nach einem Treffen mit Larry anriefen und halb
im Ernst, halb im Spaß fragten: »Na, lebst du noch?« Auf
Glassdoor, einer Webseite, auf der Mitarbeiter ihre
Arbeitgeber oder Ex-Arbeitgeber anonym bewerten
können, klagen einige über zu viel »Hierarchie« und über
ein »Old Boys Network«, es fällt gar der Vorwurf des
»Nepotismus« – allerdings ist der überwiegende Teil der
Bewertungen positiv. Bei einer Umfrage von PayScale,
einer Online-Karriereberatung zu den besten Arbeitgebern,
landete BlackRock 2013 als einziges Finanzunternehmen
auf einem der vorderen Plätze.
Vor allem Europäer scheinen jedoch Schwierigkeiten mit
der BlackRock-Kultur zu haben. Nicht-Angelsachsen
würden nicht ernst genommen, klagt einer. New York habe
stets das letzte Wort.
Ein Ex-Notenbanker, ebenfalls aus dem europäischen
Raum, fällt ein noch harscheres Urteil. Arrogant seien ihm
die BlackRock-Leute begegnet, »schlimmer als Goldman«
sogar. Und er hat eine ominöse Erklärung, warum
BlackRock zum neuen Liebling des Wall-StreetNachwuchses geworden sei: Bei Goldman und Co. sorge die
schärfere Regulierung für Banken dafür, dass die
Freiräume und Handlungsspielräume schwinden. »Was
man bei Goldman nicht mehr machen darf, das kann man
jetzt bei BlackRock machen.« Auf gewisse Weise sei
BlackRock der »dunkle Zwilling von Goldman«. Fest steht:
Fink hat es geschickt geschafft, seine einstige Bond-Bude
im Hinterzimmer innerhalb weniger Jahre zum Global
Player zu machen, der im Hintergrund die Fäden zieht. Und
das ist kein Zufall.
Der Ketzer: Hilfe, wir haben die Banken
geschrumpft!
Treffpunkt ist die Lobby des Waldorf Astoria. Der Art-décoBau an der Park Avenue ist das Stammhotel der
amerikanischen Präsidenten seit Herbert Hoover und
Heimat des gleichnamigen Salats. Der 83 Jahre alte Kasten
(davor befand sich das Hotel an der Stelle des heutigen
Empire State Building) ist eine New Yorker Ikone, hier
wohnte Marilyn Monroe, hier zog Henry Kissinger seine
diplomatischen Drähte. Ein wenig wirkt das Waldorf wie
eine jener in die Jahre gekommenen New Yorker SocietyLadies, deren funkelnde Brillanten und üppiges Rouge die
grauen Haare und knitterigen Wangen nicht verbergen
können, die aber dennoch die unangefochtenen
Herrscherinnen der Gala-Empfänge und Bälle geblieben
sind. Heute glimmen im Waldorf die Lüster schummrig, die
Spiegel sind leicht angelaufen. Im Internet meckern
Touristen aus der Provinz über klemmende
Badezimmertüren, räudige Teppiche und schäbige Tapeten.
(2014 ist das Hotel für 1,95 Milliarden Dollar an den
chinesischen Versicherungskonzern Angban verkauft
worden, der eine Rundum-Sanierung plant, die das Hotel
wahrscheinlich aussehen lässt wie seine eigene DisneyKopie.) Noch ist das Waldorf die passende Kulisse für
Richard X. Bove. Sein dunkler Anzug sitzt perfekt, die
Krawatte ist akkurat geknotet, goldene Manschettenknöpfe
glänzen matt. Der weiße Bart ist sorgfältig gestutzt, die
blauen Augen blitzen. »Halb Badass, halb Santa Claus«,
beschrieb ihn die Wirtschaftspostille Businessweek einmal.
Wenn er in seine Weste greift, ist man enttäuscht, dass er
nicht eine schwere Taschenuhr herausholt, sondern sein
Samsung-Handy. Wer Bove so sieht, würde nie darauf
kommen. Aber der Vater von sieben Kindern, Großvater von
vierzehn Enkeln und Besitzer von zwei Pizzerien ist ein
Ketzer.
Um unser Finanzsystem sicherer zu machen, müssen
Banken schärfer reguliert werden. Je mehr Kapital sie
halten, desto stabiler sind die Kreditinstitute. Großbanken
sollten am besten zerschlagen werden: Wann immer
Richard X. Bove diese Argumente hört, überkommt ihn die
Wut. Bove ist ein strammer Verteidiger der großen Banken.
Der Finanzgiganten wie JPMorgan Chase und Bank of
America. Er nennt sie »Wächter unseres Wohlstands«. Das
war auch der Titel seines Buchs, das man weniger als
Sachbuch, denn als Plädoyer eines Pro-Bono-Verteidigers
im Gerichtssaal der öffentlichen Meinung sehen muss. Den
Versuch, die Finanzkolosse durch Regulierung zu
beschränken, ja, wenn möglich, sogar zu zerschlagen,
nennt Bove eine »Riesendummheit«.
Banken sind für Bove seit über 40 Jahren das tägliche
Brot. Er ist Bankenanalyst. Das heißt, er bewertet die
Aktien von Finanzinstituten. Sein Urteil hilft Anlegern zu
entscheiden, ob sie Aktien einer Bank kaufen sollen oder
nicht (oder ob sie sie behalten sollen oder lieber
verkaufen). Banken und Investmentfirmen beschäftigen
Analysten, weil ihre Kunden – große Investoren – deren
Studien und Empfehlungen gerne als Dienstleistungen in
Anspruch nehmen. Während der Internetblase kamen
Analysten, die bei großen Banken arbeiteten, schwer in
Verruf. Wenn ihre Kollegen im Investmentbanking etwa ein
Start-up-Unternehmen an die Börse brachten, dann half
eine warme Empfehlung der Analysten aus dem eigenen
Haus beim Debüt – wenigstens aber sollten die Analysten
nicht vom Kauf abraten. Unrühmlichstes Beispiel für die
Doppelzüngigkeit wurde Henry Blodget, der als StarAnalyst bei Merril Lynch nach außen Internetunternehmen
anpries, die er in internen E-Mails an Mitarbeiter gerne
mal als Stück Sch… bezeichnete. Davon bekam der
damalige General Staatsanwalt Eliot Spitzer Wind. Spitzer
(der später als Gouverneur wegen seiner Besuche bei
Prostituierten zurücktreten musste) hatte sich
vorgenommen, an der Wall Street aufzuräumen und seine
ersten Ziele waren die Analysten. Die Banken mussten
gemeinsam 1,5 Milliarden Dollar Strafe zahlen – damals
noch ein Rekord! – und versprechen, die
Interessenkonflikte auszuräumen. Blodget wurde auf
Lebenszeit aus dem Aktiengeschäft verbannt. (Er ist
inzwischen Journalist.)
Bove gehörte nie zu den Analysten der großen Institute.
Obwohl gebürtiger New Yorker zog er mit seiner Familie
nach Tampa, Florida. Seine Arbeitgeber waren stets das,
was man an der Wall Street Boutiquen nennt: Kleinere
unabhängige Firmen, die spezialisierte Dienstleistungen für
Kunden wie Investmentfonds oder Hedgefonds anbieten.
Bove machte sich einen Namen als Analyst, weil er
»schonungslos offen«, wie das Wall Street Journal etwas
zwiespältig bemerkte, seine Meinungen verkündet. Als
Wachovia, die zweitgrößte Sparkasse im Land, im Jahr
2006 die kalifornische Golden West für 24 Milliarden Dollar
übernahm, priesen viele Analysten den Deal als strategisch
cleveren Schachzug. Boves Urteil: Wachovia habe sich
damit schlicht »Atommüll« ins Haus geholt. Denn Golden
West hatte sich auf Hypotheken mit Zinssprung
spezialisiert, die später besonders häufig ausfielen.
Wachovia kollabierte zwei Jahre später unter den Verlusten
aus den Hypotheken und wurde von der Aufsicht an Wells
Fargo zwangsverkauft.
Auch mit sich selbst geht Bove hart ins Gericht. Im
August 2005 warnte er, die Banken hätten mit ihren
Vergabekriterien eine Hypothekenblase erzeugt. »Dieses
Pulverfass wird explodieren«, war der Titel der Studie. »Als
ich das schrieb, haben mich die Leute für verrückt erklärt«,
sagt Bove. »Wenn ich dabei geblieben wäre, hätte man
mich zum Helden ernannt.« Doch im Frühjahr 2008 hatte
er den Eindruck, das Schlimmste sei vorbei – und empfahl
Bankaktien zum Kauf. Im Herbst brach Lehman zusammen.
Seine Kaufempfehlung sei ein »Horror« gewesen, sagt
Bove heute, der seinen kapitalen Fehler nicht schönreden
mag. Seine gnadenlosen Formulierungen mögen mit ein
Grund sein, warum Bove nie für eine Großbank gearbeitet
hat. Bank Atlantic, eine Regionalbank, die er 2008
öffentlich als Wackelkandidaten ausmachte, verklagte ihn
wegen Geschäftsschädigung. Das Verfahren zog sich über
Jahre und kostete Bove seinen Job sowie 800 000 Dollar an
Rechtskosten. Schließlich einigte er sich auf einen
Vergleich – wobei Bove keinen Cent an die Bank zahlen
musste. Die Börsenaufsicht SEC gewann später eine Klage
gegen Bank Atlantic, weil das Institut seine Investoren
hinsichtlich der Kreditqualität getäuscht habe.
Der Streit mit Bank Atlantic hat Bove aber keineswegs
entmutigt.
Genauso schonungslos wie er über Vorgänge bei den
Banken urteilt, so kompromisslos ist er inzwischen bei
deren Verteidigung. »Wir versuchen uns vom Finanzsystem
scheiden zu lassen – das wird in einem Desaster enden«,
warnt er düster. Seiner Ansicht nach waren die Banken
nicht einmal schuld an der Krise. Stattdessen sieht Bove
das weltweite Handelsungleichgewicht der USA als
eigentliche Ursache. Die USA importieren mehr als sie
exportieren und das vor allem im Verhältnis mit China. Da
die amerikanischen Abnehmer ihre internationalen
Lieferanten in Dollar zahlen, gab es Dollar im Überfluss.
Ȇberall schwappten Unmengen an Dollar herum und
suchten ein Zuhause«, erklärt es Bove über die Jahre vor
der Krise. Sie fanden es schließlich in exotischen
Finanzvehikeln im Immobiliensektor in den USA. In jenen
CDOs, CMOs und CDS, zu deren Pionieren einst Larry Fink
gehört hatte. Klar hätten die Banken den Prozess befördert
und beschleunigt. »Für fragwürdige oder illegale Praktiken
sollte man die Banken belangen und Verantwortliche
sollten auch ins Gefängnis gehen«, sagt Bove. Die Banken
als alleinige Schuldige auszumachen, sei aber verkehrt.
Und dieser falsche Schluss, den vor allem Politiker in den
USA und Europa populär machten, habe nun zu völlig
falschen Reformen geführt. Ganz oben auf seiner Liste
stehen die höheren Pflichtreserven, die vor allem in den
USA und zögerlicher auch in Europa eingeführt wurden.
Aber auch die Volcker-Regel mit ihren strengen Limits für
den Eigenhandel der Banken findet keine Gnade bei Bove.
Beide Maßnahmen sollen die Banken stabiler und das
Finanzsystem damit sicherer machen. Doch das Gegenteil
sei der Fall.
Als Boves Buch über die Banken als Wächter des
Wohlstands Ende 2013 herauskam, musste er eine Menge
einstecken. »Panikmache«, sei das Buch, schrieb New-YorkTimes-Edelfeder Roger Lowenstein. Das war noch eine
positive Bewertung. Weniger vornehm schrieb der
Teilnehmer eines Finanzforums im Internet, Boves
Argumente seien »B. S.«, die Abkürzung für Bullshit, was
familienfreundlich, wenn auch nicht ganz zutreffend, mit
Schwachsinn übersetzt wird. Doch so polemisch Boves
Aussagen oft sind – es fällt schwer, schärfere Regeln gegen
exzessive Strafgebühren für Bankkunden als Fehler der
Regulierer zu bewerten – in seinen Hauptpunkten behält
der Wall-Street-Veteran recht. Die Bedeutung der Banken
wird kleiner. Die Gewichte an den globalen Kapitalmärkten
verschieben sich langsam, aber sicher. Und die
Schrumpfkur, von den Bankenkritikern begrüßt, zeigt
beunruhigende Nebenwirkungen.
Für Bove schaffen die neuen Regeln ein fundamental
verändertes Finanzsystem – eines, das neue unbekannte
Bedrohungen birgt. Transaktionen und Aktivitäten wandern
ab – in das Reich der Schattenbanken. »Unsere hysterische
Verfolgung der Banken bewirkt, dass unser Finanzsystem
zunehmend die Banken, den sichtbaren und regulierten
Teil, verlässt und in den unsichtbaren unkontrollierten Teil
verschwindet«, sagt Bove. Und aus diesem Dunkel, da ist
Bove sicher, wird unsere nächste Krise kommen.
Was wirklich geschah
Schattenbanken sind nicht neu. Je nach Definition gibt es
Schattenbanken, seit es die regulierten Banken gibt. Wie
beim Krieg der Sterne gibt es die Macht und es gibt die
dunkle Seite der Macht. Der Begriff selbst entstand
allerdings erst während der Finanzkrise. Geprägt wurde er
von Paul McCulley, Ökonom und Veteran bei BlackRocks
Erzrivalen Pimco. Beim jährlichen Sommertreffen von
Zentralbankern und auserwählten Star-Volkswirten im
luxuriösen Bergresort in Jackson Hole, im Rocky-MountainStaat Wyoming (man denke sich ein Davos für
Zentralbanker), wetterte McCulley 2007 gegen die
»Buchstabensuppe von Finanzvehikeln«. Da war es
allerdings schon zu spät, die ersten der Finanzvehikel, von
denen McCulley sprach – CDO, CDS, CMO, SIV und
ähnliche Konstrukte – zeigten da bereits erste Zeichen von
Stress.
Dabei fängt das Problem mit Schattenbanken schon
damit an, dass es viele unterschiedliche Auffassungen gibt,
wer dazugehört. Das Financial Stability Board, jenes
internationale Gremium, das von den G20-Staaten nach der
Katastrophe 2008 kreiert wurde, definiert Schattenbanken
als »Kreditvermittlung, die außerhalb des regulären
Bankensystems stattfindet.« In allen Ländern mit einem
modernen Finanzmarkt dürfen nur Banken Spareinlagen
mit einer staatlichen Einlagensicherung entgegennehmen.
Und nur Banken haben direkten Zugang zur Zentralbank.
Damit spielen Banken eine spezielle Rolle im
Wirtschaftsgefüge und müssen sich deshalb speziellen
Regeln unterwerfen – wie etwa Eigenkapitalregeln, die
vorschreiben, wie viel Kapital die Bank zur Sicherheit
zurückbehalten muss. Doch das heißt keinesfalls, dass
Banken die einzigen Quellen für Kapital wären. Ein
Unternehmen kann zum Beispiel Anleihen herausgeben
und die Papiere an Anleger verkaufen – quasi ein Kredit,
den sich viele Gläubiger, die Anleiheinhaber, teilen.
Hedgefonds können Kredite vergeben. Pfandleihhäuser und
Kredithaie gehören auch dazu. Während das Financial
Stability Board den Begriff Schattenbanken sehr eng fasst,
tendieren die Banker selbst zu einer breiteren Definition
des Begriffs: Alles, was eine Bank macht – also auch
Wertpapierhandel –, aber von einer Nicht-Bank
übernommen wird.
Nicht nur die Banken wuchsen vor der Finanzkrise zu
Giganten heran. Auch die Schattenbanken schwollen auf
nie dagewesene Dimensionen an. 2007 erreichte der Sektor
in den USA allein 24,9 Billionen Dollar – das entspricht dem
Bruttoinlandsprodukt Amerikas und Chinas zusammen. Die
Krise 2008 verschonte auch die Schattenbanken nicht,
doch bereits 2013 lag der US-Anteil bei 25,2 Billionen und
damit 5 Billionen über dem traditionellen Bankensektor
dort. Weltweit erreichte die dunkle Seite der Finanzen laut
dem Jahresbericht 2014 des Financial Stability Board rund
75 Billionen Dollar. Das entspricht 120 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts, das in den von der FSB-Statistik
erfassten Ländern und Regionen erwirtschaftet wird. Die
Banken dagegen büßten ein – ihr Anteil am Finanzsystem
fiel von 49 Prozent 2008 auf nur noch 45 Prozent. Ein
Trend, der sich in den kommenden Jahren verschärfen
wird.
Banken gelten als die Hauptverantwortlichen der
Finanzkrise 2008. Und an deren fragwürdigem bis hin zu
kriminellem Verhalten gibt es nichts zu beschönigen. Doch
es waren die Schattenbanken, die die Lehman-Krise zum
Zündfunken für den weltweiten Flächenbrand machten und
die letztlich die Rezession auslösten. Damals spielten
Geldmarktfonds, die zu den Schattenbanken zählen, eine
oft übersehene Hauptrolle.
Es war Mittwoch, der 17. September 2008, und die Welt
stand am Abgrund. Zwei Tage zuvor, um 1:45 Uhr früh am
15. September, hatte die Investmentbank Lehman Brothers
nach 158 Jahren den Gang zum Konkursgericht im alten
Zollgebäude an der Südspitze Manhattans antreten
müssen. Bilder der Lehman-Mitarbeiter, ihre Topfpflanzen
und Familienfotos hastig in Pappkartons verfrachtet,
gingen um die Welt. Bis heute gelten jene zwei Tage im
September 2008 als der Höhepunkt der Finanzkrise. Nur
Insider wissen es besser.
Tatsächlich war jener Mittwoch der Katastrophentag. Da
lief plötzlich eine Meldung über die Nachrichtenticker der
Börsen: Die Anteile des Reserve Fund, einer der ältesten
und mit 64 Milliarden Dollar einer der größten
Geldmarktfonds, waren unter 1 Dollar gesackt, »breaking
the buck«, wie es an der Wall Street heißt. Das war mehr
als ungewöhnlich, es war eigentlich gar nicht möglich.
Denn die Geldmarktfonds garantierten ihren Anlegern
einen Mindestpreis von 1 Dollar. Ihre Anteilsscheine seien
so hart und so gut wie Bargeld, so das Versprechen. Was
war passiert? Der Einbruch war eine direkte Folge des
Lehman-Konkurses. Die Anleger von Reserve flohen aus
dem Fonds, denn sie fürchteten, dass die Reserve-Manager
dort auf Lehman-Schuldscheinen sitzen geblieben waren
und nun, da Lehman Insolvenz angemeldet hatte, massive
Verluste drohten. Von Reserves Kunden – Pensionskassen,
Versicherungen, Kleinanleger – versuchte jeder, sein
Kapital so schnell wie möglich aus dem Fonds abzuziehen.
Es war der gefürchtete »Run for the Exit« im Börsenjargon
– das Rennen, vor allen anderen den Notausgang zu finden,
um noch ohne Verluste sein Geld in Sicherheit zu bringen.
In nur 24 Stunden verlor Reserve zwei Drittel seines
eingelegten Kapitals. Schließlich musste er sogar
abgewickelt werden. Ein Jahrzehnte alter, 64 Milliarden
schwerer Fonds – wie weggeblasen! Panik und Notverkäufe
griffen auf andere Geldmarktfonds über. Fonds und
Banken, sonst in konstantem Austausch von Kapital,
misstrauten sich gegenseitig, nicht einmal gegen
Staatspapiere war mehr Geld aufzutreiben. Der »Run for
the Exit« griff schließlich von der Finanzindustrie auf die
Unternehmen über. Großkonzerne wie General Electric,
Toyota, der Telekomriese Verizon bis hin zum
Motorradhersteller Harley-Davidson sandten Hilferufe an
die Notenbank und Finanzminister Henry Paulson, weil
ihnen das Cash ausging und sie sich die Mittel nicht länger
am Geldmarkt besorgen konnten. Nie war der totale
Stillstand der Kapitalströme, die unsere Wirtschaft
antreiben, so nahe wie an diesem Tag.
Wer verstehen will, wie es dazu kommen konnte, muss
tief ins Innerste der Wall Street vordringen.
Über die Gründe der Krise 2008 ist viel und oft berichtet
worden. Eine von Schulden getriebene Volkswirtschaft,
überhitzte Immobilienpreise in den USA, die Verbriefung
der Hypotheken, die es den Kreditinstituten möglich
machte, sie nahezu risikolos weiterzuverkaufen, simpler
Betrug von Kreditnehmern wie -gebern, die Gier und
Leichtgläubigkeit von Bankern und Investoren, das
Versagen der Aufsicht und der Politik. Alles richtig, doch
ohne einen Mechanismus, der die Wackelhypotheken ins
Herz des Finanzsystems schleusen konnte, wäre es zwar zu
einem Schwächeanfall, aber nicht zu diesem Herzstillstand
gekommen. Dieser Mechanismus heißt Repo (Wall-StreetJargon für Repurchase Agreement: Rückkaufvereinbarung).
Der Repo-Markt hat selbst an der Wall Street den Ruf,
trüb und ein wenig unheimlich zu sein. »Selbst
Bankmanager haben eine gewisse Scheu vor Repo«, sagt
ein Insider, der jahrelang auf dem Repo-Markt tätig war.
Das liegt an der Entstehungsgeschichte. Repo war einst
Teil des »Back Office«, dem Hinterzimmer der Banken.
Dort werden die Geschäfte der Bank umgesetzt und
organisiert. Dazu gehören Buchhaltung, Verwaltung, IT und
auch das Abwickeln bestimmter Wertpapiertransaktionen.
Das Verhältnis der Investmentbanker zu den Back-OfficeAngestellten ist ungefähr wie das von Hollywood-Stars zu
Statisten. Das ursprüngliche Repo-Geschäft war eine Art
Wertpapierleihe und wurde beherrscht von »italienischen
Jungs aus Brooklyn, als das noch ein Arbeiterviertel war«,
wie es ein Veteran der Branche formuliert. Ausgerechnet
das unglamouröse Geschäft dieser Gang ist zum
neuralgischen Punkt des modernen Finanzmarkts
geworden.
Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit hat sich
nämlich eine Revolution im Bankenwesen vollzogen. Beim
klassischen Geschäftsmodell nimmt die Bank das Geld von
Sparern, die dafür mit Zinsen belohnt werden. Einen Teil
des Geldes muss die Bank als Sicherheit zurücklegen, der
Rest wird als Kredit – etwa an Unternehmen oder
Hausbesitzer – ausgezahlt, die dafür wiederum Zinsen
bezahlen. Von der Differenz zwischen den beiden
Zinssätzen lebt die Bank. Das Geschäft gibt es auch heute
noch, es ist die Finanzversion von Brot-und-Butter. Die
Wall-Street-Banker entdeckten eine lukrativere Art, Geld zu
verdienen. Man kann es die Champagner-und-KaviarVariante nennen. Statt selbst an die Unternehmen Geld zu
verleihen, wurden sie Kapitalvermittler. Sie helfen den
Unternehmen, sich über die Ausgabe von Aktien und
Anleihen die nötigen Finanzmittel zu verschaffen. Statt
Zinsen kassierten sie Gebühren.
Auch die andere Seite des klassischen Modells, die
Sparer, wanderten ab. Sie wurden angelockt von
Investmentpools, so genannte Geldmarktfonds, die ihnen
höhere Zinsen und gleichzeitig eine Sicherheit wie bei
Bargeld versprachen. Eine reizvolle Kombi, vor allem für
große Institutionelle wie Pensionsfonds, Versicherer und
die Finanzabteilungen internationaler Konzerne, die ihr
Geld zunehmend dort anlegten.
Für Normalverdiener ist Geld die Summe aus dem Saldo
auf dem Girokonto, dem (hoffentlich) Ersparten, das im
Zweifelsfall ebenfalls auf der Bank liegt, und den Scheinen
und Münzen, die er/sie im Geldbeutel hat. Für
Vermögensverwalter oder auch globale Konzerne ist Geld
etwas anderes. Muss es zwangsläufig sein, denn die Mittel,
über die sie verfügen, können sie rein physisch nicht in
Bündeln von Banknoten parken. Kein Tresor, nicht einmal
alle Schweizer Panzerschränke zusammen, reichten dafür
aus, abgesehen von den logistischen Problemen und dem
Diebstahlsrisiko. Und da diese Summen alle staatlichen
Einlagensicherungsgarantien überschreiten, stellen sie, auf
normale Bankkonten geparkt, nichts anderes dar als ein
ungesichertes (Aus-)Zahlungsversprechen dieser Bank. Mit
dem Risiko, dass die Bank im Zweifel das Geld nicht hat. So
müssen die Profis nach Alternativen suchen, ihr Cash
möglichst sicher unterzubringen. Und der Weg führt
geradewegs zu den Schattenbanken, zu denen unter
anderem die Geldmarktfonds gehören. Geldmarktfonds
sind quasi das Sparbuch institutioneller Anleger.
Die Banken passten sich an. Sie kamen mit den neuen
Rivalen ins Geschäft. Ein Geschäft, von dem alle Beteiligten
profitierten, schien es. So liehen sich die Banken Geld von
den Geldmarktfonds und anderen Investoren. Als
Sicherheit dafür hinterlegten sie Wertpapiere wie
Staatspapiere und Hypotheken, die sie in ihren Portfolios
hatten. Mit dem geliehenen Geld von den Geldmarktfonds
konnten die Banken expandieren. Dieser Austausch
zwischen den Geldmarktfonds, die ihr Geld anlegen, und
den Banken, die es leihen wollen, findet (immer noch) auf
dem Repo-Markt statt. Das einstige Hinterzimmer der Wall
Street wurde so zur Drehscheibe des großen Geldes. Es
schlug die Stunde der Repo-Jungs.
Ein Run on the Bank der neuen Art
Kaum jemand sah die Risiken, die das neue Modell mit sich
brachte. Im Gegenteil, es schien sogar sicherer als das
klassische. Während die Sparer bei diesem der Bank
schlicht vertrauen mussten, dass ihr Geld dort sicher
untergebracht war, hatten sie im Repo-Modell Wertpapiere
als Pfand. Doch diese vorgebliche Sicherheit war ein
Fehlschluss, der der Welt die Große Rezession bescherte.
Zunächst schienen Banken und Geldmarktfonds
allerdings eine nicht zu bremsende Geldmaschine kreiert
zu haben. Das neue System war so erfolgreich, dass es nur
durch einen Mangel an Wertpapieren begrenzt wurde, die
von den Banken als Pfand eingesetzt werden konnten. So
kamen die Banken auf die Idee, das Hypothekengeschäft
anzukurbeln. US-Hypotheken galten als ideal für diesen
Zweck – praktisch so sicher wie US-Staatsanleihen und mit
attraktiveren Zinsen. Das ideale Rohmaterial für
Wertpapiere, so schien es. Die Banken liehen sich Geld
gegen die Hypothekenpapiere und mit den geliehenen
Mitteln finanzierten sie neue Hypotheken, die sie wiederum
bei den Gläubigern hinterlegten, um mehr Geld zu
bekommen und so weiter. Um mehr Hypotheken ausgeben
zu können, senkten die Kreditinstitute die
Vergabekriterien, die Ansprüche an die Bonität der
Schuldner waren bald minimal. Gleichzeitig trieb die
Geldflut die Preise am Immobilienmarkt in unhaltbare
Rekordhöhen.
Weil Zentralbanken und Aufseher sich jedoch auf die
Überwachung der klassischen Bankengeschäfte
konzentrierten, entging ihnen die Gefahr, die sich in dieser
Welt der Schattenbanken aufbaute.
Bis diese im Jahr 2007 explodierte: Die Immobilienblase
platzte und viele Hypotheken gleich mit. Plötzlich erfasste
die Geldmarktfondsbetreiber und andere Repo-Gläubiger
die Angst: Was war mit ihren Repo-Pfändern? Wie sicher
waren ihre Sicherheiten? Was, wenn sich die von den
Banken hinterlegten Hypothekenpapiere als ein Haufen
Schrott herausstellten? Die Repo-Gläubiger forderten mehr
Sicherheiten von den Banken. Das brachte wiederum die
Banken in die Klemme: Sie mussten quasi über Nacht
Mittel auftreiben, um die neuen Sicherheitsforderungen zu
befriedigen. Doch sie hatten keine Reserven dafür – solche
Vorschriften gab es in der Schattenwelt ja nicht. So
verkauften die Banken hektisch Wertpapiere aus ihren
Beständen. Die Preise für diese Wertpapiere fielen
daraufhin. Das löste einen neuen Angstschub bei den RepoGläubigern aus: Denn von dem allgemeinen Preissturz
waren wiederum auch die Wertpapiere betroffen, die sie als
Sicherheiten von den Banken entgegengenommen hatten.
Ihre Pfänder waren plötzlich weniger wert. Die Folge: Sie
forderten noch mehr Pfänder, noch mehr Sicherheiten von
den Banken. Bis der Druck zu groß wurde: Im März 2008
fiel Bear Stearns und sechs Monate später musste Lehman
Brothers Insolvenz anmelden. Das Pfänderspiel der
Hochfinanz war zusammengebrochen.
Notenbank und Aufseher mussten hilflos mitansehen, wie
das sich immer rascher auflösende Schattensystem das
offizielle Finanzsystem zum Erliegen brachte. Für
Finanzhistoriker Gary Gorton ist der Kollaps 2008 die
moderne Variante eines Bank Runs – nur, dass keine
aufgeregten Kunden die Kassierer um ihre Einlagen
bestürmten, sondern der Ansturm der Repo-Gläubiger auf
die Banken hinter den glitzernden Glasfassaden der Wall
Street stattfand. Ein weiterer Unterschied: die enormen
Summen. Das Geschäft hatte inzwischen gigantische
Dimensionen angenommen. Bis zu 10 Billionen Dollar
schwappten laut Schätzungen auf dem Höhepunkt vor der
Krise durch die Repo-Schattenbanken. Nach Gortons
Kalkulation sahen sich die Banken quasi über Nacht
Forderungen von bis zu 2 Billionen Dollar gegenüber.
Die ersten Opfer des Repo-Kollapses waren die
Geldmarktfonds. Sie hatten sich als Alternative zu den
Banken eine lukrative Nische in der neuen schönen
Finanzwelt erobert. Sie ersetzten nicht nur das gute alte
Sparbuch oder die Einlagen, die vor allem Großinvestoren
früher bei ihrer Bank unterhielten. Sie spielten auch
zunehmend die Rolle des Kreditgebers für Unternehmen.
Um ihre Lieferanten und ihre Mitarbeiter zu bezahlen,
schrieben die Finanzmanager der Unternehmen
kurzfristige Schuldscheine und tauschten diese bei den
Geldmarktfonds gegen das benötigte Cash ein. Jahrelang
lief das Geschäft reibungslos. Die Geldmarktfonds bekamen
Zinsen, die Unternehmen das nötige Geld fürs
Tagesgeschäft. Doch dann kam die Lehman-Pleite und löste
den Untergang des Reserve Fund aus. Die Geldmarktfonds
gerieten in die Klemme – ihre Investoren verlangten nun
ihr eingelegtes Kapital zurück. Die Fonds kämpften ums
Überleben. Sie waren nicht mehr in der Lage, Mittel an
Unternehmen zu verleihen. Plötzlich trocknete praktisch
über Nacht eine scheinbar unerschöpfliche und günstige
Geldquelle für die Wirtschaft aus! Es bestand die Gefahr
einer Domino-Kette der Zahlungsunfähigkeit, die ein
Unternehmen nach dem anderen mitreißen würde.
Da zog der damalige Notenbankchef Ben Bernanke die
Notbremse. Um den totalen Zusammenbruch zu
verhindern, sprach er eine umfassende Garantie der
Notenbank für die wankenden Geldmarktriesen aus – das
Finanzmarkt-Äquivalent eines Sicherheitsnetzes. Das
teuerste Fangnetz der Geschichte – potenziell in
Billionenhöhe – aufgespannt von der Öffentlichkeit für die
Hochfinanzakrobaten.
Wenn man dies betrachtet, mutet es fast ironisch an, dass
die Banken nach der Krise durch die Regulierung
zurechtgestutzt wurden, während Schattenbanken nahezu
ungehindert wuchern dürfen.
Mutter aller Schattenbanken
Vor der Finanzkrise gab es zwei Lager: Die
Investmentbanken auf der einen und ihre Kunden – die
großen Investoren wie Pensionskassen, Stiftungen und
Investmentfonds, die Finanzabteilungen internationaler
Konzerne – auf der anderen Seite. Sell-Side and Buy-Side.
Man muss sich die Banken vorstellen wie Supermärkte, nur
dass die Einkäufer dort Großanleger sind. Im Angebot sind
nicht Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, sondern Aktien,
Anleihen oder Derivate. Und wie die Lebensmittelbastler
bei Kellogg’s neben den klassischen Cornflakes, immer
neue Flocken wie Rice Krispies, Honey Pops und Smacks
servieren, entwickeln auch Finanzingenieure immer wieder
neue Produkte. Statt des »voll schokoladigen
Frühstückserlebnisses« preist die Finanzversuchsküche
einen »steuersparenden arbitragierenden Zinsswap« an.
Bis zur Krise 2008 war es normal, dass Großanleger sich
bei den Supermärkten der Banken eindeckten. Die neuen
Regeln machen es schwieriger und teurer für die Banken,
die Regale auf Vorrat zu bestücken. Denn für die meisten
»Produkte«, die sie in ihren Büchern haben, müssen sie
entsprechend Eigenkapital hinterlegen. Von den leereren
Regalen einmal abgesehen, ist das Vertrauen der
Großanleger gegenüber dem, was die Wall-Street-Krämer
ihnen an neuen schillernden Waren anbieten, auf einem
Allzeittief. Kein Wunder also, dass die Investoren nach
Alternativen suchen.
Das war die Jahrhundertchance für BlackRock! Die
passive Abnehmerrolle, in die sich viele
Vermögensverwalter gefügt haben, passte sowieso nie so
recht zu Larry Fink und seinen Mitgründern und deren
Sell-Side-Herkunft. Die Schrumpfkur der Banken schafft
Platz – für die neuen Herren der Wall Street. Und die haben
klare Vorstellungen. Üblicherweise beraten
Investmentbanker Unternehmen, wie sie sich finanzieren
sollen: Wie viel Eigenkapital ist nötig, wie viel
Fremdkapital soll das Unternehmen aufnehmen? Wie lässt
sich eine Expansion oder eine Übernahme finanzieren?
Entsprechend arrangiert die Bank die Herausgabe von
Aktien oder Anleihen, platziert Anteile oder Kredite. Und
diese bieten die Banker dann wiederum ihren
Investorenkunden im Finanzsupermarkt an.
So lange will BlackRock nicht mehr warten. Finks Leute
wollen gleich zu Anfang dabei sein, wenn es um den
Finanzbedarf des Unternehmens geht. Daraus machen sie
keinen Hehl. So erklärte Peter Fisher, zuständig für
festverzinsliche Wertpapiere bei BlackRock, bereits 2011
dem Branchenjournal Institutional Investor: »Wir wollen
Anlagen mit einem von uns gewünschten Risiko-GewinnProfil kaufen und halten, statt nur die zur Verfügung zu
haben, die bereits auf dem Markt sind.«
Nehmen wir das Beispiel von Zayo Group. Das
Unternehmen betreibt Glasfasernetze für kommerzielle
Kunden wie Datenzentren und Telekomgesellschaften. Zayo
ist ein Überlebender der Internetblase der 1990er. Das hat
die Firma aus Colorado vor allem dadurch geschafft, dass
sie ständig Rivalen schluckt. Es waren mehr als 30 über
das letzte Jahrzehnt. Im Sommer 2012 schlug Zayo wieder
einmal zu. Um die 1,5 Milliarden Dollar für die Übernahme
zu finanzieren, wollte Zayo Anleihen ausgeben. Doch das
Umfeld an den Märkten war durch die anhaltenden
Turbulenzen in Europa denkbar schlecht. Investoren
verlangten hohe Zinsen, um das Risiko wettzumachen. Es
schien eine teure Angelegenheit für Zayo zu werden. Doch
dann bekam das Unternehmen ein Angebot: BlackRock
würde einen großen Teil der Anleihen zeichnen –
vorausgesetzt, der Vermögensverwalter würde bei den
Konditionen für die Anleihen mitreden dürfen. Eine
ungewöhnliche Bitte, wurden diese Bedingungen, wie
Zinscoupon, Laufzeiten und so weiter, bisher eigentlich von
Investmentbankern im stillen Kämmerlein mit dem
Unternehmen ausgemacht. Doch BlackRock war
hochzufrieden mit dem Arrangement. »Ein Modell, das die
Probleme aller Beteiligten löst«, lobte es Richard Prager
gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Fortune im November
2012. Prager, genannt Richie, ein ehemaliger Bank-ofAmerica-Spezialist für Devisen und Rohstoffe, ist seit 2009
bei BlackRock und nun dafür zuständig, immer mehr
Transaktionen dieser Art zu organisieren. Er ist einer von
mehreren Bankern, die Fink und Kapito speziell für den
Ausbau dieser Abteilung abgeworben haben.
Es ginge keineswegs darum, die Investmentbanken
rauszudrängen, beteuerte Prager gegenüber der Financial
Times, die ebenfalls über die neue Strategie berichtete.
Auch nicht darum, den Bankern ihre Gebühren streitig zu
machen. Nein, die Banker dürfen ruhig weiter mit dabei
sein bei den Deals. BlackRock will sie nicht verdrängen, so
lange eines gesichert bleibt: Man gewinnt an Einfluss.
Denn bei diesem neuen Modell sucht BlackRock nicht mehr
nur die besten Anlagemöglichkeiten heraus, sondern
schafft sie sich selbst. Die Unternehmen bekommen einen
Wunschzettel direkt vom größten Investor der Welt. »Das
erlaubt uns frühzeitig mit am Tisch zu sitzen«, sagt Prager
ganz unverblümt. Kapito war über so viel Offenheit seiner
Kollegen offenbar nicht recht glücklich. Er habe sich laut
gewundert, warum seine Partner über dieses Thema mit
dem Institutional Investor reden wollten, schließlich
handele es sich um »Betriebsgeheimnisse«, sagte er dessen
Reportern. Keinesfalls wolle er Nachahmern in der Branche
Tipps geben.
Doch andere Vermögensverwalter sind eher skeptisch,
wenn es darum geht, Bankenaufgaben zu übernehmen. Ein
Vertreter der Bostoner Investmentfirma Loomis, Sayles &
Co., ein weit kleinerer Rivale, der Ende 2014 rund 230
Milliarden Dollar verwaltet, erklärte 2011 gegenüber
Institutional Investor, bei Loomis wolle man lieber nicht
direkt an der Herausgabe von Anleihen beteiligt sein,
schließlich flössen bei dieser Gelegenheit vertrauliche
Informationen zwischen dem Unternehmen und der
betreuenden Investmentbank. Mit anderen Worten, Loomis
fürchtete Interessenkonflikte; in diesem Fall, dass die
Information einer Abteilung von einer anderen zum
eigenen Vorteil eingesetzt wird. So könnte zum Beispiel
Wissen über die Interna eines Unternehmens, das bei
einem Anleihe-Deal gewonnen wird, an einen
Fondsmanager gelangen, der dieses Insider-Wissen nutzt,
um über den Kauf von Aktien des betreffenden
Unternehmens zu entscheiden. Eine solche Weitergabe
käme bei den Aufsehern nicht besonders gut an – von dem
betroffenen Unternehmen einmal abgesehen.
Solche Interessenkonflikte schließt BlackRock
kategorisch aus. Dafür gebe es die berühmten und oben
bereits erwähnten »Chinese Walls«, jene angeblich
unüberwindlichen institutionellen Trennwände zwischen
verschiedenen Abteilungen, auf die sich die Wall Street in
solchen Fällen immer beruft. Die Reporter von Institutional
Investor merken in ihrem Bericht denn auch brav an,
BlackRock habe lange Erfahrung mit dem Schutz von
vertraulichen Kundeninformationen. »Chinesische Wände«
würden dafür sorgen, dass die Informationen nicht an
BlackRocks Fondsmanager weitergereicht werden.
BlackRock wollte sich auf Anfrage weder zur Zayo Group
noch zum Umfang solcher direkten Anleihekäufe äußern.
Auch zu potenziellen Interessenkonflikten in diesen Fällen
wollte das Unternehmen keine Stellung nehmen.
Bei anderen Gelegenheiten betätigt sich BlackRock – und
auch andere große Vermögensverwalter wie Allianz Global
Investors – ganz direkt als Kreditvermittler. Sie
übernehmen den Job, den sonst eine Bank oder eine
Sparkasse machen würde. Das heißt, sie vermitteln das
Kapital ihrer institutionellen Anlagekunden an die
Unternehmen oder Einrichtungen, die den Kredit
brauchen, ohne den Zwischenschritt einer Anleihe oder
einer Bank. Eine klassische Schattenbankfunktion. Noch
sind die Volumen in dem Bereich keine Gefahr für die
Banken. Doch der Trend, im Wall-Street-Schön-Sprech
»Private Debt« genannt, beschleunigt sich. 2011 waren es
knapp 40 Milliarden Dollar, 2013 bereits über 50 Milliarden
Dollar, berichtete das Magazin Private Debt Investor, das
sich dem neuen Segment widmet. Besonders im
Infrastrukturbereich wird »Private Debt« zunehmend zur
gängigen Alternative zum klassischen Bankkredit.
BlackRock mischt bei »Direct Debt« kräftig mit. Im Oktober
2014 gründeten die New Yorker eigens eine »Private
Debt«-Plattform in London, um dieses Kreditgeschäft in
Europa voranzutreiben.
Auch bei den wachsenden Peer-to-Peer-Kreditvermittlern
– im Finanzjargon als P2P bekannt – mischt BlackRock mit.
Beim P2P-Lending geht es um Online-Plattformen, über die
Kreditnehmer und Gläubiger sich finden, ohne dass eine
Bank dazwischen ist. Im Prinzip funktioniert P2P wie ein
Internetheiratsvermittler, bei dem ein Algorithmus
passende Partner zusammensucht. In den USA belief sich
das P2P-Volumen 2014 auf 5,5 Milliarden Dollar, fast
doppelt so viel wie noch 2013. Bis 2025 soll es sich nach
Schätzungen von PriceWaterhouseCoopers auf 150
Milliarden Dollar steigern (Februar 2015). In Europa ist die
Summe mit 275 Millionen Euro noch bescheiden. Aber die
Wachstumsraten nicht. Laut dem »Alternativen
Finanzbericht« der Universität Cambridge und der
Unternehmensberatung EY legten die P2P-Anbieter dort
zwischen 2012 und 2014 knapp 280 Prozent zu.
Deutschland ist nach Großbritannien und Frankreich der
drittgrößte Markt. (Studie ebenfalls aus Februar 2015)
Damit geht das traditionelle Geschäft an den Banken
vorbei. Tatsächlich kam Goldman Sachs in einer Studie
Anfang 2015 zu dem Schluss, dass dies für die Banken
bereits gefährlich sei. Ihre dunklen Zwillinge könnten
ihnen schon bald bis zu 7 Prozent des Profits abjagen. Das
wären – gemessen am Profit, den alle im Licht der
Regulierer operierenden US-Kreditinstitute 2014 erzielt
haben – 11 Milliarden Dollar. Noch ist die P2P-Branche
weitgehend unreguliert – und operiert ohne die
Sicherheitsnetze wie etwa einen Einlagensicherungsfonds.
Für BlackRock ist P2P eine neue Gelegenheit, als
Schattenbank eine Rolle zu spielen. BlackRock tritt dabei
als Aufkäufer der P2P-Kredite auf, die die New Yorker dann
verbriefen, also zu Wertpapieren machen. Das entspricht
im Grunde dem Prozess, mit dem einst Fink Hypotheken in
CMOs verwandelte. Fink & Co. gehören auch hier zu den
Wall-Street-Pionieren. Seit Ende 2013 habe BlackRock rund
330 Millionen Dollar an Krediten übernommen, die der
Online-Kreditvermittler Prosper arrangiert hatte,
berichtete Bloomberg im Februar 2015.
Der größte Dark Pool aller Zeiten
Auch beim Wertpapierhandel sucht der schwarze Riese
zunehmend eigene, private Wege zu gehen. Statt Aktien
über die öffentlichen Börsen zu handeln, ziehen es
Vermögensverwalter wie BlackRock mehr und mehr vor, in
VIP-Handelsplätze auszuweichen. Diese Dark Pools umgibt
eine Aura des Unterweltlichen. Selbst für Insider und
Regulierer sind diese Handelsplattformen kaum zu
durchschauen. »Es gibt einen Grund, warum sie Dark Pools
und nicht Kristallseen heißen«, unkte der Teilnehmer eines
Internetforums der Financial Times. Dabei sollten die
außerbörslichen Aktienhandelsplattformen ursprünglich
den Zweck einer Schutzzone für Investoren erfüllen. Sie
entstanden als Antwort auf Spekulanten, die mit
superschnellen Computern und komplexen SoftwareFormeln die weltweiten Aktienmärkte durchkämmen, um
auf diese Weise von Kauf- oder Verkaufsorders von
Großinvestoren Wind zu bekommen. Wenn etwa ein
Investmentfonds eine große Kauforder ausgibt, dann hat
das ein Ansteigen des Kurses zur Folge. Wenn Blitzhändler
davon Wind bekommen – durch ihre Algorithmen, mit
denen sie unablässig die Finanzmärkte durchsuchen –,
kaufen sie die betreffende Aktie vor dem Anstieg. Der
Vorteil für die Blitzhändler: Sie kassieren die Kursdifferenz
und machen Gewinn praktisch ohne Risiko. Der Nachteil
für den Investmentfonds: Weil der Kurs durch die Käufe der
Blitzhändler steigt, muss der Fonds einen höheren Preis für
die Order zahlen. Großbanken begannen deshalb vor
einigen Jahren außerbörsliche Plattformen anzubieten, die
Großanleger vor solchen Manövern schützen sollen. Im
Unterschied zu den Börsen, wo Orders immer sofort
öffentlich gemacht werden müssen, bleiben Auftraggeber
auf diesen Plattformen anonym. Die Order und der Kurs, zu
dem sie abgeschlossen wurde, werden erst im Nachhinein
in einer Pflichtmeldung an die Börsen weitergegeben.
Wegen dieser Anonymität bürgerte sich an der Wall Street
die Bezeichnung »Dark Pools« für die Handelsplattformen
ein.
Die Schattenhandelsplattformen sind in den letzten
Jahren allerdings öfter in die Schlagzeilen gekommen.
Betreiber nutzten die Undurchsichtigkeit für ihre eigenen
Zwecke. Anders als bei öffentlichen Börsen unterliegen
Dark Pools einer laxeren Regulierung. Im Wesentlichen
verlassen sich die Teilnehmer auf die Selbstregulierung der
Betreiber. Der Mangel an Transparenz hat die Kritiker
immer lauter werden lassen. »Die Flüssigkeit bei den DarkPool-Partys kann man sich denken: Dom Perignon, Cristal,
Bollinger …«, lästert der Teilnehmer eines Finanz-OnlineForums, der sich hinter dem Pseudonym »Karl Marx«
versteckt.
2014 erhob Eric Schneiderman, der Generalstaatsanwalt
von New York, schwere Vorwürfe gegen Barclays Bank:
Während Barclays seinen Kunden – darunter
Investmentfonds und Pensionskassen – versichert habe, in
dem Dark Pool sicher ihre Aktienorders abwickeln zu
können, ohne von Schnellfeuerhändlern übervorteilt zu
werden, lud die Bank in Wahrheit still und heimlich genau
diese Blitzhändler in den Dark Pool ein und gewährte ihnen
weitere Vorteile gegenüber den ahnungslosen
Großinvestoren. Barclays bestreitet die Vorwürfe, das
Verfahren läuft. Die UBS dagegen legte ähnliche
Beschwerden mit einem Vergleich bei.
Tatsächlich sind Dark Pools und Blitzhändler die Folge
von wohlmeinenden Reformen. Nach dem Platzen der
Dotcom-Blase fürchteten US-Regulierer, Amerikas Börsen
würden den Anschluss verlieren. Während in Frankfurt und
London emsig an elektronischen Handelssystemen
gebastelt wurde, schien ausgerechnet die Wall Street den
Zug der Zeit zu verschlafen. Die Parketthändler – allen
voran an der New York Stock Exchange – hielten am
traditionellen Handel fest, nicht zuletzt, weil der ihnen als
Mittelsmännern lukrative Vorteile bot. Die bestehenden
Regeln stellten sicher, dass die Mehrheit aller
Transaktionen über das Parkett lief. 2007 wurden in der
umfassenden Marktreform Regulation New Market
Structure, im Wall-Street-Jargon besser bekannt als
RegNMS, diese Privilegien abgeschafft. Das Ziel der
Reform, mehr Wettbewerb zu schaffen und den
elektronischen Handel voranzutreiben, wurde mehr als
erfüllt: Der Anteil des nicht-elektronischen Handels in den
USA ist inzwischen vernachlässigbar. Und in mehr als 70
Prozent der Fälle tippt nicht einmal mehr ein Broker die
Order in die Maschine, sondern die Computer handeln
mittels Algorithmen selbstständig unter sich. Und die
Börsen haben kräftig Konkurrenz bekommen. Heute
können Investoren auf 50 Handelsplätzen amerikanische
Aktien handeln. Rund 40 Prozent des Handels läuft bereits
an den Börsen vorbei. Die weniger streng regulierten
Handelsplattformen lockten mit schnelleren Systemen,
aber vor allem auch damit, billiger zu sein. Dark Pools
gehören mit zu den größten Profiteuren von RegNMS.
Wie akkurat sind Aktienkurse noch?
Der Dark-Pool-Boom lässt bei den Regulierern inzwischen
Zweifel am Erfolg der Finanzmarktreformen aufkommen.
Sie sehen ein noch größeres Problem als bloße
Manipulationen zuungunsten von Kunden. Sie sehen das
Funktionieren der Märkte selbst in Gefahr. Für viele
Skeptiker sind Börsen nur Zockerbuden voller Spekulanten.
Doch die Börsen erfüllen eine wesentliche Aufgabe: Sie
teilen Unternehmen Kapital zu. Und – zumindest in der
Theorie – dieses Kapital bekommen die Unternehmen nur,
wenn sie Investoren von ihren Zukunftsaussichten
überzeugen. Die Börse erfüllt öffentlich und für jeden
sichtbar die Funktion der Mittelverteilung in unserem
Wirtschaftssystem. Es ist im Prinzip wie Crowdfunding, das
bei den Millennials so beliebt ist – nur, dass die Investoren
die Chance haben, sich an den Gewinnen des Unterfangens
zu beteiligen. Hier entscheidet kein Banker im stillen
Kämmerlein, keine »Heuschrecke« und auch kein
Regierungsbeamter im Alleingang. Die Kurse, zu denen die
Aktien an der Börse öffentlich ausgewiesen werden, sind
die gleichen für den Fondsmanager wie für den
Kleinanleger. Doch mit den VIP-Handelsplattformen droht
diese Preisdemokratie bald der Vergangenheit
anzugehören.
Mary Jo White, die Chefin der US-Börsenaufsicht SEC,
erklärte bei einer Investorenkonferenz im Juni 2014, der
derzeitige Anteil an »dunklem Handel« sei der Qualität der
Märkte abträglich – vor allem bei der Kursfindung.
»Transparenz war lange das Gütesiegel des USAktienmarkts und ich bin besorgt über die mangelnde
Transparenz in den Dark Pools«, erklärte sie. Gemeint ist:
Wenn immer größere Ströme von Orders an den
öffentlichen Börsen vorbeilaufen, wie akkurat spiegeln die
Preise dort dann noch den Kurs wieder, der tatsächlich am
Markt gezahlt wird?
Die Abwanderung von Billionen in das dunkle Reich der
»Dark Pools« hat sich seit der Warnung der SEC-Chefin nur
noch beschleunigt. Im Januar 2015 kündigten neun große
amerikanische Fondsgesellschaften an, ihren eigenen
»Dark Pool« betreiben zu wollen. Das Projekt hatte
zunächst Fidelity entwickelt unter dem Codenamen
»Sakura«, dem japanischen Wort für Kirschblüte. Mit von
der Kirschblüten-Partie: BlackRock. Zwar gab es schon
vorher immer wieder Handelsplätze, die von Investoren
initiiert wurden, aber dieses Mal taten sich die Big Guys
der Investmentbranche zusammen. BlackRock erklärt auf
seiner Webseite: »Wir glauben, dass Dark Pools ein
wertvolles Instrument für das Ausführen von großen
Orderblöcken sowie für den Handel mit Aktien sind, die
wegen eines geringen Volumens geringe Liquidität haben.«
Es gibt noch mehr Vorteile, wenn es gelingt, die Orders an
den öffentlichen Börsen vorbeizuleiten. Vorteile, die sich in
Dollar ausdrücken lassen. Inzwischen hat sich der
Kirschblüten-Dark-Pool in Luminex umbenannt und wird
von einem Ex-BlackRock-Mann geführt.
Auch ein Dark Pool ist noch extern. Aber selbst den
können die großen Vermögensverwalter umgehen. Statt
über externe Handelsplattformen zu gehen, wechseln die
Fondsgesellschaften die Papiere ihrer verschiedenen
Kunden untereinander aus, im Wall-Street-Jargon
»Crossing« genannt und bei den Big Guys mittlerweile
üblich. Wenn etwa BlackRock-Kunde Pensionsfonds A
Microsoft-Aktien kaufen will und Staatsfonds B, ebenfalls
Kunde bei BlackRock, will Microsoft-Aktien verkaufen,
dann handeln sie die Aktien untereinander. Damit sparen
die Kunden die Gebühren für die externen Abwickler, so
das Argument von BlackRock. Und ihre Kunden dürften
tatsächlich wohl kaum traurig sein, wenn das für die WallStreet-Banken und Broker bedeutet, Hunderte Millionen
Dollar an Orders zu verlieren. Der schöne Nebeneffekt für
BlackRock ist dabei: Alle diese Transaktionen bleiben in
BlackRocks Servern. In einem internen Schreiben, das an
die Financial Times durchsickerte, hieß es: »Diese
Plattform wird Kostenvorteile und Handel quer durch alle
Vermögenswerte ermöglichen, indem wir eine der größten
Handelsoperationen der Welt werden.« Mit anderen
Worten, der »größte Dark Pool der Welt«, eine Art private
Börse, wie ein BlackRock-Vertreter gegenüber einem
Besucher einmal prahlte.
Aber die wichtigste Innovation mit der BlackRock unser
Finanzsystem grundlegend umkrempelt, sind ETFs. (Die
Wall Street hat eine Vorliebe für Kürzel mit drei
Buchstaben.) ETF steht für Exchange Traded Funds,
gemeint sind börsengehandelte Investmentfonds, jene
scheinbar simplen Investmentprodukte, die es
Kleinanlegern möglich machen, wie die Profis zu
investieren. Was dabei gerne übersehen wird: ETFs blühen
und gedeihen im Reich der Schattenfinanz.
Kapitel 6
ETF: Der Schwanz wackelt bald mit
dem Hund
Wer denkt, dass Geldanlage an der Wall Street oder
überhaupt in New York zu Hause ist, der irrt. Dort sitzen
lediglich die Händler, die Banker – letztlich ausführende
Kräfte. Auf den Namensschildern der Trader auf dem
Parkett der New York Stock Exchange finden sich bis heute
Namen wie Malony, Maguire, DeLucca. Als die Börse 1903
an der Südspitze Manhattans ihr neues Gebäude eröffnete,
wurden billige Arbeitskräfte für Botendienste auf dem
Parkett gesucht. Jobs, die gerne von New Yorks
Immigranten übernommen wurden – Italienern und Iren,
die oft nicht lange zuvor auf Ellis Island, dem
Einwanderungshafen, von einem der Überseeschiffe
gestolpert waren. Sie arbeiteten sich hoch und einige
wenige überlebende kleine Brokerhäuser sind bis heute
Familienbetriebe. Doch wenn es um die Entscheider ging,
die den Händlern und Bankern Anweisungen gaben, dann
gab es lange zwei Möglichkeiten: Sie fanden sich in
Philadelphia und vor allem in Boston. Dort lebte der alte
amerikanische Geldadel, die »Bostoner Brahmanen«, wie
US-Medien gerne lästerten. Die Familie von J. P. Morgan
etwa, Amerikas legendärem Banker, stammte von dort. Die
wohlhabenden Dynastien der Ostküste, denen anders als
den neureichen Wall-Street-Gewinnern Diskretion und eine
»stiff upper lip« über alles gehen, suchten früh nach einer
Möglichkeit, ihr Erbe gewinnbringend anzulegen. So
entstanden die ersten Investmentfonds. Edward C. Johnson
II sah die Chance, die elitären Geldpools für einen
breiteren Kreis von Anlegern zu öffnen und startete 1946
Fidelity Investments. Die Bostoner gehören zu den
Altersvorsorgeanbietern der ersten Stunde. Fidelity wuchs
zu einem globalen Unternehmen, seine Fonds verwalteten
2014 rund 2 Billionen Dollar (Stand Anfang 2015). Bei dem
Modell kümmern sich Fondsmanager darum, die ihnen
anvertrauten Gelder kräftig zu mehren. Einige brachten es
damit zum Star-Status – etwa Peter Lynch, der 13 Jahre
lang die Geschicke des Magellan Fonds, Fidelity’s
Flaggschiff, lenkte. Unter Lynch erreichte Magellan
schließlich 14 Milliarden Dollar – übernommen hatte er den
Fonds mit 20 Millionen. Anleger rissen sich darum, an den
genialen Investment-Schachzügen des Meisters
teilzuhaben. Zeitweise schloss Fidelity den Fonds für neue
Investoren – er war einfach zu groß geworden. Der Fluch
des Erfolgs: Je größer ein Fonds, desto höher müssen die
Gewinne des Fondsmanagers ausfallen, damit sich die
Tachonadel bewegt, wie es im Branchenjargon heißt. Für
die Fondsanleger gibt es noch einen Nachteil: Die
Fondsanbieter und der Fondsmanager verlangen Geld für
ihren Einsatz. Das schmälert die Rendite.
Schöne neue Derivatewelt
Da kam John Clifton Bogle, an der Wall Street besser
bekannt als Jack. Er hatte eine revolutionäre Idee. Warum
nicht einen Fonds kreieren, der quasi auf Autopilot
funktioniert? Statt einen teuren Manager anzuheuern, der
die Anlageentscheidungen treffen würde, sollte der Fonds
lediglich bekannte Indizes wie etwa den Standard & Poor’s
Index nachbilden. Den ersten Aktienindex kreierte der
Finanzjournalist Charles H. Dow 1896. Das Prinzip des Dow
Jones Industrial Average war recht schlicht: Dow nahm die
zwölf meistgehandelten Aktien, die an der New Yorker
Börse notiert waren, addierte die aktuellen Kurse und teilte
sie wiederum durch zwölf, um den Durchschnittskurs zu
ermitteln (heute umfasst der Dow Jones 30 Unternehmen).
Dows Ziel war es, eine Messlatte zu bekommen, mit der
sich die Bewegungen nicht nur einzelner Kurse, sondern
des gesamten Aktienmarkts messen ließen. Später wurden
die Indizes verfeinert. Beim Standard & Poor’s 500
erhalten die Kurse der Unternehmen im Index je nach
Marktwert ein höheres oder niedrigeres Gewicht
(Marktwert: ausstehende Aktien mal Kurs). Der S&P 500,
dessen Ursprung auf Henry Varnum Poors Register
amerikanischer Eisenbahnen im Jahr 1860 zurückgeht, gilt
mit seinen 500 US-Unternehmen bis heute als der
maßgebliche US-Marktindex. Bogle erweiterte Dows IndexIdee. Er wollte die Marktbewegung nicht nur messen,
sondern den Markt in einem Fonds so abbilden, dass
Anleger in den Aktienkorb investieren konnten. Grob
gesagt: Der Fonds würde die im S&P 500 enthaltenen
Aktien kaufen und halten. Der Fonds wäre dann zwar
gezwungen, mit dem Markt auf und ab zu schwanken und
seine Gewinne würden nur denen des Markts entsprechen.
Dafür konnte kein Fondsmanager den Anlegern durch
Fehlentscheidungen schaden und – vor allem – sie
Gebühren kosten.
Das Konzept war an sich nicht neu. Die Grundlagen
schufen zwei Nobelpreisträger: Der Ökonom William
Sharpe hatte das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite
analysiert und war zu dem Schluss gekommen, dass
Anleger am besten in den gesamten Markt investieren
sollten. Sein Kollege Eugene Fama entwickelte die Theorie,
dass die Kurse alle vorhandenen relevanten Informationen
widerspiegeln – demnach kann kein noch so smarter
Fondsmanager langfristig besser abschneiden als der
Markt. Auf der Basis dieser akademischen Überlegungen
tüftelte Mac McQuown, ein Finanzingenieur, bereits 1971
für die kalifornische Wells Fargo Bank das erste
Anlageportfolio aus, das einen Aktienindex nachahmte.
(Wells Fargos Kunde war Kofferhersteller Samsonite.)
Bogle jedoch war es, der Sharpes und Famas Konzepte für
die Bedürfnisse der Kleinanleger weiterentwickelte. Bogle
war bei seinem letzten Arbeitgeber, einem
alteingesessenen Investmentfonds aus Philadelphia, wegen
einer von ihm vorangetriebenen und gründlich
missglückten Fusion hinausgeflogen. Er hatte nicht viel zu
verlieren und so startete er 1975 seinen ersten
Investmentfonds, der den S&P 500, den breiten USAktienindex, nachbildete. Und erntete Hohn und Spott in
der Branche – »Bogles Folly«, Bogles Narretei, nannten sie
das Anlagevehikel. Ganz besonders von den »Bostoner
Brahmanen« kam Häme: »Ich kann mir nicht vorstellen,
dass Anleger sich mit durchschnittlichem Abschneiden
zufriedengeben«, wurde Ned Johnson III, der Sohn des
alten Fidelity-Gründers, damals zitiert. Doch da täuschte er
sich: Bogles Narretei, die heute Vanguard 500 Index Fonds
heißt, holte schließlich sogar Magellan, das Flaggschiff der
Johnsons, ein. Im Juni 2015 waren knapp 17 Milliarden
Dollar im Magellan Fonds angelegt, der Vanguard 500
verwaltete über 200 Milliarden Dollar. Paul Volcker, der
ehemalige Notenbankchef und ein Freund Bogles, ätzte
nach der Finanzkrise einmal, die einzige sinnvolle
Innovation der Finanzbranche der vergangenen 20 Jahre
sei der Geldautomat gewesen. Und wenn man auf die
vergangenen 40 Jahre blicke, gebe es noch eine zweite:
Indexfonds. Inzwischen sind Indexfonds so angeschwollen,
dass aktiv von Fondsmanagern gesteuerte Anlagepools
wohl bald zur Minderheit gehören werden.
Bogle hätte seinen Erfolg selbst fast nicht erlebt. Er erlitt
sechs Herzinfarkte und in den frühen 1990ern ging man
bei Vanguard davon aus, dass der Gründer nicht mehr
lange weiterleben würde. Also setzte ihm das Unternehmen
ein Denkmal: eine zwei Meter große Bronzestatue, auf
Wunsch von Bogle lebensecht. So sind seine durch Arthrose
knotigen Finger erkennbar. Doch 1996 erhielt Bogle ein
Spenderherz – das Herz eines jungen Mannes, wie er sagt,
habe ihn selbst verjüngt. Bogles wieder erwachte
Lebensgeister führten prompt zum Streit mit seinem
Nachfolger, den er selbst bestallt hatte.
Für Bogle waren Indexfonds mehr als nur ein Produkt. Er
selbst wurde nicht einmal reich mit Vanguard – zumindest
nicht nach Wall- Street-Maßstäben. Sein Vermögen beläuft
sich auf einen »zweistelligen Millionenbetrag« wie er der
New York Times verriet – Geld, das er mit der Anlage in
Vanguard Fonds verdient habe. (Die Fidelity-Dynastie der
Johnsons dagegen taucht regelmäßig in den Forbes-Listen
der reichsten Amerikaner auf.) Das liegt auch daran, dass
Vanguard kein normales Unternehmen ist, sondern den
Fondsanteilseignern allen zusammen gehört. Vorbild waren
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Bogle sieht sich
als Kämpfer für Kleinanleger, denen er einen fairen Zugang
zu den Aktienmärkten geben wollte. Umso entsetzter
reagierte er, als er erkennen musste, was die Wall Street
mit seiner Idee anstellte.
Findige Köpfe entwickelten den Indexfonds weiter und
schufen ein neues Anlageinstrument, den Exchange Traded
Fund oder ETF. Die ETFs verbinden die Vorteile des
Indexfonds – die Möglichkeit, günstig in einen ganzen Korb
von Aktien anzulegen – mit dem »Vorteil«, dass die
Fondsanteile wie eine einzelne Aktie gehandelt werden
können. Quasi eine Einladung zur Spekulation! Das
jedenfalls kritisierte Bogle und damit war es das genaue
Gegenteil von dem, was er mit seinen Fonds erreichen
wollte: Normalverdiener zu langfristigen Investoren zu
machen. Die ETFs, so seine Sorge, würden Kleinanleger
zum Zocken verführen. Es sei, wie »wenn man einem
Brandstifter Streichhölzer geben würde«, klagte er einmal.
Die Warnungen des Index-Pioniers verhallten ungehört.
ETFs wurden zu den erfolgreichsten neuen
Investmentvehikeln in Jahrzehnten. Anbieter liefern sich
Wettrennen, die beliebtesten ETFs zu kreieren. »Es gibt
mehr ETFs als Eiscremesorten in einer italienischen
Eisdiele«, wurde zum geflügelten Satz unter
Finanzberatern. Bald gab es nicht nur ETFs, die breite
Indizes wie den S&P 500 oder den Nasdaq 100 oder später
auch den Dax nachbildeten. Mittels ETFs ließen sich auch
Anleihe-Indizes nachbauen und wie Aktien handeln. (Anm.:
ETFs sind nur eine Gattung dieser neuen börsennotierten
Anlagevehikel ETP und ETN, hier im Text stehen ETFs für
die Palette.) Damit rückte ein langgehegter Traum der
Wall-Street-Spekulanten näher, Kredite wie Aktien an der
Börse handeln zu können. Und es dauerte nicht lange, da
gab es ETFs auf Gold, auf Silber, solche, die in Wasser,
Immobilien oder Biotechnologie investierten. Inzwischen
sind es weit, weit mehr. So schnell und so gründlich hat
selten ein Produkt die weltweiten Wertpapiermärkte
umgekrempelt. Nach den ersten Prototypen Anfang der
1990er waren es im Jahr 2000 nicht ganz 100 ETFs – Ende
2010 waren es über 2 500. 2014 hatten Anleger bereits
rund 2,7 Billionen Dollar in die weltweit 6 700 ETFs
gegossen. Bis 2020 sollen es nach Berechnungen der
Unternehmensberatung PwC (Studie Januar 2015) doppelt
so viel sein (siehe Grafik 3).
Als Vanguard unter einem neuen Vorstandschef ebenfalls
begann, ETFs herauszugeben, verließ Bogle aus Protest
den Aufsichtsrat des Unternehmens, das er selbst einst
gründete. (Vanguard richtete ihm immerhin ein eigenes
Institut ein, in dessen Namen er so kritisch sein kann, wie
er will.) Für Vanguard war es aber schon zu spät. Die
Führung bei den ETFs hatte schon jemand anderes
übernommen: BlackRock.
BlackRock stieg 2009 ins ETF-Geschäft ein. Während die
Banken und andere Konkurrenten noch mit den
Reparaturarbeiten nach der Lehman-Krise beschäftigt
waren, schlug Fink zu und übernahm die iShares-Sparte
der britischen Barclays Bank in einem 13,5-MilliardenDollar-Deal. Mit der Fondssparte von Merrill Lynch war
BlackRock bereits ins Geschäft mit der Geldanlage
eingestiegen. Doch die iShares katapultierten die New
Yorker auf einen Schlag in die erste Reihe. iShares waren
nach den ersten ETFs der frühen 1990er mit dem klaren
Ziel gestartet, eine breite Schicht von Kleinanlegern für
das Produkt zu gewinnen. 2006 hatte Barclays die ETFSparte der Hypovereinsbank übernommen und damit
gleichzeitig die Marktführung in Europa.
Trotz des zunehmenden Wettbewerbs hält BlackRock mit
den iShares einen Marktanteil von um die 40 Prozent in
den USA und sogar 45 Prozent in Europa. Allein 2014
sammelte BlackRock knapp 103 Milliarden Dollar ein, mehr
als ein Drittel des gesamten ETF-Zuflusses. »Die
erdrückend physische Marktherrschaft von iShares«,
betitelte Morningstar 2013 seinen Jahresabschlussbericht
für Europa. In dem Jahr hatte BlackRock sich auch noch
das ETF-Geschäft der Schweizer Credit Suisse einverleibt.
BlackRocks ETFs notieren in London, New York, Hongkong,
Toronto, Sydney, Frankfurt und Zürich. In Deutschland
bietet BlackRock laut der hauseigenen Werbung 240 ETFProdukte und verwaltet 136 Milliarden Euro. (700 iShare
ETFs umfasst das globale Angebot.) Inzwischen dürfte das
Engagement in Deutschland noch gewachsen sein, die
Broschüre ist auf Anfang 2014 datiert.
ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit »komplexere
Anlagestrategien zu verfolgen und mehrere Märkte und
Anlageklassen abzudecken«, so preist die iShares-Webseite
deren Vorteile an. Und sicher haben die neuen Produkte
auch Kleinanlegern Zugang zu Wertpapieren und anderen
Vermögenswerten verschafft, die bis dahin nur
Großinvestoren oder Multimillionären zugänglich waren.
Vor der ETF-Epoche war zum Beispiel ein Investment in
Rohstoffe oder Öl oder alternative Energiequellen
weitgehend reserviert für die VIPs unter den Anlegern.
»Ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded
Fund, ETF) vereint die besten Eigenschaften eines
herkömmlichen Investmentfonds und einzelner Aktientitel«,
wirbt BlackRock für die iShares. ETFs seien »einfach,
flexibel, kostengünstig«, heißt es in einer Broschüre zu den
iShares. Das mag aus Sicht eines einzelnen Anteilseigners
so sein. Doch die börsennotierten Fonds sind keineswegs
simpel. Es handelt sich letztlich um Derivate, deren Wert
sich aus den jeweils zugrundeliegenden Aktien ableitet – so
wie der Wert, der seit der Finanzkrise berüchtigten
Hypothekenpapiere auf den unterliegenden Darlehen
basiert. Mindestens ein Viertel des täglichen USAktienmarkts wird bereits über ETFs gehandelt, manche
Beobachter schätzen sogar, dass mehr als die Hälfte aller
Transaktionen von den ETFs beeinflusst sei. Dazu kommt:
Die Aktienkörbe werden gerne von Hedgefonds und HighFrequency-Tradern, jenen ultraschnellen Zockern,
eingesetzt. In einem Beitrag 2012 für das Financial Analyst
Journal, einem Fachblatt für Finanzanalysten, warnen die
Autoren (Rodney Sullivan und James Xiong) vor einem
»systematischen Risiko am Aktienmarkt«. Beim Studium
von Kursverläufen war ihnen aufgefallen, dass Aktien sich
zunehmend in die gleiche Richtung bewegten. Das kann bei
Einbrüchen einiger Aktien zu einer breiten »Ansteckung«
führen und einen Crash auslösen.
Potenzielle Probleme sehen Kritiker bei der Konstruktion
der ETFs. Die Idee klingt verführerisch simpel: ein
Wertpapierkorb, an dem sich verschiedene Investoren
beteiligen können. Doch um dieses einfache Prinzip in ein
konkretes Anlageprodukt zu verwandeln, braucht es
komplexe Transaktionen und Mechanismen im
Hintergrund. Ohne die aktive Beteiligung von
Marktteilnehmern – Banken und Brokerhäusern –, die die
Verbindung zwischen dem ETF und den ihm
zugrundeliegenden Werten stetig aufrechterhalten,
funktionieren die ETFs nicht. Nehmen wir einen ETF, der
einen Index wie den Dax nachbildet. Anleger kaufen die
ETF-Anteile und dank der Nachfrage steigt der Kurs des
ETF stärker als der Marktwert der 30 Dax-Werte, auf denen
er basiert. Die vom ETF-Herausgeber speziell mit der
Kurspflege beauftragten Marktteilnehmer, nennen wir sie
Kurspfleger, bemerken das Ungleichgewicht und kaufen
Dax-Werte, die sie dem Sponsor geben. Der bildet daraus
neue ETF-Anteile, die die Nachfrage befriedigen, und der
ETF-Kurs gibt nach. Weil die Kurspfleger die
unterliegenden Aktien kaufen, ziehen deren Kurse an. So
nähert sich der Kurs des ETF wieder der Entwicklung der
unterliegenden Aktien an. Spiegelbildlich verhalten sich die
vom Sponsor beauftragten Kurspfleger, wenn der Kurs des
ETF unter den Marktwert der Aktien fällt, die ihm
zugrunde liegen. Dann kaufen die Kurspfleger die ETFs und
tauschen sie beim Sponsor gegen den Korb an
unterliegenden Aktien ein. Die Aktien verkaufen sie
wiederum am Markt. Weil die ETFs zurückgekauft werden,
zieht deren Kurs an, während der Verkauf der
eingetauschten Aktien Druck auf deren Kurs nach unten
ausübt. So pendeln sich der Kurs des ETF und die
unterliegenden Aktien wieder auf eine Linie ein. Der
»Lohn« der Kurspfleger? In einem Wort: Arbitrage. Sie
profitieren von den kurzfristigen Differenzen zwischen ETF
und Aktien.
Kritiker sehen die Gefahr, dass die Kurspfleger in einer
Paniksituation an den Märkten ihre Aufgabe nicht
wahrnehmen würden, um nicht auf ETFs oder Aktien sitzen
zu bleiben, während deren Kurs wegbricht. In einem
Bericht 2013 für den Financial Stability Oversight Council,
ein Aufsichtsgremium im US-Finanzministerium, das wie
das FSB nach der Finanzkrise eingerichtet wurde, heißt es,
ETFs könnten bei Marktturbulenzen »potenziell
Kursausschläge beschleunigen oder verbreitern und damit
Liquidität im Markt reduzieren«. Unter diesen Umständen
könnten die Kurspfleger ihrer Aufgabe nicht mehr
nachkommen, weil sie keine zuverlässigen Kursangaben
mehr erhalten. Die Rechercheure für das Gremium fanden
Beispiele dafür. Am 20. Juni 2013 etwa, als es an den
Kapitalmärkten heftig gewitterte, hätten Kurspfleger
Orders zur Auflösung von ETFs nicht mehr erfüllt, weil sie
das Kapitallimit erreicht hatten, das ihr Arbeitgeber, eine
Bank, ihnen gesetzt hatte. Am gleichen Tag weigerte sich
ein anderer Kurspfleger, die Auflösungsorder in Cash
zurückzuzahlen und bot stattdessen Aktien an. Es werde
»von größter Wichtigkeit sein zu untersuchen, wie ETFHerausgeber und ihre Partner Stress und Volatilität
verkraften«, heißt es in dem Bericht des Financial Stability
Oversight Council.
Dann war da der »Flash Crash« am 6. Mai 2010, der bei
Skeptikern bis heute als Alarmsignal gilt. An jenem
Donnerstag sorgten sich die Marktteilnehmer um die
Situation in Griechenland, die Stimmung war nervös. Doch
nichts erklärte, was um 14:32 Uhr New Yorker Zeit
passierte: Die Kurse an der Börse begannen plötzlich
rapide zu fallen. Die Aktie von Accenture, eine
Unternehmensberatung mit 30 Milliarden Dollar Umsatz
und über 300 000 Mitarbeitern, ist ein Beispiel für das, was
geschah: Bevor der Spuk beginnt, um 14:20 Uhr, notieren
die Accenture-Aktien bei 40 Dollar, bevor sie ohne
erkennbaren Grund verlieren. Um 14:47 und 47 Sekunden
steht der Kurs bei 30 Dollar – nur 7 Sekunden später ist sie
auf 1 Cent gefallen. 1 Cent! Der Dow Jones Index, zu dem
die großen US-Konzerne wie IBM, Disney, Boeing und Coca
Cola zählen, stürzt innerhalb von Minuten fast 1 000
Punkte ab, eine Billion Dollar wird vernichtet. Es gibt aber
auch unerklärliche Bewegungen in die andere Richtung:
Der Kurs des Auktionshauses Sotheby’s, der von 30 Dollar
auf 99 999,99 Dollar schießt und damit schlagartig eine
Börsenbewertung von 6,8 Billionen Dollar erreicht – mehr
als das deutsche und das französische
Bruttoinlandsprodukt zusammen. Dann, genauso
unerklärlich, beginnen sich die Kurse wieder zu
normalisieren.
In der Öffentlichkeit geriet der Flash Crash bald in
Vergessenheit, denn schließlich hatten sich die Kurse
gleich wieder erholt. Doch Insider schreckt die Erinnerung
bis heute. Denn: Die Ursache wurde nie eindeutig geklärt.
Jahrelang erklärten die Aufseher, hauptverantwortlich für
den Crash sei Waddell & Reed’s, eine Investmentfirma in
Kansas. Dort habe ein Fondsmanager versehentlich eine 4Milliarden-Dollar- Order am Terminmarkt ausgegeben.
Dann wurde im April 2015 – fünf Jahre nach dem Flash
Crash – ein Daytrader namens Navinder Singh Sarao
verhaftet, weil er angeblich durch illegale Manipulationen
den Flash Crash ausgelöst habe. Sarao lebte bei seinen
Eltern in einem bescheidenen Reihenhaus in Hounslow,
einem Londoner Vorort nicht weit vom Flughafen
Heathrow. Dort hatte er einen Computer, den er für den
Handel mit Terminkontrakten auf Aktien nutzte. Als er dem
Haftrichter vorgeführt wurde, trug er ein kanariengelbes
Sweatshirt und eine Jogginghose. Weder in der Londoner
City noch an der Wall Street war sein Name vor seiner
Verhaftung bekannt. Saraos angeblicher Trick: Er gab
massive Orders am Terminmarkt aus, annullierte aber den
allergrößten Teil, bevor sie tatsächlich erfüllt wurden. Laut
den Strafverfolgern dienten die Phantomaufträge nur dem
Zweck, bei anderen Marktteilnehmern den Eindruck zu
erwecken, eine Verkaufswelle am Aktienmarkt stehe bevor.
Diese verkauften dann tatsächlich, worauf die Kurse
einknickten, sodass Sarao zu einem niedrigeren Preis
kaufen konnte. Wenn sich der Kurs von dem von ihm
künstlich herbeigeführten Preisverfall erholt hatte,
verkaufte Sarao zu dem höheren Kurs wieder. Die Differenz
war sein Gewinn. Das nennt man »Spoofing« und es ist
verboten. Seltsam daran ist allerdings, dass Sarao diesen
Trick mit den massiven »Spoofing«-Orders nicht nur am 6.
Mai 2010 anwandte, sondern an 250 weiteren Tagen – vor
und auch nach dem Flash Crash. Ohne dass es zu einem
Einbruch kam. Seltsam auch, dass die Chicagoer
Terminbörse CME offenbar von Saraos Aktivitäten wusste.
In einer Mitteilung, die ausgerechnet am Tag des Flash
Crash an ihn abgeschickt wurde, mahnte die Börse ihn,
Orders müssten »in gutem Glauben« abgegeben werden.
Sarao meldete sich ein paar Wochen später bei den
Börsenoffiziellen und erklärte ihnen laut seiner eigenen
Aussage, sie sollten ihn am A… lecken. Die CME
unternahm nichts weiter. »Eine Schlussfolgerung kann man
ziehen: Unhöflichkeit gegenüber Aufsehern wirkt«, lästerte
Matt Levine, ein ehemaliger Investmentbanker und
Bloomberg-Kommentator. (Allerdings muss man an der
Stelle auf einen Interessenkonflikt hinweisen: Die Börse
reguliert sich selbst, verdient allerdings auch an Gebühren,
die Händler für Transaktionen zahlen.)
Der Flash Crash beunruhigt Marktteilnehmer wie
Aufseher nach wie vor. Sie fürchten, dass es eine
Wiederholung geben könnte, die womöglich noch
schlimmere Folgen hat. Zwar hat die US-Börsenaufsicht
Sicherheitsvorkehrungen eingeführt, wie etwa einen
automatischen Handelsstopp, wenn Kurse zu schnell fallen.
Doch weil niemand weiß, warum die Kurse damals kippten,
weiß auch niemand, ob diese Maßnahmen ausreichen.
Warum ist der Flash Crash von besonderer Bedeutung für
ETFs? Von den Transaktionen, die bei den Aufräumarbeiten
danach von den Börsen annulliert wurden, betrafen über
zwei Drittel den Handel mit ETFs.
In einem Briefing zum Flash Crash räumt BlackRock zwar
ein, dass die ETFs bei dem Einbruch durch den »instabilen
Markt« in Mitleidenschaft gezogen wurden. Doch die ETFs
waren aus der Sicht von BlackRock nicht Mit-Verursacher,
sondern Opfer der Turbulenzen. Eine Umfrage unter ETFAnlegern belege, dass die Mehrheit nur minimal von dem
Crash berührt worden sei und fortgesetztes Vertrauen in
das Instrument habe, hieß es in der BlackRock-Studie. Die
Nachfrage, ob BlackRock ETF-Investoren für Folgen des
Flash Crash entschädigt hat, ließ das Unternehmen
unbeantwortet.
Eine potenzielle Bedrohung durch ETFs erwächst schlicht
durch ihre Popularität. Die großen Standardindizes sind –
wie im Fall des S&P 500 beschrieben – gewichtet. Das
heißt, das Unternehmen mit dem größten Börsenwert hat
auch das größte Gewicht im Index. Bei den TechAktienindizes sind das zum Beispiel Apple und Google.
Wenn ETFs den Index nachbilden, fließen zwangsläufig die
meisten Mittel in die Indexschwergewichte. Dadurch
wächst deren Börsenwert und ihr Gewicht im Index noch
weiter. Statt dass die Anleger ihr Risiko durch
Indexinvestment breit streuen, reitet immer mehr Kapital
auf nur wenigen Aktien. (Bei Anleihe-Indizes hat die
Gewichtung den perversen Effekt, dass das Unternehmen,
das die meisten Anleihen ausgegeben hat, also die meisten
Schulden gemacht hat, das höchste Gewicht im Index
erhält.) Ein Rezept für heftige Kursausschläge und der
Horror für Kleinanleger. Der Aufstieg der ETFs fand
während einer langen Periode stetigen Aufstiegs an den
Aktienmärkten und Ruhe an den Anleihemärkten statt. Die
wird unweigerlich zu Ende gehen. Dann müssen die ETFs
sich unter Stressbedingungen bewähren. »Es geht nicht
nur darum, sich während einer Hausse erfolgreich zu
schlagen, sondern wie viel man in einer Baisse verliert«,
warnt James Stack, ein Investmentberater, der seit 20
Jahren einen anerkannten Newsletter veröffentlicht.
Gerade für Kleinanleger sei das ein wesentlicher Punkt.
Besonders clevere Finanztüftler kreieren ETFs nicht mit
den Aktien oder Werten, auf denen der nachgebildete Index
eigentlich basiert. Stattdessen bauen sie die
Kursentwicklung und Rendite mittels anderer Wertpapiere
und einer komplexen Tauschaktion mit einem
Handelspartner – einem Swap – nach. Die Performance
eines ETF, der eigentlich auf Biotech-Aktien basiert, kann
dann zum Beispiel mit einer Kombination aus griechischen
Bonds und japanischen Small-Caps-Aktien »synthetisch«
nachgeahmt werden. Sinn der Übung: Der ETFHerausgeber kann mit der Finanzakrobatik die
Performance des Index einfacher und akkurater abbilden,
ohne Arbitrageure einzusetzen.
Manche Märkte sind für Investoren nur schwer
zugänglich – Russland etwa oder Indien und bei den
meisten Rohstoffen geht nichts ohne die Swap-Derivate.
Doch es gibt die Gefahr, dass der Partner bei dem
Tauschgeschäft – Großbanken und Brokerhäuser – ausfällt
und den ETF mitreißt. Eine Art Lehman im ETF-Format.
Aufseher warnen deshalb seit einiger Zeit vor
synthetischen ETFs, die vorwiegend in Europa zur
Anwendung kamen. (Die US-Aufsicht ist strikter.)
BlackRock hat diese Exoten in seiner Produktpalette
weitgehend vermieden. Bei einer weiteren Sorte von ETFs,
bei denen die Herausgeber zusätzlich Derivatewetten
einsetzen, um die Rendite des unterliegenden Index
hochzujazzen, gehört Larry Fink sogar zu den lautstärksten
Gegnern. Diese ETF-Wetten drohten »eines Tages die ganze
Branche implodieren zu lassen« warnte er auf einer
Investorenkonferenz 2014.
BlackRock hat allen Grund, Probleme mit ETFs zu
fürchten. Selbst eine größere Diskussion über die Risiken
von ETFs könnte sich schon schädlich für den Marktführer
erweisen, etwa indem sie Zweifel bei Kunden weckt oder
die Aufsicht auf den Plan ruft. Denn der Gigant hat große
Pläne mit den neuen Instrumenten.
Der Prinz der iShares
Anders als seinen Boss Larry Fink, der allein mit seiner
Körpergröße seine Umgebung überragt, könnte man Mark
Wiedman auf den ersten Blick übersehen. Selbst an der
Wall Street heißt es (noch): »Wiedman – wer?« Doch das
dürfte sich ändern. Der Chef der iShares-Sparte gilt als
aufsteigender Star bei BlackRock. Er wird sogar als
potenzieller Nachfolger von Fink gehandelt. Der
Mittvierziger ist ein aufmerksamer Zuhörer und ein
unterhaltsamer Gesprächspartner. Unter den Kollegen
erntet er Spott dafür, dass er zwar den englischen
Romantiker Shelley zitieren, aber nur mit Mühe zwei
Teams der National Football League benennen kann. Um
seine Herkunft macht Wiedman nicht viel Wind. Er wuchs
in Long Island auf, in einem jener Vororte in die die weiße
Mittelschicht in den 1970ern und 1980ern zog, um der von
Kriminalität und Graffiti gezeichneten New York City zu
entfliehen. »Ausfahrt 39, in einem unscheinbaren Vorort in
einem unscheinbaren Haus«, wie er es selbst einmal dem
Finanznachrichtendienst Bloomberg beschrieb. Wiedman
stammt aus einem Medizinerhaushalt. Sein Vater, ein Arzt,
praktizierte noch in seinen 80ern. Seine Mutter
unterrichtete Krankenpflege am örtlichen College. Doch
Wiedman schaffte es nicht nur, einen Studienplatz am
Harvard College zu ergattern, er schloss sein Studium dort
auch mit einem »magna cum laude« ab. Dann wechselte er
an die rivalisierende Yale University und studierte Jura. Für
seinen ursprünglichen Plan, Richter zu werden, zeigte er
sich allerdings zu ungeduldig – und vielleicht auch zu
wenig bescheiden. Nach einem kurzen Abstecher beim
Beraterkonzern McKinsey & Co. ging er nach Washington
zum Finanzministerium. Sein früherer Chef dort,
Unterstaatssekretär Peter Fisher, ging zu BlackRock und
holte Wiedman nach. Zunächst gehörte er nach der
Finanzkrise zum ursprünglichen Team, das Zentralbanken
und Regierungen mit ihren toxischen Altlasten beriet. Dann
bekam er seine Chance – Fink machte ihn zum Chef der
zugekauften iShares-Sparte. Wiedman sollte das ETFGeschäft zu einem Teil von BlackRock machen, den
Neuzugang auf die New Yorker Linie trimmen. Und er
sollte die Konkurrenz von Vanguard auf Abstand halten.
Vanguard war zwar dank Bogles Widerstand spät in das
Rennen eingestiegen. Aber durch die eigentümliche
Eigentümerstruktur – es gibt keinen Eigner, der Gewinne
abschöpft – konnte die Investmentgesellschaft aggressiv
günstige Konditionen bieten, was sie vor allem bei
Kleinanlegern beliebt macht.
Das alles spornt Wiedman offenbar nur an. In der eher
gesetzten, wenn nicht gar langweiligen Branche der
Fondsanbieter machte er bald Schlagzeilen. Zu seinen
ersten Schachzügen gehörte, sich mit Vanguards altem
Bostoner Konkurrenten Fidelity zu verbünden und eine
Vertriebspartnerschaft einzugehen. Aber das war nur der
Beginn. »Ehrgeizig«, nannte ihn die Financial Times, die
ihm 2012 ein Porträt widmete. Diese Beschreibung des
iShare-Bosses dürfte als britisches Understatement gelten.
Wiedman will die Finanzmärkte fundamental verändern. Es
sei der Bereich mit den »am intellektuell interessantesten
und bahnbrechendsten Entwicklungen«, verkündete er den
FT-Reportern. Er vergleicht ETFs mit der Einführung von
Containern in der Schifffahrt in den 1950er Jahren, die das
globale Transportsystem komplett veränderten.
Was Wiedman vorhat, könnte den Finanzmarkt komplett
und nachhaltig verändern – nicht nur für Kleinanleger,
sondern für Großinvestoren, für Hedgefonds und selbst für
die Börsen. Wiedman sieht nämlich in den ETFs viel mehr
als bloß eine Spielart der Indexfonds, weit mehr als eine
peppigere Alternative zum Sparbuch. Er glaubt, dass ETFs
über kurz oder lang die eigentlichen Werte, auf denen sie
basieren, ersetzen werden – zumindest, was die Anleger
angeht. »Die Idee, dass Versicherungen, die bisher einzelne
Anleihen oder Derivate gekauft haben, jetzt stattdessen
ETFs als Kernbestandteil für ihre Portfolios benutzen, ist
vollkommen neu«, sagte er der Financial Times. Als
Beispiel nennt er einen amerikanischen Pensionsfonds, dem
BlackRock geholfen habe, Positionen in 2 000
verschiedenen Wertpapieren aufzulösen und das Kapital
stattdessen in nur vier ETFs zu investieren. In einem
späteren Interview mit Bloomberg erzählt Wiedman von
einem Großinvestor, der statt 2 200 verschiedene Anleihen
zu halten, sein Kapital in lediglich zwei ETFs
zusammenführte. Und den Anleihemanager, der diese
Positionen bis dahin betreut hatte, habe sich der iSharesKunde auch gleich gespart, freute sich Wiedman. Das Ziel
ist klar: Statt wie bisher in Aktien, Anleihen oder Rohstoffe
direkt zu investieren, sollen auch Großinvestoren künftig
über ETFs anlegen. Eine Entwicklung, von der ETFAnbieter wie Wiedmans iShares enorm profitieren dürften.
Aber Wiedman geht noch weiter. Im Sommer 2013 kam
es wieder zu einer Bewährungsprobe für die ETFs. Der
damalige Fed-Chef Ben Bernanke deutete damals an, dass
die Zeit des billigen Notenbankgeldes zu Ende gehen
würde. Das Auslaufen des Fed-Programms war im WallStreet-Jargon besser als der »Taper« bekannt. Die
Marktteilnehmer reagierten wie Zweijährige, denen Papa
den Lutscher wegnehmen will, und so gingen die
Kurseinbrüche, die Bernankes Ankündigung folgten, als das
»Taper Tantrum«, der »Wutanfall über den Taper«, in die
Wall-Street-Annalen ein. Nervös kauften und verkauften
Anleger vor allem eines: ETF-Anteile. Nach iShares eigenen
Angaben überstieg das Handelsvolumen beim High Yield
US Bond, einem ETF von US-Schrottanleihen, in jenen
Tagen zum ersten Mal mehr als 1 Milliarde Dollar – täglich.
Der größte der iShare-Schwellenländerfonds sah an einem
Tag während des »Wutanfalls« sogar ein Handelsvolumen
von 5,6 Milliarden Dollar. Problemlos sei der Handel trotz
der hohen Wellen in den ETFs seines Hauses gelaufen, wie
Wiedman später resümierte.
Nicht bei allen Anbietern lief es allerdings so reibungslos:
Bei einigen ETFs, die auf Wertpapieren aus
Schwellenländern und auf seltener gehandelten Anleihen
basierten, hatten die Kurspfleger ihre Not, die notwendigen
Papiere heranzuschaffen. Es kam zu Ausfällen.
»Turbulenzen wecken erneut Sorge über strukturelle
Probleme bei ETFs«, konstatierte die Financial Times.
Allein am 26. Juni seien ETF-Transaktionen in Höhe von
knapp 4 Milliarden Dollar nicht zum vereinbarten Zeitpunkt
abgeschlossen gewesen. Das heißt, der
Transaktionspartner konnte die vereinbarten Wertpapiere
nicht in der vorgesehenen Zeitspanne besorgen. Nur am
15. August 2011 waren die Ausfälle noch höher gewesen:
6,6 Milliarden Dollar. Damals erschütterte die Eurokrise die
Märkte. Marktteilnehmer wiegeln jedoch ab – die Ausfälle
stellten lediglich einen operativen Schluckauf, aber kein
systemisches Risiko für den Markt dar. Die meisten
Transaktionen würden letztlich in einer Nachfrist
problemlos erfüllt.
Wetten auf ETFs – Das »Ein-Pferd-Rennen«
Anders als die Skeptiker reagierte Wiedman. Er sah in dem
»Taper- Wutanfall« keinesfalls eine Warnung, sondern
nahm die Episode zum Anlass, Ende Juni einen offenen
Brief an die iShares-Investoren zu schreiben. Darin erklärte
er, die ETFs hätten dem Marktdruck gut standgehalten. Er
verwies darauf, dass BlackRock in den USA mit 45
Kurspflegern zusammenarbeite – alles »weltweit führende
Finanzinstitute«, die sicherstellten, dass auch große Orders
problemlos abgewickelt würden. Und dann kommt er zu
seinem eigentlichen Punkt: Die Turbulenzen zeigten
keineswegs mögliche Probleme oder gar systemische
Risiken von Wall Streets neuester Lieblingsinnovation.
Nein, für Wiedman war es der Beweis, dass ETFs den
Markt stattdessen besser machten. Ja, ETFs seien
eigentlich der Markt. Die Preise des ETF und nicht länger
die der unterliegenden Papiere oder Werte seien
ausschlaggebend für die Anleger. Statt dass die ETFs den
Kursen der Wertpapiere passiv folgten, sei es gerade
anders herum. Salopp gesagt: Der Schwanz wackelt künftig
mit dem Hund. Was Wiedmann nonchalant in seinem
Schreiben anmerkte, ließ selbst die Augenbrauen der
abgebrühten Wall-Streeter hochschnellen. »iShares
Behauptungen machen mich nervös«, lautete die
Schlagzeile der Branchen-Webseite ETF.com, die sich an
Profis richtet. »Das Unternehmen will mit seinen ETFs in
Konkurrenz zu Terminkontrakten und anderen Derivaten
treten und, bis zu einem gewissen Grad, die Rolle von
einzelnen Aktien übernehmen«, heißt es da fast schon
ungläubig. Und nicht nur bei den Autoren des
Branchenorgans lässt Wiedmans Enthusiasmus für die
Wertpapier-Waschkörbe böse Erinnerungen wach werden.
An die Hypothekenpapiere. Auch diese Finanzinnovation –
an der Wiedmans Boss Larry Fink federführend beteiligt
war – wurde zunächst gepriesen, weil sie zuvor nur schwer
zugängliche Anlageformen, in dem Fall Hypotheken auf USImmobilien, einem breiten Anlegerkreis erschlossen. In der
Aufbruchsstimmung glaubten diese Anleger tatsächlich,
dass allein durch die geschickte Verbriefung und FinanzAlchimie sich die Kreditqualität der unterliegenden Kredite
verbessern ließe. Dann kam die Krise 2007 bis 2008 und
selbst angeblich sichere Kredite platzten. Die Alchimie
enttarnte sich als ein Rezept für Desaster.
Die Kritik führte dazu, dass andere iShares-Vertreter
schleunigst öffentlich zurückruderten und Wiedmans
Behauptung deutlich relativierten. Doch Wiedman legte
nach. Rund ein Jahr nach dem PR-Desaster erklärte er in
einem Interview mit einem Vertreter des Fondsbewerters
Morningstar herablassend, Unwissenheit sei eines der
größten Hindernisse der Branche. Dass Abweichungen
zwischen dem ETF-Kurs und den unterliegenden Werten
ein Problem darstellten, sei ein »großer Mythos«, der vor
allem von der Presse verbreitet würde, behauptete er in
dem Gespräch. Es sei falsch, bei ETF die überkommenen
Maßstäbe anzulegen, mit der der Wert von klassischen
Fonds bestimmt werde. Besonders unter Stress sei der
Kurs des ETFs »der wahre Markt« und die Bewertung der
unterliegenden Werte tatsächlich die Preise »von gestern«.
Folgt man Wiedmans Argumenten, ersetzen ETFs über kurz
oder lang für das Gros der Anleger das Engagement in
einzelnen Aktien und Anleihen. Damit nicht genug: Ein
BlackRock-Mitarbeiter erzählte bei einer anderen
Gelegenheit stolz, man sei dabei, den Terminbörsen in
Chicago Konkurrenz zu machen. Statt Futures und
Optionen würden Großinvestoren künftig zunehmend
entsprechende ETF-Instrumente einsetzen. »Das ist billiger
als die Terminkontrakte der Börse zu nutzen.« Erfüllt sich
die Vision der New Yorker, würden iSharesFinanzingenieure, die die ETFs zusammenbasteln,
bestimmen, was an den Finanzmärkten gehandelt wird –
und vor allem wie es gehandelt wird.
Und wenn ETFs das »Ein-Pferd-Rennen« sind?
Wie die ETF-Struktur unter Panik am Markt funktioniert,
weiß niemand genau. Regulierer sind beunruhigt über die
explosionsartige Vermehrung der neuen Derivate. »ETFs
haben sich in neue Anlageformen ausgebreitet (Anleihen,
Kredite, Schwellenländer, Rohstoffe), Bereiche, in denen
die Transparenz und Liquidität typischerweise geringer
sind«, heißt es in einer Studie des Financial Stability
Board, jenem Gremium, das die G20 nach der Finanzkrise
eingerichtet haben und das helfen soll, neue
heraufziehende Gefahren für das Finanzsystem frühzeitig
zu erkennen.
Außerdem sorgen sich die FSB-Beobachter, dass das, was
Anleger schätzen, nämlich, dass sie ihr Geld auf Wunsch
jederzeit abziehen können, sich als Risiko nicht nur für die
ETFs, sondern für das gesamte System erweisen könnte.
Turbulenzen an den Märkten sind immer dann gefährlich,
wenn die Marktteilnehmer keine Zeit zum Reagieren
haben. Dann kommt es zu den gefürchteten DominoEffekten. Klassische Investmentfonds halten in der Regel
Cash vor, um gegebenenfalls Investoren zufriedenstellen zu
können, die ihre Einlagen zurückfordern. Das
Bargeldpolster sorgt dafür, dass der Fondsmanager nicht
sofort Vermögenswerte losschlagen muss, um die nervösen
Investoren auszuzahlen. Hedgefonds haben in ihrem
Kleingedruckten meist eine Frist festgeschrieben, die der
Investor abwarten muss, bevor er sein Geld abziehen darf.
Beide Strategien verhindern, dass Fonds durch
Investorendruck zu Schnellfeuer-Verkäufen gezwungen
werden, die das Potenzial haben, die Panik am Markt noch
zu verstärken.
ETFs haben dagegen kein Sicherheitspolster und auch
keine Schonfrist – das Interessante an ihnen ist ja gerade
das Versprechen an die Inhaber, die Anteile jederzeit
losschlagen zu können. Das funktioniert so lange
reibungslos, wie sich am Markt immer jemand findet, der
die Gegenposition einnimmt. Grob gesagt, ist ein
Vermögenswert – etwa Aktien, Anleihen, Fondsanteile –
dann liquide, wenn ich ihn verkaufen kann, wann ich will,
ohne deswegen einen deutlichen Preisabschlag in Kauf
nehmen zu müssen. Sichergestellt wird das, indem
genügend Käufer am Markt sind, die den fraglichen
Vermögenswert erwerben wollen. Liquiditätsengpässe bei
ETFs könnten böse Folgen haben, fürchten Insider. Im
März 2015 löste Howard Marks, Mitgründer von Oaktree,
einem Fonds, der sich auf angeschlagene Kreditpapiere
spezialisiert hat, mit einem Schreiben an seine Anleger
heftige Diskussionen aus. ETFs, schreibt der Wall-Street-
Veteran, seien ein Paradebeispiel für Finanzinnovationen,
die Anleger dazu verführten zu denken, ein »Allheilmittel«
sei gefunden, ein Produkt, das den traditionellen
Anlageformen überlegen sei. Solche Finanzinnovationen
erinnerten ihn, so Marks, immer an die Geschichte von dem
Spieler, der stets auf der Suche nach der absolut sicheren
Wette war. »Ein Rennen mit nur einem Pferd schien eine
solche zu sein. Der Spieler setzte sein ganzes Geld, doch
mitten in dem Rennen brach der Gaul aus, sprang über den
Zaun und galoppierte davon.«
Die große Bond-Blase
Das Gefährliche an Schattenbanken ist, dass eine bisher
unverdächtige, ja geradezu langweilige Ecke des
Kapitalmarkts plötzlich zu wuchern beginnt. Ein wenig wie
im Krieg der Sterne, wenn die dunkle Seite der Macht zu
stark wird. Regulierer sehen die unheimliche Veränderung
– siehe Geldmarktfonds – oft erst, wenn es zu spät ist.
»Hindsight 20/20«, sagen achselzuckend die Wall-StreetJungs. Gemeint ist: Im Rückblick hat man immer die
perfekte Sehschärfe – nämlich 20/20 (Wenn man beim
Optiker aus einer Entfernung von 20 Fuß alle Buchstaben
des Sehtests lesen kann.) Wann übernimmt ein
Anlageprodukt, eine Praxis der Marktteilnehmer die
Funktion einer Schattenbank? Wann wandeln sich
Geldmarktfonds von modernen Sparschweinen für
Großanleger zum Finanz-Schmiermittel der Wirtschaft?
Wann sind die unregulierten Finanzierer ein Risiko? Mit
dieser Frage plagen sich Regulierer zunehmend herum.
Beim Repo-Markt und den Geldmarktfonds kam ihre
Erkenntnis zu spät. Jetzt sorgen sie sich um einen anderen
Bereich, der bisher in den Augen der Allgemeinheit
zumindest eher an Eigenschaften wie mündelsicher und
konservativ denken ließ: Corporate Bonds –
Unternehmensanleihen. Bei Unternehmensanleihen denkt
zunächst niemand an die dunkle Seite des Finanzmarkts.
Ein einfaches und bewährtes Kreditinstrument: Ein
Unternehmen nimmt Geld auf und vergibt dafür
festverzinsliche Wertpapiere an die Gläubiger. Doch der
Markt für diese Routinewertpapiere hat in den letzten
Jahren eine Mutation durchgemacht.
Das billige Geld der Notenbanken hat für Verwerfungen
gesorgt. Ausgerechnet die niedrigen Zinsen, mit denen sie
die Wirtschaft nach der Kreditkrise 2008 retteten, haben
nun womöglich eine neue Kreditblase aufgepumpt. Dieses
Mal sind es nicht Hausbesitzer, die sich überschulden,
sondern Unternehmen. Industrieanleihen erleben einen
historischen Boom. Allein 2014 gaben US-Unternehmen
Anleihen in Höhe von 1,4 Billionen Dollar aus. Davon waren
312 Milliarden so genannte Junk Bonds, also Anleihen
herausgegeben von Unternehmen mit schlechterer Bonität
– die Entsprechung der einstigen Wackelhypotheken. Damit
kamen letztes Jahr mehr Junk Bonds auf den Markt als in
den Vorkrisenjahren 2006 und 2007 zusammen.
Der Anleihemarkt in Deutschland ist im Vergleich zu den
USA verschwindend klein – deutsche Unternehmen
finanzieren sich nach wie vor maßgeblich über Banken.
Doch seit die Banken schrumpfen, suchen auch
europäische Unternehmen nach Alternativen. 2009 gab es
laut Creditreform lediglich 50 Anleiheemissionen in
Deutschland mit einem Volumen von 36 Milliarden Dollar.
2013 waren es bereits 130 Anleiheausgaben – allerdings
stieg das Volumen nur mäßig auf knapp über 40 Milliarden.
Und die Geldverwalter haben diese Anleihen gekauft und
in ihre Fonds gelegt. In den USA sind Fonds, die in
Anleihen investieren, auf 3 Billionen Dollar angeschwollen.
Das ist sechs Mal so viel wie noch 1994. In dem Jahr war
Pulp Fiction der Hit in den Kinos. Veteranen am
Finanzmarkt erinnern sich allerdings eher an das »BondMassaker« von 1994, als die Fed mit einer überraschenden
Zinserhöhung einen drastischen Einbruch an den
Anleihemärkten auslöste. Für die Finanzmärkte ist es
immer ein heikler Moment, der Wechsel aus einem
jahrzehntelangen Niedrigzinsumfeld in ein Umfeld
steigender Zinsen. Damals erwies sich das System als
robust genug, den Schock abzufedern. Doch ob das auch
bei der kommenden Zinswende gelingt, ist alles andere als
ausgemacht. Zum einen wegen der historisch hohen
Bestände in den Fonds der Geldverwalter, zum anderen,
weil die Banken ihre Rolle als Stoßdämpfer und Puffer an
den Anleihemärkten nicht mehr so spielen können wie
damals.
Und das beunruhigt die Regulierer. Denn wenn die
Fondsanleger ihre Anteile verkaufen und ihr Geld abziehen,
dann müssen die Fondsverwalter die Anleihen zu Cash
machen, um den Anlegern ihr Geld auszahlen zu können.
Unter normalen Umständen ist das kein Problem. Doch
wenn es Turbulenzen gibt am Markt, wenn Anleger in
Scharen ihre Anteile abstoßen, dann könnte der Ansturm
eine der gefürchteten Domino-Situationen auslösen:
Verkäufe, die Preise abstürzen lassen und dadurch weitere
Verkaufswellen auslösen.
Verkaufswellen bei Anleihen sind an der Wall Street
besonders gefürchtet. Denn anders als Aktien werden die
Kreditpapiere bis heute nicht im großen Stil an Börsen
gehandelt. Das liegt an der Art, wie Anleihen ausgegeben
werden. Während Aktien weitestgehend standardisierte
Unternehmensanteile sind, die ihren Inhabern mehr oder
weniger dieselben Rechte einräumen und deswegen an
öffentlichen Börsen, Handelsplattformen und elektronisch
gehandelt werden können, sind Anleihen maßgeschneidert
nach den Bedürfnissen des herausgebenden
Unternehmens, mit jeweils individuell unterschiedlichen
Rechten und Konditionen. Grob gesagt: Aktien sind von der
Stange, Anleihen gibt’s nur als Maßanzug. Deshalb werden
Anleihen nach wie vor mehrheitlich von Händlern bei den
Banken telefonisch gehandelt. Die Händler holen Angebote
von Investoren ein und machen selbst welche, sie
vermitteln zwischen Investoren. (Und kassieren kräftig
Marge für sich selbst!) Doch seit die neuen Kapitalregeln
gelten, mussten die Banken auch ihre Aktivitäten in diesen
Handelsräumen herunterfahren. Nach Schätzungen des
Finanznachrichtendienstes Bloomberg sogar um 76
Prozent. Und noch etwas ist passiert: Gleichzeitig mit dem
Volumen der ausgegeben Unternehmensanleihen ist in den
vergangenen Jahren das Bond-Universum geradezu
explodiert. Investoren können jetzt zwischen 46 000
verschiedenen Unternehmensanleihen wählen. Zum
Vergleich: An den amerikanischen Aktienmärkten sind
gerade mal 5 000 verschiedene Aktien notiert. Das macht
den Handel mit den Kreditpapieren noch komplexer. Bei
einzelnen Anleihen hält ein Fonds die Hälfte der
ausgegebenen Papiere. Wenn so viele Schulden eines
Unternehmens in einer Hand konzentriert sind, dann liegt
der Unterschied zur Hausbank nur noch im Auge des
Betrachters oder besser gesagt, in der unterschiedlichen
Regulierung.
Jetzt befürchten Marktteilnehmer, dass etwa in
Stresszeiten, wenn größere Blöcke von Anleihen schnell die
Hände wechseln müssen, nicht genug Angebot und
Nachfrage vorhanden ist. Dann kann es zu gefährlichen
Preisausschlägen an dem wichtigsten Markt für
Unternehmensfinanzierungen kommen. Oder eben einem
»Schnellfeuerverkauf« und letztlich zu Panik.
Die Aktivitäten im Anleihemarkt seien schon »ein wenig
bankmäßig«, formulierte es Jeremy Stein, damals noch
Gouverneur der Fed im Mai 2014 gegenüber der Financial
Times. »Es mag die Essenz der Schattenbanken sein, den
Leuten einen liquiden Anspruch auf einen illiquiden
Vermögenswert zu geben«, sagte er in Bezug auf die
Anleihefonds. Die Fonds versprechen ihren Anlegern,
jederzeit ihre Anteile verkaufen zu können (damit sind
diese Anteile liquide), gleichzeitig sind Anleihen notorisch
schwieriger am Markt zu verkaufen und zu kaufen (die
Vermögenswerte der Fonds sind also eher illiquide). Und
wie lautet ein alter Wall-Street-Spruch so schön: »Liquidität
ist wie Atemluft, man vermisst sie, wenn sie fehlt.«
BlackRock ist sich der Gefahr durchaus bewusst. Im Herbst
2014 stellte BlackRock ein Thesenpapier auf die
hauseigene Webseite. Die Autoren – darunter Richie Prager
– erklärten darin den Handel mit Anleihen schlicht für
»kaputt«. Es sei höchste Zeit für eine Generalüberholung
dieses Markts. Der Titel des Werks, »Marktstruktur
Unternehmensanleihen: Die Zeit für Reformen ist jetzt«,
liest sich zwar wie die banale Überschrift eines
Parteiprogramms. Doch in der Branche sorgten BlackRocks
Forderungen für fast so viel Aufregung wie Luthers Thesen
zu Wittenberg. »Bereiten Sie sich auf den kommenden
Anleihe-Crash vor«, warnte die Financial Times. Motto:
Wenn schon BlackRock nervös wird, dann muss der Rest
der Welt mit dem Schlimmsten rechnen. Und der
Nachrichtendienst Bloomberg fragte: »Was ist schlimmer?
Wenn große Banken den Markt erschüttern oder große
Anleiheinvestoren?« Geht es nach der Vorstellung von
BlackRock, würde die Rolle der Banker als Mittelsmänner
drastisch reduziert, das heißt die Anleihen möglichst
standardisiert werden, sodass sich die Papiere ähnlich wie
Aktien problemlos elektronisch handeln lassen würden.
Dies würde letztlich Anleihen, also Kredite, handelbar
machen wie Aktien. Und damit die Liquidität erhöhen.
Doch das ist derzeit ungefähr so weit von der Umsetzung
entfernt wie die Menschheit von der Marslandung – nicht
unmöglich, aber äußerst schwierig.
BlackRocks Vorstoß muss man als Defensivmaßnahme
verstehen. Für den Koloss unter den Geldverwaltern ist
ohne Zweifel ein funktionierender Anleihemarkt von
allergrößter Wichtigkeit. Wie sonst kann er seiner
grundlegenden Aufgabe nachkommen und das Geld seiner
Kunden bewegen? Und – Worst Case – was wäre im Fall
eines Crashs, der dann womöglich die gesamten Märkte
mitreißt – ähnlich wie bei den Geldmarktfonds und der
Lehman-Pleite? Probleme am Anleihemarkt sind absehbar
und werden sich, darin sind sich alle Beteiligten einig, noch
verschärfen, sobald die Zinsen wieder anziehen. Wenn
Marktteilnehmer wie BlackRock, Pimco oder Vanguard
künftig größere Positionen an Anleihen schnell abstoßen
müssen, wird es eng werden, zumindest aber werden
mangels Abnehmern die Preise verfallen. Kein Wunder,
dass man im BlackRock-Hauptquartier auf Abhilfe sinnt.
Wenn nicht vorher Schlimmeres passiert. Das trockene
Holz ist da – fehlt nur noch der Zündstoff. So angespannt
war die Lage im Frühjahr 2015, dass Anleihehändler
beunruhigt waren, wenn sie während der Handelszeit mal
austreten mussten – was, wenn in ihrer Pinkelpause die
Kurse wegbrachen?
Eine Vorwarnung erhielten Investoren bereits – allerdings
nicht im Markt für Unternehmensanleihen, sondern bei den
US-Staatsanleihen. Ausgerechnet an dem Markt, der
weltweit als die sicherste Zuflucht der Anleger gilt. Am
Morgen des 15. Oktobers 2014 brachen die Renditen der
10-jährigen Staatsanleihen scharf ein. Eine solch heftige
Bewegung am Anleihemarkt hatte es zuletzt vor 20 Jahren
gegeben. Fondsmanager sahen fassungslos auf ihre
Bildschirme, ein Händler gestand dem Nachrichtendienst
Bloomberg, er habe schlicht den Stecker seines Computers
gezogen. Als Auslöser für den Einbruch machten
Marktteilnehmer erst einmal schlechte Zahlen aus dem
amerikanischen Einzelhandel aus. Doch das erklärt nicht
die Ursache. Je mehr Investoren und Regulierer den Crash
analysierten, desto besorgter wurden sie. Bald schrillten
die Alarmglocken an oberster Stelle: Solche Einbrüche
stellten eine wachsende Gefahr für das Finanzsystem dar,
erklärte im November 2014 das US-Finanzministerium.
Über den Grund redete man in Washington allerdings nicht
gerne: Jahre nach der Finanzkrise griffen nun die
strengeren Kapitalvorschriften und Einschränkungen für
den Eigenhandel. Mit der Folge, dass das Risiko sich an die
brisanteste Stelle der Märkte verlagert: an den Markt für
US-Staatsanleihen.
Vor den Reformen konnten sich Finanzkonzerne und
Großinvestoren – vor allem Pensionskassen,
Investmentfonds, Hedgefonds – darauf verlassen, an dem
12 Billionen Dollar schweren Markt für US-Staatspapiere
immer einen Abnehmer oder Anbieter für ihre Anleihen zu
finden. Im Zweifel standen die Banken als Handelspartner
zur Verfügung. Ihre Handelsabteilungen lieferten das
Schmiermittel, das den Markt reibungslos laufen ließ. Bei
Gefahr konnten Anleger weniger sichere Werte abstoßen
und sich in den US-Anleihemarkt zurückziehen. Allein diese
Tatsache, dass die Großanleger im Zweifel immer auf den
US-Anleihemarkt gehen konnten und dort Abnehmer für
ihre Papiere finden würden, übte eine beruhigende
Wirkung auf die internationalen Marktteilnehmer aus. Doch
diese Präsenz wird den Banken zu teuer. »Für jeden Bond
muss der Händler praktisch eine Gegenbuchung
vornehmen«, klagt der Manager einer großen US-Bank.
Der Crash, von dem außerhalb der Finanzbranche so gut
wie niemand Notiz nahm, zeigte plötzlich, dass diese
Zuflucht zumindest infrage gestellt ist. Dafür sind neue
Mitspieler in den Markt gekommen: Blitzhändler mit
superschnellen Computern, die von kurzfristigen
Spekulationen profitieren und schon am Aktienmarkt im
Verdacht stehen, Crashs auszulösen. Die
Schnellfeuerhändler ziehen ihr Kapital blitzschnell aus dem
Markt zurück, wenn die Ausschläge zu heftig werden.
Genau dann also, wenn es gebraucht wird. So tragen
ausgerechnet die strengeren Regeln für Banken – populär
bei Wählern und Steuerzahlern – zur Crashgefahr bei.
BlackRock in allen Winkeln des Markts
»BlackRock ist überall«, hört man im Vertrauen Banker,
Börsianer, Regulierer sagen. Teils ist es Klage, teils
unverhohlene Bewunderung. »Wenn wir jetzt in die Küche
gehen, dann finden wir bestimmt jemand von BlackRock,
der uns in die Suppe spuckt«, witzelt ein Wall- StreetVeteran beim vertraulichen Lunch. In nur wenigen Jahren
hat es Larry Finks Truppe geschafft, in fast alle Winkel des
Kapitalmarkts vorzudringen. Wäre BlackRock ein
Wasserkonzern, dann würde er Haushalte und
Unternehmen überall in der Welt versorgen. Er würde
Kläranlagen, Reservoire und Kanäle betreiben, Dämme
errichten und an Schleusen kassieren, wäre aktiv von der
Hochseeschifffahrt bis zur Dampfturbine. In vielen
Bereichen – als direkter Kreditgeber für Unternehmen, als
Aufkäufer von Online-Privatkrediten, Betreiber eines
hauseigenen »Dark-Pools«, als ETF-Sponsor – ist BlackRock
nicht bloß aktiv, sondern formt sie kraft seiner
Marktdominanz neu oder – wie bei der Generalüberholung
der Anleihemärkte – versucht es zumindest nach Kräften.
Kein Wunder, dass die Finanzwelt beunruhigt ist. »Wir
beobachten BlackRock ganz genau«, sagt ein führender
Mitarbeiter bei Goldman Sachs. Und selbst er kann sich
eine gewisse Anerkennung für den gerade mal 25 Jahre
alten Start-up-Rivalen nicht verkneifen. Doch all diese
Verschiebungen und Veränderungen gehen weitgehend an
der Öffentlichkeit vorbei.
Jetzt könnte man dieses alles – die ETFs als neue Chips
für die Finanzjongleure, die wachsenden
Schattenbankaktivitäten, die privaten Börsen und Dark
Pools – als etwas sehen, das die Amerikaner gerne »Inside
Baseball« nennen. Eine Fülle von Details, die nur die Fans
dieser als Sportart getarnten Ansammlung von Statistiken
interessieren. Ist es nicht herzlich egal, ob Goldman Sachs
oder Deutsche Bank am Drücker sind oder BlackRock?
Nein, ist es nicht. Denn es geht um mehr als Rivalitäten der
Geldelite untereinander. Bei BlackRocks Umgestaltung der
Märkte geht es darum, wie das Finanzsystem künftig seine
eigentliche Rolle spielt, nämlich wie es unsere reale
Wirtschaft am Laufen hält. Es geht nicht um Boni und Egos,
sondern um die Finanzierung von Unternehmen,
Kommunen, Regierungen. Es geht darum, wer die
Konditionen dafür bestimmt. Und welche Risiken dabei
entstehen. Eines steht fest: BlackRock spielt bei all diesen
Veränderungen nicht nur eine große Rolle, sondern eine
Rolle in der Übergröße XXL.
Und doch ist die Transformation des Finanzmarkts nur
eine Baustelle des Schwarzen Riesen. Fink und sein Koloss
sind darüber hinaus Treiber und Speerspitze einer noch
weit tieferen Veränderung. Diese betrifft die Unternehmen
selbst und letztlich unser gesamtes Wirtschaftssystem.
Kapitel 7
Finanzkapitalismus 2.0
Der Besuch des New Yorker Finanzmagnaten wurde in
London mit Spannung erwartet. So groß sei seine
Bedeutung für die City, schrieb ein Reporter, dass einige
Vertreter der Finanzwirtschaft sogar bei Lloyd’s eine
Versicherung auf dessen Leben abgeschlossen hätten. Der
Mann kontrolliere oder beeinflusse heute mehr Geld und
Interessen als jeder andere auf der Welt. »Niemand kann
abschätzen, vielleicht nicht einmal er selbst, welche
Verantwortung und welche Bedeutung diese Macht hat«,
heißt es in dem Bericht. Dabei sei der 64-Jährige noch vor
25 Jahren an der Wall Street nahezu unbekannt gewesen.
»Heute verfügt er über fast so viel Einkommen und
Ausgaben wie das deutsche Kaiserreich.« Die Rede ist von
John Pierpont Morgan. Erschienen ist der Artikel 1901 in
McClure’s Magazine, einer der ersten investigativen
Publikationen, anlässlich eines Besuchs des New Yorker
Bankiers in Großbritannien. Kaum angekommen kaufte er
die Schifffahrtslinie Leyland, die immerhin 38
Dampferlinien im Atlantik unterhielt, und verleibte sie
seinem Imperium ein. Dass der Neuankömmling so eine
massive Transaktion quasi en passant, als »Ferienspaß«
abwickelte, habe die Briten geschockt, schreibt der Autor,
denn es bestätige ihre Befürchtungen, dass Morgan die
englische Vorherrschaft in der Seefahrt im Visier habe.
(Tatsächlich gehörte Morgan später zu den Finanziers der
Titanic und hätte eigentlich auf der Jungfernfahrt mit dabei
sein sollen – eine Luxuskabine mit privatem
Promenadendeck war bereits für ihn reserviert. Er sagte im
letzten Augenblick ab, um länger in Aix-les-Bains, einem
Kurort im französischen Jura, zu bleiben.)
Ein Geldfürst für ein neues Zeitalter
Ohne den New Yorker Banker sähe die Welt anders aus.
Amerika verdankt ihm seine großen weltbeherrschenden
Industriekonzerne – wie etwa US Steel, General Electric,
AT&T, Westinghouse, Portland Cement. Er ist der Ahnherr
von Amerikas größtem Bankenkoloss JPMorgan Chase
sowie der Investmentbank Morgan Stanley. Vor allem aber:
J. P. Morgan begründete jenen Finanzkapitalismus, dessen
Erbe Larry Fink ist. Anders als Zeitgenossen, wie der
Stahlmagnat Andrew Carnegie, war Morgan kein SelfmadeMann. Er stammte aus einer wohlhabenden
Bankiersfamilie. Die Morgans kamen bereits 1636 in
Neuengland an. Sie kämpften im Unabhängigkeitskrieg auf
der Seite der Revolutionäre. Morgans Großvater war noch
Farmer gewesen, er hinterließ vorteilhaften Grund und
Boden in Connecticut. Morgans Vater, Junius Spencer
Morgan, wurde Banklehrling und arbeitete später für die
Peabody, Mitglieder des neuenglischen Geldadels. Weil er
als Kind an rheumatischem Fieber litt und zeitweise nicht
mehr laufen konnte, wurde der kleine J. P. zur Erholung auf
die Azoren geschickt. Wie viele amerikanische
Elitesprösslinge kam er später zur Ausbildung nach
Europa. Im Schweizer Bellerive lernte er Französisch, dann
studierte er Kunstgeschichte an der Universität Göttingen
und verbrachte einige Zeit in Wiesbaden. Sein Deutsch sei
passabel gewesen, heißt es.
Morgans wahre Berufung aber waren Finanzgeschäfte.
Die lernte er, als er 1857 in die Bank seines Vaters
zunächst in London eintrat. Er sei sehr vertraut geworden
mit dem Außen- und Devisenhandel, bemerkt das
McClure’s Magazine. Vor allem aber »sah er das
Kreditsystem in seinen größeren Zusammenhängen«.
Morgan war kein klassischer Banker – er sah sich nicht in
der Rolle des bloßen Kreditgebers. Das Auftreiben von
Kapital war nur ein Mittel zum Zweck. Bald stieg der junge
Banker beim Vater ein – als ebenbürtiger Partner, nicht als
Juniorchef. Morgan, ein massiger Mann, machte Eindruck.
Es sei, wie wenn ein Windstoß durch Gebäude fahre,
berichteten Zeitgenossen. Anders als bei seinem
unauffälligen Nachfolger Larry Fink war alles in seinem
Leben überdimensional. Seine Liebschaften waren
berüchtigt. Jachten waren seine Leidenschaft – je größer,
desto besser. Sein privates Schiff Corsair wurde später von
der US-Kriegsmarine gekauft und im Krieg gegen Spanien
eingesetzt. Er rauchte die dicksten Zigarren – wahre
Herkuleskeulen wie Spötter meinten. Durch eine
Hautkrankheit verformte sich seine Nase aufs Hässlichste
und verfärbte sich violett – worüber sich seine vielen
Feinde gerne lustig machten. Das erklärt, warum es kaum
Fotografien von Morgan gibt – alle offiziellen Porträts sind
retuschiert.
Mehrfach griff Morgan rettend ein, um einen Absturz der
Wall Street und Amerikas zu verhindern. Im Februar 1895
nahm er den Zug von New York nach Washington. Ohne
Voranmeldung erschien er im Weißen Haus und verlangte
den Präsidenten Grover Cleveland zu sehen. Der ließ ihn
zunächst abblitzen. Doch Morgan erklärte, er werde so
lange warten, bis der Präsident ihn empfange. Cleveland
traf sich mit dem Bankier am nächsten Morgen. Der
Präsident hatte keine Alternative. Die USA befanden sich in
einer tiefen Wirtschaftskrise. Das Finanzsystem der USA,
das auf dem Goldstandard basierte, stand vor dem Kollaps.
Morgans Angebot: Er und die Rothschilds würden 3,5
Millionen Feinunzen Gold in Europa kaufen und dafür eine
30-jährige Gold-Anleihe der Staatskasse bekommen.
Cleveland, mit dem Rücken zur Wand, akzeptierte.
»Morgan agierte praktisch wie eine Zentralbank – die es zu
dem Zeitpunkt noch nicht gab«, so der Finanzhistoriker
John Steele Gordon. Und das Eingreifen des Wall-StreetTycoons habe letztlich die Wende für Amerika eingeleitet.
Doch ganz so uneigennützig war die Rettung nicht, denn
auch Morgan profitierte von der Transaktion, die von vielen
Zeitgenossen heftig kritisiert wurde. In seiner satirischen
Geschichte der Vereinigten Staaten It all started with
Columbus fasst Richard Armour die Rolle des umstrittenen
Bankiers süffisant zusammen: »Dieser Morgan ist als J. P.
bekannt, um ihn von Henry Morgan, dem Piraten, zu
unterscheiden.«
Morgan selbst sah sich eher in der Tradition von
Geldfürsten wie der Medicis. Er sammelte leidenschaftlich
Bücher – darunter eine Gutenberg-Bibel – und Kunst. An
der vornehmen Madison Avenue in Manhattan ließ er sich
eine Bibliothek im klassizistischen Stil bauen. Sein
»Studierzimmer«, heute für neugierige Normalverdiener
zugänglich, hätte einem Renaissancefürsten alle Ehre
gemacht. Scharlachroter Damast bespannt die Wände, die
ausladenden Sofas mit rotem Samt bezogen. Die
geschnitzte Holzdecke ließ Morgan aus einem Florentiner
Palast herschaffen, die Fenster zieren
Originalglasmalereien aus mittelalterlichen Kirchen.
Daneben hängen Originale von Memling, Tintoretto und
Cranach, über die sich jedes Museum freuen würde. Im
Kamin ließe sich bequem ein Ochse grillen. Für Morgans
Schreibtisch, an dem er in seinen späteren Jahren gerne
saß und in seinen Schätzen aus seiner Bibliothek blätterte,
ging gut und gerne ein Eichenhain drauf. Hier sperrte
Morgan am 2. November 1907, in einer windigen
Samstagnacht, die 50 wichtigsten Banker und Finanziers
von New York ein.
Denn 1907 spielte Morgan erneut die Rolle des Captain
America. Damals gab es eine Finanzkrise, die in
wesentlichen Zügen der Krise von 2008 ähnelt. Ein WallStreet-Haus, Moore and Schley, hatte sich bei Investments
verkalkuliert, die Gläubigerbank drohte, die Kreditlinien
fällig zu stellen. Wenn Moore and Schley gefallen wäre,
hätten die vielfältigen Kreditverbindungen mit den anderen
Wall-Street-Häusern einen Kollaps vieler weiterer zur Folge
gehabt. Das gesamte Finanzsystem wäre mitgerissen
worden – worunter auch Morgans Imperium zu leiden
gehabt hätte. Da half Morgan aus. Selbst sein Vermögen
hätte allerdings nicht ausgereicht. Und so trommelte er in
jener Nacht die Wall-Street-Spitzen zusammen. Erst als
diese zusagten, das notwendige Rettungskapital zu stellen,
schloss Morgan die schweren Flügeltüren wieder auf.
Draußen dämmerte es bereits.
Ohne Morgans Eingreifen wären die USA erneut in eine
Finanzkrise gestürzt. Seine Gegner ließ das jedoch nicht
verstummen. Noch 25 Jahre nach Morgans Tod schrieb der
Schriftsteller John Dos Passos bitterböse: »Krieg und Panik
an der Börse, Maschinengewehrfeuer und Brandstiftung,
Konkurse, Kriegsanleihen, Hunger, Läuse, Cholera und
Typhus, das ist Wachstumswetter für das Haus Morgan.«
Damit spielte Dos Passos unter anderem auf die Anfänge
von Morgans Laufbahn an, der gute Geschäfte mit den
amerikanischen Bürgerkriegsparteien machte. Dann aber
entdeckte Morgan die Eisenbahnen. Sie waren die
Internetaktien seiner Zeit, Morgan sah das Potenzial. Die
Eisenbahn erst schuf den US-Binnenmarkt. Die
Gesellschaften konkurrierten heftig um neue Strecken und
Güter, hatten einen fast unerschöpflichen Kapitalbedarf
und verspekulierten sich darum häufig. Das war die
Gelegenheit für den Finanzier mit unternehmerischem
Ehrgeiz. Er spezialisierte sich auf Fusionen und
Übernahmen, für die er das Kapital organisierte. Die
neuentstandenen Konglomerate kontrollierte er, indem er
Anteile behielt. Es gab an der Wall Street bald ein Wort für
das, was den übernommenen Unternehmen widerfuhr: Sie
wurden »morganisiert«. Zwar kann John D. Rockefeller mit
seiner Standard Oil für sich in Anspruch nehmen, der
größte Monopolist seiner Zeit gewesen zu sein. 90 Prozent
des in den USA geförderten Öls lief damals durch seine
Raffinerien. Damit scheffelte er ein Vermögen, das bis
heute unerreicht ist. Es entsprach schließlich 1,5 Prozent
der amerikanischen Wirtschaftsleistung oder 340
Milliarden Dollar in heutigen Verhältnissen. Angeblich soll
Rockefeller, als er nach Morgans Tod erfuhr, der Bankier
habe seinen Erben »nur« 80 Millionen Dollar hinterlassen,
ungläubig ausgerufen haben: »Und zu denken, dass er
nicht einmal reich war!« Doch Morgan ging es um mehr als
Reichtum, sein Einfluss auf die gesamte Wirtschaft reichte
viel weiter als die Rockefellers. Morgan schaffte es, Kapital
in Dimensionen zu organisieren, wie es kein Mensch vorher
getan hatte.
Jener Besuch 1901 in London, der die Aufmerksamkeit
des Mc-Clure’s-Reporters weckte, folgte auf Morgans
legendären Kraftakt: die Schaffung von US Steel. So ein
Unternehmen hatte es noch nie gegeben. Es hatte Kapital
von über 1 Milliarde Dollar und 250 000 Beschäftigte –
»eine Million Seelen leben von der Unternehmung, fast
eine eigene Nation«, kommentiert McClure’s staunend.
Morgan war es gelungen, diesen Koloss wie einen
Frankenstein aus Teilen von schwächelnden Stahlkochern
zusammenzubauen. In einem geheimen Pakt hatte er
schließlich Carnegie überzeugen können, ihm für 480
Millionen Dollar dessen Stahlunternehmungen zu
überlassen. US Steel sollte die damals führenden Mächte
im Stahlgeschäft – Großbritannien und Deutschland –
angreifen. Ziel war es aber nicht nur, das Stahlgeschäft,
sondern gleich den ganzen Infrastrukturmarkt zu
beherrschen. Es waren die Gründerjahre Amerikas – der
Bedarf an Brücken, Schiffen, Eisenbahnen, Stahlträgern
schien unerschöpflich. US Steel war Morgans Meisterwerk.
Der Konzern kocht heute trotz aller Pleiten und Krisen
noch immer Stahl in seinen Werken.
Morgan nutzte seine Position als Kapitalgeber, um aktiv
Einfluss auf die Unternehmen zu gewinnen. »Wenn ein
Banker einmal einen Sitz im Verwaltungsrat ergattert hat,
wird er zäh an ihm festhalten und sein Einfluss wird
normalerweise dominieren, denn er kontrolliert den
Nachschub an frischem Geld«, ätzte der Zeitgenosse Louis
Brandeis in seinem Werk Other People’s Money. Brandeis
war Richter am Obersten Gerichtshof und ein vehementer
Kämpfer gegen Kartelle und Monopole, also Morgans
Nemesis. Morgan und eine Handvoll New Yorker Banker
kontrollierten damals praktisch die Geschäfte aller großen
US-Unternehmen ihrer Zeit. Vertreter von J. P. Morgans
Bankhaus hatten zeitweise 72 Direktorenposten bei 47
Großunternehmen inne. Er habe nichts gegen »ein
bisschen Konkurrenz«, sagte Morgan herablassend, als er
bei einer Untersuchungskommission nach
Monopolbestrebungen gefragt wurde. Das wurde zum
geflügelten Wort. Eine Karikatur zeigt Morgan mit
Knollennase, dicker Zigarre und noch dickerem Bauch,
neben ihm steht ein volles Glas, so hoch wie ein Fass und
eine Flasche, enorm wie ein Tank, darauf das Etikett:
»Monopol-Whisky«, daneben ein geradezu winziges
Sodafläschchen mit der Aufschrift »Wettbewerb« – ein
Spritzer davon würde den Monopol-Drink wohl kaum
verdünnen. Von Wettbewerb hielt Morgan tatsächlich nicht
allzu viel. Seine Vertreter saßen zum Beispiel sowohl im
Verwaltungsrat bei General Electric als auch bei dessen
Rivalen Westinghouse. Ähnliche Überkreuzverbindungen
gab es auch bei Eisenbahnen. Vom Standpunkt der Banker
hatte ein Wettbewerb »Linke Tasche gegen rechte Tasche«
nicht viel Sinn.
Aufstand der Manager
Ein Nebeneffekt von Morgans Einfluss war, dass New York
zur Hauptstadt des Kapitals wurde. Großindustrielle zog es
an den Hudson, weil sie in der Nähe des Finanziers sein
wollten. Für sie war es ein goldenes Zeitalter, sie bauten
sich Paläste nach den Vorbildern der Aristokratie. Wer die
Fifth Avenue hinunterschlendert, kann einige heute noch
finden. Bevor sich Eisenbahnerbe George Vanderbilt II
seinen Landsitz »Biltmore« mit 250 Zimmern,
Zentralheizung, Swimming Pool und Bowlingbahn bauen
ließ, tourte er zu den Schlössern der Loire. Die SocietyLady Mrs. Stuyvesant Fish gab eine rauschende Party für
ihren Hund, der zu der Gelegenheit mit einem 15 000Dollar-Diamant-Halsband erschien. Das war mehr als das
Zehnfache des mittleren Jahreseinkommens der großen
Mehrheit der Amerikaner damals. Die Arbeiter lehnten sich
auf, allein in den 1880er Jahren kam es zu mehr als
tausend Streiks. Immer wieder gab es brutale
Auseinandersetzungen mit Toten und Verletzten. Nach
einem Anschlag in Chicago, bei dem ein Polizist ums Leben
kam, wurden vier rebellierende Arbeiter aufgehängt. Den
Höhepunkt markierte der Streik bei der Pullman Palace Car
Company, am besten bekannt für ihre luxuriösen
Schlafwagen, ausgestattet mit Polstermöbeln, einer
Bibliothek und allem Komfort, in denen die Oligarchen
bequem durchs Land reisten. Das Unternehmen gehörte
gleichzeitig zu den größten Eisenbahngesellschaften.
Während der Rezession 1894 senkte Pullman die Löhne und
erhöhte die Mieten in seiner Arbeiterkolonie. 240 000
Arbeiter in 26 Bundesstaaten streikten daraufhin. Die
Unternehmensmanager holten sich die Unterstützung von
Regierungstruppen, die die Proteste niederschlugen. Viele
Streikenden wurden verhaftet und landeten auf schwarzen
Listen. Sie fanden keine Jobs mehr. Die amerikanische
Arbeiterbewegung kam erst 50 Jahre später wieder in
Gang.
Nicht nur in den Städten, wo die Arbeiter in
Mietskasernen eingepfercht waren, wuchs der Widerstand.
In North Dakota kam es zur offenen Revolte gegen die New
Yorker »Raubtierspekulanten«, die nach Ansicht der
Einheimischen die Farmer dort ruiniert hatten. Um sich
dem Wall-Street-Einfluss zu entziehen, gründete North
Dakota schließlich 1919 eine staatliche Bank, die es bis
heute gibt (und die von Aktivisten immer wieder als Vorbild
angeführt wird). Zwar wurde die Arbeiterbewegung
niedergeschlagen, aber unter dem wachsenden politischen
Druck begann Washington, erst mit Regulierungen und
dann mit Gerichtsverfahren gegen die Kartelle und Trusts
vorzugehen.
Doch die Umwälzung ging schließlich von den
Unternehmern aus, nicht von den Arbeitern. Die
Unternehmenslenker schüttelten nach und nach die
Kontrolle der Banker ab. Dabei half den Konzernlenkern,
dass Wertpapiere in Amerika schon bald nicht mehr nur
den Reichen und gut Vernetzten vorbehalten blieben. Die
ersten Wertpapiere, die von breiten Bevölkerungsschichten
gekauft wurden, waren Kriegsanleihen – also
Staatsschuldpapiere. Denn um den Ersten Weltkrieg zu
finanzieren, verkaufte der US-Fiskus Kriegsanleihen – die
»Liberty Bonds« – nicht nur an schon bewährte Investoren
wie die Banken oder große Privatinvestoren, sondern auch
an Kleinanleger. Reklameposter und Auftritte von Charlie
Chaplin, aber auch Organisationen wie die Boy Scouts
machten auf das neue Angebot aufmerksam und
appellierten vor allem an den Patriotismus. Die Strategie
hatte Erfolg. Von den 23 Millionen Amerikanern, die in die
so genannten »Liberty Bonds« investierten, waren viele
erstmalige Wertpapierbesitzer. Das neu gewonnene
Vertrauen in solche Geldanlagen übertrugen die
Amerikaner auf die großen amerikanischen Unternehmen
wie General Electric, AT&T und die neuen Autohersteller
Ford, General Motors und Chrysler.
Morgan und seine Finanziers wurden von der neuen
Kaste der Manager abgelöst. Zwar sah man nach wie vor
überwiegend die gleichen Gesichter in den Aufsichtsräten
(sie sind bis heute überwiegend weiß und männlich), doch
ihren Einfluss verdankten sie ihrer Zugehörigkeit zur
herrschenden Elite, nicht ihrem Zugang zum Kapital. Hier
trennen sich erst einmal die Wege Amerikas und Europas.
Auf dem alten Kontinent entwickelte sich nie breit
gestreuter Aktienbesitz und börsenfinanzierte
Unternehmen blieben eine Minderheit. (Deutschland hat
nur 700 börsennotierte Unternehmen und damit weniger
als Pakistan.) Bis heute sind Unternehmen in Europa
mehrheitlich bankenfinanziert.
Wie BlackRock der neue J. P. Morgan wurde
Der Finanzkapitalismus aus Morgans Goldenem Zeitalter
erlebt eine Wiedergeburt. Nur die Dimensionen sind
gewaltiger geworden. Statt Banker sind es nun die
Vermögensverwalter, die das System beherrschen.
»Finanzkapitalismus 2.0«, nennt es Gerald Davis von der
University of Michigan in einem Thesenpapier, das er 2012
vorstellte. Oder: »Wie BlackRock der neue J. P. Morgan
wurde«. Sowohl die Protestierer von Occupy als auch die
Mitglieder der Tea Party sind sich sicher: Die Schuld an der
derzeitigen sozialen Ungleichheit und der wirtschaftlichen
Unsicherheit, unter der Normalverdiener leiden, ist bei Big
Business zu suchen. Das Gegenteil ist der Fall, sagt Davis.
Die Macht der Großkonzerne sei gebrochen.
Finanzkapitalisten regierten wieder. Und genau deshalb
schwinden Arbeitsplatzsicherheit und soziales Netz.
Hätte man es darauf angelegt, man hätte den Kreis nicht
besser schließen können. Die börsennotierten
Großkonzerne, die J. P. Morgan einst mit angeschoben
hatte, wurden das Fundament des Wirtschaftsbooms in den
50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie waren
die Basis für die wachsende Mittelschicht. In den 1970er
Jahren arbeitete einer von zehn Amerikanern für einen der
25 US-Großkonzerne. Sie stellten Millionen Arbeitsplätze
für »Average Joe«, den amerikanischen Otto-NormalVerbraucher. Der besaß bald Kühlschränke von General
Electric, den Telefonanschluss von AT&T, das Auto von
General Motors oder Chrysler, ausgestattet mit Reifen von
Goodyear und betankt bei Standard Oil oder Texas, aß
Lebensmittel von General Foods (später Kraft) und
verwendete Kosmetikartikel von Procter & Gamble. Das
war der »American Way of Life«: Das kleine Haus auf
eigenem Grundstück, ein Auto, zwei Kinder, und die
Möglichkeit, diesen eine vernünftige College-Ausbildung zu
bezahlen. Wer bei den Schwergewichten zudem angestellt
war, kam in den Genuss von firmeneigenen
Krankenversicherungspaketen und Altersvorsorge. Auch
das unterscheidet Amerika bis heute von Europa – in der
alten Welt übernimmt vorwiegend die Allgemeinheit die
Sozialleistungen. Die Großzügigkeit der US-Arbeitgeber
war allerdings Kalkül – sie wollten sich durch die
Sozialleistungen ihre Macht sichern.
Doch dann kamen die Globalisierung und vor allem die
Öffnung Chinas. Der Erfolg der US-Großkonzerne nach
dem Zweiten Weltkrieg führte zu der Überzeugung, nicht
nur den heimischen Markt spielend zu beherrschen,
sondern auch global problemlos in Führung gehen zu
können. So drängte die US-Wirtschaftsvertretung darauf,
den chinesischen Markt für ihre Interessen zu öffnen. Der
Wendepunkt kam 1972 mit dem Besuch Nixons, eines
erklärten Kommunismusverächters, in China – ein
Wendepunkt, den der amerikanische Komponist John
Adams sogar in einer Oper verewigte. (»Als ich die Hand
von Chou En-lai schüttelte, auf dem kahlen Feld vor Peking,
lauschte die Welt«, singt Nixon in seiner Arie im ersten
Akt.) Beijing, damals im Westen noch als Peking bekannt,
zeigte sich interessiert. Es kam ganz anders, als die
Konzernlenker sich das vorgestellt hatten: Die Chinesen
nutzten die Öffnung, um ihrerseits die USA mit billigen
Konkurrenzprodukten zu fluten. Plötzlich wurden die
Sozialleistungen für die Arbeiter und Angestellten zum
teuren Nachteil im internationalen Ringen um
Marktanteile. General Motors etwa war vor dem Konkurs
2009 der größte private Gesundheitsversorger der USA –
bis zu eine Million GM-Arbeiter, GM-Rentner und deren
Angehörige hingen an dem Autohersteller. Das kostete GM
bis zu 1 400 Dollar zusätzlich pro Auto.
Und so begannen die Unternehmen nach Möglichkeiten
zu suchen, sich aus der Verantwortung zu winden. Es war
ein günstiger Zeitpunkt: Ronald Reagan mit seinem
Cowboy-Marktwirtschafts-Credo war Präsident. Der Staat
half den Unternehmen, indem er individuelle Sparpläne
förderte, die nach der Anfang der 1980er Jahre erlassenen
entsprechenden Steuervorschrift 401(k) genannt werden.
Der gravierende Unterschied zu den Betriebskassen, die
bis dahin jahrelang das dominierende Modell waren: Die
Rente wurde nicht länger vom Arbeitgeber garantiert.
Nach dem neuen Modell zahlt der Arbeitgeber lediglich
Beiträge oder Zuschüsse für die individuellen Sparpläne –
und in Krisenzeiten kann er sogar das einstellen. Das
Risiko wandert so vom Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer.
Die 401(k)-Sparpläne machten aus »Average Joe« und
»Average Jane« mehr oder minder unfreiwillige Teilnehmer
des Aktienmarkts. Diese neuen Aktionäre waren ganz
anders als die Wall-Street-Profis oder die wohlhabenden
Erben der Bostoner Brahmanen. Überwiegend vertrauen
sie ihre Ersparnisse fürs Alter Investmentfonds an – am
liebsten großen und bekannten Gesellschaften wie Fidelity,
Pimco oder Vanguard oder später eben BlackRock. Das war
der Beginn des Aufstiegs der Vermögensverwalter. In den
1950er Jahren fanden sich rund 100 Fonds mit etwa einer
Million Anteilseignern in den USA. Heute sind es mehr als
10 000 Fonds. 1989 – knapp zehn Jahre nach Einführung
der 401(k) – Sparpläne – verwalteten die privaten USInvestmentfonds bereits über 1 Billion Dollar. 2014 waren
es rund 15 Billionen Dollar und damit fast vier Mal so viel
wie das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland.
Das ist eine massive Konzentration des Kapitals in den
Händen von Fondsmanagern. Gerald Davis, Kritiker des
Finanzkapitalismus 2.0, hat ausgerechnet, dass 2010 rund
75 Prozent der Aktien der 1 000 größten Unternehmen von
institutionellen Anlegern gehalten werden. Und BlackRock
gehörten bereits 2011 mindestens 5 Prozent der Aktien von
mehr als 1 800 US-Unternehmen. BlackRock war nach
Davis’ Berechnungen damals der größte Einzelaktionär bei
einem von fünf Unternehmen, Fidelity der größte
Einzelaktionär bei jedem zehnten US-Unternehmen. »Nicht
einmal auf der Höhe des Finanzkapitalismus Anfang des 20.
Jahrhunderts war das Unternehmenseigentum auf so
wenige Finanzinstitutionen beschränkt«, schreibt Davis.
Relativ gesehen hat Larry also den alten J. P. längst
überholt.
Shareholder Value: Die andere 68er-Revolution
Inzwischen ist die Fixierung von Managern auf
Gewinnmaximierung und endlose Kostenreduzierung, auf
Wettbewerbsvorteile und Marktanteile derartig verbreitet
und verinnerlicht, dass es scheint, als habe es nie etwas
anderes gegeben, als seien sie ursprüngliche Bestandteile
des Kapitalismus. Doch dies ist Ergebnis einer Revolution,
die vor mehr als 40 Jahren begann: die Shareholder-ValueRevolution. Eine Bewegung, die Unternehmen, Wirtschaft
und Gesellschaft mindestens so grundlegend verändert hat
wie die 68er. Während Studenten in den frühen 1970ern
mit Protestplakaten über den Campus von Harvard liefen,
trugen ihre Kommilitonen aus der Betriebswirtschaft, die
Anhänger der Revolution des Kapitals, Fallstudien in ihren
Aktenmappen. Corporate America, von wo die Bewegung
ausging, steckte damals in einer tiefen Krise, es war der
Anfang der Globalisierung und der Konkurrenz aus den
Billiglohnländern. Gleichzeitig hatten der Ölschock und die
folgende Inflation die Kosten explodieren lassen, die
Gewerkschaften verlangten zum Ausgleich höhere Löhne.
Auf die neuen Herausforderungen reagierten die CEOs mit
einer massiven Fusions- und Aufkaufwelle. Aus Betrieben
wurden weltumspannende Konglomerate, nicht selten mit
Produkten, die nichts miteinander zu tun hatten. Die
Aufkäufe blähten die Verwaltungen auf, nur wenige
erzielten die versprochenen Gewinne.
Es schlug die Stunde der Berater. Die wurden oft gegen
den Willen des Managements angeheuert: von den
unzufriedenen Eigentümern, den Anteilseignern. Mit ihren
strikten Analysen sollten die Rechenknechte Ineffizienz und
mögliche Sparmaßnahmen aufspüren. Die Boston
Consulting Group, McKinsey & Co. und Bain & Company –
einstiger Arbeitgeber des gescheiterten
Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney – gehörten zu den
Kaderschmieden. Hier begannen viele der jungen
ehrgeizigen Business-School-Absolventen ihre Karriere. Sie
fanden für Unternehmen heraus, was ihr Markt war oder
wo sie im Vergleich zur Konkurrenz standen und wo sie
ihre größten Wachstumschancen finden würden. Es war vor
allem Fleißarbeit: Informationen von Mitarbeitern,
Lieferanten, Kunden sammeln, durch Rechnungen und
Aufträge sieben und schier endlose Riemen von Daten in
die noch groben Rechenprogramme der Zeit einspeisen.
(Hier wurden die Grundlagen für die spätere
Digitalisierung geschaffen.) Die Berater wechselten oft in
die von ihnen betreuten Unternehmen und verhalfen so den
Ideen des Shareholder Values in den 1980er und 1990er
Jahren zum Durchbruch.
Konsequente Fortsetzung der Beraterdenke sind die
Private-Equity-Gesellschaften, in Deutschland besser als
Heuschrecken bekannt, die ebenfalls zu dieser Zeit ihren
Siegeszug begannen. Statt die Unternehmen nur zu
beraten, haben die Rechenknechte diese dabei gleich
übernommen – oder zumindest Teile aus den
Konglomeraten herausgelöst. Denn obwohl die Berater
satte Honorare kassierten, ging bei Erfolg der Hauptanteil
der Gewinne an die Eigentümer, die Aktionäre. Stattdessen
machten die Firmenjäger die Unternehmen mithilfe der
Beratermethoden, sprich Kostendrücken, profitabel und
stießen sie anschließend mit Gewinn wieder ab. Die WallStreet-Finanziers hatten ebenfalls mit Übernahmen gutes
Geld verdient. Doch das hieß zumeist, dass die
übernommenen Unternehmen »finanzoptimiert« wurden –
ihnen wurden etwa neue Schulden aufgebürdet oder ihre
Reserven wurden flüssig gemacht –, alles zugunsten der
neuen Eigentümer. (Es gab Spezialisten wie Robert S.
Miller, der sich den Ruf verdiente, ein
»Pensionskassenknacker« zu sein, indem er bei
angeschlagenen Industrieunternehmen einstieg und deren
Betriebsrentenpläne abwickelte.) Um das eigentliche
Geschäft der aufgekauften Unternehmen kümmerten sich
diese Finanzakrobatiker dagegen kaum. Das wurde mit den
Ideen der »Number Cruncher« aus dem Stall von Bain und
Boston Consulting anders – jetzt zogen die Zahlenumdreher
mit ihren Taschenrechnern vom Einkauf über die
Produktion bis zum Vertrieb, um die Vorgänge schlanker
und effizienter zu machen. Die Private-Equity-Formel ist die
Kombination der Wall-Street-Bilanzauspressermethoden
mit denen der Kostenjäger aus der Beraterriege. Es ist die
unerbittliche Anwendung des Shareholder-ValueGedankens in allen Bereichen. Das einzige Ziel von Private
Equity ist die Steigerung des Gewinns der Eigentümer – ob
dadurch Jobs geschaffen oder gestrichen werden, ist
lediglich eine Nebenwirkung. Die Praktiken von Private
Equity hatten einen weitreichenden Einfluss, weit über die
Betriebe hinaus, die von den Private-Equity-Firmen
tatsächlich übernommen wurden. Manager von
Konkurrenten kopierten die Methoden. Aktionäre stellten
ihnen hohe Erfolgsprämien in Form von Aktien in Aussicht.
So sollten die Interessen von Eigentümern und Managern
deckungsgleich werden: Manager sollten nicht nur
Angestellte sein, die ihren Lohn bekamen, selbst wenn sie
das Unternehmen in die roten Zahlen führten – das
Shareholder-Value-Argument galt nun auch für die
Chefetage.
Angefeuert durch neue Technologien wurden
Fabrikhallen und schließlich auch Verwaltungen
»verschlankt«. Der Triumphzug des Shareholder-ValueGedankens blieb auch nicht auf Amerika beschränkt.
Outsourcing in Billiglohnländer war bald auch in
Deutschland gang und gäbe. Die Überzeugungen dahinter
sind weit tiefgreifender als smarte Kosten-Nutzen-Analysen
oder laserartiger Fokus auf Problemlösung. Es ist die Idee
des Shareholder Values, der zufolge der Zweck eines
Unternehmens zuoberst und nahezu ausschließlich ist, dem
jeweiligen Eigentümer oder Aktionär wachsende Profite zu
bescheren. Es ist das Primat des Kapitals.
Keine bleibenden Werte
Und wenn dieses Kapital auf der Suche nach dem
maximalen Gewinn immer flüchtiger geworden ist, dann ist
es auch die Institution des Unternehmens. J. P. Morgans US
Steel und Eisenbahnen brauchten enorme Summen an
Kapital, damit sie es in Schmelzen oder Gleise stecken
konnten, um eine bleibende Organisation aufzubauen.
Heute sind Unternehmen weniger Institutionen als ein
Bündel an Patenten, Logistik und Verträgen. Das sich auch
rasch wieder auflösen kann.
Gerald Davis hat dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Die
Flip-Kamera war das »Must-have-Gadget« um 2007, als
Youtube populär wurde. Damit konnten Privatleute einfach
und schnell Videos drehen, auf ihrem Computer bearbeiten
und Freunden und Verwandten schicken. Die Kamera war
relativ erschwinglich, sie kostete um die 100 Dollar.
»Flipcam« wurde – zumindest für kurze Zeit – zu einem
stehenden Begriff wie »Tesa« oder »Kleenex«. Das
Unternehmen, das die Kamera verkaufte, musste dafür
jedoch nicht eine einzige Fabrikhalle erstellen, geschweige
denn Arbeiter einstellen. Stattdessen bauten asiatische
Subunternehmen die Flip. 2009 hatte der Kamera-Anbieter
20 Prozent des relevanten Markts, aber nur 100
Beschäftigte, berichtet Davis in seiner Fallstudie.
Im selben Jahr verkauften die Gründer ihr Unternehmen
für 600 Millionen Dollar an den Internet-InfrastrukturGiganten Cisco. Zwei Jahre später stellte Cisco den
Vertrieb ein, die Flipcam war tot. Was war passiert? Die
verbesserte Kamerafunktion in den neuen Smartphones
ersetzte die Flipcam – niemand brauchte mehr ein
zusätzliches Gerät. Vom Aufstieg bis zum Ende vergingen
nicht einmal ganz vier Jahre. »Anders als noch der
Untergang eines Unternehmens wie Eastman Kodak, das
über 120 Jahre lang ein großer Arbeitgeber und
gemeinnütziger Spender war, bevor es Konkurs anmelden
musste, hinterließ das Verschwinden von Flip so gut wie
keine Spuren«, so Davis’ nüchternes Fazit.
Um zu erklären, was mit den Unternehmen im
Finanzkapitalismus 2.0 passiert, greift Davis in seiner
Studie auf Begriffe aus der Physik zurück. Die Funktionen
des Unternehmens seien den Fliehkräften des Outsourcings
unterworfen. Dagegen hätten sich die Zentrifugalkräfte, die
einst nach dem Ende der »Morganisierung« für eine
Verteilung der Kapital-Eigentümer auf eine breite
Aktionärsbasis gesorgt hatten, nun umgedreht. Aktien
haben sich über die letzten Jahrzehnte immer mehr in den
Händen von Vermögensverwaltern konzentriert. Diese sind
nicht selbst die Eigentümer – das sind die Anleger ihrer
Fonds oder die Mitglieder der Pensionskassen, die sie
beauftragt haben –, sondern nur Mittelsmänner. Doch sie
sind es, die das investierte Kapital dirigieren. Und das tun
sie mit einem Ziel: Gewinnmaximierung innerhalb relativ
kurzer Zeit. Denn sie stehen selbst unter enormem
Wettbewerbsdruck. Die Fondsherausgeber verdienen nur
dann ihr Geld und können Anleger halten oder neue
hinzugewinnen, wenn ihre Fonds und deren unterliegende
Werte besser abschneiden als der jeweilige Markt und die
Konkurrenz. Während John Pierpont Morgan bei seinen
Anteilskäufen in der Regel eine Strategie verfolgte – und
sei es, der Monopolist der betreffenden Branche zu werden
–, gibt es keine solche einende Stoßrichtung bei den
Beteiligungen der Fondsgesellschaften. Bei den aktiv von
einem Fondsmanager geführten Fonds geht es darum, die
gewinnträchtigsten Unternehmen oder Strategien
auszusuchen. Bei den passiven Fonds wie den iShares von
BlackRock können sie gar nicht bestimmen, welche
Unternehmensanteile die Fonds kaufen oder verkaufen.
Weil der größte Teil der Investitionen in den ETFs von
iShares liegt (über 80 Prozent der Aktien, die BlackRock
hält), folgt das Investment in Unternehmen den
vorgegebenen Aktienindizes. Das heißt, wenn BlackRocks
Kunden mehr Dax-ETFs kaufen, muss BlackRock in mehr
Dax-Unternehmen investieren. Und wenn sie ihre iShareCore-Dax-Anteile wieder abstoßen, dann ziehen BlackRocks
ETFs ihr Kapital wieder ab.
Das hat das Kapital der Unternehmen volatiler gemacht.
Deutlich volatiler. Vor 30 Jahren hielten institutionelle
Investoren ihre Papiere um die fünf Jahre, heute liegt die
normale Haltefrist bei fünf bis neun Monaten. Ein bis zwei
Jahre gelten inzwischen bei den professionellen Investoren
als »langfristig«. Selbst das ist in der Regel zu kurz für
Manager, um fundamentale Umwälzungen in ihrem
Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Die Unternehmen
mussten sich anpassen. Sie müssen ihre Kapitalgeber
pflegen und ihnen die gewünschte Performance im
gewünschten Zeitraum liefern.
Gerne glauben Europäer, besonders die Deutschen, dass
dieses Diktat des Finanzmarkts, dass der
Finanzkapitalismus 2.0 vor allem eine US-Erscheinung ist.
Schließlich spielt die Börse keine zentrale Rolle im
Wirtschaftsgeschehen Deutschlands. Deutsche
Mittelständler finanzieren sich nach wie vor im
Wesentlichen über Bankkredite, weniger über Anleihen.
Die neuen Schattenbanken, der Aufstieg der
Vermögensverwalter, alles Probleme der »Angelsachsen«,
wie deutsche Politiker es gerne erklären. Das ist ein Irrtum.
Aus Sicht des Finanzmarkts ist Deutschland längst eine
Kolonie. Die Akteure sitzen in London und New York. Und
so gesehen ist die deutsche Wirtschaft zwar der
Schauplatz, aber nicht der Ort, wo die Entscheidungen
getroffen werden.
Kapitel 8
Wie BlackRock die Deutschland AG
lenkt
Wenn es einen Ort gibt, der für die deutsche Version des
Industriekapitalismus steht, dann ist das die Villa Hügel im
Essener Stadtteil Bredeney. Begonnen wurde der Bau der
Villa, die man eher ein Schloss nennen könnte, von Alfred
Krupp im Jahr 1870. Bis dahin wohnte der Fabrikantensohn
– wie damals üblich – auf dem Werksgelände. Der erste
Krupp hatte unter anderem mit der Herstellung von
Werkzeug und Münzstempeln mehr schlecht als recht
gewerkelt, doch Alfred schaffte mit Radreifen für die
expandierenden Eisenbahnen den Durchbruch. Mit dem
Erfolg kam der Wunsch nach sozialem Aufstieg – Krupp
wollte mit seiner Familie aus der unmittelbaren Nähe jener
Stahlwerke mit ihrem Ruß und Dreck entfliehen, die
Grundlage seines Wohlstands waren. Nach über drei Jahren
Bauzeit zogen die Krupps endlich ein, da war Bismarck
bereits zwei Jahre Reichskanzler. Der Bau mit seinen 269
Räumen, umgeben von grünen 28 Hektar Park und
Panoramablick, wurde Familiensitz und Repräsentanz der
Ruhrbarone. Alfreds Nachfolger ergänzten den Prachtbau
um Tennisplätze, Reitanlage und eine Kegelbahn. Über 500
Bedienstete sorgten zeitweise für das Wohl der Bewohner.
Man stelle sich Downton Abbey vor, den fiktiven Landsitz
aus der beliebten britischen Serie, nur eben ein paar
Nummern größer. Kruppstahl wurde zum Begriff in der
ganzen Welt, wenn auch nicht immer positiv assoziiert.
Rüstung wurde für den »Kanonen-König« Krupp das größte
Geschäft. Als der letzte Träger des Familiennamens, Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach am 30. Juli 1967 starb,
vermachte er alles der Krupp-Stiftung »für wohltätige
Zwecke«. Die Stiftung wurde Großaktionär des
Stahlkonzerns. Alfried Krupps Vertrauter, Berthold Beitz,
übernahm als Generalbevollmächtigter das Ruder bei
Stiftung und Konzern. Das blieb auch so, als Krupp 1997
trotz Arbeitnehmerprotesten mit dem einstigen Rivalen
Thyssen fusionierte. Beitz, der gerne als der Patriarch der
Deutschland AG oder wegen des Krupp’schen Logos
liebevoll als »Herr der Ringe« bezeichnet wurde, war der
letzte Überlebende jener Ära des »Rheinischen
Kapitalismus«, die von persönlichen Beziehungen und
gegenseitigen Beteiligungen geprägt wurde.
Um die Zeit, als die Bauarbeiter die Villa Hügel
errichteten, wurden auch die Fundamente für die
Deutschland AG gelegt. Es war die Zeit, als die großen
Aktiengesellschaften entstanden. Die Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg war eine Blütezeit der deutschen Wirtschaft.
Zwischen den 250 Großunternehmen der damaligen Zeit
gab es 2286 Beziehungen, wie Paul Windolf in einer Studie
2013 analysierte. So trafen sich die Herren – es sind bis
heute so gut wie ausschließlich Männer in den
einschlägigen Gremien – mehrmals im Jahr. Weil sie als
Direktoren die Interessen verschiedener Unternehmen
gleichzeitig vertraten, so Windolf, wirkte die Clique der
Aufsichtsräte und Vorstände wie ein übergreifendes
Kontrollgremium.
Die zentrale Rolle spielten in dem Netz die Banken, die
Dresdner und besonders die Deutsche Bank. J. P. Morgan
hätte bei einem Besuch in Frankfurt sein System
problemlos wiedererkannt. Carl Klönne etwa war um die
Jahrhundertwende Vorstandsmitglied bei der Deutschen
Bank. Gleichzeitig saß er in den Aufsichtsräten von
Siemens, Allianz, der Rütgerswerke, der Gelsenkirchener
Bergwerks-AG und weiteren 17 Unternehmen.
In den frühen Jahren der Bundesrepublik übernahm der
Deutsche-Bank-Chef Hermann Josef Abs die Rolle des
Primus inter Pares. Abs saß während seiner Amtszeit in 30
Aufsichtsratsgremien, bei vielen war er sogar in leitender
Funktion. Dabei ließ er gerne wissen, was er von diesen
besseren Herrenclubs hielt. »Die Hundehütte ist für den
Hund, der Aufsichtsrat ist für die Katz«, war einer seiner
Aussprüche. Neben den Frankfurter Bankiers saßen die
Münchener Versicherer, die Allianz und die Münchener
Rück, mit an den Schalthebeln der deutschen
Nachkriegswirtschaft. Sie bauten große Beteiligungen an
den wichtigsten Industriekonzernen des Landes auf. Sie
bestimmten bis vor wenigen Jahren, wer in Aufsichtsrat
und Vorstand kam. Die Deutsche Bank übte nicht nur direkt
über eigene Beteiligungen Macht aus. Sie stimmte
außerdem im Namen ihrer Depotkunden ab, die der Bank
das Stimmrecht ihrer Aktien übertragen hatten. Und die
Frankfurter waren oft gleichzeitig die Hausbank und
entschieden über Kredite. Der Chefposten im Aufsichtsrat
beim größten Autokonzern Daimler war geradezu ein
Erbhof für den jeweiligen Deutsche-Bank-Chef.
Bundeskanzler Schröder, der sich in der Gesellschaft der
Bosse wohlfühlte, bezeichnete sich nur halb scherzhaft
gerne als »Vorstandsvorsitzender der Deutschland AG«.
Aber es ließ sich nicht viel in Deutschlands Wirtschaft
bewegen, ohne die Zustimmung der Frankfurter Banker –
auch nicht von der Regierung. Es war ein informelles
Lenken: Man kannte sich untereinander, man traf sich
regelmäßig. Bei den Tagungen des BDI und des
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. Oder bei
den beliebten Baden-Badener Unternehmergesprächen: In
der Kurstadt treffen sich nach wie vor die Spitzenleute der
deutschen Unternehmen »zum Lernen und Kennenlernen«,
wie es das manager magazin einmal formulierte. Im
Sommer kam die Deutschland AG dann in Bayreuth bei den
Wagner-Festspielen zusammen oder in Salzburg, wo man
sich nach dem Jedermann in den »Goldenen Hirschen«
zurückzog.
Bis in die 1990er-Jahre gelang es dem Männerbund, die
deutsche Wirtschaft zu dominieren und auch gegen das
Ausland abzuschotten.
Das Netzwerk schirmte die Manager gegen den Einfluss
der Finanzmärkte ab. Die Verflechtungen und vor allem die
starke Einbindung der Banken in die Konzernführung
sorgten dafür, dass sich das Kapital »geduldiger« und
»freundlicher« als in der amerikanischen Variante des
Kapitalismus zeigte. Deutschland erschien als das
»Gegenmodell zum amerikanischen Marktkapitalismus«,
beschreibt es Gewerkschaftsforscher Martin Höpner in
einer Habilitationsschrift 2007. Hier schlugen keine
Fondsmanager als Aktionäre auf den Konferenztisch und
forderten mehr Gewinnsteigerungen, höhere
Dividendenausschüttungen, schärfere Sparmaßnahmen.
Feindliche Übernahmen waren geradezu unerhört.
Wirtschaftshistoriker argumentieren, dass nur in einem
solchen Schutzraum die Einbeziehung der
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat möglich war. Für
Amerikaner ist die Mitbestimmung der Belegschaft bis
heute eine Einrichtung, mit der sie sich schwertun.
Das Prinzip »Eine Hand wäscht die andere« führte
allerdings in nicht wenigen Fällen dazu, dass beide
schmutzig blieben. Da war der Skandal um die Philipp
Holzmann AG. Nur Tage nach dem 150-jährigen
Firmenjubiläum musste der bis dahin größte Baukonzern
bis zu diesem Zeitpunkt verheimlichte Milliardenverluste
eingestehen. Trotz eines Rettungspakets der SchröderRegierung meldete Holzmann 2002 Insolvenz an. Die
Vorwürfe – unter anderem ging es um Scheinrechnungen
und Aktiengeschäfte – gegen Vorstand und Aufsichtsrat
wurden durch Vergleiche beigelegt. Oder der PleiteBaulöwe Jürgen Schneider, der die Banken mit seinem
Schein-Imperium fünf Milliarden Deutsche Mark kostete
und reihenweise Handwerksbetriebe in den Ruin trieb.
(Was der damalige Deutsche-Bank-Vorstandschef Hilmar
Kopper mit seinem berüchtigten Ausspruch, das seien
»Peanuts« kommentierte.)
Dann kam 1999 der Angriff des britischen
Mobilfunkkonzerns Vodafone auf Mannesmann, ein DaxSchwergewicht, dessen Ursprünge auf die ersten nahtlosen
Stahlrohre der Gebrüder Max und Reinhard Mannesmann
im Jahr 1886 zurückgingen. Nach einer monatelangen
Übernahmeschlacht unterlag der deutsche Konzern. Im
Februar 2000 stimmte der Aufsichtsrat schließlich der
Übernahme zu. »Die Einigung von Düsseldorf markiert
gleichzeitig das Ende des Rheinischen Kapitalismus. Mit
diesem auf Konsens und Mitbestimmung basierenden
System hatten sich die deutschen Konzerne bisher
erfolgreich gegen Angriffe aus dem Ausland gewehrt«,
schrieb damals der Spiegel. Es war die erste erfolgreiche
feindliche Übernahme eines bedeutenden
Traditionsunternehmens. Das Bollwerk der Deutschland AG
bröckelte da schon eine Weile. Die Globalisierung spielte
eine Rolle: Um zu überleben, mussten die deutschen
Konzerne internationaler werden. Sie begannen im Ausland
nicht nur zu verkaufen, sondern zunehmend auch zu
produzieren. Von den Siemens-Beschäftigten etwa befindet
sich bald die Hälfte im Ausland. Aber vor allem verändert
sich das Machtzentrum der Deutschland AG, die Deutsche
Bank. Sie zieht sich zurück. Unter dem Vorstandsvorsitz
von Josef Ackermann, der wegen seiner Rolle als
Aufsichtsratschef bei Mannesmann während der VodafoneAttacke zweimal vor Gericht musste, verkaufen die
Frankfurter nach der Jahrtausendwende Schlag auf Schlag
ihre Industriebeteiligungen. Ackermann hatte – gemeinsam
mit anderen Mannesmann-Vorständen und Aufsichtsräten
wie Ex-Chef Klaus Esser und dem ehemaligen IG-MetallVorsitzenden Klaus Zwickel – kurz vor der Übernahme
Prämien kassiert, deren Rechtmäßigkeit angezweifelt
wurde. Im ersten Prozess wurden die Angeklagten
verurteilt, in der Berufung wurde das Verfahren gegen
Millionenzahlungen eingestellt. Es war das spektakulärste
Wirtschaftsverfahren der Nachkriegsjahre. Kein Wunder,
dass die Devise in den Frankfurter Deutsche-Bank-Türmen
danach umso vehementer lautete: Rückzug aufs
Kerngeschäft, also auf die Finanzen. An Daimler etwa hielt
die Bank bis 2004 noch knapp 12 Prozent, Ende 2006
waren es nur noch 4,4 Prozent, 2009 hatte sich der Anteil
auf 2,5 Prozent verringert.
Die deutsche Version des Industriekapitalismus
geht zu Ende
Es war die Politik, die den Untergang der Deutschland AG
schließlich beschleunigte. Quer durch alle Parteien stieß
das Modell der Kreuz- und Querbeteiligungen von Banken
und Industriekonzernen in den 1990er Jahren auf
wachsende Kritik. Nicht nur die marktliberale FDP hielt es
für ein wachstumshemmendes Problem, auch die SPD und
die Grünen sahen darin ein Kartell der Manager. Es war die
rotgrüne Koalitionsregierung, ausgerechnet unter dem
selbsterklärten Ehren-Vorstandschef Schröder, die 2001 die
Steuer auf Veräußerungsgewinne strich und damit den
Verkauf von Beteiligungen steuerlich attraktiv machte. Das
Geflecht der Macht, das zwei Weltkriege überdauert hatte,
begann sich immer schneller aufzulösen. Lothar Krempel,
vom Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung,
hat das anhand der Zahlen der Monopolkommission
untersucht. Noch Mitte der 1990er Jahre gab es 62
Kapitalverflechtungen zwischen den 100 größten
Unternehmen. Im Kern des Netzwerks befinden sich immer
noch die Finanzdienstleister, Deutsche Bank, Allianz,
Münchener Rück und Dresdner Bank. 2006 gab es nur
noch 39 solcher Querverbindungen. Die Manager der
Deutschen Bank hielten 1996 immerhin noch 32
Aufsichtsratsmandate, zehn Jahre später sind es lediglich 4.
Auch die Villa Hügel ereilte die Zeitenwende.
Thyssen-Krupps Patriarch Berthold Beitz, der auch mit
fast 100 Jahren noch in sein Büro kam, starb am 30. Juli
2013 – auf den Tag genau 46 Jahre nach seinem Freund
Alfred Krupp. Nur wenige Monate nach Beitz’ Tod verlor
die Krupp-Stiftung ihre Sperrminorität. ThyssenKrupp
hatte jahrelang Verluste gemacht und Milliarden in Werke
in den USA und Brasilien versenkt und war ins Visier von
Hedgefonds geraten, die eine Kapitalerhöhung forderten.
Die Stiftung konnte nicht mitziehen. Mit einem Aktienanteil
von 25 Prozent hatte die Stiftung unter Beitz bis dahin das
Sagen gehabt bei dem Stahlkonzern, sie hatte feindliche
Übernahmen und eine Zerschlagung über Jahrzehnte
verhindert. Statt wie bisher drei Aufsichtsratsposten bei
ThyssenKrupp darf die gemeinnützige Stiftung nur noch
zwei besetzen. Während der Anteil der Stiftung sank,
erhöhten die anderen Großaktionäre ihren Anteil: Der
schwedische Hedgefonds Cevian, die amerikanische
Fondsgesellschaft Franklin Mutual und – BlackRock. Der
Nexus der neuen »Germany Inc.«.
Nicht nur bei den Dax-Schwergewichten verabschieden
sich nach und nach die angestammten Eigentümer –
Familien, Stiftungen oder andere Unternehmen, die aus
strategischem Interesse eine Beteiligung hielten. In den
vergangenen Jahren hat sich der Abschied dieser
Ankeraktionäre auch beim Mittelstand, der traditionellen
Basis der deutschen Wirtschaft, deutlich beschleunigt. In
einer Studie untersuchten die Beratungsunternehmen
Cometis und Ipreo die Eigentümerstruktur von
Unternehmen, die in den kleineren Dax-Indizes vertreten
sind. Ergebnis: Im SDax – einem Index, zu dem unter
anderem Puma, Heidelberger Druck und der Autovermieter
Sixt gehören – belief sich der Anteil der Ankeraktionäre
Ende 2014 auf 41 Prozent. Nur zwölf Monate zuvor waren
es noch 47 Prozent gewesen. Beim MDax – zu dessen 50
Werten unter anderem der Axel Springer Verlag, die
Optikerkette Fielmann und die Osram AG zählen – waren es
sogar nur 34 Prozent. Auch beim MDax hatte sich der
Anteil binnen Jahresfrist noch einmal um vier
Prozentpunkte verringert. Die neuen Aktionäre, die sich
stattdessen in die Dax-Werte eingekauft haben, kommen
mehrheitlich aus Nordamerika, Großbritannien und
Skandinavien (Norges Bank Investment Management, der
staatliche norwegische Pensionsfonds, ist einer der größten
institutionellen Investoren in Deutschland.) Unter den Top
10 der Mittelstandsinvestoren finden sich mit der DWS,
dem Vermögensverwaltungsarm der Deutschen Bank, und
Allianz Global Investors nur noch zwei deutsche
Finanzunternehmen. BlackRock war zum Zeitpunkt der
Studie in Unternehmen des MDax mit rund 1,2 Milliarden
Euro investiert – fast doppelt so viel wie noch ein Jahr
zuvor. Und diese Summe bezieht sich allein auf die Fonds,
die BlackRocks Fondsmanager aktiv betreuen. Insgesamt
dürfte der Anteil noch höher ausfallen, denn 14 Prozent der
MDax-Werte werden von Indexfonds, also passiven
Investoren, gehalten. Und BlackRock verwaltet im Schnitt
fast 80 Prozent seiner Gelder als passiver Investor. Damit
gehören die New Yorker zu den führenden Finanziers des
deutschen Mittelstands, zumindest der börsennotierten
Unternehmen. (Stärkster aktiver Investor im MDax ist
BlackRocks kleinerer kalifornischer Rivale Capital World
Investors, eine 1,1 Billionen Dollar schwere
Fondsgesellschaft, die den zweifelhaften Ruf genießt, so
arrogant und geheimniskrämerisch aufzutreten, dass sie
selbst abgebrühte Wall-Street-Kunden verprellte.)
Die neuen Herren der Dax-Familie haben ihre eigenen
Sitten und Gebräuche mitgebracht. Das hat für einige
unangenehme Überraschungen bei den Angehörigen der
alten Deutschland AG gesorgt. Als etwa der DeutscheBank-Boss Josef Ackermann 2012 – wie in den alten Zeiten
üblich –nahtlos vom Vorstand- in den AufsichtsratChefsessel wechseln wollte – zur Krönung seiner Karriere
–, verweigerten ihm die ausländischen Anteilseigner die
Zustimmung. Ackermann verzichtete – angeblich, weil er in
seiner verbleibenden Zeit als Vorstand noch zu beschäftigt
mit den Folgen der Finanzkrise sei und sich nicht auf die
neue Rolle vorbereiten könne. BlackRock schweigt dazu,
weil es sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Unternehmen
äußert. Aber Insider berichten, dass auch BlackRock als
einer der Großaktionäre der Deutschen Bank Ackermanns
Wechsel an die Spitze des Aufsichtsrats verhindert habe.
Mehrfach hätten die Frankfurter für ihren Chef
antichambriert – vergeblich. Die zuständige Person bei
BlackRock erteilte ihnen eine klare Antwort: »No!«
Ackermann kam offenbar den Personalplänen New Yorks in
die Quere. Larry Fink machte öffentlich Werbung für
»seinen« Spitzenkandidaten Anshu Jain.
Jain galt zwar als ein Gewächs der Londoner City (was
ihm in Deutschland genügend Sympathien kostete). Doch
angefangen hat der Mann aus dem indischen Jaipur an der
Wall Street. Er ist vertraut mit der Kultur und war
willkommener Gast bei jenen Veranstaltungen, bei denen
sich die Big Honchos der Street selber feiern. (Garniert
sind solche Angelegenheiten mit einem Feigenblatt der
Wohltätigkeit.) Andere Auslandsbanker dürfen dagegen
nicht einmal Zaungäste sein. »Anshu hat einen
fantastischen Job gemacht«, schwärmte auch Fink
gegenüber der New York Times im Juni 2011. »Er würde
einen sehr guten Vorstandschef der Deutschen Bank
abgeben.« Ackermanns Wunschkandidat für seine
Nachfolge war dagegen Ex-Bundesbankchef Axel Weber.
Am 1. Juni 2012 wurde Jain zum Vorstandsvorsitzenden der
Deutschen Bank ernannt (gemeinsam mit Ko-Chef Jürgen
Fitschen, der vor allem den Deutschen, die mit Jain, einem
Inder, als Chef der Deutschen Bank haderten, ein vertrautheimatliches Gesicht »ihrer« Bank präsentieren sollte).
Eine Aktionärsrevolte drohte auch dem langjährigen
Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber, der sich vor der
Hauptversammlung 2013 bereits an der Spitze des
Lufthansa-Aufsichtsrats gesehen hatte. Doch vor allem den
amerikanischen Investoren passte der aus ihrer Sicht
rasche Flip-Flop vom Manager zum Kontrolleur ganz und
gar nicht. Sie drohten bei der Aktionärsversammlung
gegen den Österreicher zu stimmen. Mayrhuber wurde
zwar doch noch gewählt, aber in allerletzter Minute und
mit peinlich knapper Mehrheit. So etwas wäre im
Herrenclub früherer Tage nicht passiert. In der alten
Deutschland AG löste man Konflikte bei einem gepflegten
Essen oder mit einem diskreten Anruf. Oder wie ein ExBanker, der lange bei einem der großem Institute war, es
ausdrückt: »Die Deutschland AG hat viele geschützt. Heute
ist jedes Unternehmen den vier Jahreszeiten ausgesetzt.«
So ist der Aufsichtsrat ein ungemütlicher Posten
geworden. »Im angelsächsischen Raum schicken die
Investoren ›ihren‹ Vertreter in den Aufsichtsrat, der dort
ihre Interessen wahrnehmen soll. Das ist amerikanische
Corporate Governance. Und das wollen sie dann in
Deutschland natürlich auch«, sagt Peter Dehnen, ein
Anwalt, der sich auf die Beratung von Aufsichtsräten
spezialisiert hat. Nach deutschem Recht und deutscher
Corporate Governance ist das nicht zulässig – der
Aufsichtsrat gehört zu den »inneren Organen« des
Unternehmens und als solches ist er unabhängig und allein
dem Wohl des Unternehmens und allen mit ihm
verbundenen Parteien – also auch der Belegschaft –
gleichermaßen verpflichtet. Dehnen sah in den
vergangenen Jahren einen derartig großen
Orientierungsbedarf bei den verunsicherten
Konzernkontrolleuren, dass er eine eigene
Interessensvertretung für sie gründete: die Vereinigung der
Aufsichtsräte in Deutschland, mit über 100 Mitgliedern.
Einmal im Jahr trifft man sich zum Austausch, dabei geht es
um Themen wie »Teamkompetenz«, »Strategiekompetenz«
und »Personalkompetenz«. Bei einem der vergangenen
Treffen arbeitete man sich im »Zukunftsforum« am
»Leitbild Aufsichtsrat« ab – immerhin von Talk-Ikone
Sabine Christiansen prominent moderiert. Auf jeden Fall ist
es eine anstrengendere Agenda als die Speisekarte des
»Goldenen Hirschen«.
Eine ganze Branche ist entstanden, um den deutschen
Bossen den richtigen Umgang mit ihren neuen,
amerikanischen Eignern nahezubringen. So trifft sich eine
Gruppe von Beratern in Düsseldorf regelmäßig, um über
die richtige Interpretation der neuesten Schriften von
Lucian Bebchuck zu brüten. Bebchuck, ein HarvardProfessor, gilt als Guru der Corporate Governance, der
richtigen Unternehmensführung. »Alles, was in den USA
Praxis ist, landet über kurz oder lang bei uns«, erklärt
Burkhard Fassbach, einer der Initiatoren des Kreises, die
Motivation der Teilnehmer. Da will man nicht unvorbereitet
sein. Fassbach hat sich auf Aufsichtsratshaftungsfragen
spezialisiert, ein Fachgebiet, das es bis vor kurzem in
Deutschland in der Form gar nicht gab. Inzwischen
gehören juristische Auseinandersetzungen zwischen
Aktionären und Aufsichtsrat oder auch zwischen Vorstand
und Aufsichtsrat zum Alltag.
Zu den Errungenschaften des Finanzkapitalismus 2.0 zählt
auch die Position der Investor Relations – gerne schnittig
IR abgekürzt. Diese Position ist meist an den Vorstand
angedockt. Sie ist mit dem Aufstieg der Fonds zu
Großeigentümern entstanden. Die Unternehmen stellen die
IR als eine Art Aktionärspflege ab. Ihre Aufgabe besteht im
Wesentlichen darin, die großen Anteilseigner bei Laune zu
halten. Nach dem Abschied der Ankeraktionäre der alten
Deutschland AG sind über 80 Prozent der Dax-Werte in
Streubesitz und somit ihre Aktien im Kapitalmarkt frei
gehandelt. Das führt dazu, dass es schon genügt, wenn ein
Fonds Anteile im einstelligen Prozentbereich hält, um
Einfluss zu haben. (Das Beispiel mit den Gummi-Entchen!)
»Wenn wir eine Liste unserer Top 10 zusammenstellen,
dann gilt ein Investor mit einem Prozent bereits als
Großaktionär«, sagt der IR-Manager eines DaxUnternehmens. Zu den Schwierigkeiten der IR gehört, dass
es gar nicht mehr so einfach ist zu wissen, wer gerade ein
Großaktionär ist und wer bereits nicht mehr. Zwar gibt es
die Stimmrechtspflichtmeldungen an die Bafin, die das
Wertpapierhandelsgesetz vorschreibt, sobald der Anteil
bestimmte Schwellen überschreitet. (Jene Meldungen, bei
denen BlackRock mit der Bafin Probleme bekam.) Aber die
Meldungen geben nur eine ungefähre Hausnummer. Um es
genau zu wissen, erteilen die IR regelmäßig Spezialisten
den Auftrag, die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse
ausfindig zu machen. Die Aktionärsdetektive klappern dann
Investmentbanken und Investoren ab und rufen bei DepotBanken an, die Stimmrechte von ihren Kunden übertragen
bekommen haben. Abgesehen von einer Liste der
wichtigsten Anteilseigner interessiert die IR auch, wer die
Aktien ihres Unternehmens kauft – beziehungsweise
verkauft und möglichst auch warum. Ist die gesamte
Branche bei Investoren gerade unbeliebt geworden und hat
der Fondsmanager die Aktie deshalb abgestoßen? Oder
zeigt es Unzufriedenheit mit dem Unternehmen selbst?
Solche Fragen sollen die Zahlenknechte herausfiltern.
Denn die IR sollen dafür sorgen, dass der Aktienkurs keine
heftigen Ausschläge erleidet – idealerweise soll er sich
stetig nach oben entwickeln. Doch seit die deutschen
Unternehmen den Turbulenzen des globalen Kapitalmarkts
ungeschützt ausgesetzt sind, bedarf das einigem Einsatz
und Geschick. Ganz schlecht sind Überraschungen. Etwa
ein Umsatzeinbruch. Der sollte die Investoren nicht
unvorbereitet treffen. Wenn die schlechten Zahlen über den
Nachrichtenticker gehen, ist es schon zu spät. Dann gilt
das bewährte Wall-Street-Motto: »Erst verkaufen, dann
fragen!« Kein Investor will sich hinterher ärgern, dass er
die Loser-Aktie nicht schnell noch abgestoßen hat. Auf
unangenehme Botschaften muss der IR seine
Großaktionäre deshalb schonend einstimmen. Allerdings
darf er ihnen keine konkreten Zahlen vor den anderen
Aktionären geben – das wäre ja dann Insiderhandel. Da gilt
es, vorsichtig zu sein. Guten Aktionärs-Dompteuren muss
das Kursmanagement per Andeutung gelingen.
Zum Alltag in der neuen Germany Inc. gehören
Konferenzen, bei denen die Investor-Relations-Leute und
ihre Vorstände die Unternehmenseigner persönlich treffen.
Organisiert werden diese Zusammenkünfte meist von den
Banken, meist in einem Frankfurter Hotel. Wer allerdings
erwartet, etwa mit den Herren und Damen von BlackRock
dort beim Fingerfood zu plauschen, sieht sich herbe
enttäuscht. Die großen Investoren ziehen es vor,
stattdessen eine Suite im selben Hotel zu mieten. Dorthin
bitten sie dann nacheinander die Vorstände der jeweiligen
deutschen Unternehmen zum Stelldichein. Dann und wann
gehen die Unternehmenschefs – vor allem die Finanzchefs –
auf »Roadshow« und statten ihren ausländischen
Großaktionären einen Besuch ab. Sie reisen dann nach
London oder New York. Reiseveranstalter sind bei dieser
Gelegenheit wieder die Banken, die auch die Zeche
bezahlen. Die Banker hoffen, dass sich das langfristig über
Honorare und Provisionen wieder einspielt und sie im
Gegenzug bei künftigen Aufträgen von Unternehmen und
Investoren berücksichtigt werden. Dafür arrangieren die
Banker ein Rundum-sorglos-Reisepaket: Sie sorgen dafür,
dass die Vorstände ihre Termine bei den wichtigen
Investoren bekommen und auch für die standesgemäße
Unterbringung und ein standesgemäßes Transportmittel
(ein Mercedes S-Klasse oder ein vergleichbares Modell
sollte es schon sein!). Die britischen Aufsichtsbehörden
stoßen sich inzwischen allerdings an dem Arrangement, sie
wollen eine größere Transparenz, wer an wen und warum
zahlt. In die drohende Lücke sind neue Dienstleister
gesprungen – Ex-Banker, die sich quasi als Reisebüro für
Investoren-Roadshows selbstständig gemacht haben. Für
kleinere Unternehmen wird es dadurch allerdings
schwieriger werden, ihre Investoren zu treffen oder neue
kennenzulernen, fürchtet ein Insider. Sie können sich
künftig die teuren Trips nur selten leisten. Bisher zahlt der
Investor indirekt über Banker-Provisionen für die Kleineren
mit. Bei den größeren Unternehmen wird regelmäßiges
Erscheinen erwartet. BlackRock etwa wünsche, so
berichtet der IR eines Dax-Unternehmens, den
Vorstandschef oder zumindest den Finanzchef zweimal
jährlich in London, zweimal in New York und zweimal in
Edinburgh zum Rapport zu sehen. (In der schottischen
Hauptstadt sitzen Analysten und Fondsmanager, die
BlackRocks Engagements in Europa managen.)
In modernen Aktiengesellschaften herrscht, zumindest
formal, Demokratie. Die Aktionäre bestimmen den
Aufsichtsrat und der wiederum den Vorstand. Bei der
Hauptversammlung – für die meisten Unternehmen fällt sie
auf einen Frühjahrstag – stimmen die Anteilseigner über
Vorschläge des Managements und Forderungen von
Aktionären ab. Die wichtigste Aufgabe für die IR ist es, die
Hauptversammlung so vorzubereiten, dass sie reibungslos
– also im Sinne des Vorstands – über die Bühne geht.
Idealerweise, aus der Sicht der Investor Relations und der
Manager, sollten die Aktionäre die Vorstandsvorschläge
ohne große Diskussion durchwinken. Um sich zu wappnen,
bereiten die IR-Abteilungen Hunderte von Antworten auf
potenzielle Fragen vor. Große Konzerne engagieren
zusätzlich externe Berater, die bei der Optimierung der
Tagesordnung helfen sollen. In Gesprächen im Vorfeld
sondieren die IR-Leute die Stimmung unter den Aktionären.
Sie versuchen Verbänden von Kleinaktionären, die mit
nervigen Nachfragen stören könnten, vorab den Wind aus
den Segeln zu nehmen. Die größte Gefahr sind jedoch nicht
Grantler und Querulanten. »Stell dir vor, es ist
Hauptversammlung und keiner geht hin«, das ist das
Schreckensszenario für die Unternehmen. Eines der
Probleme ist, ähnlich wie bei der Bundestagswahl, die
Gleichgültigkeit vieler Aktionäre, die auf eine Stimmabgabe
schlicht verzichten. »Die Präsenz auf der HV ist für uns als
Unternehmen ein großes Thema, sonst kann schnell einmal
aus einer 6-bis-7-Prozent-Beteiligung eine Sperrminorität
werden. Wenn 30 Prozent unseres Kapitals auf der HV
präsent sind, sind wir schon zufrieden«, erzählt der
langjährige Investor Relations Manager eines deutschen
Finanzkonzerns.
Selbst bei den großen Dax-Konzernen liegt die
Beteiligung in den vergangenen Jahren nicht selten unter
50 Prozent. Und das ist bereits ein Grund zum Feiern! Bei
der Hauptversammlung der Deutschen Bank im Mai 2015
zeigten gerade mal 33 Prozent der Anteilseigner Präsenz –
obwohl es um die Zukunft der Vorstände Anshu Jain und
Jürgen Fitschen ging, die wenige Wochen später gehen
mussten. Das Problem einer niedrigen Beteiligung: Wenn
nur ein geringer Teil des stimmberechtigten Kapitals
erscheint, dann schwächt dies das Management. Oder,
noch schlimmer, dann reichen die Stimmen bereits
kleinerer Querschläger aus, um eine Sperrminorität zu
bilden und die Pläne des Vorstands mal eben so zu
durchkreuzen. Oder ein Aufsichtsratskandidat wird
abgewatscht und abgelehnt oder – Worst Case – eine
Kapitalerhöhung scheitert. Eine solche Blamage bringt
Schlagzeilen, Unruhe und auf jeden Fall den Kurs ins
Rutschen. Also all das, was IR zu verhindern suchen.
Im Griff der kalifornischen Sondereinheit
Für BlackRocks Imperium übt eine 21-köpfige
Spezialeinheit die Aktionärsrechte aus. Ihre Mitglieder
sorgen dafür, dass BlackRocks Interessen von Managern
weltweit berücksichtigt werden. Sie arbeiten verteilt auf
sechs Büros in fünf verschiedenen Ländern und drei
Weltregionen. Hauptquartier ist ein Büro in San Francisco.
Dort laufen die Fäden zusammen, die eine rothaarige
Mittvierzigerin namens Michelle Edkins in der Hand hält.
Die gebürtige Neuseeländerin hat den Job 2010
übernommen und bemüht sich nun darum, dass BlackRock
eine klarere Linie in Sachen Corporate Governance fährt.
Corporate Governance wurde zum Schlagwort nach den
Skandalen von Enron und Worldcom Anfang der 2000er
Jahre, bei denen Beschäftigte Tausende Jobs und Anleger
Hunderte Milliarden verloren. Beim texanischen
Energieunternehmen Enron, das vom Wirtschaftsmagazin
Fortune sechs Jahre hintereinander zum »innovativsten
Unternehmen Amerikas« gekürt worden war, stellte sich
heraus, dass die Gewinne nur auf dem Papier bestanden
und schlicht eine Art Hütchenspiel mit Derivaten waren.
Bei Worldcom fälschte CEO Bernie Ebbers ganz klassisch
die Bücher und kaufte sich eine Ranch, dreimal so groß wie
New York City sowie eine Herde mit 22 000 Rindern.
Investoren und Regulierer schworen, dass solche frechen
Betrügereien nie wieder vorkommen und bessere
Kontrollen in den Unternehmen stattfinden sollten. Darüber
bei den Tausenden Unternehmen im Portfolio zu wachen,
ist nun die Hauptaufgabe von Edkins Abteilung. Sie und
ihre Aktionärs-Soko haben für ihre Mission sogar einen
eigenen Jargon entwickelt. Hält ein Aufsichtsrat zu viele
Mandate bei unterschiedlichen Unternehmen, dann macht
er sich des »overboarding« schuldig. Er ist nach Ansicht
der BlackRock-Truppe zu beschäftigt, um sich um jedes
einzelne Unternehmen genug zu kümmern. Ein anderer
Begriff ist »Engagement«, der im Englischen einen
militärischen Beigeschmack hat. Bei BlackRock bedeutet
es, dass ein Analyst losgeschickt wird, um bei dem
betreffenden Unternehmen nach dem Rechten zu sehen,
mindestens aber müssen die Unternehmenschefs mit einem
bohrenden Anruf rechnen. Jährlich erhalten rund 1 500
Unternehmen aus BlackRocks Reich einen Besuch von
einem Kollegen aus Edkins Team oder zumindest ein paar
Anrufe, 1 432 waren es laut Rechenschaftsbericht 2013.
»Refreshment«, Auffrischung, ist kein Kururlaub für müde
Aufsichtsräte, sondern Maßnahmen, die drohen, wenn
»Engagement« nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hat.
Dann ist nach BlackRocks Ansicht möglicherweise ein
Personalwechsel angesagt. So beschreibt es jedenfalls die
New York Times 2013 in einem atemlosen Bericht über
Edkins Truppe. »Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass
Manager zu einem hohen Grad auf private Ansprache
reagieren«, erklärte Edkins zufrieden dem Branchenjournal
Pensions & Investments. Das überrascht nicht – welcher
Vorstand hat nicht ein offenes Ohr für einen seiner größten
Eigentümer? Und oft genug ist BlackRock nicht nur das,
sondern gleichzeitig auch ein wichtiger Gläubiger, der
Anleihen und Kredite hält. Mehr Karten kann man
eigentlich kaum in der Hand haben.
Allerdings läuft das – wie alles im Hause BlackRock – im
Hintergrund ab. »Niemandem ist damit gedient, wenn zwei
Seiten sich in den Zeitungen bekriegen«, erklärt Larry Fink
seine Vorliebe für Diskretion im Vorwort zum CorporateGovernance-Jahresbericht 2012, der BlackRocks Aktivitäten
als Großaktionär zusammenfasst. Ganz unverblümt heißt es
zwei Seiten weiter zur Aktionärsphilosophie von BlackRock:
»Wir sprechen nicht öffentlich über unser Vorgehen bei
einem Unternehmen, weil es keine Schlagzeilen braucht,
um Aktionärsinteressen zu bewahren.« Damit bleiben
Forderungen und Wünsche, die BlackRock an die Manager
heranträgt, hinter den Kulissen. Was genau bei den
»Engagements« mit den Unternehmenschefs besprochen
wird und welchen Einfluss sie haben, das wissen nur die
Betreffenden selbst.
Einer der seltenen Fälle, in denen BlackRocks Wünsche
publik wurden, war im Mai 2014 im Zusammenhang mit
dem Versuch des amerikanischen Pharmariesen Pfizer, den
britisch-schwedischen Konkurrenten AstraZeneca zu
übernehmen. Pfizer wollte sich durch die Fusion vor allem
Steuervorteile sichern. Das US-Unternehmen plante, eine
spezielle Holding zu gründen und deren Sitz nach London
zu verlegen. Dadurch hätte der Konzern Hunderte
Millionen Dollar sparen können. Die Übernahme scheiterte,
AstraZeneca lehnte ab. Pfizer zog sich zurück, denn in
Großbritannien muss der Aufkäufer mehrere Monate
warten, bevor er erneut ein Angebot abgeben darf.
BlackRock, ein Großaktionär bei AstraZeneca, forderte
dessen Vorstand auf, nach der gesetzlich vorgeschriebenen
Wartefrist erneut mit Pfizer zu verhandeln. Das zumindest
steckte ein Insider dem New-York-Times-Blog Dealbook.
Auch wenn der Inhalt der Gespräche zwischen den
Managern der Unternehmen und den Vertretern ihrer
Großaktionäre streng vertraulich ist, ihr Effekt ist
nachweisbar. Das zumindest ist die Schlussfolgerung einer
Studie, die sich mit den Auswirkungen des
Finanzkapitalismus 2.0 beschäftigt hat. Eine Folge der breit
gestreuten Beteiligungen der großen Fondsgesellschaften
wie BlackRock, Vanguard und Fidelity ist, dass
Unternehmen einer Branche vielfach derselben Gruppe von
Eigentümern gehören. (Bei einer Investition in einen
Branchenindex etwa ist das per definitionem für den ETFHerausgeber sogar notwendig.) So sind zum Beispiel bei
den rivalisierenden US-Drogerieketten CVS und Walgreens
fünf der zehn größten Eigentümer identisch: BlackRock,
Vanguard, Wellington Management, State Street und
Franklin. (Stand März 2015) »Wie wirkt sich diese
gemeinsame Eigentümerstruktur auf das
Konkurrenzverhalten aus?«, wollte der Finanzökonom
Martin Schmalz, Dozent an der University of Michigan,
wissen. Also: Scheut CVS nun einen Preiskampf mit
Walgreens, um Marktanteile zu gewinnen, weil der letztlich
dem gemeinsamen Eigentümer schadet oder zumindest
nichts nützt? Man könnte auch fragen: Gibt es im
Finanzkapitalismus 2.0 dieselben monopolistischen Effekte
wie unter John Pierpont Morgan?
Schmalz untersuchte diese neue Art Oligopol in einer
Studie zusammen mit seinen Kollegen José Azar und Isabel
Tecu (September 2014). Er schaute sich amerikanische
Fluggesellschaften an und deren Preise sowie
Passagieraufkommen auf bestimmten Strecken. Als
Startpunkt nahm er die Übernahme der iShares durch
BlackRock 2009. Die Übernahme sorgte für eine stärkere
Konzentration der Eigentümer der Airlines, die bestimmte
Flugstrecken bedienten – und sich dabei eigentlich
Konkurrenz machen sollten. Das Resultat: Ticketpreise
waren rund 5 Prozent höher und das Passagieraufkommen
rund 6 Prozent geringer als diese Werte gewesen wären,
wenn die konkurrierenden Airlines auf der Strecke
verschiedenen Eigentümern gehört hätten. Das Absinken
der Passagierzahlen bedeutet, dass die Preise offenbar
nicht wegen höherer Nachfrage angezogen hatten. Vor
allem in Sektoren mit einer beschränkten Anzahl an
Wettbewerbern, so Schmalz, gelte: »Gemeinsame
Eigentümer kombiniert mit dem Axiom der ShareholderValue-Maximierung impliziert Anreize für Firmen in den
Portfolios die Quantität zu reduzieren und Preise zu
erhöhen und den damit miteinhergehenden
Wohlfahrtsverlust für die Volkswirtschaft.« Weniger
akademisch ausgedrückt: Während die Anteilseigner von
der Konzentration der Eigentümer profitieren, zahlen die
Verbraucher drauf.
Dabei seien sich die Vertreter der Fonds, die mit den
Managern des Unternehmens sprechen,
höchstwahrscheinlich nicht einmal bewusst, dass sie sich
wettbewerbsverzerrend verhalten, glaubt Schmalz. Es
reiche schon, wenn etwa der Fondsvertreter – der ja die
Situation der Konkurrenz auch gut kennt – dem Vorstand
den Hinweis gibt, lieber höhere Margen anzustreben, statt
um mehr Marktanteile zu kämpfen.
Wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass BlackRock in
vielen Branchen Anteile an den verschiedenen
Konkurrenten hält, dann bekommt man eine Ahnung von
dem potenziellen Problem. Oder wie Autoren des OnlineMagazins Slate unter der Überschrift »Die dunkle Seite der
Investmentfonds« anlässlich der Studie anmerkten,
vielleicht sei nicht Kapitalismus per se schuld an dem
dramatischen Aufstieg des 1 Prozent der Superreichen,
sondern die Art, wie unser Finanzsystem organisiert ist.
Die Wettbewerbshüter haben sich mit diesem Thema bisher
nicht auseinandergesetzt. Schmalz ist aber überzeugt, dass
das nur eine Frage der Zeit ist.
Besser als auf den Anruf oder den Besuch eines BlackRockVertreters zu warten, ist es, den Wünschen von Fink und
Co. zuvorzukommen: Wer ein gutes Verhältnis zu dem
schwarzen Riesen haben will, sollte BlackRock am besten
regelmäßig auf dem Laufenden halten. Sein Unternehmen
wünsche »einen Dialog«, erklärte Fink 2012 in einem Brief
an 600 Vorstände, an deren Unternehmen BlackRock
beteiligt war. Weigert sich das Management auf die
Vorstellungen von BlackRock einzugehen, kann es
allerdings ungemütlich werden. »Wir werden gegen das
Management stimmen, wenn wir zu dem Schluss kommen,
dass unsere direkte Ansprache zu nichts geführt hat«, heißt
es in dem BlackRock-Zehnpunkteplan für den Umgang mit
Unternehmen. Vorstände, die einen ihrer größten
Anteilseigner gegen sich haben, sitzen auf einem
wackeligen Stuhl …
Opposition von Vorständen muss BlackRock aber kaum
fürchten. Mehr Ärger bereiten da andere Anleger, die den
Interessen des Riesen in die Quere kommen. Mehrfach hat
Fink scharfe Worte gegen »aktivistische Investoren«
gefunden, von denen er sich distanzieren will. Diese
Anleger – oft sind es Hedgefonds – gelten als die Rabauken
unter den Investoren, denn sie wollen Unternehmen ihren
Willen aufzwingen. Dazu kaufen sie entsprechend Anteile
auf, die ihnen das Recht geben, einen oder mehrere
Aufsichtsratsposten zu besetzen. Die von ihnen entsandten
Aufsichtsräte haben dann zur Aufgabe, die
Unternehmensleitung in die von ihrem Investor
gewünschte Richtung zu drängen. Meist geht es ihnen
schlicht darum, dass das Unternehmen mehr Geld an seine
Aktionäre auszahlt. Oder sie drängen auf die Abspaltung
von Unternehmensteilen, um dabei Kasse zu machen. Als
Index-Investor ärgert sich Fink über die Abkassierer-Fonds,
die meist ihre Anteile wieder abstoßen, nachdem sie ihre
Forderungen abgepresst haben oder das Unterfangen
gescheitert ist. Für Anleger, die nicht so einfach verkaufen
können, zu denen Fink zumindest mit seinen ETFs
zwangsläufig gehört, sind die Aktionen der Aktivisten
störende Zwischenspiele. In einem Brief vom April 2015 an
Vorstandschefs amerikanischer Unternehmen warnte er, sie
sollten sich durch diese Art Anteilseigner keine
kurzfristigen Ziele aufzwingen lassen. »Aktivismus zerstört
Jobs«, proklamierte Fink gar öffentlich bei der DealbookKonferenz 2014 in New York, bei der sich jedes Jahr die
Top-Dogs der Wall Street auf einen Plausch mit ihrem
Lieblingsjournalisten Andrew Ross-Sorkin einfinden. Finks
Aversion gegen Aktivisten gilt allerdings offenbar nicht,
wenn die Aktionen der Aktivisten potenziell günstig für
BlackRock sein könnten. Dann macht BlackRock durchaus
gemeinsame Sache mit ihnen. Wie das Wall Street Journal
unter Berufung auf D. F. King, ein
Aktionärsberatungsunternehmen, berichtete, stimmte
BlackRock zwischen 2009 und 2013 bei 50
Auseinandersetzungen um die Nominierung von
aktivistischen Aufsichtsräten immerhin in 34 Prozent der
Fälle mit den Aktivisten. Erz-Rivale Vanguard, ebenfalls
maßgeblich ein Indexfonds-Investor, tat das nur in 11
Prozent dieser Fälle. (Die mehrheitlich aktiven
Fondsmanager von Fidelity machten in 44 Prozent der Fälle
gemeinsame Sache mit den Hedgies.)
Informationen in der Einbahnstraße
Um die deutschen Unternehmen kümmert sich der
Londoner Ableger von Edkins Team. Allerdings müssen sich
die Deutschen deren Aufmerksamkeit teilen. Die insgesamt
fünf Mitarbeiter dort betreuen BlackRocks Beteiligungen in
ganz Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, kurz EMEA
genannt. Legt man die relevanten Börsenindizes für diese
Region zugrunde, sind dort mehr als 600 Unternehmen
börsennotiert. Zum Vergleich: Andere Dienstleister, die mit
der Wahrnehmung von Aktionärsrechten Geld verdienen,
wie etwa die britische Hermes Equity Ownership Services
haben einen deutlich höheren Betreuungsschlüssel: »Ein
Mitarbeiter von uns betreut etwa zehn bis zwanzig
Unternehmen. Nur so viel ist möglich, wenn man sich
sinnvoll um ein Unternehmen kümmern will«, sagt HansChristoph Hirt, Director bei Hermes Equity Ownership
Services. Mit dem Anteil an einem Unternehmen steigt die
Verantwortung. »Wenn wir 3 Prozent an einem größeren
Unternehmen halten, dann ist der Dialog intensiv.«
Immerhin erhalten die BlackRock-Corporate-GovernanceTeams Unterstützung aus dem Haus, und zwar von den
Aktienanalysten und Fondsmanagern, die sich die Aktie ins
Portfolio geholt haben. Bei einigen deutschen Unternehmen
sind sie die Ansprechpartner. Der IR-Leiter eines ChemieUnternehmens im Dax etwa hatte noch nie mit der Edkins-
Truppe zu tun, wohl aber mit dem Analysten für die
Chemiebranche. Nach welchen Kriterien sich die
Zuständigkeit entscheidet, darüber herrscht zumindest bei
den betroffenen Unternehmen Rätselraten. Ein anderer
Investor Relations Manager klagt, er wisse nie genau, wer
eigentlich bei BlackRock für ihn zuständig sei. Wieder ein
anderer gibt zu Protokoll, für ihn sei nicht ersichtlich,
welche Abteilung bei der Hauptversammlung die
Stimmrechte für BlackRock ausübt.
Über ihr Verhältnis zu BlackRock möchten die
Unternehmensvertreter nicht öffentlich reden. Über ihr
Intimleben zu plaudern, würde ihnen wahrscheinlich
leichter fallen. Aber wer will schon einen der wichtigsten
Aktionäre – oft ist BlackRock sogar der größte Aktionär –
verärgern? Nur nach der Zusicherung absoluter
Anonymität waren IR von Dax-Unternehmen verschiedener
Größe und aus verschiedenen Branchen zu vertraulichen
Gesprächen bereit. Keiner der Befragten ist ein Neuling:
Sie alle machen den Job seit Jahren, teilweise Jahrzehnten.
In einem stimmten alle überein: BlackRock sieht
Informationen als Bringschuld. Die BlackRock-Vertreter
erwarten, dass die Unternehmen bei wichtigen Fragen auf
sie zukommen. Der Informationsfluss geht allerdings nur in
eine Richtung. Das ist nicht nur bei BlackRock so. Die
Anteilseigner müssen dem Unternehmen nicht mitteilen,
wenn sie die Aktie abstoßen oder warum. Genauso wenig,
wie sie erklären müssen, warum sie ihren Anteil
aufstocken. Oft vergehen sechs bis acht Wochen ehe die
Unternehmen erfahren, dass sich bei ihren großen
Eigentümern etwas verändert hat. »Von uns wird absolute
Transparenz verlangt, aber die Fonds müssen uns nichts
mitteilen«, ärgert sich der IR-Manager eines
Unternehmens im Gesundheitswesen. Nicht einmal, wie
viele Stimmrechte auf passives oder aktives Engagement
entfallen. Das macht durchaus einen Unterschied, weil die
passiven Stimmen an die Zugehörigkeit zum Index
geknüpft sind und deshalb nur abgestoßen werden, wenn
sich am Index etwas ändert. »Um diese Information zu
bekommen, müssen wir extra Dienstleister bezahlen!«,
beschwert sich der Vertreter eines Finanzkonzerns.
Immerhin – alle befragten deutschen
Unternehmensvertreter und Investmentprofis sind sich
einig: Im Unterschied zu anderen Großinvestoren bemüht
sich BlackRock, zumindest die wichtigsten
Aktionärspflichten zu erfüllen, wie etwa die Stimmen für
die Hauptversammlung rechtzeitig zu registrieren und bei
der Hauptversammlung abzustimmen. »Professionell«,
»informiert« waren häufig verwendete Begriffe, wenn es
um die BlackRock-Vertreter ging. Keiner klagte über ein
angespanntes Verhältnis, alles sei »stinknormal«, wie es
der IR eines Dax-Chemieunternehmens formuliert. Finks
Corporate-Governance-Truppe legt demnach Wert auf die
formalen Requisiten der guten Unternehmensführung.
Darunter fällt etwa die Einhaltung einer
»Abkühlungsphase«, bevor ein ehemaliger Vorstand in den
Aufsichtsrat wechseln darf. Oder die Forderung nach mehr
Frauen in der Vorstandsriege. Was aber auch zutage kam:
Mehr als dieses Minimum an Engagement findet bei einem
der größten Eigentümer deutscher Konzernanteile in der
Regel nicht statt. Im Jahresbericht 2013 des CorporateGovernance-Teams von BlackRock liest sich das ganz
anders. »Wir bauen Beziehungen zu unseren PortfolioUnternehmen auf, um ein gegenseitiges Verständnis in
Fragen der Performance, Strategie und Risikominderung
aufzubauen«, heißt es in der Broschüre mit dem schönen
Titel »Taking the long view«.
In dem Vierteljahresbericht vom Herbst 2014 beschreibt
die Londoner Corporate-Governance-Truppe ein paar –
stets anonymisierte – Beispiele ihrer Einsätze. Einmal habe
man mit einem »großen Schweizer Konsumgüterhersteller
über verantwortungsbewusstes Marketing gesprochen«.
Gemeint ist da wohl Nestlé und die Kritik an der
Vermarktung von Babynahrung, die allerdings bereits seit
einigen Jahrzehnten erhoben wird. Die BlackRock-Prüfer
kommen zu dem Schluss, der Konzern erfülle inzwischen
die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation. »Wir
werden die Fortschritte weiter überwachen«, schließt der
Bericht. In einem anderen Fall geht es um die Bezahlung
der Manager einer russischen Bank. Dabei will BlackRock,
dass die Bezüge für die Bankbosse künftig erfolgsabhängig
sein sollen. Aus den Statistiken lässt sich klar herauslesen,
dass BlackRocks Schwerpunkt in den USA liegt: Dort
fanden nach BlackRock-Angaben 2013 immerhin 658 aller
»Engagements« der Edkins-Truppe statt, in den Regionen
Europa, Mittlerer Osten und Afrika waren es insgesamt
231, Großbritannien 211, in Asien 332. Laut dem
Jahresbericht 2012 fanden in dem Jahr 692 »Engagements«
in Amerika statt, 283 in Australien und Neuseeland, 186 in
Großbritannien, 134 in Kontinentaleuropa, dem Mittleren
Osten und Afrika, 116 in Japan und 35 im restlichen Asien.
Laut dem Corporate-Governance-Bericht 2013 hat
BlackRock bei über 14 000 Hauptversammlungen mit
abgestimmt, davon waren 2 405 bei Unternehmen in
Europa. Ähnlich sah das Verhältnis im Jahr zuvor aus. Trotz
mehrfacher Nachfragen war BlackRock nicht bereit, ein
Gespräch mit Team Edkins über BlackRocks CorporateGovernance-Praktiken generell und speziell in Deutschland
zuzulassen. Stattdessen bat das PR-Team um einen
schriftlichen Fragenkatalog. Die Antworten kamen nach
Wochen und und gaben zum großen Teil in Passagen den
Inhalt der Corporate-Governance-Berichte wieder. Offenbar
hat Deutschlands größter Aktionär kein Interesse, gezielte
Nachfragen zum Umgang mit seinen Portfoliounternehmen
in der Öffentlichkeit zu beantworten.
Die aufwendigen Broschüren und informationsgeladenen
Webseiten können nicht über ein Problem hinwegtäuschen:
Die neuen Großkapitalisten können sich nur um gezählte
Unternehmen in ihrem Besitz wirklich kümmern. Denn die
Aktionärsrolle richtig auszufüllen, bedeutet Aufwand. Einen
Aufwand, den große Fondsgesellschaften nicht nur für ein
einzelnes Unternehmen betreiben müssen oder müssten,
sondern für Hunderte Unternehmen in ihren Portfolios. In
Dutzenden Ländern, nach den jeweiligen Vorschriften.
Allein die damit verbundene Bürokratie – etwa das
ordnungsgemäße Anmelden der Stimmrechte – kostet
Manpower, kostet Geld. Kosten, die ein Fondsanbieter nur
bedingt in Form von Gebühren an seine Kunden
weitergeben kann. Denn die Vermögensverwalter liefern
sich einen harten Konkurrenzkampf. BlackRock ist selbst
eine börsennotierte Gesellschaft, deren Anteilseigner
wachsende Gewinne und steigende Kurse sehen wollen.
Wenig überraschend gehen die großen Fondsgesellschaften
bei ihrer Interaktion mit den Unternehmen in ihren
Portfolios gezielt vor und beschränken sich beim großen
Rest auf das Notwendigste.
Finks Aufruf zu einem ständigen Dialog mit den
Managern seiner Portfolio-Unternehmen kann man auch als
Eingeständnis verstehen, dass BlackRock selbst nicht bei
jedem Manager nachfragen kann.
BlackRock ist zwar die größte Fondsgesellschaft, die mit
dem Problem zu kämpfen hat, aber bei Weitem nicht die
einzige. Die großen Fonds müssten bei all den
Unternehmen, an denen sie eine Beteiligung haben, bei der
Hauptversammlung erscheinen. Und nicht nur das: Sie
müssten auch alle jeweiligen Tagesordnungspunkte kennen
und sich eine Meinung zu denen gebildet haben, die zur
Abstimmung anstehen. Punkte wie die Vergütung der
Manager des Unternehmens, die Höhe der
Dividendenausschüttung oder eine anstehende
Kapitalerhöhung. Sie müssten sich als Aktionäre im Vorfeld
über die Kandidaten für Vorstand oder Aufsichtsratsposten
schlau gemacht haben. Und natürlich die Performance des
Unternehmens bewertet haben. Und das alles nicht nur für
ein Unternehmen, sondern für Hunderte, womöglich
Tausende in verschiedenen Ländern. Da kamen findige
Köpfe an der Wall Street auf die Idee, einen Service
anzubieten, der den überlasteten Fondsverwaltern diese
Arbeit abnimmt. So entstand der Job eines »Proxy
Advisors«, zu deutsch genauso kryptisch
»Stimmrechtsberater«. Der nach wie vor größte Anbieter
solcher Dienstleistungen rund um die »Corporate
Governance« ist das 1985 gegründete New Yorker
Unternehmen Institutional Shareholder Service, besser
bekannt unter dem Kürzel ISS. Bei über 7,5 Millionen
Abstimmungen übernimmt ISS für die eigentlichen
Aktionäre und vertritt nach eigener Aussage die
Stimmrechte von über vier Billionen Aktien. (Die Nummer
zwei in diesem Markt der Aktionärsflüsterer ist Glass
Lewis, die Tochter eines kanadischen Pensionsfonds.) Die
Stimmrechtsberater analysieren im Auftrag von
Pensionkassen, Hedgefonds oder eben Investmentfonds wie
denen von BlackRock die Tagesordnungen für die jeweilige
Hauptversammlung und bewerten Kandidaten für Vorstand
und Aufsichtsrat. Dann empfehlen sie ihren Auftraggebern,
wie diese in dem jeweiligen Punkt abstimmen sollen.
Maßstäbe sind dabei Corporate-Governance-Leitfäden wie
eine Vermeidung von Ämterhäufung bei Aufsichtsräten
oder eine »Cool off«-Periode für den Wechsel vom Vorstand
in den Aufsichtsrat. Aber es gibt auch spezifische Vorgaben
des Auftraggebers – etwa Umweltschutz oder soziale
Kriterien, die die Stimmrechtsberater bei ihren Analysen
berücksichtigen. Doch nicht einmal die Stimmrechtsberater
schaffen die Aufgabe ohne Hilfe. ISS etwa hat ein in der
Corporate-Governance-Branche viel bewundertes SoftwareSystem, das Tagesordnungen von Hauptversammlungen
entsprechend durchsiebt und Empfehlungen praktisch
automatisch erstellt. (Diese werden laut ISS aber noch von
menschlichen Analysten überprüft.) Die Fonds müssen den
Empfehlungen nicht folgen, tun es aber überwiegend.
Warum sollten sie sonst Millionen an Gebühren an ISS oder
Glass Lewis zahlen? Ihre Tätigkeit hat den
Stimmrechtsberatern inzwischen selbst zu Einfluss
verholfen. Auch in Deutschland. Sie seien die »heimliche
Macht« im Dax behauptete etwa die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung im April 2015. Kurz darauf, im
Mai, lieferten diese die Probe aufs Exempel. ISS empfahl
im Vorfeld der Hauptversammlung der Deutschen Bank
ihren Klienten, gegen eine Entlastung der CoVorstandschefs Anshu Jain und Jürgen Fitschen zu
stimmen, Glass Lewis riet zur Stimmenthaltung. Als Grund
nannten die Berater unter anderem die 2,5 Milliarden
Dollar hohen Zahlungen für die Verwicklung der Bank in
den Skandal um die Manipulation des Libor-Zinssatzes. Die
Entlastung des Vorstands ist normalerweise eine reine
Routinesache. Hier wurde sie zum historischen
Misstrauensvotum. Üblich sind sonst Zustimmungsraten
wie einst in der Sowjetunion – 90 Prozent und mehr. Jain
und Fitschen erhielten bei der denkwürdigen
Hauptversammlung nur jeweils knapp 60 Prozent. Wenige
Wochen später traten die beiden Vorstände zurück. Das
Muskelspiel der Stimmrechtsberater hatte offenbar
Wirkung gezeigt.
So ganz passt Fink & Co. diese neue Macht der
Stimmrechtsberater, die sich praktisch verselbstständigt
hat, offenbar nicht. So warnte Fink die Manager »seiner«
Portfolio-Unternehmen ausdrücklich davor, sich darauf zu
verlassen, dass BlackRock blind den Empfehlungen von ISS
& Co. folgen werde. »Wir ziehen unsere eigenen Schlüsse
unabhängig von den Stimmrechtsberatern«, schrieb Larry
Fink 2011 an die Manager großer US-Unternehmen, an
denen BlackRock Anteile hielt. »Wir stimmen dabei
aufgrund unserer eigenen Richtlinien ab, die unsere
Aufgabe als Treuhänder und Wahrer der ökonomischen
Interessen unserer Kunden widerspiegeln.« Will heißen:
Wir, BlackRock, sind die wahren Herren, die Jungs von ISS
und Glass Lewis sind nur unsere Dienstleister. Am Ende
gilt, was wir entscheiden. Allerdings kommt BlackRock
ohne die Zuarbeit der Berater offenbar nicht aus: Aus
Berichten und Insiderinformationen geht hervor, dass
BlackRock nach wie vor zu den Kunden der
Stimmrechtsberater gehört.
Der Witz dabei: Hier rangeln letztlich Stellvertreter mit
Stellvertretern. Sowohl die Macht von ISS als auch die
BlackRocks basiert letztlich auf der Abwesenheit der
eigentlichen Eigentümer: der Anleger. Und das ist ein
Problem.
Finanzsurrealismus: Kapitalismus ohne
Kapitalisten
Anleger spielen in unserem System der Marktwirtschaft
eine fundamentale Rolle: Sie entscheiden, welche
Unternehmen expandieren können und welche schließen
müssen. Im eigenen Interesse wollen sie ihr Geld den
Unternehmen geben, die die besten Zukunftsaussichten
haben. Anteilseigner wählen zwischen den vorhandenen
Anlagemöglichkeiten aus und sorgen so für die
bestmögliche Verteilung des vorhandenen Kapitals. Das
heißt auch, dass sie die Unternehmen ständig beobachten
und kontrollieren, ob diese das Kapital wirklich
nutzbringend einsetzen. Im Gegenzug für ihren Einsatz
erhalten Aktionäre verbriefte Rechte – sie haben ein
Anrecht auf einen Teil des Gewinns und dürfen das
Management bestimmen. Das ist die ideale Version. Davon
entfernen wir uns immer weiter. Im Finanzkapitalismus 2.0
hat sich die Verbindung zwischen den Eigentümern und
den Unternehmen in eine immer längere Kette verwandelt.
Die Zwischenglieder sind professionelle Verwalter, die im
Namen der eigentlichen Anleger handeln. Das Phänomen
hat einen Namen: Es ist die »Trennung des Eigentums vom
Eigentum«. Das klingt wie ein Echo von Magritte, der
»Ceci n’est pas une pipe« unter das Bild einer Pfeife
schrieb. Doch der Finanzsurrealismus ist längst Alltag. Die
Verlängerung der Investitionskette resultiere in
zusätzlichen Vermittlerkosten sowohl für das System, als
auch für den Anleger, während die Kontrolle über
Entscheidungen sich immer weiter von denjenigen
entferne, die deren Risiken tragen und deren potenzielle
wirtschaftliche Vorteile erhalten, heißt es in einem Bericht
des New Yorker Conference Board, eines
unternehmensnahen Wirtschaftsinstituts vom November
2013. Eine Pensionskasse etwa vergibt den Auftrag, einen
Teil ihrer Gelder zu verwalten, an einen
Vermögensverwalter wie BlackRock. Der wiederum verteilt
sie auf verschiedene Fondsmanager. Darunter kann ein
Hedgefonds sein, der wiederum passive ETFs kauft, um am
Markt zu spekulieren. Jeder dieser dazwischengeschalteten
Akteure will bezahlt werden und hat wiederum eigene
Interessen, die nicht immer mit denen der eigentlichen
Eigentümer übereinstimmen.
Diese zunehmende »Trennung des Eigentums vom
Eigentum« führe zu schwerwiegenden Verwerfungen,
argumentiert Leo E. Strine, Richter am Obersten
Gerichtshof des Bundesstaates Delaware. Strine war zuvor
lange Richter am Chancery Court in Delaware. Seine
Stimme hat Gewicht, denn dieses Gericht hat großen
Einfluss auf das weltweite Konzernrecht. (Im Bundesstaat
Delaware hat die Mehrheit der großen börsennotierten USUnternehmen ihren rechtlichen Sitz, es ist eine US-interne
Steueroase.) Die Trennung, so warnte Strine in einer viel
beachteten Rede 2007, habe eine neue Stellvertretermacht
geschaffen, mit »Risiken für den einzelnen Investor, aber
auch für den Wohlstand unserer Nation«. Das Problem der
wachsenden Dominanz der Vermögensverwalter ist nicht,
dass sie Unternehmen in eine bestimmte Richtung lenken.
Zumindest ist es nicht das größte Problem. Das
zunehmende Problem ist, dass sie sich nicht wirklich für
das Schicksal der meisten Unternehmen in ihren Portfolios
interessieren.
Eine kuriose Anekdote beleuchtet das: Im März 2015
hätte BlackRock beinahe das australische Unternehmen
Monadelphous Group übernommen. Aus Versehen. Denn
BlackRock hielt über seine Fonds über 20 Prozent an der
Bauingenieursgruppe. Nach den australischen
Börsenvorschriften muss ein Investor, dessen Anteil die 20
Prozent übersteigt, jedoch ein Übernahmeangebot für das
komplette Unternehmen abgeben. BlackRock entschuldigte
sich und gab die Schuld den fehlerhaften Berechnungen
der Indexherausgeber, die entsprechende Indizes, auf
denen BlackRocks Fonds basierten, falsch kalkuliert hätten,
sodass BlackRock zu viele Aktien erworben hatte und über
die kritische Grenze gekommen sei. »Unsere interne
Kontrolle hat das Problem erkannt, wir haben es der
Aufsicht gemeldet und entsprechend kontrolliert«, erklärte
BlackRock gegenüber der Financial Times .
Ein weit problematischeres Beispiel für die Folgen der
Stellvertreter-Eigentümer ist die Deutsche Bank. Jahrelang
taumelte die Großbank von einem Skandal in den nächsten
– Wackelhypotheken, Libor-Manipulation, Geldwäsche und
dergleichen unappetitlicher Vorwürfe mehr erhoben die
Behörden so regelmäßig, dass Razzien von Ermittlern in
den Frankfurter Türmen geradezu Routine wurden. Immer
neue Milliarden musste die Bank zahlen. Doch die
Großinvestoren ließ das jahrelang recht kalt. (BlackRock
war zum Zeitpunkt, als Anshu Jain und Jürgen Fitschen
gehen mussten, mit 6 Prozent der größte Einzelaktionär.)
Sie zogen die Reißleine erst, als sie nicht länger glaubten,
dass Jain und Fitschen ihre Renditeversprechen einhalten
würden. Fink hatte noch ein paar lobende Worte für seinen
scheidenden Liebling: »Anshu hat das Richtige getan, er
war selbst zum Thema geworden. Ich bin froh, dass er
selbst entschieden hat zu gehen, statt vom Aufsichtsrat
gezwungen zu werden.«
Um die Sollbruchstelle in der für unser System so
wichtigen Verbindung zwischen Anleger und Unternehmen
zu kitten, haben sich Behörden und Organisationen in den
vergangenen Jahren Kataloge von Corporate-GovernanceRegeln und Selbstverpflichtungen ausgedacht. Da ist der
britische Stewardship Code, dann haben die Vereinten
Nationen »Prinzipien für verantwortungsbewusstes
Investment« erarbeitet, die auch Soziales und
Umweltbelange berücksichtigen. Japan hat sieben
Grundsätze für gute Unternehmensführung aufgestellt und
Deutschland den Corporate-Governance-Kodex erdacht.
Sicher alles wohlmeinende und hilfreiche Initiativen. Doch
eine OECD-Studie (S. Çelik, M. Isaksson 2013) ging der
Frage nach, warum trotz all dieser Anstrengungen das
Engagement der Großeigentümer weiter zu wünschen
übrig lässt. Das ernüchternde Fazit: Während bei manchen
Investoren, wie etwa Hedgefonds oder Private Equity
Fonds, aktives Engagement ein notwendiger Bestandteil
des Geschäftsmodells sei, stelle es bei anderen schlicht
zusätzliche Kosten dar. »Im ersten Fall braucht es keine
Regeln und im zweiten werden Regeln wenig mehr
erreichen, als dass Listen abgehakt werden«, heißt es in
der Studie. Mit anderen Worten: Das Grundproblem bleibt
bestehen, es gibt nur mehr Bürokratie. Dann sind da die
Interessenkonflikte. Etwa, wenn ein Vermögensverwalter
die Auseinandersetzung mit dem Vorstand eines PortfolioUnternehmens scheut, weil er gleichzeitig auf das Mandat
hofft, den Betriebspensionsfonds dieses Unternehmens zu
managen. »Das lässt manches Investmenthaus zögern,
allzu aggressive Forderungen aufzustellen«, schrieb Simon
Wong, Partner bei der Londoner Investmentfirma
Governance for Owners, 2011 in einem Kommentar für das
»Harvard Law School Forum on Corporate Governance«.
Da reiche manchmal schon eine versteckte Drohung von
Unternehmensseite, den Auftrag anderweitig zu vergeben,
beschreibt Wong seine Erfahrungen als Berater aus der
Praxis. (Governance for Owners war der frühere
Arbeitgeber von Michelle Edkins, bevor sie CorporateGovernance-Frontfrau bei BlackRock wurde.)
Bei BlackRock sei die Trennung zwischen den beiden
Geschäftsbereichen klar geregelt, versichert das
Unternehmen. So hat es Fink persönlich gegenüber dem
Magazin Fortune im Juli 2014 geschworen. Wobei er
einräumt, Anrufe von Unternehmenschefs zu bekommen,
darunter auch Bekannte und Freunde, die ihn auffordern,
BlackRock solle in ihrem Sinne abstimmen. Das bringe ihn
in eine unmögliche Lage, klagt der BlackRock-Boss in
Fortune. It pisses me off, so sein wörtlicher Kommentar, der
mit »verärgern« nur unzureichend übersetzt ist.
Die Schlagzeilen wie »Der Schattenmann, der die Welt
regiert« oder »Die heimlichen Herren im Dax«, die quasi
eine Fernsteuerung der Konzerne implizieren, gehen am
eigentlichen Kern vorbei. Entgegen dieser Befürchtungen
ist das Problem der neuen Germany Inc. nämlich nicht,
dass sich BlackRock oder die ausländischen Großaktionäre
in die Unternehmen einkaufen, um dann den Vorstand
herumzukommandieren. Bis auf aggressive Hedgefonds, zu
deren Strategie dieses Vorgehen gehört, haben die
Fondsgesellschaften schlicht nicht die Kapazitäten für ein
solches Mikro-Management. Im Verhältnis zu den
deutschen Unternehmen ist BlackRock wie ein New Yorker
Immobilienmogul, der sich müht, seine Besitzungen in
Übersee so profitabel und reibungslos wie möglich zu
betreiben. Die Unternehmenschefs entsprechen dem
Hausverwalter, der dem Besitzer regelmäßig die Miete
überweist und das Gebäude in Schuss hält. So lange der
Verwalter sich als zuverlässig erweist, besteht kein Grund
sich einzumischen. Dieses Laissez-faire mag angenehm für
den Verwalter sein. Doch irgendwann passt das Haus nicht
mehr in das Portfolio oder das Haus braucht eine
aufwendige und langwierige Sanierung, dann verkauft der
Eigentümer es einfach. Im schlimmsten Fall an ein
Abbruchunternehmen, eine Heuschrecke.
Kapitel 9
Aladdin – der Dschinn in der
Apfelplantage
4 425 Kilometer liegen zwischen der Wall Street und
Wenatchee, fast ein ganzer Kontinent, auf jeden Fall aber
eine Welt. Wenatchee liegt ganz im Nordwesten der USA
am Columbia River, der sich seinen Weg durch Kanadas
Wälder Richtung Süden bahnt. Über Wenatchee ragen die
zackigen Bergrücken der Cascade Mountains, dahinter,
drei Autostunden entfernt, erstreckt sich der Pazifik. Noch
im Frühjahr tragen die Gipfel eine Kapuze aus Schnee,
während an den tieferen Hängen schon die Obstblüte
beginnt. Wenatchee, 30 000 Einwohner, behauptet stolz, die
»Welthauptstadt der Äpfel« zu sein. Es gibt ein ApfelBesucherzentrum, einen Apfel-Wanderweg und im April das
elf Tage dauernde Apfelblütenfest. Wer eine schmalere
Straße nach Osten hinauffährt, kommt an kleinen Häusern
mit ordentlichen Gärten vorbei. An einem Zaun hängt ein
Schild, auf dem »Honig zu verkaufen« steht. Die Straße
führt vorbei an Pferdekoppeln, Apfelplantagen und an
einem kleinen Flugplatz, bis sie an zwei flachen beigen
Neubauten anlangt. Sie sind von einem zwei Meter hohen
Zaun umgeben, das schwarze Stahlgittertor ist
geschlossen. Auf den Parkplätzen stehen vielleicht ein
halbes Dutzend Autos. Kameras überwachen die
Umgebung. Fremde Fahrzeuge, die zu lange stehen
bleiben, locken nach einigen Minuten einen uniformierten
Wachmann aus dem Gebäude. Kein Schriftzug, kein
Firmenname deutet auf das hin, was im Inneren der Anlage
passiert.
Hier, auf einem ehemaligen Weizenfeld, speichert,
selektiert, kalkuliert, arbitragiert Aladdin in seinen
Tausenden Prozessoren endlose Zahlenreihen und Formeln.
Vierundzwanzig Stunden, sieben Tage die Woche. Aladdin
ist BlackRocks elektronischer Dschinn. Wie der Geist aus
der Flasche im Märchen hat Aladdin dessen sagenhaften
Erfolg möglich gemacht. Aladdin ist, was BlackRock im
Innersten zusammenhält. Aladdin ist die Basis für seine
wachsende Macht.
BlackRock macht aus Aladdins Existenz und Bedeutung
gar kein Geheimnis. Im Gegenteil: Die PR-Abteilung hat
sogar einen Werbefilm über das Elektronik-Superhirn
gedreht. Da sehen wir junge dynamische Menschen
unterschiedlichster Herkunft und Hautfarbe – offensichtlich
allesamt BlackRock-Mitarbeiter. Sie sitzen hemdsärmelig in
New Yorker Taxis oder stehen vor Londons Big Ben und
den typischen roten Doppeldeckerbussen, posieren
windzerzaust vor San Franciscos Golden Gate Bridge oder
Hongkongs Skyline. Sie erzählen uns mit ernster Stimme,
wie Aladdins tägliche Arbeit so aussieht: über 1,8 Millionen
Berichte erstellen, Zinsbewegungen in Europa beobachten
– genauso wie die Dürre im Mittleren Westen der USA –,
dann die Silberpreise in Asien abfragen. Gleichzeitig
registrieren, wie vier Milliarden Aktien an der New Yorker
Börse die Hände wechseln und selbst 25 000
Handelstransaktionen abwickeln und – aufgepasst! –
obendrein noch 3 000 Anlage-Katastrophen verhindern.
Denn das ist Aladdins eigentliche Aufgabe: festzustellen,
welche Auswirkungen all diese Informationen und
Ereignisse auf 20 000 Anlageportfolios haben und damit auf
deren Sicherheit, über die Aladdin ständig und
unermüdlich wacht. Aladdin soll sie vor unangenehmen
Überraschungen und vor allen Dingen unerwarteten
Verlusten schützen. Aladdin bewacht auf diese Weise 14
Billionen Dollar. Auch das eine Information, die BlackRock
stolz präsentiert. Über seine Rechner fließen damit Mittel,
die der Wirtschaftsleistung von China, Brasilien und
Frankreich zusammen entsprechen. Es ist eine Summe,
über die keine Regierung, keine Institution der Welt sonst
verfügen kann.
Wenn die Macher des Werbestreifens die Absicht hatten,
den Zuschauer zu beeindrucken, dann gelingt das – wenn
auch nicht unbedingt im positiven Sinne. Vollends
unheimlich wird der Werbespot dann, wenn Aladdin durch
die BlackRock-Mitarbeiter zu uns spricht – sie damit quasi
zu seinen menschlichen Avataren macht. Sie sagen dann
Sätze wie diese: »Ich bin Aladdin und finde die Zahlen
hinter den Zahlen.« Oder »Ich bin Aladdin und ich weiß,
was ich weiß. Überall und sofort.« Aladdin sei intelligenter
als jeder Algorithmus, mächtiger als jeder Prozessor,
versichern uns Aladdins menschliche Sprecher. Kurz:
Aladdin sei eine neue Art der Intelligenz, erklärt Larry
Fink, der ebenfalls in dem Werbespot auftaucht. Von
BlackRock selbst wird Aladdin in dieser Darstellung als ein
kollektives Genie gefeiert, ein hoch begabtes Zwitterwesen,
halb Mensch, halb Technologie.
Hunderte Menschen haben über zwei Jahrzehnte an den
Programmen gearbeitet, die Aladdin ausmachen.
Inzwischen besteht Aladdin aus einem Heer von Tausenden
Analysten und rund 6 000 Rechnern, die Hunderte
Millionen Kalkulationen pro Woche ausführen. Eine Anlage,
die die Weltraumbehörde NASA neidisch machen kann. All
die Kapazität braucht Aladdin, um täglich, stündlich,
minütlich und teilweise sogar sekündlich auszurechnen,
welchen Wert Aktien, Bonds, Devisen oder Kreditpapiere
haben, die in den milliardenschweren Anlageportfolios
liegen. Gleichzeitig durchleuchtet Aladdin, wie sich dieser
Wert verändern dürfte, wenn sich das Umfeld verändert –
durch die Konjunktur etwa oder die Umsatzzahlen, wenn
Währungskurse purzeln oder der Ölpreis klettert. Das
klingt wesentlich einfacher, als es ist, denn Wertpapiere,
mit denen Investmenthäuser und Anleger jonglieren, sind
komplizierte Konstrukte. Meist handelt es sich um Pools
mit Abertausenden verschiedenen Anlageprodukten,
Wertpapieren, Immobilien, Fondsanteilen. Das macht es
extrem komplex herauszufinden, wie viel das Investment
eigentlich wert ist – und wo die Gefahren liegen.
Der Vorteil für Aladdins Kunden: Wer seine weltweit
verstreuten Positionen und Risiken auf Knopfdruck abrufen
kann, gewinnt einen entscheidenden Vorsprung im immer
schnelleren Wall-Street-Milliardengezocke. Er kann
rechtzeitig kaufen oder verkaufen, Gewinne einstreichen
oder Verluste vermeiden. »Es ist eine Art
Kernspintomograph für die Anlageportfolios von
institutionellen Investoren«, erklärt es Rob Goldstein, der
Hüter vom »Genie in a Bottle«, Besuchern.
Eins werden mit der Maschine
Rob Goldstein wird intern gerne mal als »Wunderkind«
bezeichnet. Groß und schlacksig strahlt der Anfang 40Jährige die Begeisterungsfähigkeit von jemandem aus, der
noch nicht lange aufgehört hat, Videospiele zu spielen und
der seinen ersten Commodore-64-Computer aus den
1980er-Jahren noch in der Garage gebunkert hat. Nur die
goldene Uhr und die Goldrandbrille fallen aus dem Bild.
Goldstein gehört zu den Pionieren bei BlackRock. Er hat
praktisch sein ganzes Erwachsenenleben bei Fink
verbracht, denn er kam bereits 1994 zu BlackRock, zwei
Wochen nach seinem Abschluss an der Universität. Das war
zu einer Zeit, als BlackRock noch das Wall-StreetÄquivalent einer Garagenfirma war. Heute ist er Chief
Operating Officer und Global Head von BlackRock
Solutions. Das sind seine offiziellen Titel. Goldstein ist vor
allem jedoch der Hüter von Aladdin.
Hinter dem 1001-Nacht-Namen verbirgt sich eine
vergleichsweise dröge Erklärung. Aladdin steht für die
englischen Begriffe »Asset Liability and Debt, Derivative
Investment Network«. Angeblich ist ein früher Kunde auf
die märchenhaft klingende Abkürzung für das Programm
verfallen.
Aladdins Anfänge sind genauso prosaisch. Das globale
Superhirn hat seinen Ursprung in jenem Rechner, der einst
in der Küchenzeile in BlackRocks erstem Büro stand. Die
ersten Programme, die auf dem Gerät liefen, tüftelten
damals Mitgründer und MIT-Ass Bennett Golub und Charlie
Hallac, BlackRocks Angestellter aus den frühen
Gründertagen, zusammen aus. Einmal, so will es die
Legende, wollten die beiden Daten ausdrucken, doch im
ganzen Büro war kein Druckerpapier zu finden. Nur noch
ein Stapel grünes Papier. Was als Notlösung anfing, wurde
zur Tradition und noch heute heißen die Aladdin-Ausdrucke
intern das »grüne Paket«.
Aladdin ist, wenn man so will, Larry Finks Paranoia in
Sachen Risiko, umgeschrieben in 25 Millionen Zeilen
Computer-Code. Das sind etwa so viele Code-Zeilen wie
die, die Facebook braucht, um seine Milliarden
Nutzerprofile zu verwalten. Microsofts Windows, das unter
Techies als eines der komplexesten Programme, wenn nicht
das komplexeste überhaupt, gilt, hat rund 45 Millionen
Code-Zeilen.
Die frühen BlackRocker merkten, dass die
Kreditwertpapiere, die Larry Fink einst mit aus der Taufe
gehoben hatte, seit den Pioniertagen immer komplexer
geworden waren. Es gab immer mehr Risikotranchen, die
Investoren erwerben konnten. Neben Hypotheken wurden
nun auch andere Kredite gebündelt – etwa Autokredite
oder Studentenkredite. Mehr und mehr setzten die WallStreet-Banker »financial engineereing« ein und damit
wurde es immer schwieriger für die Käufer der Papiere,
herauszufinden, wie groß das Gewinn- und Verlustpotenzial
dabei war. Zunächst nutzte BlackRock die Analysen für die
eigenen Transaktionen. Doch zunehmend meldeten sich
Kunden, die ihre Kreditportfolios von dem System
analysieren lassen wollten. Der Durchbruch kam, wie
bereits beschrieben, mit dem Mischkonzern General
Electric. Aladdins Hüter Goldstein gehörte zum Team, das
für GE das berüchtigte Kidder Peabody Portfolio
auseinandernahm. Die Daten dafür wurden auf einer
Diskette gespeichert, jene Diskette, die heute noch
gerahmt in Goldsteins Büro hängt. So wie ein Rockstar
seine goldene Schallplatte aufhängt. Oder der Schlossherr
ein Bild seiner Ahnen.
So etwas wie Aladdin hat es noch nie gegeben. Um besser
zu verstehen, was in dem Superhirn vorgeht, stelle man
sich vor, wie es wäre, wenn Aladdin statt Hunderte
Milliarden an Transaktionen und Daten am Finanzmarkt zu
durchforsten, unser alltägliches Chaos überwachen würde.
Man könnte sich seinen Einsatz etwa folgendermaßen
vorstellen: Aladdin übernimmt morgens die Weckfunktion.
Da er aus den historischen Erfahrungswerten vergangener
Tage ermittelt hat, wie lange das Duschen, Anziehen,
Frühstückmachen, Broteschmieren und Schulranzenpacken
jeweils brauchen, gleicht er diese Zeitdauer mit dem UBahn-Fahrplan ab. Den Fahrplan wiederum gleicht er auch
noch mit den tatsächlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten an
der Haltestelle ab, die er im Laufe der vergangenen
Monate oder gar Jahre gesammelt hat. Er checkt die
aktuellen Wetterdaten und empfiehlt, bei hoher
Niederschlagswahrscheinlichkeit, Schirm und Gummistiefel
nicht zu vergessen. Schließlich kalkuliert er, ob es bei
normaler Gehgeschwindigkeit noch rechtzeitig zur U-BahnStation reicht und was passiert, wenn der Lieblingspullover
des Sohnes kurzfristig unauffindbar ist oder der Vater
nochmal zurückmuss, um das vergessene Mobiltelefon zu
holen. So kann Aladdin warnen, wenn Gefahr besteht, zu
spät in die Schule oder ins Büro zur Arbeit zu kommen.
Diese Kalkulationen würde Aladdin nicht nur für eine
Familie vornehmen, sondern für alle Familien der Schule, ja
sogar für die des ganzen Schulbezirks. Andere Risiken sind
komplexer: Etwa wenn auf dem Schulweg ein Taxi bei
einem illegalen Überholmanöver außer Kontrolle gerät und
auf dem Bürgersteig landet, dann ist das ein seltenes, aber
nicht auszuschließendes Risiko. Ein tödliches Risiko. In der
Finanzwelt wäre das zum Beispiel die Tatsache, dass
Hypotheken in den USA massenweise ausfallen. Ein Risiko,
aber eines, das vor 2007 viele in der Finanzbranche für
wenig wahrscheinlich hielten – weit weniger
wahrscheinlich, als vom Taxi überfahren zu werden. Aber
auch solche seltenen, aber verheerenden Risiken soll
Aladdin rechtzeitig aufspüren – damit BlackRock und seine
Kunden sie vermeiden können.
Doch Aladdin ist mehr als ein Computerprogramm und
weit mehr als eine Datenbank. Aladdin, das versteckte
Superhirn in der Apfelplantage, ist Vorbote einer Zukunft,
die den Maschinen gehören wird.
Die Halle ist dunkel, nur hier und da flimmern die kleinen
Vierecke von Smartphone-Displays auf. Es könnte das Set
für Alien, den Hollywood-Science-Fiction-Horrorklassiker,
sein. Zu dem Grusel-Effekt tragen auch die Schaukästen
auf der Bühne bei, in denen vage künstliche Gliedmaßen
und ein Mannequinkopf zu erkennen sind. »Kunst«, erklärt
der Moderator, nachdem er die vielleicht vier- bis
fünfhundert Anwesenden, die auf Plastikklappstühlen
sitzen, bei der Veranstaltung »Rise of the Machines«
begrüßt hat. Sie könnte auch »Warten auf Kurzweil«
heißen. Einer der Besucher ist Alan S., der wie die meisten
hier nur wegen ihm gekommen ist. Er hat sogar einen
Nachtflug von San Francisco in Kauf genommen, um
rechtzeitig zur Konferenz von Ray Kurzweil in New York zu
sein. »Ray ist der Philosoph der Techies«, sagt Alan, auf
dessen T-Shirt »singularity.net« steht. Singularity ist der
Zeitpunkt, an dem künstliche Intelligenz die menschliche
überholen wird. Der Physiker und Mathematiker John von
Neumann, einer der Beteiligten des Manhattan Project und
Miterfinder der Atombombe, verwendete den Ausdruck in
den 1950er Jahren in dem Zusammenhang als Erster.
Breiter bekannt machte den Begriff der Science-FictionAutor Vernor Vinge. Zu den großen Propheten der
Singularity gehört heute Ray Kurzweil. Der fast 70-Jährige
gilt seinen Anhängern als Genie, der Autodidakt hält 19
Ehrendoktorwürden und hat erfolgreich mehr als ein
halbes Dutzend Unternehmen gegründet. Time widmete
ihm eine Titelgeschichte, eine Ehre, die er unter anderem
mit Papst Franziskus und Michail Gorbatschow teilt. Laut
Kurzweil, dessen Beruf man am ehesten mit Futurist
beschreibt, wird die künstliche Superintelligenz im Jahr
2045 soweit sein, ihre menschlichen Schöpfer zu
überrunden. Seinem Werk Die Singularity ist nah gab er
den Untertitel Wenn Menschen die Biologie überwinden.
Gemeint ist nicht die Möglichkeit, dass diese Vorhersage
eintritt, sondern der Zeitpunkt. Denn Kurzweil ist sicher,
dass Mensch und Maschine fusionieren.
In dem hippen Nachtclub am unglamourösen Rand
Manhattans treffen sich an einem grauen Wintertag 2013
Kurzweils Fans. Doch ihr Idol ist erst für den Höhepunkt
der Veranstaltung vorgesehen. Davor dürfen andere
Futuristen ihre Prognosen mit dem wohlwollenden
Publikum teilen. Da ist etwa Jincey Lumpkin, die SexKolumnistin der Huffington Post und Chief Sexy Officer
eines Start-ups namens Juicy Pink Box, das online lesbische
Pornos anbietet. Lumpkin ist außerdem überzeugte
Kurzweil-Anhängerin und Juristin. Bis 2047 werden
Roboter eine dem Menschen ähnliche Intelligenz besitzen,
stellt sie fest. Und sie werden unsere Sexpartner werden.
Da sei es wichtig, meint die Anwältin, sich früh ethische
und rechtliche Fragen zu stellen, etwa inwiefern ein
Roboter einen eigenen Willen habe und ob man oder frau
einen Roboter vergewaltigen könne. An ihren Vortrag
schließt sich ein Kurzfilm über einen Raumfahrer der
Zukunft an, der mit einem Roboter als einzigem Begleiter
strandet. Der Roboter hat eine heimliche Vorliebe für
Robot-Pornos. Die Sache geht nicht gut aus – am Ende
schlitzt sich der Roboter die Ölleitungen auf. Schließlich ist
es soweit: Der Moderator kündigt den Star des Tages an,
fast erwartet man einen Tusch. Dann betritt ein schmaler,
älterer Mann mit Stirnglatze die Bühne. Er trägt einen
dunklen Anzug und bequeme Halbschuhe, die Lesebrille
baumelt an einem Band um den Hals. Kurzweil, der 100
Pillen am Tag schluckt, die sein Leben verlängern sollen,
wirkt älter als auf seinen Pressefotos. (Vor einigen Jahren
waren es noch 150 Pillen am Tag, doch die Wirkstoffe seien
besser geworden, vertraute Kurzweil 2015 einem FinancialTimes-Reporter an, dem er beim Frühstückstermin zudem
Früchte, dunkle Schokolade, Makrelen und – laut dem FTMann »fade schmeckenden« – Porridge servierte.)
Kurzweil ist ein routinierter Redner. Während das
aufgeregte Gemurmel im nun gut gefüllten Saal noch
anhält, klickt er schon per Fernbedienung die ersten
Grafiken auf den Bildschirm. Er beschreibt seine Theorie,
dass das Gehirn als eine Hierarchie von Mustern
verstanden werden kann. Mit dieser Theorie sei es möglich,
die Hirnfunktion künstlich nachzubilden. Damit werde der
nächste Schritt der Evolution für den Menschen einsetzen.
Der bisherige technologische Fortschritt belege seine
These. Kurzweil spricht über Cloud-Computing, das
fahrerlose Google-Auto, Stammzellen, IBMs Supercomputer
Watson, den Kampf um die Internetfreiheit, Smartphones.
Selten kann er sich verkneifen, darauf hinzuweisen, dass er
ja bereits Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zuvor, die heutigen
Errungenschaften mehr oder weniger vorhergesagt habe.
Damals sei er allerdings als Spinner abgetan worden.
Das wird Kurzweil nicht mehr ganz so häufig. GoogleMitgründer Larry Page holte ihn als Chef-Entwickler für
Artificial Intelligence. Mithilfe künstlicher Intelligenz soll
Kurzweil eine neuartige Suchmaschine entwickeln. Im
Sommer 2014 zeigte sich Kurzweil bei einer Silicon-ValleyKonferenz des Tech-Konzerns gewohnt optimistisch, in
nicht allzu ferner Zukunft einen künstlichen Assistenten
geschaffen zu haben, der Anfragen nicht, wie bisher bei
Google üblich, mit der Anzeige von Links und
Querverweisen beantwortet, sondern eine vollständig
ausformulierte Antwort geben kann. »Man wird mit ihm
reden können wie mit einem Menschen«, beschied
Kurzweil die Journalisten. Kurzweil will Computern
beibringen, nicht nur Worte in einem Text zu finden,
sondern den Text zu verstehen wie ein Mensch. Diesem Ziel
am nächsten gekommen ist Watson, das jüngste Superhirn
von IBM. Watson trat 2011 erfolgreich gegen menschliche
Gegenkandidaten beim amerikanischen TV-Quiz Jeopardy
an. Doch nach wie vor basiert Watsons AI auf der Fähigkeit,
mehr Daten zu analysieren als jeder Mensch und dabei
Muster zu entdecken. Kurzweil will Maschinen dazu
bringen, den tieferen Sinn von Worten zu erfassen. Wenn
Watson den Satz »John verkauft seinen roten Volvo an
Mary« liest, dann versteht er nicht, dass es dabei um einen
Eigentumstransfer geht. Kurzweils Maschinen sollen solche
Zusammenhänge verstehen können.
Den von ihm verkündeten Aufstieg der Maschinen sieht
Kurzweil als uneingeschränkt positiv. Er selbst hofft darauf,
lange genug zu leben, um sein biologisches Gehirn in einen
Computer hochladen zu können und so unsterblich zu
werden. Vor allem im Silicon Valley, wo Tausende
Ingenieure, Software-Entwickler, Mathematiker, Physiker,
Kybernetiker täglich an immer smarteren und schnelleren
Maschinen arbeiten, ist die Mehrheit in Kurzweils Lager.
Doch nicht alle Futuristen sind derart überzeugt von
einem rosigen Cyberzeitalter. Ausgerechnet Physik-Guru
Stephen Hawking warnt vor den Computer-Superhirnen. In
der Wissenschaft ist Hawking mit seinen Beiträgen zur
Relativitätstheorie und der Physik Schwarzer Löcher nicht
unumstritten. Über 30 Jahre hielt er den LucasianLehrstuhl für Mathematik an der britischen University of
Cambridge. In seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit
stellte er seine Vision eines endlosen Universums ohne
Schöpfergott dar. Hawkings Botschaft ist der Sieg der
Wissenschaft über die Religion. Er ist ein großer
Befürworter der Weltraumkolonisierung – dafür soll die
Menschheit seiner Ansicht nach sogar die Mittel der
Gentechnik in Anspruch nehmen. (Mit Außerirdischen
sollen die Kolonisten aber besser keinen Kontakt
aufnehmen. Hawking ist überzeugt, dass es andere Wesen
im All gibt, diese aber feindlich gesinnt seien …) Der
Physiker leidet, seit er 20 Jahre alt ist, unter ALS, einer
seltenen degenerativen Erkrankung des motorischen
Nervensystems, und sitzt im Rollstuhl. Seit er seine
Fähigkeit zu sprechen verloren hat, kommuniziert er über
ein Computerprogramm, das er mit Augenbewegungen
steuert. Umso bemerkenswerter ist seine Skepsis
gegenüber künstlicher Intelligenz. Die Entwicklung einer
voll ausgebildeten künstlichen Intelligenz könnte das Ende
der Menschheit einläuten, warnte Hawking überraschend
in einem BBC-Interview 2014. »Sobald Menschen eine
künstliche Intelligenz entwickeln, die sich von alleine
weiterentwickelt, könnte diese sich selbst immer schneller
weitererfinden.«
Hawking mag man als Wissenschaftler abtun, der von
seinem akademischen Elfenbeinturm aus über die TechBranche urteilt. Doch anders verhält es sich mit Jaron
Lanier, der zu den Internetpionieren gehört. Er entwickelte
die ersten Anwendungen für virtuelle Realität – einen
Ausdruck, den er selbst kreierte –, ohne die es keines der
heutigen Videospiele geben würde. Und ausgerechnet
Lanier, mit seinen langen Dreadlocks und Hippie-Look, ist
die Kassandra der Tech-Branche geworden. In seinen
Büchern ruft er zum Widerstand gegen die Verherrlichung
der Computer auf. Sein Horror-Zukunftsszenario ist aber
ein ganz anderes als das Hawkings. Er fürchtet nicht die
Tyrannei durch sich verselbstständigende Maschinen,
sondern die Tyrannei durch Menschen mittels der
Maschinen. Und er sieht überall in unserem Alltag die
Anzeichen dieser Herrschaft. Die Besitzer der Maschinen –
also Eigentümer und Lenker der Tech-Giganten wie Google,
Facebook, Apple, Microsoft – bereicherten sich auf Kosten
der Arbeiter und der Mittelschicht. Die Saga von der
künstlichen Intelligenz diene nur dazu, die realen Beiträge
von Menschen zu diesen Tech-Imperien zu verschleiern,
ihnen ihren Wert abzuknöpfen. Lanier argumentiert, dass
die von den Silicon-Valley-Giganten für ihre Zwecke
genutzten Daten und Informationen nicht von einer
Maschine geliefert werden, sondern von den Nutzern
selbst, von Menschen. Die Masse kreiere Big Data, ohne
dafür entlohnt zu werden. Künstliche Intelligenz existiere
nicht, sagte Lanier dem amerikanischen Tech-Reporter
Kurt Andersen. »Es ist bloß ein modernes Wort für
Plutokratie.« Was aber sowohl Kritiker wie Lanier und
Hawking als auch Optimisten wie Larry Page und Ray
Kurzweil eint: Sie sind alle überzeugt, dass es über kurz
oder lang gelingen wird, Maschinen zu bauen, die wie
Menschen denken. Die Frage ist längst nicht mehr, ob es
sie geben wird. Die Frage ist: Wer wird sie kontrollieren?
Cyborgs beherrschen die Märkte
Es war 13:07 Uhr New Yorker Ortszeit am 23. April 2013,
als die Washingtoner Vertretung der Nachrichtenagentur
Associated Press den folgenden Tweet ins weltweite Netz
stellte: »Eilmeldung: Zwei Explosionen im Weißen Haus,
Barack Obama verletzt.« Binnen Millisekunden brachen die
Kurse an den Aktienmärkten ein.
So schnell hätte gar kein Mensch auf die Nachricht
reagieren können: Es waren Maschinen, spezialisiert
darauf, den Informationsstrom des Internets nach
Stichworten zu durchsuchen, die die Finanzmärkte
bewegen könnten. Obama, Weißes Haus in Verbindung mit
dem Wort Explosion löste bei den Suchmaschinen Alarm
aus. Andere Computer, zuständig für den Handel mit
Wertpapieren wie Aktien, empfingen die Nachricht und
starteten prompt Verkaufsorders. Dieses Mal führte die
Suche der künstlichen Marktwächter allerdings in die Irre:
Der angebliche Tweet von AP kam in Wirklichkeit von der
Syrian Electronic Army, Hacker-Terroristen, die das Regime
von Bashar el Assad unterstützen. Die digitalen Terroristen
hatten das Twitter-Konto von AP gehackt und die
Falschmeldung abgesetzt. Minuten später erklärte AP die
Meldung für falsch. Für die Aktienmärkte kam das APDementi allerdings zu spät: Über 200 Milliarden Dollar an
Vermögen waren durch den Kurssturz bereits vernichtet
worden. Menschliche Händler, etwa auf dem Parkett der
New Yorker Börse, waren bei der Meldung gleich skeptisch
gewesen – doch ihre Reaktionszeit war weit langsamer als
die ihrer Computerkollegen. Der Zwischenfall zeigt, wer
den Aktienmarkt inzwischen beherrscht: Maschinen. Oder
Bots, wie die Wall Street sie liebevoll nennt.
Computer erledigen inzwischen 70 Prozent des
Aktienhandels, 50 Prozent des Devisenhandels und 40
Prozent des Handels mit Anleihen. (BlackRock gehört, wie
beschrieben, zu den größten Antreibern des elektronischen
Handels von Anleihen.) Bekannt – oder besser: berüchtigt –
sind die High Frequency Trader, kurz HFT, Händler, die
dank enormer Rechnerkapazität und cleverer Software
nahezu in Lichtgeschwindigkeit durch die Finanzmärkte
surfen und dabei Gewinne einsacken. Die großen Banken
haben in den letzten Jahren ebenfalls elektronisch
aufgerüstet. Mit den Bots können menschliche Händler
nicht mithalten. »Klassische Trading Floors, jene
Turnhallen voller Händler mit ihren Vorstadtvillen und
BMWs – das ist bald Vergangenheit«, ätzt ein langjähriger
Kenner der Wall Street, der wegen seiner Auftraggeber
lieber anonym bleiben will. Bots verlangten eben keine
Boni. HFT, das sei schlicht Stand der Technik, sagt der ITChef einer internationalen Großbank, der ebenfalls seinen
Namen nicht gedruckt sehen will. Es geht nicht nur um den
Handel. Längst verfassen Computer Nachrichten für
Computer, die dann von anderen Computern »gelesen«
werden – und die daraufhin Investmententscheidungen
treffen. Wie bei der Reaktion auf das gehackte AP-TwitterKonto. Computerprogramme analysieren Datenmengen,
deren schiere Masse bis vor kurzem undenkbar war – ganz
zu schweigen davon, die Datenfluten sinnvoll zu
analysieren. Immer häufiger finden diese Prozesse ohne
menschliches Zutun statt. Vor nur wenigen Jahren war die
Wall Street ein Ort, wo es darauf ankam, über Erfahrung
und Beziehungen zu verfügen – heute kommt es auf den
richtigen Algorithmus an und die Verbindungen sind
elektronisch. »Maschinen haben die Wall Street
übernommen. Künstliche Intelligenz, mathematische
Modelle und Supercomputer haben menschliche
Intelligenz, menschliche Überlegung und menschliche
Umsetzung abgelöst«, ist das Fazit von Tom C. W. Lin,
Dozent an der Temple University Beasley, der sich in einem
Thesenpapier aus dem März 2014 mit »Cyborg Finance«,
wie er es nennt, auseinandersetzt. Cyborgs sind halb
Lebewesen, halb Maschine. Genauso beschreibt BlackRock
in seinem Werbevideo auch Aladdin – intelligence part
human, part technology.
Die Automatisierung wird immer schneller und nimmt
menschlichen Akteuren immer mehr Bereiche weg. Seit der
Finanzkrise haben Banken und andere Finanzinstitutionen
Hunderttausende Jobs gestrichen. Hätte es sich um eine
Branche wie die Autoindustrie gehandelt, hätte der
radikale Abbau zu Protesten und zu Händeringen über den
Verlust von Arbeitsplätzen durch die Automatisierung
geführt. Stattdessen herrscht, wenn überhaupt, nur
Schadenfreude. Weil die Öffentlichkeit den Bankern die
Krise nicht verziehen hat, findet die digitale Revolution des
Finanzsystems, außer bei den Betroffenen, kaum
Beachtung. Das ist ein Fehler – denn die Digitalisierung
unseres Finanzsystems hat enorme Folgen für uns alle.
Ihren Ursprung hat Cyborg Finance vor mehr als 40
Jahren. Damals mussten junge Wissenschaftler – vor allem
Physiker, Mathematiker, Informatiker, Chemiker –
feststellen, dass Stellen in der Forschung rar geworden
waren. Der Konkurrenzkampf um Technologie zwischen der
Sowjetunion und Amerika gipfelte in Sputnik und
schließlich der Mondlandung. Doch dann verschlang der
Vietnamkrieg die amerikanischen Mittel und staatliche
Forschung wurde zurückgefahren. Für viele der frisch
gebackenen Absolventen des MIT oder der University of
California tat sich da die Wall Street als Alternative auf.
Statt an Plänen für zukünftige Marskolonien zu basteln
oder neue Energiequellen zu suchen, tüftelten sie bald an
Renditemodellen und Hedging-Strategien. Und verdienten
ein Vielfaches. Später, als die Sowjetunion schließlich
auseinanderbrach, kam noch einmal ein ganzer Schwung
gut ausgebildeter Wissenschaftler nach. Anfänglich
nannten die Händler die Neuankömmlinge spöttisch
»Rocket Scientists« – sie glaubten nicht, dass die
»Raketenerfinder« sich gegen ihr Gespür und ihre
Erfahrungen durchsetzen würden. Doch das hat sich in den
vergangenen zehn Jahren gründlich geändert. In den
Handelsräumen hat der russische Programmierer den
irischen oder italienischstämmigen Broker als typischen
Wall-Streeter abgelöst. Vorbei die Zeiten, als sich an Tagen,
an denen der Dow Jones, der Aktienindex der
amerikanischen Schwergewichte wie IBM und Exxon, einen
neuen Rekord brach, die Händler an der Theke von Harry’s
Bar an der Südspitze Manhattans drängten und die
Gewinner des Tages eine Lokalrunde nach der anderen
ausgaben. Heute ist aus Harry’s Bar ein Edelrestaurant
geworden, in dem Nachmittags-Martinis gereicht werden
und die Hamburger vom japanischen Kobe-Rind stammen.
Von den alten Stammgästen ist keiner mehr da. Ihre
Nachfolger treffen sich statt in der Kneipe auch lieber mit
anderen Programmierern – etwa zum Hackathon, einer Art
Brainstorming-Party für Software-Entwickler, die
gemeinsam einen Tag oder eine ganze Woche lang,
angetrieben von einer Menge Take-out-Pizza, an Projekten
tüfteln.
Die Quants: Glauben an den Markt und die
Modelle
Der Aufstieg der Quants ist nicht aufzuhalten. Der Name
steht für die Methoden, die sie anwenden, um den Markt zu
verstehen: quantitative Analysen. Wer mit der Bezeichnung
angefangen hat, ist nicht ganz klar. Fest steht: Seit die
Quants ihren Einzug an der Wall Street gehalten haben,
sind sie für so gut wie alle Innovationen im Finanzbereich
verantwortlich. Mit ihren Formeln, Datensammlungen und
Hochleistungsrechnern haben sie das Volumen der
Transaktionen, die Geschwindigkeit und die Wirkung der
Finanzmärkte potenziert. Finanzinstrumente wie
Kreditderivate sind ohne die »Rocket Scientists« kaum
denkbar. Und damit sind Quants letztlich auch dafür
verantwortlich, dass die Katastrophen an diesen Märkten
schnell auf die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft
durchschlagen. Die Quants sind sich ihrer einflussreichen
Rolle durchaus bewusst. Er fühle sich jedoch nicht für das
Finanzsystem verantwortlich, erklärte Aaron Brown, der
beim 130-Milliarden-Dollar-schweren Hedgefonds AQR,
einem der prominentesten Quant-Fonds, für das
Risikomanagement zuständig ist. (Stand März 2015) »Mein
Job ist es, die beste technische Lösung zu finden, die
meinen Investoren oder meinem Arbeitgeber oder – wenn
es um mein Geld geht – mir selbst am meisten nützt«,
schrieb Brown in einem Essay für das Branchenjournal Risk
Professional. Aber er sehe ein, wenn viele Quants nach der
Devise vorgingen, dass dies das gesamte Finanzsystem
umwälze und Gewinner und Verlierer schaffe. »Ich habe
keine Ahnung, ob dies zu einer globalen Katastrophe
führt«, schreibt Brown, immerhin mit erfrischender
Ehrlichkeit. Er habe lediglich einen »leicht mystischen
Glauben«, dass Wissen besser sei als Ignoranz, Fortschritt
besser als Stillstand und gute technologische
Entwicklungen zu guten Resultaten führten. Sein Fazit:
Innovation im Finanzbereich sei unaufhaltsam und
Erfindungen sollten nicht nach unterschiedlichen
Maßstäben bewertet werden. Es sei nicht fair, seinen iPod
zu lieben, klagt Brown in seinem Essay, jedoch Collateral
Debt Obligations zu hassen, jene CDOs, die es in der
Finanzkrise auch bei Finanzlaien zu Prominenz brachten.
Unfair auch, sich einerseits zu freuen, dass es Viagra gebe,
nicht aber über Exchange Traded Funds, die
börsennotierten Index-Fonds. Das Antiblockiersystem zu
loben, hingegen den Hochfrequenzhandel zu verteufeln.
Wenn es einen Mann gibt, den man für den Aufstieg der
Quants verantwortlich machen kann, dann ist das Edward
Oakley Thorp. Als Kind fiel Thorp, von allen Ed gerufen,
wegen seiner Streiche auf. Einmal warf er Farbe ins
öffentliche Schwimmbad, das komplett abgelassen werden
musste. Später wurden seine Einfälle nützlicher – seine
Begabung für Mathematik stellte sich heraus. Er wurde
Doktor der Physik und lehrte schon früh als Professor an
der Tech-Hochburg MIT in Boston. Doch es sollte sich
herausstellen, dass Thorps seiner Vorliebe für Streiche
auch als Gelehrter treu blieb. Sein besonderes Interesse
galt Glücksspielen. Anfang der 1960er Jahre entwickelte er
mit einem Kollegen zusammen den ersten tragbaren
Computer. Das wäre an sich eigentlich schon ein
Riesenerfolg gewesen zu einer Zeit, als Computer noch
ganze Etagen einnahmen. Doch Thorp hatte ein ganz
eigenes Ziel bei der Sache. Er wollte den tragbaren
Computer einsetzen, um am Roulettetisch den Lauf der
Kugel im Voraus berechnen zu können. Thorp hatte
entsprechende Experimente mit Murmeln und
Rouletterädern durchgeführt, um daraus eine Formel
ableiten zu können. Im Kasino, so der Plan, würde Thorp
den Computer mit Daten über den Spielverlauf füttern – auf
welchen Zahlen blieb die Kugel stehen, wie häufig landete
sie auf Schwarz, auf Rot und so weiter. Daraus würde der
Computer eine Prognose für kommende Spielgewinne
ableiten. Per Funk sollten seine Kalkulationen dann an
einen drahtlosen Empfänger im Ohr eines Partners am
Roulettetisch übermittelt werden, der die entsprechenden
Wetten platzieren sollte. Wenig überraschend, flogen die
beiden Forscher mit ihrer Elektronik aus den Kasinos raus.
Erfolgreicher war Thorp beim Blackjack. Dank komplexer
Computerberechnungen auf dem IBM-Großrechner 704
seiner Hochschule entwickelte Thorp ein Modell, um
Karten zu zählen. Damit glaubte er, vor allem gegen Ende
des Spiels, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Karten des
Croupiers vorhersagen zu können. Um seine Methode
auszuprobieren, wollte er in die Spielerparadiese Las Vegas
und Reno. Er bekam 10 000 Dollar Einsatz von einem
professionellen Spieler mit zwielichtigen Verbindungen, der
in der Zeitung über den spielverrückten Professor gelesen
hatte. In seinem Buch, das Thorp über den Tripp schrieb,
nennt er ihn nur Mr. X. Später erklärte Thorp, wenn er
über Mr. X fragwürdige Verbindungen Bescheid gewusst
hätte, wäre er nie darauf eingegangen. Auch dieses Mal
flogen Thorp & Co. aus einigen Kasinos hinaus, weil sie zu
oft gewannen und die Manager ein System vermuteten.
Thorp ließ sich einen Bart wachsen, musste allerdings
feststellen, dass sich die Kasino-Betreiber untereinander
bereits vor einem »bärtigen Spieler« gewarnt hatten. Doch
Thorps Experiment war erfolgreich. An einem Wochenende
gewann Thorp 11 000 Dollar mit seiner Methode. (Damals
war das noch eine beeindruckende Summe.) Was noch
entscheidender war: Er hatte bewiesen, dass das, was
bisher als nicht vorhersehbar galt – sondern als Fortunas
Willkür –, durchaus kalkulierbar war. 1966 fasste der
Matheprofi, damals gerade mal Anfang 30, seine Ideen in
einem Buch zusammen. Beat the Dealer oder wie man das
Kasino schlägt. Das Werk wurde auf Anhieb ein Bestseller
und verkaufte sich über 700 000 Mal. Die Kasinos sahen
sich gezwungen, ihre Blackjack-Regeln zu ändern.
Doch dann hatte Thorp den Einfall, der nicht nur Las
Vegas, sondern die ganze Welt verändern sollte. Er glaubte,
dass sich auch im allergrößten Kasino der Welt mithilfe
eines Computerprogramms Gewinne kassieren lassen
würden: an der Wall Street. So wie bei Spielern in Vegas
immer die Regel galt, langfristig gewinne immer die
Spielbank, so galt an der Street die Auffassung, kein
Investor könne den Markt auf Dauer schlagen. Doch auch
hier, so fand Thorp, war es möglich, durch Informationen
über historische Kursverläufe und andere Faktoren eine
Prognose für künftige Kurse abzugeben. Schon kurz darauf
legte der Mathematiker nach und veröffentlichte ein Buch,
in dem er sein »wissenschaftliches System für den
Aktienmarkt« vorstellte. Und er beließ es nicht bei der
Theorie. Thorp machte mit seinen Hedgefonds ein
Vermögen. Nach eigener Aussage wiesen seine eigenen
Investments mithilfe seiner Methoden über knapp 30 Jahre
eine Rendite von 20 Prozent auf. Thorp war der Mann, der
zeigte, was Wissenschaftler, die außerhalb ihrer Hörsäle
gerne mal als Nerds abgetan wurden, in der sehr realen
Welt der Hochfinanz erreichen konnten. Viele folgten
seinem Beispiel.
Die Quants trugen ihren Teil zum Desaster 2008 bei. Ohne
ihre Formeln wäre es nicht möglich gewesen, aus
Autokrediten, Kreditkartenschulden und Hypotheken eine
Flut neuer Wertpapiere zu schaffen. Es wäre nicht möglich
gewesen, Wetten auf deren Ausfall abzuschließen und auch
daraus wiederum Wertpapiere zu kreieren – nämlich
Kreditderivate. Die Quants halfen nicht nur, eine neue
Generation an Finanzinstrumenten zu konstruieren. Sie
entwickelten auch die Computerprogramme, mit denen
diese Neuerfindungen auf ihr Risiko getestet wurden. Doch
die Denkmodelle, die sowohl den neuen
Finanzinstrumenten, als auch den Tests zugrunde lagen,
basierten auf Annahmen, die sich im Nachhinein als
fehlerhaft und unzureichend herausstellten. Anders als in
der Mathematik oder Physik, dem angestammten Terrain
der Quants, verhalten sich die Teilnehmer des
Finanzmarkts nicht immer rational und schon gar nicht
konstant. So wurde es den Modellen und Simulationen zum
Verhängnis, dass sie weitgehend aus der Vergangenheit
Schlüsse für die Zukunft zogen. Sie ignorierten die
Möglichkeit extremer Ereignisse, die in der Vergangenheit
so nicht vorgekommen waren. Ereignisse, die zwar selten
eintraten, aber dafür umso verheerender waren. Bei der
Krise hätten sich zwei Sorten Menschen ruiniert, sinnierte
der altgediente Spekulant Henry Kauffman, der in den
1950er Jahren erst bei der Notenbank und später 26 Jahre
lang bei Salomon Brothers war: »Die einen, die keine
Ahnung haben, und die anderen, die alles wussten.«
Wer Monte Carlo hört, denkt an das Spielermekka an der
Mittelmeerküste. Doch für Finanz-Insider steht Monte
Carlo für etwas anderes. Damit ist eine
Computersimulation gemeint, mit der sich künftige
Szenarien durchspielen lassen. Ein wenig, wie wenn man
tausendfach einen Würfel rollen lassen und die Ergebnisse
nach ihrer Wahrscheinlichkeit ordnen würde . Erste Ideen
für Monte Carlo entwickelte bereits in den 1930er Jahren
der Kernphysiker Enrico Fermi. In den 1940er Jahren
griffen Stanislaw Ulam und John von Neumann (derselbe
von Neumann, der den Begriff Singularity einführte) seine
Gedanken auf, als die beiden in den geheimen Labors von
El Alamo an der Atombombe arbeiteten. Auf die
Bezeichnung Monte Carlo kam angeblich von Neumann,
weil sein Onkel die Spielbank dort besucht hatte. Die
Quants brachten die Methode aus der Physik mit an die
Wall Street. Dort war sie bald sehr beliebt. Denn damit
ließen sich neue, künstlich zusammengebaute Wertpapiere
wie die CDOs oder die neuen Kreditderivate wie CDS
(Credit Default Swap), für die es keinerlei Erfahrungswerte
gab, zumindest theoretisch bewerten. Ohne Monte Carlo
war es nahezu unmöglich, einen Preis für die Produkte zu
finden, und ohne eine Bewertung hätte sie kein
Marktteilnehmer gekauft.
Zu den eifrigen Anwendern des finanzmathematischen
Würfelspiels gehörten und gehören die Ratingagenturen.
Sie setzten während des Hypothekenbooms ihre MonteCarlo-Simulationen unter anderem ein, um ihre
Kreditwürdigkeitsnoten wie AAA für die
Hypothekenpapiere zu erwürfeln, pardon, zu vergeben.
Ohne diese Gütesiegel hätten sich die Pensionskassen und
Staatsfonds geweigert, die neuen Papiere zu kaufen. Doch
gerade bei den Hypothekenpapieren zeigten sich die
Schwächen von Monte-Carlo-Modellen. Ein rascher und
ganz Amerika umfassender Einbruch am Immobilienmarkt
erschien zu unwahrscheinlich, um bei den Modellen in
Betracht gezogen zu werden. Der Großinvestor Warren
Buffett, ein Kritiker der jüngsten Finanzinnovationen,
fasste sein Problem mit solchen Produkten und den
Denkmodellen, die dahinterstecken, einmal
folgendermaßen zusammen: »Sie geben mir eine Pistole
mit einem Magazin mit Tausenden oder gar Millionen
Kammern, in der sich jedoch nur eine Patrone befindet.
Dann fragen Sie, wie viel ich verlange, um die Waffe an die
Schläfe zu halten und ein einziges Mal abzudrücken. Ich
weigere mich, egal wie viel Sie mir bieten. Ich sehe keinen
wirklichen Vorteil für mich, wenn es gut geht, aber einen
ziemlich klaren Nachteil, wenn es schiefgeht.« Im
Finanzbereich seien jedoch viele bereit, sich auf solche
Spiele einzulassen.
Das Versagen von Monte Carlo hat keineswegs dazu
geführt, dass die Methode verschwunden ist. Der Fehler
seien nicht die Modelle an sich gewesen, sondern die
Daten, mit denen sie gefüttert wurden, so argumentieren
die Quants. »Garbage in, garbage out« – wer Müll
reinpackt, kriegt Müll raus.
Und so wird Monte Carlo weiter eingesetzt. Unter
anderem auch bei Aladdin.
Und obwohl ihre Modelle vielfach und spektakulär
versagt haben, sind die Quants nicht etwa verbannt
worden. »Wenn eine Brücke zusammenbricht, schafft man
deshalb ja auch nicht gleich die gesamte Zunft der
Bauingenieure ab«, grantelt Steven Shreve über die
Kritiker der »Rocket Scientists«. Shreve ist
Mathematikprofessor an der Carnegie Mellon University
und Betreuer von Quants, die dort den Doktortitel ablegen
wollen. Shreve räumt sogar ein, dass sich zu Zeiten des
Hypothekenbooms Absolventen seines Programms, die an
der Wall Street arbeiteten, besorgt bei ihm meldeten, weil
sie erkennen mussten, dass die komplexen Finanzprodukte
die Grenzen ihrer Modelle längst gesprengt hatten. Aber
bei den meisten Banken, verteidigt Shreve seine Kollegen,
seien schließlich die Bankmanager, die Chefs, nicht die
Quants für die Entscheidungen verantwortlich gewesen.
Sie hätten die Warnungen der Quants in den Wind
geschlagen, um möglichst viel Profit herauszuschlagen.
Shreve sieht das Debakel 2008 für ein kurzes, wenn auch
düsteres Zwischenspiel beim unaufhaltsamen Aufstieg. Er
ist wie viele seiner Quant-Kollegen überzeugt: Quants
werden in der Finanzindustrie immer dominanter werden.
»Auch wenn viele sich das wünschen, wir werden nicht zu
einer einfacheren Zeit zurückkehren«, schrieb er in einem
Blogeintrag als Antwort auf die Kritiker. Die Banken und
Investmenthäuser jedenfalls sind derselben Auffassung. Sie
wollen noch mehr Quants in ihre Reihen locken. Und die
amerikanischen Eliteuniversitäten liefern sie: Neben
Shreves Programm bieten die New York University genauso
wie Kaliforniens Stanford entsprechende Studiengänge an.
Auch in Großbritannien, China und Deutschland gibt es
Angebote für eine Karriere als Cyborg.
Was ein Küchenmixer und Zinsprognosen
gemeinsam haben
Amazon ist am besten bekannt als Online-Warenhaus, bei
dem es alles gibt. Etwa so nützliche Dinge wie Bücher,
Kaffeemaschinen, Skianzüge und Druckerpatronen. Doch
der Einzelhändler hat ein weiteres Geschäft, das sogar
schnelleres Wachstum als das Kerngeschäft verspricht. Die
Tochter mit dem nichtssagenden Namen Amazon Web
Services – besser bekannt als AWS – ist seit dem Start 2006
auf 5 Milliarden Dollar Umsatz angewachsen (Amazon wies
den AWS-Umsatz zum ersten Mal im ersten Quartal 2015
extra aus – davor hielt Gründer Jeff Bezos die AWS-Zahlen
geheim). Bis 2017 könnten es laut Branchenanalysten 17
Milliarden Dollar werden. Hinter AWS verbirgt sich das
Angebot, Computerkapazitäten für externe Auftraggeber
zur Verfügung zu stellen und zu managen. Eine Art externe
IT-Abteilung. Cloud Computing ist die wolkige Bezeichnung
dafür in der Tech-Branche. Für die Tech-Gemeinde ist die
Cloud weit mehr als eine Dienstleistung, sie verkörpert
Potenzial. Vor der Cloud waren Unternehmen gezwungen,
ihre Computersysteme und Software selbst aufzubauen und
vorzuhalten. Mit den entsprechenden Kosten für Hardware
und Personal. Es gab zwar die Möglichkeit, ein anderes
Unternehmen damit zu beauftragen. Doch das bedeutete in
der Regel komplexe Verträge, lange Bindungen und hohe
Gebühren. Für Start-ups stellte der schwierige Zugang zu
IT-Kapazitäten ein wesentliches Hindernis dar. Die Cloud
änderte das. Rechnerkapazität war plötzlich kurzfristig und
flexibel zugänglich. Und billig. Die Cloud-Verfechter
erhoffen sich einen Innovationsschub. Denn die Cloud
verringert das Risiko teurer Fehlentscheidungen. Stellt sich
ein Projekt als Misserfolg heraus, bleiben zumindest keine
überflüssigen Server stehen oder langfristigen
Serviceverträge zu erfüllen.
So alltäglich ist die Nutzung der Cloud inzwischen, dass
kleinere Firmen die Dienstleistung wie Bürobedarf mit der
Kreditkarte zahlen. Im Silicon Valley verteilen VentureCapitalist-Investoren schon mal Geschenkgutscheine für
Amazon Web Services als nette Aufmerksamkeit an
Gründer. Bei Internetunternehmen wie Netflix, dem VideoStreaming-Anbieter, ist die Cloud Teil des
Geschäftsmodells. Aber auch Old-Economy-Konzerne wie
Kraft Foods gehören zu den Cloud-Nutzern. Kommunen wie
die Stadt Miami schaffen so Bürgerservice, ohne den
öffentlichen Apparat aufblähen zu müssen. Und selbst die
CIA ist Kunde bei Amazons IT-Wolke.
Was Amazon mit seinen Küchenmixern und BlackRock mit
seinen Zinsprognosen verbindet: Beide Unternehmen
haben entdeckt, dass es lukrativ sein kann, interne
Kapazitäten und Möglichkeiten externen Kunden zur
Verfügung zu stellen. So wie Amazon Silicon-Valley-Startups seine Server anbietet, bietet BlackRock großen
Investoren Hilfe bei der Bewertung von Portfolios an sowie
Stresstests und nicht zuletzt den Zugriff auf einen
Datenschatz, wie ihn sonst niemand auf der Welt hat.
Als 1984 BlackRocks Tech-Guru Bennett Golub das MIT
mit einem Doktortitel in »Applied Economy and Finance«
verlassen hatte und einen Job an der Wall Street suchte,
hatte er erst einmal wenig Glück. Über Monate erhielt er
Absagen von Investmentbanken. Keiner wusste mit seiner
Ausbildung etwas anzufangen. Bis er bei einer kleinen
Bank anheuerte. Dort hatte ein Händler zwar angefangen,
ein Modell zur Hypothekenbewertung zu programmieren,
war aber gegangen, ohne es fertigzustellen. Golub
übernahm und schrieb, wie er später MIT-Studenten
berichtete, in drei Monaten mit 80 Stunden pro Woche
eines der ersten Modelle für die damals noch neuen
Hypothekenpapiere. Jene CMOs, die sein späterer Kollege
und Mitgründer Larry Fink mit eingeführt hatte. »Auf die
Frage, was machen Sie eigentlich, konnte ich jetzt sagen:
Ich baue CMO-Modelle und habe einen Doktor von MIT.«
Es war die Zeit, als Verbriefungen populärer und
komplexer wurden. Golub war plötzlich ein gefragter
Mann. Finks Arbeitgeber First Boston heuerte ihn an. Dort
startete Golub eine Abteilung, die er »Financial
Engineering« nannte. Golubs Begründung: Es waren
tatsächlich Ingenieure am Werk und sie nutzten Software,
die nicht unähnlich den CAD-CAM-Systemen war, die
zunehmend in der Industrie für die automatisierte
Fertigung eingesetzt wurden. Mit diesen Programmen
entwarf Golubs Team nach den Vorstellungen von Anlegern
passende Hypothekenpapiere. In nur drei Jahren
verbrieften die Finanztüftler Kredite zu Wertpapieren im
Wert von 25 Milliarden Dollar. Vor allem aber traf Golub bei
First Boston Gleichgesinnte: Fink, Kapito und Novick. Die
Idee für eine eigene Firma wurde geboren.
Schon bald nach dem Start von BlackRock erkannten
Golub und die anderen BlackRocker, dass sich die Analysen
und Modelle, die sie für ihre eigenen Zwecke erstellten, in
einen neuen Geschäftszweig ausbauen ließen. Im Jahr 2000
ging Aladdin ganz offiziell als Angebot an den Start. Seither
sind immer mehr Kunden an Bord gekommen. Wie auch im
Beratungsgeschäft kam BlackRock dabei die Finanzkrise
zur Hilfe. Bis zum Debakel 2008 galt bei institutionellen
Großanlegern die Maximierung der Rendite als oberste
Priorität. Die Krise machte Risikomanagement plötzlich
zum Hot Topic. Kein Verantwortlicher wollte noch einmal
mit heruntergelassenen Hosen erwischt werden. Zudem
hatten die Aufseher plötzlich Fragen und verlangten Daten
in nie gekanntem Ausmaß. Doch nur die wenigsten großen
Vermögensverwalter verfügen über genügend Personal und
Know-how, um diese Ansprüche mit Bordmitteln zu
befriedigen. BlackRocks Angebot, Aladdins
Analyseinstrumente und Datenbanken zu nutzen, muss da
wie die göttliche Antwort aufs Gebet wirken. Über 150
institutionelle Investoren sind bereits Kunden, darunter die
größten Anleger der Welt, also Pensionskassen, Stiftungen,
Versicherer, Staatsfonds sowie 50 Zentralbanken (es gibt
177 Zentralbanken weltweit laut der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich). Sogar der
Vermögensverwaltungsarm der Deutschen Bank lässt
inzwischen das Kapital über Aladdins Plattformen laufen.
Eine solche Marktdurchdringung haben nur wenige
Unternehmen – man muss schon Suchmaschinenbetreiber
Google oder Facebook im Bereich Social Media
heranziehen, um eine ähnliche Dominanz zu finden.
Rechenzentren wie das von BlackRock in Wenatchee
bestehen aus Tausenden von Servern – Computern mit
besonders starker Leistung. Und die einzelnen Server sind
aufeinandergestapelt wie Schubladen in übermannshohen
Schränken. Noch vor ein paar Jahren kauften die
Unternehmen einen Server nach dem anderen, wenn sie
mehr Kapazitäten aufbauen wollten. Heute bestellt etwa
Microsoft die Geräte per Lkw-Container. Die ServerSchränke reihen sich aneinander, sorgfältig beschriftete
Kabel in verschiedenen Farben führen von dort zu
Kabelsträngen, dick wie die Oberarme eines Bodybuilders.
Die Hallen sind meist dämmrig – Licht bringt unerwünschte
zusätzliche Wärme – und menschenleer. Alles, was zu hören
ist, sind die Maschinen. »Wenn einer unserer Techniker
hier in einer der Einheiten bastelt, findet ihn keiner so
schnell«, sagt die Managerin eines Datenzentrums, das
einem großen Internet-Konzern gehört. Dieselgeneratoren,
groß wie Loks, springen im Notfall ein, sollte der Strom
ausfallen. BlackRock verfügt über drei solcher NotfallDieselgeneratoren mit je 2,5 Megawatt. Zusammen
könnten sie eine kleine Stadt mit Strom versorgen.
Was BlackRock dazu brachte, sein elektronisches
Superhirn ausgerechnet in den abgelegenen Nordwesten
zu bringen, hatte einst auch die Wanapum-Indianer
angelockt: der Columbia. Jahrhundertelang siedelte der
Stamm der »Flussleute« entlang den Ufern in
Schilfgrashütten. Sie lebten vom Lachsfang. Doch die
europäischen Farmer nahmen immer mehr Land für sich
ein. Schließlich kamen Ingenieure und ließen Dämme
bauen. Die Dämme schnitten den Zug der Lachse ab, die
jedes Jahr zum Laichen aus dem Pazifik hochschwammen.
Heute leben die verbliebenen Nachfahren der Wanapum in
bescheidenen Häusern, die ihnen die
Elektrizitätsgesellschaft gebaut hat. Die Stromversorger
betreiben nun die Dämme, rund 400 gibt es. Sie stauen seit
den 1950er Jahren den Columbia und seine Zuflüsse. Was
den Indianern ihre Existenz raubte, schafft heute die
Grundlage für eine neue Branche, die sich im Becken des
Columbia niedergelassen hat: Datenzentren.
Yahoo, Microsoft und Dell betreiben jeweils eigene
fußballfeldergroße Rechenzentren in Quincy, einem kleinen
Farmerflecken, 20 Minuten von Wenatchee entfernt. Im
Gebäude neben BlackRock hat die Telekomtochter T-Mobile
ihre Serverbänke stehen. Der Strom aus den
Staudammturbinen ist geradezu unschlagbar billig.
Zwischen 2 und 3 Cent pro Kilowattstunde kostet er in
Wenatchee und benachbarten Gemeinden – im USDurchschnitt zahlen Unternehmen über 7 Cent. Die kühlen
Außentemperaturen senken die Kosten noch weiter. Denn
die Milliardenkalkulationen Aladdins lassen die Computer
und die Kabel buchstäblich heiß laufen.
Rechenzentren wie die Anlagen in Wenatchee und Quincy
sind die oft übersehene reale Seite unserer digitalen Welt.
Datenverarbeitung hat inzwischen den größten und den am
schnellsten wachsenden Stromverbrauch. 2013
verbrauchten Datenverarbeiter 91 Milliarden
Kilowattstunden, so errechnet von der Umweltorganisation
Natural Ressources Defense Council. Damit könnte man
New York mit seinen acht Millionen Einwohnern mehr als
zweimal versorgen. Bis 2020 soll Big Data bereits 140
Milliarden Kilowattstunden jährlich verschlingen.
Allerdings sind Anlagen wie die von BlackRock nach
Ansicht der Umweltschützer geradezu vorbildlich »ultraeffizient« und grün. Es seien vor allem kleinere und
mittlere Anlagen bei Unternehmen, die meist ineffizient
seien und für den enormen Verbrauch sorgen.
Wir Nutzer im Netz von Aladdin
Aladdin wächst täglich, stündlich, minütlich, jede Sekunde.
Denn er wird ständig mit neuen Daten gefüttert. Wie bei
Google und anderen Tech-Konzernen werden diese nicht
zuletzt von den Nutzern freiwillig geliefert. In dem Fall sind
es die großen Investoren. Aladdin weiß, wohin Kapital auf
unserem Globus fließt, er weiß auch, woher es kommt.
Selbst Informationen über Normalverbraucher finden ihren
Weg zu Aladdin. Neue Wohnung gekauft? Rate fürs Auto zu
spät bezahlt? Geld in einen Investmentfonds angelegt?
Irgendwann finden alle diese Details ihren Weg in das
Superhirn im abgelegenen Wenatchee. Anders als bei
Google & Co. immerhin in anonymer Form. Aber das spielt
eigentlich keine Rolle. »BlackRocks Analysemodell ist in
der Lage, so detaillierte Informationen herauszusieben, wie
etwa, dass Leute, die in der Nähe von IBM-
Niederlassungen wohnen, ihre Hypotheken häufig früher
zurückzahlen«, schreibt das Wirtschaftsmagazin Fortune
bewundernd über Aladdins Genie. Der Grund: IBMManager werden öfter an andere Einsatzorte versetzt,
verkaufen deshalb ihre Eigenheime und zahlen den Kredit
vor Ablauf zurück. Für Aladdins Kunden sind solche
Erkenntnisse Geld wert: Denn das heißt, dass Hypotheken
an Hausbesitzer, die in der Nähe von IBM wohnen, ein
größeres Risiko darstellen. Ein zu früh zurückgezahltes
Darlehen ist nämlich gar nicht gut für Investoren in
Hypothekenpapiere. Denn es bedeutet, dass die fein
auskalkulierten Renditen dieser Hypohekenbündel nicht
mehr zutreffen. Was können die Investoren mit der IBMInformation anfangen? Man kann sich zum Beispiel
vorstellen, dass sie Hypotheken aus diesen Gegenden nicht
in ihren Verbriefungen haben wollen. Banken wollen jedoch
Hypotheken am liebsten an die Investoren weiterverkaufen
und so würden sie eine Hypothek meiden, bei der das
aufwendiger werden könnte. Was wiederum bedeuten
kann, dass es für Käufer, die eine Wohnimmobilie im
Umfeld von IBM erwerben wollen, schwieriger und teurer
wird, eine Hypothek zu bekommen.
Ausgerechnet der Erfolg von Aladdin macht das System
so gefährlich. Wenn bei Amazons klassischem BestellGeschäft reihenweise die Server verrücktspielen würden,
dann bedeutet das Umsatzeinbußen und Verluste für
Amazon. Und unter Umständen eine verspätete Lieferung
für die Kunden. Wenn bei Amazon Web Services die Lichter
ausgehen würden, dann wäre das potenziell für Hunderte
Unternehmen der GAU. Ähnlich ist es auch bei BlackRock.
Fehler im System sind nun nicht mehr auf das
Unternehmen selbst beschränkt – sie breiten sich auf das
gesamte Netz der Kunden aus – und im Fall von Aladdin
möglicherweise auf das Finanzsystem. BlackRock ist zwar
nicht der einzige Anbieter eines solchen Systems,
allerdings hat kein anderes die globale Reichweite von
Aladdin.
Die Analysesysteme verführen ihre Nutzer dazu, sich zu
sehr auf die Maschinen zu verlassen. So, wie ein mit dem
Taschenrechner errechnetes Ergebnis oft erst einmal ohne
großes Nachdenken akzeptiert wird. Oder so, wie sich die
Investoren auf die AAA-Kreditbestnoten der
Ratingagenturen für die Wackelhypothekenprodukte
verließen – jene Kreditnoten, die die Ratingagenturen
mithilfe ihrer Quant-Modelle ermittelt hatten. Wer wollte
an den »Raketenerfindern« zweifeln? Der Rest der
Geschichte ist bekannt.
Bemerkenswerterweise mahnt BlackRock selbst die
eigenen Kunden zur Vorsicht. »Es kommt darauf an, wie die
Risikomodelle eingesetzt werden«, sagte Rob Goldstein der
Financial Times im Juli 2014. »Die Modelle sagen dem
Nutzer nicht: diesen Vermögenswert kaufen oder verkaufen
oder halten – sie stellen lediglich Instrumente zur
Verfügung, den Vermögenswert zu beleuchten.« Im
Klartext: Für die Schlüsse, die die Kunden aus den AladdinErgebnissen ziehen, ist BlackRock nicht verantwortlich.
Sein Boss, Larry Fink, ist sogar noch drakonischer in
seinem Urteil: »Wenn Sie glauben, dass Modelle richtig
sind, dann werden Sie falsch liegen«, sagte er im Dezember
2013 dem Economist.
Das hindert BlackRock nicht daran, die Modelle und
Programme anzubieten. BlackRock Solutions, der Bereich,
zu dem Aladdin gehört, hat 2014 rund 170 Millionen Dollar
umgesetzt. Doch je cleverer und je reibungsloser die
Analysesysteme funktionieren, desto größer die Gefahr,
dass ihre Nutzer ihnen blind vertrauen. BlackRock mag für
das Verhalten seiner Nutzer nicht verantwortlich sein, doch
das mindert keineswegs die Gefahr, die von übergroßem
Vertrauen in Systeme wie Aladdin ausgeht. Die
Bemerkungen von Goldstein und Fink, mit der sie zur
Skepsis gegenüber Modellen mahnen, klingen wie die
Beipackzettel von Medikamenten. Nur, dass es anders als
in der Pharmabranche für solche Produkte keine
Sicherheitsvorschriften gibt.
Und es ist nicht die einzige Bedrohung, die unser
Cyberfinanzsystem mit sich bringt.
Die Siegesmeldung des Eroberers kam per Instant
Messaging. »Nasdaq ist unser«, schrieb Aleksandr Kalinin,
in seinen Kreisen besser als Tempo bekannt, an seinen
Komplizen. Kalinin war einer der Hacker, die im Mai 2007
eine Schwachstelle auf der Webseite der Nasdaq entdeckt
hatten. Die Nasdaq ist die Tech-Börse per se. Hier sind 3
200 Unternehmen gelistet – darunter viele große USTechnologiewerte. Über die Passwort-Erinnerungsfunktion
für Kunden verschaffte sich Kalinin Zugang in die internen
elektronischen Systeme der Nasdaq – durch eine so
genannte »back door« – und hatte bald dieselben
Möglichkeiten, wie die Systemverwalter der Nasdaq selbst.
»Wir haben Zugriff auf die Server und können auf ihnen
laufen lassen, was wir wollen«, schrieb er an seinen
Kumpanen via Instant Messaging. Er war offensichtlich
beeindruckt: »Die Datenbanken sind höllisch groß, ich
denke, es sind Aufzeichnungen von Handelstransaktionen.«
Die Bande flog auf und US-Strafverfolger werfen Kalinin
vor, sich bis Oktober 2010 über die elektronische Hintertür
immer wieder illegal Zugang zu den Nasdaq-Rechnern
verschafft zu haben. Immerhin gehen die Behörden davon
aus, dass die Computer, die direkt den Handel abwickeln,
nicht von der Manipulation betroffen waren und die
Nasdaq nur begrenzten Schaden erlitt. Einer von Kalinins
Komplizen war ein gewisser Albert Gonzalez, alias
Soupnazi, der als einer der erfolgreichsten Hacker gilt.
Gonzalez, der zeitweise Informant des FBI war, räumte als
20-Jähriger bereits in großem Stil Kreditkartenkonten ab,
den Erlös verpulverte er angeblich unter anderem für eine
75 000 Dollar teure Geburtstagsparty. Laut den Behörden
war Gonzalez, der inzwischen wegen der früheren
Vergehen eine 20-jährige Haftstrafe verbüßt, nur einer der
Mitverschwörer bei dem bisher größten Finanzdatenklau.
Die anderen Drahtzieher, vier Russen und ein Ukrainer,
knackten neben den Systemen der Nasdaq auch die Server
von über einem Dutzend großer Unternehmen, darunter
Citibank und der europäische Supermarktbetreiber
Carrefour. Dabei stahlen sie die Nummern von 160
Millionen Kreditkarten. Experten waren beeindruckt, wie
gut organisiert die Bande dabei vorging – und wie lange sie
unentdeckt blieb. Unter anderem arrangierten sie von ihrer
Operationsbasis in Russland aus Hehlerplattformen in
Deutschland, Panama und den Bahamas, um die erbeuteten
Daten zwischenzulagern.
Cyberattacken gehören inzwischen an der Wall Street
zum Alltag. Und sie werden immer gefährlicher.
Längst geht es nicht mehr allein um geklaute
Kreditkartendaten oder geknackte Konten von privaten
Kunden. Die Bedrohung gilt dem Herzen der globalen
Kapitalmärkte. Bei einer im Sommer 2013 veröffentlichten
Untersuchung des Weltbörsenverbandes und der IOSCO,
einer internationalen Vereinigung von Aufsehern, gab
immerhin mehr als die Hälfte der befragten Börsen an, von
Hackern angegriffen worden zu sein. Cyberkriminalität, so
die Untersuchung, sei ganz oben auf der Gefahrenliste für
die Finanzmärkte, weil diese immer mehr von
Informationstechnologie abhängig sei. In einer im Oktober
desselben Jahres veröffentlichten Studie berichtete Aite,
eine Beratungsgruppe für Finanzinstitute, im Schnitt
würden täglich bis zu 150 000 Codes krimineller Software
in Umlauf gebracht. »Die Risiken vermehren sich schneller,
als Banken und Unternehmen ihre Abwehr dagegen in
Stellung bringen können«, schreiben die Autoren der
Studie. Alarm schlug auch das US-Clearinghaus DTCC. Das
Unternehmen ist ein wichtiger Teil der FinanzInfrastruktur. Es ist praktisch die Verteilerzentrale der Wall
Street – hier findet der tatsächliche Austausch »Aktien
gegen Geld« – statt, nachdem die Handelstransaktion an
der Börse abgeschlossen wurde. An die DTCC-Abwicklung
sind Banken, Börsen, Broker und die großen
Investmentfonds angeschlossen. Wer die globalen
Finanzmärkte aus dem Tritt bringen will, könnte hier
ansetzen. In einem Bericht der DTCC vom August des
Jahres 2014 heißt es dann auch, Cyberrisiken seien »die
Topbedrohung systemischer Art für die globalen Märkte
und ihre Infrastruktur«. Größer als etwa die Gefahr durch
eine erneute Kreditklemme.
Was Börsen, Banken und Behörden aufschreckt: Die Art
der Attacken hat sich verändert. Etwa die immer
häufigeren Angriffe, bei denen Internetseiten und
Internetzugang betroffener Firmen durch gezielte
Überlastung – so genannte Distributed-Denial-of-ServiceAttacken – zum Absturz gebracht werden sollen. Noch vor
kurzem, so die DTCC-Experten, seien solche Attacken von
Desktops und Heimcomputern ausgegangen. Heute greifen
professionelle Server im Dienst der Internetverbrecher an –
in einigen Fällen waren es Tausende solcher
leistungsstarken Rechner. Vor 2012 schickten die Computer
der Hacker höchstens ein bis zwei Gigabits pro Sekunde an
die Internetseite des Instituts, das sie im Visier hatten.
Heute erleben die Unternehmen Trommelfeuer von 150
Gigabits pro Sekunde – das entspricht ungefähr der
fünfzehnfachen Aufnahmekapazität der Webseiten einer
normalen Finanzinstitution.
Noch perfider sind die Fälle, in denen sich die Angreifer
unbemerkt ins System einschleusen, um es von innen
heraus zu manipulieren. Solche so genannten Advanced
Persistent Threats – im Cyber-Jargon kurz APT – spionieren
bevorzugt ihre Ziele in sozialen Netzwerken aus und
nutzen ihre Erkenntnisse, um ihre Manipulationssoftware
etwa getarnt als E-Mail-Anhang gezielt an Mitarbeiter in
Schlüsselstellungen zu schicken.
Wie professionell die Hacker vorgehen, zeigt die Attacke
auf JPMorgan Chase im Sommer 2014. Unbekannte
verschafften sich Zugang zur innersten elektronischen
Infrastruktur der größten US-Bank und klauten Gigabytes
an Information, auch über Kunden, bevor JPMorgans
Informatiker ihnen auf die Schliche kamen. So hoch
entwickelt waren die Mittel der Kriminellen, dass Experten
vermuteten, sie hätten womöglich Verbindung zur
russischen Regierung und Vladimir Putin. Die Russen
leugneten es.
Fest steht: Nicht immer geht es den Hackern um den
monetären Gewinn. Große Sorgen bereitet Aufsehern,
Börsen und Finanzinstituten der Trend, mit der Infiltration
und Manipulation politische Ziele zu verfolgen. Wie etwa
die oben beschriebene Attacke der Syrian Electronic Army,
die die falsche Twitter-Nachricht lancierte, in der angeblich
die Nachrichtenagentur AP meldete, Präsident Obama sei
bei einem Anschlag im Weißen Haus verletzt worden, und
die prompt einen Kurssturz an der Börse auslöste. (Die SEA
ist weiter aktiv, auch die New York Times und kurzzeitig
eine Rekrutierungswebseite der US-Marine wurden von
den Cyberterroristen gehijackt.) Eine wachsende
Befürchtung der Unternehmen und Behörden sind Attacken
auf das gesamte System durch feindliche Nationen wie
etwa den Iran, Nordkorea oder China. So steht Nordkorea
im Verdacht, Sony Studios Server geknackt zu haben und
brisante Interna wie die Vergütung von Managern und
Hollywoodstars publik gemacht zu haben. Die Aktion, so
wird vermutet, war ein Racheakt, nachdem Sony The
Interview, eine Komödie, produziert hatte, in der zwei
Amerikaner – gespielt von den Stars Seth Rogen und James
Franco – die Ermordung von Nordkoreas Diktator Kim-Jong
Un planen. Auch wenn es offenbar viele Hinweise gibt, die
für eine Beteiligung von Nordkorea sprechen, einen
definitiven Nachweis wird es wohl nie geben. »Der Aufbau
von Cyberangriffspotenzial lässt sich weit besser
verbergen, als der Aufbau physischer Angriffskapazitäten«,
heißt es in der Studie des Weltbörsenverbandes. Zudem sei
eine solche Internetattacke weit schwieriger
zurückzuverfolgen.
Klar ist, dass Hacker die Cyberfinanzwelt für sich
entdeckt haben und deren Schwachstellen gnadenlos
ausnutzen werden. »Es gibt zwei Arten von US-Konzernen:
solche, die gehackt wurden, und solche, die nicht wissen,
dass sie gehackt wurden«, erklärte FBI-Direktor James
Comey in einem Interview mit ABC News im Mai 2014,
nachdem sich herausgestellt hatte, dass chinesische
Cyberspione Dutzende von Unternehmen infiltriert hatten.
Ein System wie Aladdin zu knacken, dürfte für Hacker
verlockend sein – dank solcher Daten könnten sie sich
entscheidende Informationsvorsprünge an den Märkten
verschaffen. Noch erschreckender ist die Vorstellung, dass
sich dem Westen feindlich gesinnte Nationen Einblick in die
Daten verschaffen könnten.
BlackRock wollte sich zu der Frage, wie Aladdin vor
Hackern geschützt ist und ob es bereits Attacken gegen
BlackRock gegeben hat, nicht äußern.
Die Welt durch BlackRocks Brille
Eine weitere Gefahr, die Aladdin mit sich bringt, ist
schwerer zu greifen, aber deshalb nicht weniger
beunruhigend. Sie hängt damit zusammen, wie Preise und
Bewegungen an den Finanzmärkten entstehen. Letztlich
funktionieren diese nur, wenn die Teilnehmer verschiedene
Auffassungen über die Zukunft haben. Nehmen wir eine
Aktientransaktion: Der Verkäufer glaubt, der Kurs werde
nicht mehr weiter steigen oder sogar fallen. Der Käufer
sieht dagegen Potenzial nach oben. (Klar, es ist nicht immer
so einfach. Es kann viele andere Motivationen geben –
etwa, weil der Verkäufer dringend Cash braucht oder der
Käufer sein Portfolio umschichten will.) Bei Anleihen gehen
die Ansichten der Transaktionspartner über die künftige
Zinsentwicklung auseinander – oder fundamentaler: über
die künftige Entwicklung der Wirtschaft. Ähnliches gilt für
Rohstoffe, für Devisen. Die unterschiedlichen Auffassungen
drücken sich in Transaktionen und Preisen aus – und ihre
Summe steuert letztlich den Markt. Ein Crash ist nichts
anderes als ein Herdentrieb, der zu viele Teilnehmer in die
gleiche Richtung steuert.
Da muss es beunruhigen, dass so viele Lenker des
globalen Kapitals die Welt durch die Brille von BlackRock
sehen.
Wenn ein großer Teil der Marktteilnehmer die Daten
mithilfe von Aladdin interpretiert, dann übernehmen sie
auch die Annahmen, auf denen die Analysen und Modelle
basieren. »Käufer, Verkäufer und Regulierer gehen
womöglich alle von denselben Annahmen aus, einfach weil
sie Aladdin konsultieren«, sorgte sich selbst der Economist.
Sonst steht die britische Postille der Wirtschaftselite (und
derer, die sich dafür halten), Technologie und Innovationen
im Finanzmarkt ausgesprochen positiv gegenüber. Doch im
Dezember 2013 widmete das Magazin dem Thema sogar
einen Titel. »Der Monolith und die Märkte«, lautete die
ominöse Überschrift. Seit 2008 brauchen selbst NichtInsider keine große Fantasie, um sich vorzustellen, was
passiert, wenn zu viele Marktteilnehmer Annahmen teilen,
die sich dann in katastrophaler Weise als falsch
herausstellen. Und was sagt BlackRock zu der Befürchtung,
Aladdin führe Marktteilnehmer dazu, die Märkte durch
BlackRocks »Brille« zu sehen und könne dadurch einen
Herdentrieb auslösen? Auch zu dieser Frage wollte sich
BlackRock nicht äußern.
Kapitel 10
Machtwechsel an der Wall Street
Touristen, die sich bei ihrer Shopping Tour von der Fifth
Avenue in das San Pietro verirren, sind verwirrt. Auf den
ersten Blick glauben sie, in einem jener kitschigen, leicht
angestaubten italienischen Nachbarschaftslokale gelandet
zu sein. Überall stehen Vasen und Väschen,
Porzellanfiguren und Figürchen. Von der Decke baumeln
funkelnde Kristallkugeln, die nicht so recht zu den
rustikalen Keramikkacheln mit den maritimen Motiven
passen wollen. Es wirke wie eine Kulisse aus Martin
Scorseses Mafia-Epos Goodfellas, lästerte einmal das New
York Magazine. Doch sobald die Besucher von einem der
weiß-livrierten Kellner formvollendet und routiniert an
einen der perfekt gedeckten Tische geführt worden sind,
bemerken sie ihren Irrtum. Und nicht nur wegen der
atemberaubenden Preise und der Maßanzüge, die ihre
Tischnachbarn tragen. Das San Pietro ist kein normaler
Ravioli-und-Tiramisu-Laden. (Obwohl beide Gerichte hier
exzellent sind.) Das Lokal der Gebrüder Bruno, die
ursprünglich aus Salerno stammen, ist der inoffizielle Club
der Wall-Street-Mogule. Am Fenster plaudert John Mack
mit ausländischen Gästen. Der frühere Morgan-StanleyBoss, heute als Berater und graue Eminenz bei der Bank,
ist besser als »Mack, The Knife« bekannt, wegen der
radikalen Personalmaßnahmen, mit denen er einst seine
Angestellten in Angst und Schrecken hielt. Am
Nachbartisch hat sich Stammgast Joe Perella eingefunden,
der legendäre Banker jener Firmenjäger, die in den 1980er
Jahren mit ihren Übernahmeattacken US-Konzernbosse wie
Arbeiter das Fürchten lehrten. Heute isst der Graubärtige
nur Gemüse, er ist zum Vegetarier bekehrt. In der
gedämpften Atmosphäre bei Branzino in Salz und
Kräuterkruste – San Pietros 43 Dollar teure Fischspezialität
oder dem Kalbsrücken mit Radicchio für 48 Dollar –
werden Deals besiegelt, Freundschaften geschlossen und
Feindschaften begraben. Ellenbogen an spitzem Ellenbogen
unter Wall Streets Großen. Wenn Bankbosse hier
gemeinsam auftauchen, hat das den Rang einer
Pressemitteilung. Weswegen sich Reporter wie Charlie
Gasparino, der für Fox Business Network die neusten News
aus Finanzen und Politik sammelt, gerne an der polierten
Edelholzbar herumdrücken und auf die nächste große
Zusammenkunft warten. Noch vor ein paar Jahren konnte
Fink hier unbemerkt an einem Tisch sitzen. Noch gehörte
er nicht zu dem kleinen elitären Kreis, der hier die
»Chairman Row« besetzt – die begehrten Plätze am
Fenster. Inzwischen hat Fink nicht nur einen Stammplatz
im San Pietro, sondern Gerardo Bruno, der
geschäftsführende Bruder, weiß auch um Finks Vorliebe für
frische Erbsen.
Und doch ist er anders als die anderen Clientes des San
Pietro. Er hat sich sein eigenes Reich erst schaffen müssen,
ist nicht auf den Chefsessel eines der Traditionshäuser
berufen worden. Bis Fink dann so mächtig war, dass er für
die Bankchefs plötzlich zum Player wurde.
Unsere Altersvorsorge: Der Heilige Gral der
Wall Street
Fink verdankt seinen steten Weg an die Spitze und einen
Stammplatz im San Pietro seinem Geschick, seinem
Ehrgeiz und auch einer Portion Glück. Sein Aufstieg wäre
jedoch kaum denkbar ohne den unaufhaltsamen Aufstieg
der Geldverwalter. Begonnen hat der Machtwechsel zwar
schon vor der Finanzkrise, aber seither hat die Entwicklung
an Fahrt aufgenommen. »Lange waren
Vermögensverwalter im Schatten ihrer Cousins bei den
Banken und Versicherern, aber bis 2020 werden sie
definitiv ins Licht gerückt sein«, beschreiben es blumig die
Autoren eines Zukunftsszenarios, das die
Beratungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers (PwC)
2014 für die Branche herausgab. (Die Autoren waren
offenbar literarisch inspiriert. Der Titel der Studie lautet
etwas zweideutig: »Brave New World« – es ist nicht ganz
klar, ob sie sich auf Shakespeares ironisch gemeintes Zitat
aus dem Sturm beziehen oder ob es ein Hinweis auf Aldous
Huxleys Roman eines chemisch ruhig gestellten, sexlosen
Weltstaates im Jahr 2540 sein soll.) Bis zur Finanzkrise
waren die Banken die Innovatoren, die Antreiber der
Entwicklungen auf dem Finanzmarkt. Sie gaben die Ideen
und die Richtung vor. Sie hatten das Ohr der politischen
Klasse. Die Krise, der Vertrauensverlust und die
anschließende globale Regulierungswelle haben die
Banken ihre Vormachtstellung gekostet.
Doch bei den Vermögensverwaltern gelten ebenfalls neue
Gesetze. Der Wettbewerb um das Geld der Welt wird mit
immer härteren Bandagen geführt. Größe und Reichweite
werden im Geschäft mit den Anlegern entscheidend, nur
dann lassen sich die wachsenden Kosten breit verteilen.
Denn mit der globalen Expansion sind die Ausgaben für
Marketing und Vertrieb in der Branche drei Mal so schnell
gestiegen wie die Erlöse, so eine Analyse der Berater von
McKinsey & Co (September 2012). Das erhöht den Druck.
Wer nicht genug Kapital ansaugen kann, um im weltweiten
Wettbewerb um Kunden und Margen bestehen zu können,
wird sich künftig mit den Brotkrumen vom Tisch der Riesen
zufrieden- oder gleich ganz aufgeben müssen. Ende 2012
kontrollierten die 20 größten Vermögensverwalter 49
Prozent des weltweit verwalteten Kapitals. Die Amerikaner
dominieren klar: 14 der Topfirmen stammen aus den USA.
Und sie haben die europäische Konkurrenz in deren
Heimatmarkt abgehängt: Zwischen 2008 und 2012 gingen
50 Prozent der Netto-Neuzuflüsse in europäische Fonds auf
das Konto von sechs amerikanischen Anbietern. Die
Konzentration auf eine Handvoll Big Player wird sich in den
kommenden Jahren noch verstärken. (PWC-Studie)
Finks BlackRock hat bisher einen gewaltigen Vorsprung.
Doch wer im Verteilungskampf in Zukunft mithalten will,
muss es vor allem schaffen, in den Schwellenländern
erfolgreich zu sein. Zwischen 2010 und 2020 wird über
eine Milliarde Konsumenten weltweit neu in die
Mittelschicht aufsteigen – der größte Anstieg dieser Art in
der Menschheitsgeschichte. Der größte Teil dieser
Mittelschicht wird nicht länger in Europa, sondern in Asien
zu Hause sein. Zwar verwaltet die Branche in Asien (ohne
Japan) bisher lediglich bescheidene 5 Billionen Dollar an
Kapital und in Lateinamerika gerade mal 2 Billionen – zum
Vergleich: in den USA sind es 34 Billionen, in Europa 20
Billionen Dollar. (Zahlen: Boston Consulting Group 2013)
Doch was für Fink und seine Rivalen wesentlich wichtiger
ist: Die Wachstumsraten in den Schwellenländern sind weit
höher als in den Industrienationen. Zwischen 2007 und
2012 wuchsen die Zuflüsse in den asiatischen Ländern
(ohne Japan) um jährlich durchschnittlich 9 Prozent. In
Lateinamerika waren es sogar 13 Prozent. In Europa und
Nordamerika betrug der Zuwachs im selben Zeitraum
jeweils magere zwei Prozent. (Boston Consulting Group)
Wie schon vor ihnen Autohersteller und Modehäuser haben
auch die Finanziers China ins Visier genommen. Chinas
spektakuläres Wirtschaftswachstum hat über das
vergangene Jahrzehnt eine aufstrebende Schicht von
Stadtbewohnern geschaffen, die zunehmend Geld für
private Altersvorsorge oder die Ausbildung der Kinder zur
Seite legt. Noch kämpfen die Geldverwalter im Reich der
Mitte mit Bürokratie und Regulierung. Der Zugang für
ausländische Anbieter ist begrenzt. Doch das alles dürfte
sich bald ändern, wenn China immer mehr den Anschluss
an die internationalen Finanzmärkte sucht.
»Vermögensverwalter haben eine glänzende Zukunft in
China«, schwärmen Analysten der Citigroup in einer Studie
über die Chancen der Branche in der zweitgrößten
Volkswirtschaft der Welt.
BlackRock jedenfalls will vorn mit dabei sein. Fink kann
es offenbar nicht schnell genug gehen. Bei einer
Telefonkonferenz mit Analysten und BlackRock-Aktionären
in 2011 gestand er laut Bloomberg, die Zuflüsse von
Investoren dort kämen »langsamer, als wir uns wünschen«.
Erst nach einer Wartezeit erhielt der schwarze Riese 2012
eine Lizenz für direkte Investitionen in Chinas heimischem
Aktienmarkt, berichtete die Financial Times. Auch in China
setzt Fink darauf, die richtigen Schlüsselfiguren zu
rekrutieren – wie etwa 2013 Wang Hsueh-Ming. Die
Absolventin der New Yorker Columbia University war zuvor
bei Goldman Sachs, wo sie es zum begehrten Partnerstatus
gebracht hatte. Mit ihren guten Verbindungen zu
Finanzkreisen in ihrer Heimat half sie Goldman, zwei
wichtige Mega-Deals an Land zu ziehen: die Börsengänge
der Telefongesellschaft China Telecom und des Ölkonzerns
PetroChina. Dabei arbeitete sie eng mit Goldmans
damaligem Vorstandschef Hank Paulson zusammen, wie die
Financial Times notierte.
In einer Hinsicht ist China dem Westen voraus: Die
Verschmelzung von Finanzen und Technologie. Als der
eCommerce-Gigant Alibaba einen Geldmarktfonds für
Kunden anbot, floss innerhalb der ersten acht Monate so
viel Kapital in den Fonds, dass er innerhalb kürzester Zeit
zu einem der größten Geldmarktfonds der Welt anschwoll.
Anfang 2015 betrug das angesammelte Kapital des Fonds
93 Milliarden Dollar. Auch im Silicon Valley wächst das
Interesse, im Finanzbereich mitzumischen. Google etwa
investiert in Online-Kreditplattformen. Apple debütierte im
Herbst 2014 mit Apple Pay, einer Art digitalen Kreditkarte.
Nutzer können ihre Rechnung mit ihrem Mobiltelefon
bezahlen. Vielleicht steckt das hinter der Entscheidung,
BlackRock-Gründungsmitglied Sue Wagner in den
Aufsichtsrat von Apple zu schicken. Der
Aufsichtsratsposten in einem Unternehmen ist eine
Ausnahme. Denn BlackRock, wie auch alle anderen großen
Geldverwalter, vermeidet es, direkt eigene Vertreter in den
Aufsichtsrat zu entsenden. (Sonst würden Insiderregeln
gelten und BlackRock-Fonds könnten nicht mehr so frei
Aktien des betreffenden Unternehmens kaufen und
verkaufen.) Wagner, muss man dazu sagen, hat sich 2012
bei BlackRock aus dem operativen Geschäft
zurückgezogen, ist aber noch im Aufsichtsrat vertreten.
»Sue ist eine Pionierin der Finanzindustrie und wir freuen
uns, sie im Aufsichtsrat von Apple willkommen zu heißen«,
ließ Apple-Chef Tim Cook bei Wagners Ernennung im
Sommer 2014 verlauten. Wagner ist nicht das einzige
Bindeglied zwischen dem Koloss der Wall Street und dem
Giganten aus dem Silicon Valley: BlackRocks Fonds
gehören zu den Topanteilseignern von Apple.
BlackRock macht es vor: Die neuen Finanzriesen werden
global, digital und vor allem enorm groß sein. Und damit
praktisch überall dabei.
Auch wenn die Deutschen weiterhin skeptisch und
zurückhaltend sind in Sachen privater Geldanlage – der
Aufstieg der Geldverwalter wird an Deutschland nicht
vorbeigehen. Denn die Branche muss ihre Billionen
weltweit investieren. Deutsche Unternehmen und
Immobilien werden so zu Anlageobjekten für die neue
globale Mittelschicht. Bei den großen Dax-Unternehmen ist
es schon so weit. Nicht nur ETFs sind stark engagiert, auch
das Interesse von Hedgies steigt. Da ist Cevian, der
Hedgefonds, der bei Thyssen-Krupp eingestiegen ist –
Anfang 2015 hatten die Schweden bereits 15 Prozent.
Damit verringert sich der Abstand zur Krupp-Stiftung, die
nur noch 23 Prozent hält, immer mehr. Wenn sich Cevian
mit anderen Investoren verbünden könnte, dann sind sie
endgültig am Ruder. Beim Baukonzern Bilfinger hat Cevian
innerhalb kurzer Zeit dafür gesorgt, dass Vorstandschef
und Aufsichtsratschef gehen mussten.
Die Entwicklung wird aber nicht auf die börsennotierten
Unternehmen beschränkt bleiben. Die Heuschrecken haben
den deutschen Mittelstand entdeckt. Die Berater von PwC
führten Anfang 2014 eine Umfrage durch und fanden
heraus, dass 85 Prozent der Private-Equity-Firmen, die zu
dem Zeitpunkt bereits in Deutschland investiert hatten,
weitere Unternehmen dort erwerben wollten. Und von den
Finanzinvestoren, die bisher noch nicht vertreten waren,
bekundeten 26 Prozent ihr Interesse an Zukäufen in
Deutschland. »Die Investoren warten nur noch auf
passende Kaufgelegenheiten, um zuzugreifen«, erzählte
Steve Roberts, der Leiter des Geschäfts mit Private-EquityFirmen bei PwC, der Wirtschaftswoche.
Die Verfasser der »Brave New World«-Studie sehen nur
ein wirkliches Problem für die Mega-Manager: das
wachsende Misstrauen der Menschen. Die Branche werde
das Vertrauen der breiteren Gesellschaft gewinnen müssen,
heißt es da. Um eine Gegenreaktion von Regulierern und
Bürgern wie nach der Finanzkrise künftig zu verhindern.
Will heißen: Sonst könnte den Finanztitanen womöglich
dasselbe blühen wie den Großbanken. Als Instrumente
schlagen die Autoren massives Lobbying und PRKampagnen vor. Und empfehlen »enge Kontakte zu
Entscheidern und Medien« aufzubauen. Sowohl auf
Branchenebene als auch auf Unternehmensebene sollten
»Beziehungen zu politischen Entscheidungsträgern«
gepflegt werden. Man werde daran arbeiten müssen, dass
die Gesellschaft die Geldverwalter als Lösung und nicht als
Teil des Problems erkennt.
Für die Mega-Manager, allen voran BlackRock, geht es
darum weiter zu wachsen, noch mehr Anlegergeld in ihre
Fonds zu holen. Da eröffnet etwa Nähe zu den
Entscheidungsträgern noch andere potenzielle
Möglichkeiten.
Monica Lewinsky: Retterin des Rentensystems
Immer wieder bemüht sich die Wall Street, Kapital, das in
öffentliche und staatliche Altersvorsorgesysteme fließt, in
ihre Kassen umzuleiten. Das Unterfangen gilt als der
Heilige Gral der Finanzindustrie. Wenn jemand ihn
erreichen könnte, dann Larry Fink. So ist BlackRock in
Großbritannien etwa bereits der zweitgrößte
Pensionsverwalter. Während der ersten Jahrzehnte des
Aufstiegs von BlackRock blieb Fink im Hintergrund. In der
Öffentlichkeit trat er selten auf. Selbst als sich der Erfolg
eingestellt hatte, blieben er und sein Unternehmen dem
Rampenlicht fern. Interviews waren selten. Das änderte
sich plötzlich im Jahr 2013. Seither taucht Larry auf allen
Kanälen auf: im Frühstücksfernsehen, in Washington, in
Madrid, in London und Berlin. Er schreibt
Meinungsbeiträge für das Wall Street Journal, gewährt der
spanischen El País eine Audienz im Ritz. Spricht mit
Hamburger Spiegel-Redakteuren, wo er erklärt, die
Deutschen seien zu ängstlich bei der Geldanlage. Er tritt
vor Studenten auf, vor Bankern, Anlegern, Politikern.
Manchmal spricht er sogar bei zwei verschiedenen
Veranstaltungen an einem Tag. Denn Fink hat eine
Botschaft, die er verkünden will: Unsere
Altersvorsorgesysteme sind dringend reformbedürftig. In
den USA hat Fink sogar einen Rentennotstand ausgerufen.
Eine nationale Krise! Und die Lösung hat der Chef von
BlackRock auch gleich parat: private Vorsorge – und zwar
nicht länger freiwillig, sondern als staatlicher Zwang.
Sein liebstes Beispiel ist Australien. Dort hat die
Regierung bei der Rentenreform die Einzahlung in einen
Sparfonds seit Januar 2014 verpflichtend gemacht. Fink
würde noch weitergehen. In den USA plädierte er dafür, die
Hälfte der Beiträge (12,5 Prozent von Lohn oder Gehalt) für
die staatliche Rentenversicherung Social Security in
private Töpfe fließen zu lassen. Denn die Social Security sei
nur als Versicherung gedacht gewesen und eine
»schreckliche Geldanlage«. Dass immer noch so viele
Bürger an den öffentlichen Systemen festhalten wollen,
liegt nach Auskunft von Fink nur an deren verzerrtem
psychologischen Blickwinkel. Studien hätten ergeben, dass
Menschen die Angst vor Verlusten höher bewerteten als
den potenziellen Genuss von Gewinnen. Diese Angst gilt es
seiner Ansicht nach zu überwinden. Er selbst, so erzählt
der Multimillionär gerne, sei 100 Prozent in Aktien. Das
Thema, das in Finks Berichten, wenn überhaupt, nur
gestreift wird: Was die Finanzkrise mit den Ersparnissen
vieler Durchschnittsamerikaner anrichtete. Durch die
Finanzkrise 2008 erlitten viele der 401(k)-Sparkonten
Einbußen von bis zu 30 Prozent. Da klingt es fast zynisch,
wenn Fink dazu auffordert, das Risiko von Verlusten etwas
lockerer zu sehen.
Fink ist auch ein Befürworter für längere
Lebensarbeitszeiten: Warum solle man ein Drittel seines
Lebens unproduktiv sein? – fragte er in einem Interview im
August 2013. »In meinen Augen ist es ein Segen, bis 67
oder 68 zu arbeiten.« Dass es für viele normale
Arbeitnehmer schlicht eine Rentenkürzung bedeutet, weil
sie in diesem Alter keinen Job mehr finden und
entsprechende Abschläge in Kauf nehmen müssen, darüber
verliert Fink kaum ein Wort in seinen Interviews und
Vorträgen. Die Altersabsicherung sei ihm ein Anliegen,
erklärt Fink, weil er selbst sich dem Rentenalter nähere –
Fink ist 1952 geboren – und weil BlackRock weltweit eine
derart große Rolle für die Vorsorge spiele. Man kann es
allerdings auch andersherum sehen: Für BlackRocks
künftiges Wachstum spielen Zuflüsse von Sparern eine
entscheidende Rolle und je mehr aus den öffentlichen
Töpfen in die privaten umgeleitet wird, desto größer die
Chance, dass der Branchenprimus einen
überproportionalen Anteil davon für sich gewinnt.
Larry Fink ist eine der mächtigsten Stimmen, die sich für
die Privatisierung einsetzen. Doch die Attacke auf die
öffentlichen Alterssicherungssysteme hat eine lange
Geschichte in Amerika – und BlackRock spielt darin auf
gewisse Weise die Rolle eines Handlangers. Dahinter steckt
ein ideologischer Kampf, das Ringen von Verfechtern einer
libertären Wirtschaftsordnung mit Befürwortern des
Sozialstaates. Die radikalen Marktwirtschaftler wollen die
Rolle des Staates zurückfahren. Und dazu gehören auch
und gerade die öffentlichen Absicherungssysteme.
Besonders in Amerika hat die Ideologie mehr und mehr
Anhänger unter Private-Equity-Baronen, HedgefondsTitanen und Großindustriellen gefunden. Sie nehmen mit
ihren enormen finanziellen Mitteln und dank
wohlgesonnener Richter, die Beschränkungen für
Wahlspenden aufgehoben haben, immer deutlicheren
Einfluss auf die Politik. In den USA wird der Kampf schon
seit Jahrzehnten geführt. Im Jahr 1980, kurz vor Reagans
Amtsübernahme, veröffentlichte der neoliberale
Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman eine Schrift,
in der er für »Entscheidungsfreiheit« plädierte. Gemeint
war ein Auslaufen des Social-Security-Programms. Reagan
zeigte sich offen für die Idee, doch ein Vorstoß scheiterte.
Die staatliche Altersvorsorge war zu populär. Reagan ließ
Social Security stattdessen nur kürzen. Doch Miltons Idee
war nicht vergessen. 1984 verfassten Stuart Butler und
Peter Germanis vom libertären Think Tank Cato Institute –
zu deren Hauptgeldgebern die Koch-Brüder gehören, die
später als Tea-Party-Sponsoren und -Organisatoren bekannt
wurden – ein Strategiepapier. Die beiden Cato-Vordenker
empfahlen eine »Leninistische Strategie« anzuwenden und
eine Art Guerilla-Taktik gegen Social Security einzusetzen.
So wie Lenin Arbeiter mobilisieren wollte, damit der
Kapitalismus schließlich zusammenbrechen würde, so
wollten sie Banker, Versicherer und Vermögensverwalter zu
Verfechtern der Privatisierung machen. Sie sollten nach
und nach die Politik von den Nachteilen der öffentlichen
Systeme überzeugen, während sie gleichzeitig die private
Vorsorge als überlegen darstellten. Die Finanzindustrie bot
sich als ein logischer Partner an. (So beschreibt es der USRentenexperte James W. Russell in seinem Buch Social
Insecurity über Amerikas Altersvorsorgekrise.)
Unter Präsident Bill Clinton kam die nächste Gelegenheit.
Clinton holte den ehemaligen Morgan-Stanley-Banker
Erskine Bowles als seinen Stabschef ins Weiße Haus.
Bowles Aufgabe: Social Security zumindest zum Teil über
den Aktienmarkt zu finanzieren und dafür staatliche
Leistungen zurückzufahren. Mit dieser Reform wollte
Clinton in die Geschichte eingehen. Die Gelegenheit schien
günstig: Der Aktienmarkt erlebte eine Rally, die
amerikanische Wirtschaft boomte. Clintons Sozialministerin
Donna Shalala berief eine Kommission, die Vorschläge
erarbeiten sollte. Mit dabei: Pete Peterson, Mitgründer von
Blackstone und einst Finks Finanzier. So nahe wie unter
Clinton kam die Wall Street nie wieder an den Heiligen
Gral. Laut dem Historiker Steven Gillon, der alle
Beteiligten später interviewte, gab es bereits eine
entsprechende Einigung zwischen Clinton und Newt
Gingrich, der damals der Mehrheitsführer der
Republikaner im Repräsentantenhaus war. »Der Präsident
war bereit gegen den Willen seiner eigenen Partei
vorzugehen und sich für die von den Republikanern
geforderte Einführung von privaten
Sozialversicherungskonten einzusetzen«, schreibt Gillon in
seinem Buch Der Pakt.
Doch dann sorgte Clintons Affäre mit der Praktikantin
Monica Lewinsky für einen Skandal und das
Amtsenthebungsverfahren. Obwohl der Präsident beides
überstand, traute sich Clinton nicht mehr, kontroverse
Projekte anzuschieben. »Monica Lewinsky änderte alles«,
sagte Bowles selbst. So rettete die damals erst 22-jährige
Lewinsky die staatliche Altersvorsorge der amerikanischen
Rentner.
Der nächste ernsthafte Vorstoß erfolgte unter George W.
Bush. Mit dem Slogan einer »Ownership Society«, einer
Gesellschaft der Eigentümer, warb er dafür, die staatliche
Rentenversicherung zumindest teilweise in private
Sparkonten umzuwandeln. Doch Bush verbrannte sich bei
dem Versuch, die vor allem bei Älteren beliebte
Absicherung abzuschaffen. Ältere Generationen haben eine
höhere Wahlbeteiligung. Die Abschaffung von Social
Security gilt deshalb seither als politisches Gift in
Washington – als »Third Rail«, das ist die Bezeichnung für
das dritte, das stromführende Gleis der U-Bahn. Wer das
»Third Rail« anfasst, erleidet einen meist fatalen
Elektroschock.
George W. Bushs Scheitern hat dazu geführt, dass die
Verfechter der Privatisierung ihre Vorgehensweise
geändert haben. Eine frontale Attacke hat sich mehrfach
als abträglich erwiesen. Jetzt versuchen sie, auf Umwegen
zum Ziel zu kommen. Sie warnen vor der Überlastung der
Systeme durch die Überalterung und davor, dass die
jüngere Generation am Ende leer ausgehen wird.
Deswegen müssten sie mit privater Vorsorge kombiniert
werden. Doch bei Normalverdienern ist das
Haushaltsbudget begrenzt. Je mehr in die privaten Fonds
fließt, desto weniger fließt in die öffentlichen Systeme. Das
führt zu Kürzungen bei den Leistungen. Und so werden die
düsteren Prophezeiungen der Kritiker schließlich wahr: Die
öffentlichen Systeme sind angeschlagen und reichen zur
Absicherung nicht mehr aus.
Auch unter Barack Obama kam die Diskussion der SocialSecurity-Reform wieder auf. Dieses Mal argumentierten die
Reformer mit der wachsenden Verschuldung der USA.
Langfristig, so ihr Argument, sei Social Security ohne
drastische Einschnitte nicht zu halten. »Fix the Debt«
lautete das Motto der Initiative, deren Ziel es war, die USA
vor der Überschuldung zu retten. Angeschoben hat »Fix
the Debt« ein alter Bekannter: Pete Peterson, der
inzwischen pensionierte milliardenschwere BlackstoneMitgründer. Petersons erklärtes Anliegen ist die Reform,
sprich die Kürzung der staatlichen Altersvorsorge. Als
Hebel versuchte er die Haushaltskrisen in Washington
einzusetzen. Die Initiative der Reichen und Mächtigen –
neben Fink waren auch Jamie Dimon, Chef der Megabank
JPMorgan Chase sowie Jeffrey Immelt, Boss von General
Electric, dabei – verzeichnete Erfolge. Präsident Obama
dachte öffentlich über eine neue Formel für die Anpassung
der Rente an die Lebenshaltungskosten nach – was in einer
schleichenden Kürzung resultieren würde. Der Vorschlag
kam von einem Komitee, das »Fix the Debt« sehr
nahesteht. In seiner zweiten Amtszeit hat Obama neue
Sparverträge namens myRA eingeführt, für Arbeitnehmer,
die keinen 401(1)-Plan über ihren Arbeitgeber bekommen.
Die myRA-Sparverträge sind zwar weit entfernt von den
Zwangssparplänen, die Fink sich vorstellt – sie können nur
in Staatsanleihen investieren –, aber es ist ein erster
Schritt in die Richtung.
Der Vorstoß der Privatisierer beschränkte sich keineswegs
auf die USA. 1994 – das Jahr, in dem Clinton den
heimlichen Social-Security-Pakt mit der Opposition schloss
– veröffentlichte die Weltbank eine Studie mit dem
warnenden Titel »Averting the Old Age Crisis«. Die Studie
sorgte dafür, dass der Privatisierungsgedanke international
an Schlagkraft gewann. Auch das historische Umfeld
passte: Der Fall der Mauer gepaart mit dem Untergang der
Sowjetunion ließ die Verfechter freier Märkte als Sieger
dastehen. Die Weltbank propagierte unter anderem, die
»maroden« öffentlichen Absicherungssysteme in Osteuropa
lieber weiter abzubauen, statt sie zu retten. Damit sollte
auch privates Kapital für den Wiederaufbau und
Investitionen freigesetzt werden. Das waren einst auch die
Argumente für eines der radikalsten Experimente mit der
privaten Altersvorsorge. Es fand in Chile statt.
Das südamerikanische Land schaffte Anfang der 1980er
die staatliche Rentenversicherung ab, die nach dem
Umlagesystem finanziert worden war, und ersetzte sie
durch private Sparpläne. Arbeitnehmer zahlen seither 10
Prozent ihrer monatlichen Einkünfte in ihre individuellen
Konten ein. Die Umstellung war teuer und wurde mit
staatlichen Mitteln bezahlt. Durchsetzen ließ sich das, weil
Chile damals vom Diktator Augusto Pinochet regiert wurde.
Hinter der Initiative steckt José Piñera, ein Minister
Pinochets, der sich von Milton Friedmans Thesen
inspirieren ließ. In den 1990er Jahren folgten weitere
Länder der Region dem chilenischen Beispiel – darunter
Argentinien, Costa Rica und Mexiko. Piñera sei der
»Rattenfänger der Rentenreform«, schrieb das Wall Street
Journal, unklar ist, ob sie dabei an die düstere Sage aus
Hameln dachten. (Piñera ist heute Sozial-Experte am Cato
Institute in Washington.)
Chile war auch das Vorbild für George W. Bush. Weltweit
wird das Land als Beispiel für gelungene Privatisierung
gelobt – zumindest von Anhängern der neoliberalen und
libertären Theorien. Die Rentenfonds haben 162 Milliarden
Dollar angesammelt, das entspricht immerhin 62 Prozent
des chilenischen Bruttoinlandsprodukts. Viele Chilenen der
Mittelschicht zeigen sich zufrieden mit dem System. Doch
Kritiker monieren die im internationalen Vergleich hohen
Gebühren für die Verwaltung der privaten Konten. Und als
die erste Generation nach der Umstellung in Pension gehen
sollte, stellten sich Defizite heraus. Statt höhere monatliche
Auszahlungen als beim früheren staatlichen System klagten
viele Pensionäre, ihre Einkünfte seien weit geringer als die
ihrer ehemaligen Kollegen, die noch unter dem alten
System in Rente gegangen waren. Viele Chilenen
verdienten so wenig, dass sie unter dem Minimum an
Einzahlungen blieben. Der Staat musste einspringen. Die
Unzufriedenheit mit der extremen sozialen Ungleichheit in
Chile brachte Michelle Bachelet an die Macht. Die
Sozialistin hatte bereits 2006 in ihrer ersten Amtszeit
versucht, eine Rückkehr zu einem staatlichen
Rentensystem einzuleiten. Damit war sie gescheitert. Doch
2008 wurde das Pensionssystem um eine Solidar-Rente
ergänzt, die Ruheständlern eine Grundsicherung bieten
soll.
Das private Rentensystem in Chile kämpft mit ähnlichen
Problemen wie das Umlageverfahren, das es einst abgelöst
hat: Die Ausbildungszeiten für junge Menschen dauern
länger und die Chilenen werden immer älter. Das verkürzt
die Zeit, in denen sie als Erwerbstätige einzahlen können.
Und auch in Chile werden langfristige und
ununterbrochene Anstellungsverhältnisse immer seltener.
Damit die Kalkulation aufgeht, müssen Beitragszahler
jedoch ihre Beiträge stetig und in genügender Höhe
leisten. Immerhin einen Gewinner gab es: die
Fondsbranche, der ein ganzes Land von Pflichtsparern
zugeführt wurde.
Chiles Erfolge und Fehler bei der Umstellung auf ein
kapitalgedecktes Pensionssystem haben Bedeutung weit
über das südamerikanische Land hinaus. Piñeras
Experiment sollten Reformer in aller Welt studieren.
Deutschlands Riester-Renten-Experiment
Auch Deutschland hat ein Experiment mit privater
Vorsorge unternommen. Die Riester-Rente, die 2001
eingeführt wurde. Es war der Versuch, der demografischen
Falle zu entkommen. Die Zahlen sprechen für sich:
Demnach wird die erwerbstätige Bevölkerung in
Deutschland ab 2020 deutlich zurückgehen und nach
Hochrechnungen des Statitischen Bundesamtes vom April
2015 bis 2060 (je nach Stärke der Nettozuwanderung)
zwischen 34 und 38 Millionen betragen. Zum Vergleich:
Noch 2013 waren 49 Millionen in der Altersgruppe
zwischen 20 und 64 Jahren. Die Bevölkerung unter 20 wird
von 15 Millionen auf 11 bis 12 Millionen sinken. Dagegen
wird die Anzahl der Menschen ab 65 Jahren weiter steigen.
Im Jahr 2060 wird die Gruppe der über 65-Jährigen bis zu
23 Millionen betragen. Jeder dritte Deutsche wird dann im
Ruhestand sein.
Und der Paritätische Wohlfahrtsverband schätzt, dass bis
2025 10 Prozent der Rentner in Deutschland von
Altersarmut betroffen sein werden. Die Lösung sahen die
Rentenreformer von 2001 in mehr betrieblicher und mehr
privater Vorsorge. Statt auf ein hohes Rentenniveau
abzuzielen und dafür steigende Beiträge für die gesetzlich
Rentenversicherten in Kauf zu nehmen, verzichtete man
auf Anpassungen. Die entstehende Lücke, so der Plan,
sollten Riester-Renten und Betriebsrenten stopfen. Doch
die Riester-Rente, benannt nach dem früheren
Sozialminister Walter Riester, hat die hoch gesetzten
Erwartungen nicht erfüllt. Zwar »riestern« inzwischen 16
Millionen Bundesbürger, aber um die gewünschte Wirkung
zu entfalten, müssten es noch viel mehr sein. Und es sind
oft diejenigen, die über andere Vermögenswerte wie
Immobilien verfügen. Ausgerechnet bei denjenigen, für die
eine private Altersvorsorge am wichtigsten wäre, klaffen
Lücken. Dazu kommt heftige Kritik an den RiesterProdukten. Die Finanzbranche hat sich nicht mit Ruhm
bekleckert. »Altersarmut-Alarm! Fast alle Riester-Renten
fallen durch«, schrieb etwa die Stiftung Warentest in ihrem
Finanztest-Magazin Ende 2013. Nur fünf der 42 geprüften
Angebote hatten in den Augen der Finanztester Bestand.
»Die Riester-Rente ist mittlerweile ineffizient. Anleger
können ihr Geld in vielen Fällen genauso gut in einen
Sparstrumpf legen«, schimpft Verbraucherschützer Axel
Kleinlein, einer der schärfsten Kritiker der Branche in
einem Interview mit dem Handelsblatt. Auch die RürupRente, das Pendant der Riester-Rente für Selbstständige,
findet bei ihm keine Gnade, denn dieses Produkt sei
ebenfalls ineffizient für die Sparer – und obendrein
unkündbar. Die Kritik hat sicher zur Skepsis der Sparer
beigetragen und damit die Riester-Rente noch weiter hinter
die ursprünglichen Ziele zurückfallen lassen.
Nicht einmal die Politik interessiert sich für das Schicksal
der mit viel Tamtam eingeführten Zusatzrente. »Die
Riester-Rente stirbt schleichend«, diagnostizierte Spiegel
Online ebenfalls im Dezember 2013. »Union und SPD
wollen Milliarden in die gesetzliche Rente pumpen, für die
Förderung der Riester-Rente haben sie nichts übrig«, heißt
es da. Und ähnlich wie in Chile hat auch die
Bundesregierung die große Rentenwende hin zu den
Privaten zumindest teilweise durch die
Leistungsausweitungen der gesetzlichen Rente 2014
wieder zurückgenommen.
Die deutsche Politik sei ja leider inzwischen gegen die
private Vorsorge eingestellt, bedauert ein deutscher
Fondsmanager, der bei einem großen internationalen Fonds
arbeitet. Aber er ist überzeugt, dass die demografischen
Zwänge langfristig auch die Deutschen in die Arme der
Geldverwalter treiben werden. Und sei es aus Mangel an
Alternativen. Die gesetzliche Rente reiche nicht aus und die
bisherige Art der privaten Altersvorsorge habe kaum eine
bessere Zukunft. »Sehen Sie, die beiden
Lieblingsanlageprodukte der Deutschen, das Sparbuch und
die Lebensversicherung, sind praktisch tot«, sagt der
Fonds-Mann. Die anhaltenden Niedrigzinsen nach der
Finanzkrise haben die Rendite dieser Produkte
plattgemacht.
Bei den Jüngeren ist die Botschaft bereits angekommen:
Auf gemeinschaftliche Absicherung ist kein Verlass mehr.
Knapp 70 Prozent der Befragten zwischen 18 und 34
Jahren glaubten bei einer Umfrage unter jungen Deutschen
von Infratest im Frühjahr 2014 nicht mehr, von ihrer
gesetzlichen Rente später auskömmlich leben zu können.
Die Finanzindustrie bestärkt sie gerne in diesem Glauben –
und darin, dass die Lösung nur sein kann, so viel wie
möglich auf die hohe Kante zu legen beziehungsweise in
ihre Produkte zu investieren.
Damit BlackRock und die anderen Vermögensverwalter
weiter wachsen können, müssen Sparer noch mehr zur
Seite legen. Kein Wunder, dass Fink nicht müde wird, die
Staatsoberhäupter und Wirtschaftsspitzen regelmäßig
daran zu erinnern, dass Sparen gefördert werden muss. Am
besten durch die Einführung von Zwangssparen. Das ist
Larry Finks jüngster Feldzug. Das wäre der krönende
Triumph seines Aufstiegs. Die Regierung und BlackRock,
Hand-in-Hand.
Übereifrige Aufseher stören da nur.
Risiko? Was für ein Risiko?
Wer in Manhattan die 14. Straße entlang in Richtung East
River geht, sieht plötzlich hohe Backsteintürme aufragen.
Wie die ziegelrote Trutzburg einer fremden Kultur heben
sich die strengen Blöcke von dem typischen New Yorker
Architektur-Allerlei drum herum ab. Das ist StuyvesantTown, eine 32 Hektar große Siedlung mit 110 Gebäuden,
benannt nach Peter Stuyvesant, jenem Generaldirektor der
Neu-Niederlande, der das damalige Neu-Amsterdam im 17.
Jahrhundert als Handelsplatz (unter anderem für Sklaven)
etablierte und an der Südspitze Manhattans einen
Schutzwall errichtete – die heutige Wall Street. Zusammen
mit dem benachbarten Peter Cooper Village ist die nach
dem alten Friesen benannte Siedlung der größte
Apartment-Komplex in Manhattan.
Und sie wird zum Schauplatz der bisher schwersten
Niederlage in der Geschichte von BlackRock. Nirgendwo
sonst hat sich das Unternehmen so offensichtlich derartig
verschätzt. Ausgerechnet in einem der Bereiche, in denen
Fink & Co. als besonders versiert galten:
Immobilienfinanzierung.
Gebaut wurde Stuyvesant Town oder kurz Stuy Town, wie
die New Yorker sagen, vom Versicherungskonzern Metlife
nach dem zweiten Weltkrieg. Damals herrschte wie heute
wieder Not an erschwinglichen Wohnungen in New York.
Stuy Town –zunächst nur weißen Mietern vorbehalten (erst
1950 ließ der Versicherer auf Druck engagierter Bewohner
auch schwarze Familien einziehen) – sollte der
Mittelschicht und öffentlichen Bediensteten wie Lehrern,
Feuerwehrleuten, Polizisten eine Alternative zur
Stadtflucht bieten. Viele der ersten Bewohner waren
Kriegsveteranen. Peter Cooper Village mit seinen für
damalige Verhältnisse luxuriöseren Einheiten war für
Ärzte, Rechtsanwälte und andere freie Berufe gedacht.
Metlife war ein guter Vermieter, sagt Susan Steinberg. Als
sie 1980 in ihr Stuyvesant-Apartment zog, war sie
begeistert. »Ich dachte, ich sei gestorben und lebte jetzt im
Paradies.« Festangestellte Hausmeister kümmerten sich
prompt um Reparaturen, Gärtner pflegten die Parkanlagen.
Steinberg, langjährige Vorsitzende des Stuyvesant-CooperMieterbundes, hatte zwei Jahre auf ihr Apartment
gewartet. Die Wartezeit wuchs später auf über 20 Jahre an,
so begehrt war der Komplex. Von Steinbergs
Wohnzimmerfenster im 11. Stock hat man einen Blick auf
die New Yorker Skyline und das Empire State Building.
Obwohl der Wolkenkratzer nur ein paar Häuserblocks
entfernt ist, wirkt die City wie eine entfernte Kulisse. 25
000 Menschen leben in der Siedlung. »Das Leben hier war
wie in der Kleinstadt, wie hatten eine Gemeinschaft«, sagt
Steinberg. Sie spricht in der Vergangenheit. Denn das
Stuyvesant, das sie seit 30 Jahren kennt, gibt es nicht mehr.
Schuld sind nach Steinbergs Ansicht der Investor
BlackRock und dessen Immobilienpartner.
Und das kam so: Während des Immobilienbooms Anfang
der 2000er weckte Stuy Town Begehrlichkeiten. Metlife
beschloss, die Siedlung zu Geld zu machen. Und so
verkaufte der Versicherungsriese Stuyvesant Town und
Peter Cooper Village für den Preis von 5,4 Milliarden Dollar
an ein Konsortium um BlackRock und Tishman Speyer. Es
war der absolute Rekord. In vielerlei Hinsicht markierte
der Deal den Höhepunkt des Betongoldrausches der frühen
2000er Jahre.
Viele von BlackRocks guten Kunden kamen mit an Bord:
etwa Calpers, der Pensionsfonds der öffentlichen
Angestellten des Bundesstaates Kaliforniens, der 500
Millionen Dollar in das Projekt steckte. Auch der
Schwesterfonds CalSTRS, der die Pensionskasse der
kalifornischen Lehrer verwaltet, war mit 100 Millionen an
Bord. Der Staatsfonds Singapurs investierte 575 Millionen
Dollar. BlackRocks Partner war Tischman Speyer, eine der
großen New Yorker Immobiliendynastien. Rob Speyer und
sein Vater Jerry leiten das Unternehmen, zu dessen
prominenten Engagements unter anderem das Rockefeller
Center, das Chrysler Building und der Frankfurter
Messeturm gehören. Speyer Senior hat gute Beziehungen
zur Wall Street. Schließlich war er von 2001 bis 2007 im
Aufsichtsrat der New Yorker Notenbank.
Viele der Mieter des Stuyvesant-Komplexes genießen
Bestandsschutz – ihre Miete darf nicht erhöht werden. Das
hat dazu geführt, dass sie heute mehrere hundert Dollar
zahlen für Wohnraum, für den sie auf dem freien Markt
mehrere tausend Dollar zahlen müssten. Laut der
Mieteraktivistin Steinberg sei der Plan gewesen, möglichst
viele Apartments möglichst schnell auf die marktübliche
Miete anzuheben. Doch der gesetzliche Bestandsschutz
war dabei im Weg. Tishman Speyer habe allerlei legale
Manöver probiert, um Mieter mit einer Mietgarantie
loszuwerden, sagt Steinberg. Sie schüttelt den Kopf über
das Engagement der Pensionsfonds bei der Stuy-TownÜbernahme. »Haben die sich denn nicht überlegt, dass die
Folgen eines solchen Deals genau die Art von Leuten
treffen, die auch ihre Mitglieder sind?«, fragt sie.
Normalverdiener, Rentner, die auf bezahlbaren Wohnraum
angewiesen sind. Ob Calpers und Calstrs dabei nur auf die
versprochene Rendite geschaut hätten? Aber in der neuen
Welt der Vermögensverwalter haben solche Überlegungen
wohl keinen Platz.
Das Kalkül der Investoren ging letztlich nicht auf. Die
Mieter wehrten sich, zogen vor Gericht. Und gewannen.
Tishman musste in vielen Fällen die Mieterhöhungen
zurücknehmen. Dazu kam die Rezession nach der
Finanzkrise 2008. Manhattans Mietpreise gaben nach.
2010 war klar, dass der größte Immobiliendeal zur größten
Immobilienpleite zu werden drohte. Die Gläubiger machten
Druck. Da entschlossen sich Tishman und BlackRock
Stuyvesant Town und Peter Cooper an die Kreditgeber zu
übergeben. Die Investoren verloren ihren Einsatz. Für
Calpers waren es 500 Millionen Dollar. Ein herber Verlust
für den Pensionsfonds. Peinlich für BlackRock: Die
Kalifornier, deren Strategien am Markt genau beobachtet
werden, entzogen BlackRock das Mandat für das
Immobilienportfolio.
Aber abgesehen von der Delle im schön polierten Ruf
kam BlackRock mit vergleichsweise übersichtlichen
Verlusten von 112 Millionen Dollar davon, so berichtete die
New York Times im Januar 2010. (Auch Tishman Speyer
verlor 112 Millionen Dollar.) In Stuy Town übernahm einer
der Gläubiger das Management. Bei den Mietern, die
durchgehalten haben, geht die Angst um, vor neuen
Gebühren, neuen Erhöhungen. »Stuy Town ist nicht mehr,
was es war«, sagt Steinberg. Sie fürchtet, dass die
Siedlung langfristig nicht mehr die bezahlbare Oase in
Manhattans Immobilienmarkt sein wird. Stuy Town werde
jetzt als »Luxuswohnen« vermarktet. Immer wieder gehen
Gerüchte über einen erneuten Verkauf um.
Für Fink ist Stuy Town ein wunder Punkt. Jeder mache
Fehler, blaffte Fink Reporter des Society-Magazins Vanity
Fair an, die sich getraut hatten, nach dem – zumindest für
die Kunden – so teuren Desaster zu fragen. Er habe
schlaflose Nächte deswegen, behauptete Fink. Schließlich,
so der Multimillionär, beziehe seine Mutter ihre Pension
von Calpers.
Stuy Town war nicht die einzige peinliche
Fehleinschätzung. Im Juni 2008 berichtete Bloomberg,
BlackRock habe Anteile an Lehman Brothers gekauft. »Wir
haben Vertrauen in die Bank, in das Führungsteam«, wird
da BlackRocks Präsident Robert Kapito zitiert. Lehmans
Spitze hätte eine Geschichte als Team, Fokus, Erfahrung in
der Krisenbewältigung, das Vertrauen des Markts. Worte,
die Kapito nur wenige Wochen später wahrscheinlich fast
noch mehr bereut hat als das finanzielle Engagement. Denn
nur zwölf Wochen später trat das von ihm so gelobte
Führungsteam um Richard Fuld den Gang zum
Konkursrichter an. Dabei war im Juni, als Kapito jenes
Bloomberg-Interview gab, Lehman bereits in schweren
Turbulenzen. Lehmans Aktien waren in den ersten sechs
Monaten um rund 60 Prozent gefallen – ganz offenbar
mangelte es den Marktteilnehmern an Vertrauen in
Lehman. Um sich selbst zu retten, hatte Fuld bereits seine
rechte Hand, Joseph Gregory, und seine Finanzchefin Erin
Callan »unter den Bus geworfen«, wie es so anschaulich an
der Wall Street heißt. Er hatte sie verantwortlich für die
Krise gemacht und gefeuert.
Wie Fink richtig sagt, jeder macht Fehler. Dennoch sind
das Stuy-Town-Debakel und der Lehman-Fehlgriff wichtige
Momente in BlackRocks Werdegang, denn sie zeigen, dass
sich auch BlackRock trotz des immer wieder betonten
Fokus auf das »paranoide Risikobewusstsein« und der
bewusst kommunizierten Distanz zur Wall Street nicht der
dort herrschenden Mentalität und Kultur entziehen kann.
Hört man Interviews von Fink, kann man den Eindruck
gewinnen, dass sein Unternehmen trotz der gigantischen
Reichweite praktisch weniger Risiko für das Finanzsystem
darstellt als die Sparkonten einer Volksbank. BlackRock sei
lediglich ein Mittler des Anlegerwillens, beharrt der
BlackRock-Boss. »Es ist nicht mein Geld«, sagt er wieder
und wieder, wenn die Frage nach dem Systemrisiko in
Interviews auftaucht. Und er hat recht: Verluste bei den
Anlageprodukten trägt der jeweilige Investor, nicht
BlackRock als Verwalter. Anders als bei Banken riskieren
Vermögensverwalter nicht ihr eigenes Kapital
beziehungsweise staatlich garantierte Spareinlagen. Und
Vermögensverwalter setzen auch keinen Kredithebel ein.
Anders als Lehman und die anderen Banken, die vor der
Finanzkrise für jeden eigenen Dollar bis zu 50 dazu liehen.
Doch das heißt nicht, dass die Herren des Geldes kein
Risiko für die Allgemeinheit bergen. Die Gefahren sehen
nur anders aus als die der Banken.
Im Frühjahr 2014 lud die London Business School
Andrew Haldane zu einer Konferenz ein. Es ging um das
Thema Geldanlage. Haldane war zu dem Zeitpunkt der
Leiter der Abteilung Finanzmarktstabilität bei der
britischen Notenbank, der Bank of England. Was er den
Teilnehmern der Veranstaltung zu sagen hatte, ließ
Fondsbetreiber zusammenzucken und Aufseher weltweit
aufhorchen. »Wir leben in der Ära der
Vermögensverwalter«, erklärte Haldane. Weltweit gebe es
immer mehr potenzielle Sparer – und damit potenzielle
Kunden für die Branche. Seit 1950 sei die
Lebenserwartung um nahezu 50 Prozent gestiegen, die
Weltbevölkerung habe sich verdreifacht und das
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat sich fast vervierzigfacht.
Auch die Vermögen sind seit der Nachkriegszeit deutlich
gestiegen. Heute wird das Gesamtvermögen, das die
Verwalter eingesammelt haben, auf knapp 64 Billionen
Dollar geschätzt. (Das umfasst alle Arten von Fonds von
öffentlichen Pensionskassen, Staatsfonds,
Stiftungsvermögen, Private Equity, Hedgefonds,
Investmentfonds aller Art und so weiter.) Bis 2020, so hat
PriceWaterhouseCoopers prognostiziert, werden die
Vermögensverwalter ein Kapital von 100 Billionen Dollar in
ihren Fonds haben. Wenn man die bisherigen Trends
zugrunde lege, dann könnte die Branche bis 2050 die
Summe von 400 Billionen unter Verwaltung haben. Das
wäre einhundert Mal das deutsche Bruttoinlandsprodukt!
Bei den Fondsgesellschaften, wie die, die von BlackRock
betrieben werden, verteilt sich ein großer Teil der Summe
auf wenige Player. Zehn Gesellschaften halten jeweils mehr
als 1 Billion Dollar, neun davon stammen aus Nordamerika.
Skaleneffekte bei Portfolioaufbau und Verwaltung und die
neuen Indexfonds hätten zu einer hohen Konzentration in
der Branche geführt, heißt es in einem Bericht des
Washingtoner Office of Financial Research aus dem Herbst
2013. Die Behörde, die nach 2008 als eine Art öffentlicher
Sturmwarndienst für das Finanzsystem eingerichtet wurde,
schreibt darin, die »starke Konzentration könnte das Risiko
erhöhen, das die einzelnen Anbieter für den Finanzmarkt
darstellen – das operative Risiko sowie das
Investmentrisiko«.
Allein die Größe stellt auch nach Ansicht Haldanes
bereits eine Gefahr dar. Ein angeschlagener
Vermögensverwalter könnte Anleihen, Aktien, Rohstoffe
schnell abstoßen müssen, um Investoren ihr Geld
zurückgeben zu können. Das könnte einen »Fire Sale«
ausbrechen lassen. Und so könnte das Brand-Szenario
aussehen: Der Ausverkauf eines wackelnden
Branchenriesen lässt die Kurse am Markt einbrechen. Das
wiederum löst eine Kaskade von Verkäufen weiterer
Marktteilnehmer aus und bringt immer mehr Investoren
dazu, ebenfalls ihr Kapital zurückzufordern, was wiederum
weitere Verkäufe veranlasst – und so im schlimmsten Fall
zu einem Zusammenbruch des gesamten Markts führt. Eine
Studie der University of Chicago Booth hat untersucht, ob
auch Nicht-Banken einen Crash auslösen können, obwohl
sie keinen Kredithebel einsetzen. Kurze Antwort der
Autoren: Ja. Die Geldverwalter konkurrieren um die Gunst
der Kunden und wollen deshalb stets besser abschneiden
als ihre Wettbewerber. So will keiner der Letzte sein, wenn
es darum geht, aus einer Verlustposition auszusteigen und
zu verkaufen. Das kann im ungünstigsten Fall eine
Verkaufswelle lostreten, die sich verselbstständigt.
Umgekehrt besteht die Gefahr, dass die Fonds auf der
immerwährenden Suche nach maximaler Rendite in die
gleiche Richtung drängen. Vermögensverwalter könnten
einem Herdentrieb erliegen, warnte das Office of Financial
Research in seinem Bericht 2013, der alle in die gleiche
Richtung rennen lässt, was zu Blasen und anderen
Verwerfungen führen kann. Der Wettbewerbsdruck könne
Investmentmanager dazu verführen, höhere Risiken
einzugehen.
Das Terrain der Geldverwalter und Schattenbanken ist
für Regulierer schwierig – die Branche ist so schnell
gewachsen und hat sich dabei fundamental geändert, dass
viele Bedrohungen schlicht unbekannt sind. »Deutliche
Datenlücken verhindern eine effektive Analyse und
Aufsicht«, muss das Office of Financial Research am Ende
seines Berichts gestehen. Doch das muss nicht heißen, dass
es keine Risiken gibt. »Schwarze-Schwan-Ereignisse
könnten eine reale und wachsende Bedrohung sein«,
warnte auch Haldane seine Zuhörer.
Schwarze Schwäne – so nennt Nassim Nicholas Taleb, ein
ehemaliger Derivatehändler und Professor an der New York
University, seine Theorie der unvorhergesehenen
Ereignisse, die massive Konsequenzen haben – wie die
Terroranschläge des 11. Septembers, die Erfindung des
Internets oder der Zusammenbruch des Immobilienmarkts
in den USA vor der Krise 2007. Ereignisse, die unsere
Denkmodelle sprengen, so wie im 17. Jahrhundert die
Entdeckung schwarzer Schwäne in Westaustralien die
überkommene Annahme der Europäer, Schwäne seien
grundsätzlich weiß, buchstäblich mit einem Augenblick
widerlegte. Dieses Ereignis hatte glücklicherweise keine
bitteren Konsequenzen, höchstens für die Schwäne, die für
Tiergärten in der Alten Welt eingefangen wurden. Welche
Gefahren von einem Geld-Koloss wie BlackRock
möglicherweise drohen, können sich selbst Experten – noch
– nicht genau vorstellen. Fest steht: Wenn es bei den
Vermögensverwaltern rumst, wird es nicht so harmlos sein
wie die Entdeckung einer neuen Art Wasservögel.
Die Unruhe der Regulierer ist auch Fink & Co. nicht
verborgen geblieben. Ein Grund, warum BlackRock es
vorzieht, unter dem Radar zu bleiben, ist die Befürchtung,
dem Koloss könnte das passieren, was den großen Banken
passiert ist, die sich durch Tausende neuer Vorschriften
nach der Finanzkrise gefangen fühlen wie Swifts Gulliver,
der von den Liliputanern mit ihren Schnüren am Boden
bewegungsunfähig gemacht wird. In den vergangenen
Jahren musste BlackRock jedoch bangen, dass die Nurnicht-auffallen-Strategie, das stets wiederholte Mantra
»Wir sind doch bloß ein großer Sparverein« nicht mehr
ausreichen würde. Es wurde Zeit, das Problem in
Washington anzupacken – und Fink hatte auch schon
jemanden, der die heikle Mission übernehmen sollte:
Barbara Novick.
Wie BlackRocks Supermom Washington gewann
Der Sicherheitscheck durch Beamte samt Scanner am
Eingang steigert das Gefühl der Exklusivität. An diesem
windig-regnerischen Winterabend finden sich etwa hundert
Gäste im Deutschen Haus, der offiziellen New Yorker
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland, ein.
Eingeladen haben das German Center for Research and
Innovation und Women in Sovereign Entities, ein Verein,
der Frauen in Staatsorganen fördern will. Doch die
Veranstaltung hat wenig mit Frauen oder mit deutscher
Forschung zu tun. Es geht, so der Titel, um die »Wirkung
von Innovation auf die Effizienz von Zentralbanken«.
Schnell wird klar, hier sprechen Eingeweihte vor
Eingeweihten. Im Publikum sind unter anderem die
Vertreter der Zentralbanken von Indonesien, Thailand und
Österreich sowie der Finanzbehörden von Singapur und
Hongkong. Dazu eine Abgesandte des UN-Pensionsfonds
und der People’s Bank of China. Anders ausgedrückt:
BlackRocks VIP-Kunden. Und auf dem Podium thront
Mervyn King, zehn Jahre lang Gouverneur der Bank of
England, sowie Christine Cumming, die Vize-Präsidentin
der New Yorker Notenbank. Neben den beiden
Zentralbankern sitzt eine schmale Frau Mitte 50. Mit ihrer
unauffälligen Brille und den brav gescheitelten dunklen
langen Haaren könnte man sie für eine Lehrerin halten –
Bio und Sport vielleicht. Eine von der strengeren Sorte
allerdings. Das ist Barbara Novick, Gründungsmitglied von
BlackRock. Sie gehörte schon vorher bei First Boston zur
Clique um Fink und Kapito. Zu den »mächtigsten Moms der
Welt« zählt die Wall-Street-Boulevard-Webseite Business
Insider die Mutter dreier Kinder. (Sie ist auch Fußballcoach
der Jungendliga in Westchester, jenem grünen Speckgürtel
um New York, wo sie mit ihrer Familie wohnt). Als Mitglied
des weltweiten Steuerungskomitees von BlackRock gehört
sie zum Topmanagement. Sie war lange zuständig für
Geschäftsentwicklung und Kundenbeziehungen und kennt
das Unternehmen mindestens so gut wie Fink. Seit 2010
hat Novick eine neue Aufgabe übernommen: Government
Relations. Im Klartext: Novick ist BlackRocks oberste
Lobbyistin. Ihre Mission: BlackRock vor den immer
zudringlicheren Regulierern zu schützen. Novick spricht
überraschend leise (das Mikrofon funktioniert nicht) und
sehr schnell. Doch kommt sie bei der Paneldiskussion
direkt zu ihrer Kernbotschaft. »Wir beobachten, dass bei
Reden von Regulierern und Experten weltweit der Begriff
Schattenbanken zunehmend durch Marktfinanzierung
ersetzt wird«, stellt sie zufrieden fest. Interessant:
BlackRock scannt also offenbar systematisch die Redetexte
von Aufsehern und Notenbankern weltweit nach dem
Begriff. Was nach dem Gipfel der Wortklauberei klingt, hat
weit tiefere Bedeutung. Denn die Formulierungen und
Bezeichnungen sind von großer Wichtigkeit an der Wall
Street. Darin hat es die Branche zur Meisterschaft
gebracht. So heißen Wackelanleihen von Unternehmen mit
nicht ganz so glänzender Kreditwürdigkeit mit
erfrischender Ehrlichkeit »Junk« Bonds – Schrott-Anleihen.
Gegenüber Anlegern legen Banker allerdings großen Wert
darauf, stattdessen von »High Yield Bonds«, also
hochverzinslichen Anleihen, zu sprechen. Aus den
Corporate Raiders wurden schönfärberisch »Private
Equity«-Firmen, was eher nach exklusivem Club als nach
Unternehmensjägern auf Pump klingt. »Eine der Folgen
der Finanzkrise war, dass die Wall Street ihre silbernen
Zungen verlor. Sie stammelten und stotterten, als sie
erklären sollten, wie es zu dem Desaster gekommen war«,
lästerte die Financial Times. Doch mit der Erholung des
angelsächsischen Finanzkapitalismus sind auch die
Silberzungen zurückgekehrt. Nun soll also aus
Schattenbanken, einem Begriff, der selbst bei Laien
zumindest vage Vorstellungen von Zwielichtigem auslöst,
die nichtssagende »Marktfinanzierung« werden. Das klingt
harmlos genug – und das soll es wohl auch.
Novick hat die Beharrlichkeit einer guten Lehrerin. Bei
Fragen im Anschluss an die Podiumsdiskussion an jenem
Abend im Deutschen Haus korrigiert sie sofort. »Die
Bezeichnung Schattenbanken hat einen negativen
Beiklang.« Schatten, das klinge nach Bedrohung. Dabei
gehe es doch darum, nützliche Projekte für die
Allgemeinheit zu finanzieren, wie etwa
Infrastrukturmaßnahmen. Gefragt nach möglichen
Interessenkonflikten bei Vermögensverwaltern und ob es
da nicht neue Regeln für Schattenbanken bräuchte, verliert
Novick die Contenance. Sie wüsste nicht, von was die Rede
sei. »Wir sind treuhänderisch unseren Kunden
verpflichtet«, das sei BlackRocks oberstes Gebot, schnappt
sie noch, bevor sie sich grußlos umdreht und im
Treppenhaus verschwindet. Oben beim Sektempfang wird
der Small Talk unter ihresgleichen sicher angenehmer
verlaufen. Für BlackRocks oberste Diplomatin ist der
Auftritt überraschend dünnhäutig. Vielleicht sind die
Fragen der Gesprächspartner in Washington und Brüssel
aber auch feinfühliger gestellt.
Bis zur Finanzkrise hielt sich BlackRock in Washington sehr
zurück. Im Wesentlichen verließ sich das Unternehmen auf
die Vertretung durch Branchenverbände, in denen
BlackRock Mitglied ist. Im Jahr 2008 etwa findet sich für
BlackRock direkt gar kein Eintrag bei OpenSecrets, der
Washingtoner Webseite, die die Lobby-Aktivitäten der
Unternehmen und Verbände verfolgt. Im Jahr 2009
vermerkt OpenSecrets lediglich 545 000 Dollar an
Honoraren für zwei Lobby-Firmen – eine Summe, die nicht
einmal einen Rundungsfehler in der Kostenrechnung des
Geldgiganten darstellt. Es ist die Zeit, als BlackRock als
Verbündeter von Finanzministerium und Notenbank
auftritt. Dann ist da noch der kurze Draht zu
Finanzminister Geithner. Warum auch Geld für etwas
ausgeben, was BlackRock praktisch frei Haus bekommt?
Wenig später nehmen die New Yorker die Aktivitäten in
der Hauptstadt aber wohl ernster. Es ist die Zeit der
Finanzreform. Nachdem Volksvertreter und Aufseher die
Gefahr im Bankensystem verschlafen (oder ignoriert)
hatten, sind sie nun sensibler für potenzielle Risiken
geworden. Und die schiere Größe von BlackRock, Fidelity
und anderen bereitet ihnen plötzlich Unbehagen. Der
Financial Stability Oversight Council, ein Gremium, das
quasi die Aufsicht der Aufseher darstellt und im USFinanzministerium angesiedelt ist, beginnt öffentlich
darüber nachzudenken, ob große Vermögensverwalter
nicht als SIFI – als Systemically Important Financial
Institution – eingestuft werden müssten.
Das würde besondere Auflagen und spezielle Aufsicht
bedeuten – etwas, was Fink und Co. kategorisch ablehnen.
Zeit, in Washington zu intervenieren: Für 2011 registriert
OpenSecrets für BlackRock plötzlich über 2,5 Millionen
Dollar an Ausgaben für Lobbying. Wie ernst Fink die
Bedrohung nimmt, zeigt die Tatsache, dass er nicht – wie
die meisten Konkurrenten – einen ehemaligen
Kongressabgeordneten oder Ex-Ministerialen als
Lobbyisten anheuert, sondern stattdessen seine
Mitgründerin Novick in die Hauptstadt entsendet.
Dort besucht die BlackRock-Diplomatin unter anderem
mehrfach Debbie Matz, die Chefin der National Credit
Union Administration, ein Verband, von dem selbst die
Politik-Junkies der US-Hauptstadt selten etwas gehört
haben. Offiziell ist die NCUA, die ihren Sitz nicht einmal
direkt in DC, sondern in einem Vorort der Hauptstadt hat,
für die Interessenvertretung der lokalen Sparvereine
zuständig. Doch Matz hat noch eine andere Funktion. Sie
gehört zum zehnköpfigen Financial Stability Oversight
Council – richtig: Das ist jenes Gremium, das darüber
entscheiden soll, ob BlackRock künftig den Warnaufkleber
SIFI verpasst bekommt. Das FSOC muss Entscheidungen
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit treffen. Novick muss es
also gelingen, mindestens vier Mitglieder zu überzeugen,
damit BlackRock nicht als eine Gefahr eingestuft wird. Ihre
Besuche bei Matz hätten der Aufklärung gedient, zitiert der
Nachrichtendienst Bloomberg Novick. Viele Aufseher
hätten wenig Erfahrung mit Vermögensverwaltern. Um die
notwendigen Stimmen im FSOC zusammenzubekommen,
verbündet sich BlackRock sogar mit der Allianz, der
Muttergesellschaft des Erzrivalen Pimco.
Doch dann erhält BlackRock unter den FSOC-Mitgliedern
einen weit wertvolleren Verbündeten. Mary Jo White. Wenn
man Mary Jo White beschreiben will, dann fällt einem Yoda
ein, der knitterige, gnomenhafte Lehrmeister der JediRitter aus der Krieg-der-Sterne-Saga. Wie bei Yoda wäre es
ein Fehler, White zu unterschätzen. Sie gehört zu den
Juristen, über die andere Juristen stets mit einem Unterton
von Ehrfurcht reden, ihre Kontrahenten mit einem
Unterton von Furcht. Mary Jo White hat die so genannte
Drehtür – wie das Pendeln zwischen öffentlichem Amt und
privatem Job in den USA genannt wird – so oft durchlaufen,
dass einem allein beim Lesen ihres Lebenslaufs leicht
schwindelig wird. Als junge Anwältin in den 1970er-Jahren
arbeitete sie bereits für Debevoise & Plimpton. Die New
Yorker Traditionskanzlei genießt den Ruf, die »Waffe der
Bosse« zu sein. Lange war Debevoise & Plimpton vor allem
eine Anlaufstelle für US-Unternehmen und Behörden. Die
Mandantenliste liest sich wie das Who’s who der
amerikanischen Großkonzerne: American Airlines, CNN,
Coca-Cola, ExxonMobil, General Electric, die
Bekleidungskette Gap, der Versicherer Metlife, die
Investmentbank Goldman Sachs, der Musikkonzern
Universal Music oder das Onlineportal Yahoo, die New York
Times und der weltgrößte Spielzeughersteller Hasbro.
Auch international wenden sich Aufsichtsräte in Not
inzwischen gerne an die Anwälte der Traditionsfirma, die
Niederlassungen in Paris, Moskau, Hongkong, Shanghai
und auch in Frankfurt unterhält. Zu den Klienten zählten
unter anderem die russische Airline Aeroflot, der
französische Assekuranzkonzern Axa, DaimlerChrysler, der
Schweizer Pharmahersteller Novartis und der japanische
Unterhaltungsriese Sony. Nach ihrem ersten Einsatz für
Debevoise & Plimpton wechselte White zur
Staatsanwaltschaft. In den 1980er-Jahren arbeitete sie
erneut für die Traditionskanzlei. Dann wieder war sie neun
Jahre lang leitende Bundesstaatsanwältin in New York, zu
deren Zuständigkeitsbereich auch die Wall Street zählte.
Sie war die erste Frau in der 200-jährigen Geschichte der
Strafverfolgungsbehörde, die diesen Posten innehatte. Sie
ermittelte unter anderem gegen die Terrorattentäter des
ersten Anschlags auf das World Trade Center sowie gegen
die Mafia und deren Versuche, ihren Einfluss und ihre
Geschäfte auf die Börse auszudehnen. Im Jahr 2002
wechselte White erneut die Seiten und wurde die Leiterin
der Abteilung für Streitsachen bei Debevoise & Plimpton.
In ihr Spezialgebiet – interne Untersuchungen und
Verteidigung von Unternehmen gegen Vorwürfe von
Regierungsinstitutionen oder der US-Börsenaufsicht – fiel
auch der Fall Siemens. Der Münchner Konzern heuerte die
Kanzlei für eine interne Untersuchung seiner
Korruptionsaffäre an. Ziel solcher Untersuchungen, so das
harsche Urteil von Kritikern, sei letztlich nur die
Ausstellung eines öffentlichkeitswirksamen Persilscheins.
Im Jahr 2013 machte sie Präsident Obama schließlich zur
Chefin der US-Börsenaufsicht. Befürworter der Drehtür
sehen einen Vorteil darin, dass Behördenvertreter auch die
Gegenseite gut kennen. Genau das sei das Problem, sagen
dagegen Kritiker des Systems.
Wie dem auch sei, White jedenfalls schlug sich in der
Diskussion über den Gefahrenaufkleber für
Vermögensverwalter auf deren Seite. Sie wiederholte sogar
öffentlich deren Argumente. White sei auf einer
»Verbeugungstour« bei den Fondsmanagern, um ihnen ihre
Sympathie zu versichern, spottete gar die New York Times.
Doch im Hintergrund ging es noch um etwas anderes:
Zwischen der SEC und der Fed war ein Revierkampf
ausgebrochen. Erhielten die Vermögensverwalter die SIFIEinstufung, würde Fed-Chefin Janet Yellen vornehmlich die
Aufsicht führen. Das wollte White verhindern. Sie hatte die
SEC in einem demoralisierten Zustand übernommen. Der
einst gefürchtete Wachhund der Wall Street war zum
Schoßhündchen verkommen. Nicht nur hatten die SECWächter die Wackelhypotheken komplett ignoriert, sie
hatten auch den Milliardenbetrüger Bernie Madoff erst
enttarnt, als dessen Jahrhundertschneeballsystem von
allein zusammenbrach. Keinesfalls wollte White weiter an
Bedeutung verlieren. Als der FSOC in einer Studie 2013 zu
dem Schluss kam, die Fondsriesen könnten tatsächlich eine
Gefahr darstellen, veröffentlichte White das Papier ohne
ihre FSOC-Kollegen zu konsultieren. Als sich Obamas
Finanzminister Lew, ebenfalls ein Mitglied des Gremiums,
über den Alleingang beschwerte, entschuldigte sich White
brav. So jedenfalls berichteten es Washington-Insider
gegenüber Bloomberg News. Doch Whites VorabVeröffentlichung bot den Vermögensverwaltern die Chance,
ihre Lobbyisten mit Munition zu versorgen und in Stellung
zu bringen. Auch Novick wurde aktiv, berichten die Insider.
Sie und die Vertreter von Fidelity und Pimco wandten sich
an Abgeordnete des Repräsentantenhauses. Die –
vorwiegend republikanischen – Volksvertreter sind
notorisch gegen staatliche Regulierung.
Und Novick und Co. erreichten ihr Ziel: Bei einer
Anhörung vor dem Kongress musste der FSOC-Vertreter,
der für die Studie verantwortlich war, sich einiges von
aufgebrachten Volksvertretern anhören, unter anderem,
dass die Untersuchung ein fehlendes Verständnis für die
Branche zeige. Der Unmut zeigte Wirkung. Nach dem
Gegenwind aus dem Kongress stellte der FSOC die SIFIFrage erst einmal zurück. Im Sommer 2014 verlautete aus
dem Gremium dann, man werde den Fokus der SIFIEinstufung ändern – künftig ginge es um einzelne Produkte,
nicht länger um einzelne Unternehmen. Ein SIFI-Aufkleber
für BlackRock oder Fidelity war damit erst einmal vom
Tisch. Auch das Baseler Financial Stability Board, das
internationale Gremium, überlegt, die Schattenbankriesen
als potenziell systemgefährdend einzustufen. Doch nach
dem Einknicken des FSOC ist das schwieriger geworden.
Die Europäer würden keinen Alleingang wagen, denn »die
US-Regulierer werden in dieser Sache die bestimmende
Kraft bleiben wollen, da die größten Fonds-Konglomerate
alles US-Unternehmen sind«, fassten es Analysten der
internationalen Beratungsgesellschaft
PriceWaterhouseCoopers in einem Briefing nach dem
FSOC-Rückzieher zusammen. Chapeau, Novick!
Heimlicher unheimlicher Herrscher der Welt
Es war im Januar 2009, als sich der Besitzer des
Zeitungskiosks neben der New Yorker Börse, sonst eher an
die Fragen nach dem Wall Street Journal und der Financial
Times gewohnt, wunderte: »Jeder will heute das RollingStone-Magazin, was ist denn da drin?« Die Banker und
Börsianer hatten nicht plötzlich ein reges Interesse an dem
Rapper Snoop Dog oder neu aufgetauchten Bob-DylanSongs entwickelt. In der Ausgabe erschien der Artikel oder
besser gesagt die Polemik des Reporters Matt Taibbi, der
darin die Investmentbank Goldman Sachs als »VampirKalmar« beschrieb, der sich »um das Gesicht der
Menschheit gewickelt habe und seinen blutsaugenden
Rüssel überall hineinstecke, wo es nach Geld riecht«. Wow,
das schlug Wellen. Den Vampir-Ruf hat Goldman seither nie
mehr so richtig abgeschüttelt. (Das Lektorat des Rolling
Stone hatte eingewendet, der echte Vampir-Tintenfisch sei
kein Blutsauger, aber Taibbi holte die Genehmigung des
Chefredakteurs ein und so blieb er drin.) Was wäre
BlackRocks zoologische Entsprechung? Wie wäre es mit
dem Riesenkalmar mit seinen zehn Tentakeln? Lange
wurden Erzählungen von diesem »Monster der Tiefe« als
Seemannsgarn abgetan. Etwa jene Geschichte, die
Überlebende des während des zweiten Weltkriegs von den
Deutschen versenkten britischen Truppentransportschiffes
Britannia erzählten. Sie hielten sich an einem Rettungsfloß
fest, als einer von ihnen von einem Riesenkraken in die
Tiefe gezogen wurde, berichteten die Schiffbrüchigen
später. Doch dann fanden sich immer mehr Hinweise
darauf, dass es sich nicht um ein Fabelwesen, sondern um
ein wirkliches Tier gehandelt hatte. Auf der Haut von
Pottwalen fanden sich vernarbte Abdrücke von Saugnäpfen.
Von großen Saugnäpfen. Haie werden offenbar Beute des
Molusken. Dann wurden an Stränden einzelne meterlange
Tentakel angespült. Bis man schließlich tote Exemplare der
Riesenkopffüßler fand. Doch bis heute weiß niemand
wirklich, wie groß diese Tiere der Tiefe sind. Schätzungen
gehen bis zu zwölf Meter, mit ausgestreckten Fangarmen.
Auch die Lebensweise ist bisher nur andeutungsweise
bekannt.
BlackRocks Finanzarme reichen heute fast überall hin.
Die New Yorker halten Anteile von Unternehmen in so gut
wie allen Branchen, auf allen Erdteilen. Gleichzeitig sind
sie auch Gläubiger von Tausenden Unternehmen. Fink &
Co. sind Eigentümer und Kunde der größten Banken der
Welt. Sie agieren als Schattenbank, Hedgefonds und BigData-Staubsauger. BlackRocks Vertreter sind Einflüsterer
von Notenbankern und Behörden, den Strippenziehern in
Washington und Brüssel.
Auf fast alle Bereiche unseres Lebens hat der
Geldverwalter inzwischen Einfluss: Arbeitsplätze,
Wohnungen, Straßen, Brücken, Erziehung,
Gesundheitsversorgung. Noch vor zehn Jahren wäre es
dem, der einen solchen Riesenkalmar des Geldes
beschrieben hätte, so gegangen wie jenen Schiffbrüchigen
der Britannia. Ein solches System im Finanzsystem hätte
die Vorstellungskraft überstiegen.
In der Ära der Mega-Manager wird BlackRocks Einfluss nur
noch weiter steigen. China und andere Schwellenländer
schließen sich dem angelsächsischen Finanzsystem an.
Wenn Fink und seine Nachfolger es geschickt anstellen,
werden weitere Billionen in ihre Kassen fließen. Doch
unser Wissen über sein Tun und die Risiken, die der
Aufstieg des Riesenkalmars des Kapitalmarkts mit sich
bringt, ist, wie bei seinem zoologischen Vorbild, bestenfalls
lückenhaft. Das gilt nicht nur für Bürger und Politiker. Auch
Akademiker und Regulierer müssen blinde Flecken
eingestehen. Während das Verhalten und der Kollaps von
Banken seit Jahrhunderten studiert worden seien, stehe
eine ähnliche Analyse der institutionellen
Geldverwalterbranche noch ganz am Anfang, ist das Fazit
von Andrew Haldane, dem Finanzmarktexperten der Bank
of England, bei seiner warnenden Rede im April 2014. Die
Branche sei eine »grüne Wiese, die sorgfältig kultiviert
werden müsse«, um Fallstricke wie bei den Banken zu
vermeiden. Brad Jones, Finanzexperte des Internationalen
Währungsfonds, hat im Rahmen einer Studie aus dem
Februar 2015 die Dimensionen der grünen Wiese so
umrissen: Sowohl in ihren Eigenschaften – wie Größe,
Konzentration und gegenseitige Abhängigkeiten – als auch
bei ihren Aktivitäten, die Gefahren wie SchnellfeuerVerkaufswellen und Herdentrieb heraufbeschwören, sieht
Jones das Potenzial für eine Destabilisierung des
Finanzsystems. Das biete »fruchtbaren Boden für künftige
Forschung«, schließt Jones.
Dabei lassen sich die Regulierer offenbar Zeit. Immerhin
gibt es einen neuen Vorstoß. Im Frühjahr 2015 stellte das
Financial Stability Board der G20 gemeinsam mit der
IOSCO, der Internationalen Vereinigung der
Wertpapieraufsichtsbehörden (bei der auch die Bafin
Mitglied ist), ein neues Arbeitspapier vor. Darin legten sie
dar, wie Regulierer systemrelevante Geldverwalter
ausfindig machen sollen, will heißen, solche Unternehmen,
deren Aktivitäten die Finanzmärkte gefährden können. Die
Branche reagierte reflexartig mit den üblichen
Argumenten, zusätzliche Regulierung sei zu teuer und
überhaupt unnötig. »Wir glauben weiterhin, dass sich
systemisches Risiko nach Produkten und
Geschäftspraktiken wie dem Einsatz von Kredithebeln
bestimmen sollte und nicht nach Größe eines Fonds oder
des verwalteten Kapitals eines Unternehmens«, rügte eine
Sprecherin von BlackRock im Branchenblatt Pensions &
Investments die Ideen der Aufpasser. Im Klartext: Schaut
nach Hedgefonds und sonstigen Zockerfonds – nicht nach
uns. Wir sind groß, aber ungefährlich. Würden allerdings
die Grundsätze des internationalen Regulierungsgremiums
zur Anwendung kommen, wie sie in dem Papier vom März
2015 dargelegt werden, dann würden BlackRock und die
anderen Großen der Branche mit hoher Wahrscheinlichkeit
den Gefahrenaufkleber »systemrelevant« bekommen.
Damit ist das Papier viel stringenter als die vorherige
Version vom Frühjahr 2014. Doch spricht wenig dafür, dass
dies die Endfassung des Entwurfs für ein internationales
Regelwerk ist. Den Entwurf eines solchen haben die G20Staatschefs beim FSB in Auftrag gegeben – und warten nun
bereits seit 2011 darauf. Zeit, die die Lobbyisten der
Branche nicht ungenutzt verstreichen lassen. Barbara
Novick, Ihr Einsatz!
Wenn die Analysen und wohlüberlegten Regeln
schließlich fertig sind, könnte es allerdings zu spät sein.
Denn der nächste Testfall ist gewiss. Den könnte zum
Beispiel die Zinswende an den Anleihemärkten
verursachen. Seit dem Bond-Massaker von 1994 haben die
Anleihemärkte völlig neue Dimensionen erreicht. Allein in
den USA beläuft sich das Volumen der ausstehenden
Anleihen (inklusive Staatspapiere und
Kommunalobligationen) auf knapp 40 Billionen. (Stand
Ende 2014 laut dem Finanzmarktverband Sifma) BlackRock
selbst macht sich Sorgen darüber, was passiert, wenn
dieser Schulden-Mount-Everest ins Rutschen kommt.
Denkbar ist auch ein anderes Schreckensszenario. Wenn
sich etwa die dunklen Seiten der ETFs zeigen. Anders als
noch vor zehn Jahren hat sich ein Ozean von
Investorengeldern in die passiven Fonds ergossen,
Erschütterungen dort könnten einen Tsunami auslösen, der
Märkte ins Wanken bringt – oder gar abstürzen lässt. Je
weiter sich diese Derivate von der ursprünglichen Idee
entfernen, Kleinanlegern eine bezahlbare Anlage in breiten
Aktienindizes zu ermöglichen, desto größer ist die Gefahr,
dass sie unvorhergesehene Nebenwirkungen entwickeln.
Dann wird der Flash Crash wie der sprichwörtliche Sturm
im Wasserglas aussehen. Bei Anleihen und ETFs lassen sich
zumindest noch die möglichen Gefahren in ihren Umrissen
ausmachen. Aber was ist mit den vielen neuen Spielarten
der Schattenbanken, die sich im neuen digitalen
Finanzsystem vervielfältigen? Werden wir wie bei den
Hypothekenpapieren und den Geldmarktfonds wieder zu
spät erkennen, von wo die Gefahr droht?
Und auch wenn ein Crash (vorerst) vermieden werden
kann – was ist mit der eigentümlichen Eigentümerrolle der
Mega-Manager? Wie passt der »Kapitalismus ohne
Kapitalisten« in unsere Welt, in der wir von unseren
Unternehmen immer stärker verlangen, dass sie sich
Fragen der Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung
stellen? Welche Rolle können oder wollen die MegaManager spielen? Das ist keine Frage für Akademiker. Für
Kofi Thompson zum Beispiel ist es ganz real. Der Kolumnist
in Ghana sorgt sich um die Zukunft seines Landes. Da sind
die großen Minengesellschaften, die rücksichtslos Gold und
Öl fördern in einem »Für-uns-alles-gratis-Modell«, wie er es
nennt. Die in Naturschutzgebieten nach Gold wühlen.
Gleichzeitig fehlen die Mittel, um die Infrastruktur in dem
afrikanischen Land aufzubauen. Frustriert, weil die
jahrelangen Bitten der afrikanischen Staatschefs um
fairere Vereinbarungen mit den Konzernen nichts fruchten,
kam Thompson eine Idee: Wie wäre es, wenn sich die
Landesoberen an Michelle Edkins, die CorporateGovernance-Frau von BlackRock, wenden würden?
»Während die Multis die Forderungen unserer Staatschefs
ignorieren können, würden sie es nicht wagen, die
Wünsche von BlackRock zu ignorieren«, schrieb er in
seiner Kolumne für Ghana-Web. BlackRock könnte Ländern
wie Ghana helfen, indem der Großaktionär von den
Minengesellschaften verlangt, Steuern auf ihre Profite zu
zahlen, die sie mit den Rohstoffen aus Ghana verdienen –
statt das Geld durch Steuertricks außer Landes zu bringen.
»Ghana braucht dieses Geld, um die Lebensqualität der
Bevölkerung zu verbessern«, schreibt Thompson in einer EMail. »Michelle Edkins könnte viel für die
Entwicklungsländer tun, indem sie darauf besteht, dass
dieselben ethischen Standards weltweit eingehalten
werden.« Dass Thompson bei BlackRock mehr Einfluss
sieht, als in Regierung oder internationalen Organisationen
spricht Bände.
Welche Rolle kann und soll BlackRock als Großaktionär
spielen? Welche Rolle spielen Mega-Manager künftig in
unserer Welt? BlackRocks Aufstieg steht auch für eine
Gesellschaft, die sich immer weniger als
Solidargemeinschaft versteht. Zunehmend wird Vorsorge –
für Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter – auf den Einzelnen
abgewälzt. Jeder kämpft für sich. Wer nicht genug verdient,
um etwas auf die Seite zu legen, und nicht erbt, hat eben
Pech. So schaffen wir einen immer weiteren Abstand
zwischen den Habenden und den Habenichtsen. Natürlich
ist Larry Fink nicht der Verursacher dieser Entwicklung,
aber er weiß sie für sich zu nutzen wie kaum ein Zweiter.
Und nicht zu vergessen: Aladdins Algorithmen. Da sind
die Fragen der Datensicherheit, die Fragen des
Datenschutzes. Und es sind die weniger greifbaren
Aspekte, die Unbehagen auslösen. Adam Curtis, ein
britischer Dokumentarfilmer, hat eine subtilere Bedrohung
durch BlackRock ausgemacht. Curtis beschäftigt sich in
seinen Werken vor allem mit Macht und wie sie in der
Gesellschaft ausgeübt wird. Im Juli 2014 postete er in
seinem Medien-Blog für den Sender BBC einen Essay mit
dem Titel: »Die verborgenen Systeme, die die Zeit
einfrieren und uns daran hindern, die Welt zu verändern.«
Dabei geht es ihm um die Kombination von konstanter
Überwachung und Digitalisierung. Eines seiner Beispiele
sind Empfehlungen, wie sie etwa der Onlinehändler
Amazon seinen Kunden zukommen lässt. Ein Algorithmus
analysiert die bisherigen Bestellungen nach Mustern,
erstellt daraus ein Profil und macht entsprechende
Angebote für Produkte, die zu dem auf diese Weise
herausgefilterten Geschmack des Kunden passen. Was
Curtis daran stört: Wir sind auf unsere vergangenen
Entscheidungen festgelegt.
Weniger harmlos sind so genannte digitale Tracker, mit
denen sich amerikanische Politiker zunehmend konfrontiert
sehen. Die Tracker arbeiten für die Wahlkampagne des
jeweiligen Gegners und dokumentieren Reden, Interviews
und Bürgergespräche. Dabei sind sie auf der Suche nach
Widersprüchen zu früheren Aussagen des Politikers. In
Videomontagen wird daraus schnell das Porträt eines
Umfallers und Opportunisten. Seine Meinung zu ändern,
wird für Politiker zum Risiko, das es zu vermeiden gilt.
Auch das macht es schwieriger, Kompromisse zu finden –
und könnte die zunehmende Polarisierung der
amerikanischen Politik erklären. Aber Curtis schlägt den
Bogen weiter: Ȇberall in der westlichen Welt sind neue
Systeme entstanden, deren Aufgabe es ist, ständig die
Gegenwart aufzuzeichnen und mit der aufgezeichneten
Vergangenheit abzugleichen. Das Ziel ist es, Muster zu
erkennen – Zufälle und Korrelationen –, um dann Wege zu
finden, Veränderungen zu verhindern«, schreibt Curtis. Der
Effekt all dieser Systeme sei schließlich, dass wir in einem
gigantischen Kühlschrank enden. Eines der EinfrierSysteme, auf das Curtis stieß: Aladdin. BlackRocks
Superhirn, das 14 Billionen Dollar analysiert. In mancher
Hinsicht sei BlackRock mächtiger als traditionelle Politik,
glaubt Curtis. Was Curtis an Aladdin Angst macht, ist nicht
BlackRocks Möglichkeit, damit die Welt zu verändern,
sondern im Gegenteil, der Versuch durch ein System wie
Aladdin, Veränderungen aufzuhalten. Ein System, das
Risiken verhindert, wolle keine Veränderung. Und es gibt
keine Veränderung ohne Risiko.
In diesem Sinne ist auch der Aufstieg von BlackRock eine
Veränderung, die neue Risiken birgt. Risiken, mit denen wir
uns auseinandersetzen müssen. Und darin steckt
gleichzeitig eine große Ironie: Risiko zu vermeiden ist
BlackRocks Mission. Doch indem Fink und seine Truppe
diese Mission fleißig zu erfüllen suchen, kreieren sie selbst
neue Gefahren.
Kapitel Epilog:
Aber Larry Fink ist noch nicht fertig
Seit J. P. Morgan hat niemand die Finanzmärkte so
nachhaltig verändert. Doch anders als Morgan ist Fink kein
amerikanischer Medici-Prinz, eingebettet in Samt und
Seide. Fink weiß, wie gefährlich es für BlackRock wäre,
wenn seine Kunden, also die Pensionskassenwarte, auf der
berüchtigten Klatschseite Page Six der New York Post
Schlagzeilen über einen pompösen Lebensstil entdecken
würden. Gerne streut er in Interviews seine Vorliebe fürs
Zugfahren ein. Lange nahm er Linienflüge, statt den unter
Billionären und Wall-Street-Oberen üblichen Gulfstream-Jet
zu nutzen (dabei ist BlackRock an General Dynamics, dem
Mutterkonzern des Luxus-Flugzeugbauers, beteiligt). Das
entspricht Finks Image vom sparsamen Sachverwalter, dem
ersten Diener seiner Anleger. Aber Fink leistet sich
durchaus die Privilegien, die ihm mit seinem Aufstieg
zufallen.
Schattige Feldwege führen durch Wäldchen und sanft
ansteigende Wiesen, vorbei an kristallklaren Bächen.
Hinter den meilenlangen, unauffälligen Zäunen und dichten
Hecken blitzen ab und zu Dächer auf, meist zu weit
entfernt, um Gebäude auszumachen. Dazwischen liegen
Pferdekoppeln und ab und zu sieht man sogar Kühe. An den
Weggabelungen breiten jahrhundertealte Eichen ihre
knorrigen Äste über verwitterte Steinmauern aus. Es ist
still. So stellt man sich die Welt englischen Landadels vor
der Industrialisierung vor. Doch dies ist North Salem, eine
gute Stunde mit dem Zug und 20 Minuten Autofahrt von
den Bürotürmen und Hochhausschluchten Manhattans
entfernt. North Salem ist so exklusiv, dass es nur
Eingeweihten bekannt ist. »Wir wünschen keine Publicity«,
erklärte eine Anwohnerin einst der New York Times. »Wir
wollen nicht, dass die Leute von dieser Gegend erfahren
und hier herumlatschen und alles ruinieren.« Wer mit
einem Kleinwagen herumkutschiert, handelt sich schnell
scheele Blicke ein. Eine Dame, hoch zu Ross, den Hund im
Gefolge, bedeutet dem Störenfried am Steuer mit einem
energischen Wink ihrer behandschuhten Hand, sich
gefälligst im Schritttempo vorbeizuschleichen. Im »Farmer
and the Fish«, einem Lokal in einem weißgetünchten
Kolonialhaus noch aus Zeiten vor dem Revolutionskrieg,
knistert ein Feuer im Kamin und am Tresen sitzen Männer
in Tarnfarben, die Basecaps ins Gesicht gerückt. Doch sie
mit einfachen Farmern zu verwechseln, wäre verkehrt. Die
Sportuhren sind so casual, wie sie teuer waren, und zum
Bier schlürfen sie ein Dutzend Austern. Nicht weit von hier,
über ein Gewirr von Straßen, Sträßchen und schließlich
Fahrwegen, kommt eine Bilderbuch-Farm, die Grandma
Moses nicht hübscher hätte malen können. Das ist Finks
Gehöft, hier ist er der Gentlemen Farmer, hier darf er es
sein. Eine Art Bauernhof-Disneyland, wie Finks eigener
Bruder, ein Silicon-Valley-Investor, einmal lästerte. Dort,
auf 18 Hektar Land, züchtet Fink Pferde.
Und er sammelt Kunst – in seinem Fall allerdings nicht
französische Impressionisten oder amerikanische
Minimalisten, ersteigert für Hunderte Millionen bei
Sotheby’s oder Christie’s wie seine Hedgefonds-Kollegen es
zu tun pflegen. Fink sammelt American Folk Art. Zum
Beispiel alte Wetterhähne. »Passend für jemanden, zu
dessen Geschäft es gehört, auf die unberechenbaren
Richtungswechsel des Markts zu reagieren«, schrieb mit
mildem Spott der britische Economist über Finks
bodenständiges Hobby. Etwas außer der Reihe war sein
Engagement beim Plattenlabel Octone. Zu den ersten
Bands des neuen Labels gehörte Maroon 5, eine Pop-Rock-
Band aus Finks Heimat Kalifornien, die Anfang der 2000er
Jahre von ein paar Highschool-Freunden gestartet worden
war – das erste Album Songs about Jane war ein Erfolg –
und Maroon 5 spielte sogar bei der Weihnachtsfeier für
BlackRock. Octone gibt es allerdings in der Form nicht
mehr.
Larry und seine Frau Lori haben sich zudem ein Haus in
Aspen geleistet. Die alte Silberminenstadt in den Rocky
Mountains von Colorado hat sich dank des zuverlässigen
Pulverschnees zum Ski-Resort gewandelt, in das Amerikas
Wirtschaftselite wie Zugvögel pünktlich zur Wintersaison
einfällt. Kamen früher Glücksritter her, um in den Minen
nach einem Vermögen zu wühlen, finden sich heute
diejenigen hier ein, die woanders ihr Glück bereits gemacht
haben. Und das sollte nicht zu knapp ausgefallen sein:
Aspens Immobilien zählen zu den teuersten Amerikas. Beim
Katasteramt von Aspen sucht man ihre Namen allerdings
meist vergebens. Die Besitzer jener »Chalets« und
»Mountain Refuges«, die gerne zweistellige
Millionenbeträge kosten dürfen, tauchen bei den Ämtern
meist nur »getarnt« auf – eingetragen sind die Namen der
Treuhändergesellschaften, über die die Promis ihre
Immobilien laufen lassen. Je nach Temperament sind es
einfallslose wie »Treuhänderverein II«, angeberische wie
»Goldader Investments« oder verspielte wie »Welpe
Smith«. Amerikas Oligarchen wollen ihre Adressen ungerne
veröffentlicht sehen.
Damit verfügt Fink über all die Statussymbole, die einen
Wall-Street-Mogul ausmachen.
Und doch.
Etwas fehlt noch.
Für Fink gilt es jetzt, sich und BlackRock endgültig als
neues Haus am Platz zu etablieren. Noch immer umgibt
BlackRock der Geruch des Start-ups. Auch wenn die
Investmentbanker ihren »Master of the Universe-Ruhm
eingebüßt haben, ihre Institutionen blicken auf eine
Tradition zurück. Merrill Lynch mag die Unabhängigkeit
verloren haben und nur noch der Name einer Abteilung des
Finanzkonzerns Bank of America sein – doch die
»donnernde Herde« von Charles Merrill, wie die Broker
sich gerne nennen, ist seit 1914 auf den Hufen. Citigroup
hat Wurzeln, die bis ins Jahr 1812 reichen, als die USA
ihren letzten Krieg gegen die Briten führte. BlackRock gibt
es nicht einmal drei Jahrzehnte. Und noch immer haftet
den Vermögensverwaltern an der Wall Street das Image an,
das Refugium derer zu sein, die sich nicht trauen, hart am
Wind zu segeln. So nützlich dieses (Vor-)Urteil gegenüber
Kunden und Regulierern ist, Fink möchte BlackRock gerne
auf Augenhöhe von Goldman Sachs etablieren. Eine der
Usancen der Goldmänner war es bis zur Finanzkrise, am
Ende ihrer Karriere bei der Bank, der »Allgemeinheit zu
dienen«, wie es in Reden und offiziellen Lebensläufen so
schön heißt. Gemeint ist, ein möglichst renommiertes Amt
in Washington anzutreten. Neben Chefposten bei diversen
Ministerien und Behörden, haben gleich zwei Ex-GoldmanChefs den Posten des Finanzministers übernommen. Robert
Rubin war Goldmans CEO und dann Bill Clintons
Finanzminister, Hank Paulson übernahm denselben Posten
unter George W. Bush. Larry Fink, ein Demokrat, gehörte
zu den frühen Unterstützern von Obama und immer wieder
gab es Gerüchte, dass der BlackRock-Chef nach DC berufen
werden könnte. Daraus wurde nichts. Spätestens als
Obama die Wall-Street-Großen als »fette Kater«
bezeichnete und sich gegen die Finanzindustrie einschoss,
zerbrach das einst freundliche Verhältnis. Doch
Gerüchteköche spekulieren, dass Fink unter einer
Präsidentin Hillary Clinton gute Chancen hätte. Die
Clintons haben nie einen Hehl aus ihrem entspannten
Verhältnis zur »Moneyed Class« gemacht. Tochter Chelsea
heiratete 2010 – nicht allzu weit von Finks Farm – einen ExGoldman-Banker, der inzwischen einen Hedgefonds
betreibt. Die Spekulationen um Finks mögliche politische
Ambitionen bekamen 2013 kräftig neue Nahrung, als
BlackRock Cheryl Mills in den Aufsichtsrat holte. Mills ist
keine Finanzfachfrau, die 50-Jährige ist durch und durch
ein Washington-Insider. Sie ist die Allzweckwaffe der
Clintons. So half die Juristin einst Bill Clinton, sich in
seinem Amtsenthebungsverfahren wegen der MonicaLewinsky-Affäre zu verteidigen. Später gehörte sie zu
Hillarys Beraterstab bei deren gescheiterter
Präsidentschaftskampagne und später im Auswärtigen Amt.
Mills bringe »weitere Dimension und Breite« in den
BlackRock-Aufsichtsrat, erklärte Fink die Wahl der
fachfremden Clinton-Vertrauten.
Als Hillarys Finanzminister würde Larry Fink nicht nur
das Gehabe eines Staatsmanns haben, dann wäre er
endlich einer. »Hillary könnte Finks Ticket nach
Washington sein«, wie es Wall Streets Klatschreporter
Charlie Gasparino in einem Stück für Fox News beschreibt.
Da könnte er sich persönlich darum kümmern, dass seine
Vorstellungen einer Neuordnung der Altersvorsorge – wie
etwa das private Zwangssparen – umgesetzt würden.
Niemand hätte 1988 geglaubt, dass Larry Fink aus der
Anleiheklitsche im Hinterzimmer einen globalen Koloss
bauen würde, der ihn zum einflussreichsten Finanzier
seiner Zeit macht. Niemand reicht in puncto Größe,
Einfluss und Reichweite an BlackRock heran. Niemand
weiß, welche Folgen ein solches Finanzsystem im
Finanzsystem für uns hat. Es wird Zeit, dass sich das
ändert. Und der schwarze Riese ins Licht der Öffentlichkeit
kommt.
Grafiken
Grafik 1: Wenn BlackRock ein Land wäre …
BlackRock-Vermögen im Vergleich zu Bruttoinlandsprodukt (2014):
4,6 der genannten 14 Billionen US-Dollar werden von BlackRock direkt
verwaltet
Quelle: IWF, BlackRock
Grafik 2: BlackRock – Großaktionär der Germany, Inc.
Der Anteil BlackRocks an ausgewählten deutschen Unternehmen in Prozent
Quelle: BlackRock-Meldung an Bafin 25.9.2014
Grafik 3: Der weltweite ETF-Boom und BlackRocks Anteil
Quelle: Statista, EFGI, BlackRock
Register
AIG 60–64, 70, 74
Aktienkurse 58, 67, 124, 179
Aktienmärkte 33, 122, 125, 128, 130, 133, 136 f., 147, 150, 163, 209, 214, 234,
239 f.
Aktionärsrevolte 176
Aladdin 199–204, 210, 220–224, 228 f., 263–265
Allianz 9, 15, 21, 28, 63, 120, 170 f., 174 f., 256, 274
Altersvorsorge 33, 128, 161,
232, 234, 237, 239–242, 244 f., 270
Ankaufprogramm 93
Ankeraktionäre 174, 178
Anlageportfolio 48, 129, 200 f.
Anleihen 10, 17, 34, 36, 42 f., 48, 53 f., 110, 114, 117–120, 137, 140, 141, 143–
150, 168, 183, 209, 228, 251, 254, 262
Apple 10, 137, 208, 235
Aufsichtsrat 11, 25, 44, 55, 71, 131, 160, 170–178, 180–182, 186, 189, 191,
195, 235 f., 247, 257, 270
Ausfallrisiko 39, 77, 93
Bank of America 10, 13, 56, 60, 106, 119, 269
Bank of Irland 72 f., 75
Bear Stearns 44, 57–59, 61, 63, 67 f., 71, 74, 116
Bernanke, Ben 56, 68, 94–96, 117, 141
Bilanzen 23, 56, 65, 72 f.
Blackstone 14, 23, 25, 29, 42–45, 51, 53, 71, 240 f.
Blankfein, Lloyd 44, 100
Bond-Blase 42, 145
Bove, Richard X. 106–110
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 20–22, 25, 178, 261,
274
Bush, George W. 65, 70, 100, 102, 240, 242, 270
Buy-Side 47–49, 102, 117
Chevron 10
Clinton, Bill 70, 90, 239–241, 270
Collateralized Mortgage Obligations (CMO) 37–40, 50, 52, 61, 109 f., 122, 219
Corporate Governance 177, 182 f., 187, 189–191, 195 f., 263
Credit Suisse 21, 42, 132
Cyberfinanzsystem 224
Cyborg 209–211, 217
»Dark Pool« 122–126, 151
»Davos-Set« 74
»Dealmaker« 42
Deutsche Bank 9, 39, 93, 151, 171–175, 274
Deutsches Aktieninstitut 18
Deutschland AG 10, 17, 29, 169, 171–173, 175, 177 f.
Dimon, Jamie 44, 58 f., 71, 241
Dominoeffekt 58, 117, 144, 146
Dotcom-Blase 34, 53, 123
Draghi, Mario 90–94, 96, 100
ETF (Exchange Traded Fund) 11, 126 f., 130–135, 137–144, 151, 168, 184, 186,
194, 206, 218, 236, 262, 274
Europäische Zentralbank (EZB) 10, 75, 79 f., 90–100
ExxonMobil 10, 257
Federal Reserve 71, 73, 94
Financial Stability Board 90, 110 f., 143, 258, 261
Finanzaufsicht 20, 103
Finanzbranche 13, 34, 51, 72, 95, 97, 130, 150, 204, 244
Finanzkapitalismus 2.0 153 f., 161, 163, 166–168, 178, 184, 193, 254
Finanzkrise 34, 57, 62 f., 65, 67–69, 75, 79, 90, 93, 100 f., 110 f., 117, 130, 133
f., 139, 143, 149, 156, 176, 210, 212, 220, 232 f., 236, 238, 245, 248, 250,
252, 254 f., 270
Finanzmärkte 58, 69, 74, 76, 90, 122, 140, 143, 146, 171, 209, 212, 225 f., 228,
234, 261, 267
Finanzsystem 9, 16, 94, 106, 108 f., 111, 113, 116, 126, 143, 149, 151, 155 f.,
185, 211 f., 223 f., 249 f., 260–262, 271
Fink, Larry 11–16, 29, 31–56, 58–61, 63–65, 68 f., 71 f., 74 f., 77 f., 82, 87 f., 90–
92, 96, 99, 102, 105, 109, 118 f., 122, 132, 138 f., 150 f., 154 f., 176, 183, 185
f., 188, 190, 192, 195 f., 201–203, 219, 223 f., 232–234, 237 f., 241, 245 f., 248
f., 252 f., 255, 260, 263, 265, 267–271
First Boston 15, 36, 40–42, 46, 49–51, 55, 71, 219, 253
Fixed-Income-Abteilung 43
»Flash Crash« 135–137, 262
Fonds-Oligopol 184
Fondsmanager 11, 17, 21, 66 f., 104, 120, 125, 128–130, 135, 144, 149, 167,
171, 175, 178, 180, 187, 194, 245, 258
Geithner, Timothy 58, 67 f., 70–72, 88, 90, 102, 255
Geldbuße 20
Geldmarktfonds 74, 111 f., 114–117, 145, 149, 235, 262
Geliehene Macht 14 f.
General Electric 51 f., 112, 154, 158, 160 f., 203, 241, 257
Gewerbeimmobilien 26
Goldman Sachs 9, 13 f., 44, 55, 62, 65, 68, 70 f., 76, 90, 99–101, 121, 151, 234,
257, 259, 270
Goldstein, Rob 52, 201–203, 223 f.
Großeigentümer 18, 60, 178, 195
Hacker 209, 224–228
Hedgefonds 45, 47 f., 54, 69 f., 86, 88, 90, 107, 110, 133, 140, 144, 150, 174,
186, 191, 194–196, 212, 214, 236, 239, 250, 260 f., 268, 270
»Heuschrecken« 23, 25, 29, 42 f., 45, 102, 164, 197, 236
Hildebrand, Philipp 88–91, 96
Hypothekenkrise 40, 48
Hypothekenpool 38 f.
Immobilienblase 32, 34, 115
Indexfonds 22, 130 f., 133, 140, 175, 250
Industriekapitalismus 169, 173
Insiderhandel 51, 102, 179
Institutional Shareholder Service (ISS) 191
Interessenkonflikte 55, 59, 63 f., 66, 74, 82, 93 f., 97, 104, 107, 120, 136, 195,
254
Internationaler Währungsfonds (IWF) 71, 73, 79, 273
Investmentbanken 13 f., 27 f., 36, 42, 44, 47, 49, 53 f., 57, 60, 107, 111, 113,
117–120, 136, 154, 178, 219, 257, 259, 269
Investmentfonds 35, 47, 107, 117, 122 f., 126 f., 129, 133, 144, 150, 163, 185,
191, 222, 250
Investor Relations 18, 178–181, 187, 253, 264
iShares 11, 74, 132 f., 138–143, 167 f., 184
JPMorgan Chase 10, 14, 44, 58, 71, 106,154, 226 f., 241
Junk Bonds 42 f., 92, 96, 145 f., 201, 254, 256
Kapitalismus 9, 14, 33, 153 f., 161, 163, 166–173, 178, 184 f., 193, 239, 254,
262
Kapito, Rob 50 f., 65, 119, 219, 249, 253
Kleinanleger 11, 47, 112, 125 f., 129–132, 137, 139 f., 160, 262
Kreditausfälle 77 f., 81
Kreditderivate 61, 212, 215 f.
Kriegsanleihen 157, 160
Krisenherd 76
Krupp 169 f., 174, 236, 274
Lehman Brothers 34, 37, 42 f., 49, 58, 60, 80, 108, 111 f., 116 f., 132, 138, 149,
249
Lobbyisten 10, 13, 99 f., 105, 236, 253, 255, 258, 262
Machtwechsel 16, 28, 231 f.
Manipulation 124, 135, 192, 195, 225–227
McDonald’s 10, 48
Morgan, John Pierpont 14, 127, 153–161, 166 f., 170, 184, 267
»Multi-Asset-Manager« 17
»Neutronen-Jack« 51 f.
Nixon, Richard 43
– Besuch in China 162
Notenbanken siehe Zentralbanken
Notenbanker 58, 61, 88, 90 f., 94–97, 105, 254, 260
Notfallkreditprogramme 95
Obama, Barack 45, 70, 88, 90, 96, 102, 209, 227, 241, 257 f., 270
Peabody 51 f., 154, 203
Peer-to-Peer-Kreditvermittler (P2P) 121
Pensionsfonds 10, 25, 33, 69, 114, 126, 140, 175, 191, 196, 247 f., 253
Peterson, Pete 15, 42 f., 71, 240 f.
Pflichtmeldungen 20 f., 123, 178
Pimco 28, 63 f., 66, 81, 96, 110, 149, 163, 256, 258
Private Equity 14, 42 f., 45, 47, 164 f., 187, 195, 236, 239, 250, 254
Projekt »Solar« 76–78
Proxy Advisor 191
Putin, Wladimir 12, 227
»Quants« 212 f., 215–217
Ratingagenturen 47 ff., 61, 216, 223
Reformstau 96
Regulierer 10, 35, 90, 109, 121–124, 143, 145 f., 149 f., 182, 229, 236, 251–253,
259–261, 269
Repo-Markt 113 f., 145
Riester-Rente 243 f.
Rockefeller, John D. 157
Rockefeller-Stiftung 90
Rückzahlung, vorzeitige 38, 41
Salomon Brothers 36, 38, 46, 215
Schattenbanken 99, 109–111, 114–117, 145, 148, 168, 251, 253 f., 262
»Schwarze Schwäne« 251 f.
Schwarzman, Steven 15, 42–45
Sell-Side 47–49, 117 f.
Shareholder-Value-Prinzip 163–166, 185
Sharpe, William 129
Shiller, Robert 34, 84
Schrottanleihen 141, 254
Staatsanleihen 75, 80, 92, 115, 149, 241
Standard & Poor’s 48, 128
Stimmrechtsberater 191 f.
Streubesitz 18, 178
Trichet, Jean Claude 90, 96
»Troika« 75, 78, 79–82
Trump, Donald 44, 244
Vermögensverwalter 9, 13, 15, 17, 20 f., 48, 53 f., 60, 114, 118–120, 122, 125,
161, 163, 167 f., 190, 193–195, 220, 232–234, 239, 245, 248–252, 254–258,
269
Wackelhypotheken 54, 56, 60, 64, 75, 92, 113, 145, 195, 223, 258
Welch, Jack 52
Weltbank 100, 241 f.
Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum) 82 f., 85, 89
Zentralbanken 10, 12, 41, 59 f, 62–75, 78 f., 81 f., 86, 92, 94, 96 f, 110, 112, 115
ff., 139, 145, 155, 220, 247, 250, 253 ff.
Impressum
ISBN 978-3-593-50458-2 (Print)
ISBN 978-3-593-43211-3 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-593-43228-1 (EPUB)
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist
urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags
unzulässig. Das gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Copyright © 2015 Campus Verlag GmbH, Frankfurt am
Main
Umschlaggestaltung: total italic, Thierry Wijnberg,
Amsterdam/Berlin
Umschlagmotiv: © Thinkstock
Konvertierung in EPUB: le-tex publishing services GmbH,
Leipzig
www.campus.de





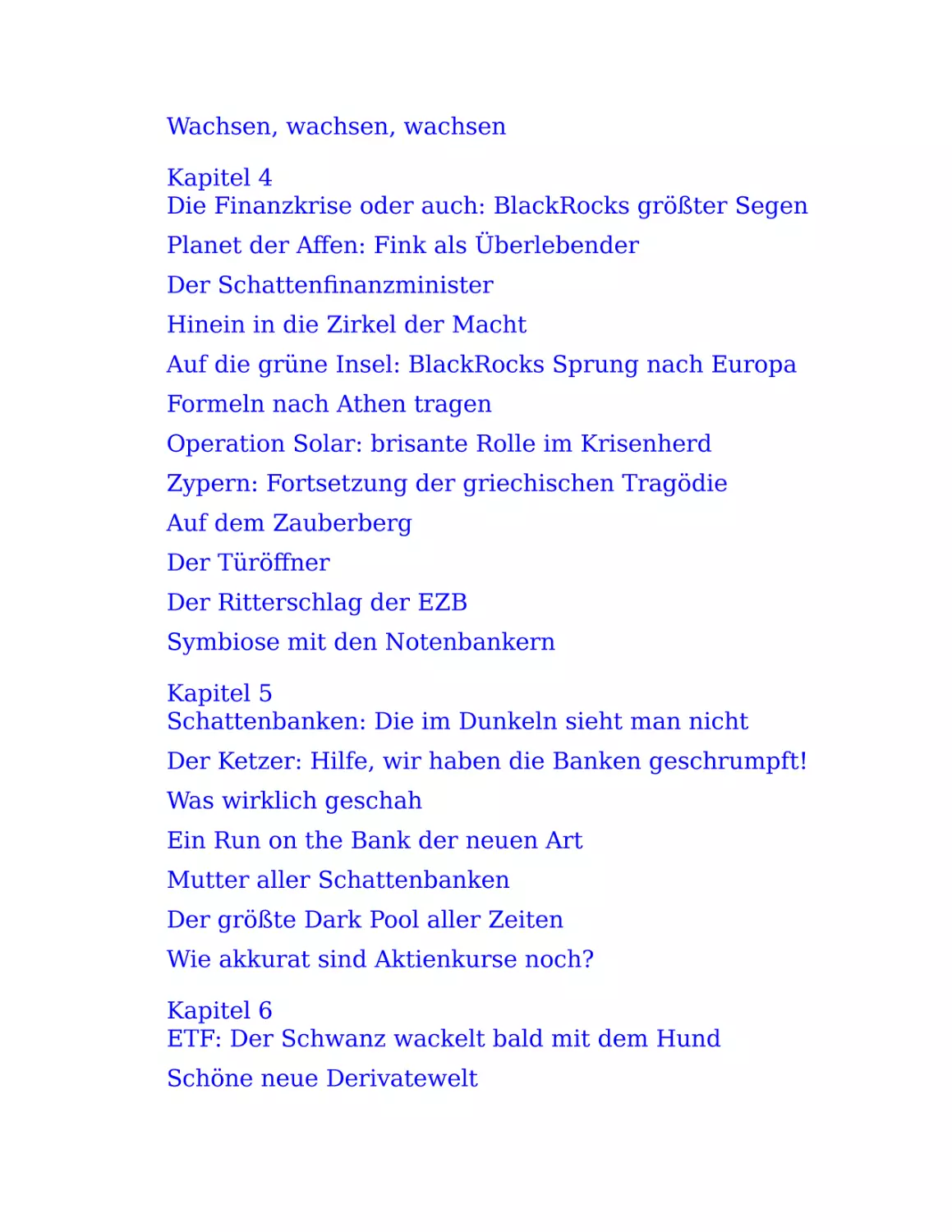











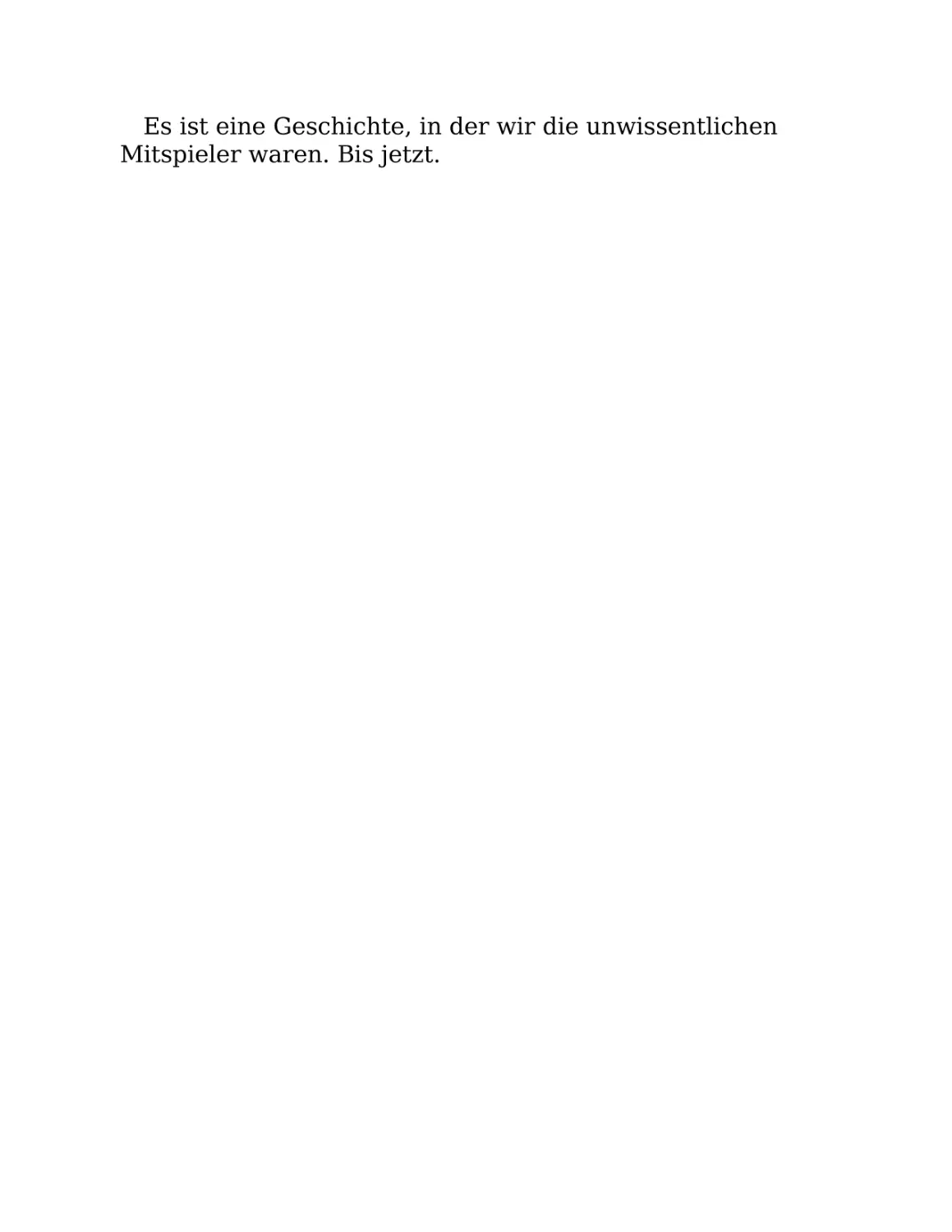










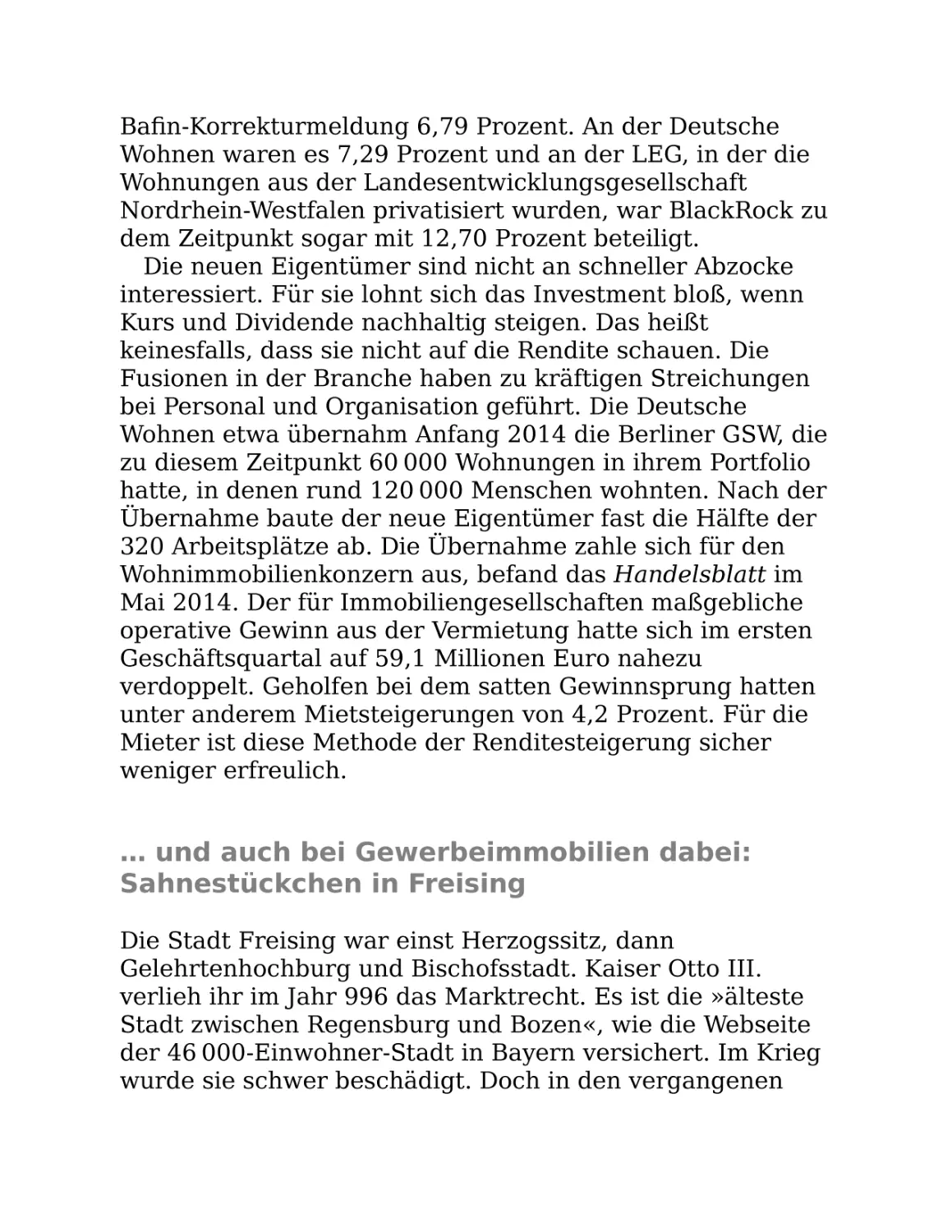




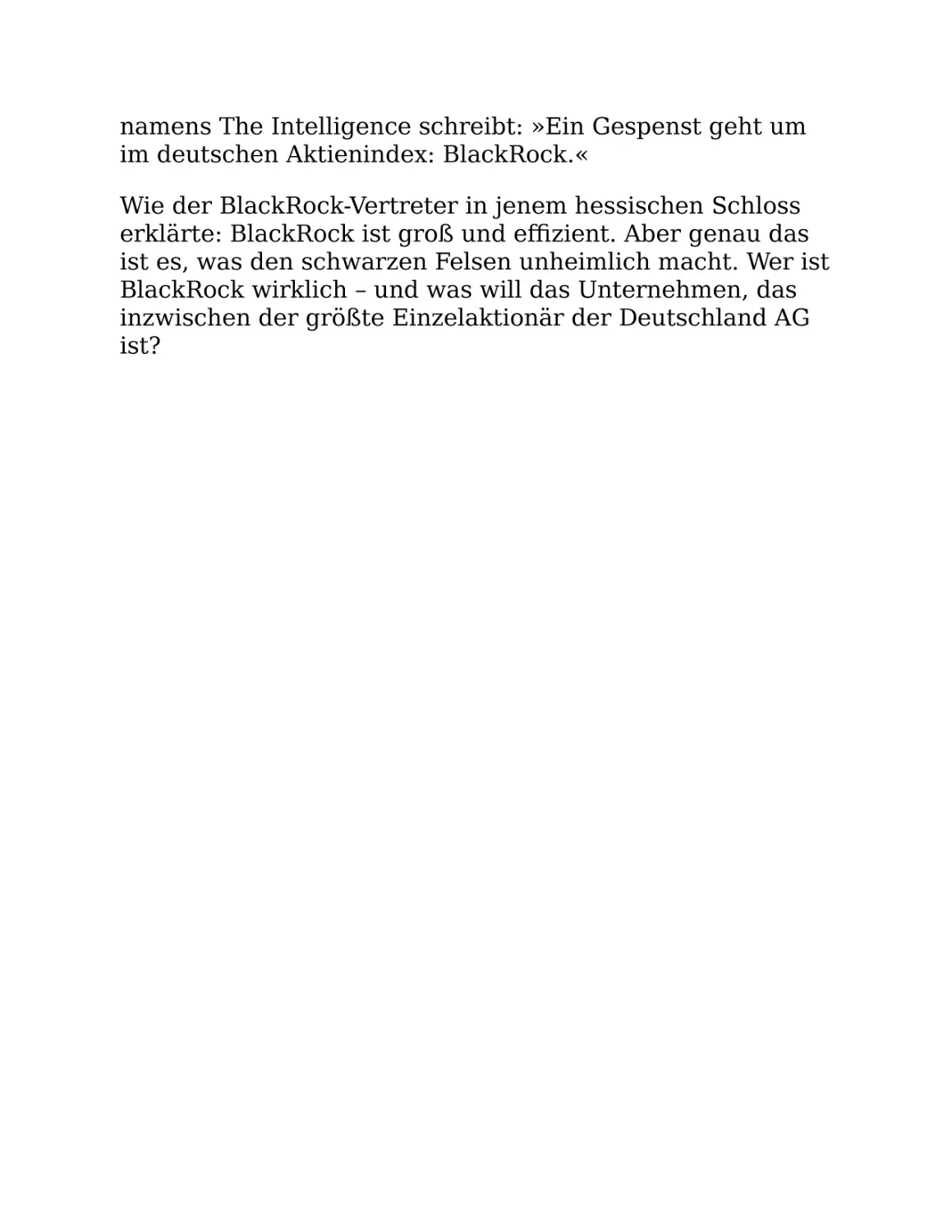







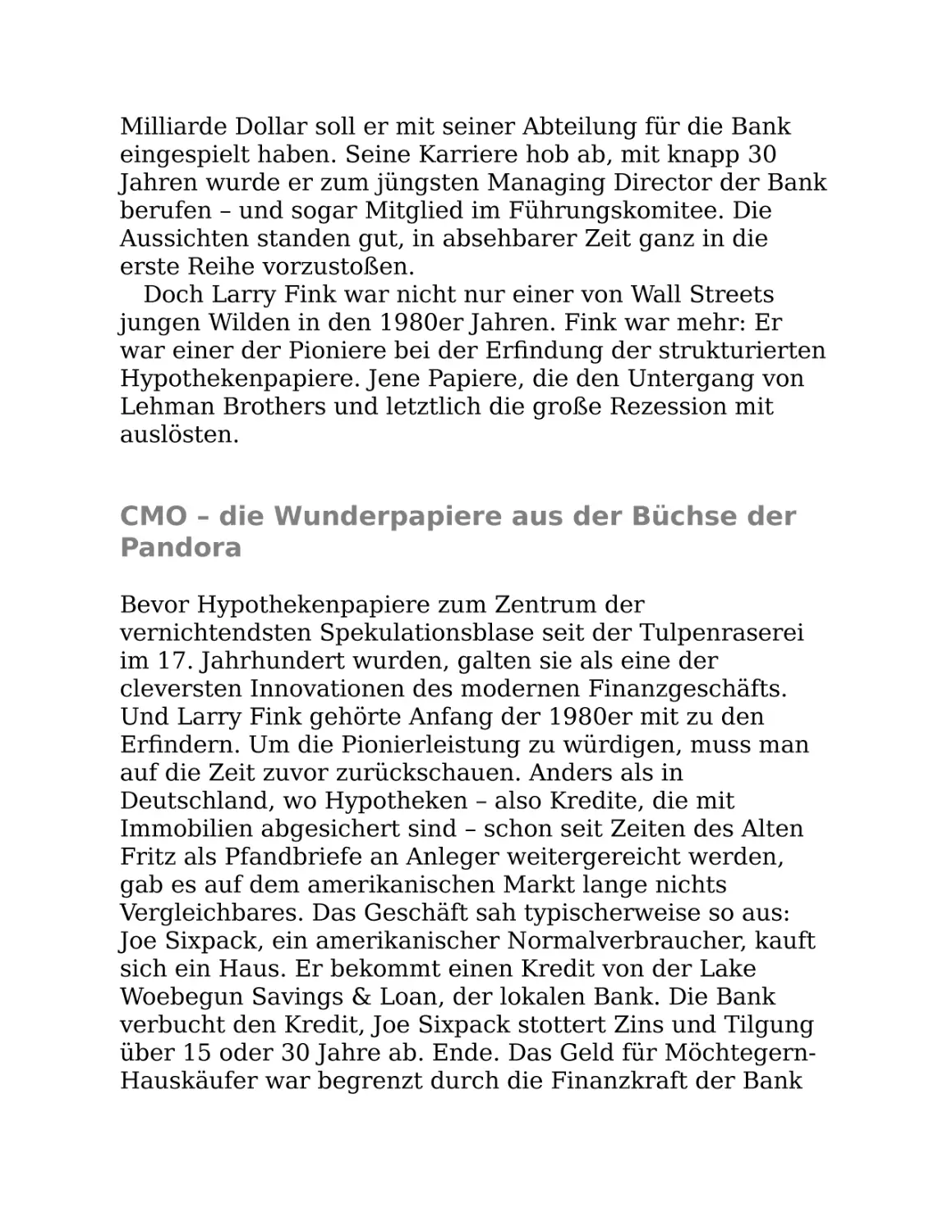






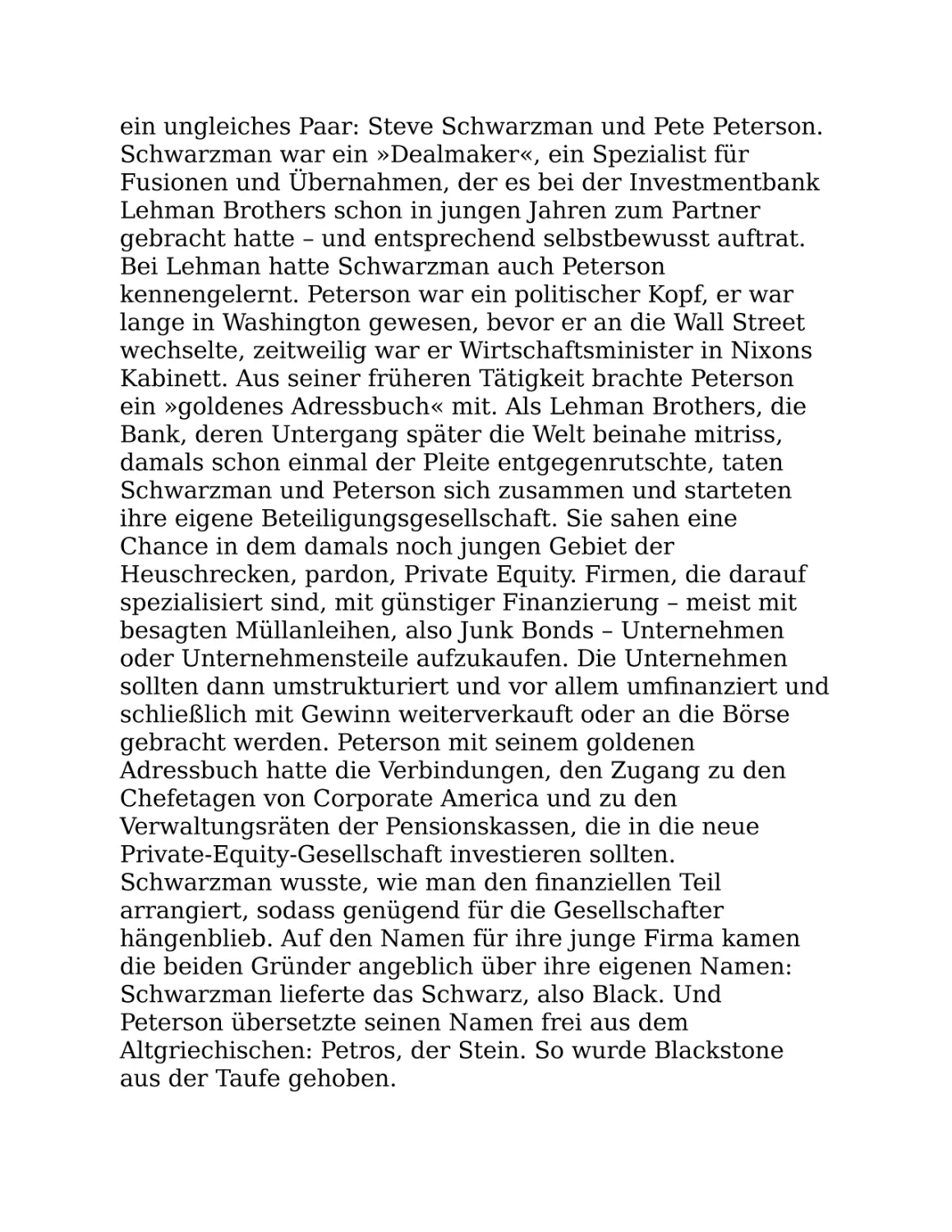















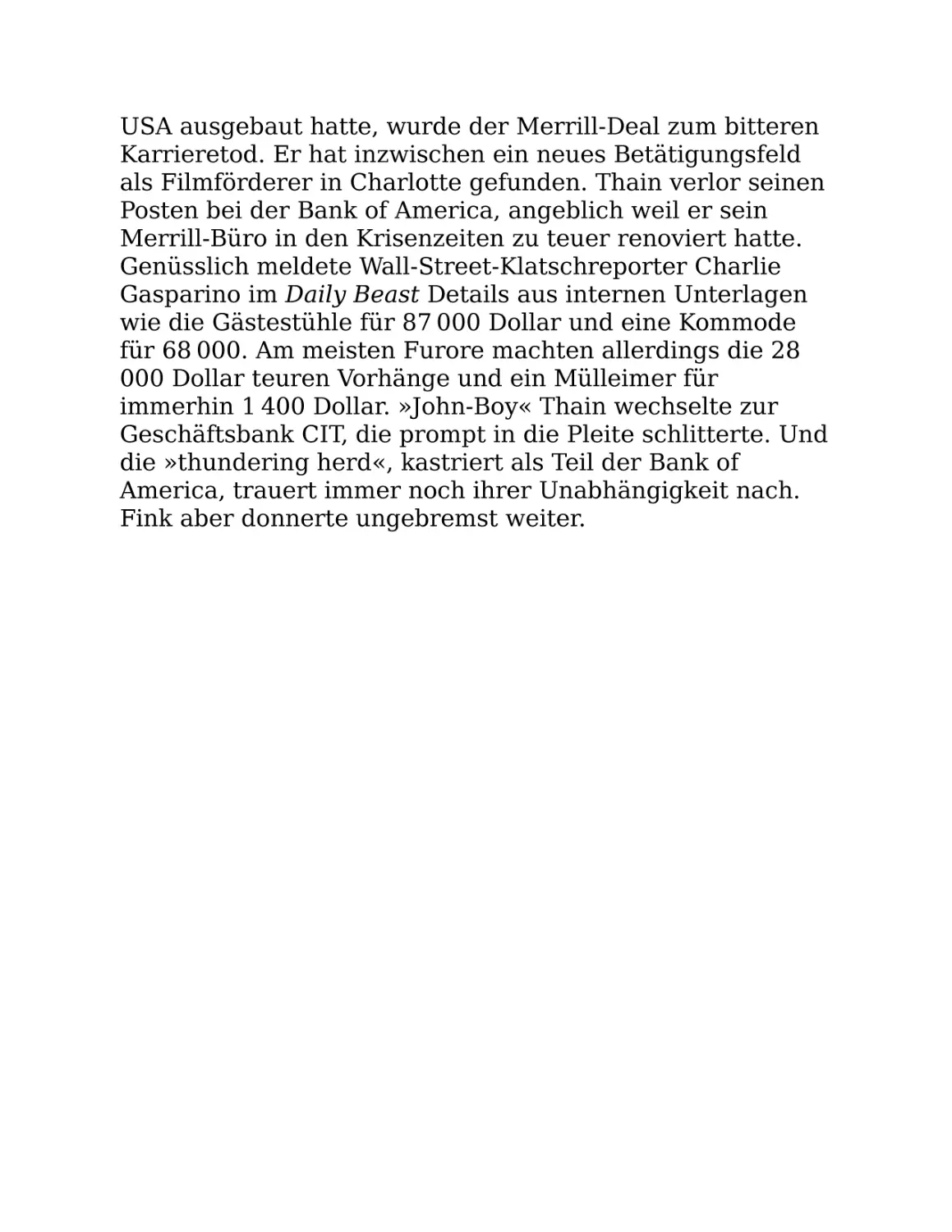








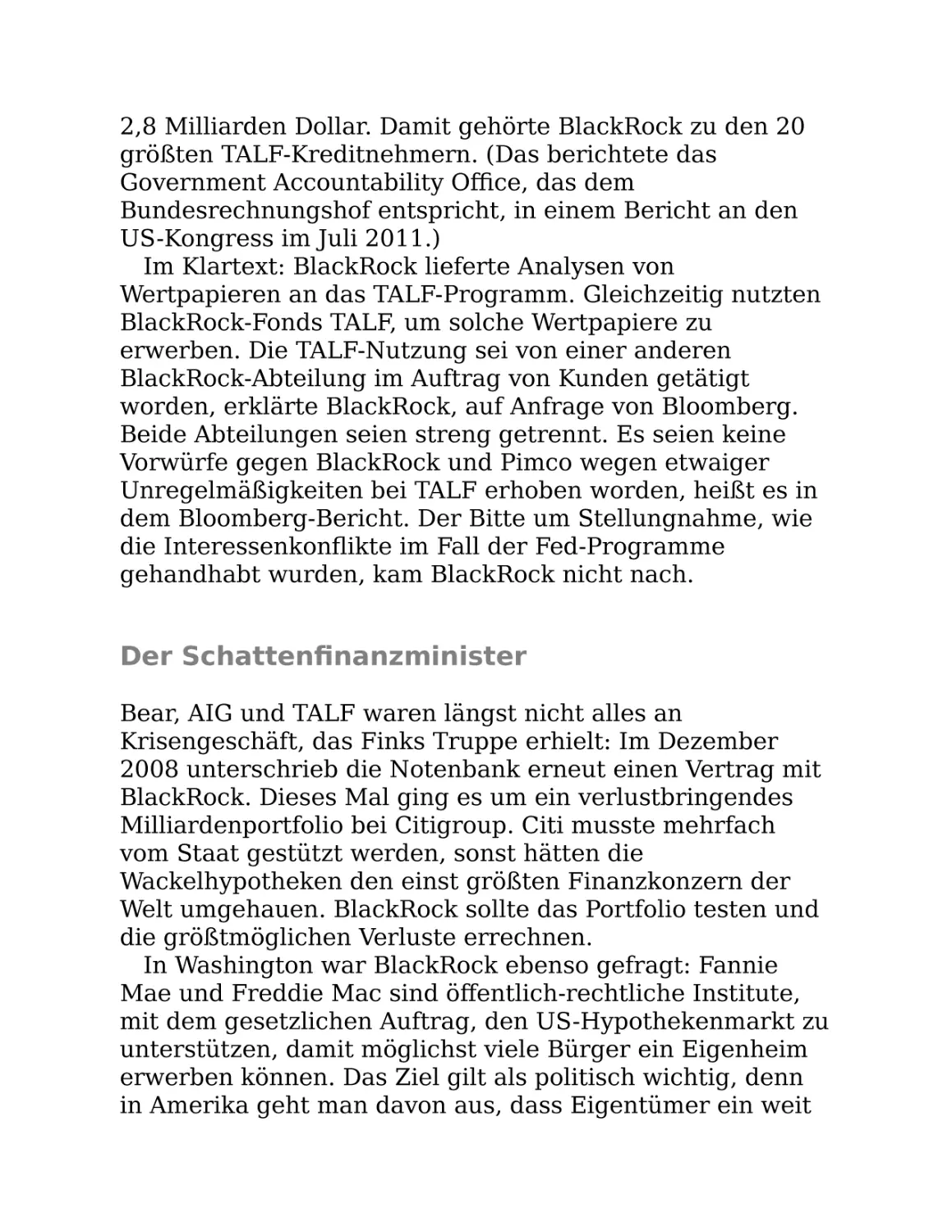













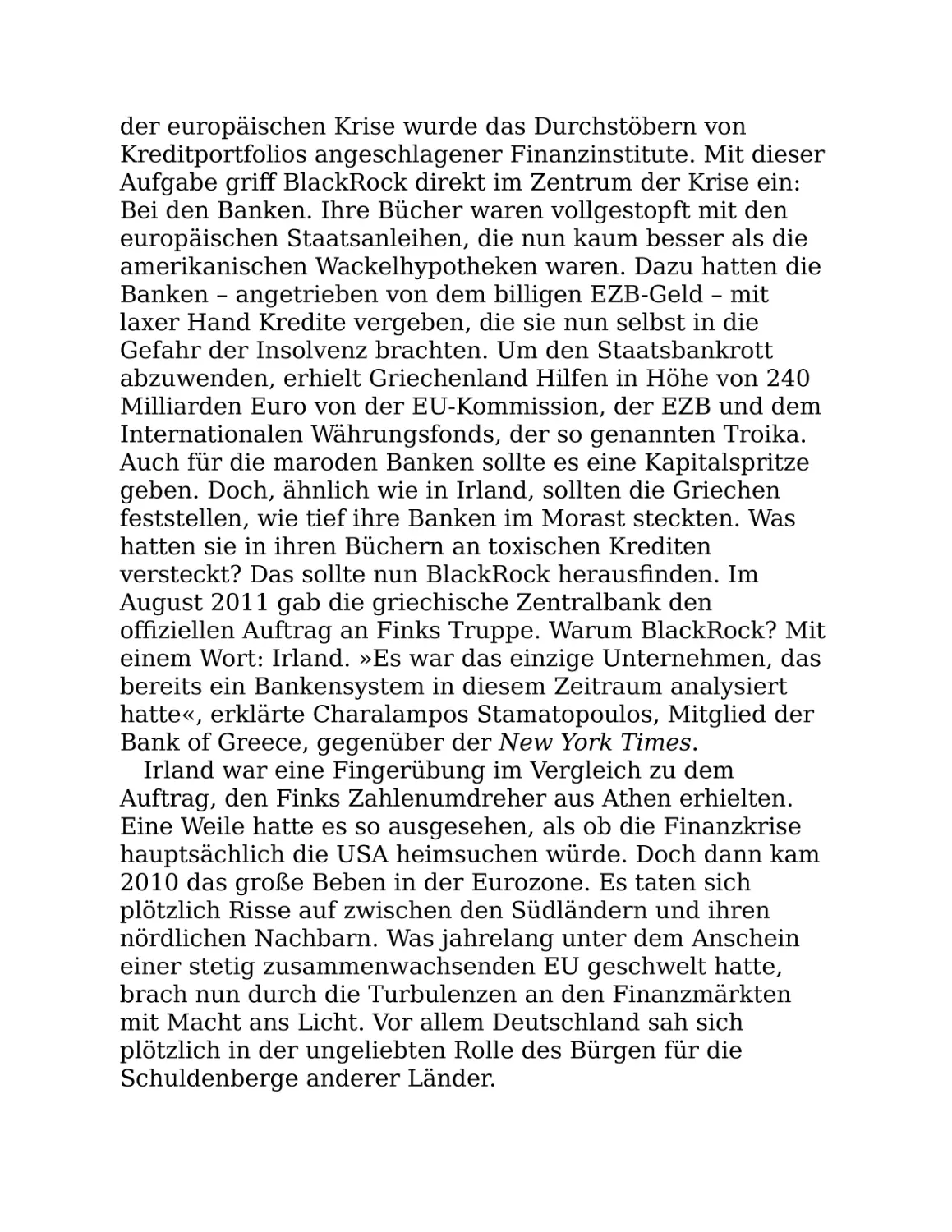



















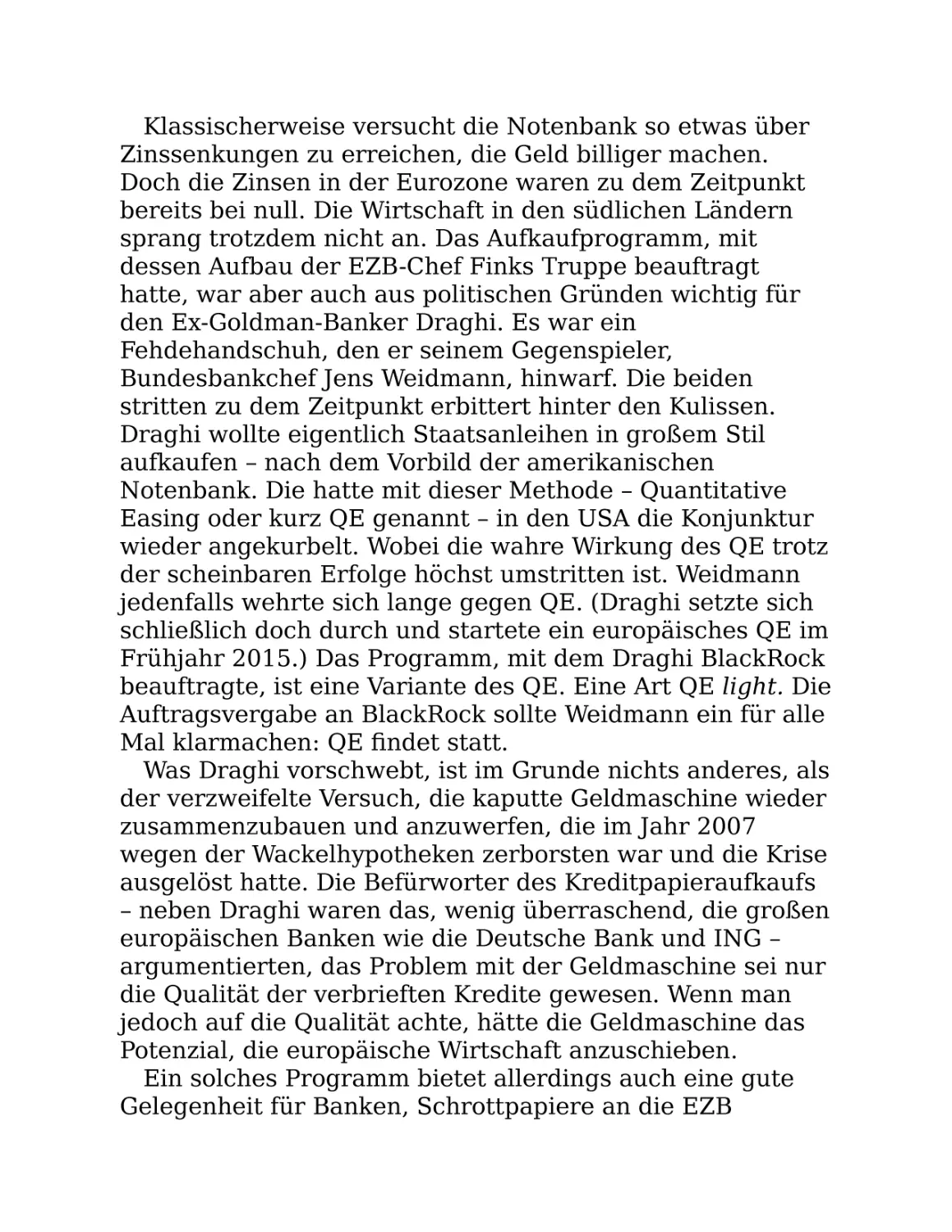



















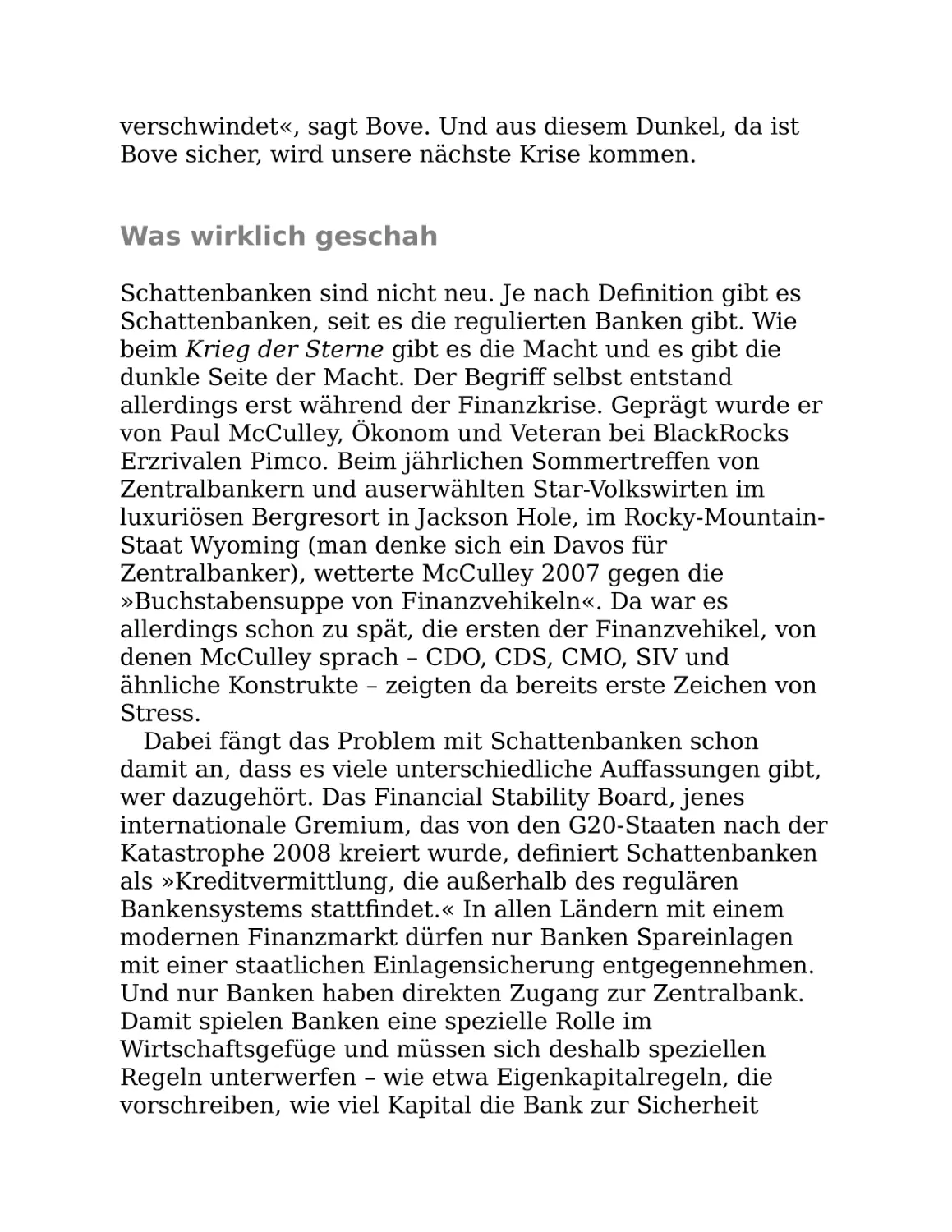














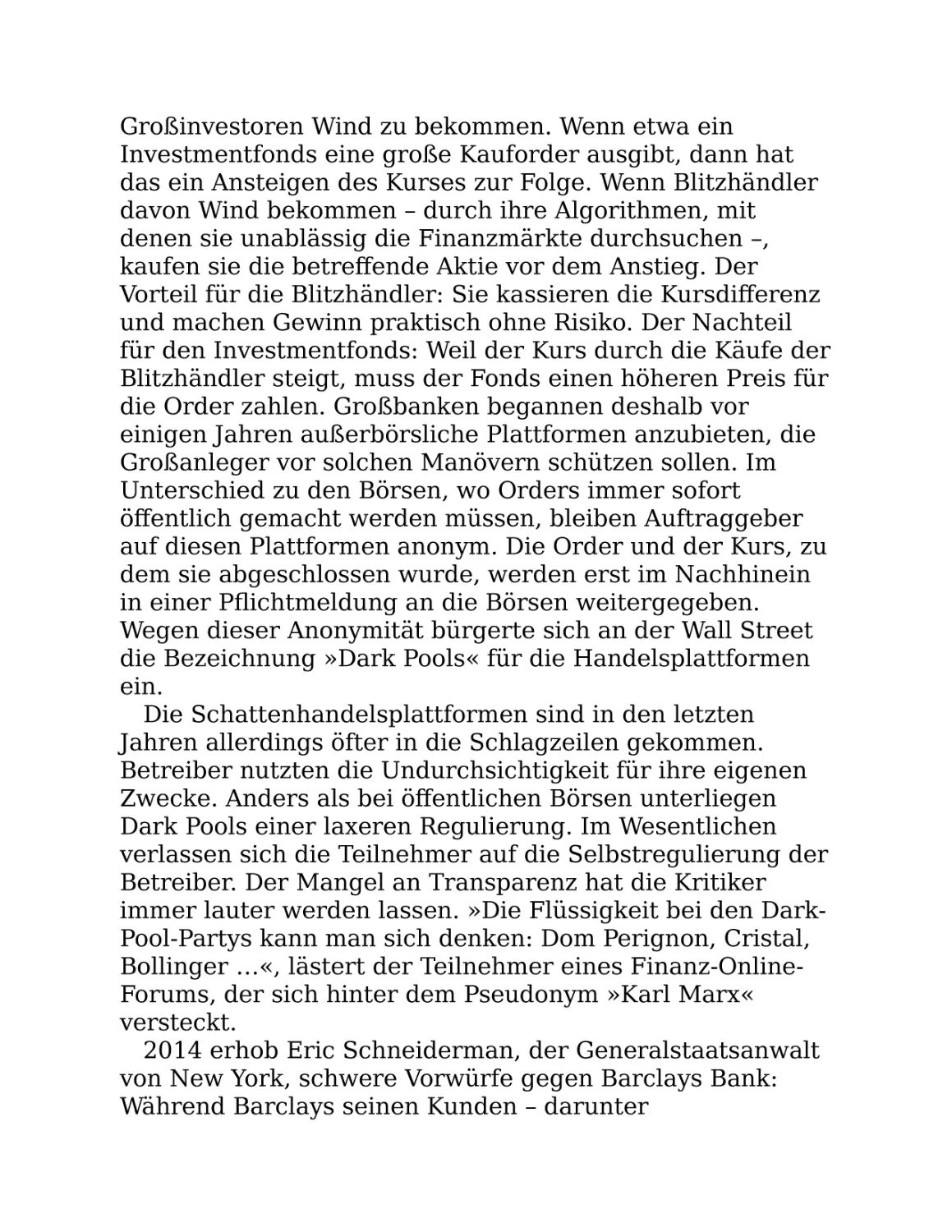

























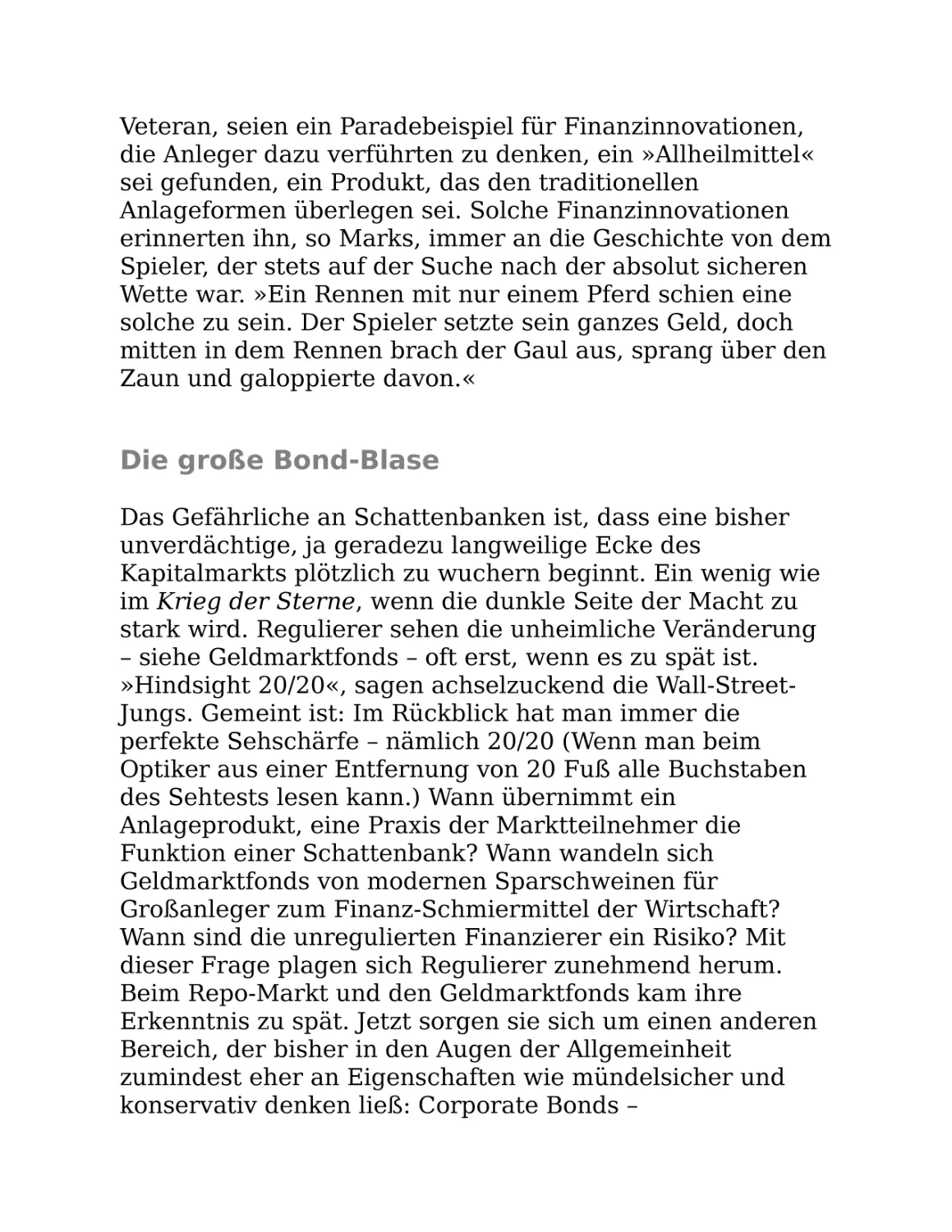







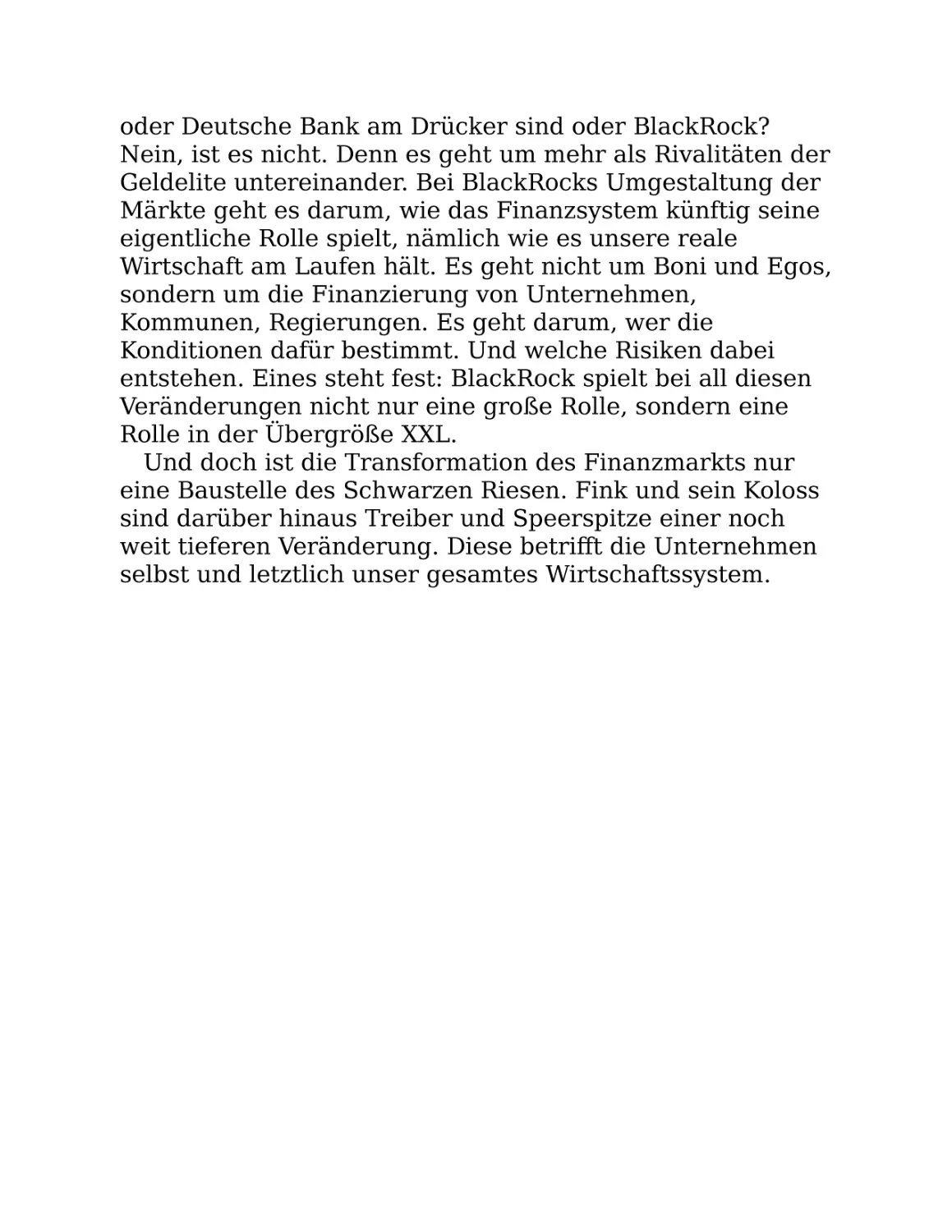
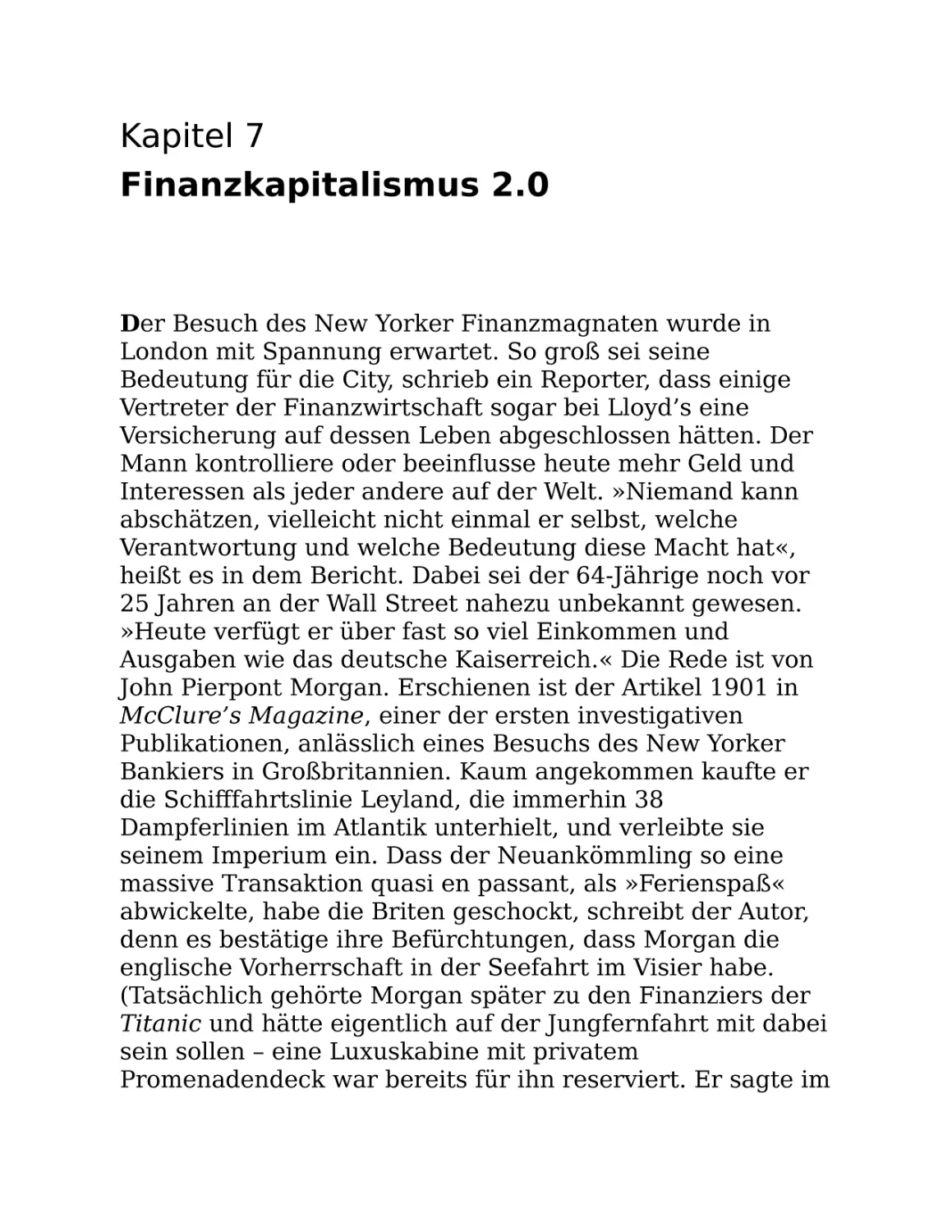





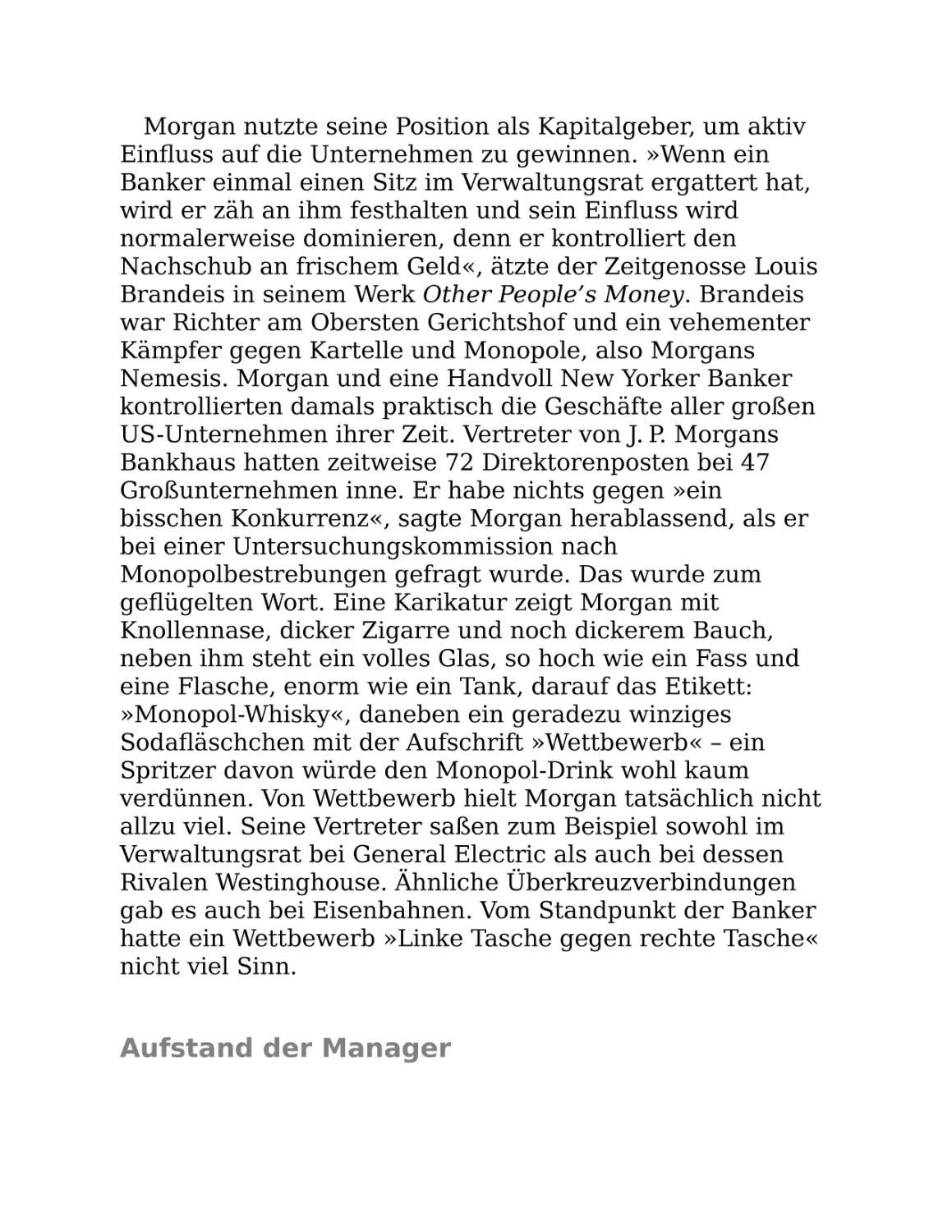





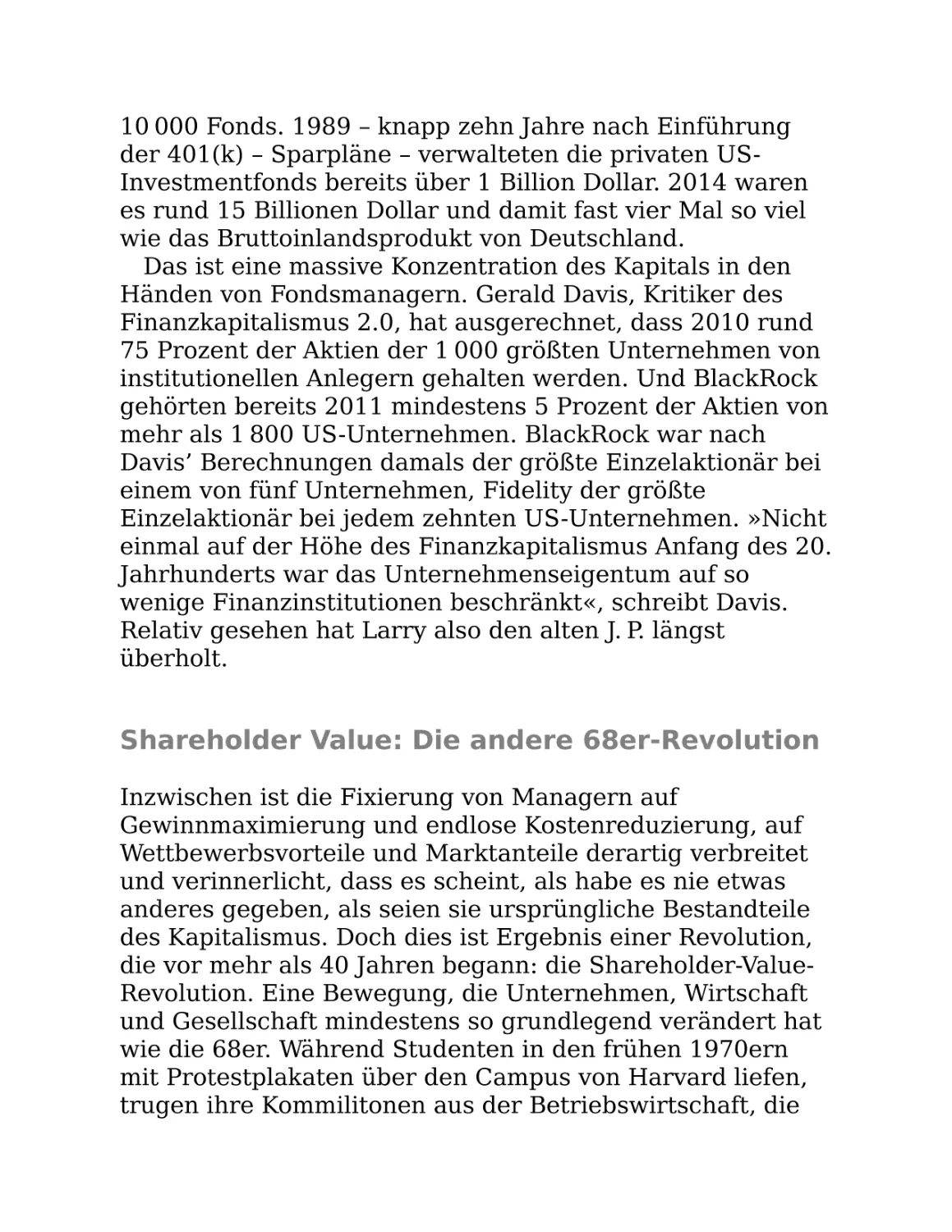

















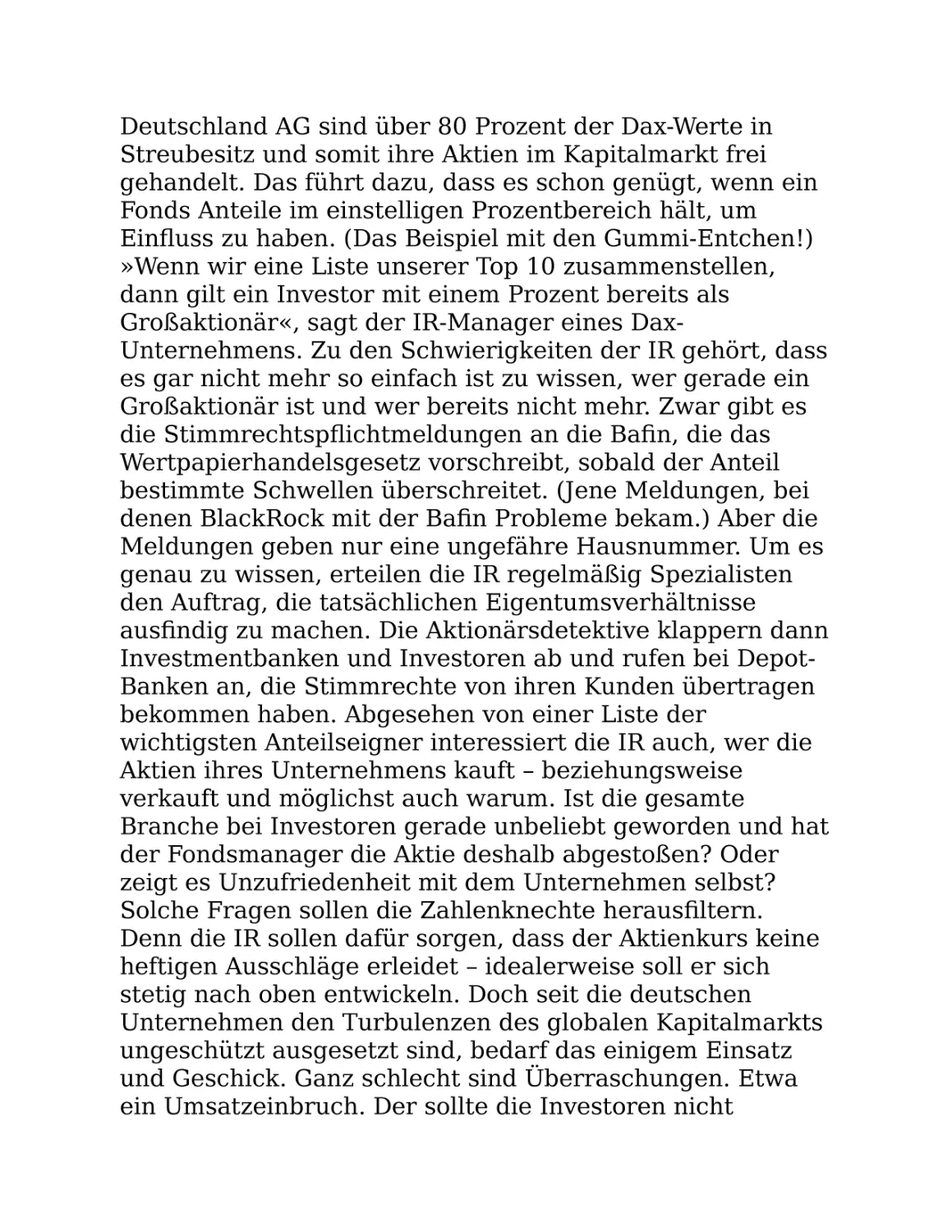














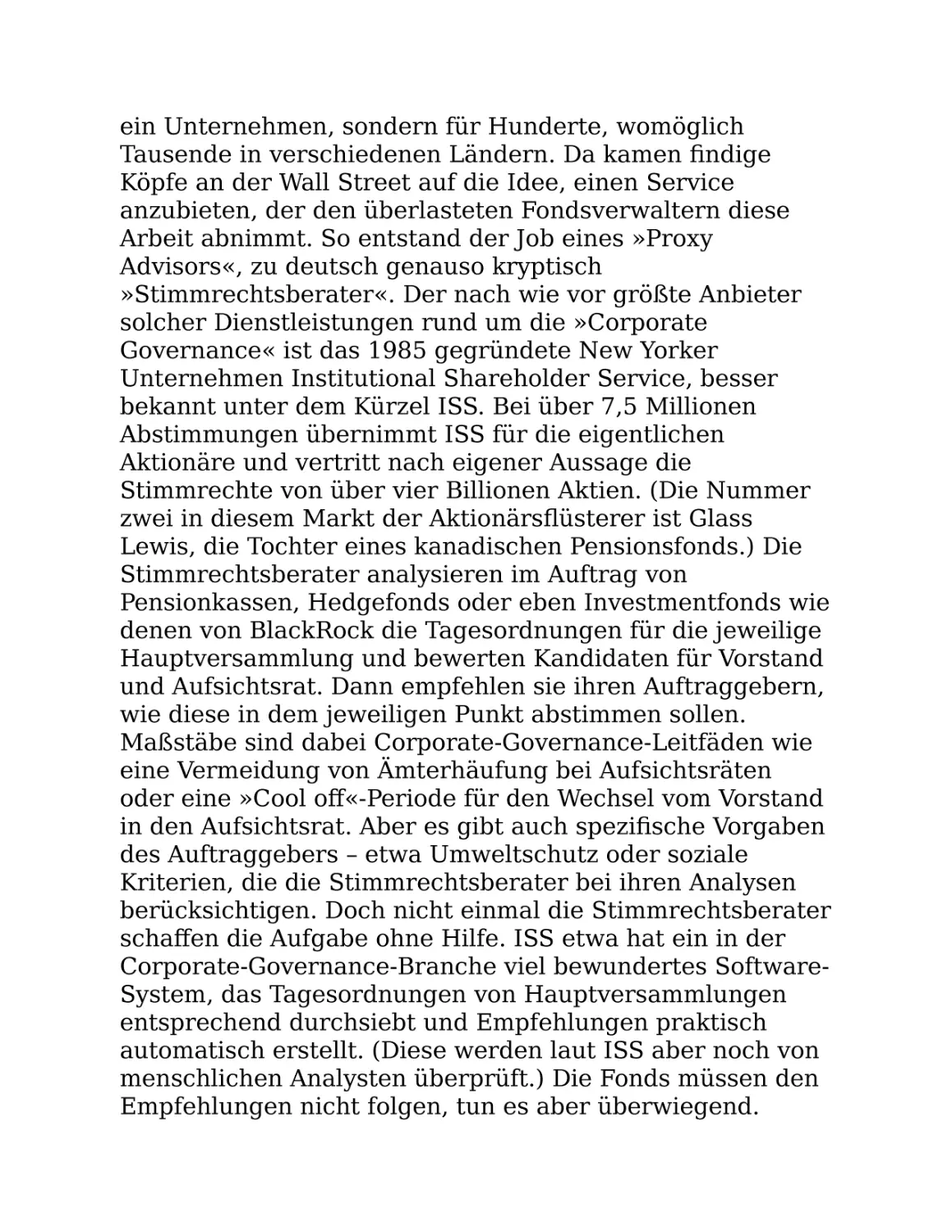

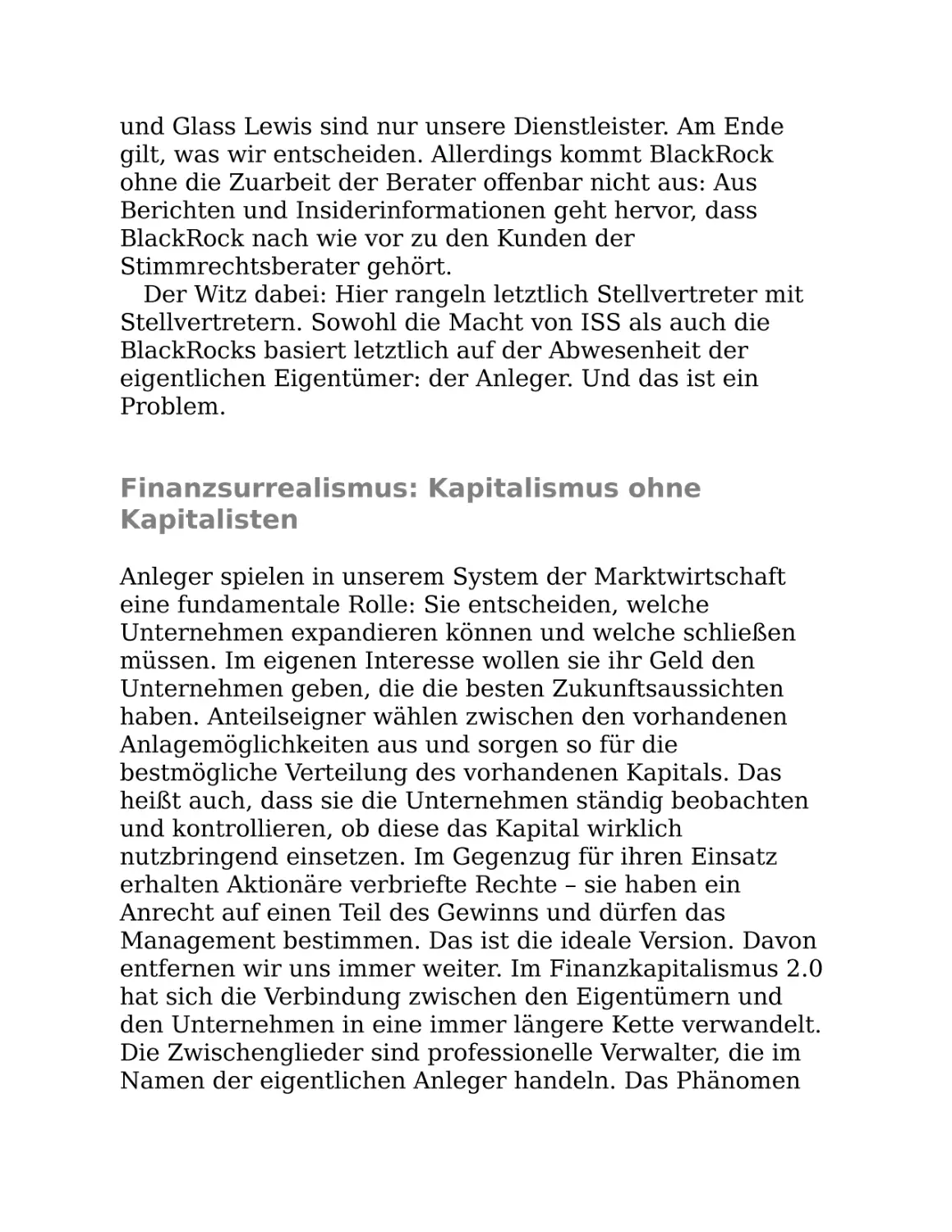





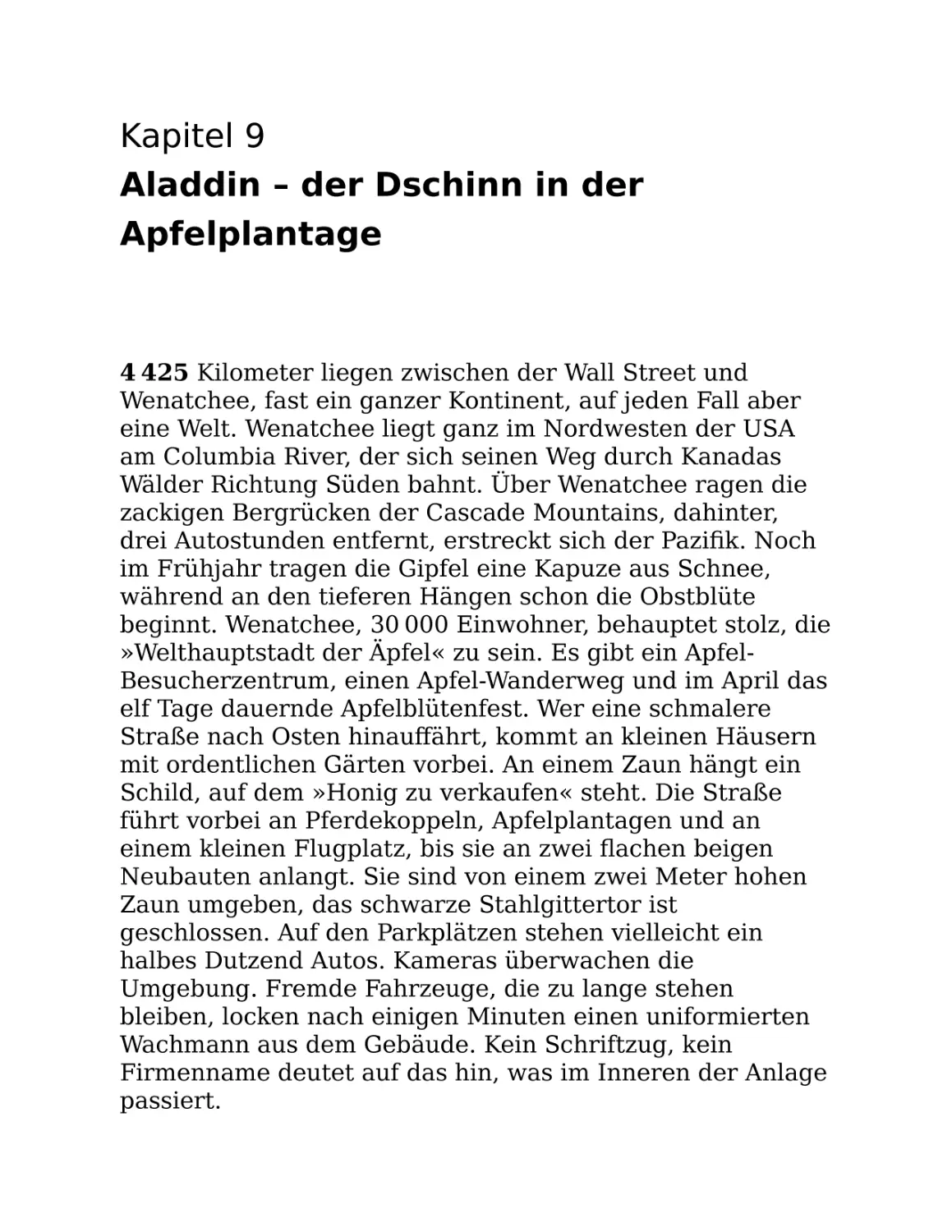





















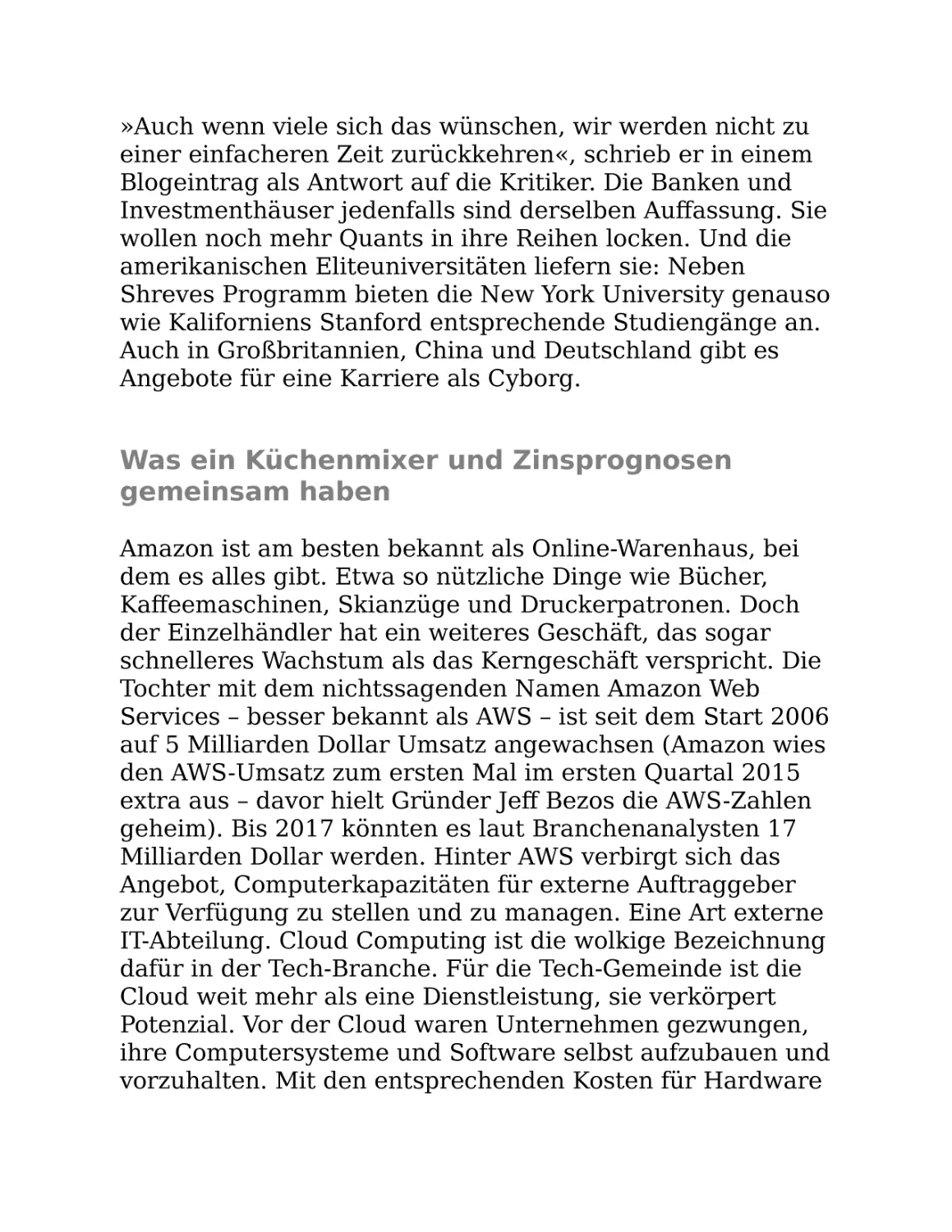




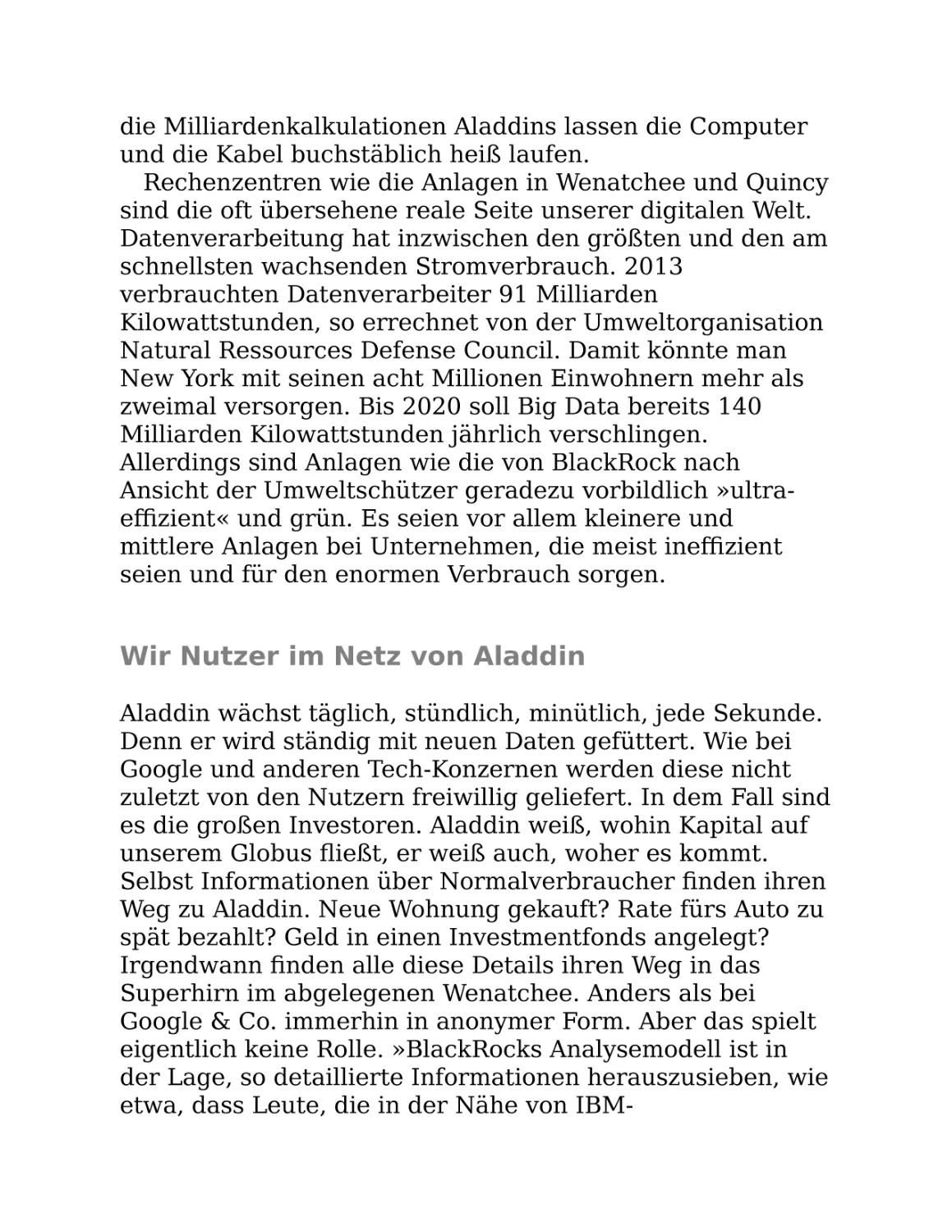
















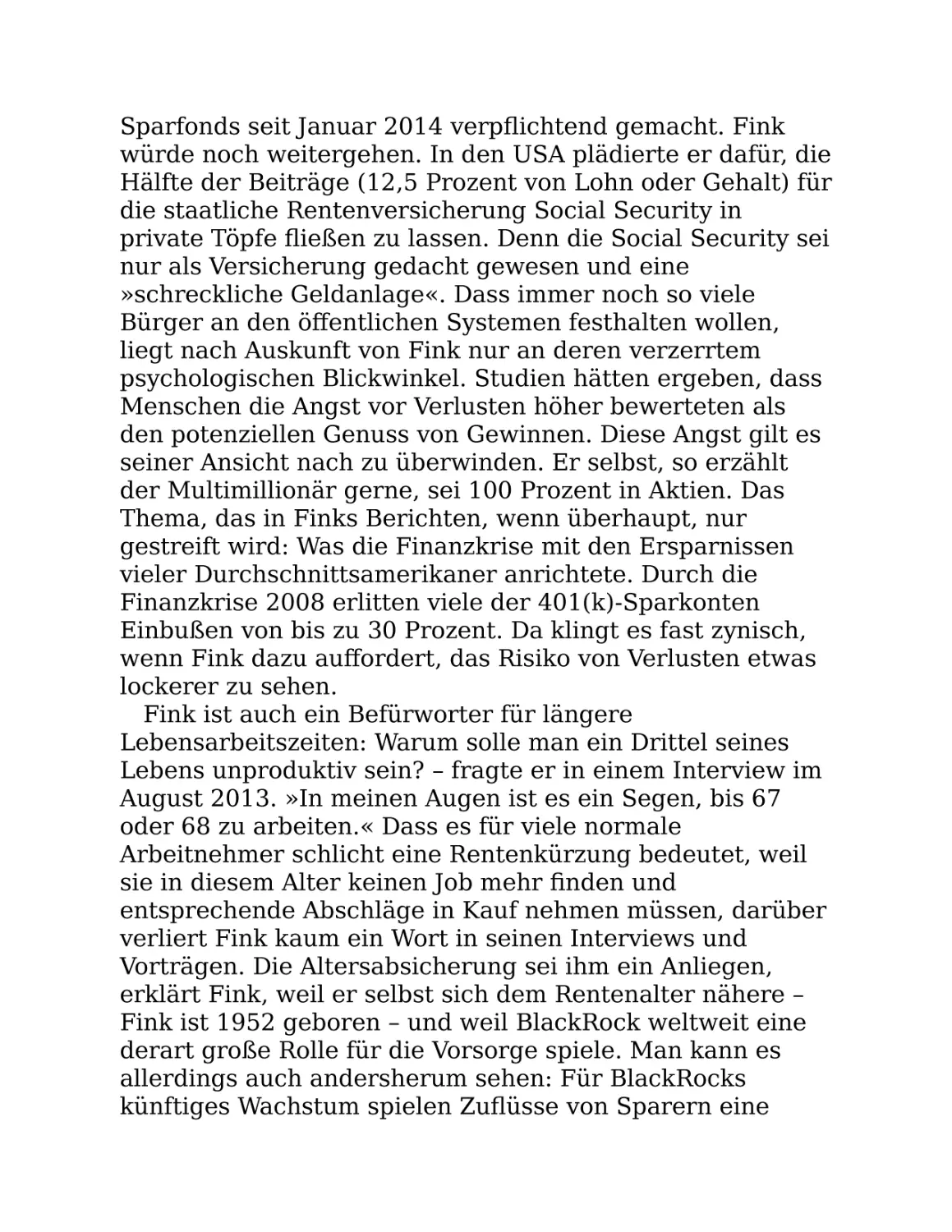








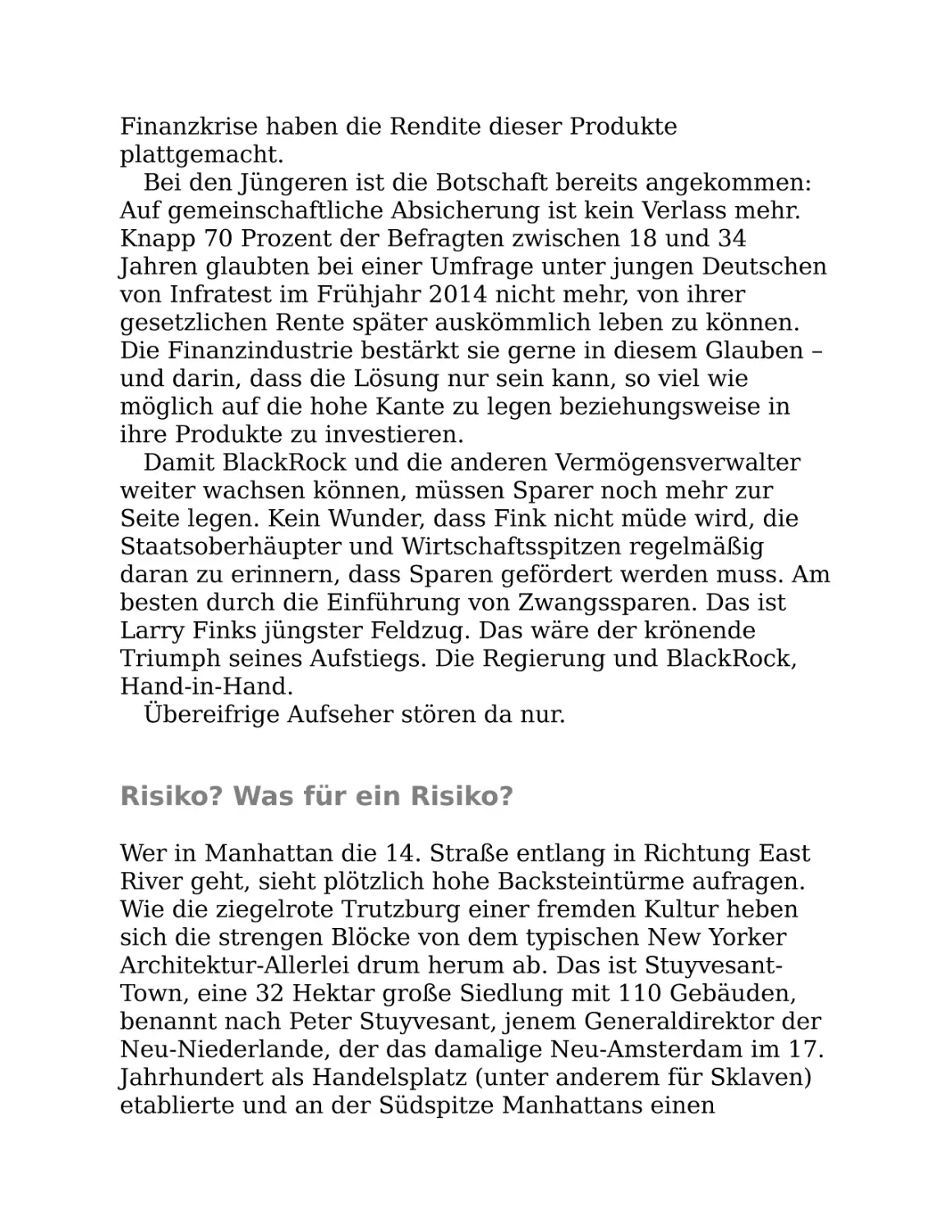














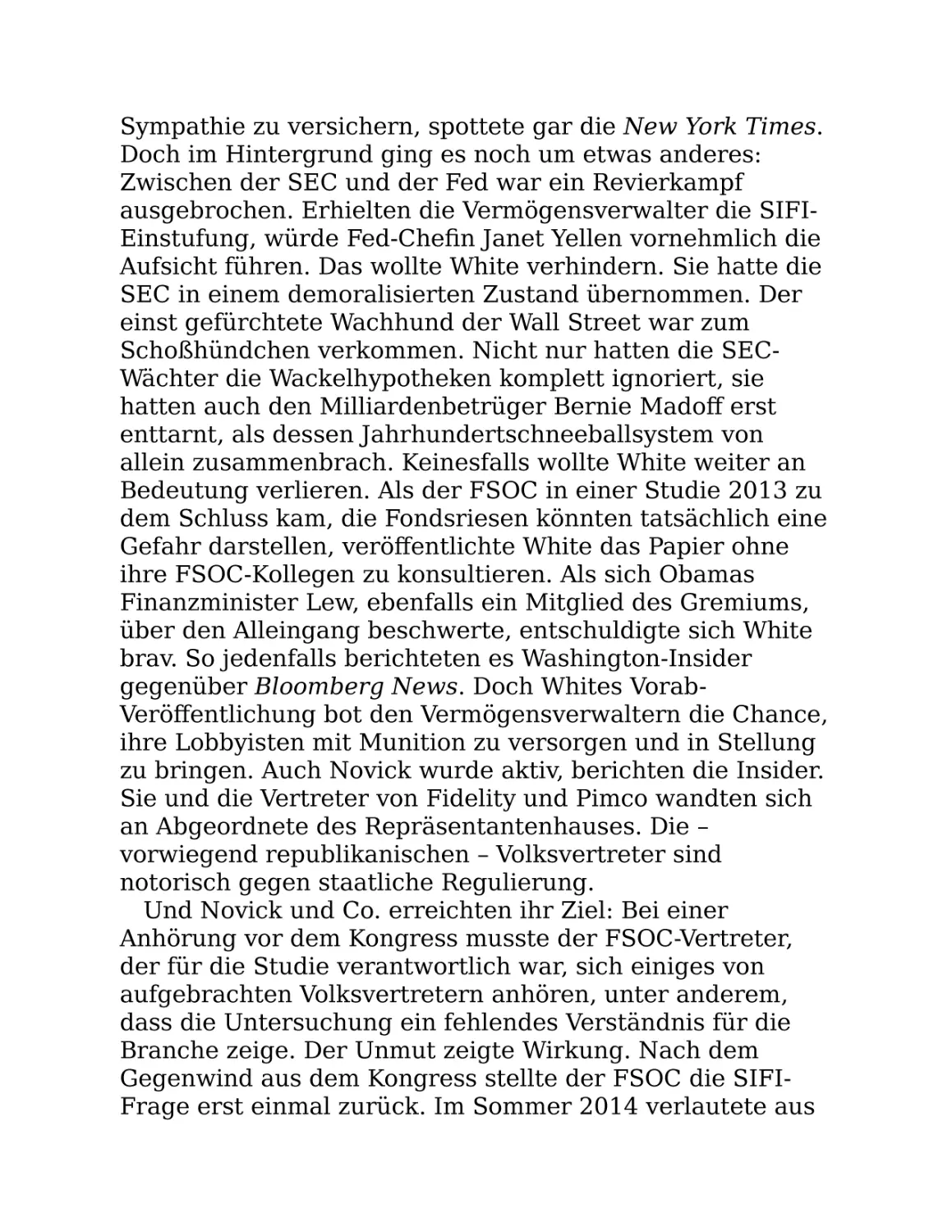
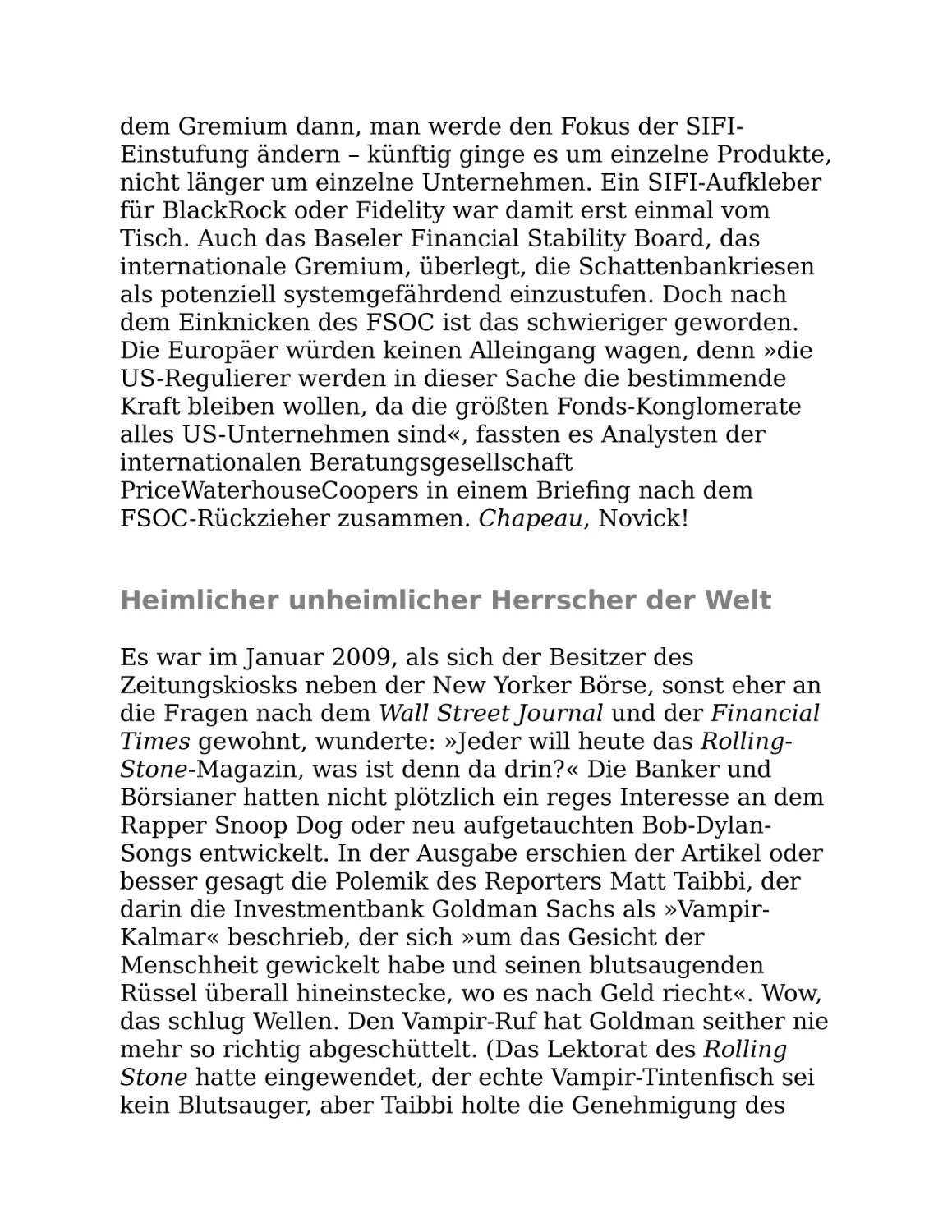












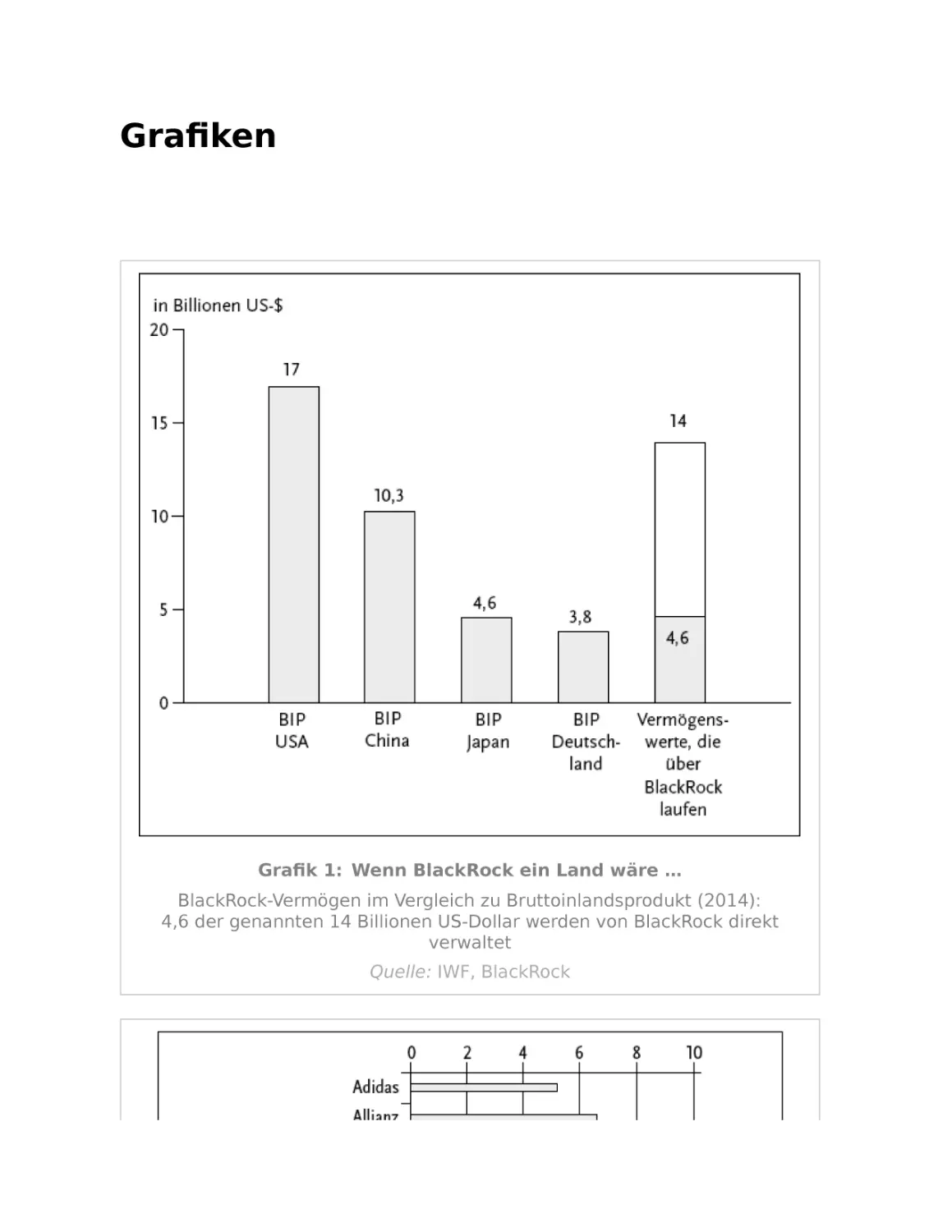
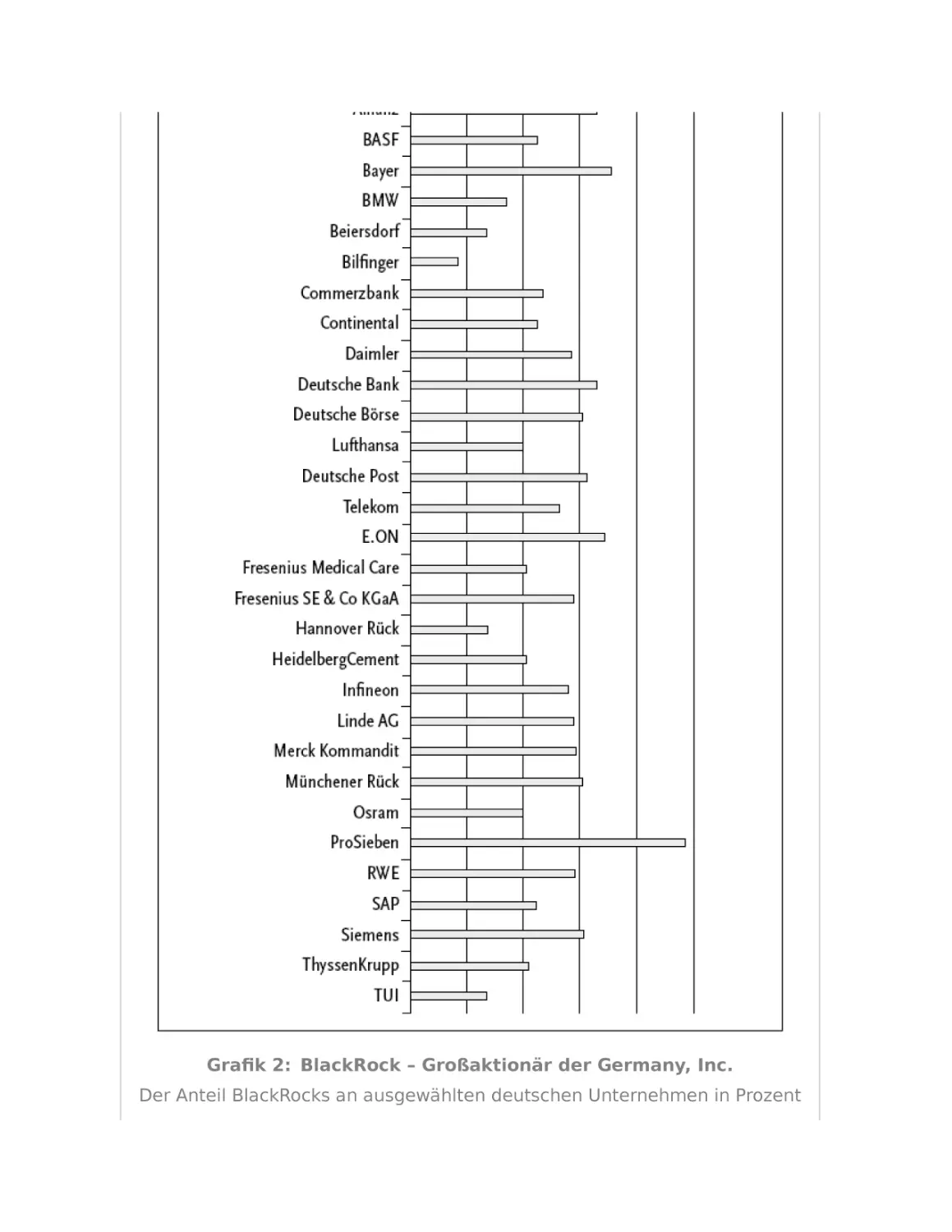

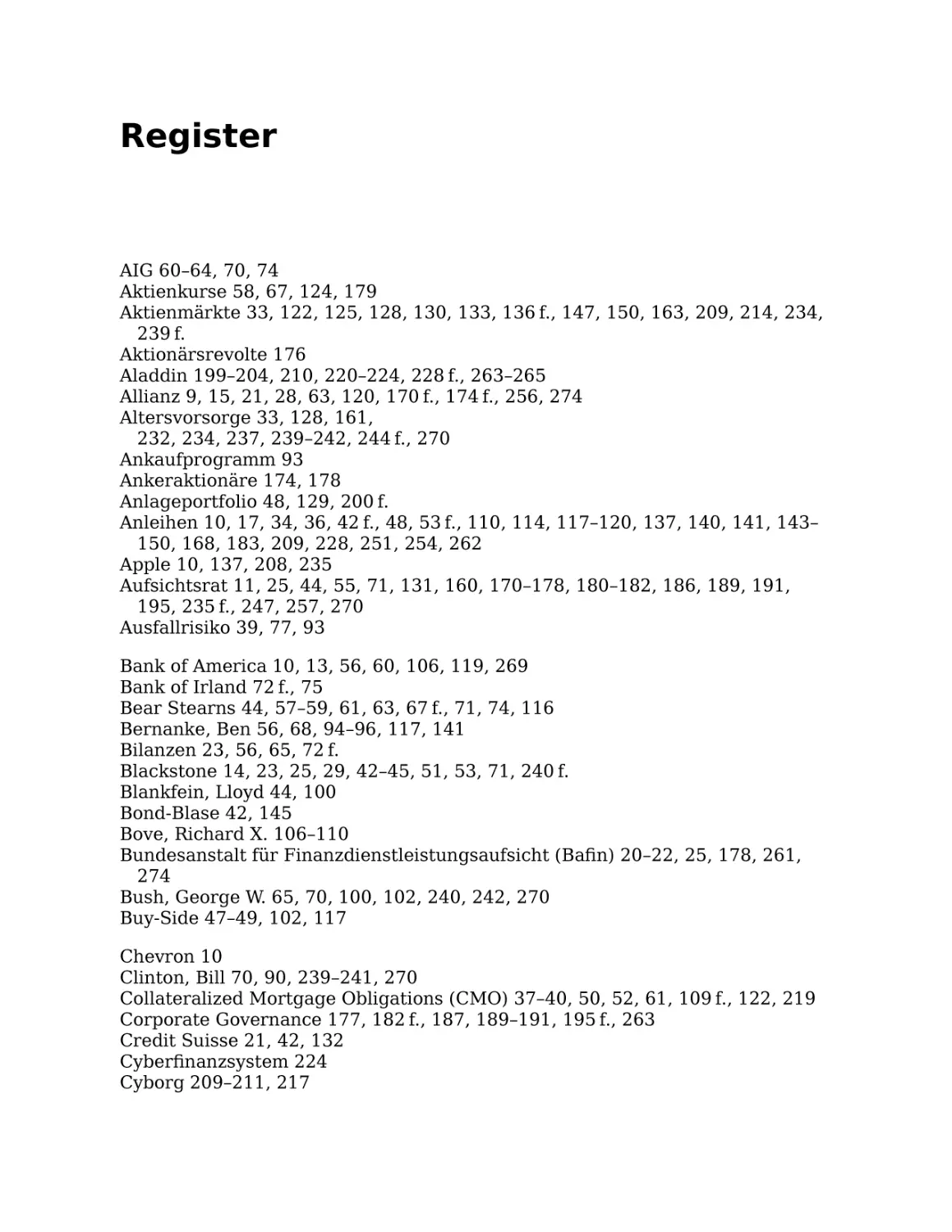
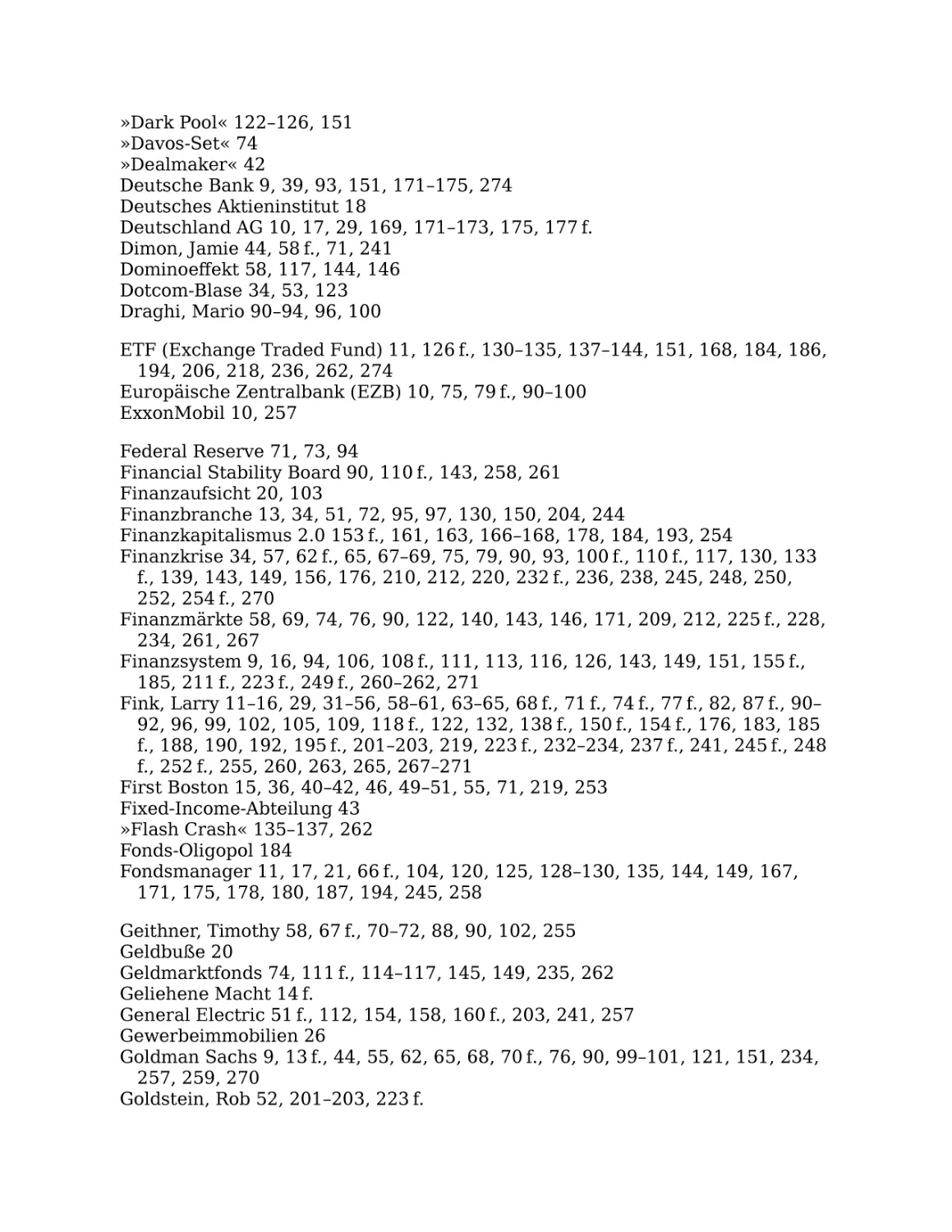
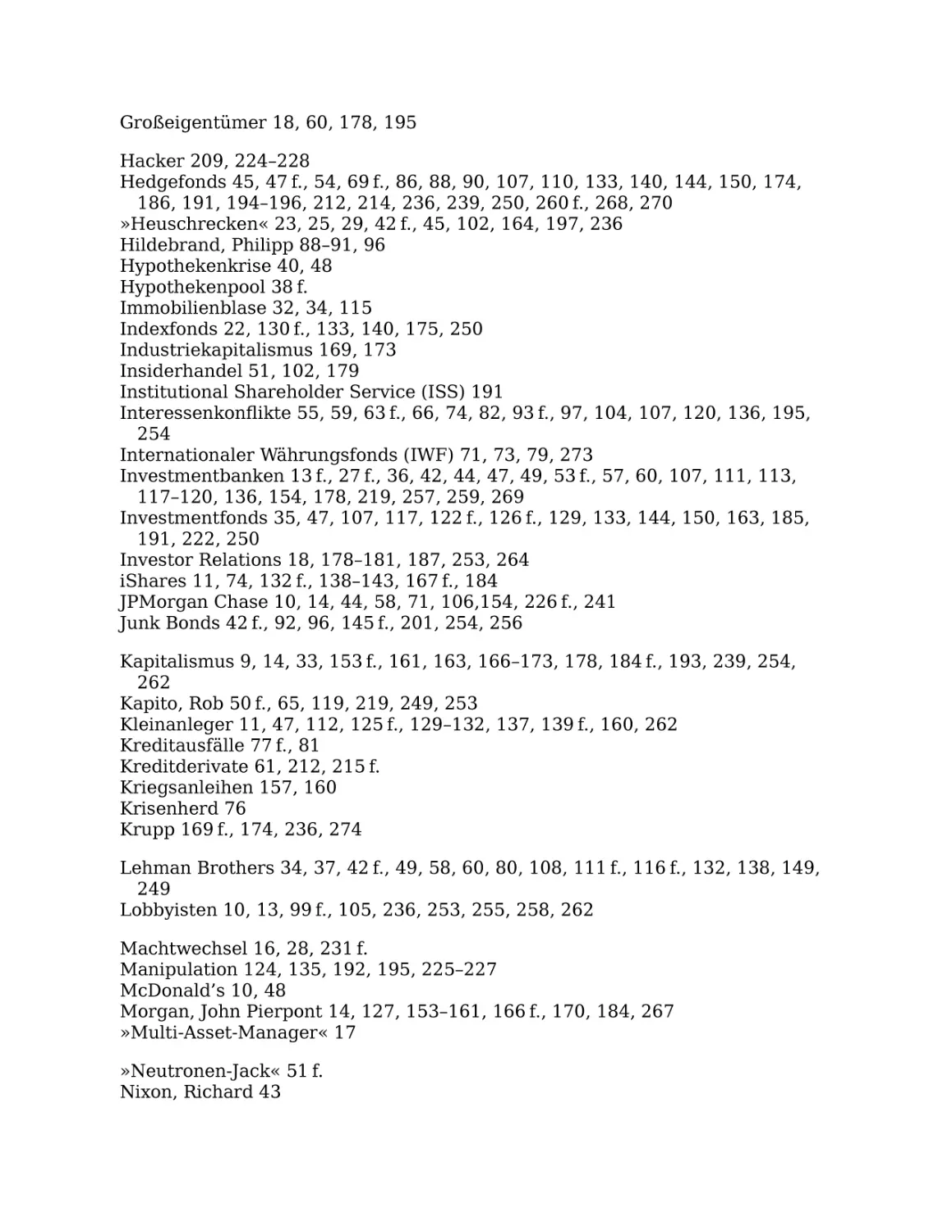
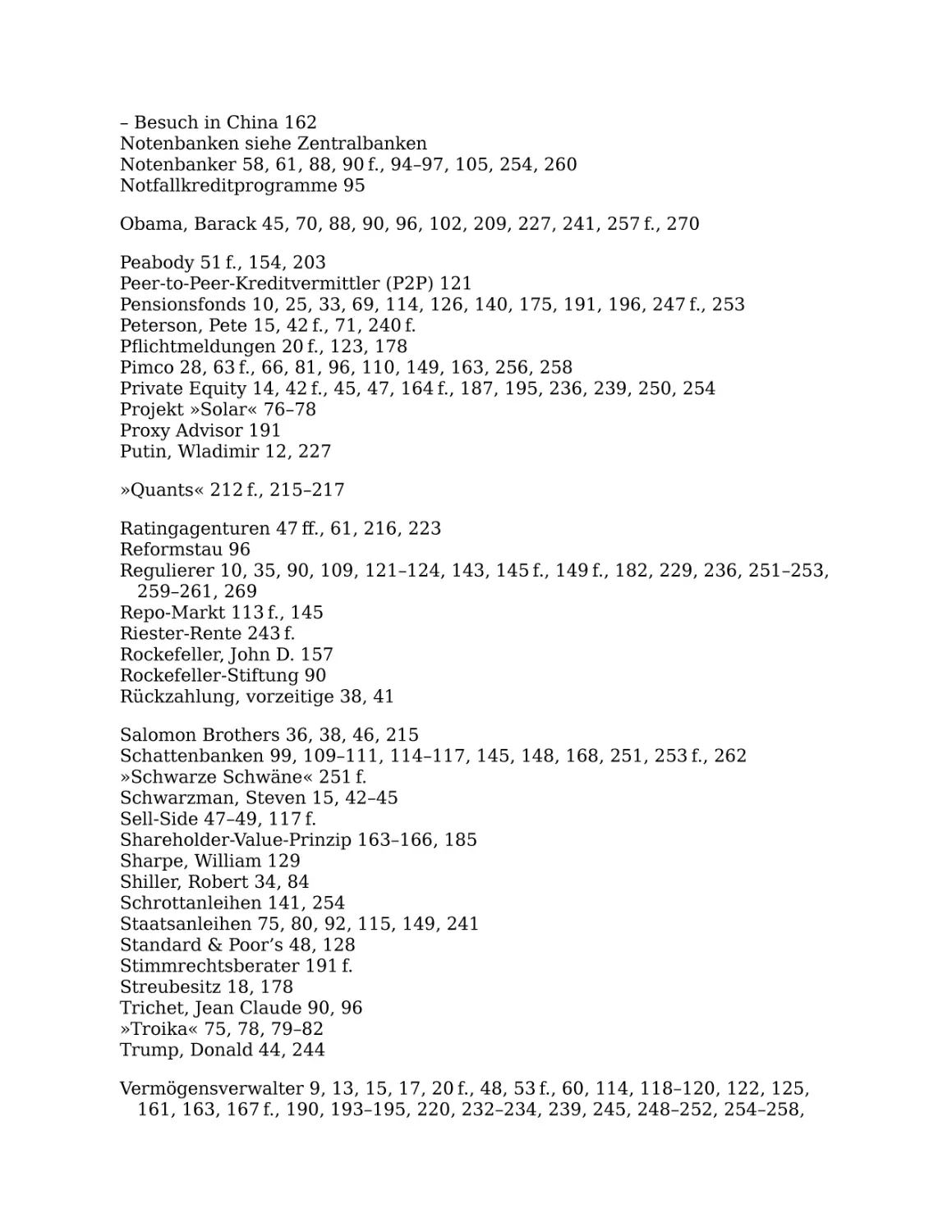
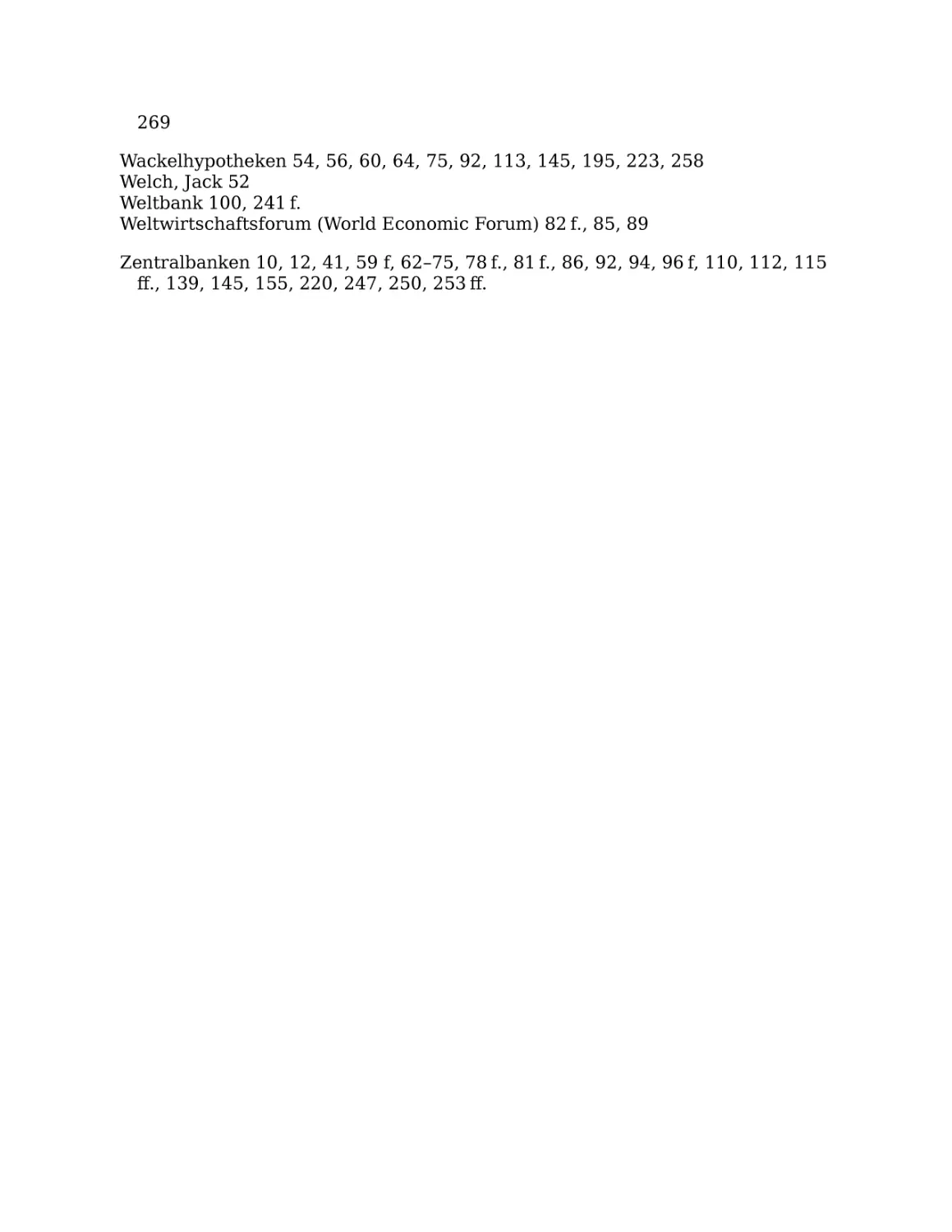
![[Impressum]](https://djvu.online/jpg1/V/i/N/ViN8OBz7vQih9/321.webp)



