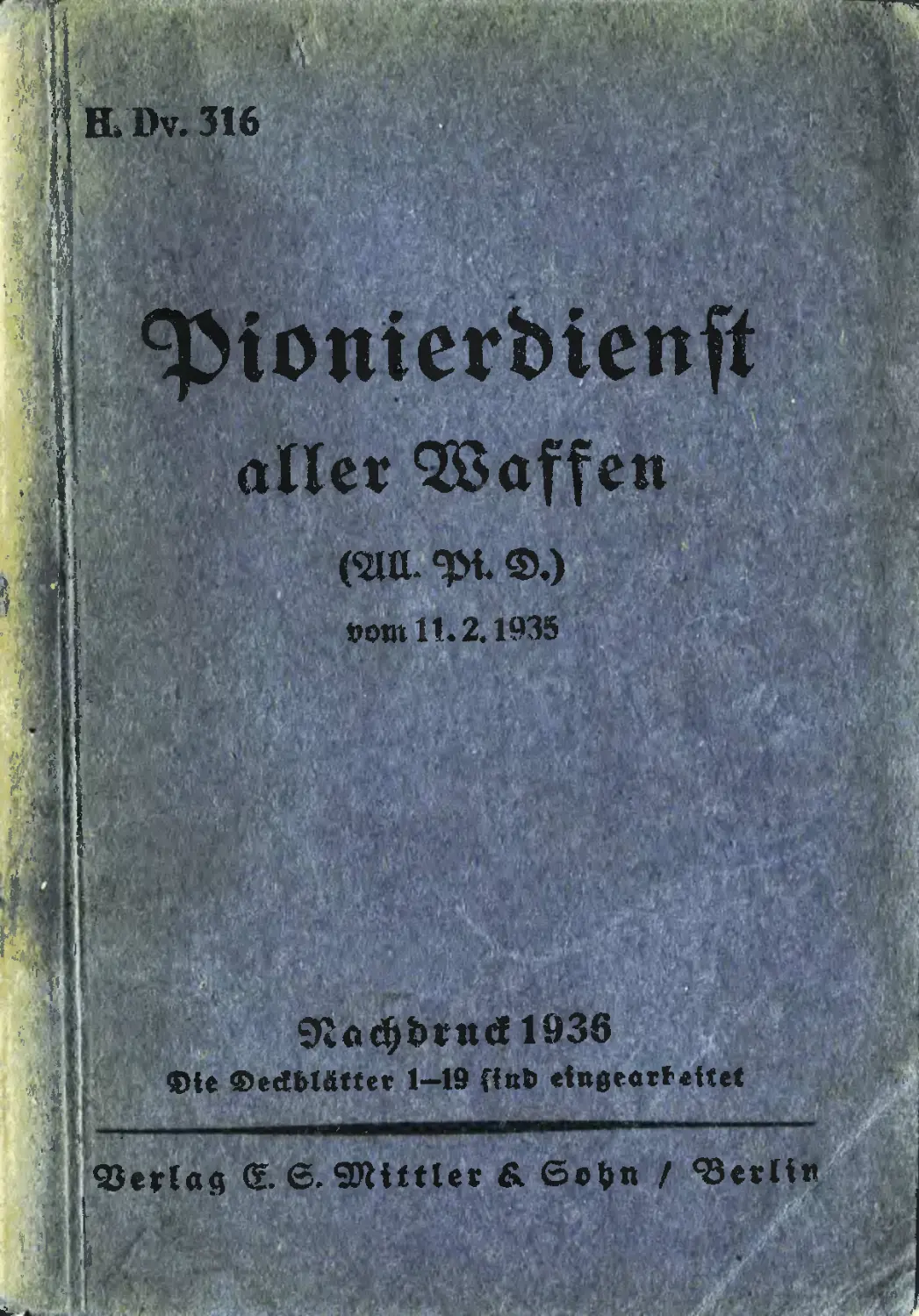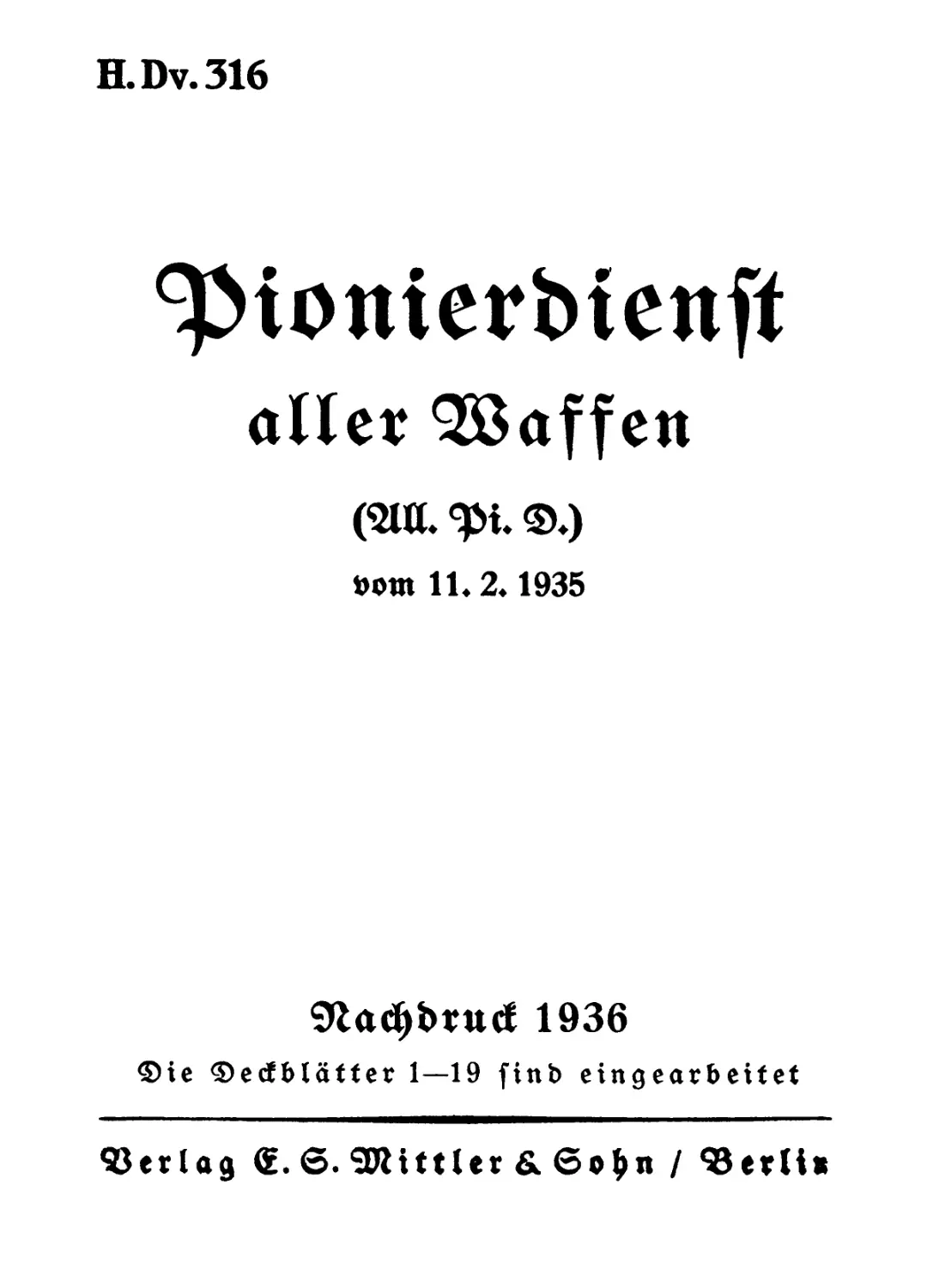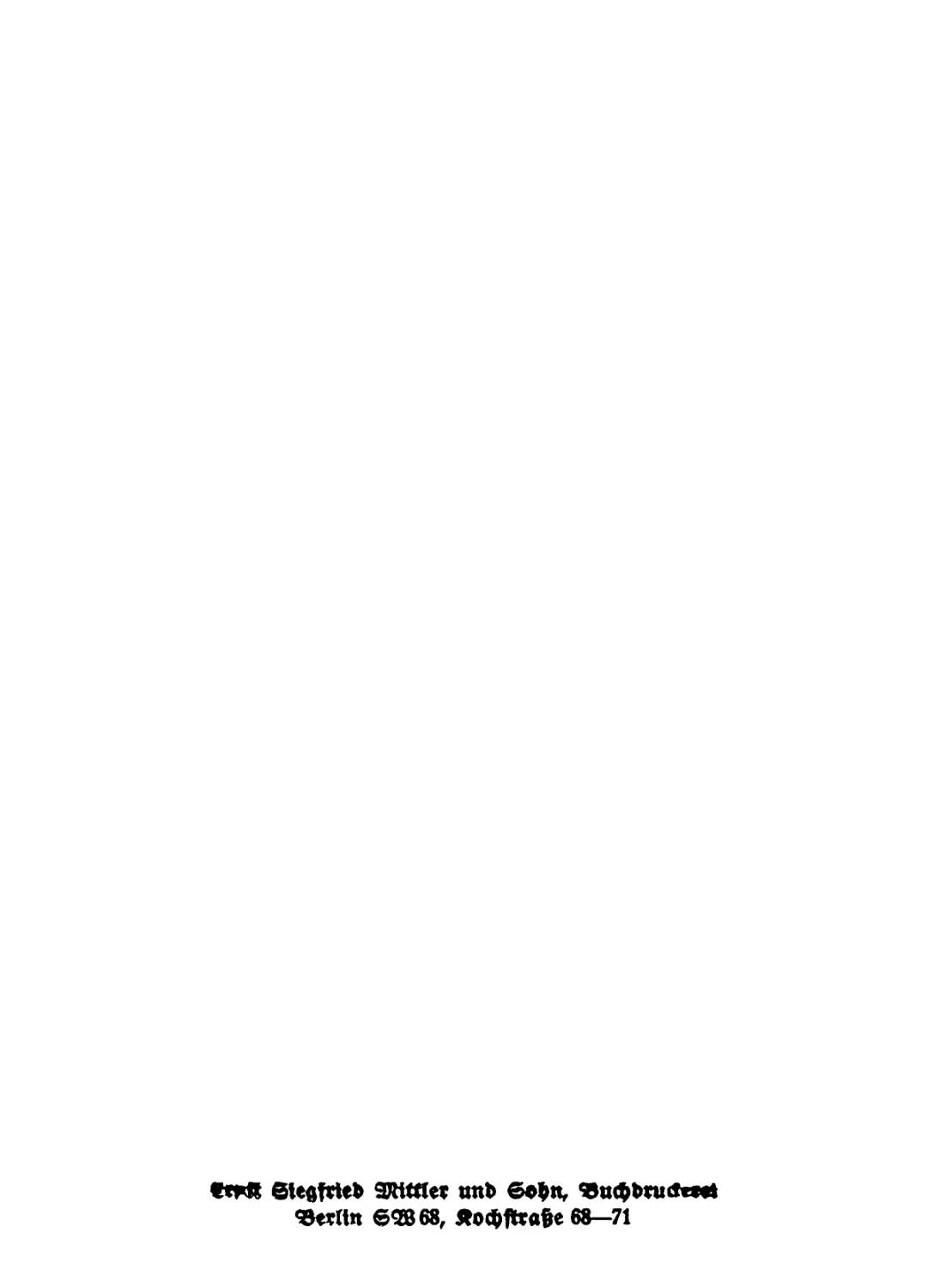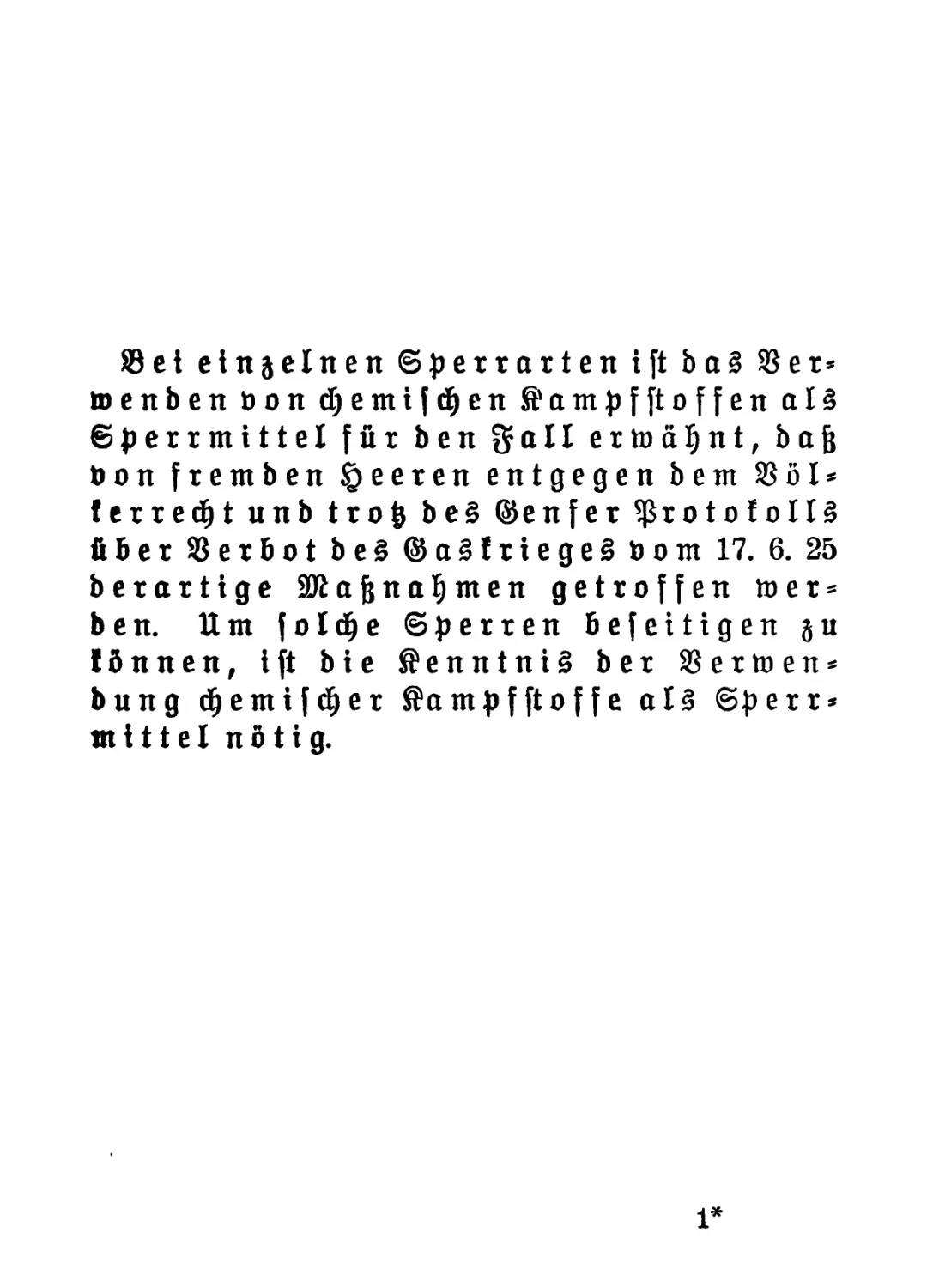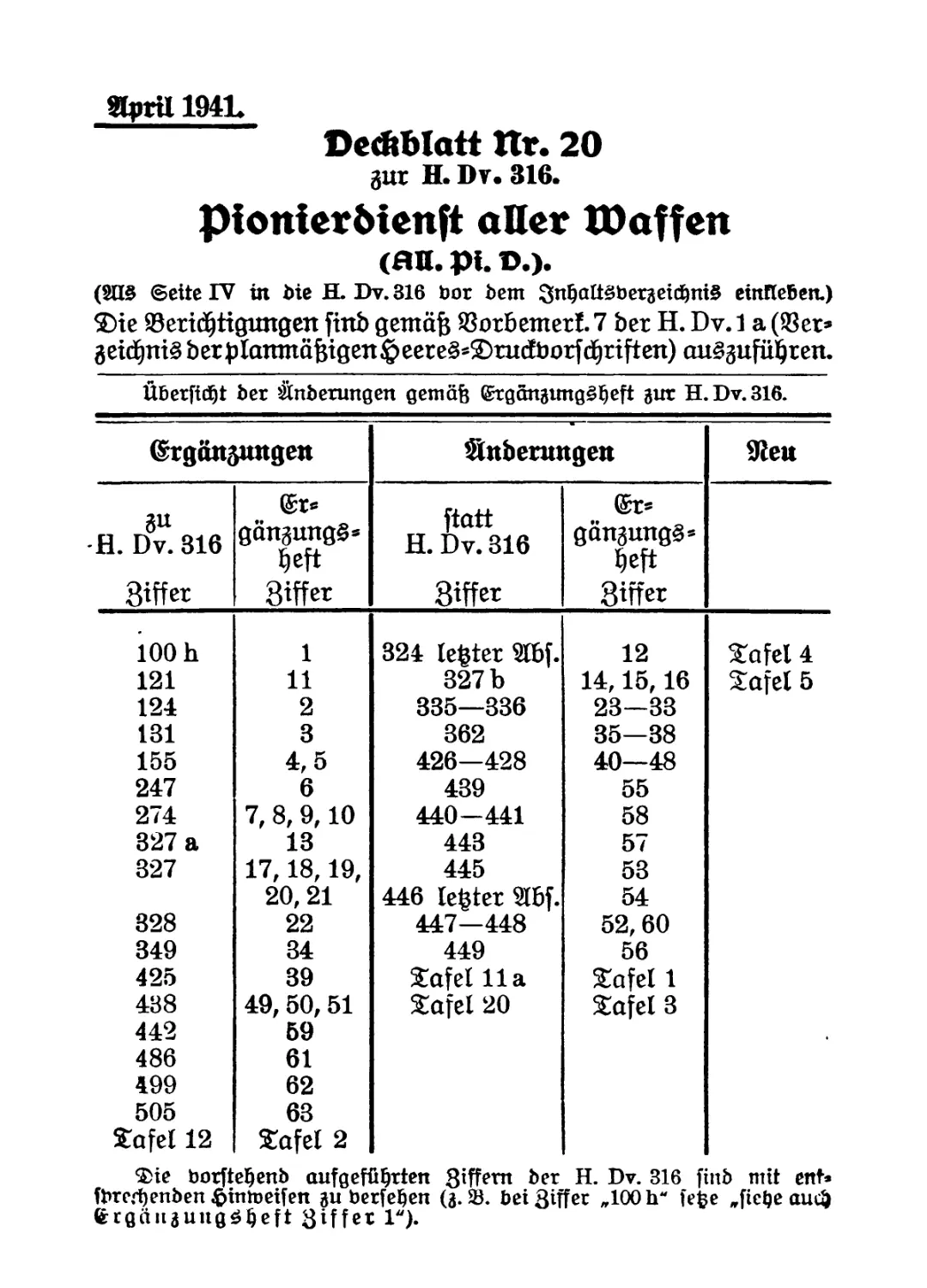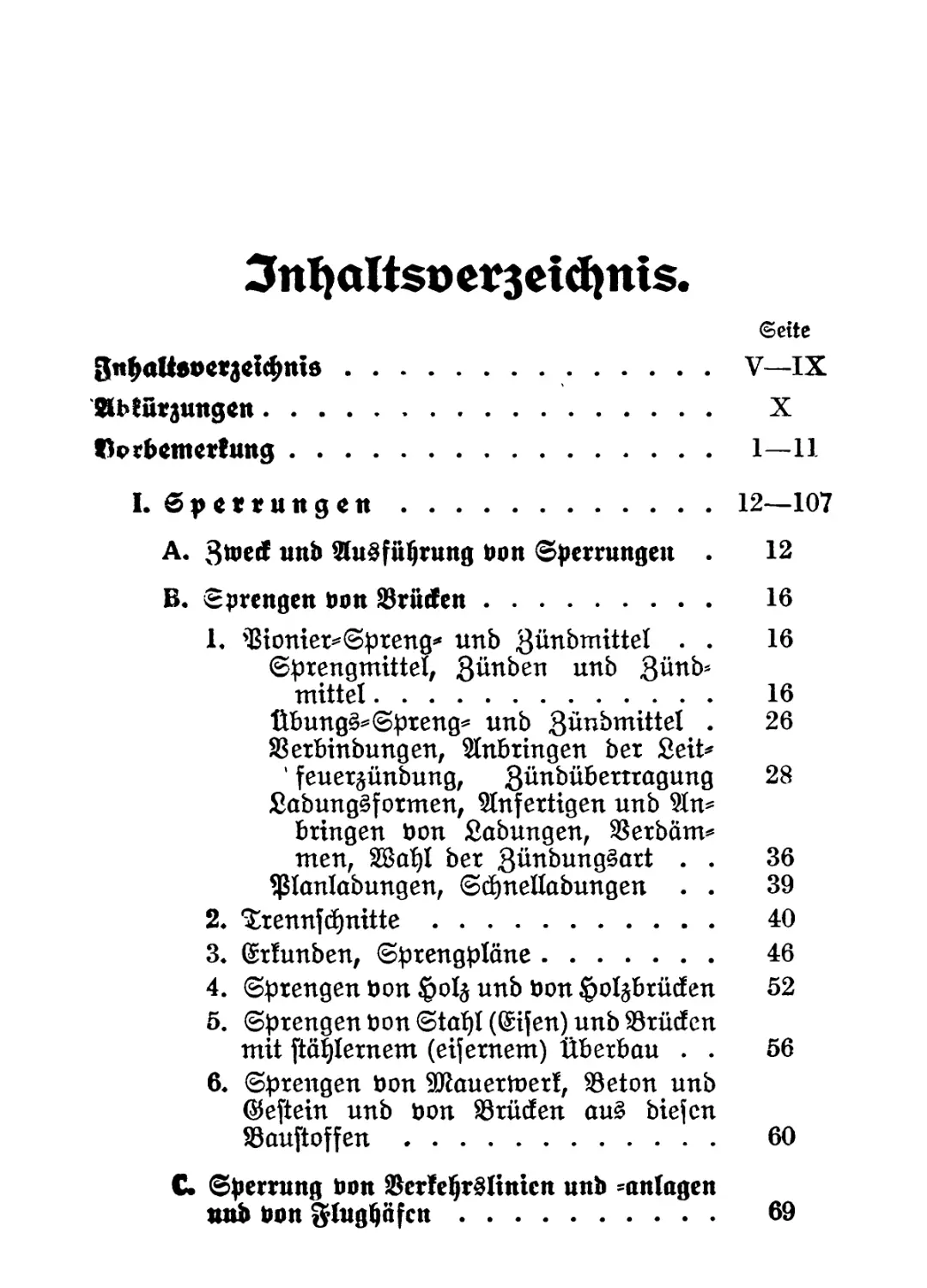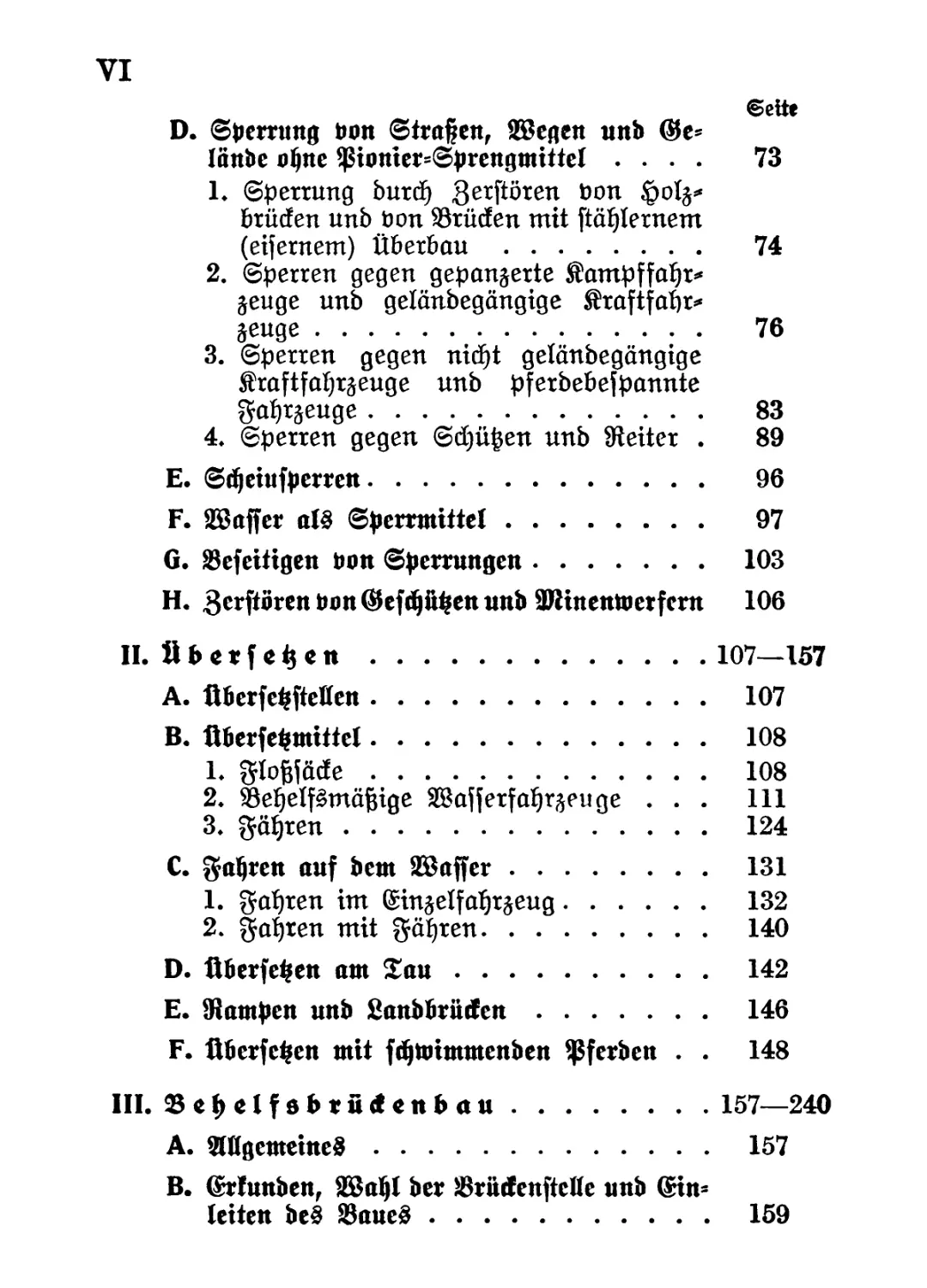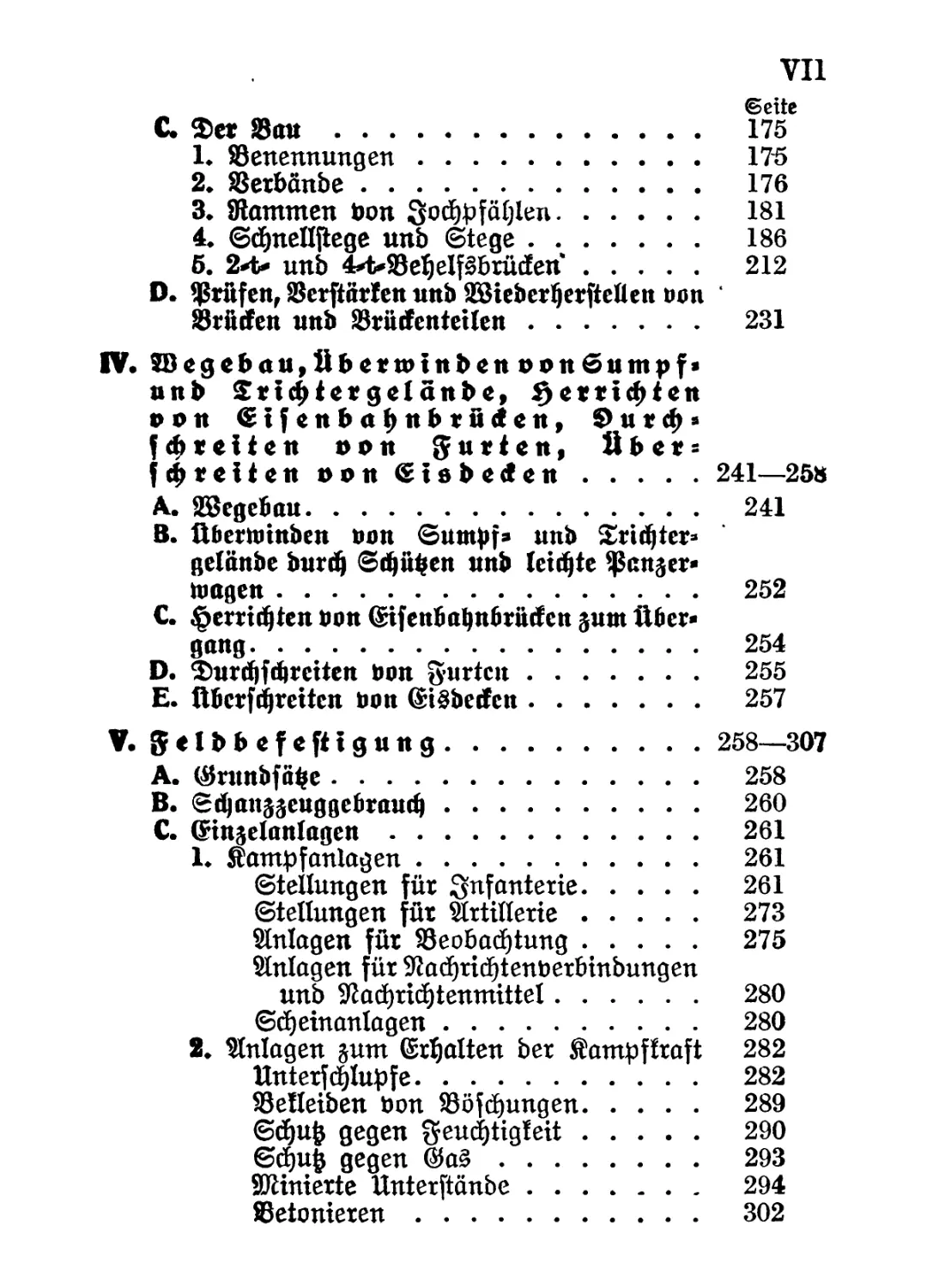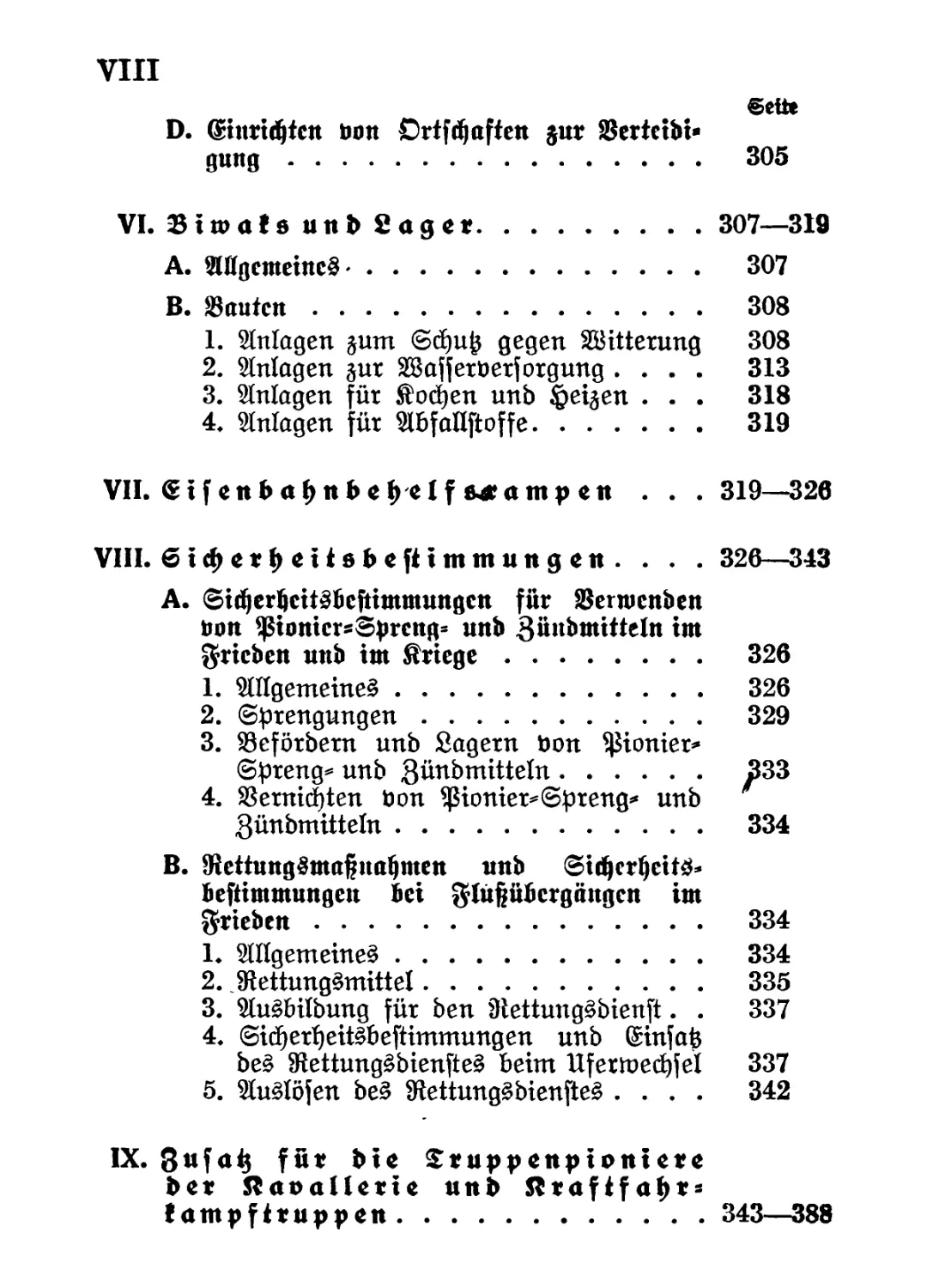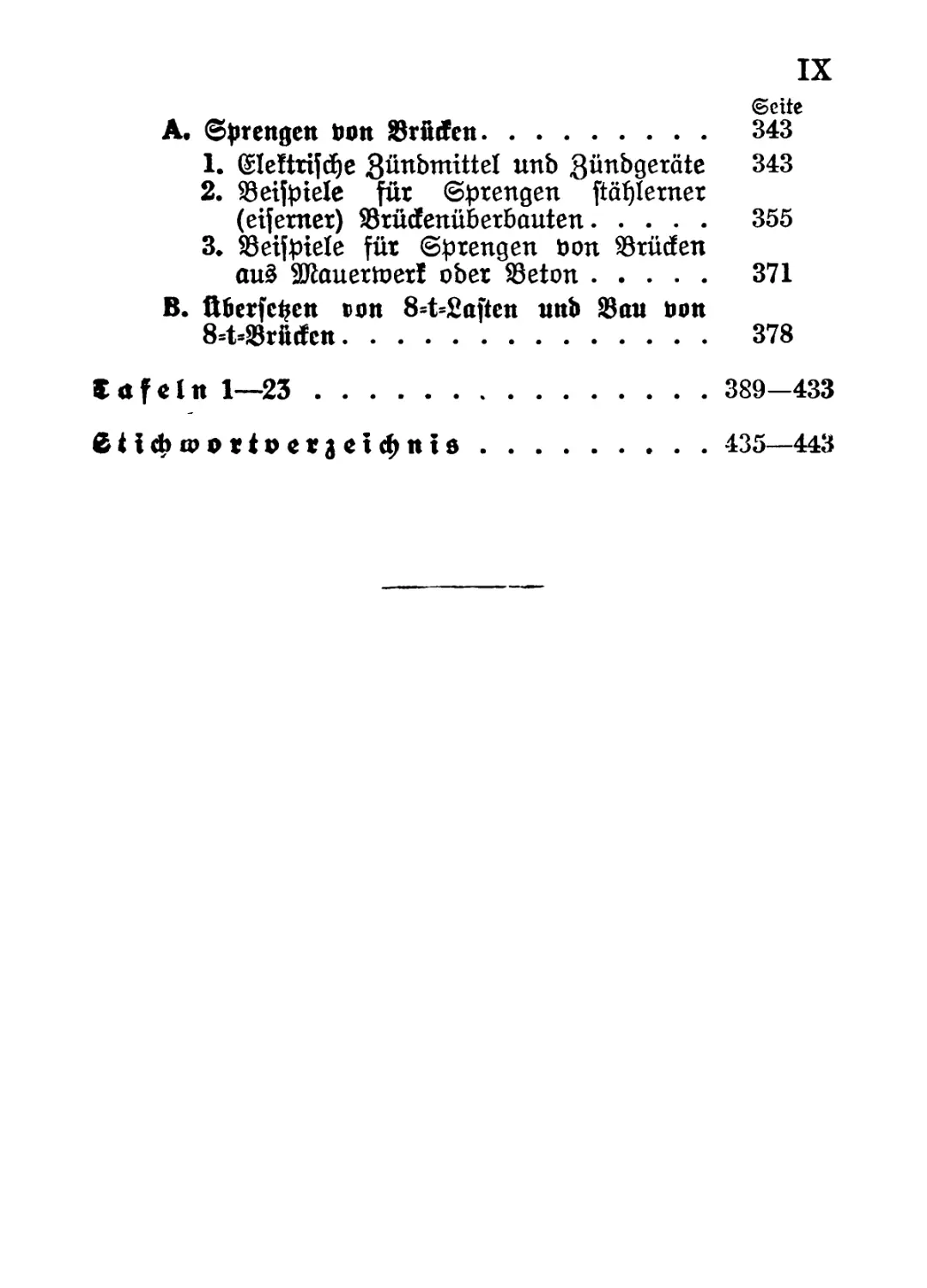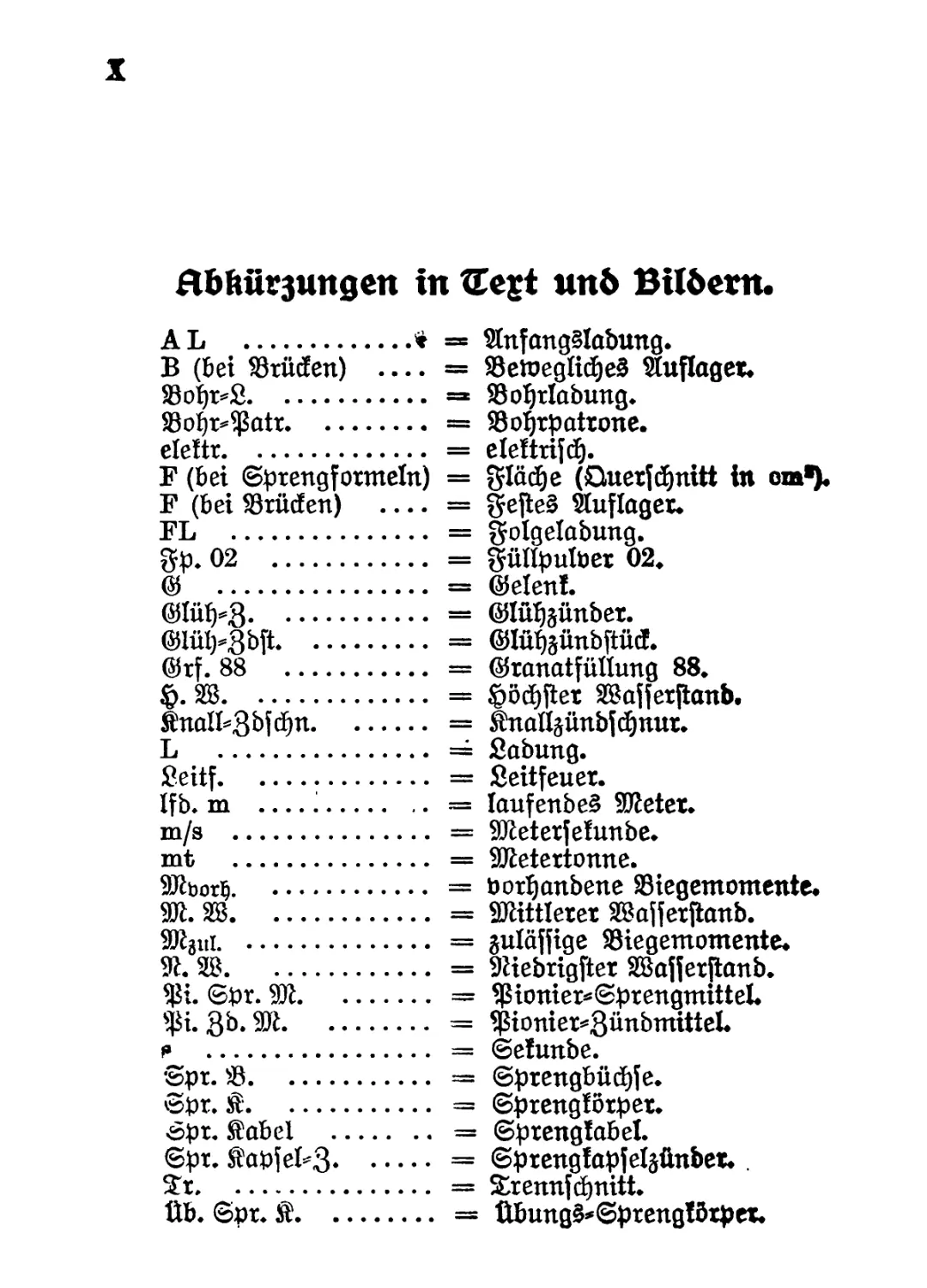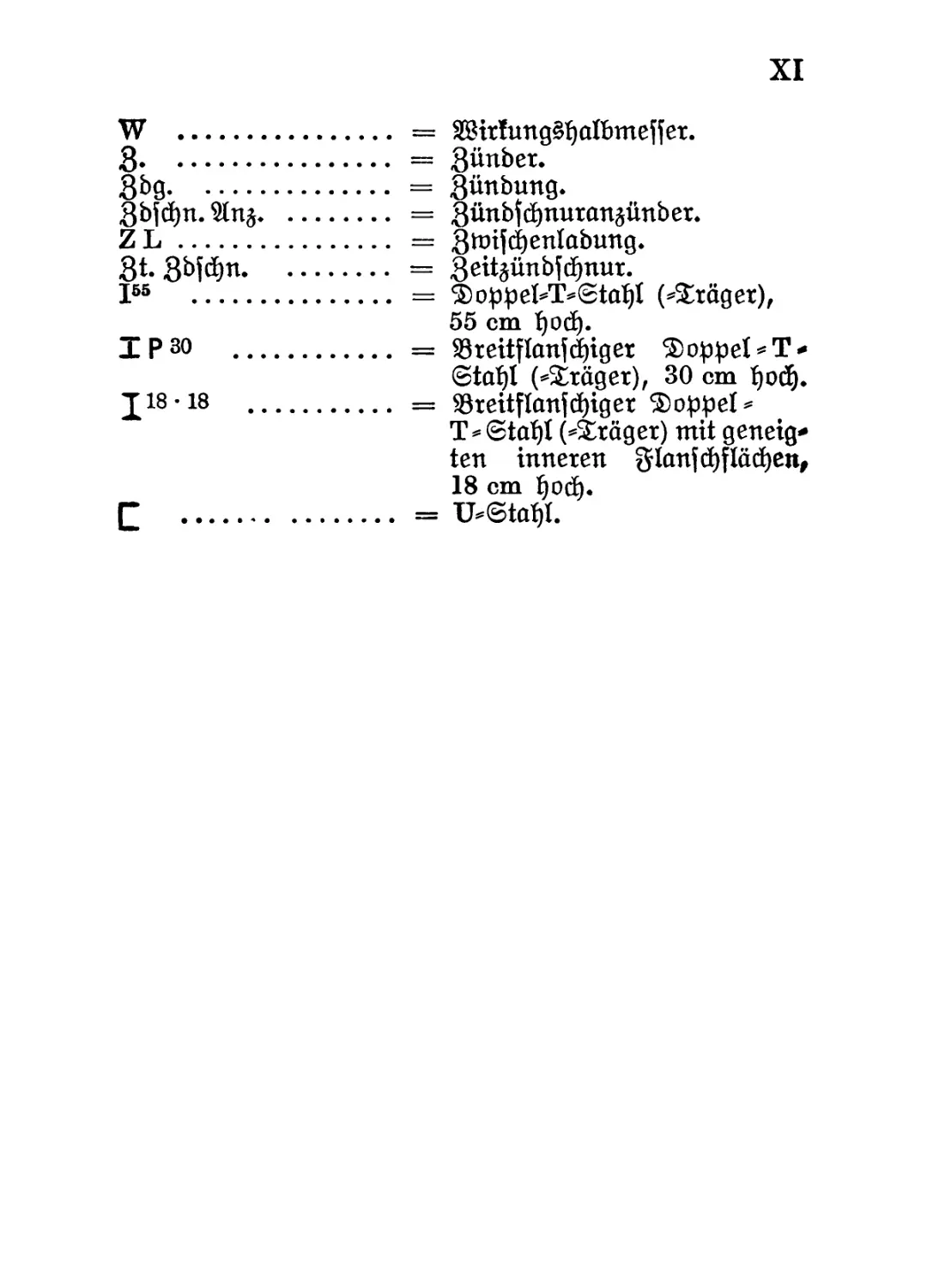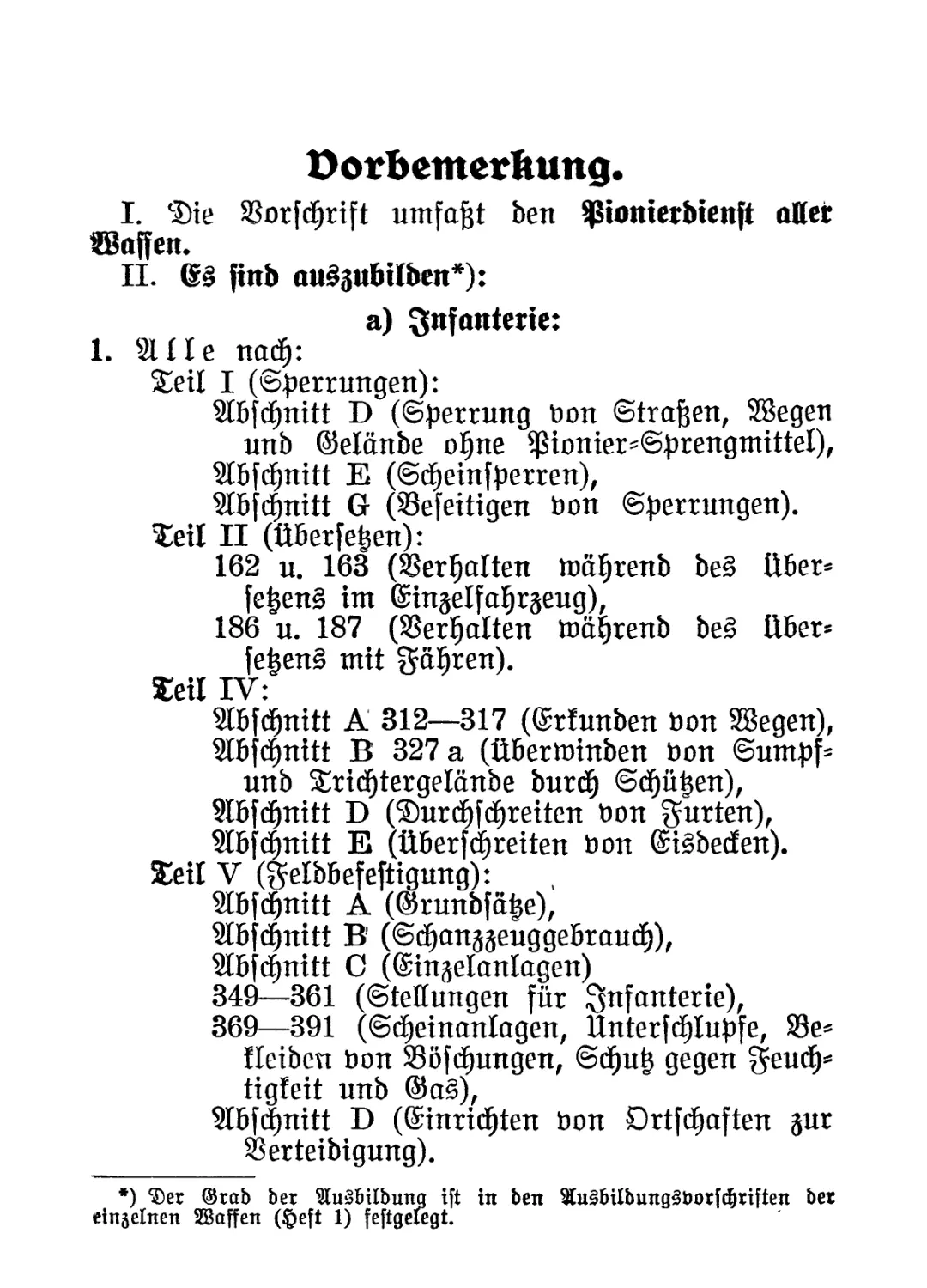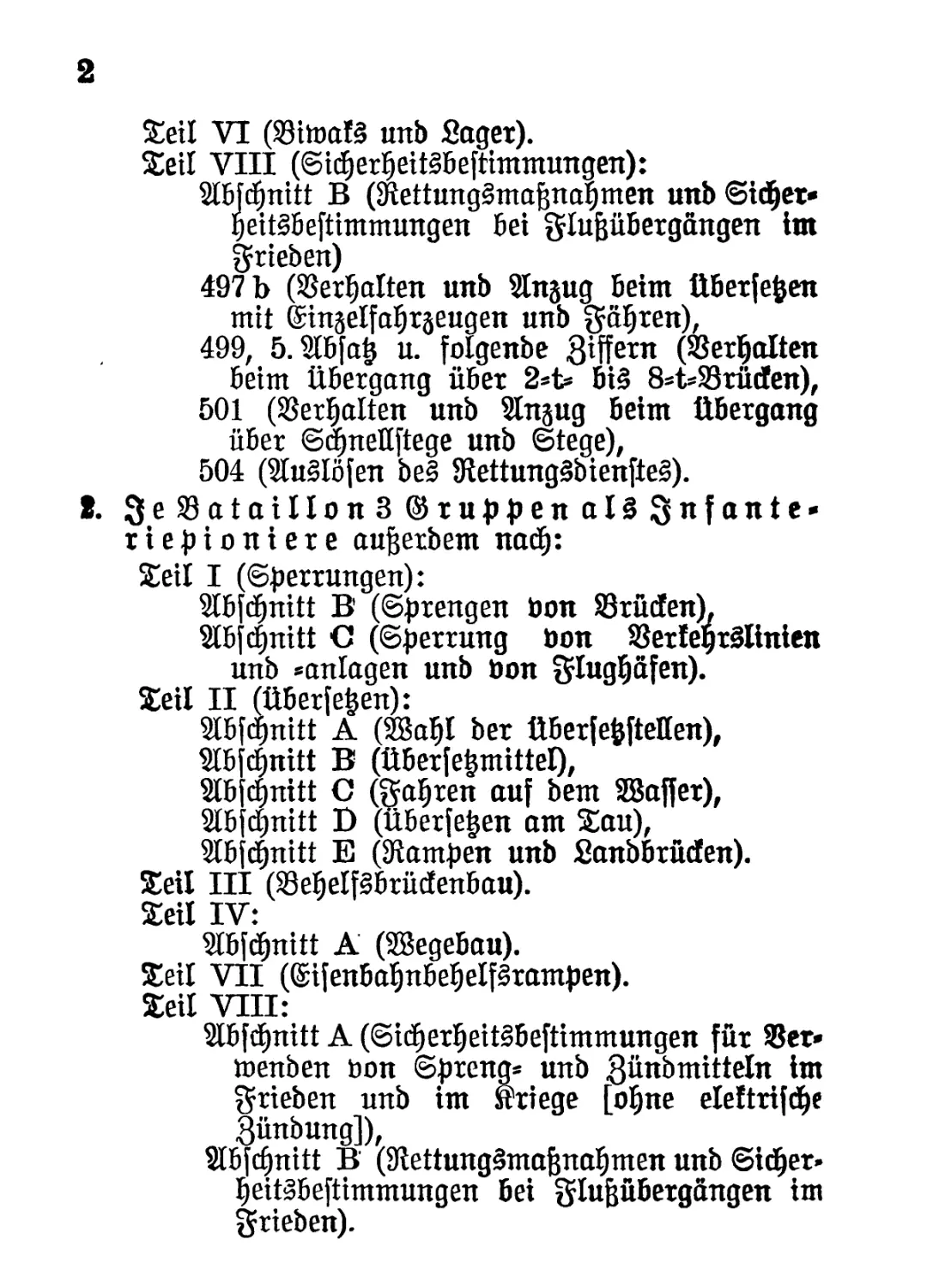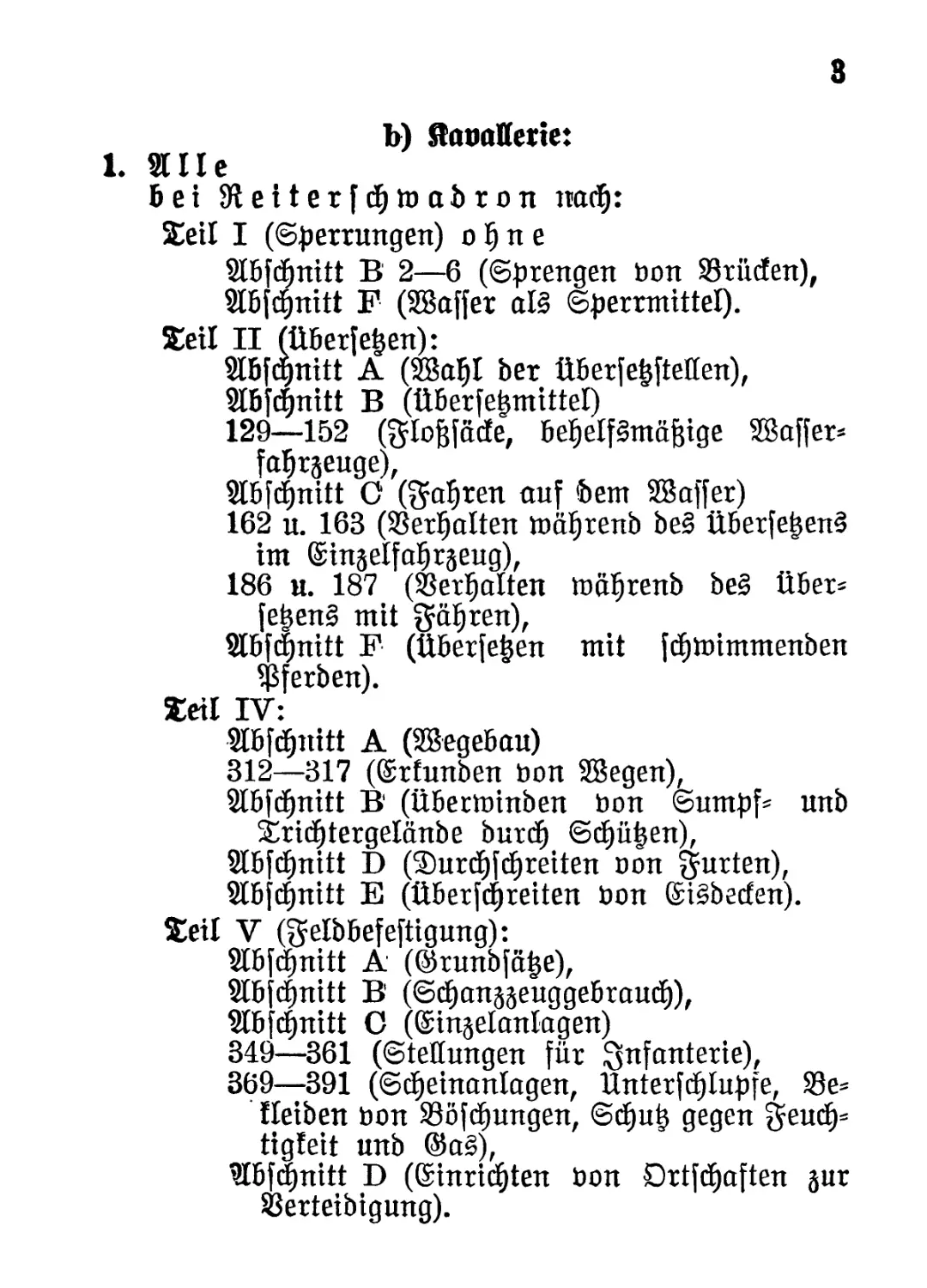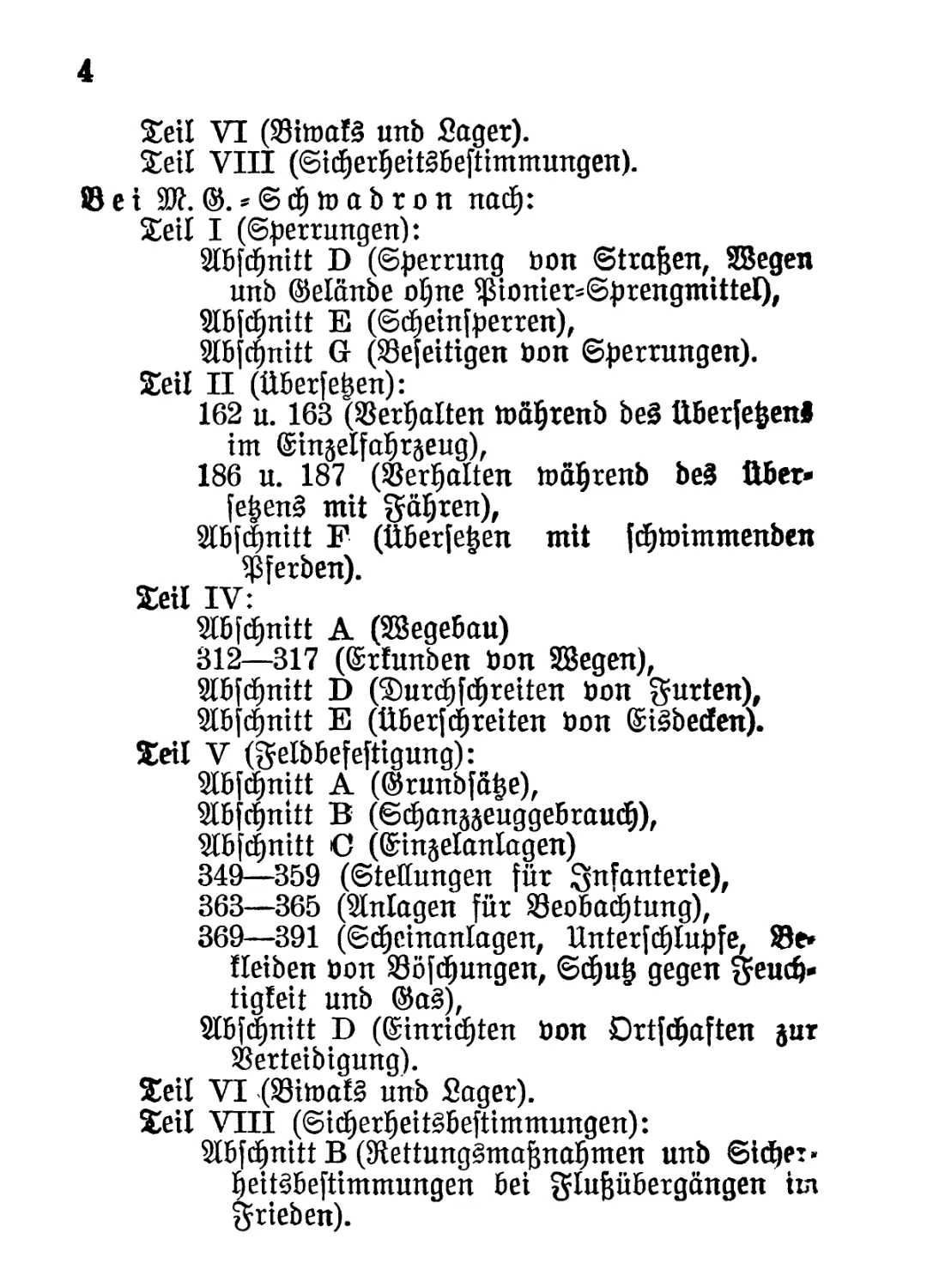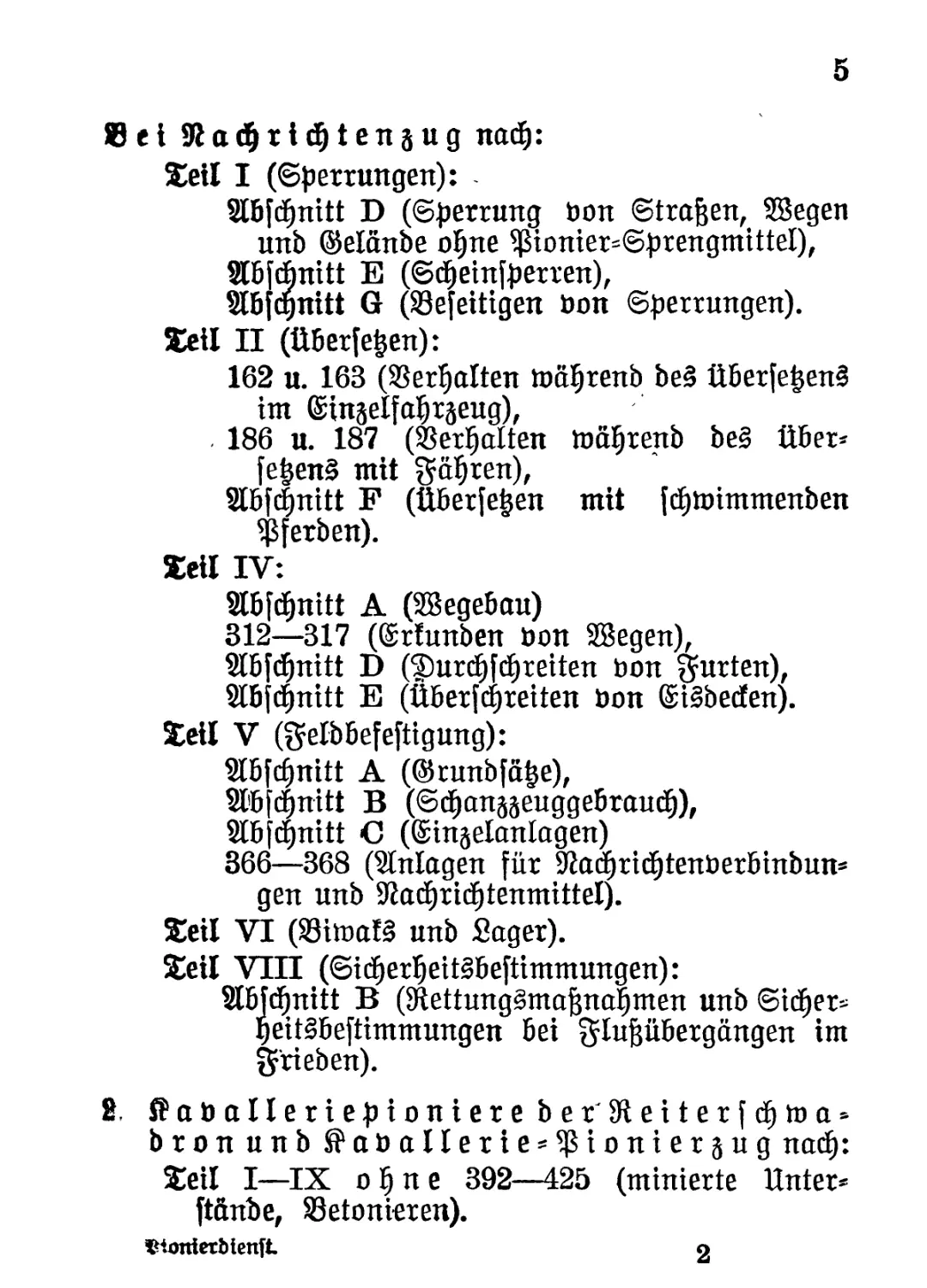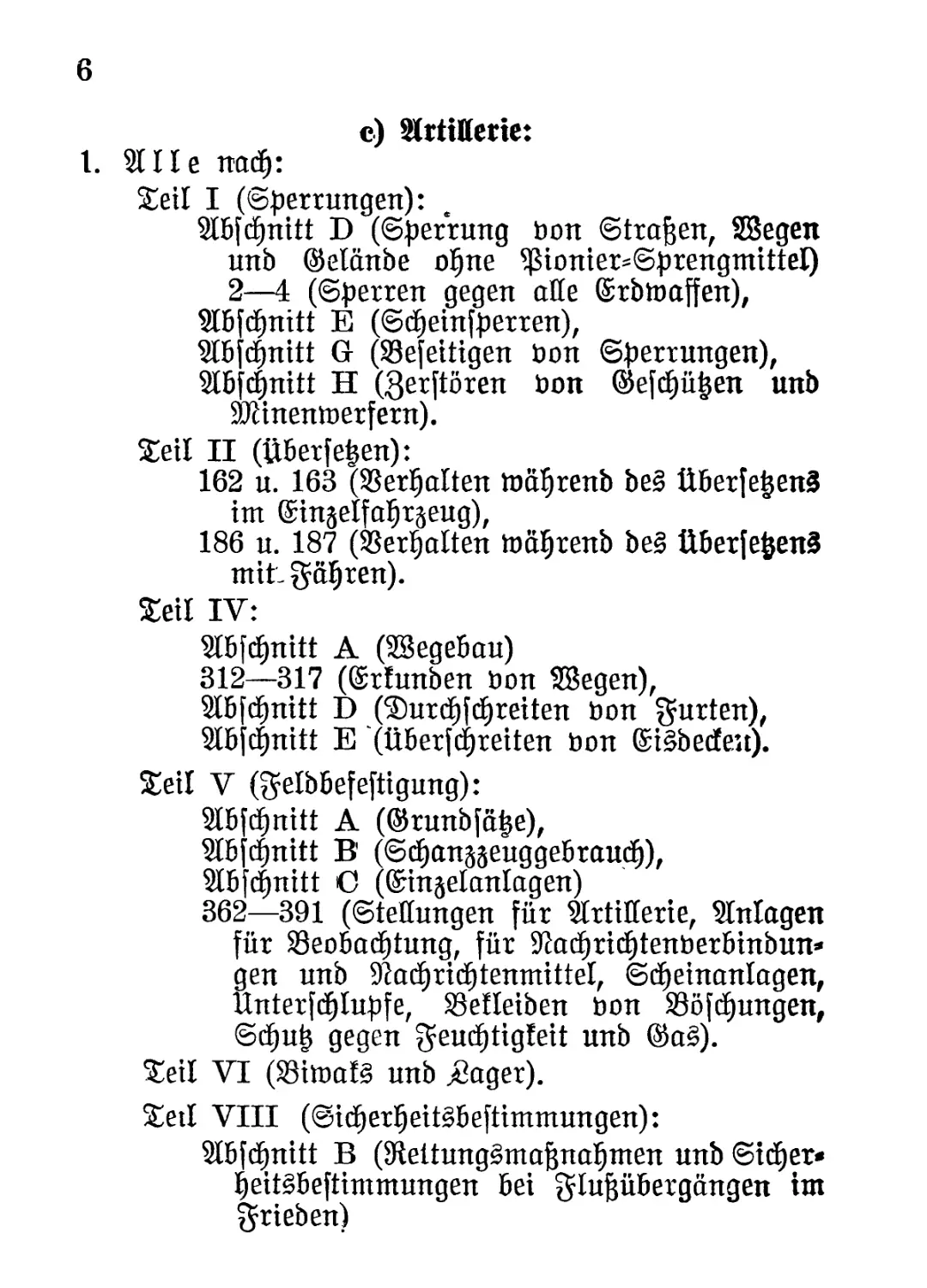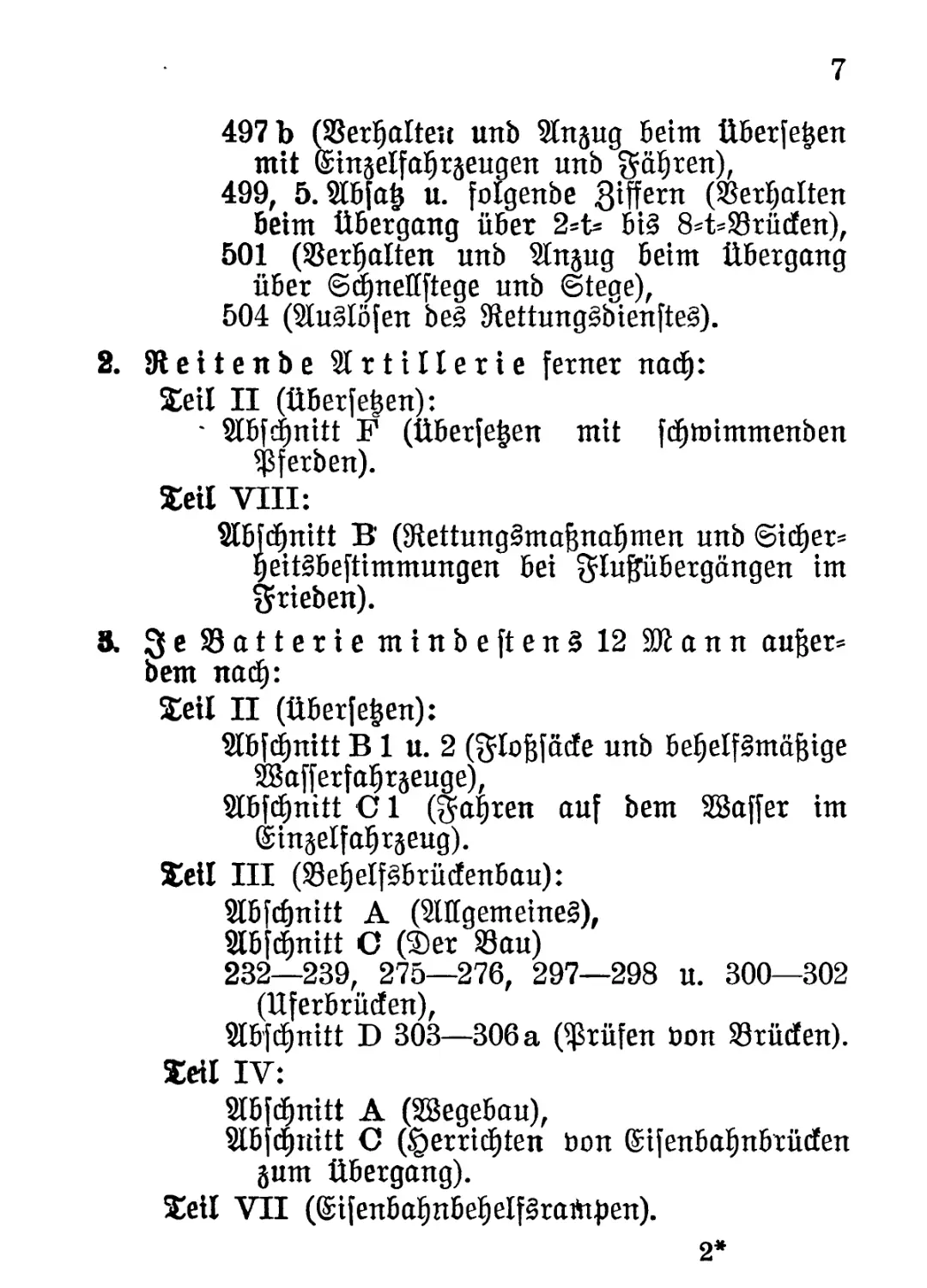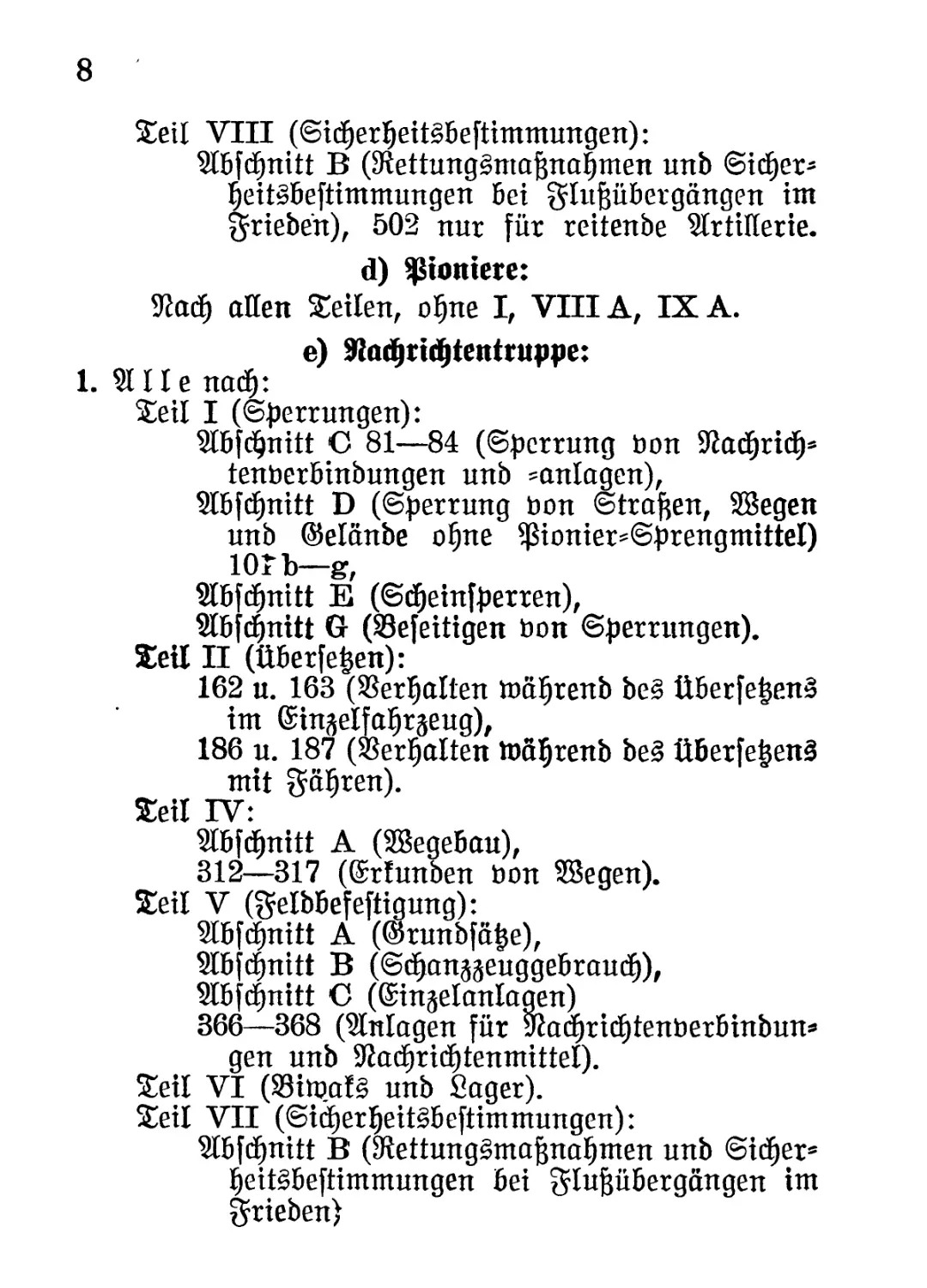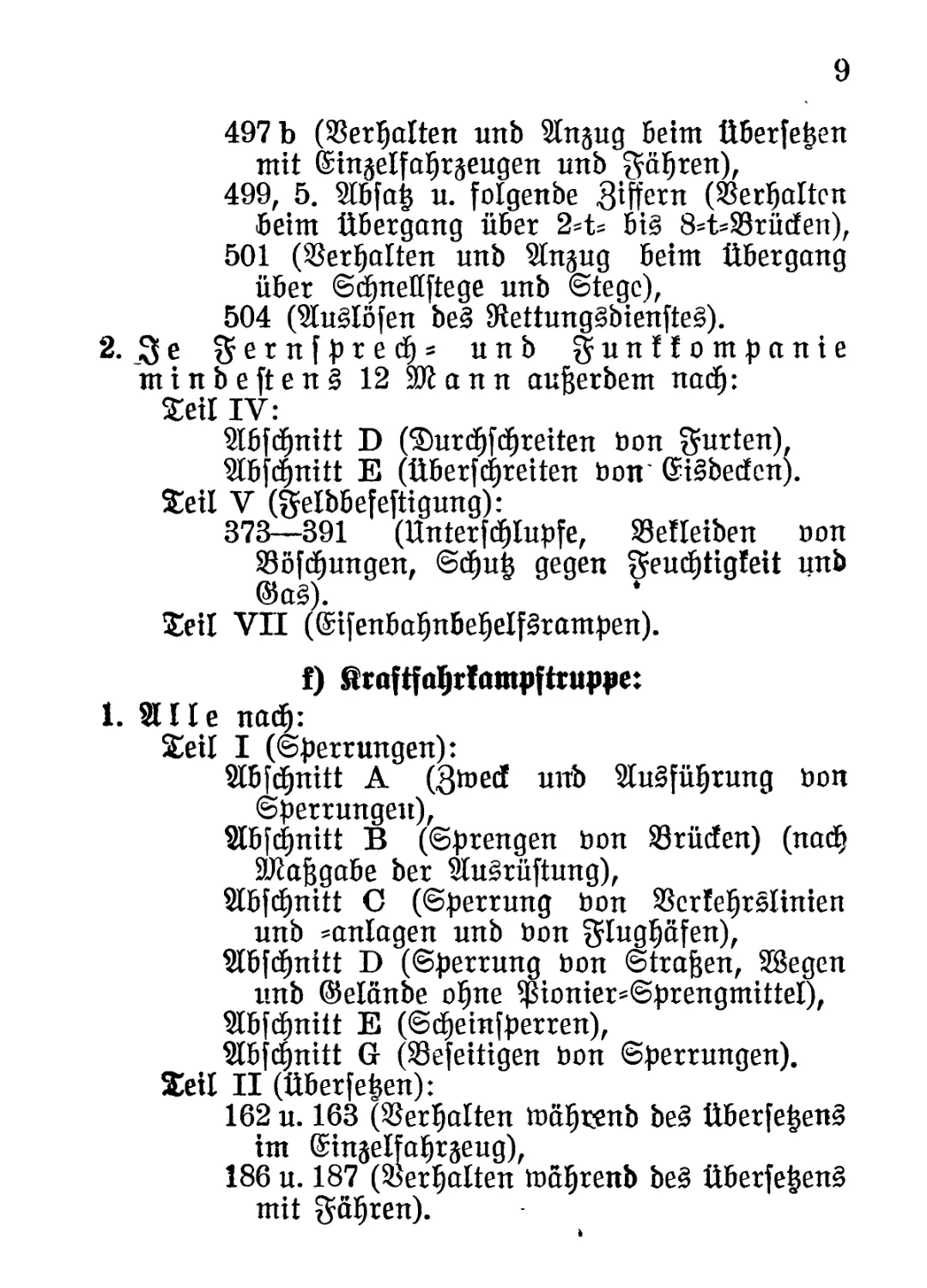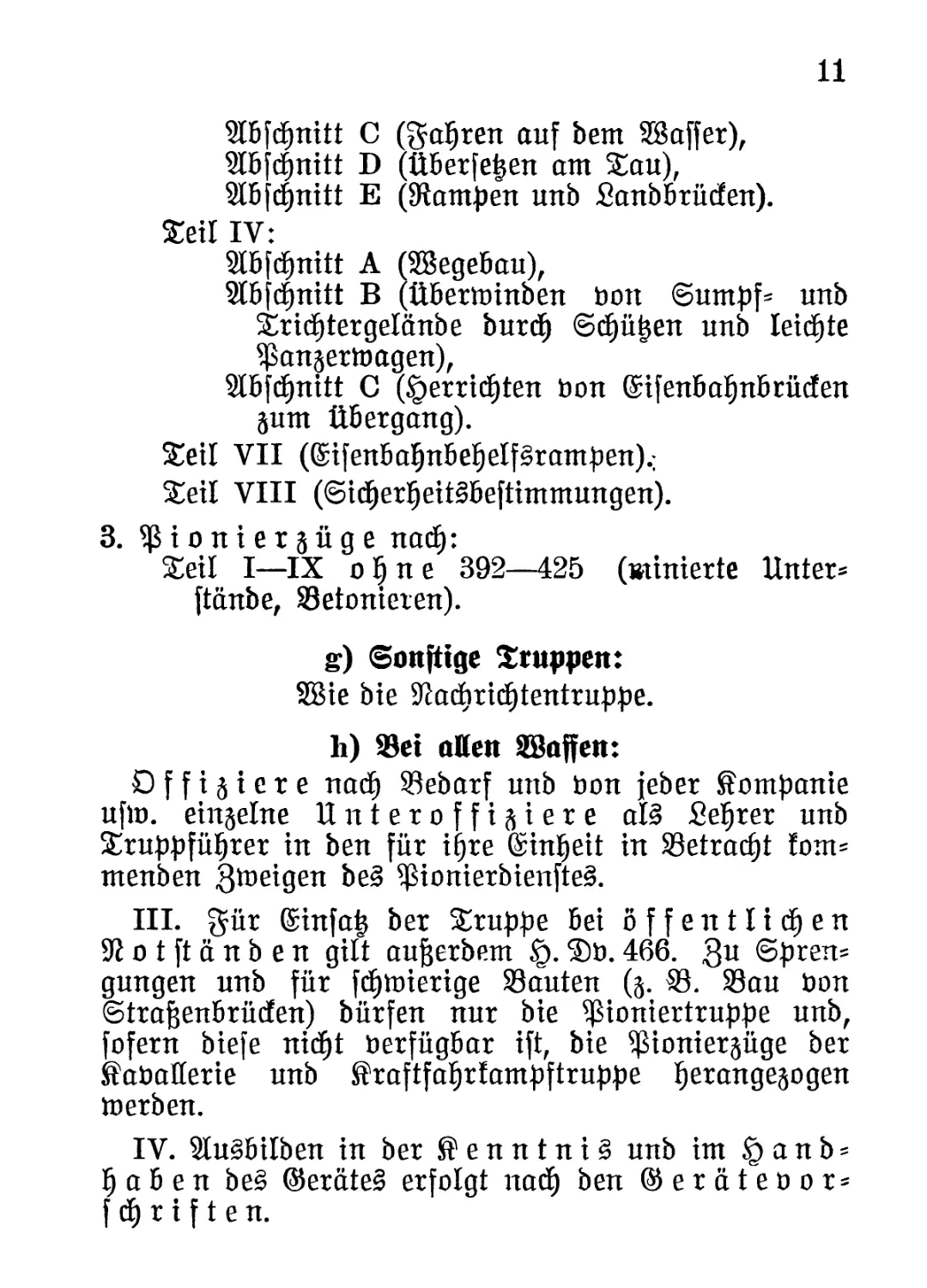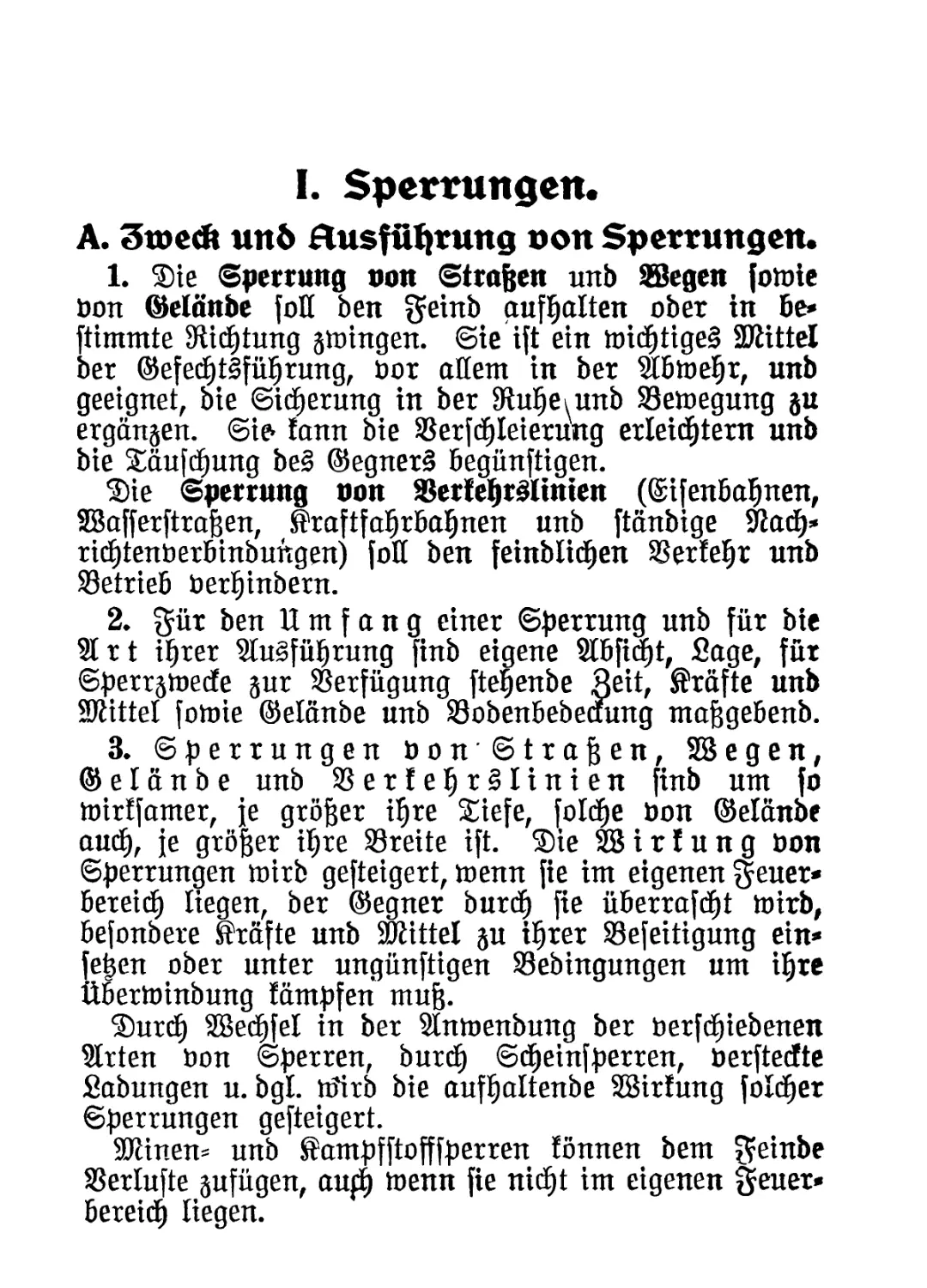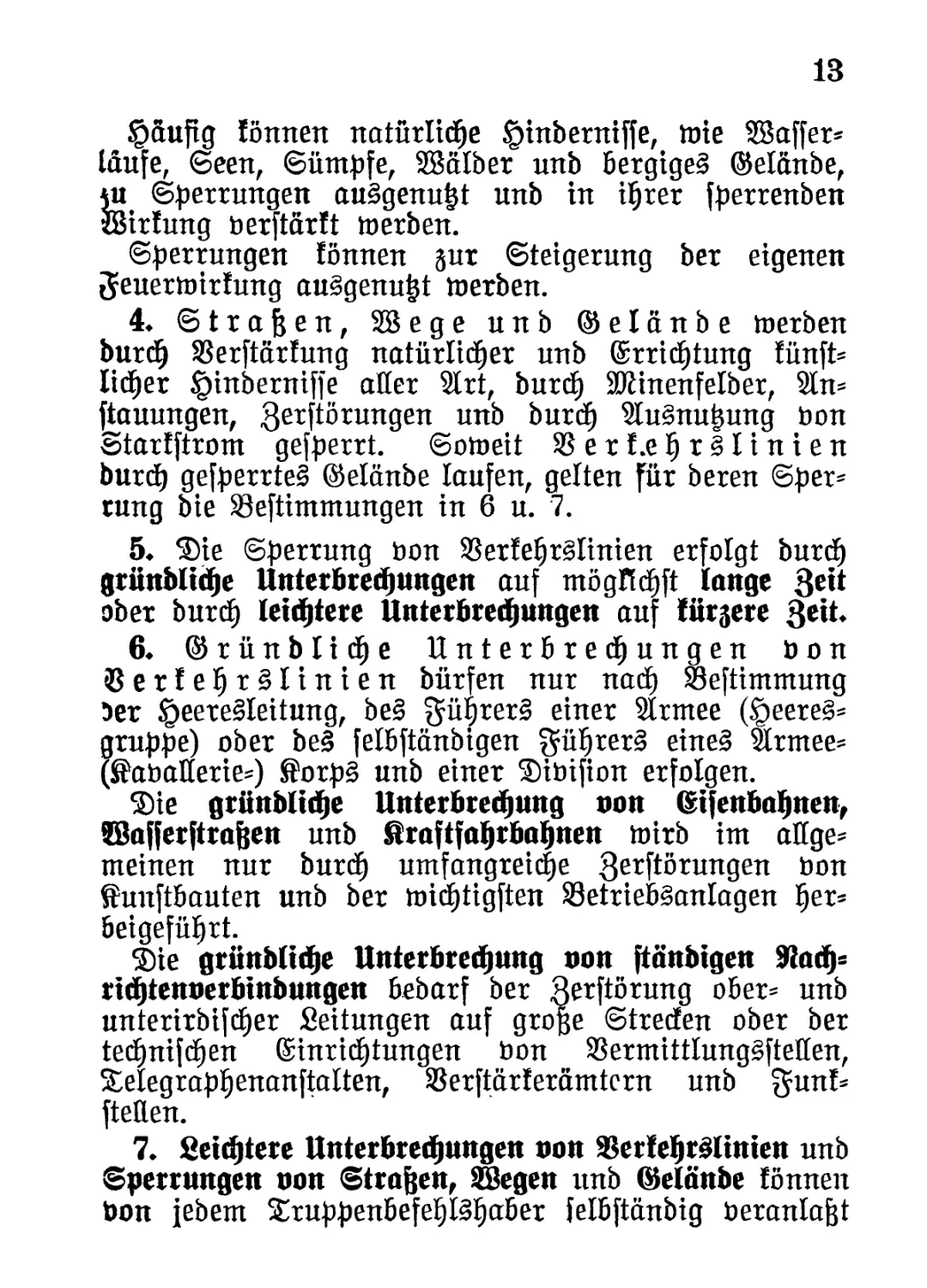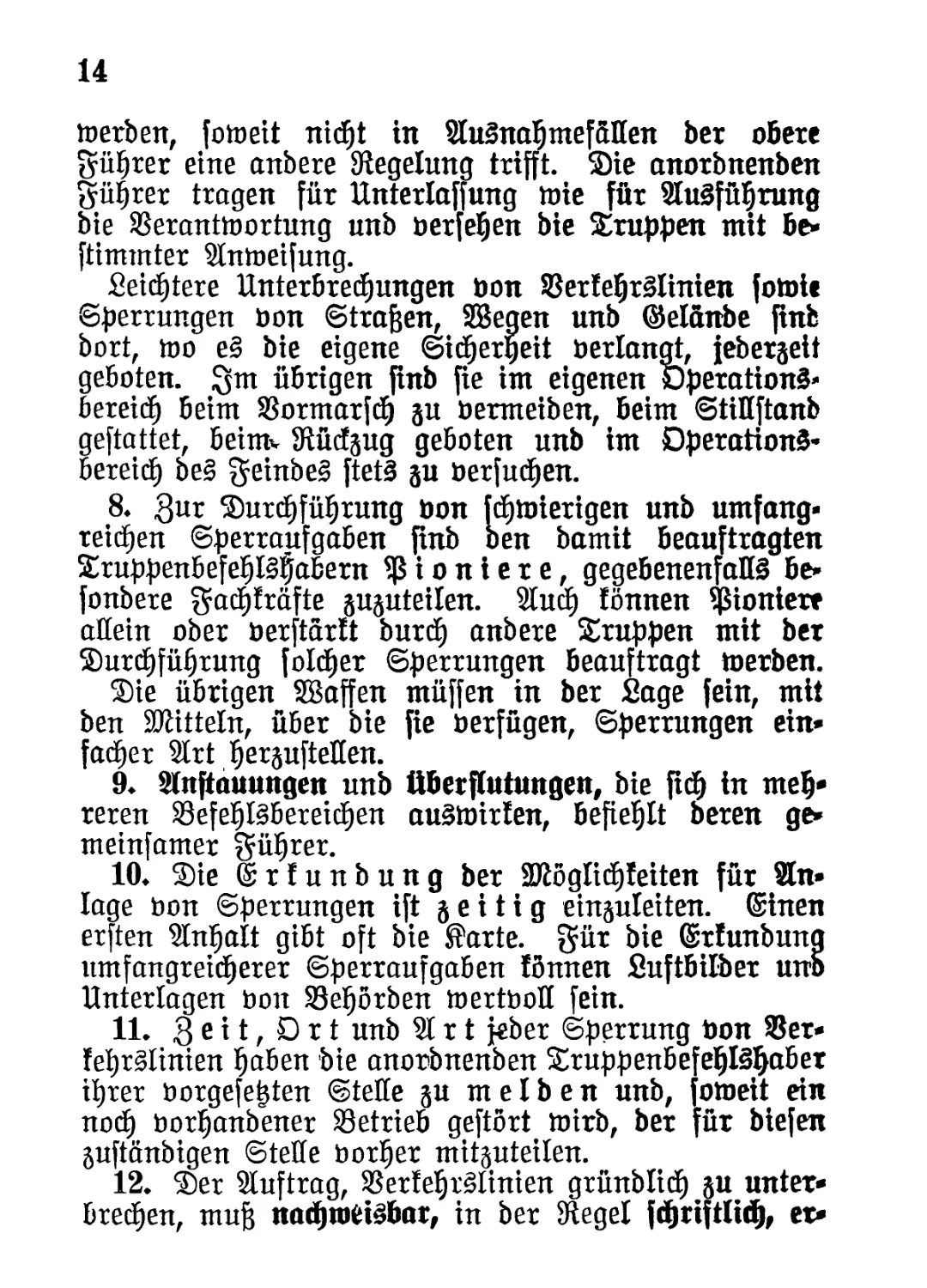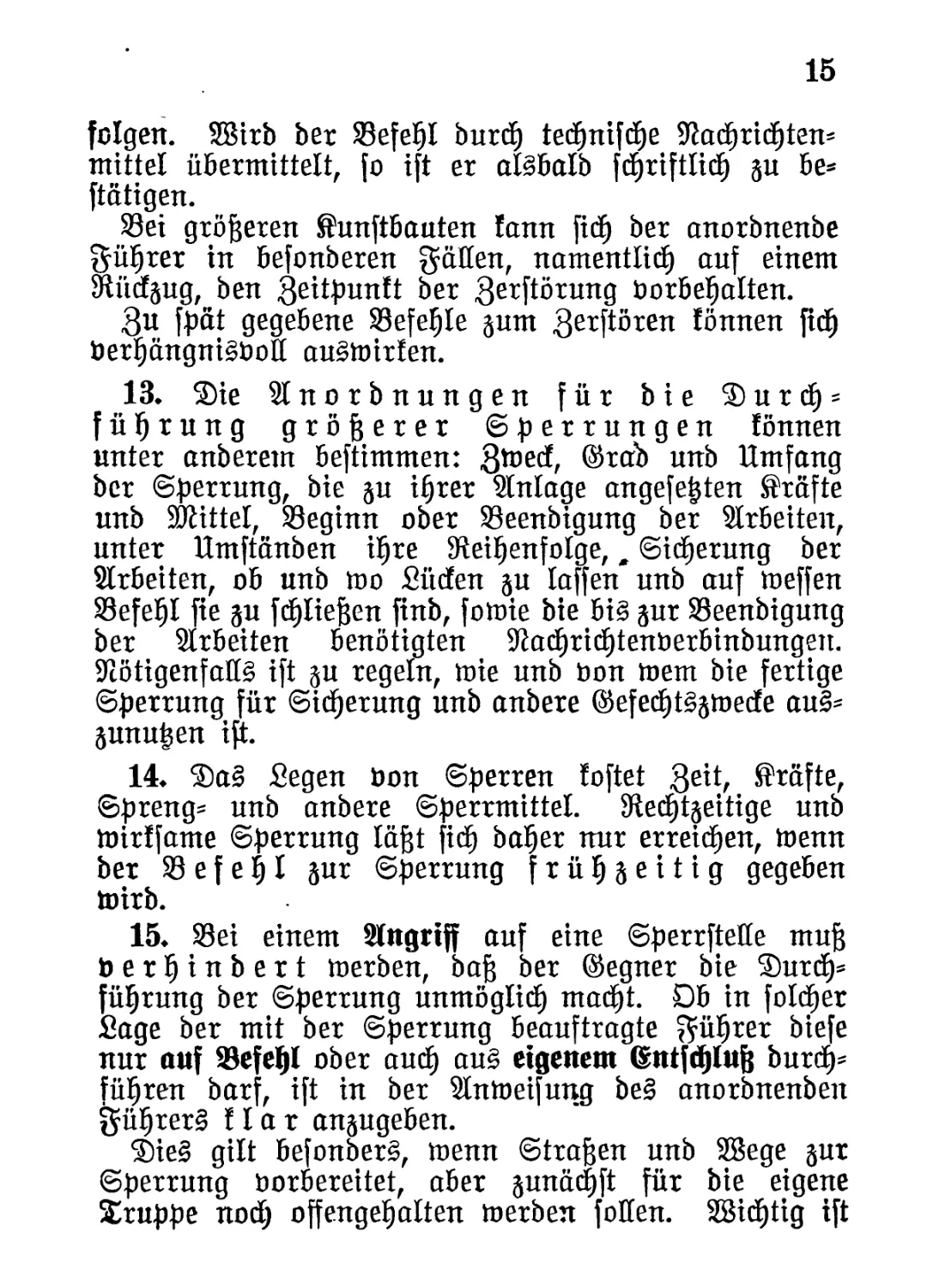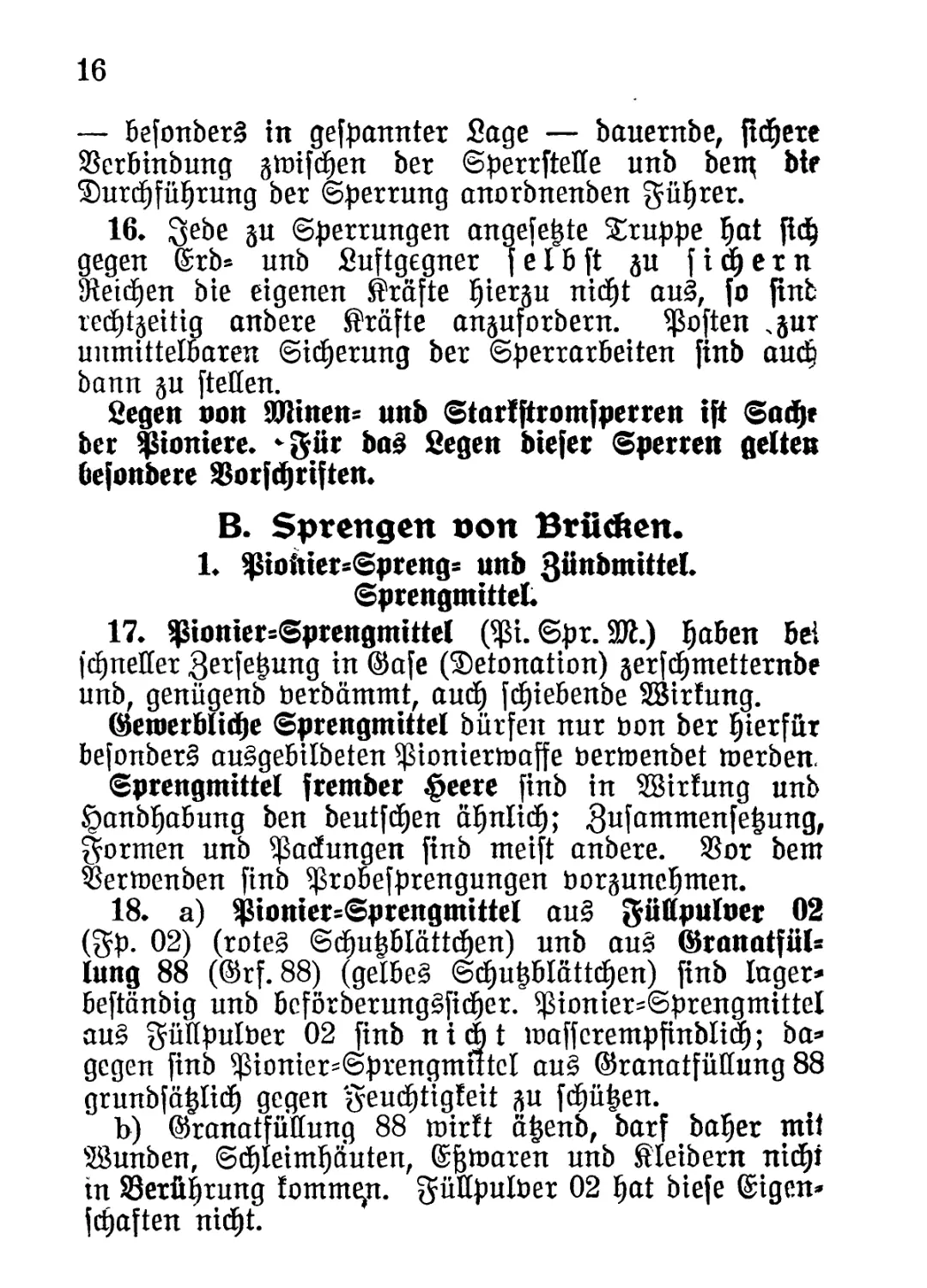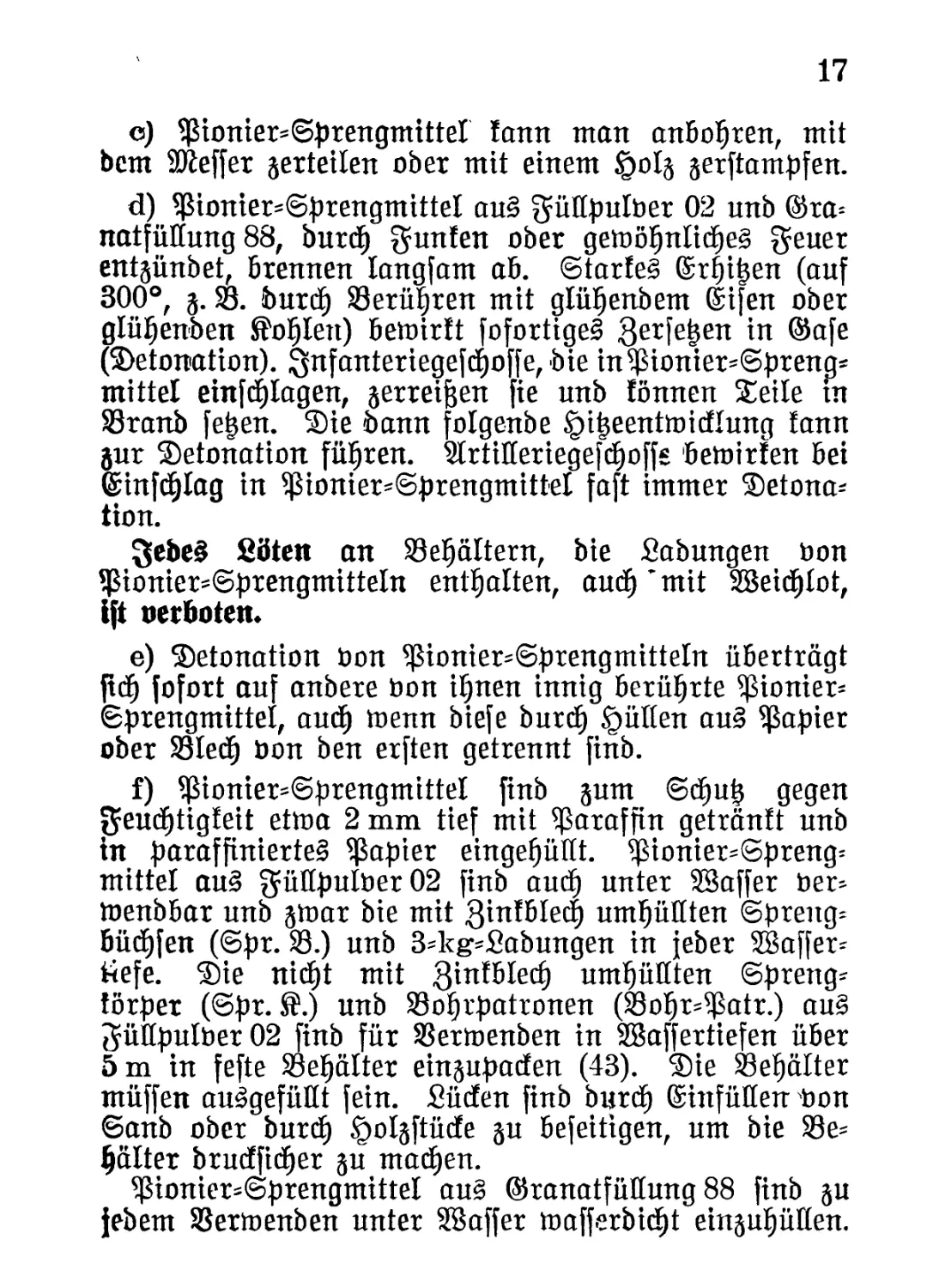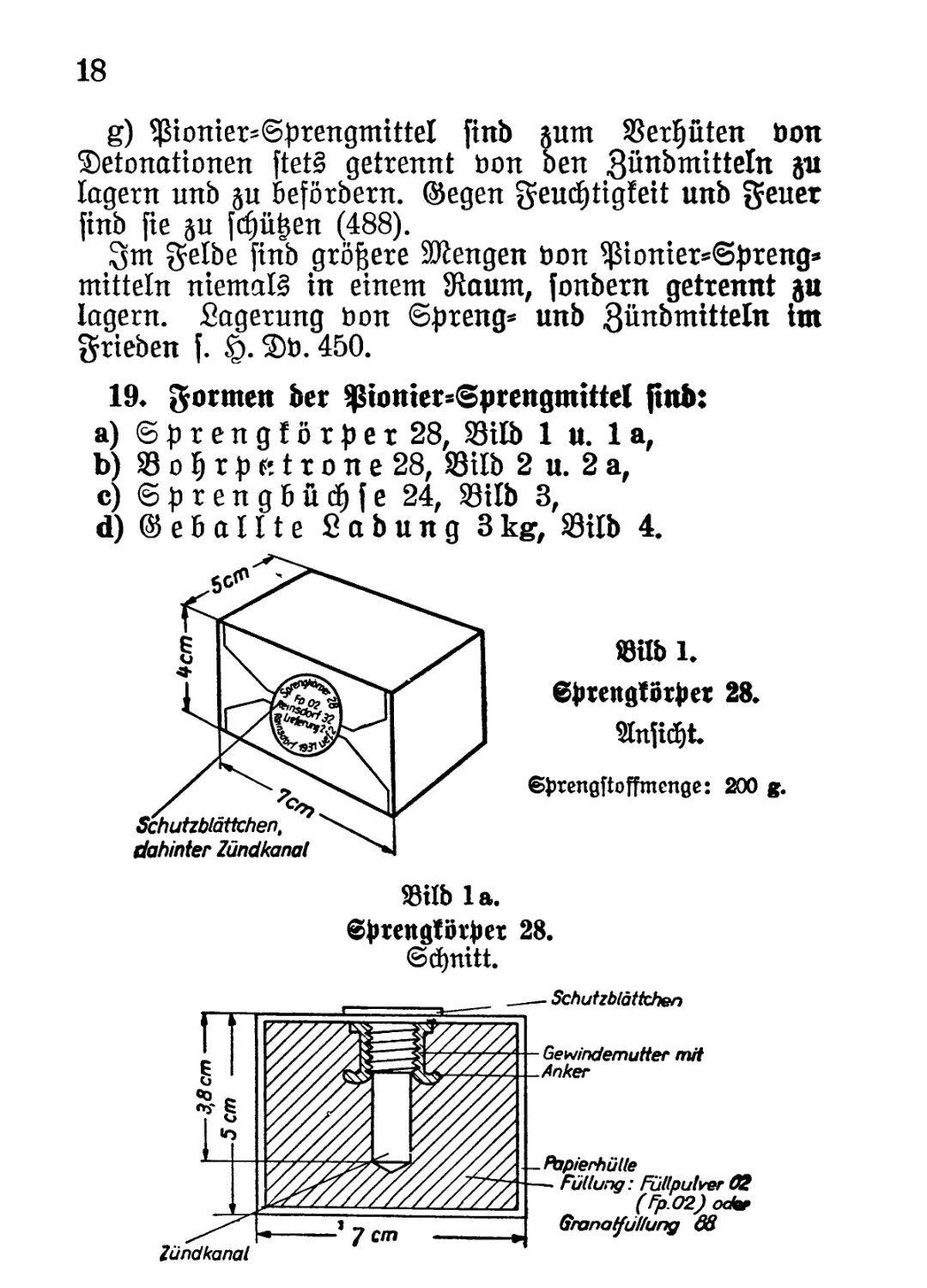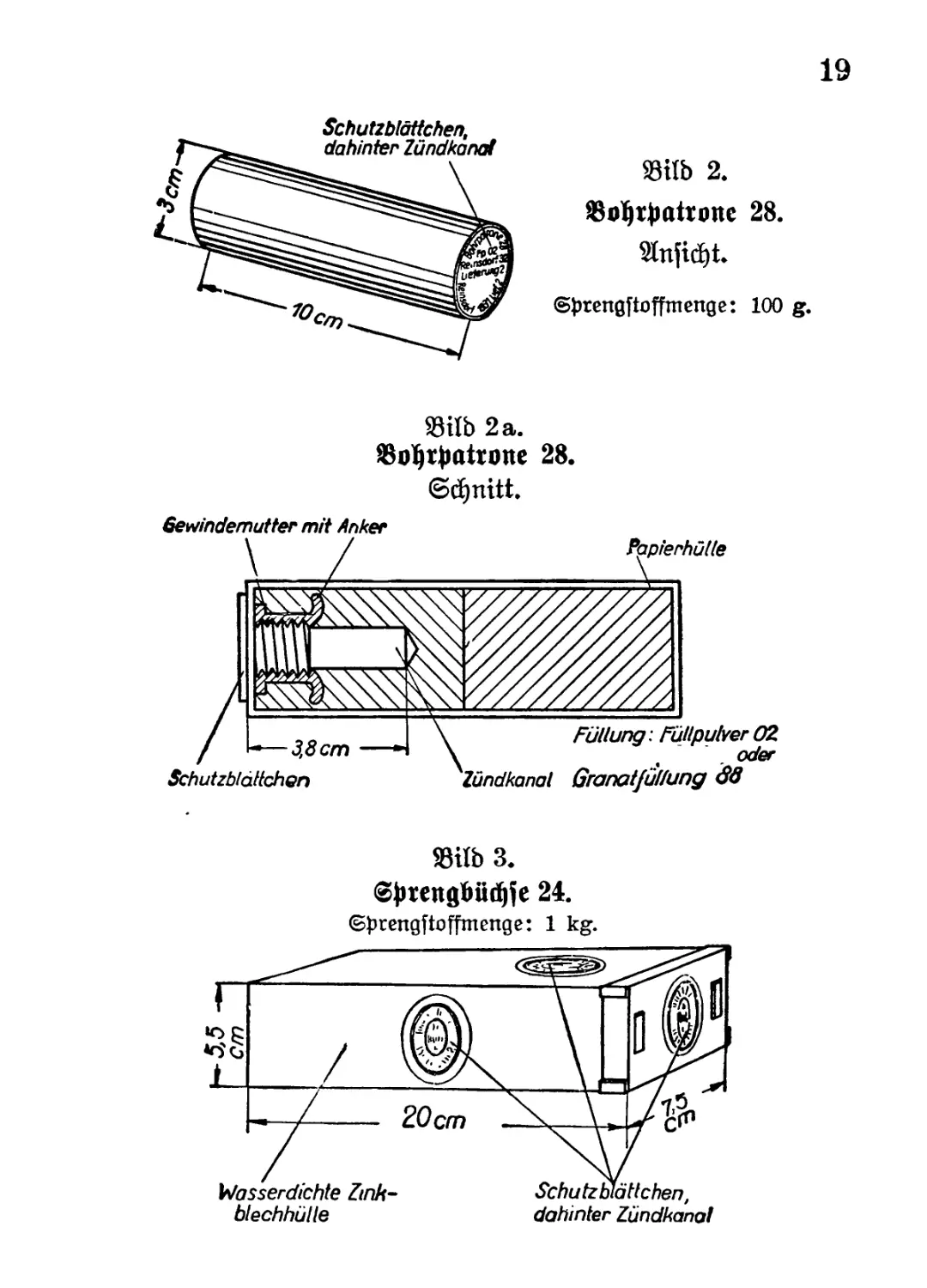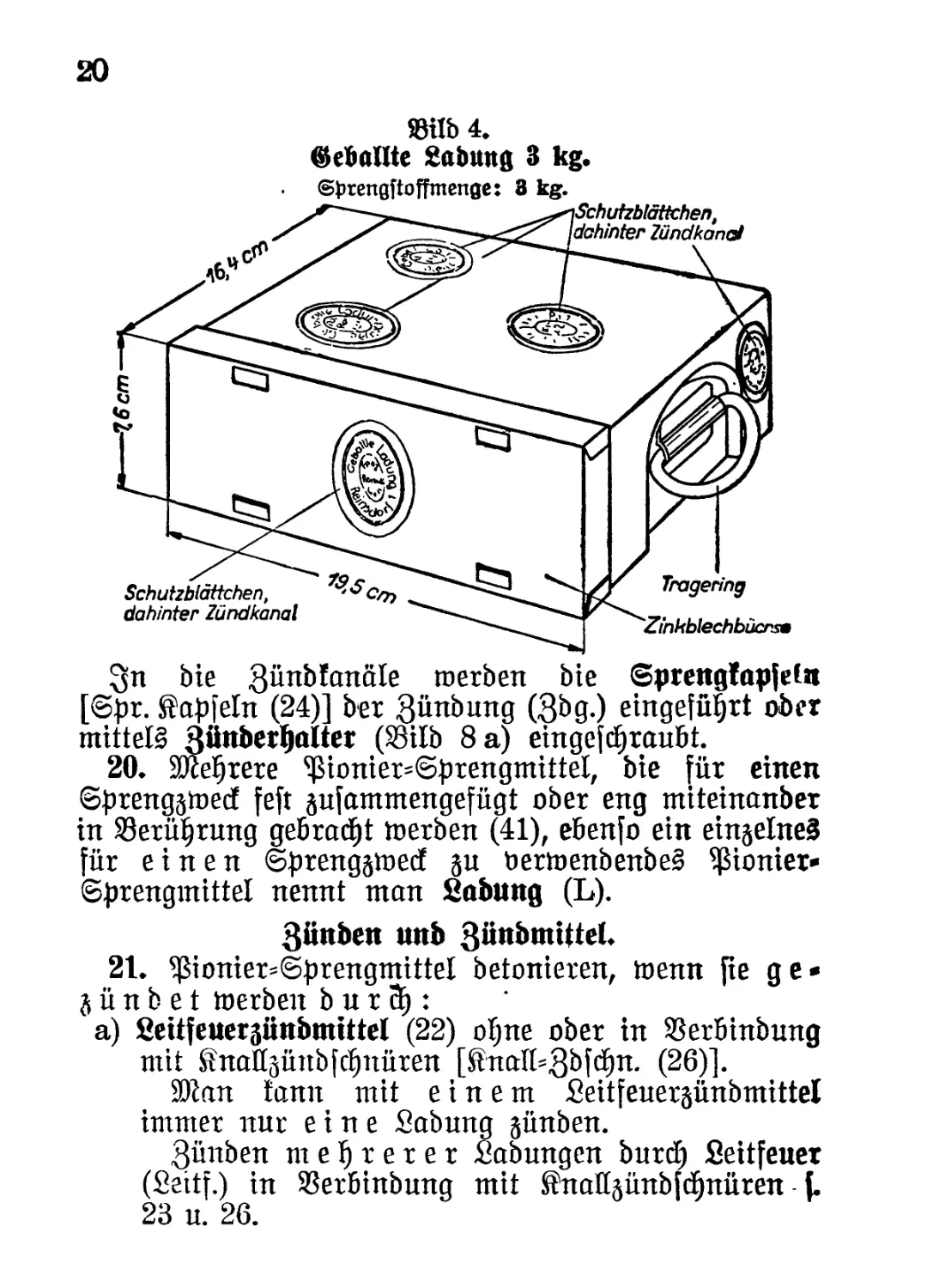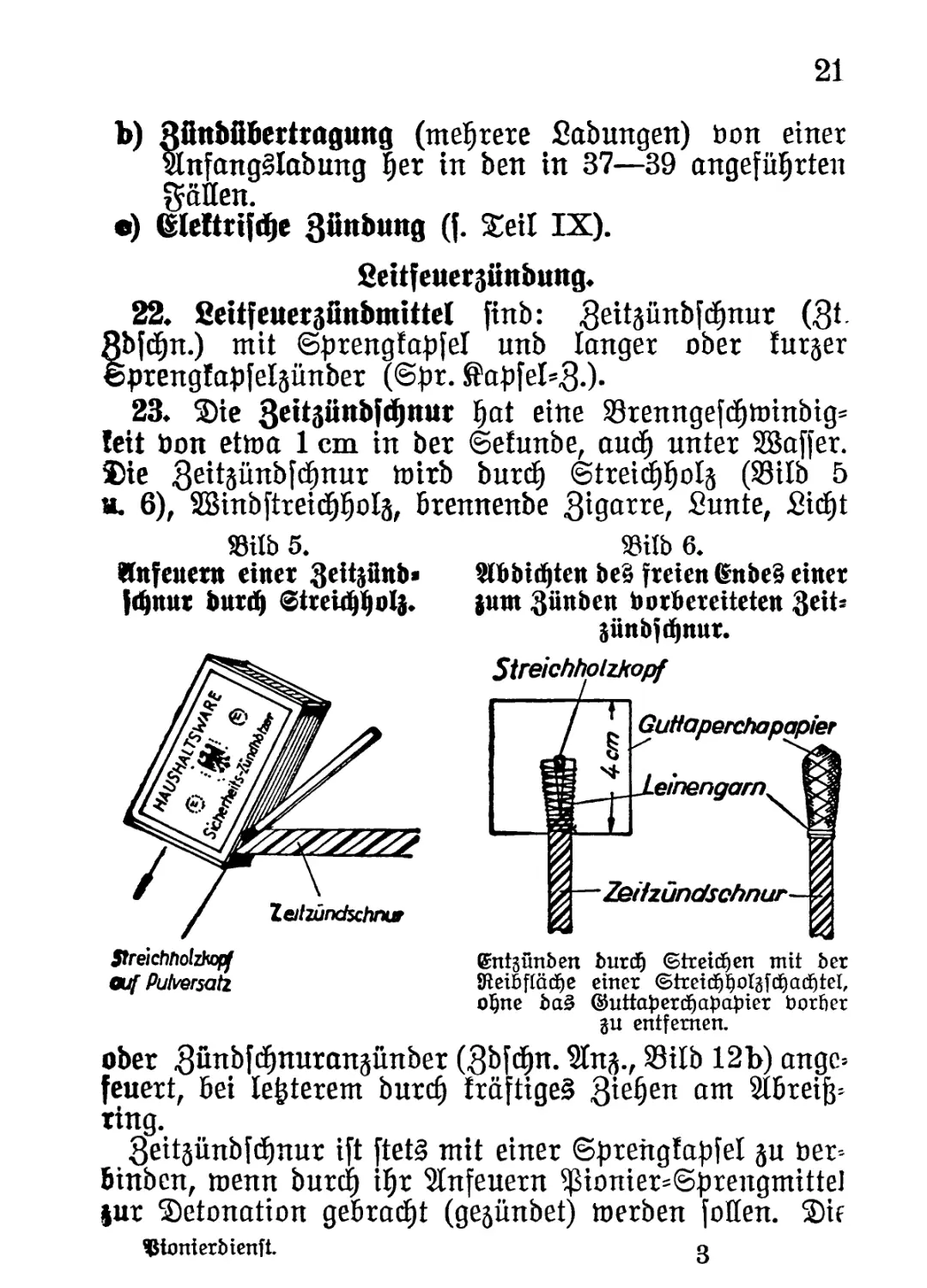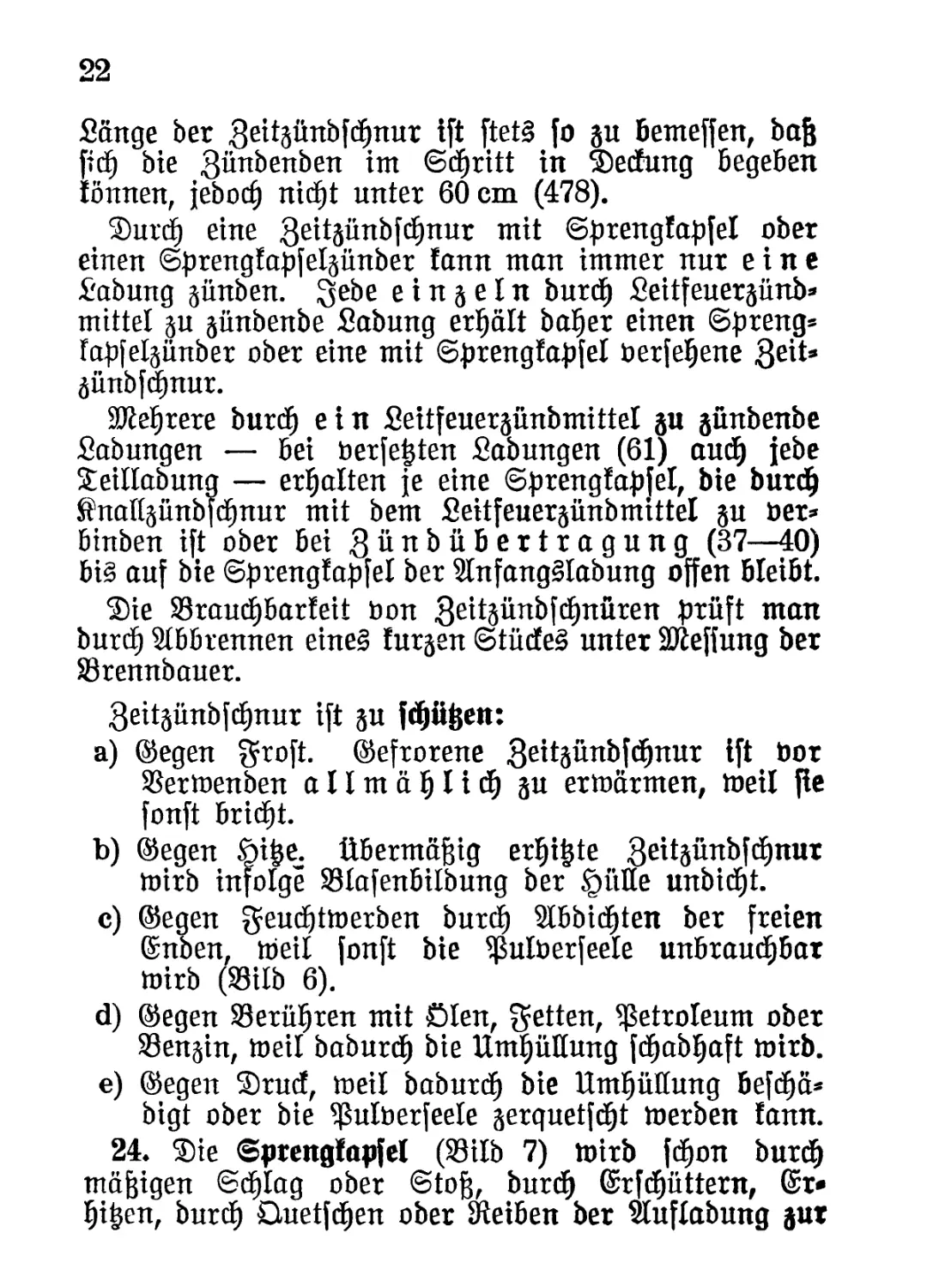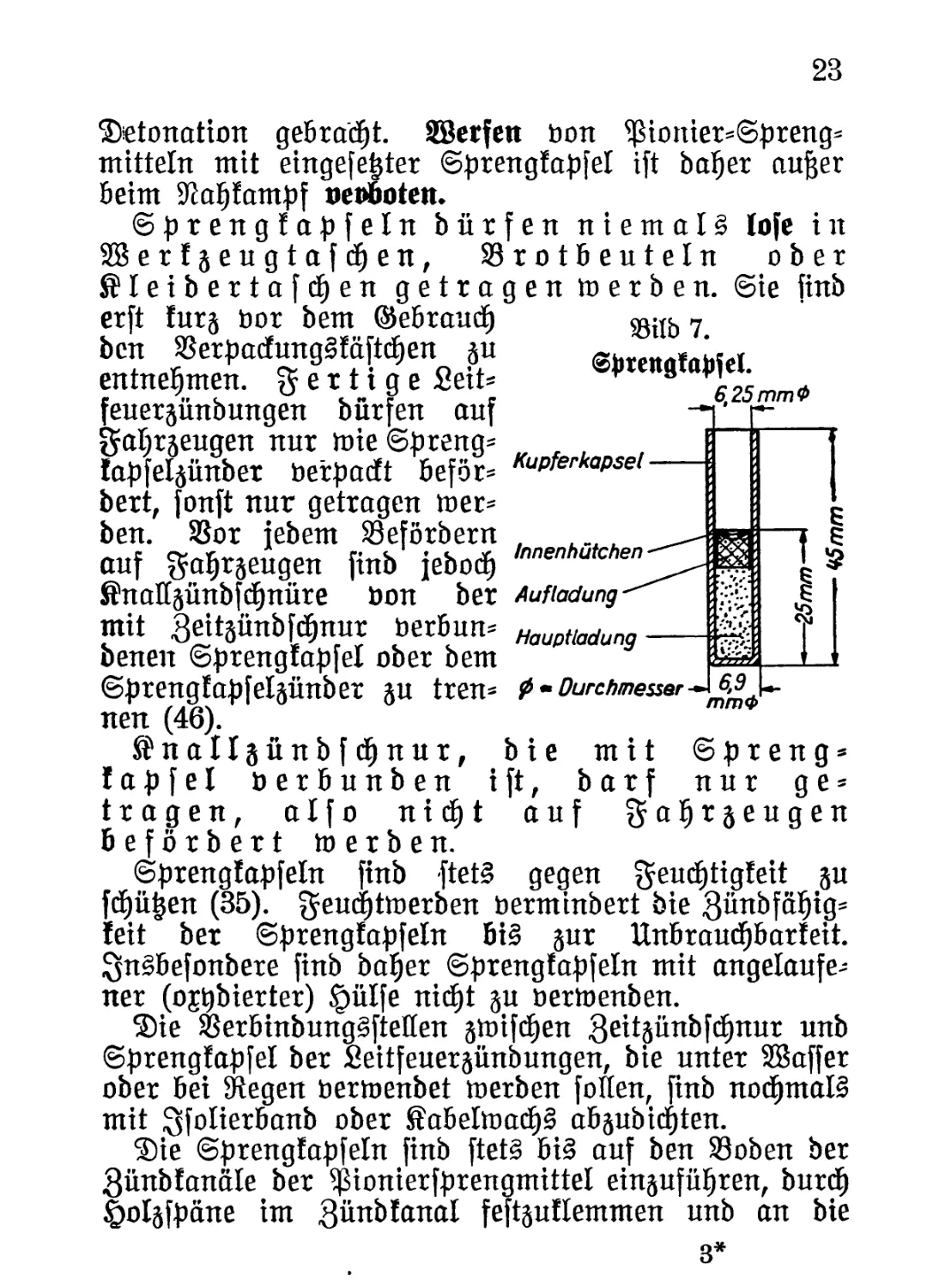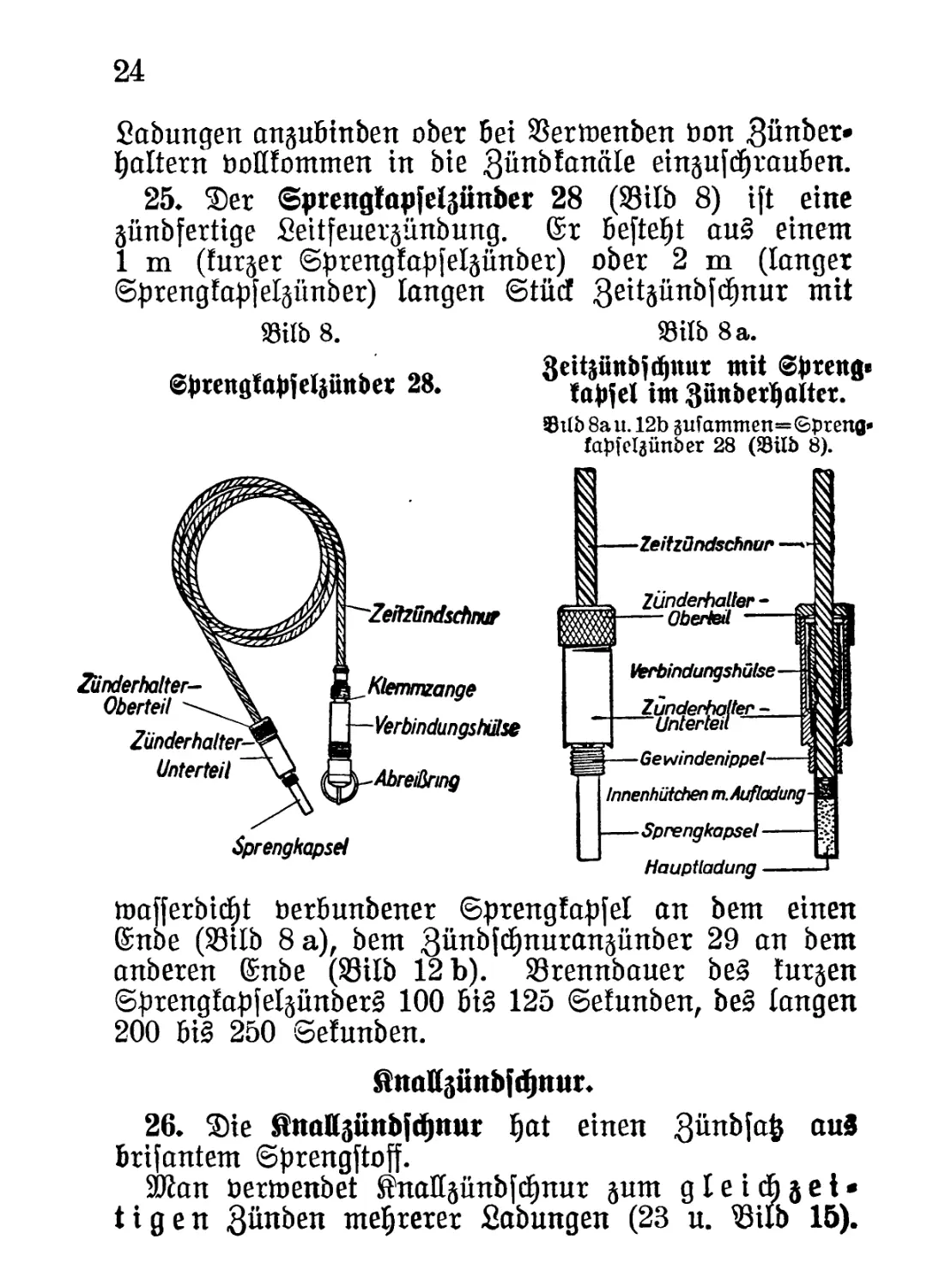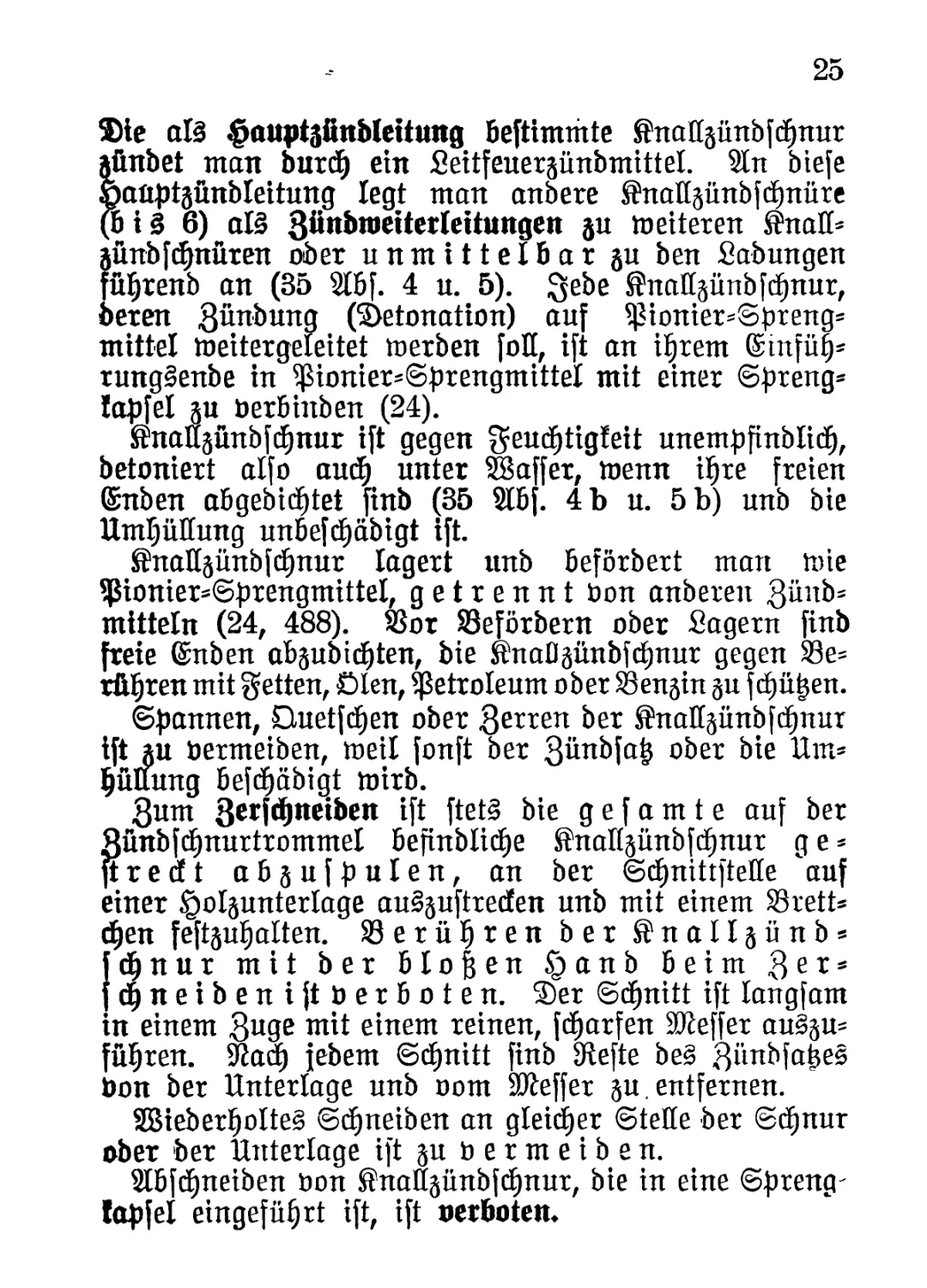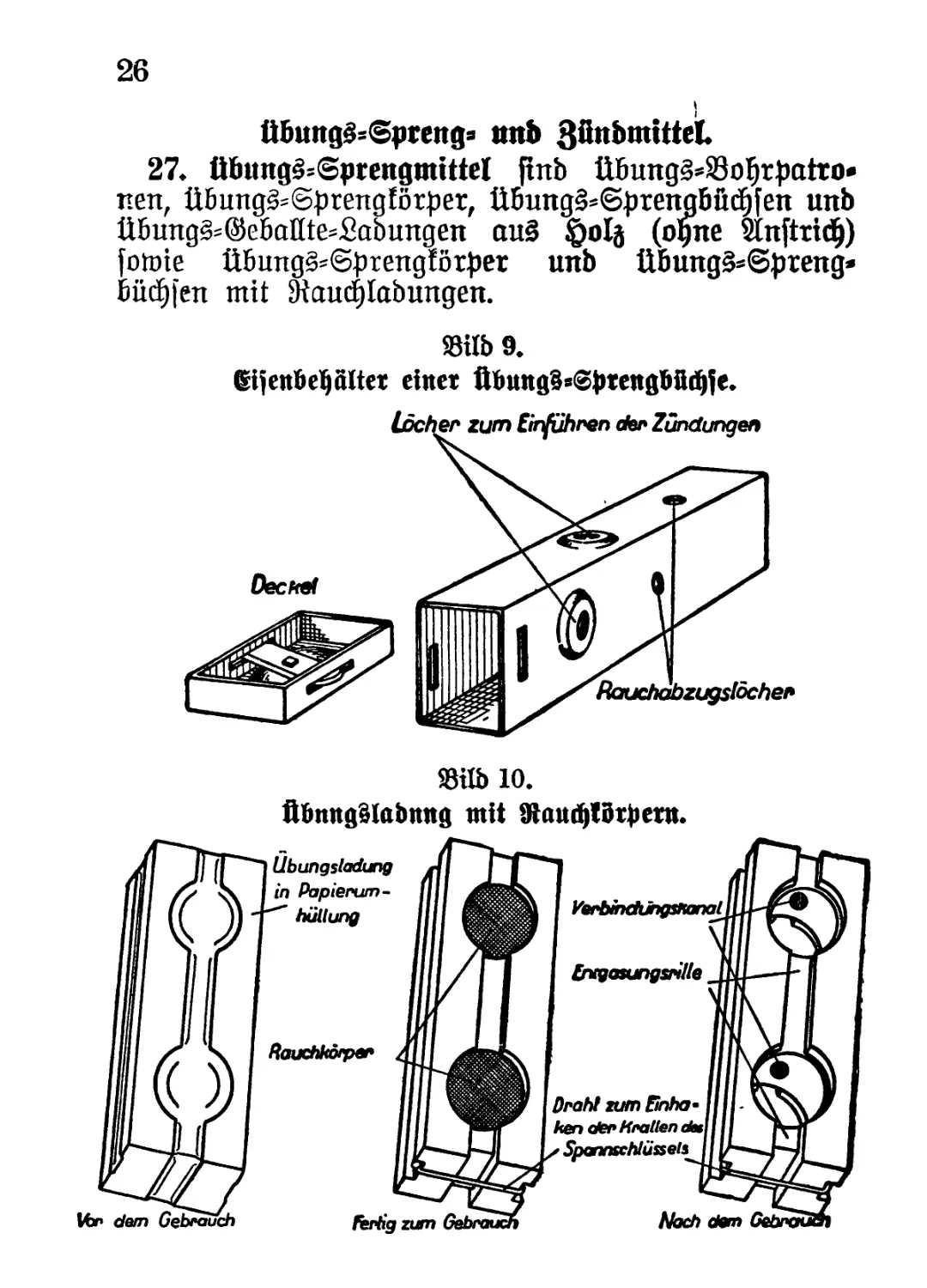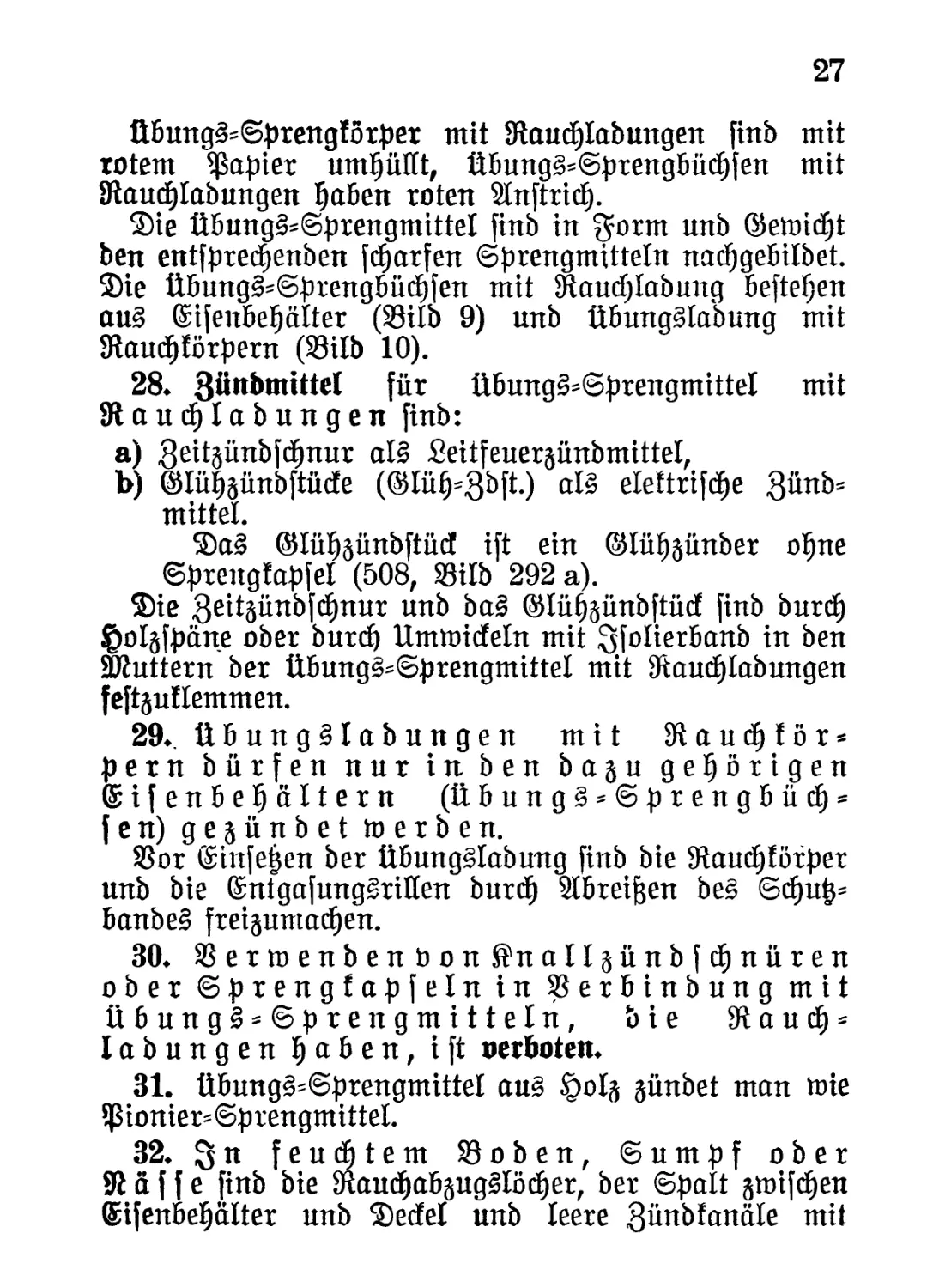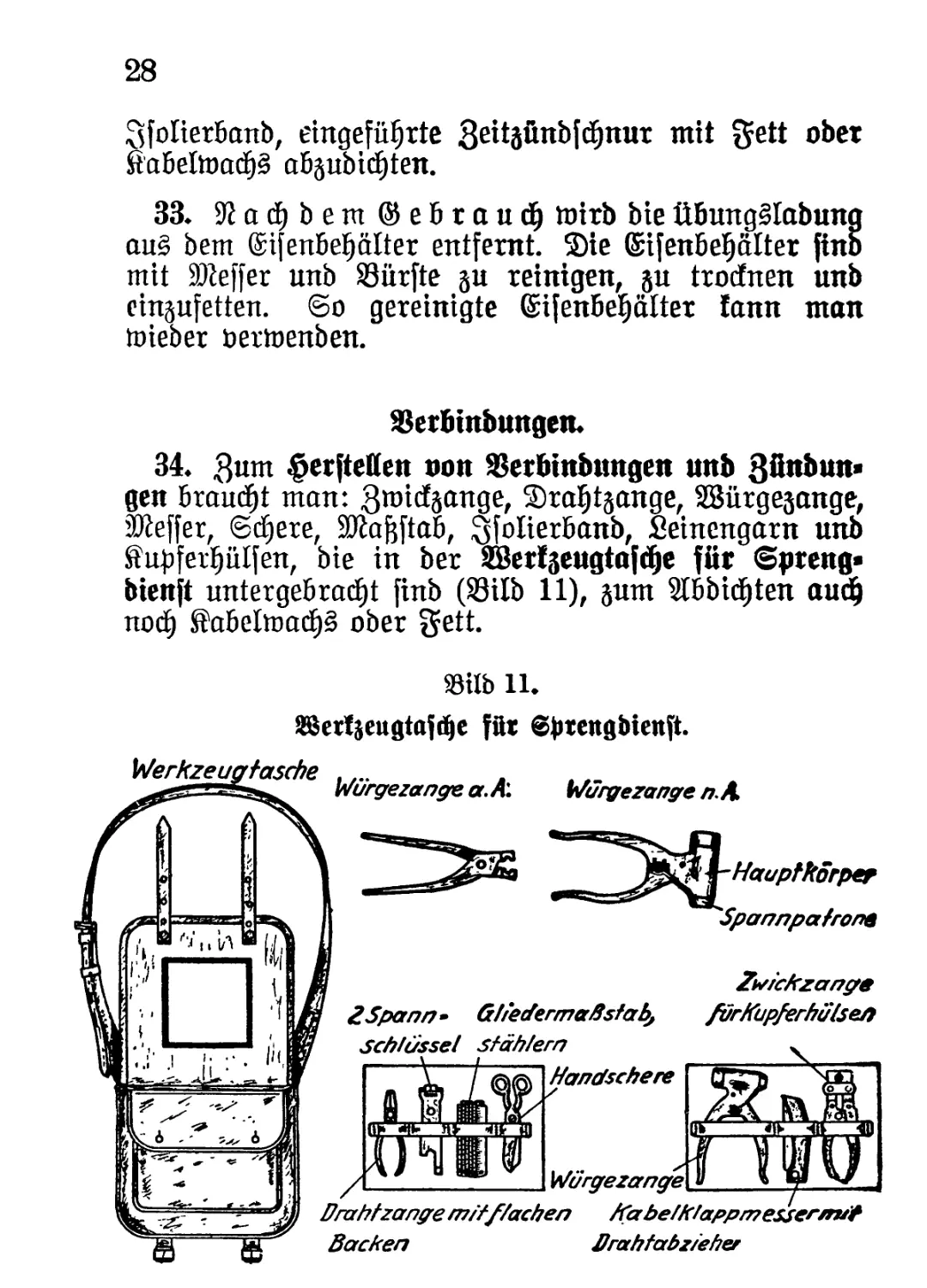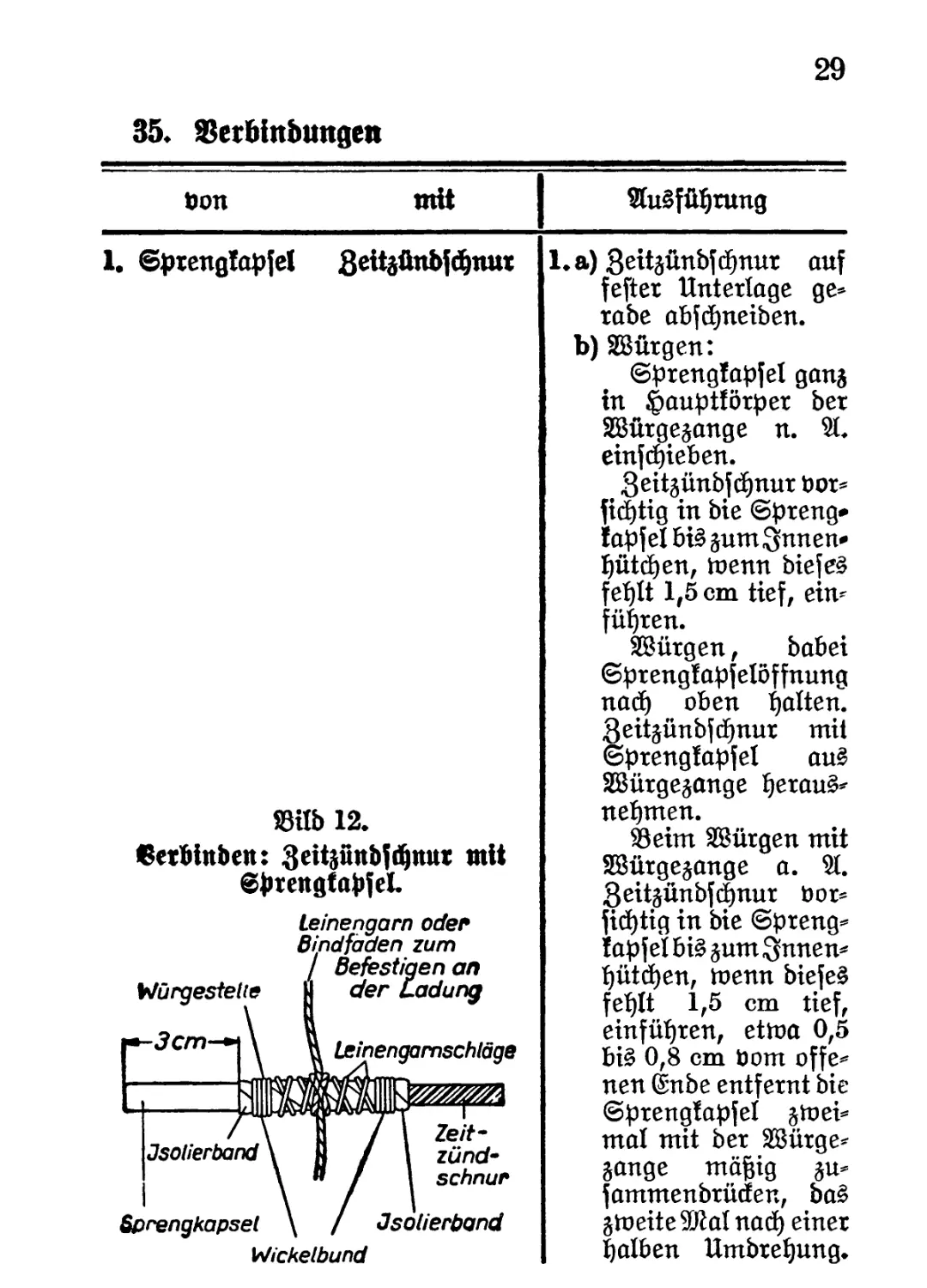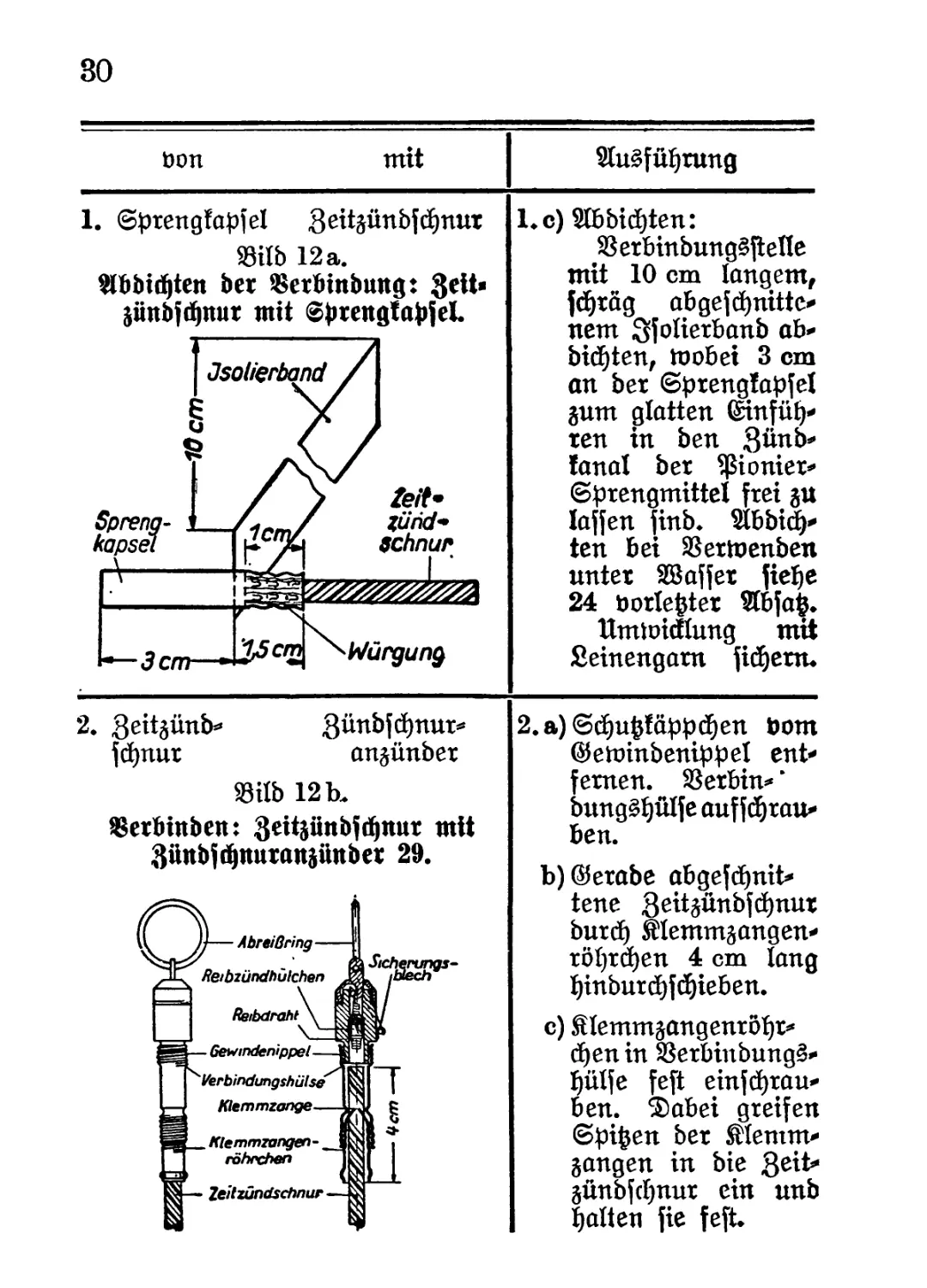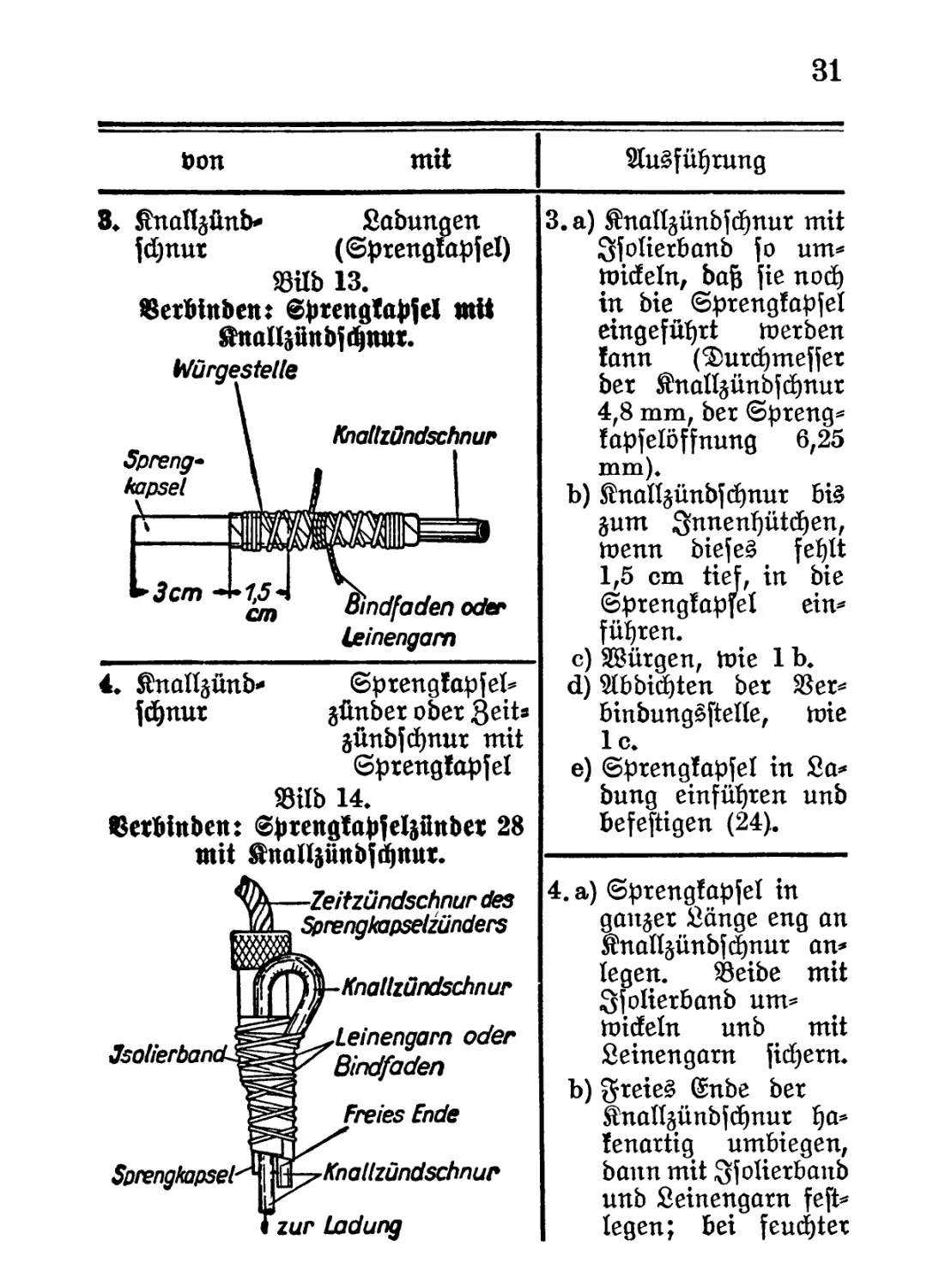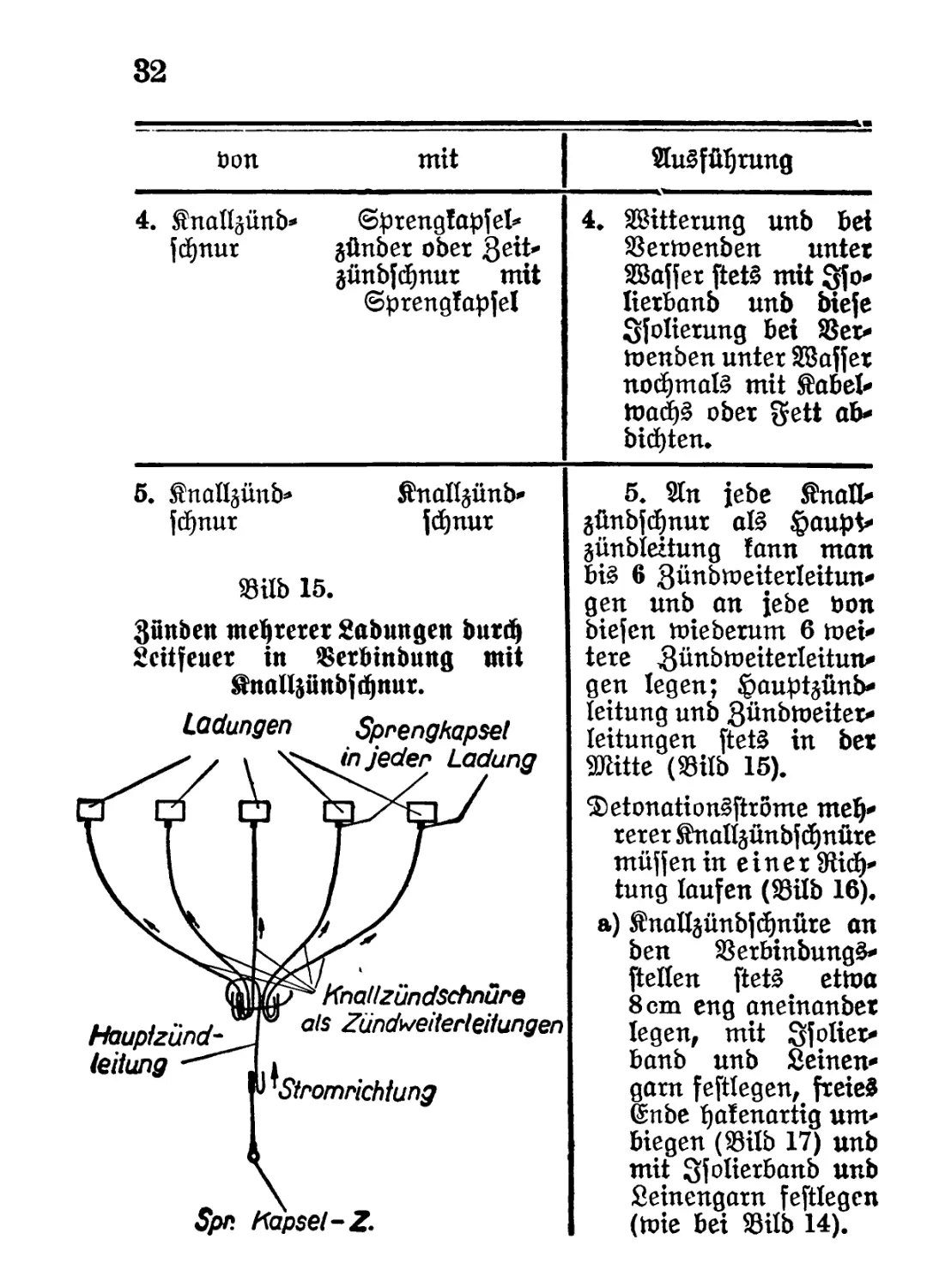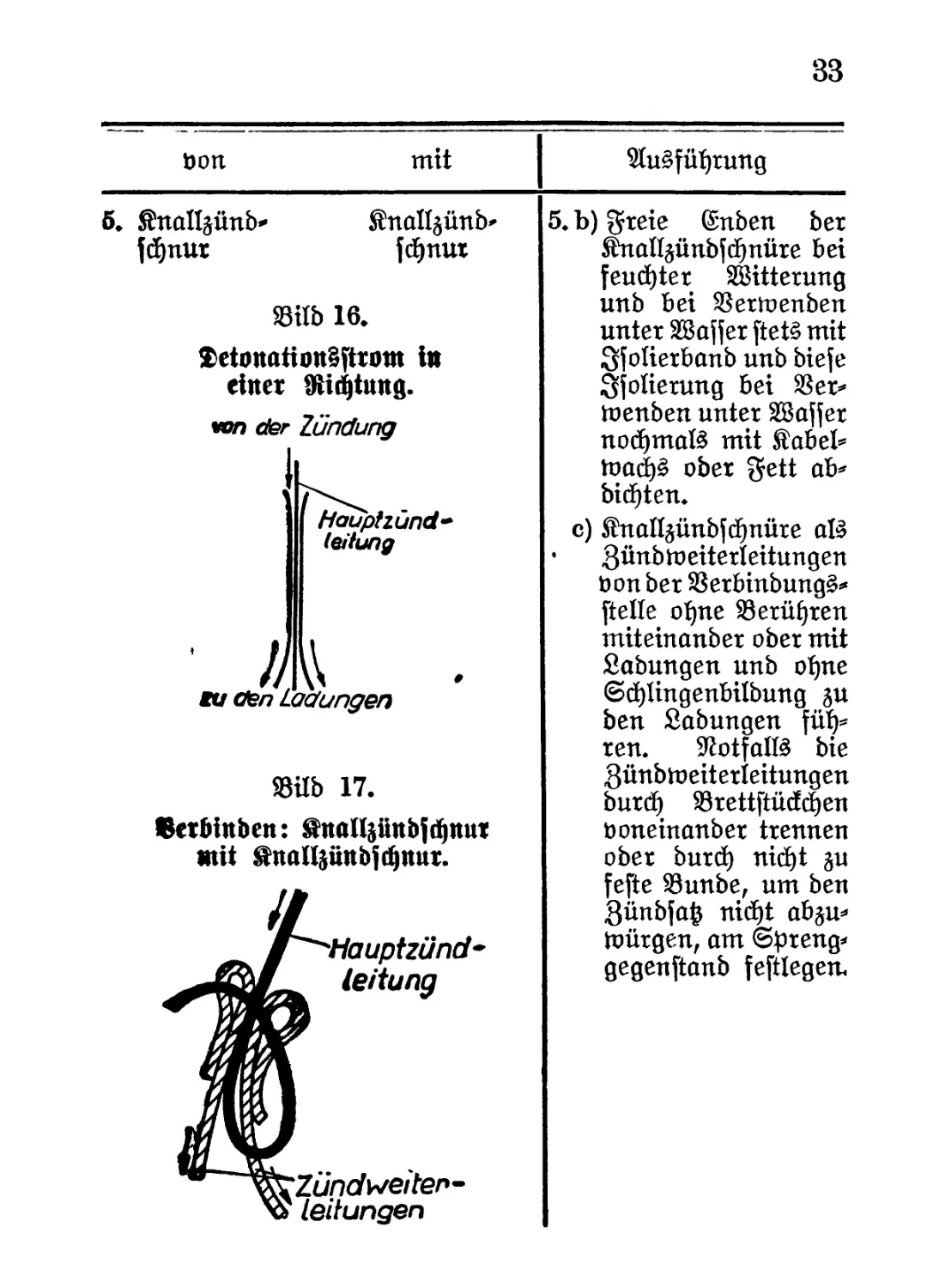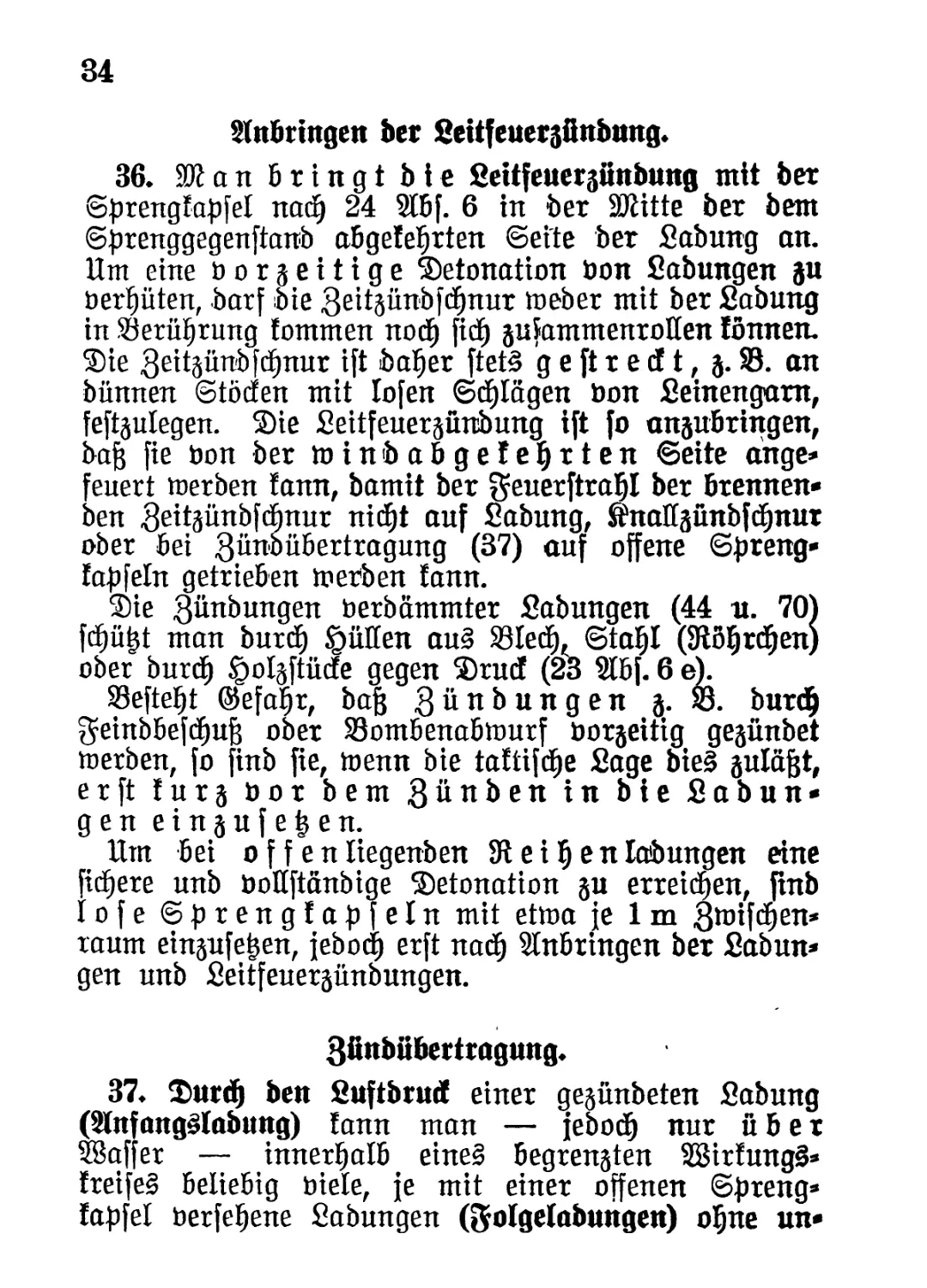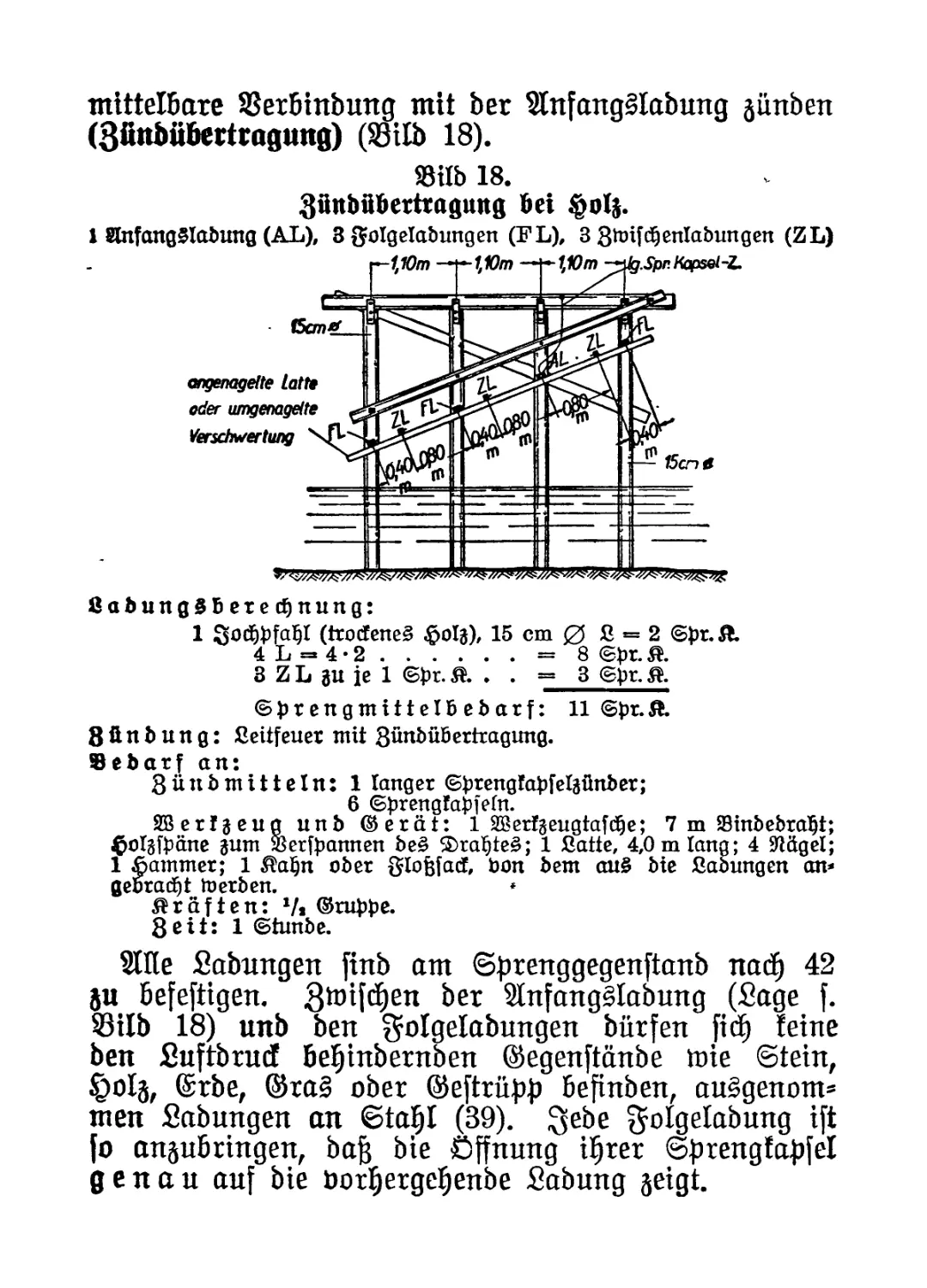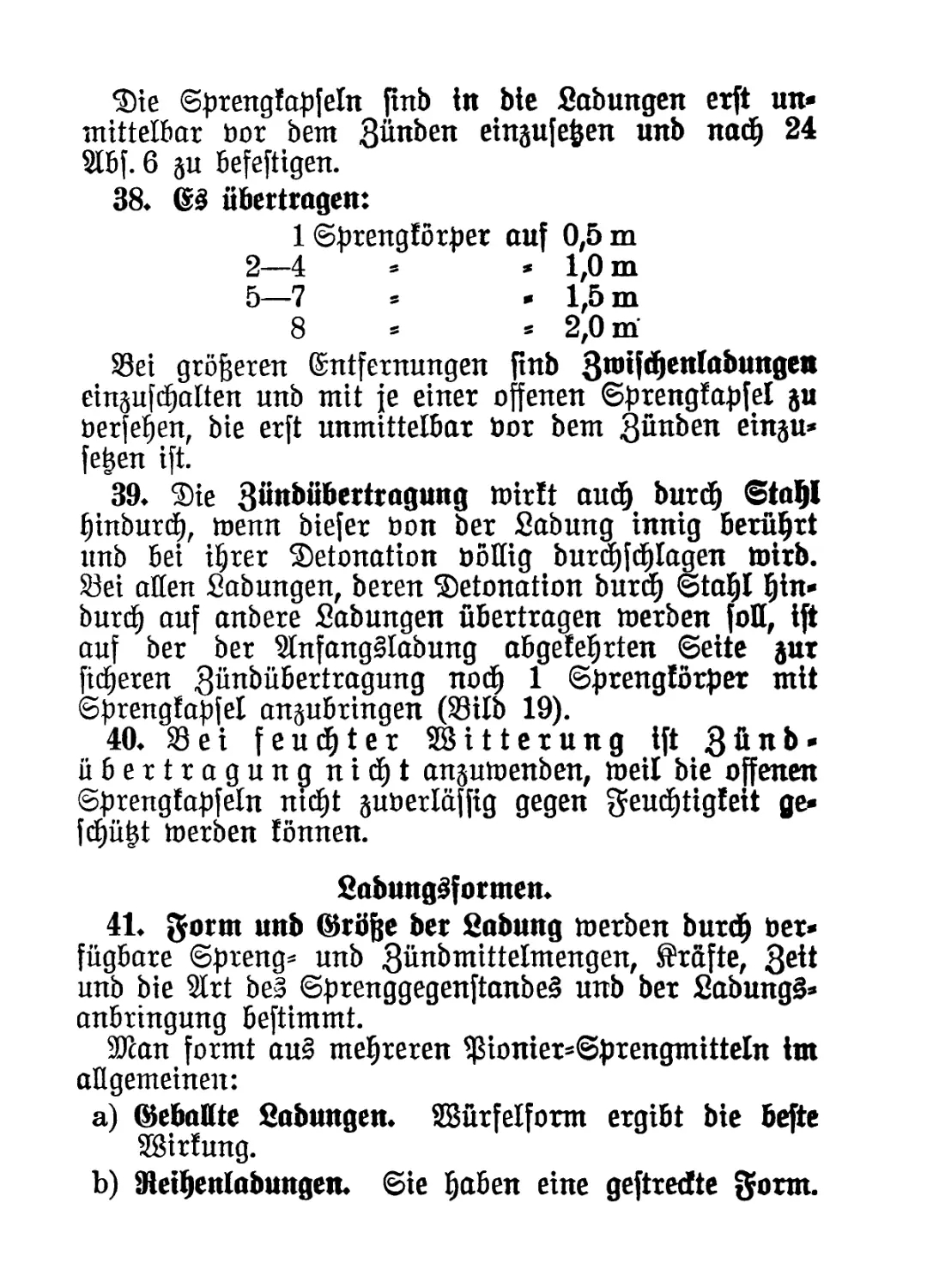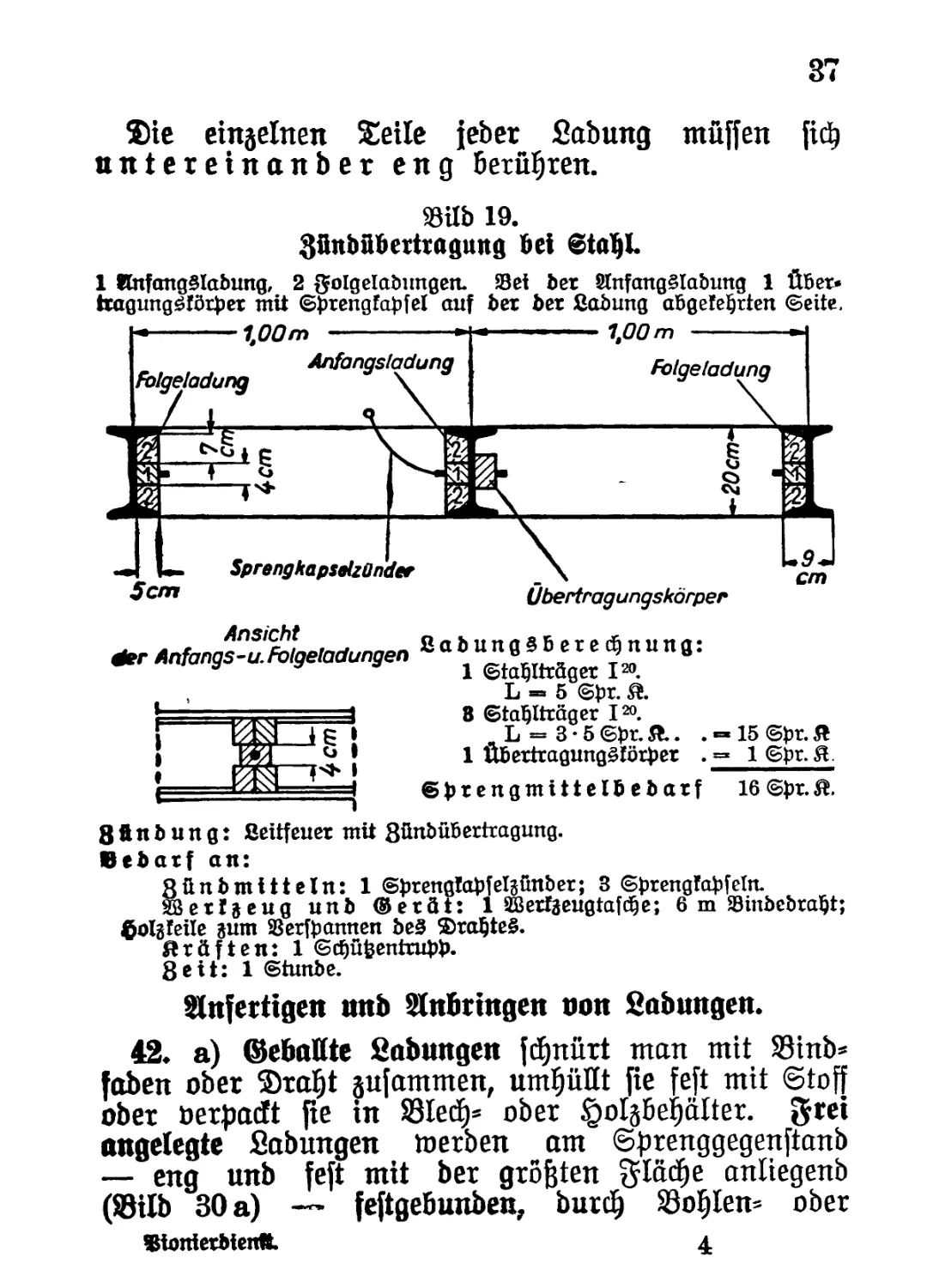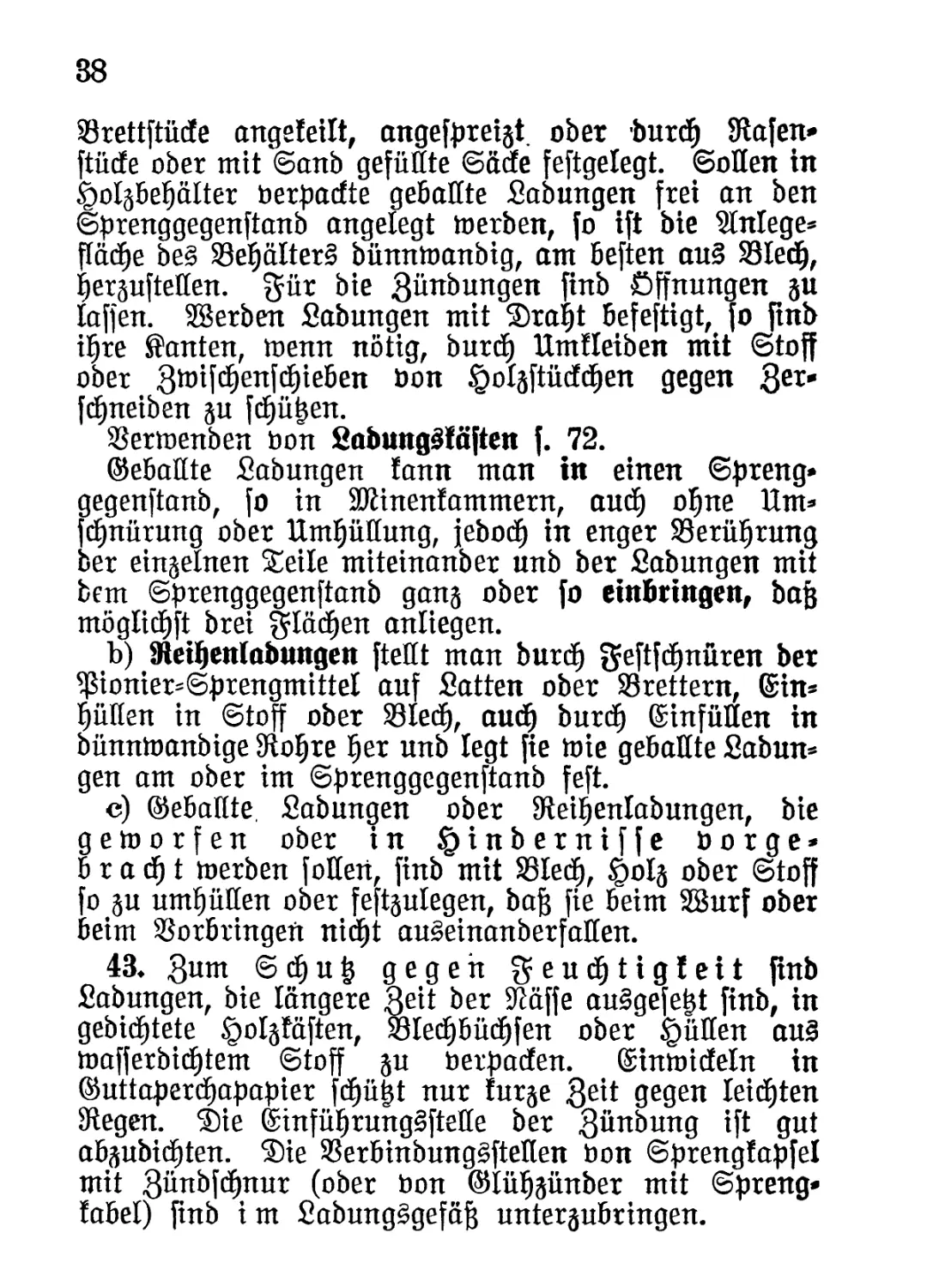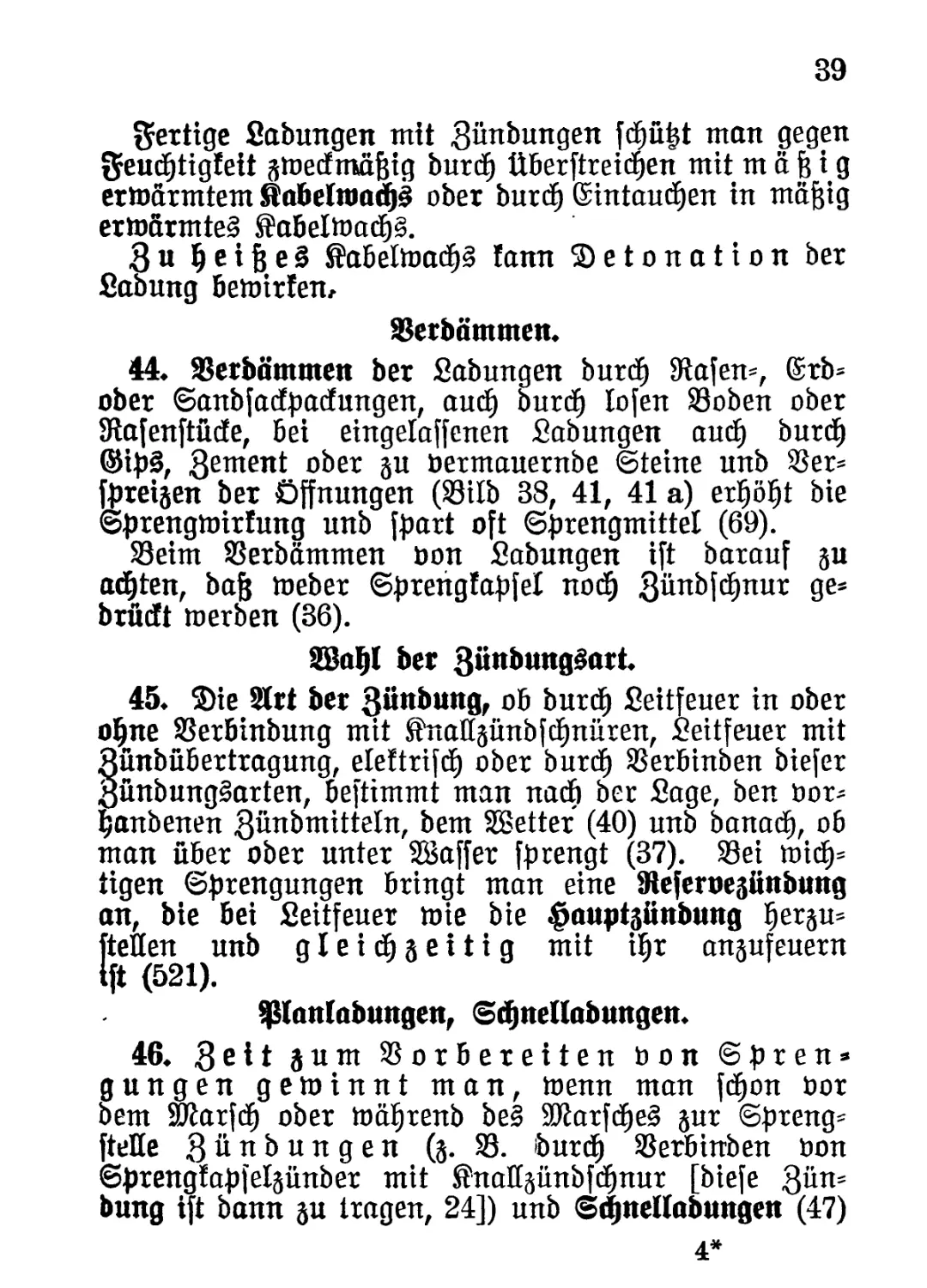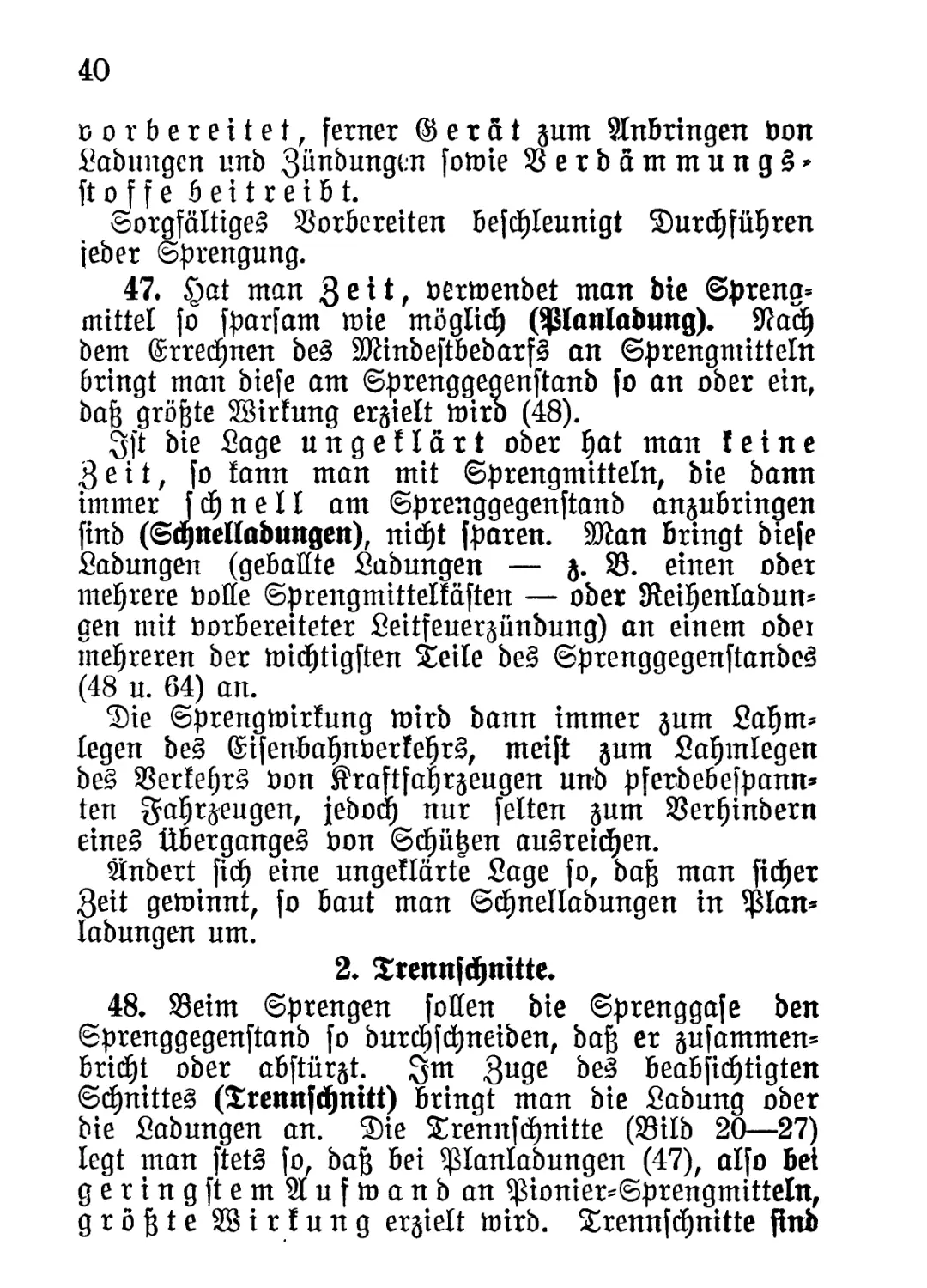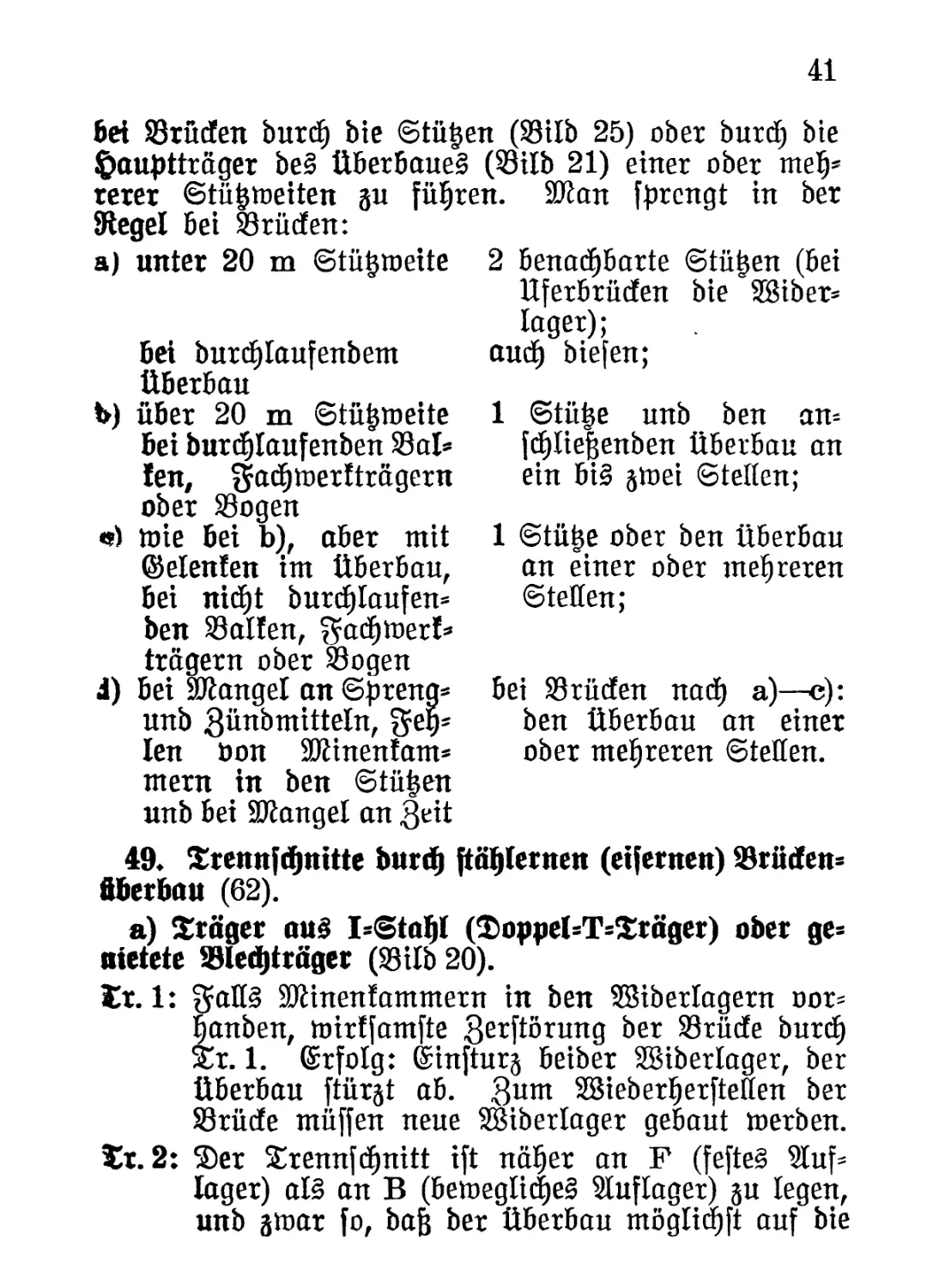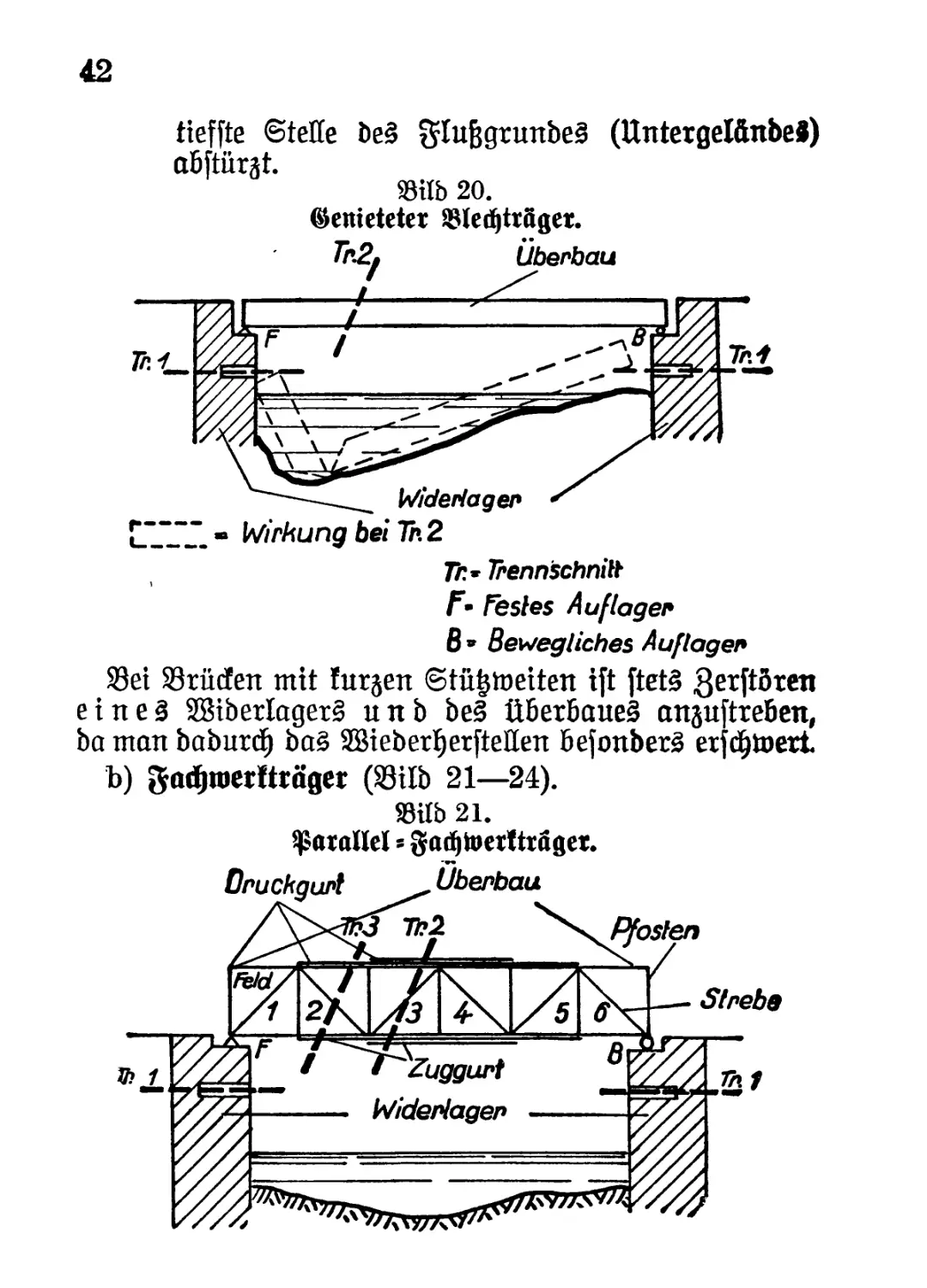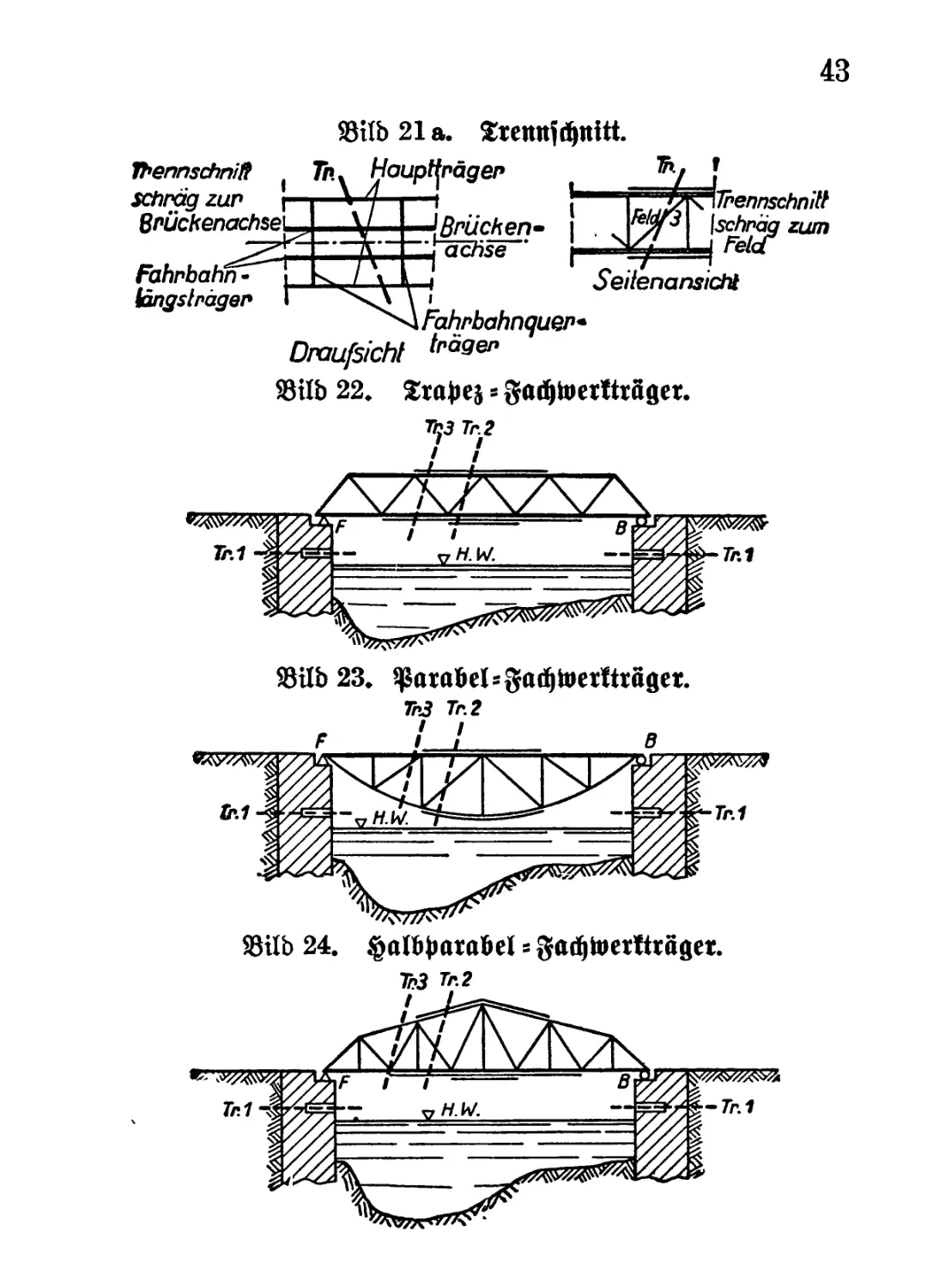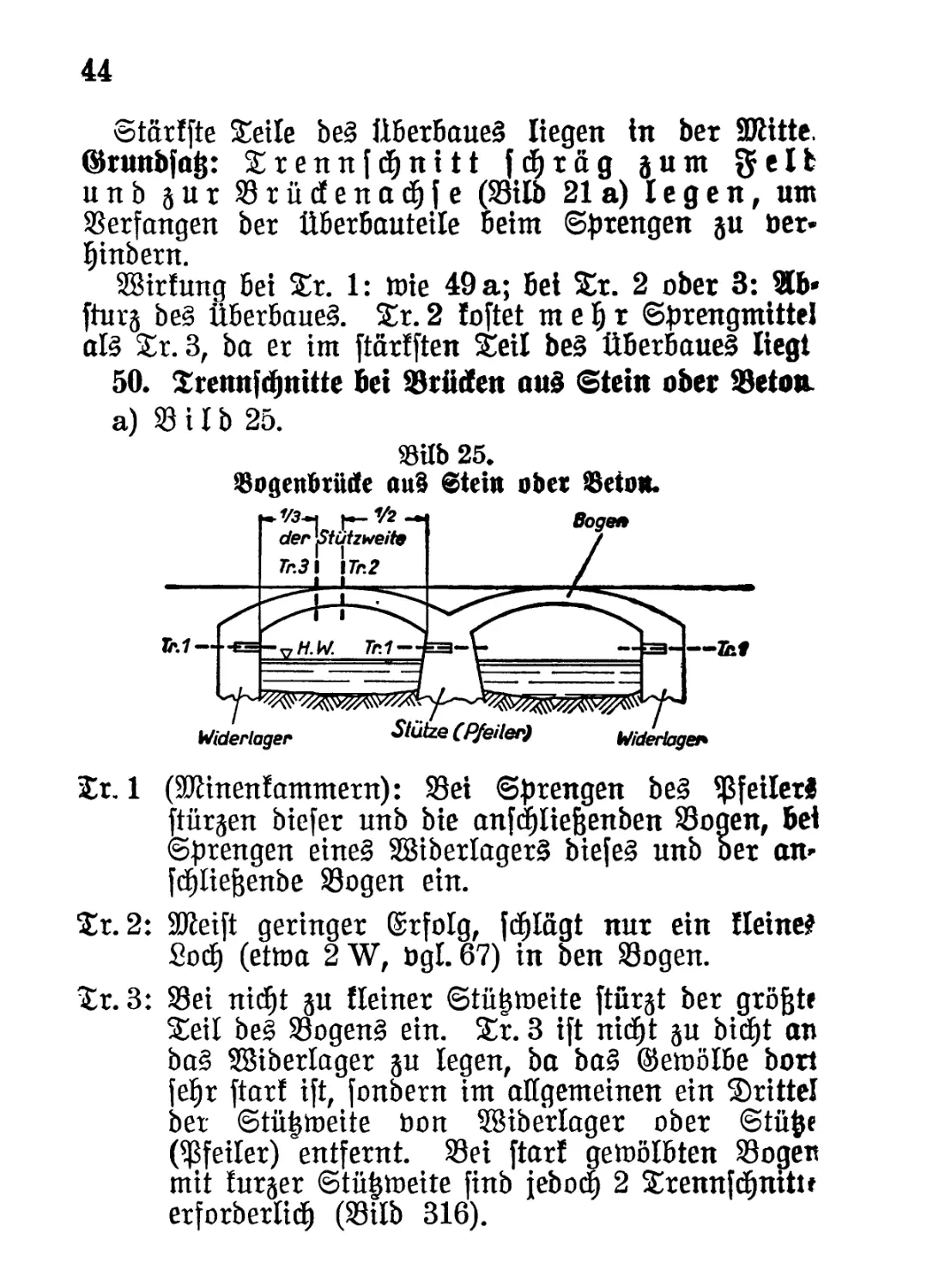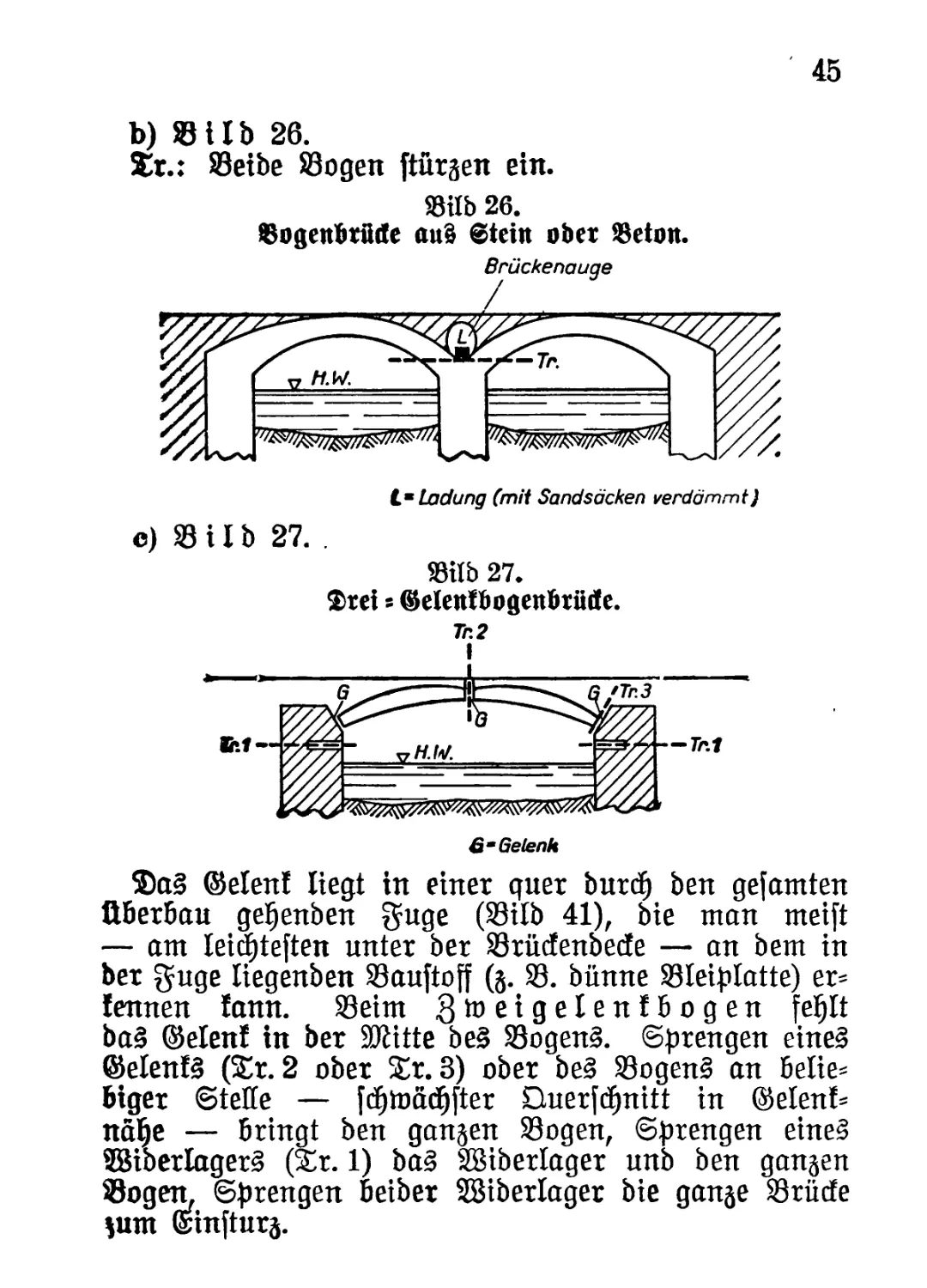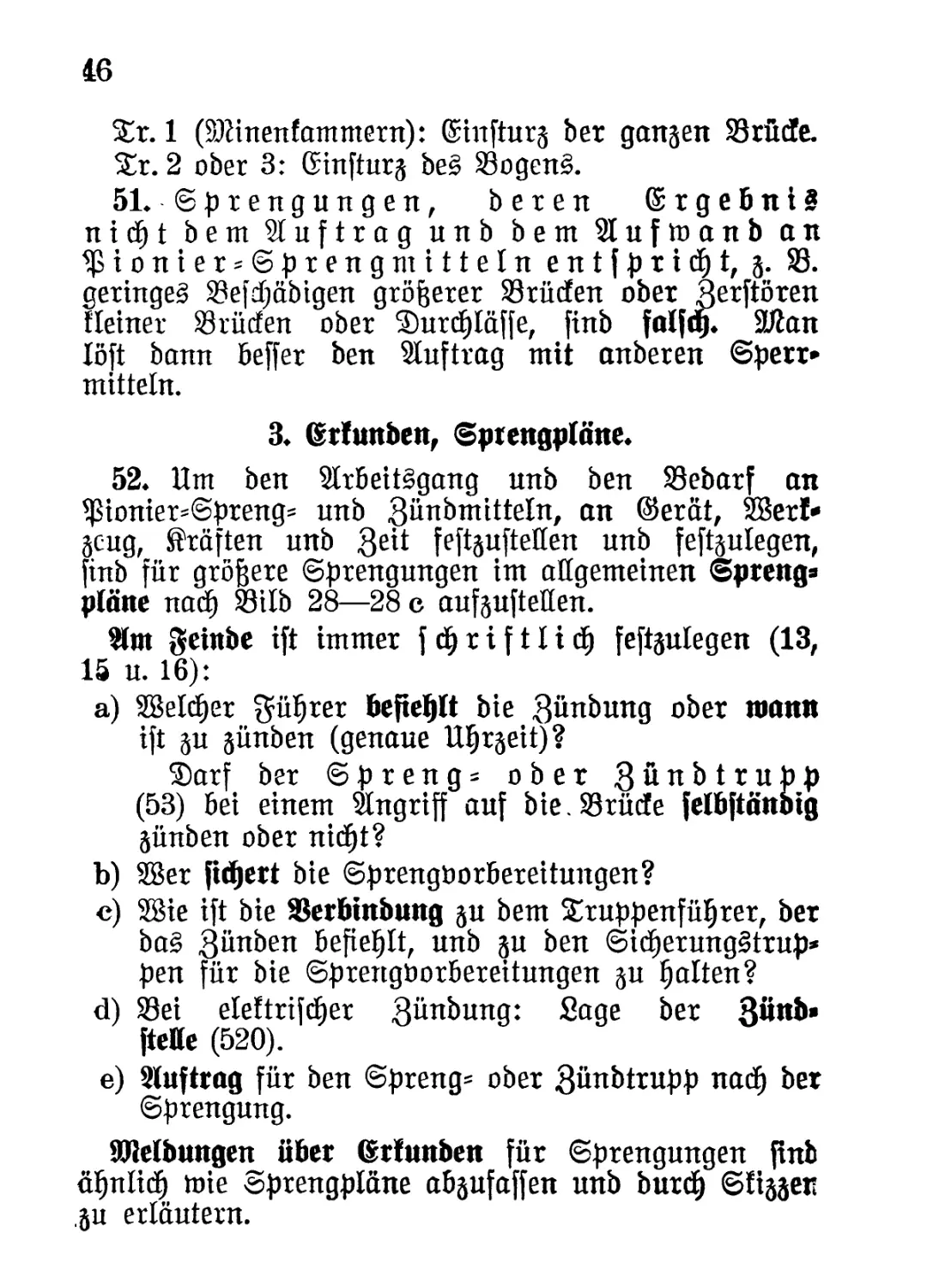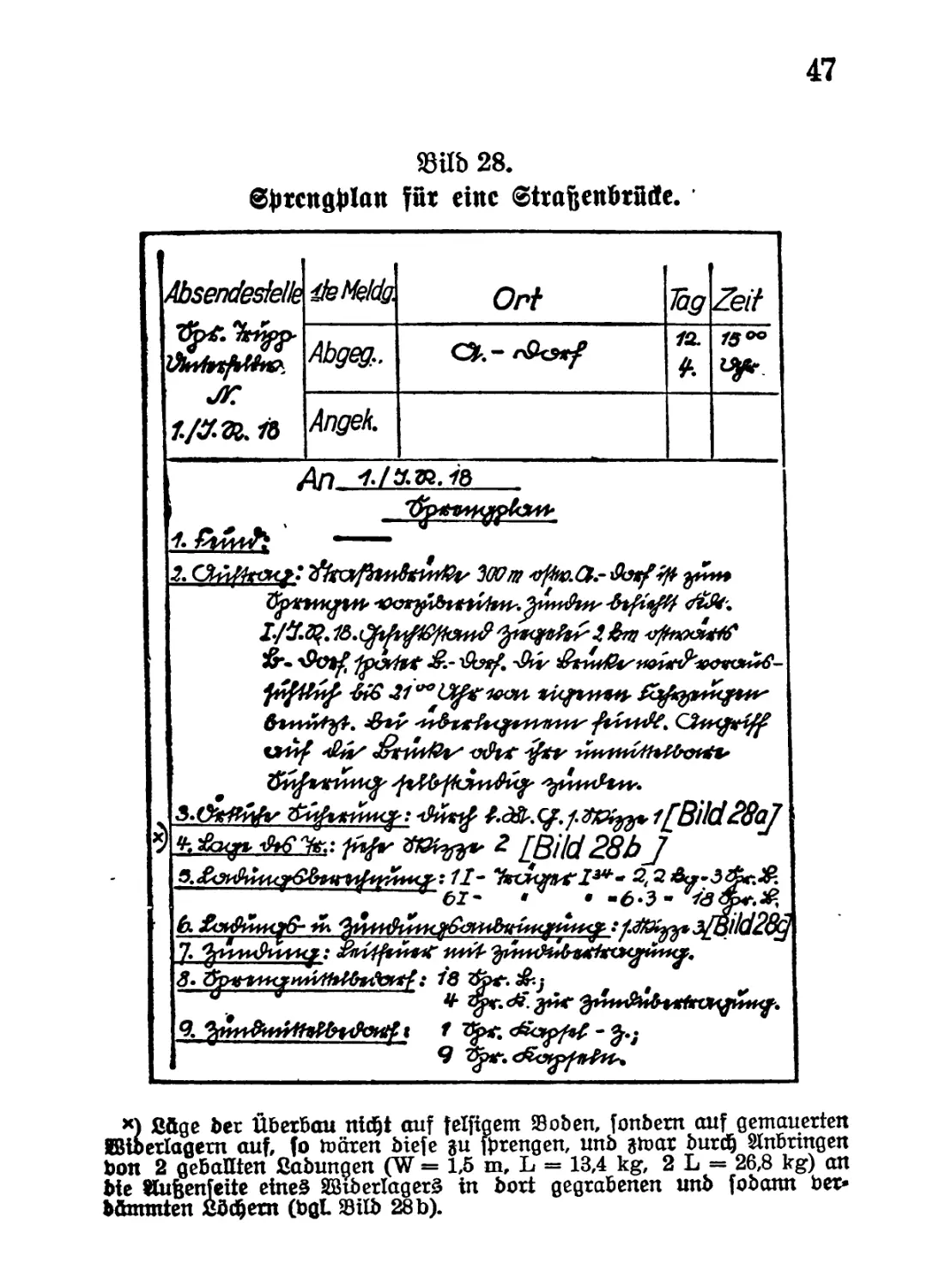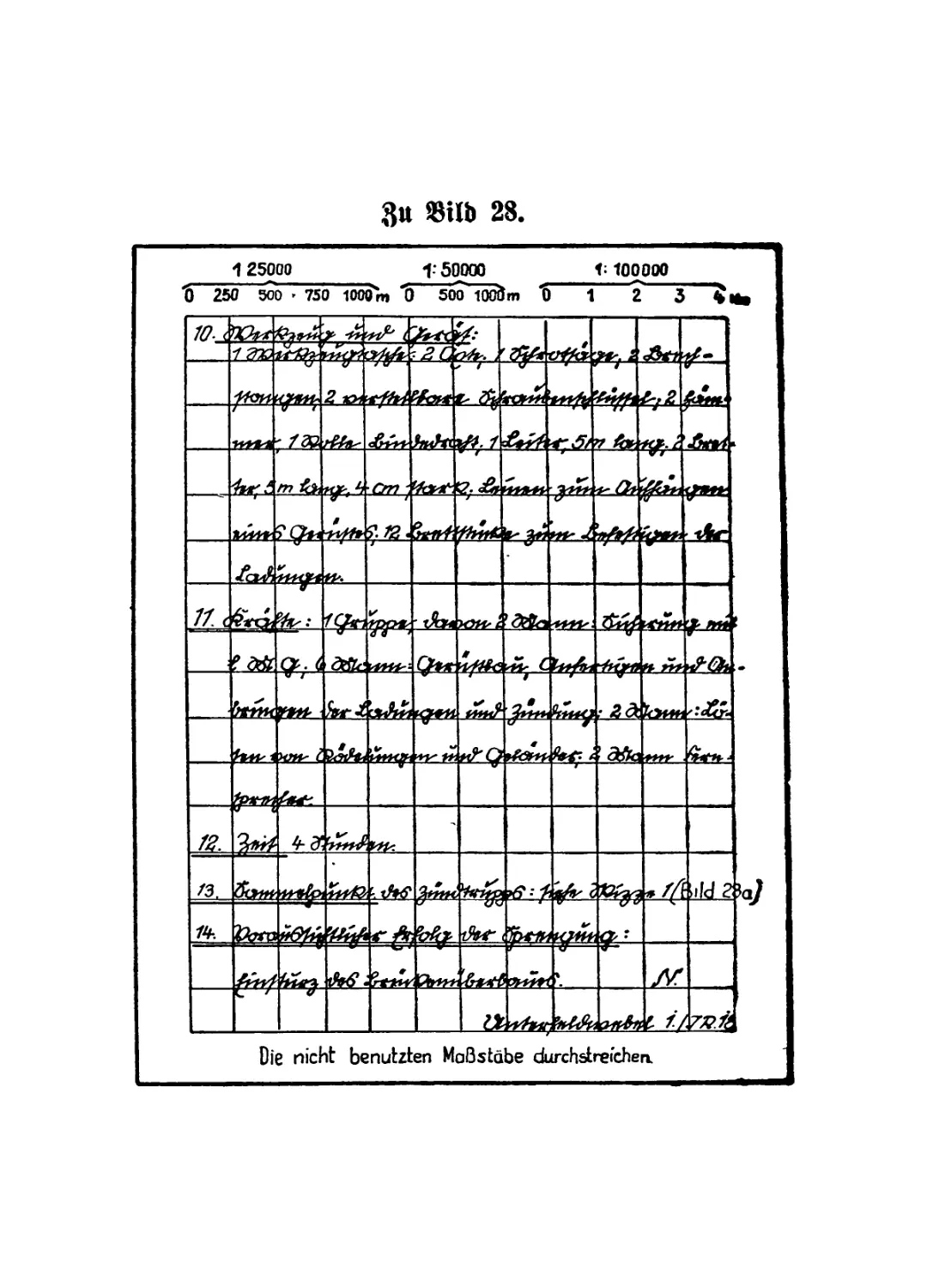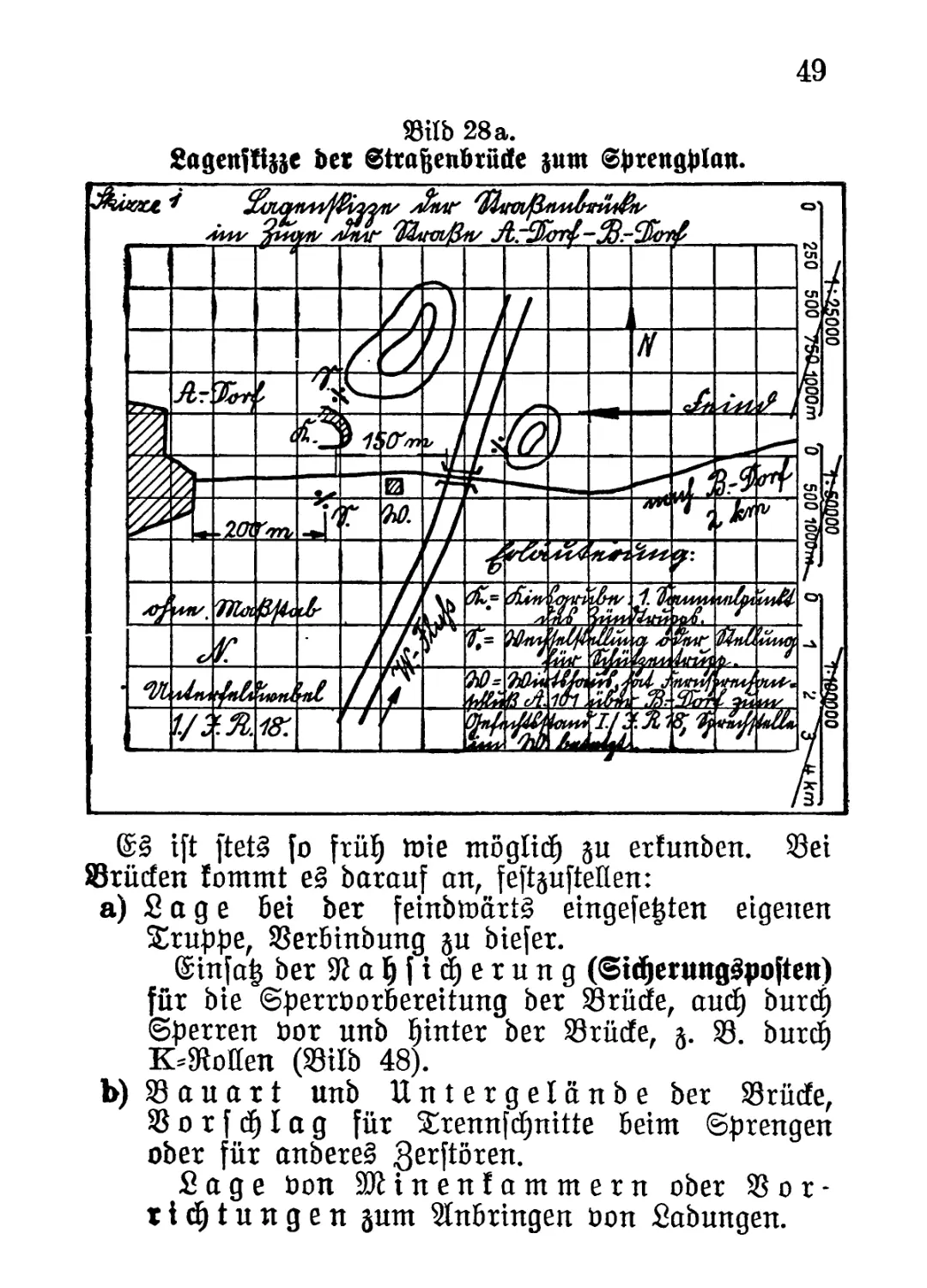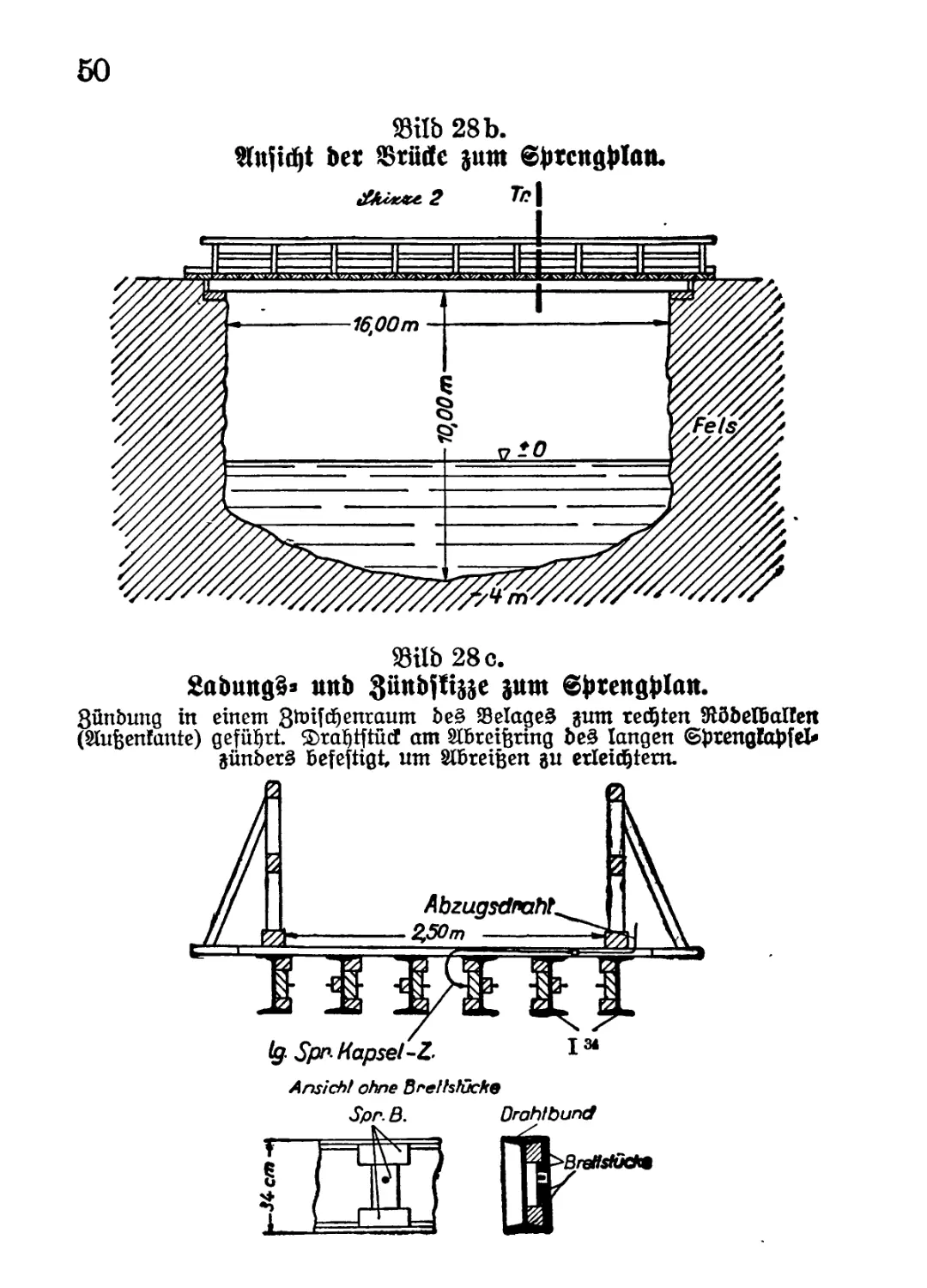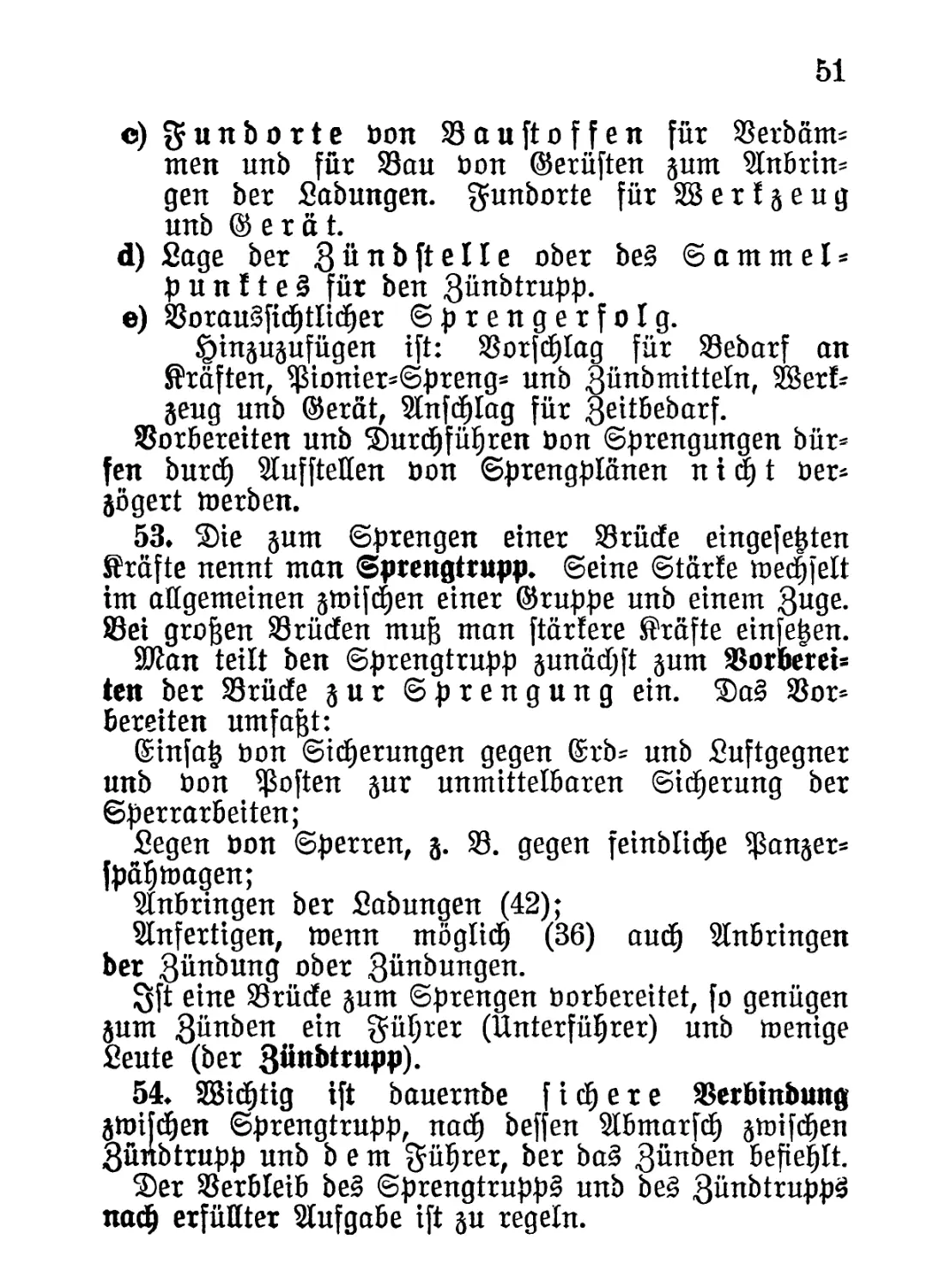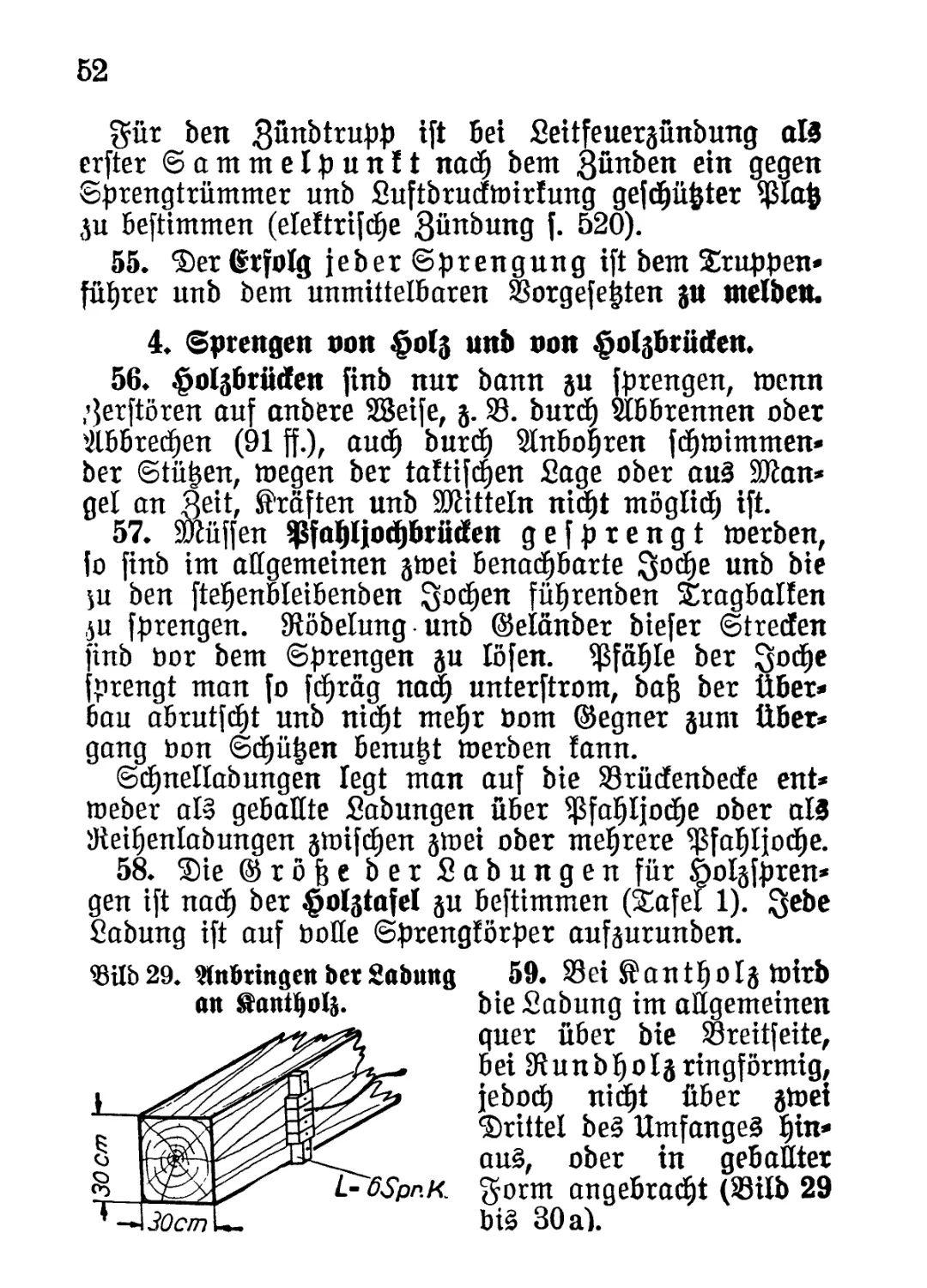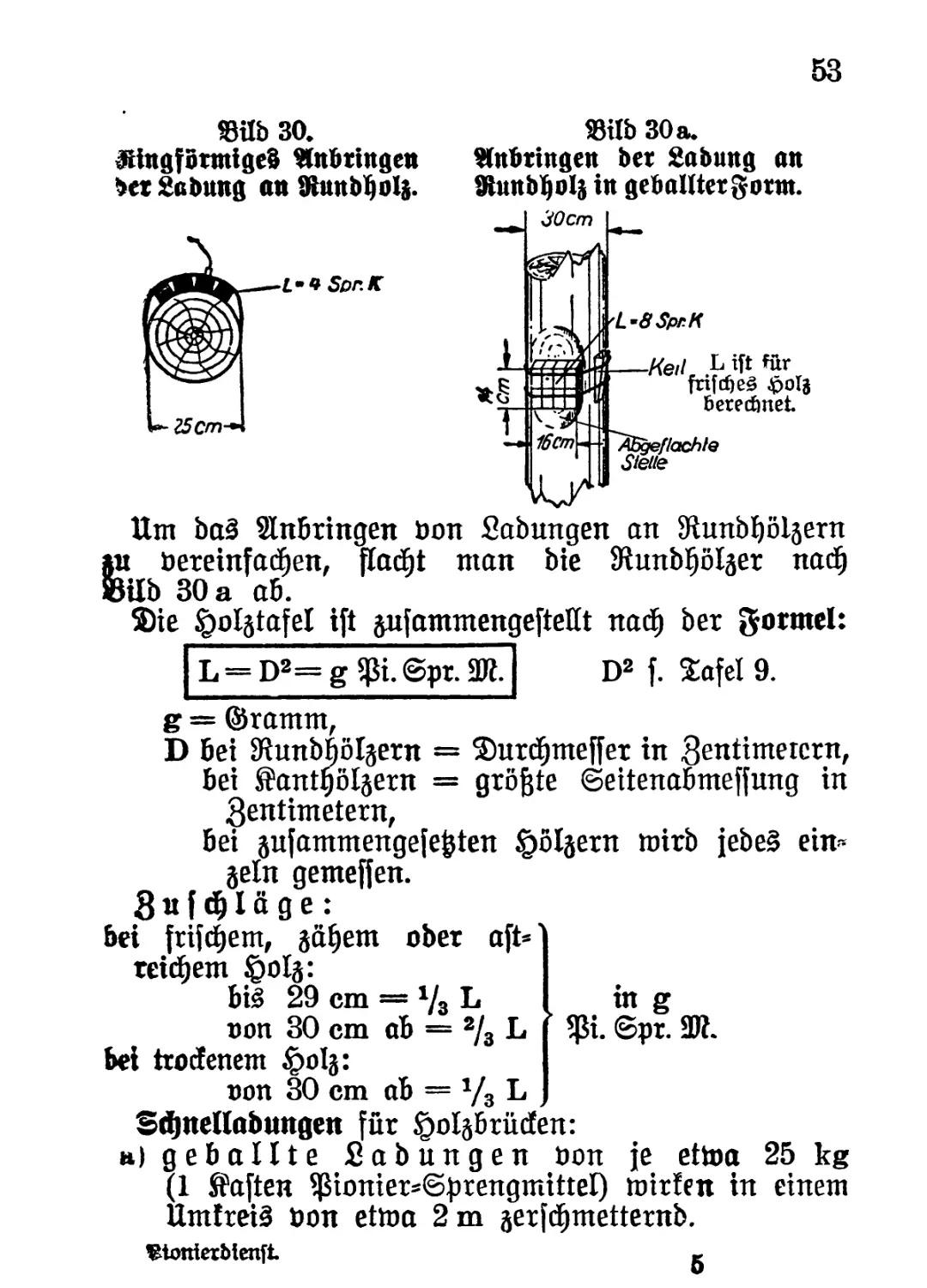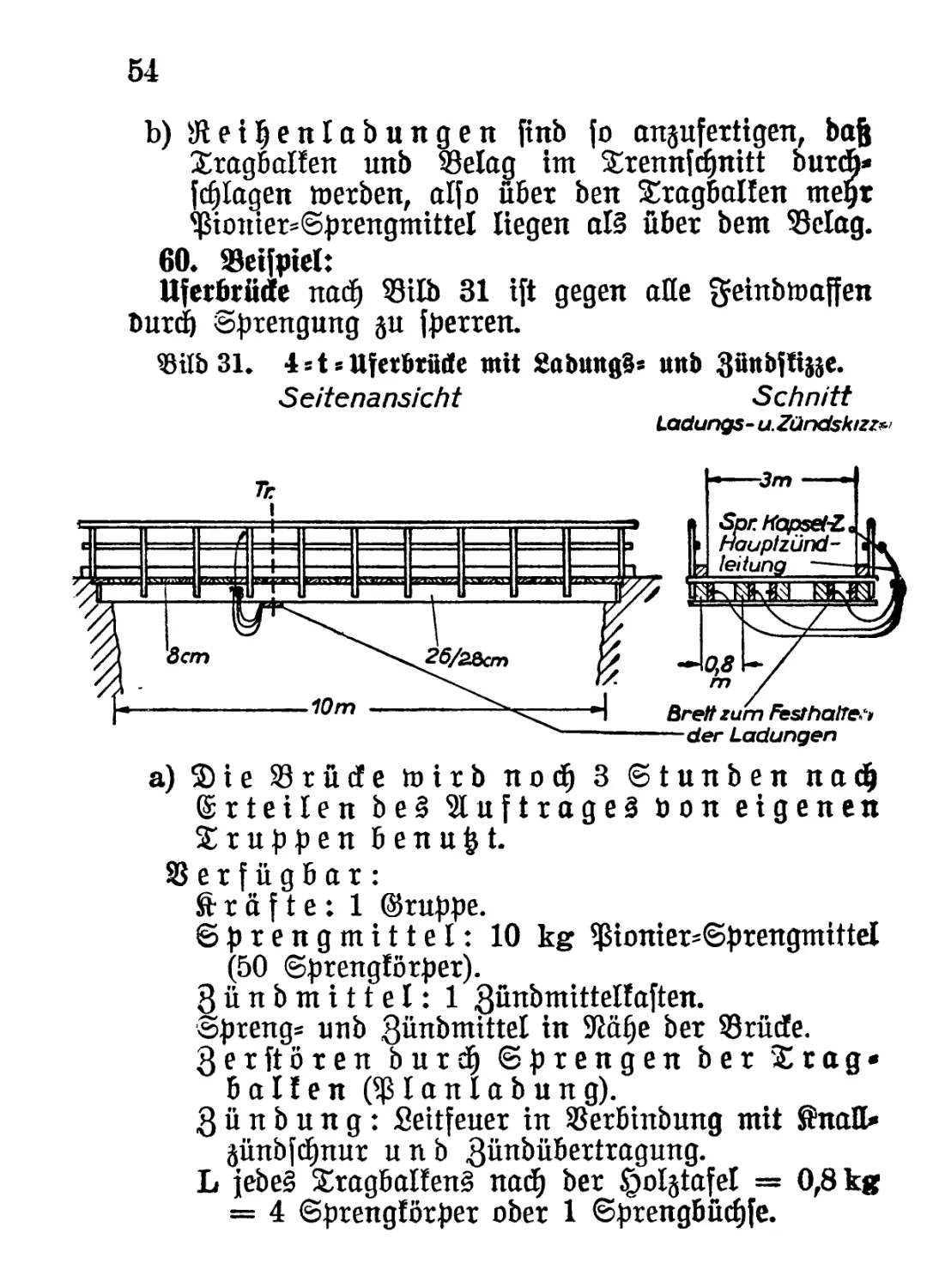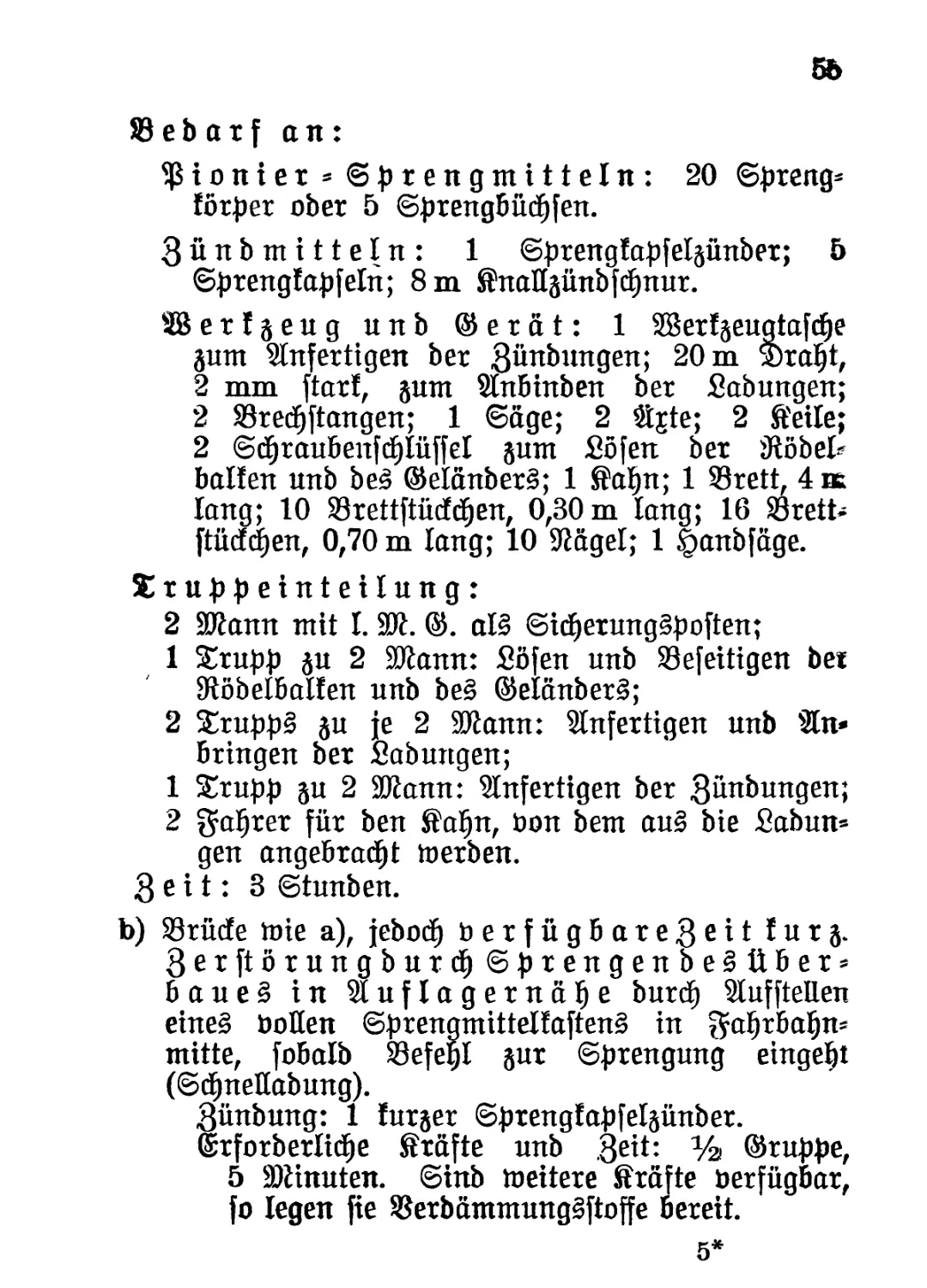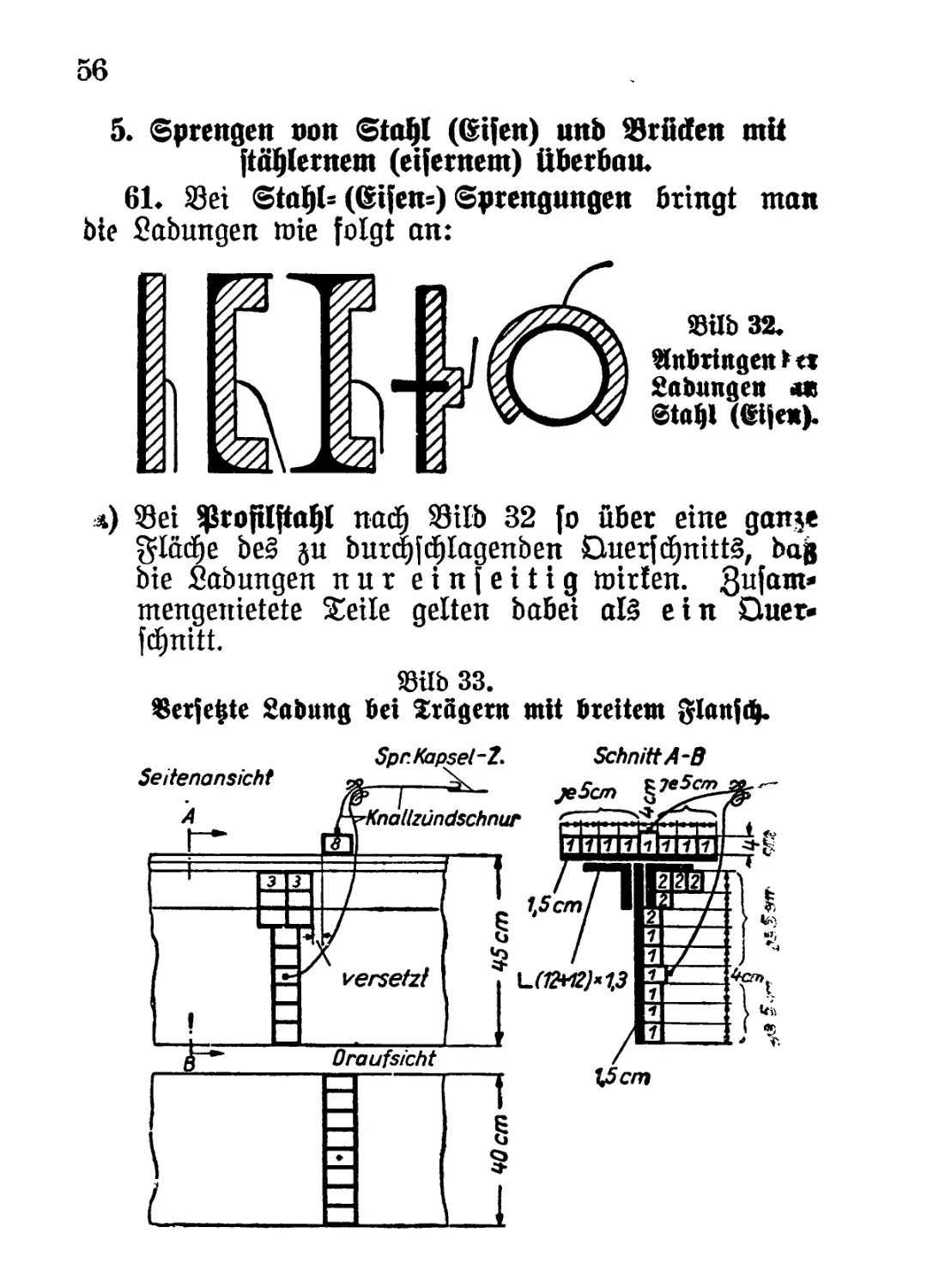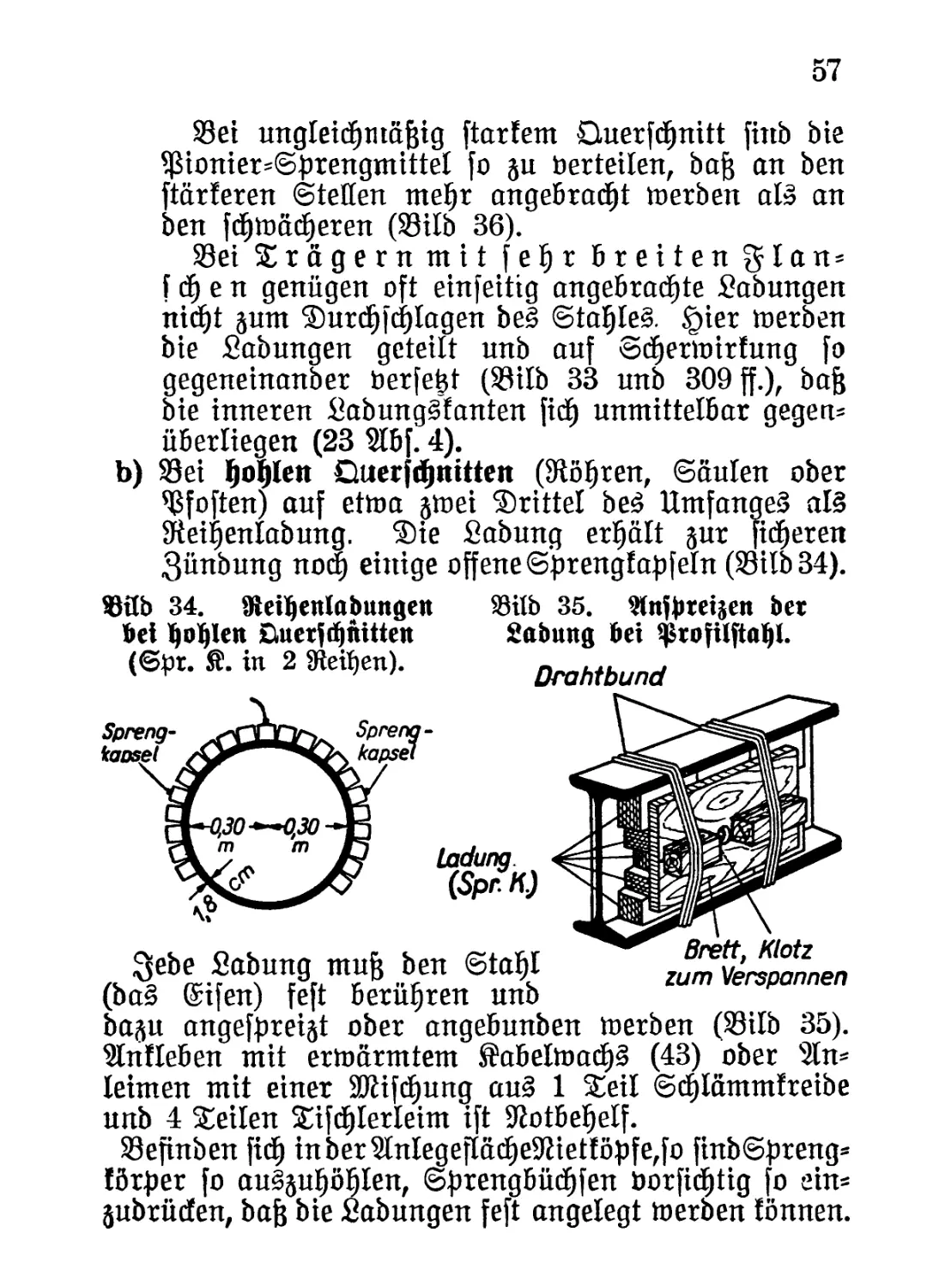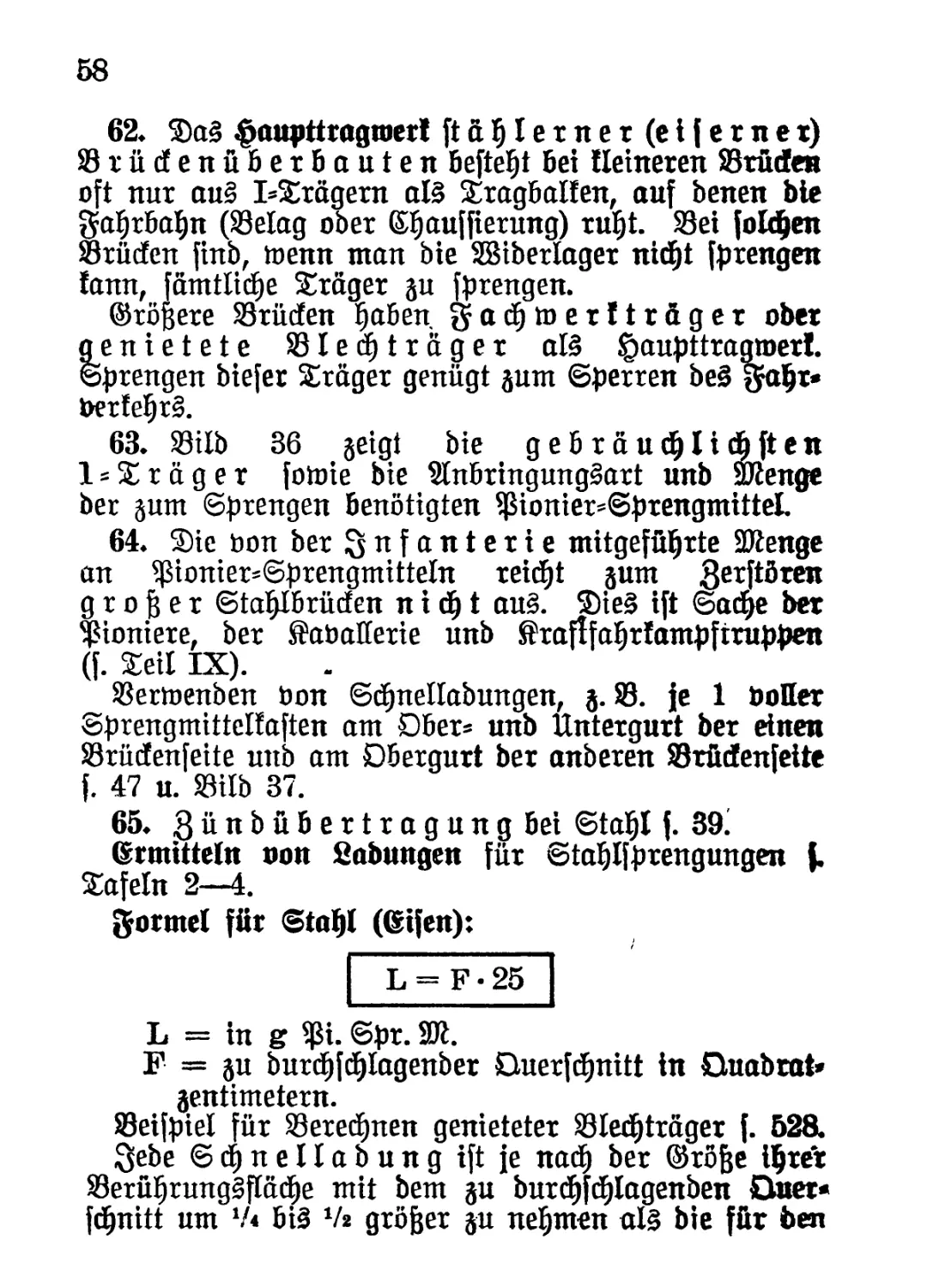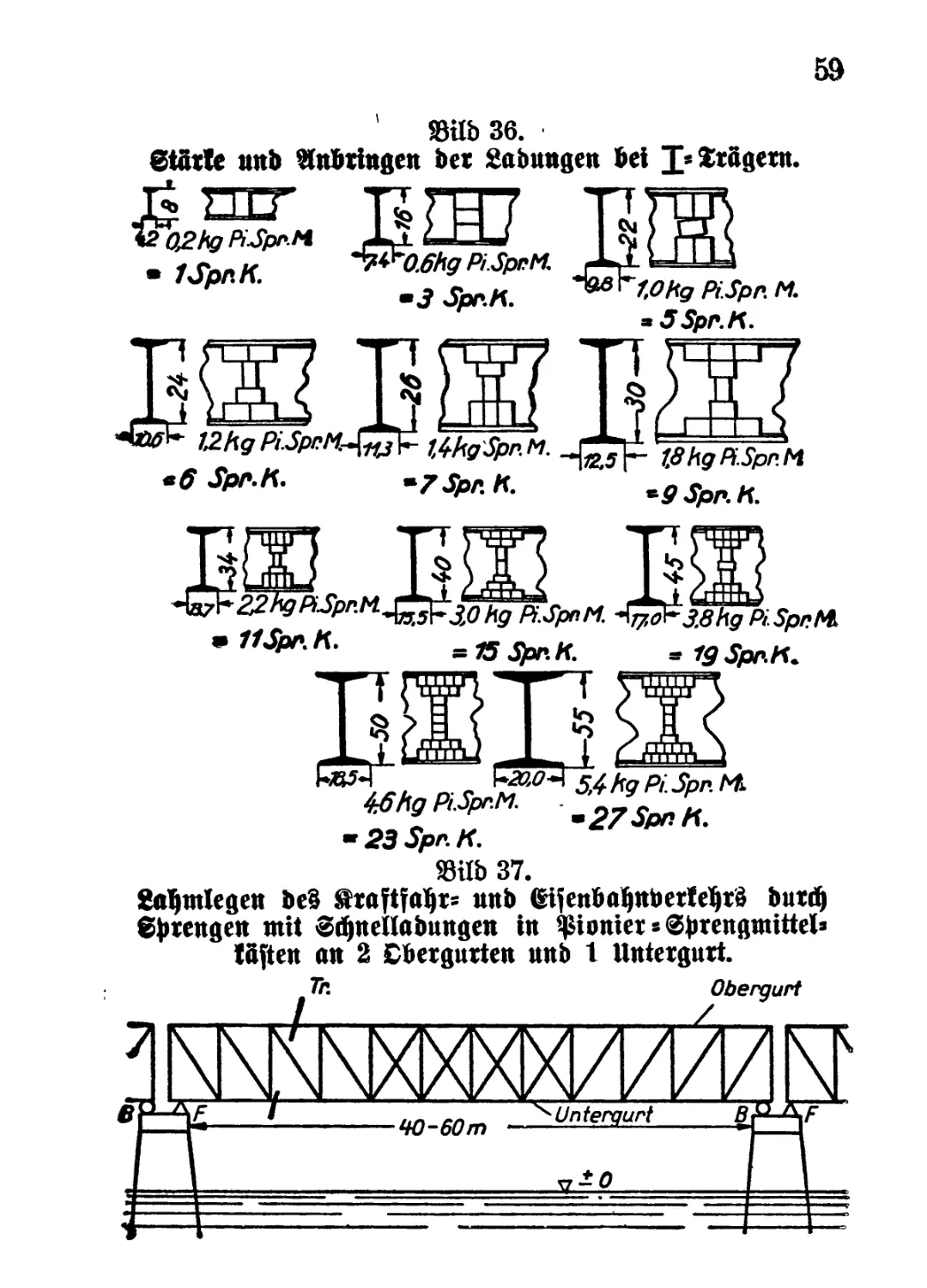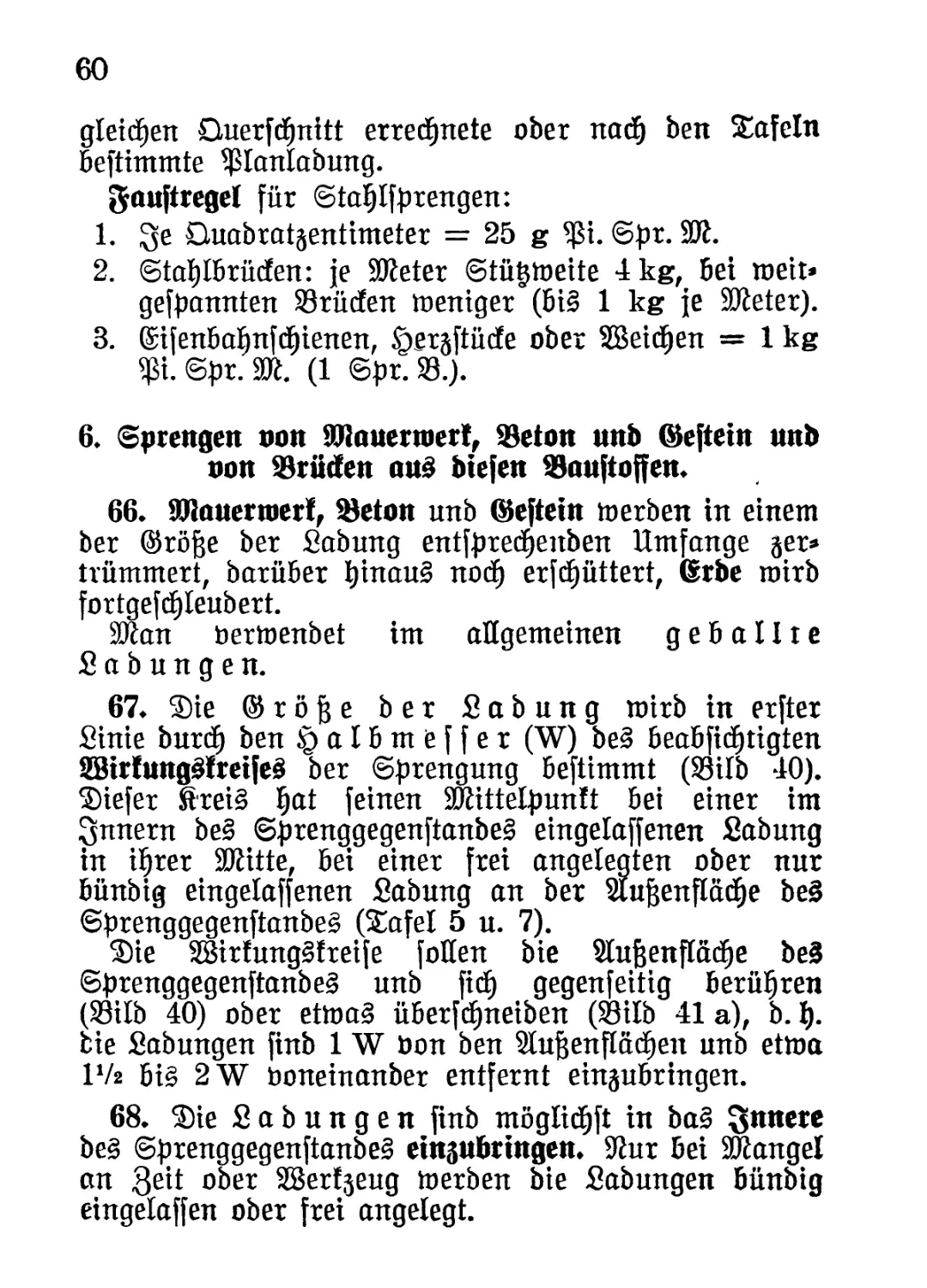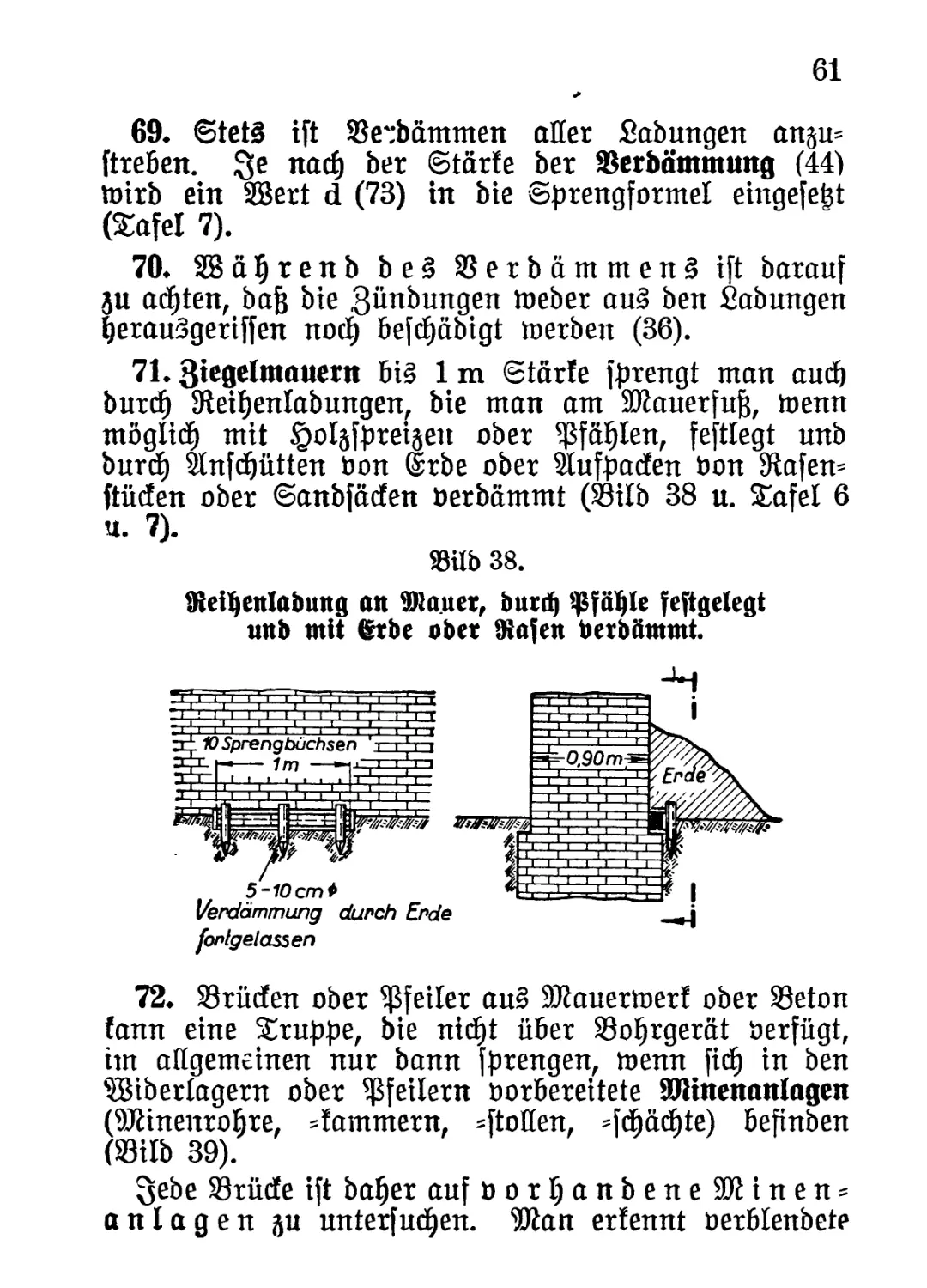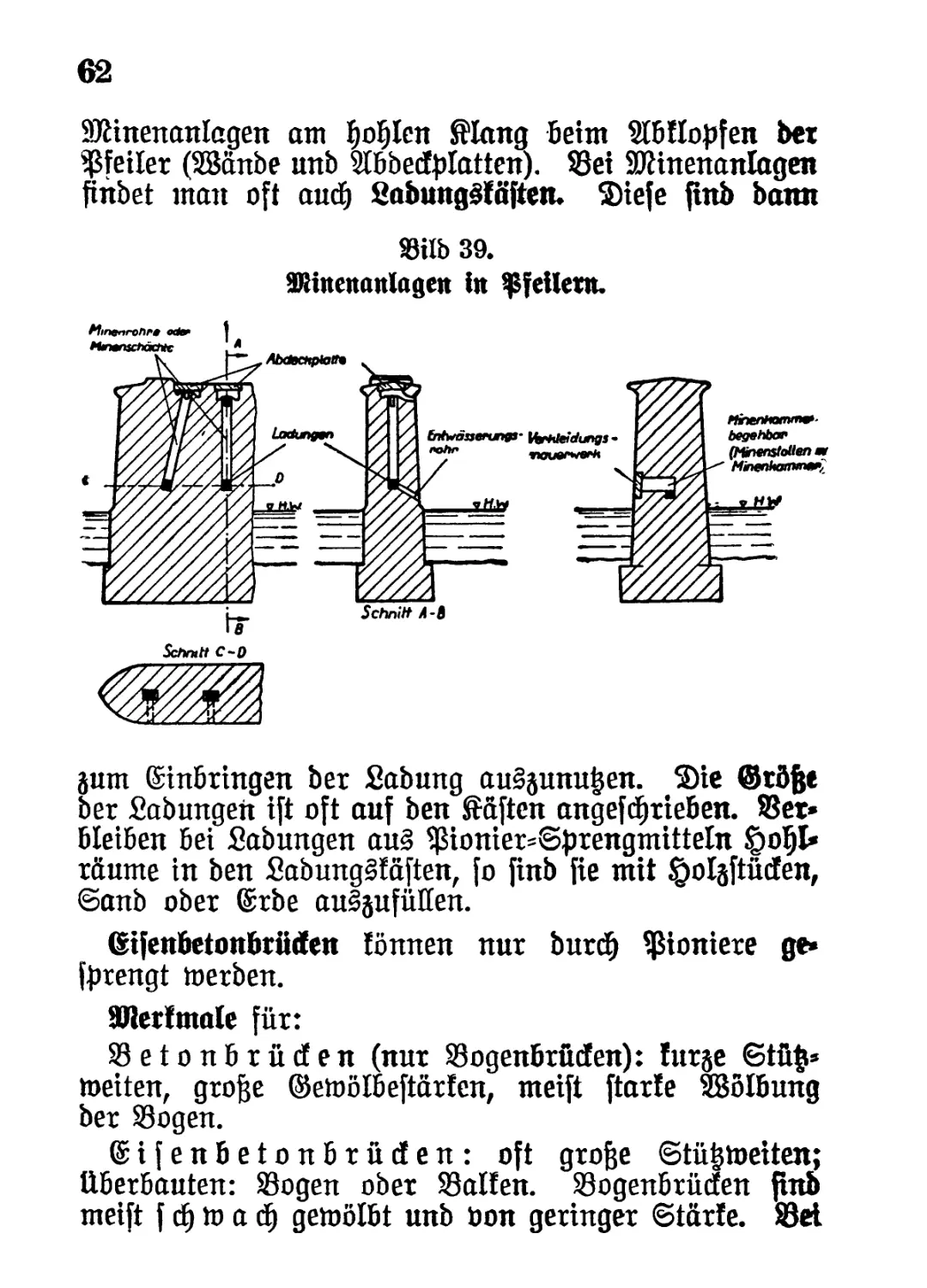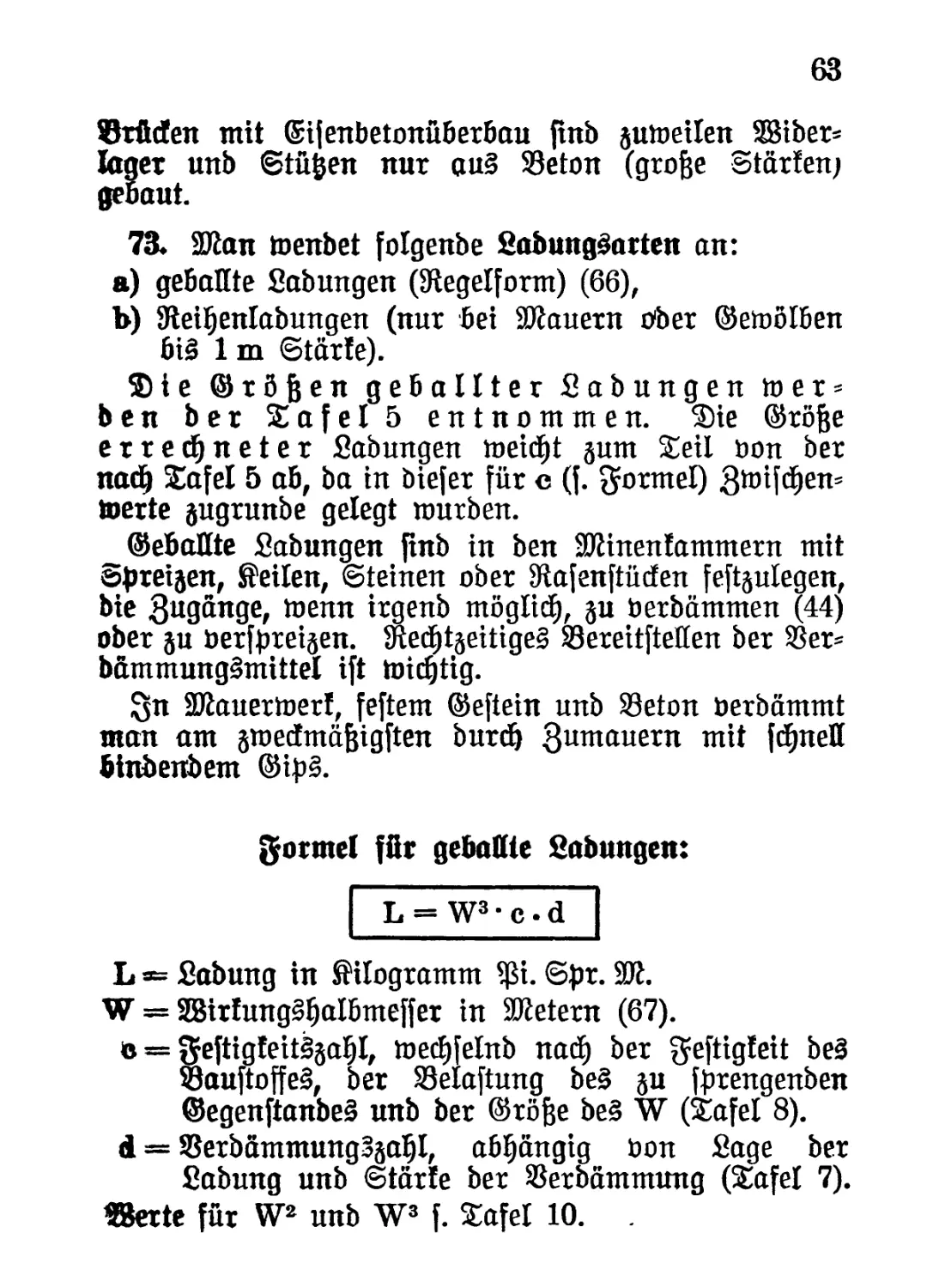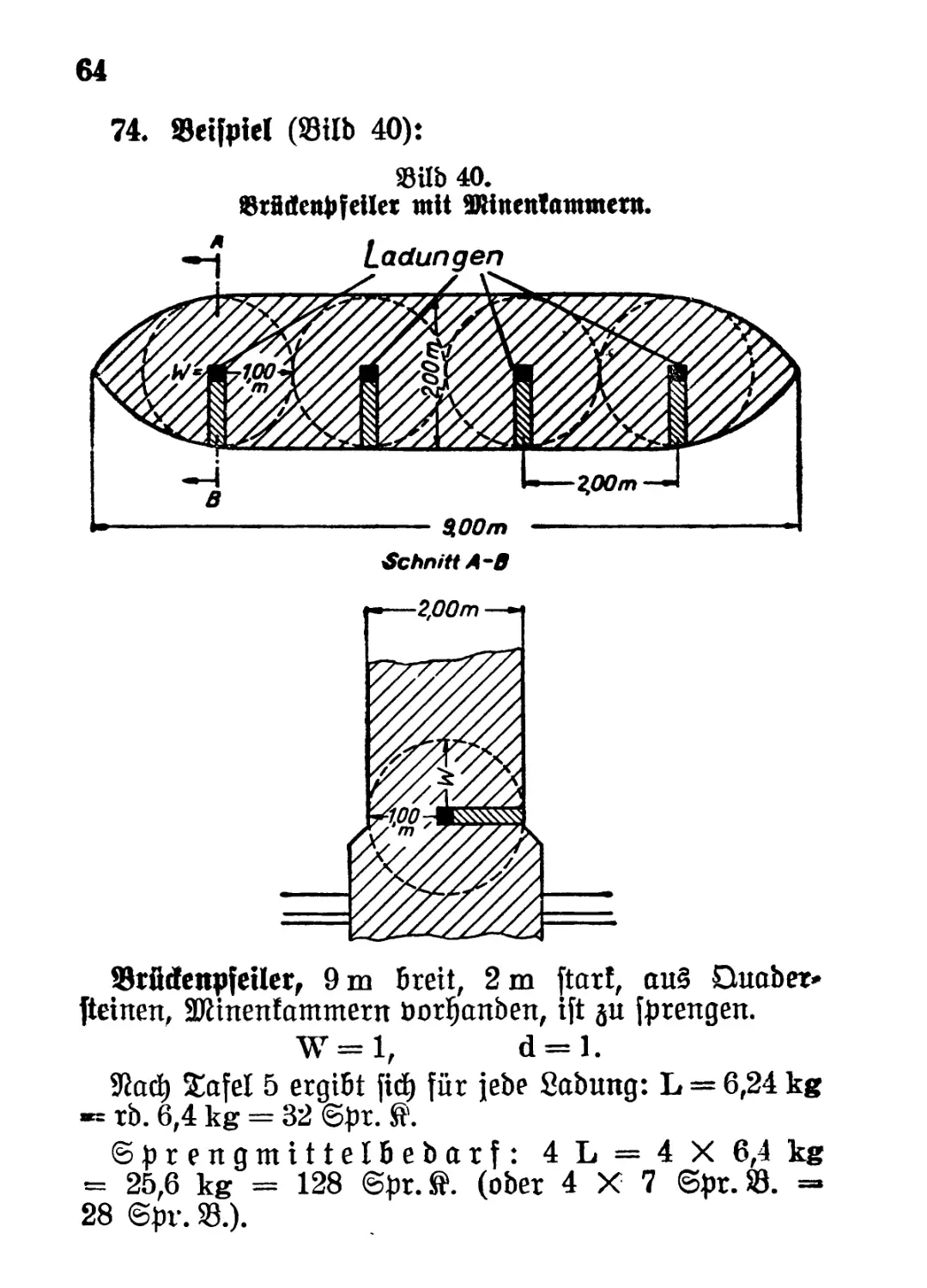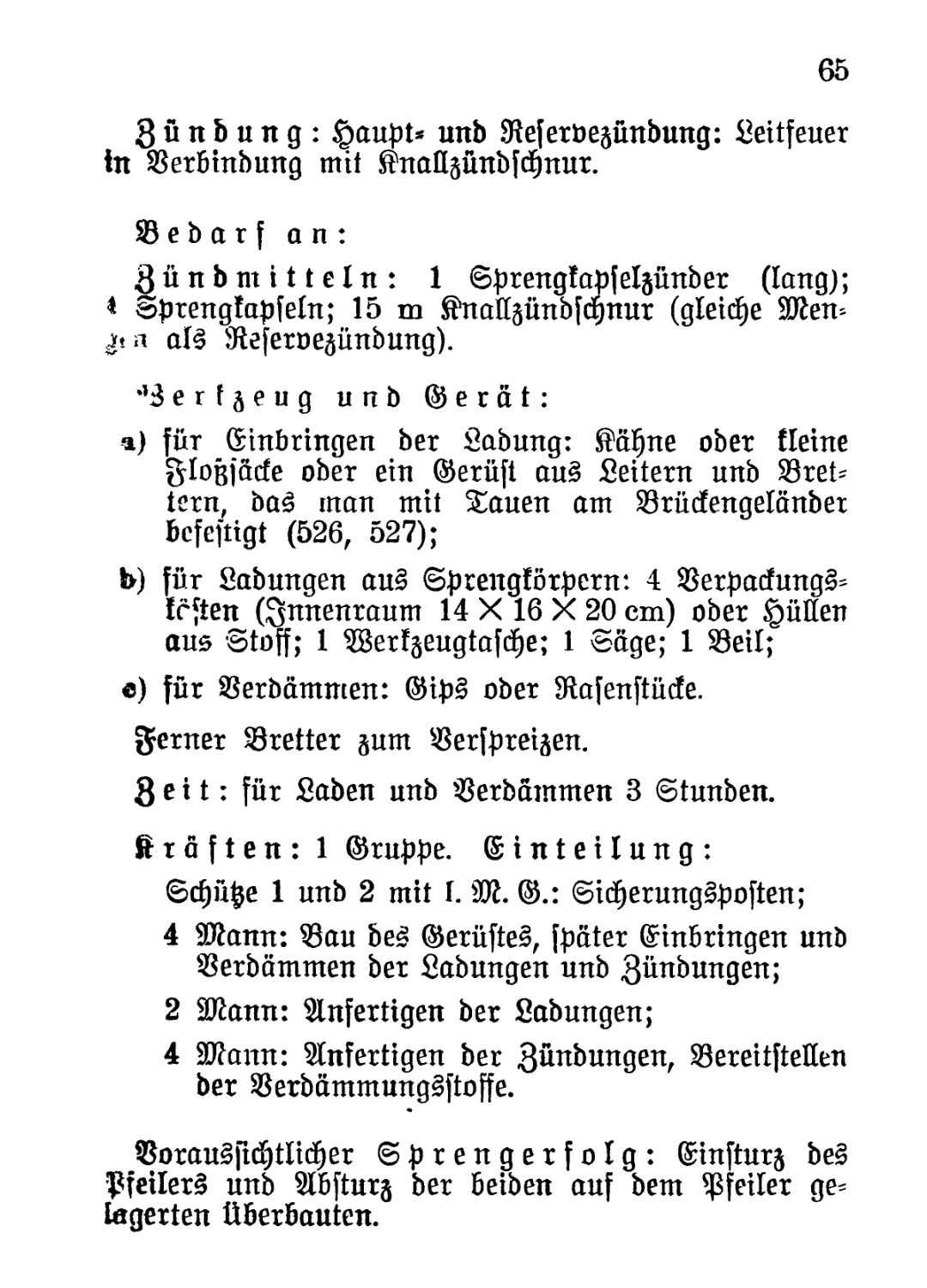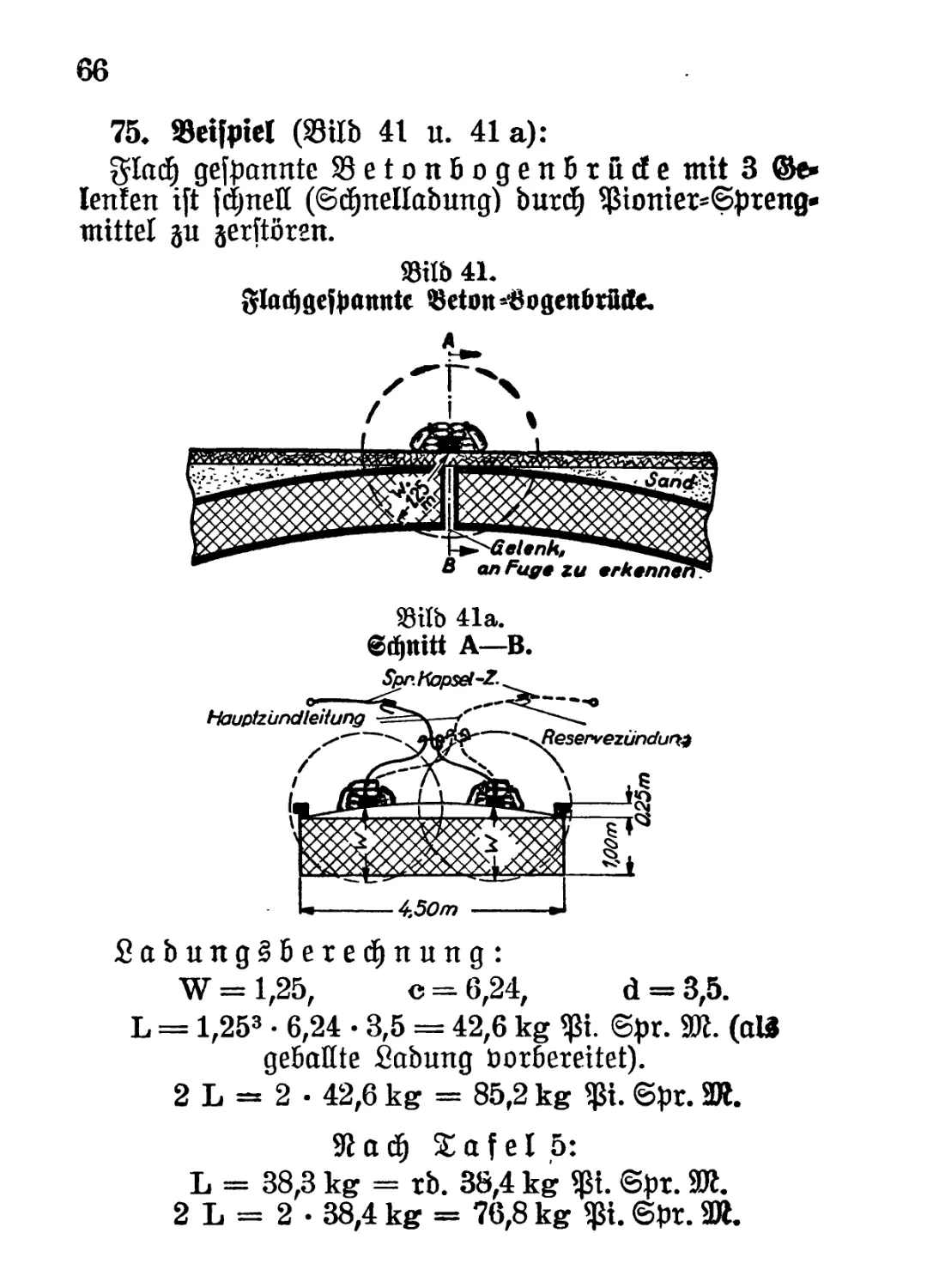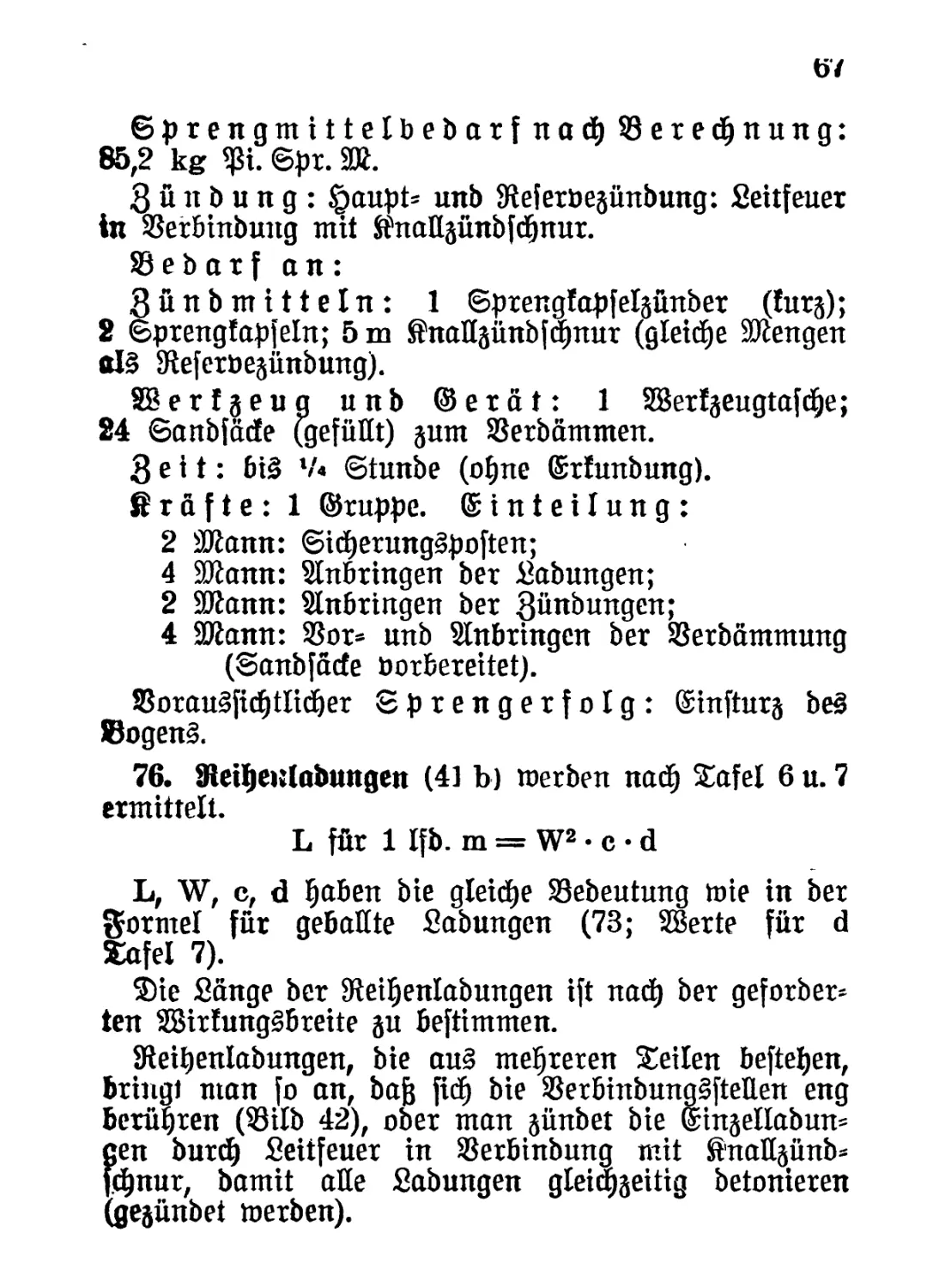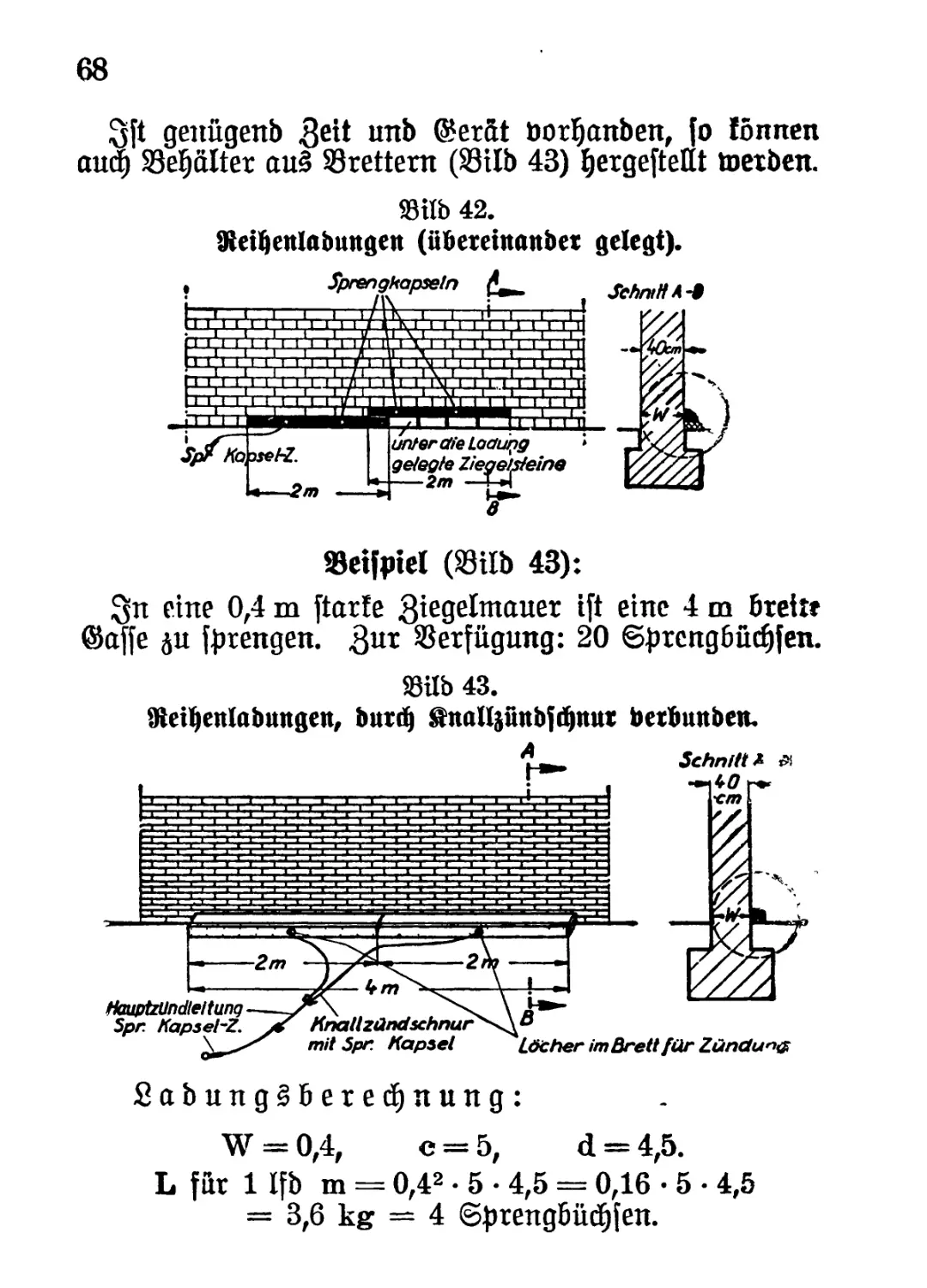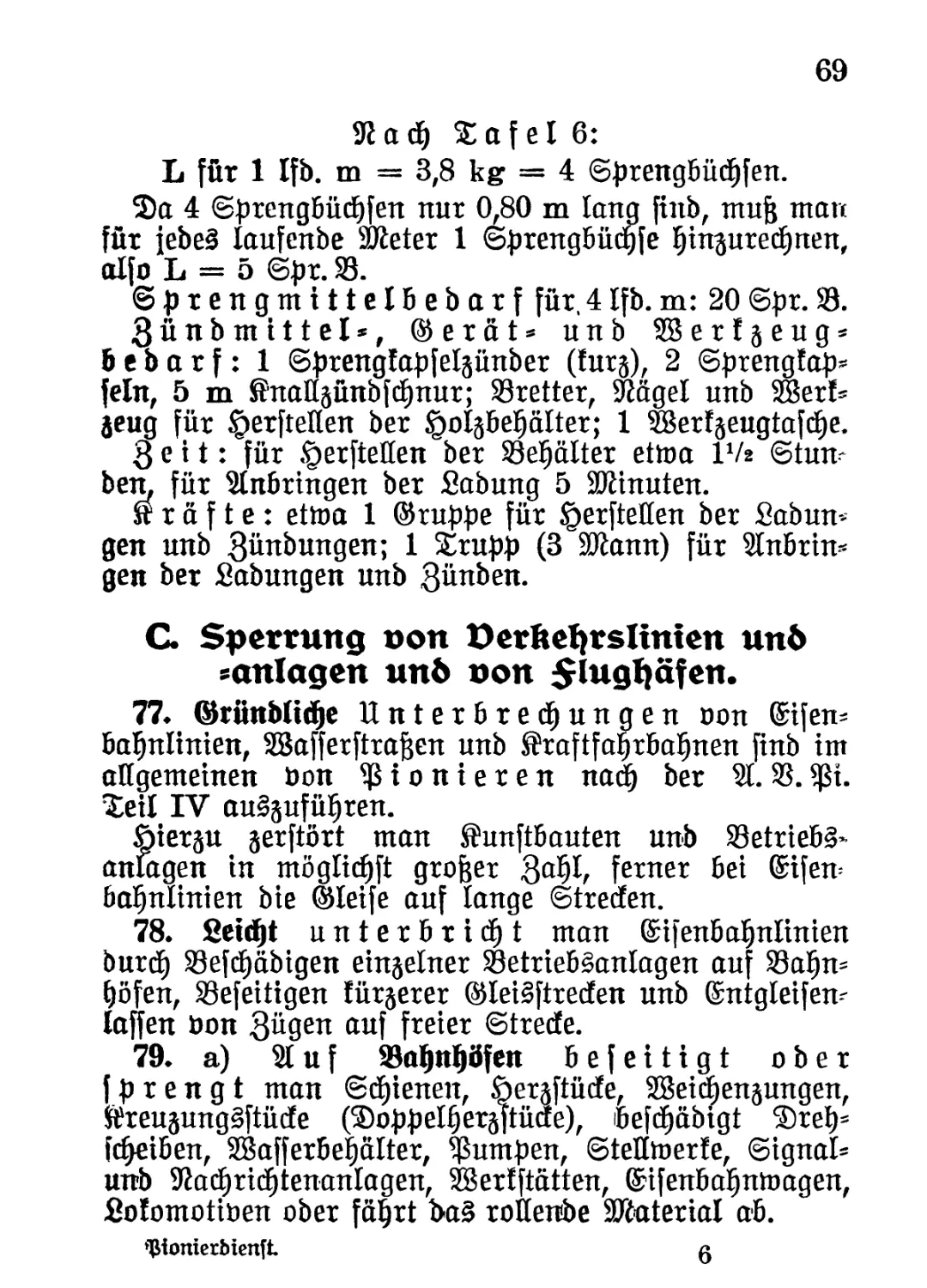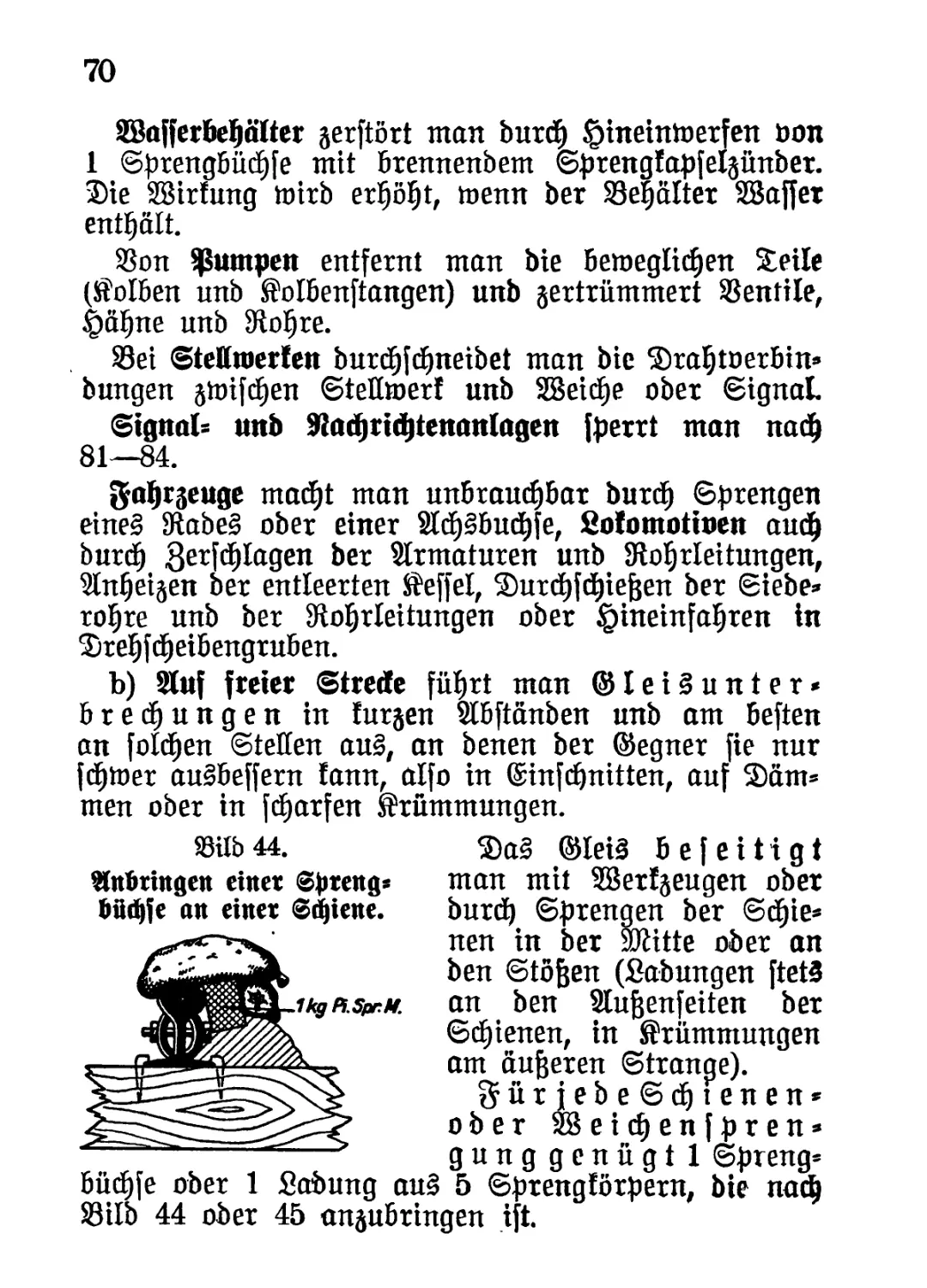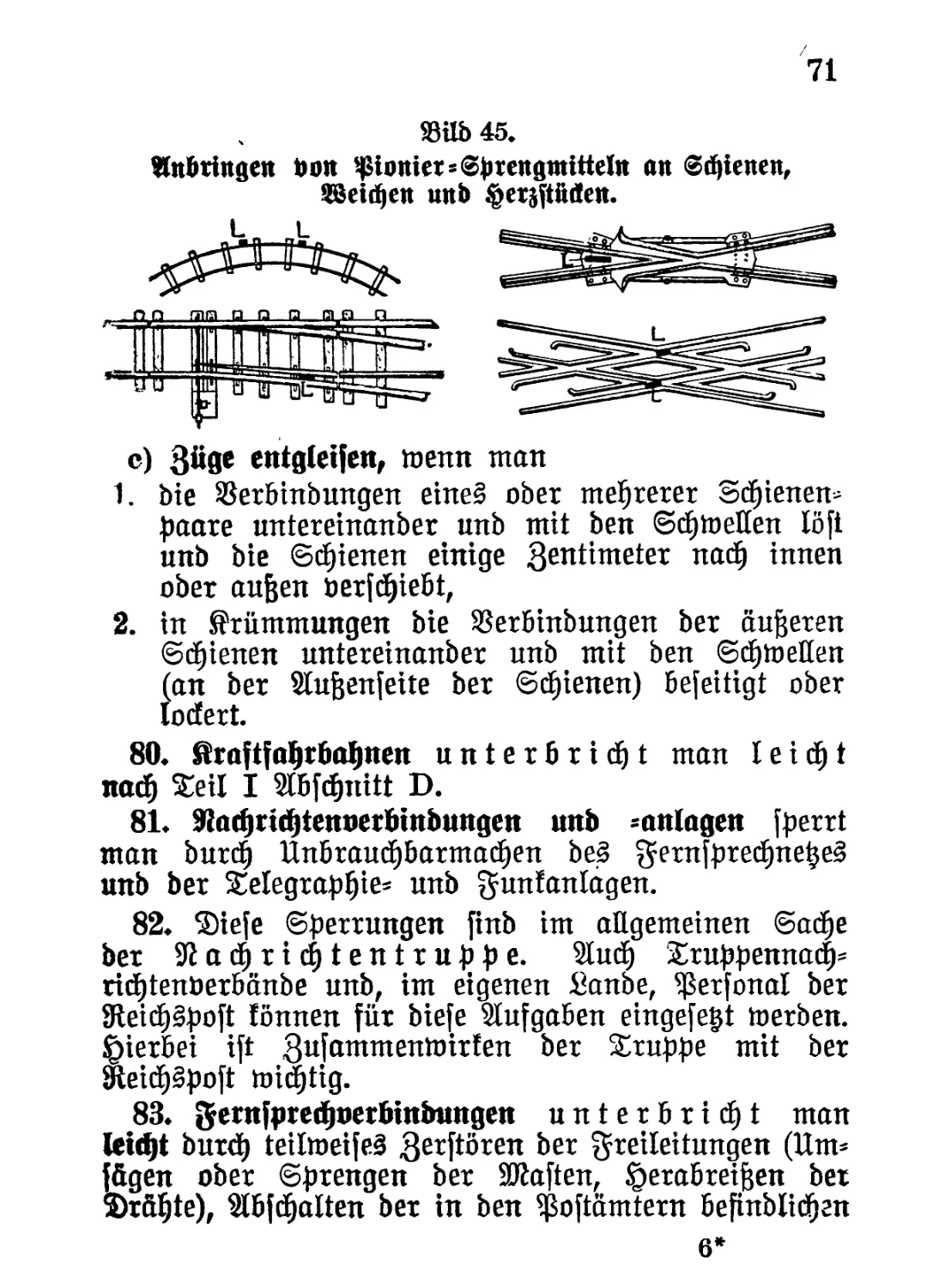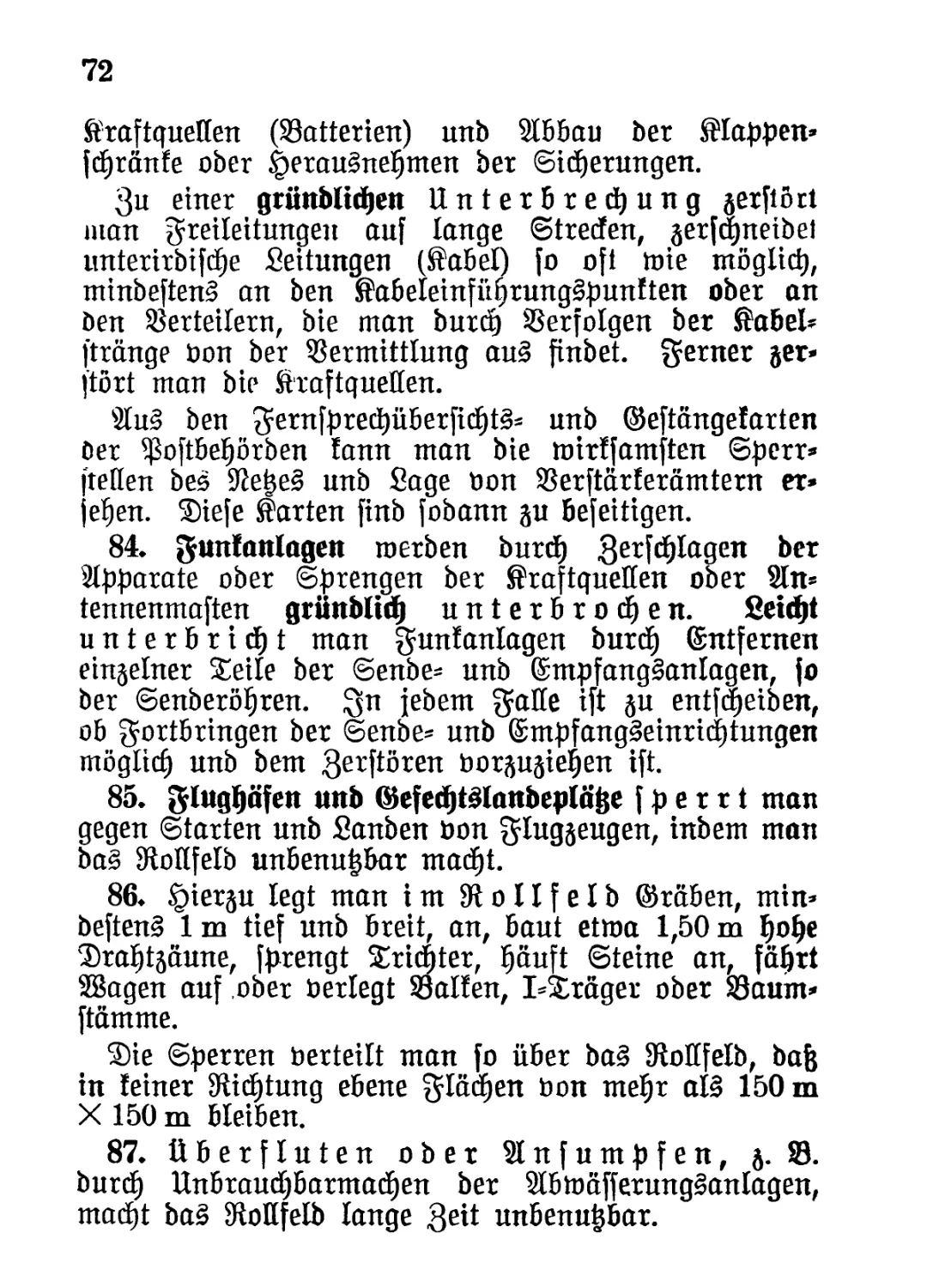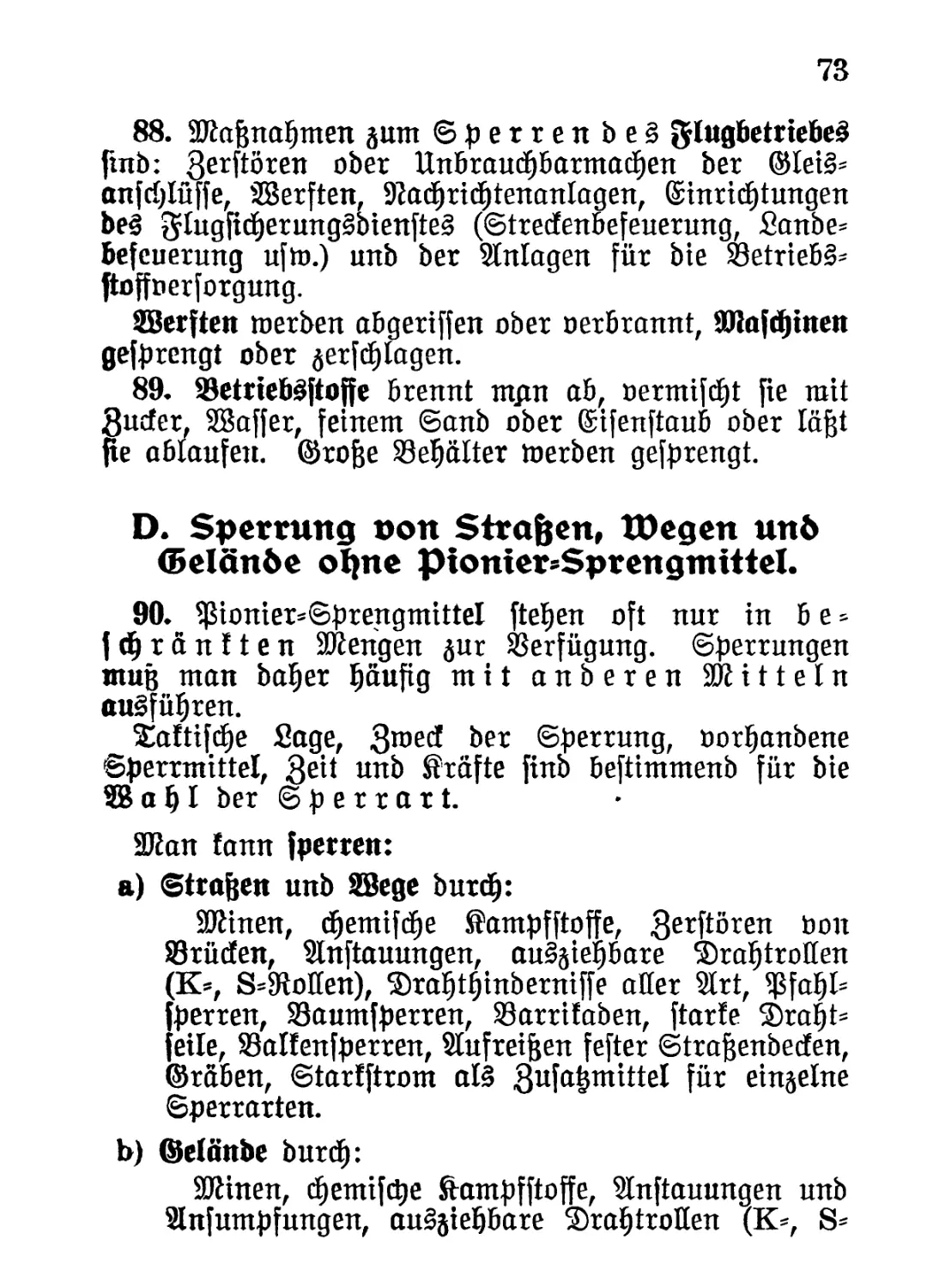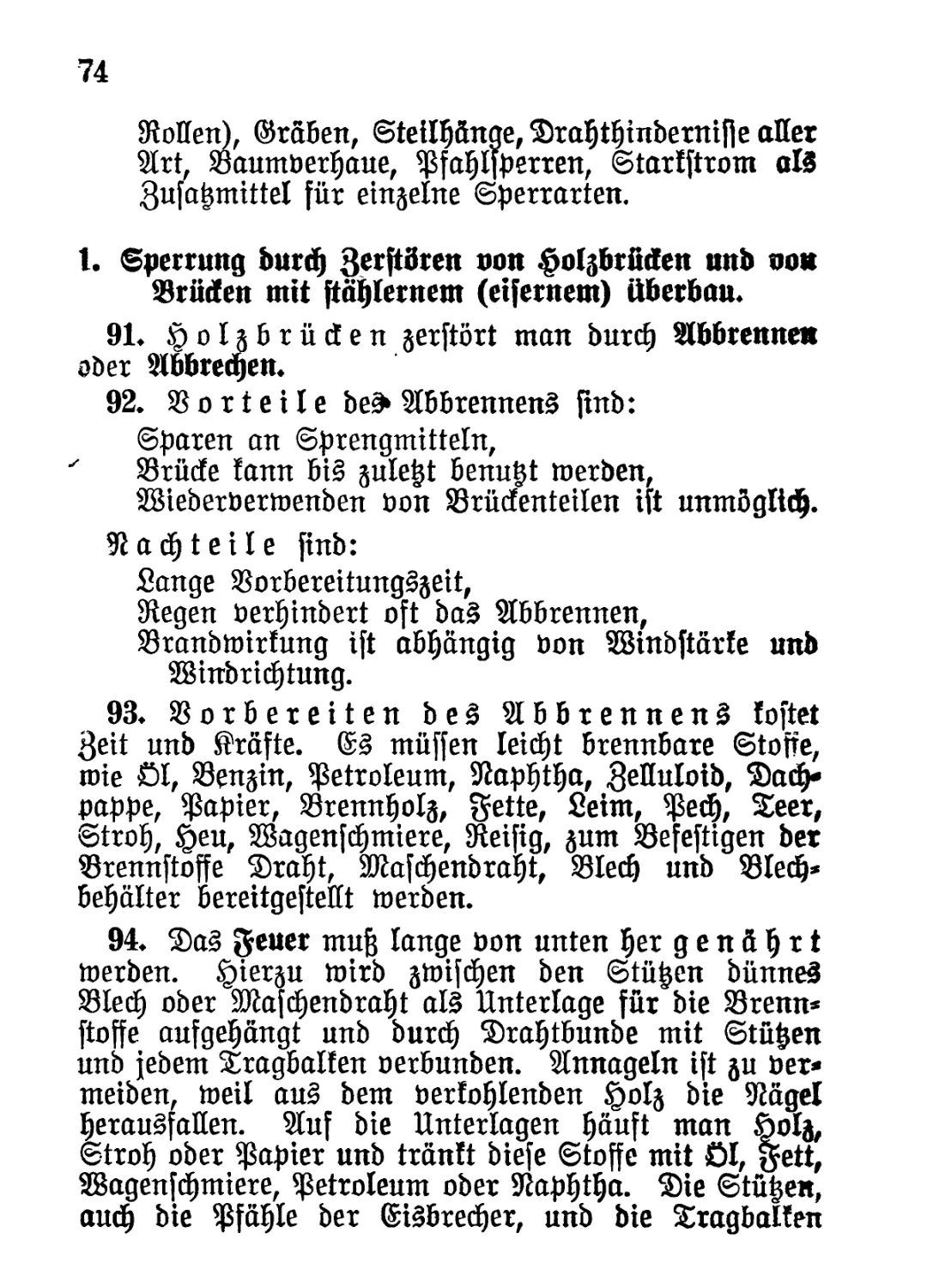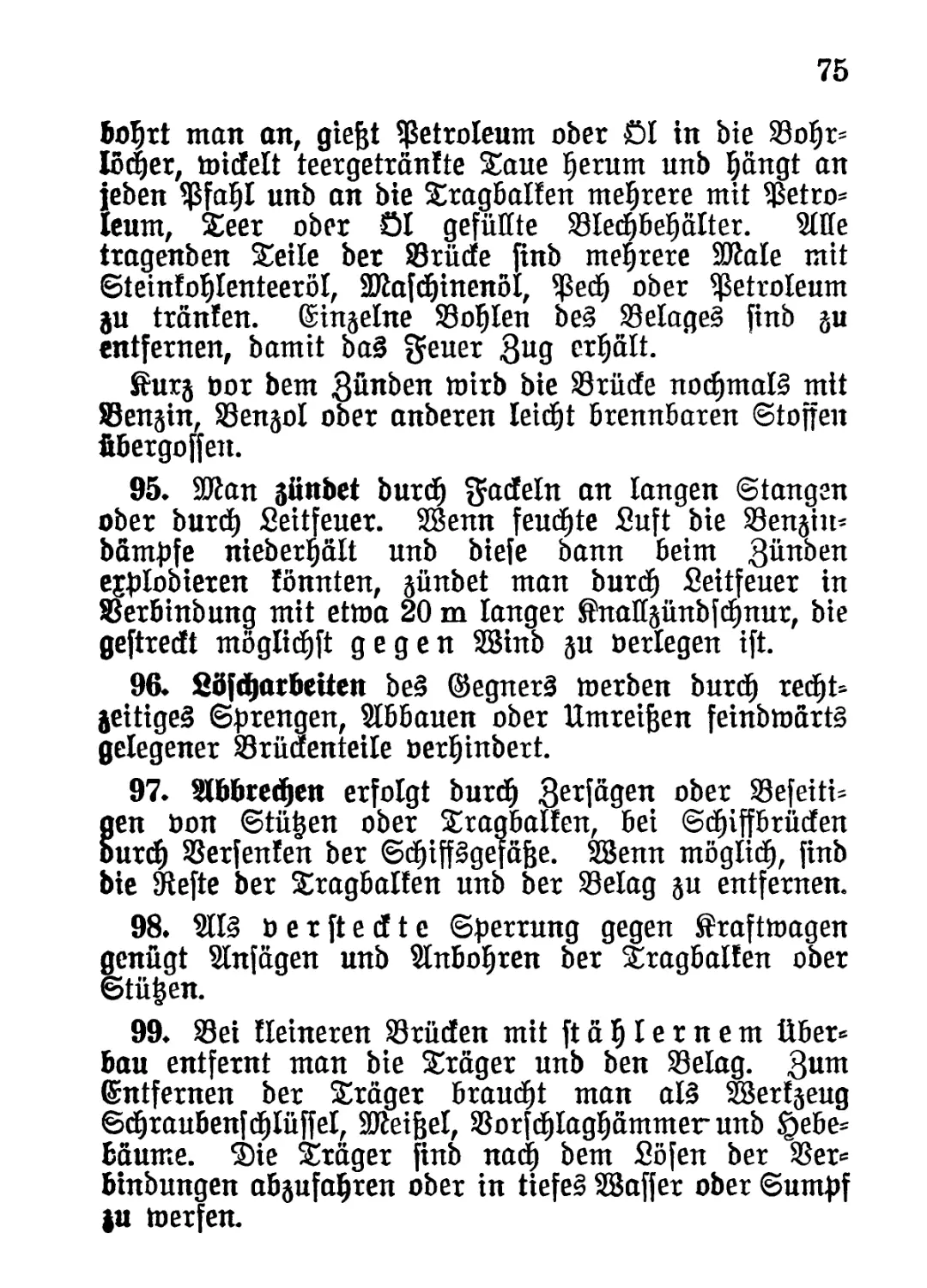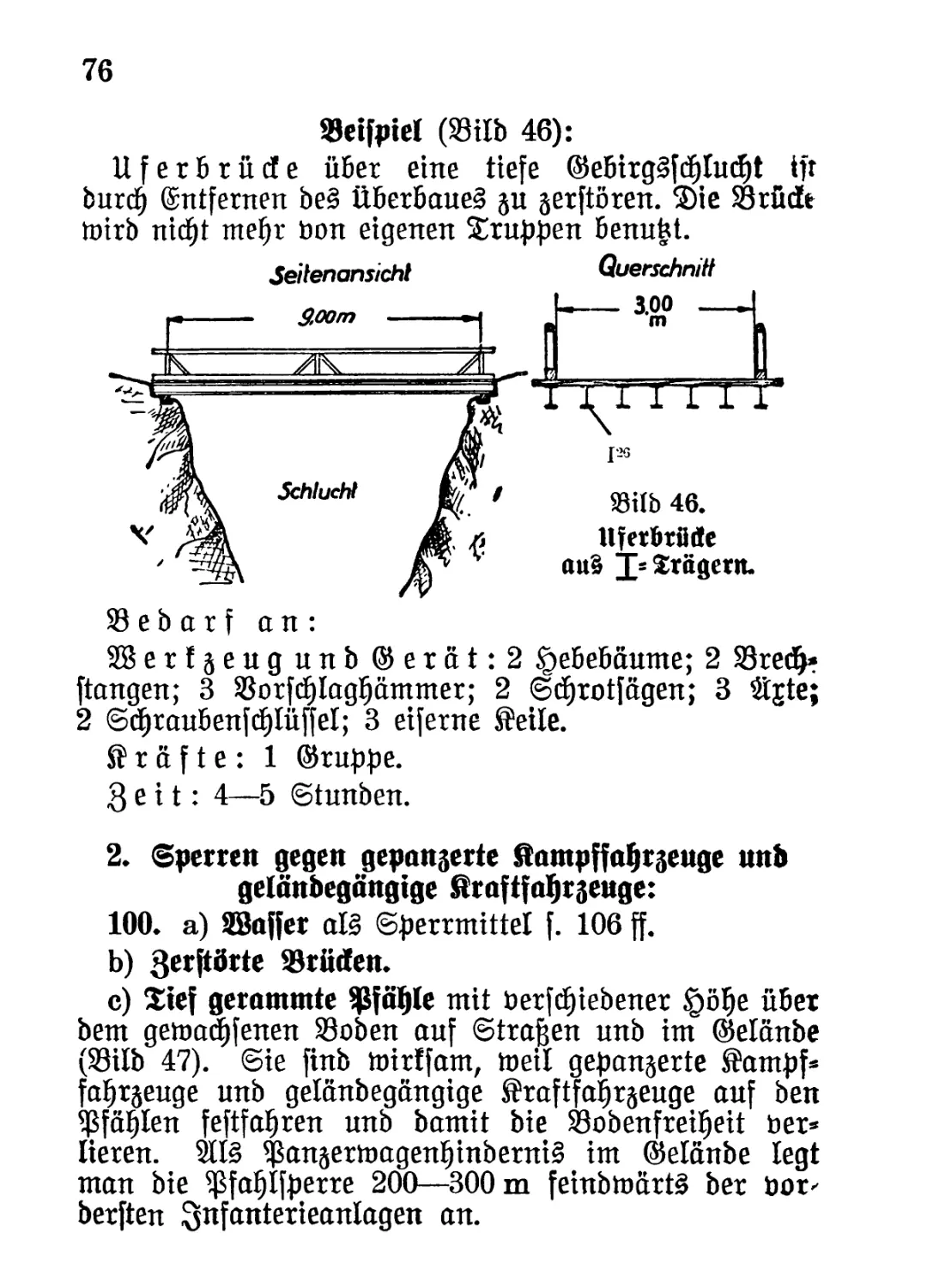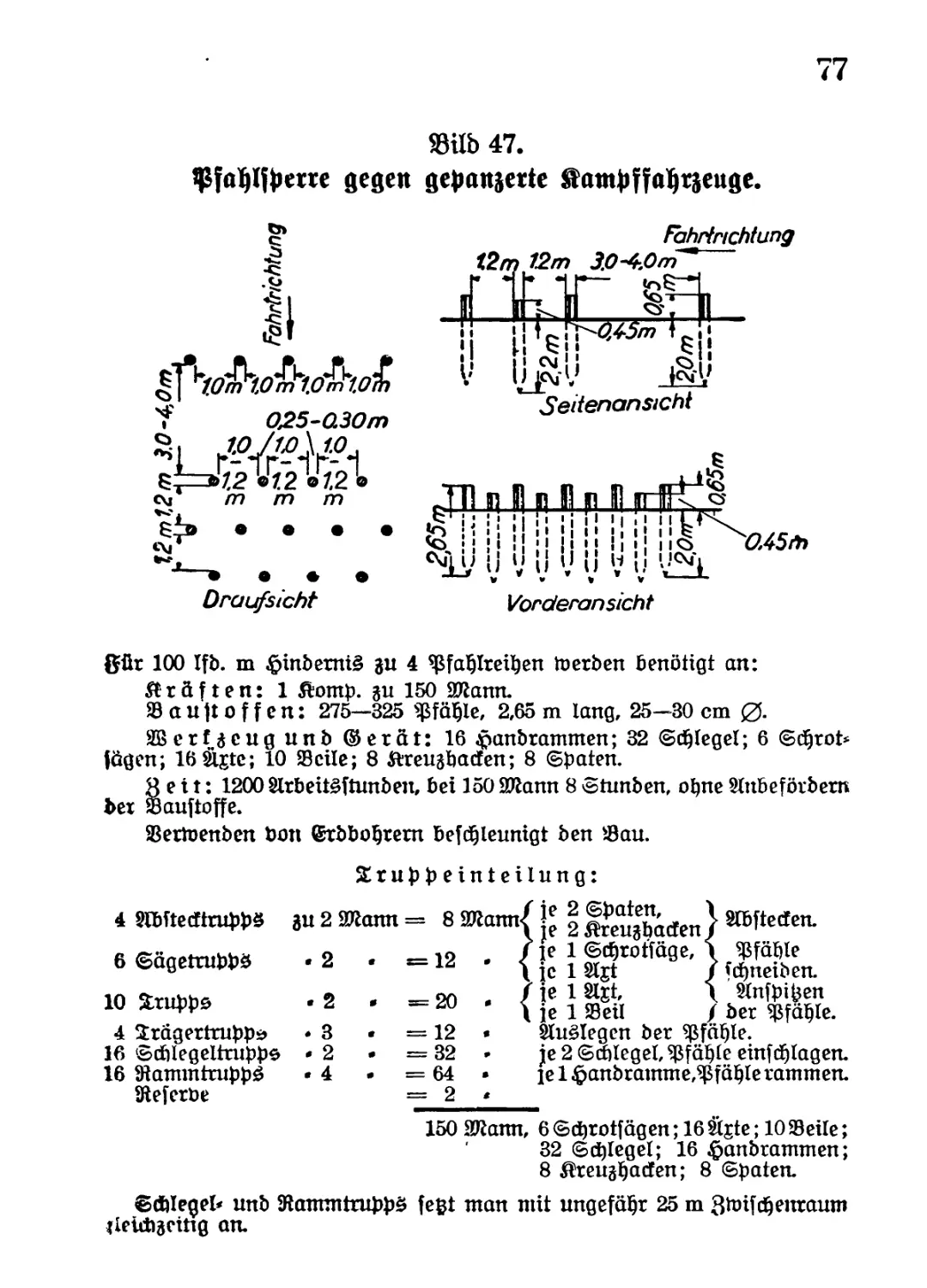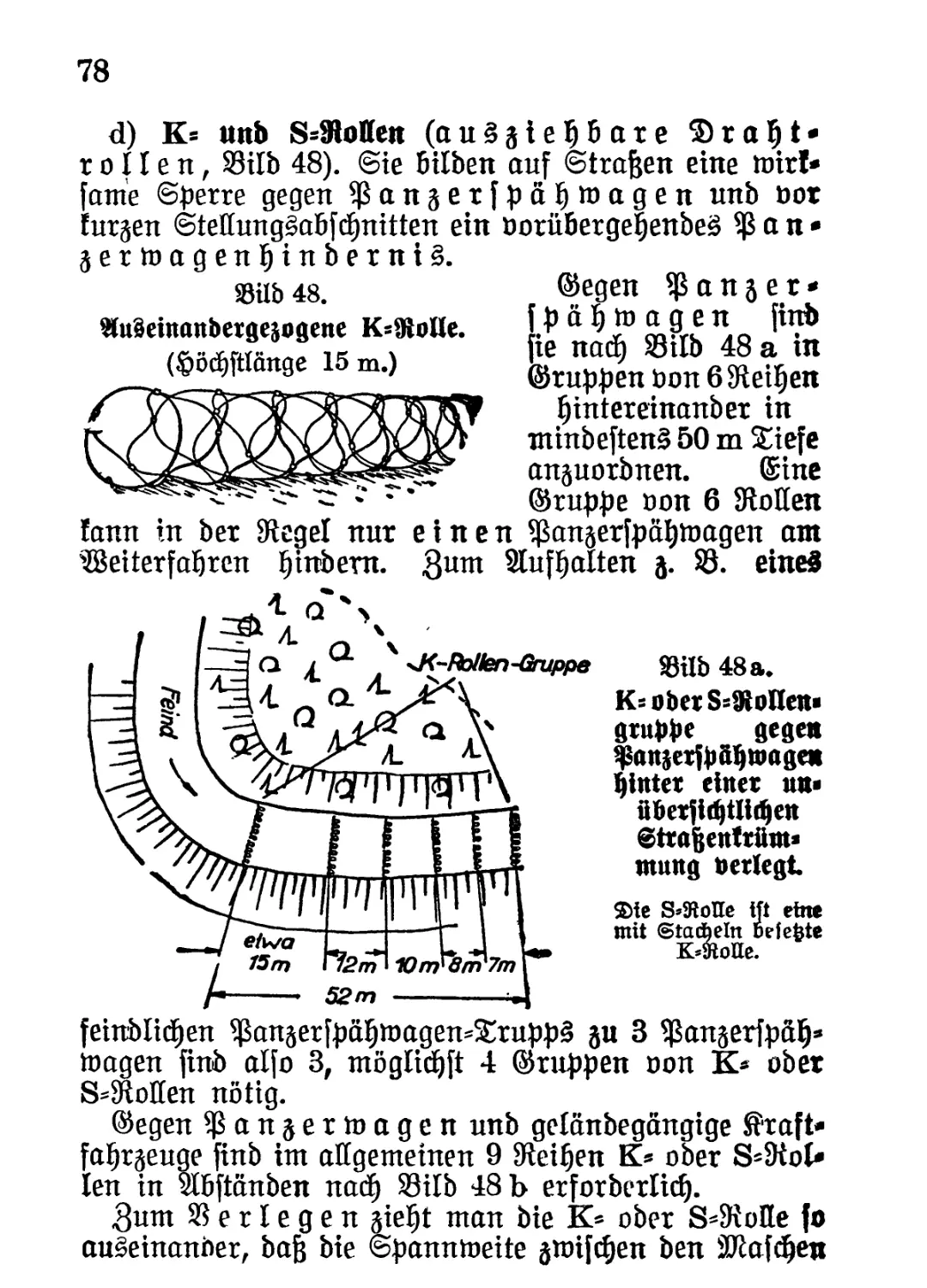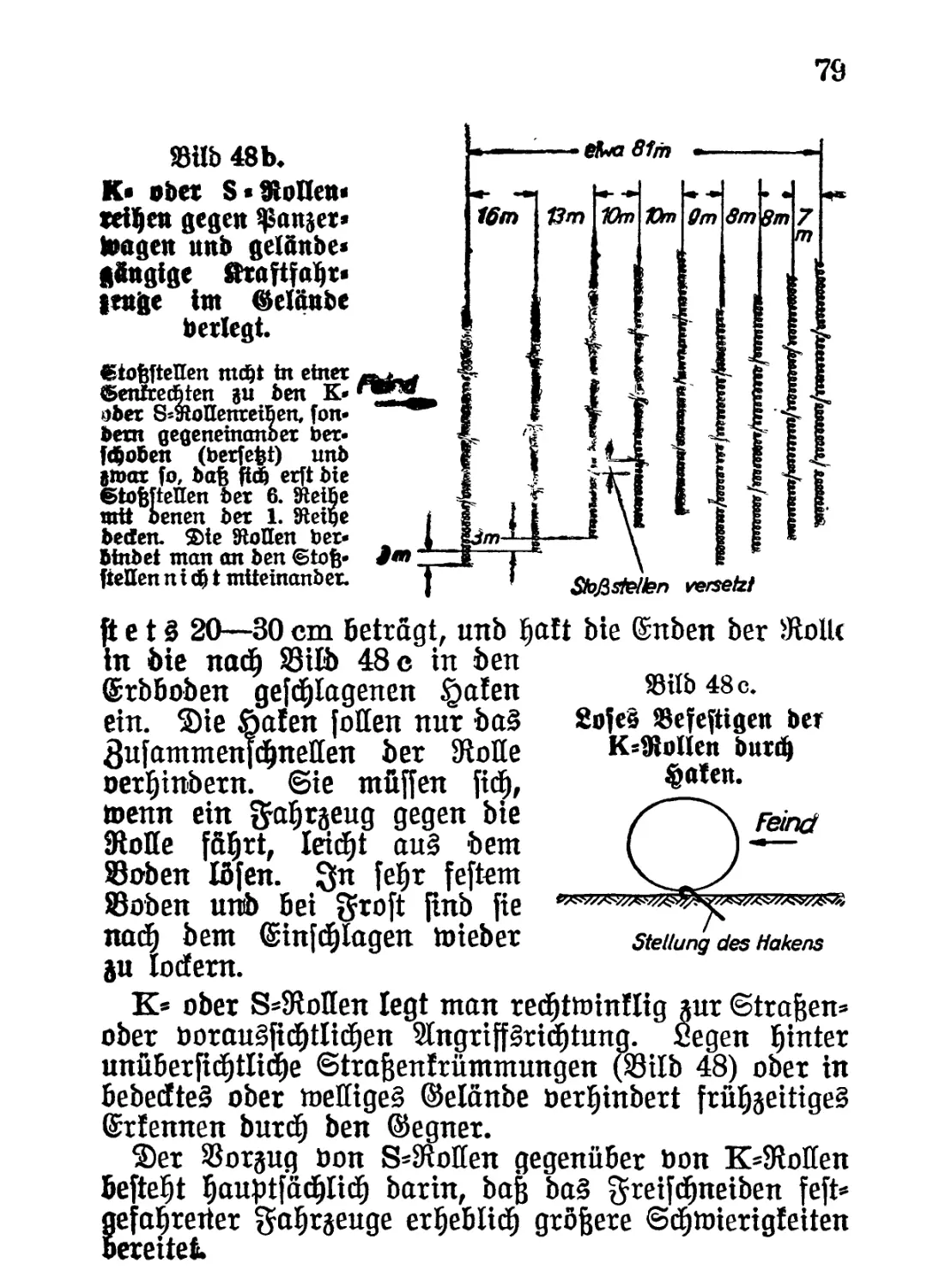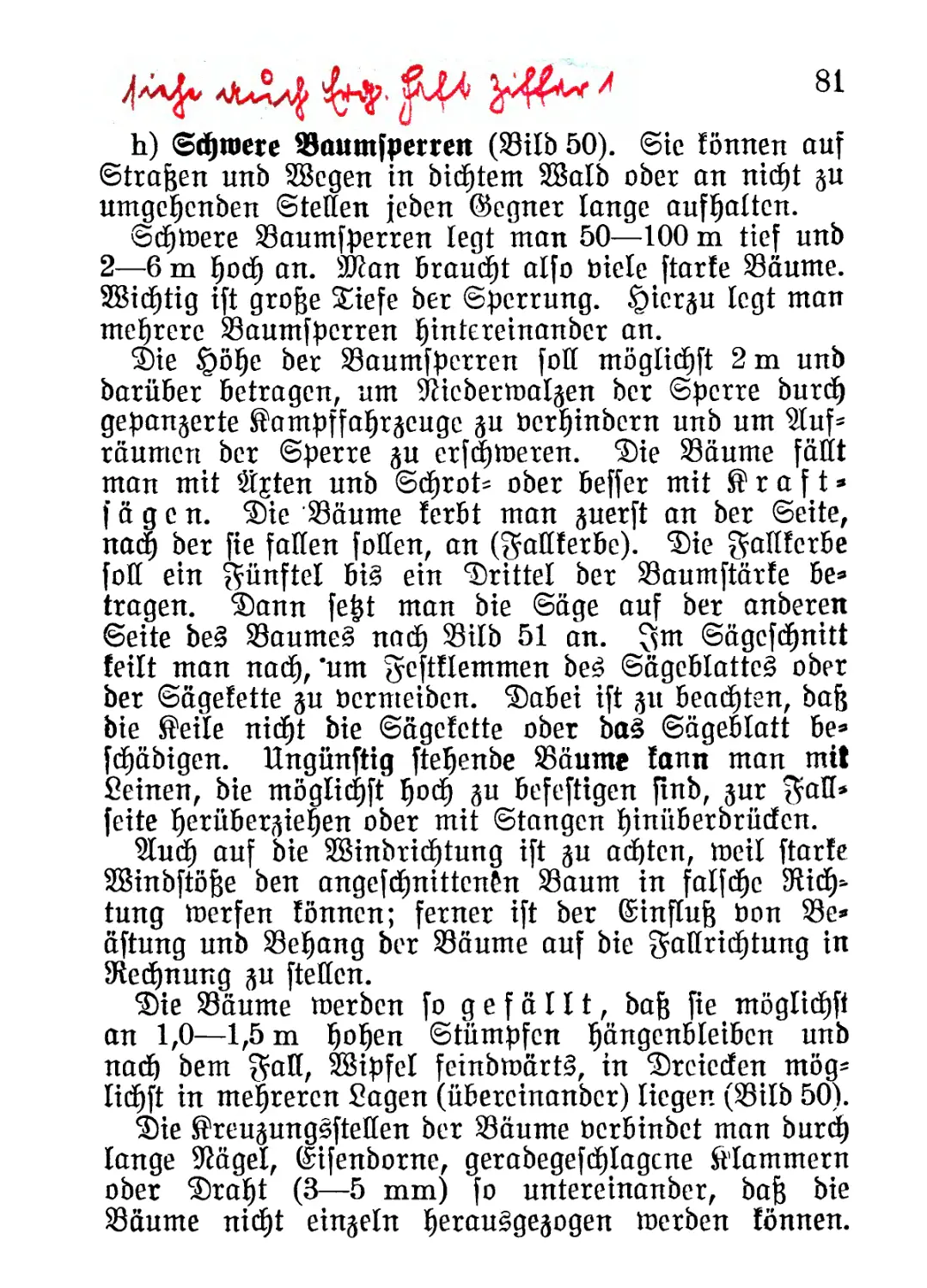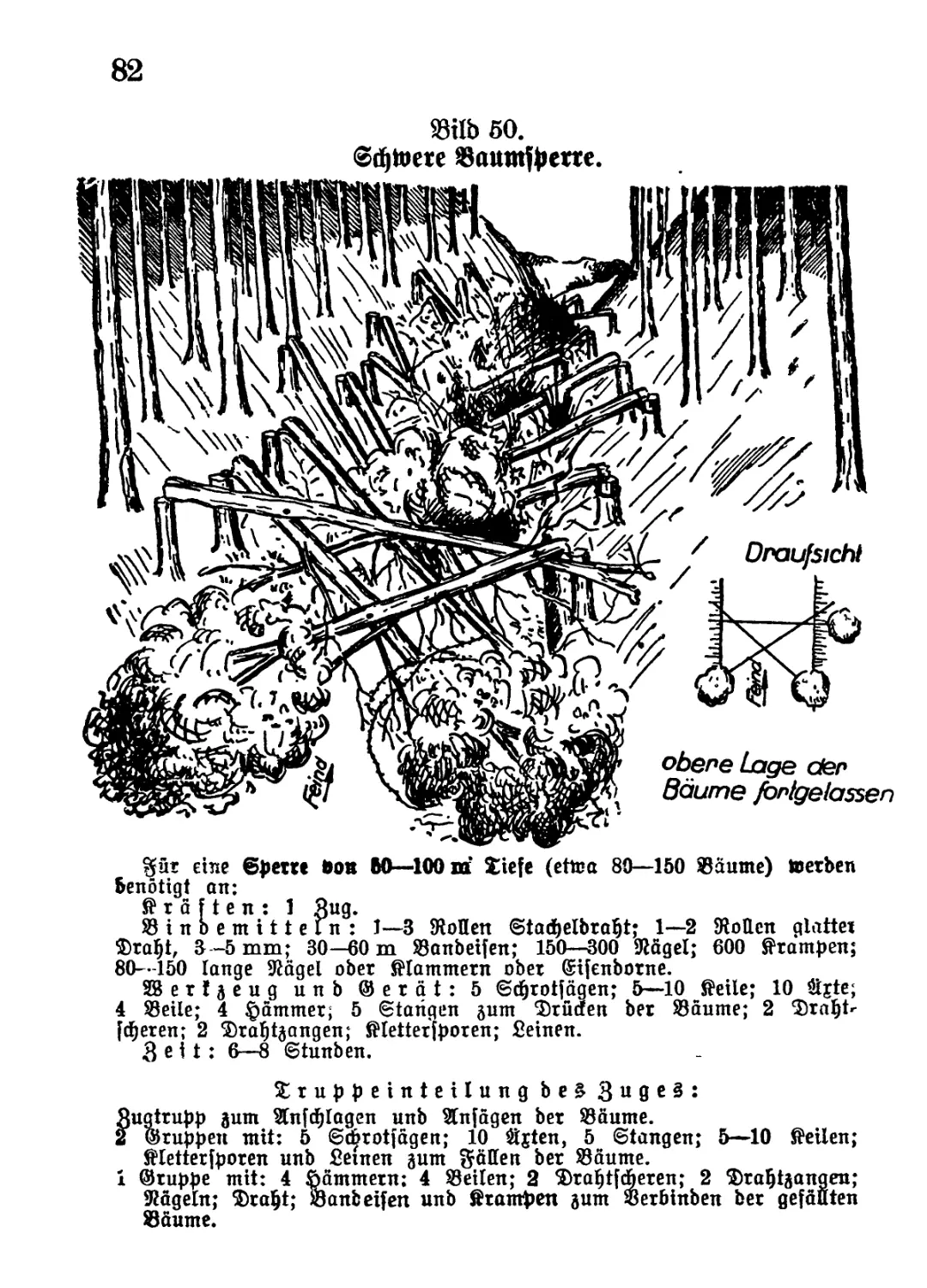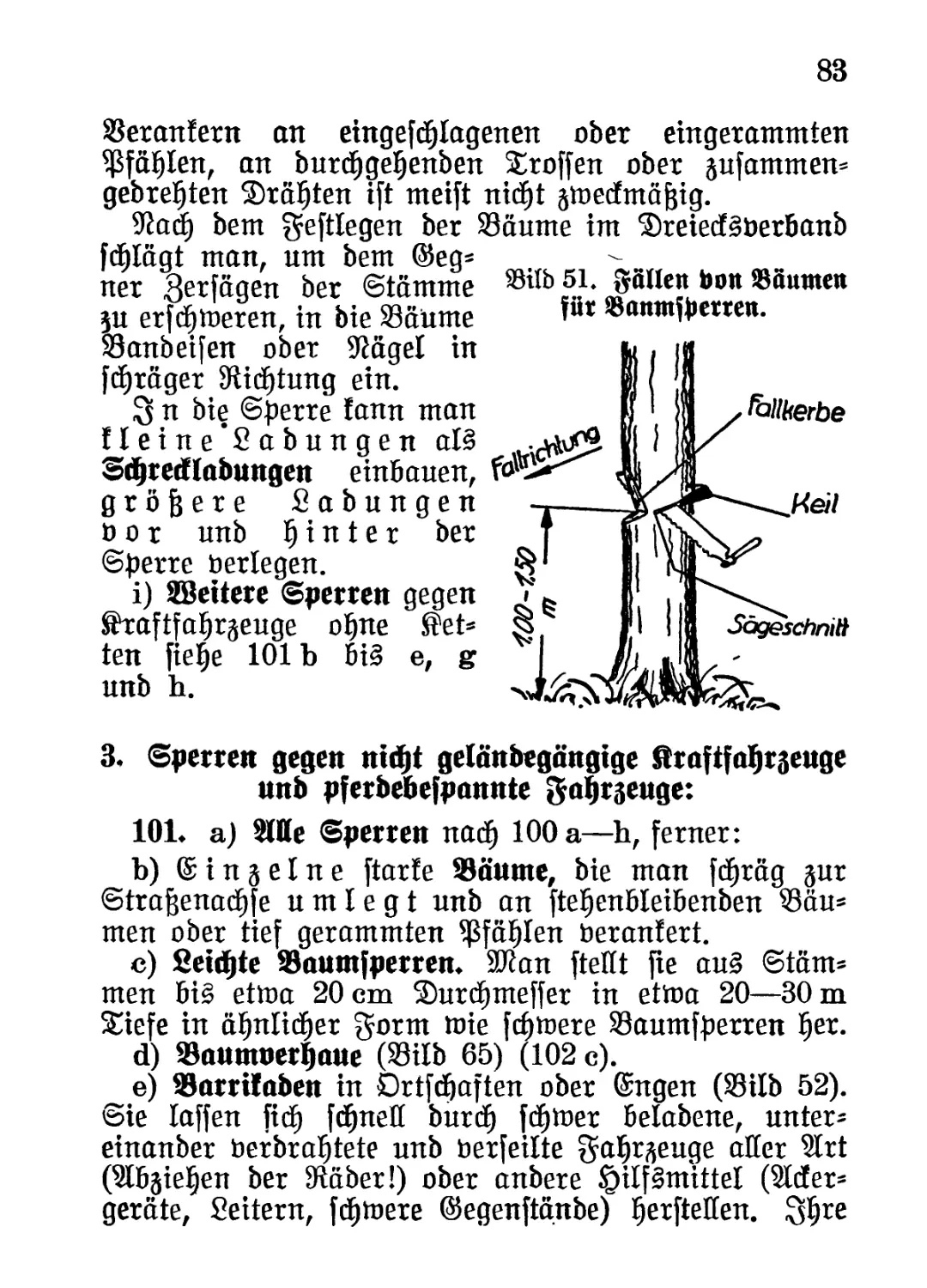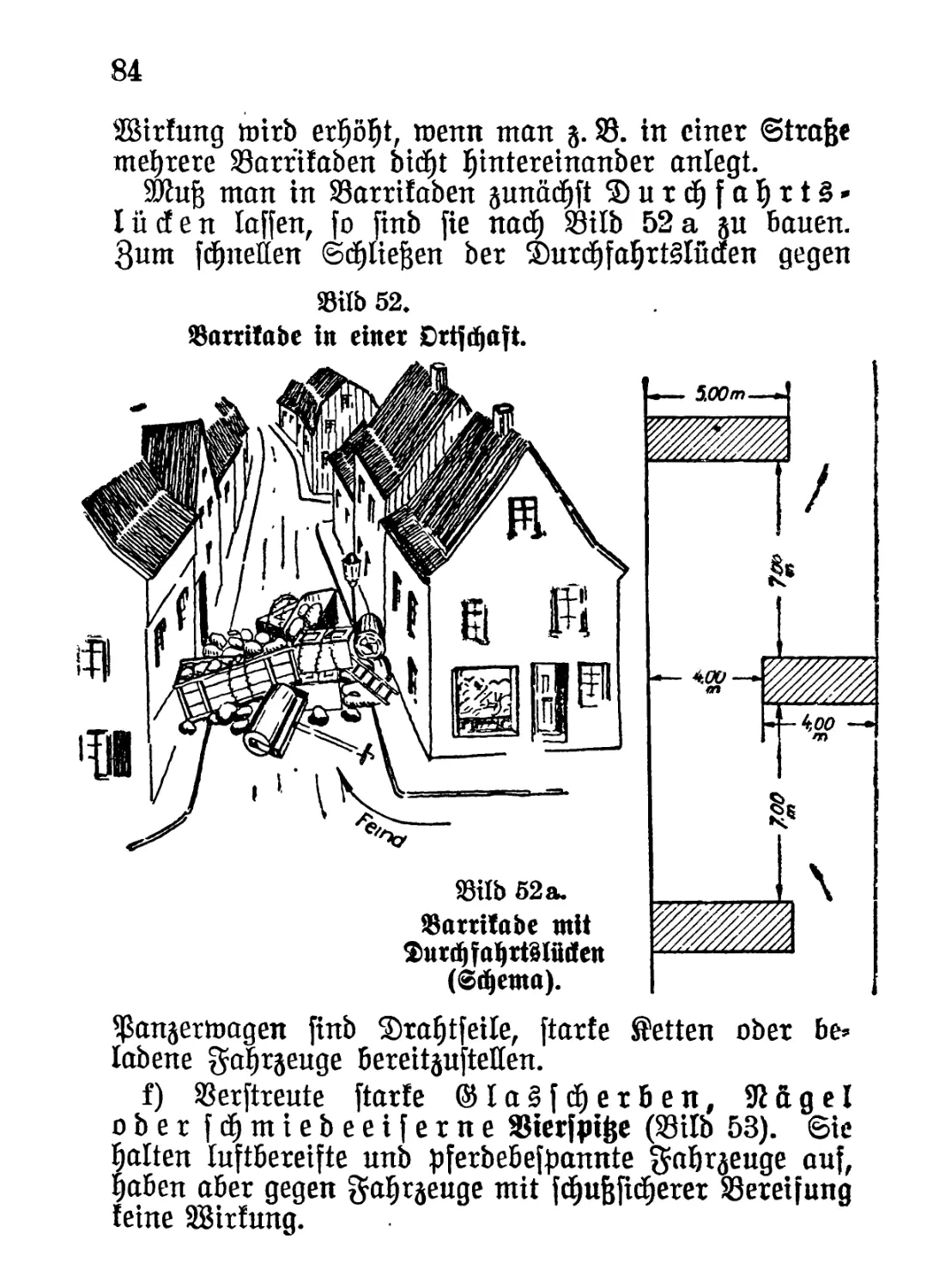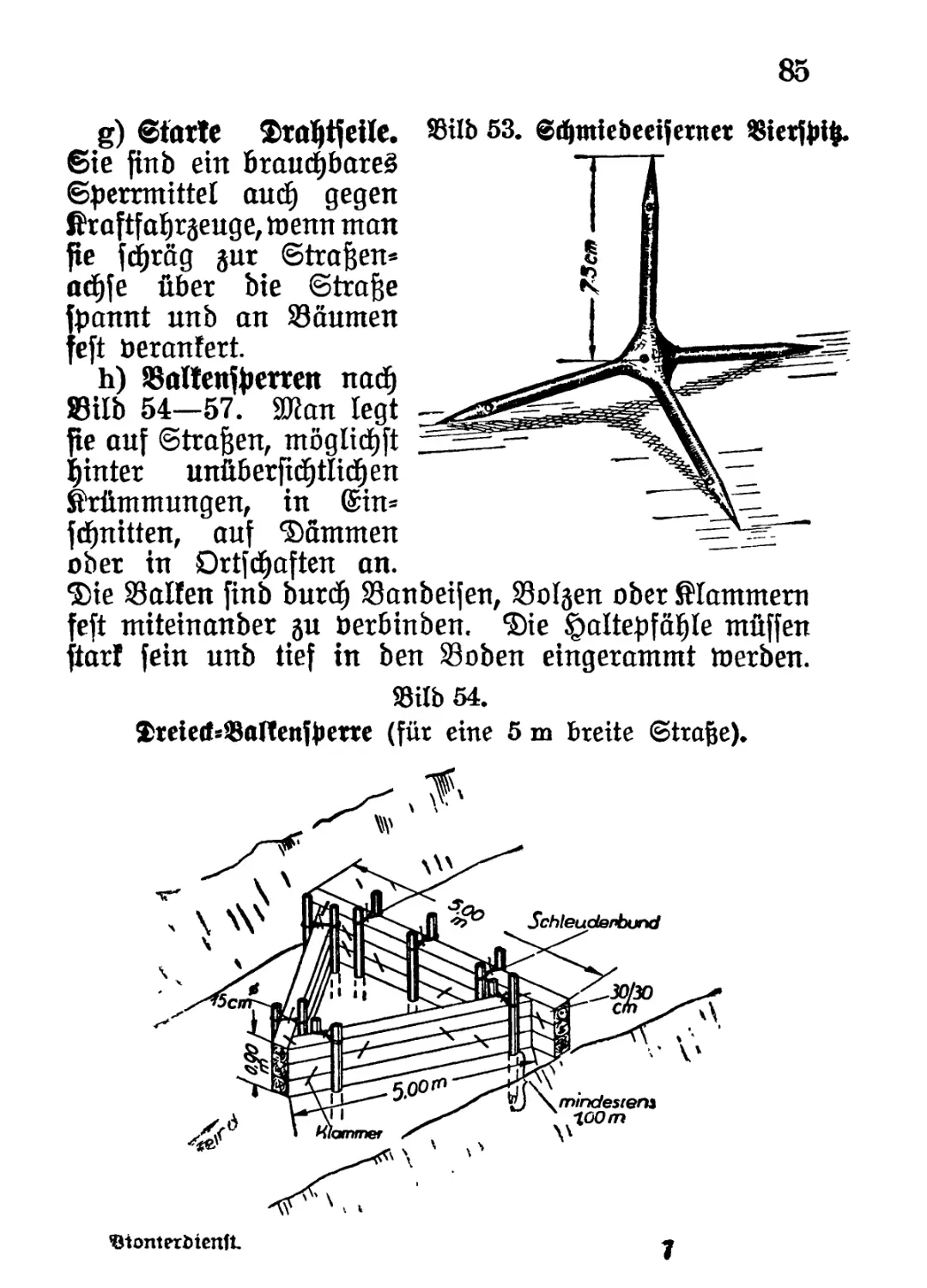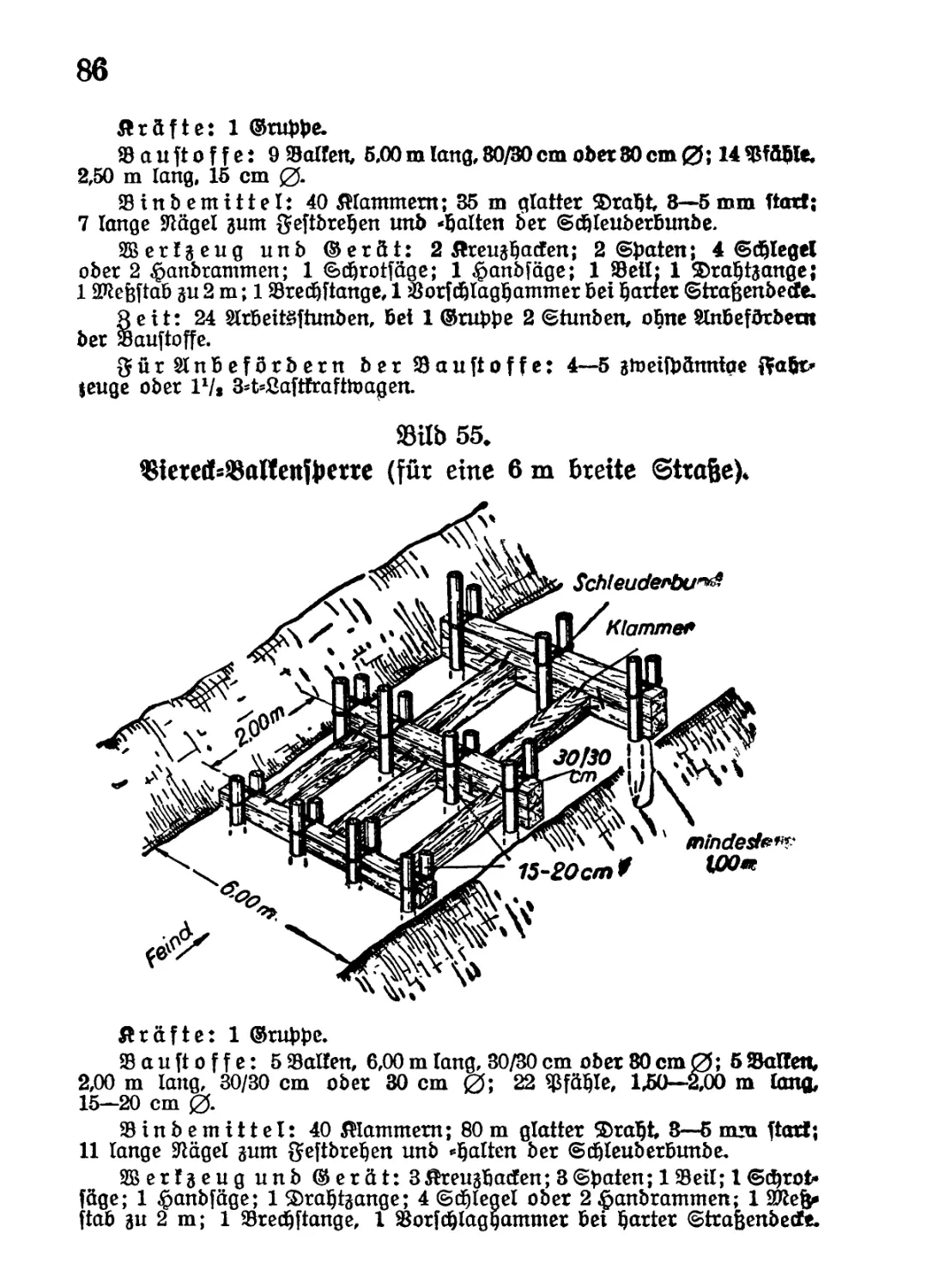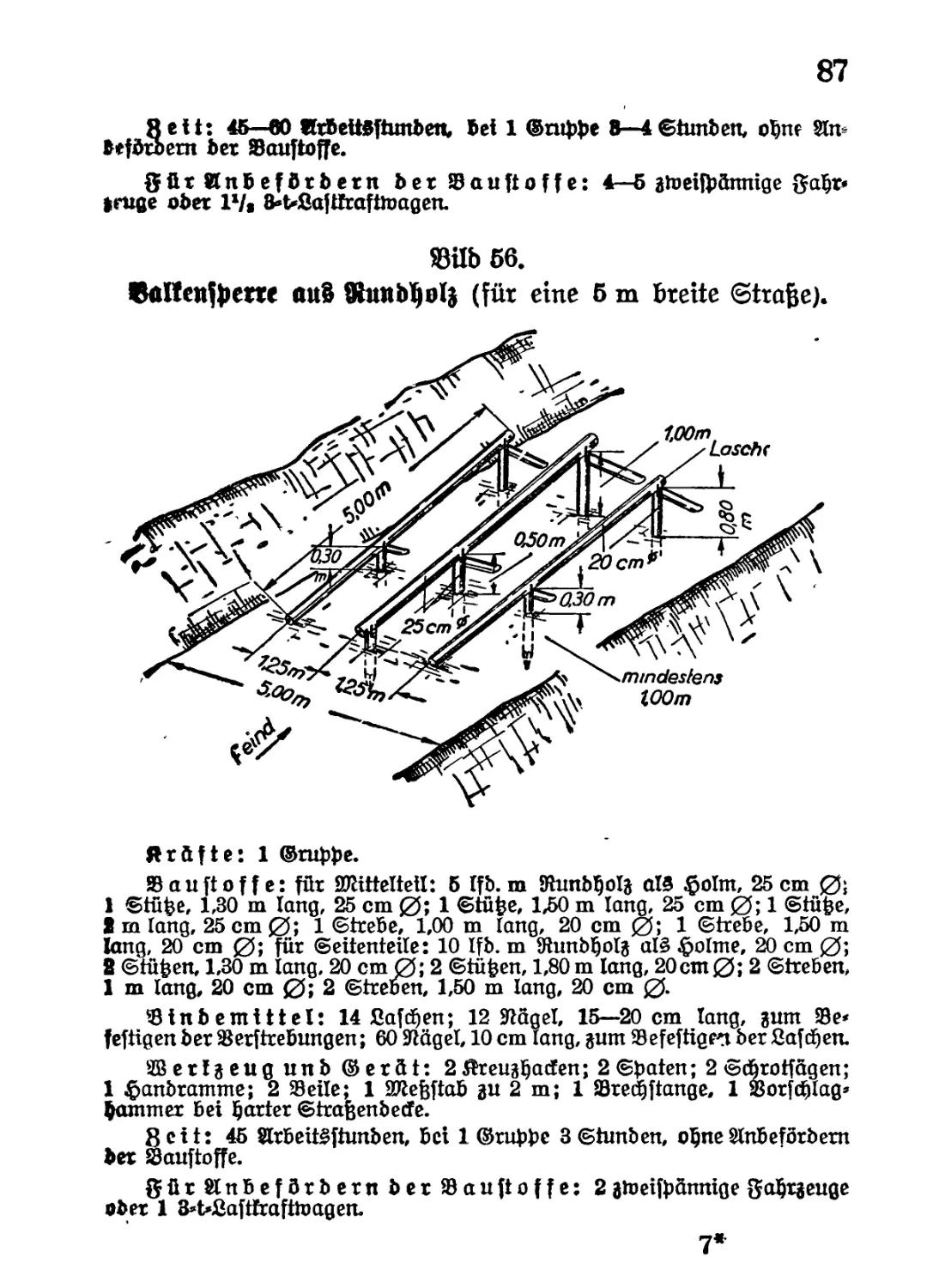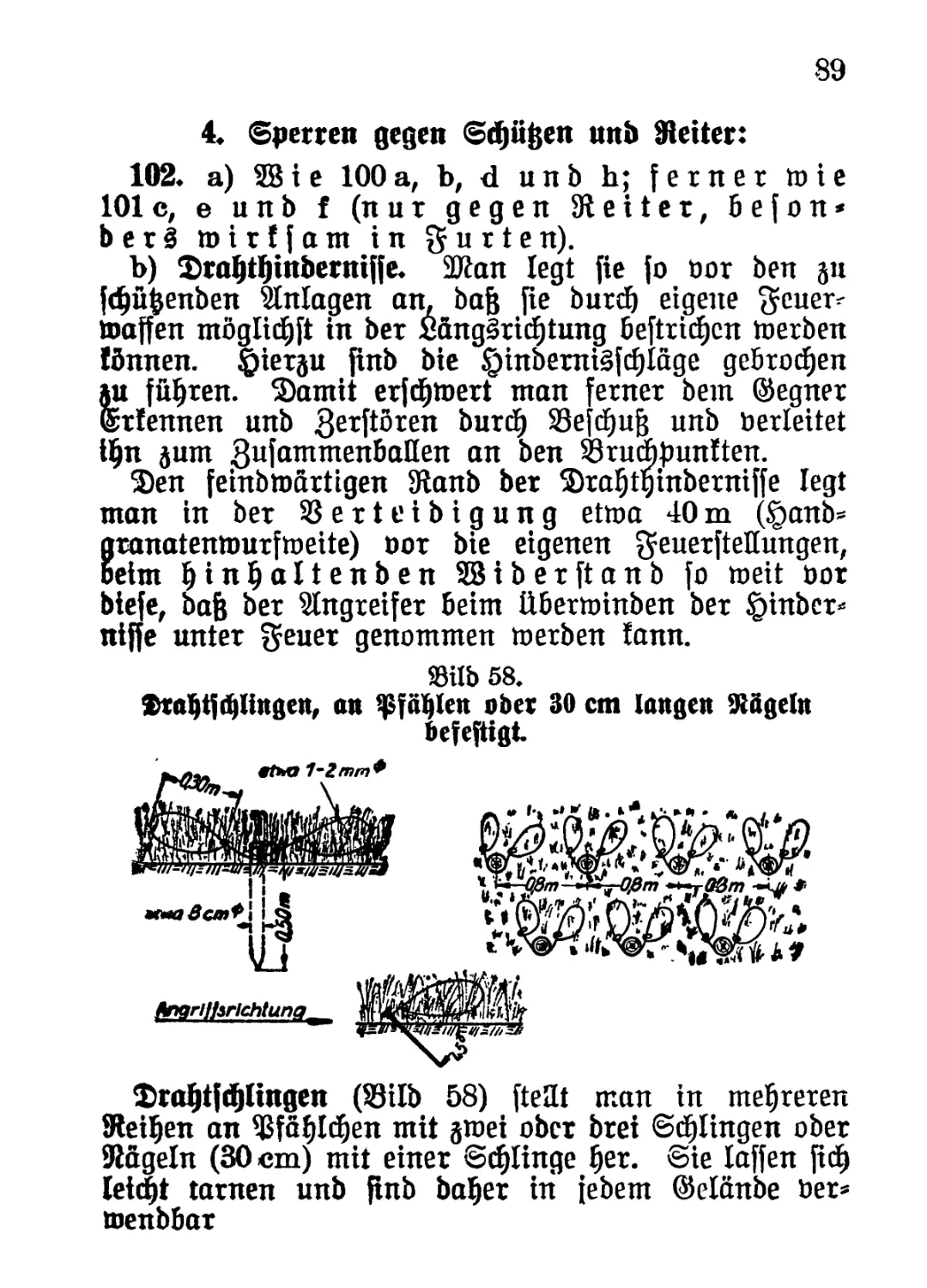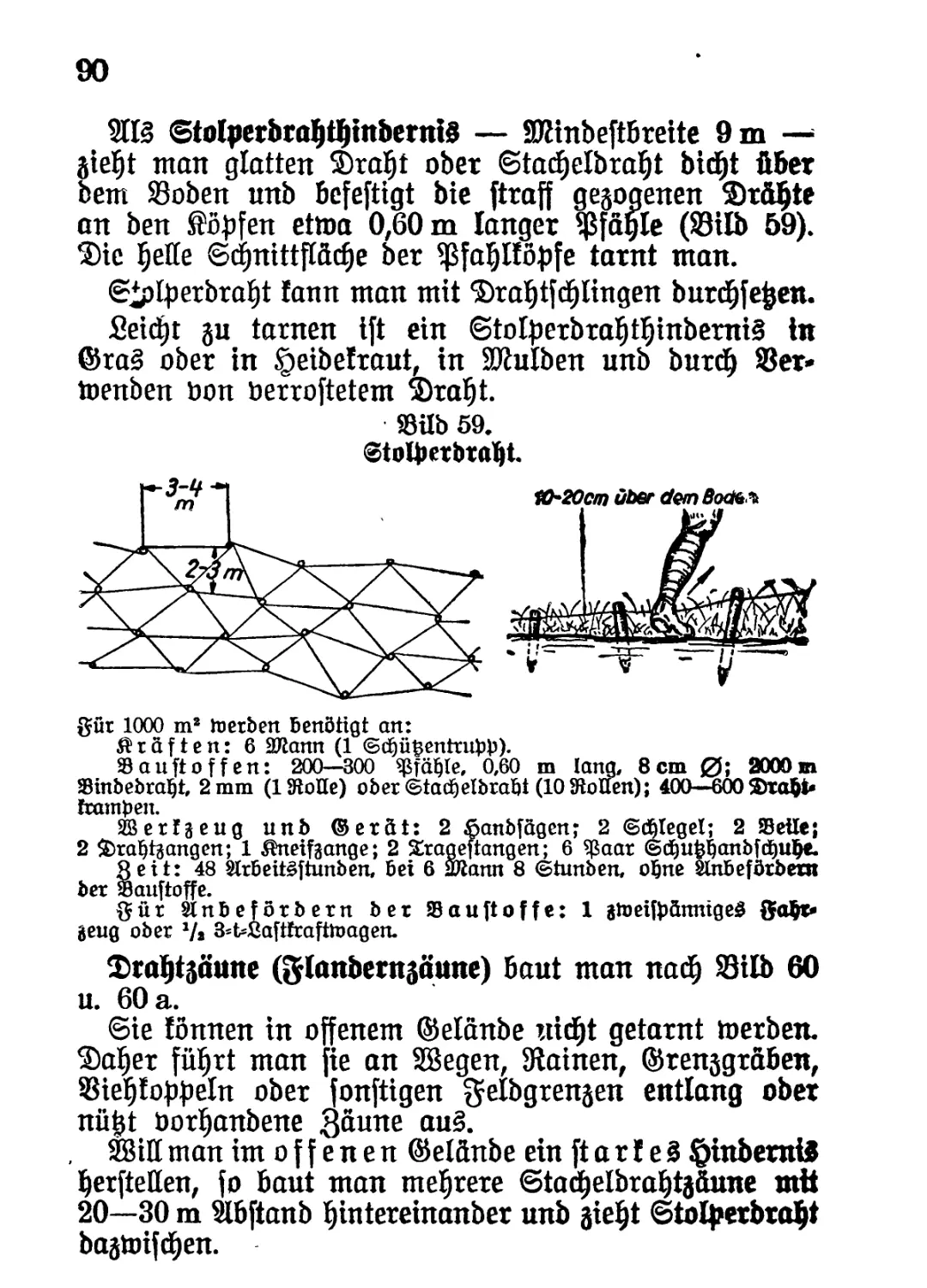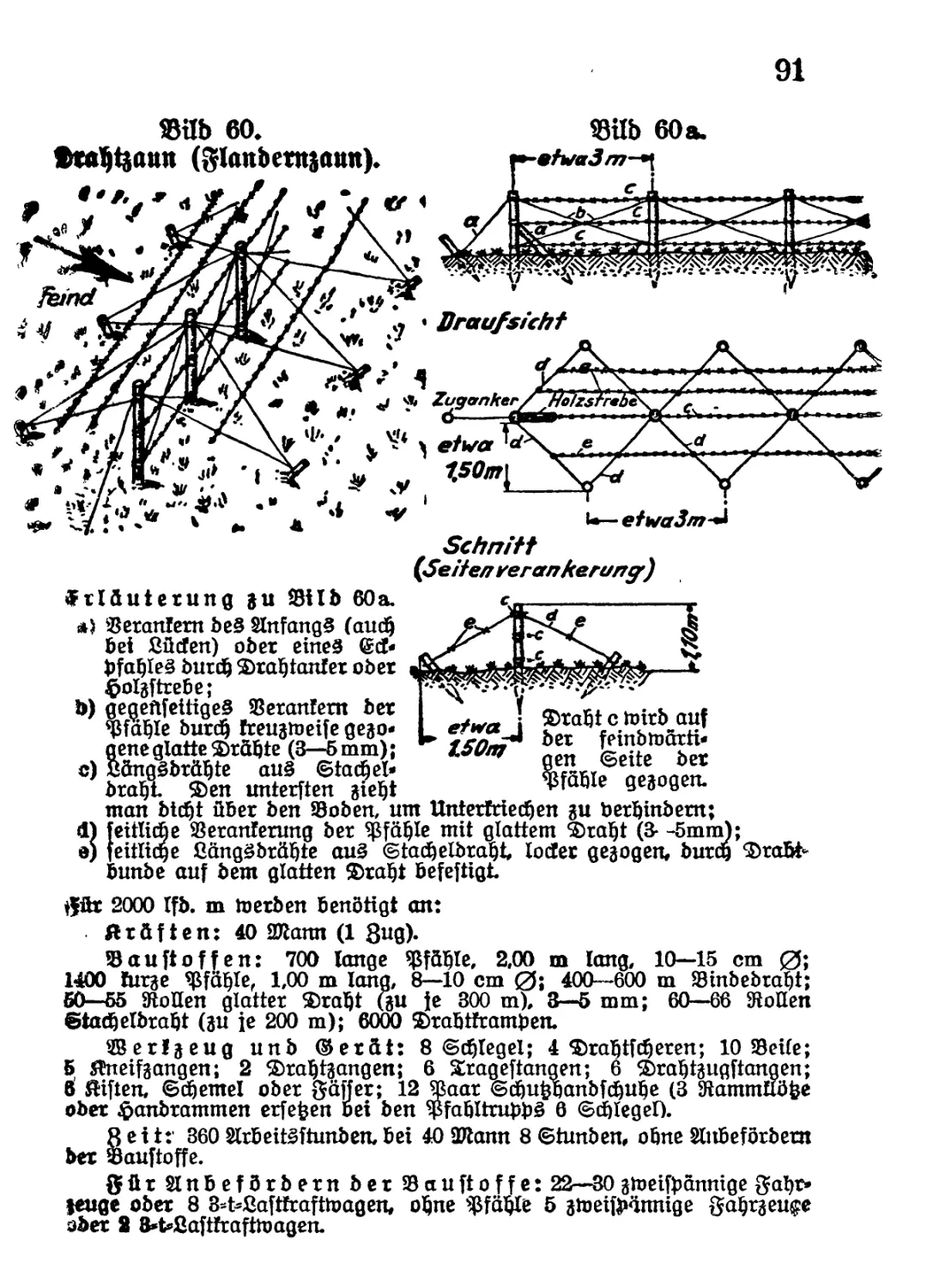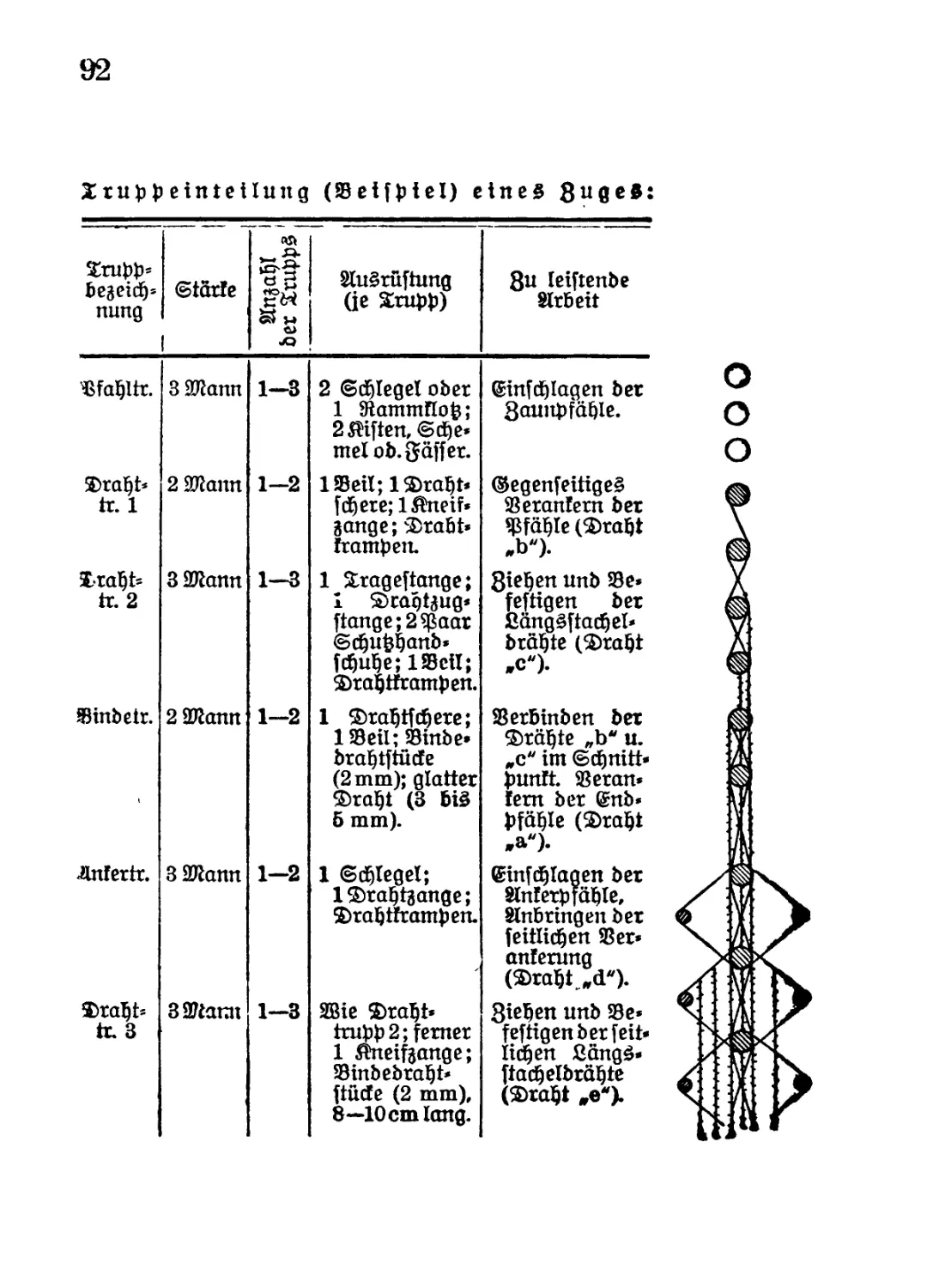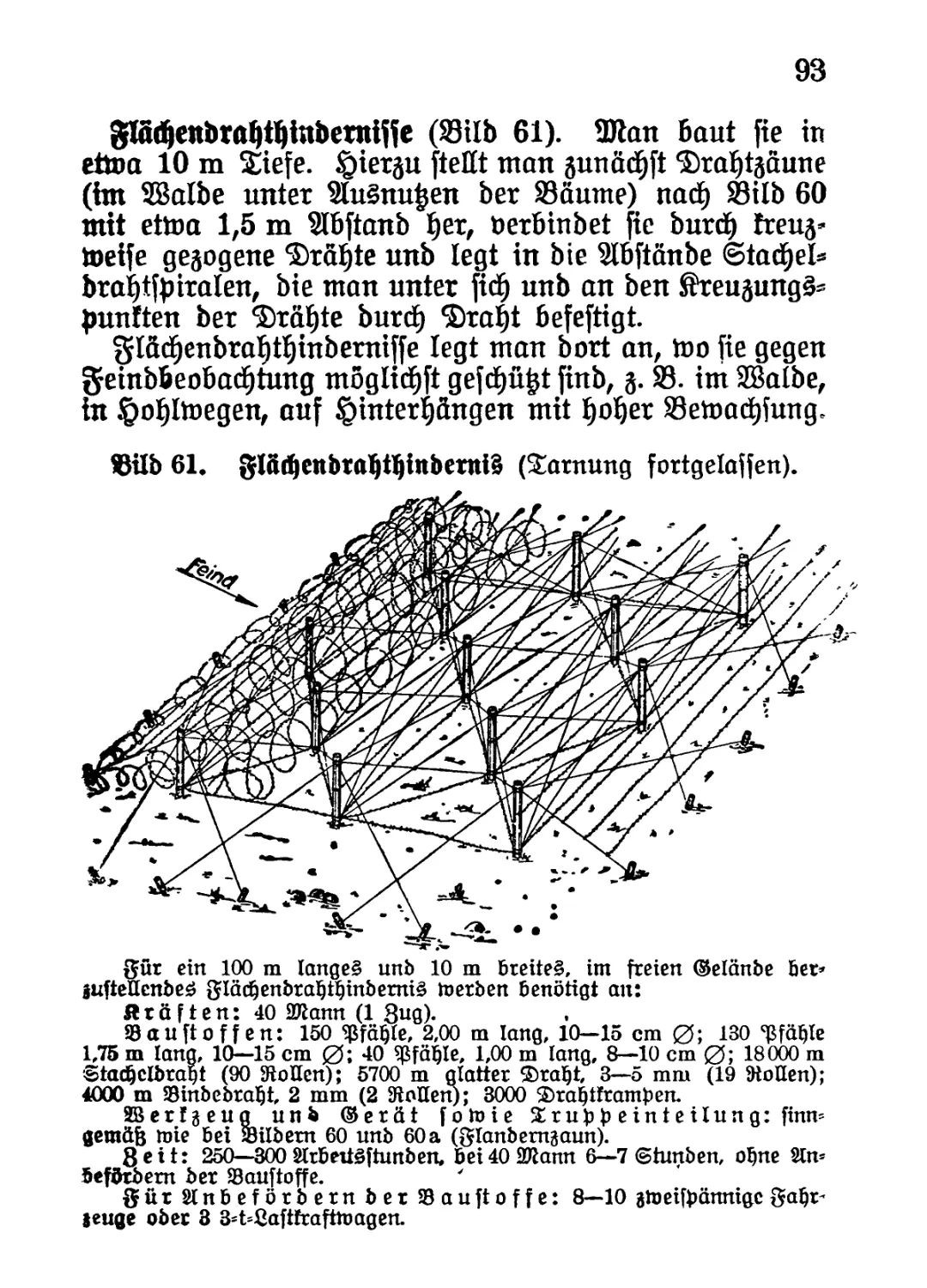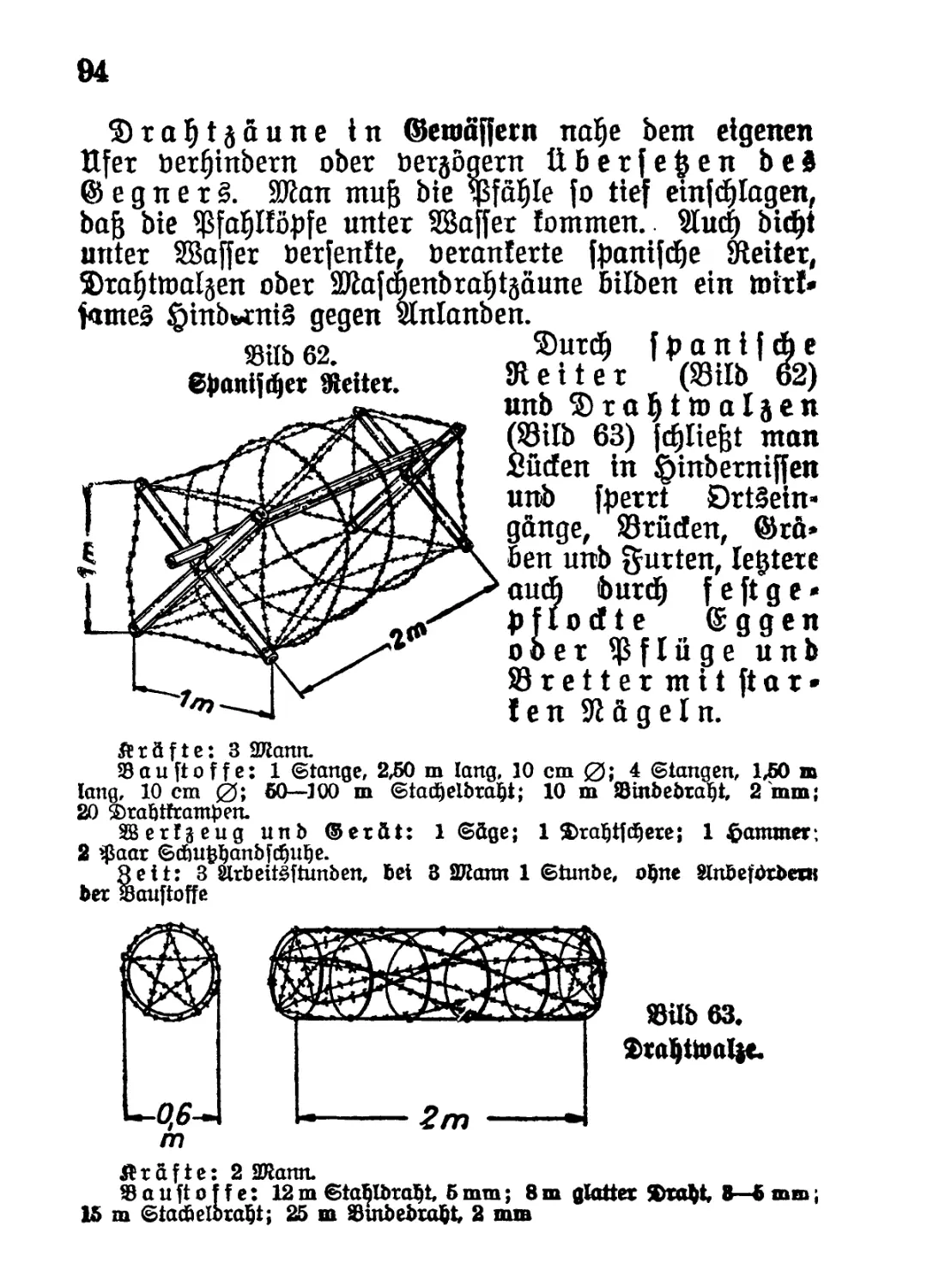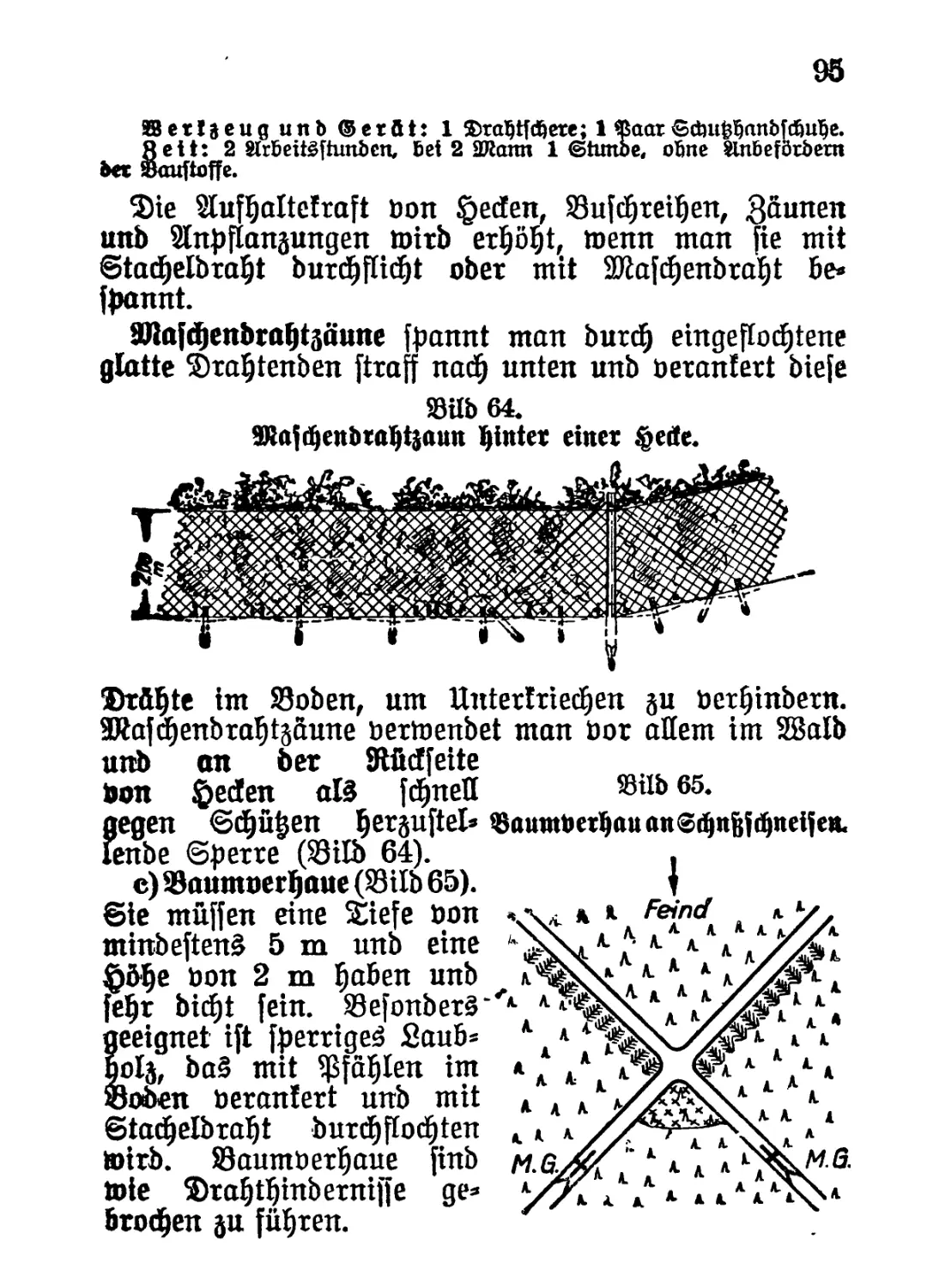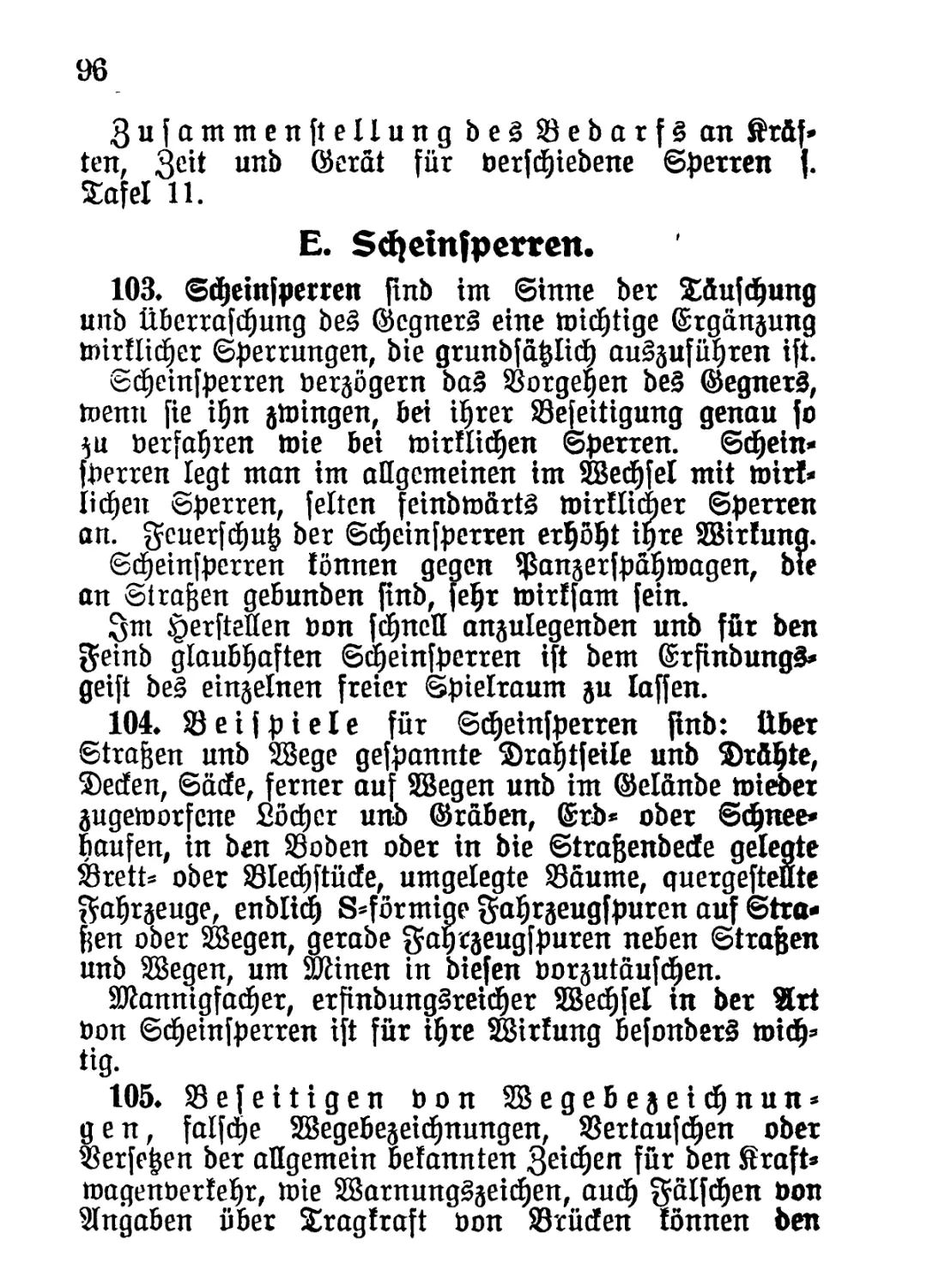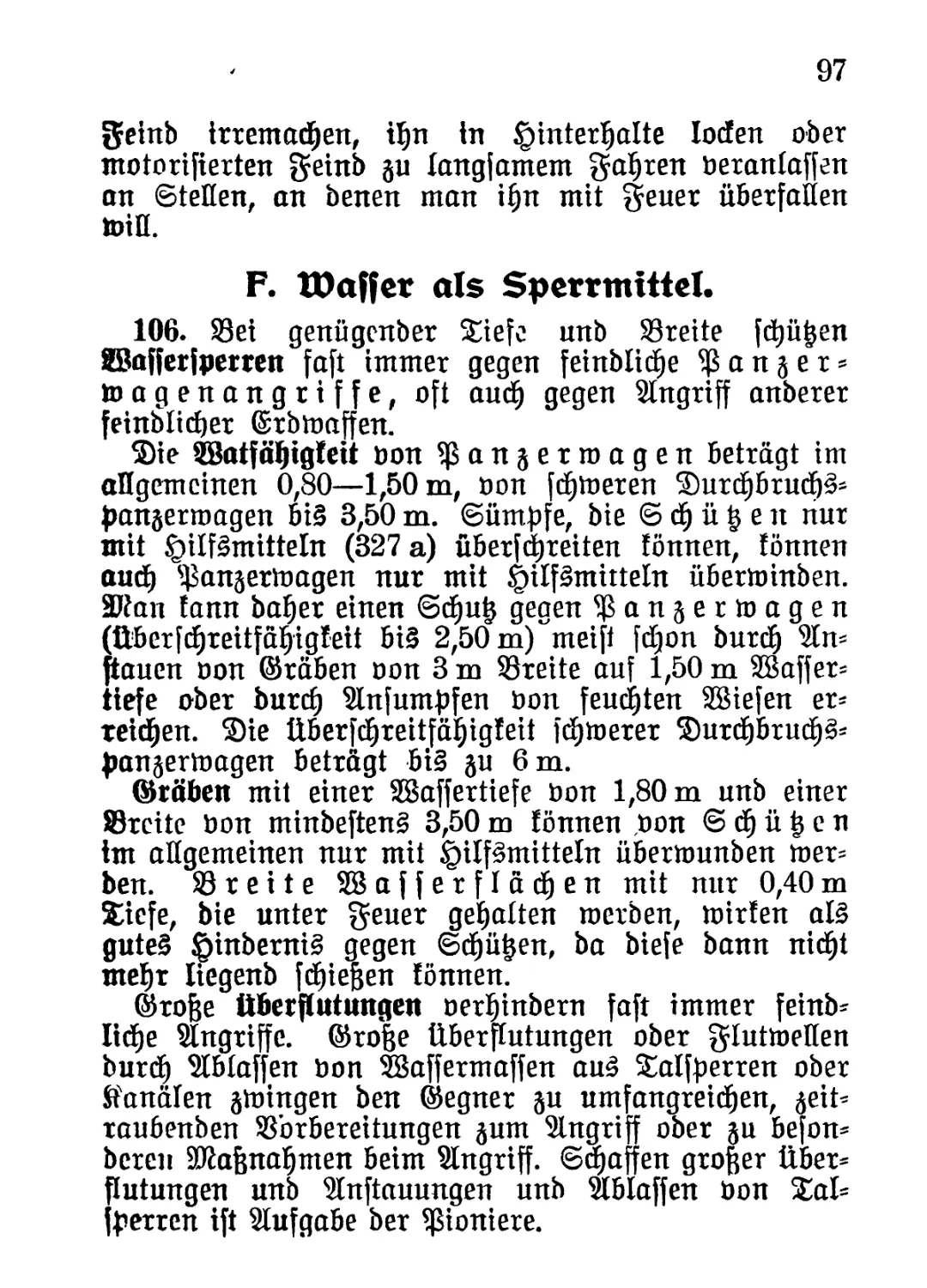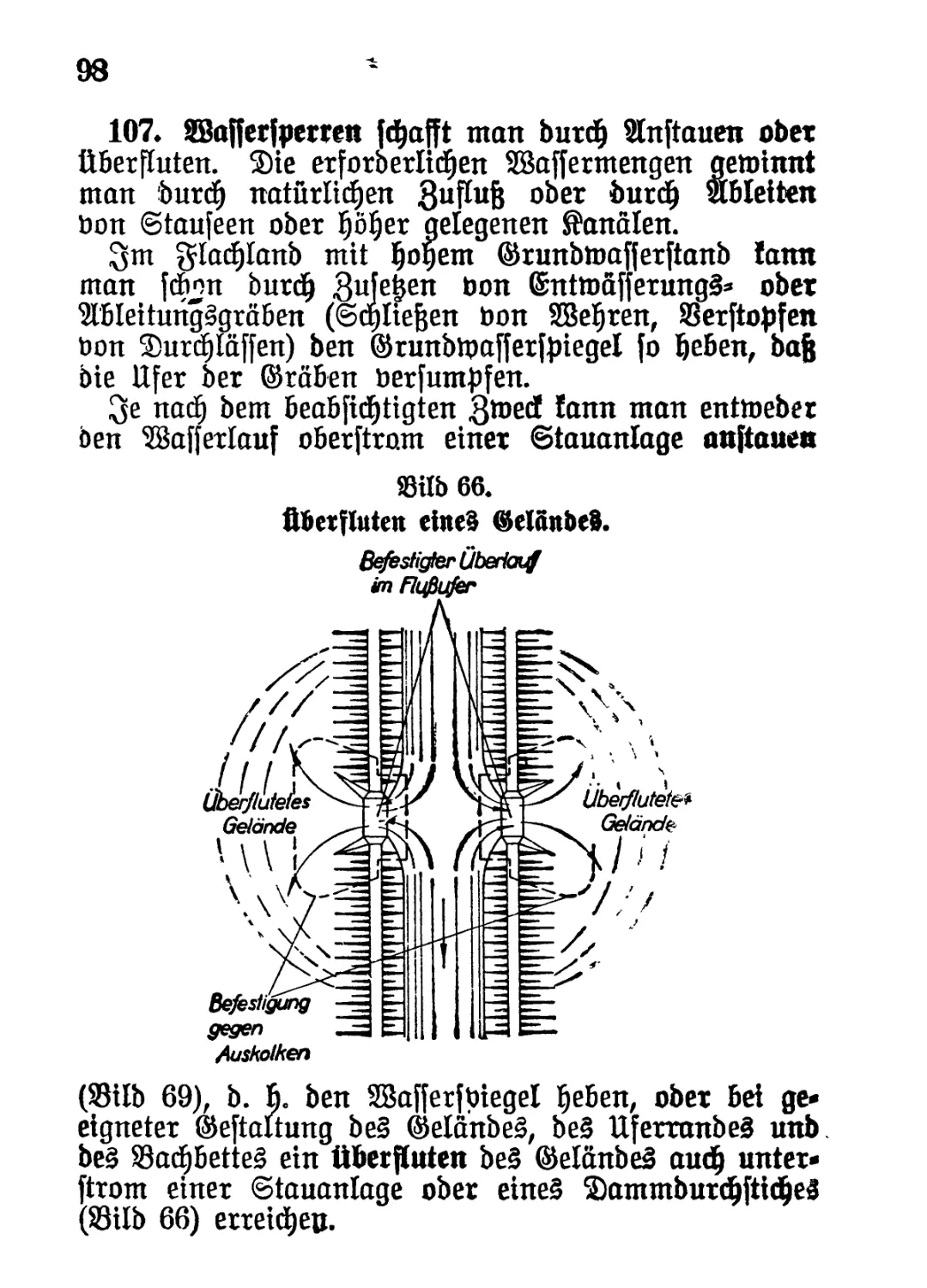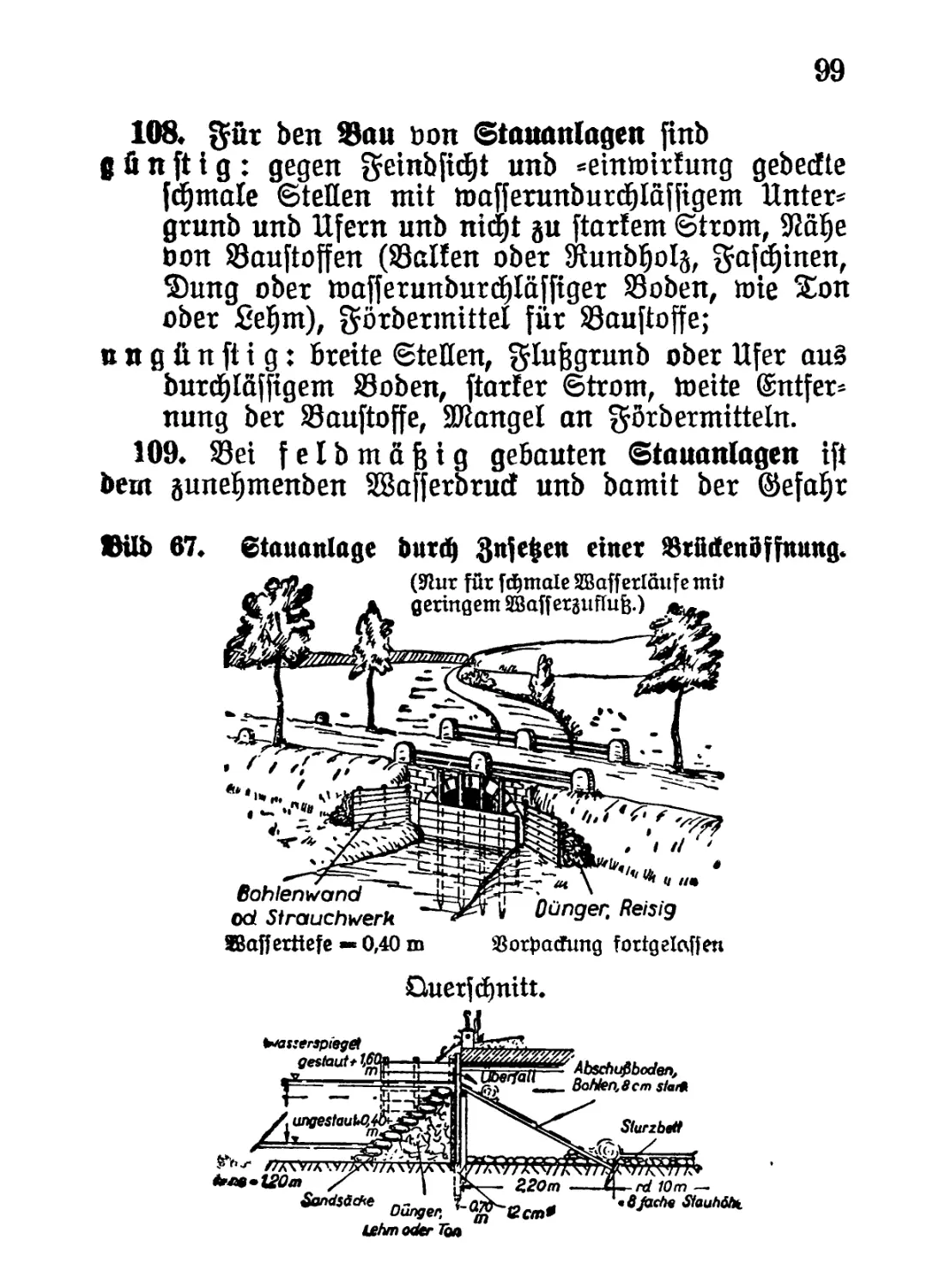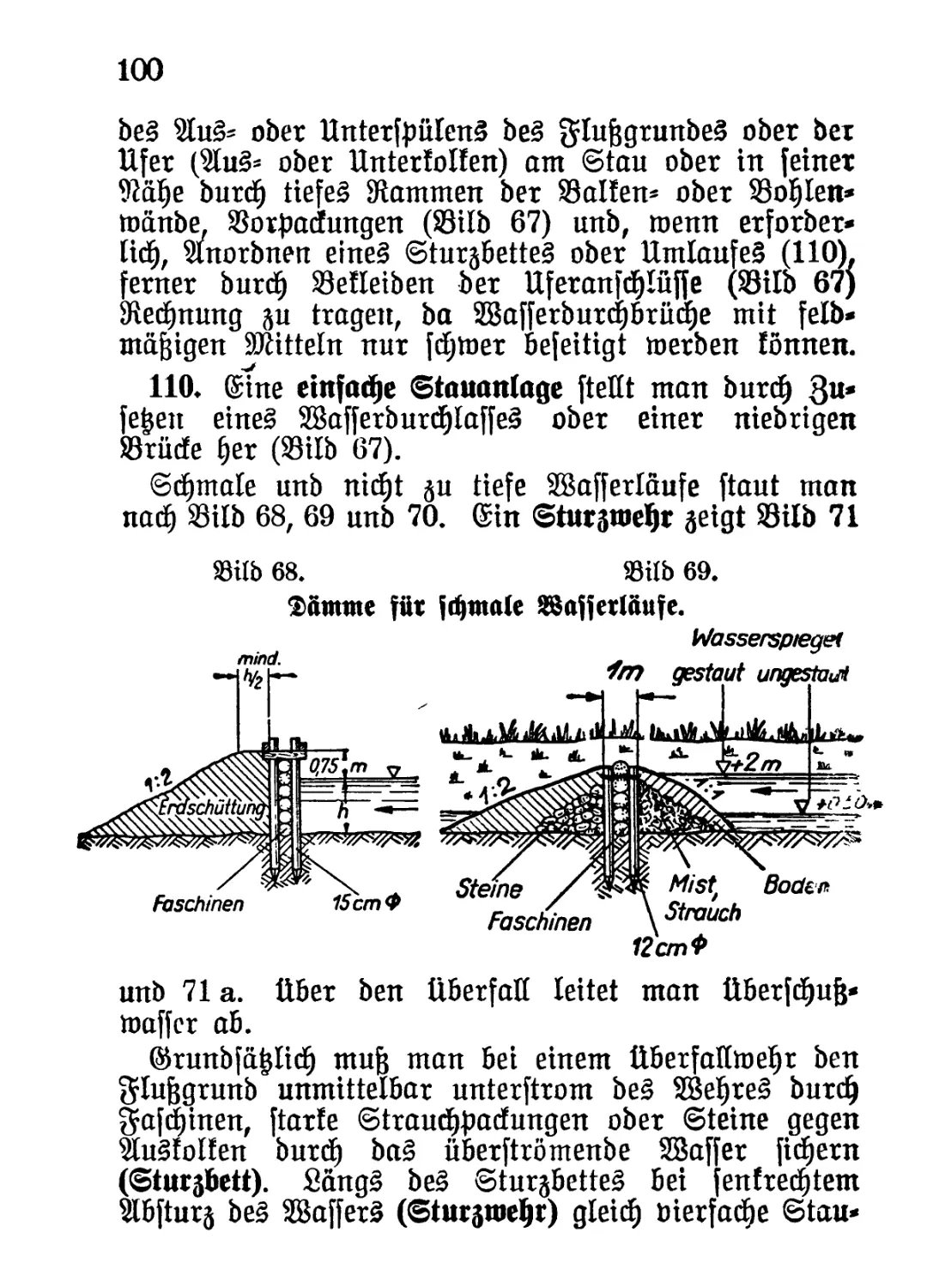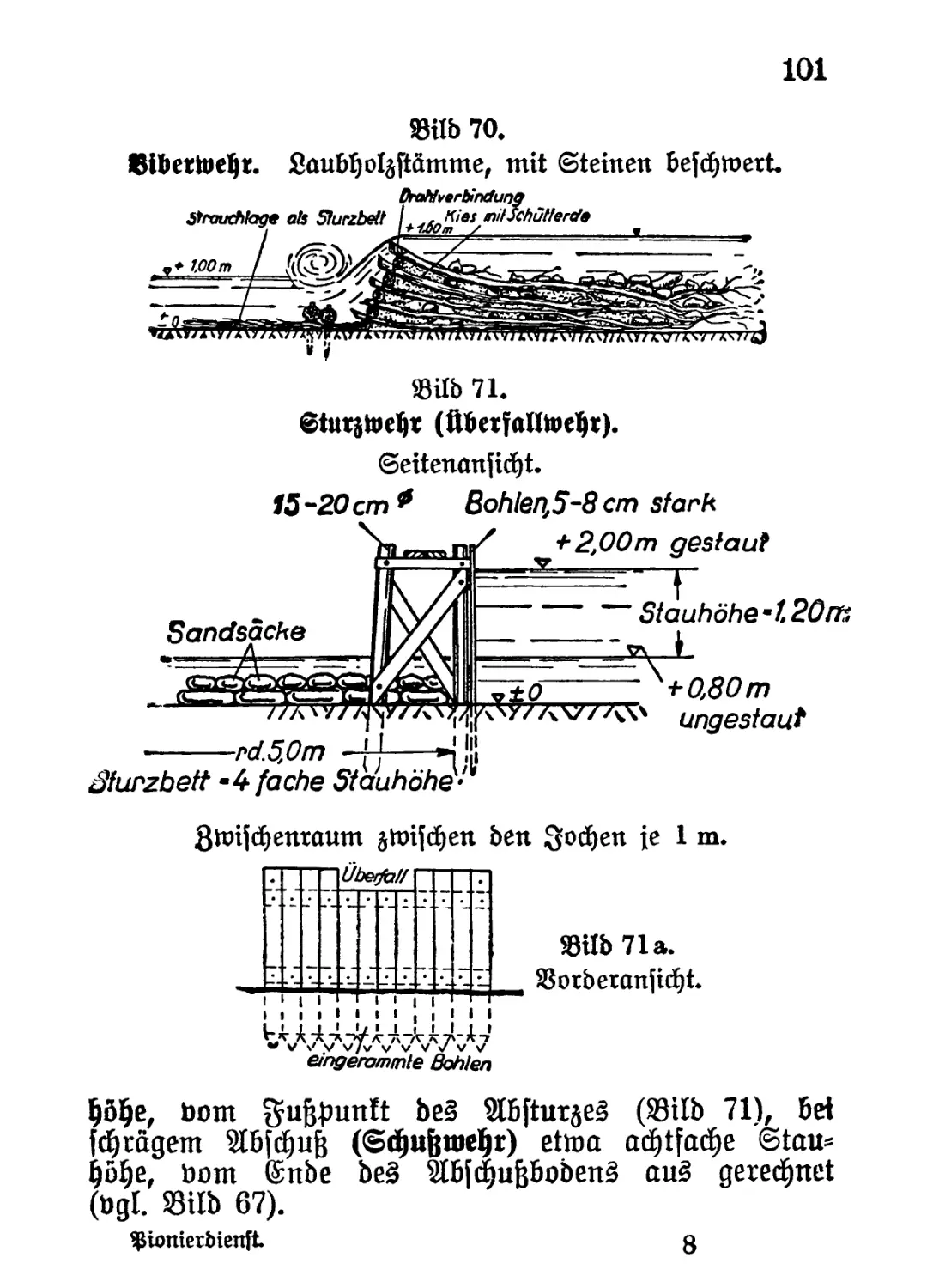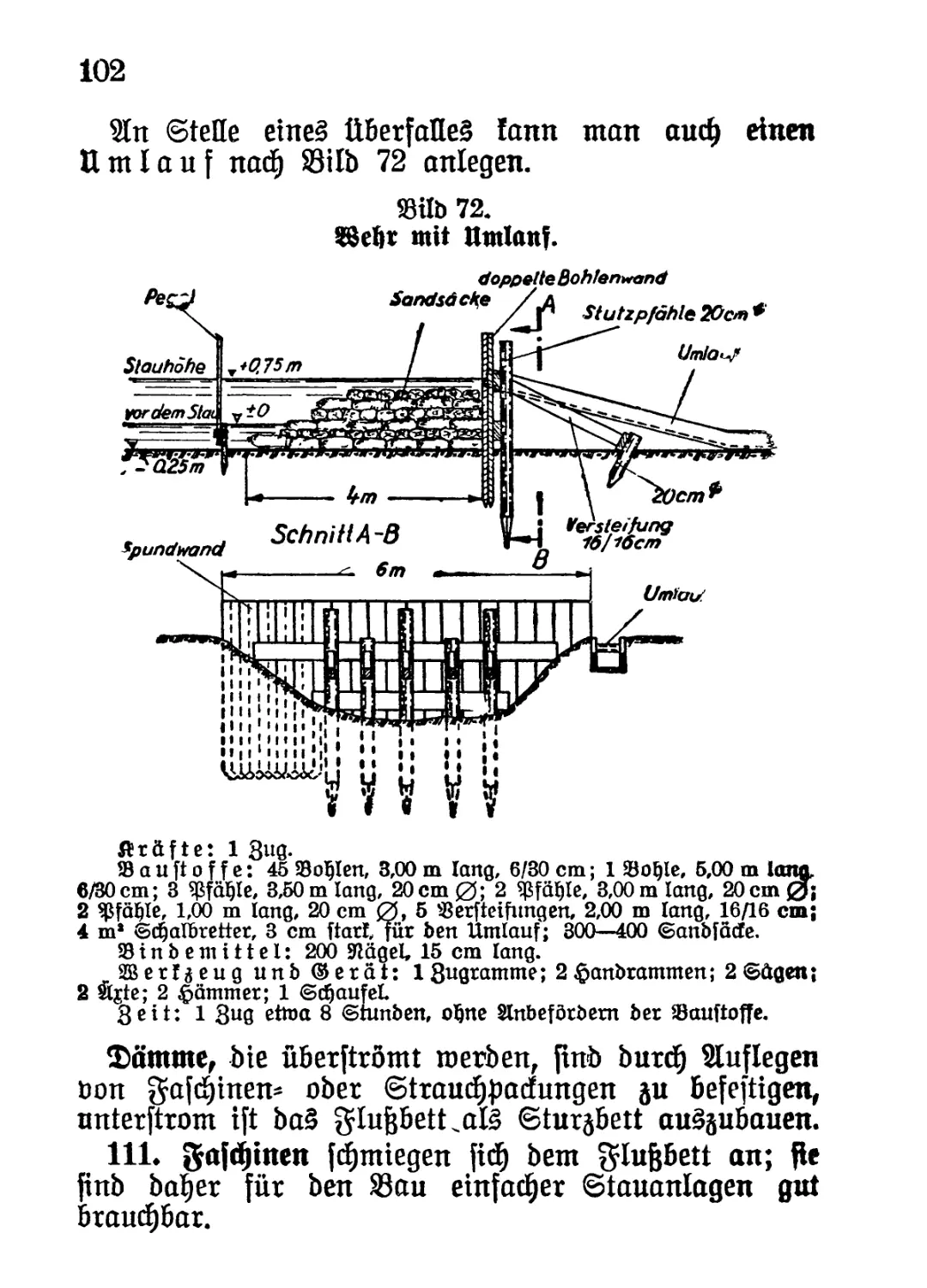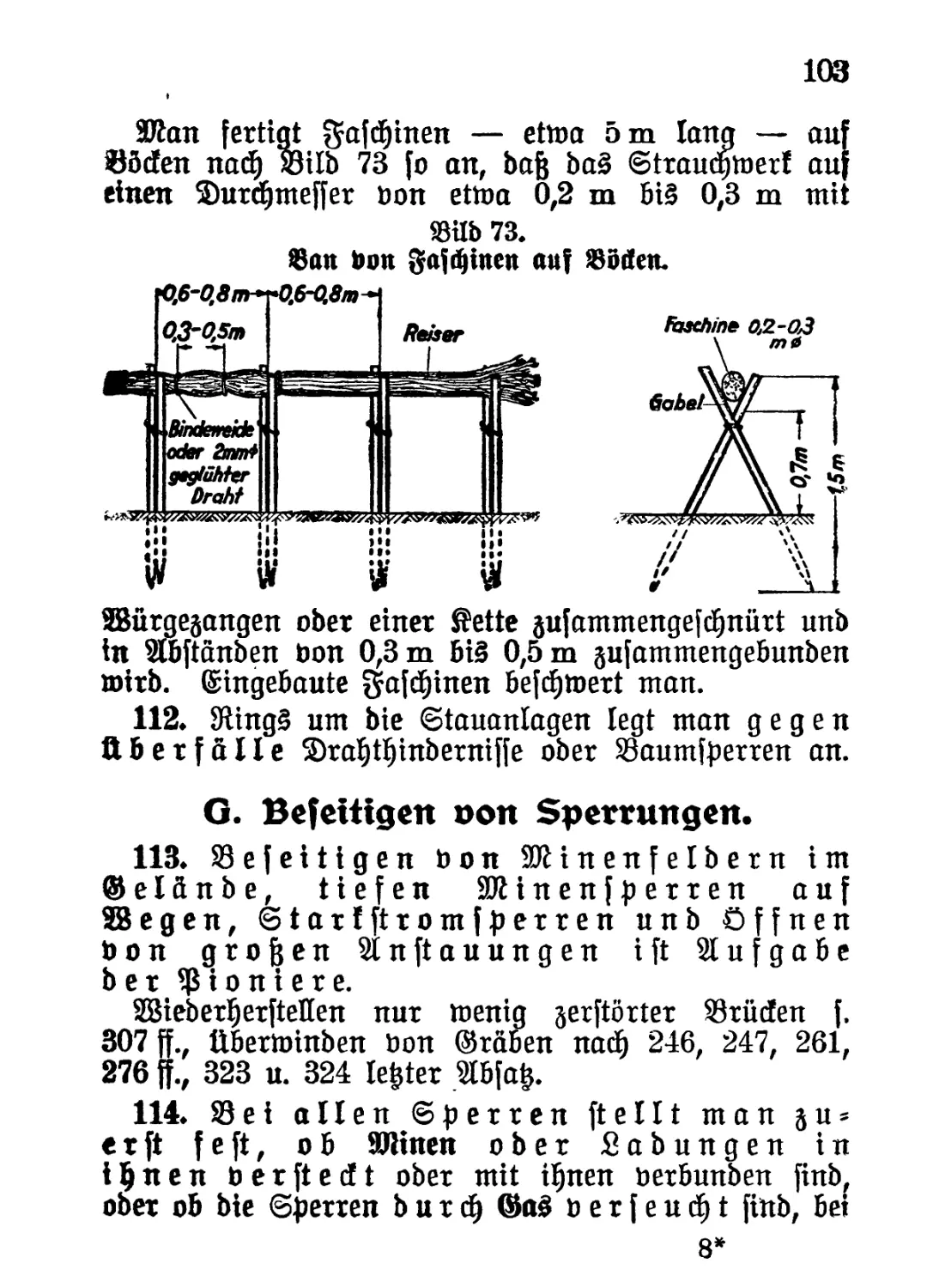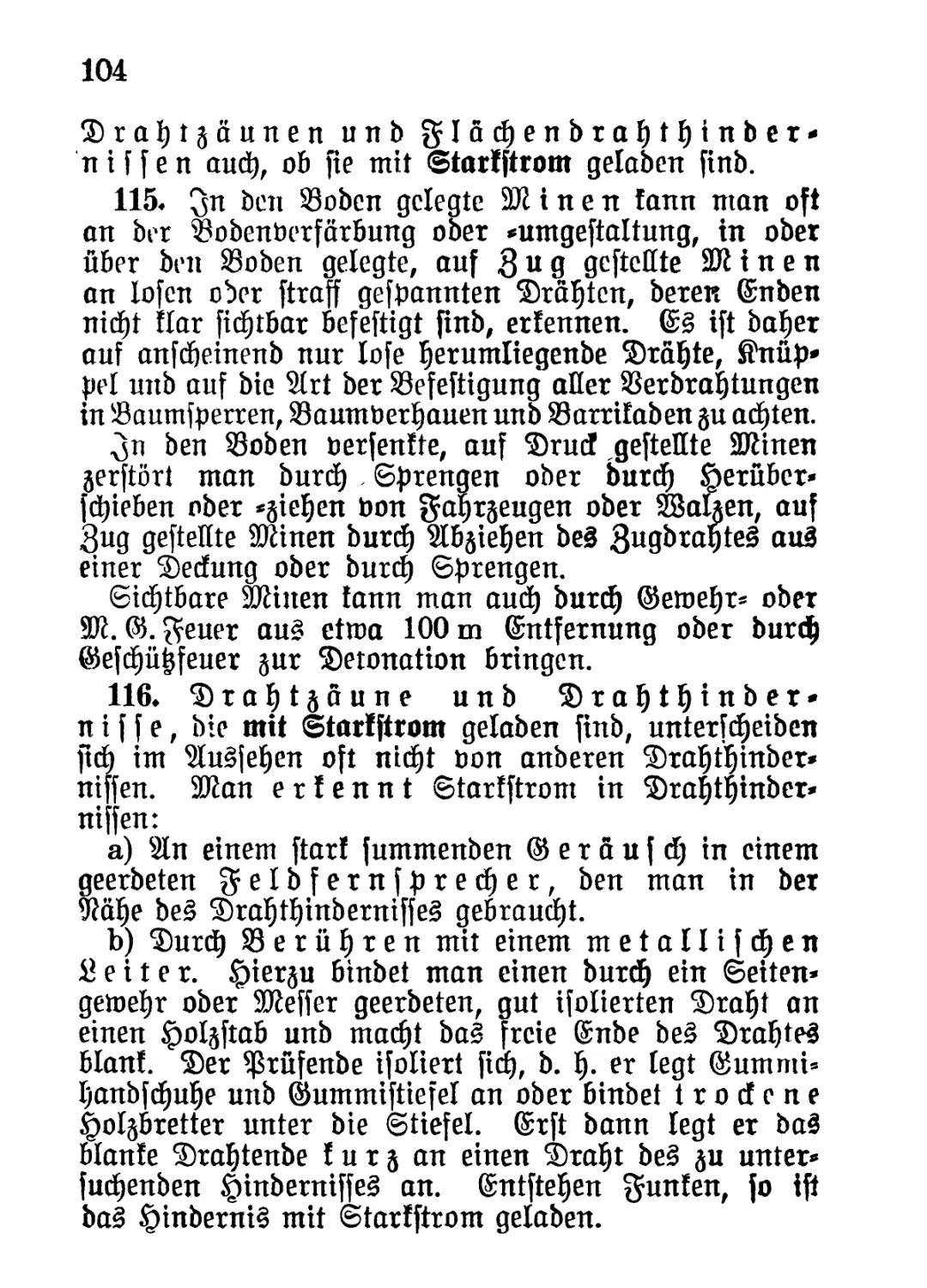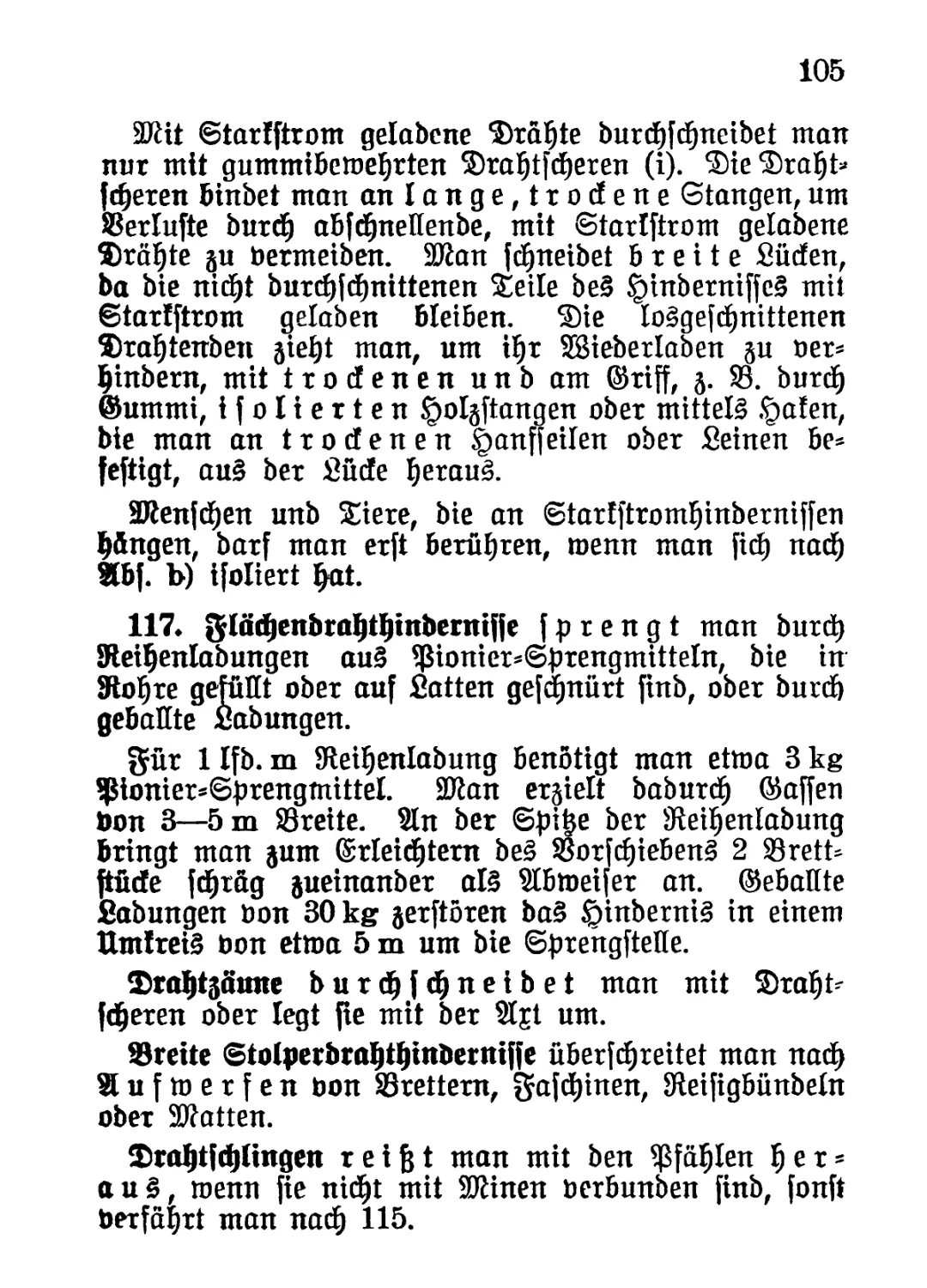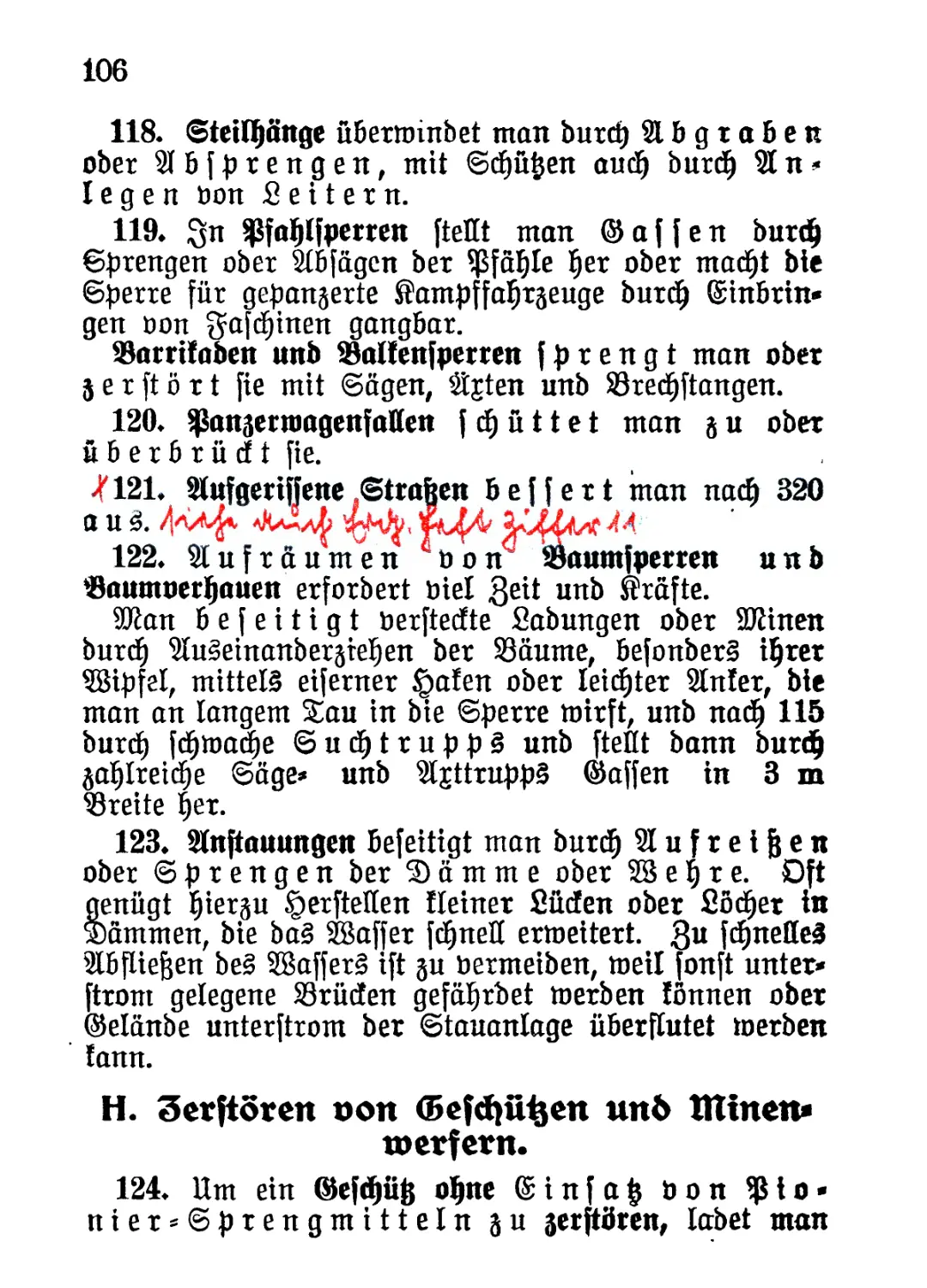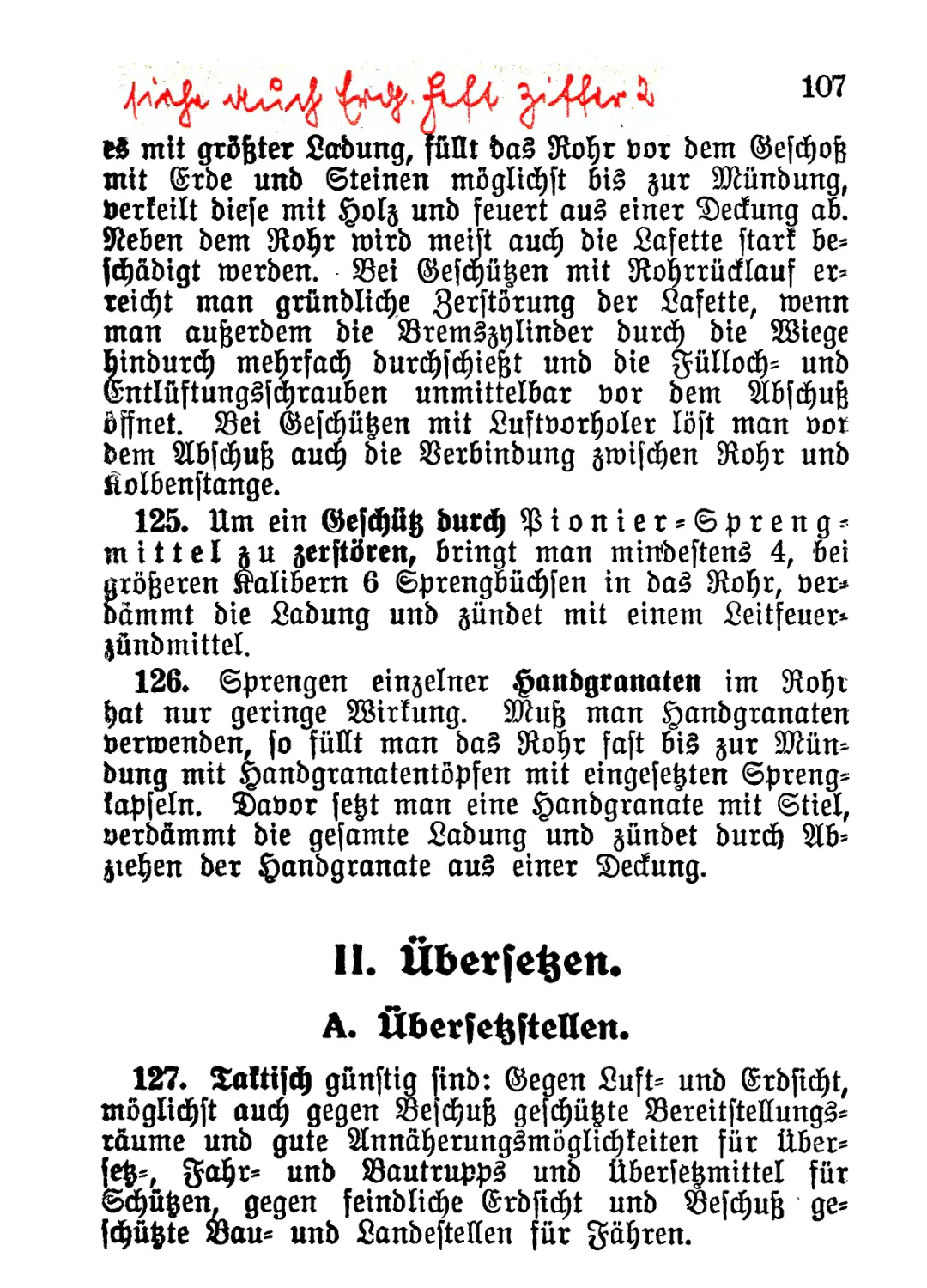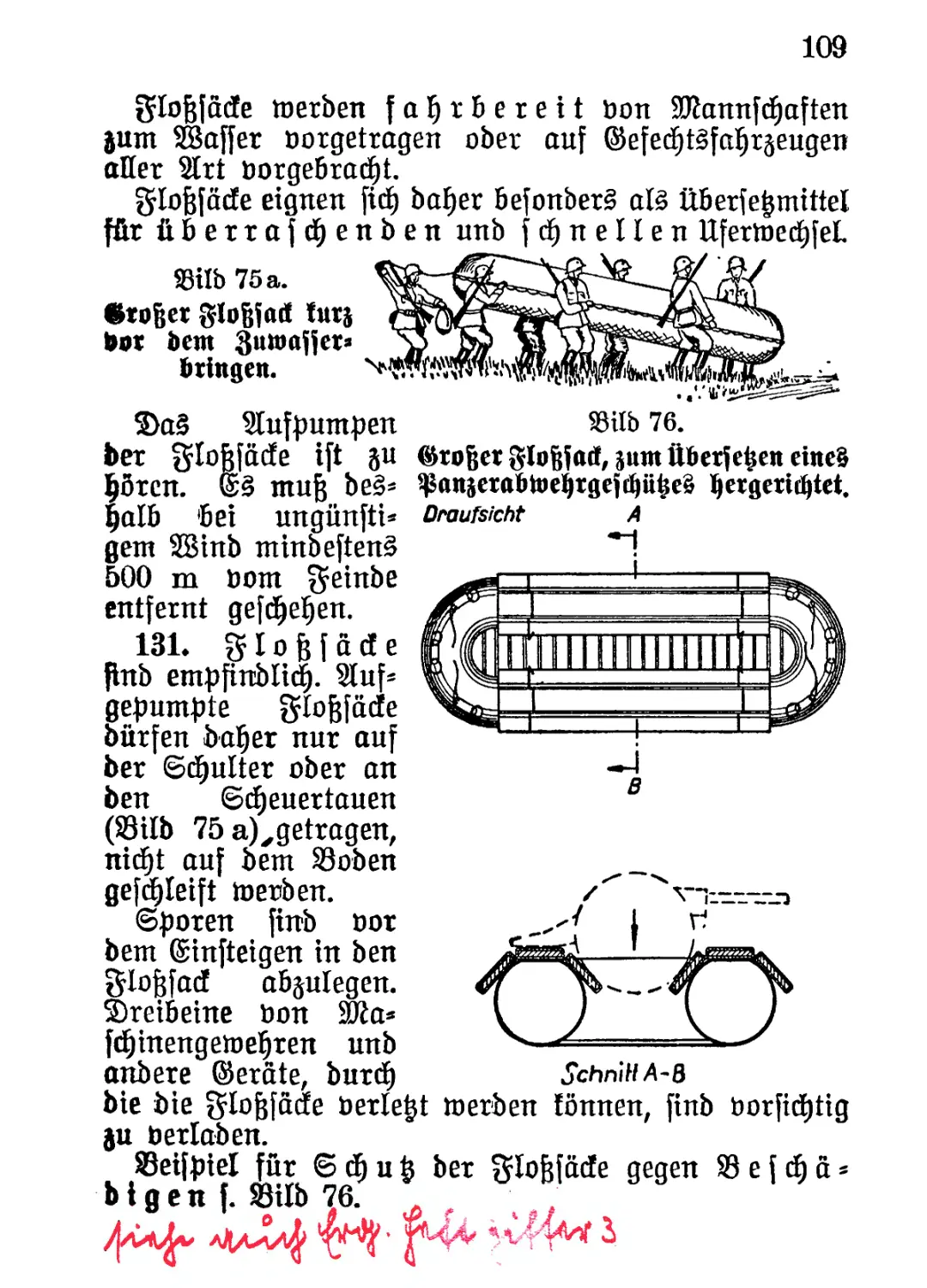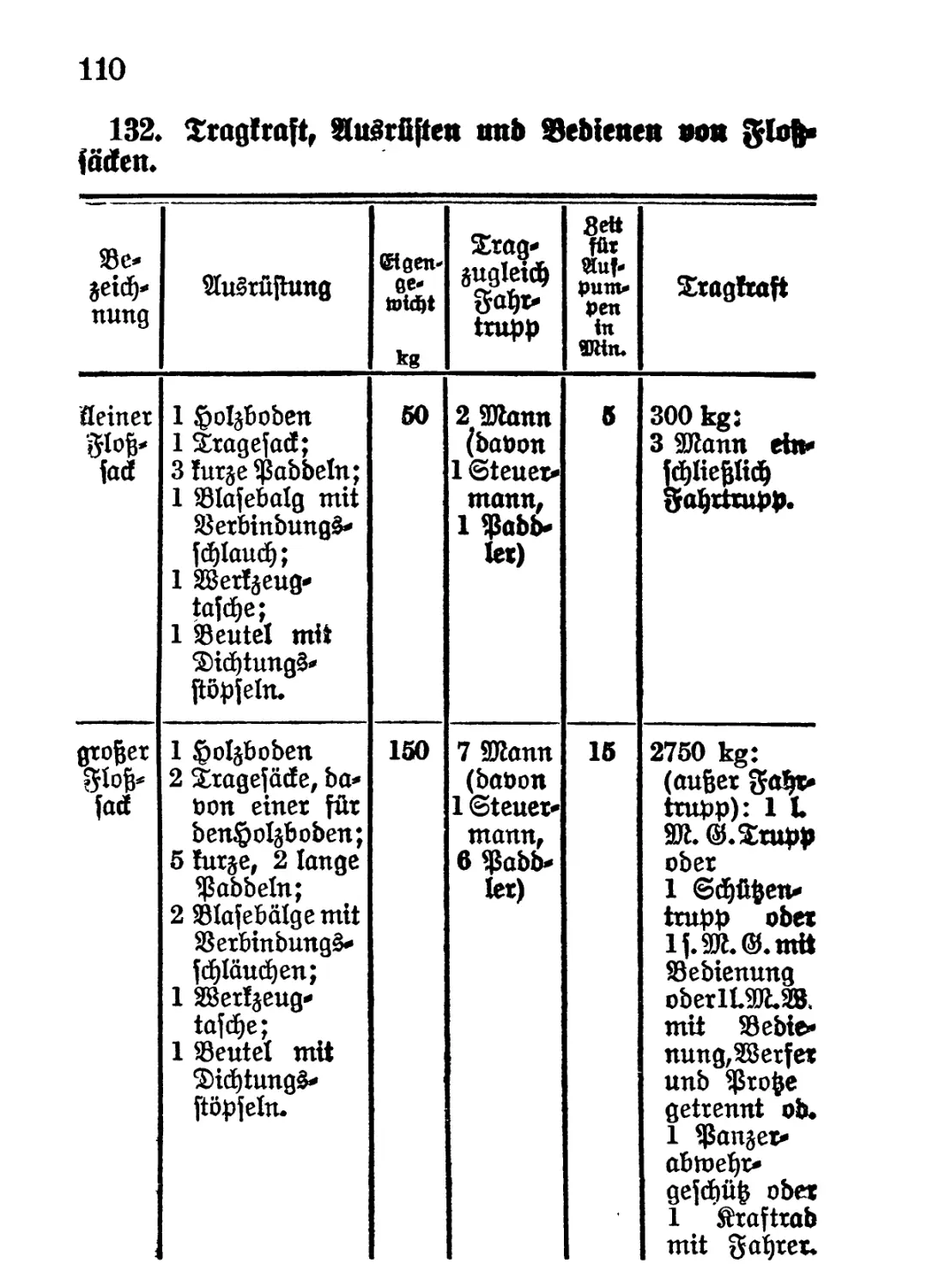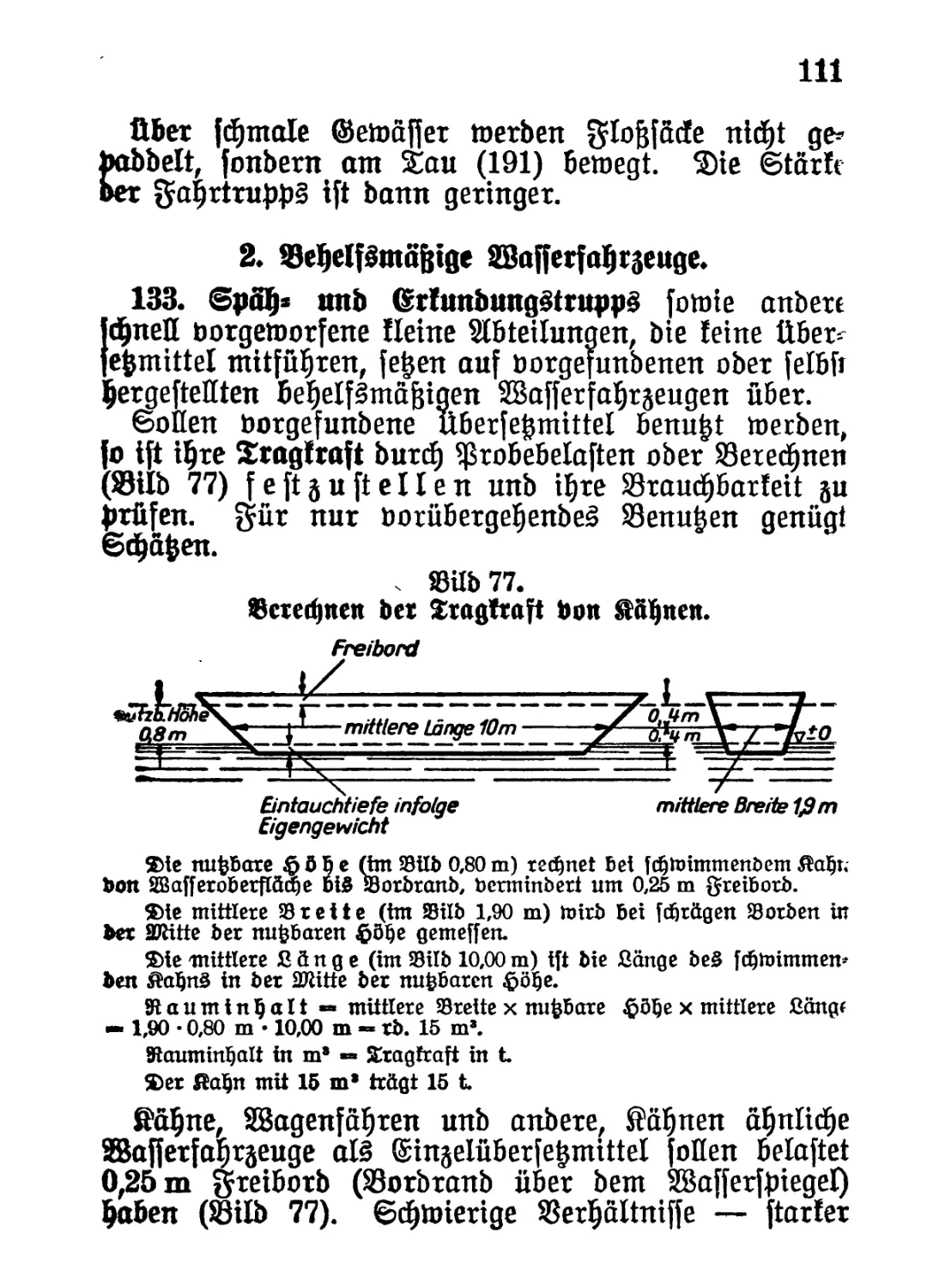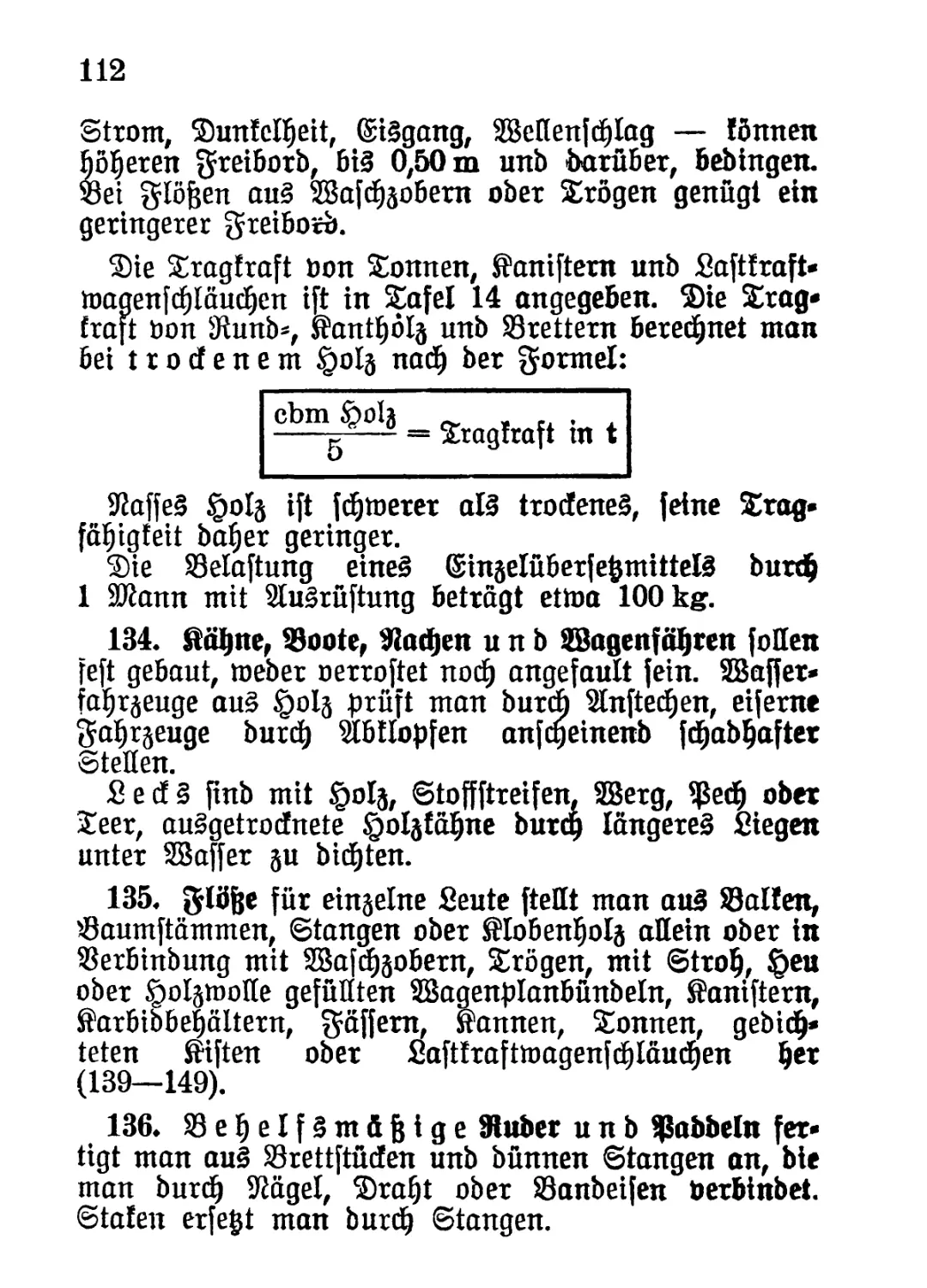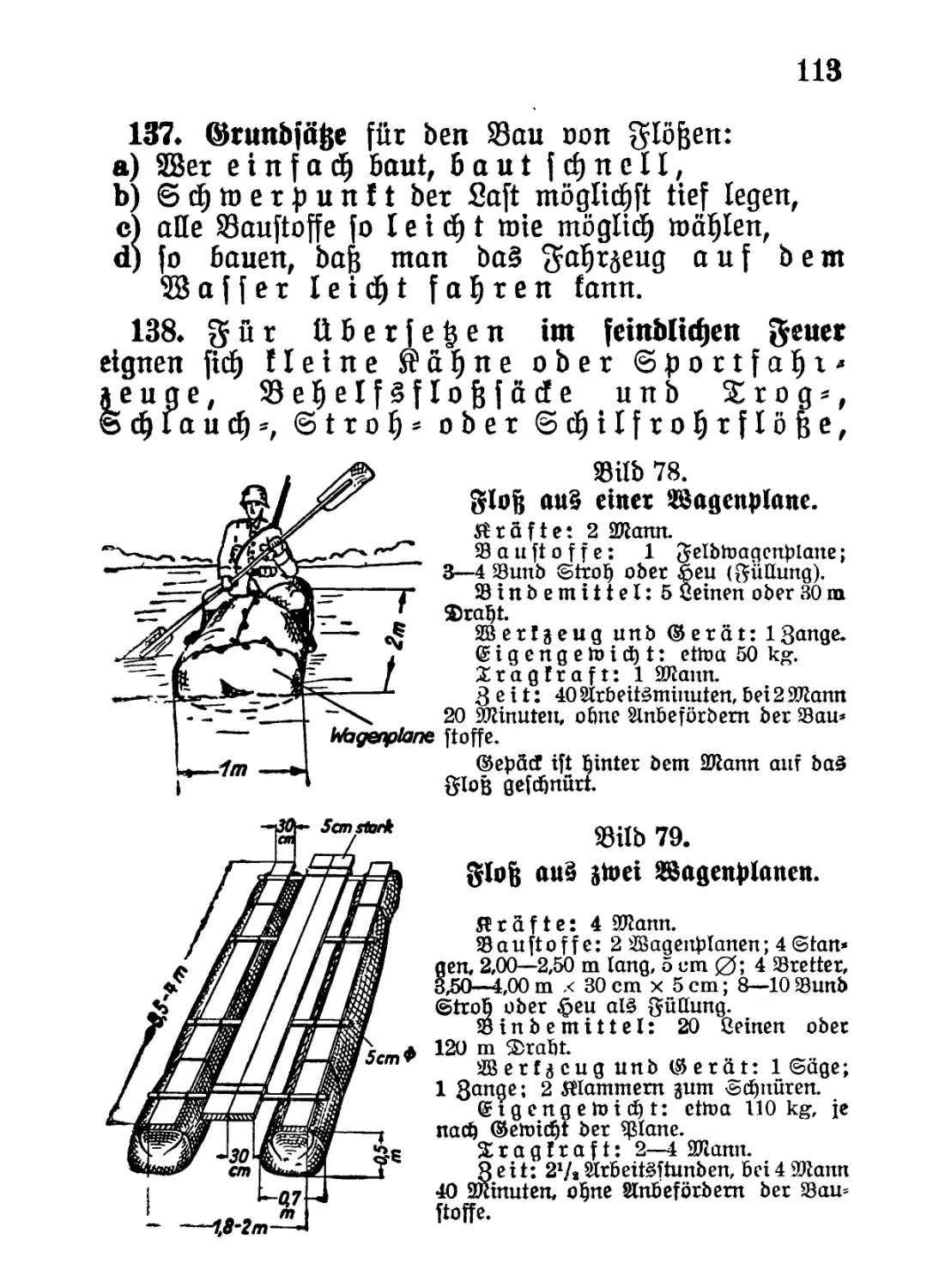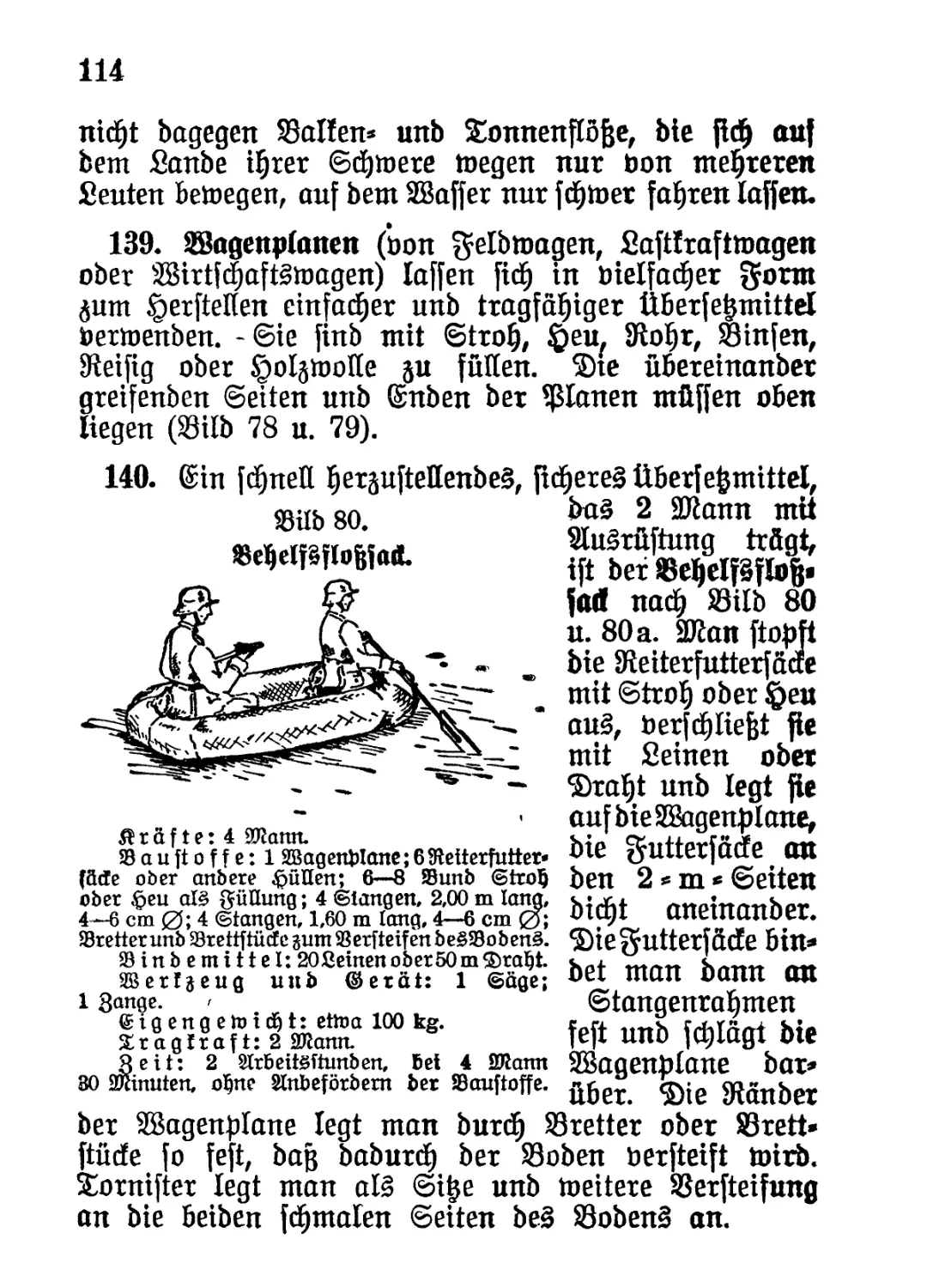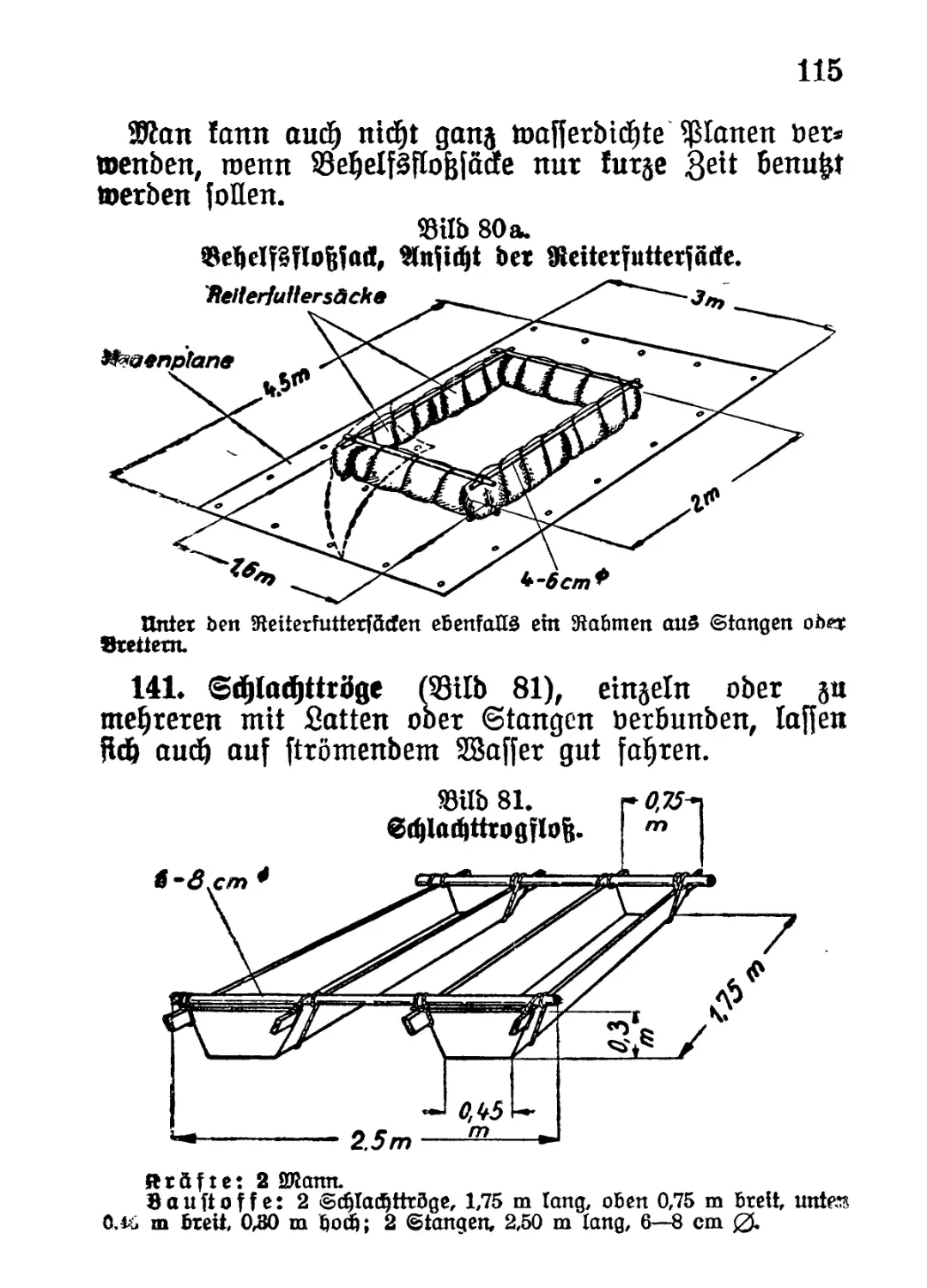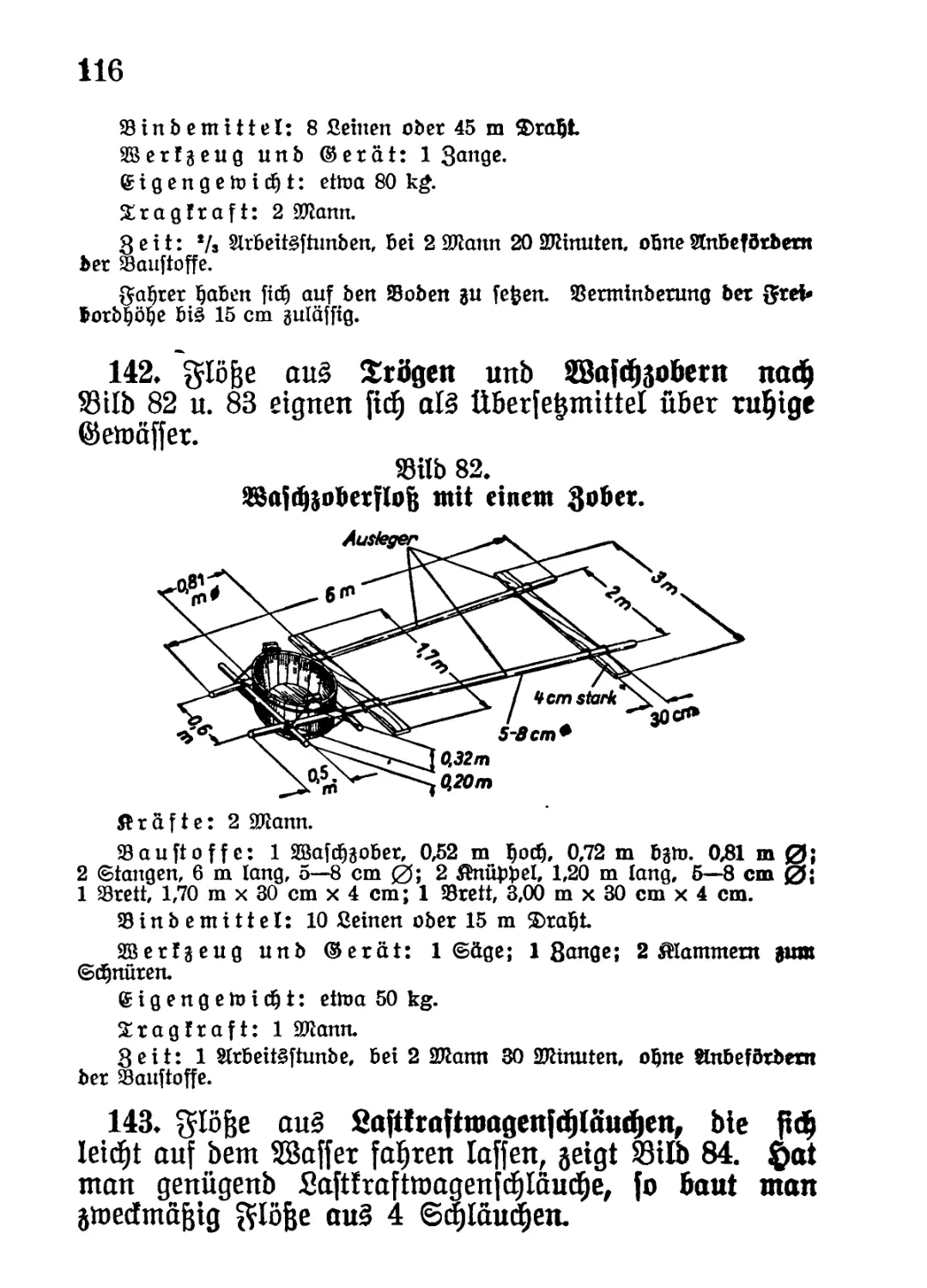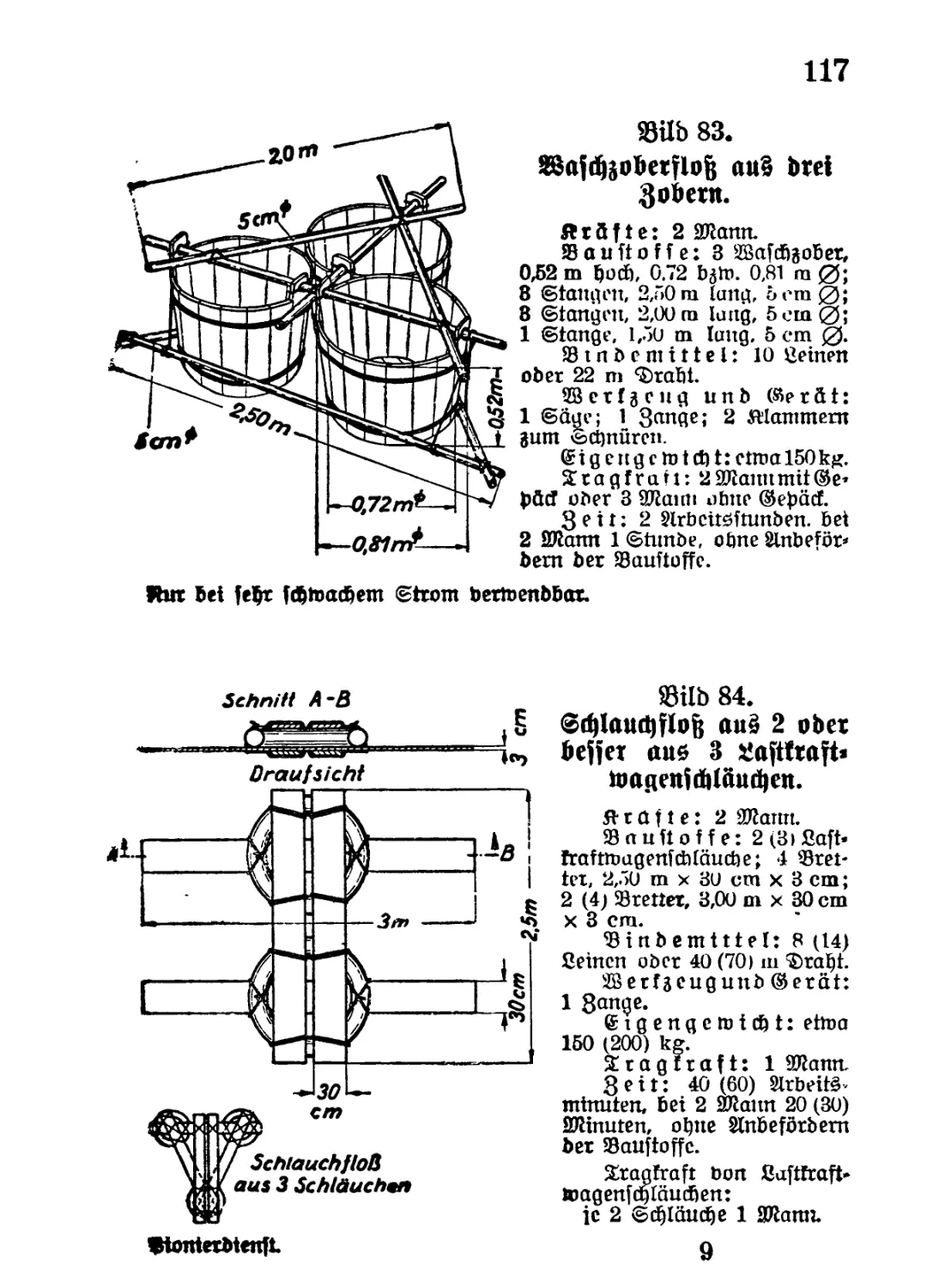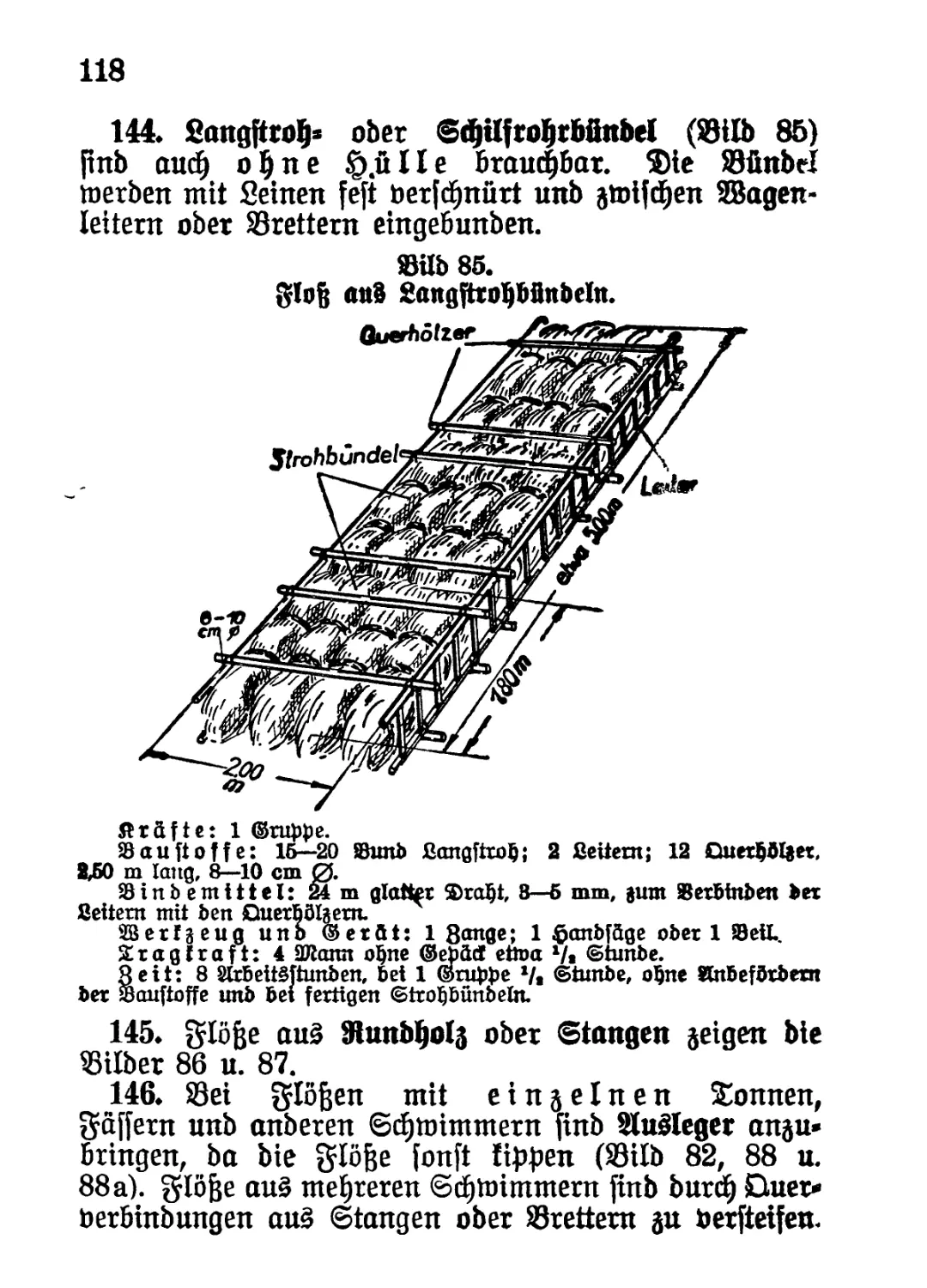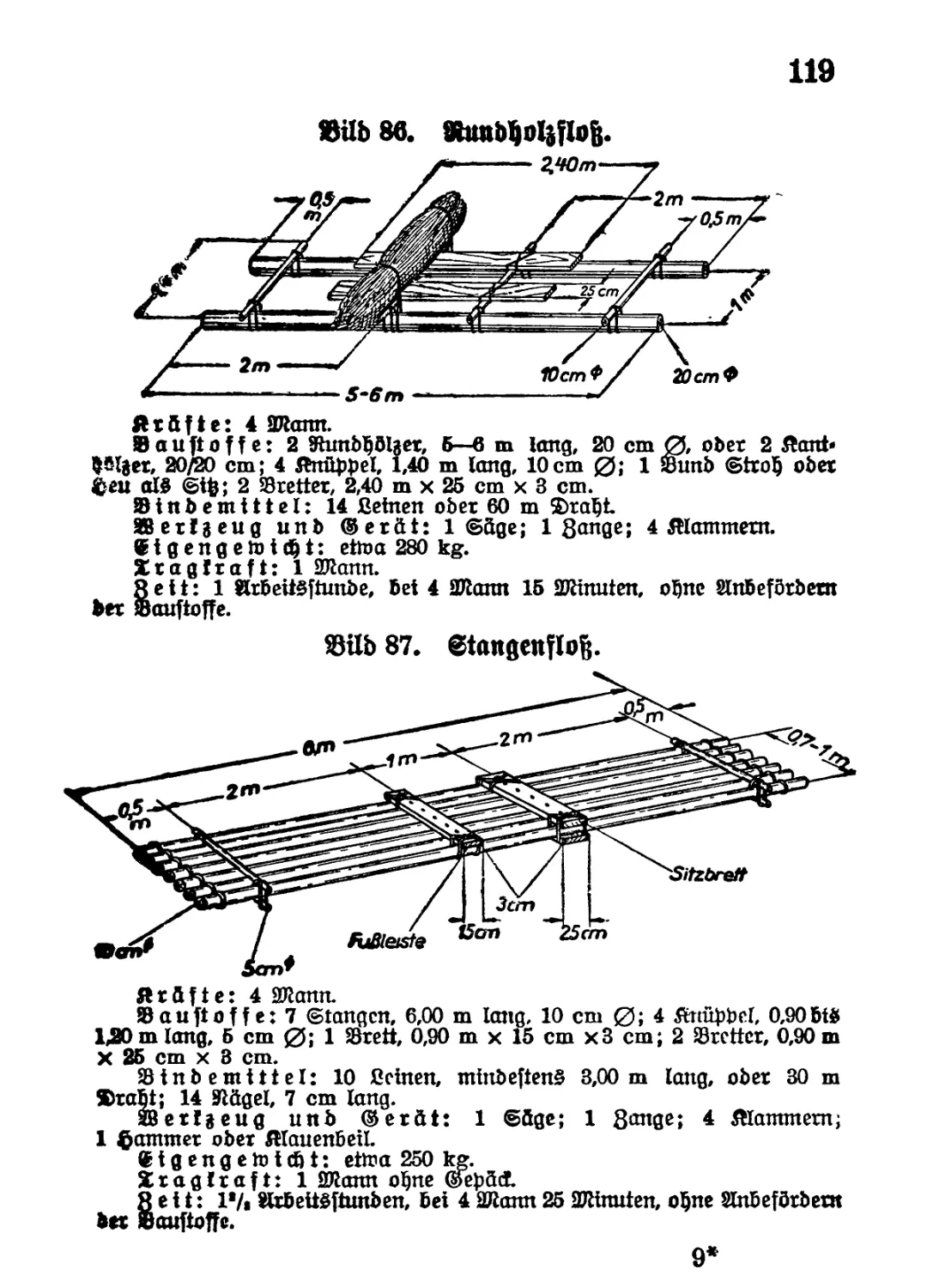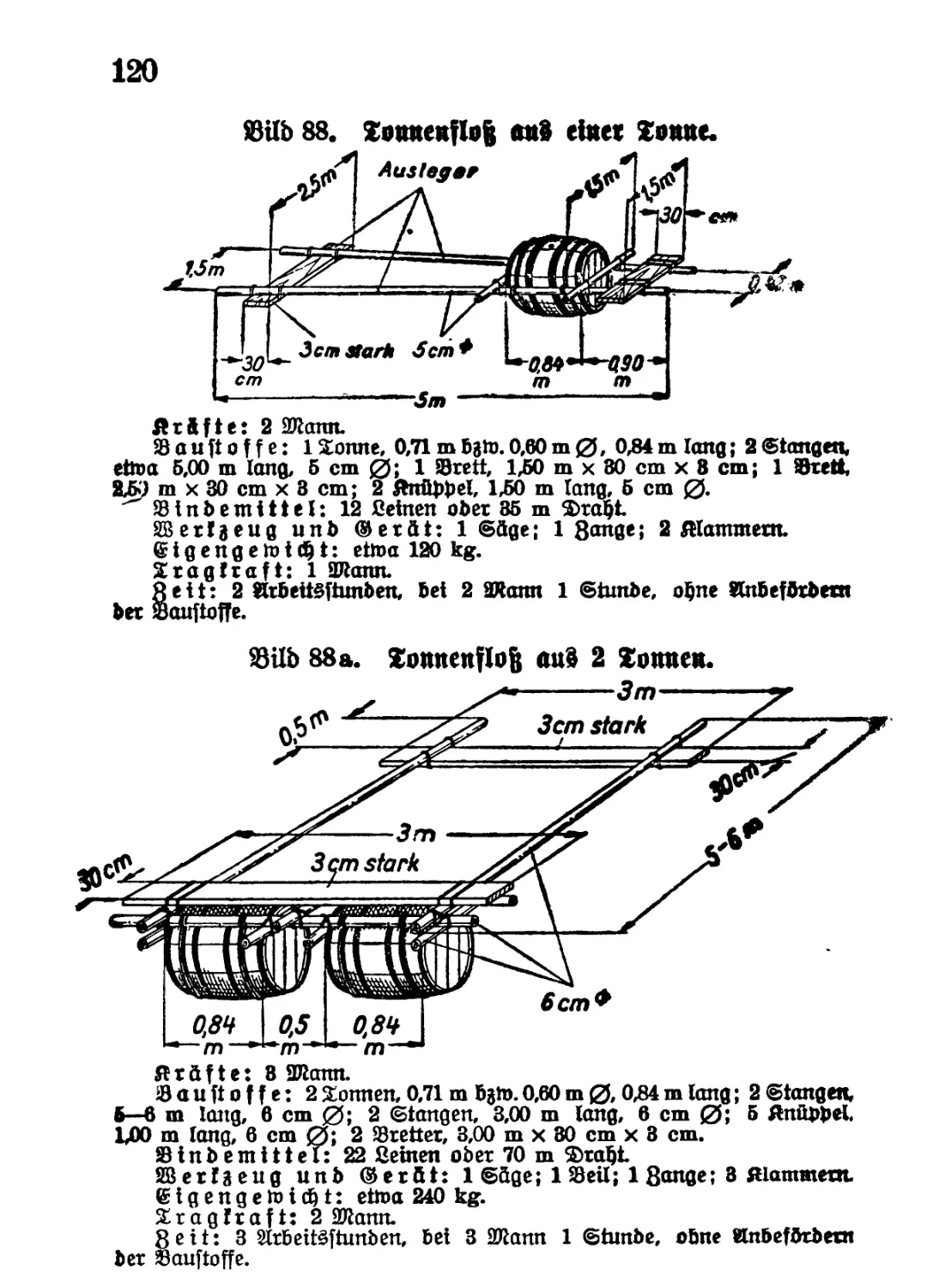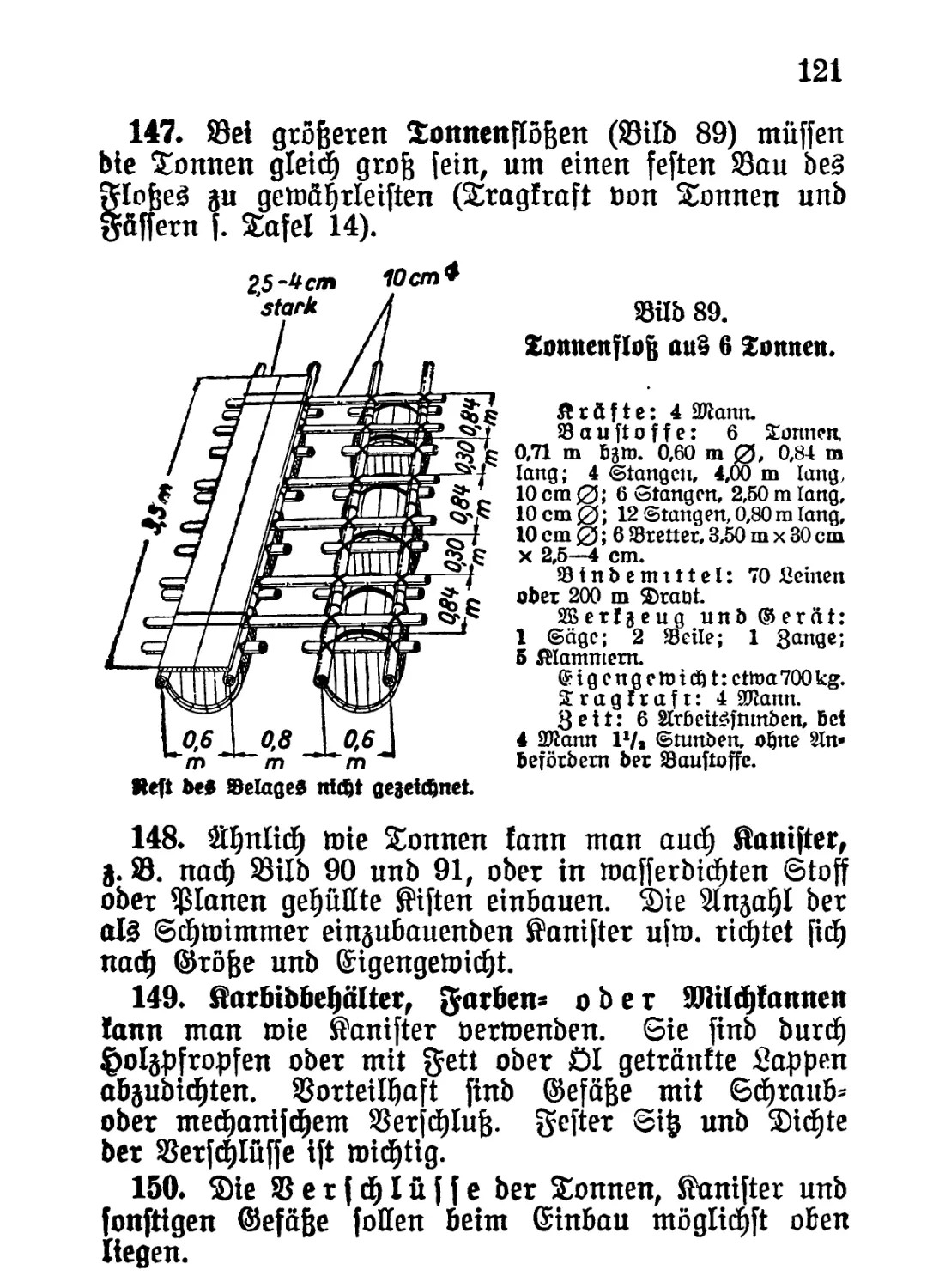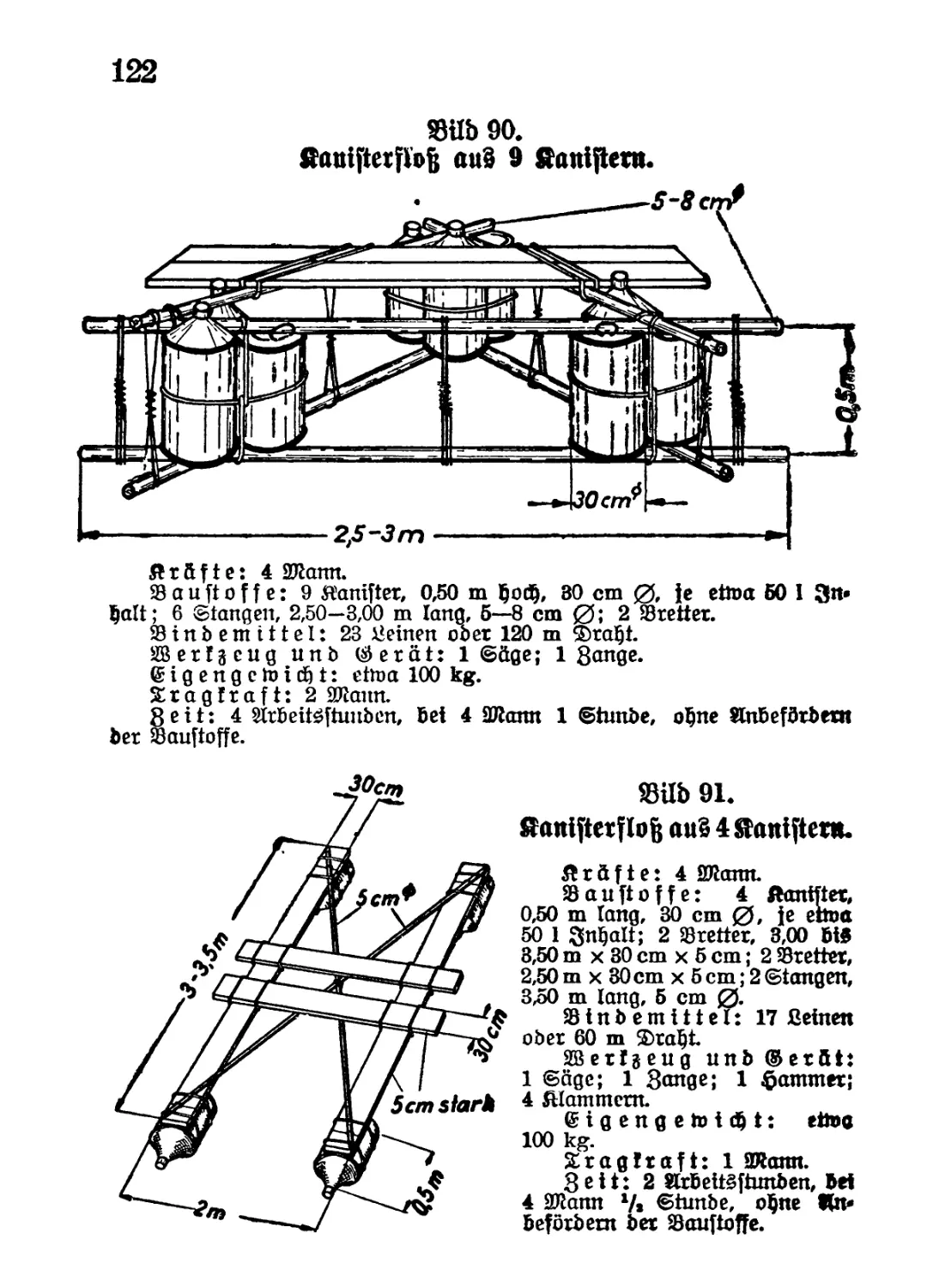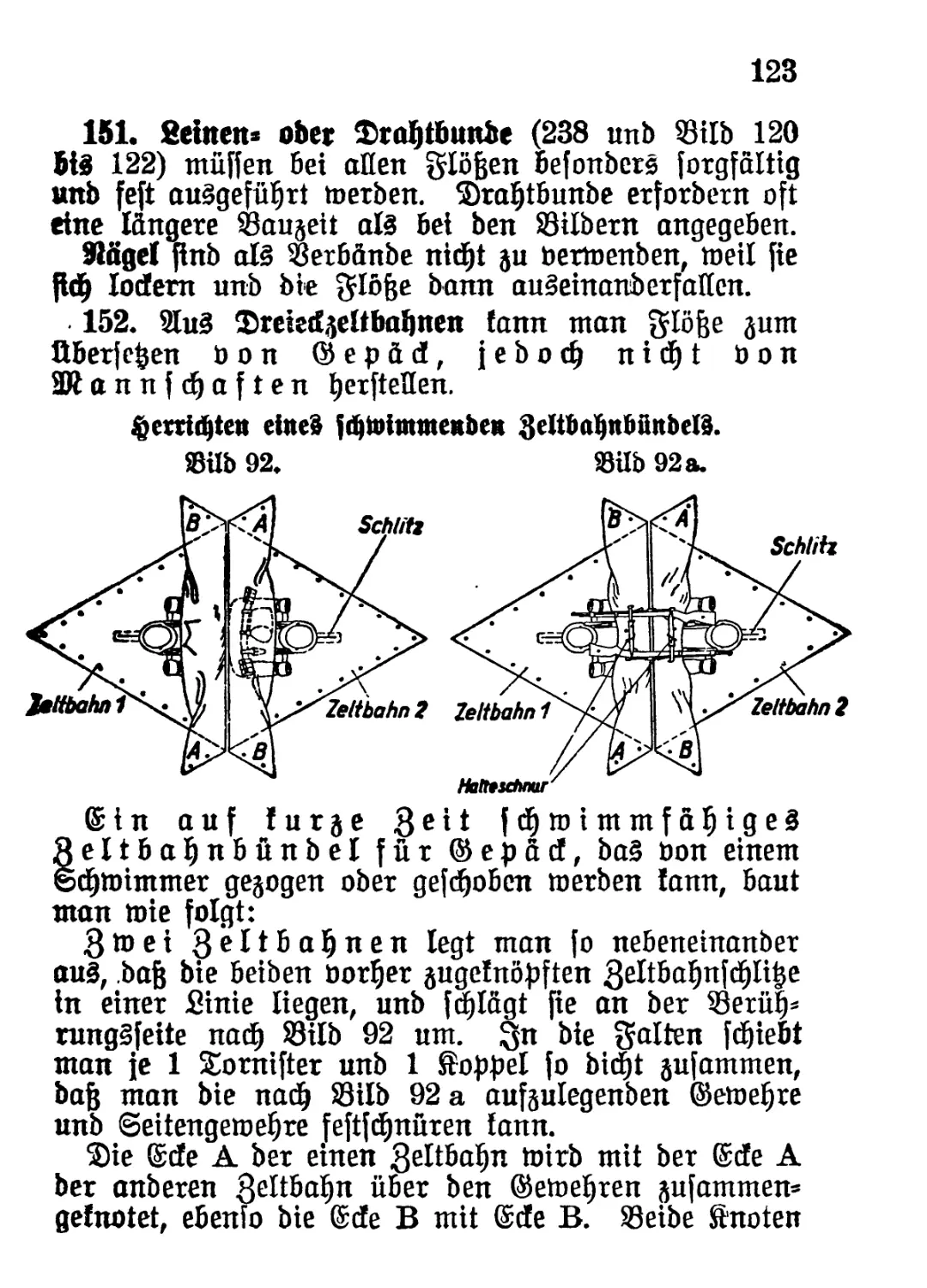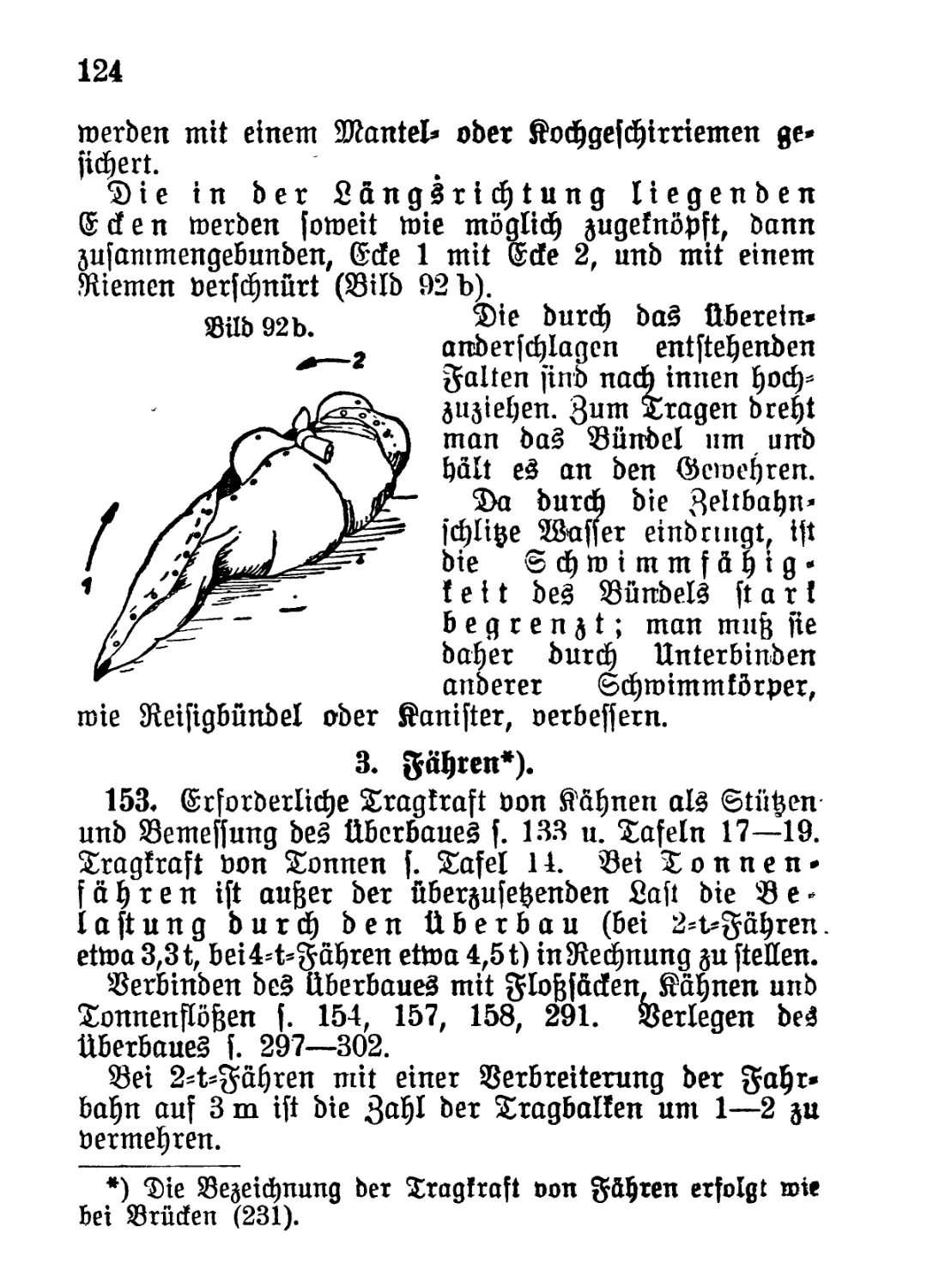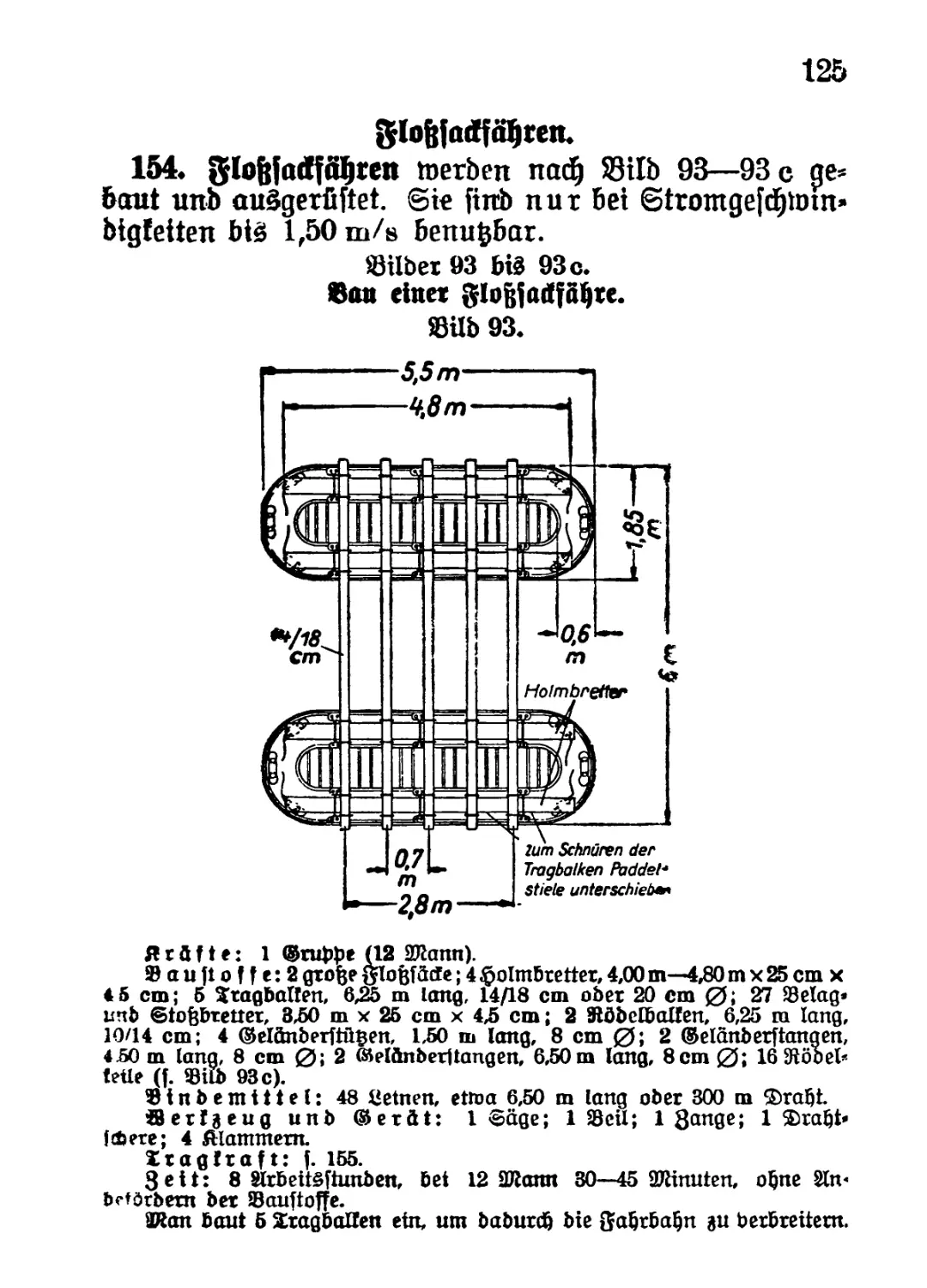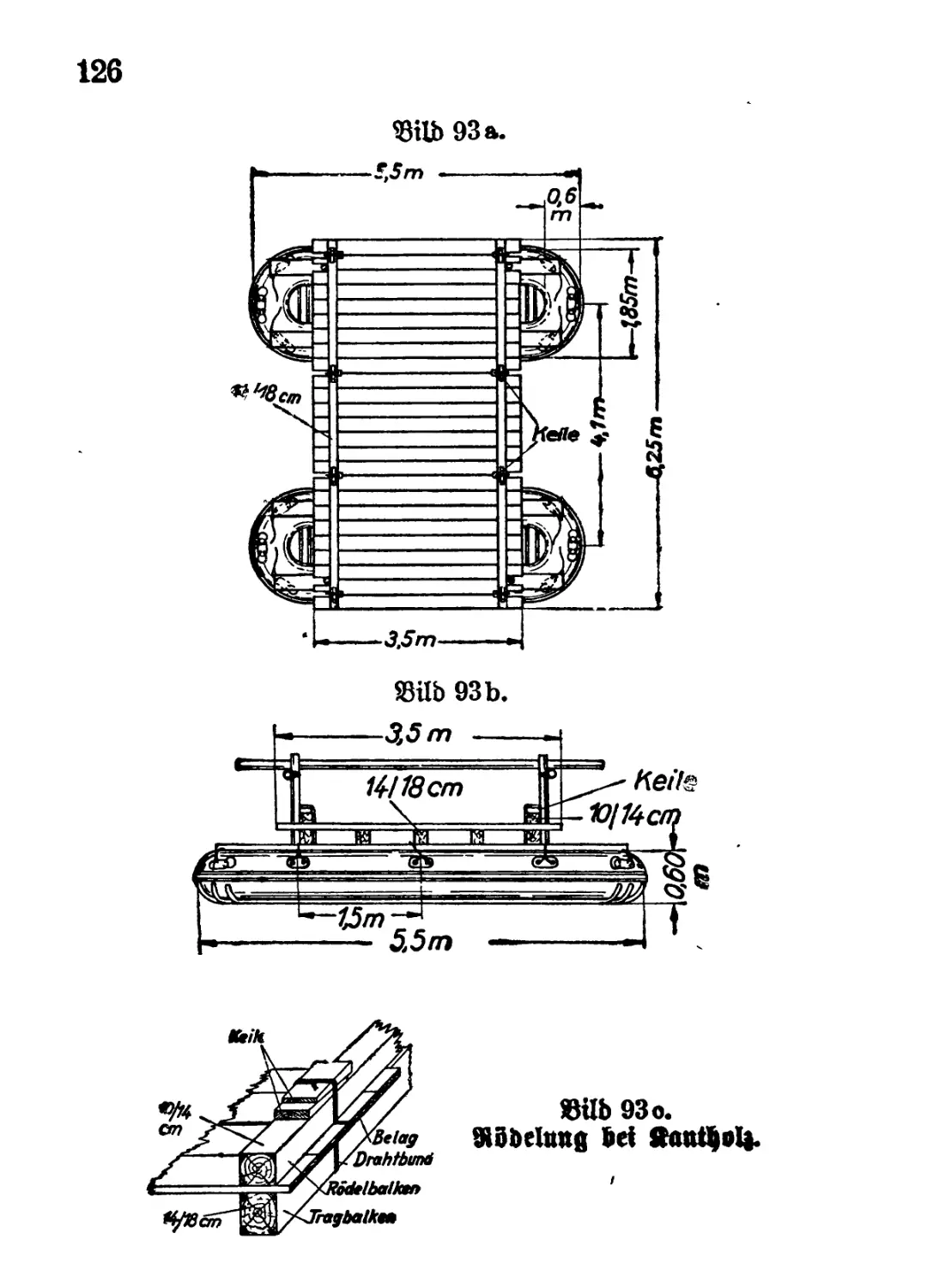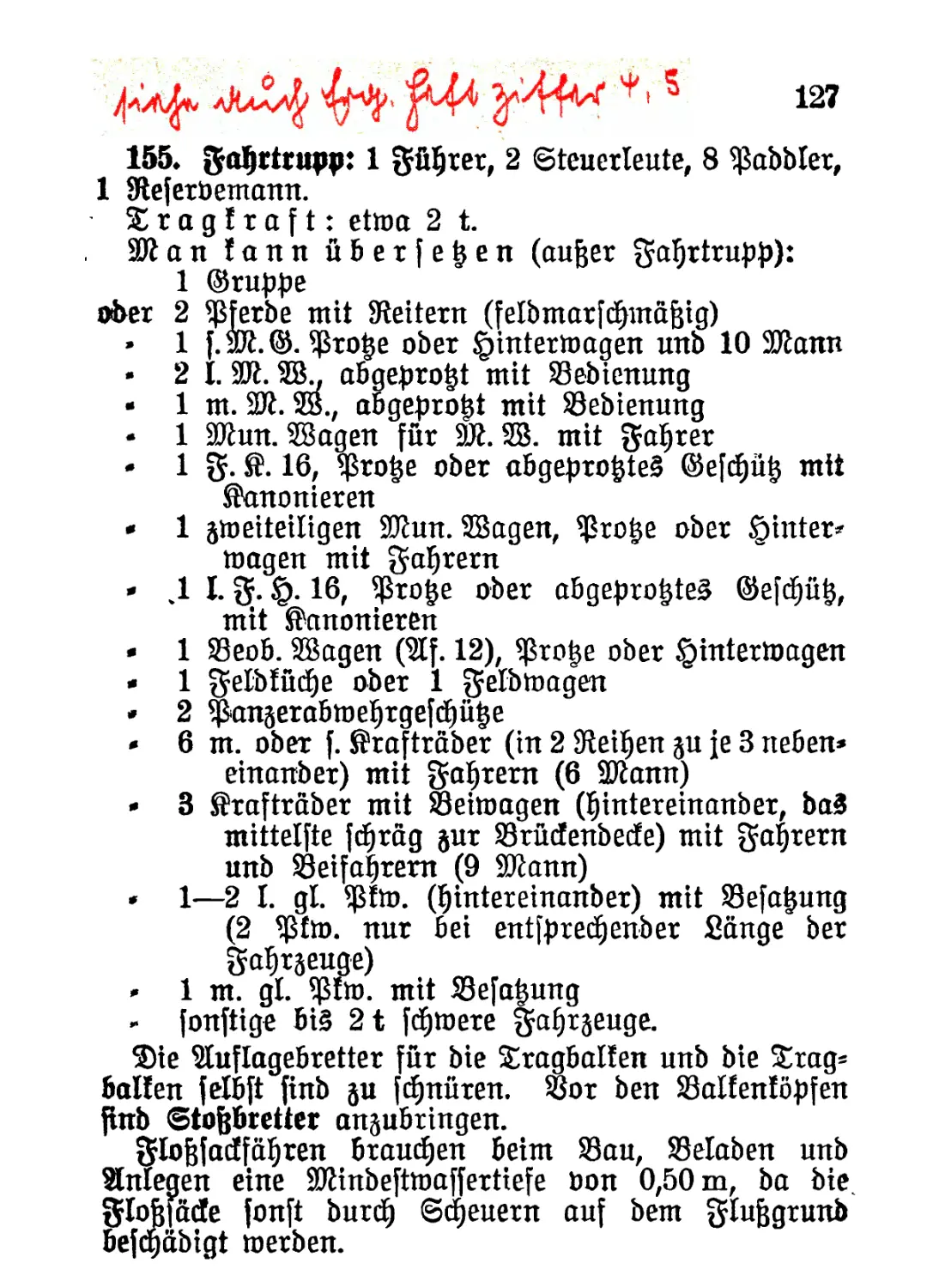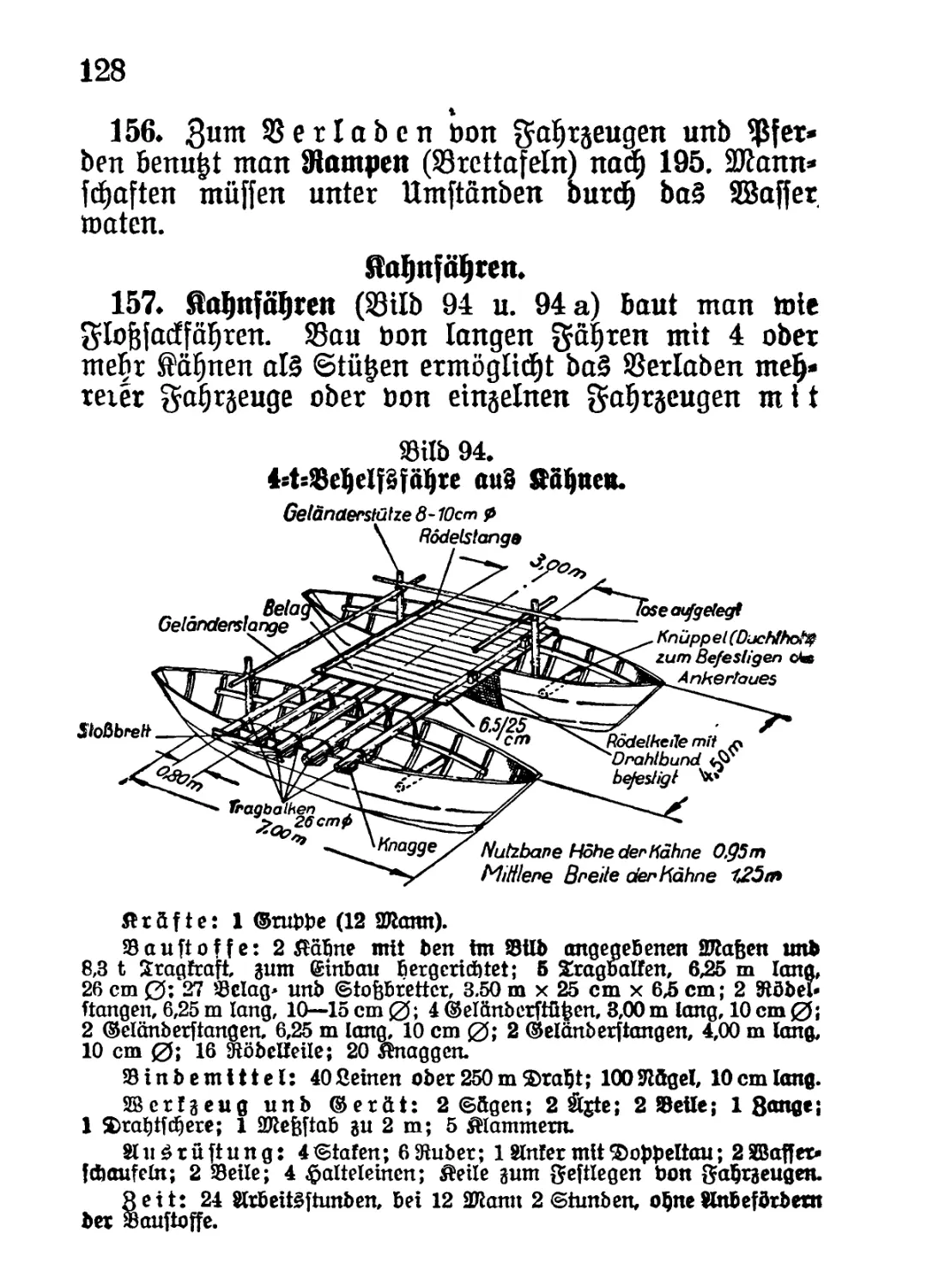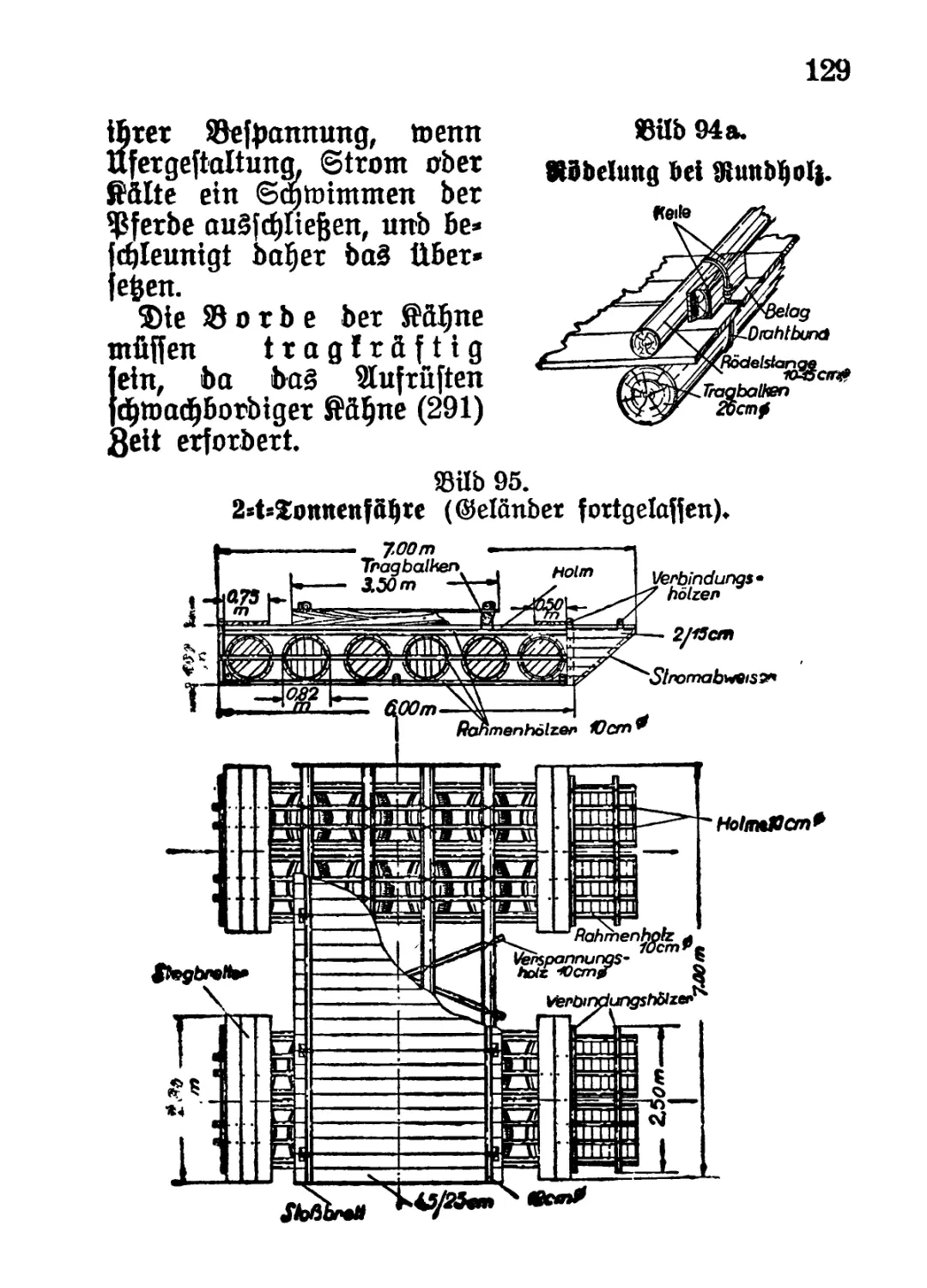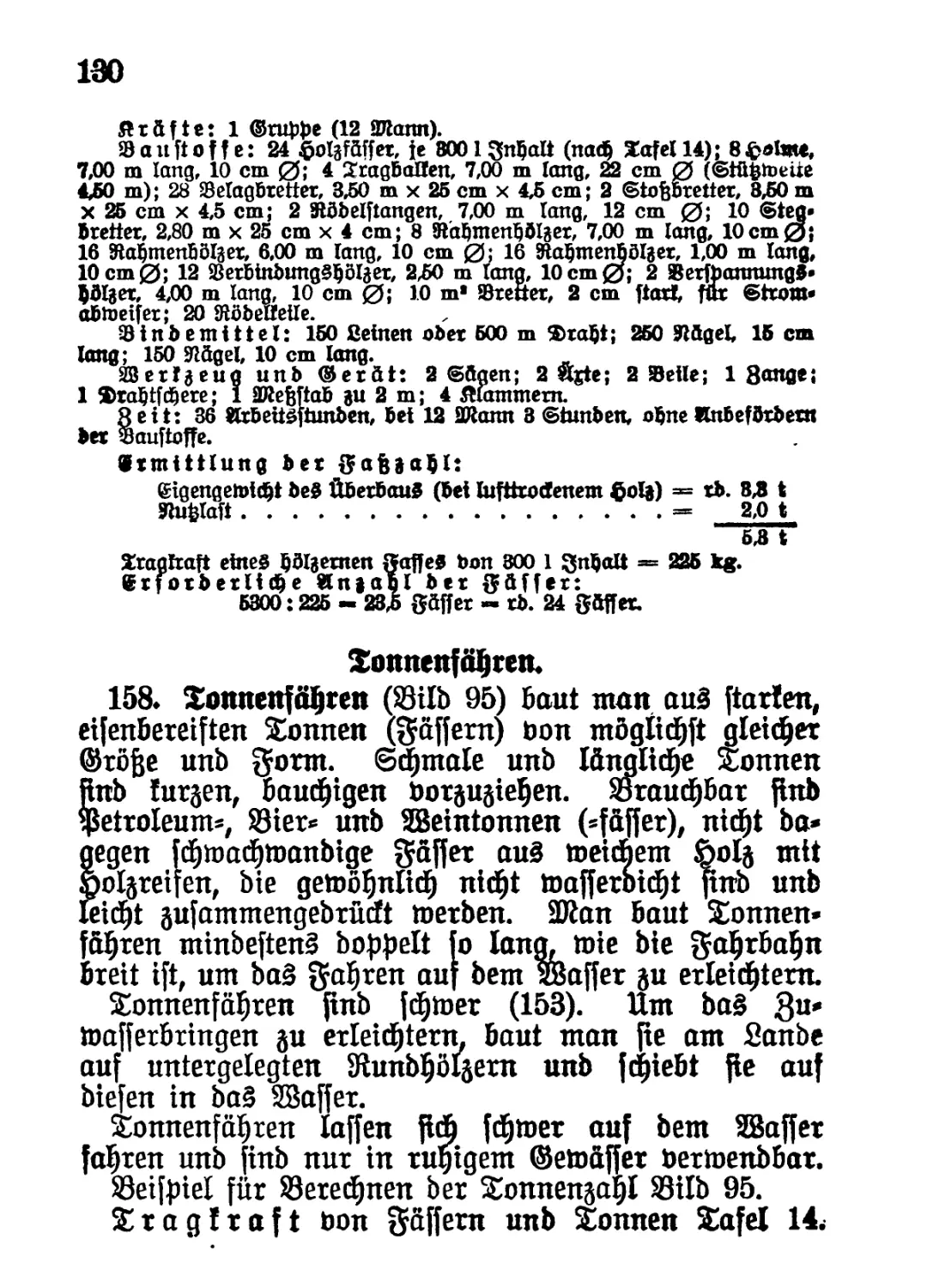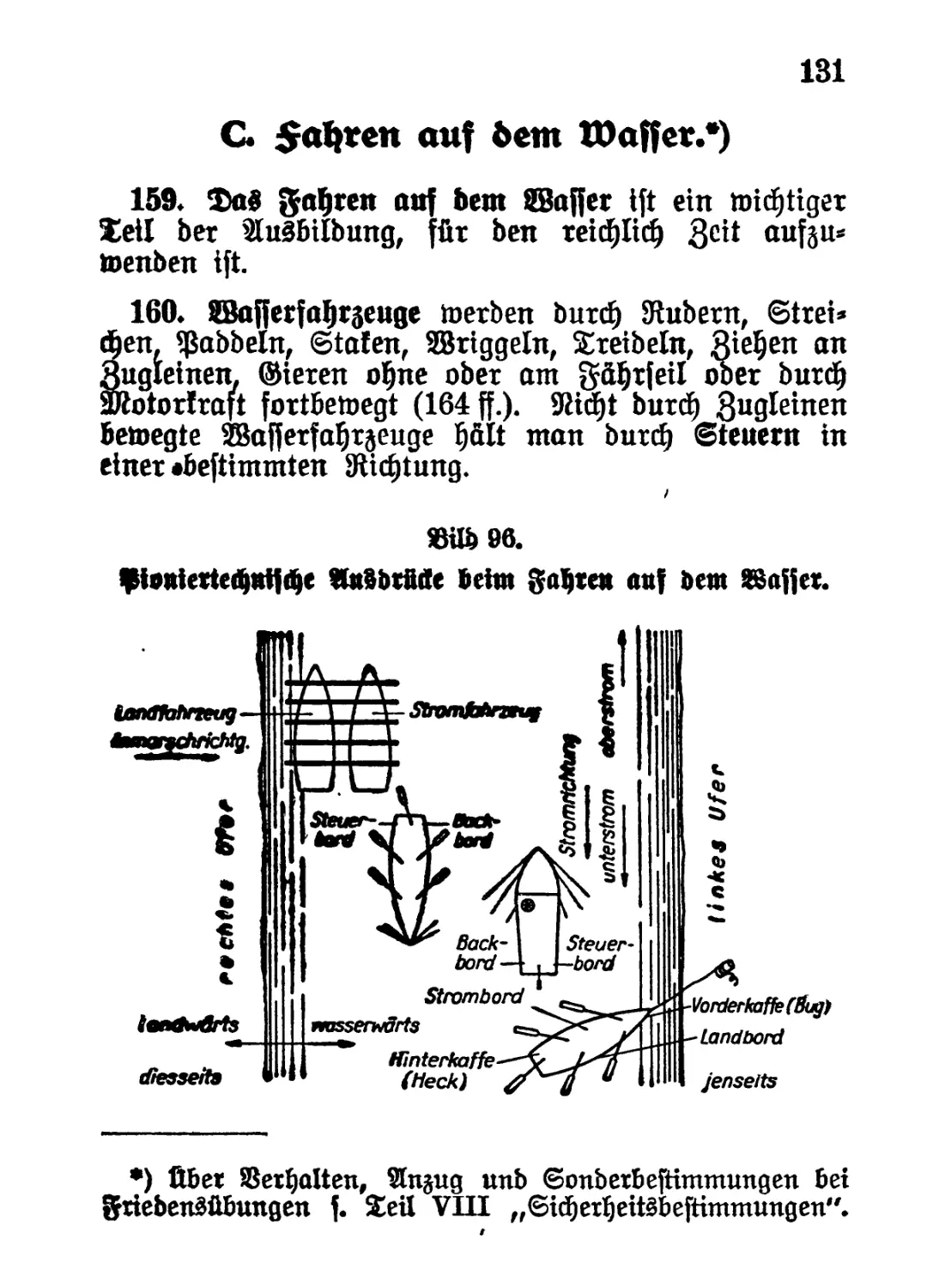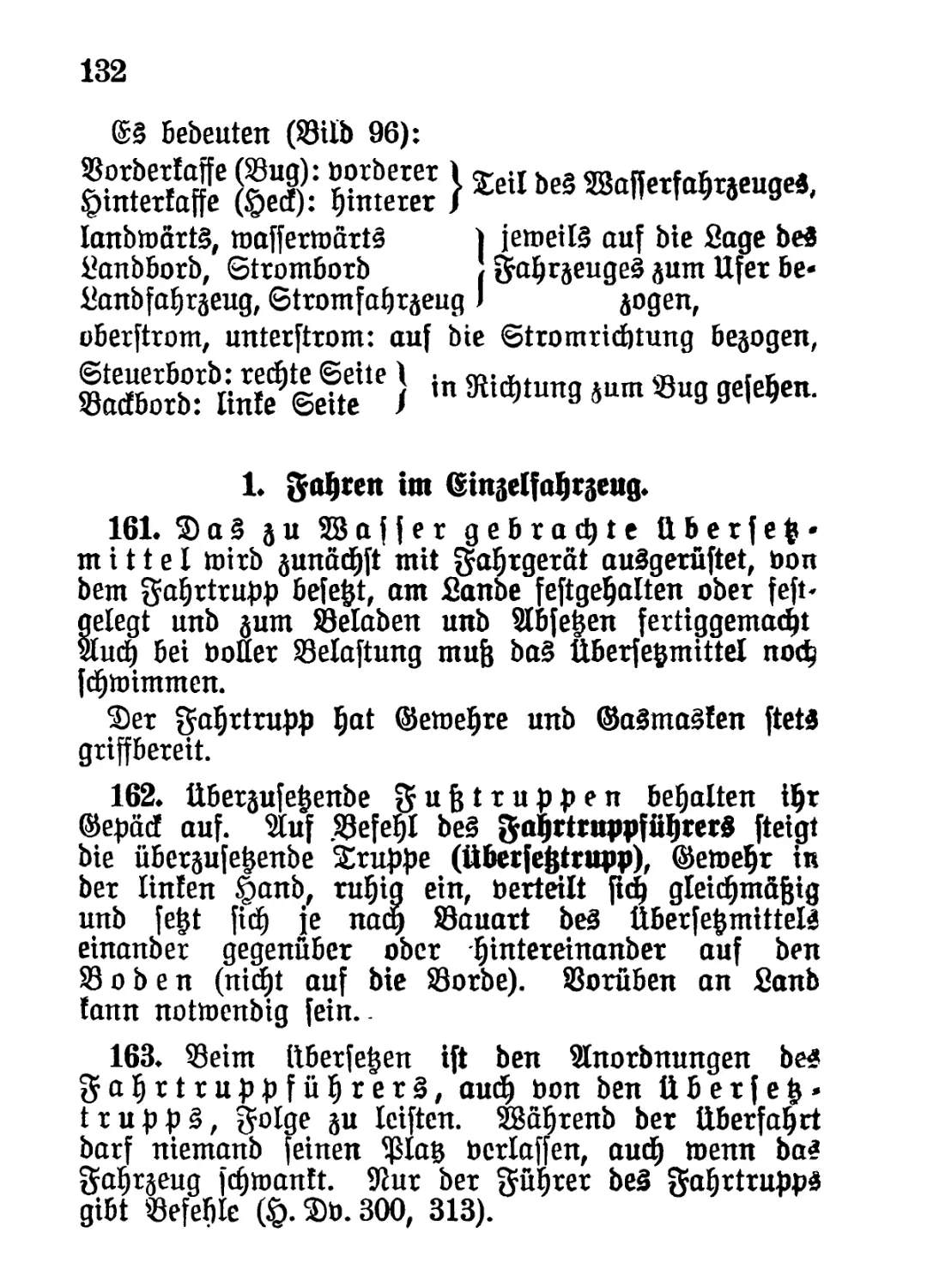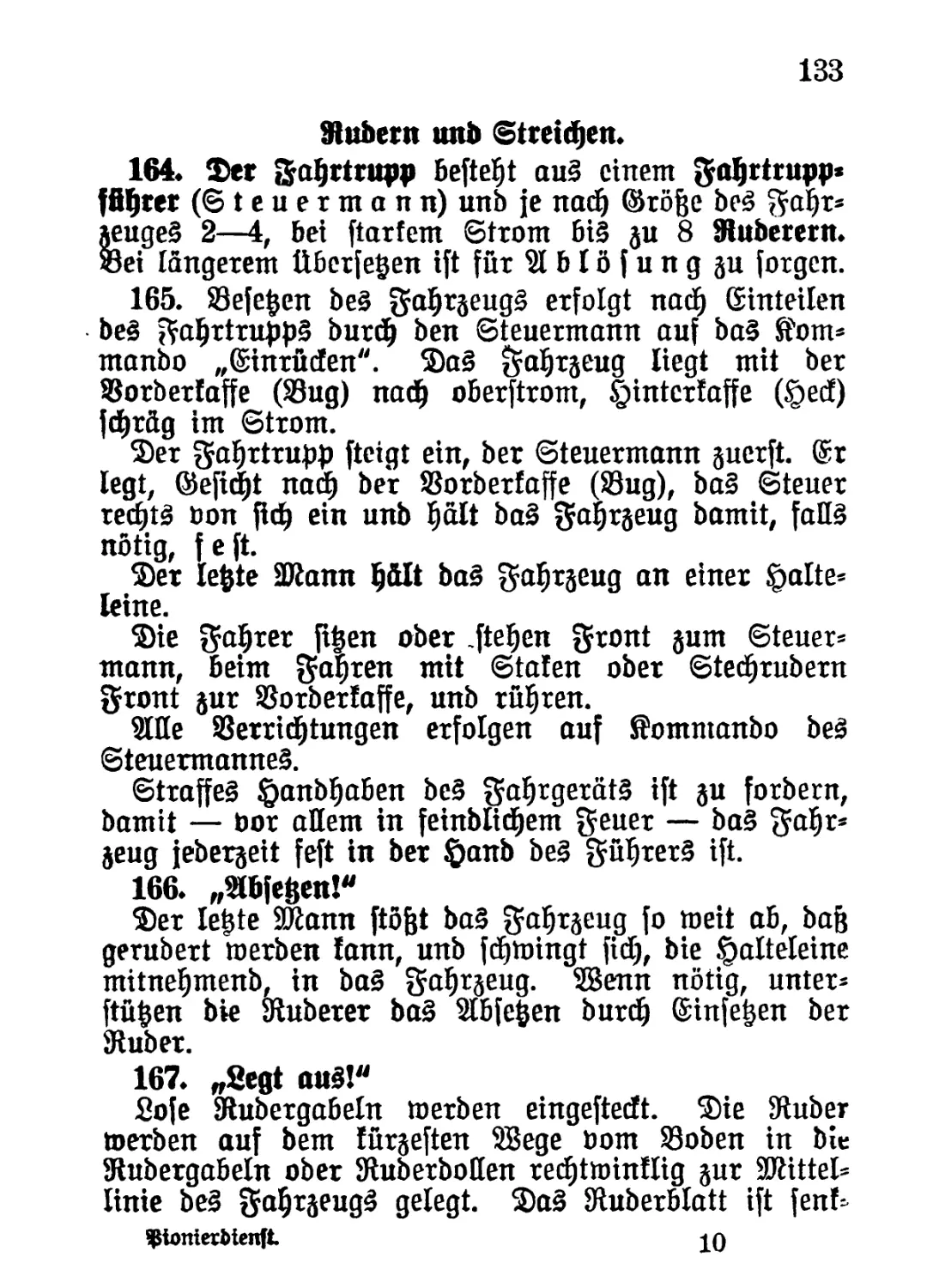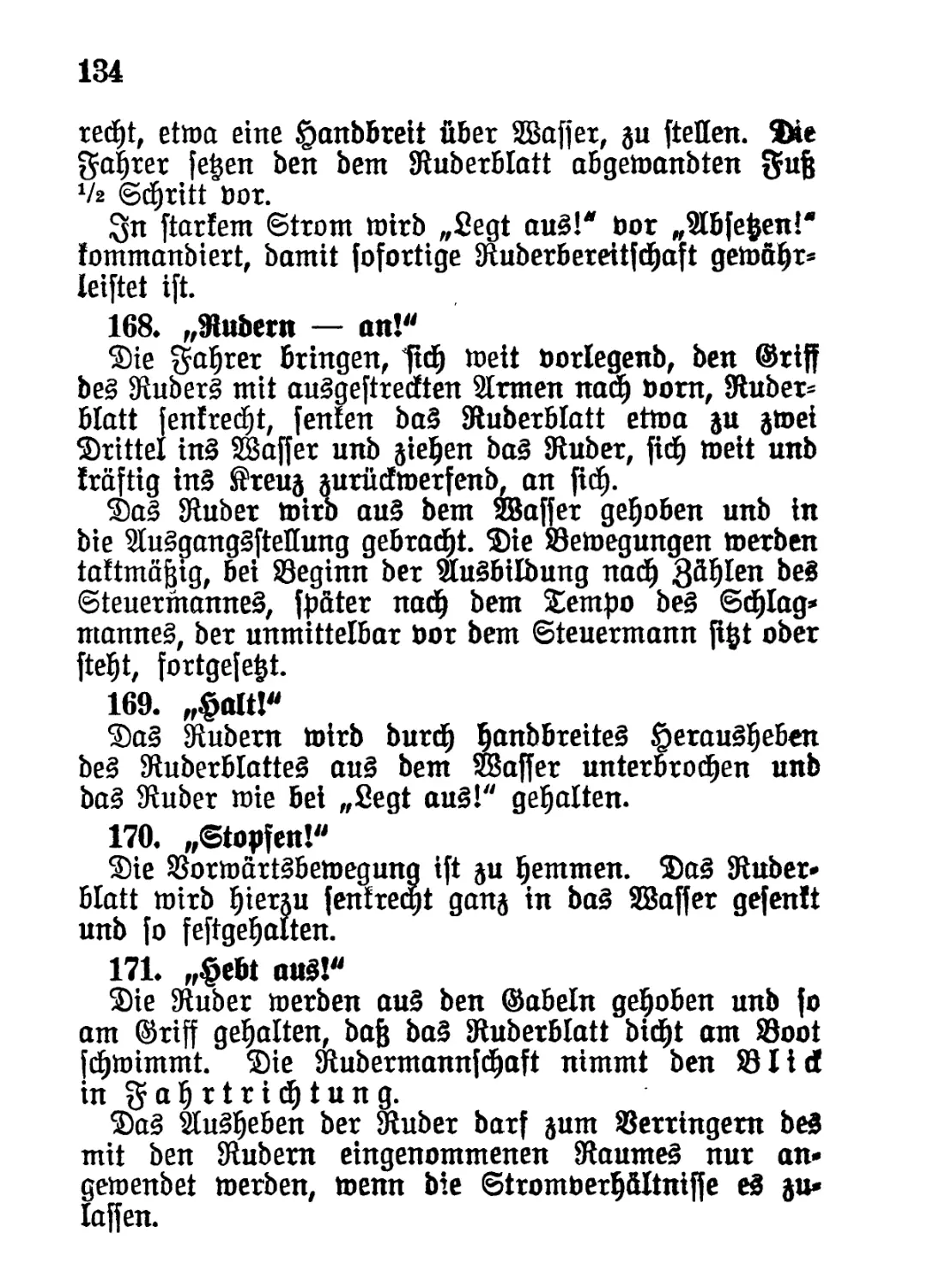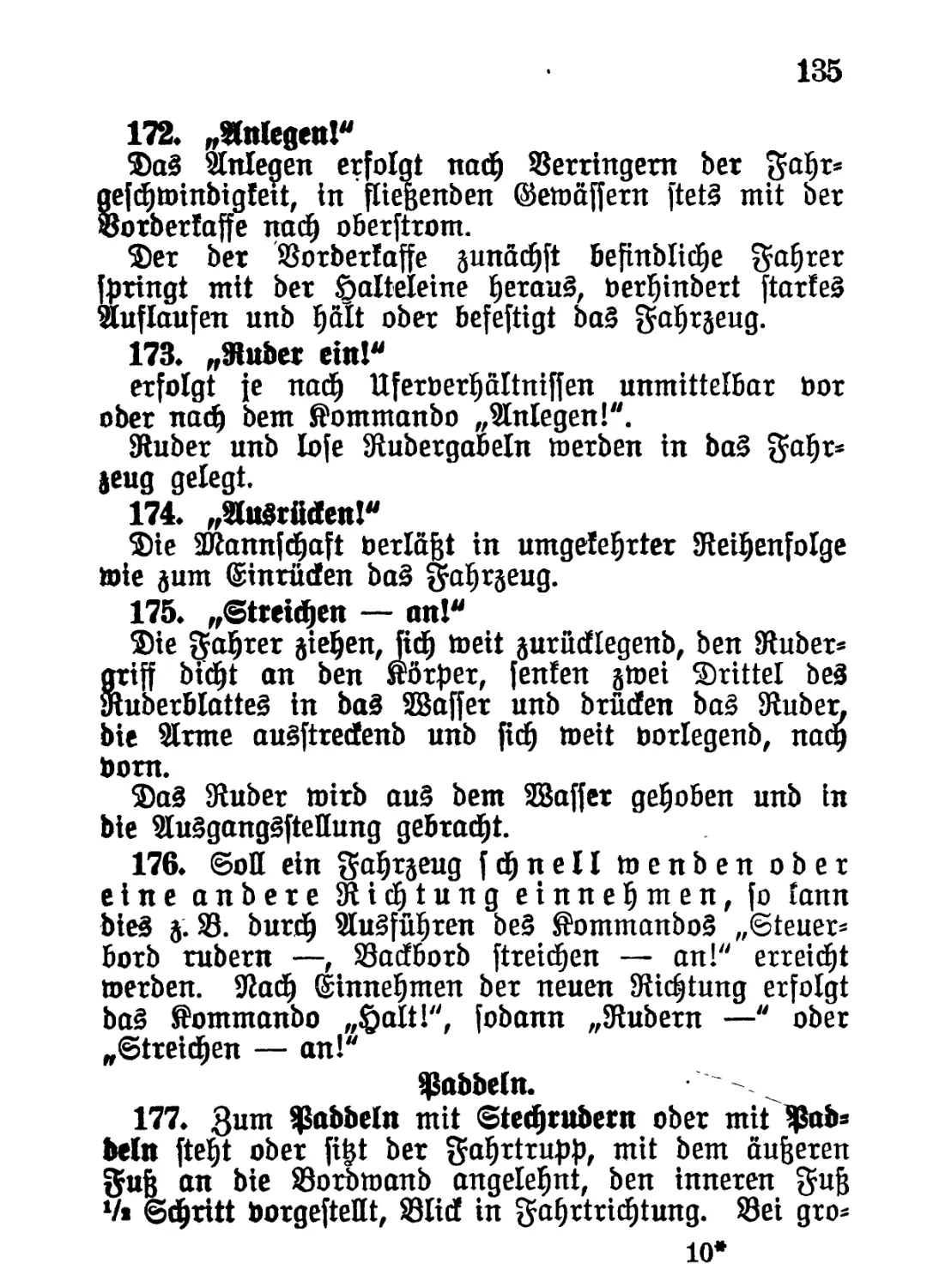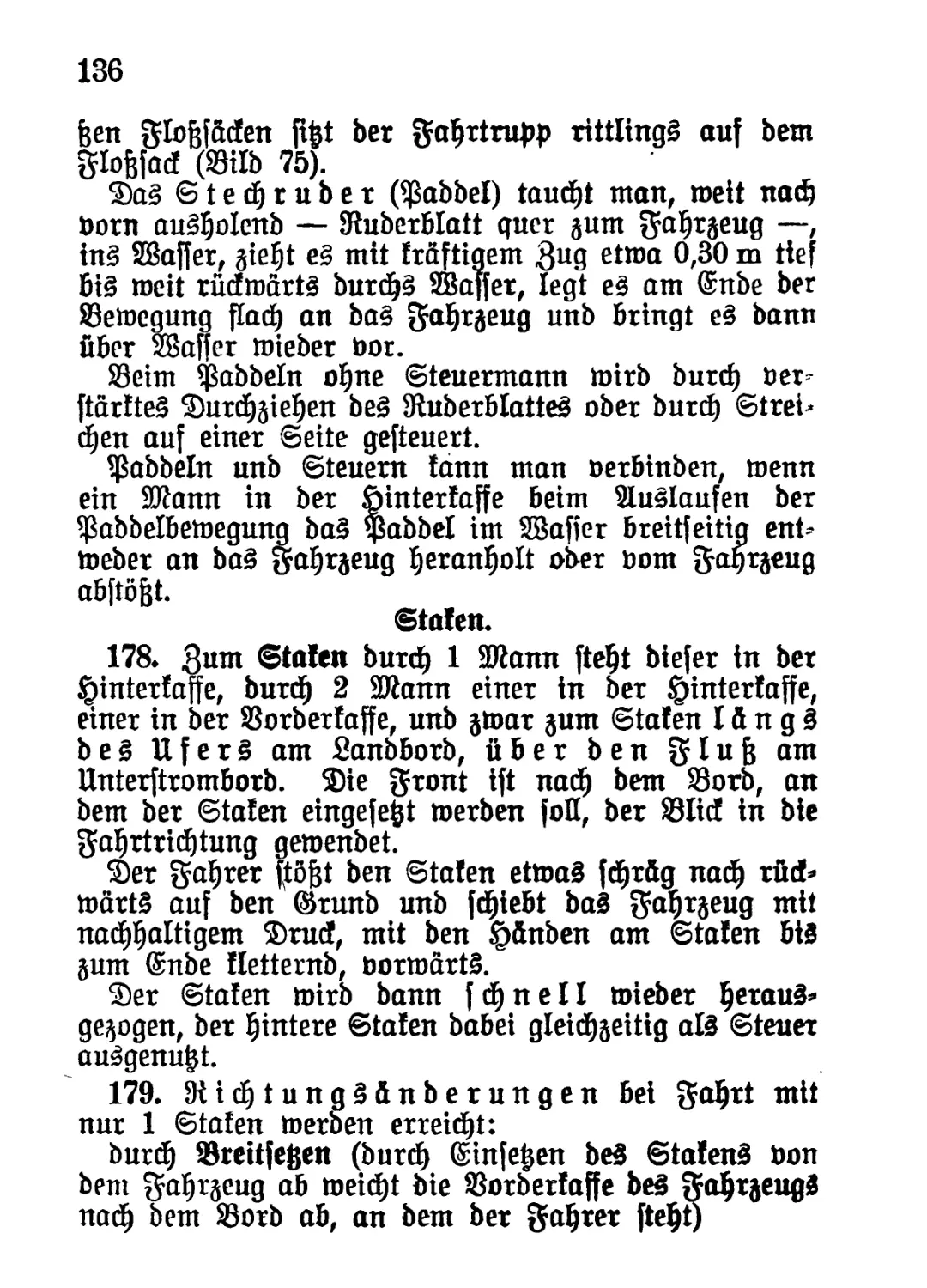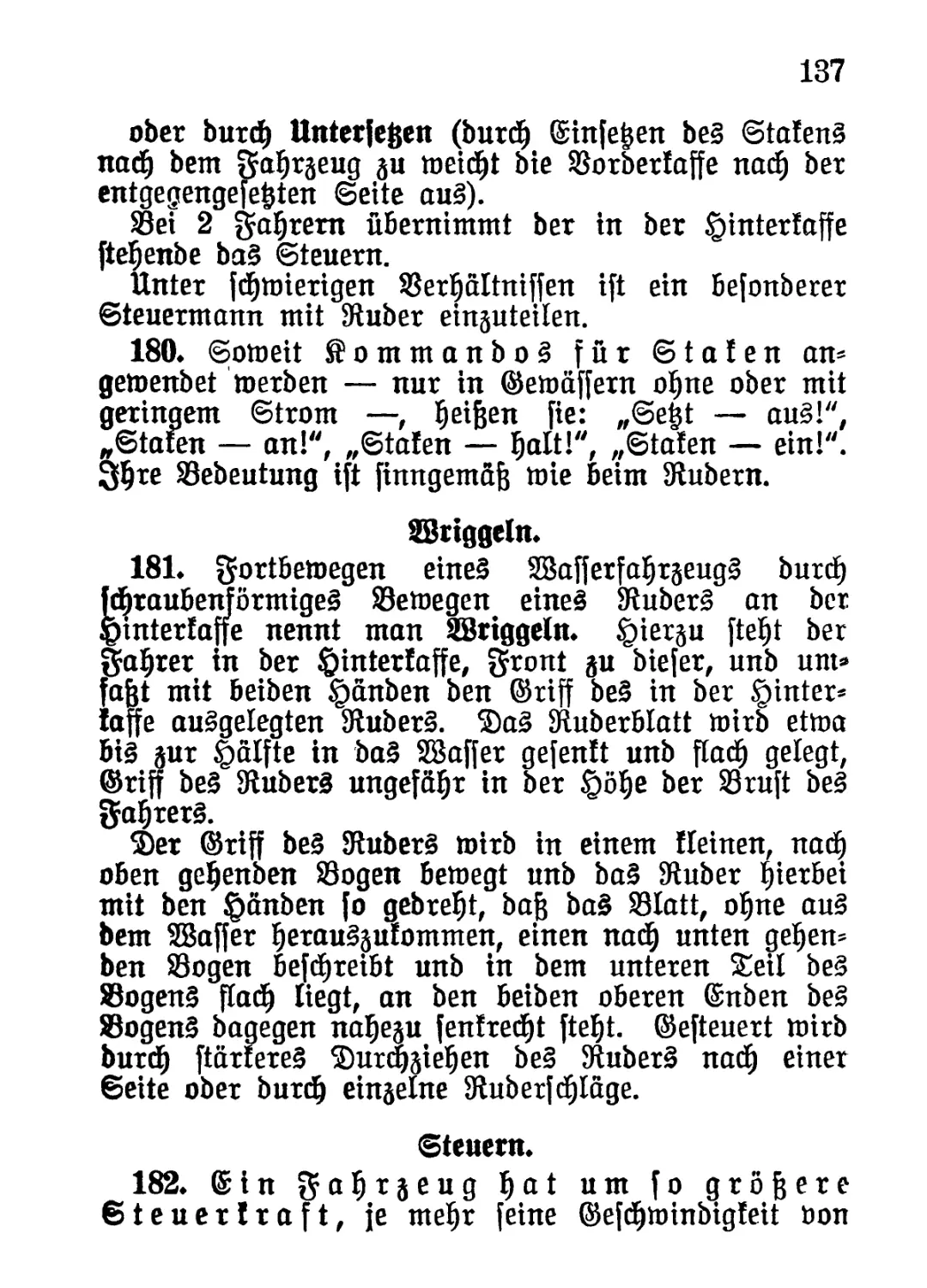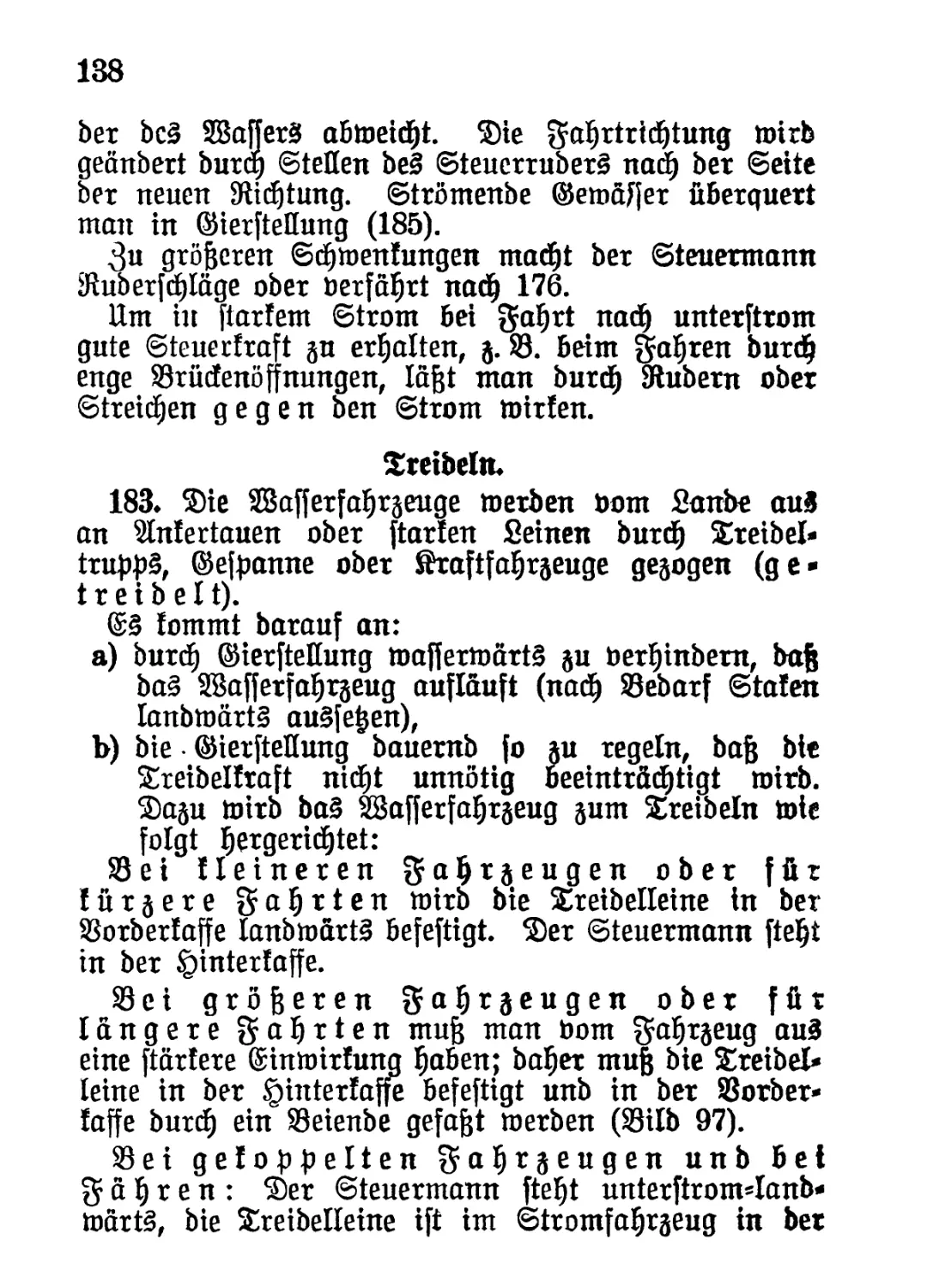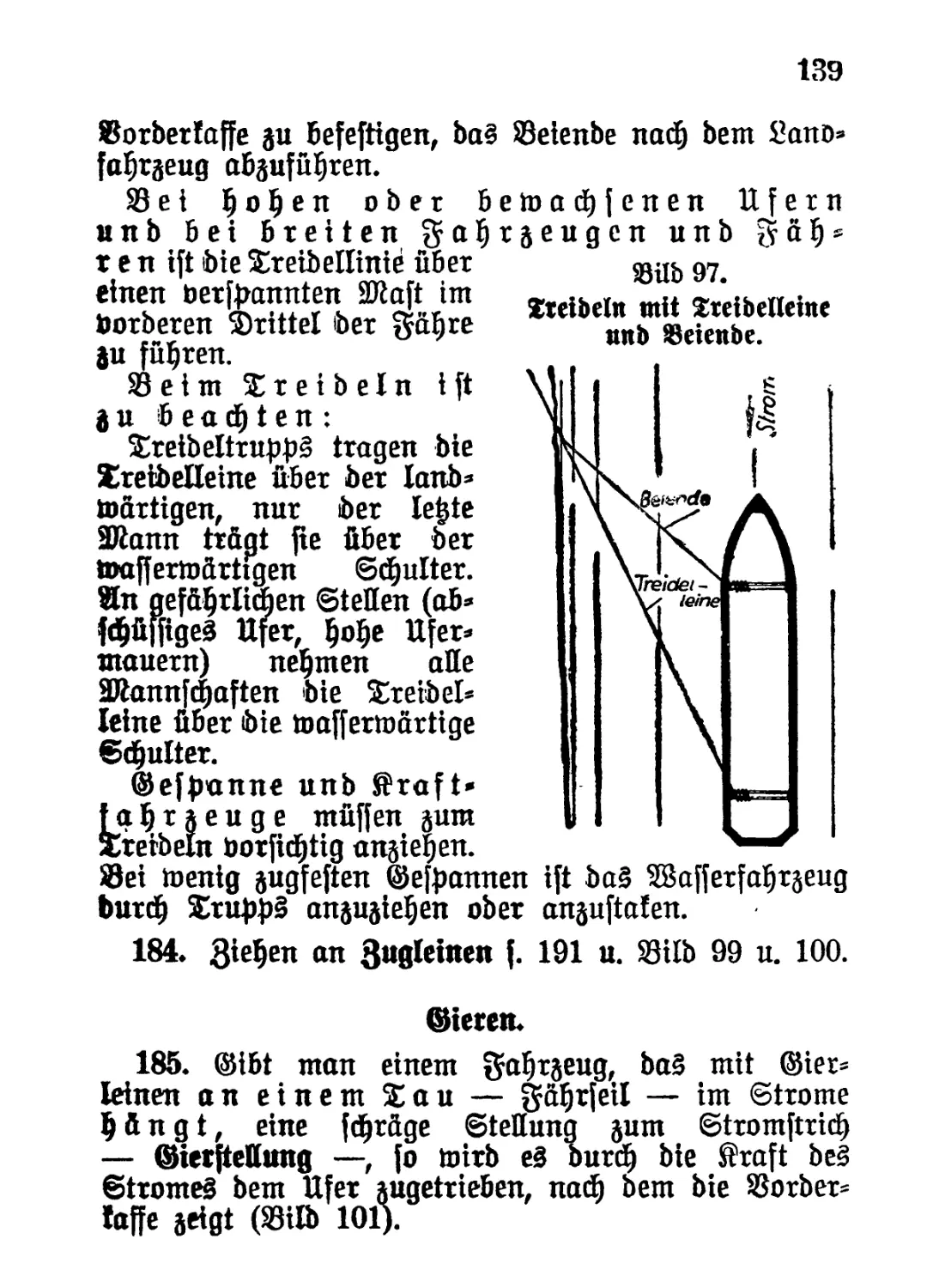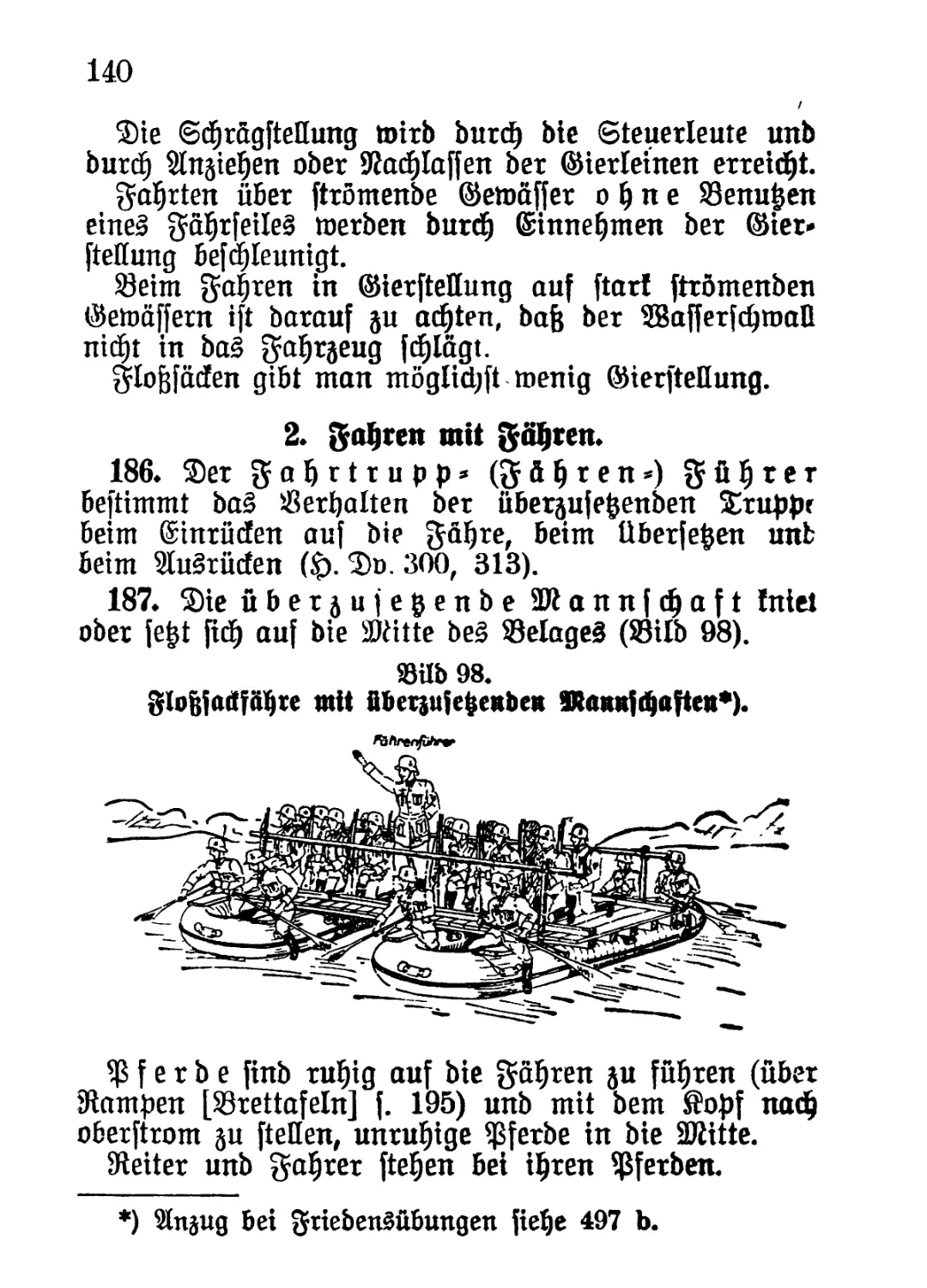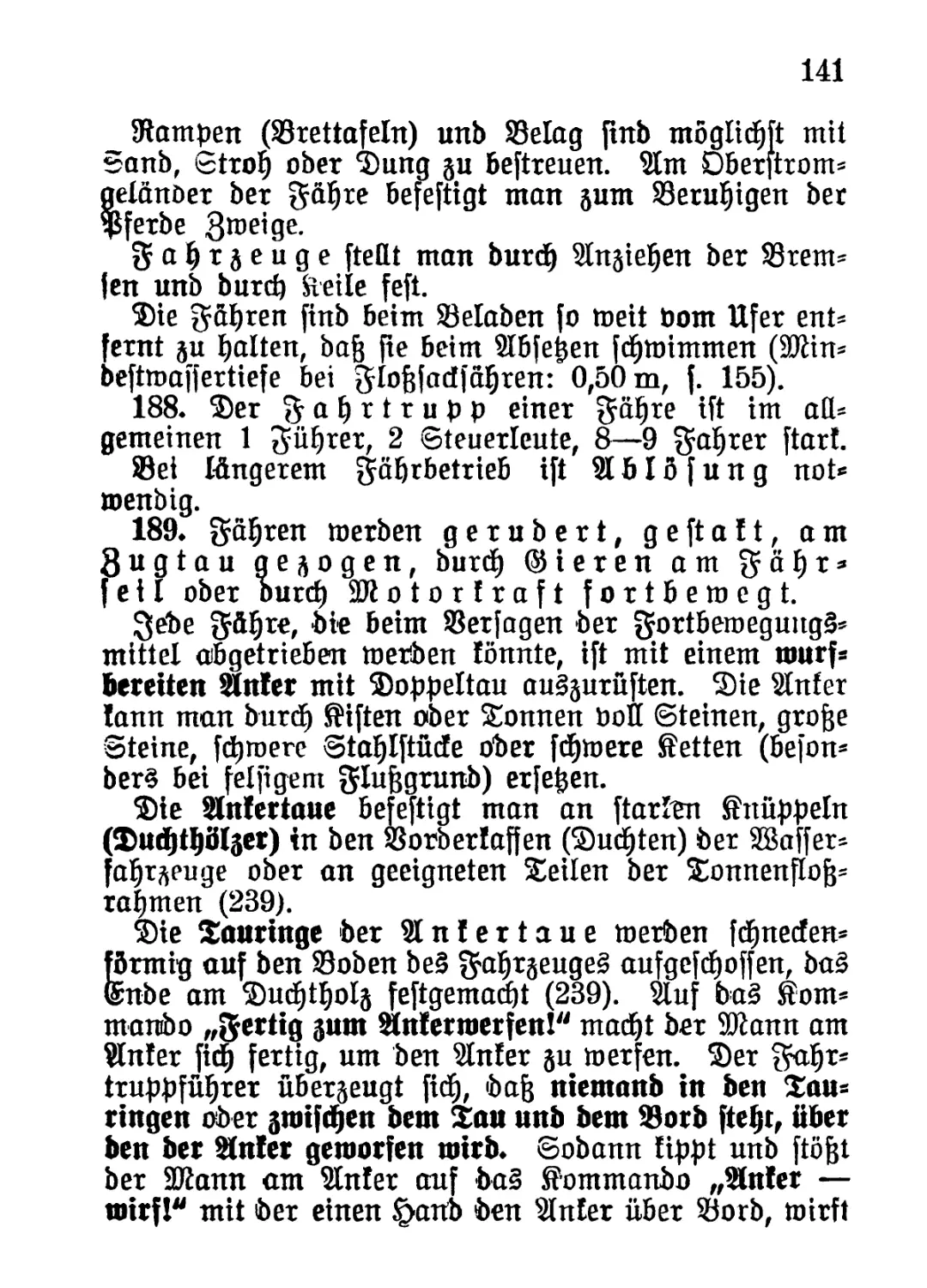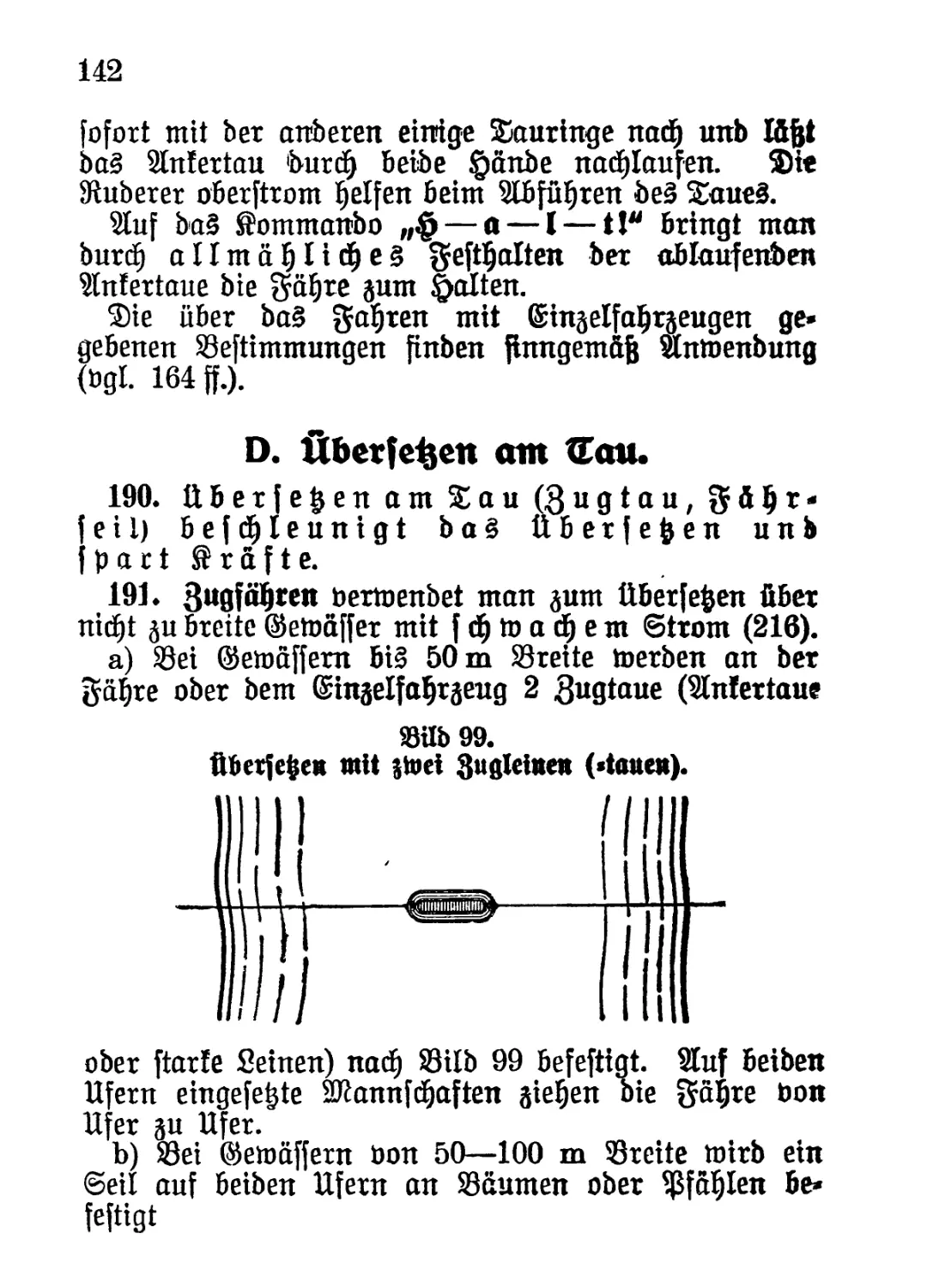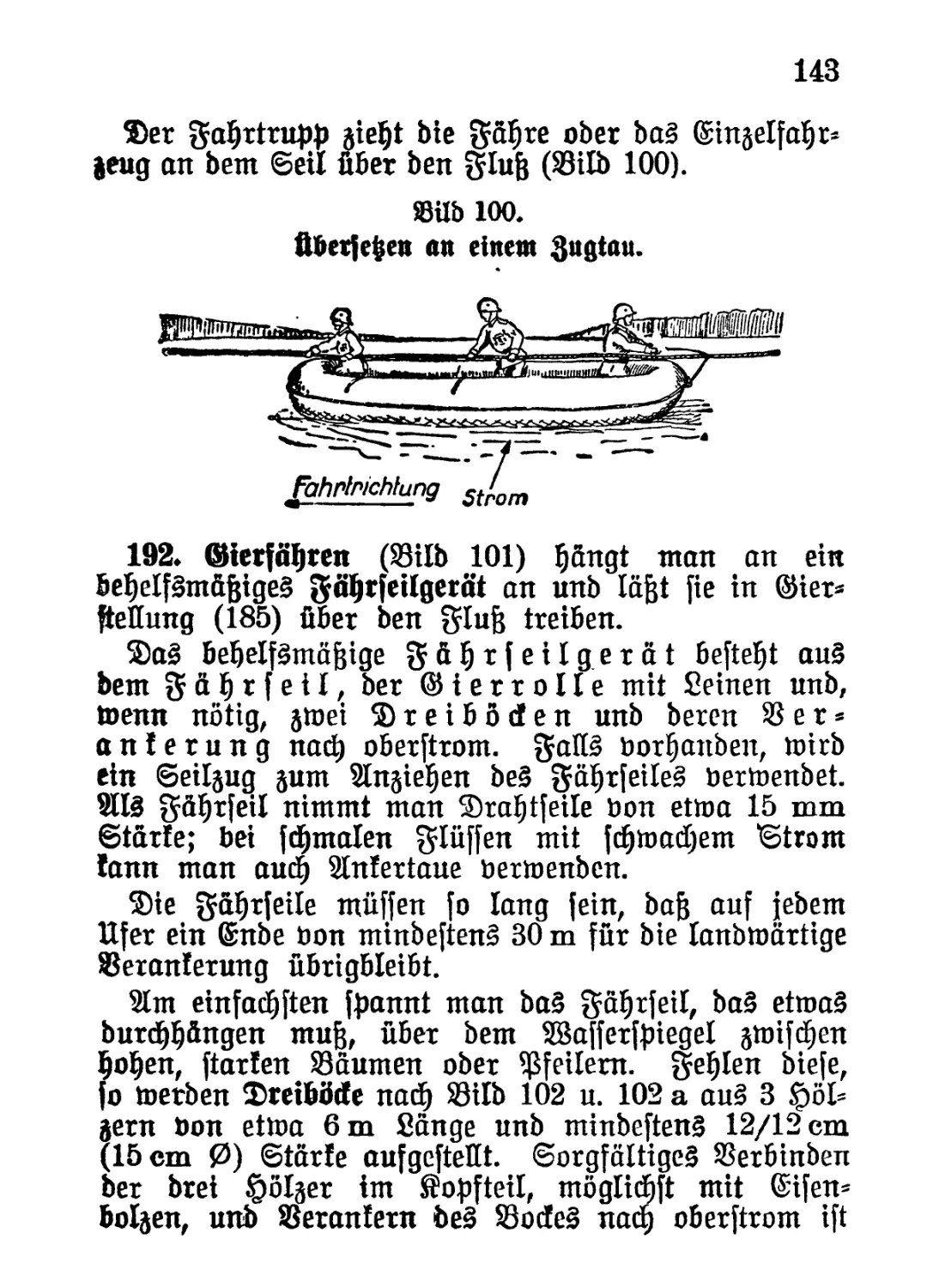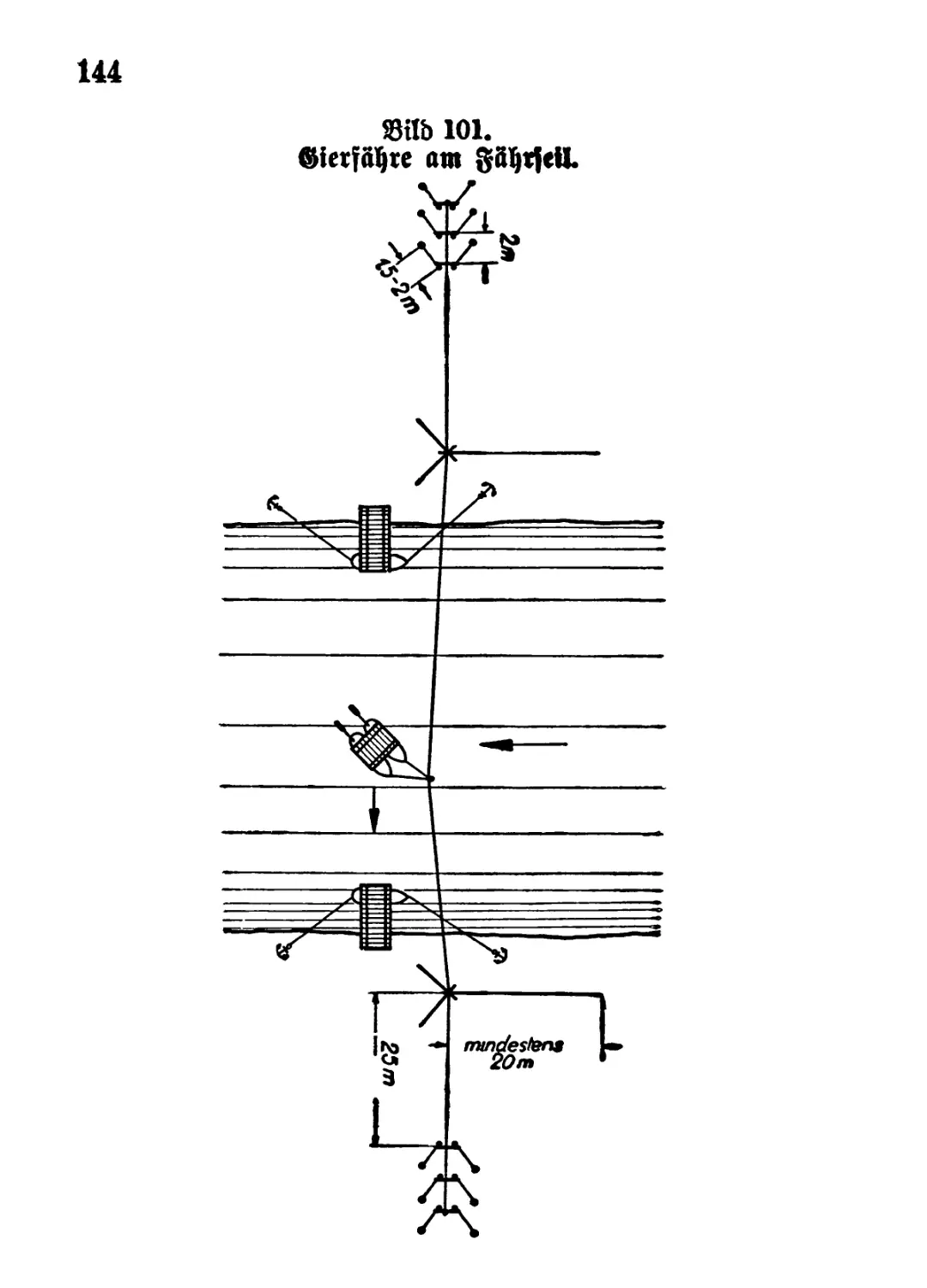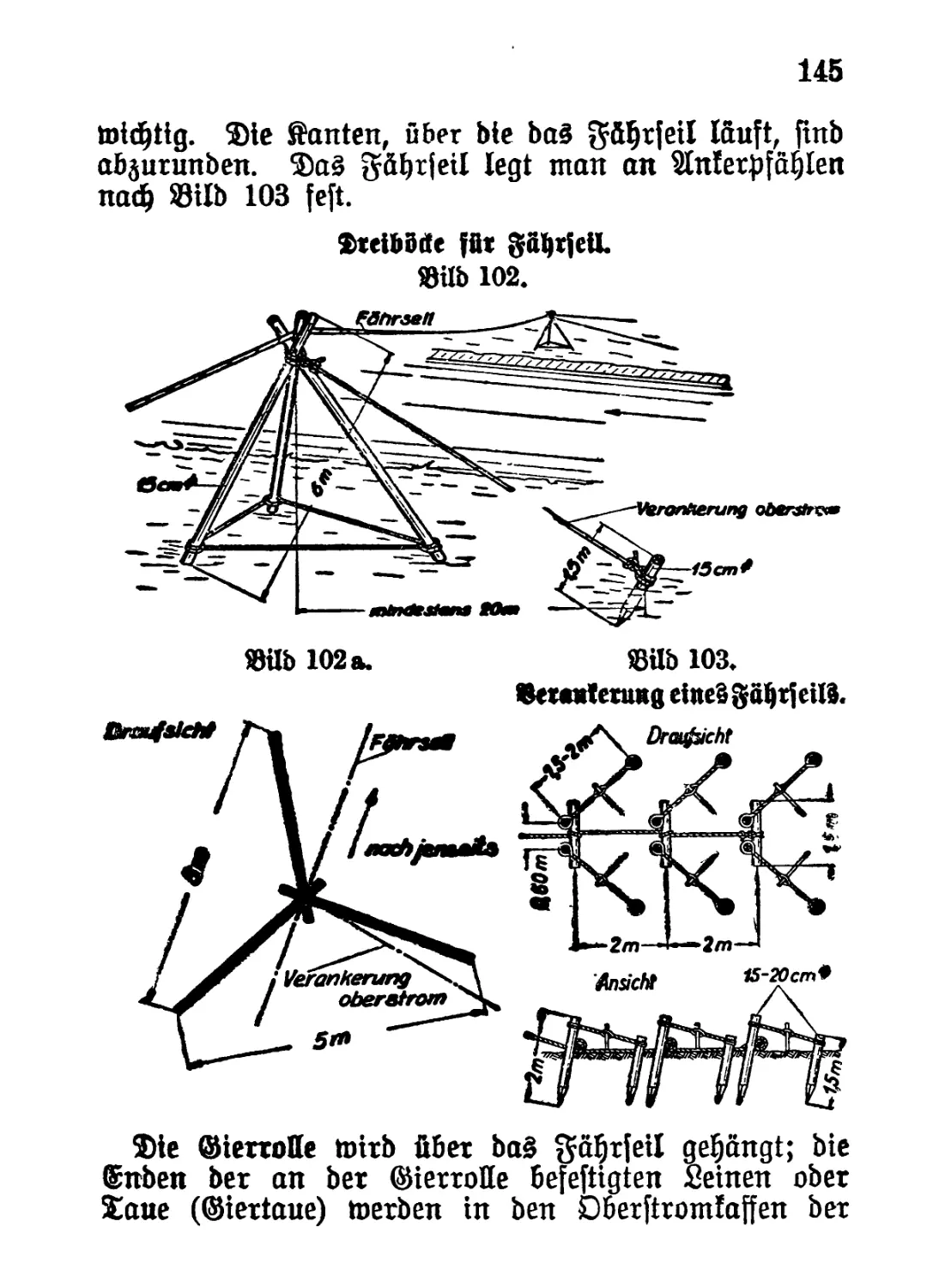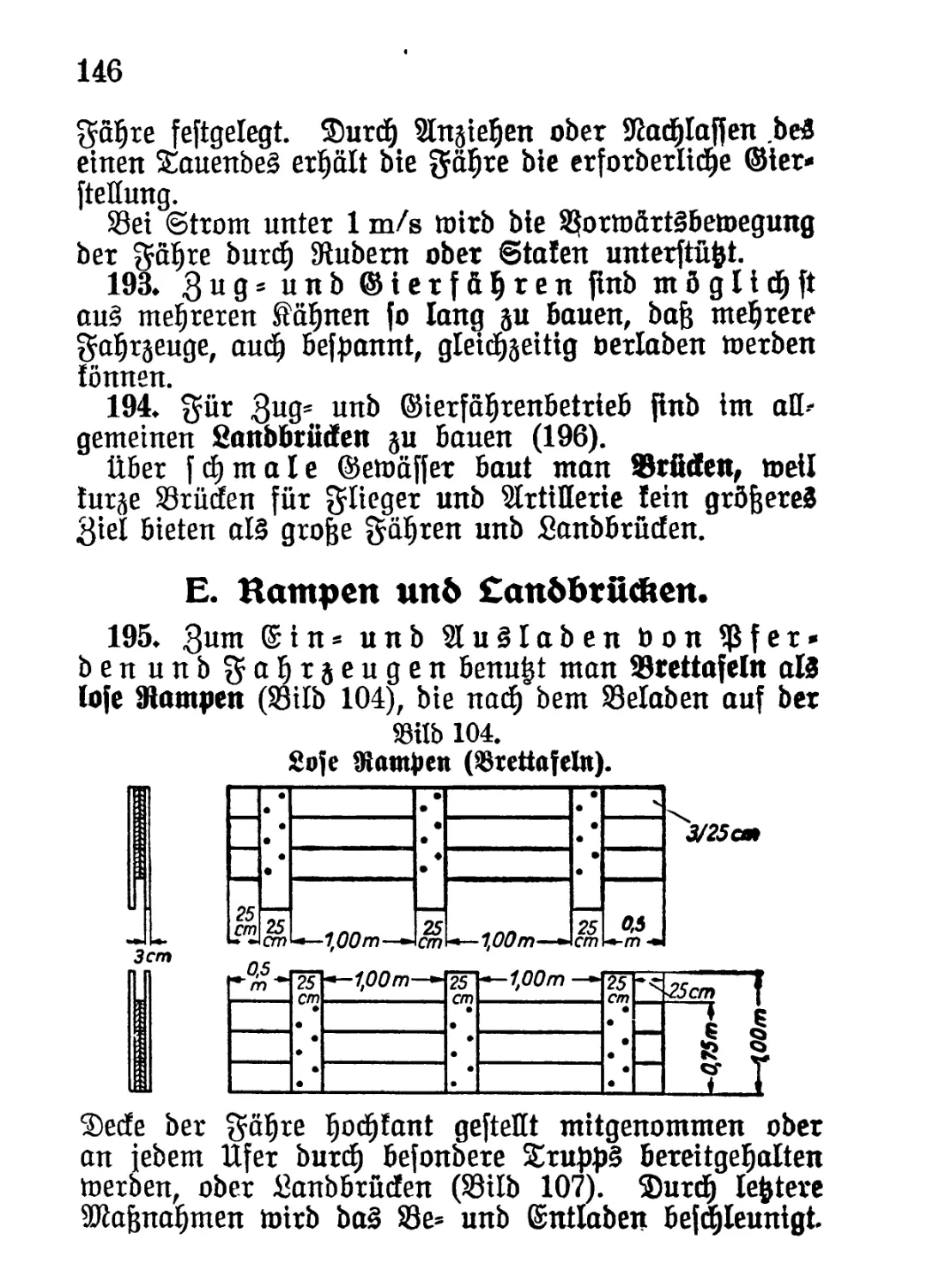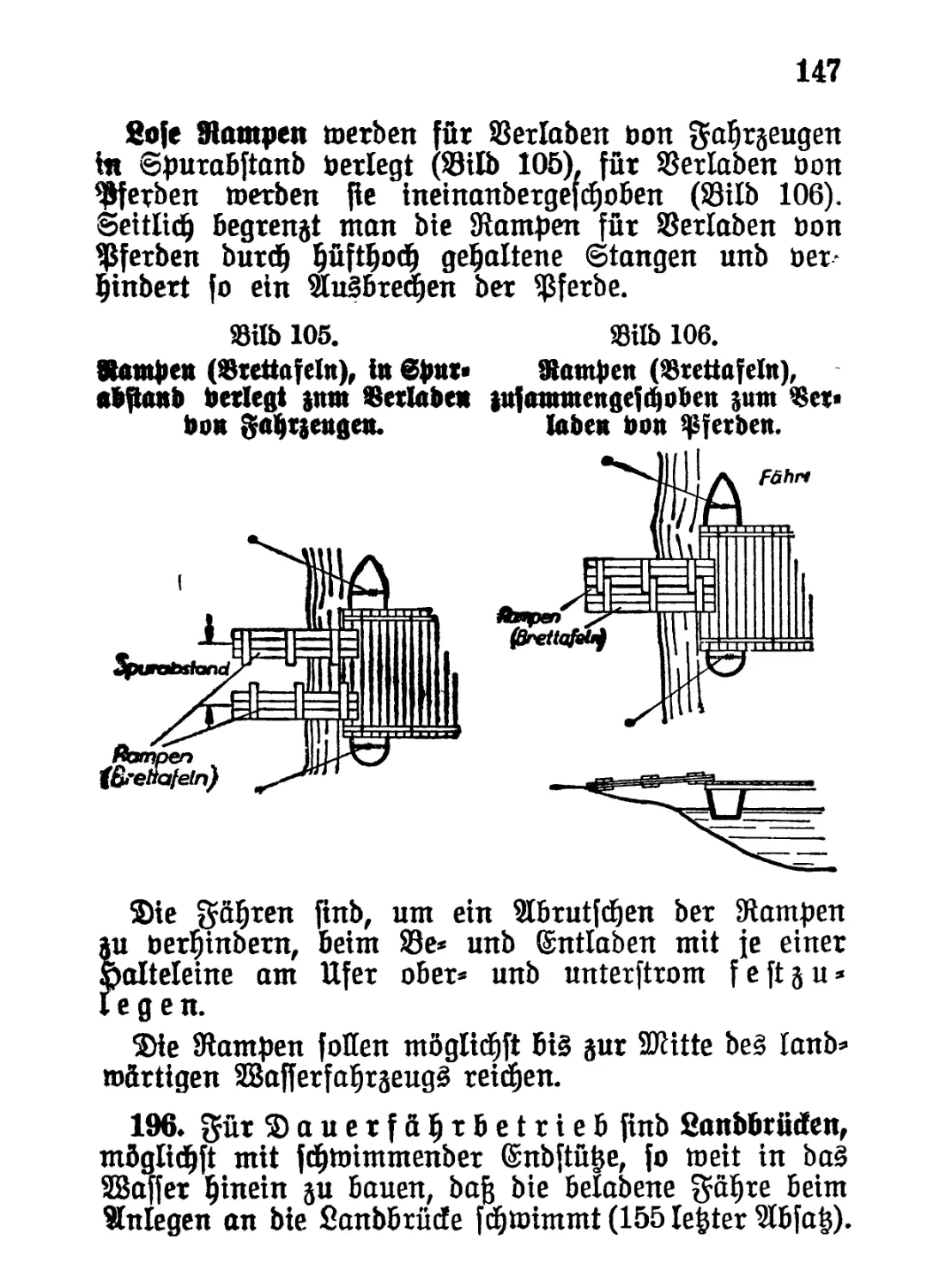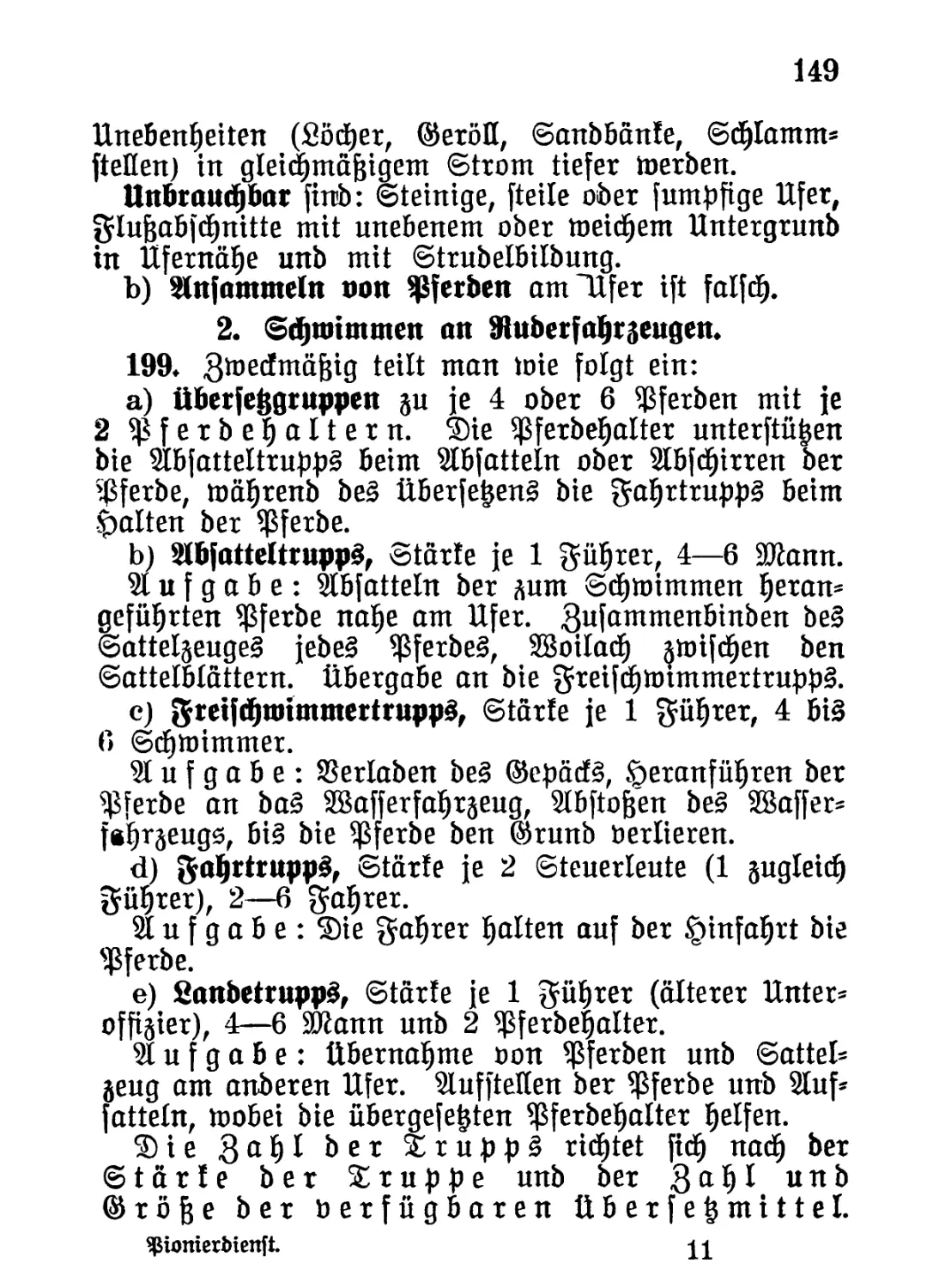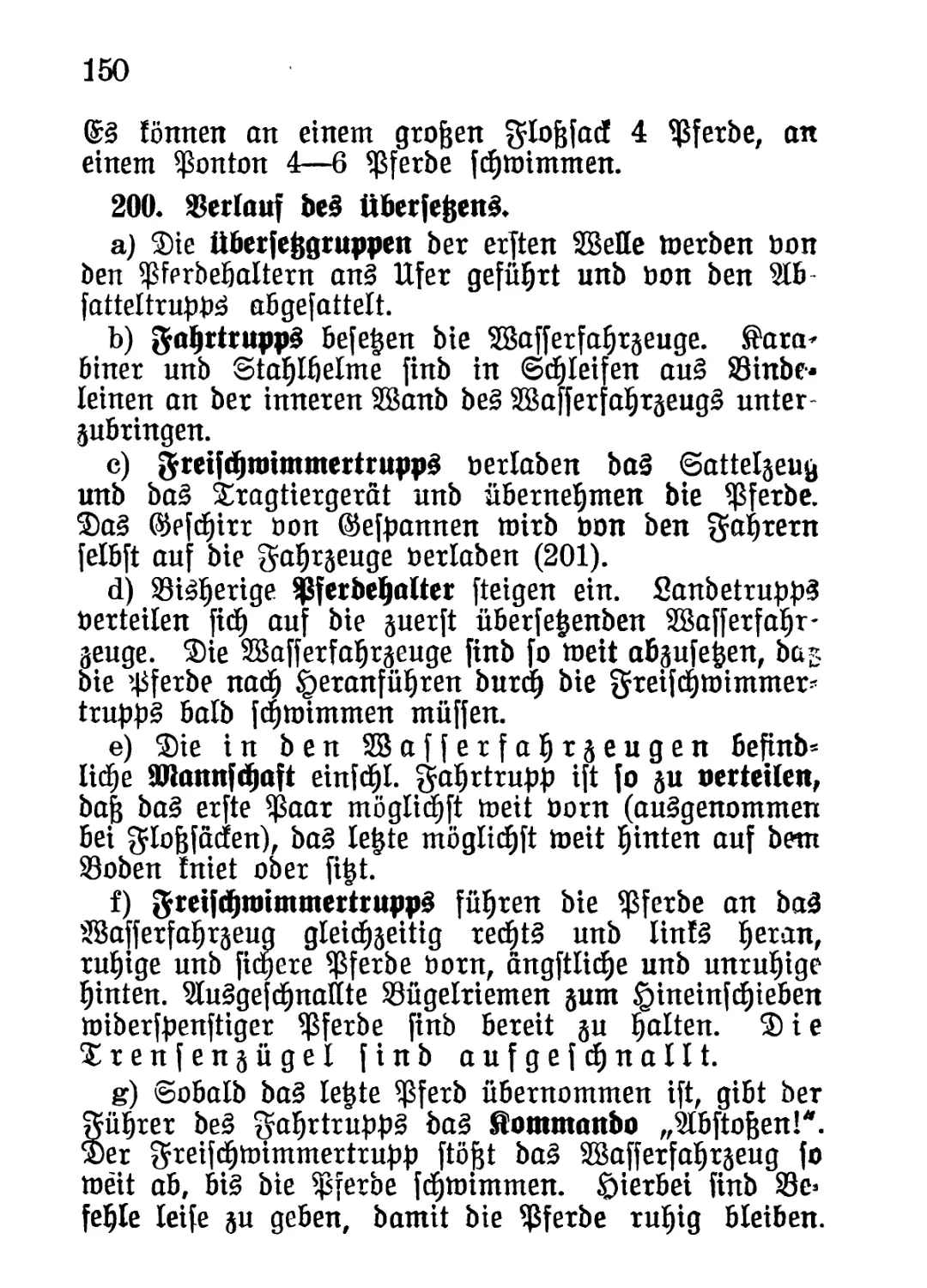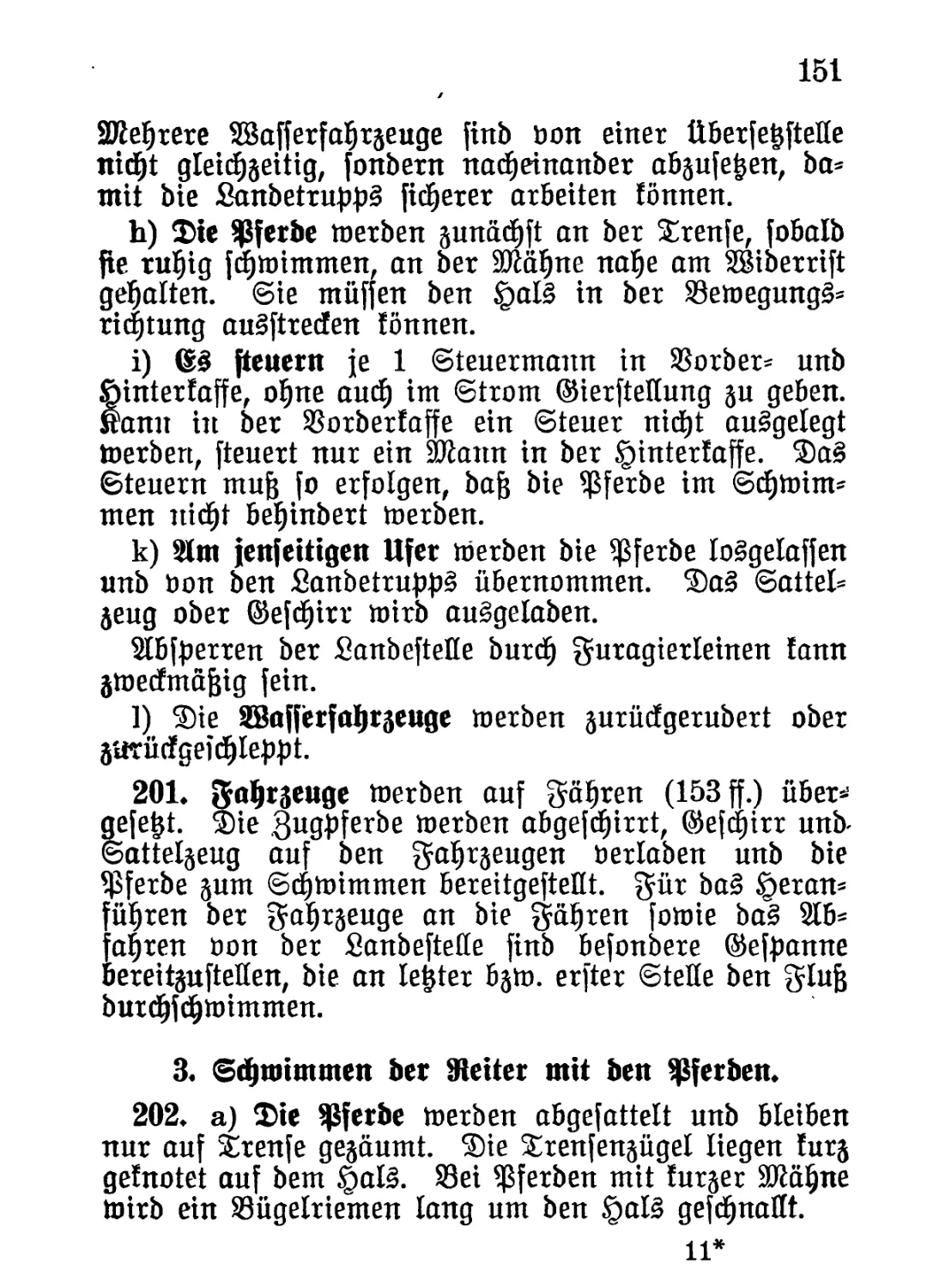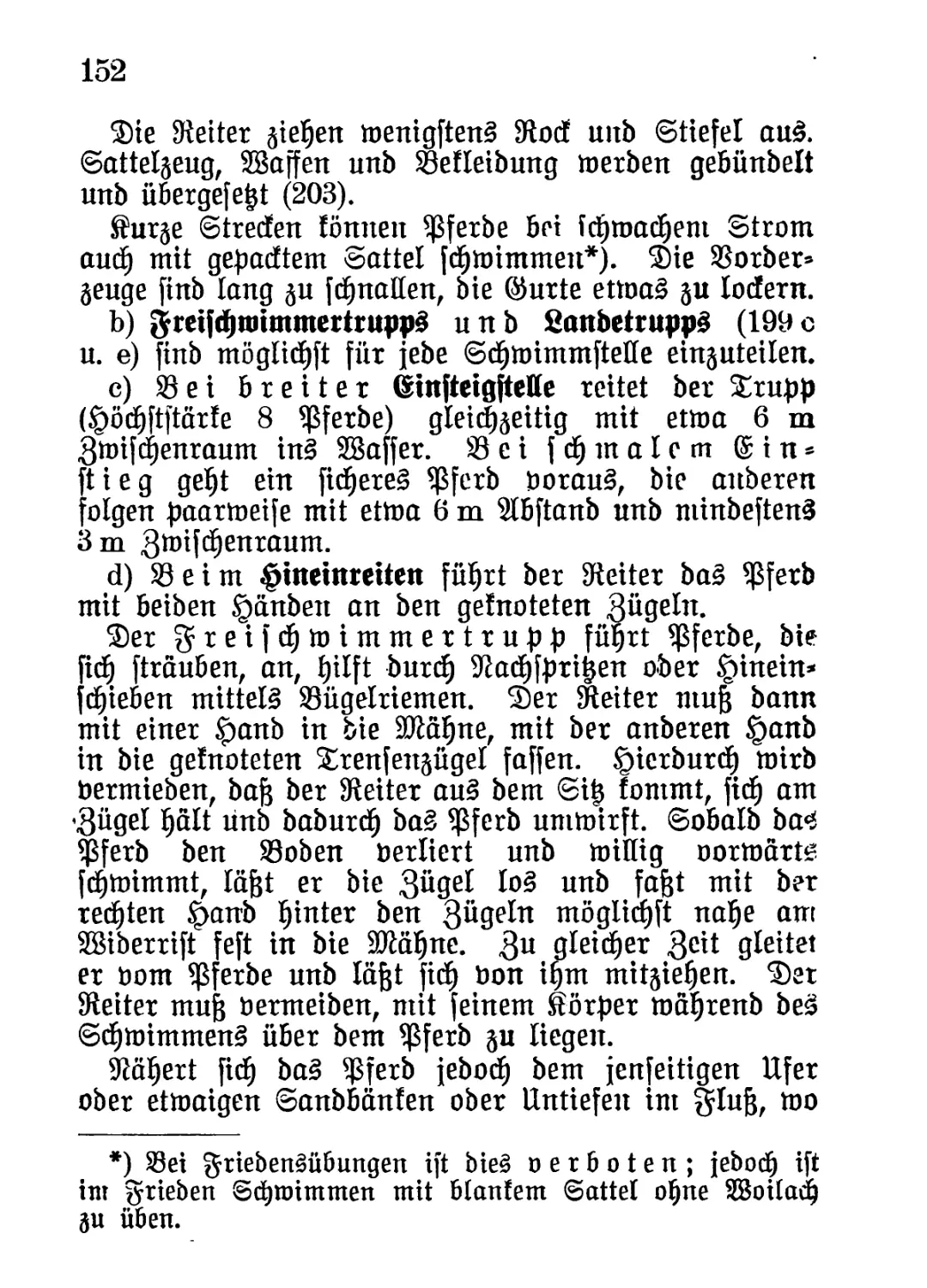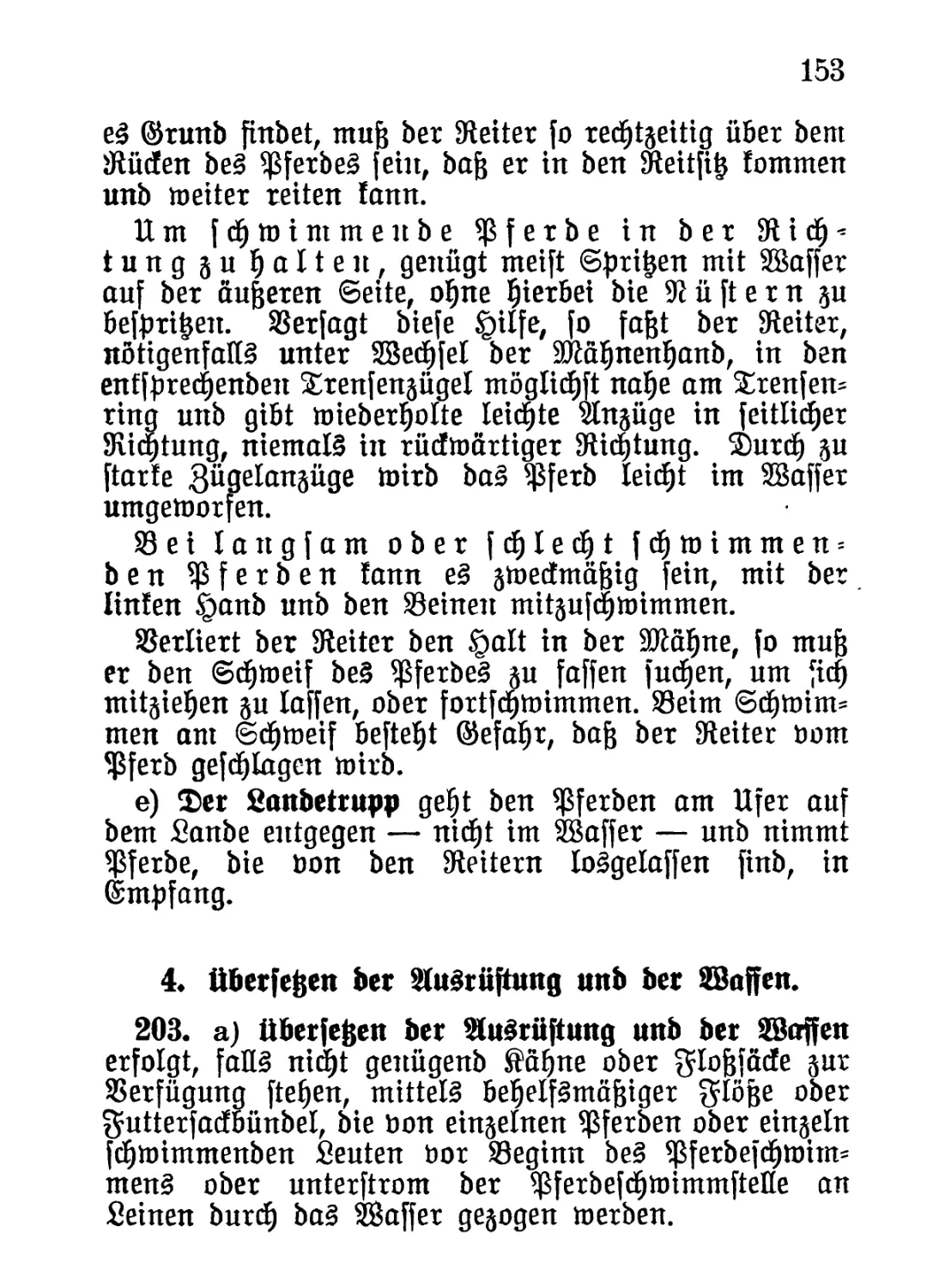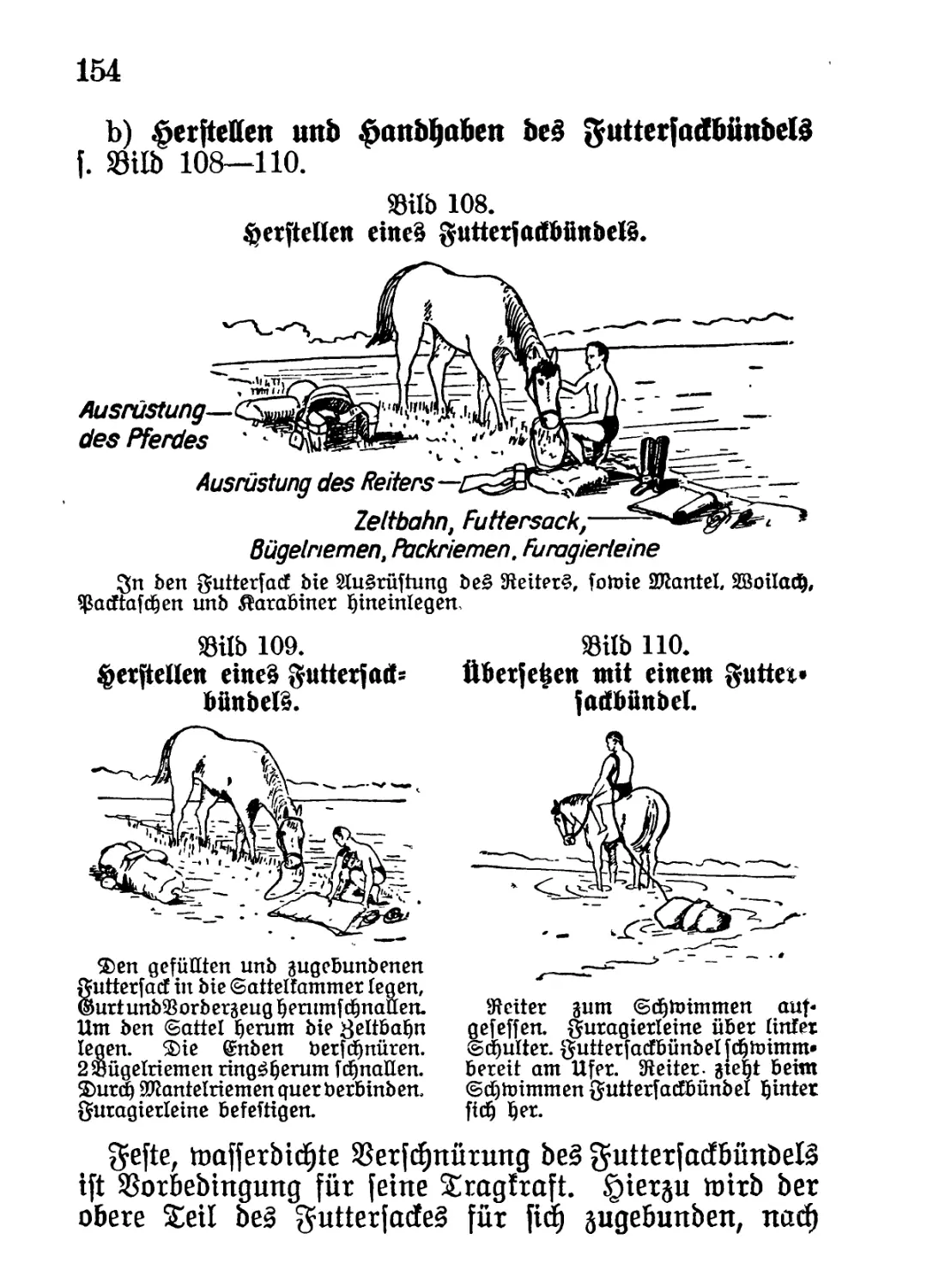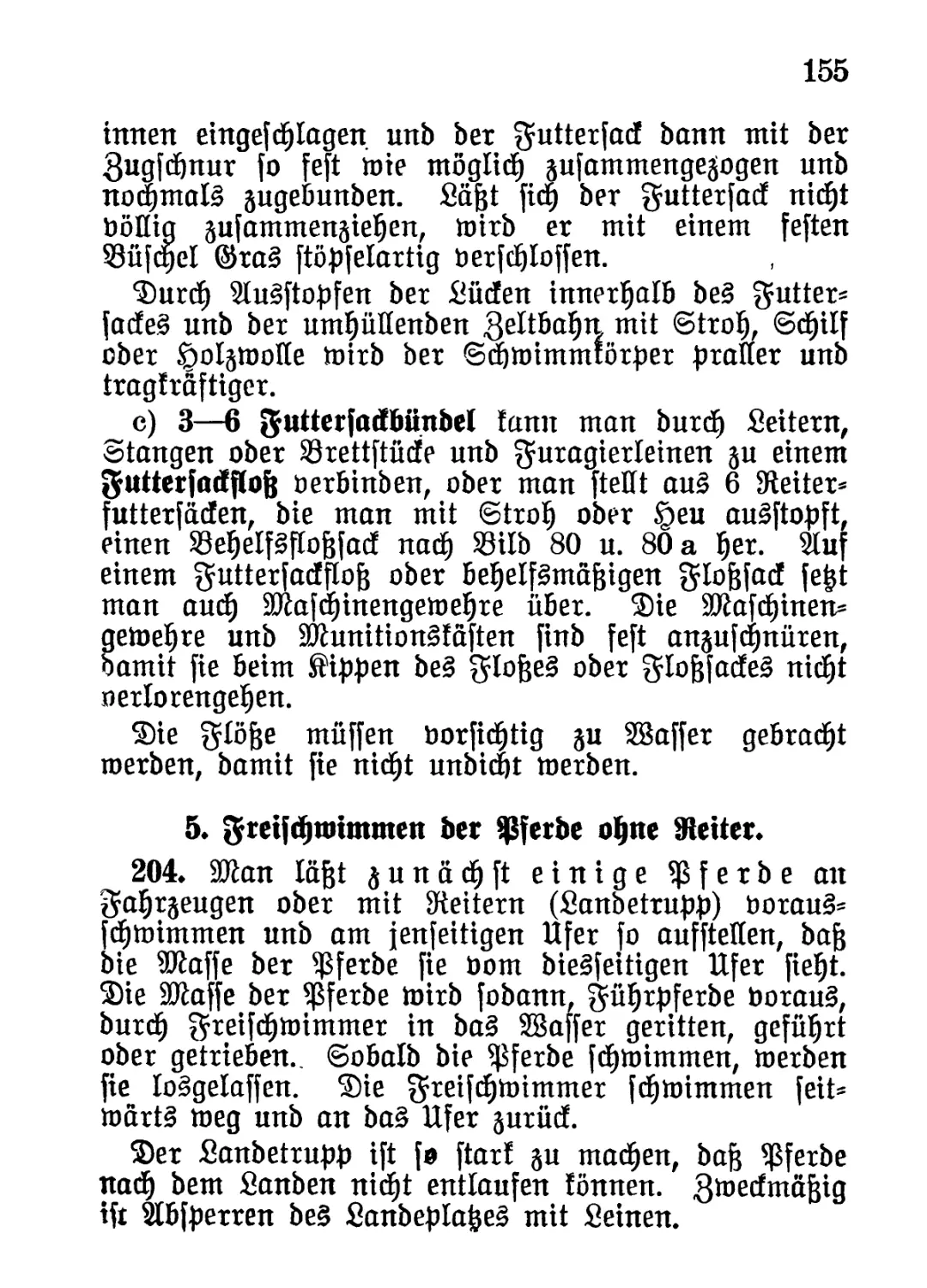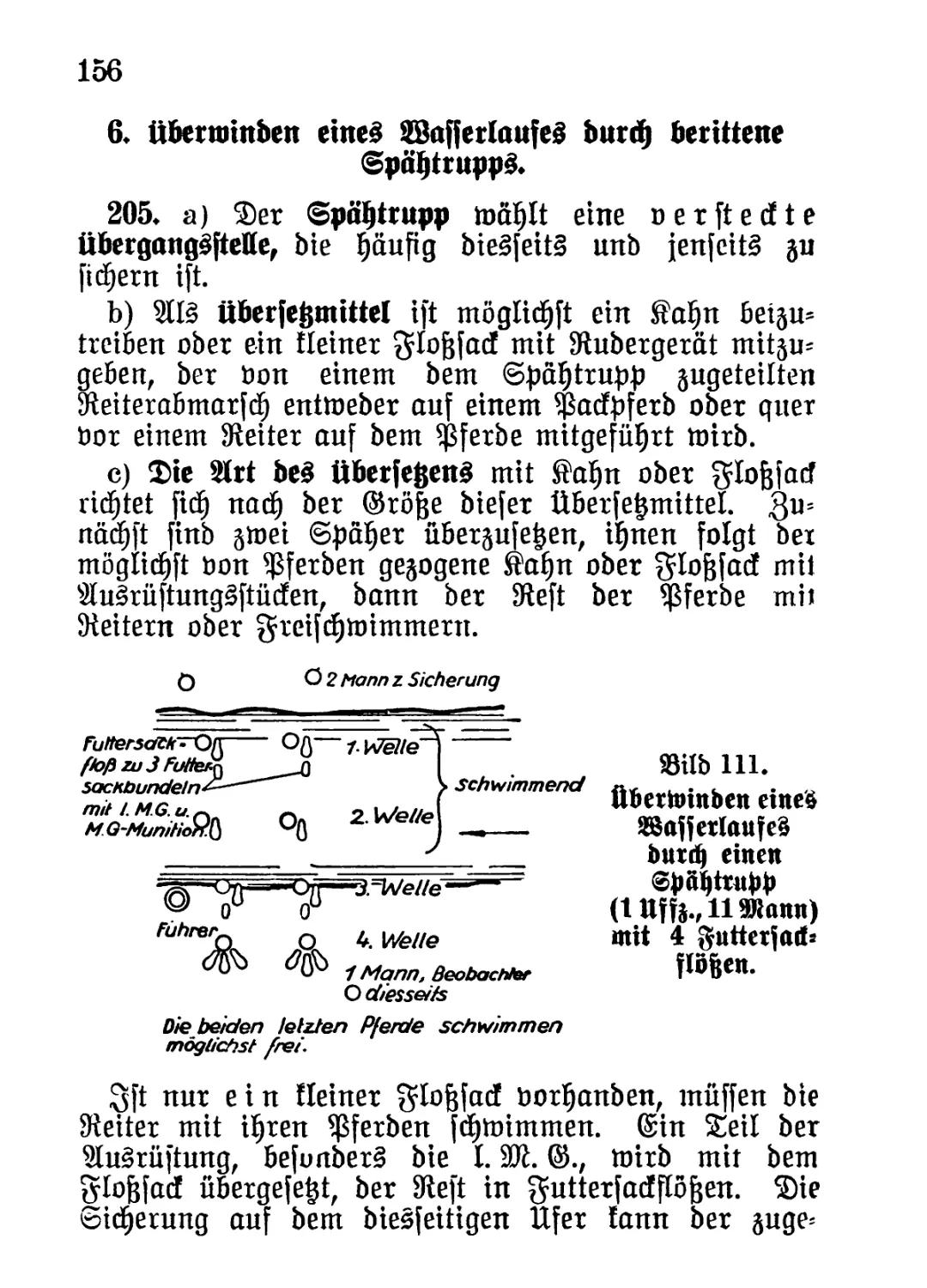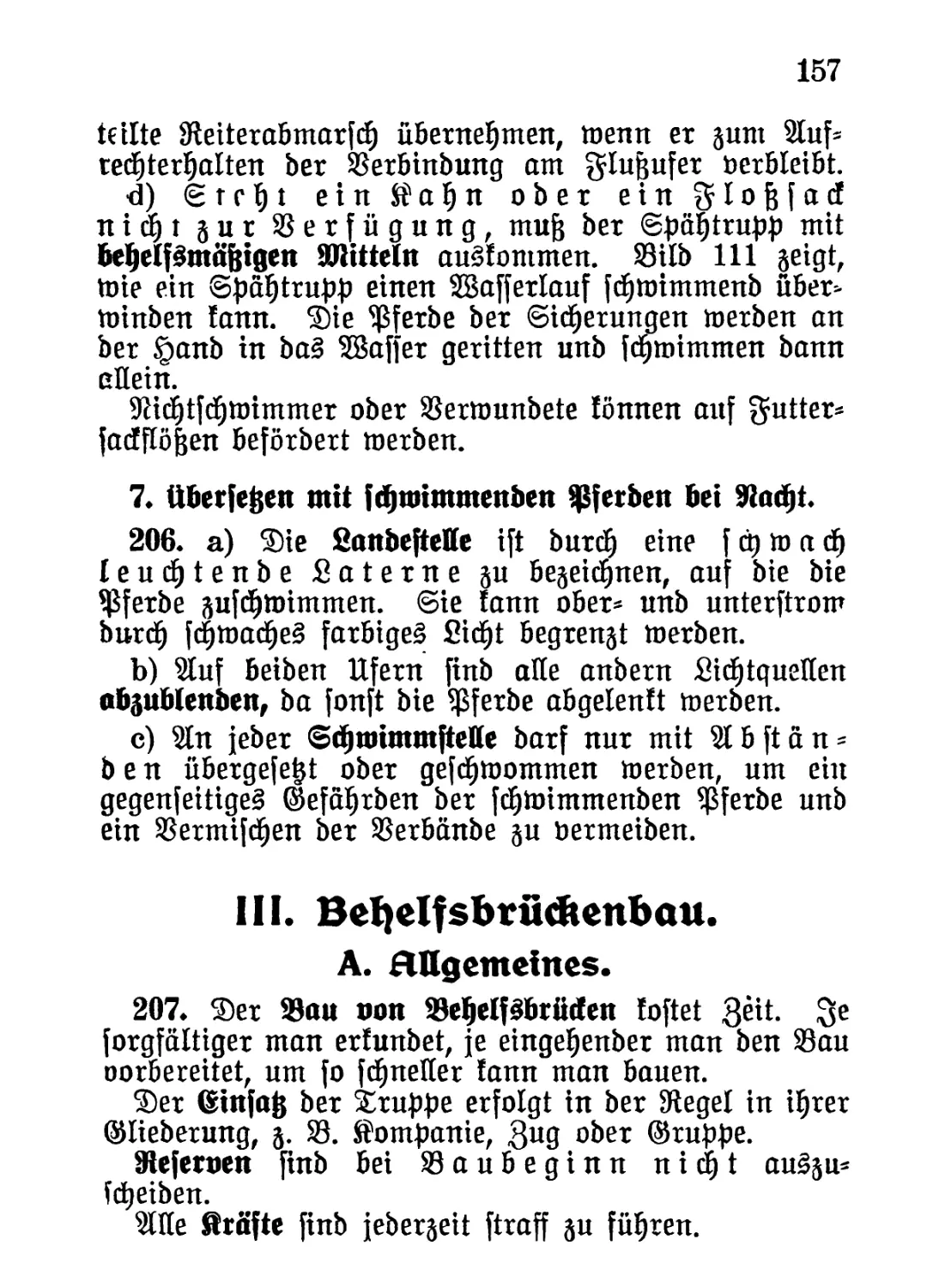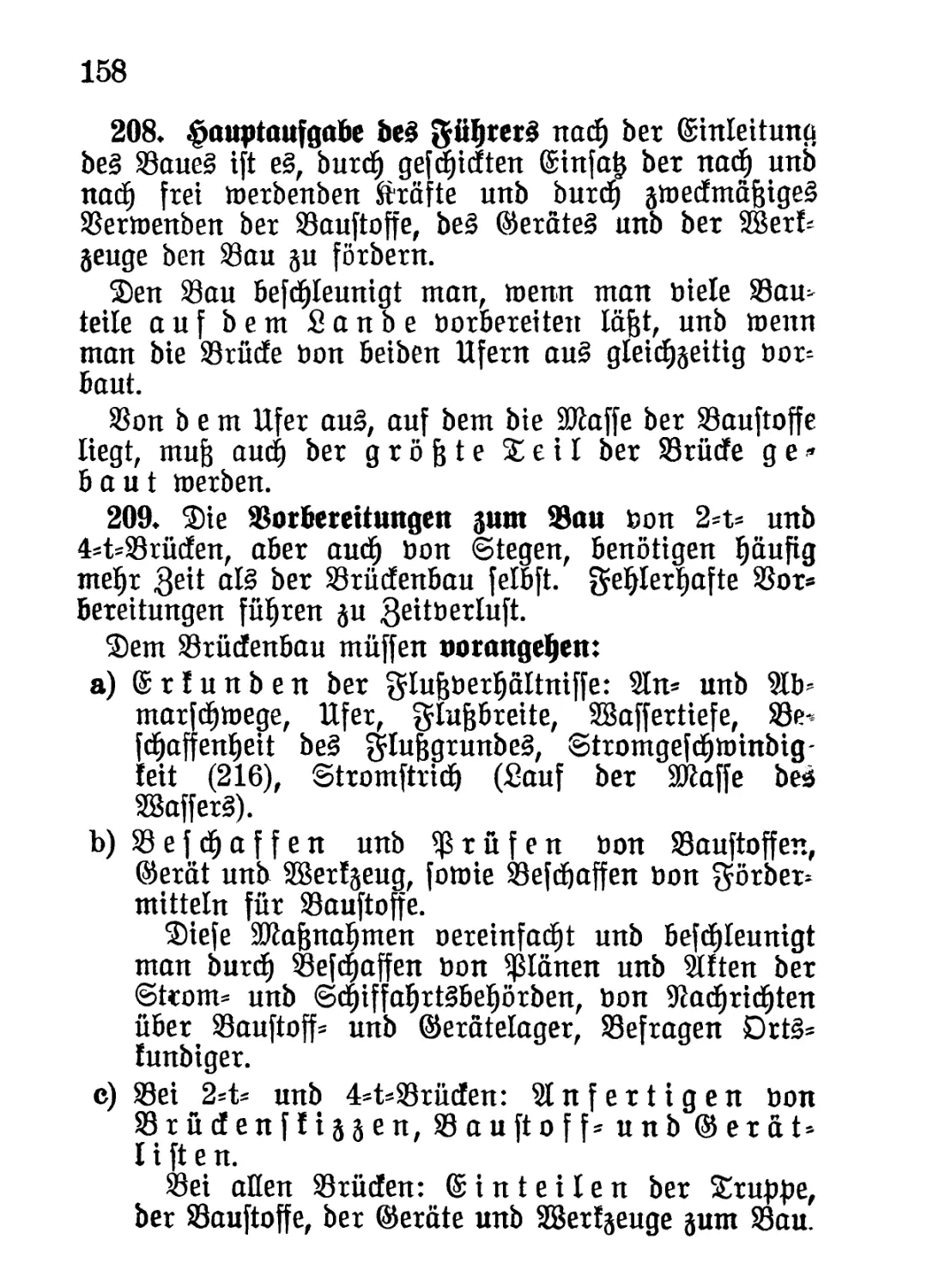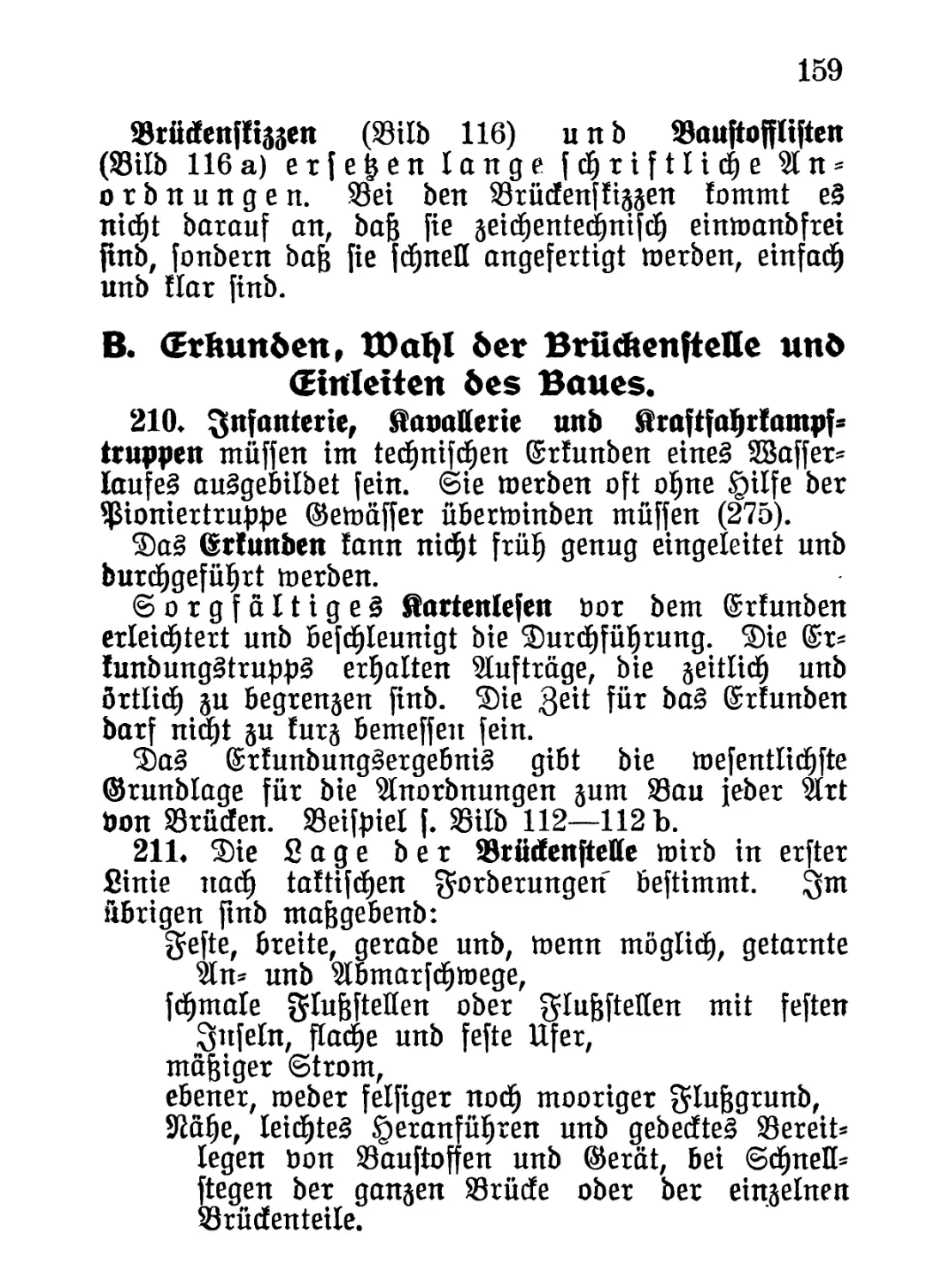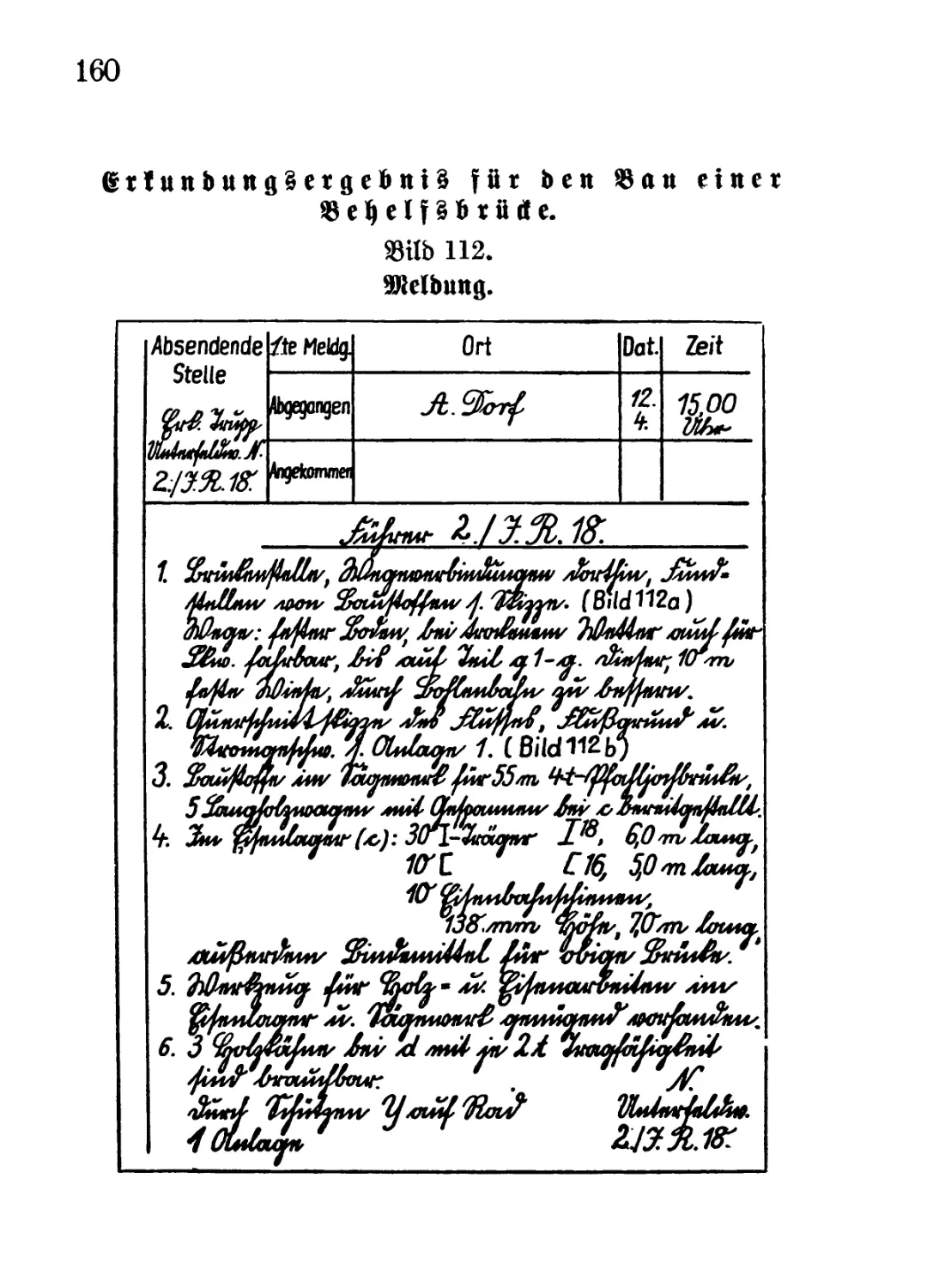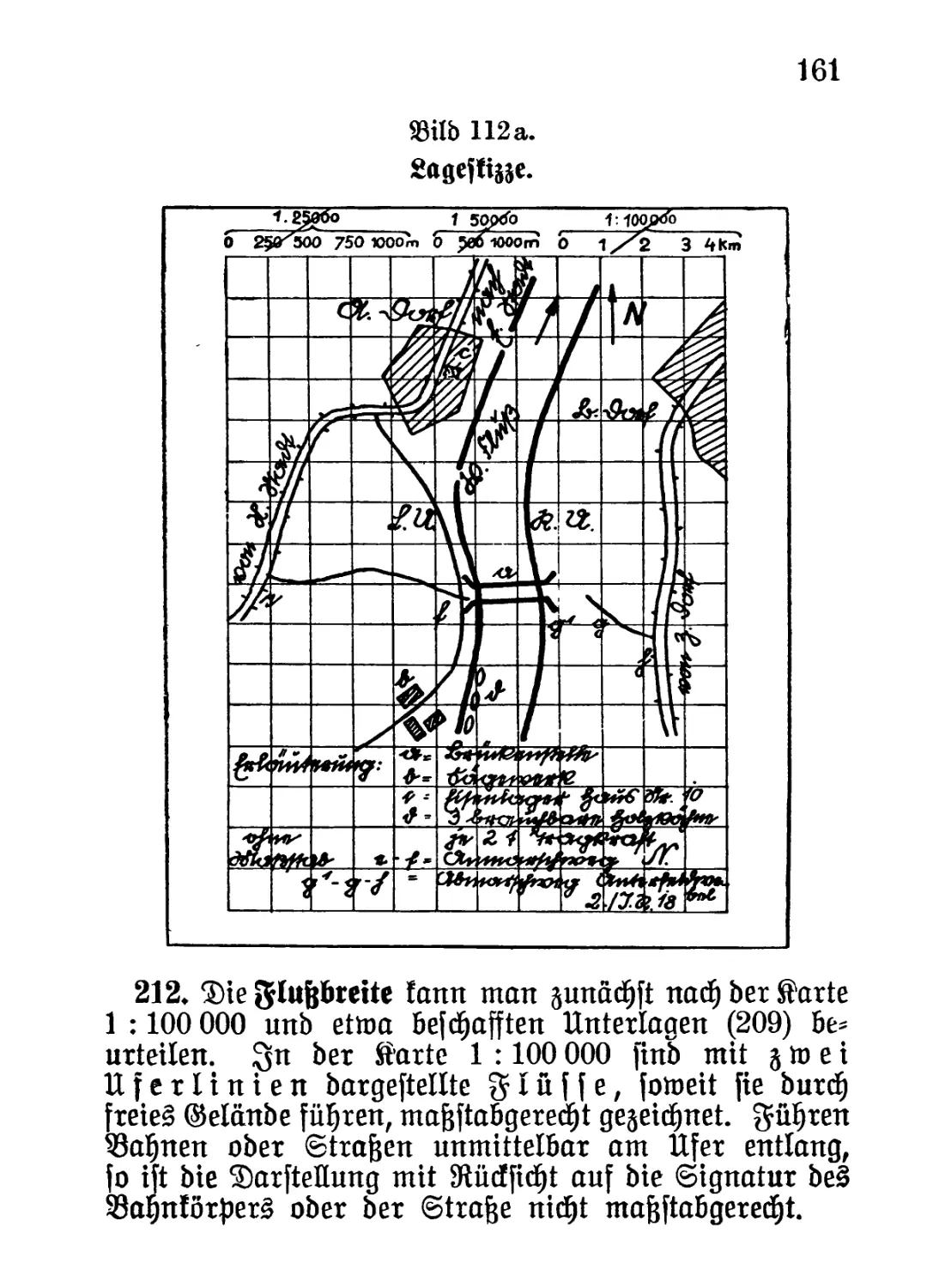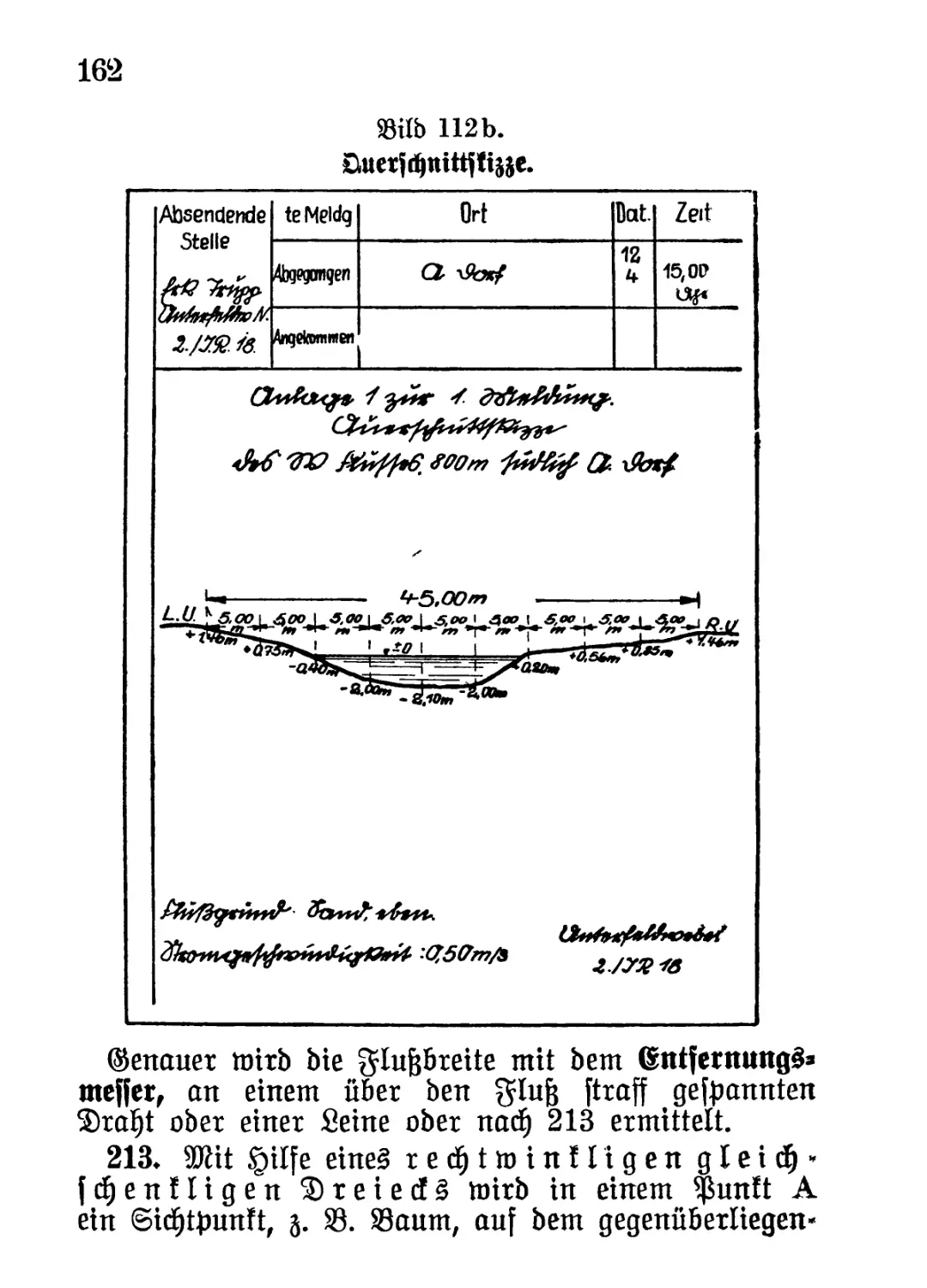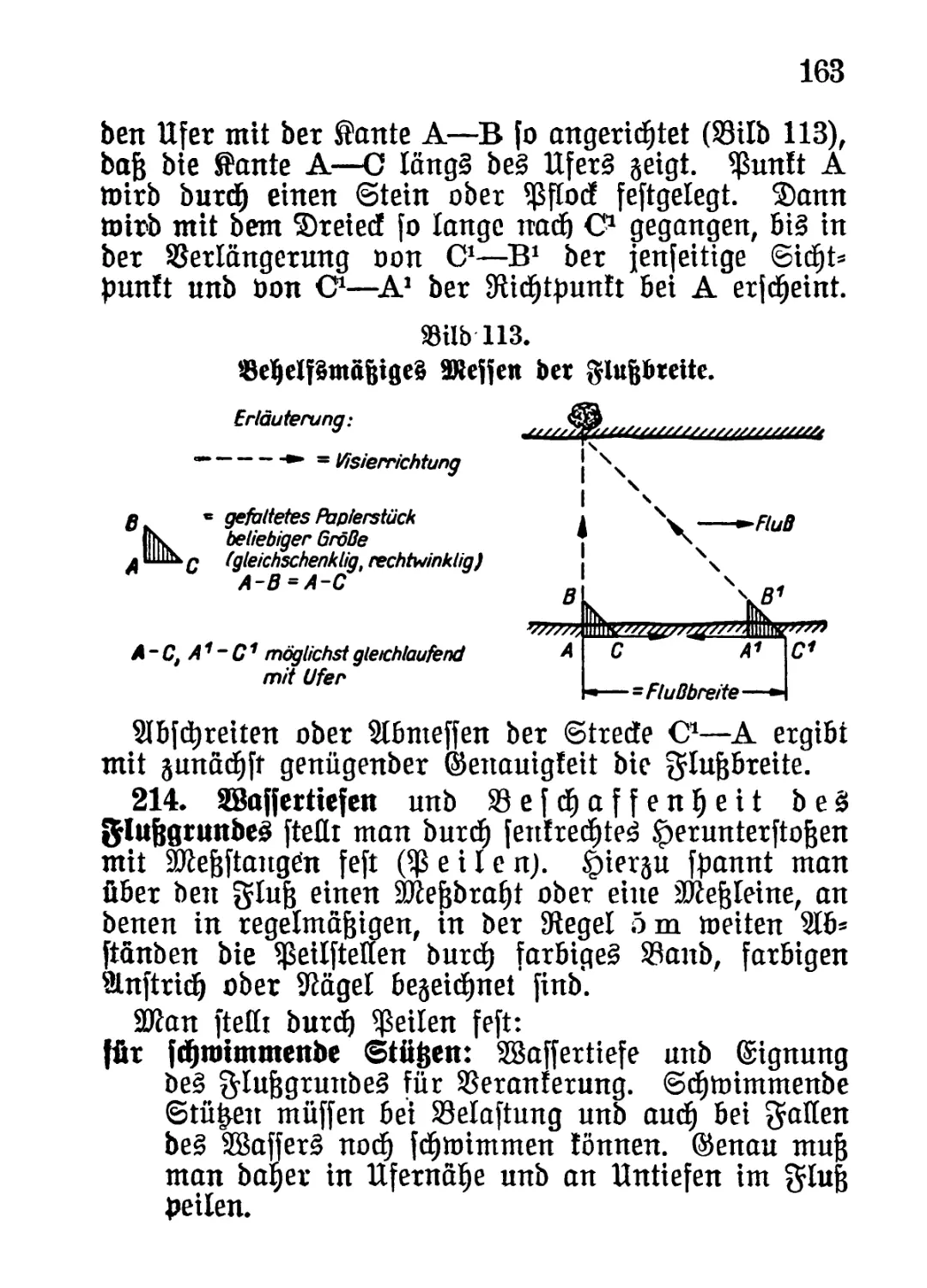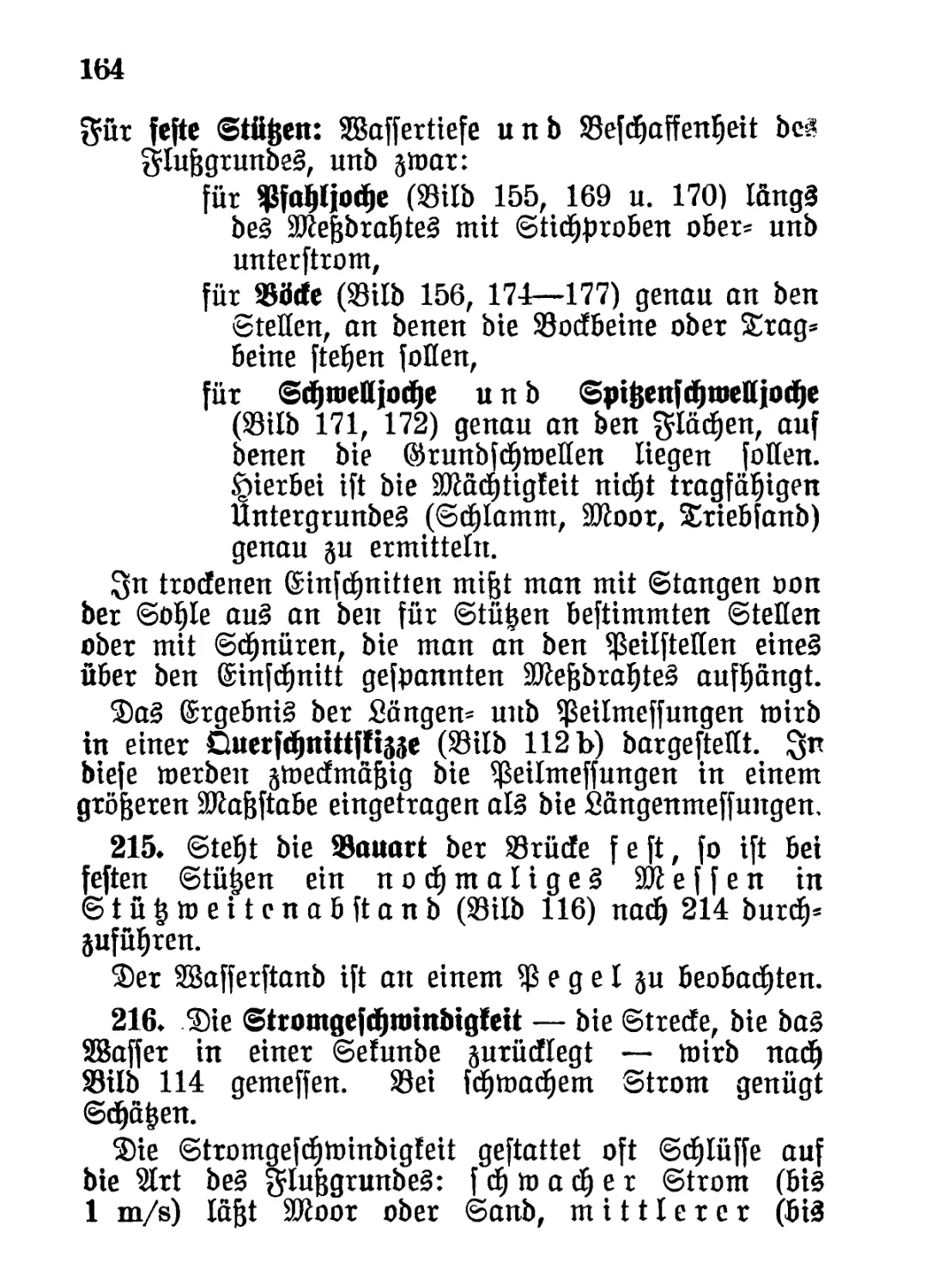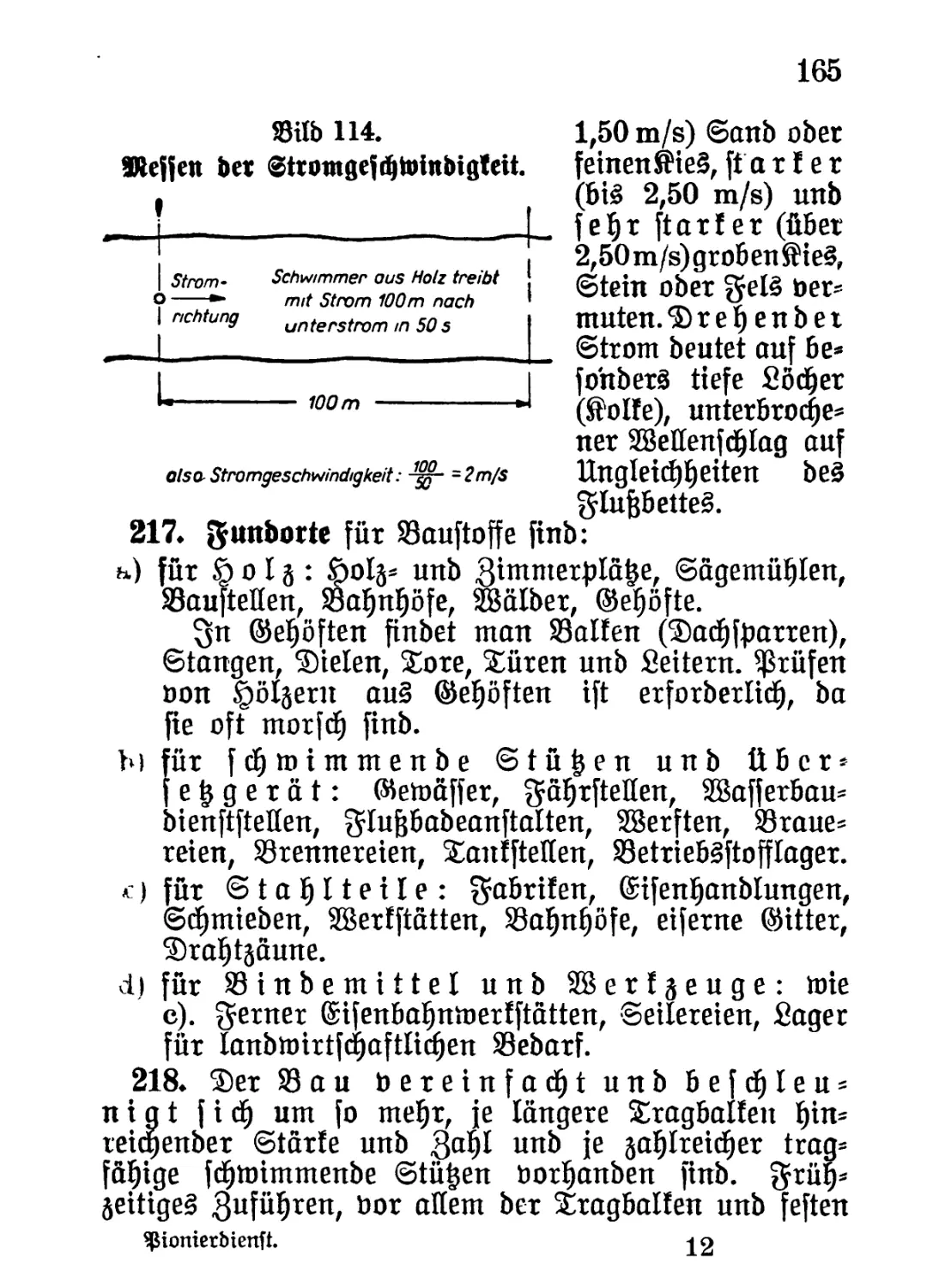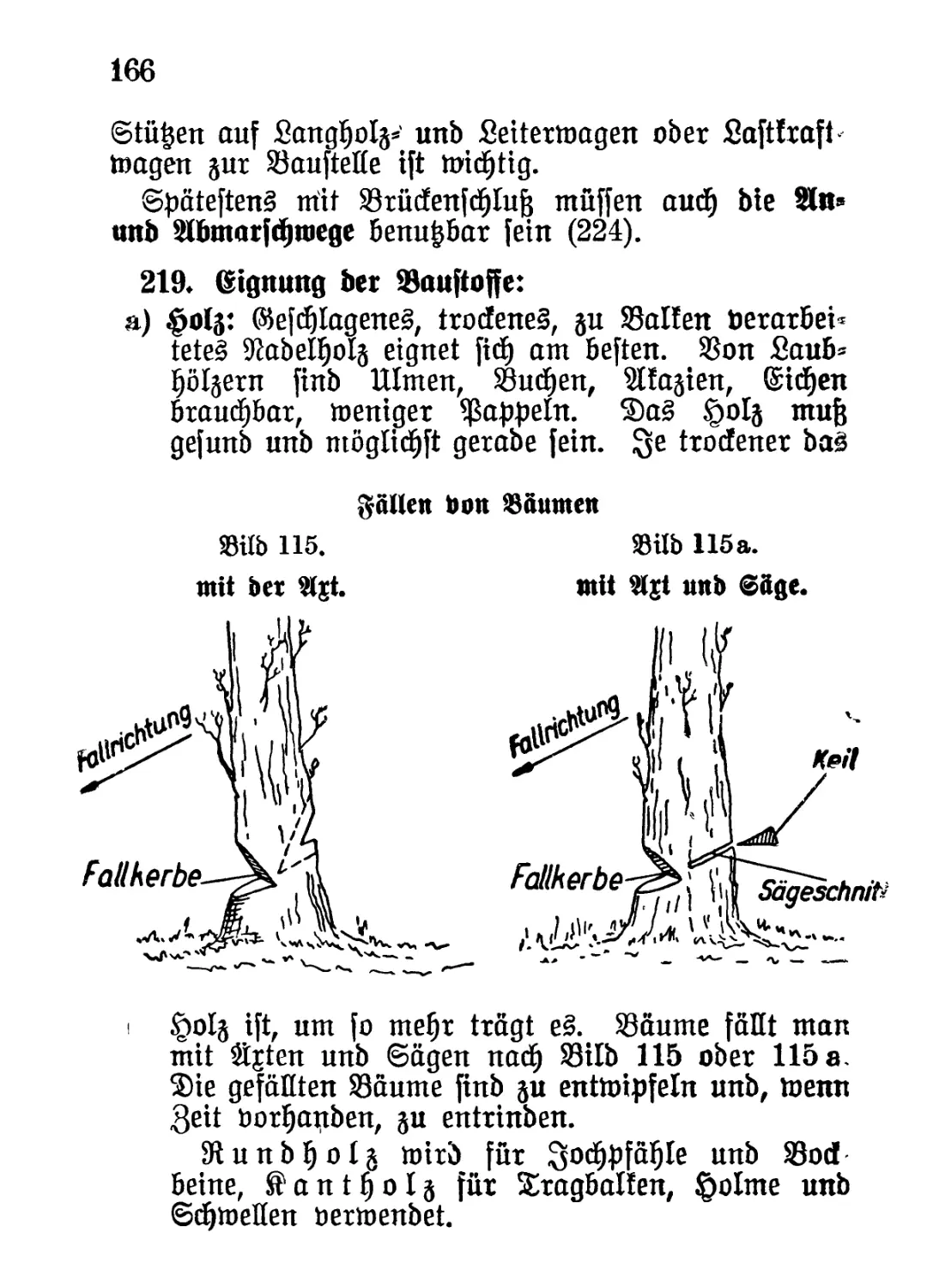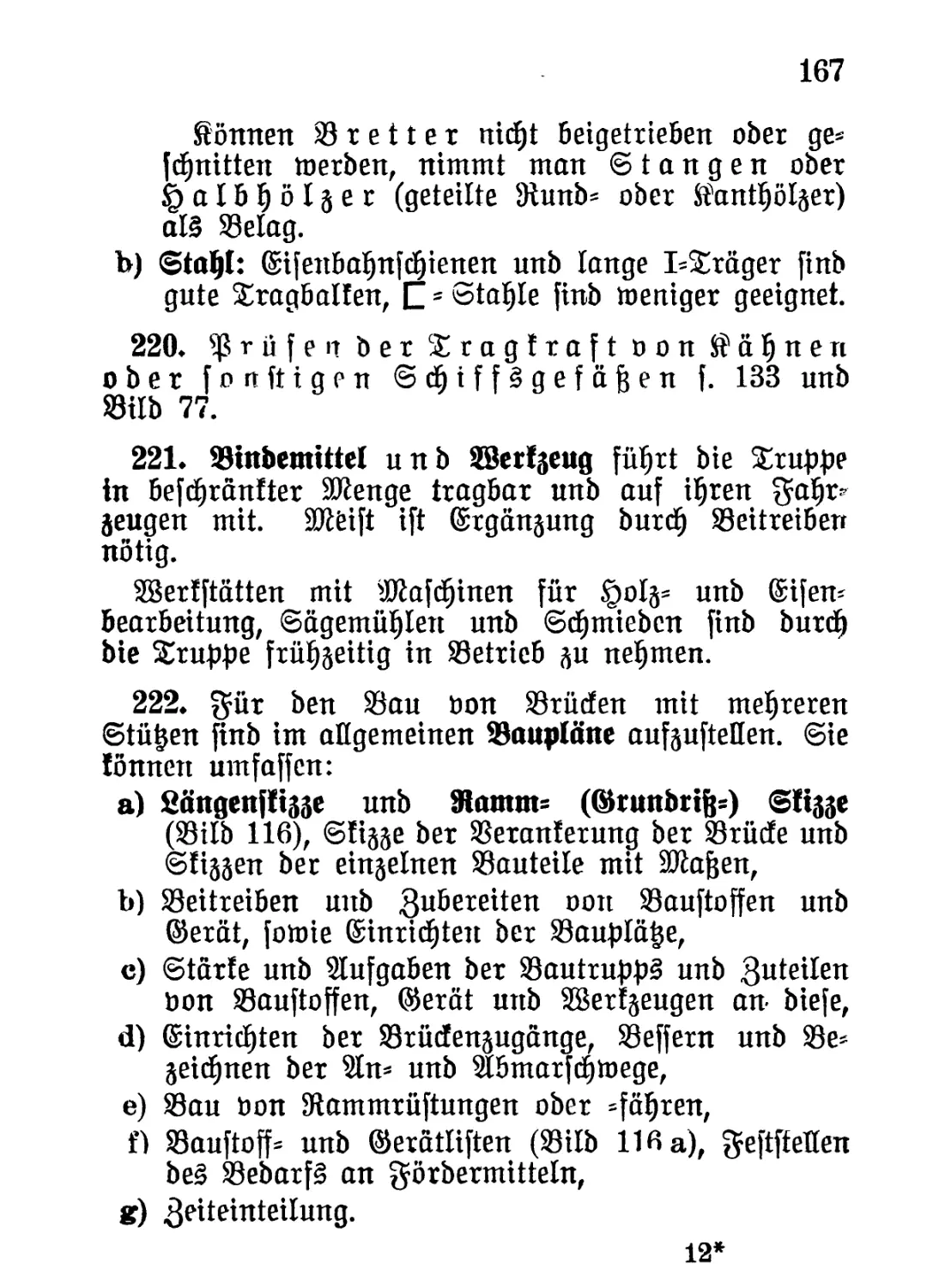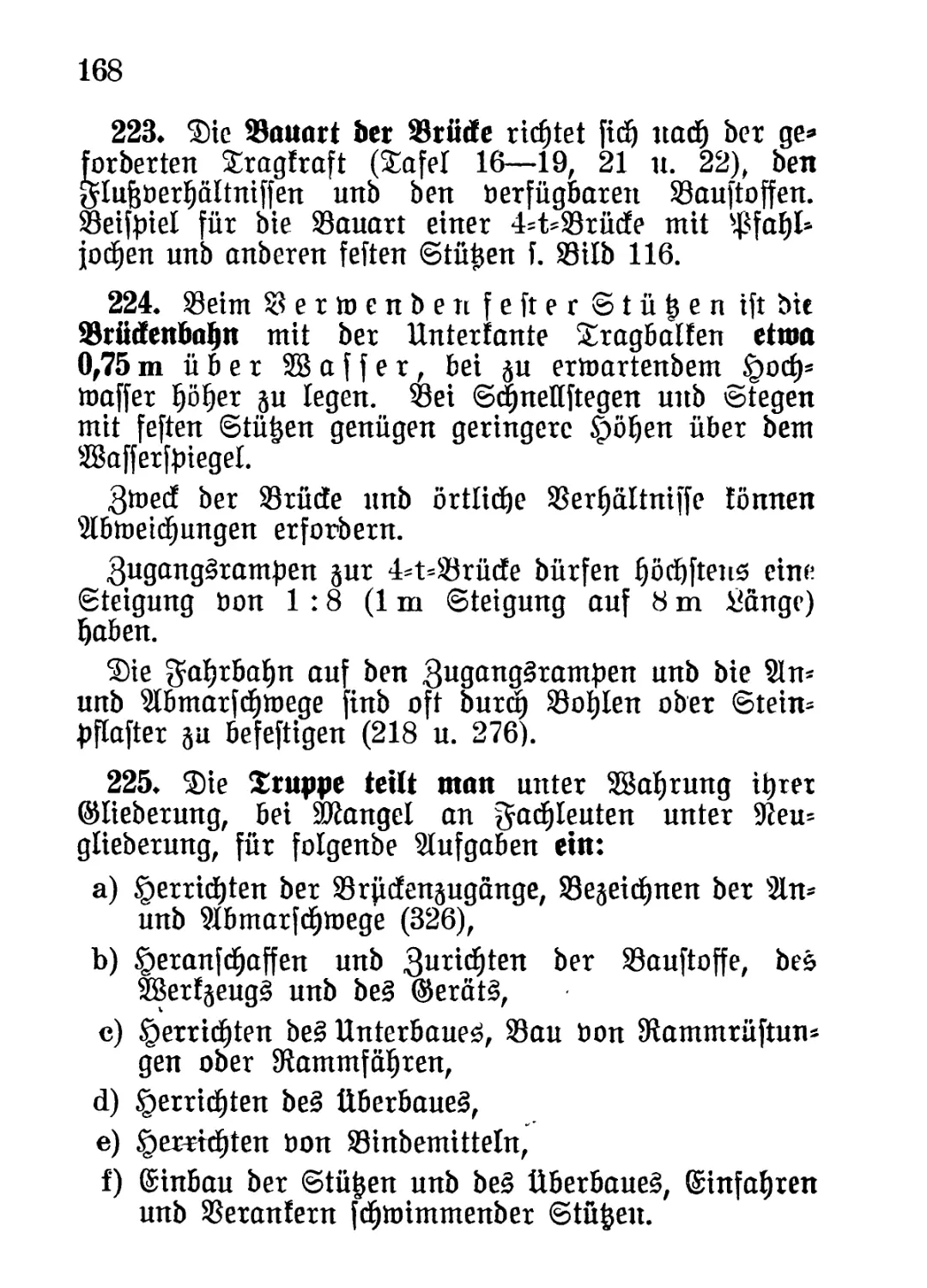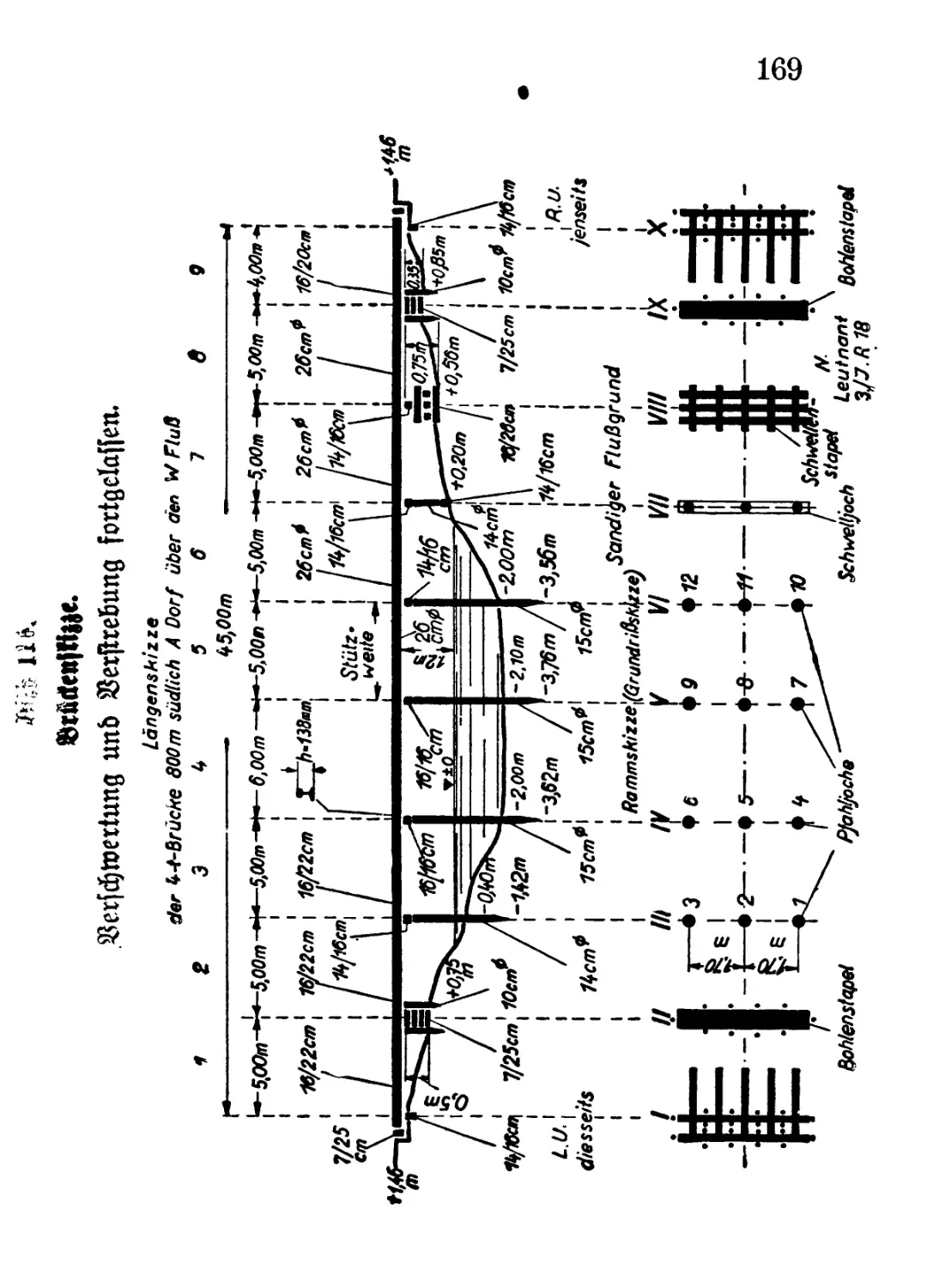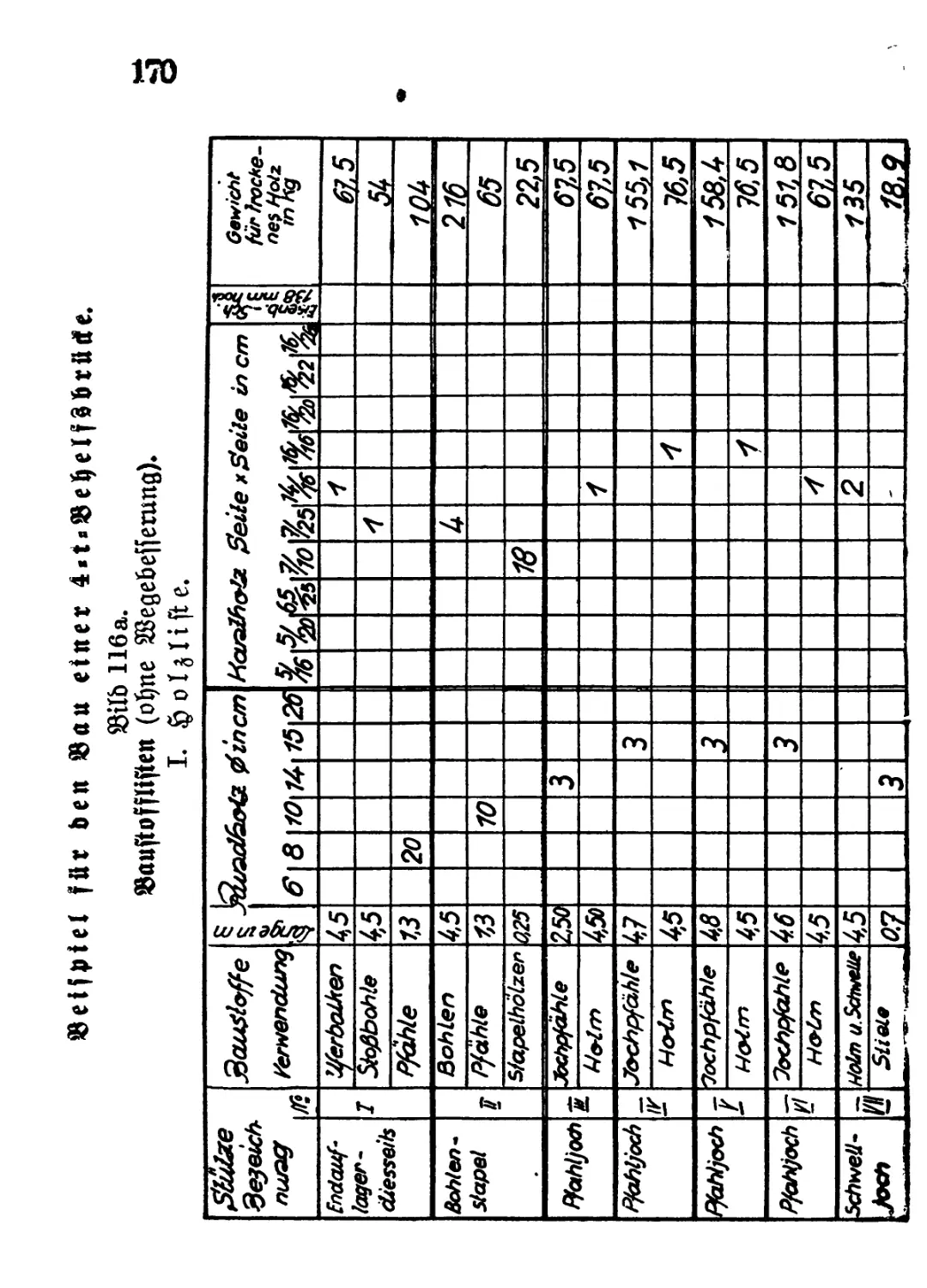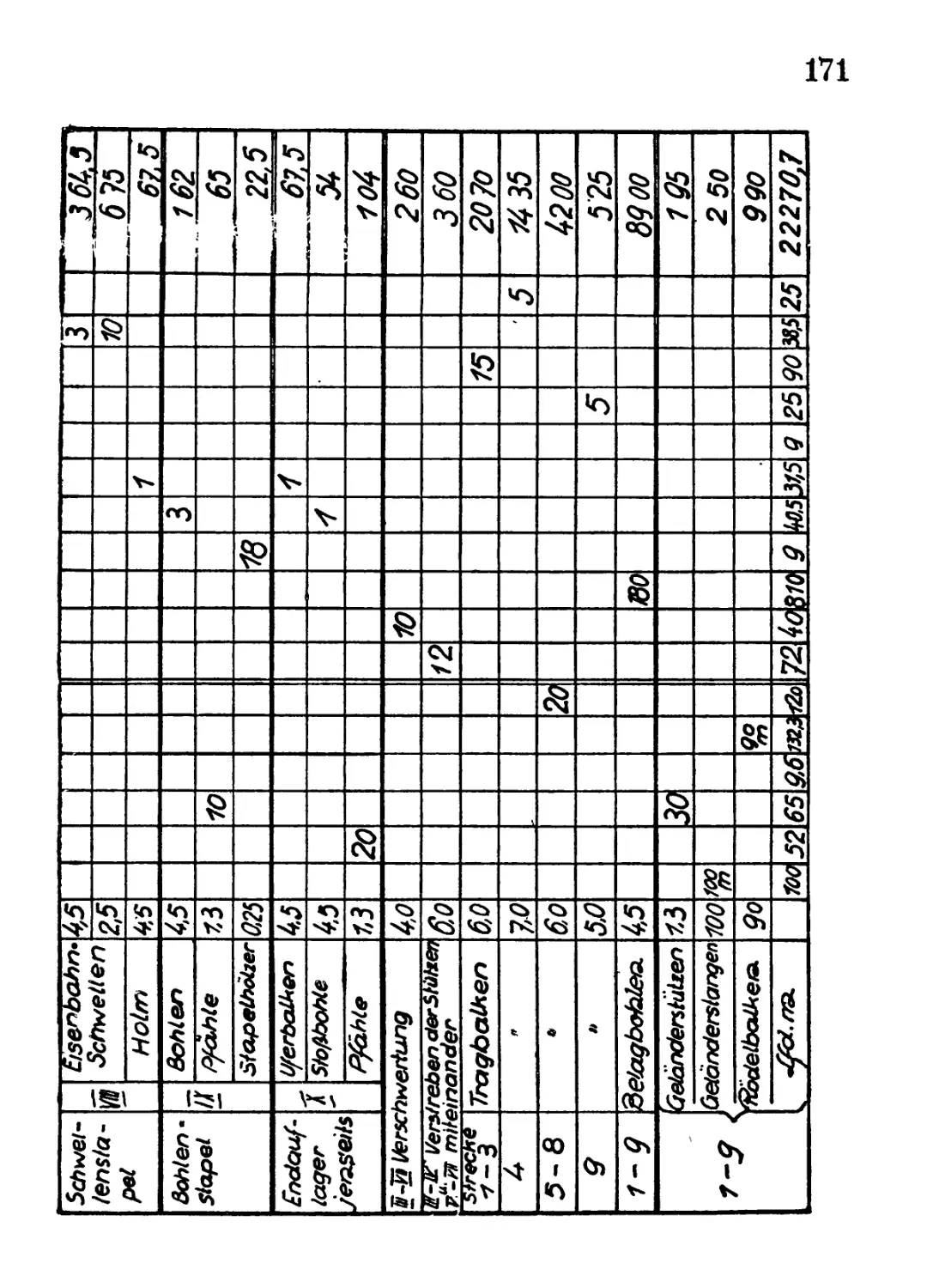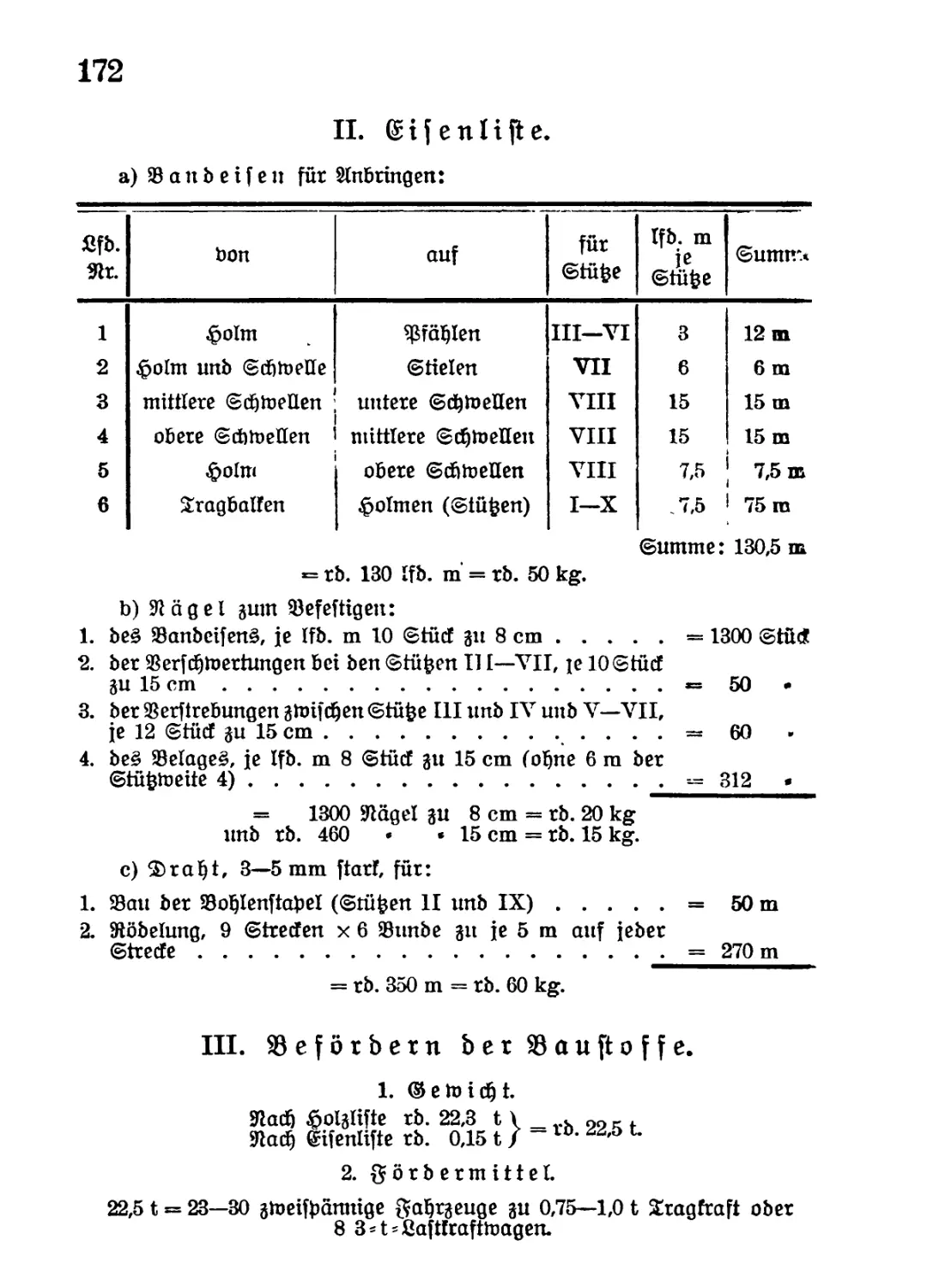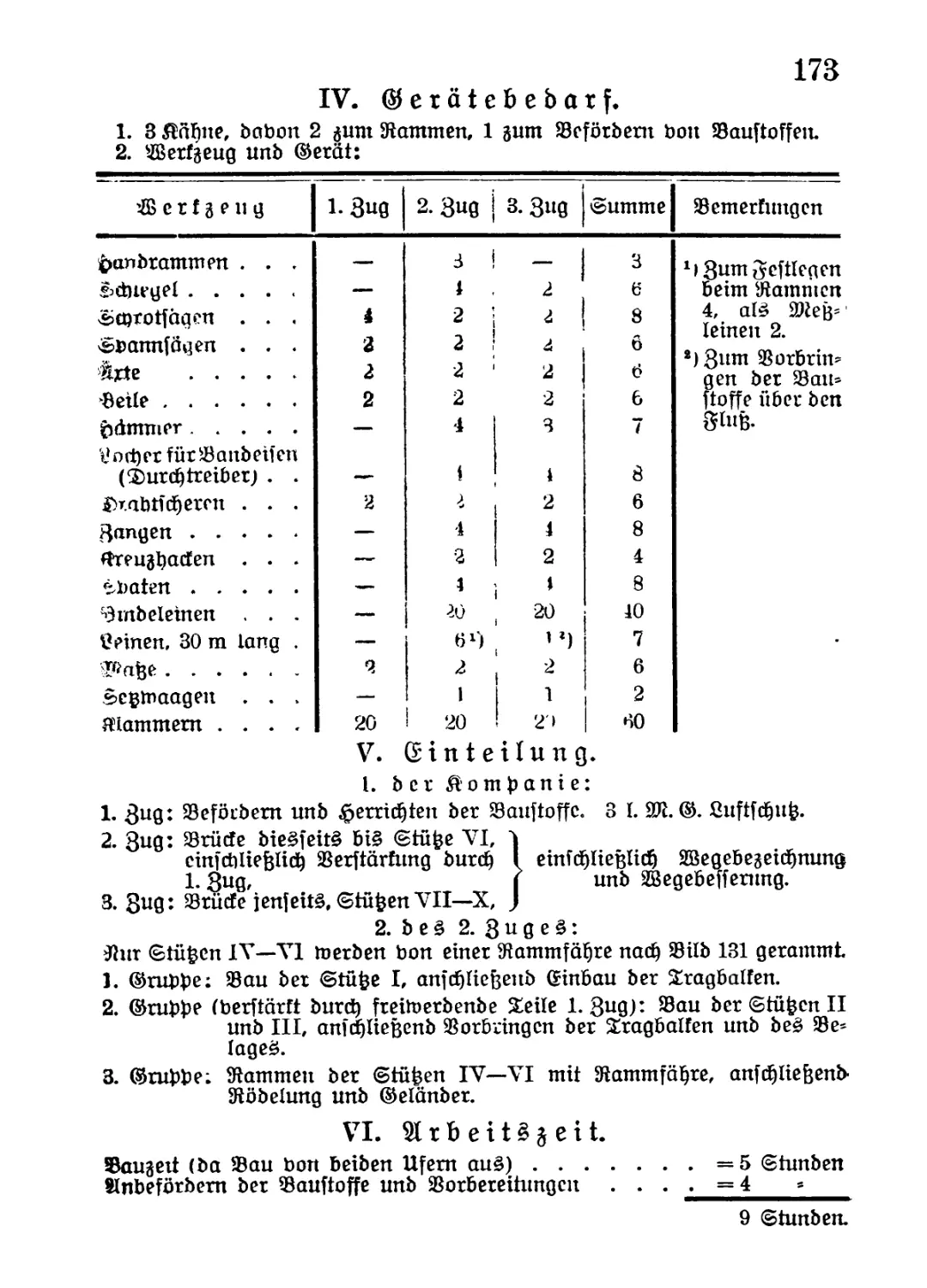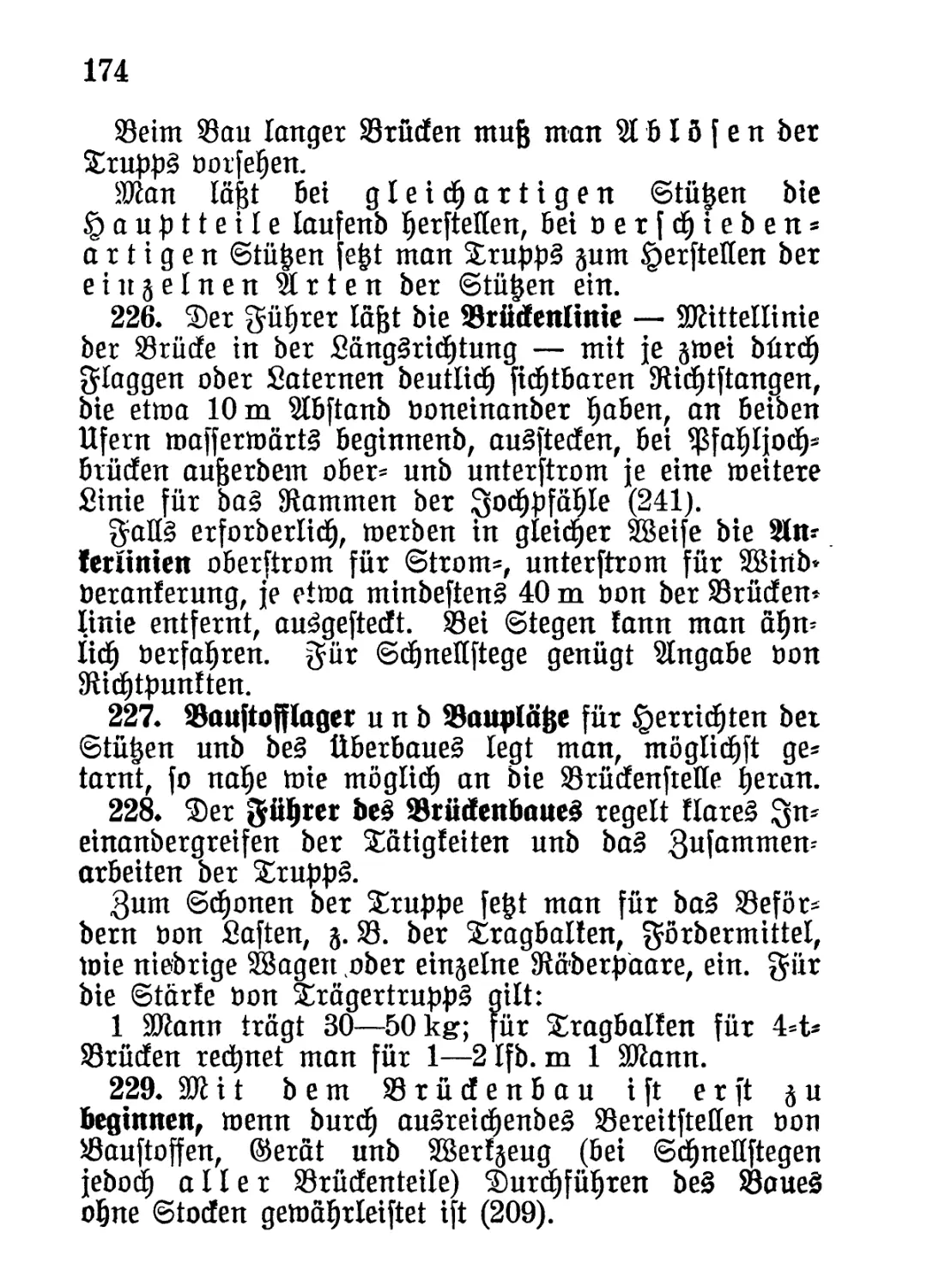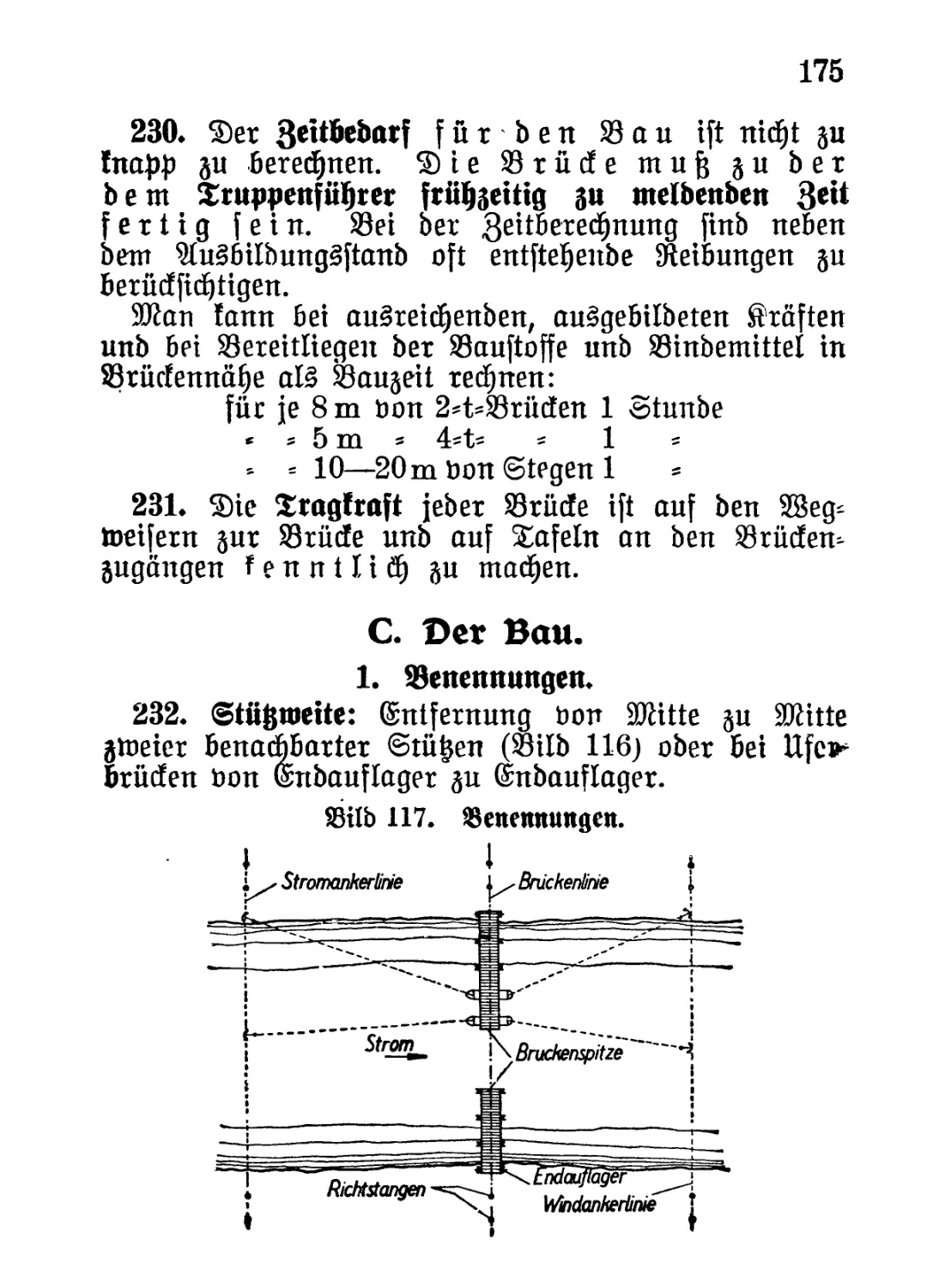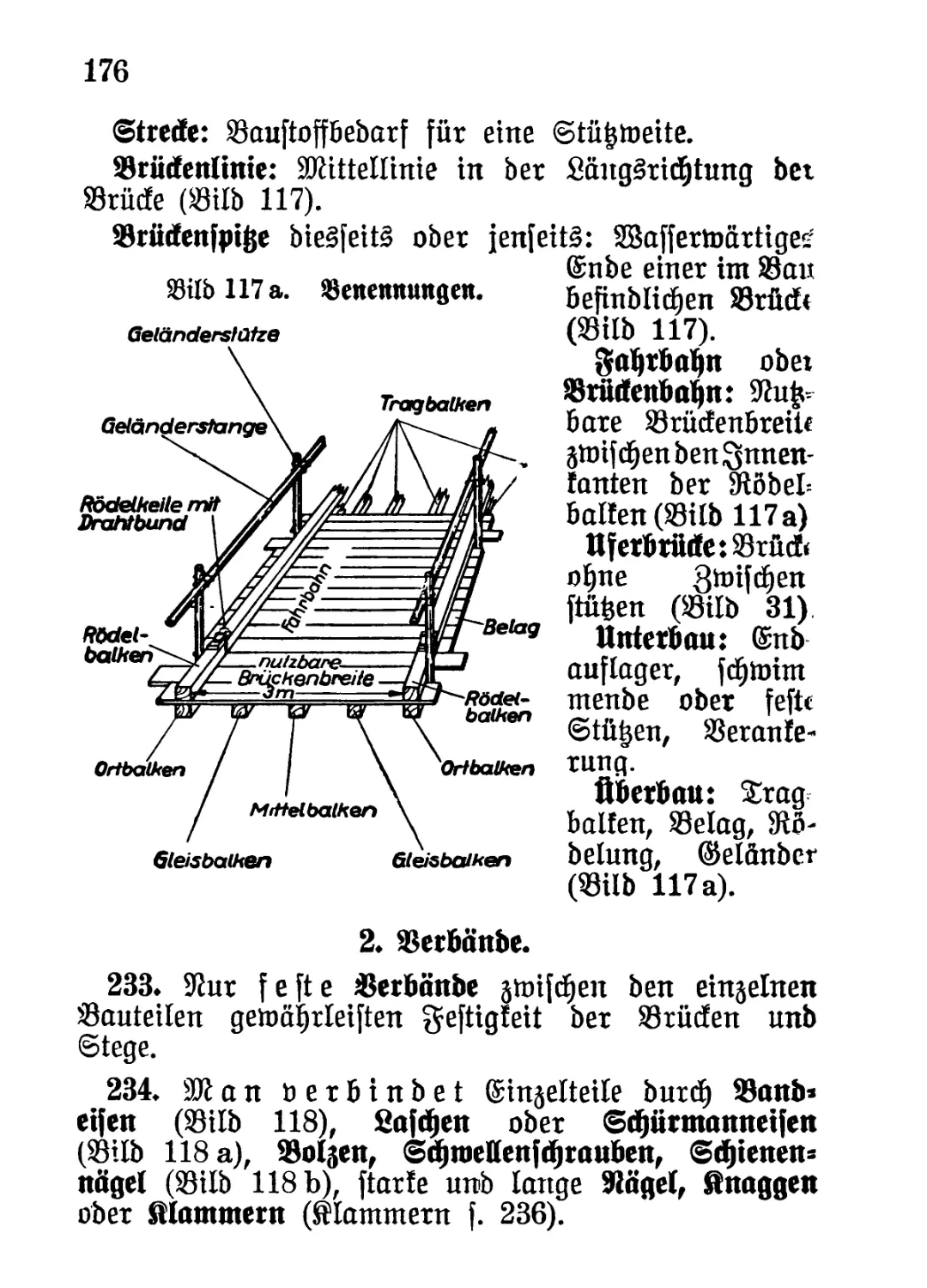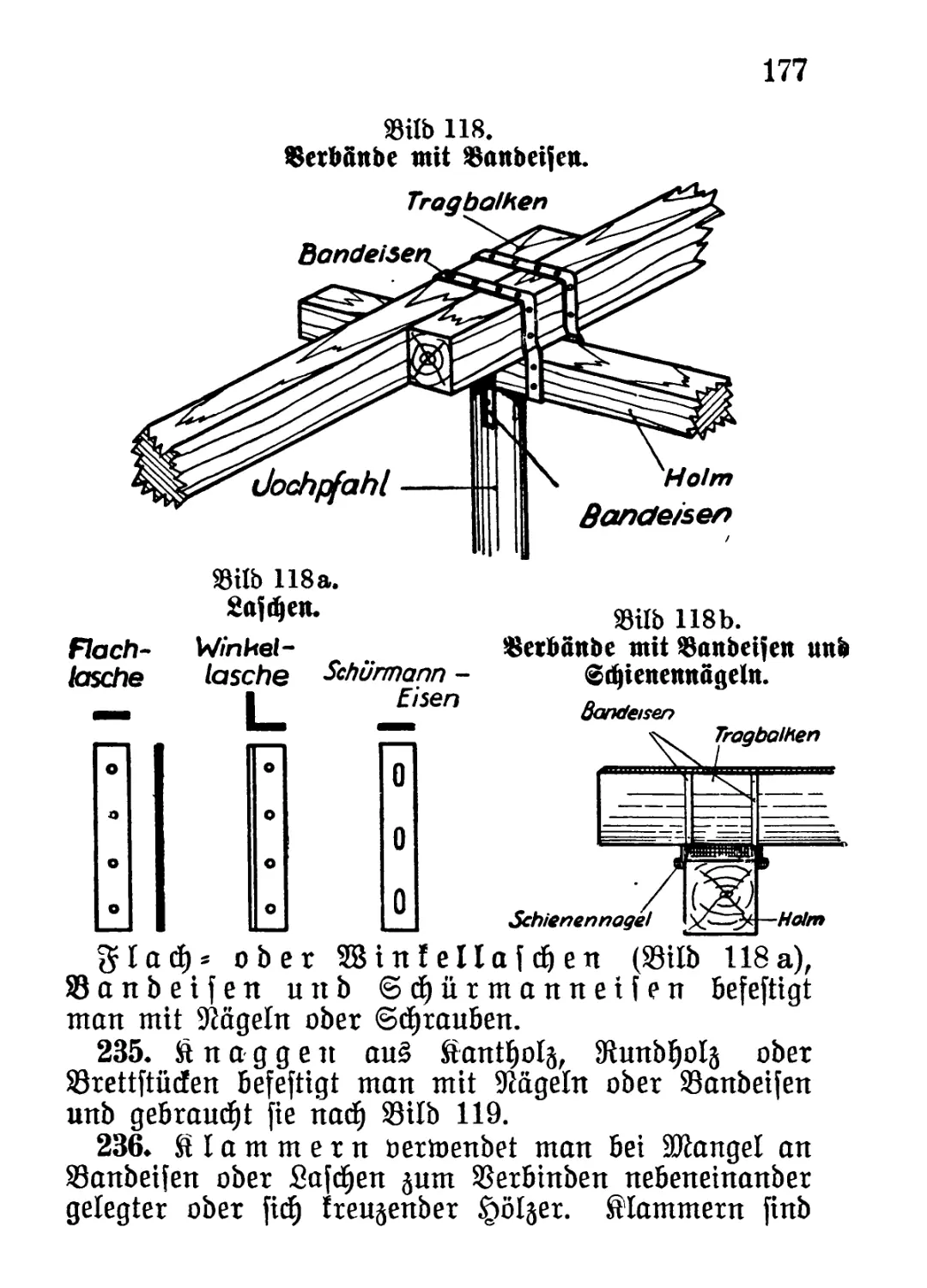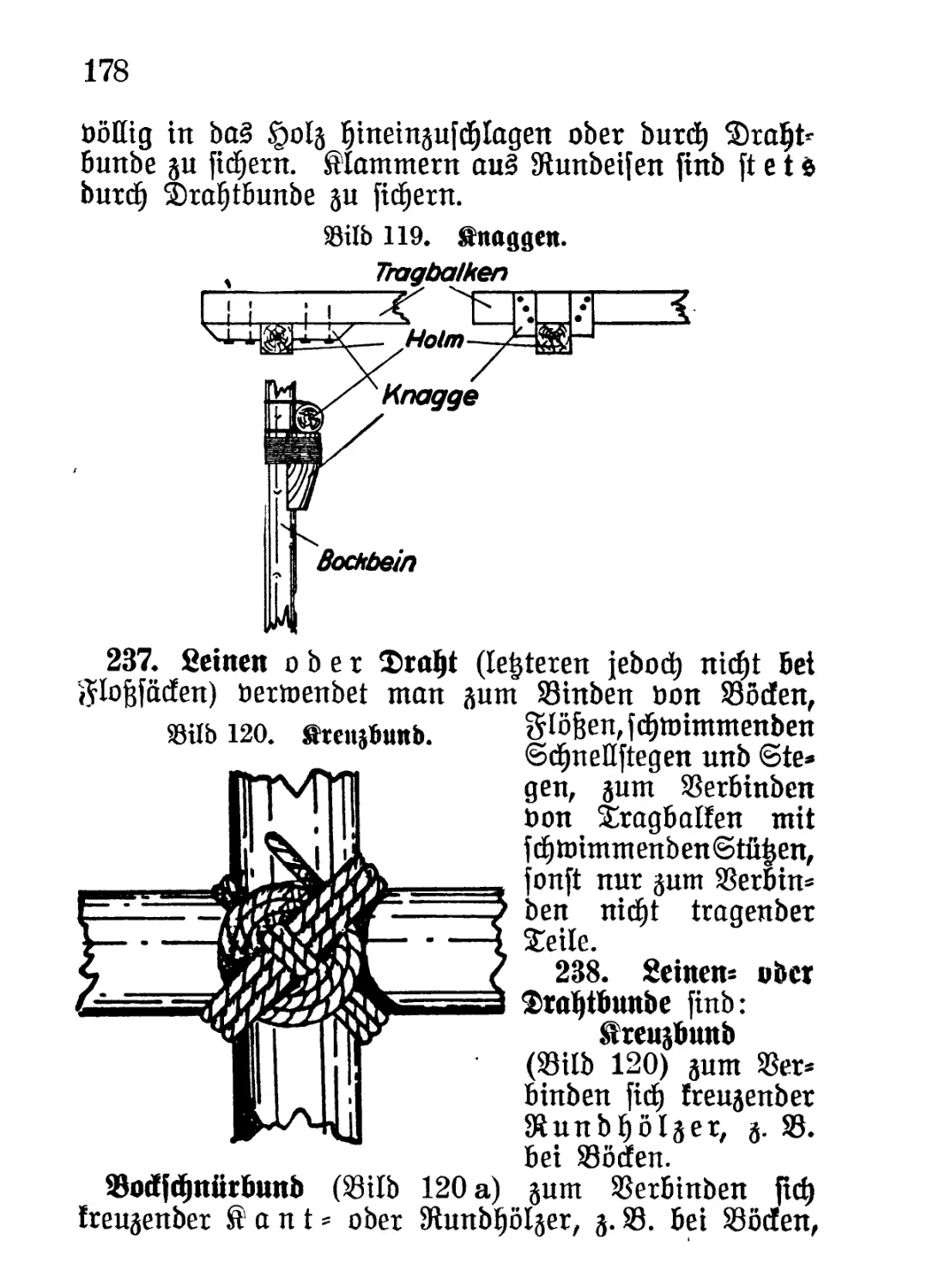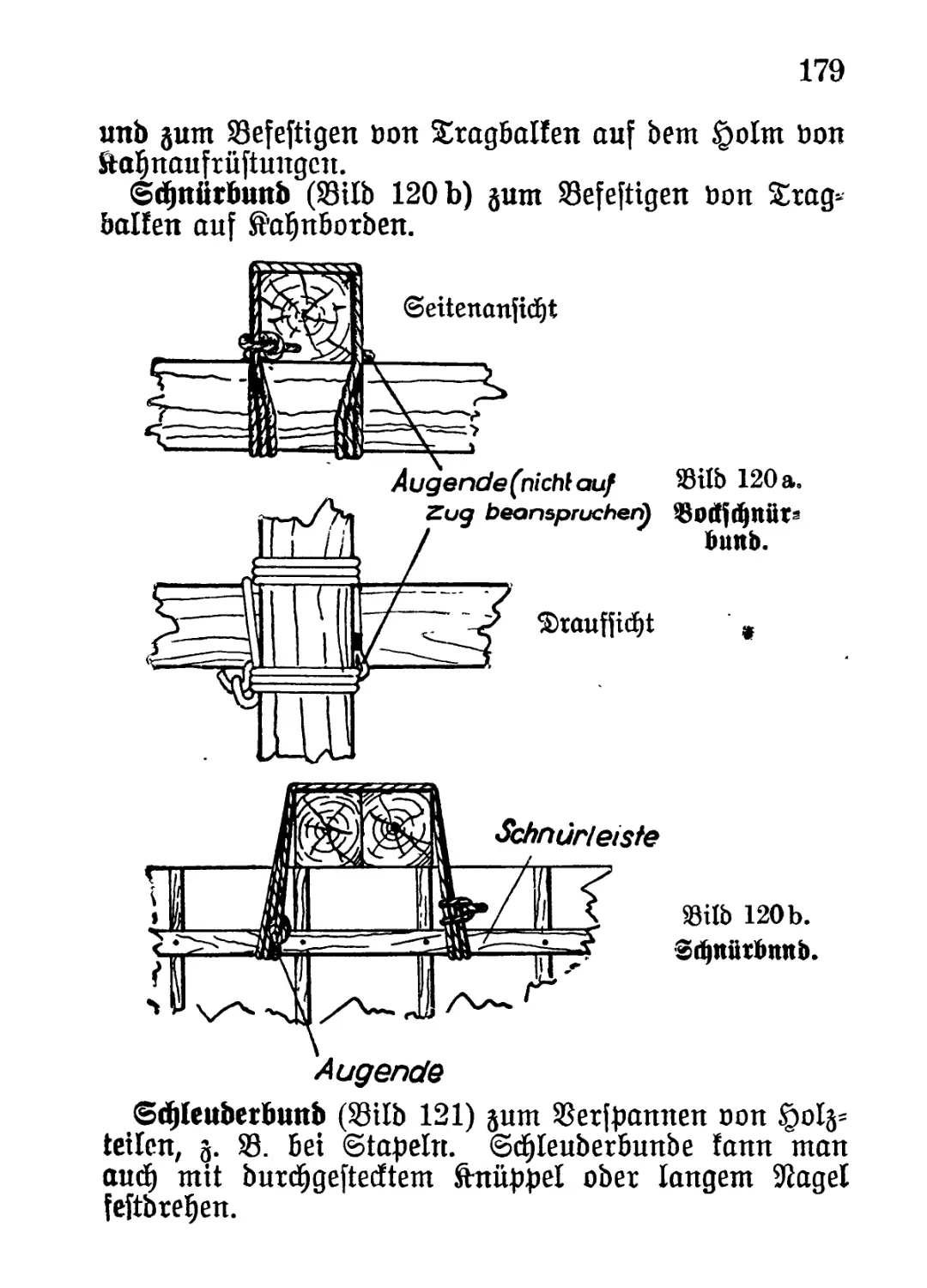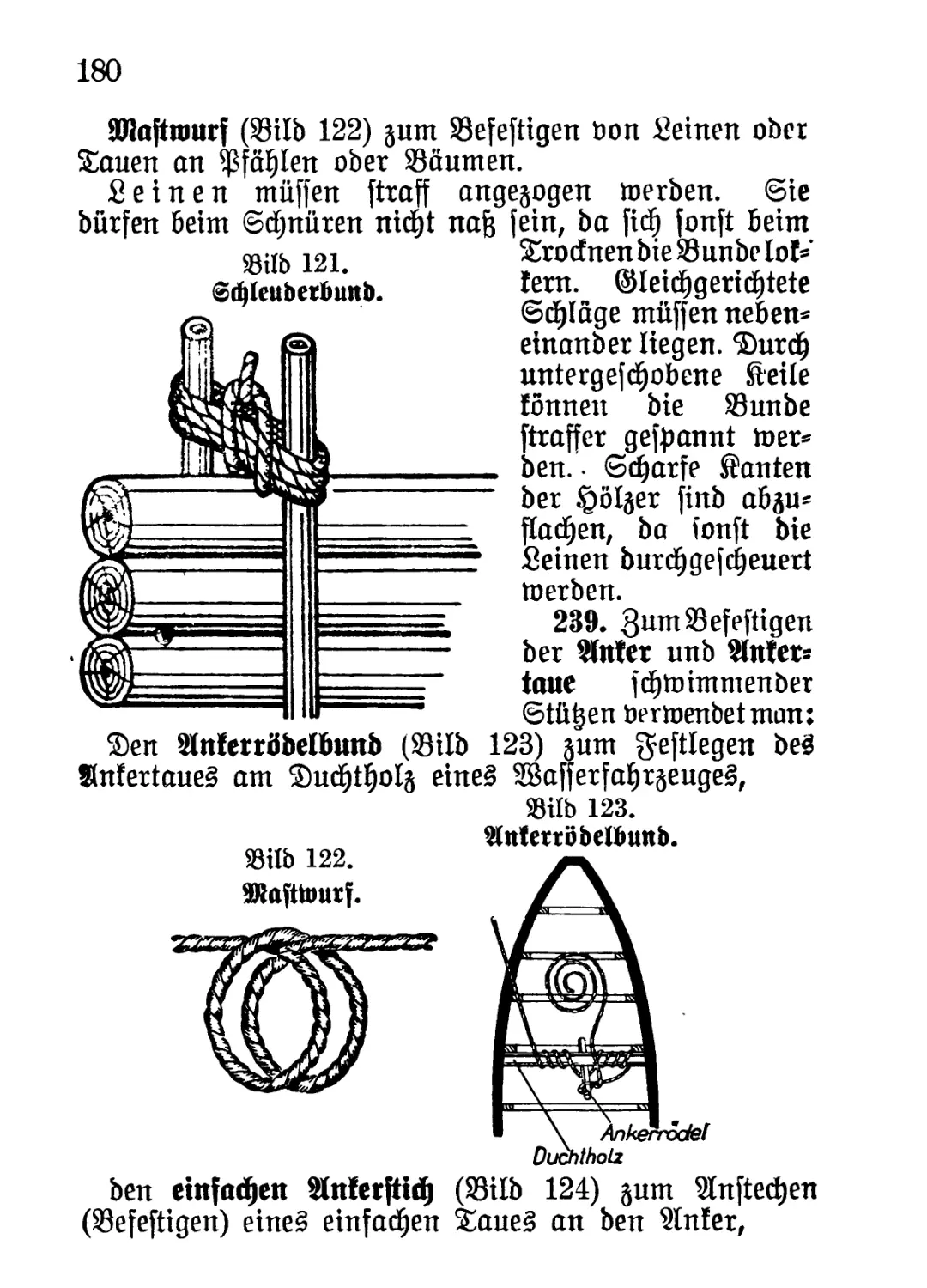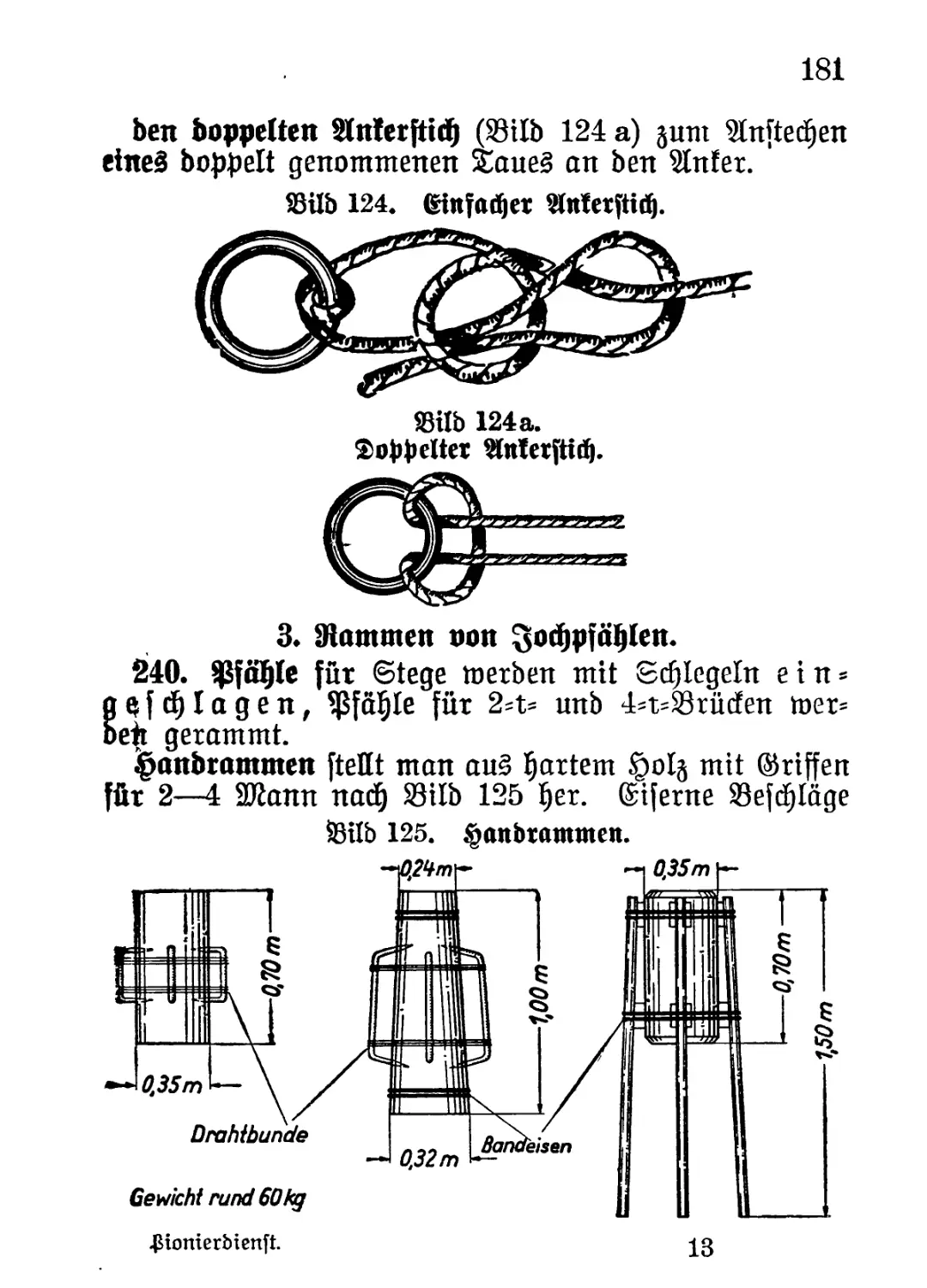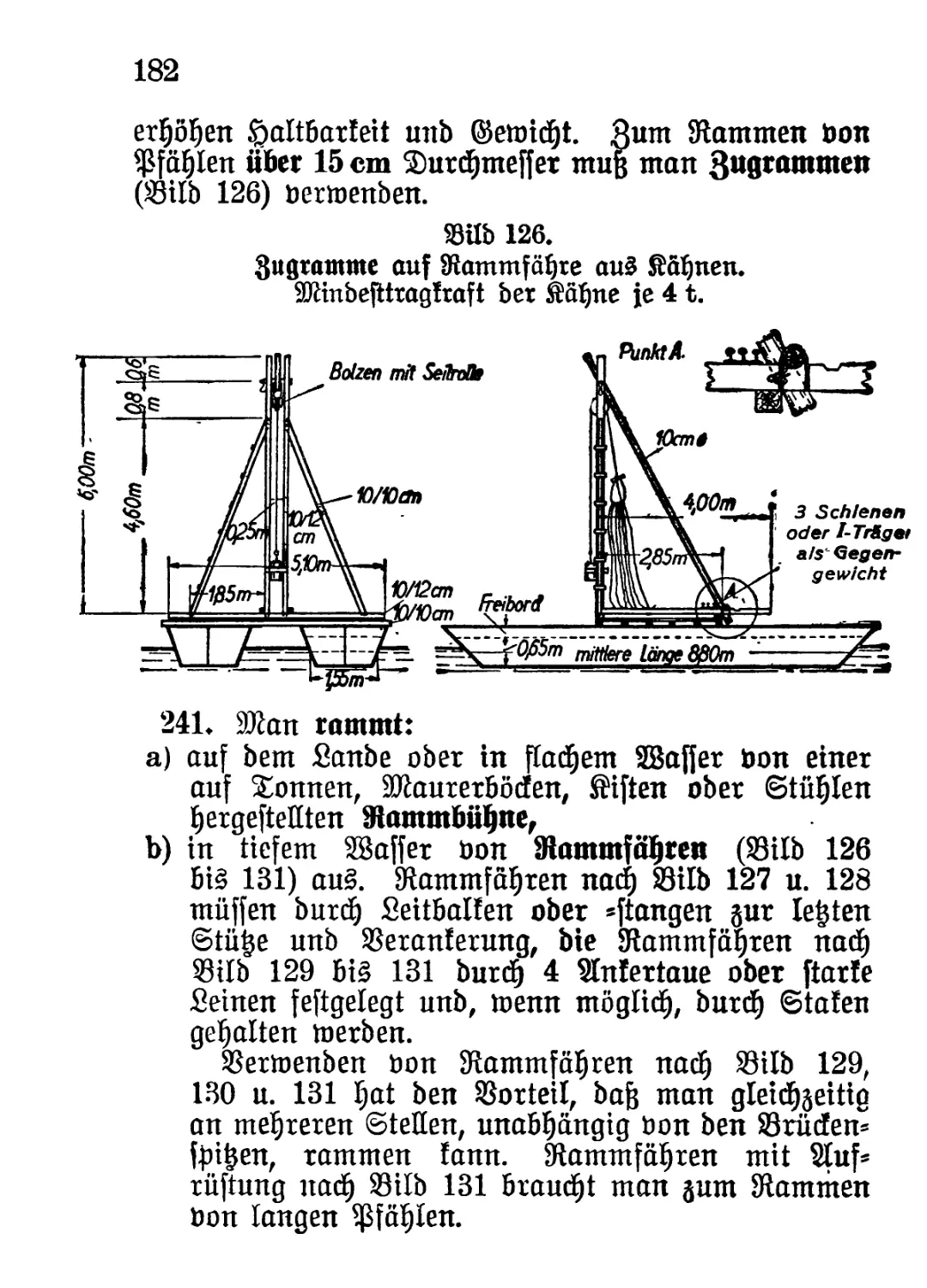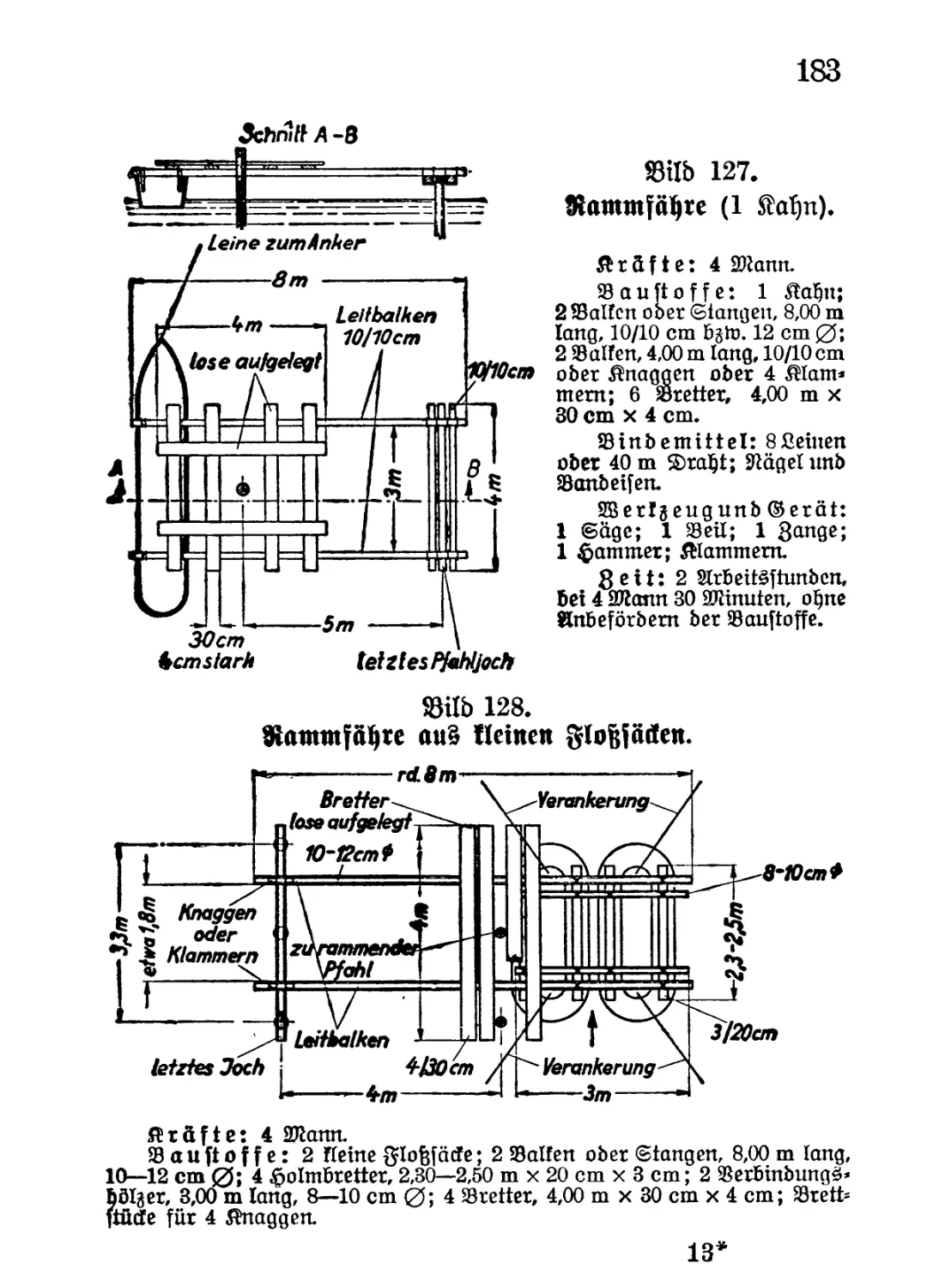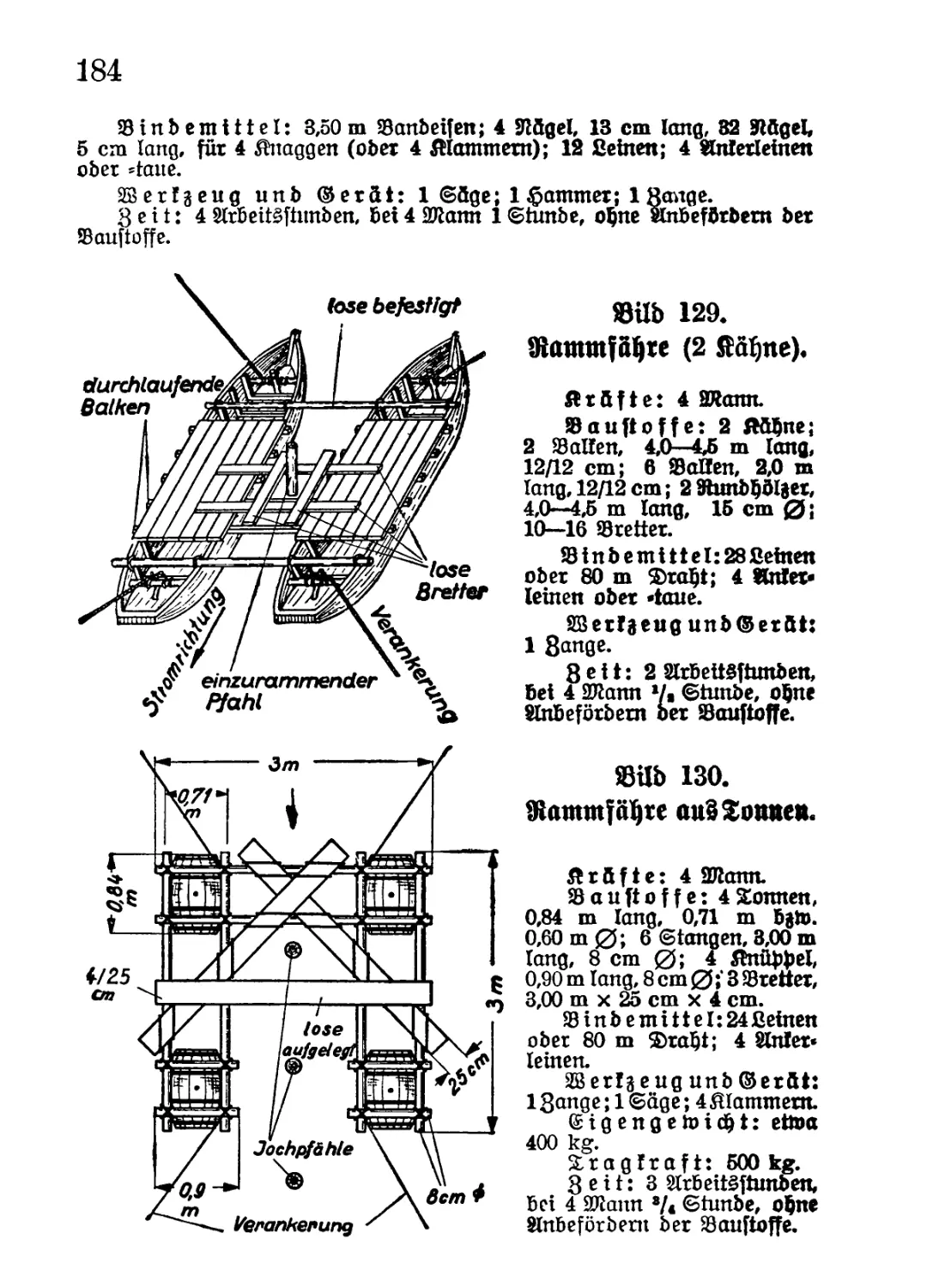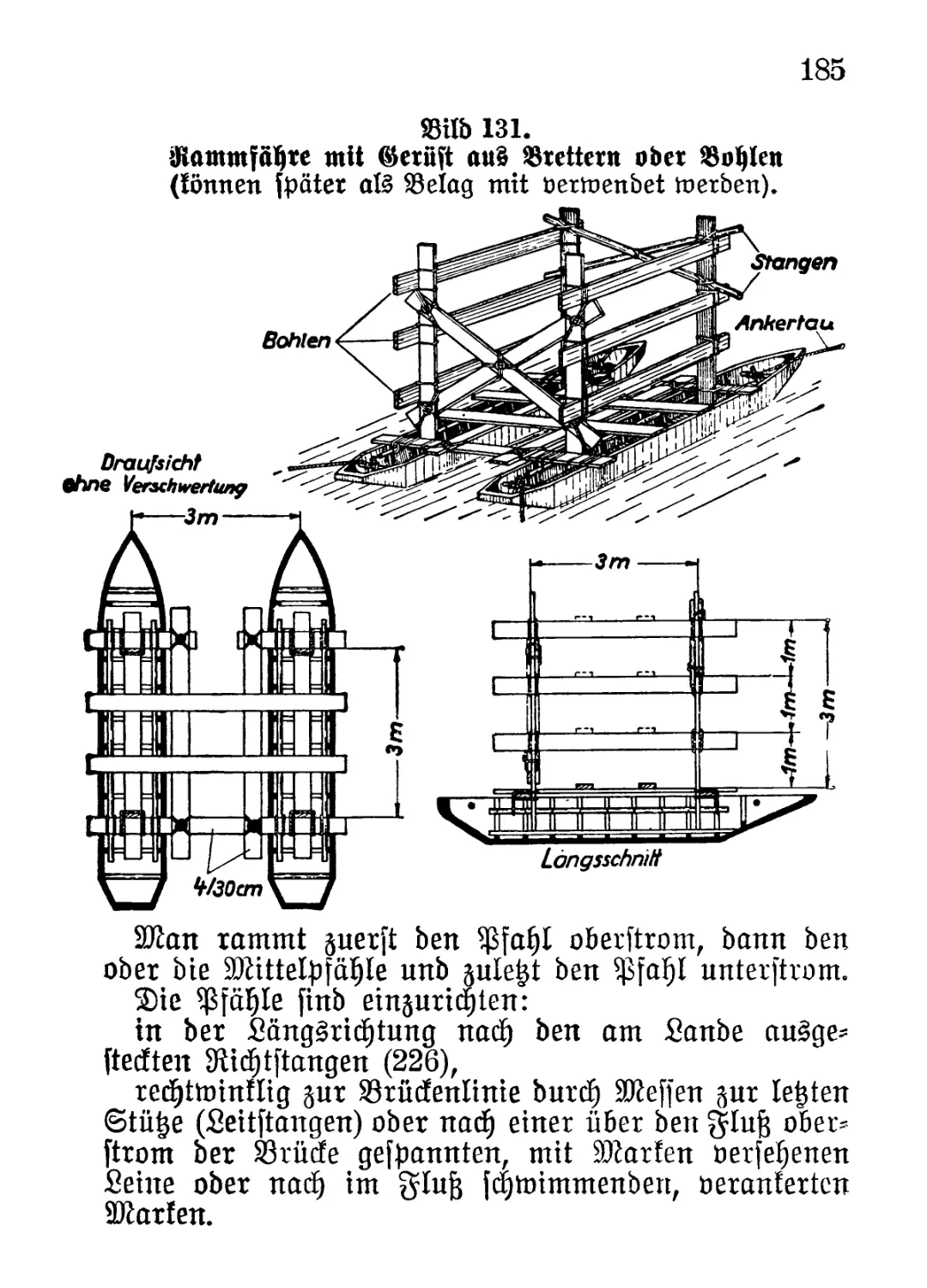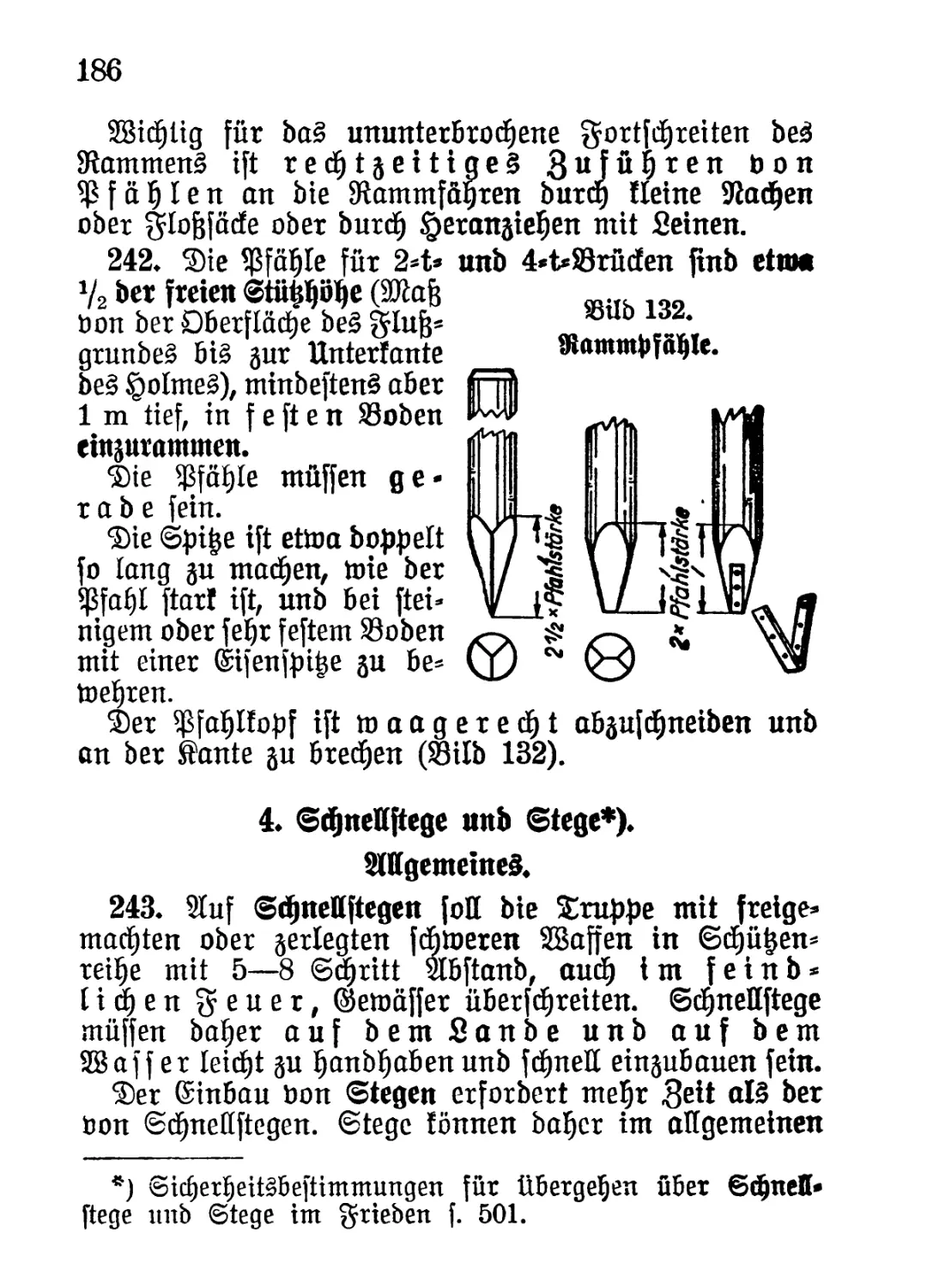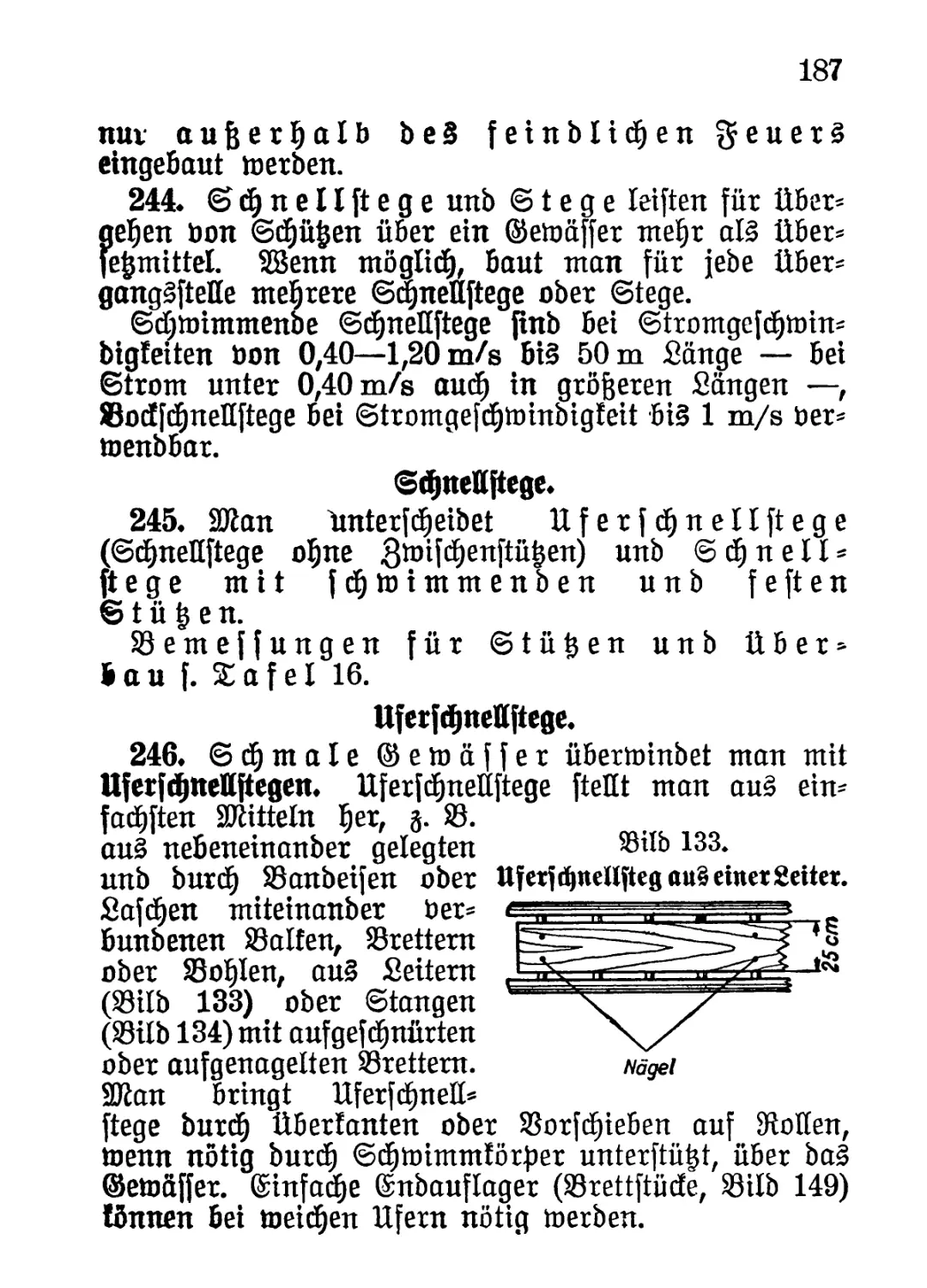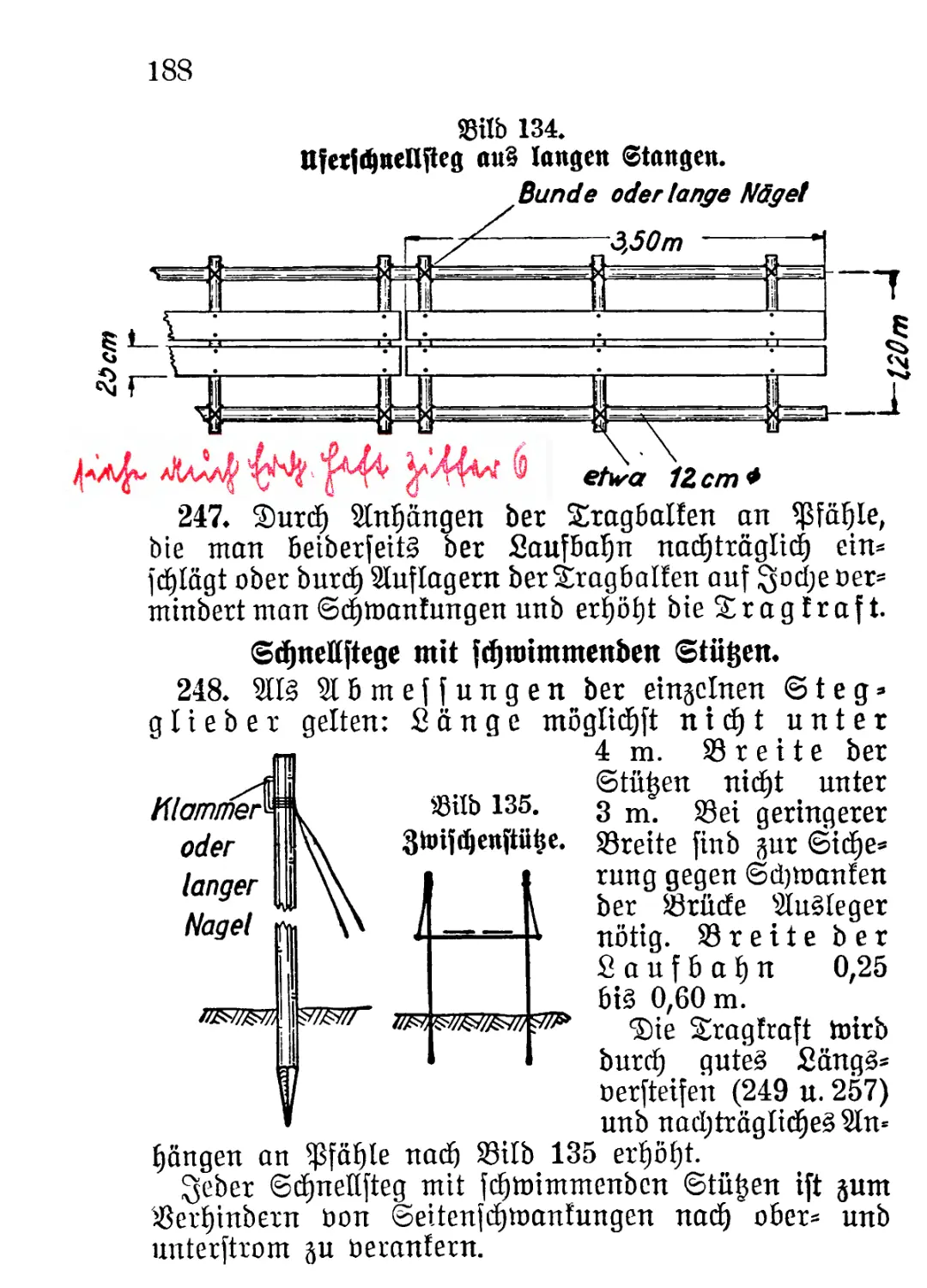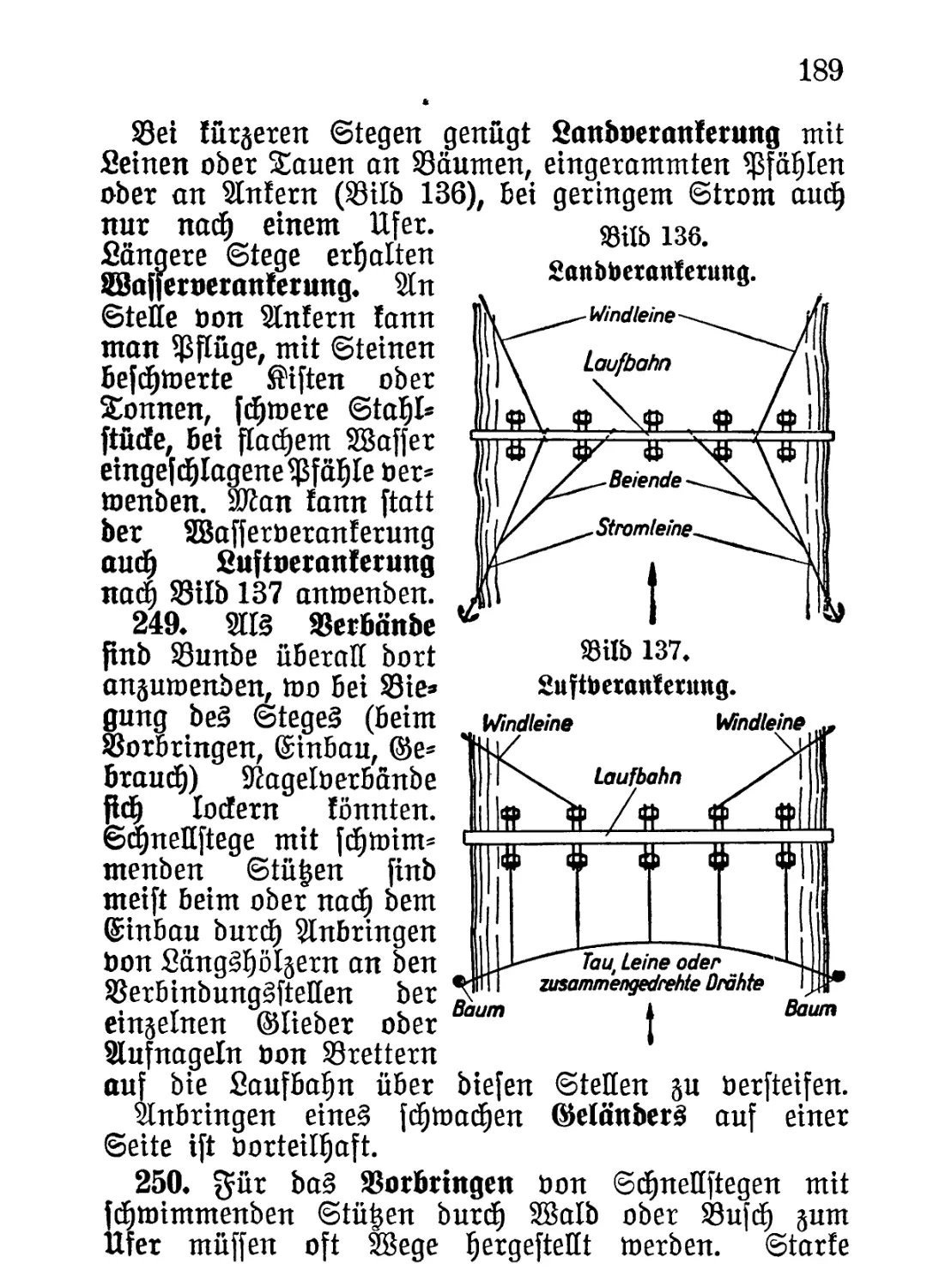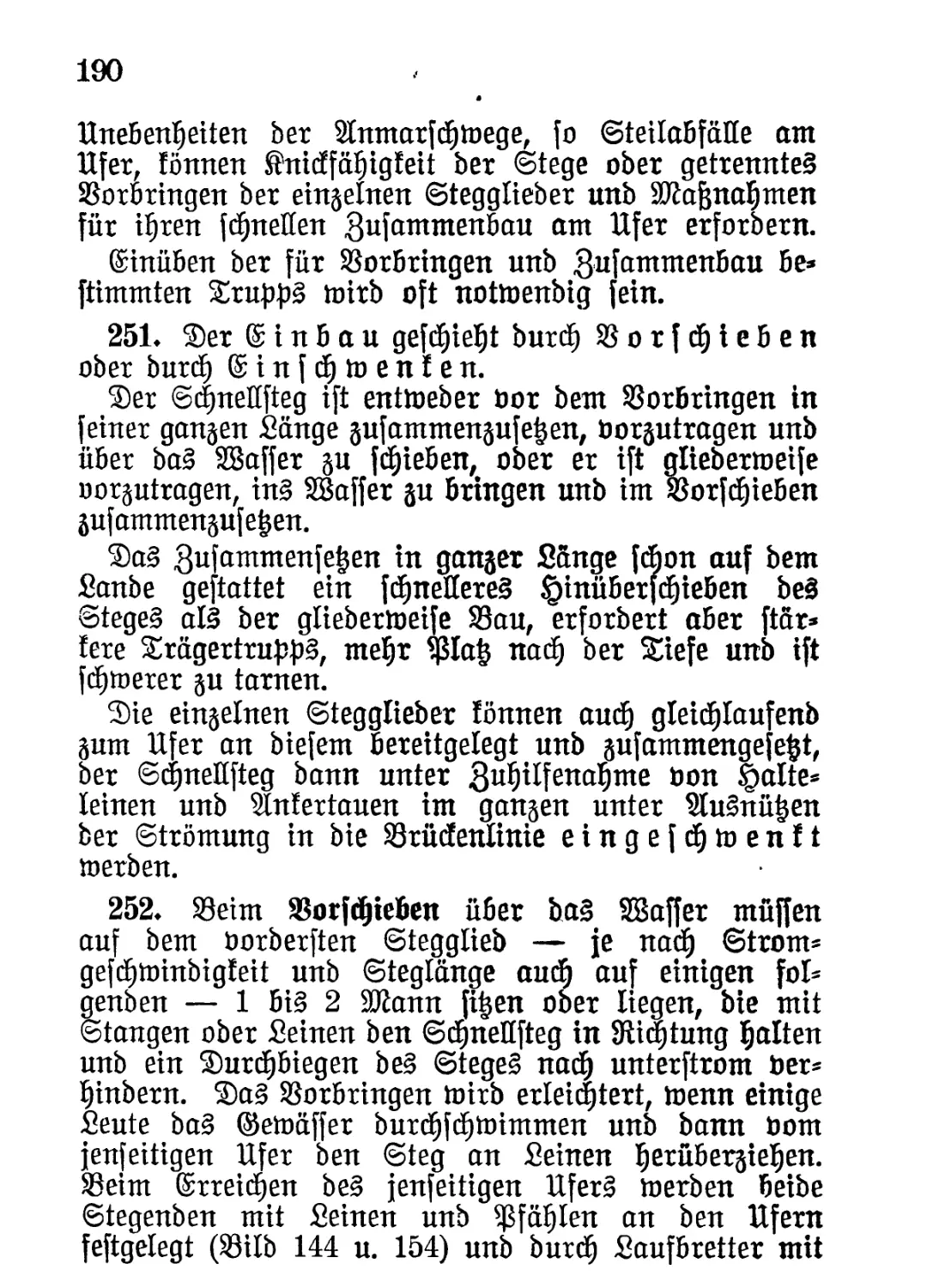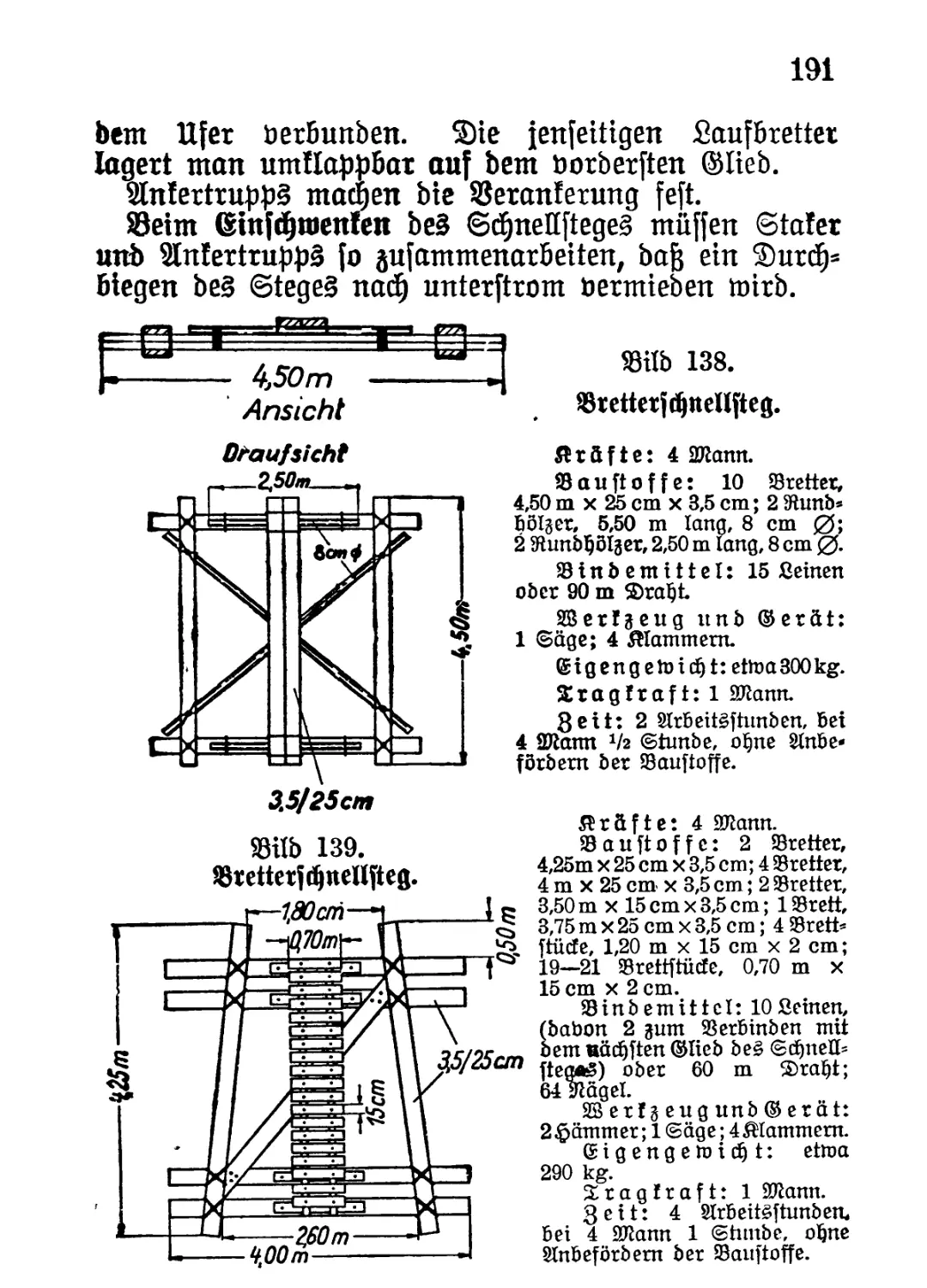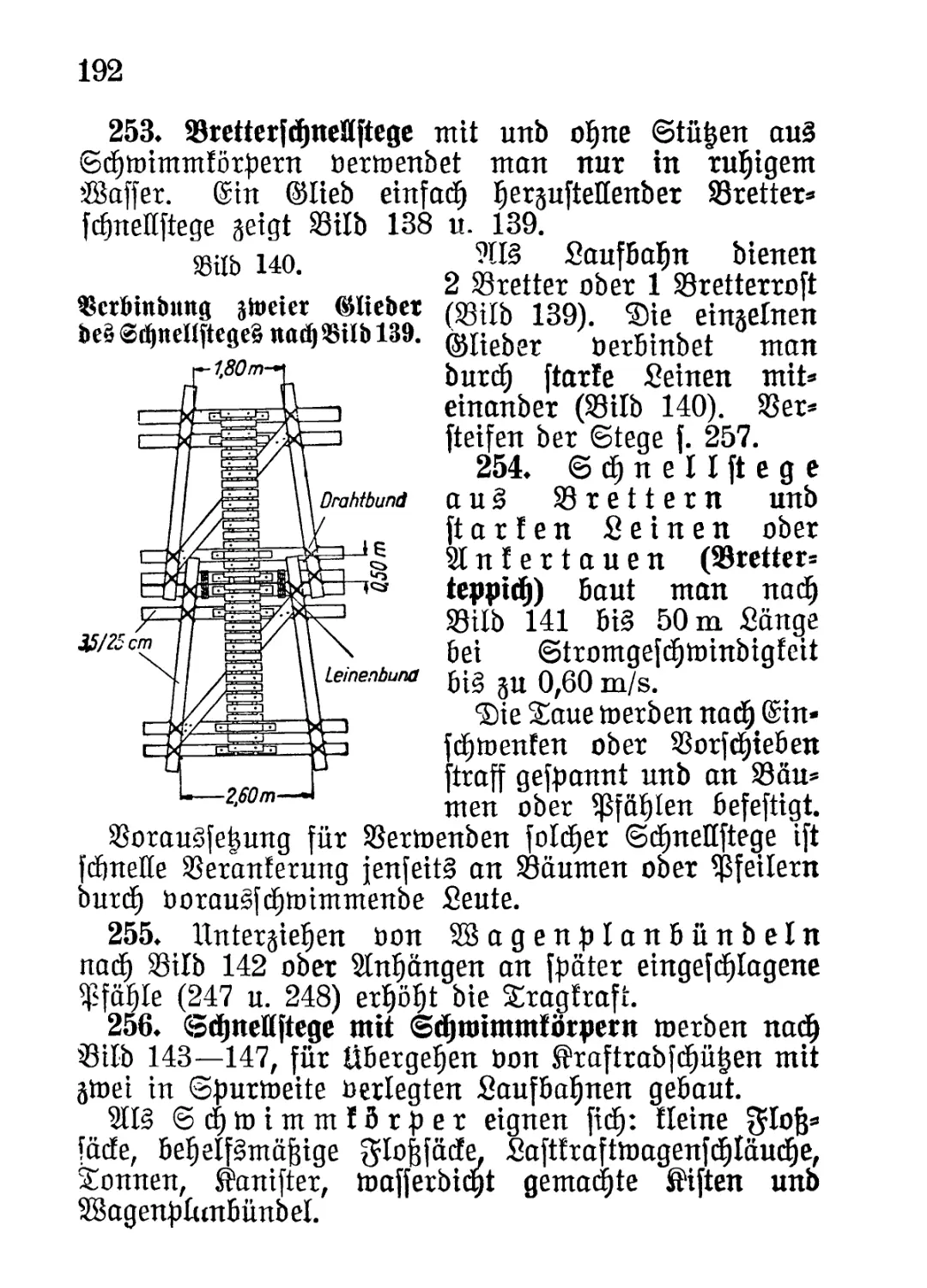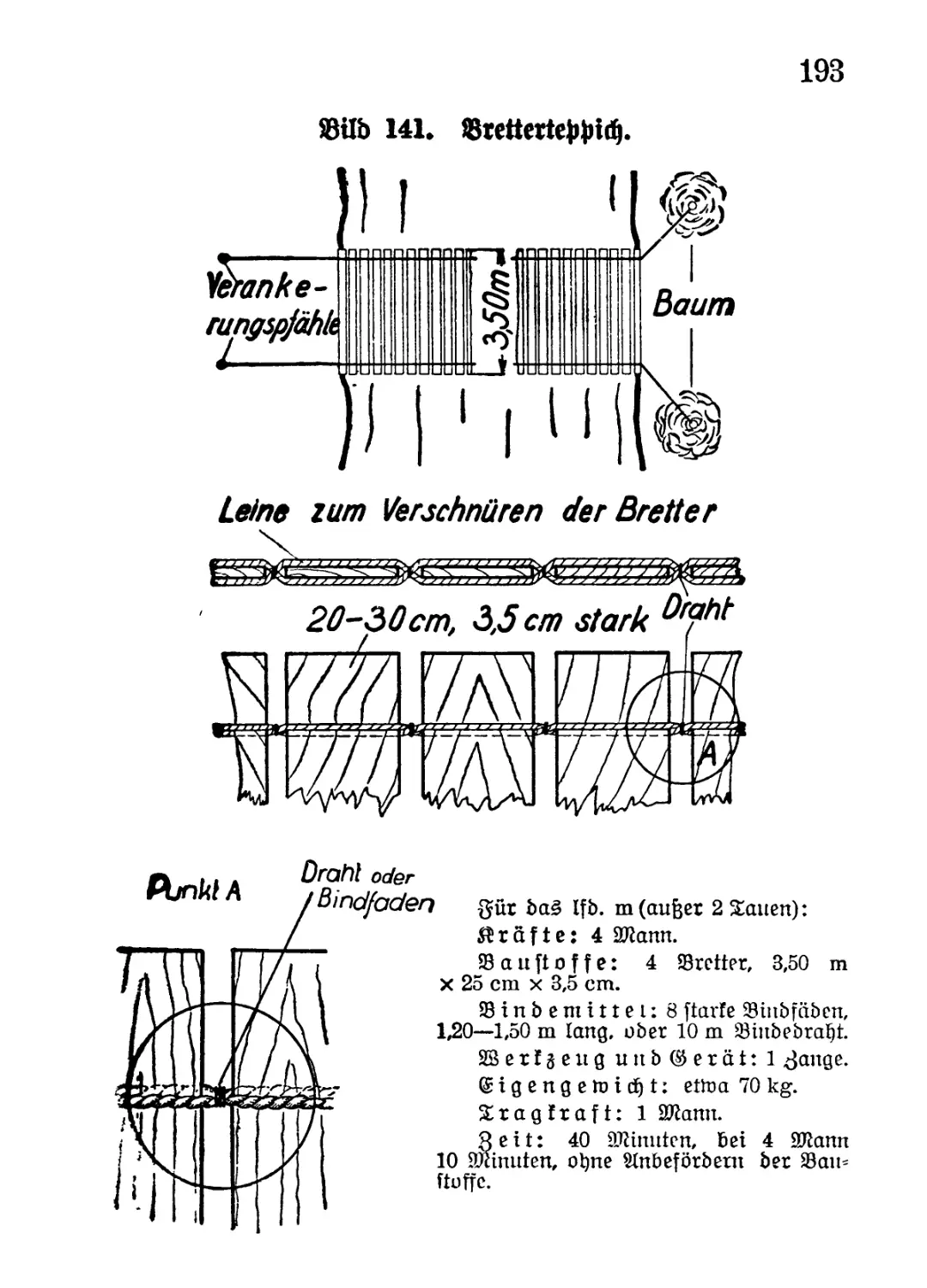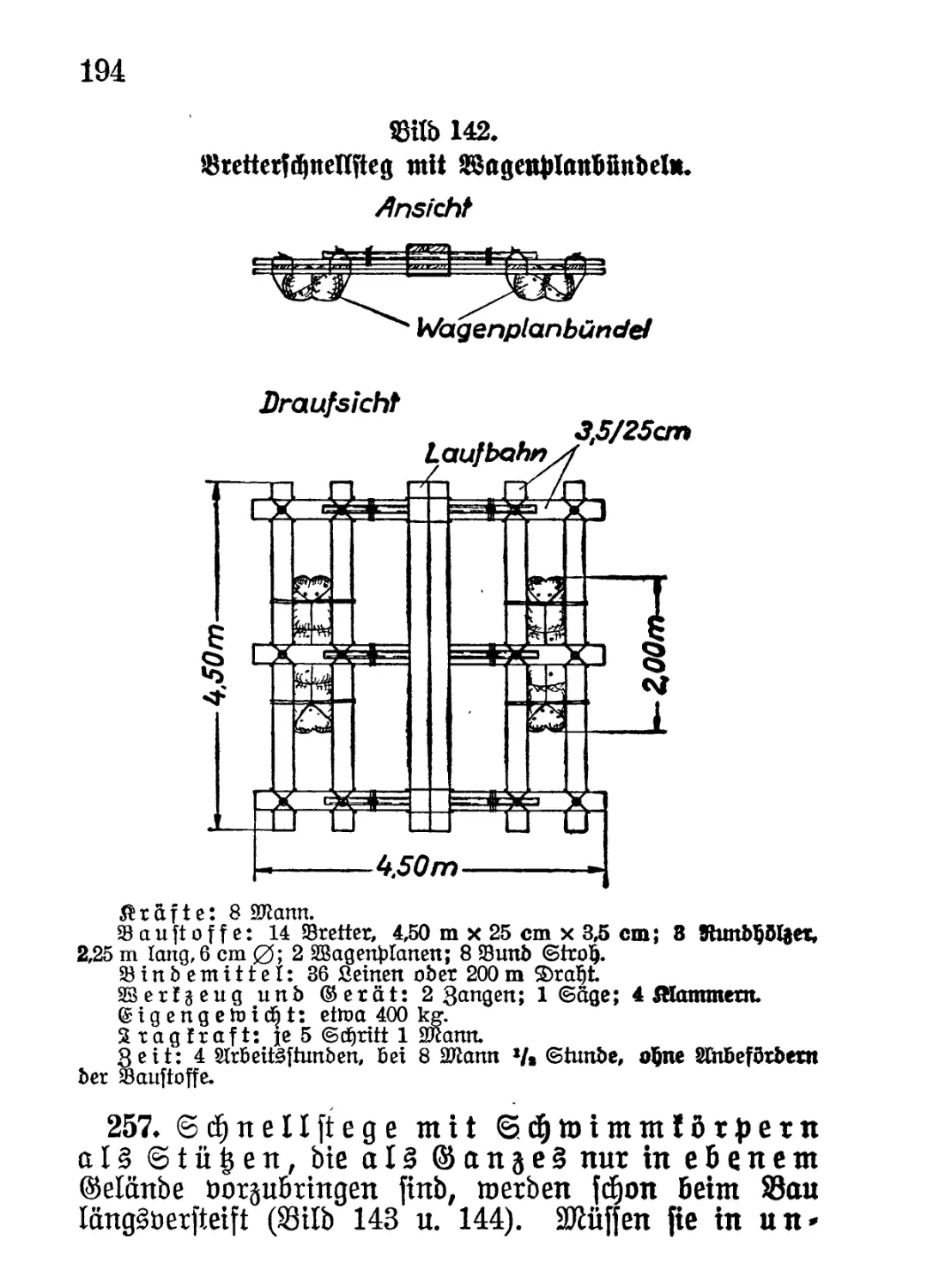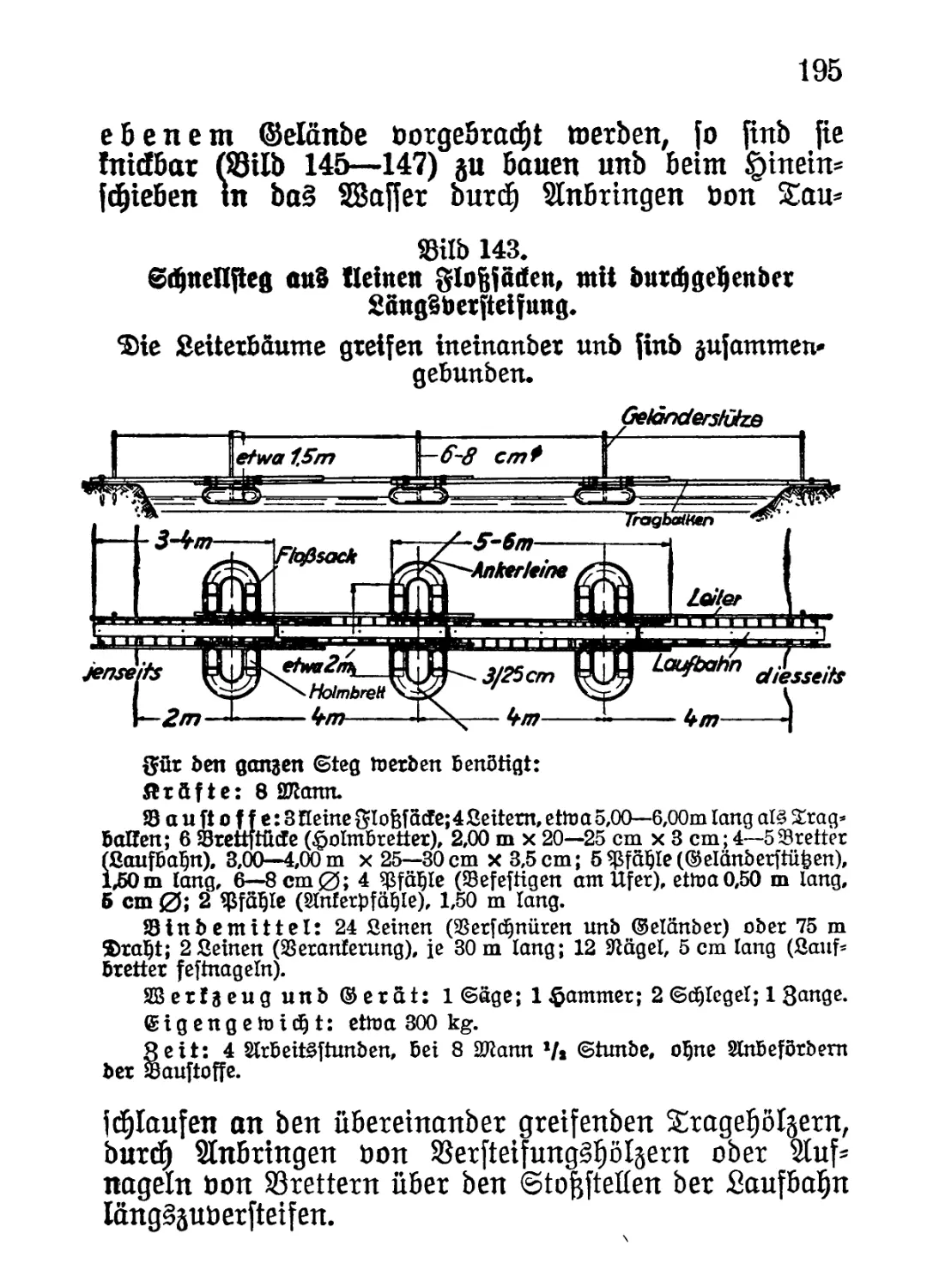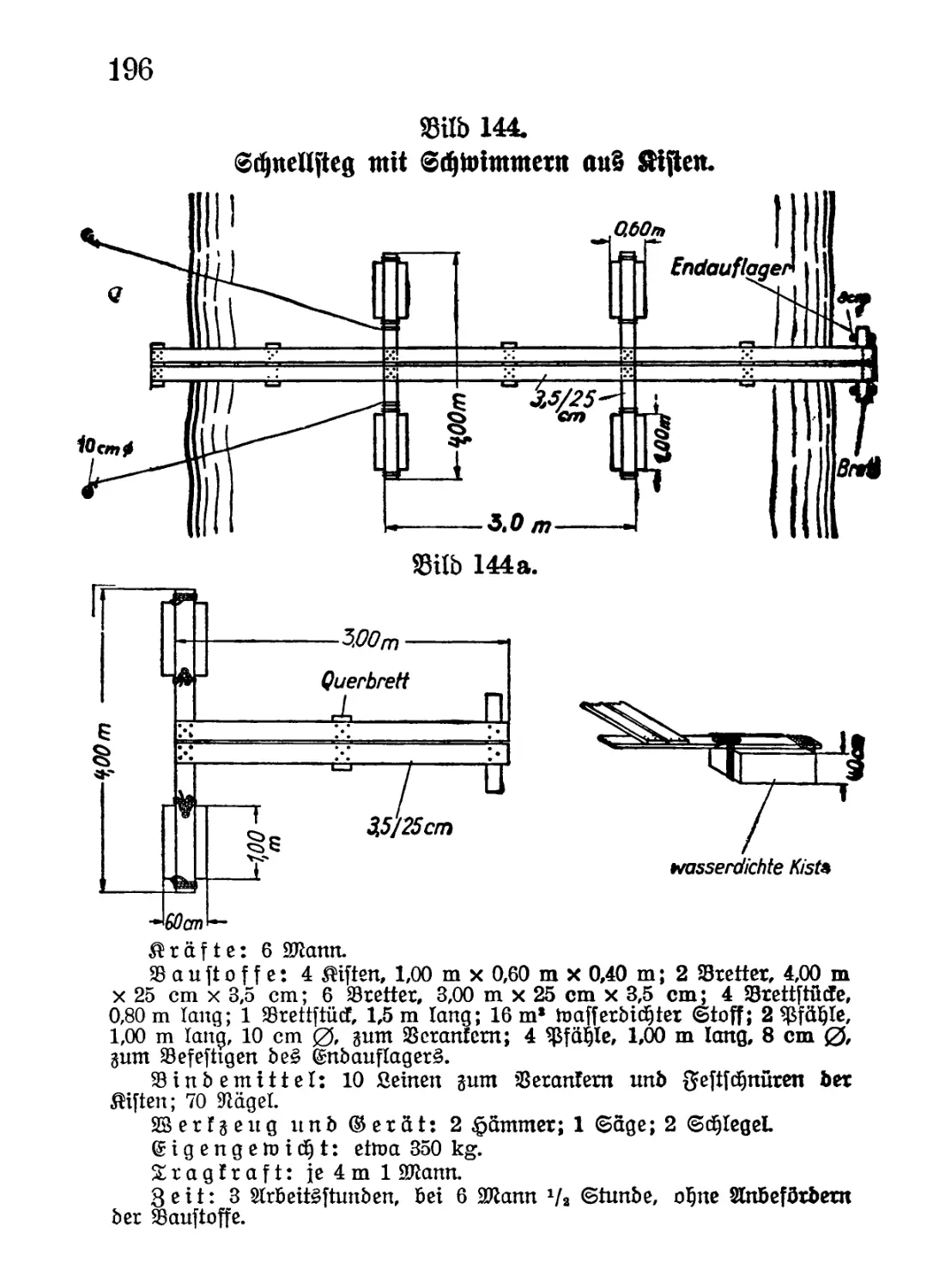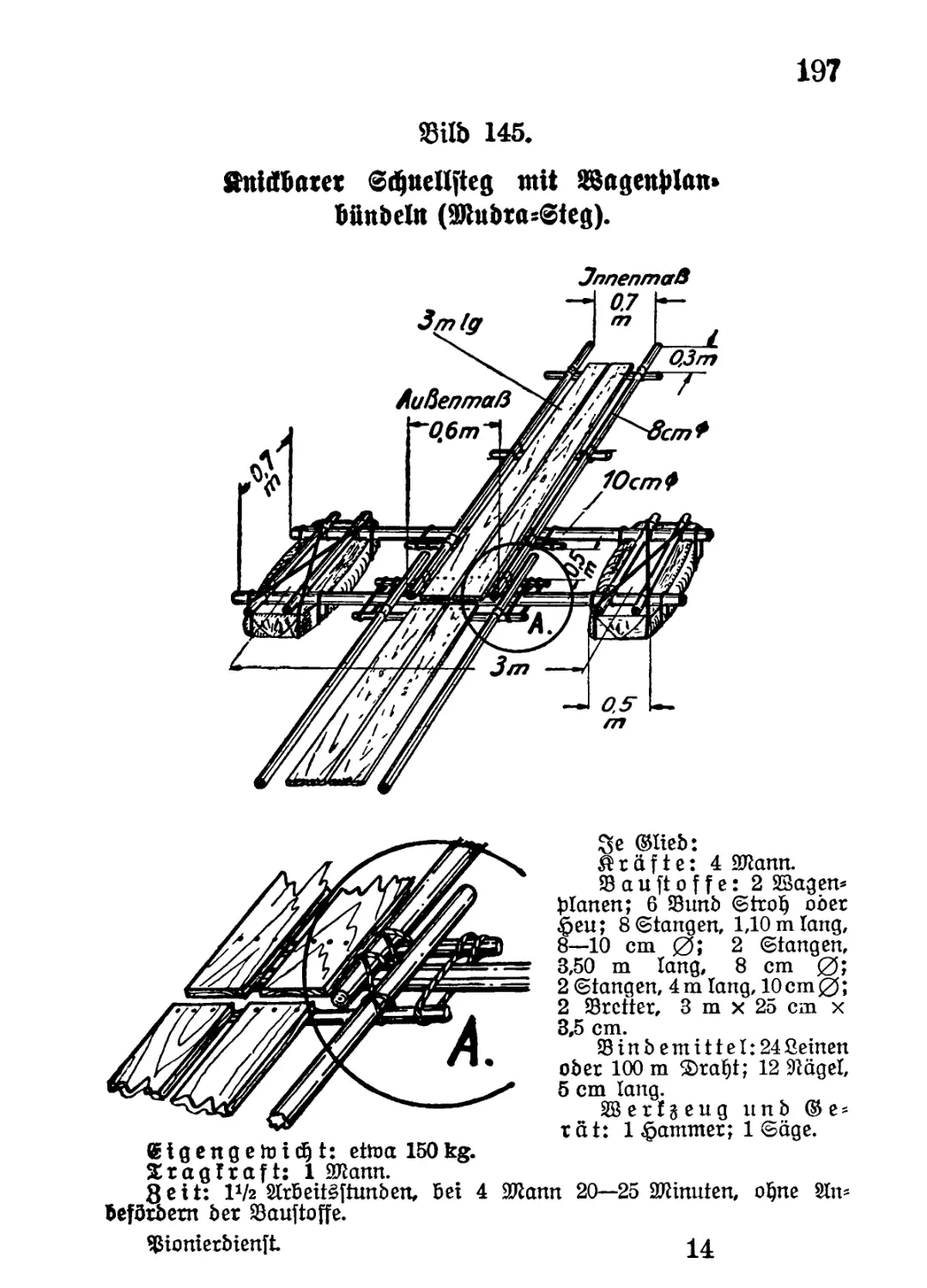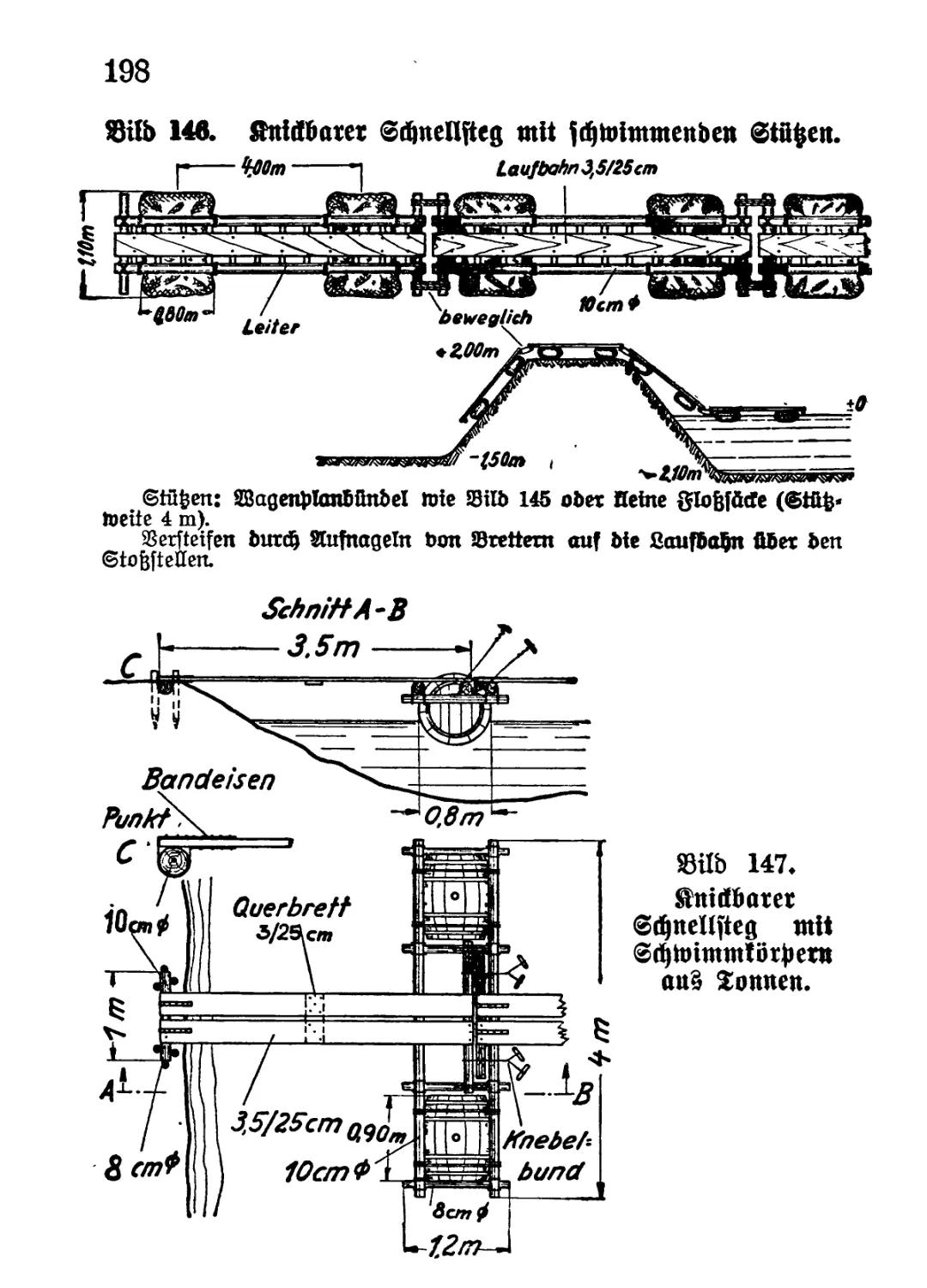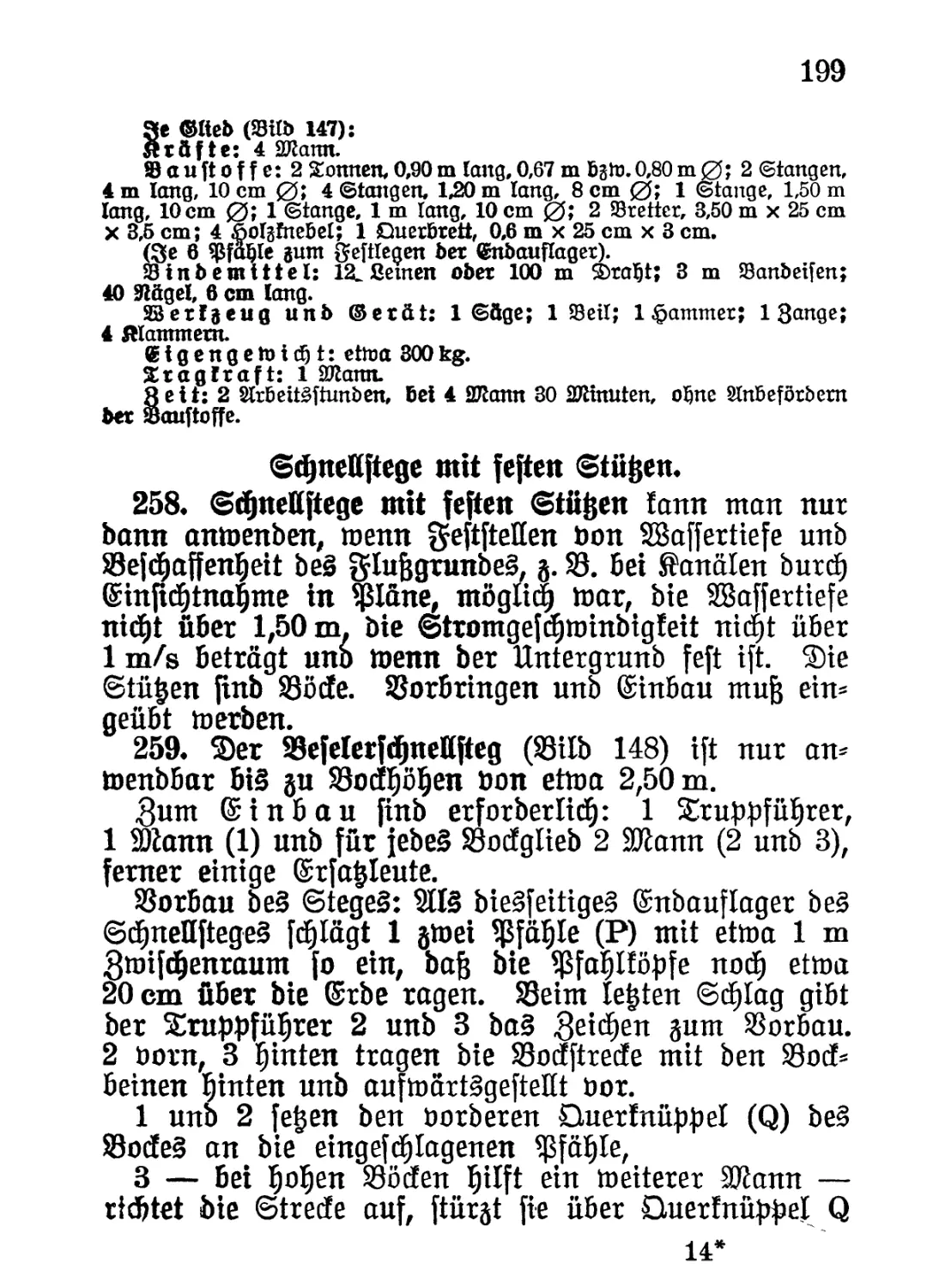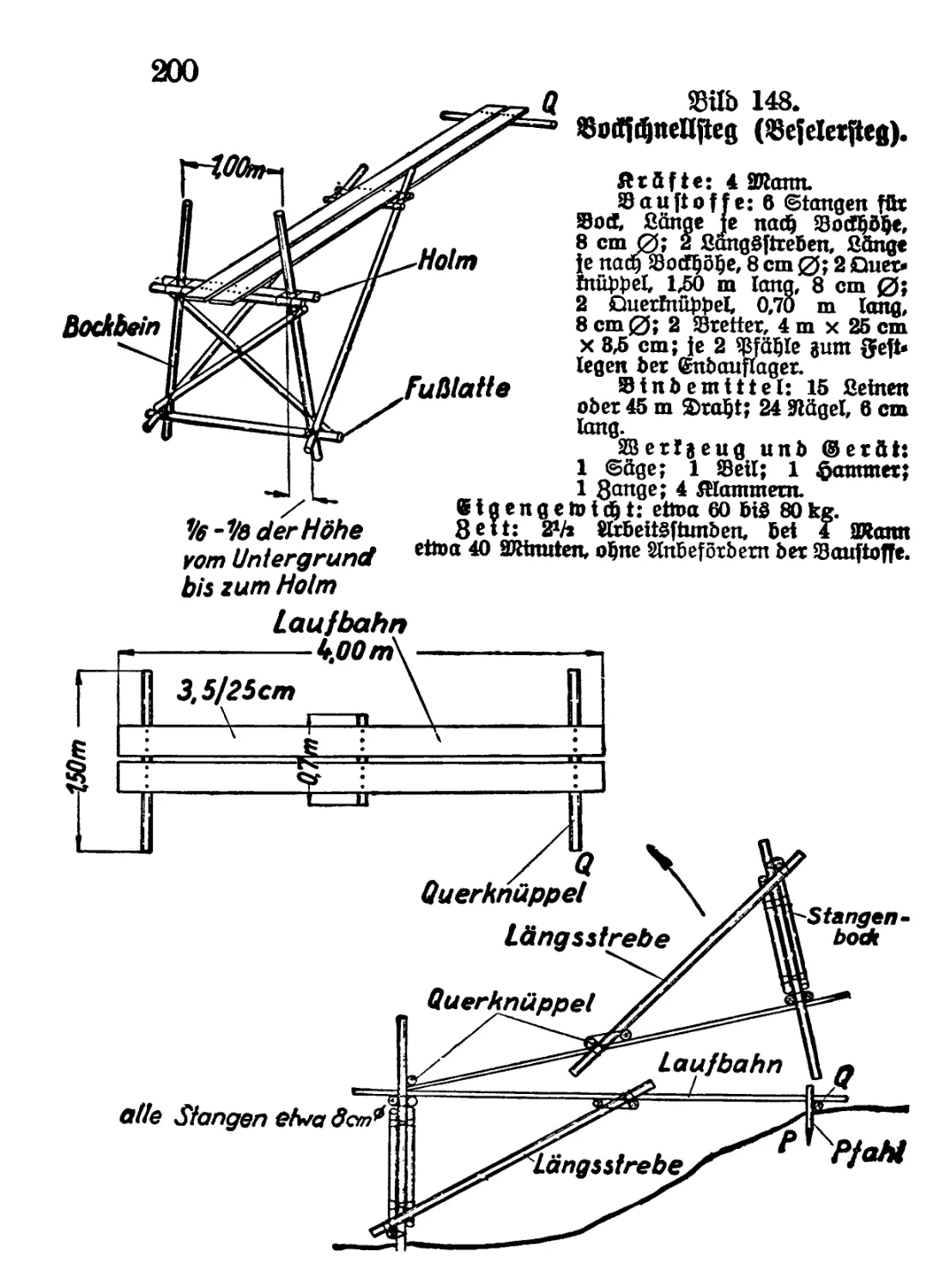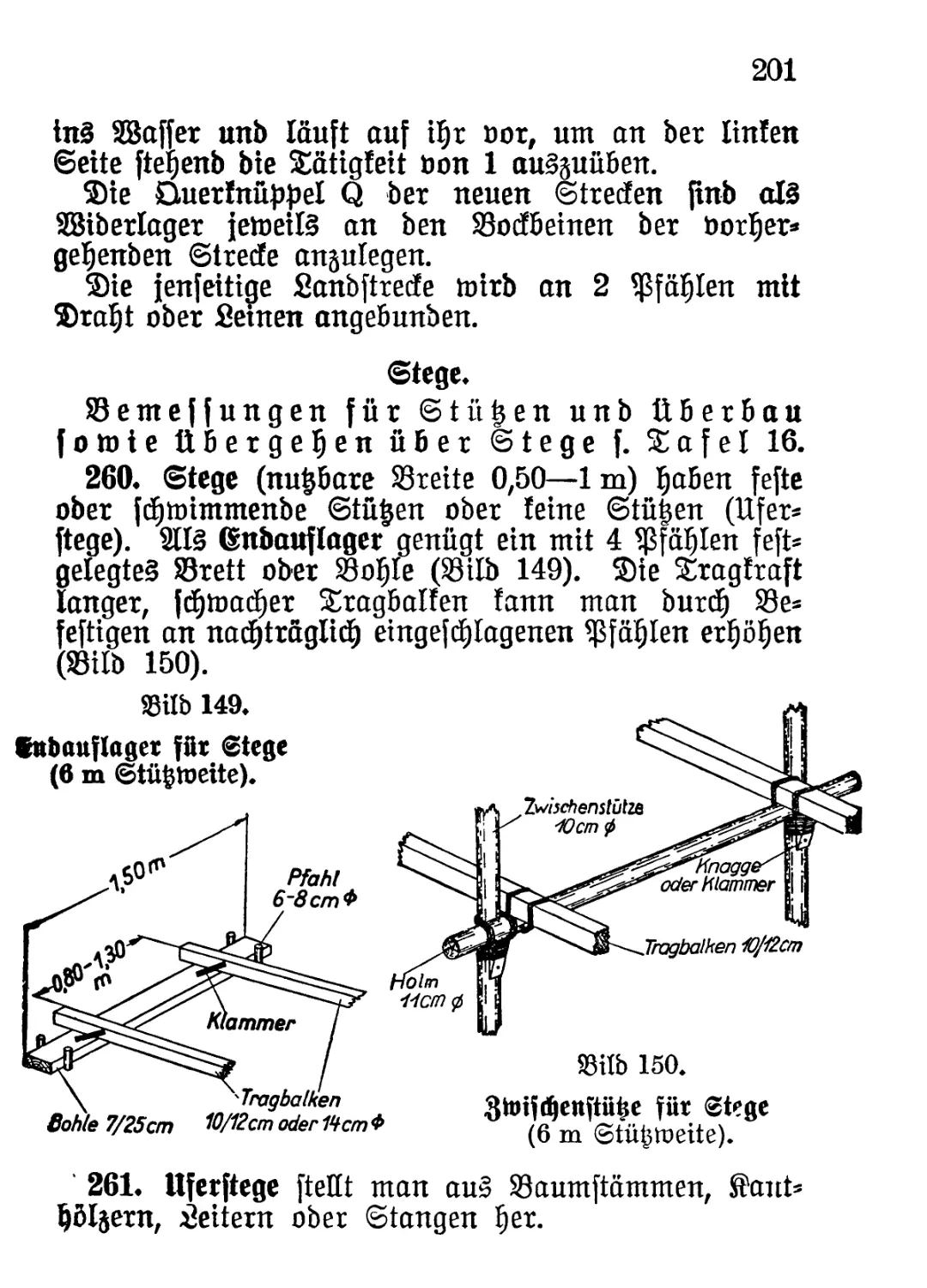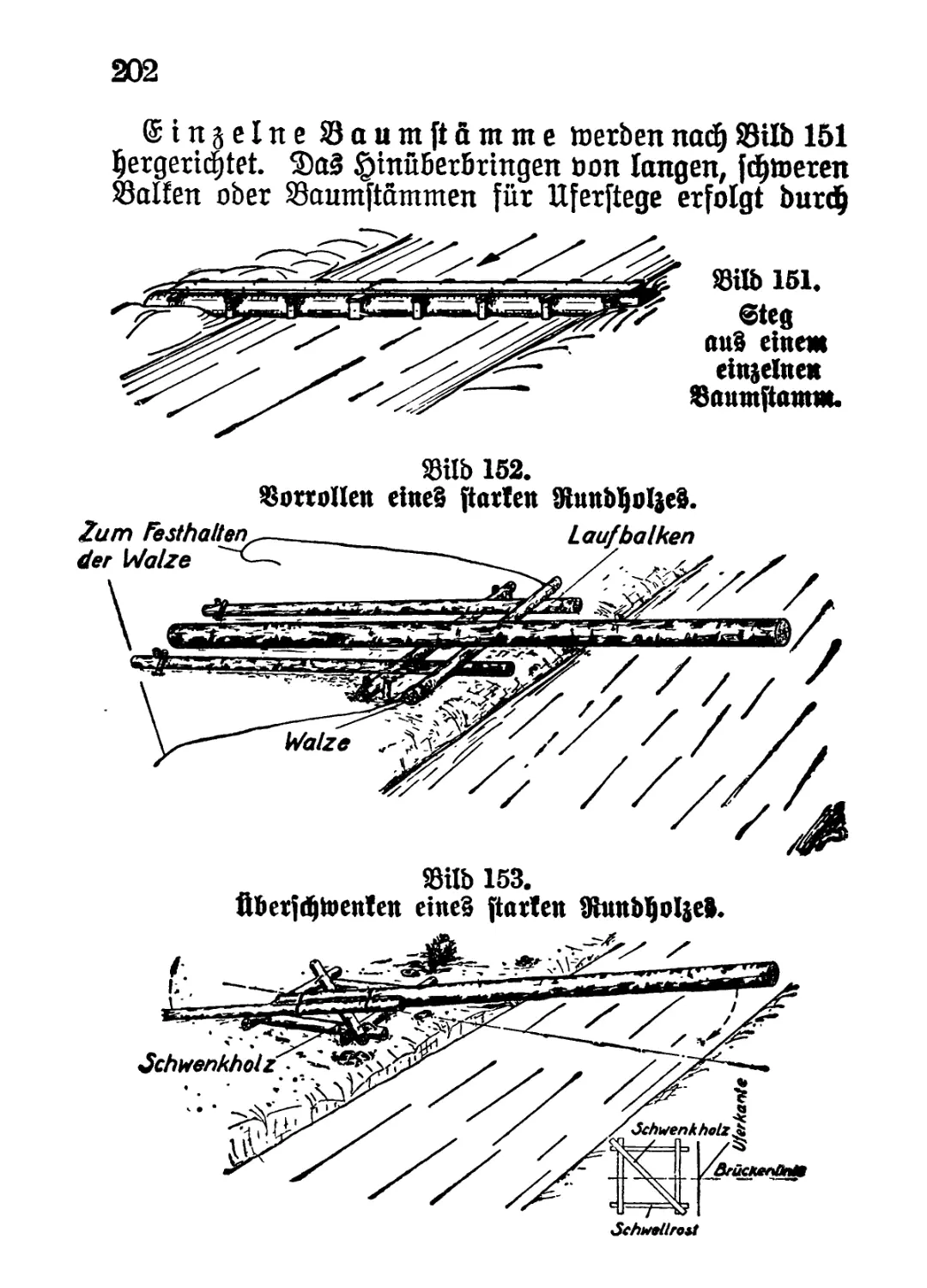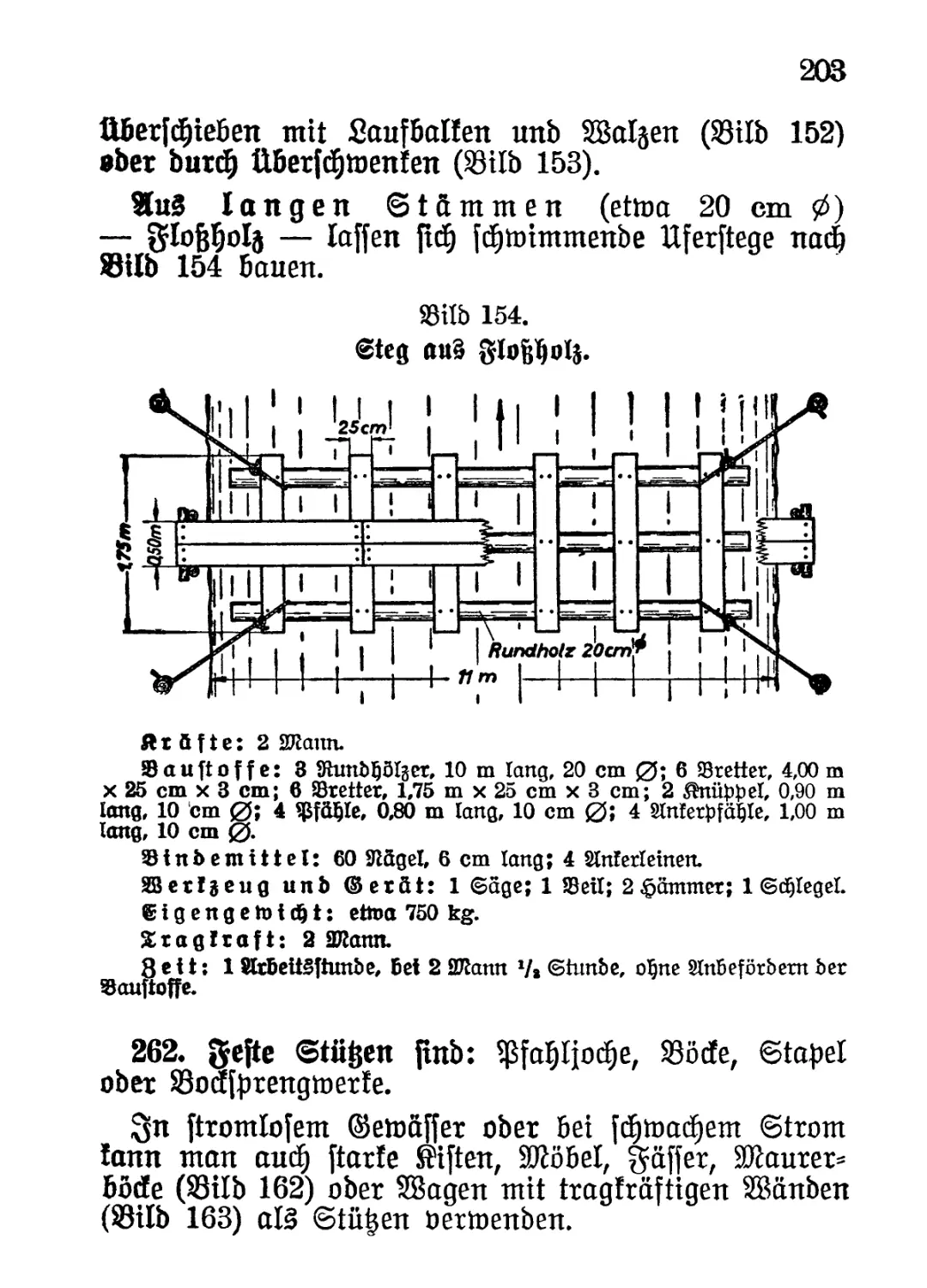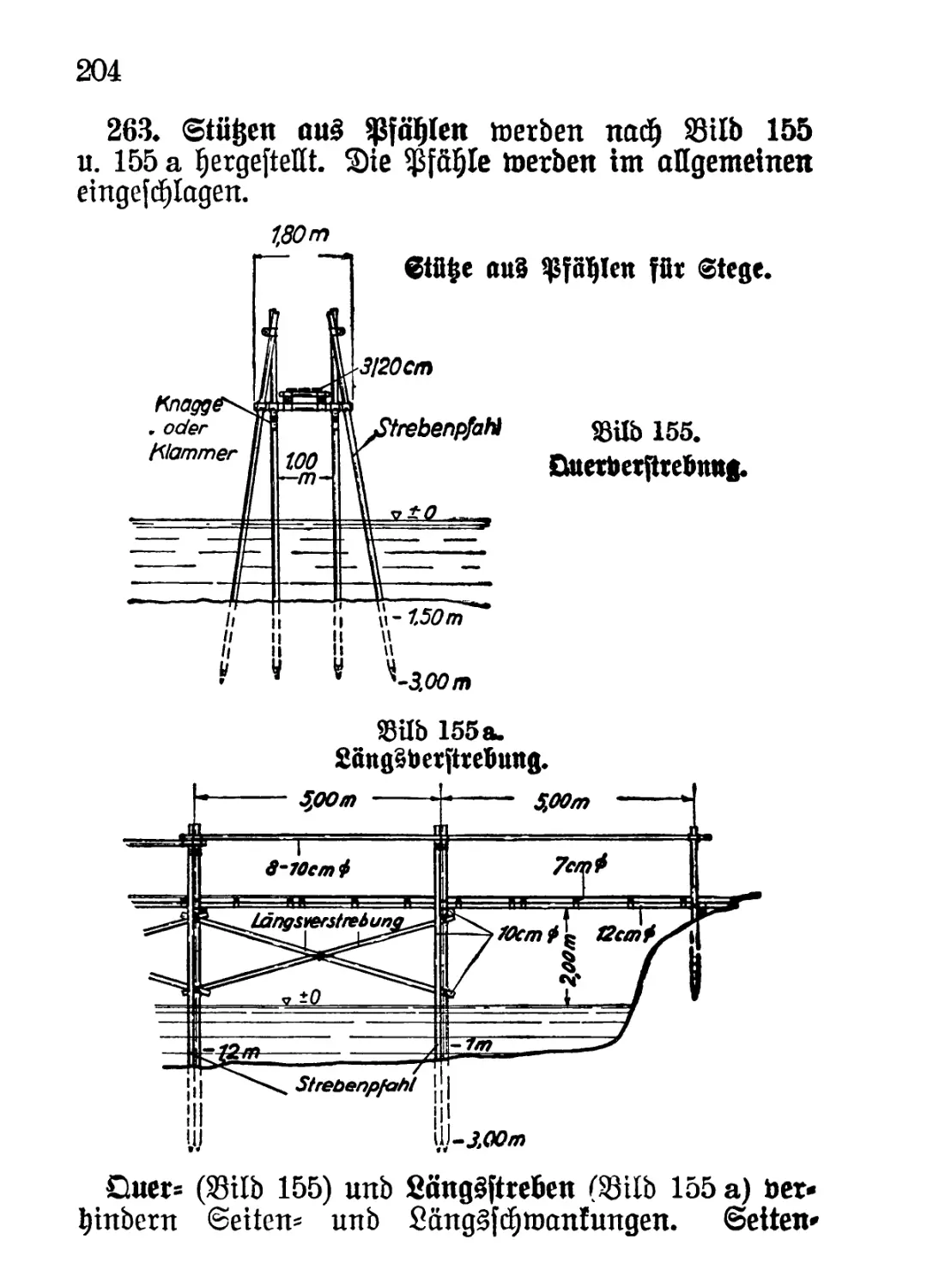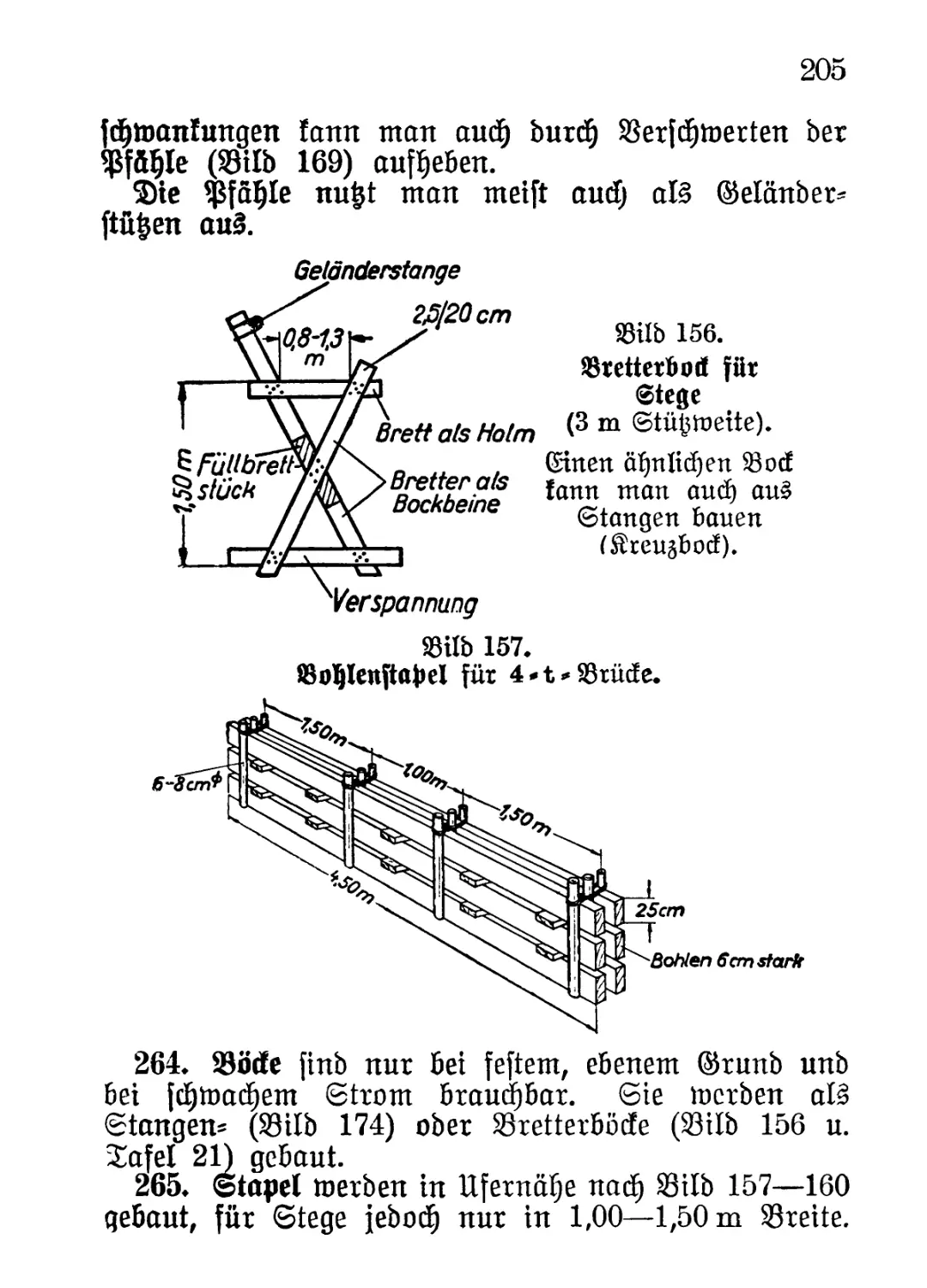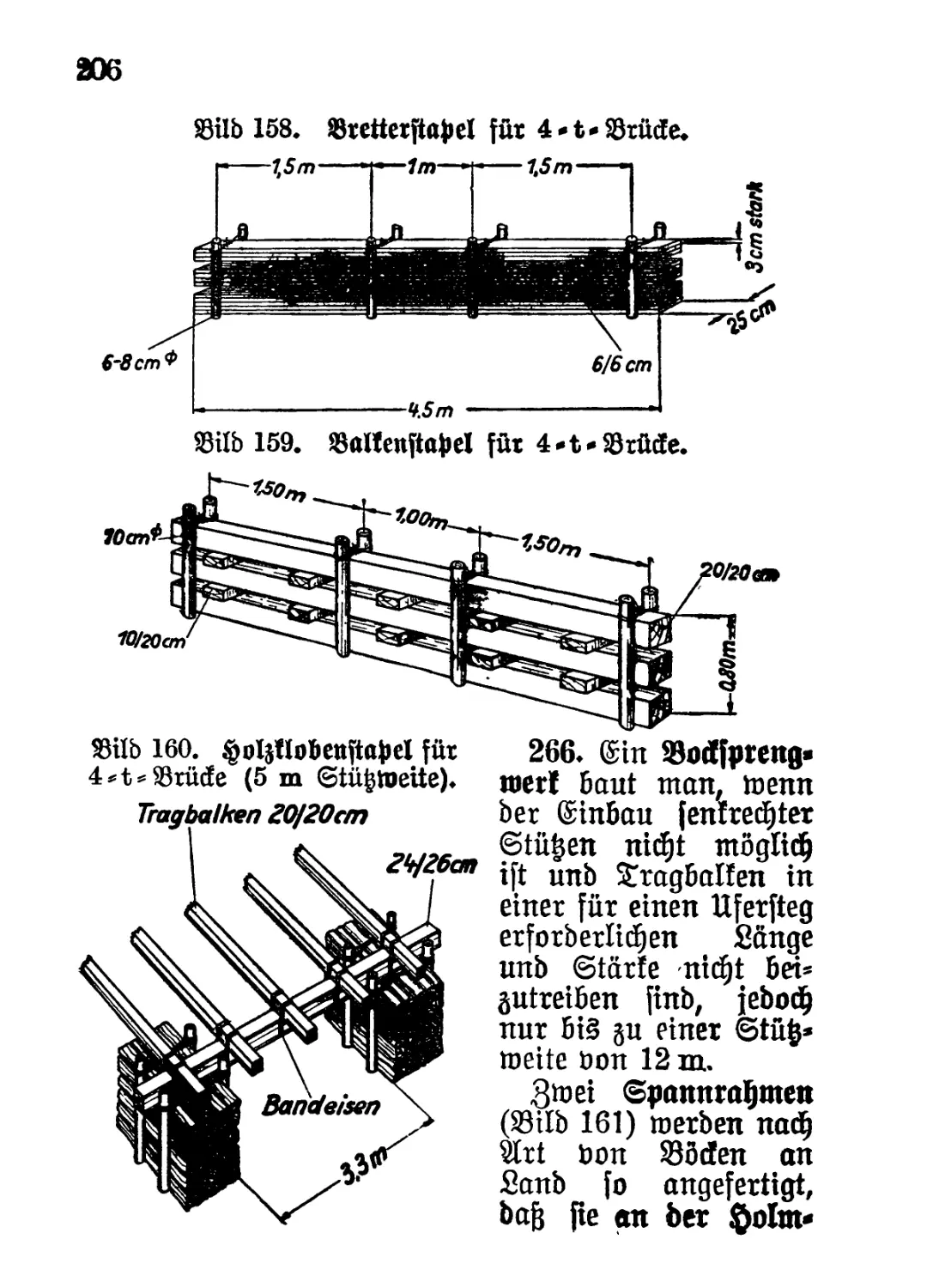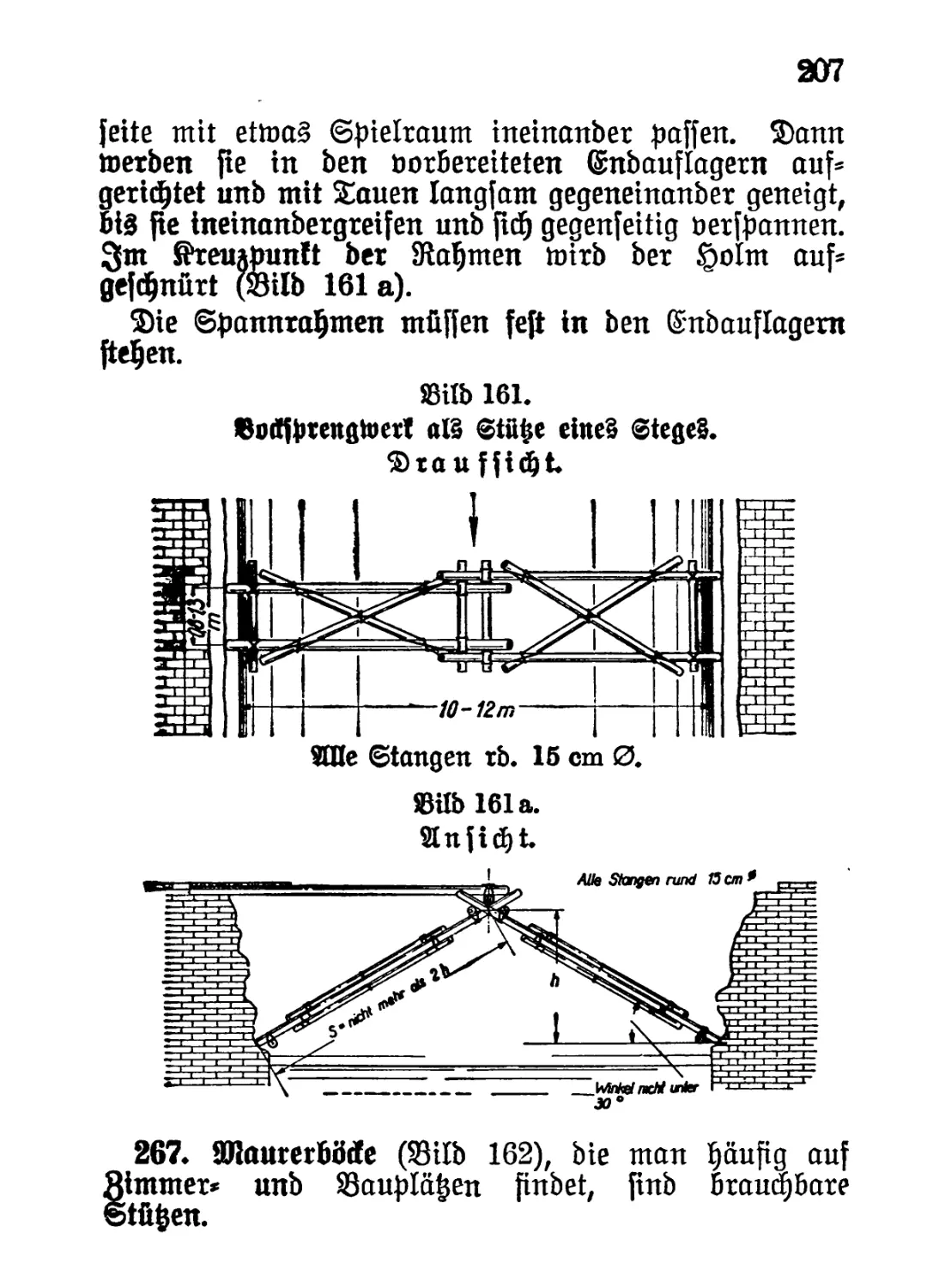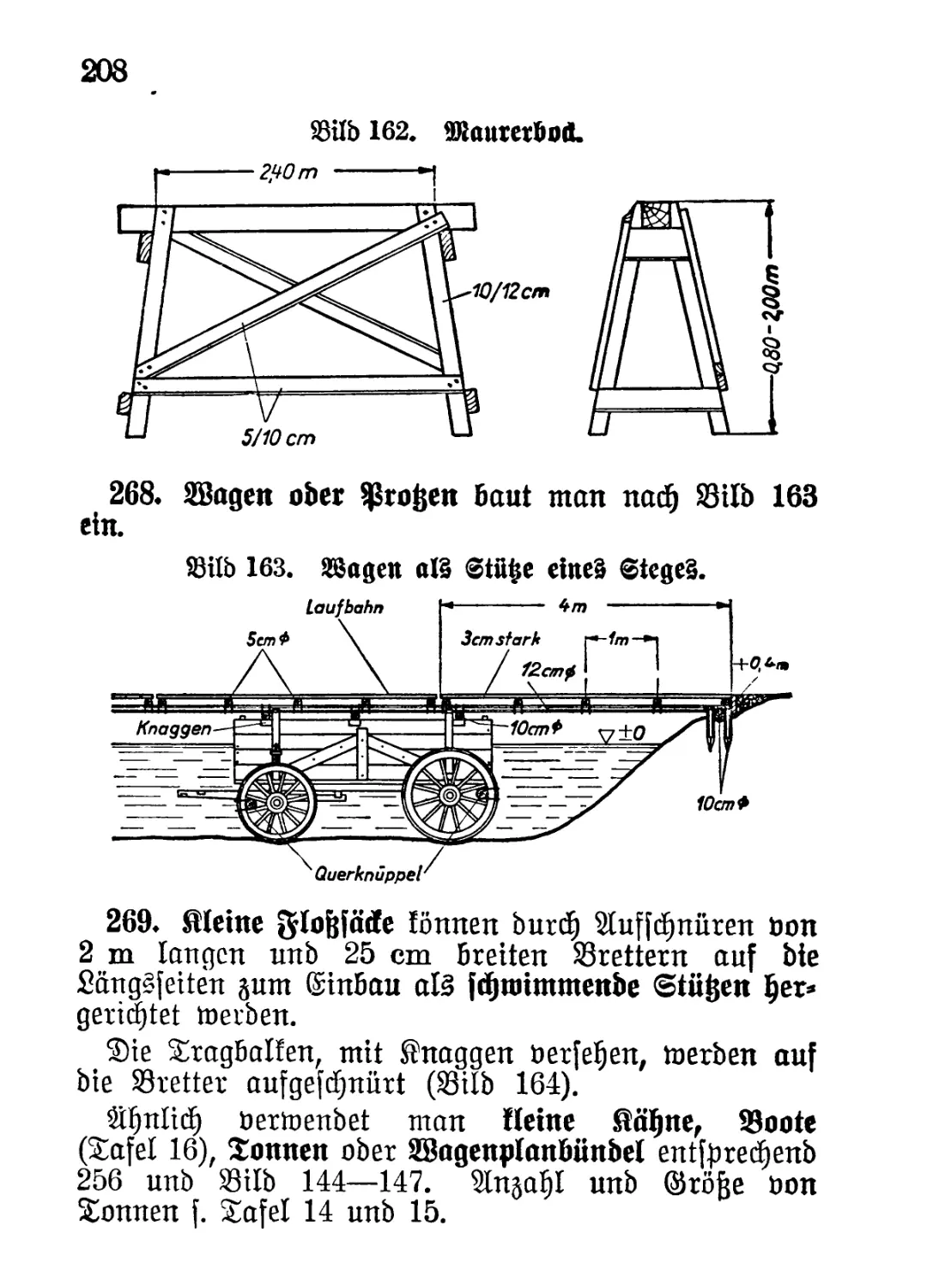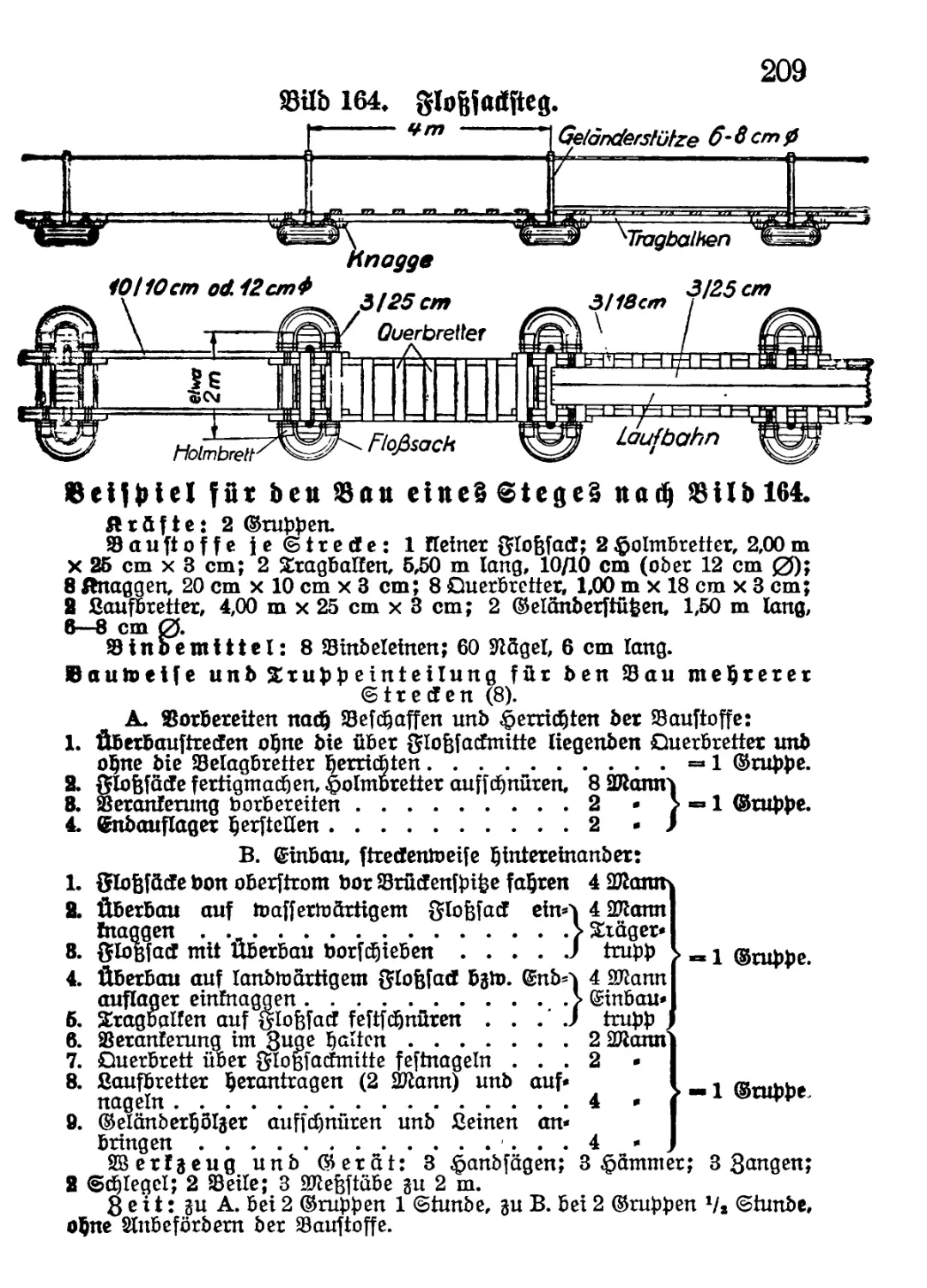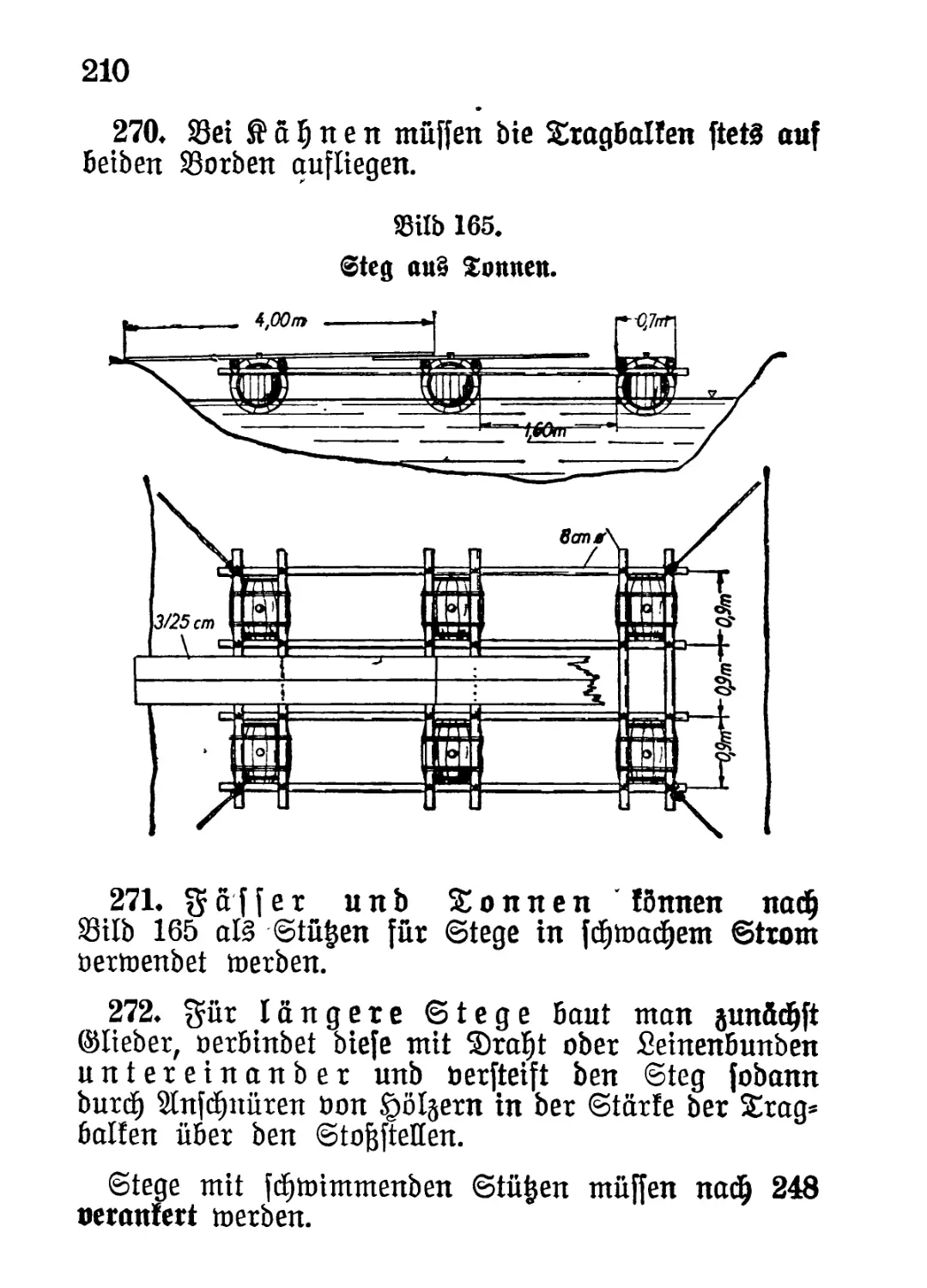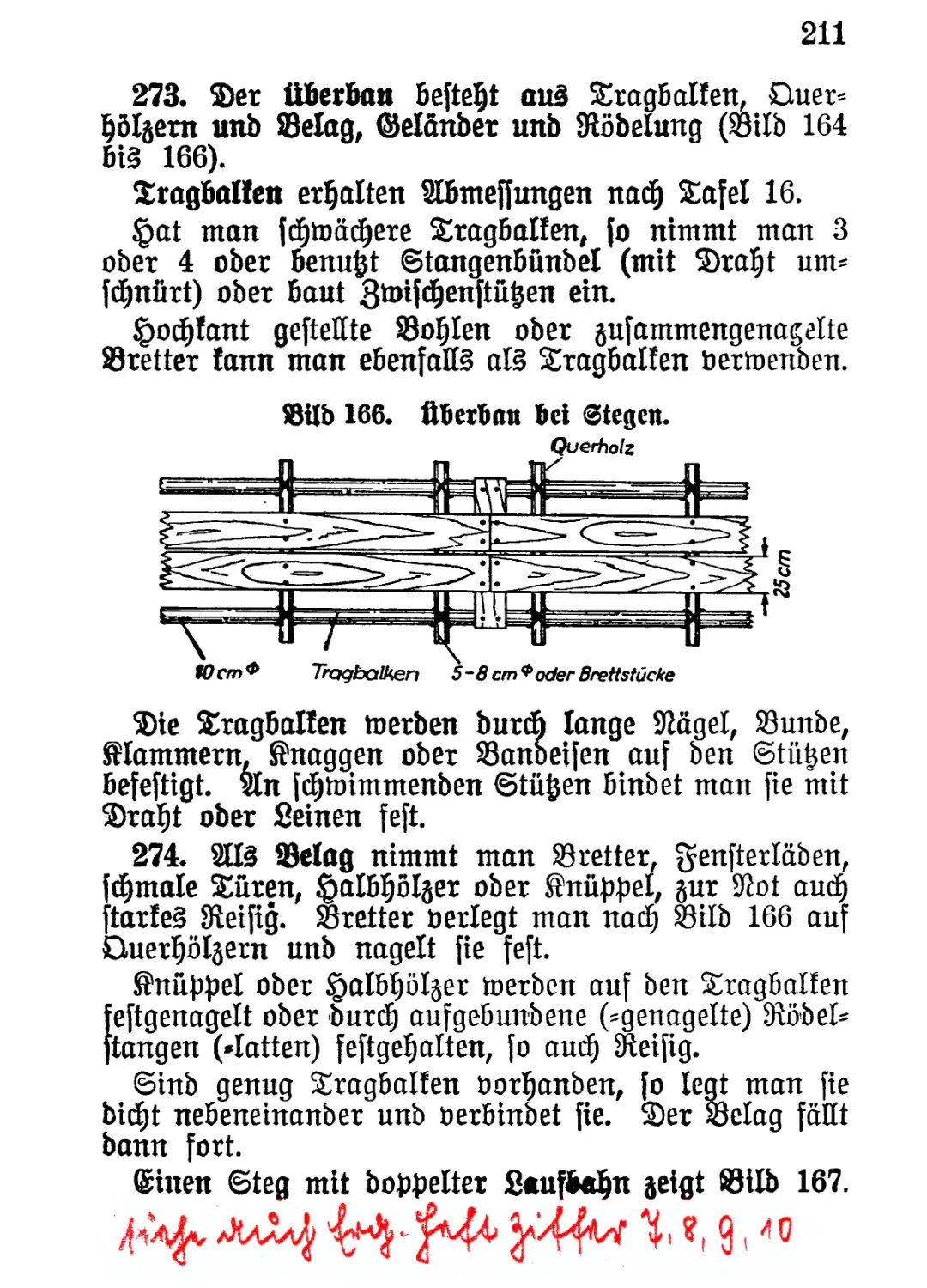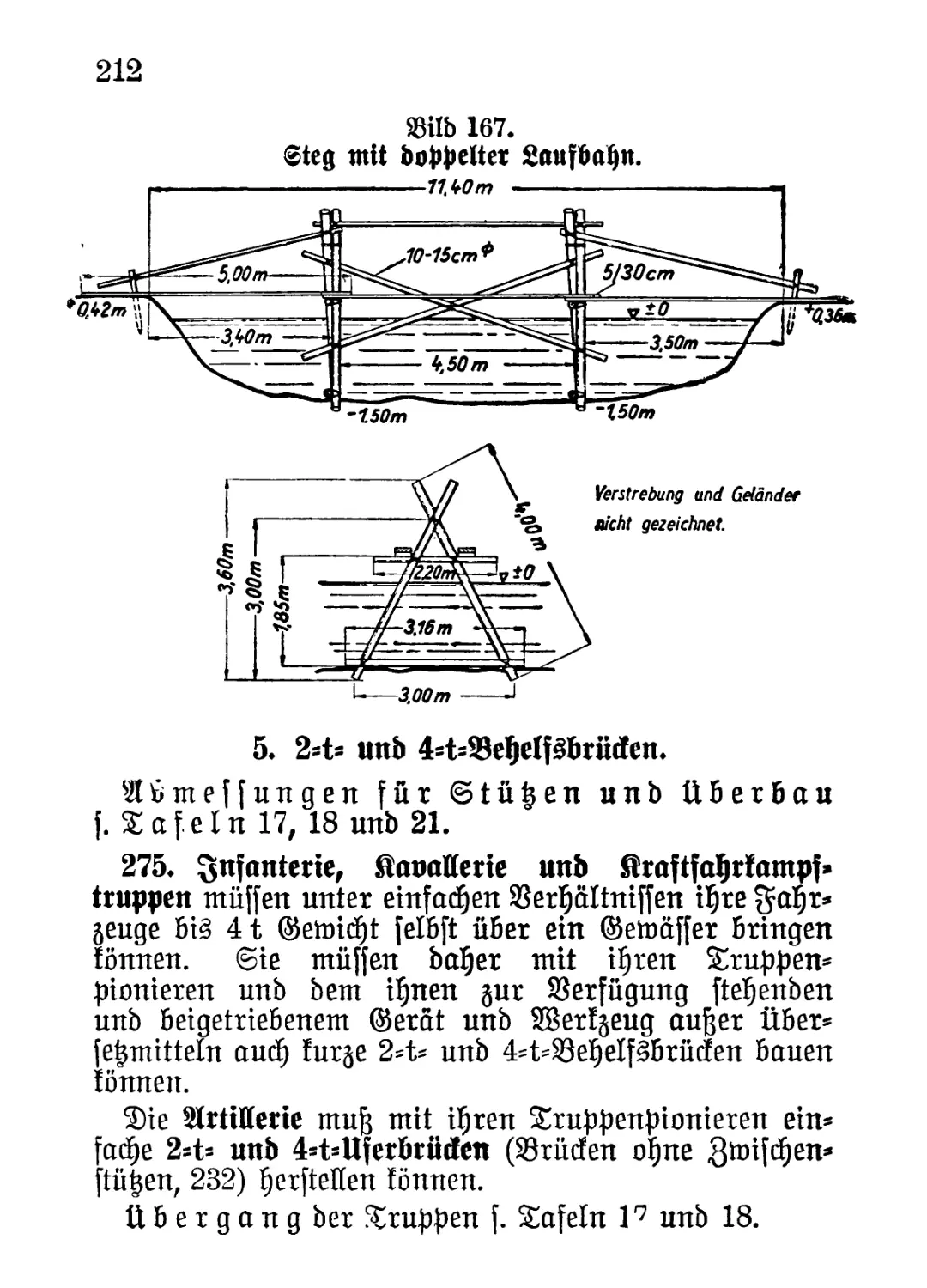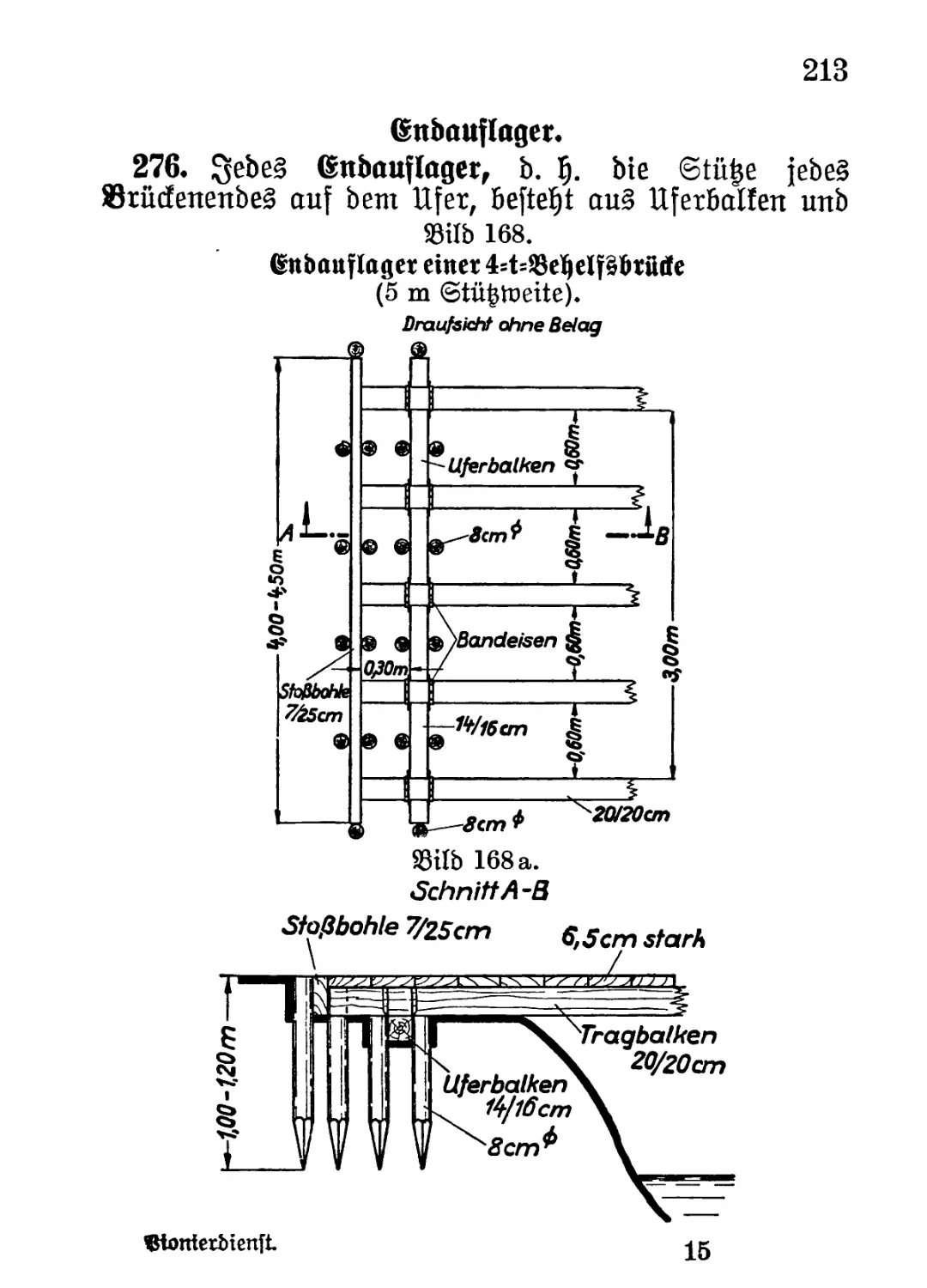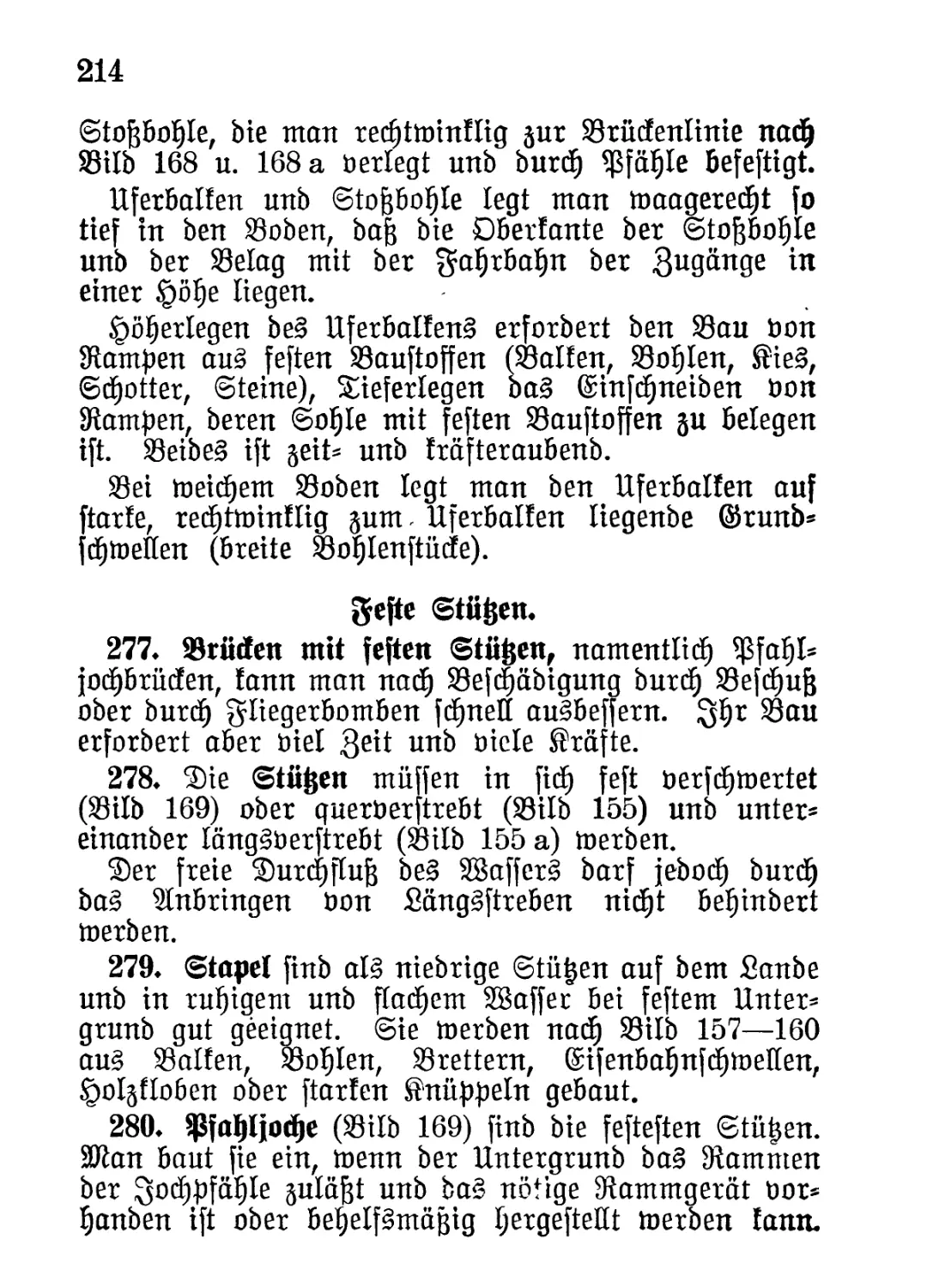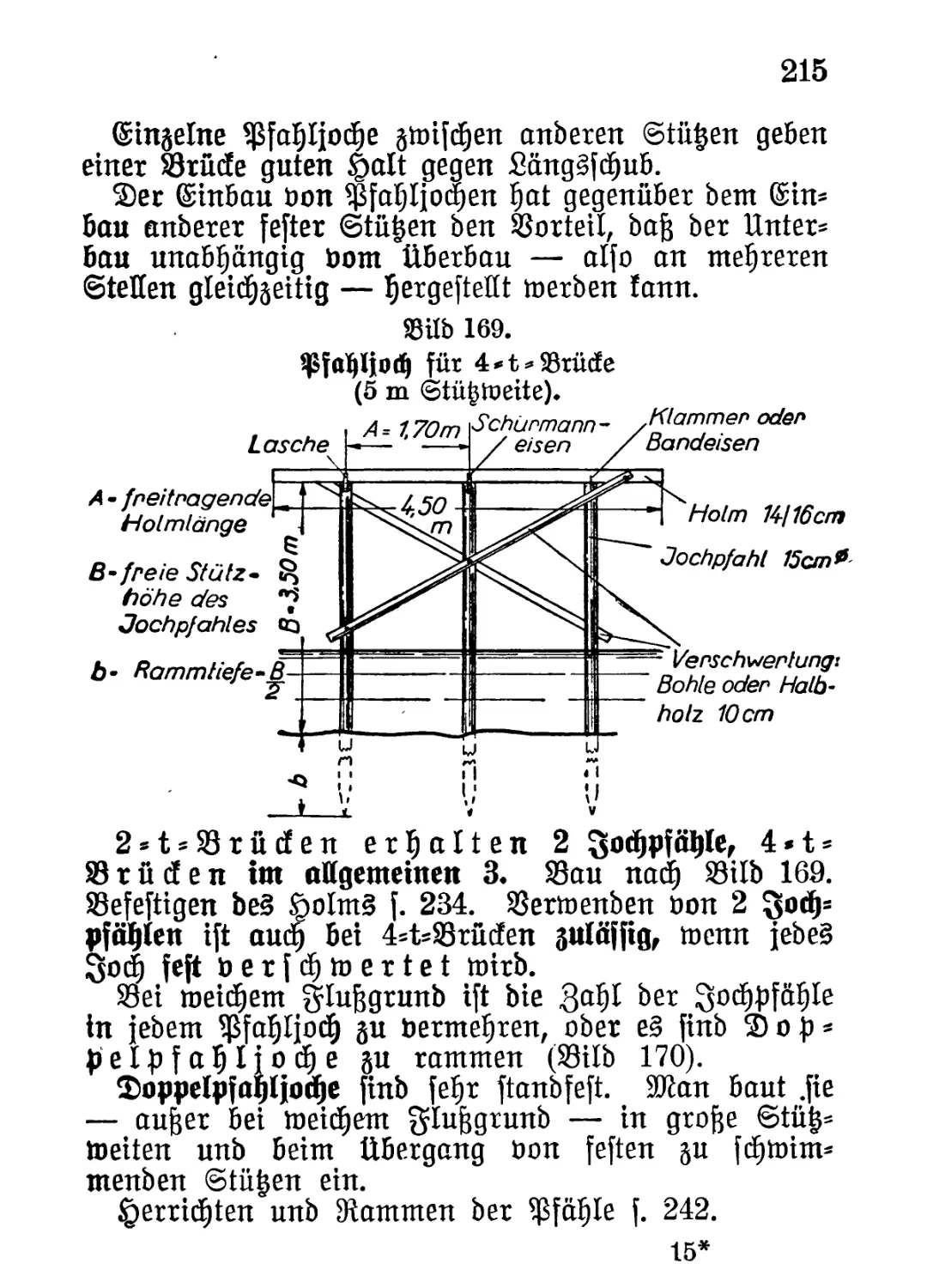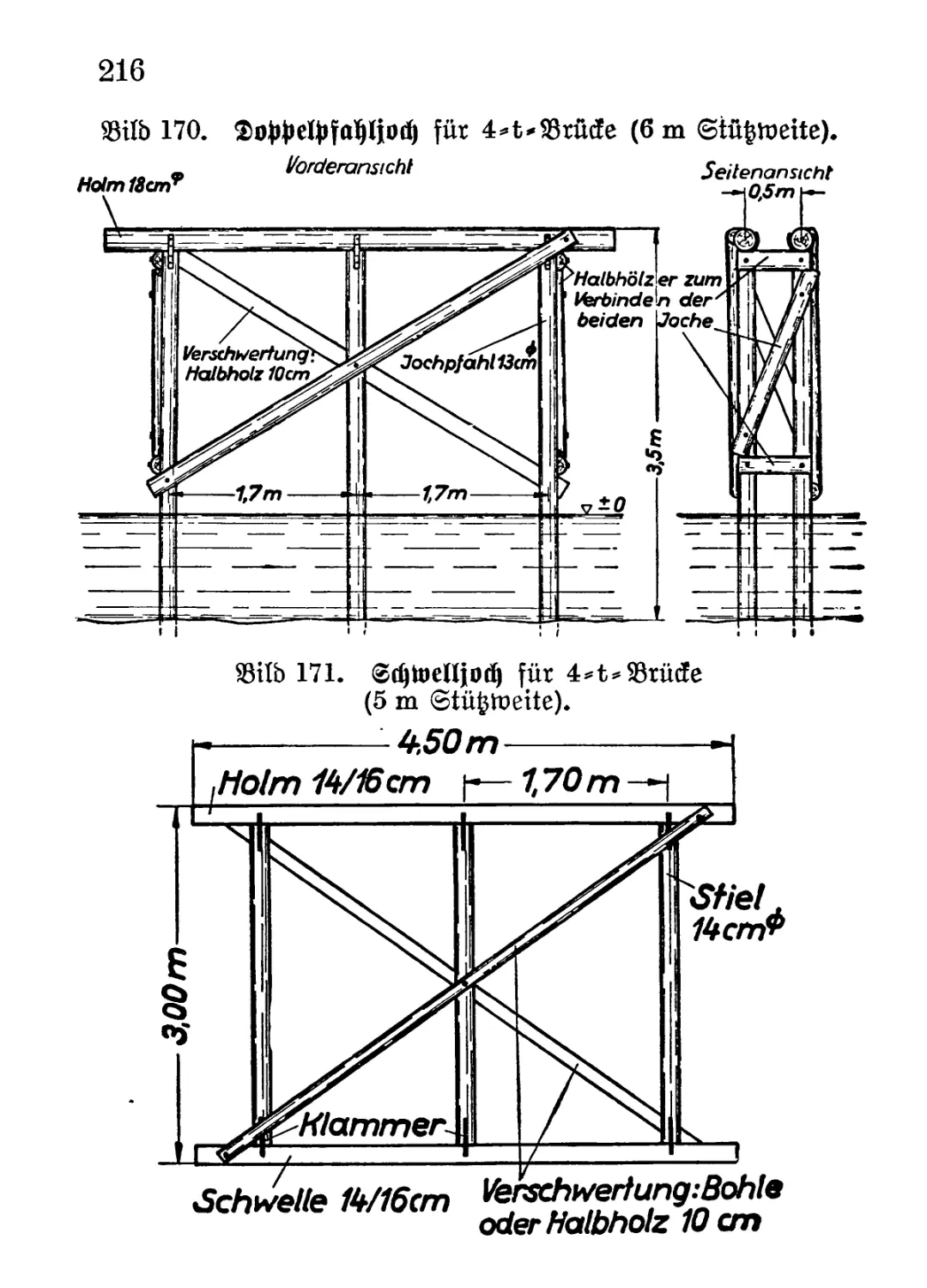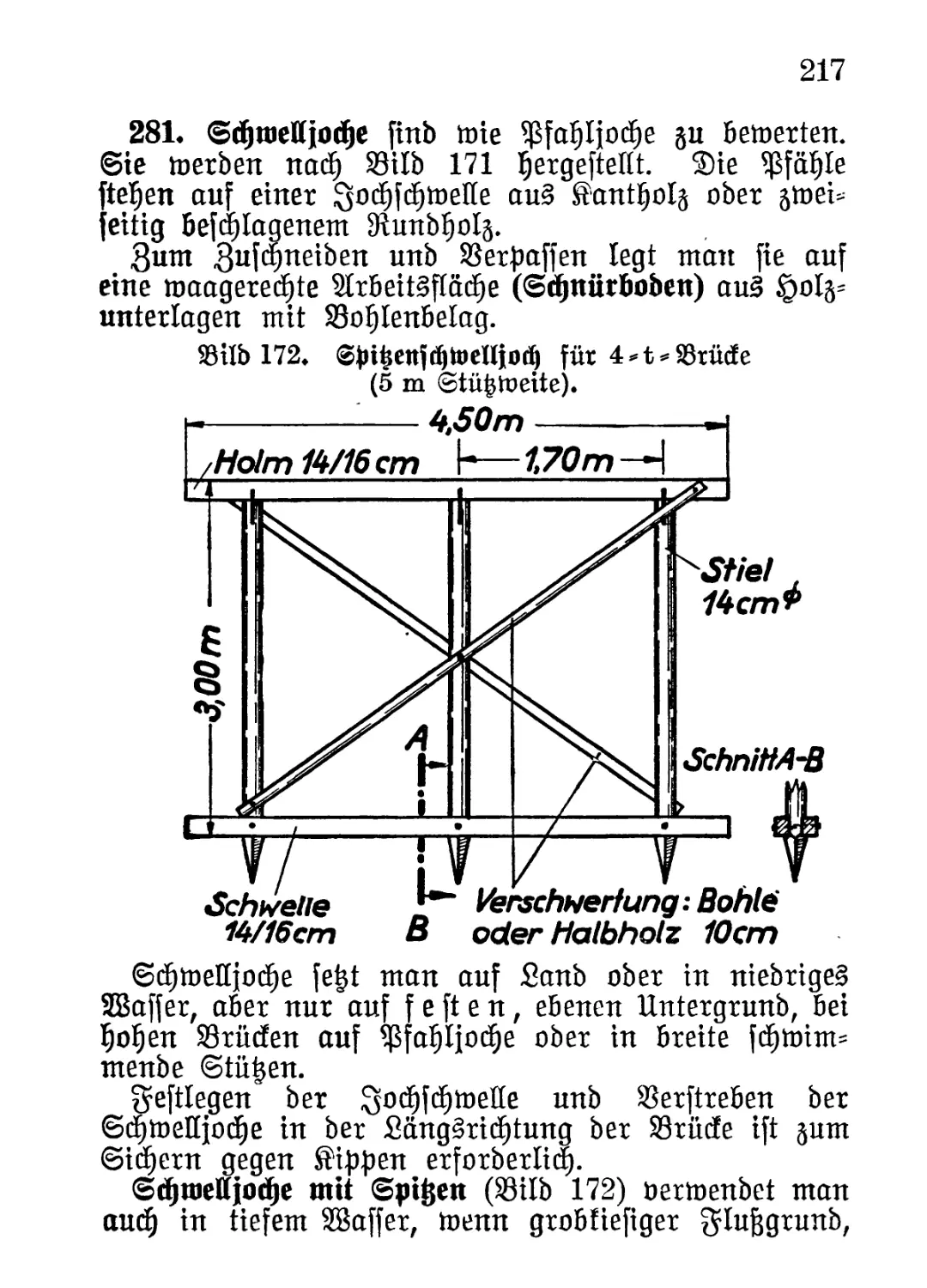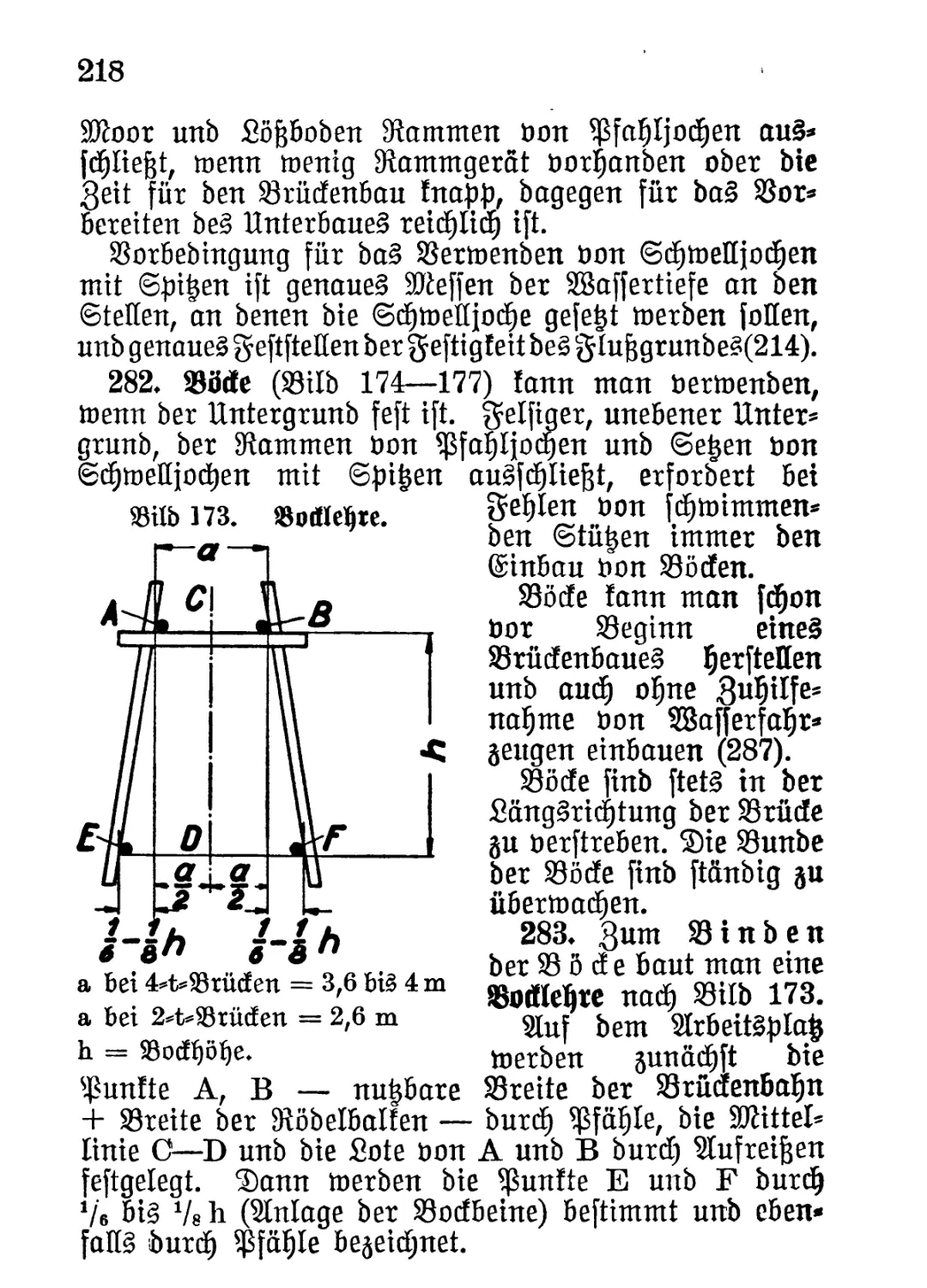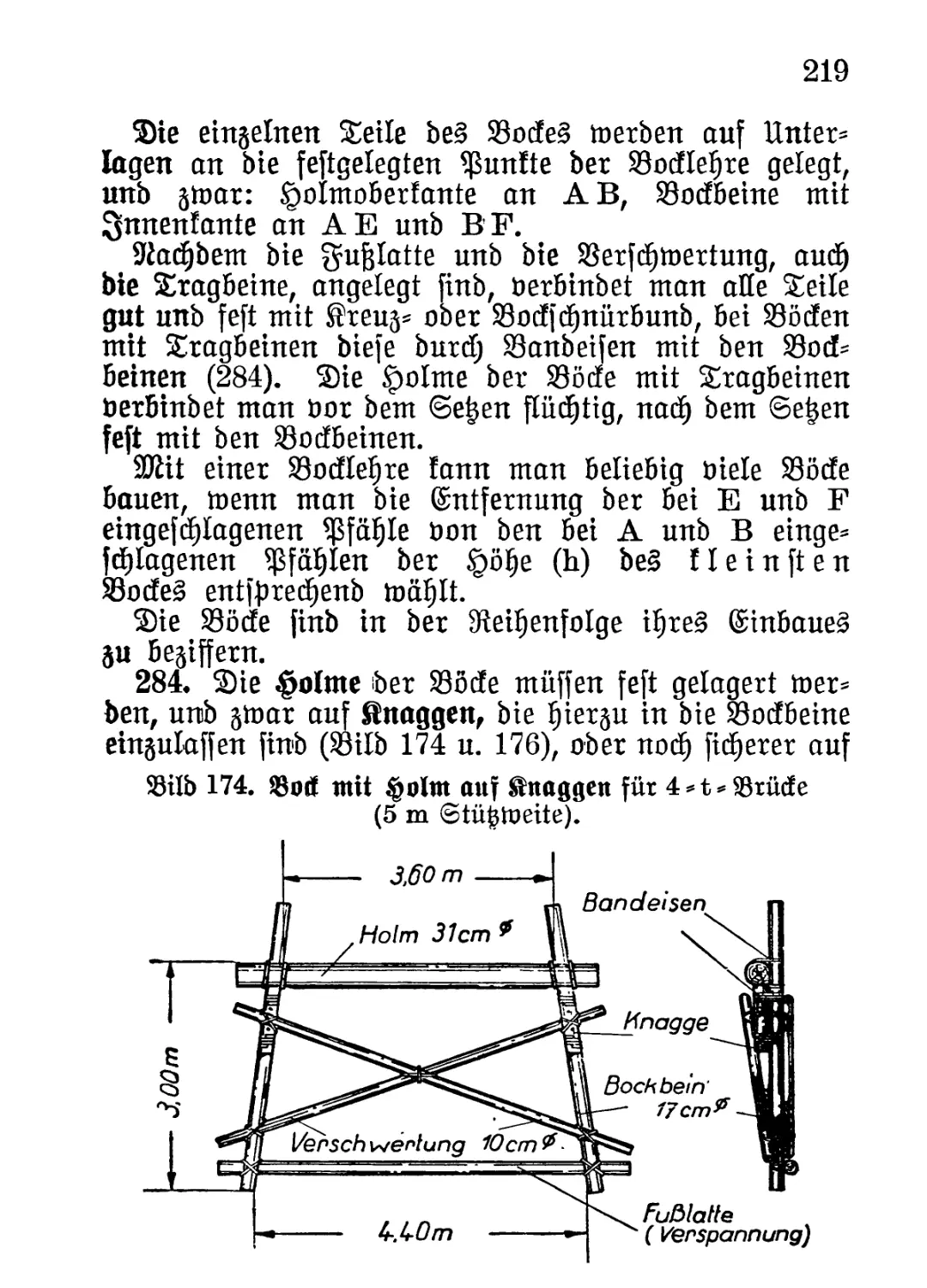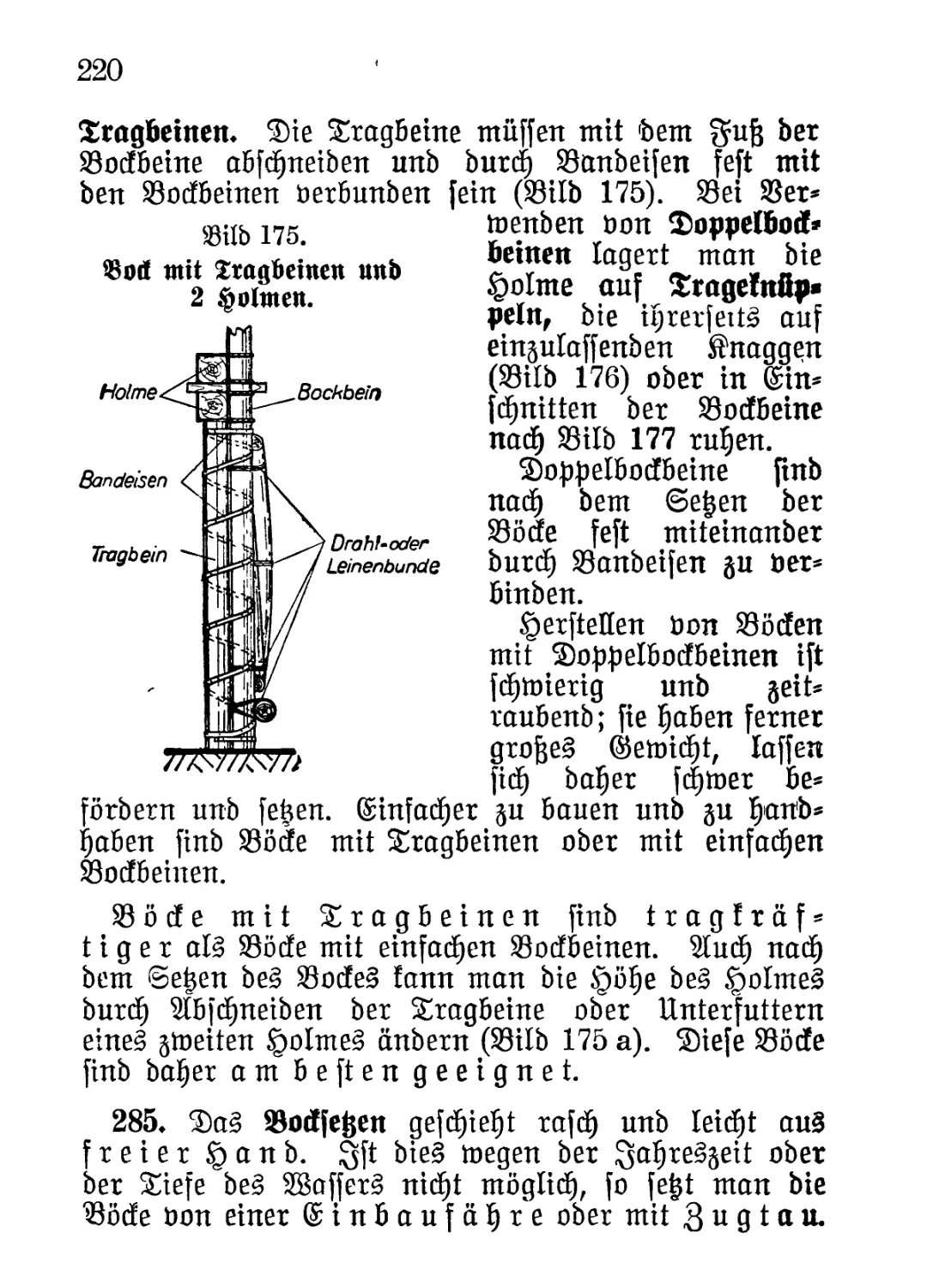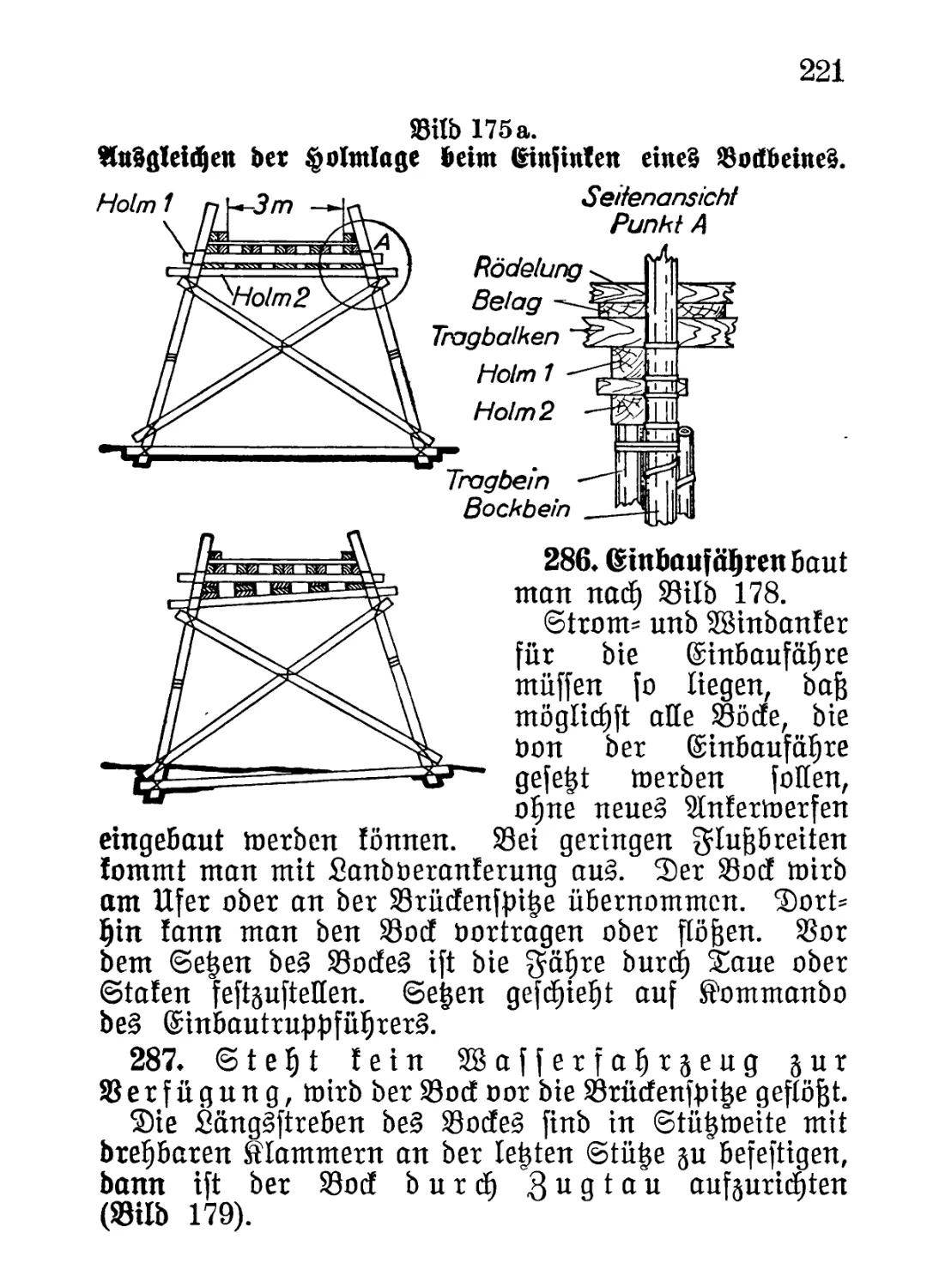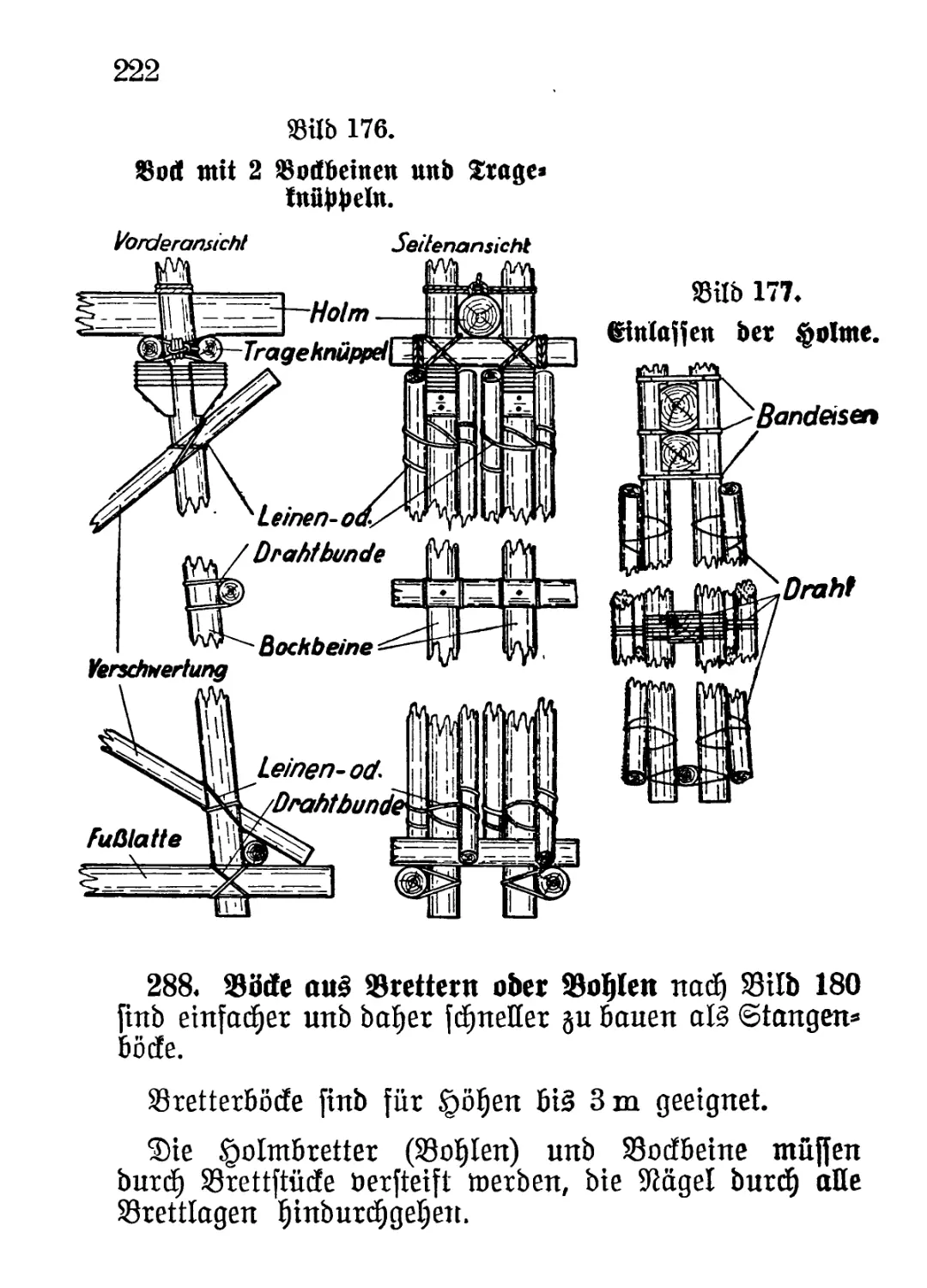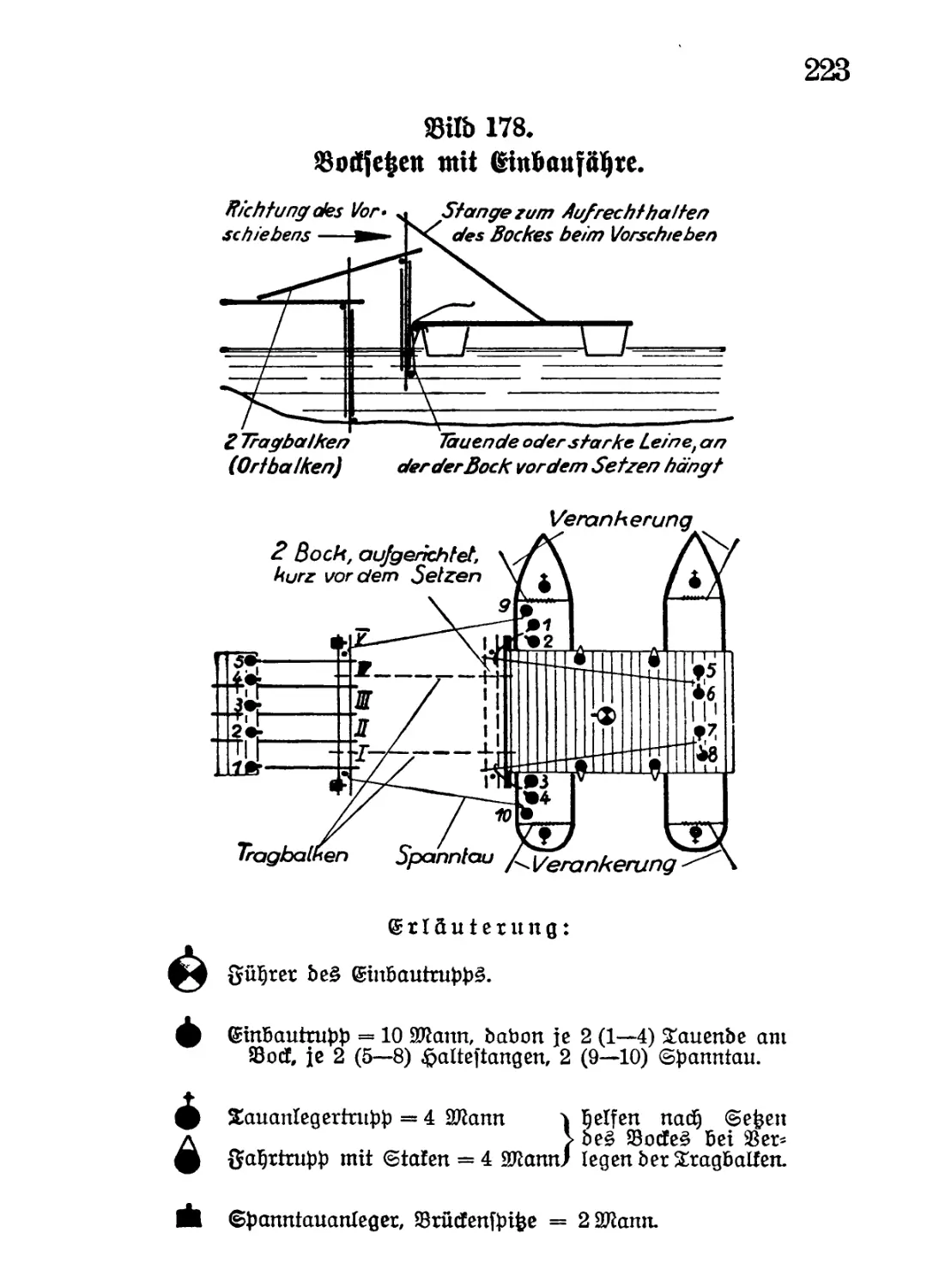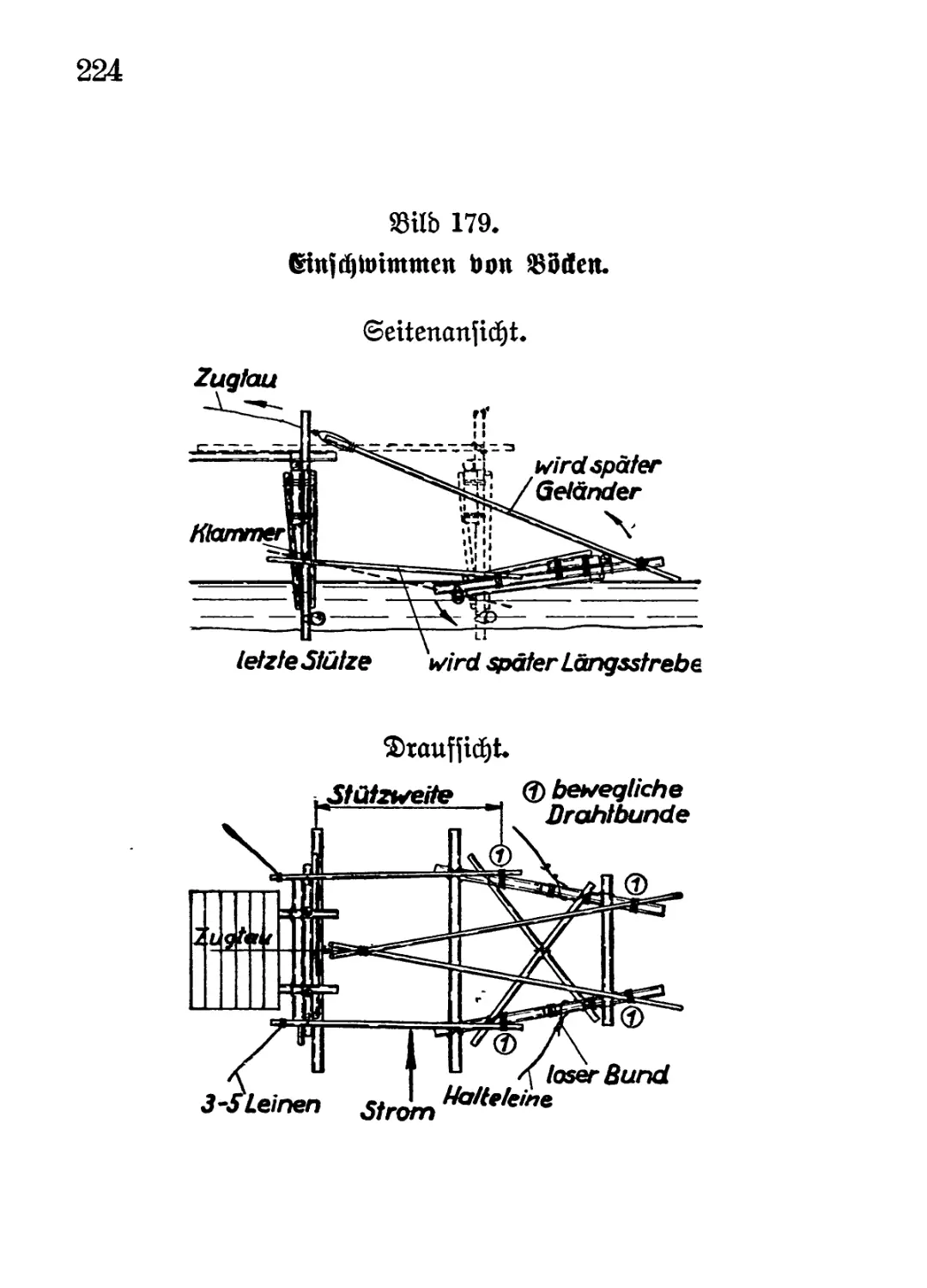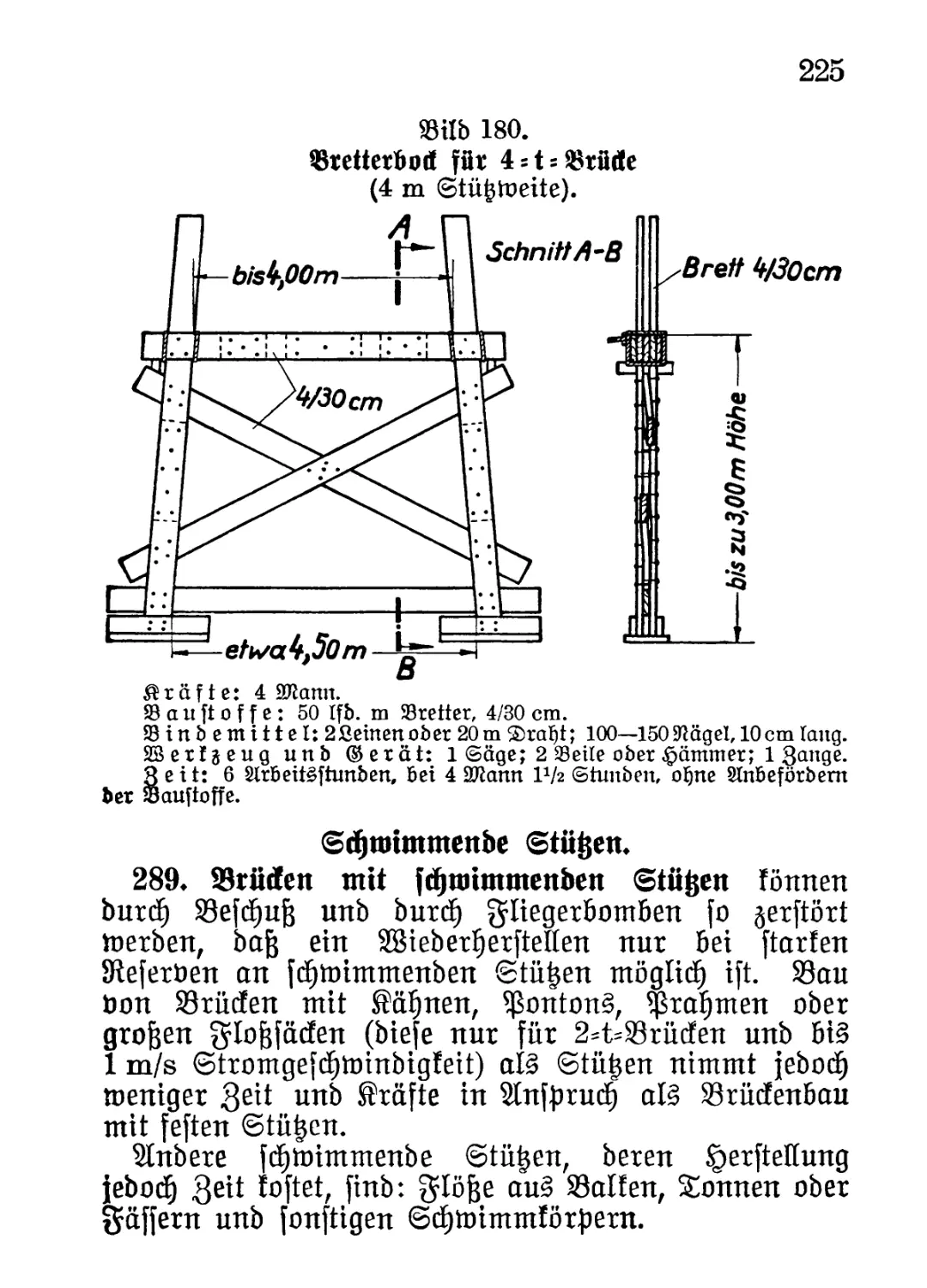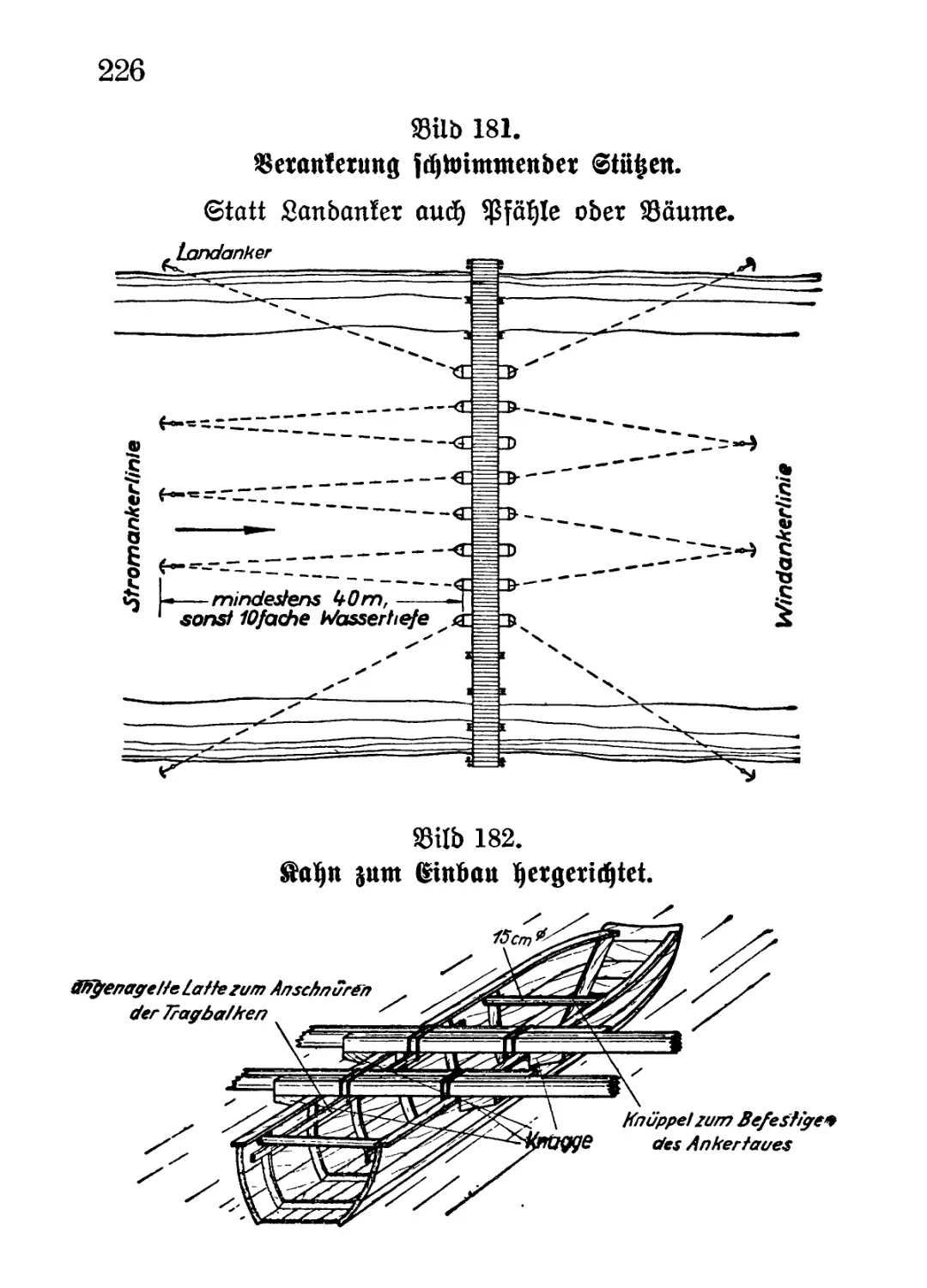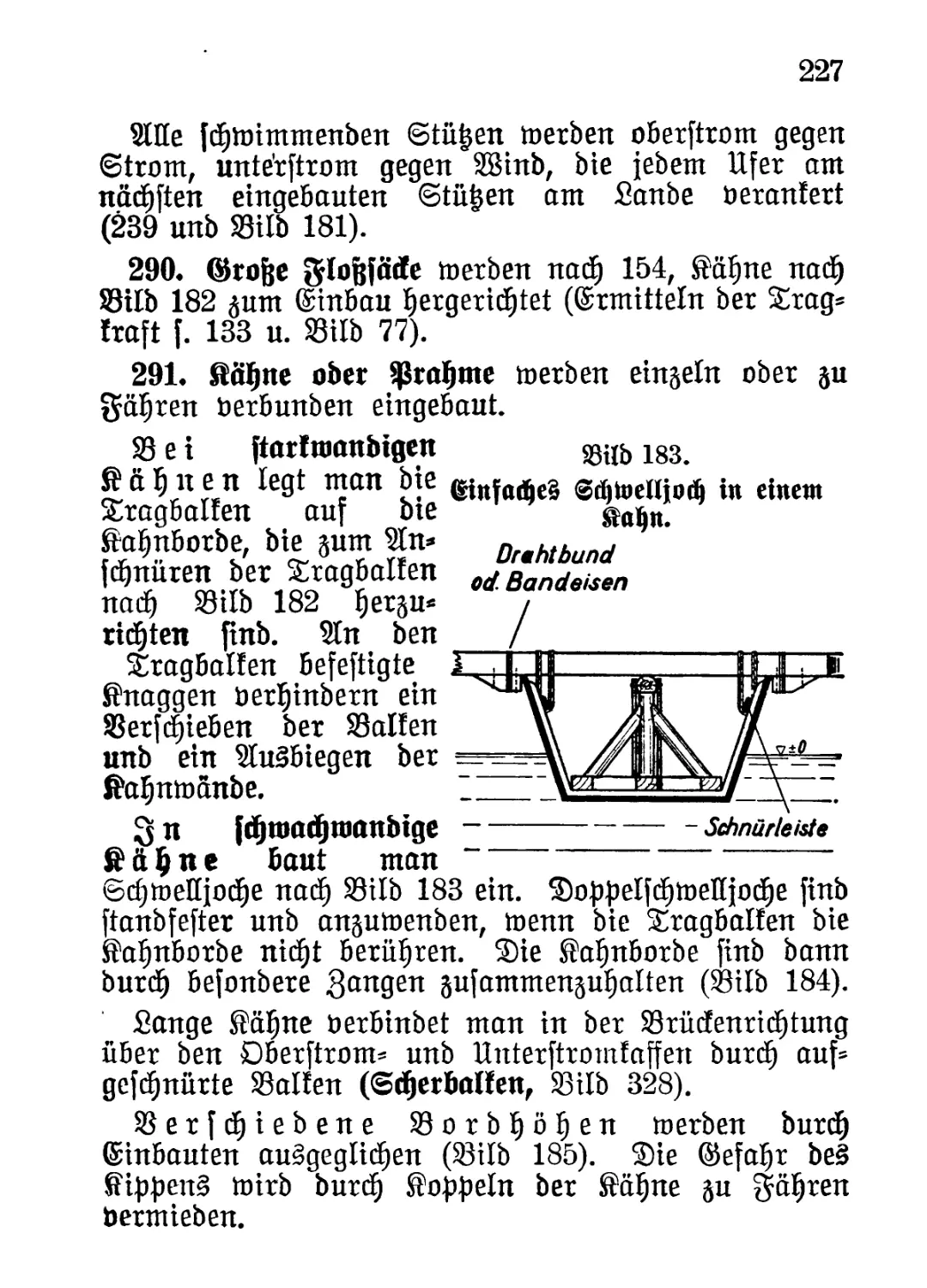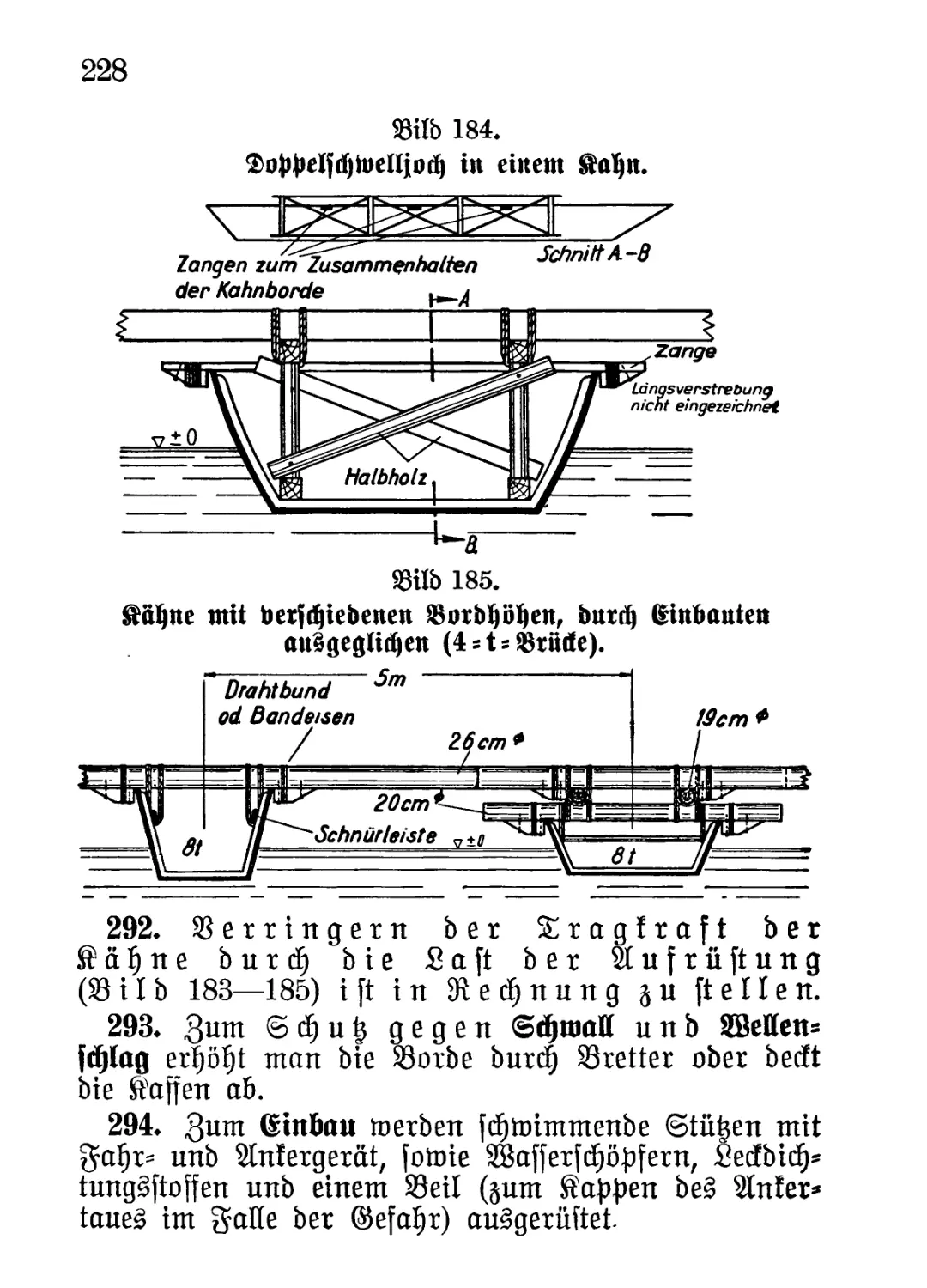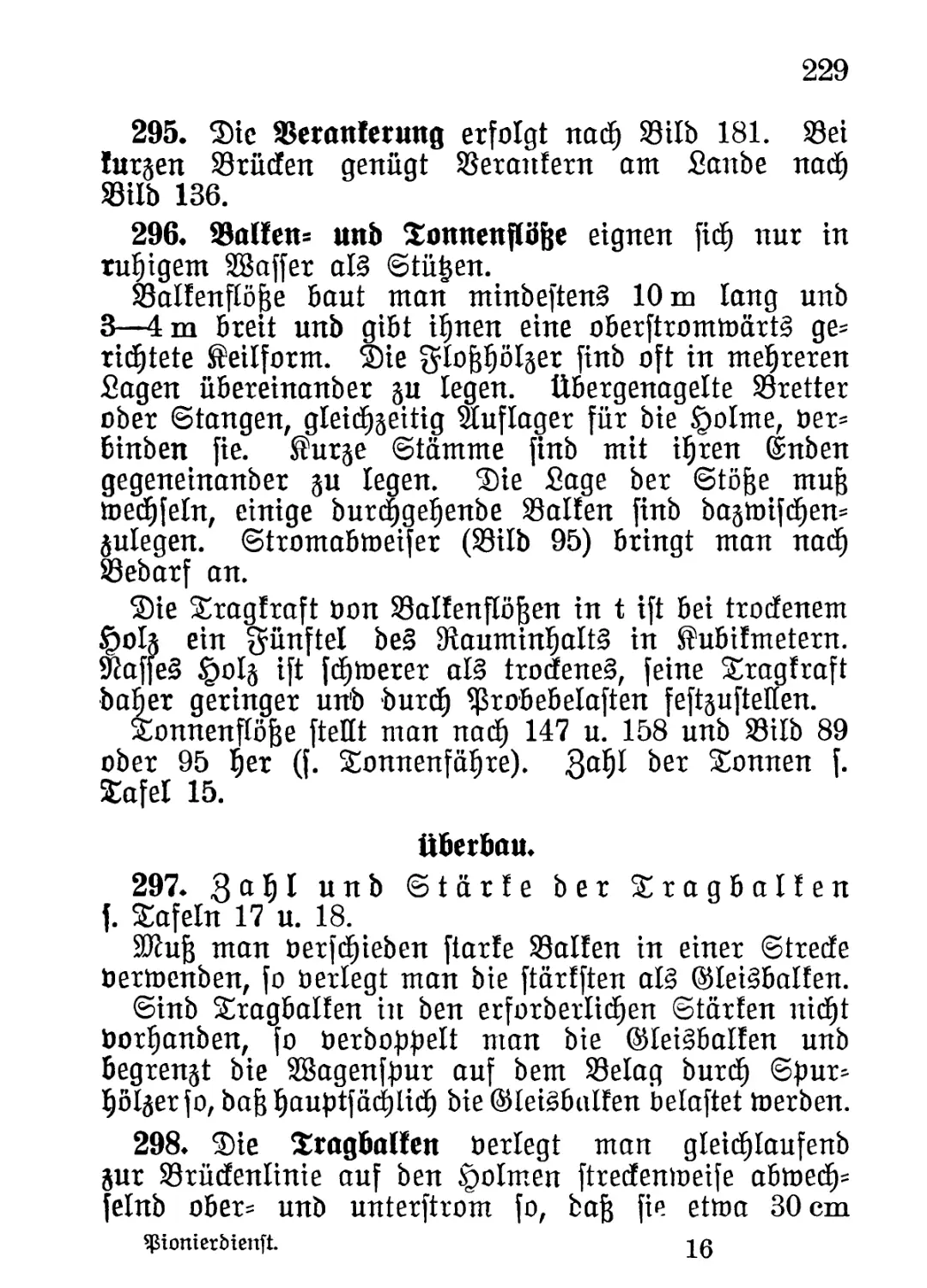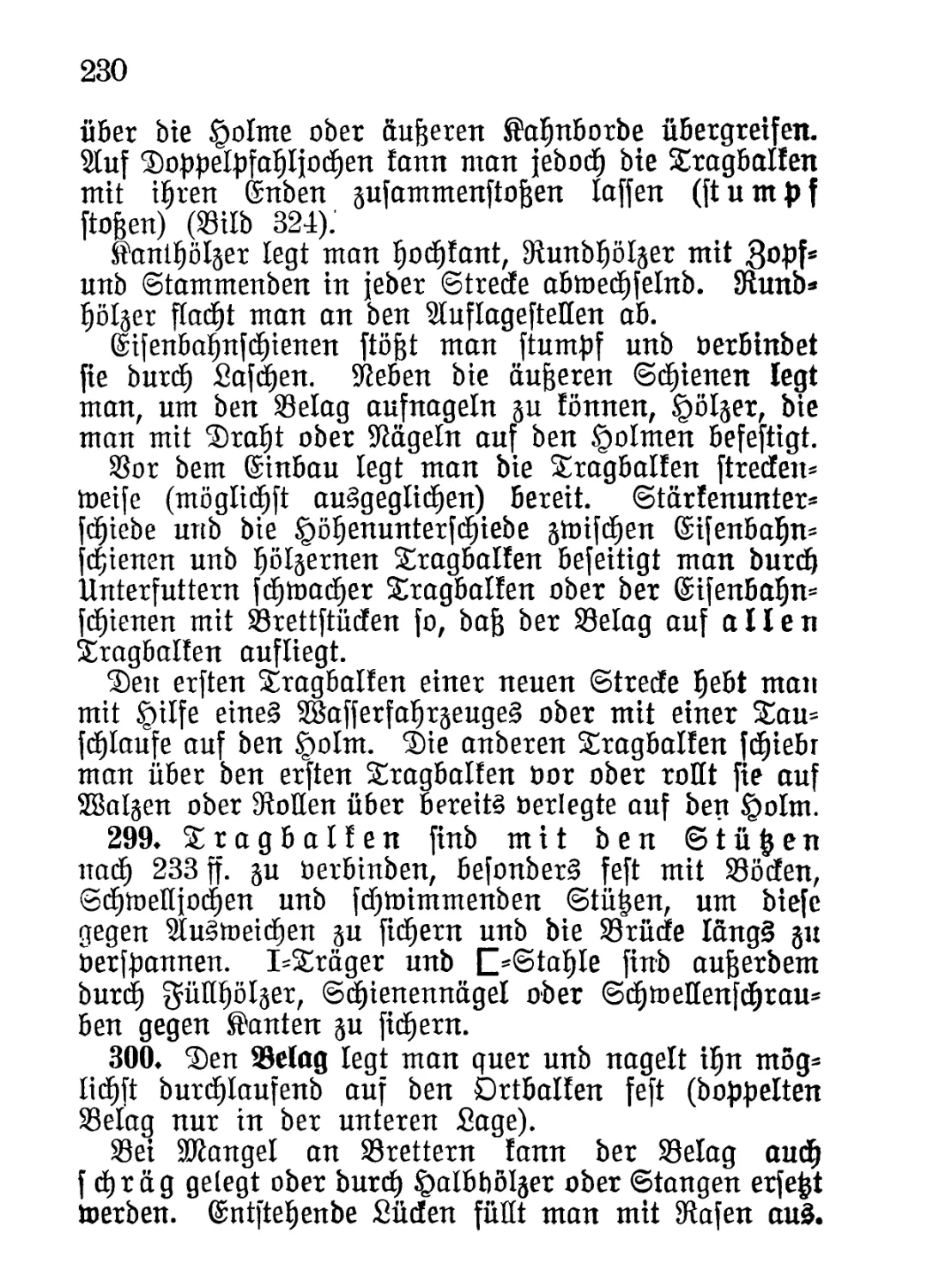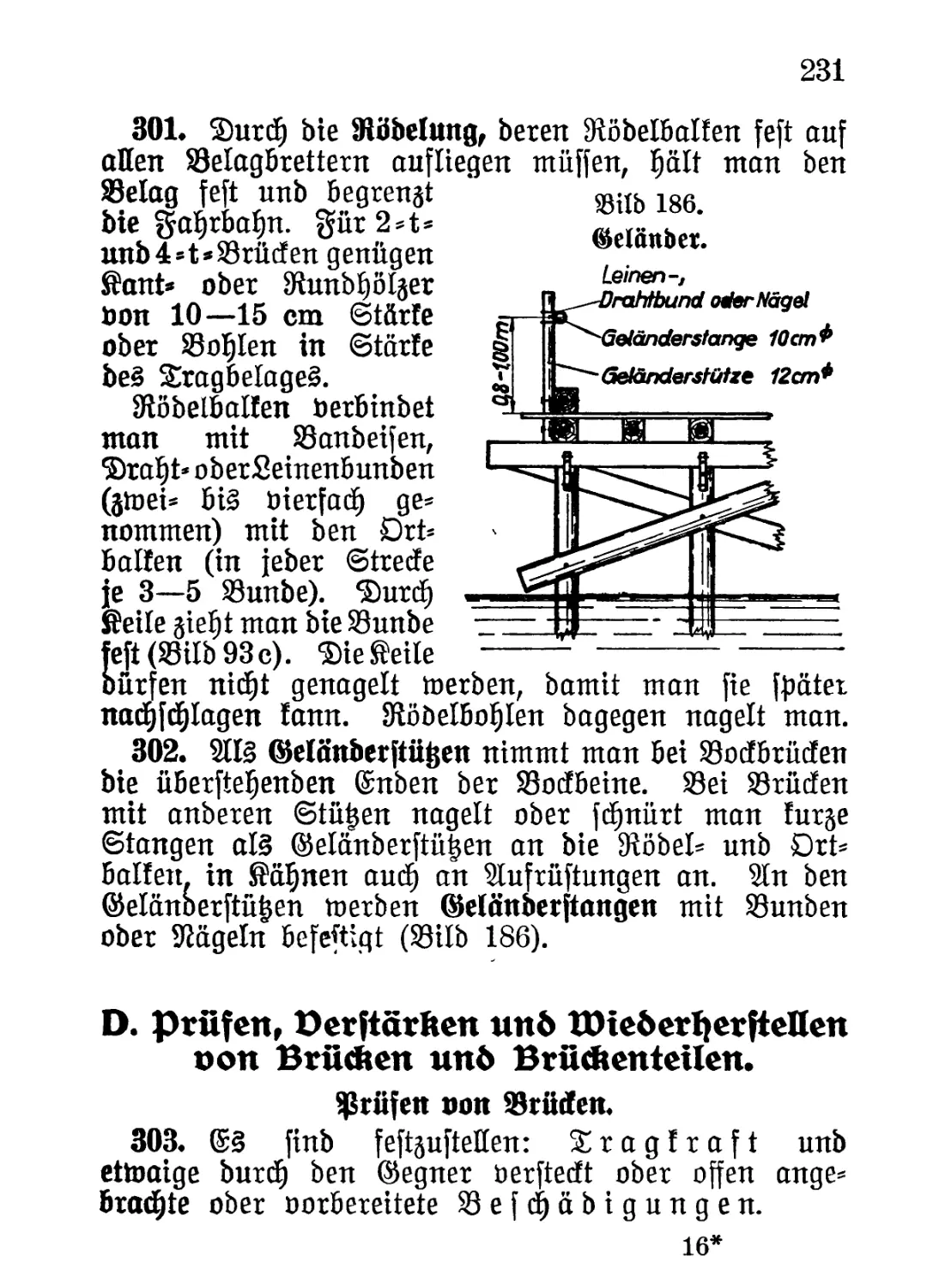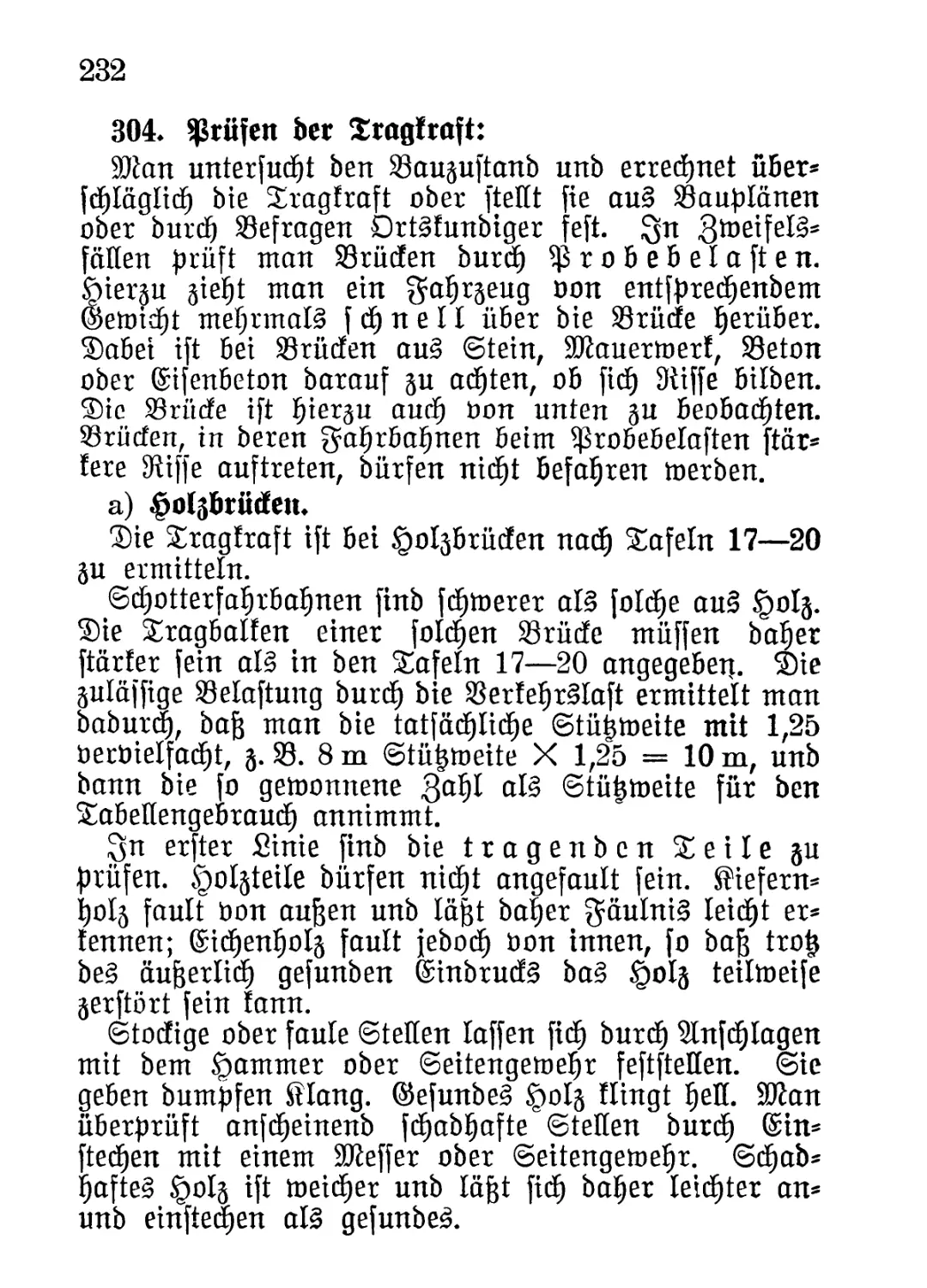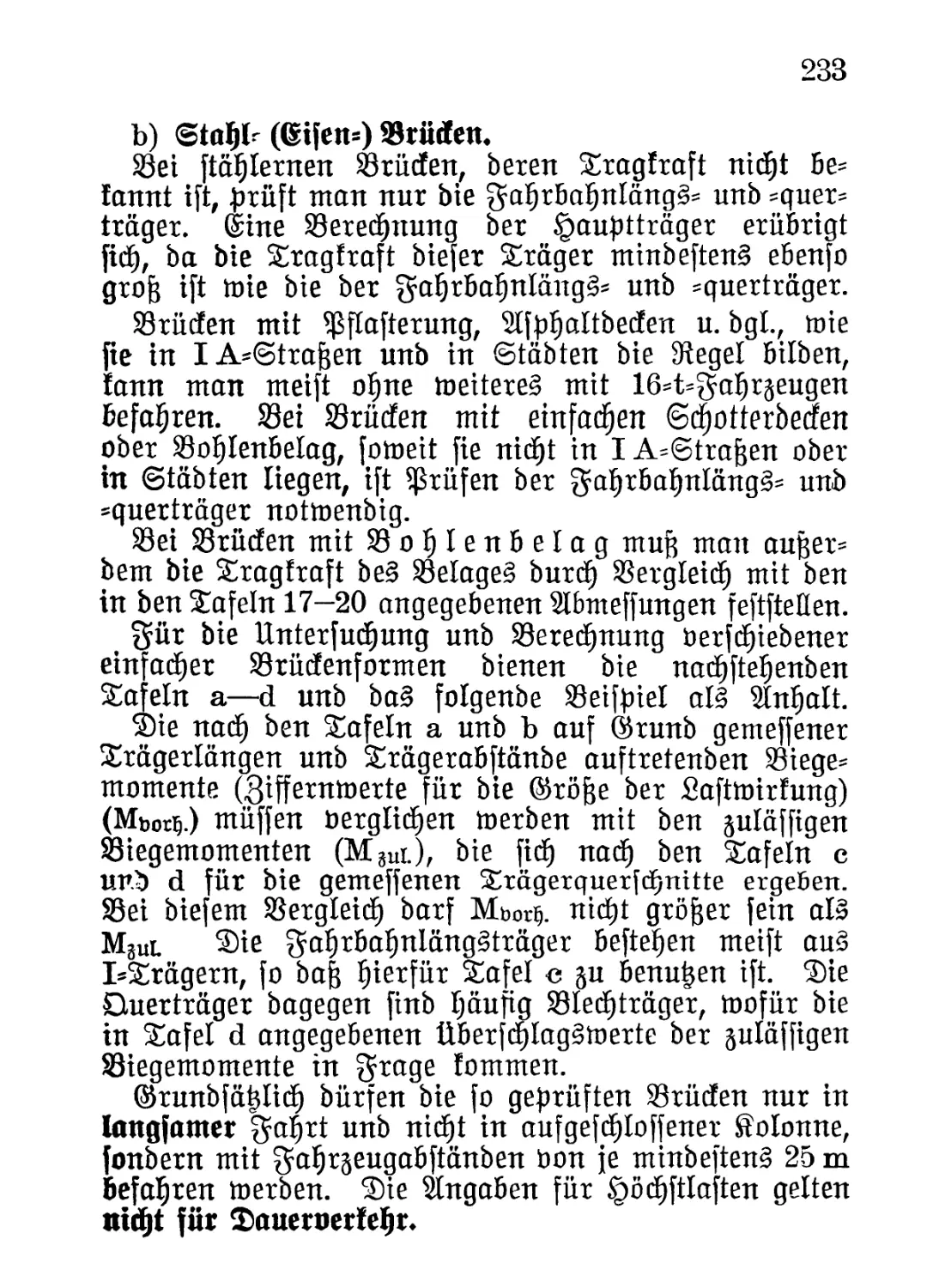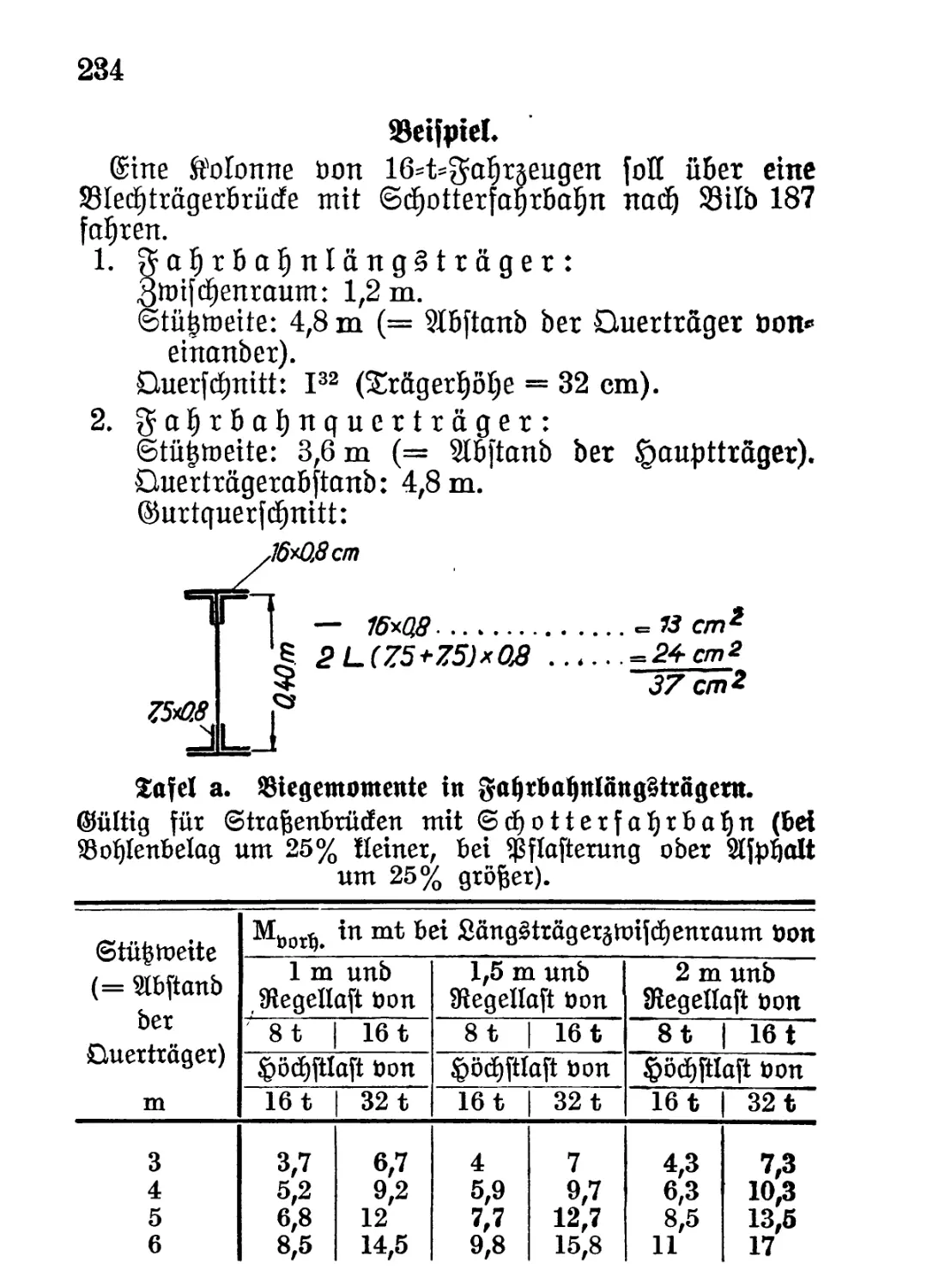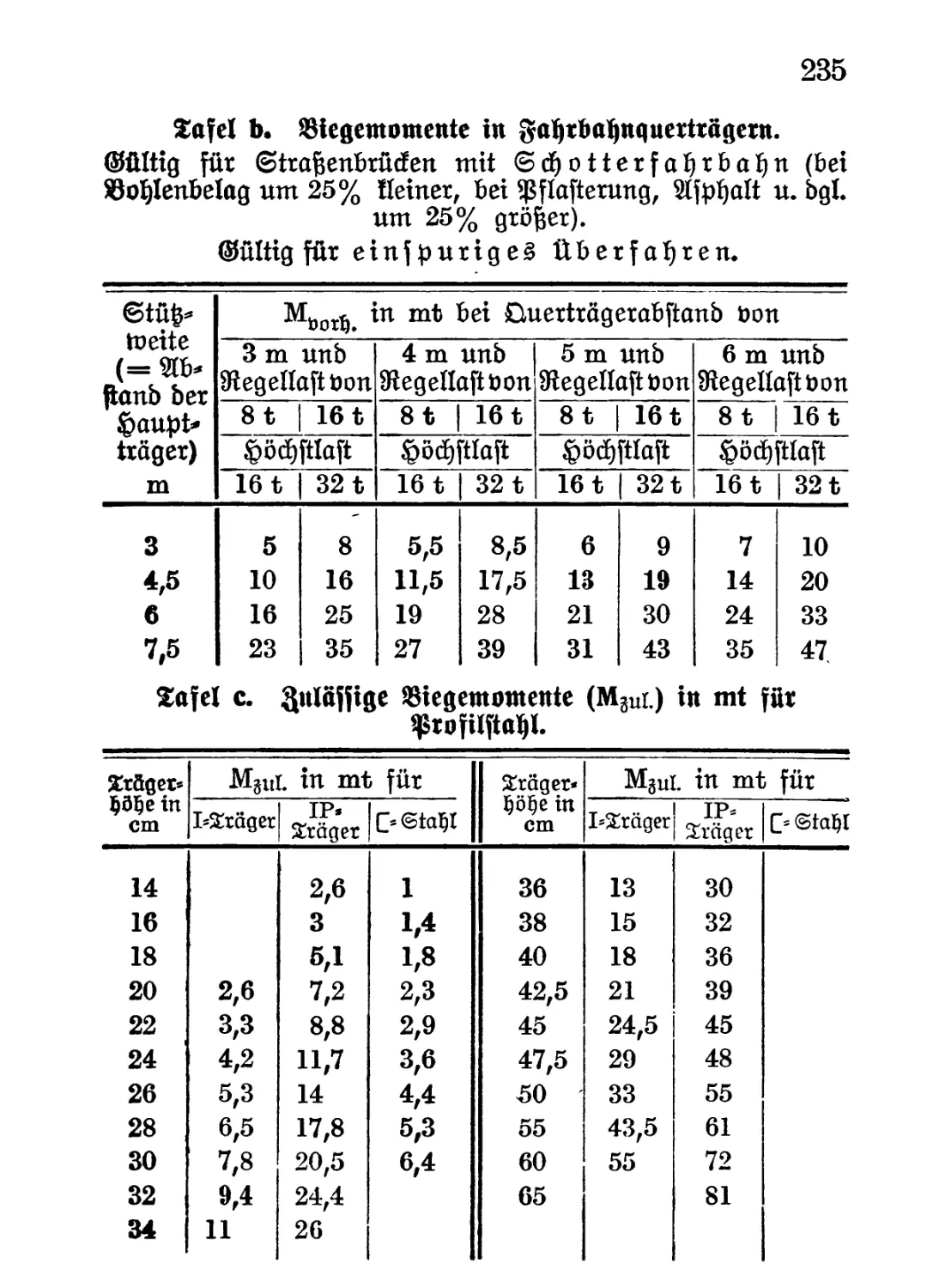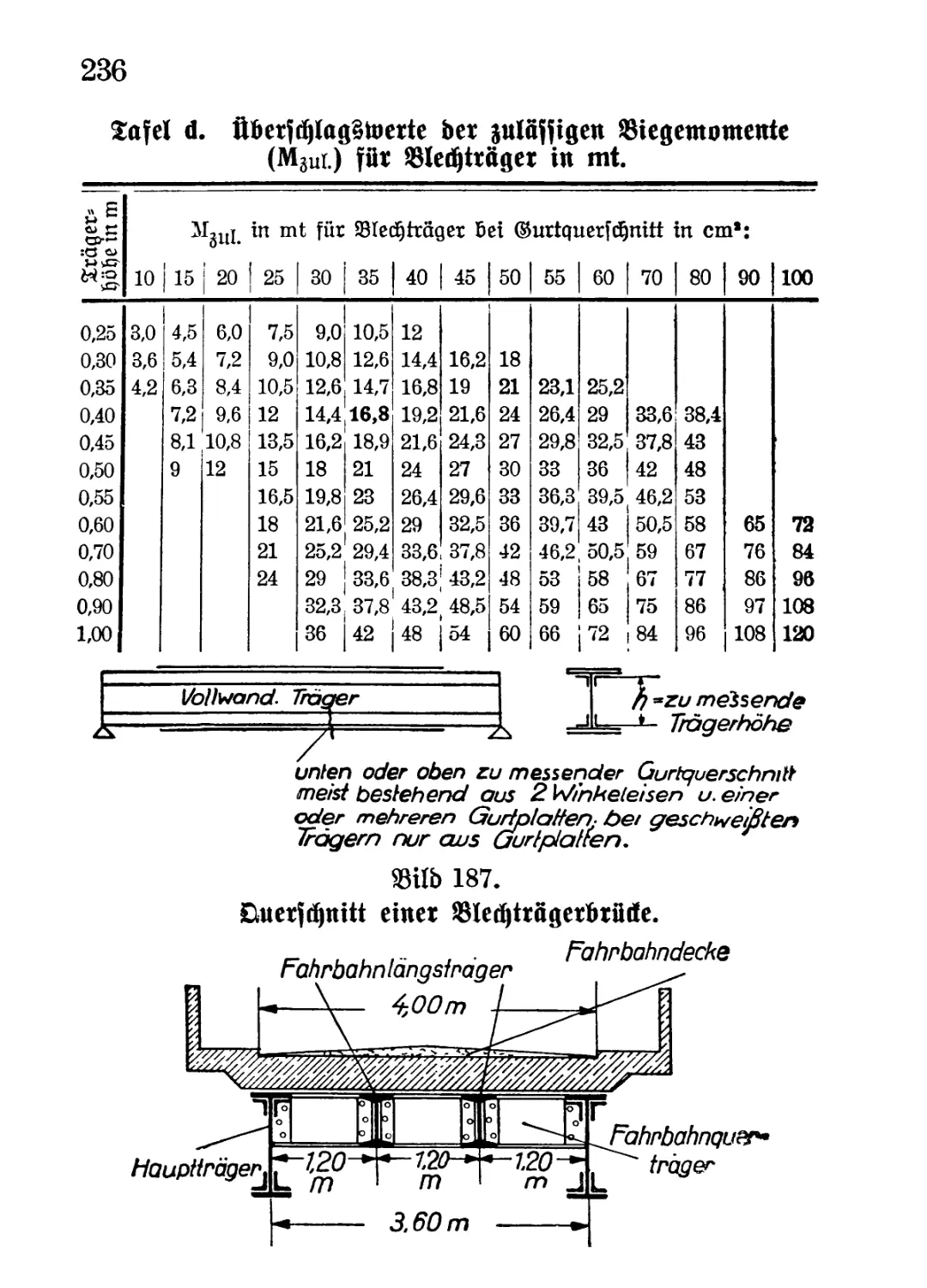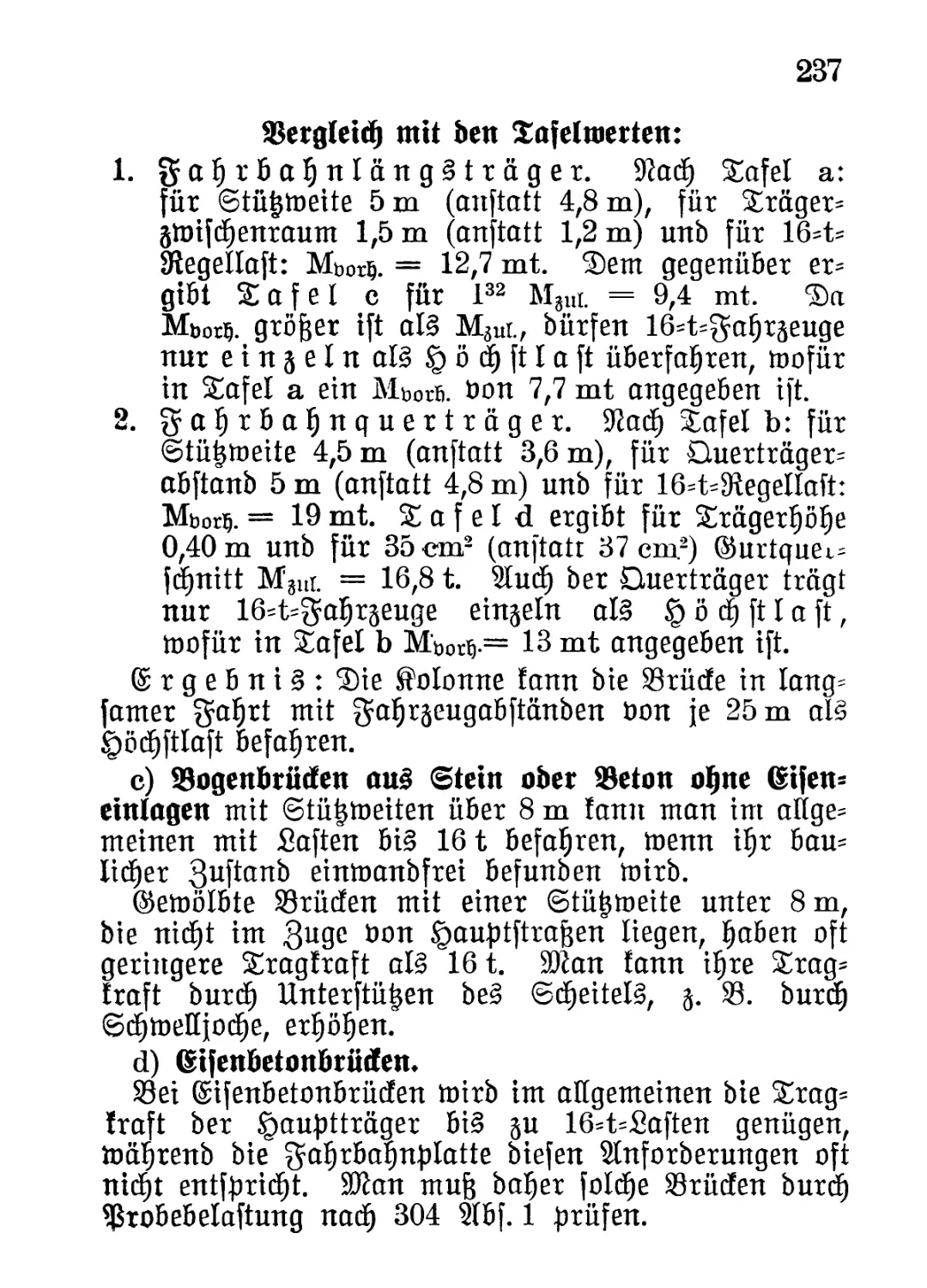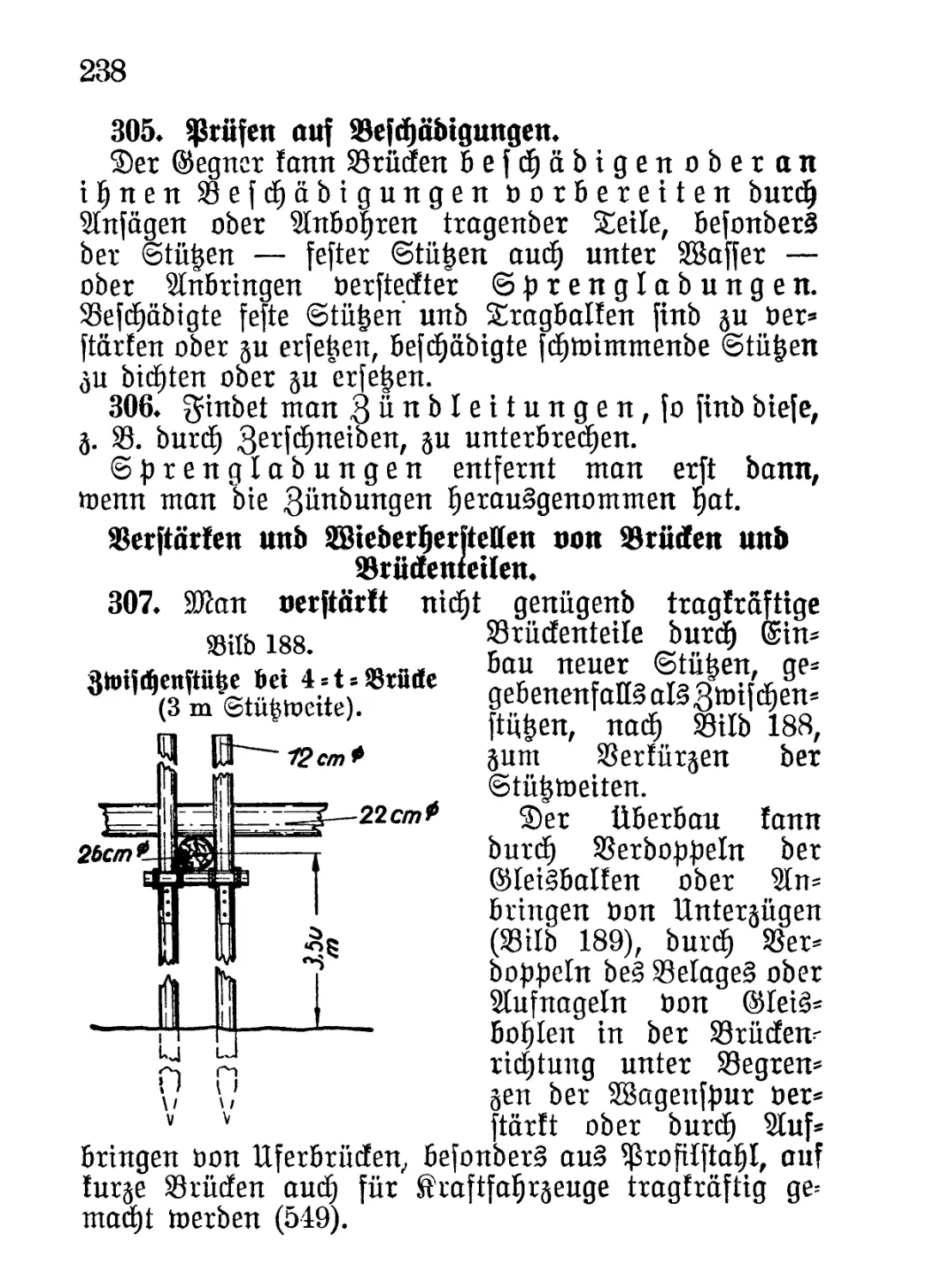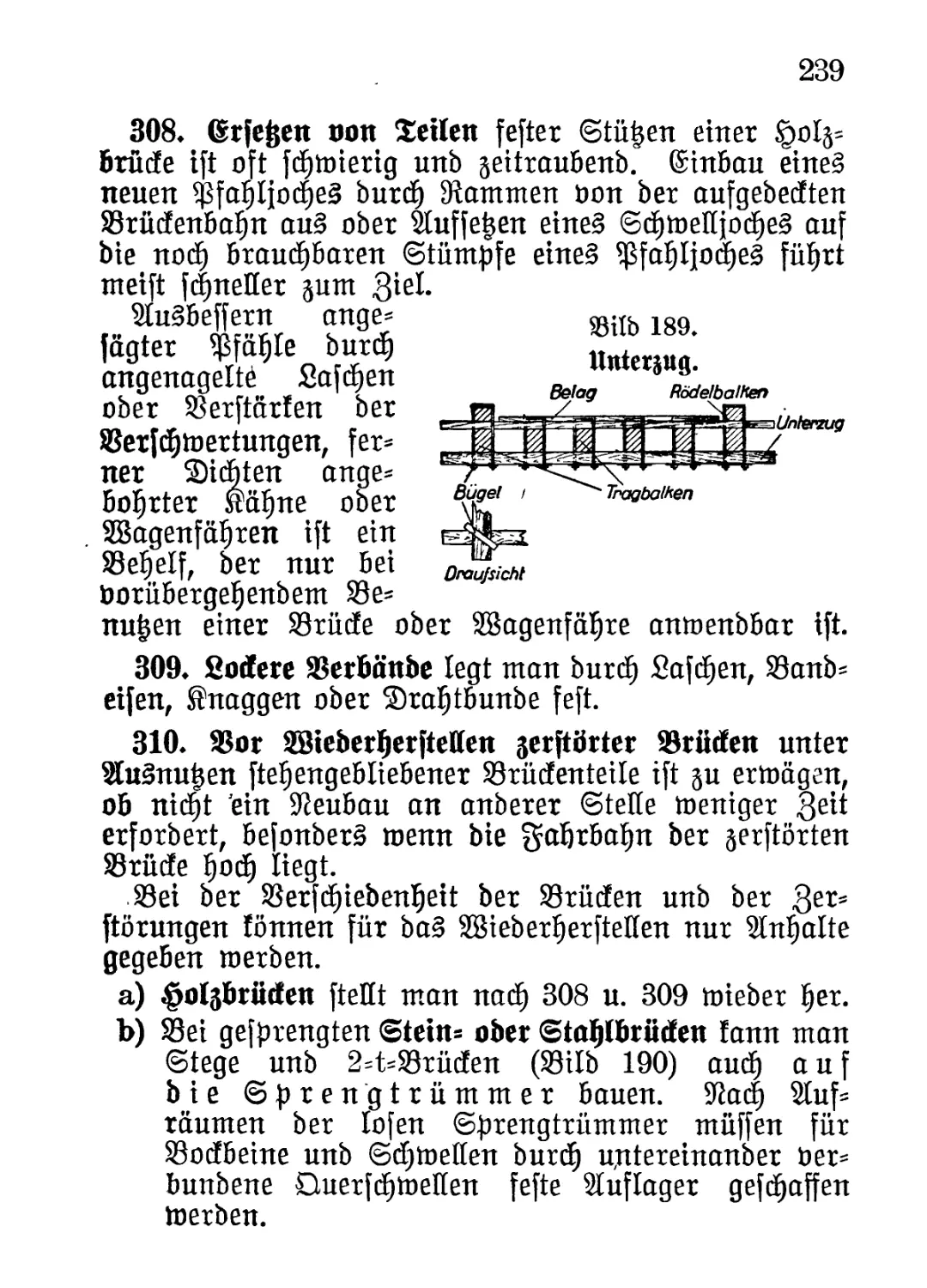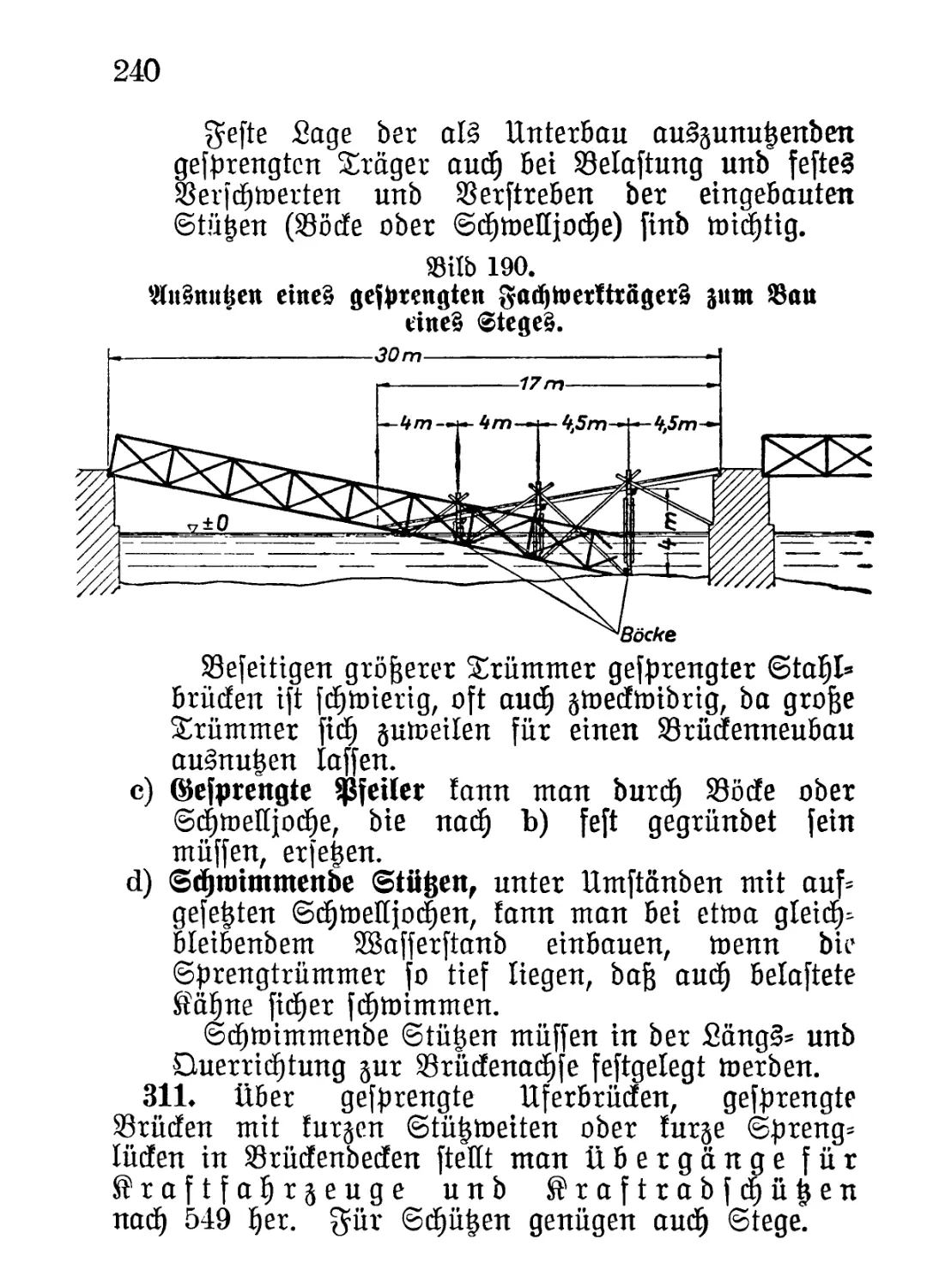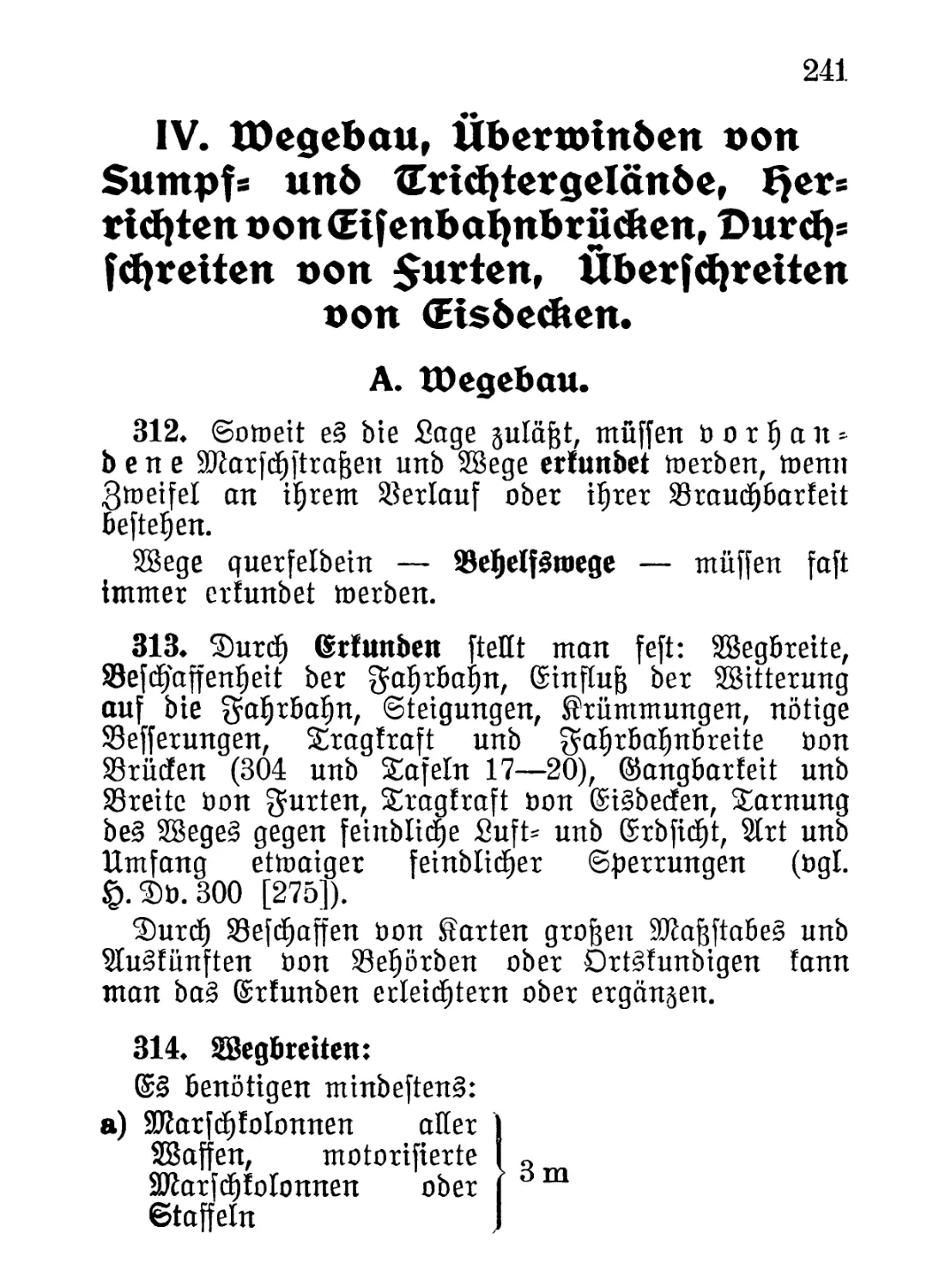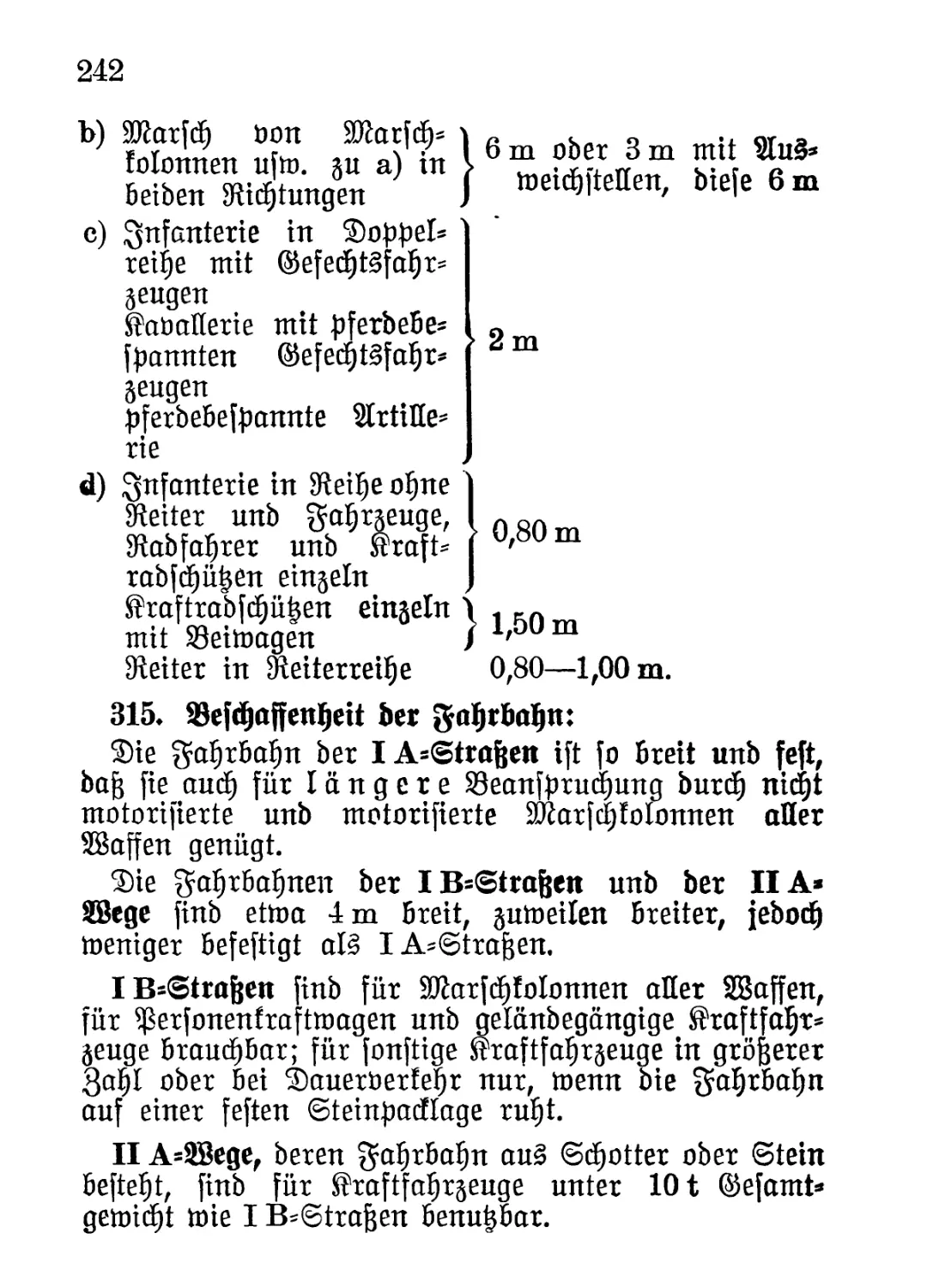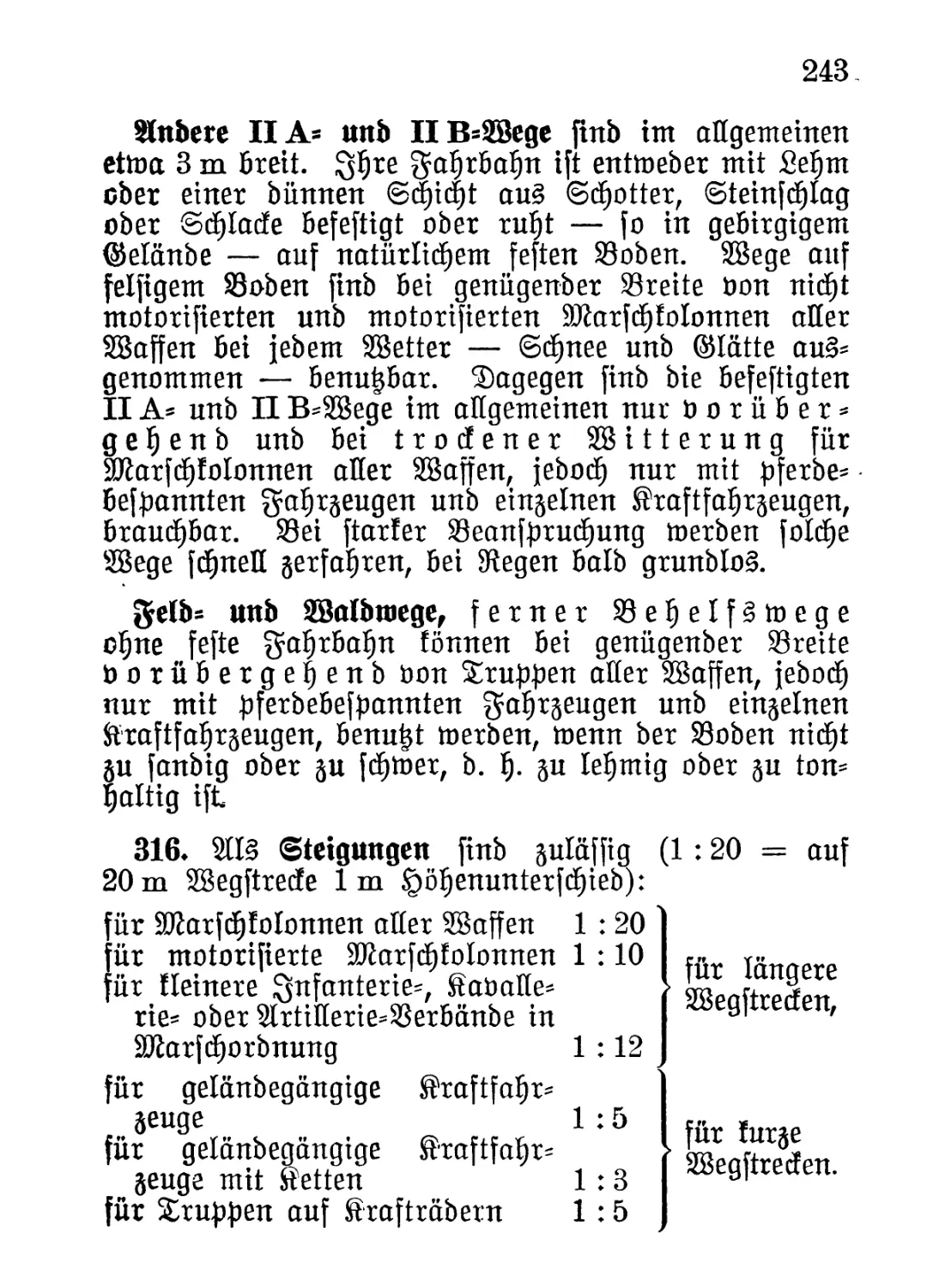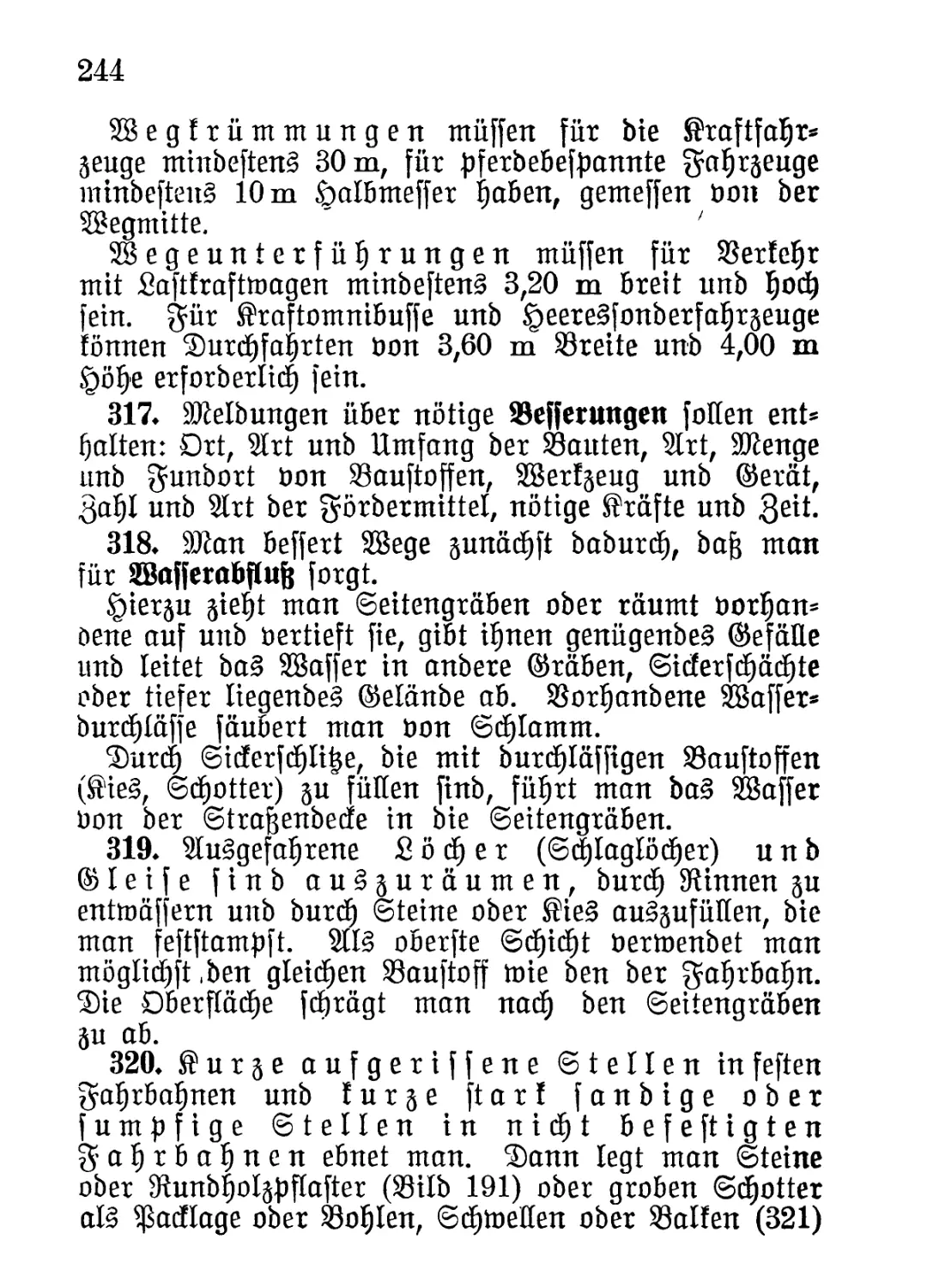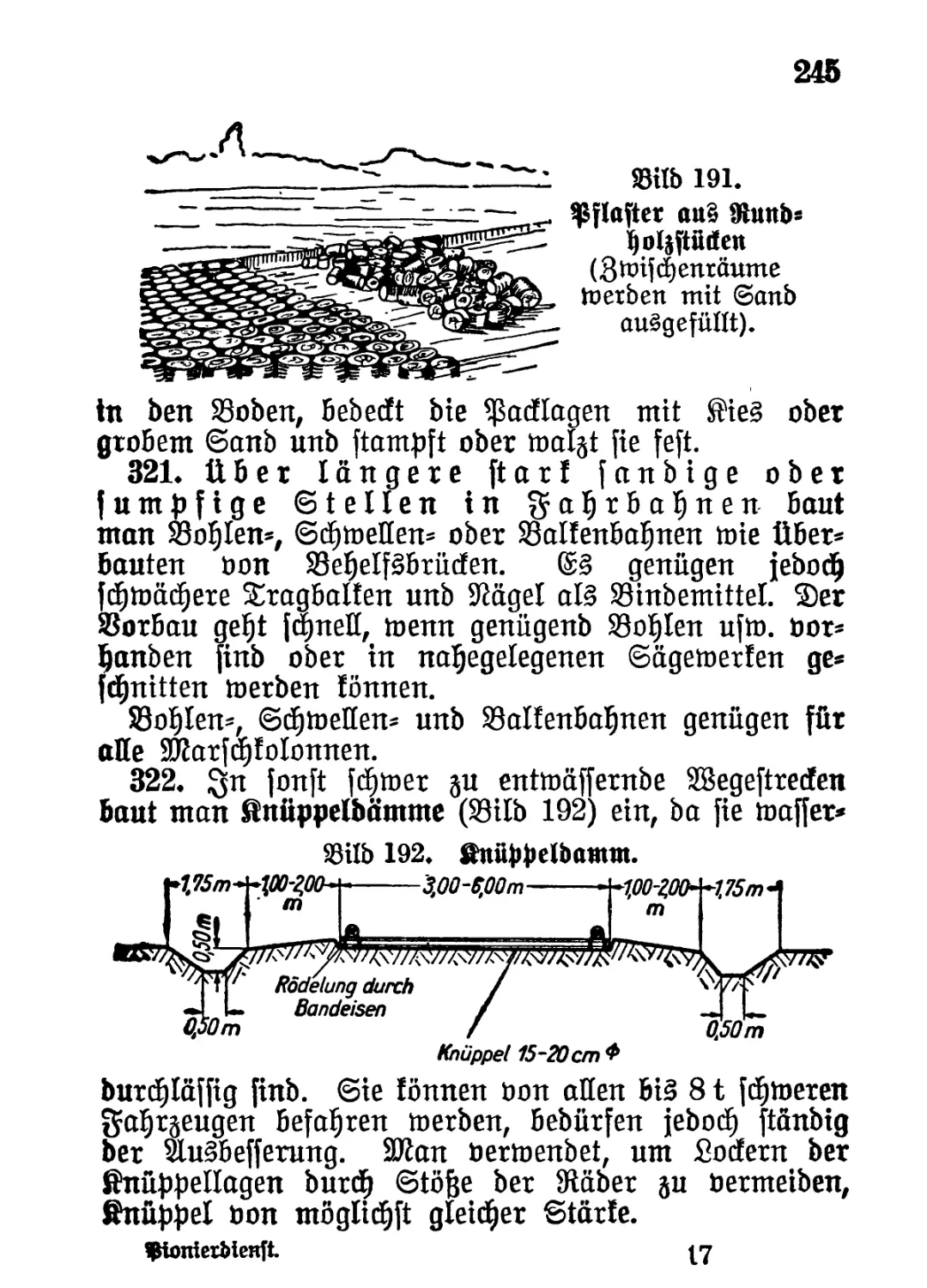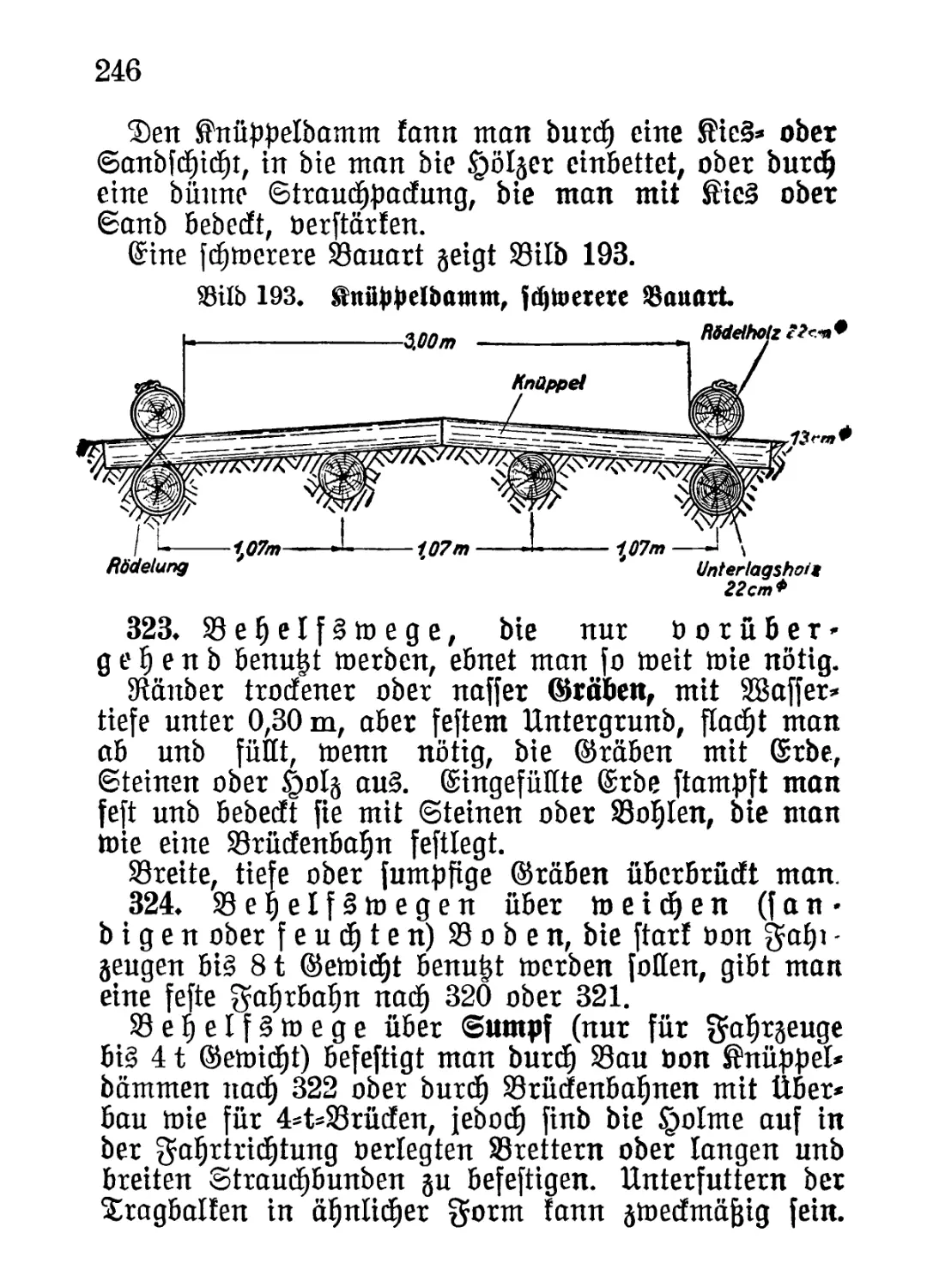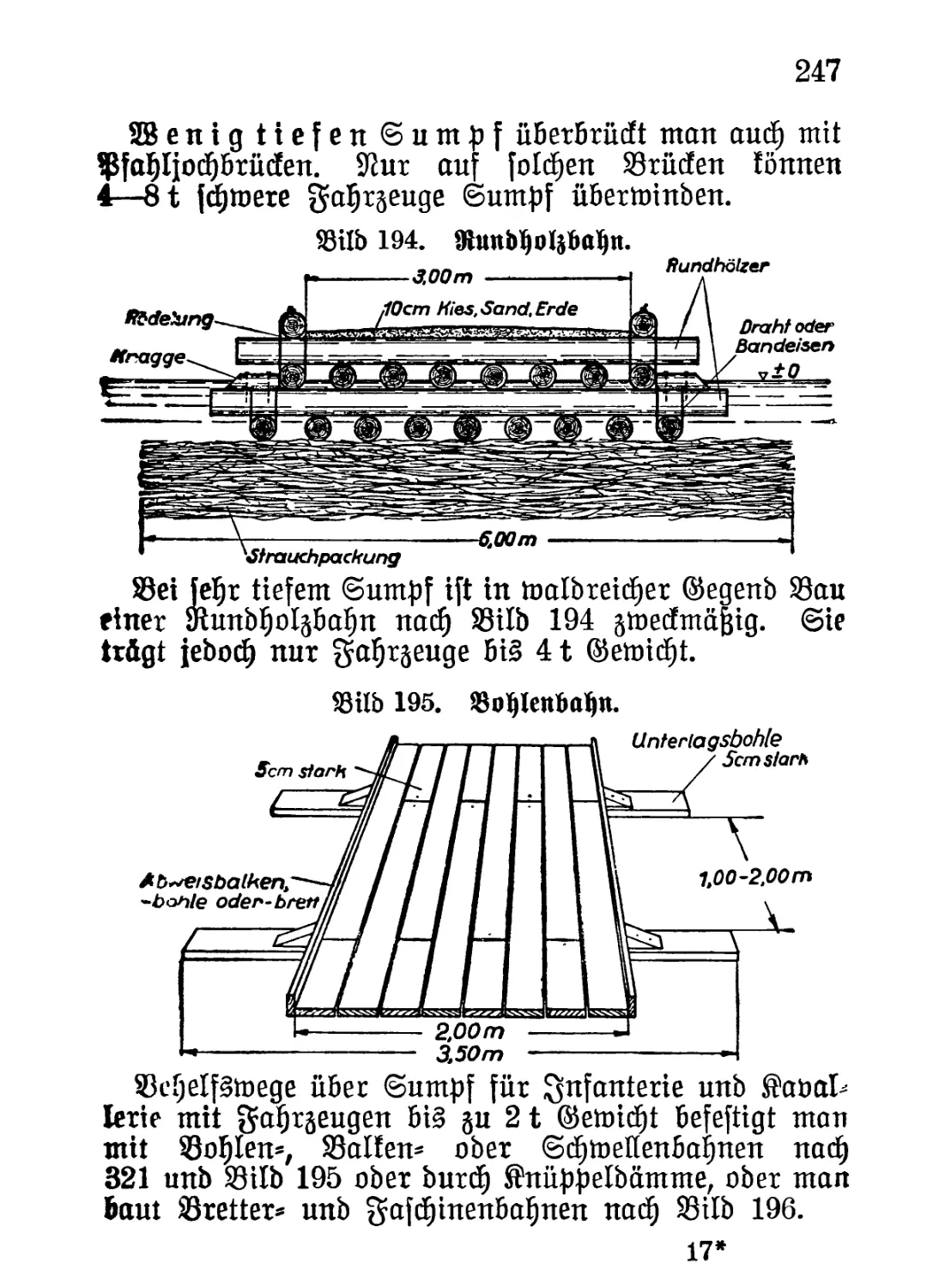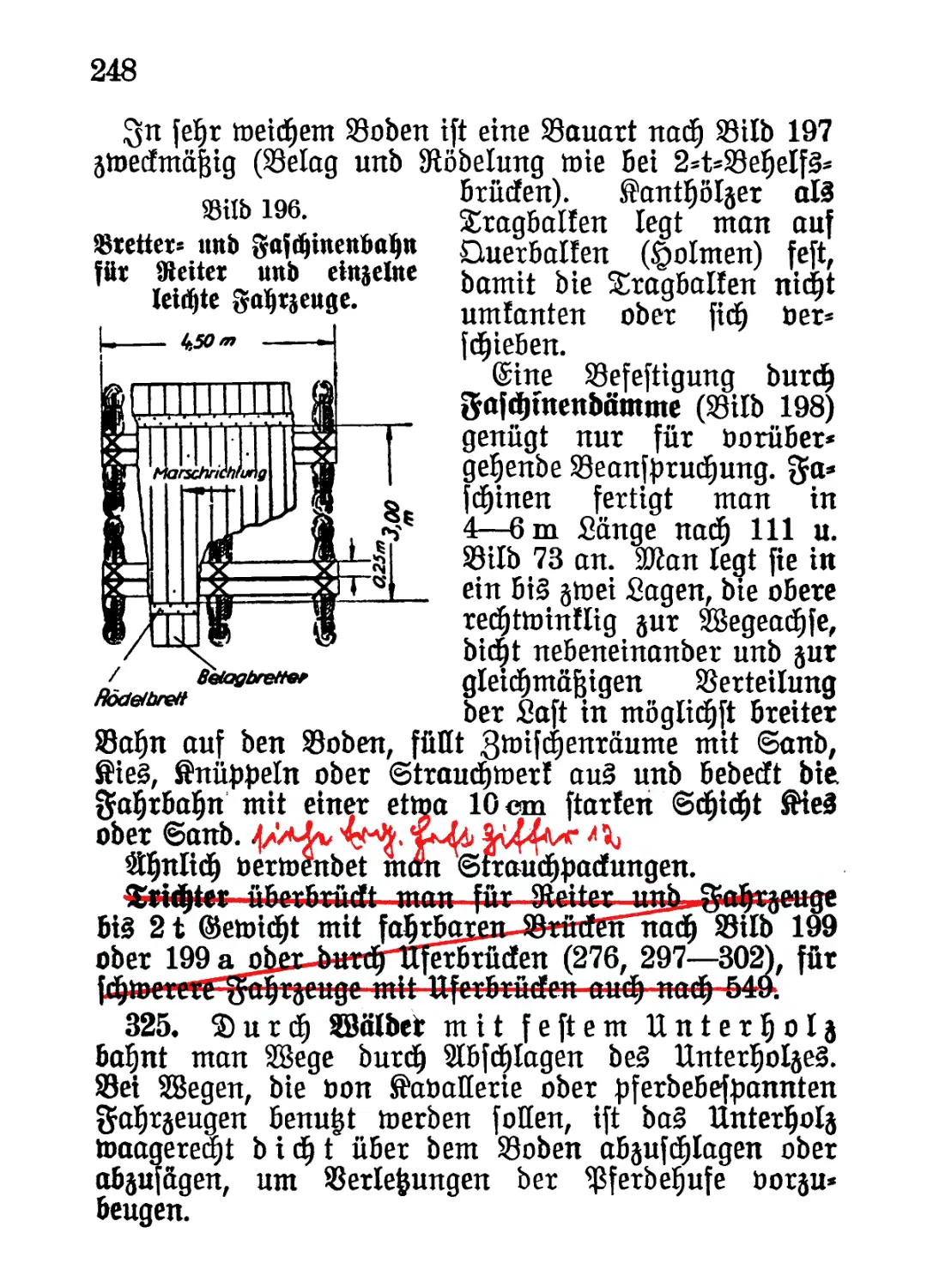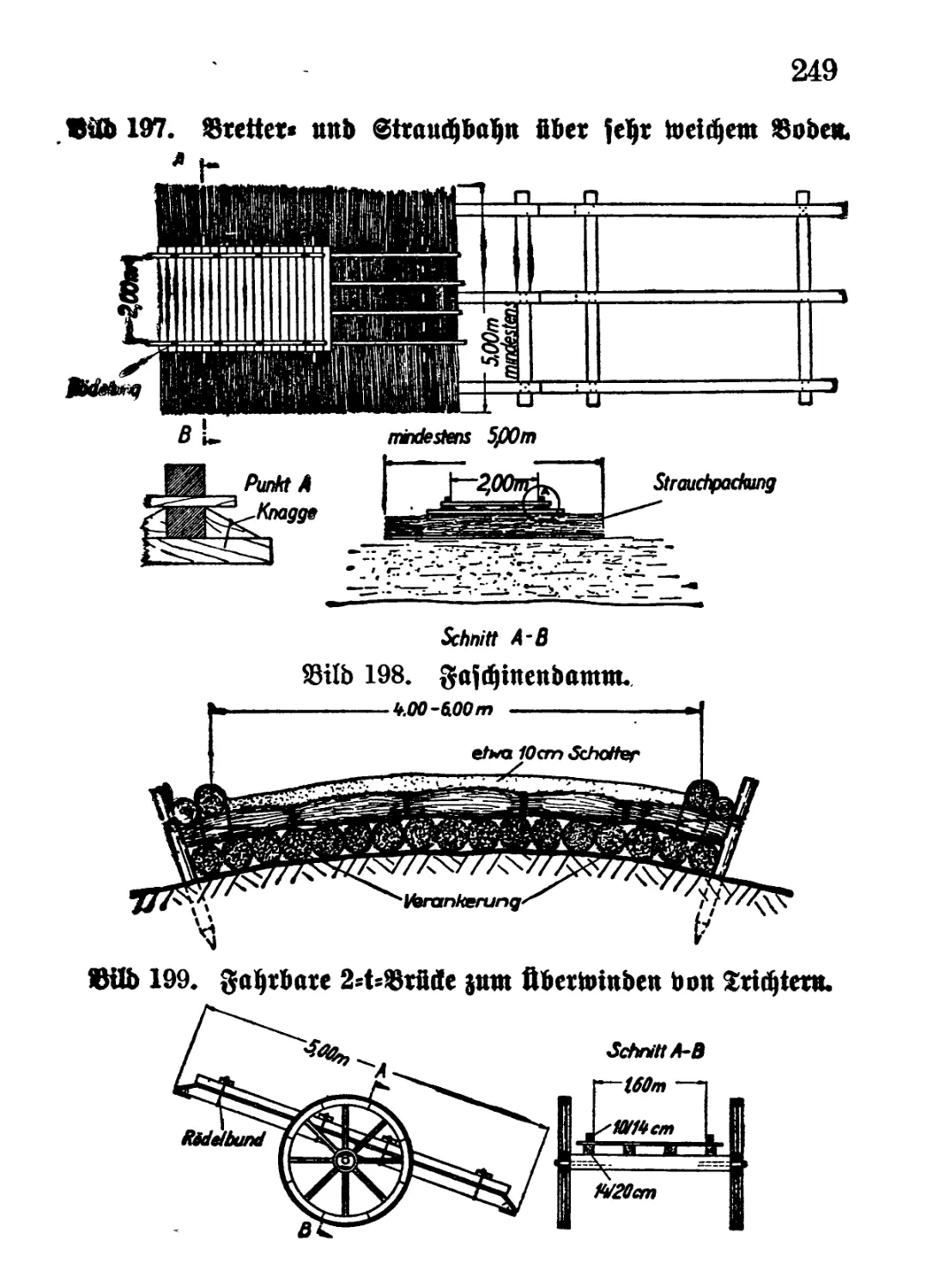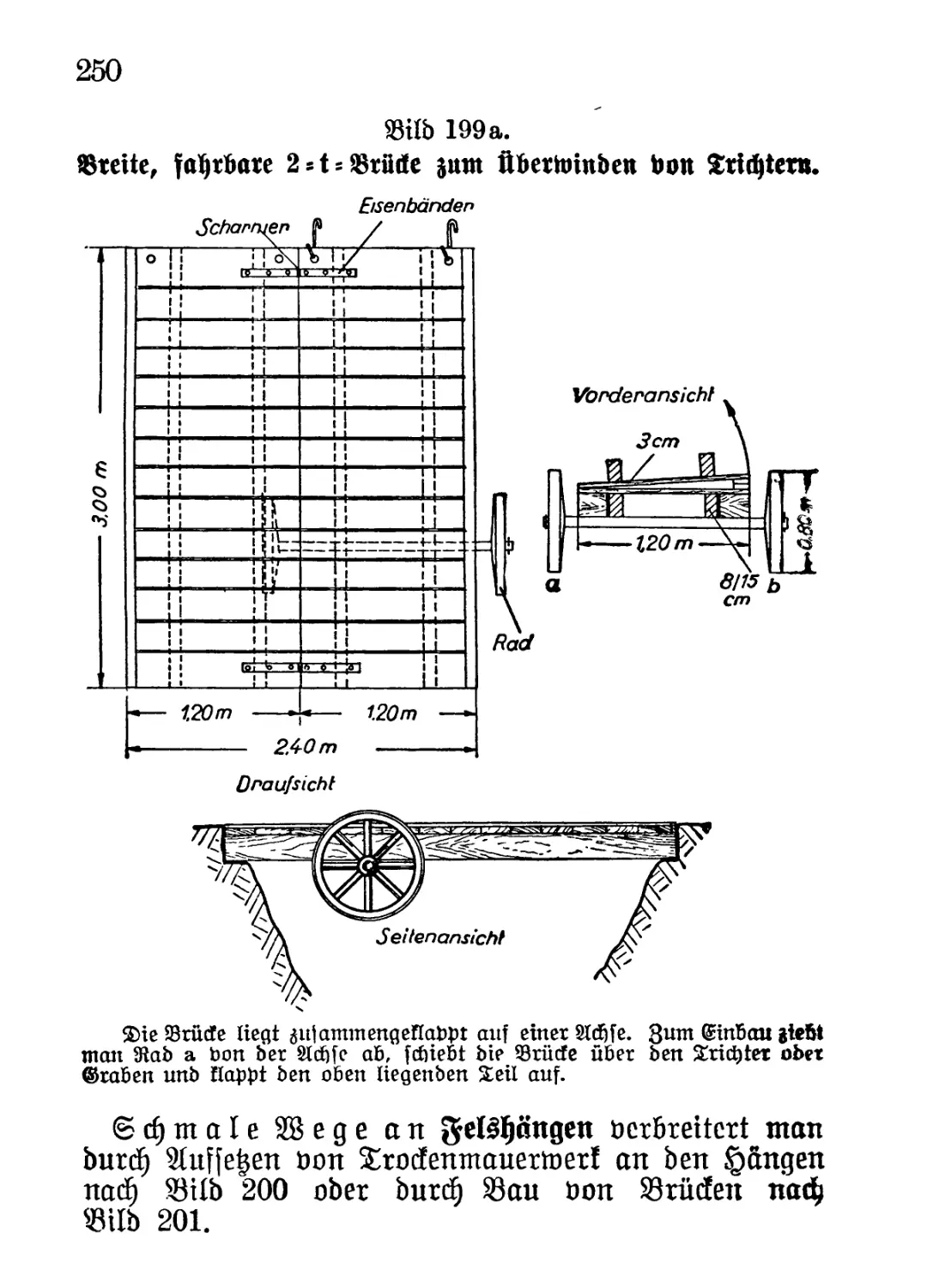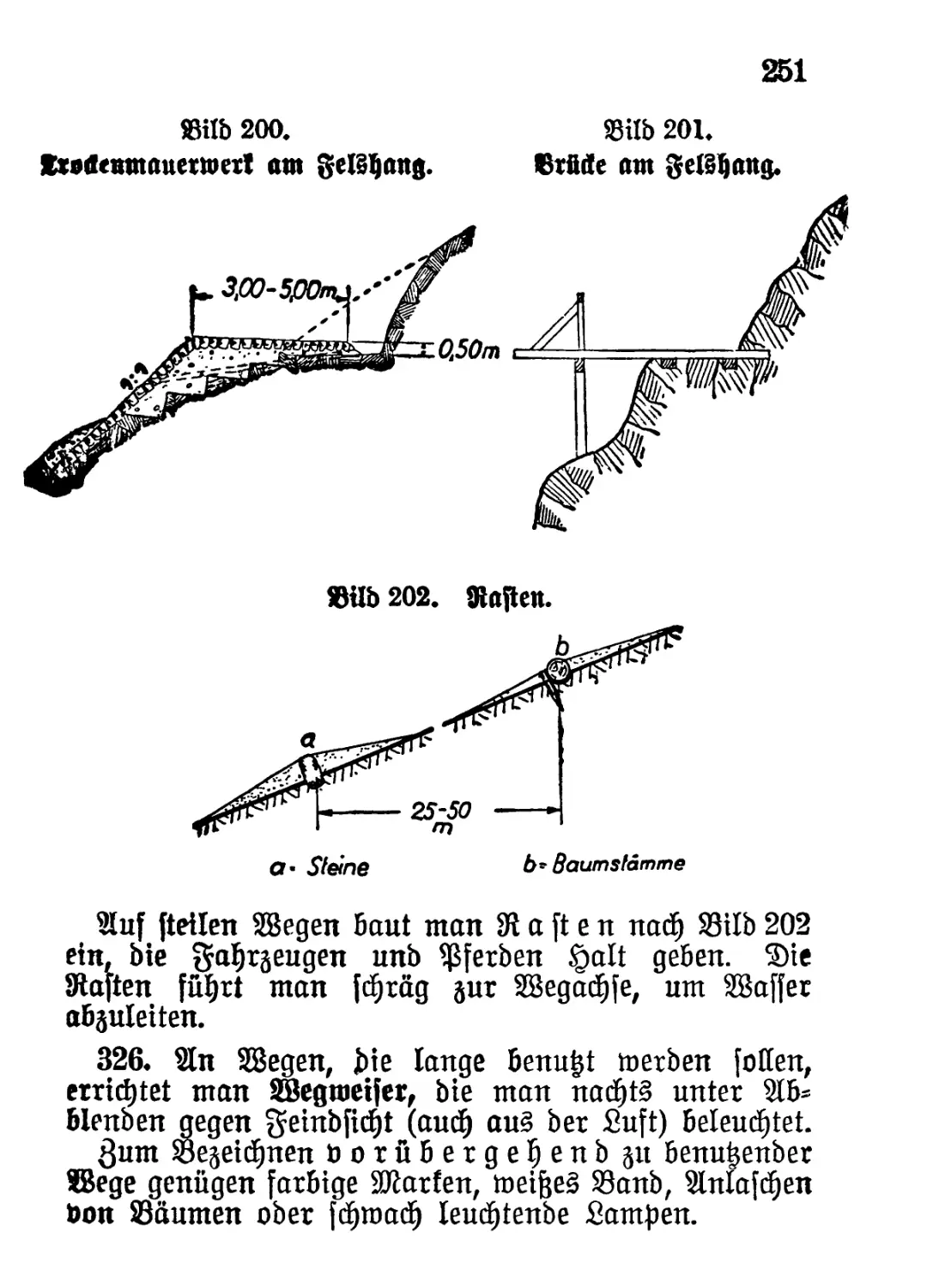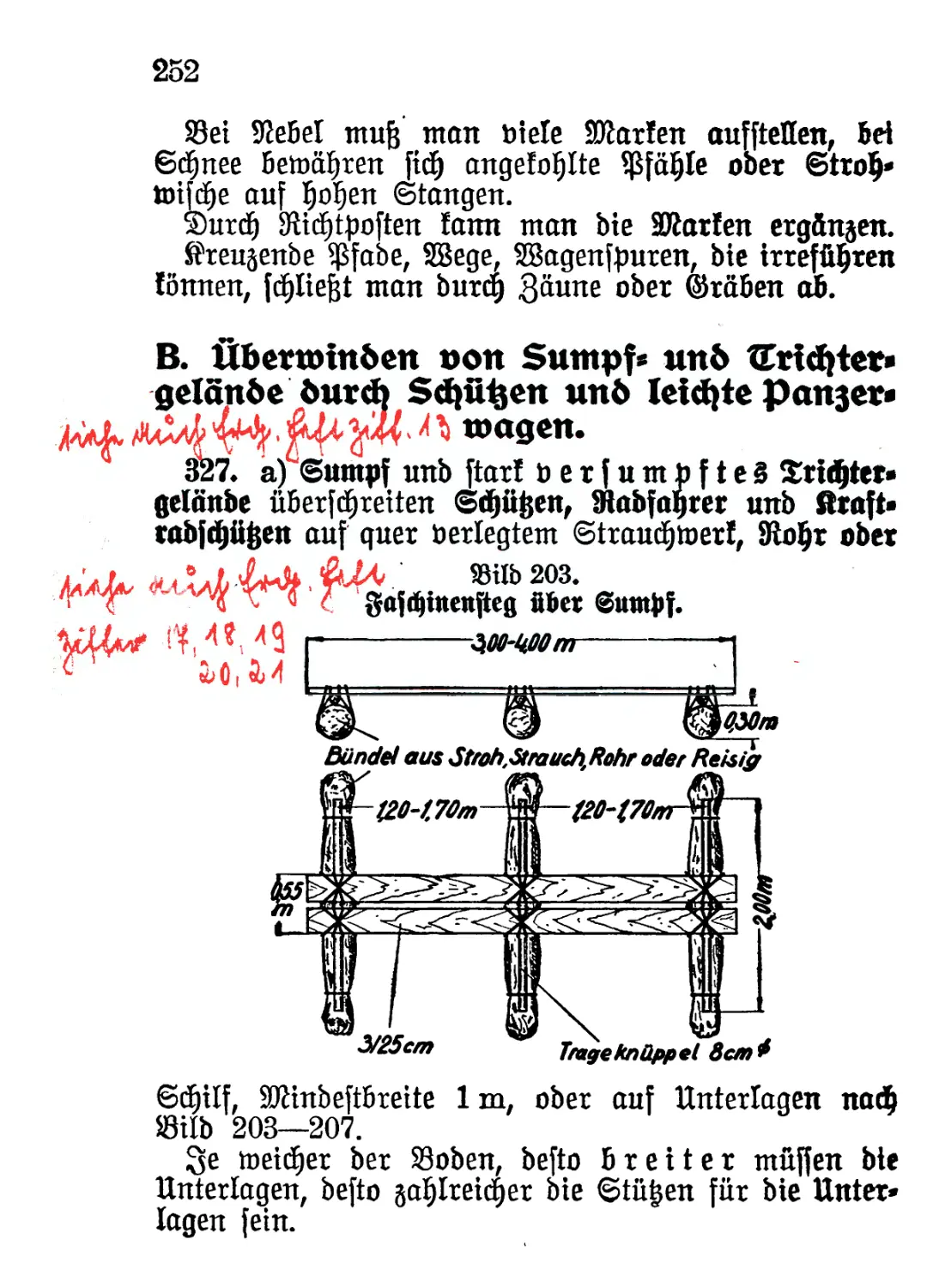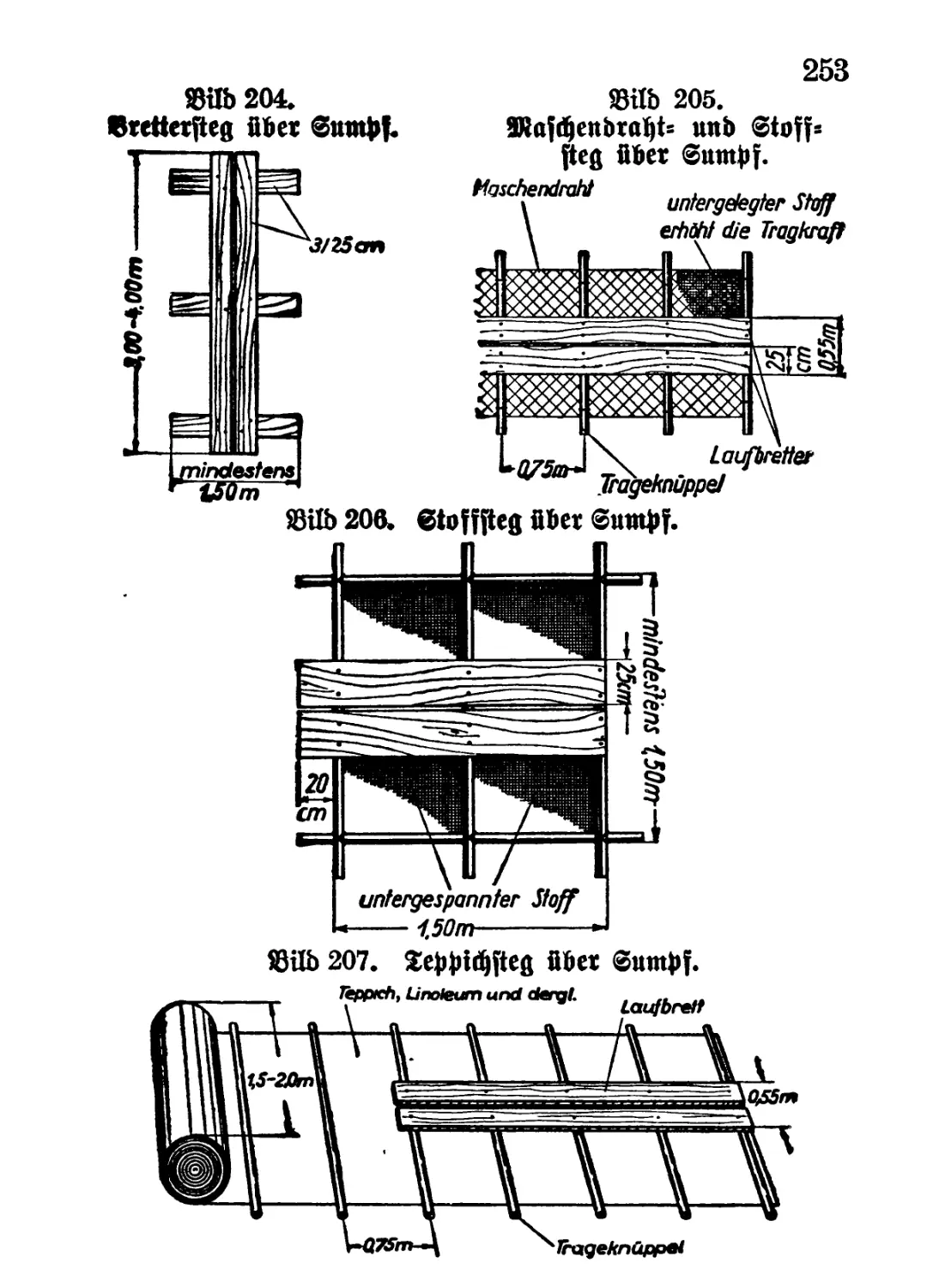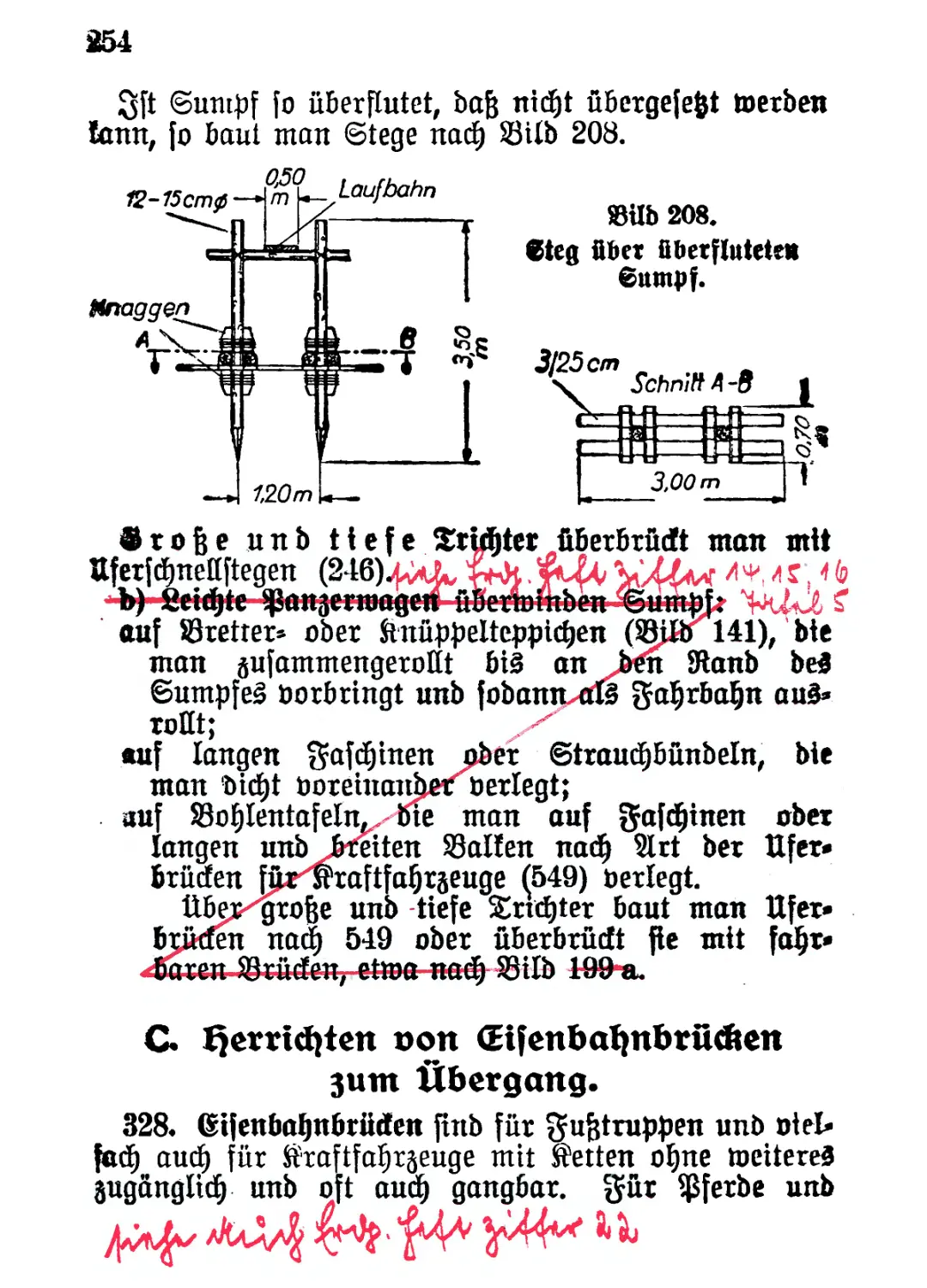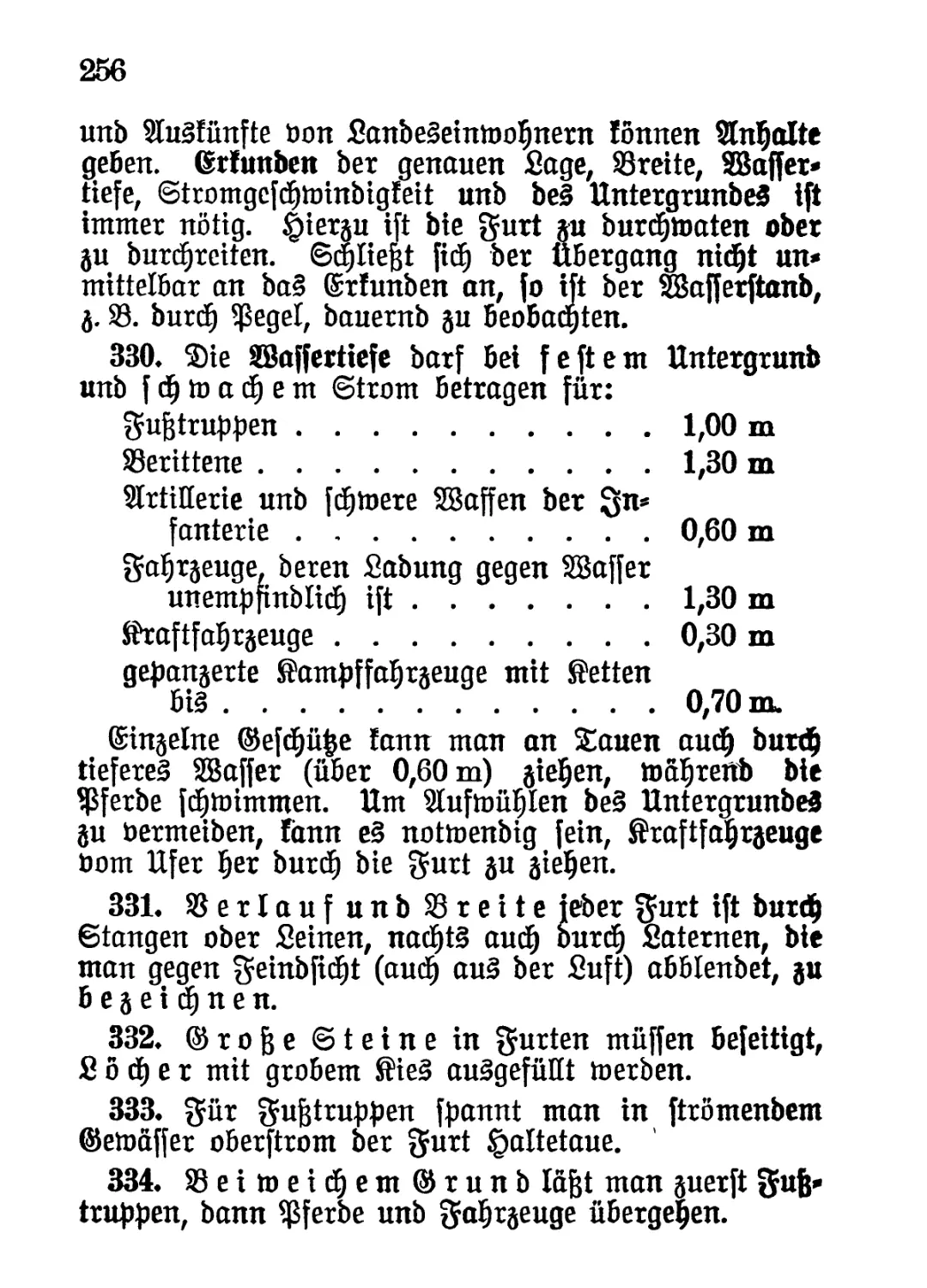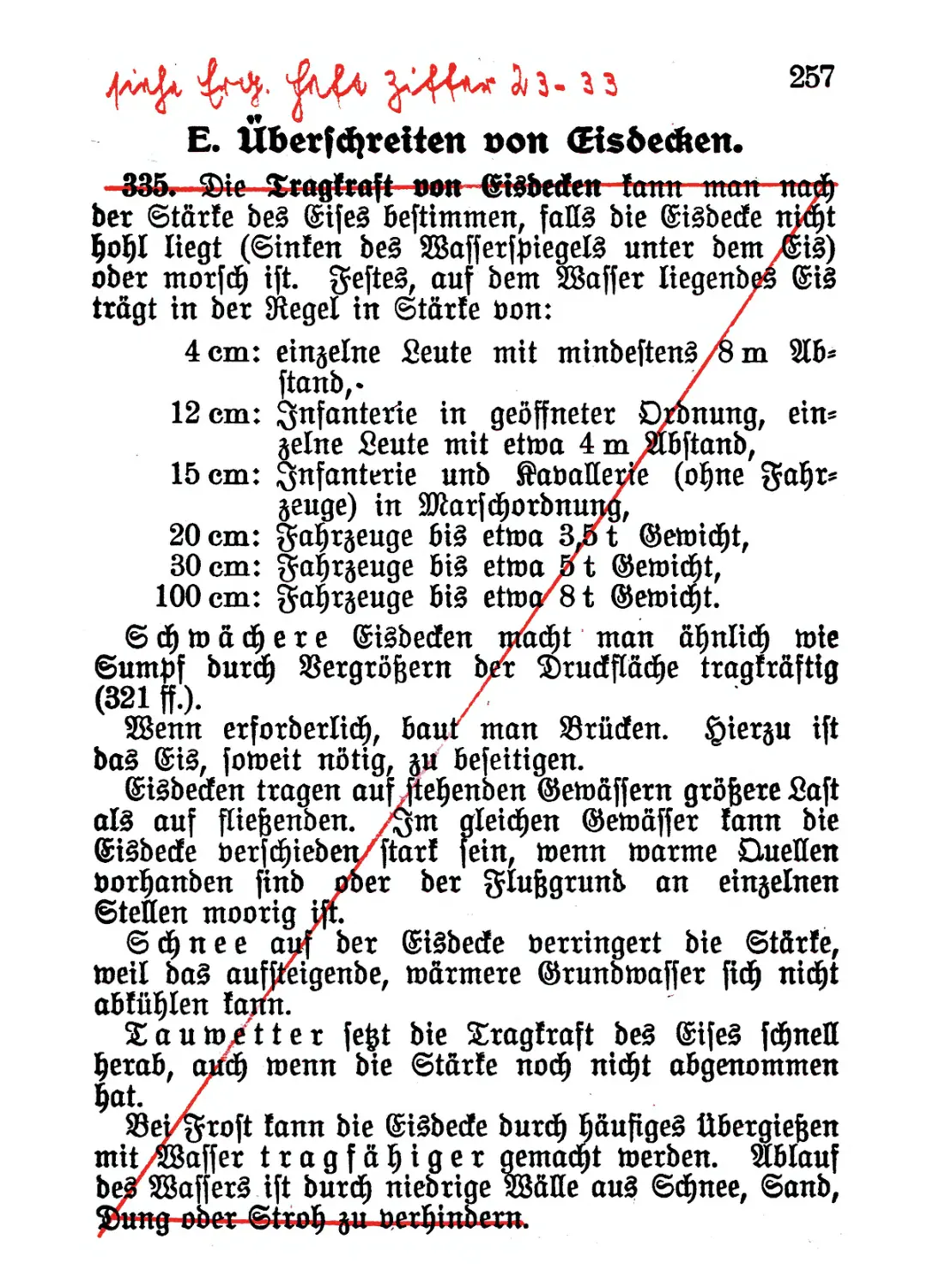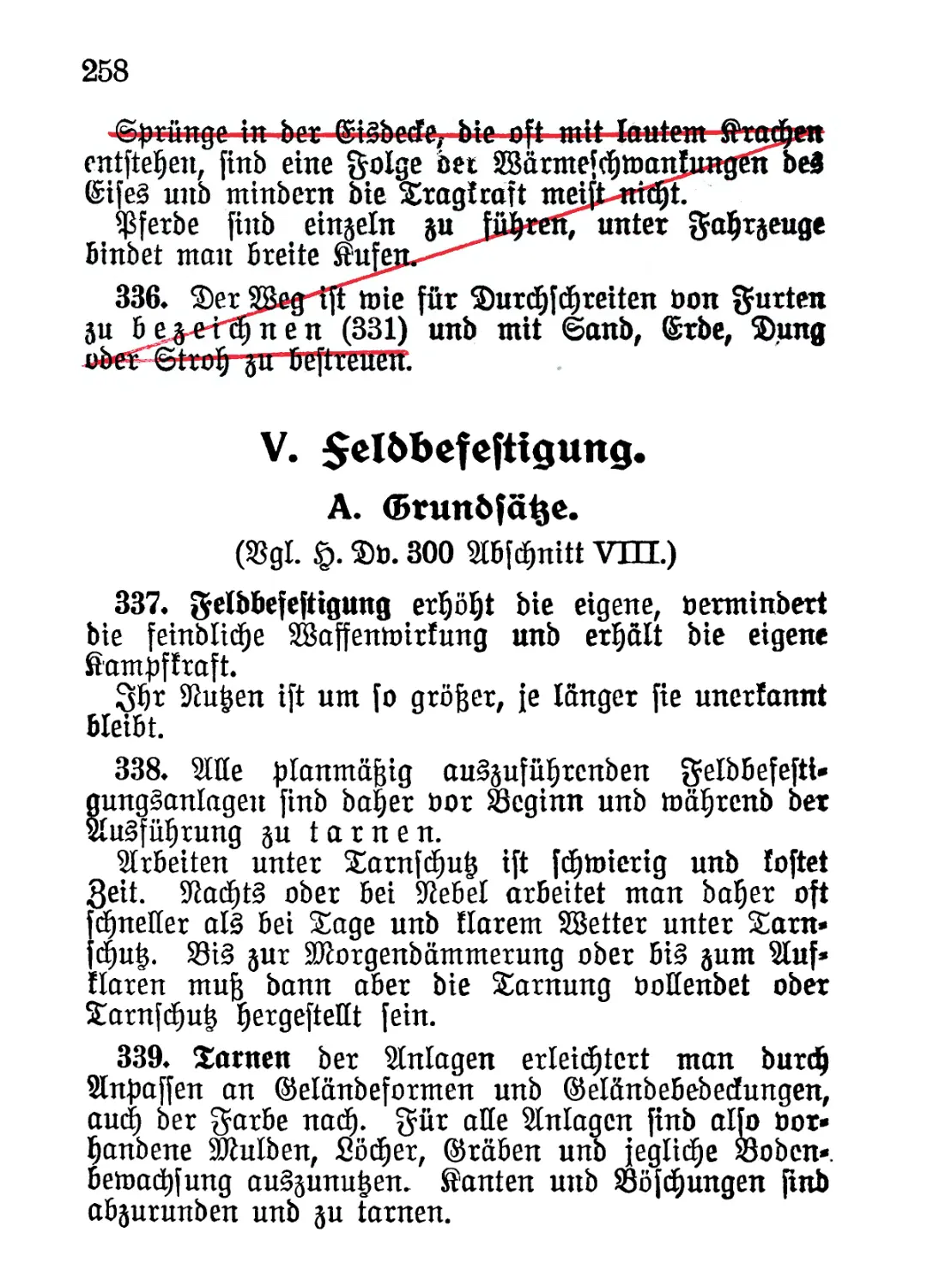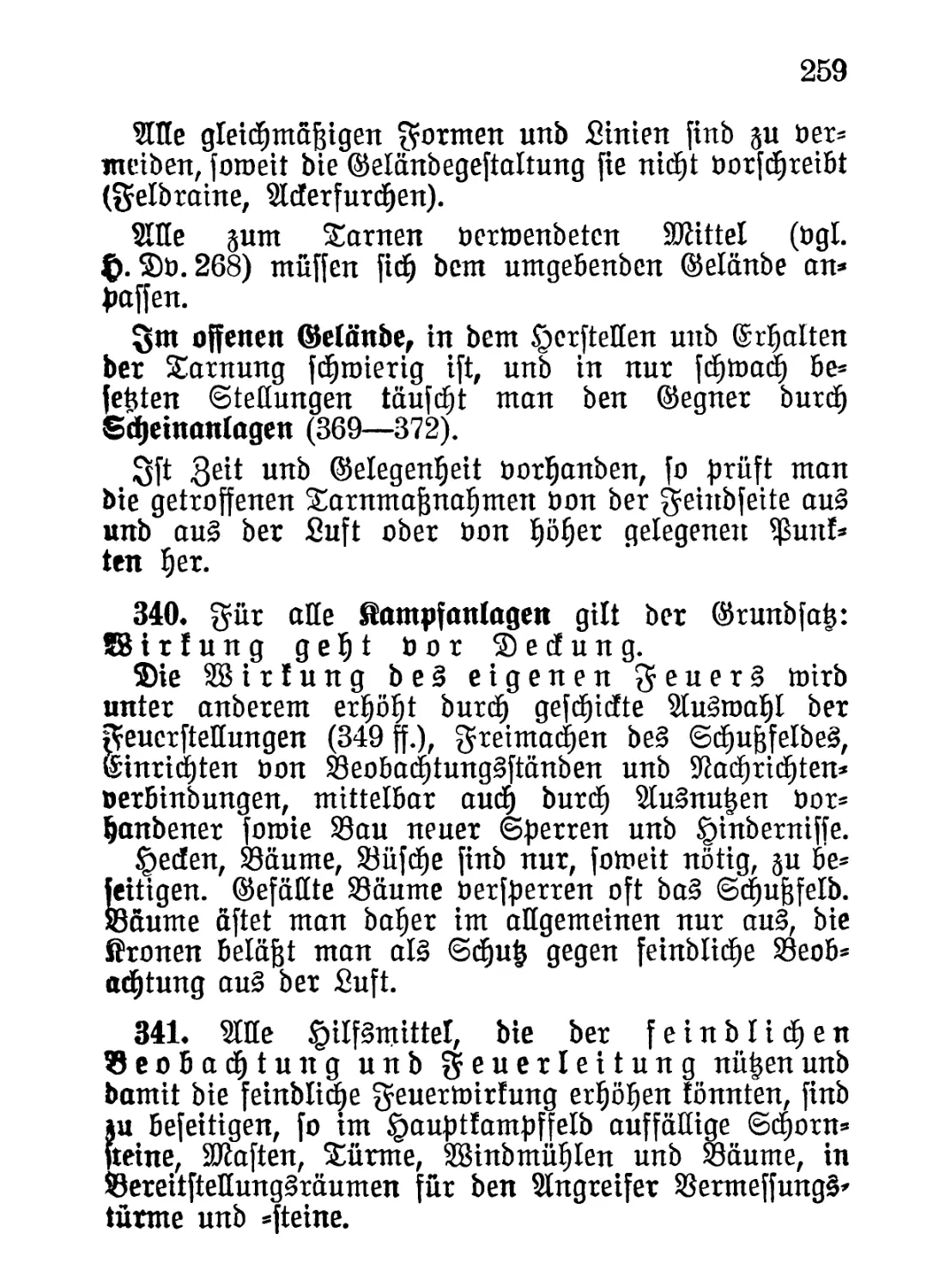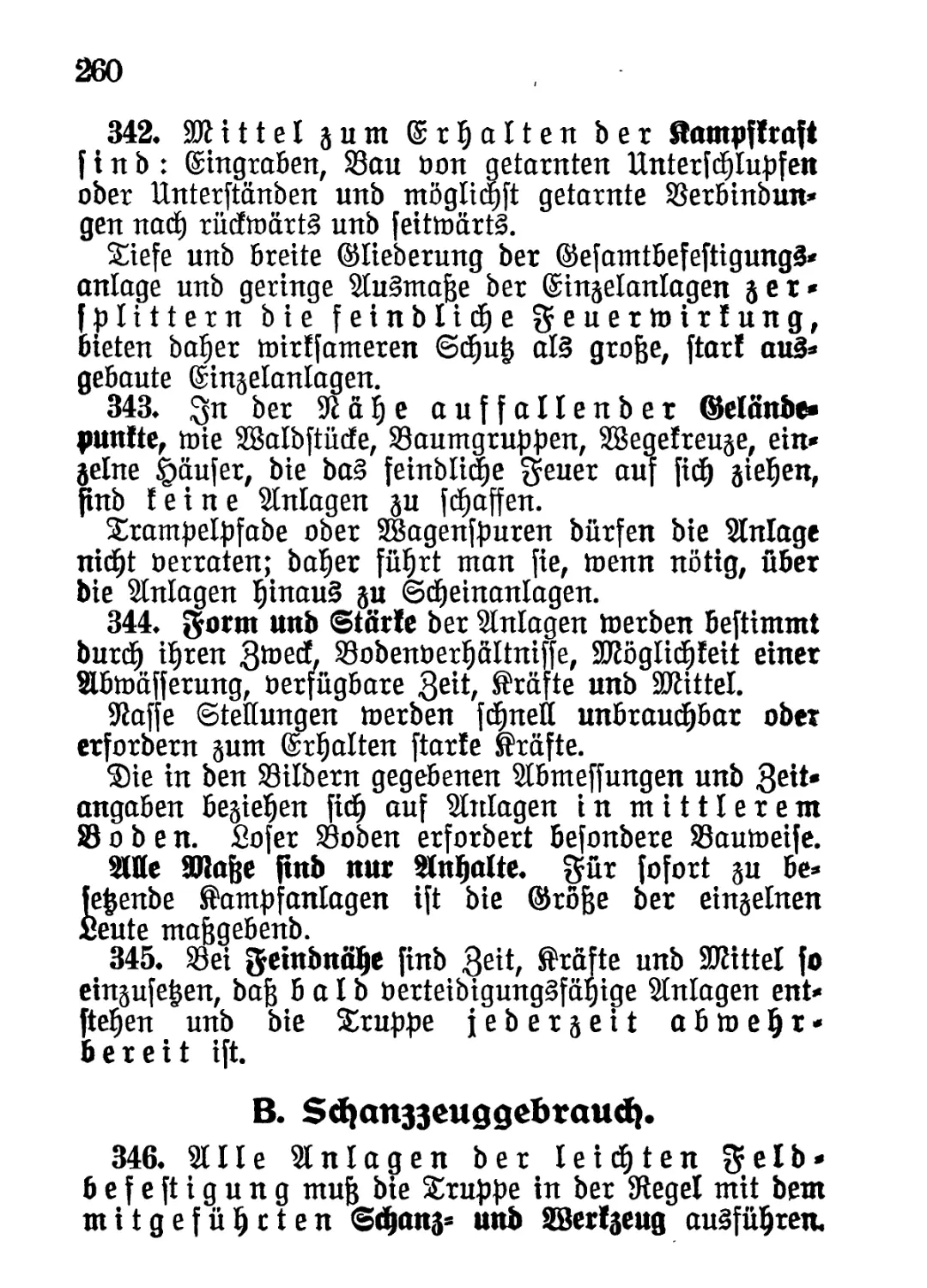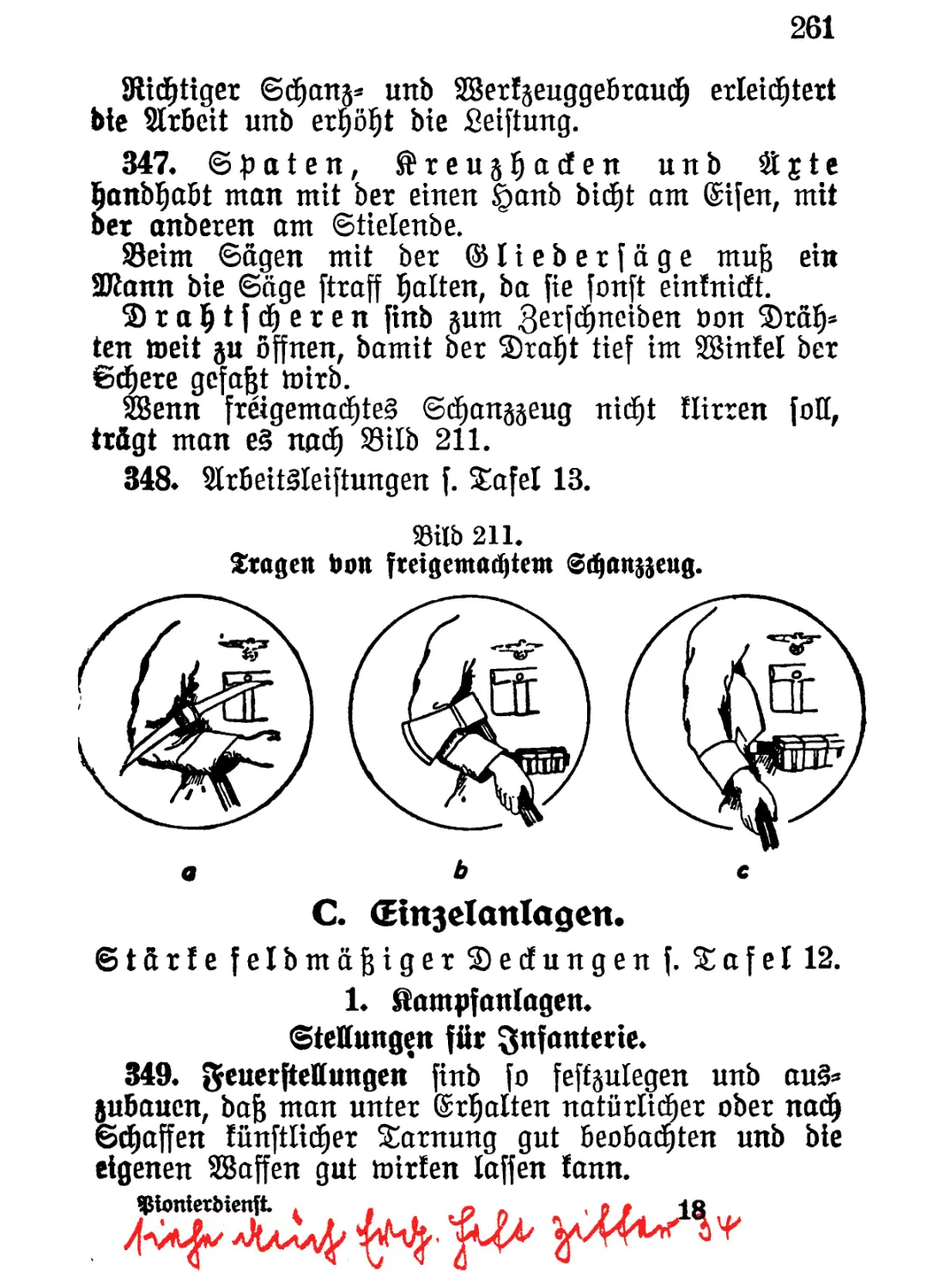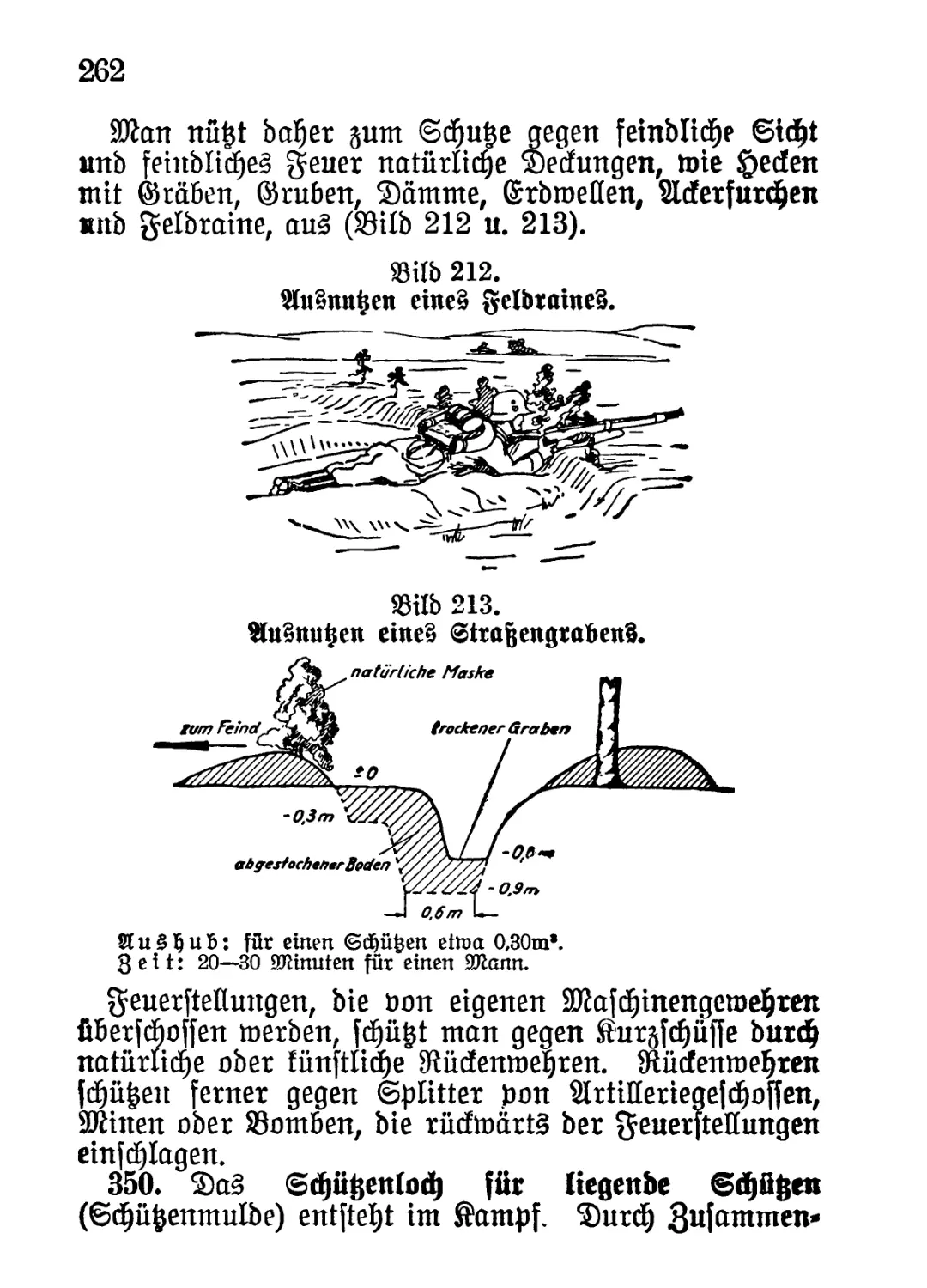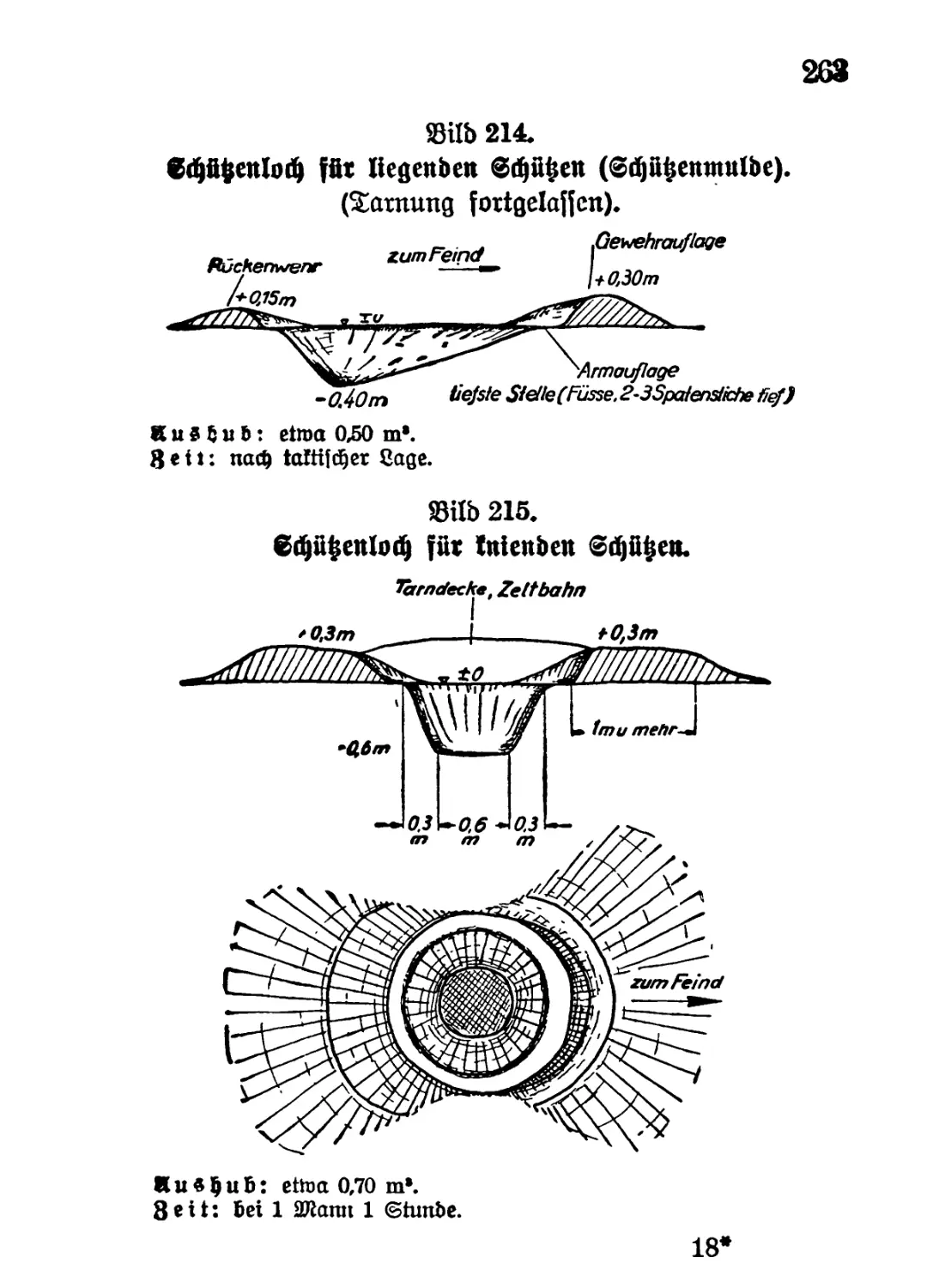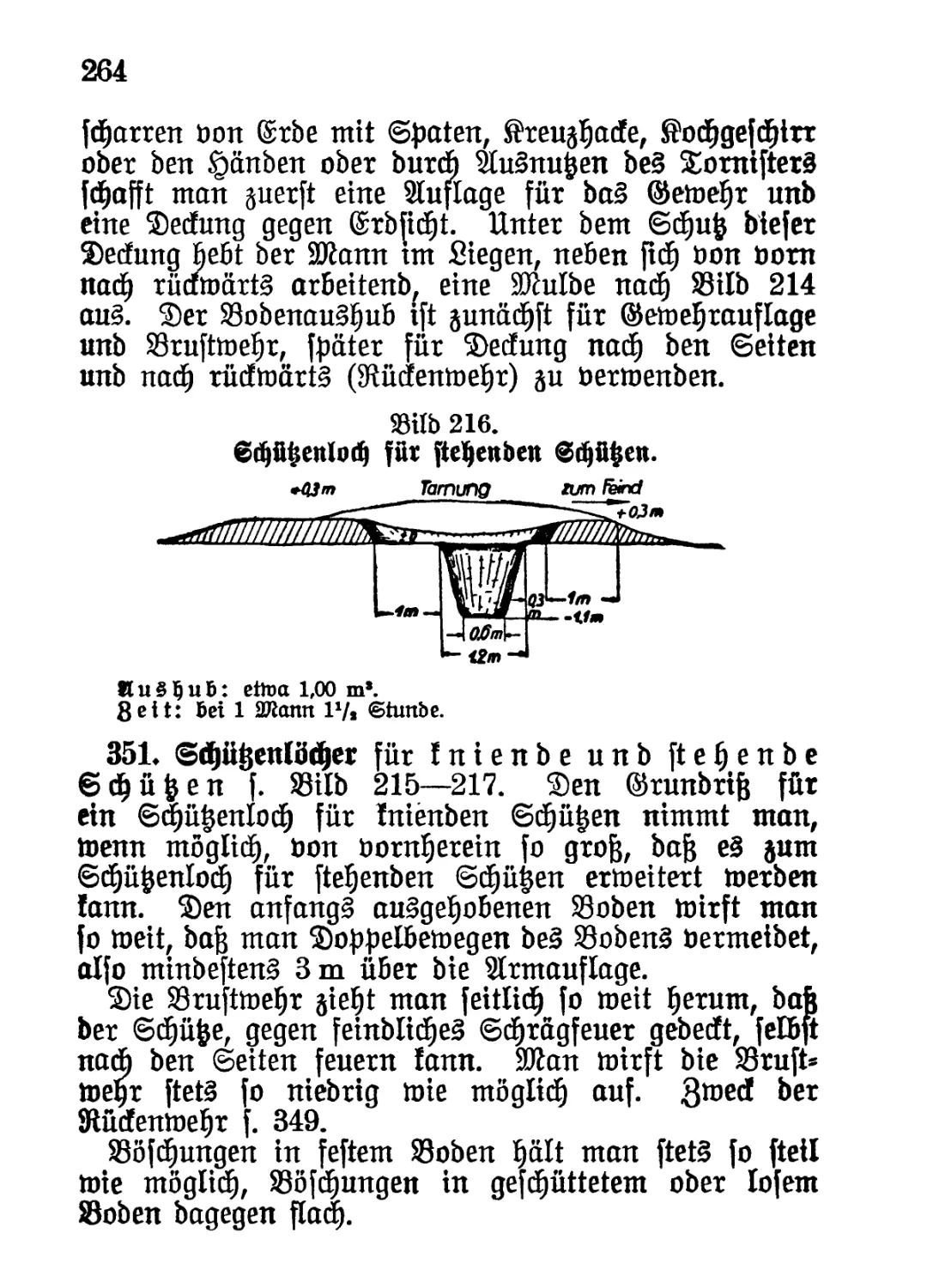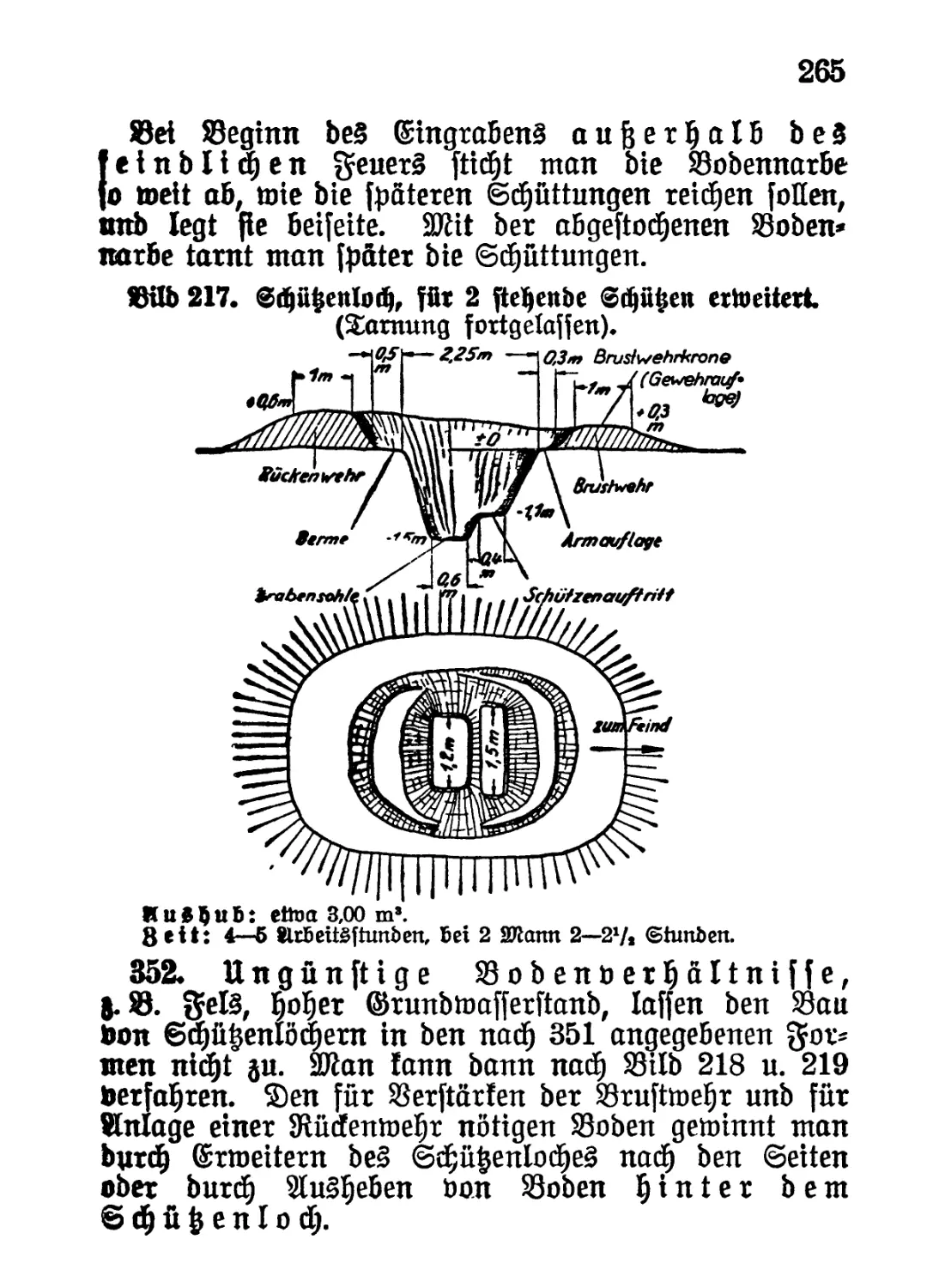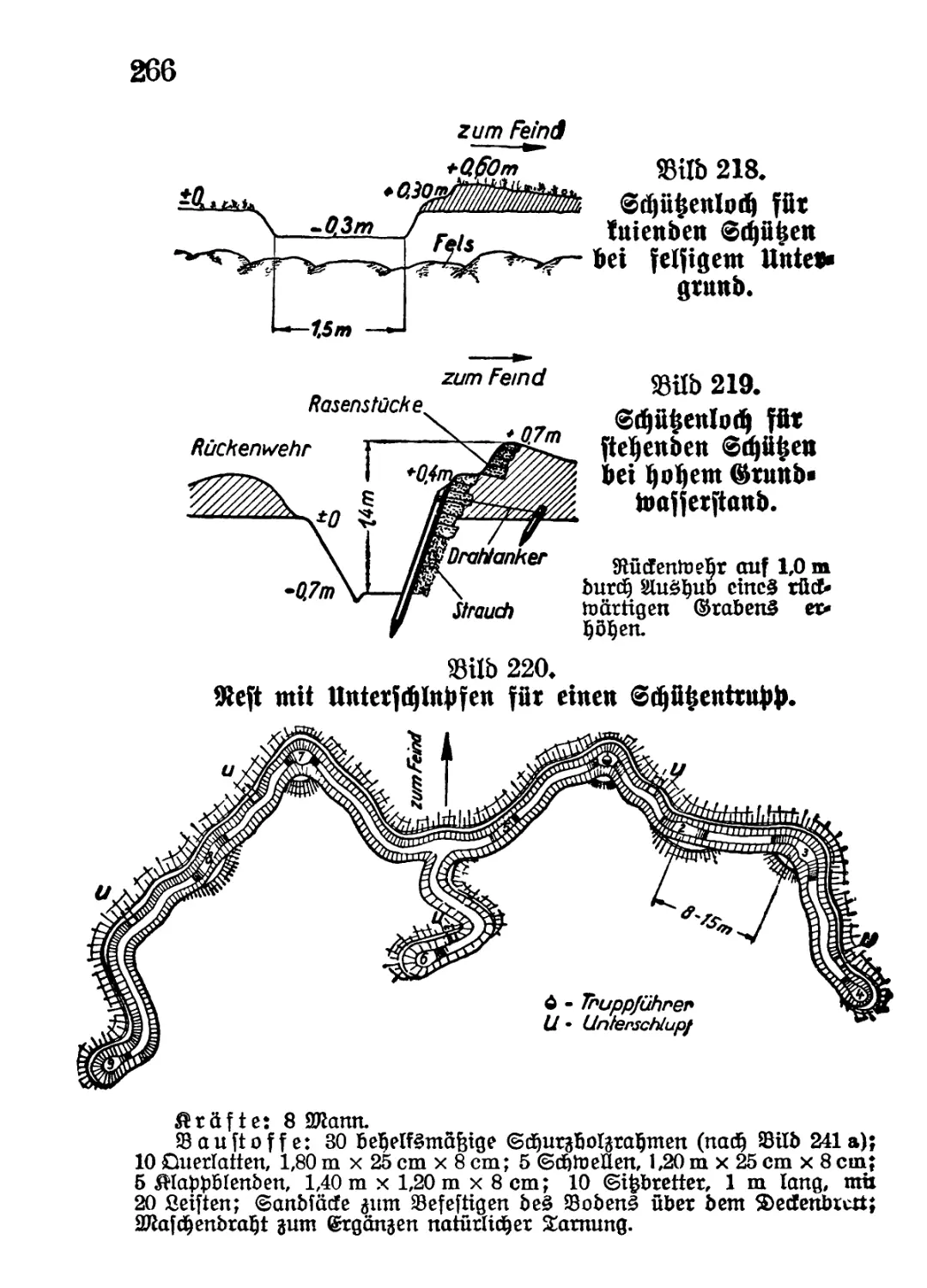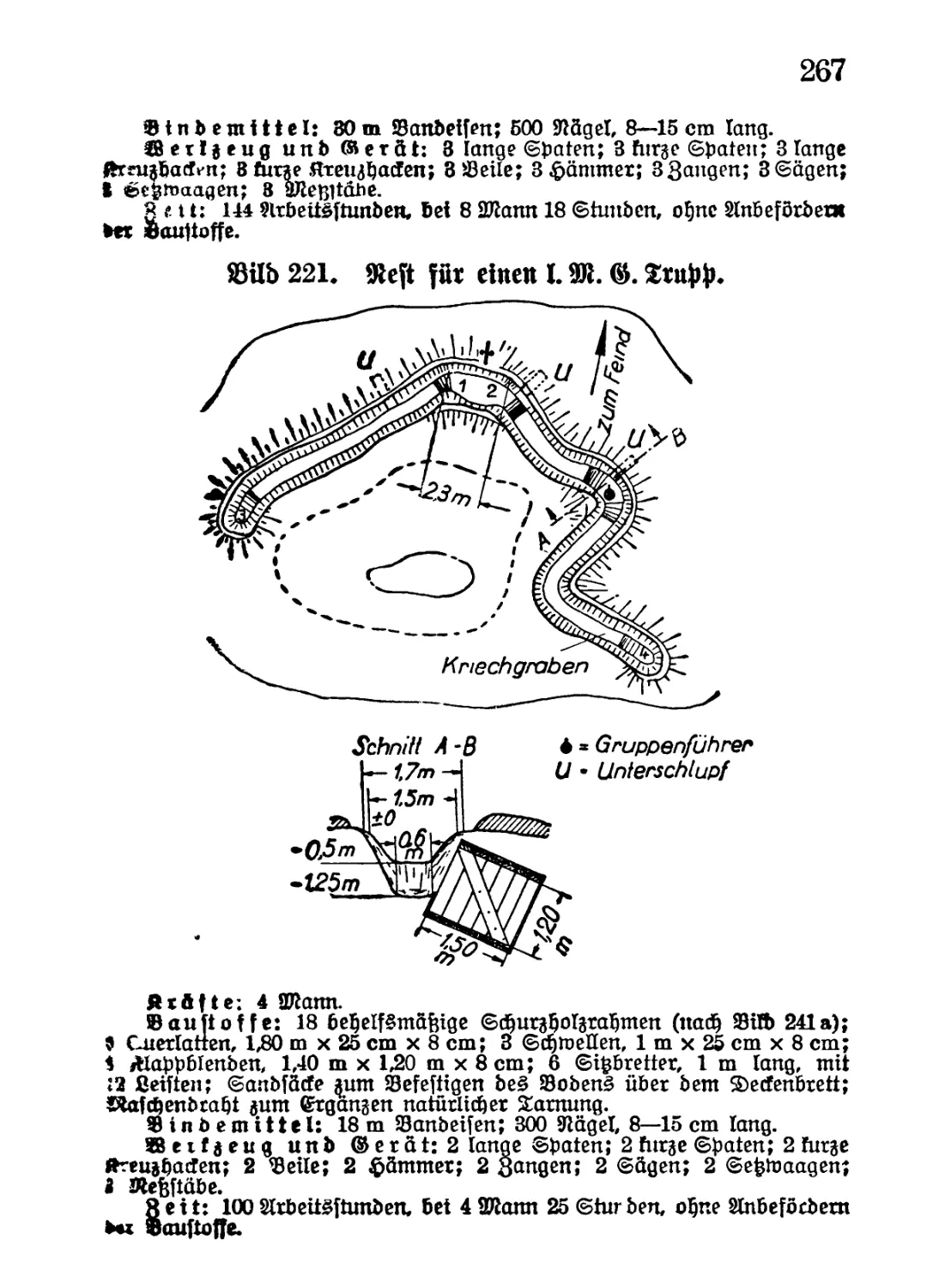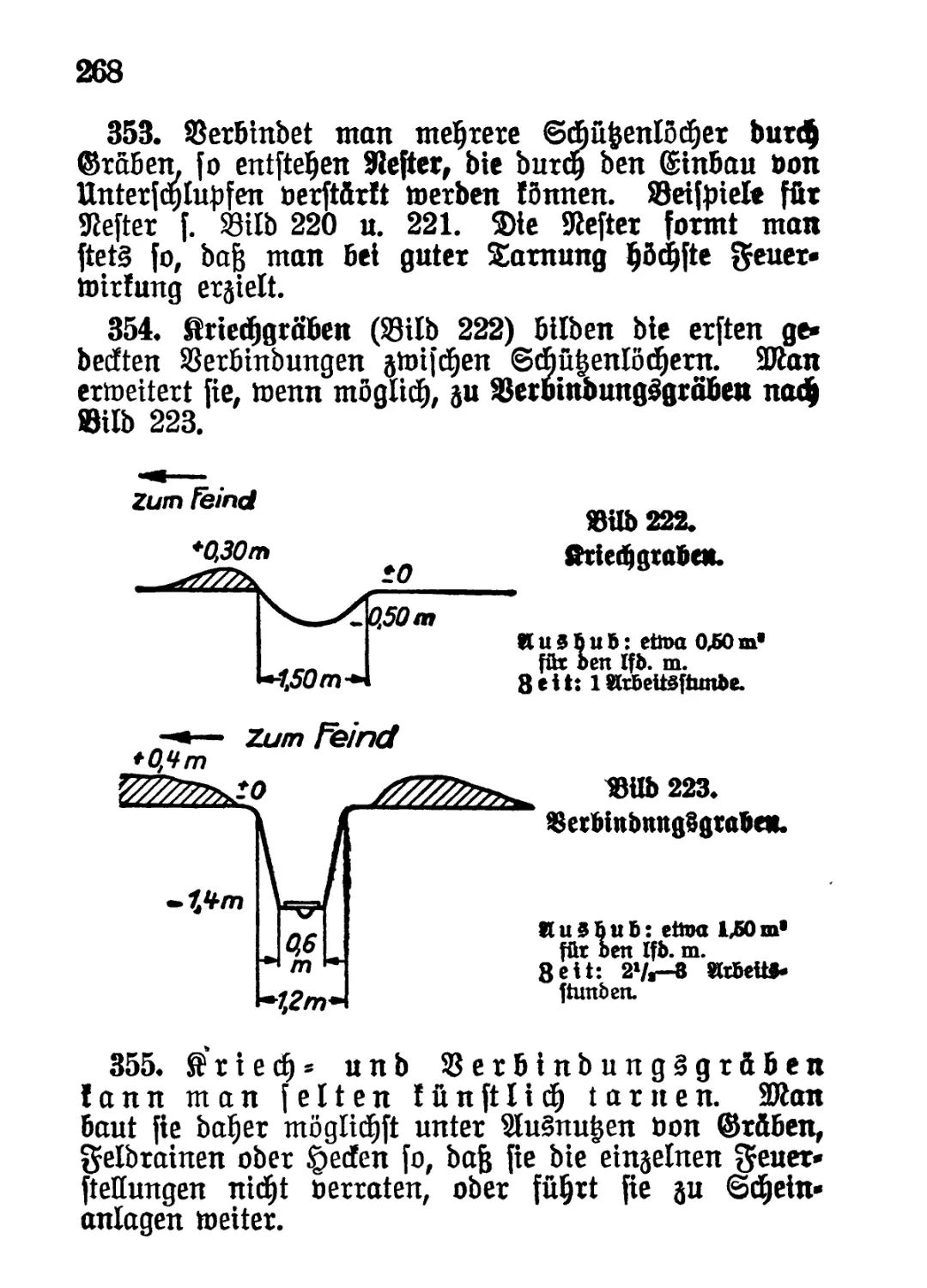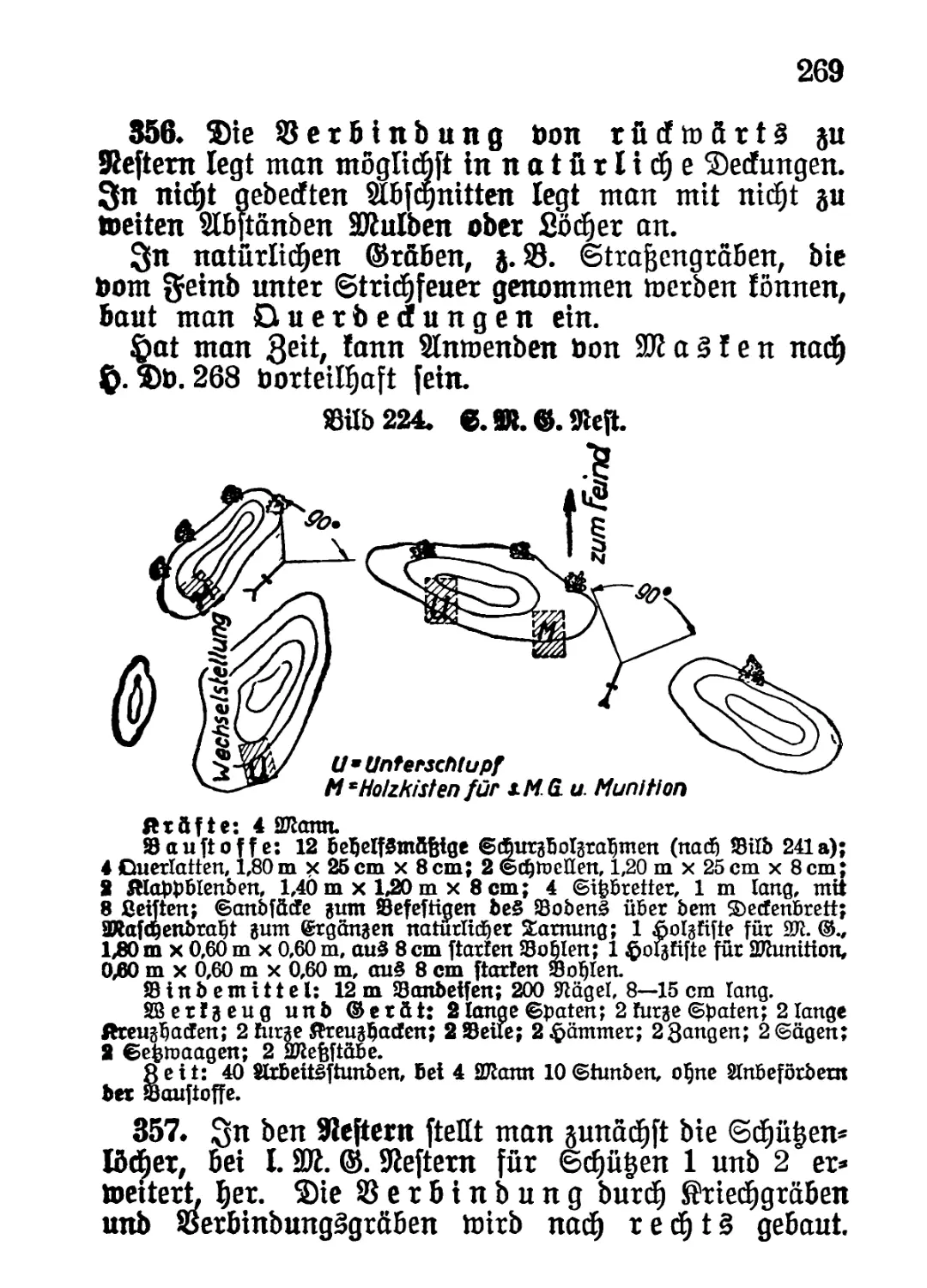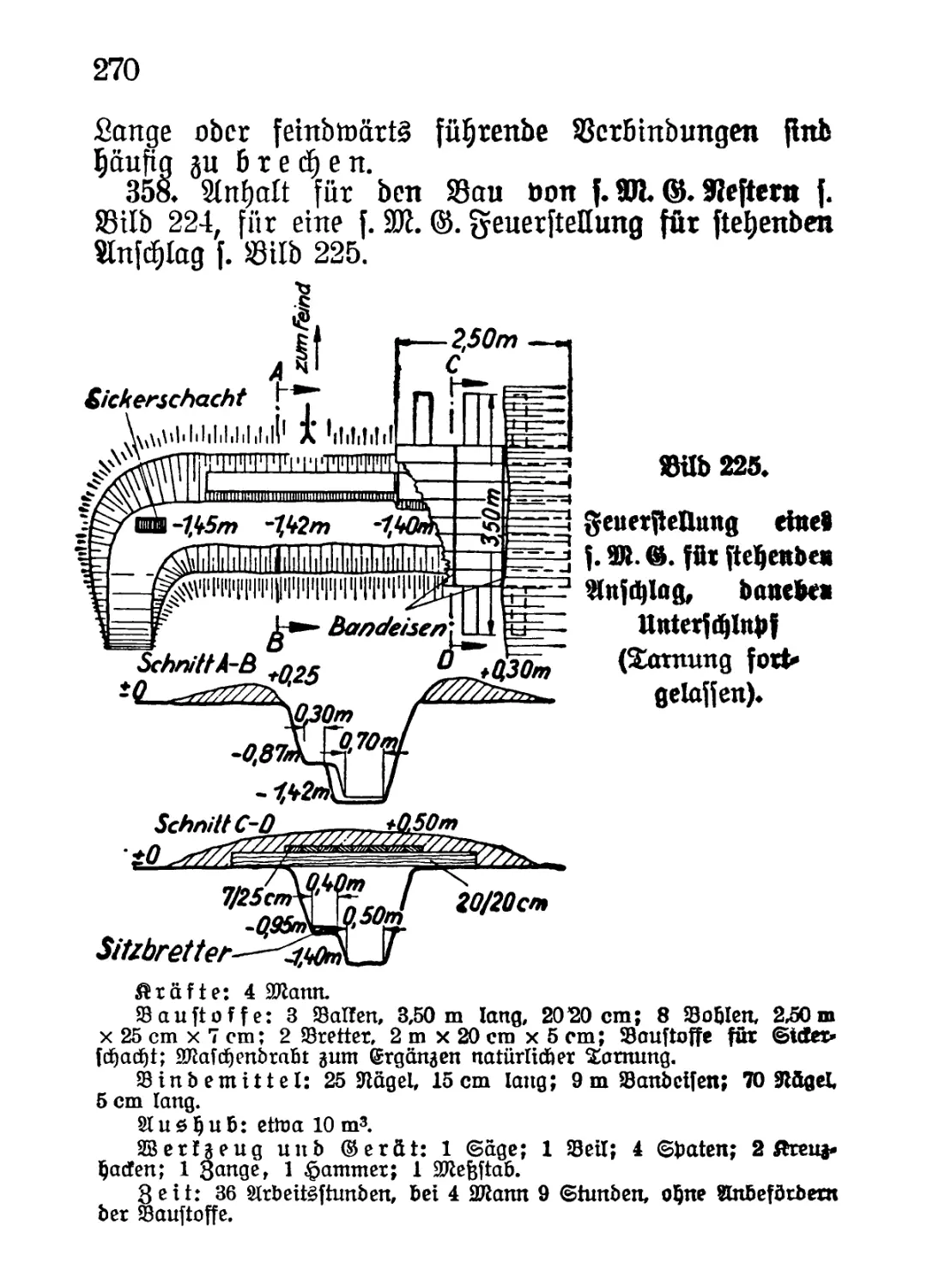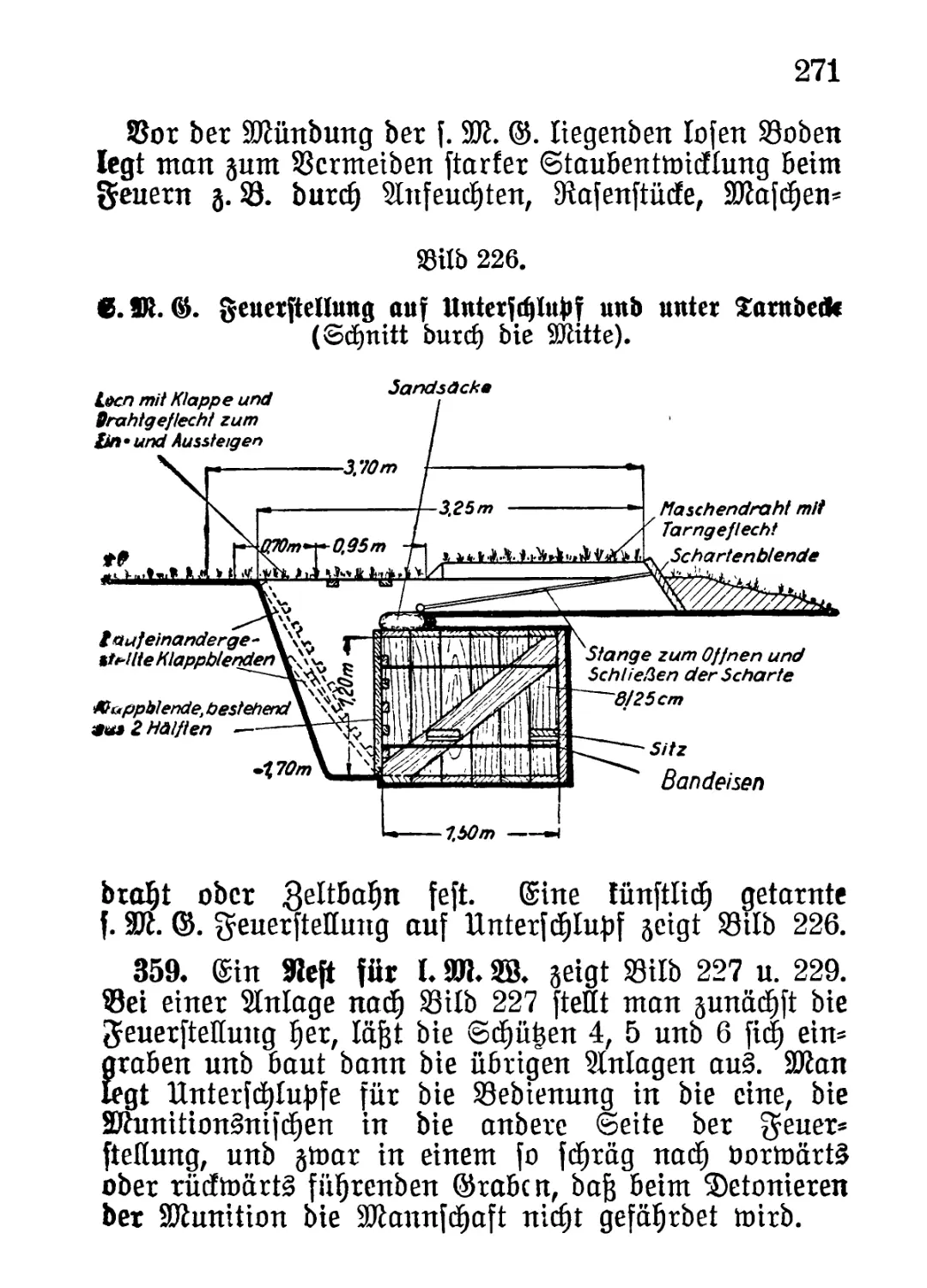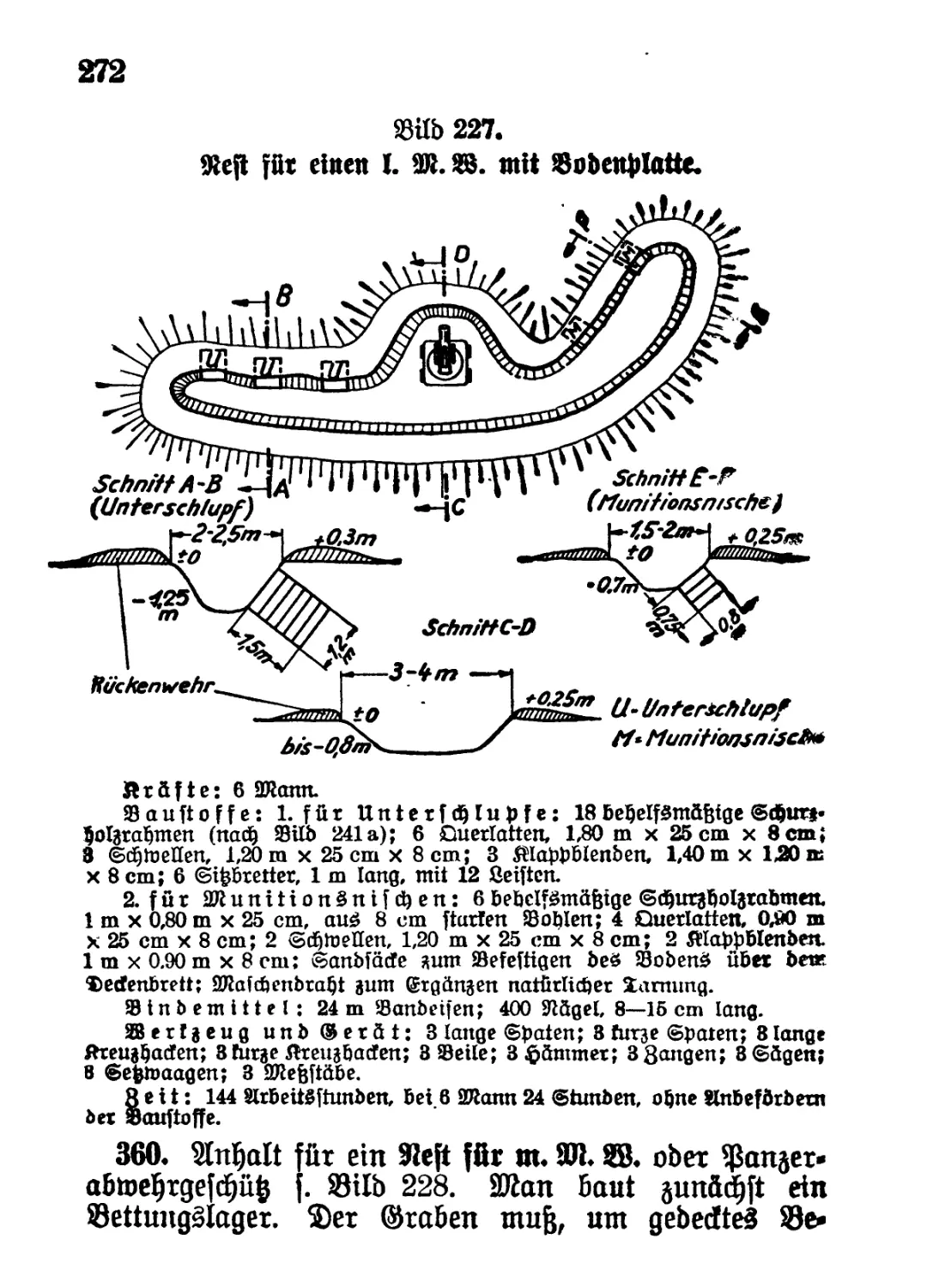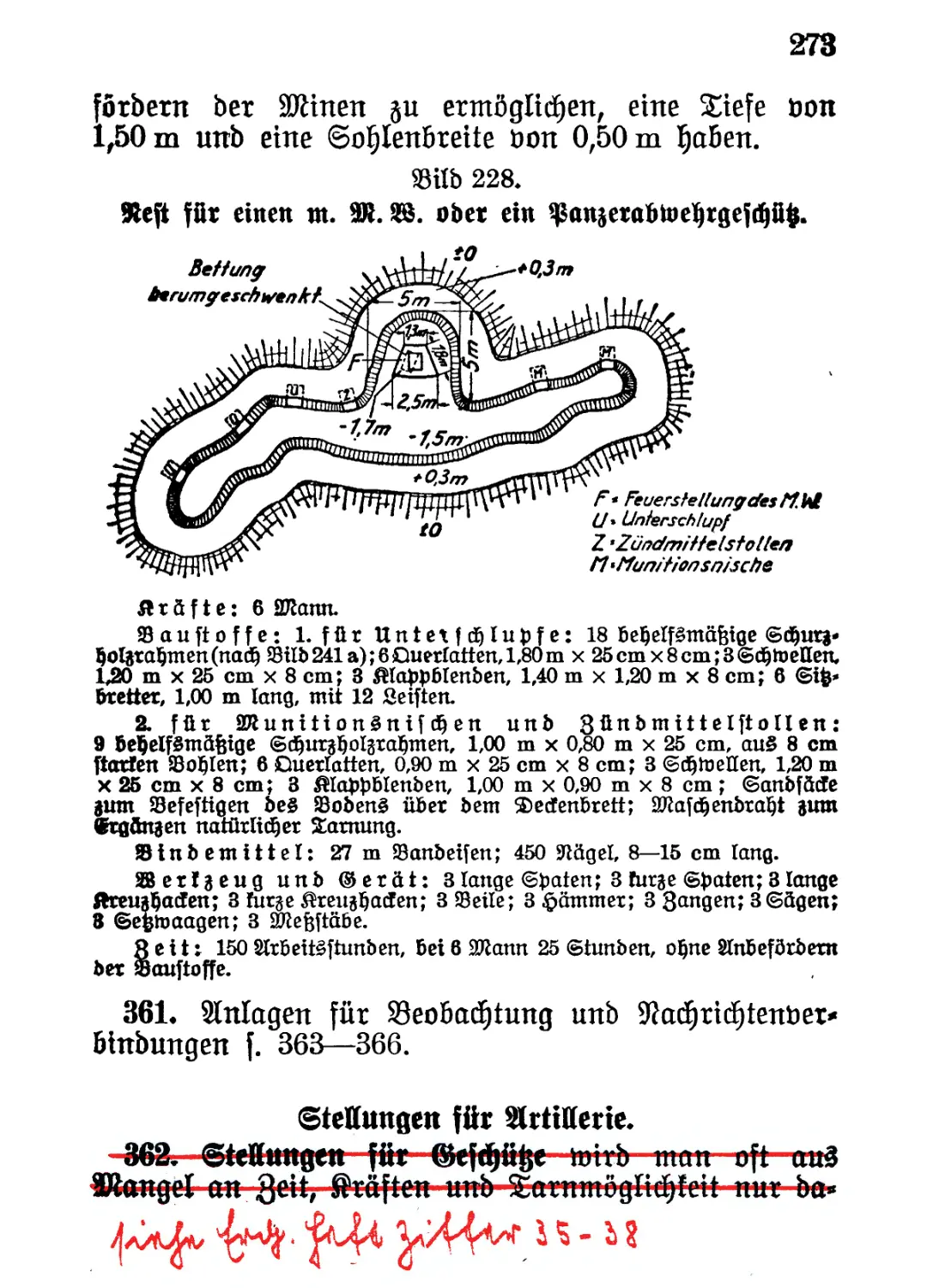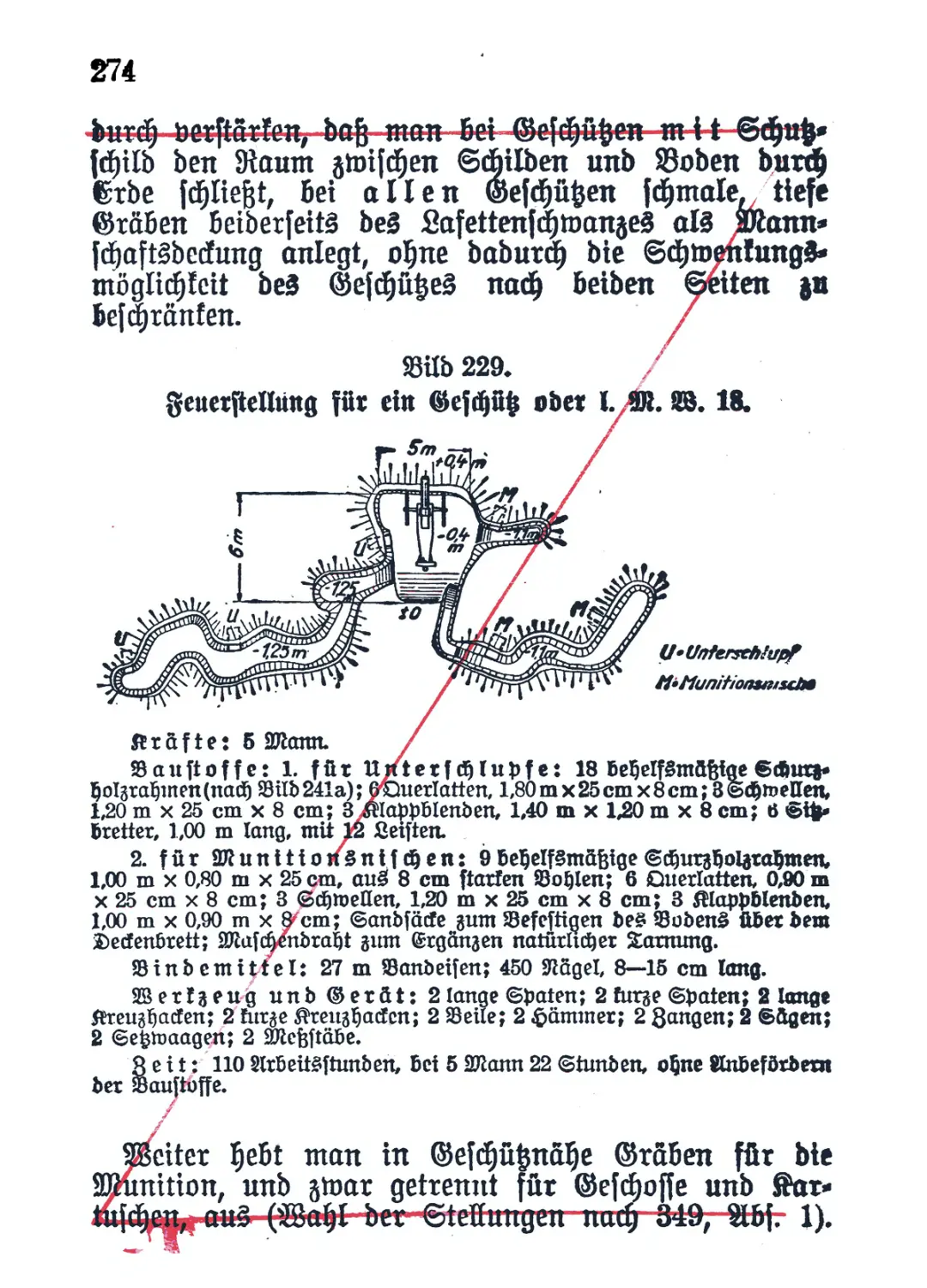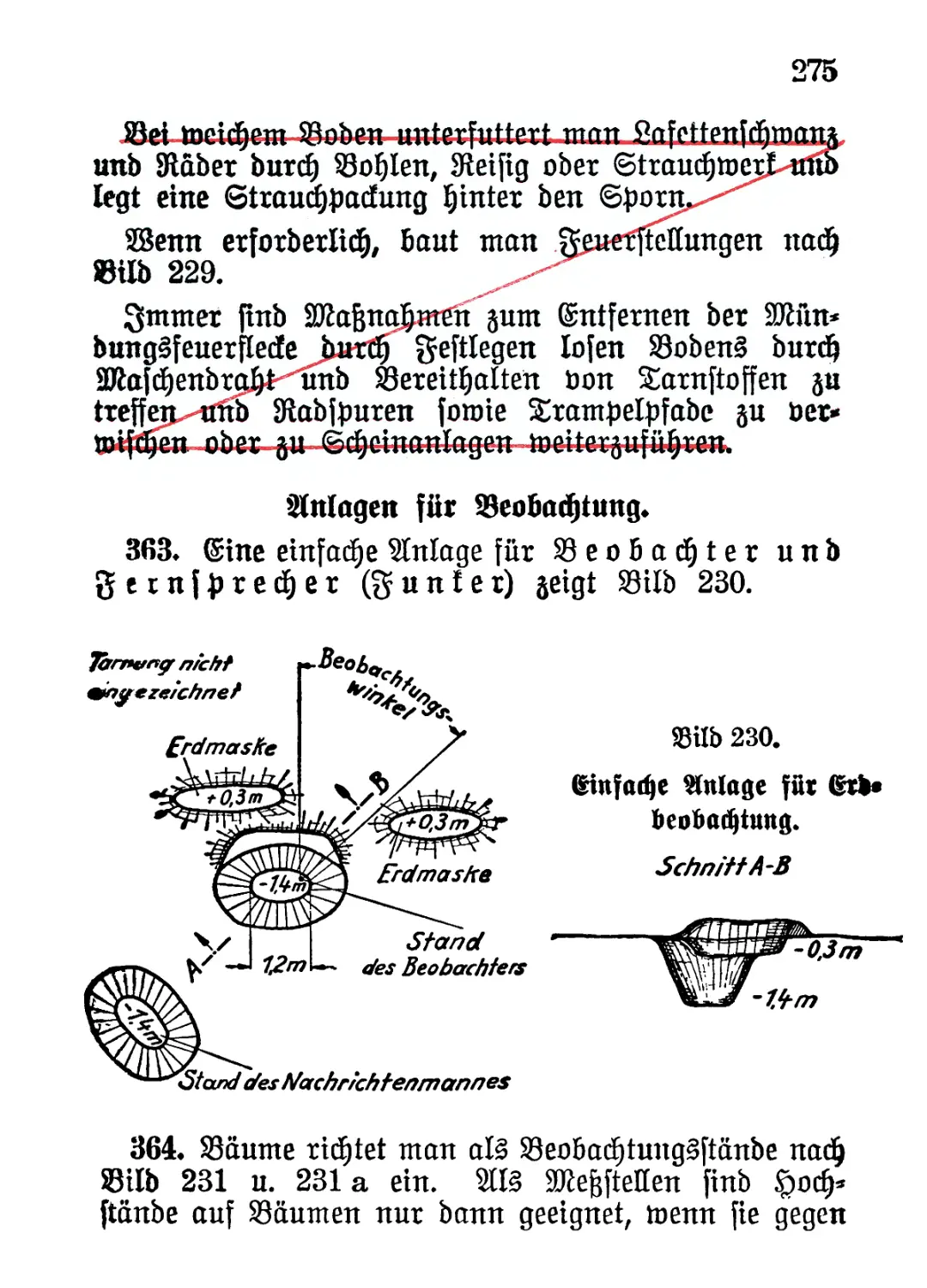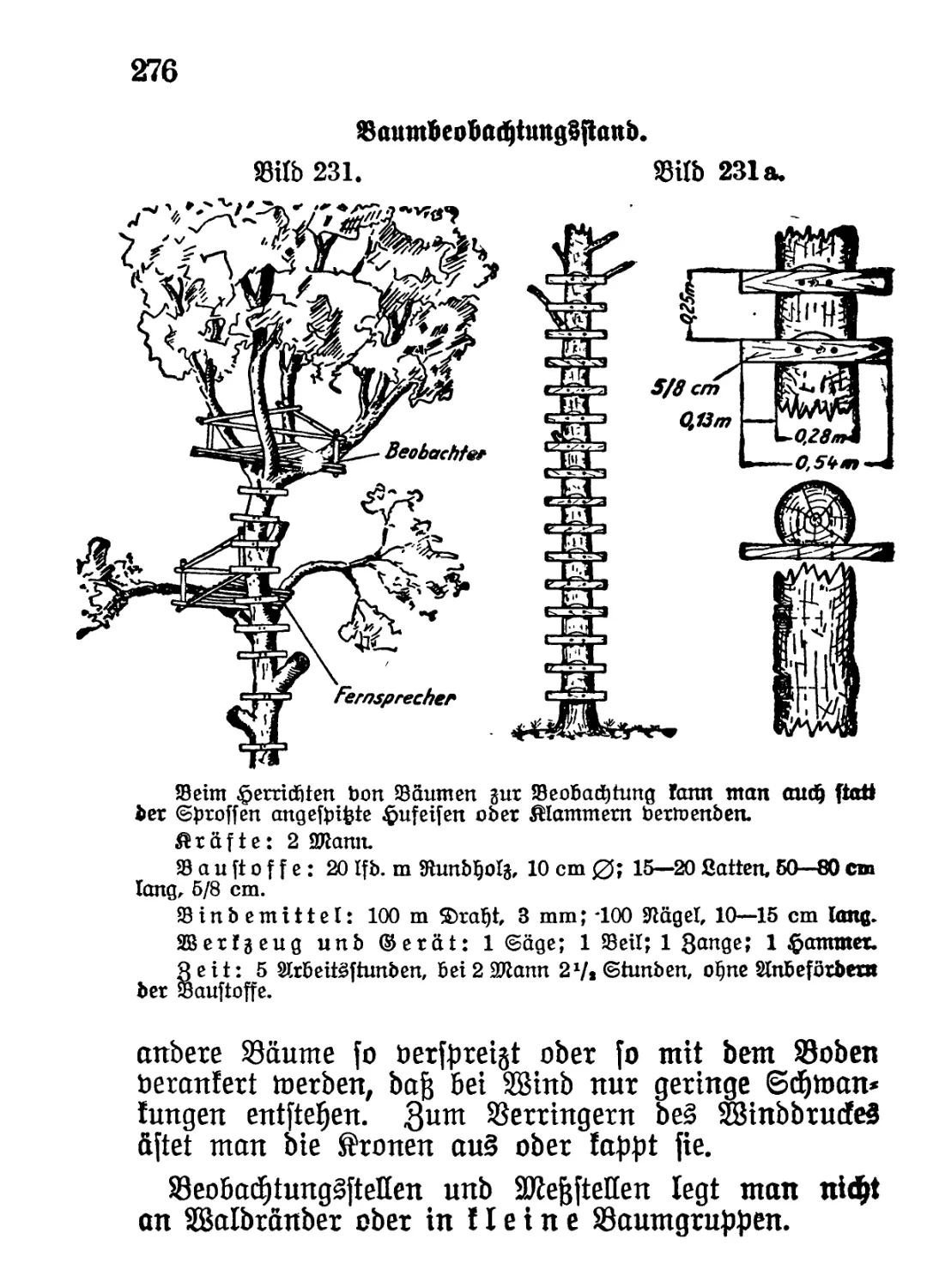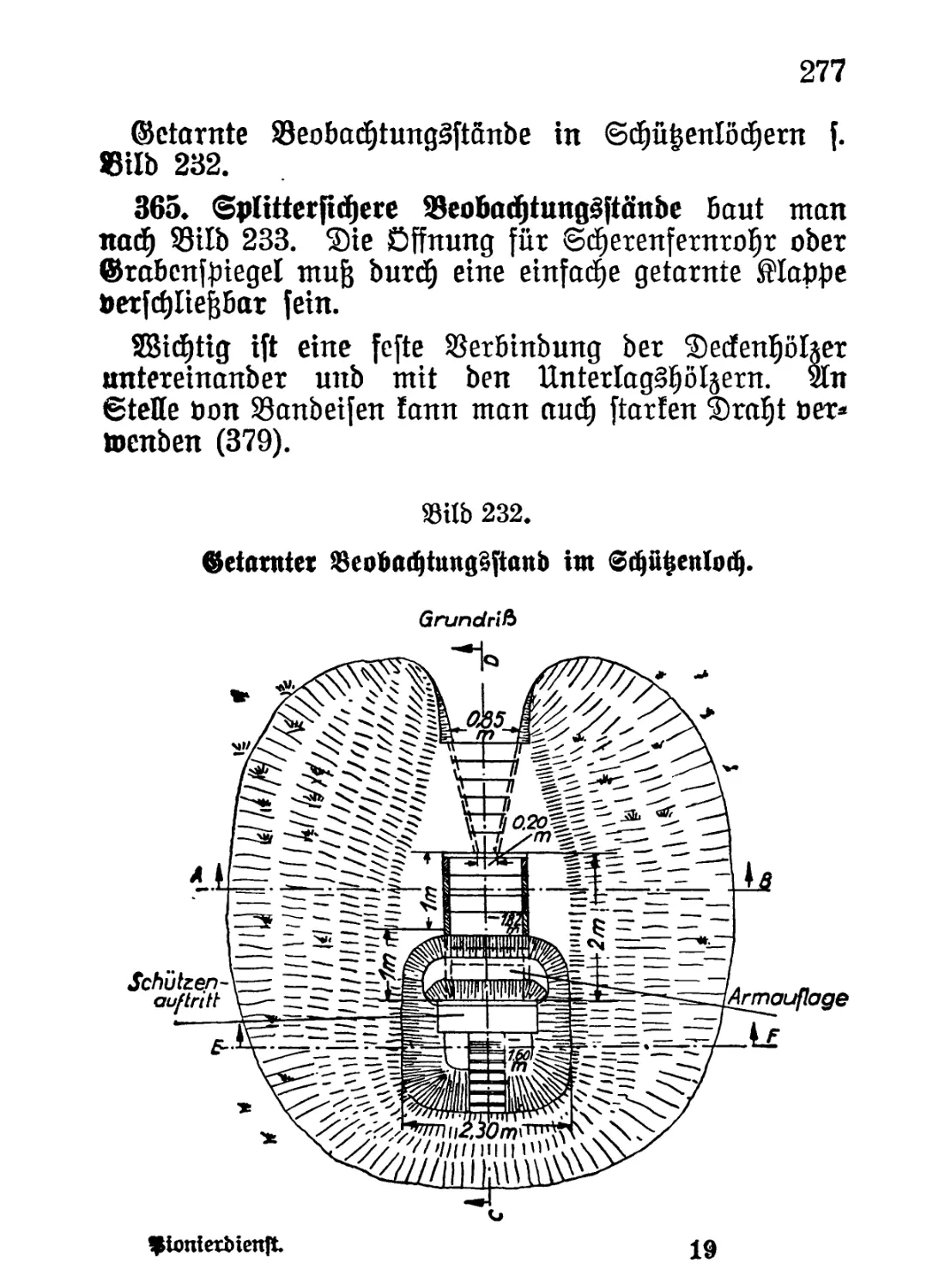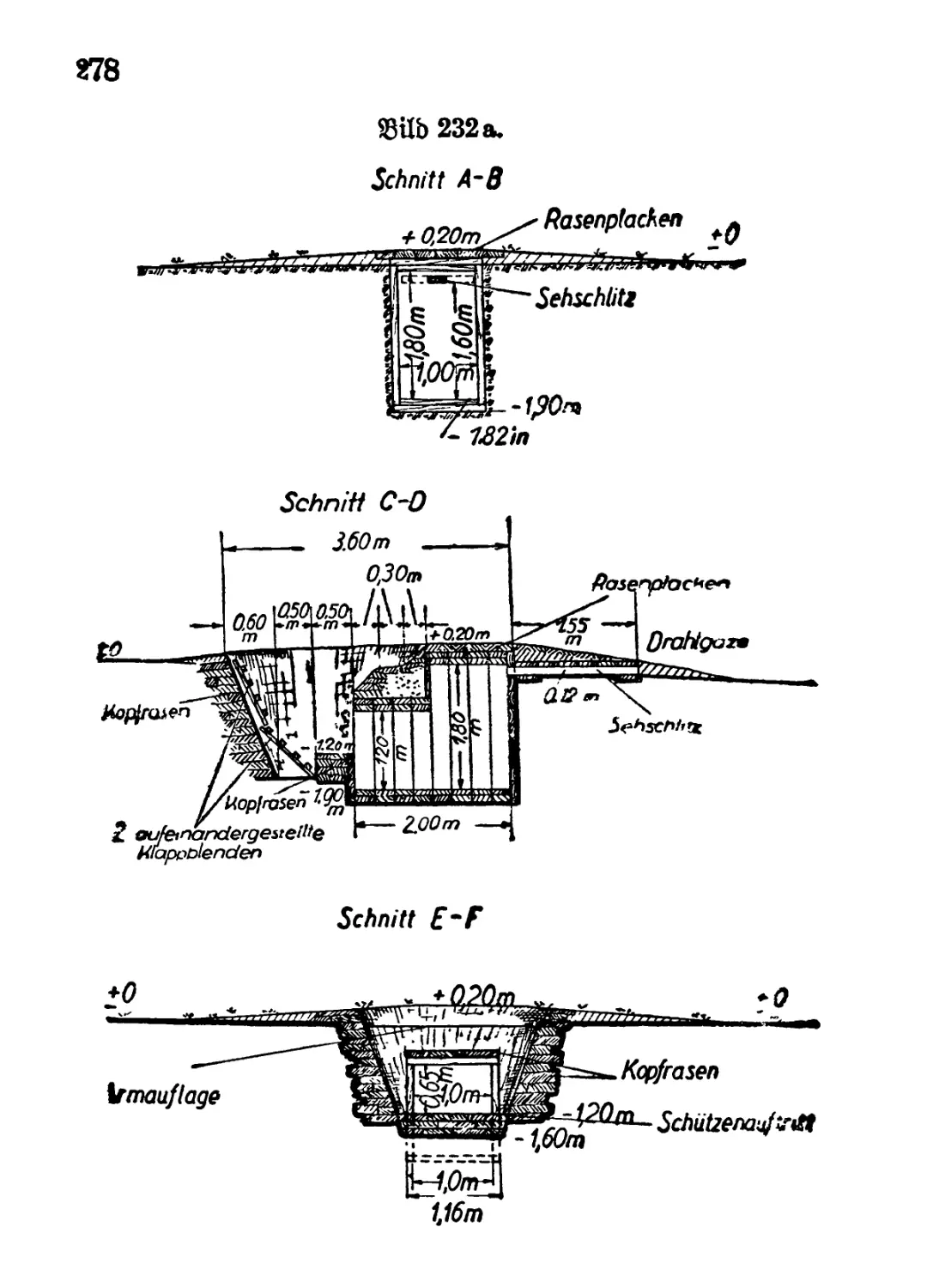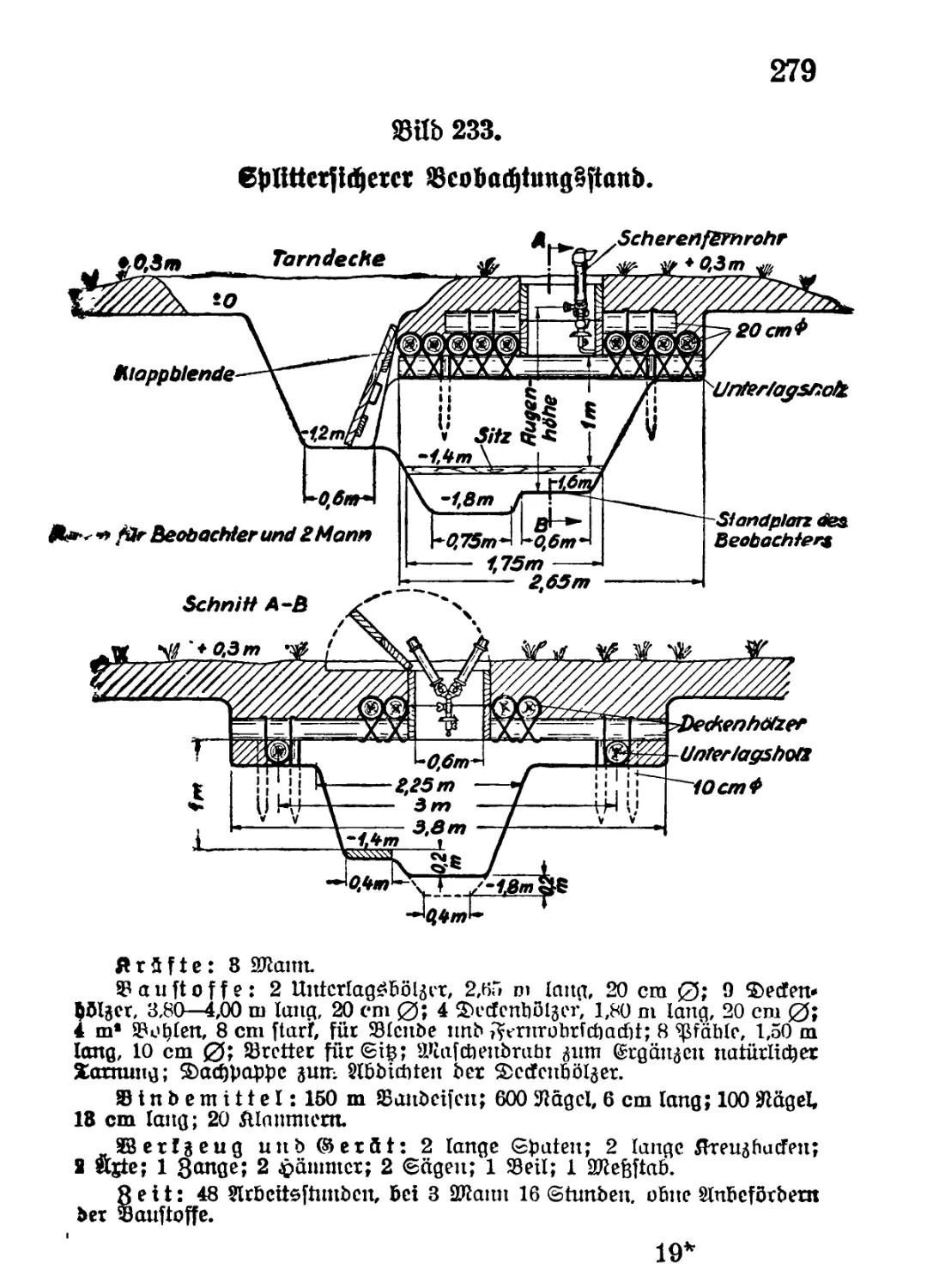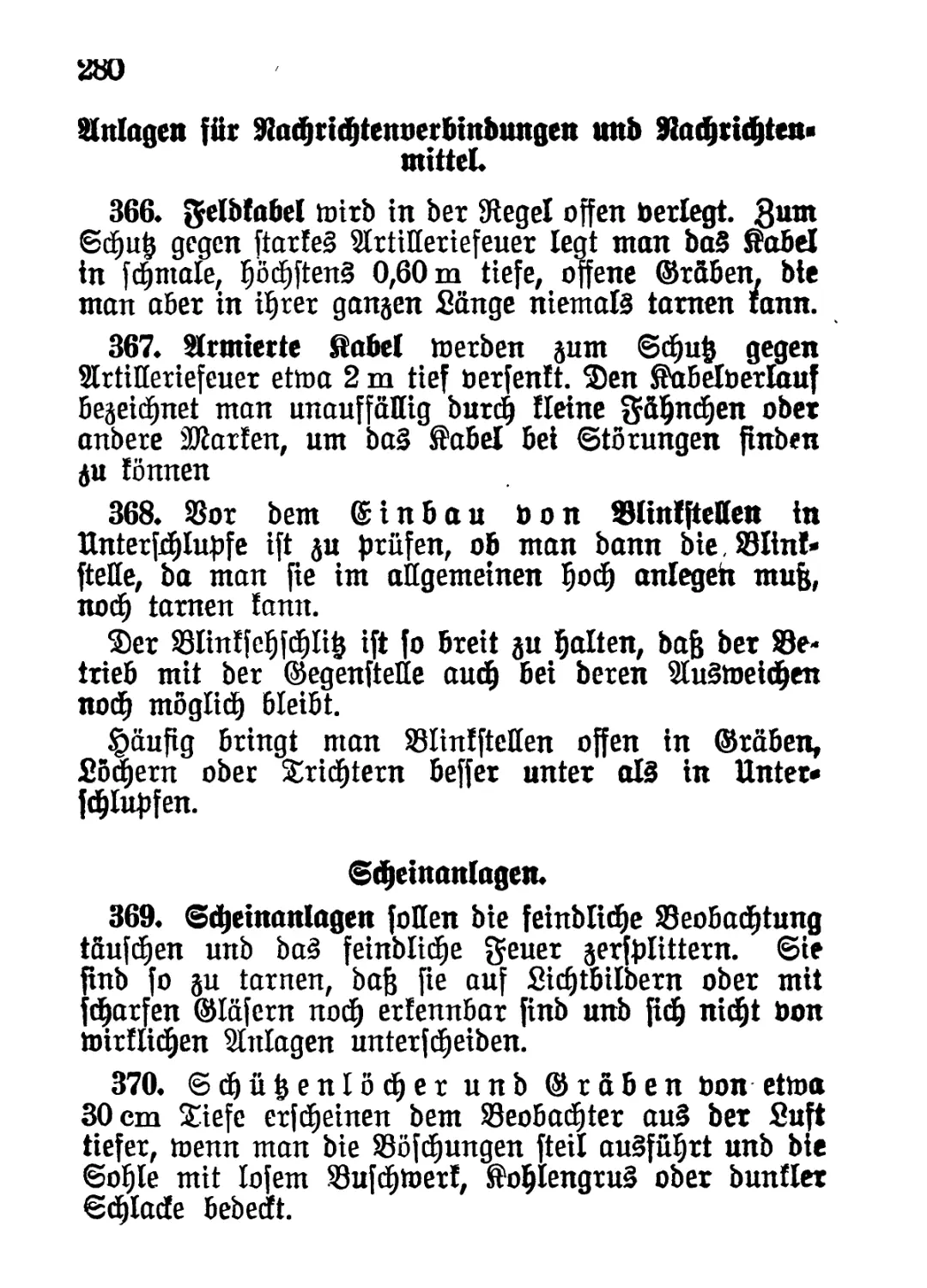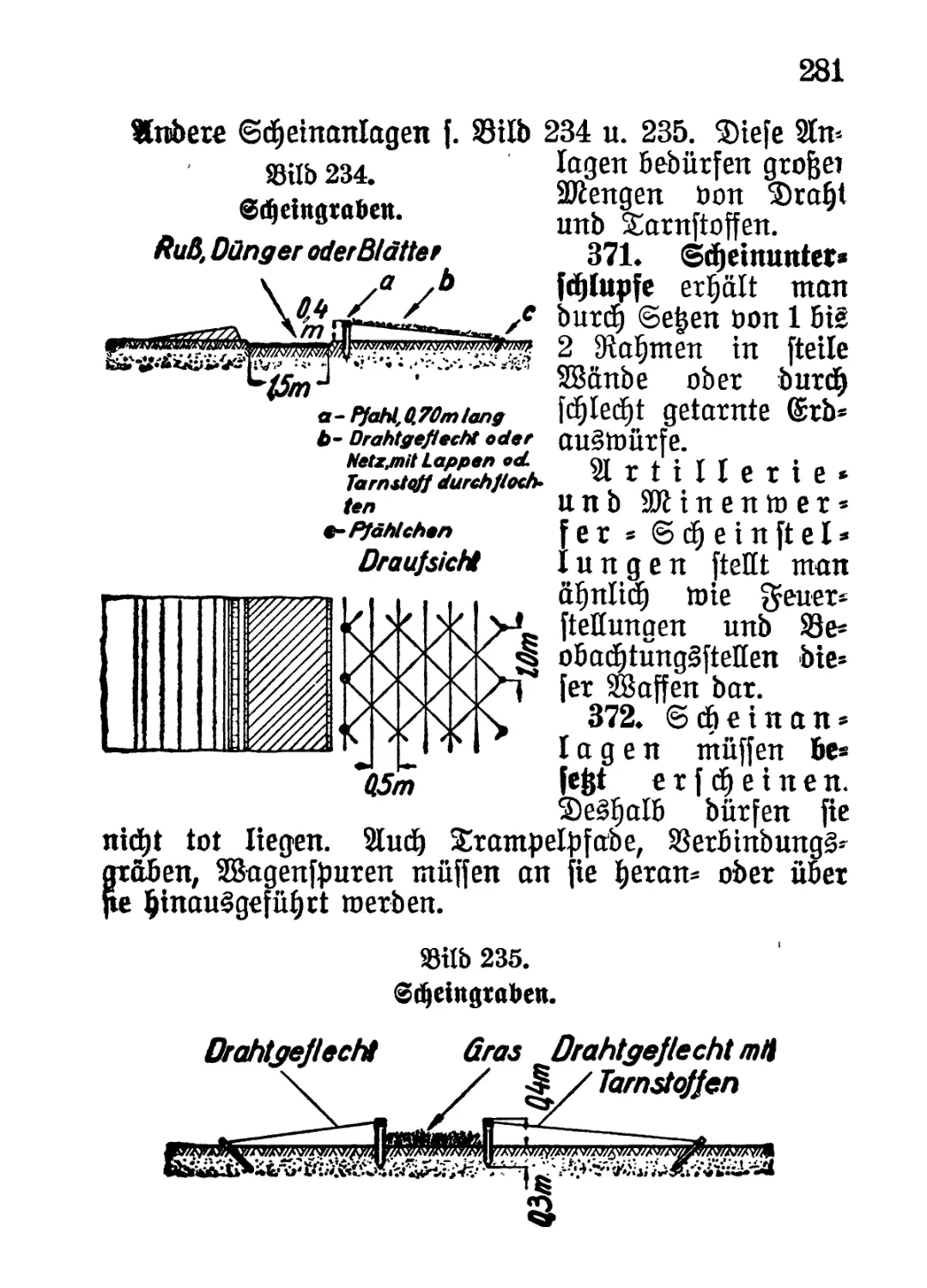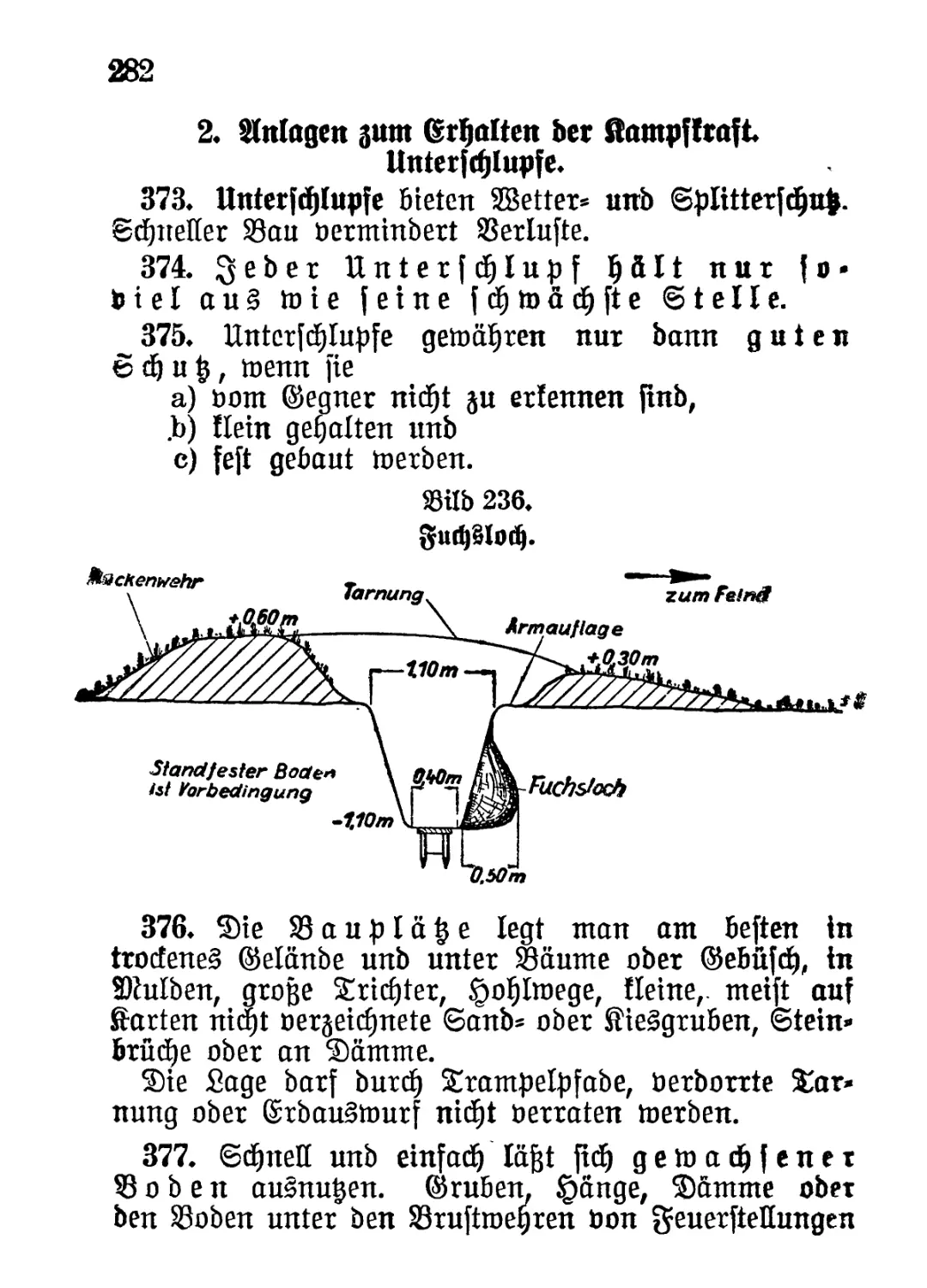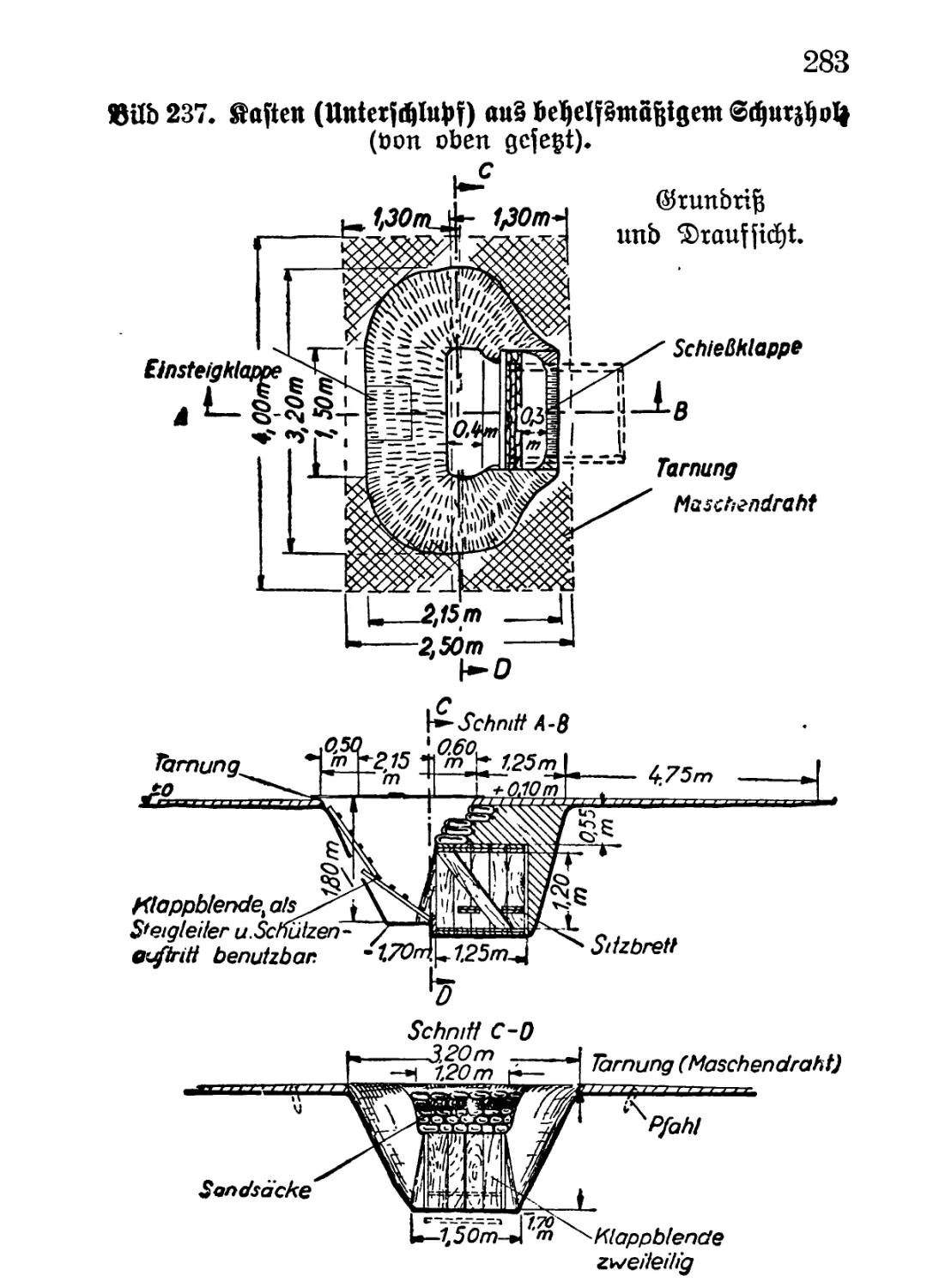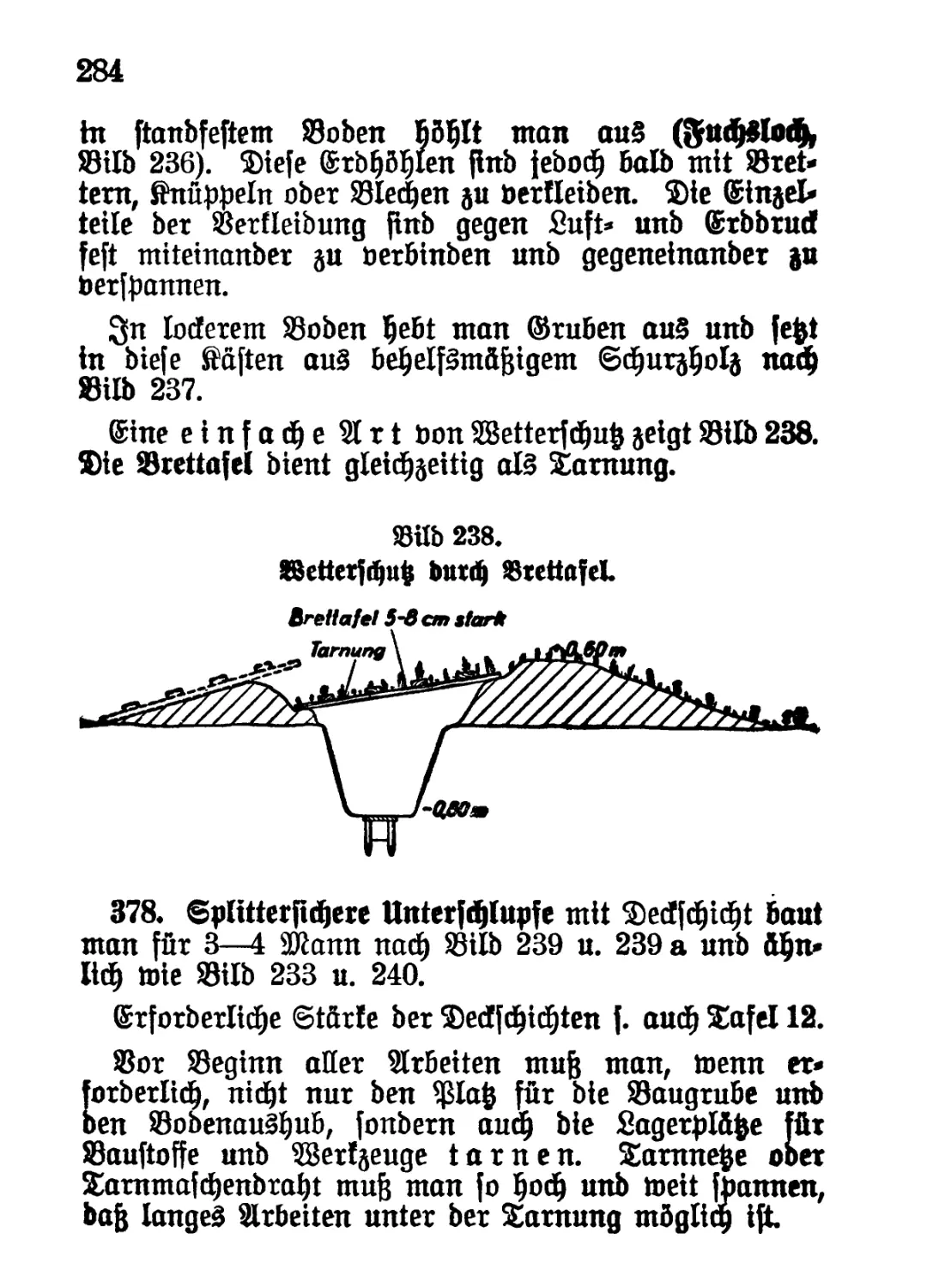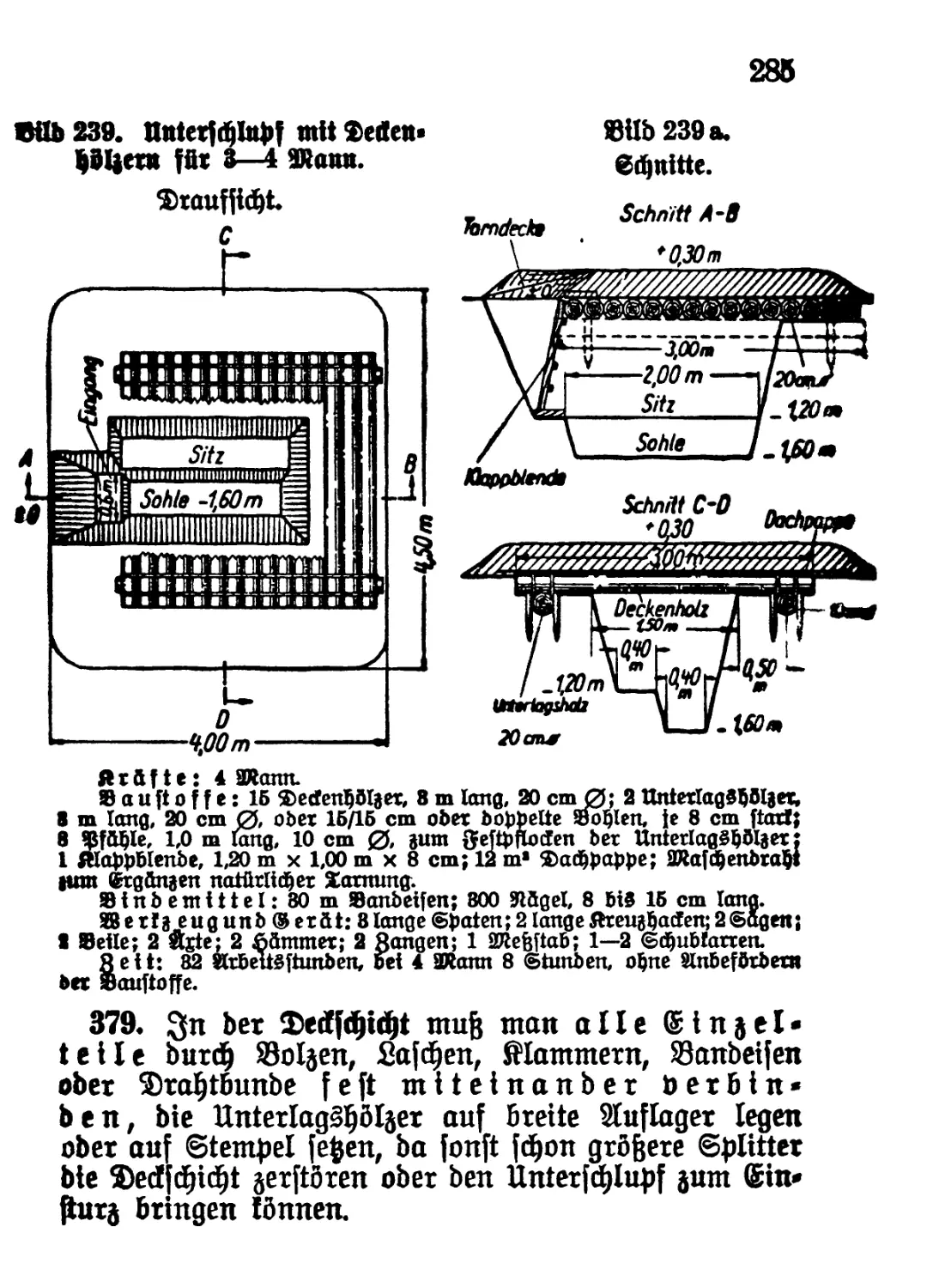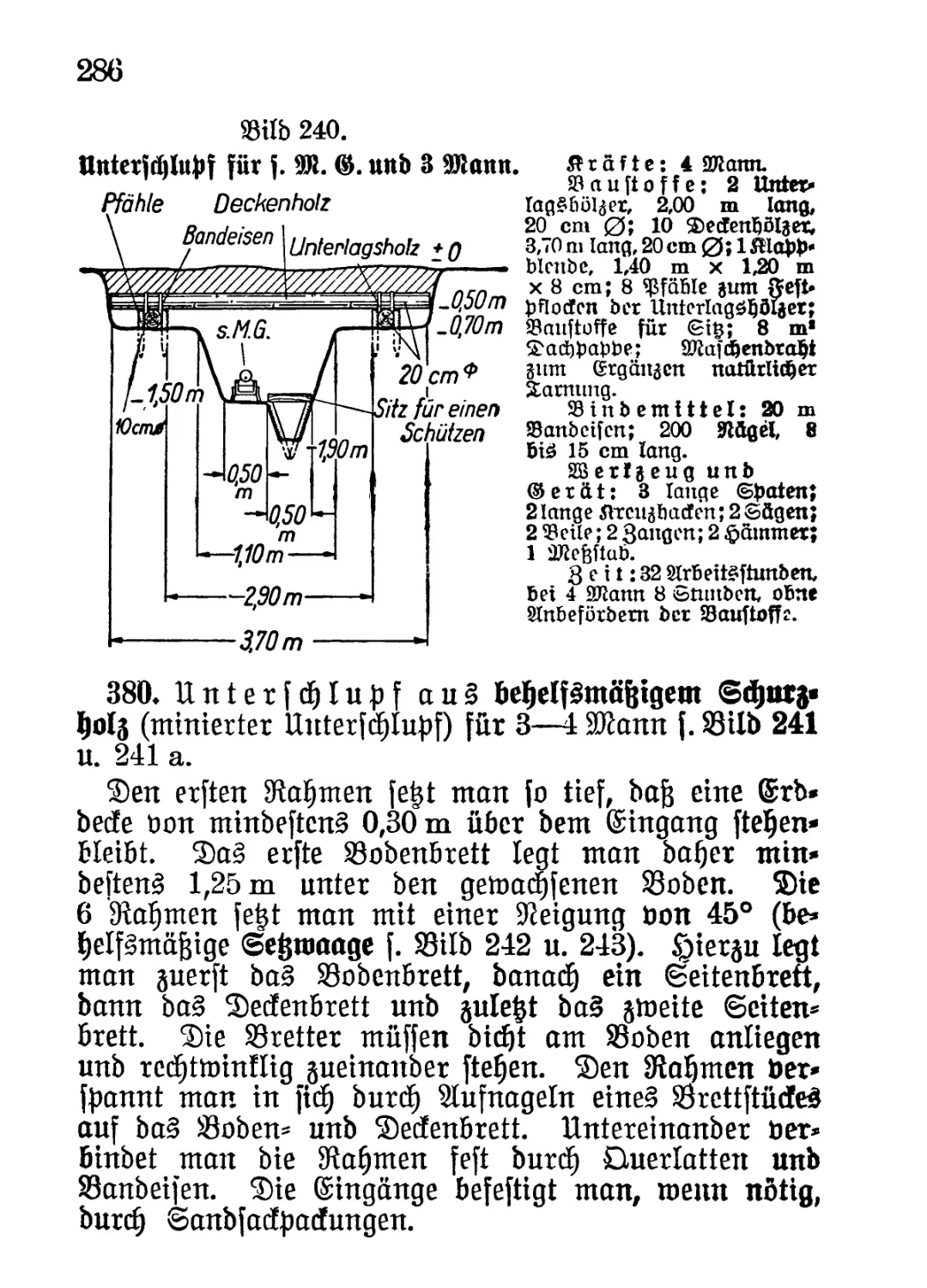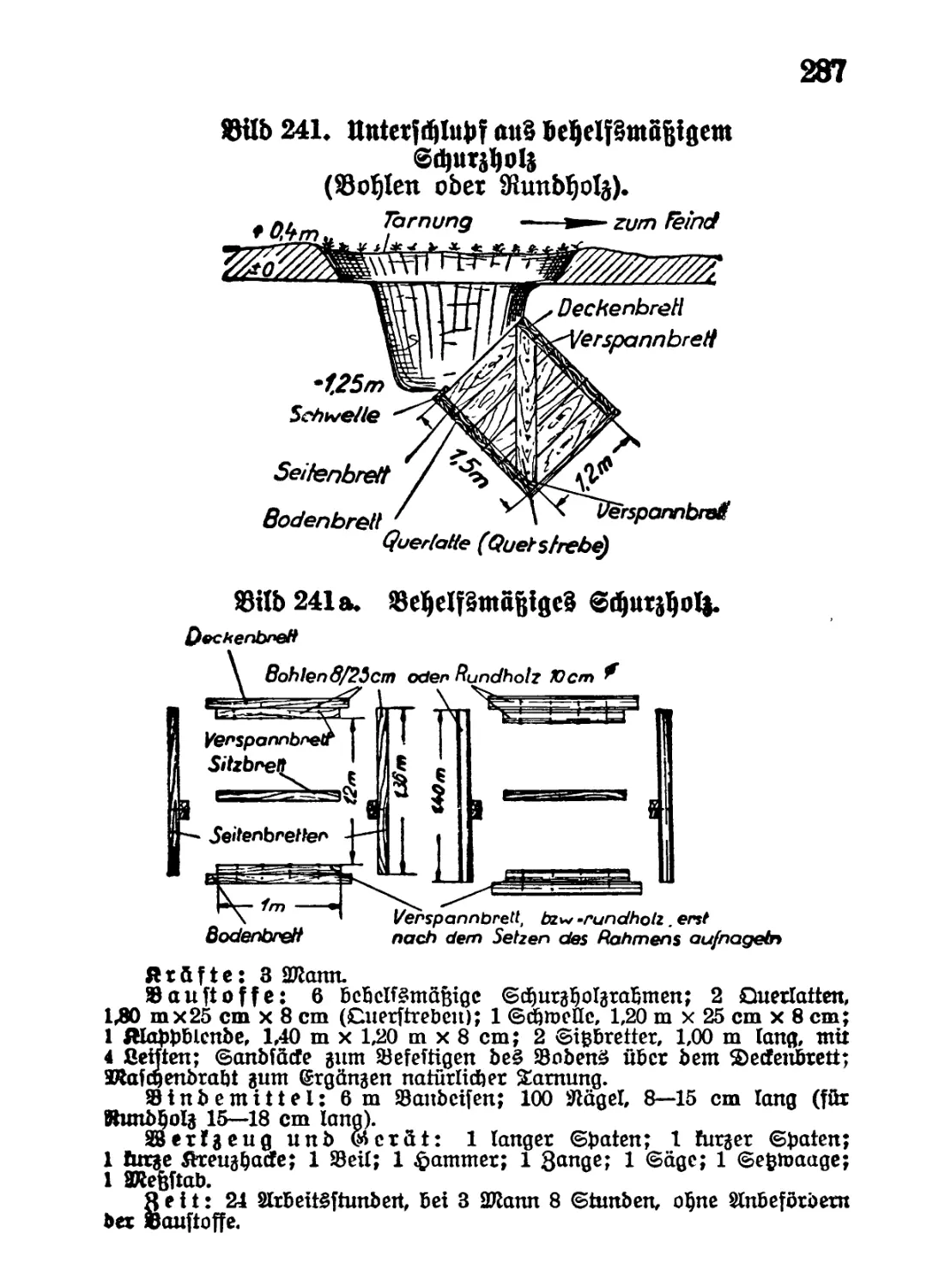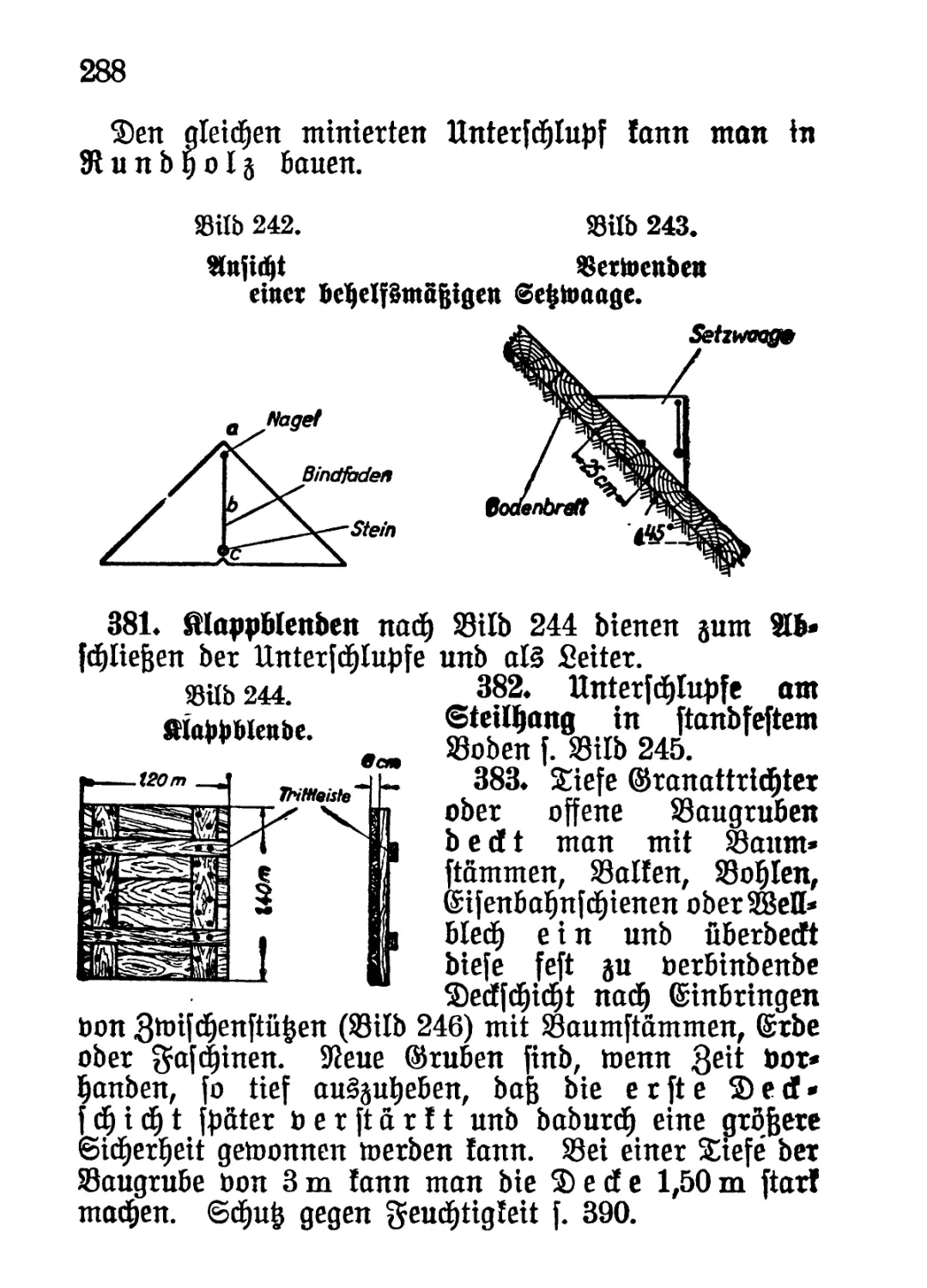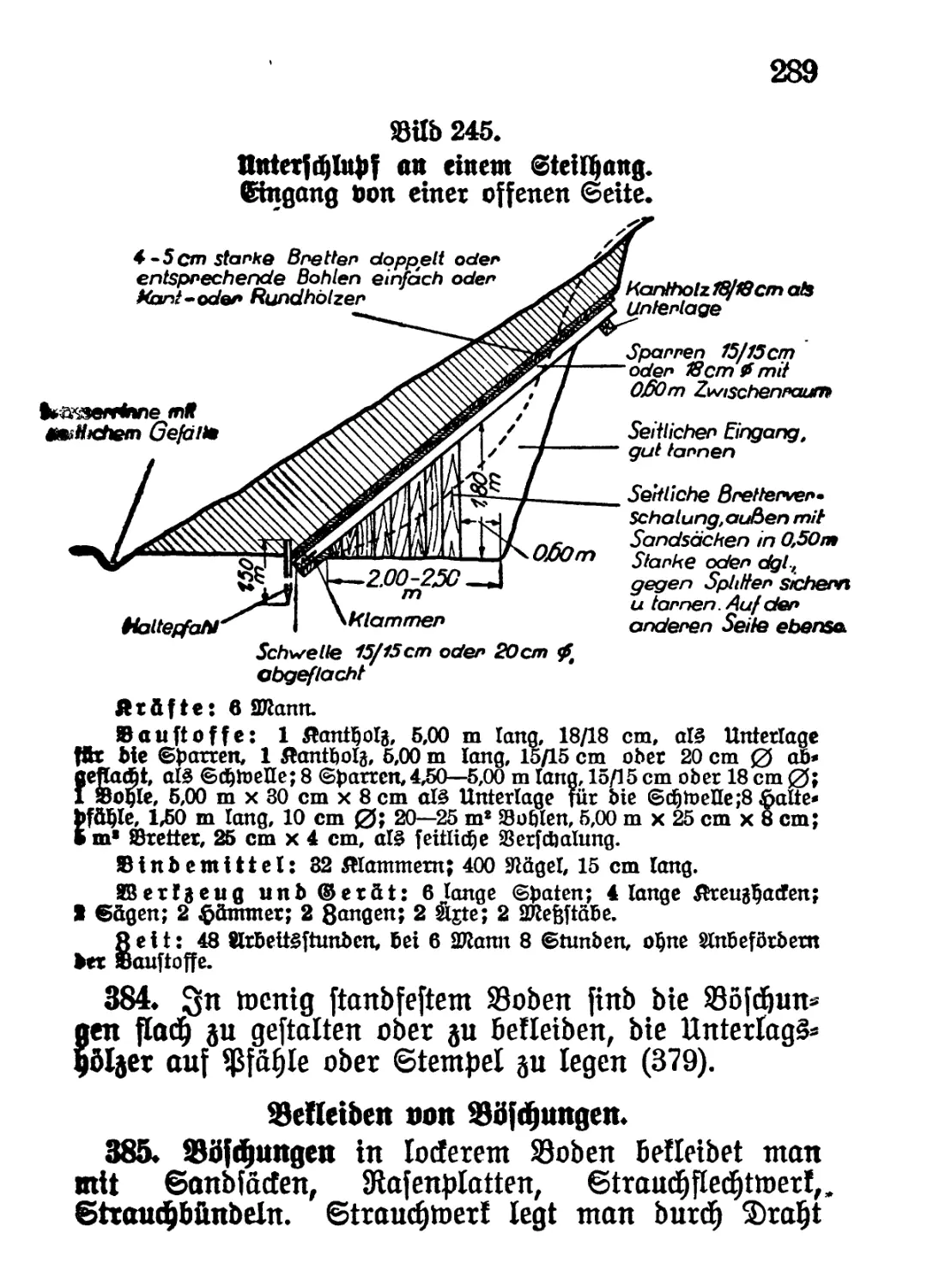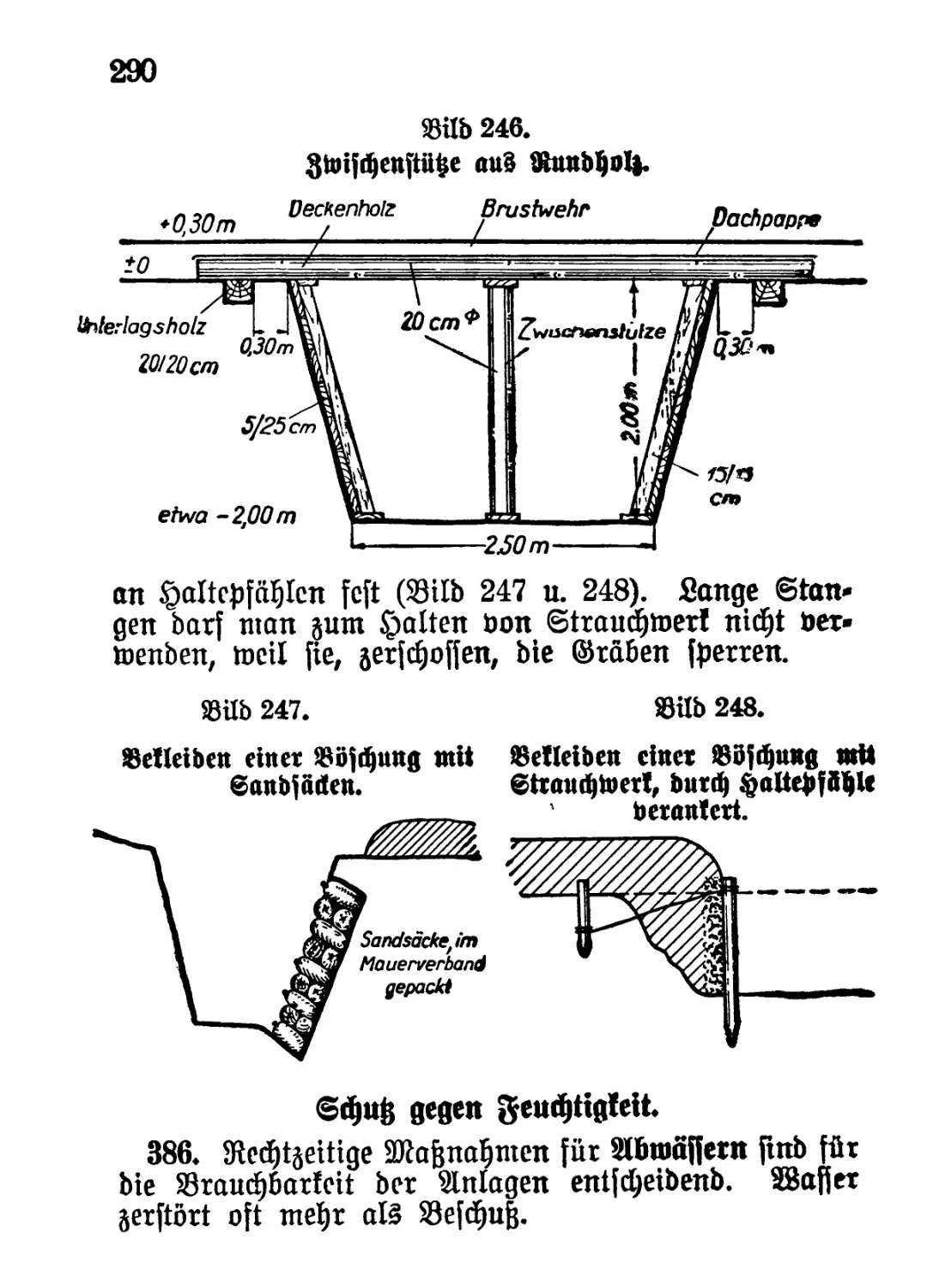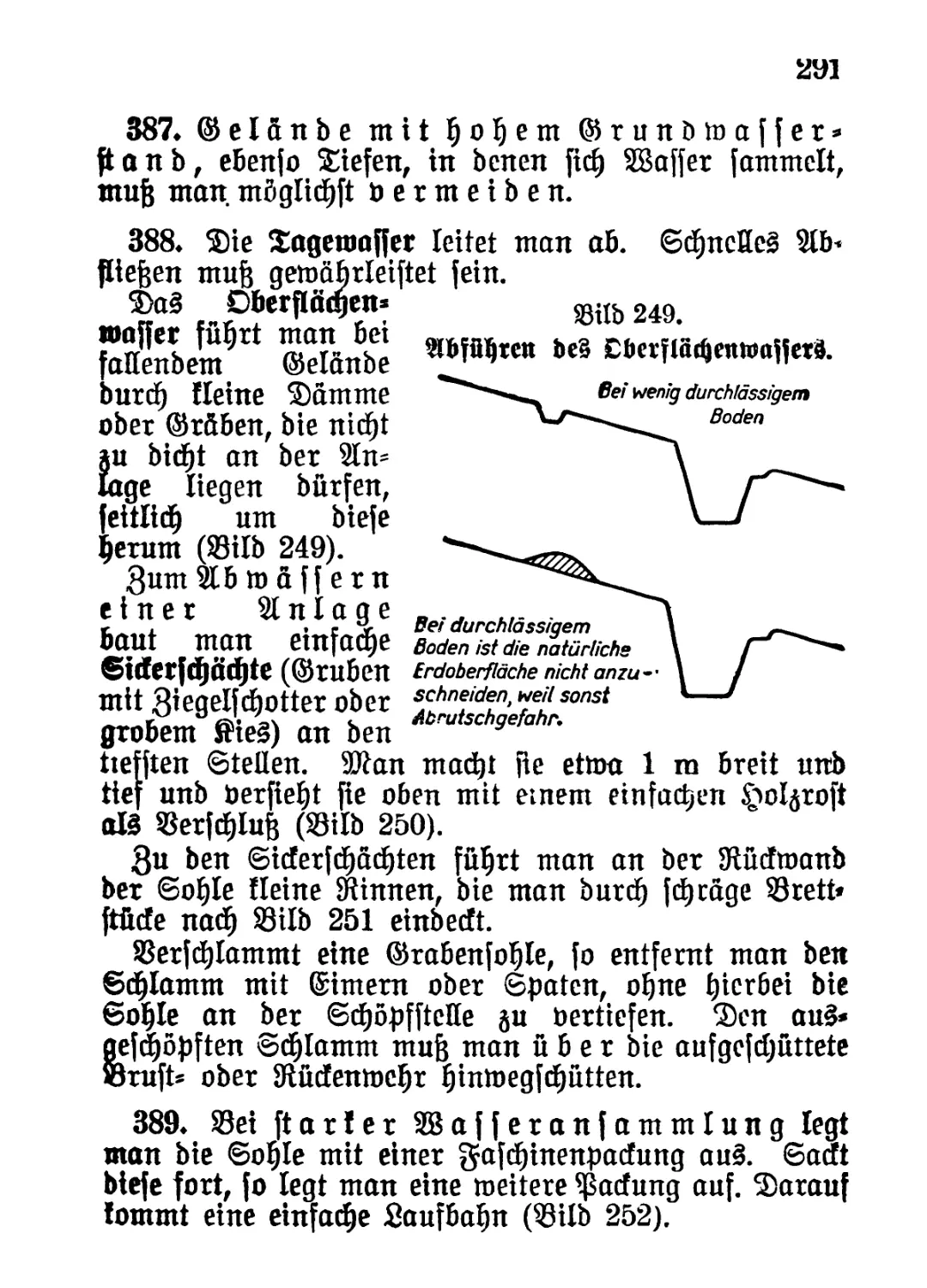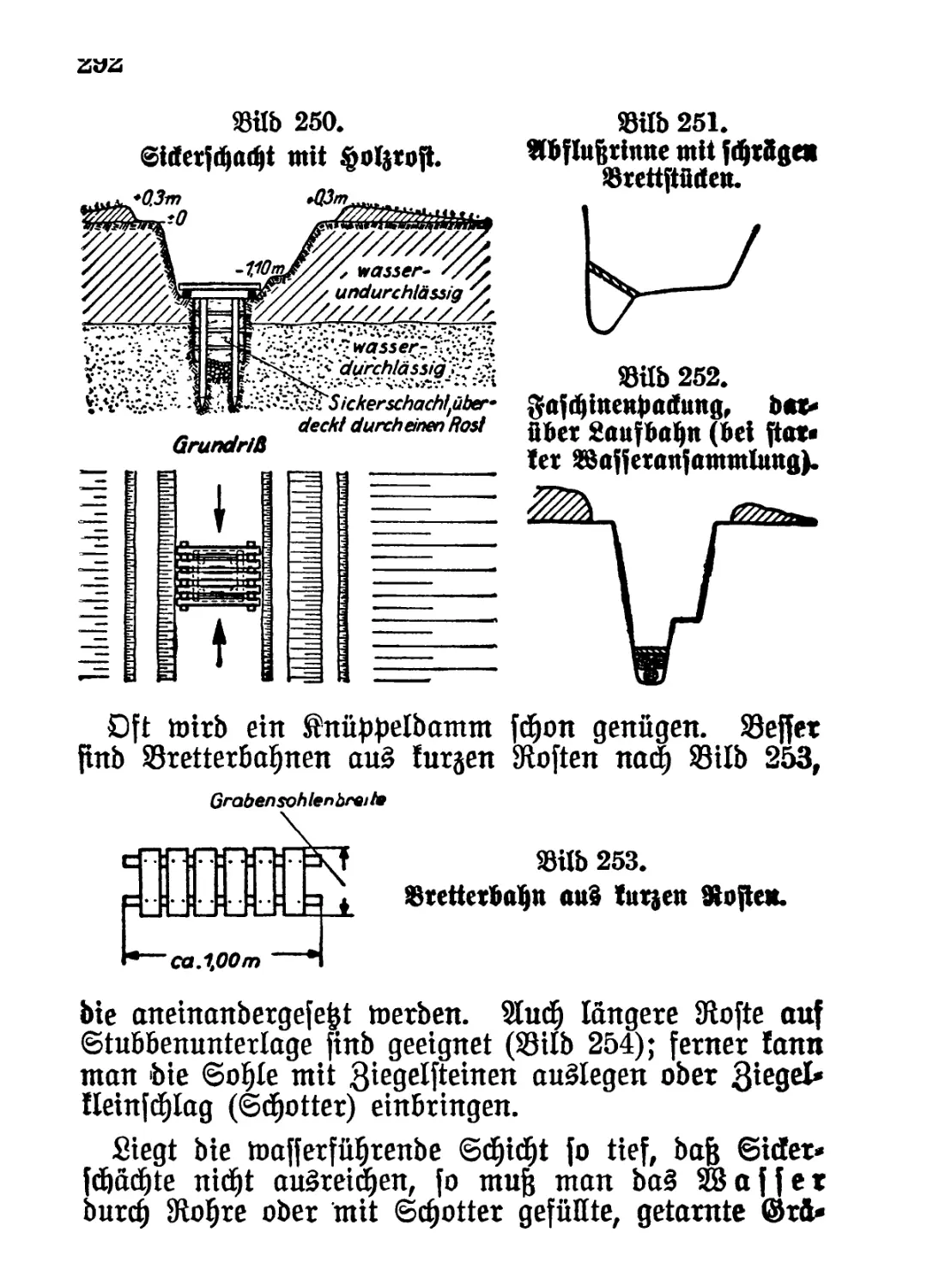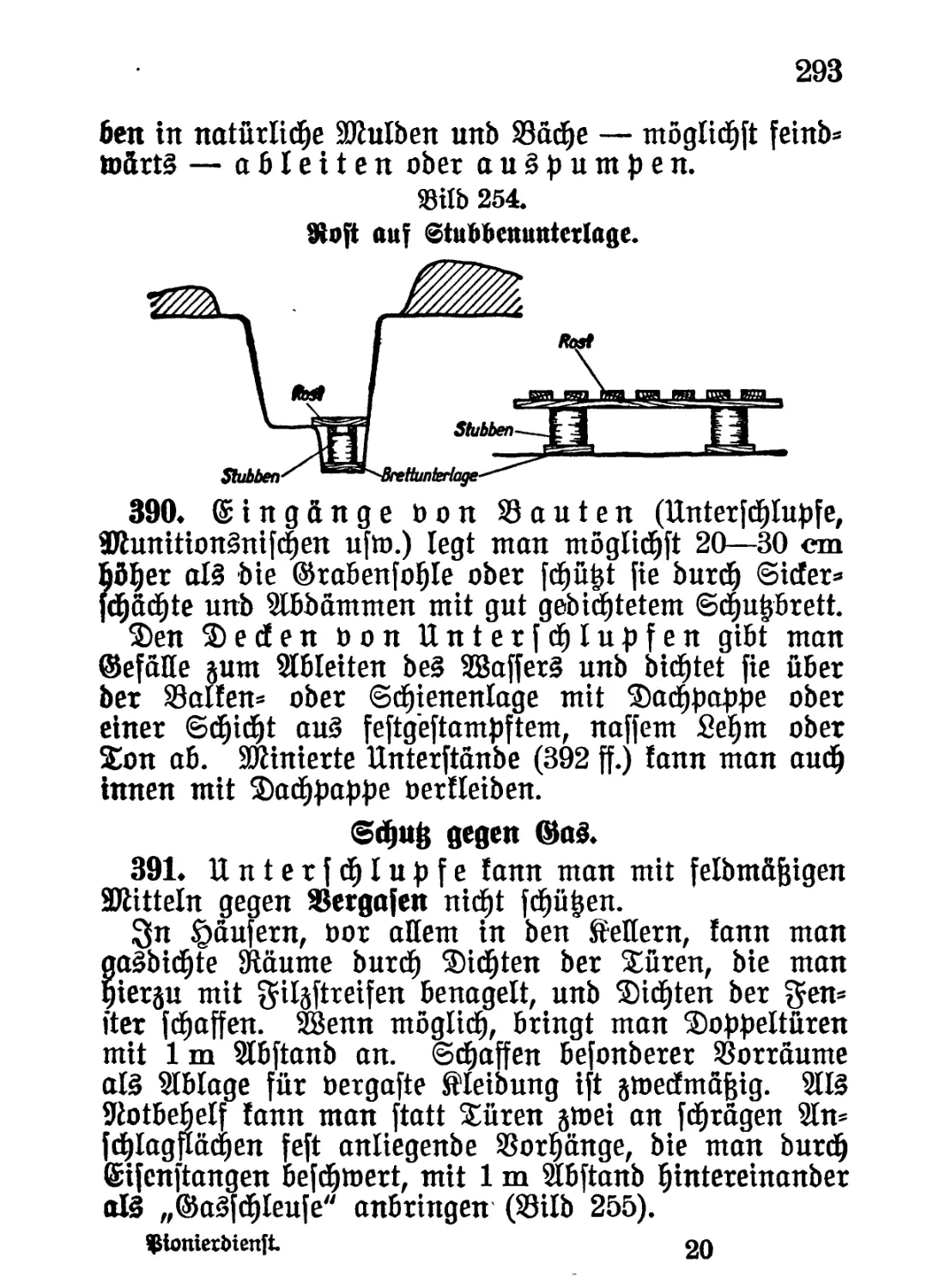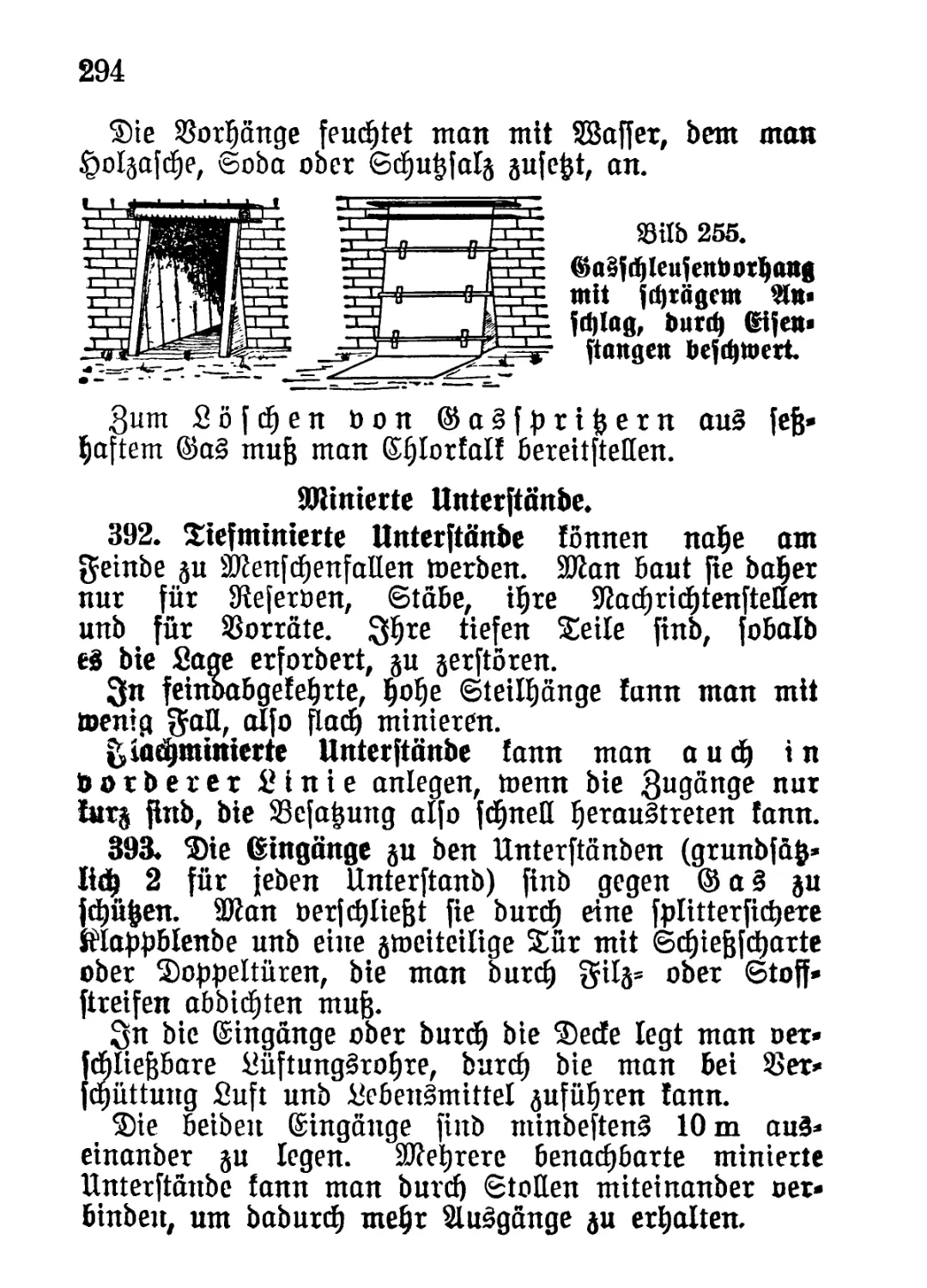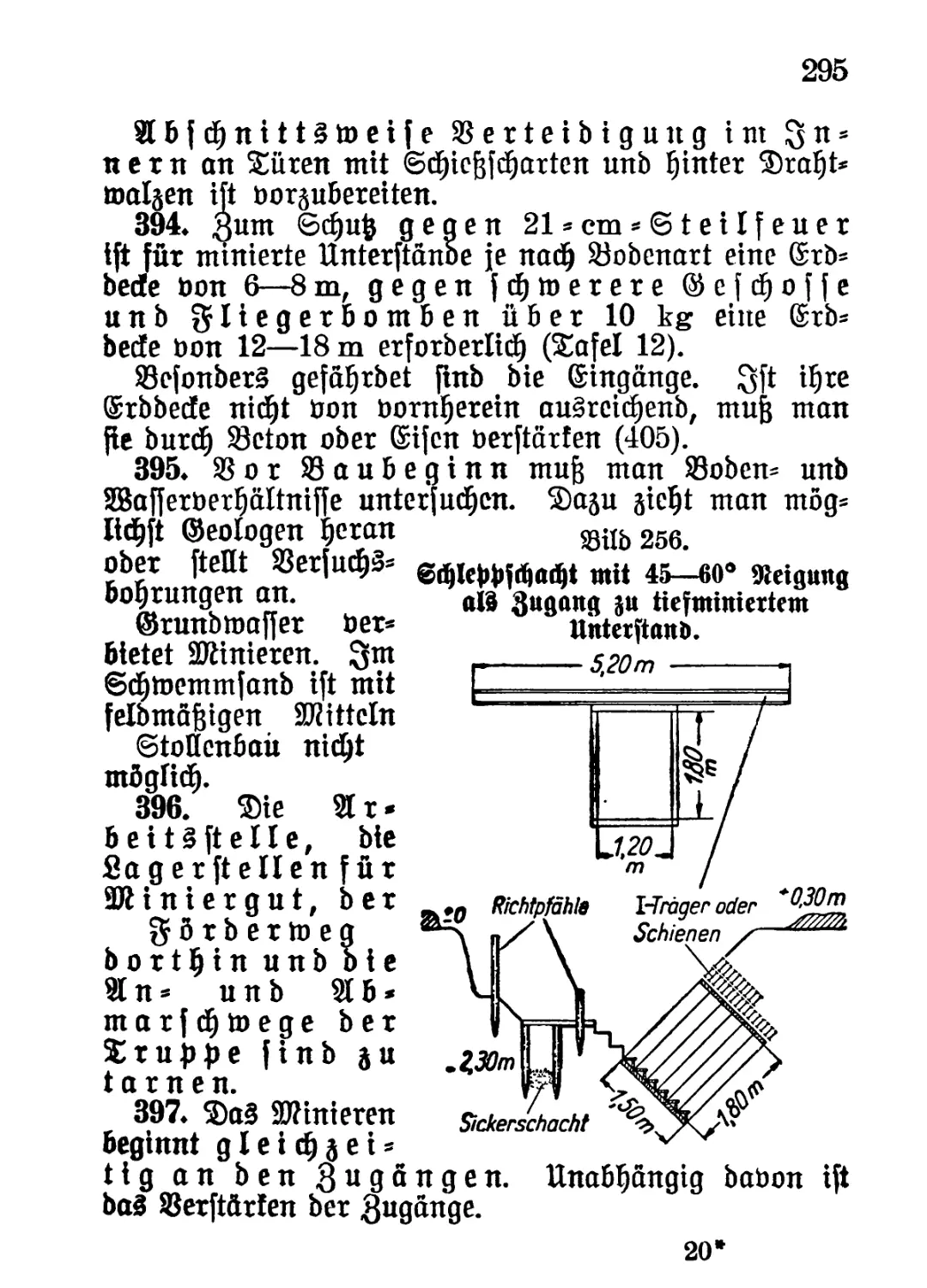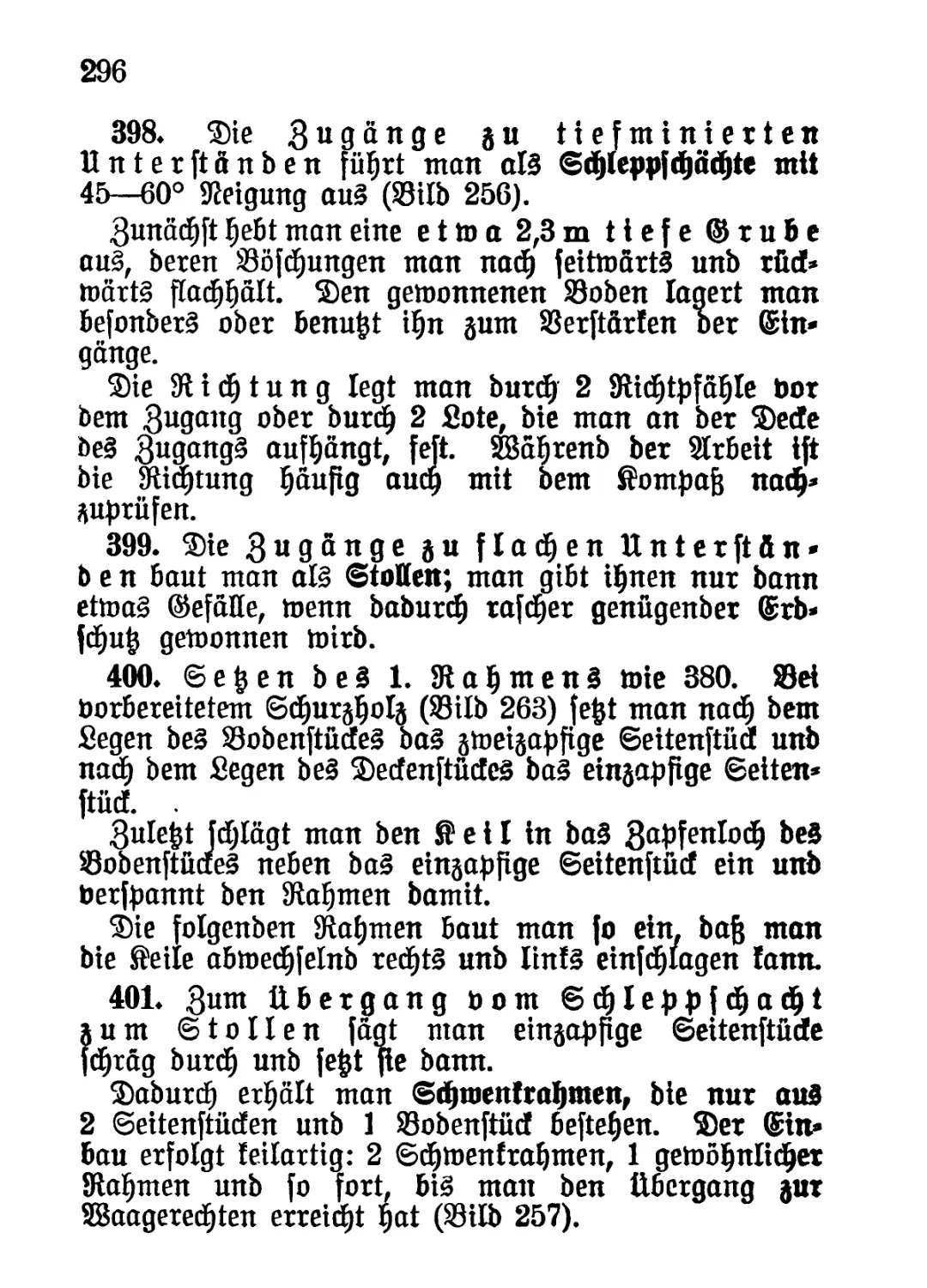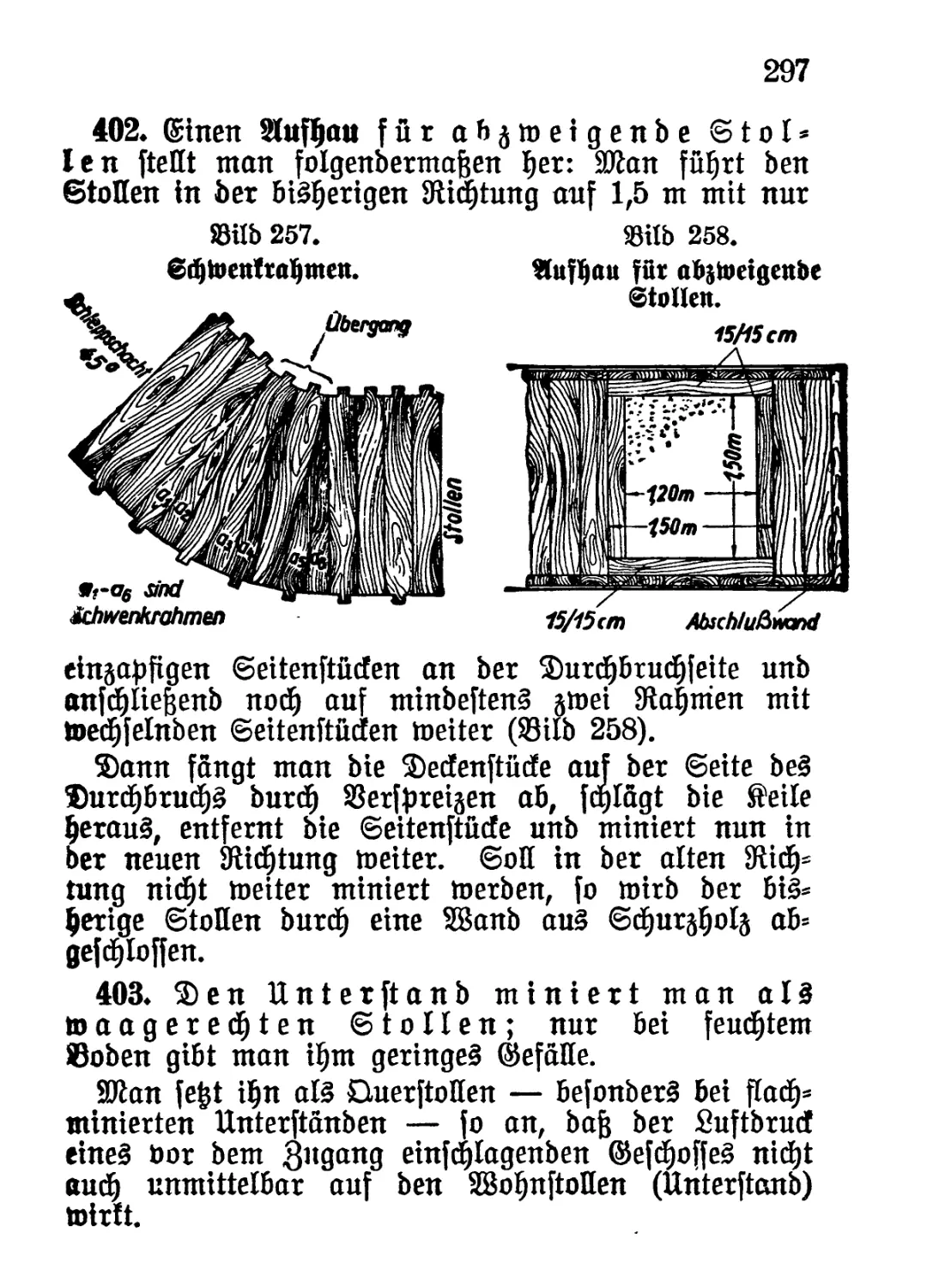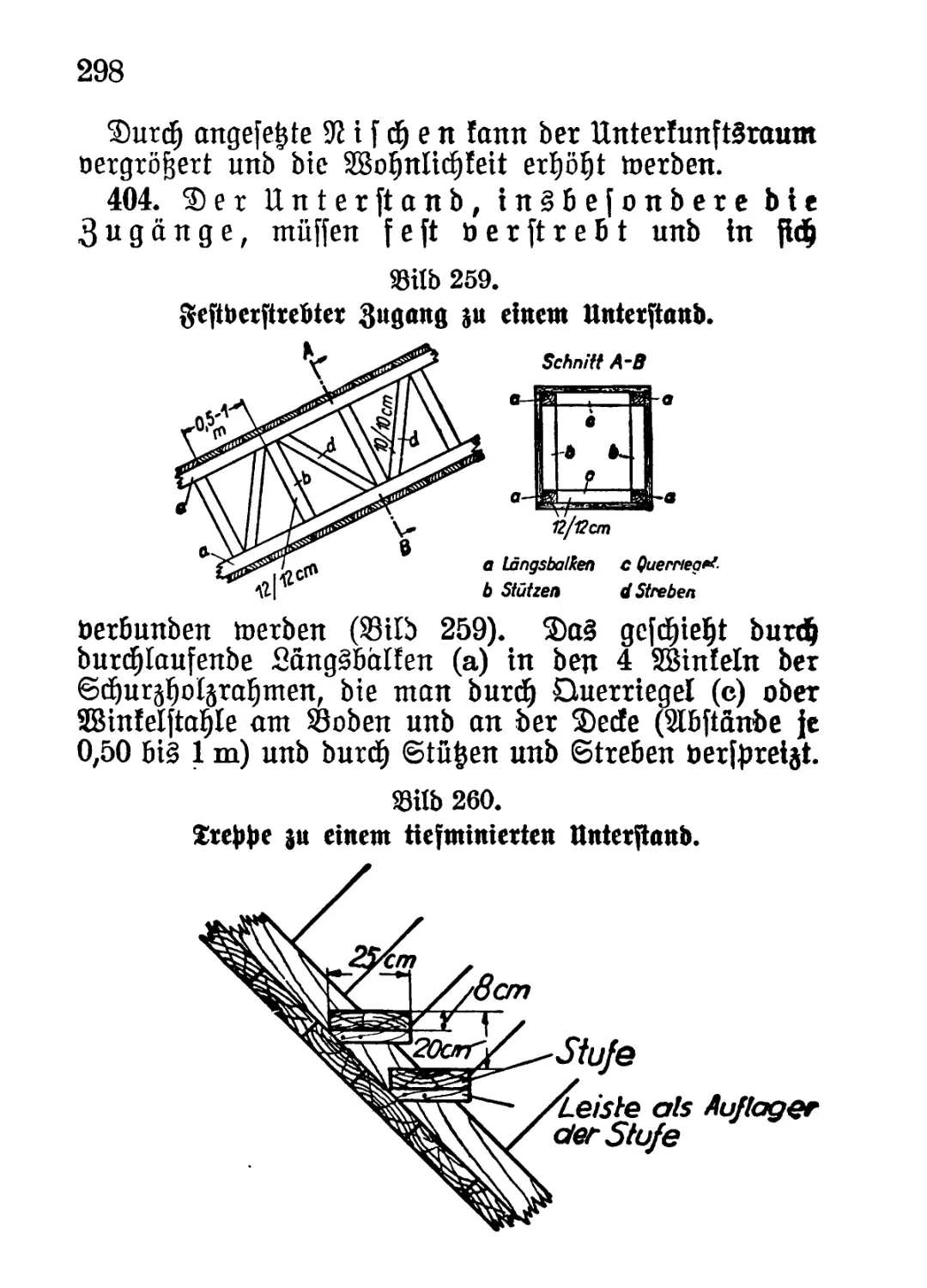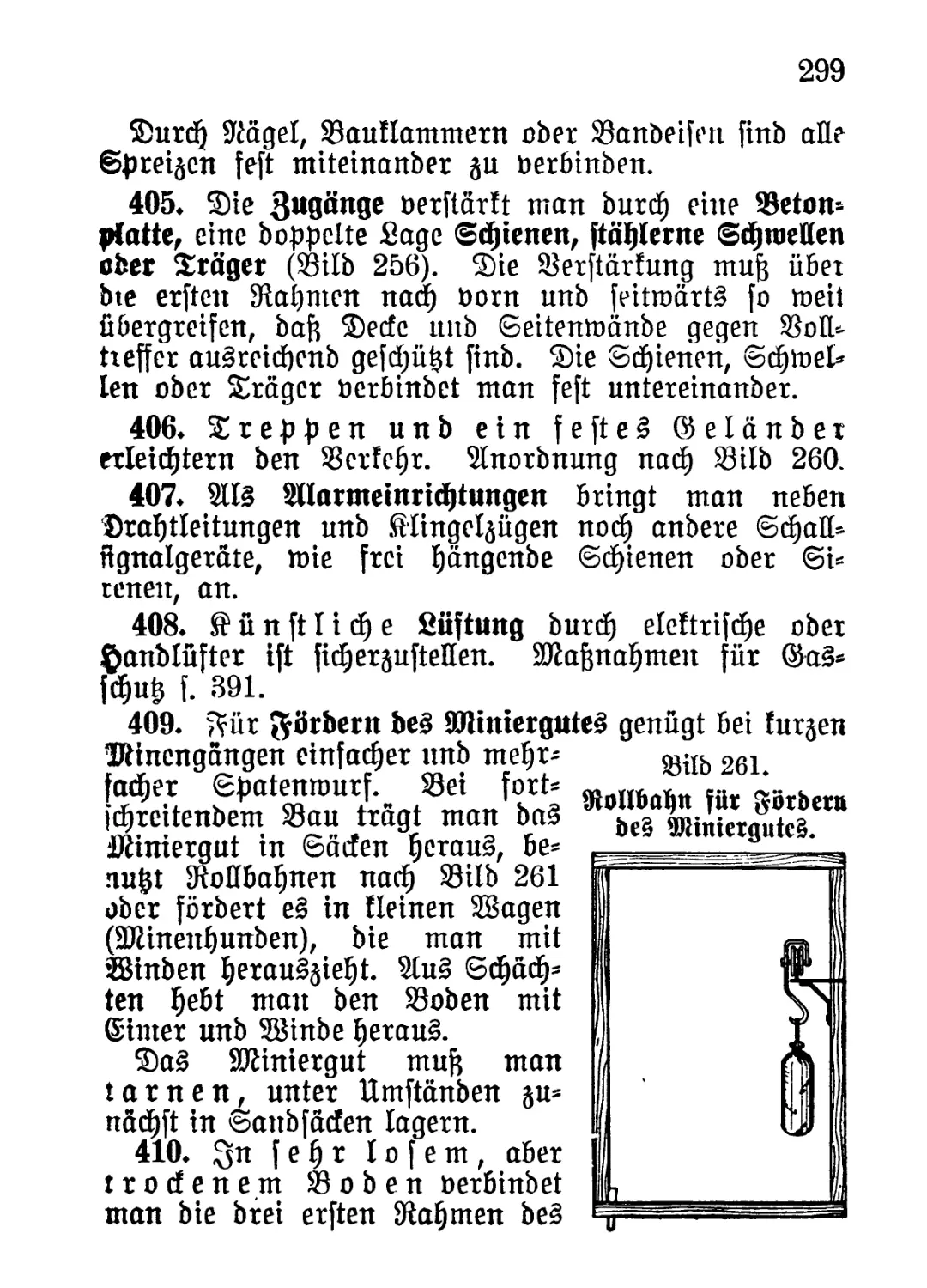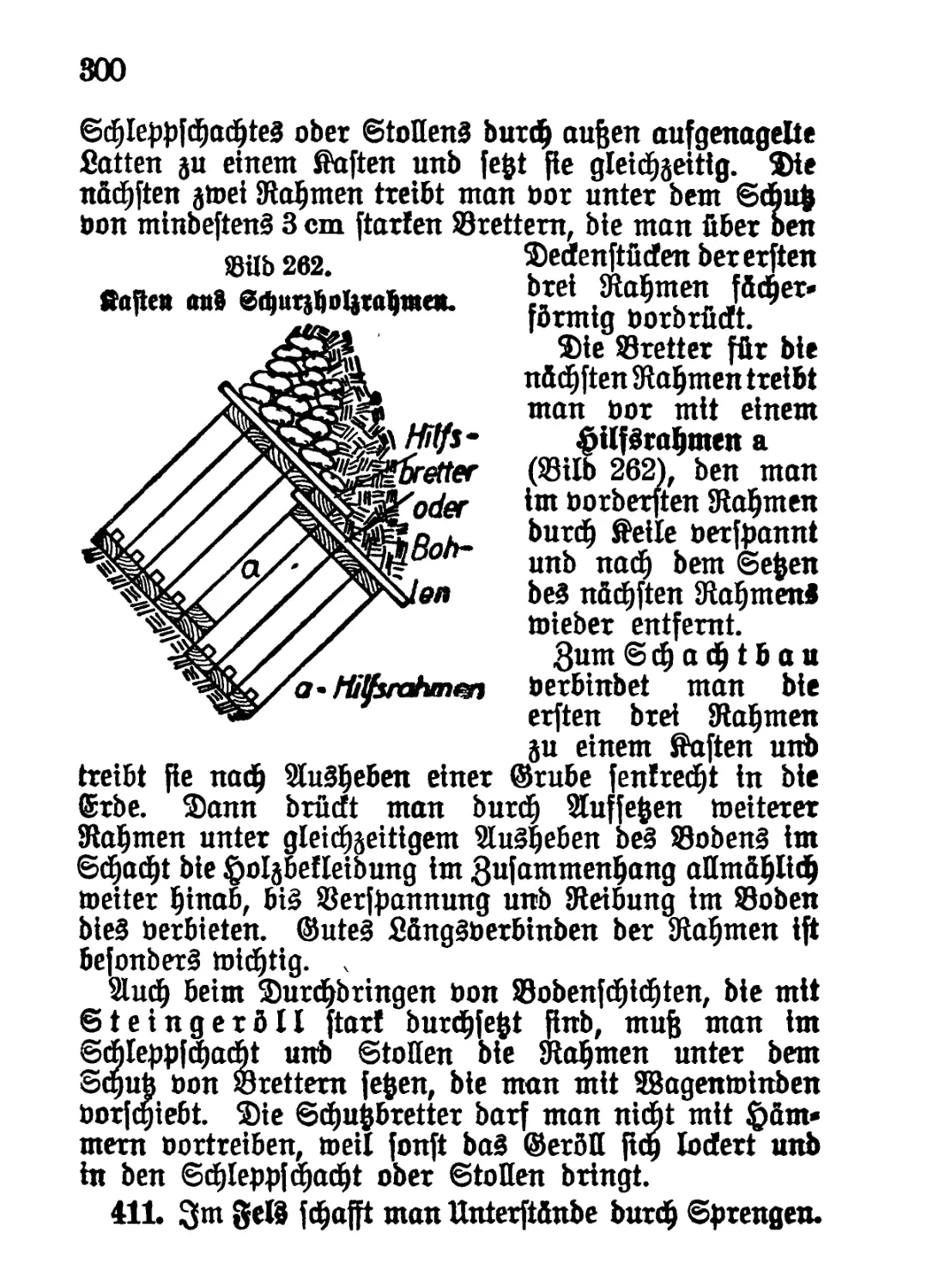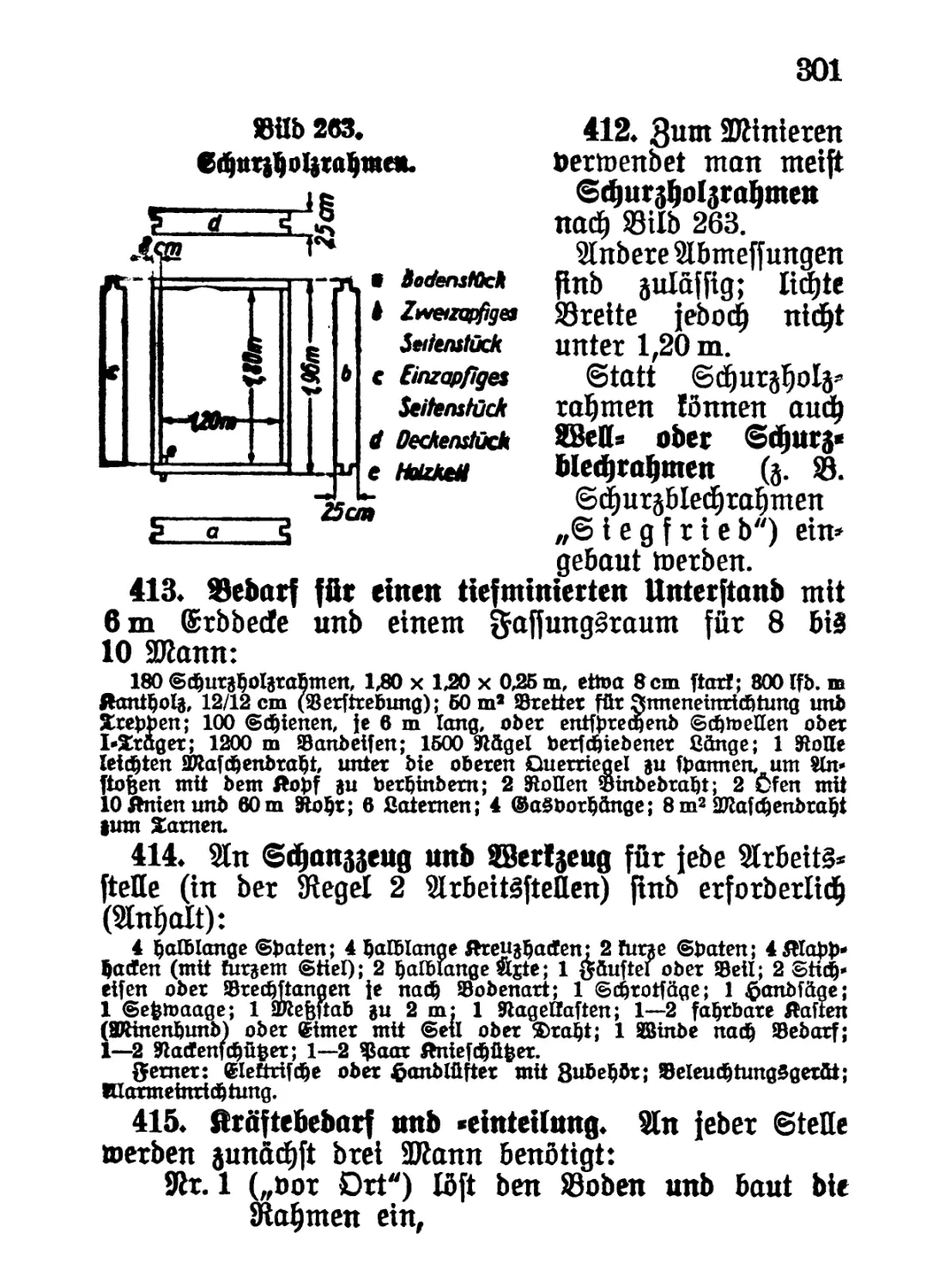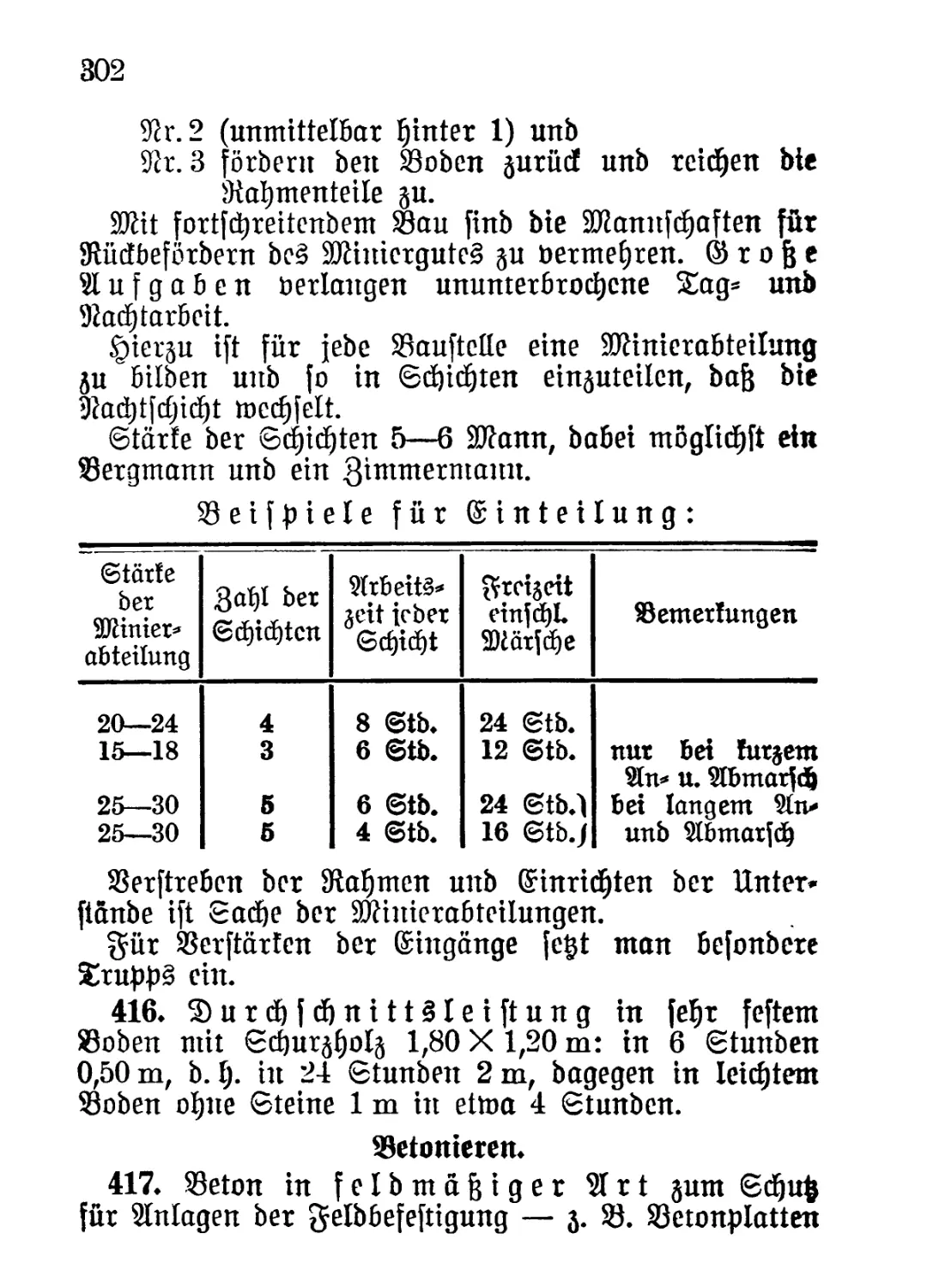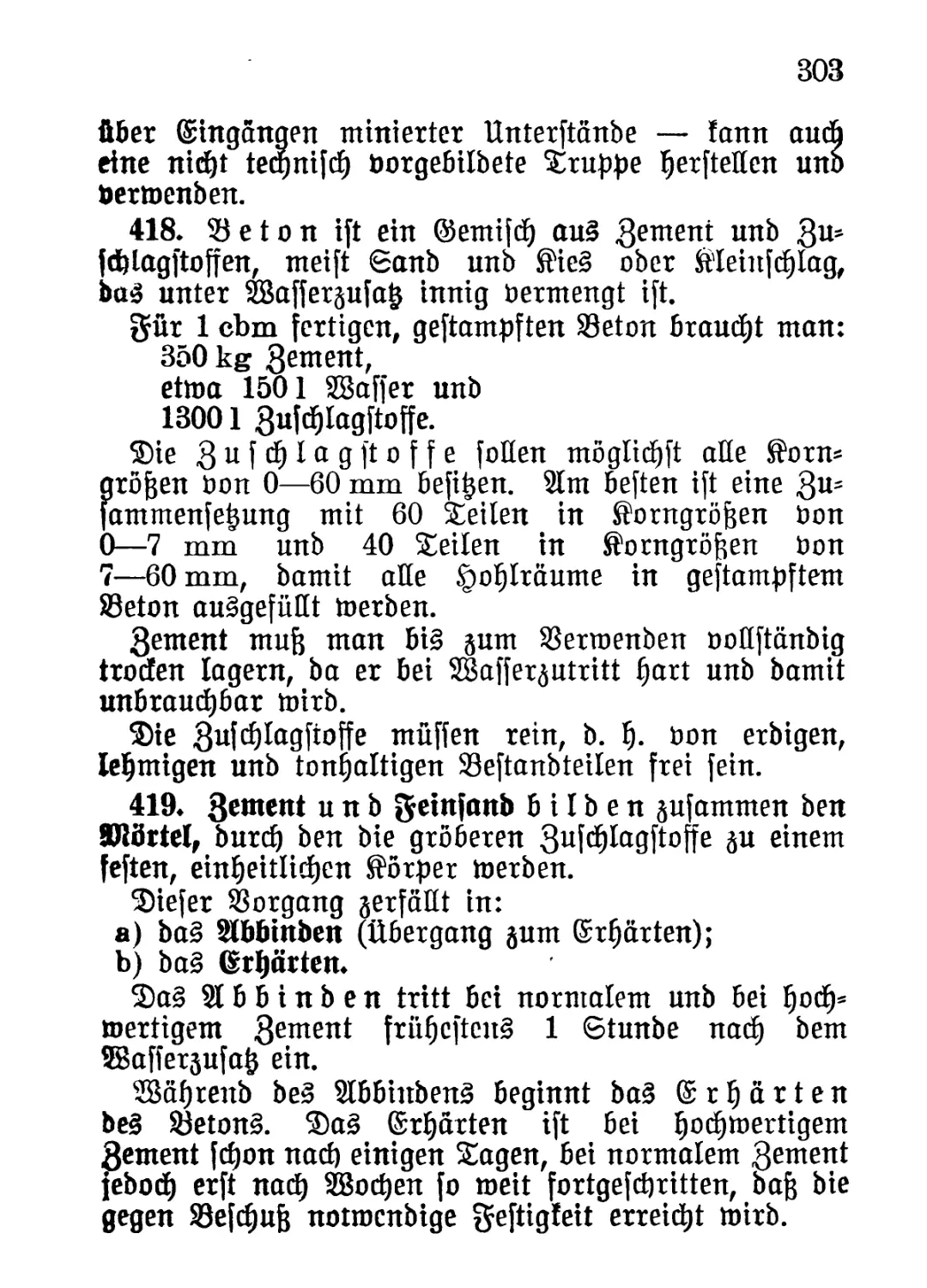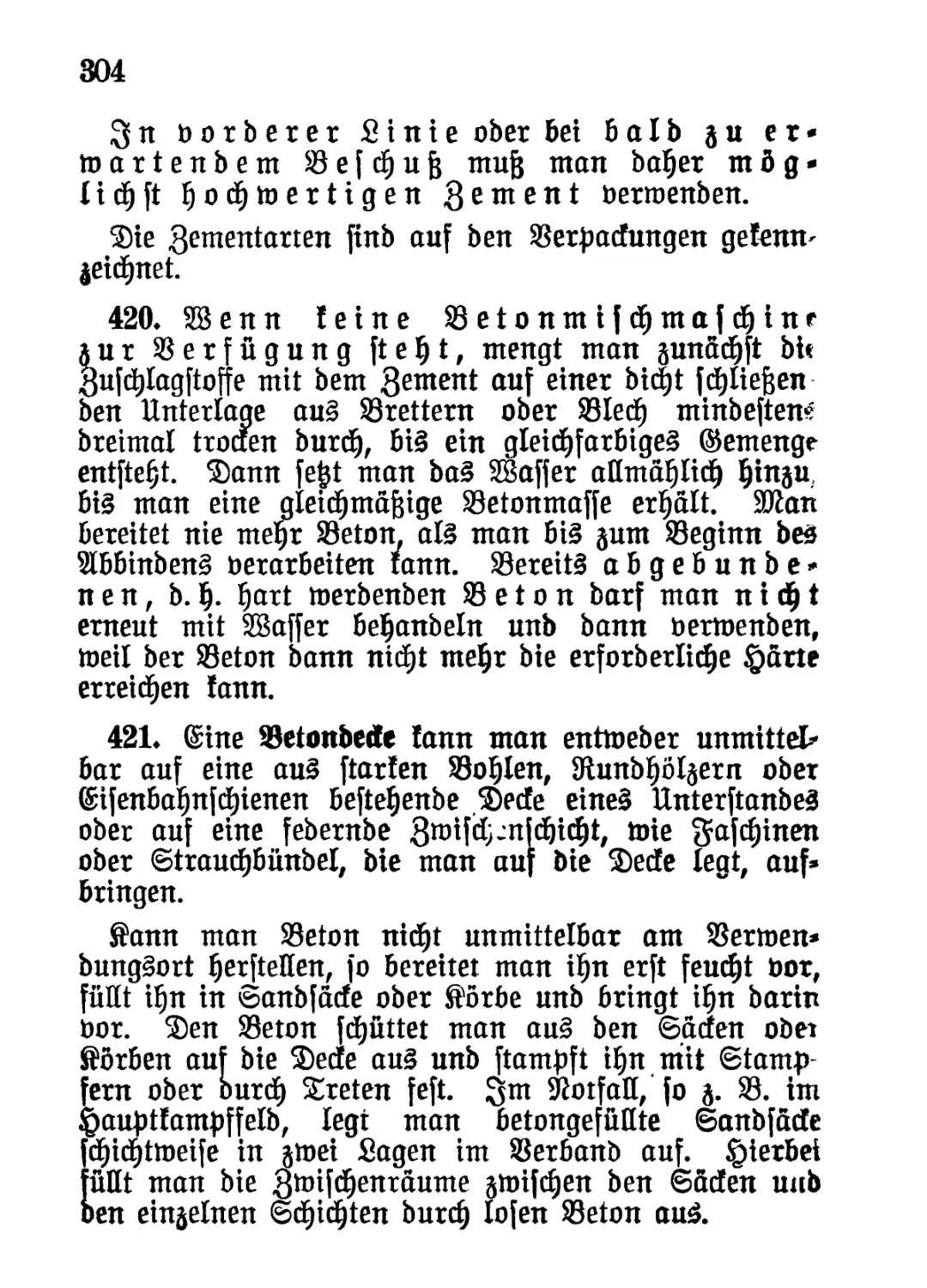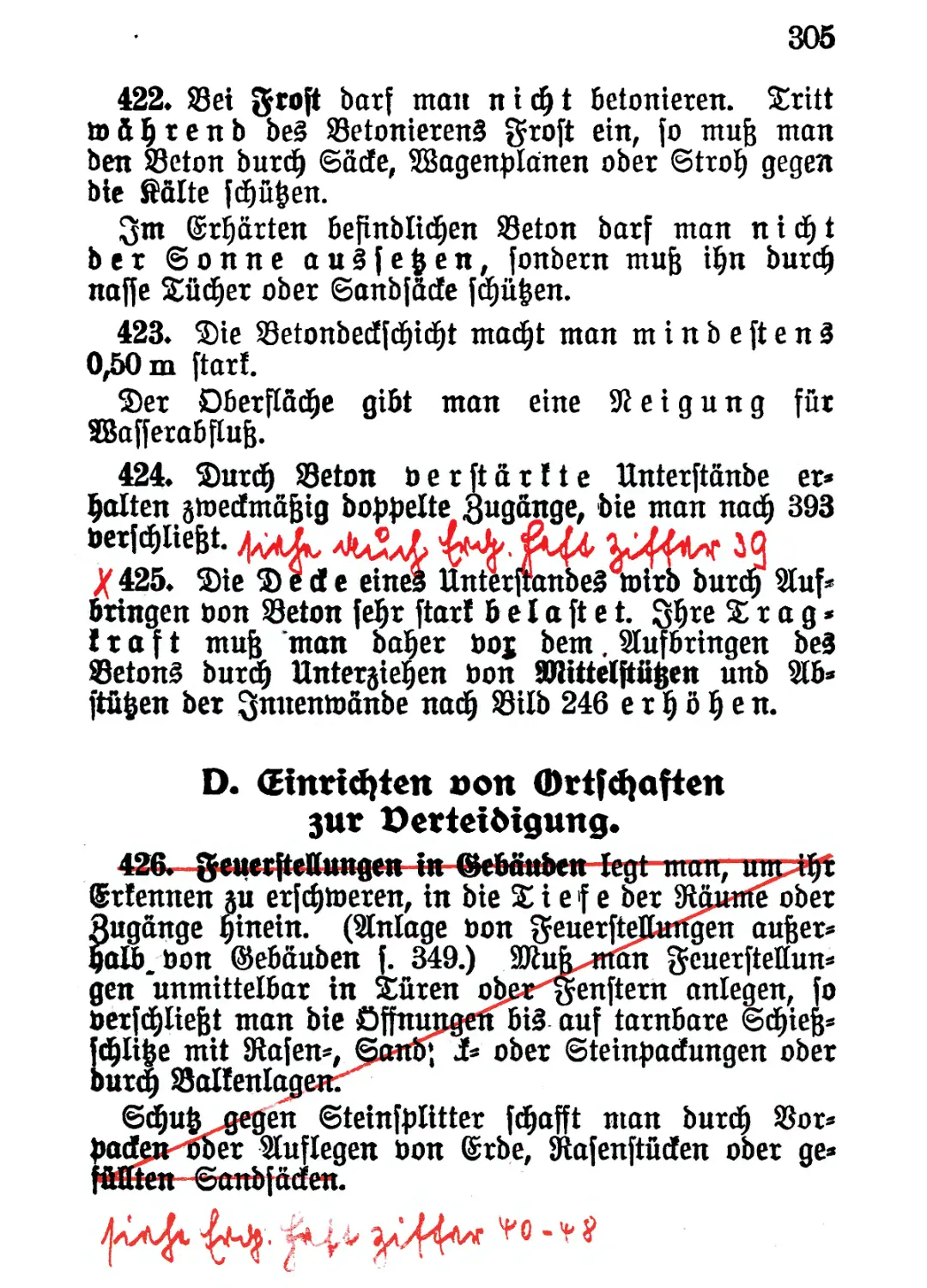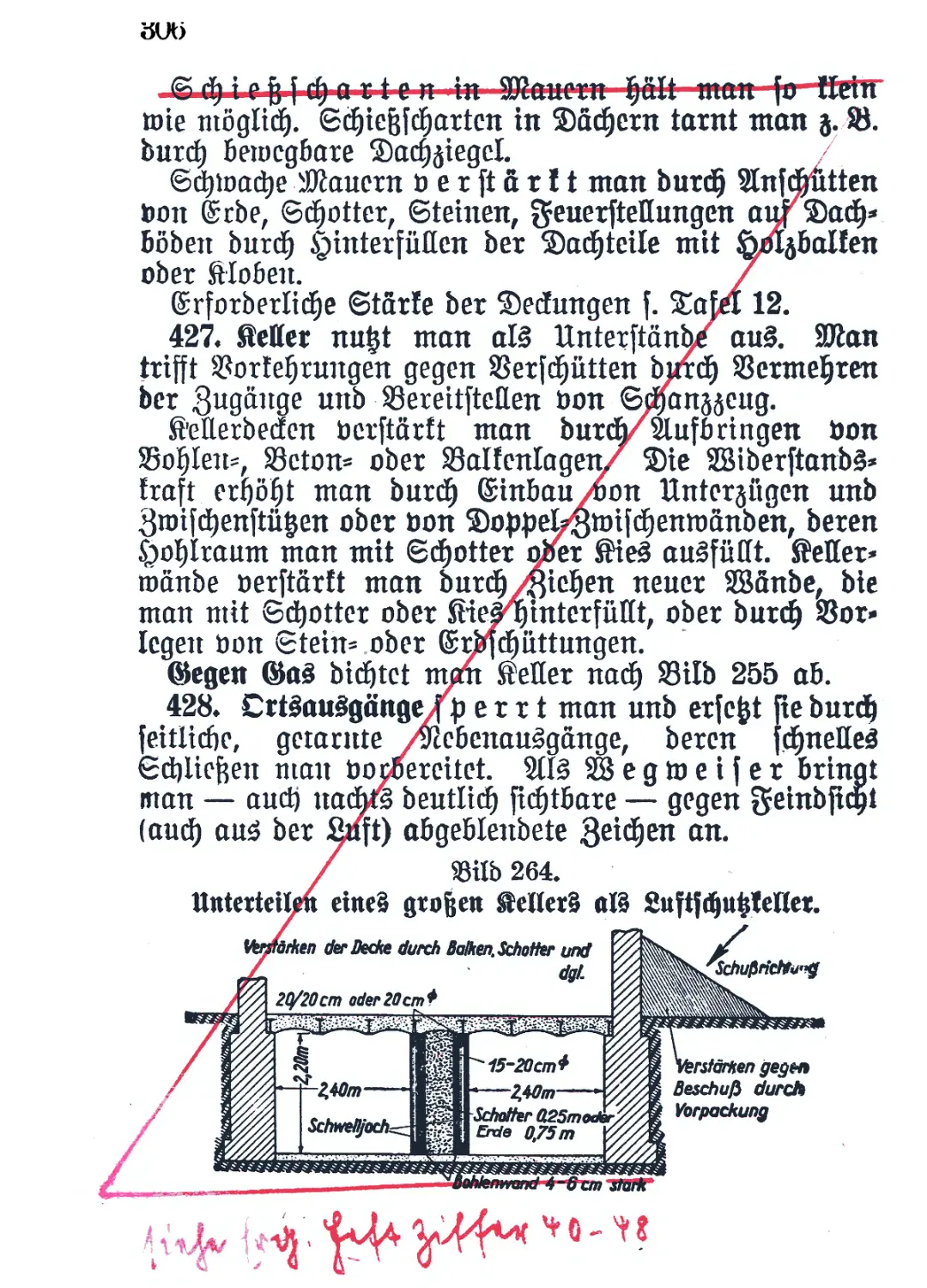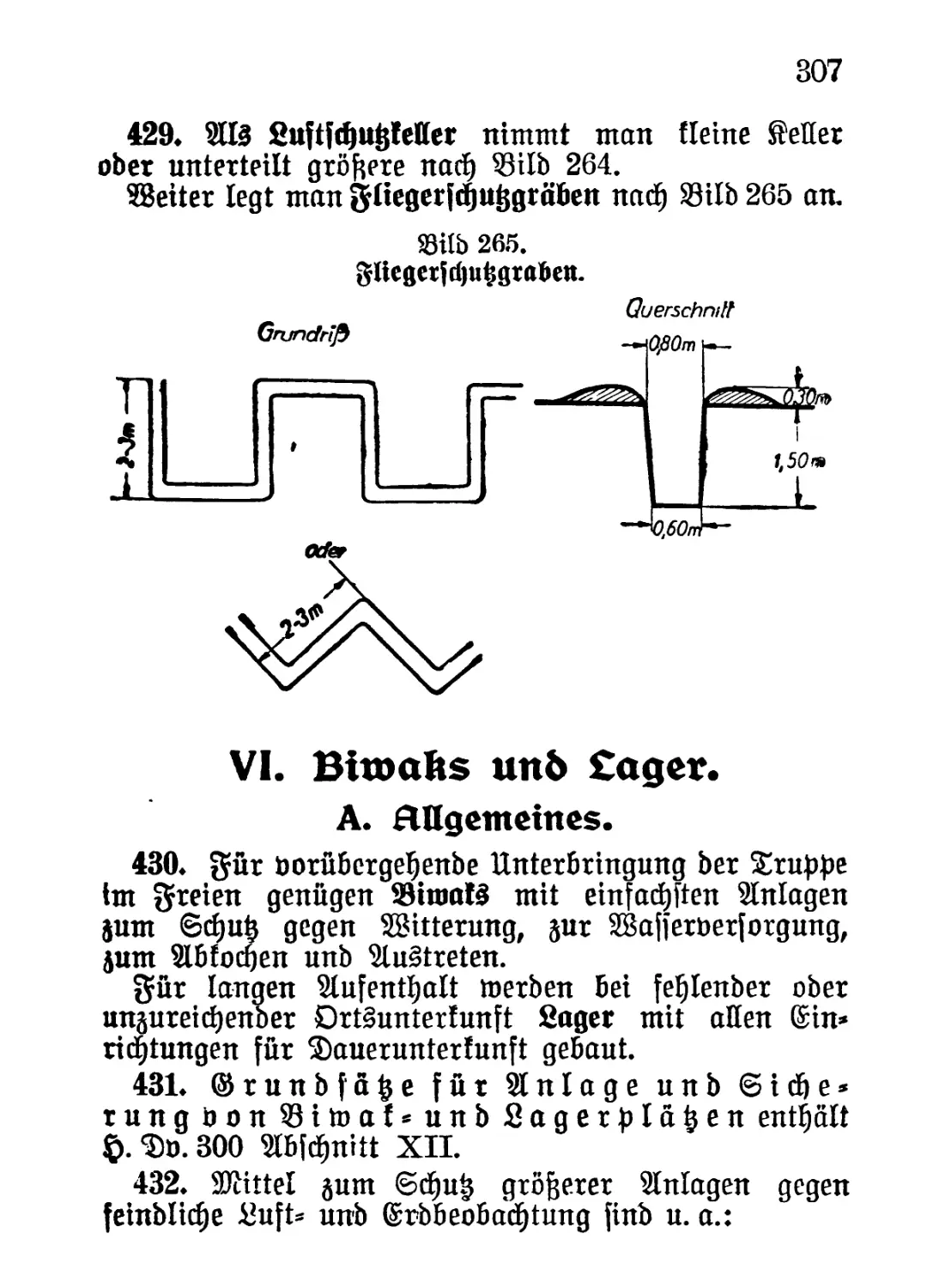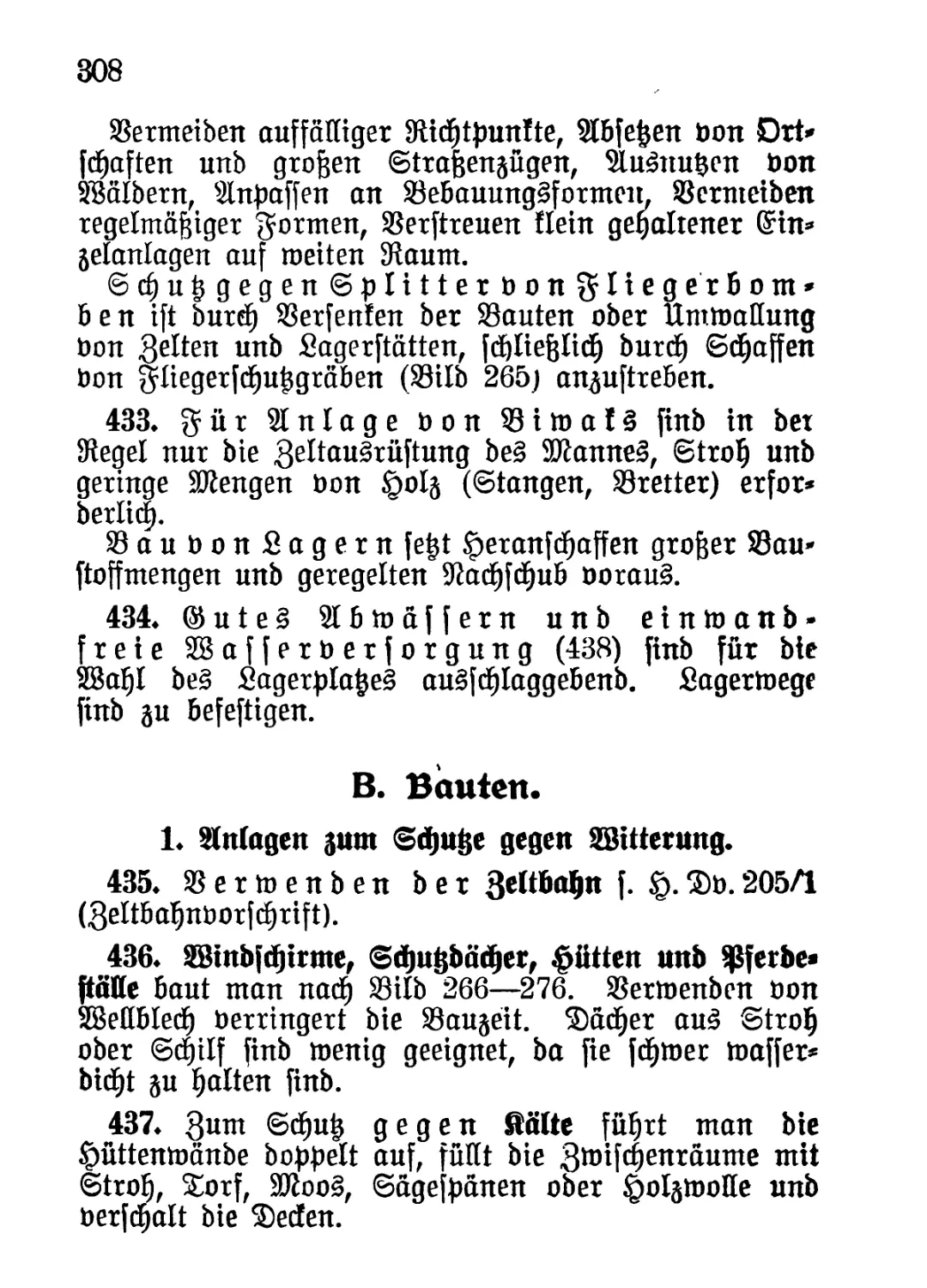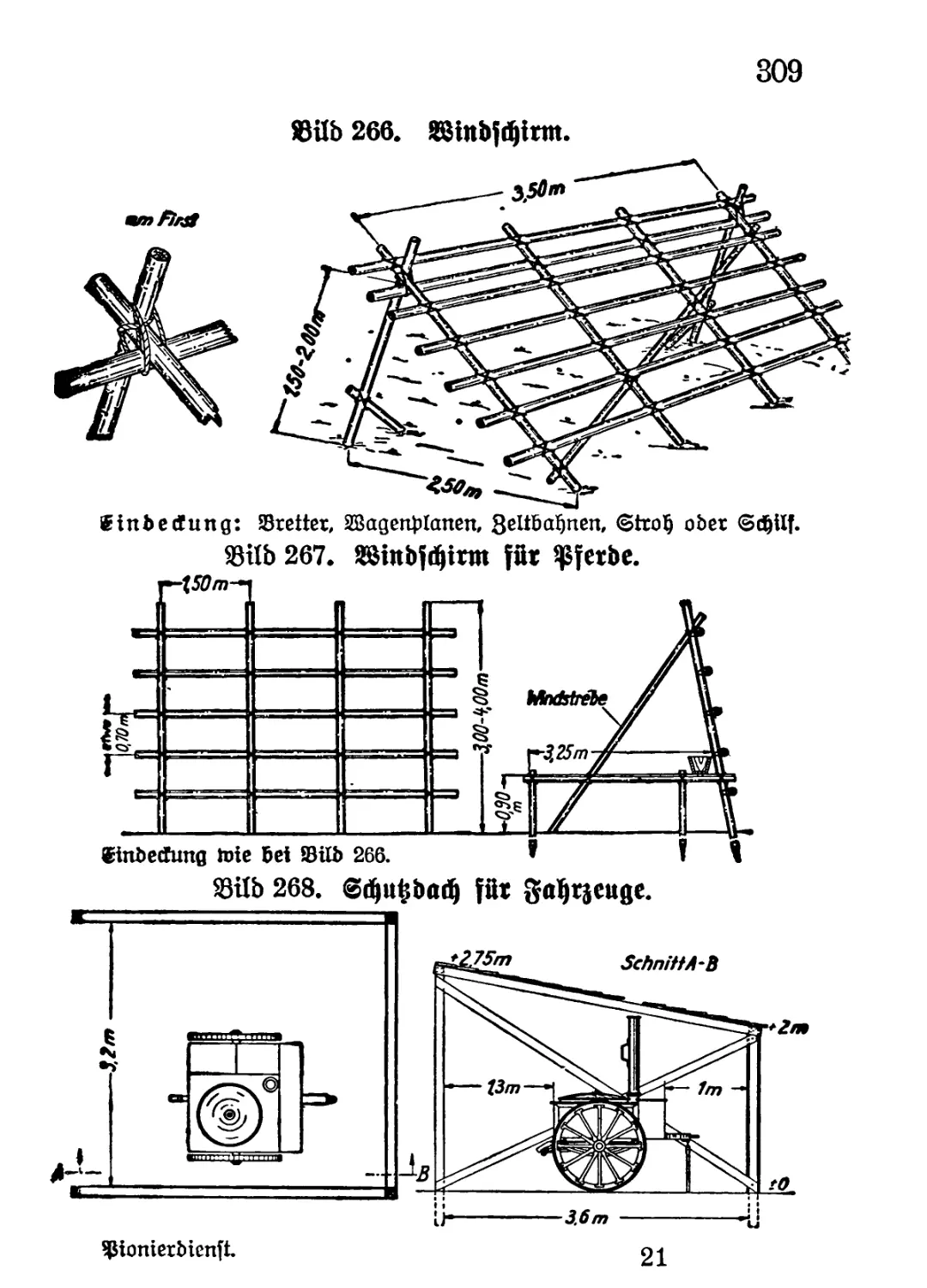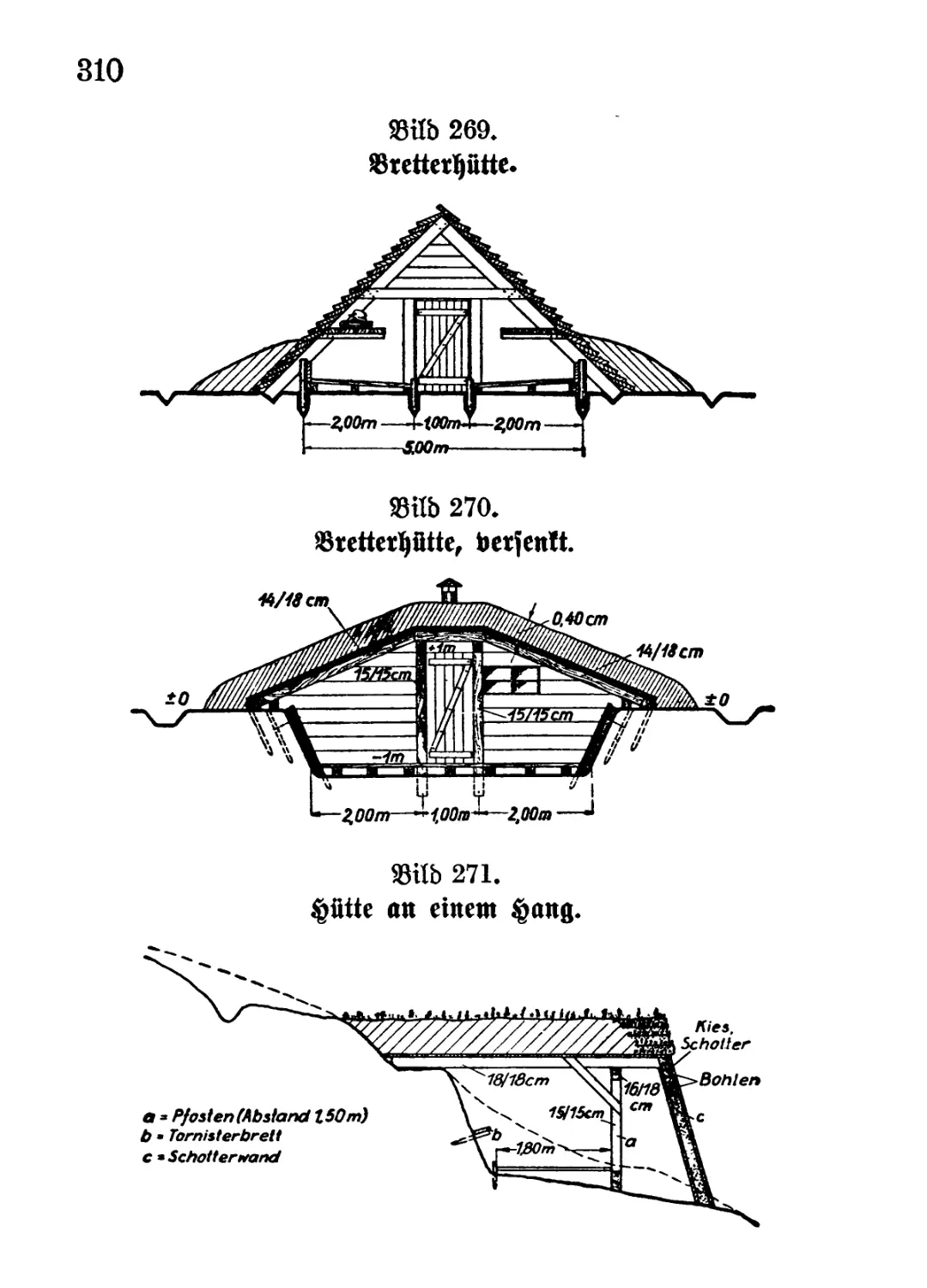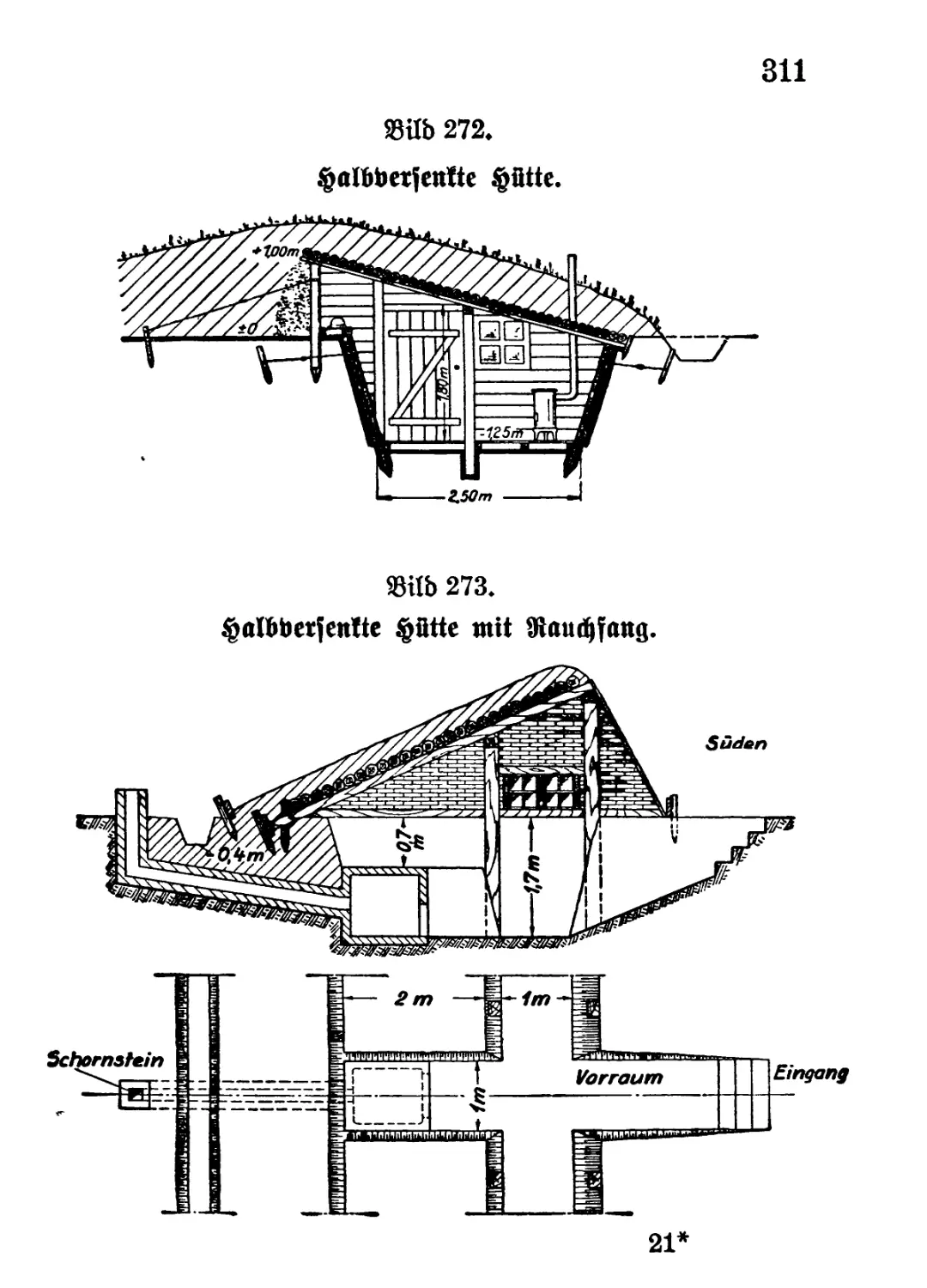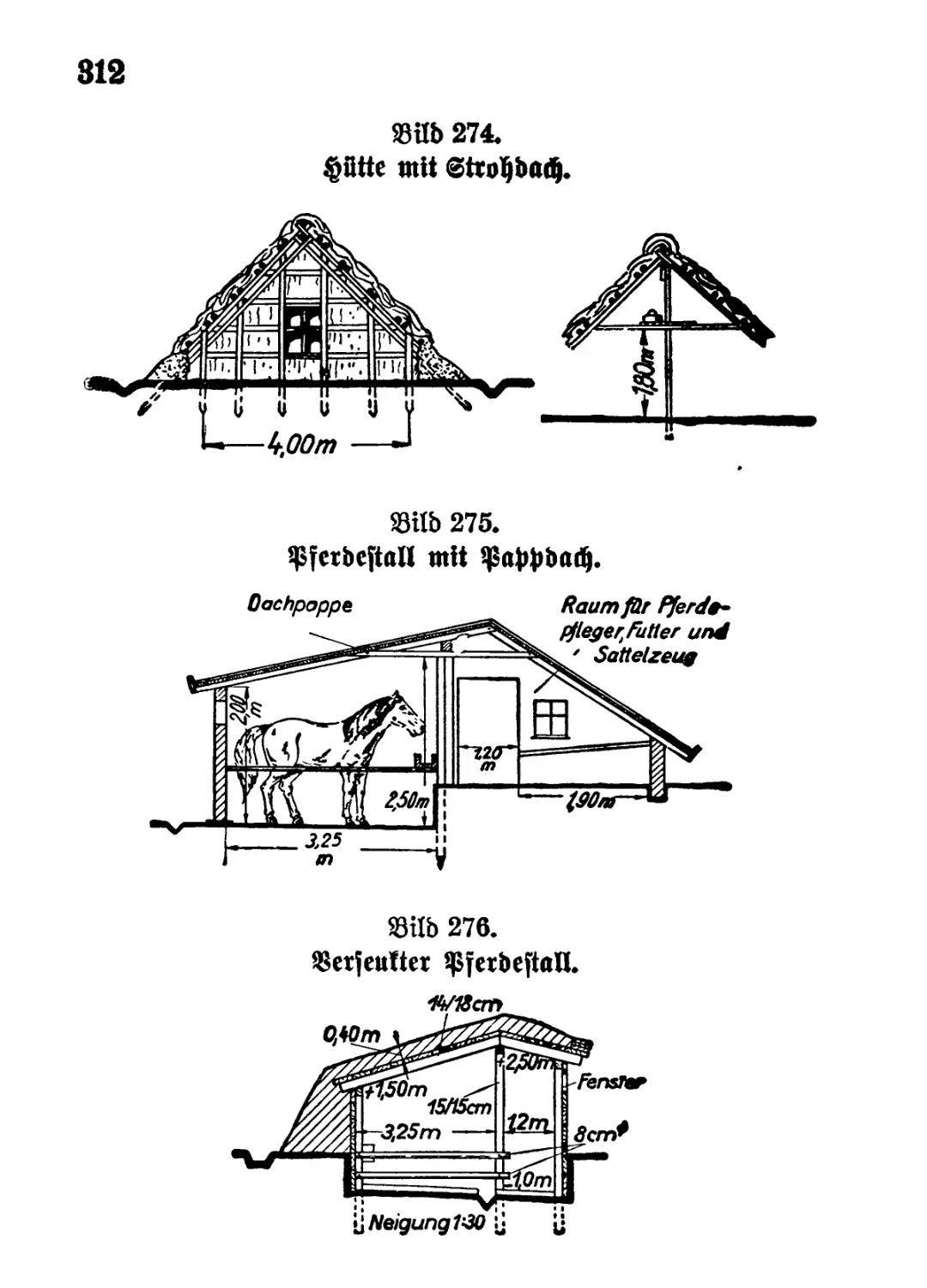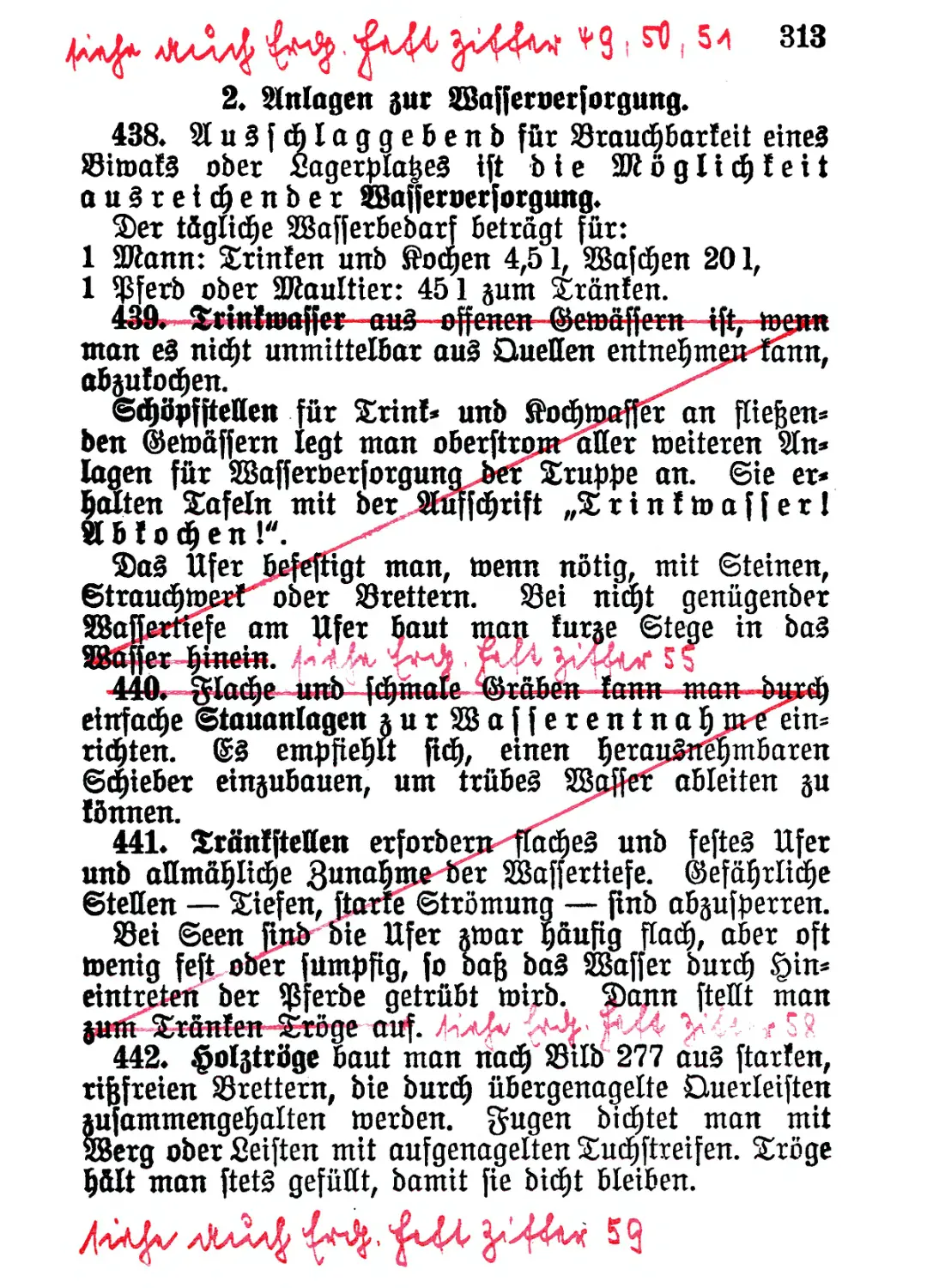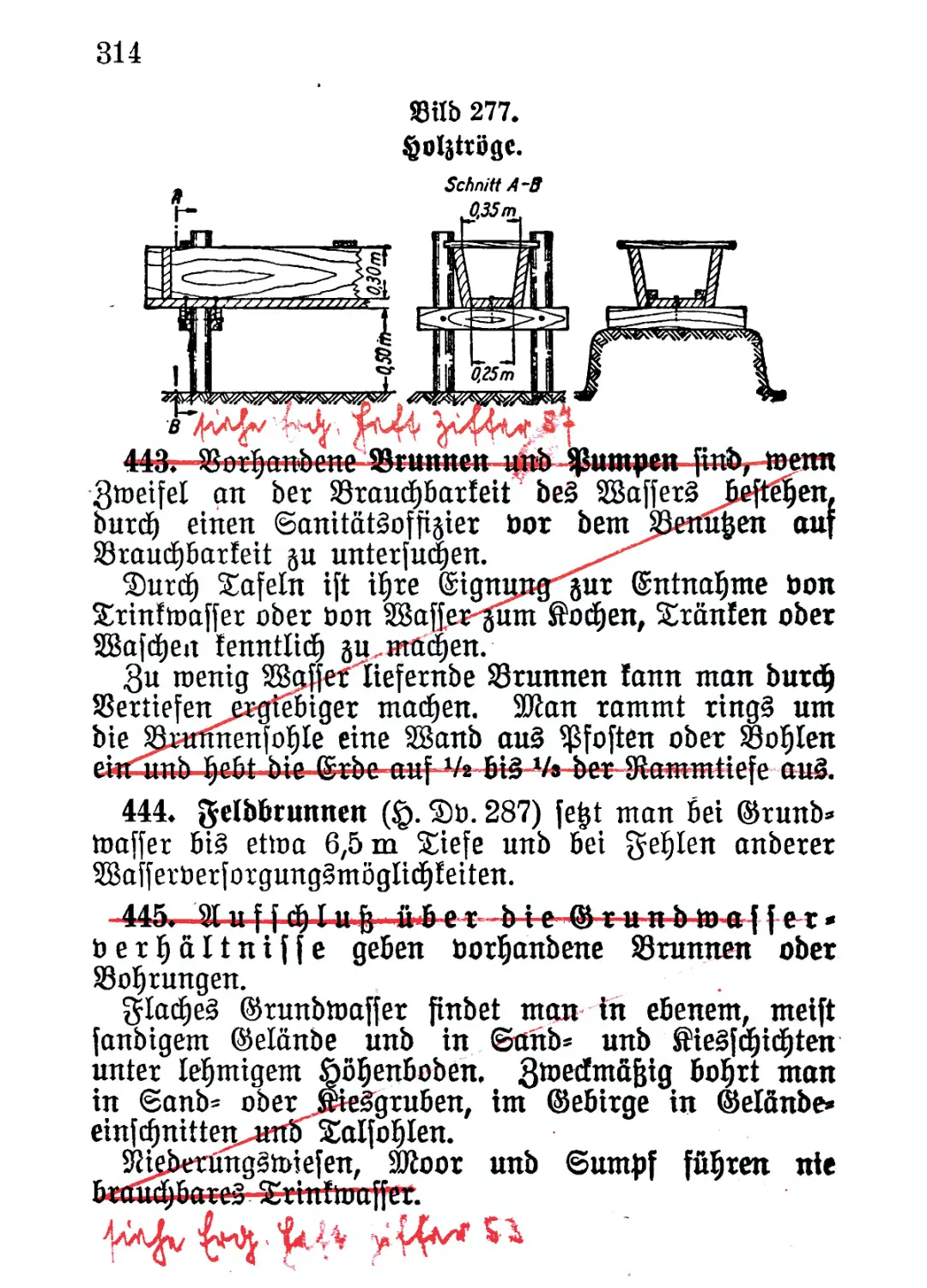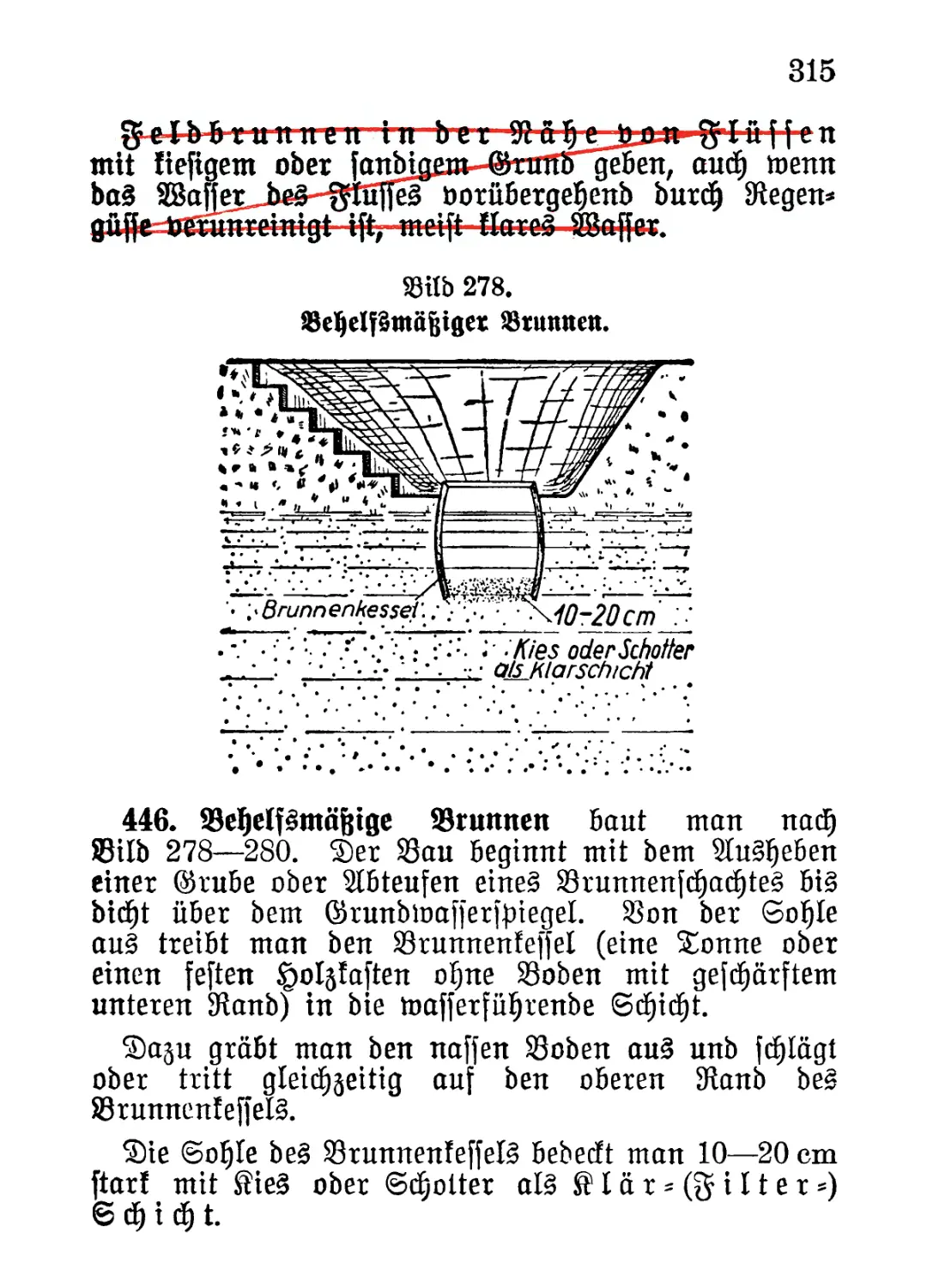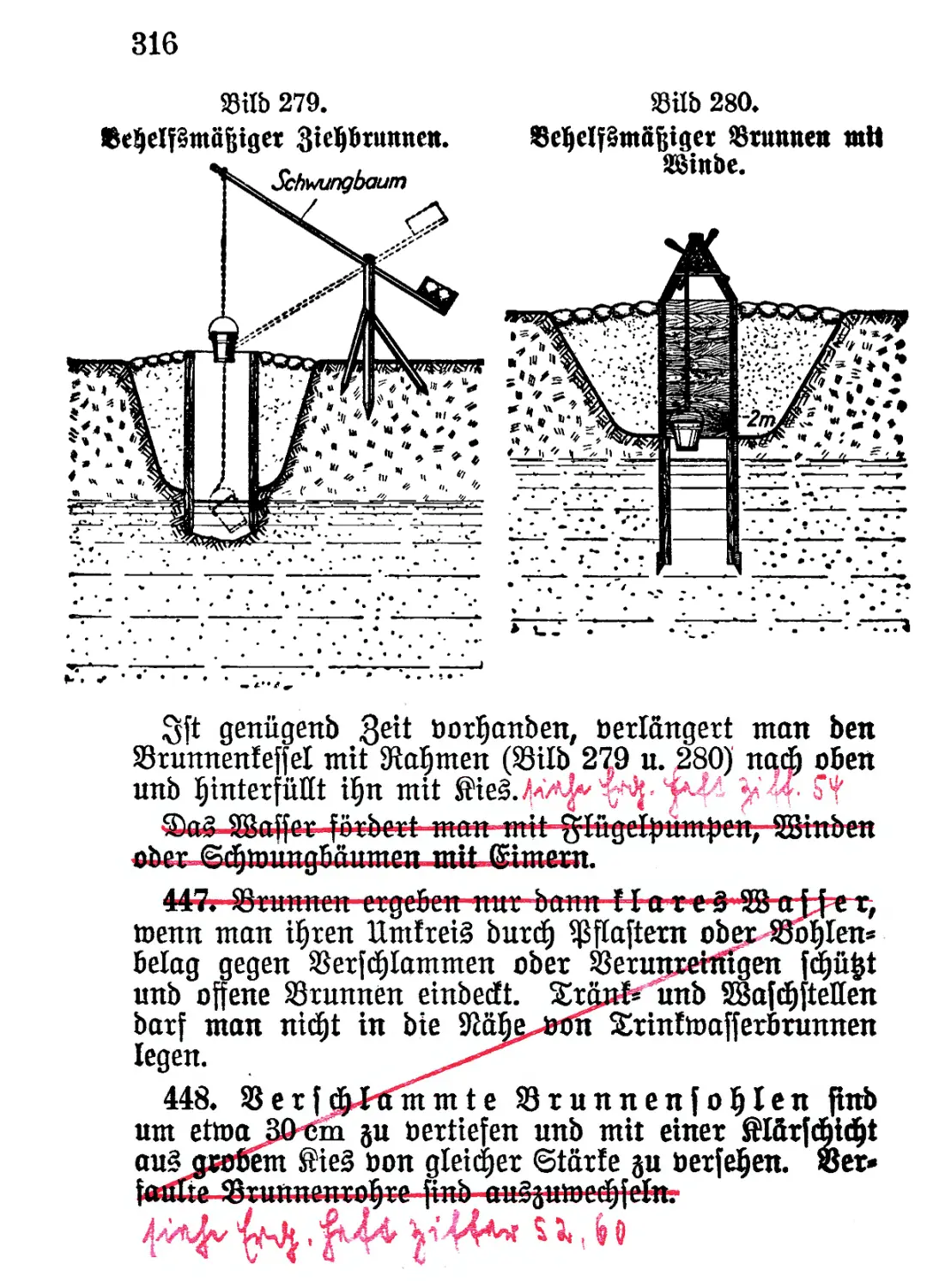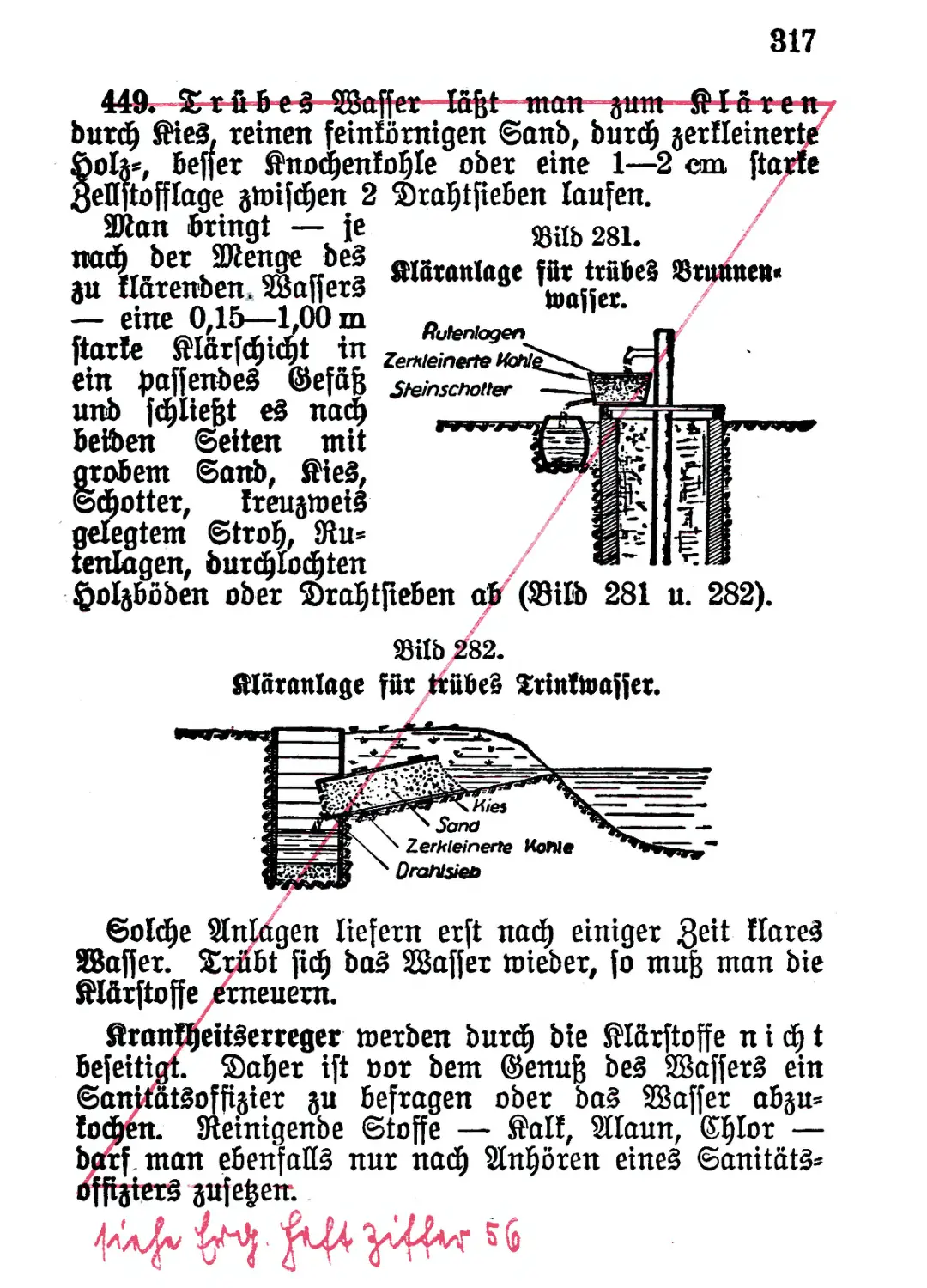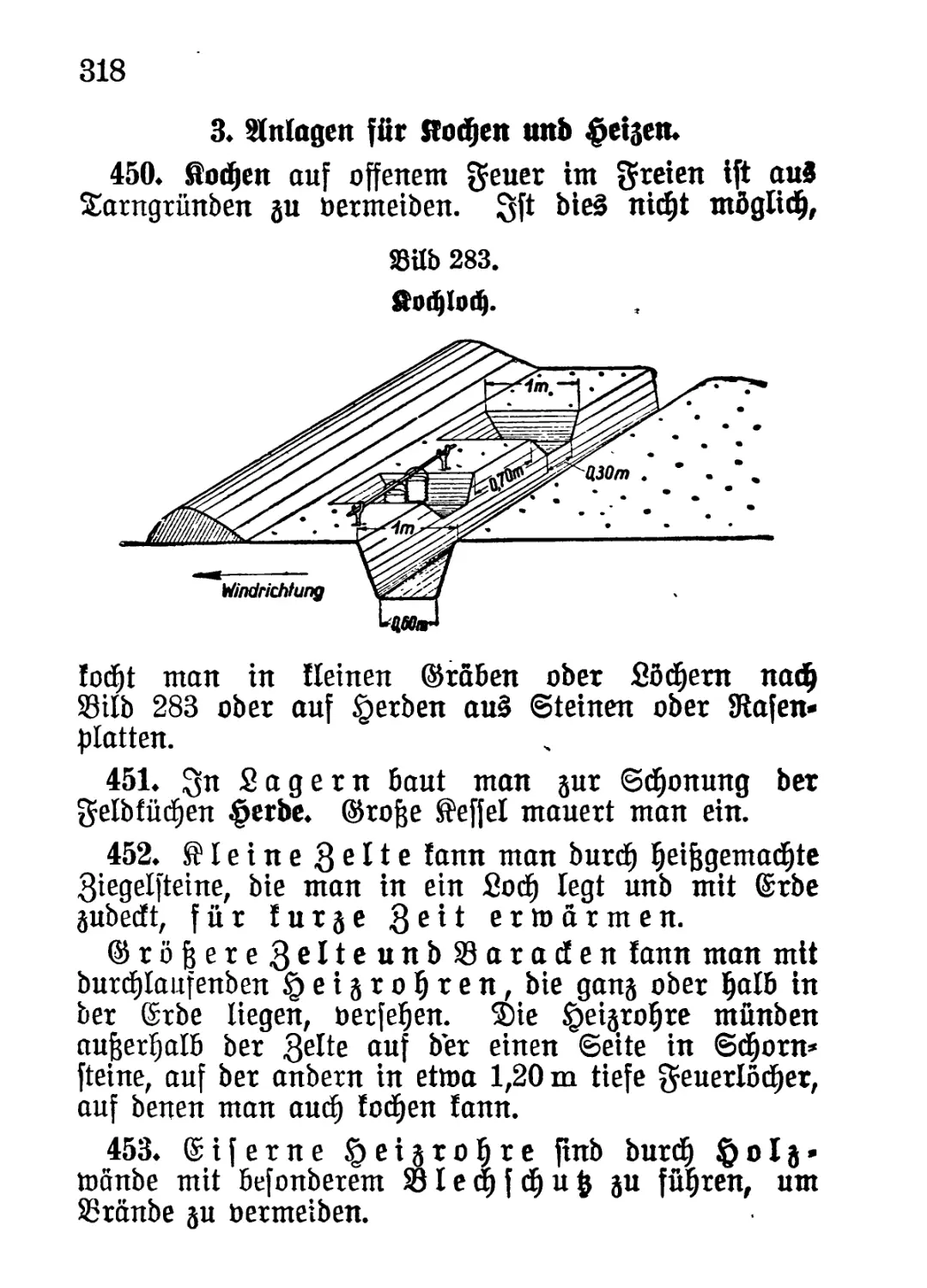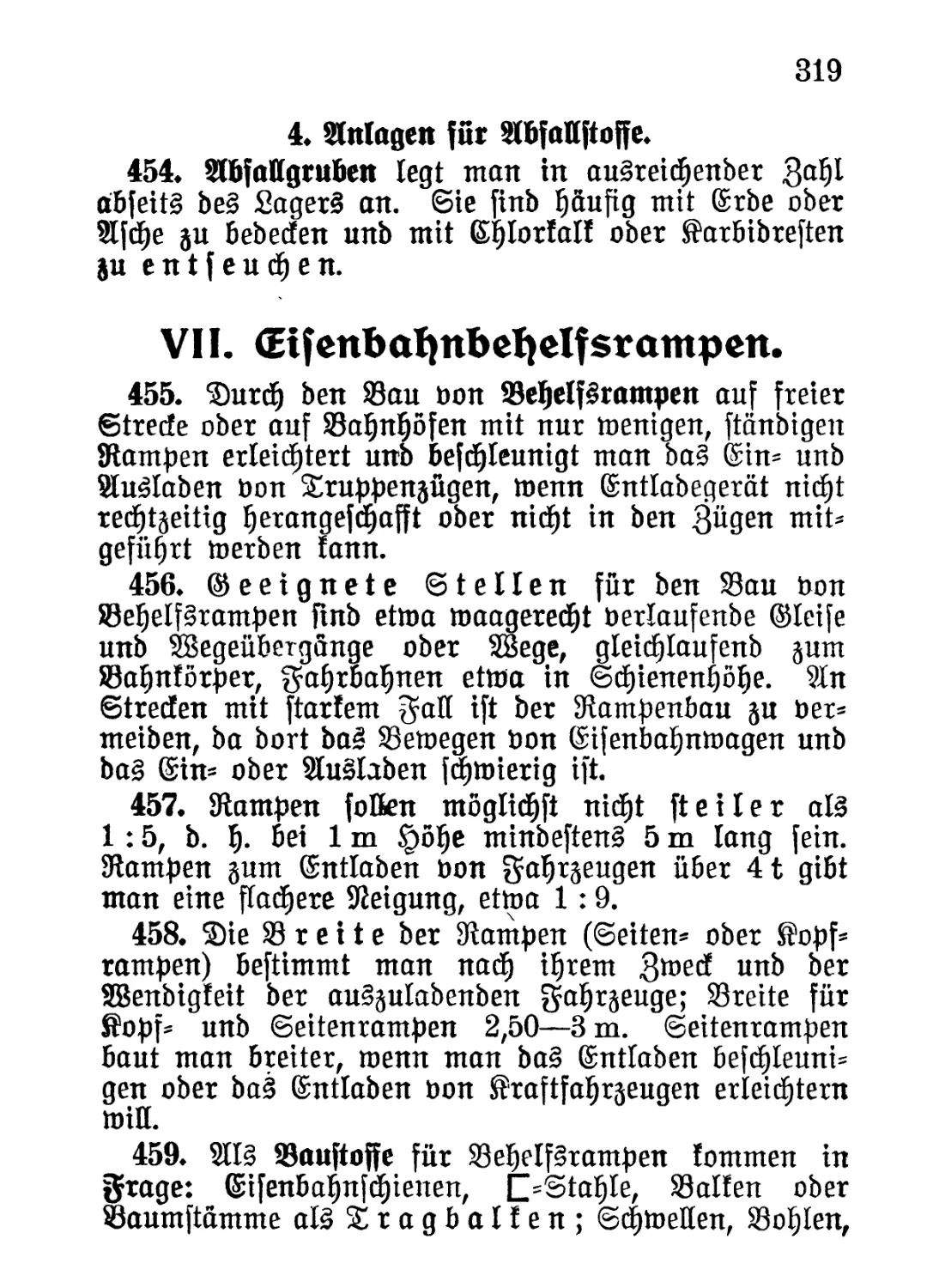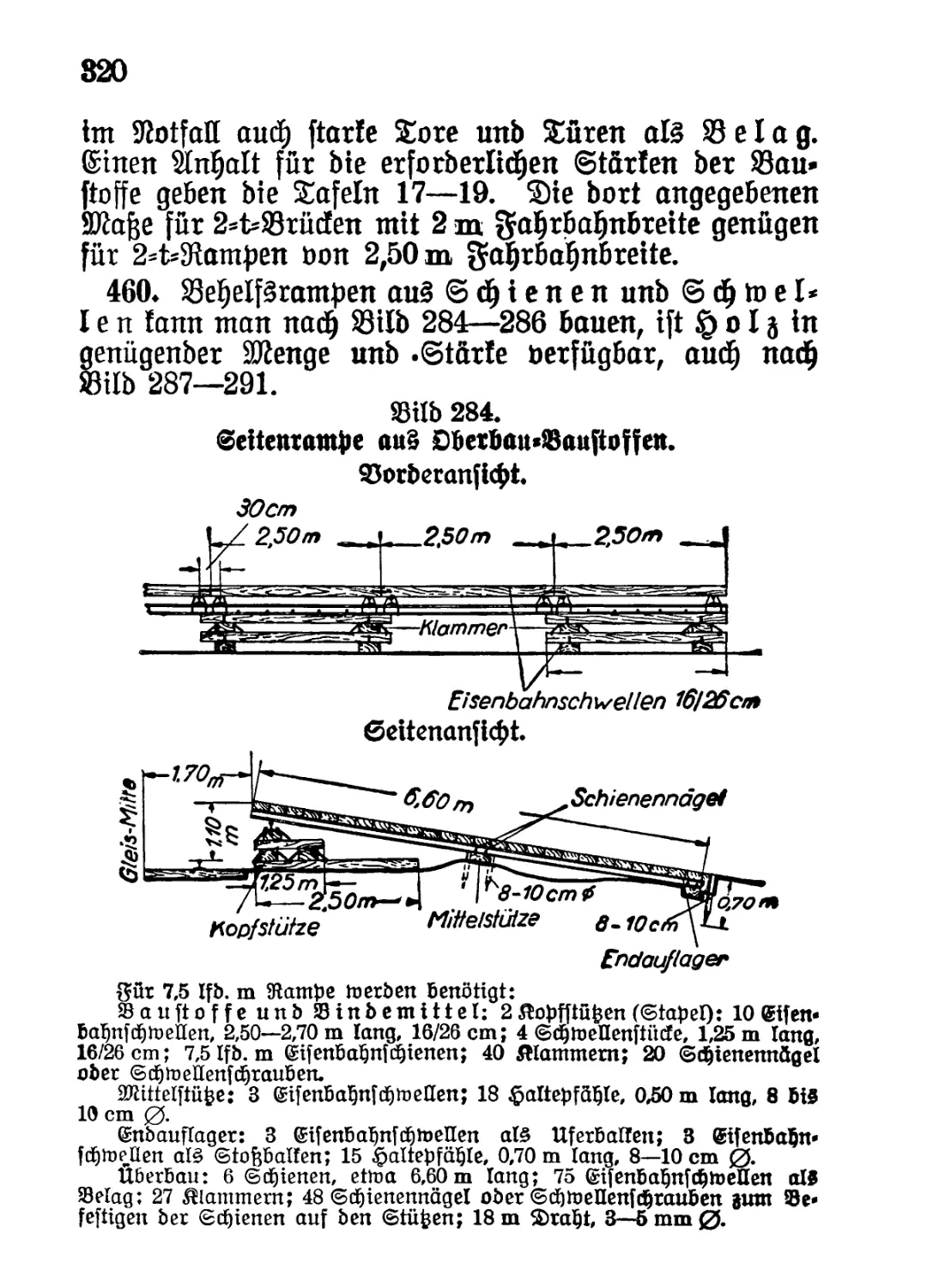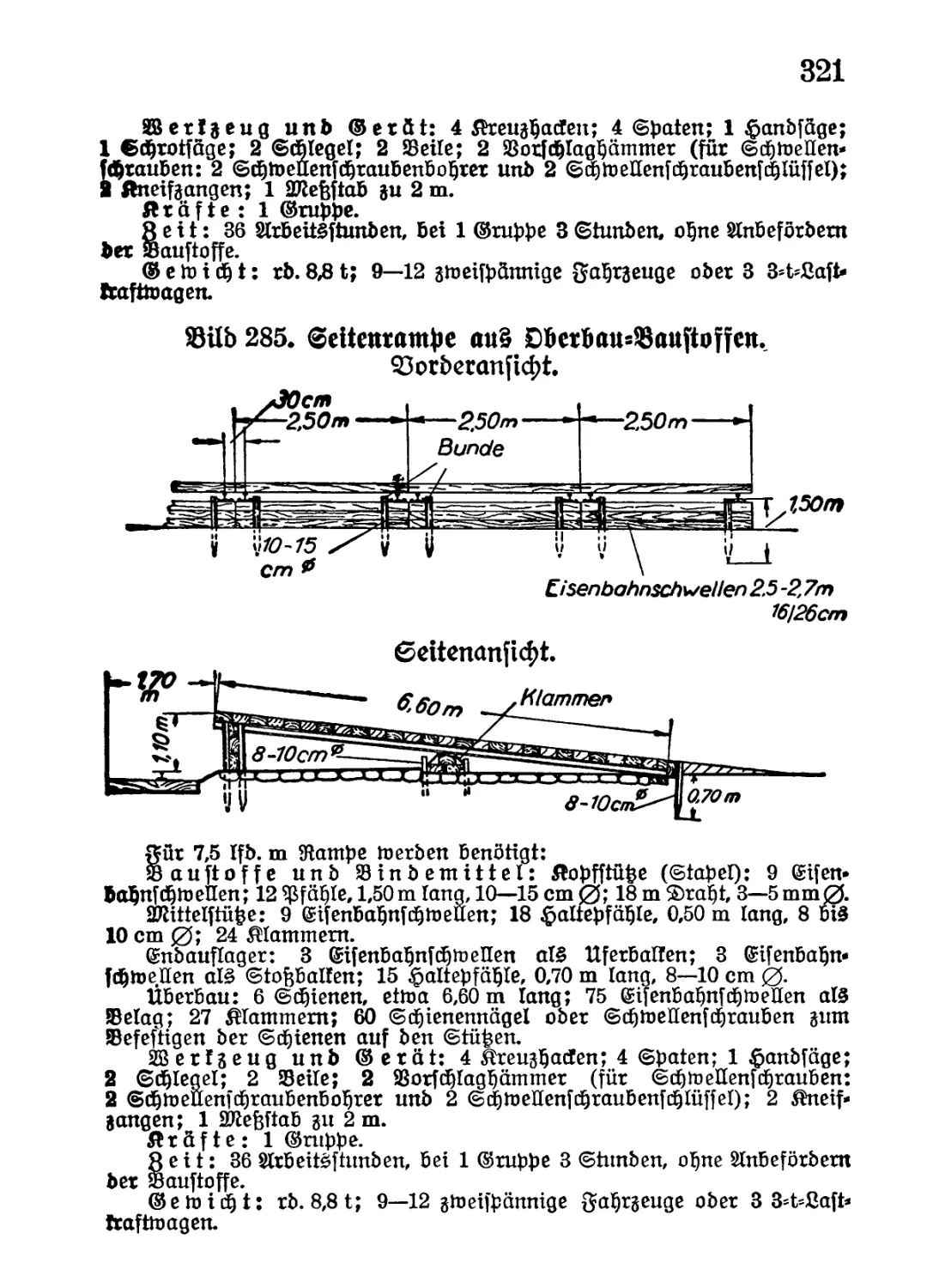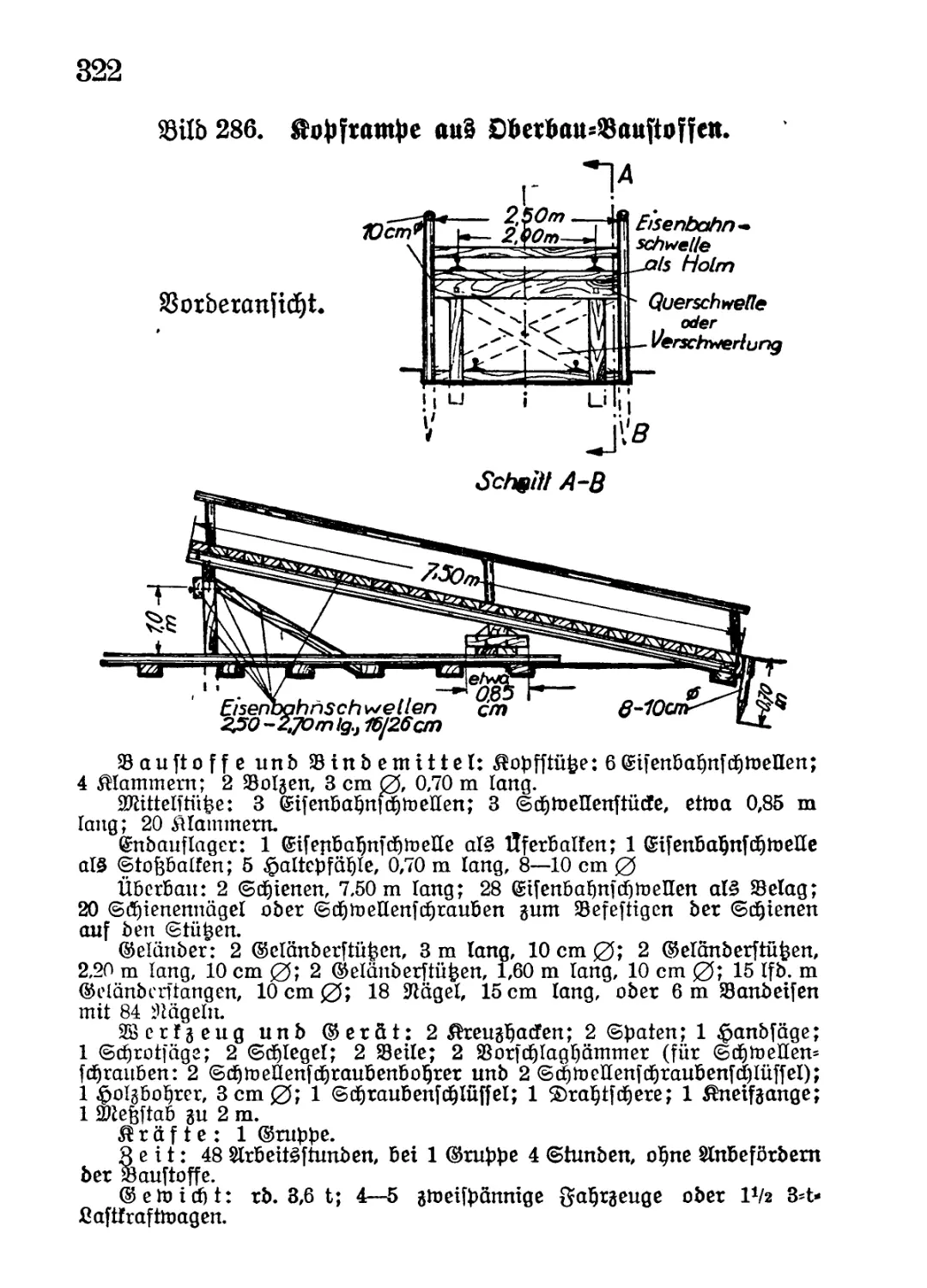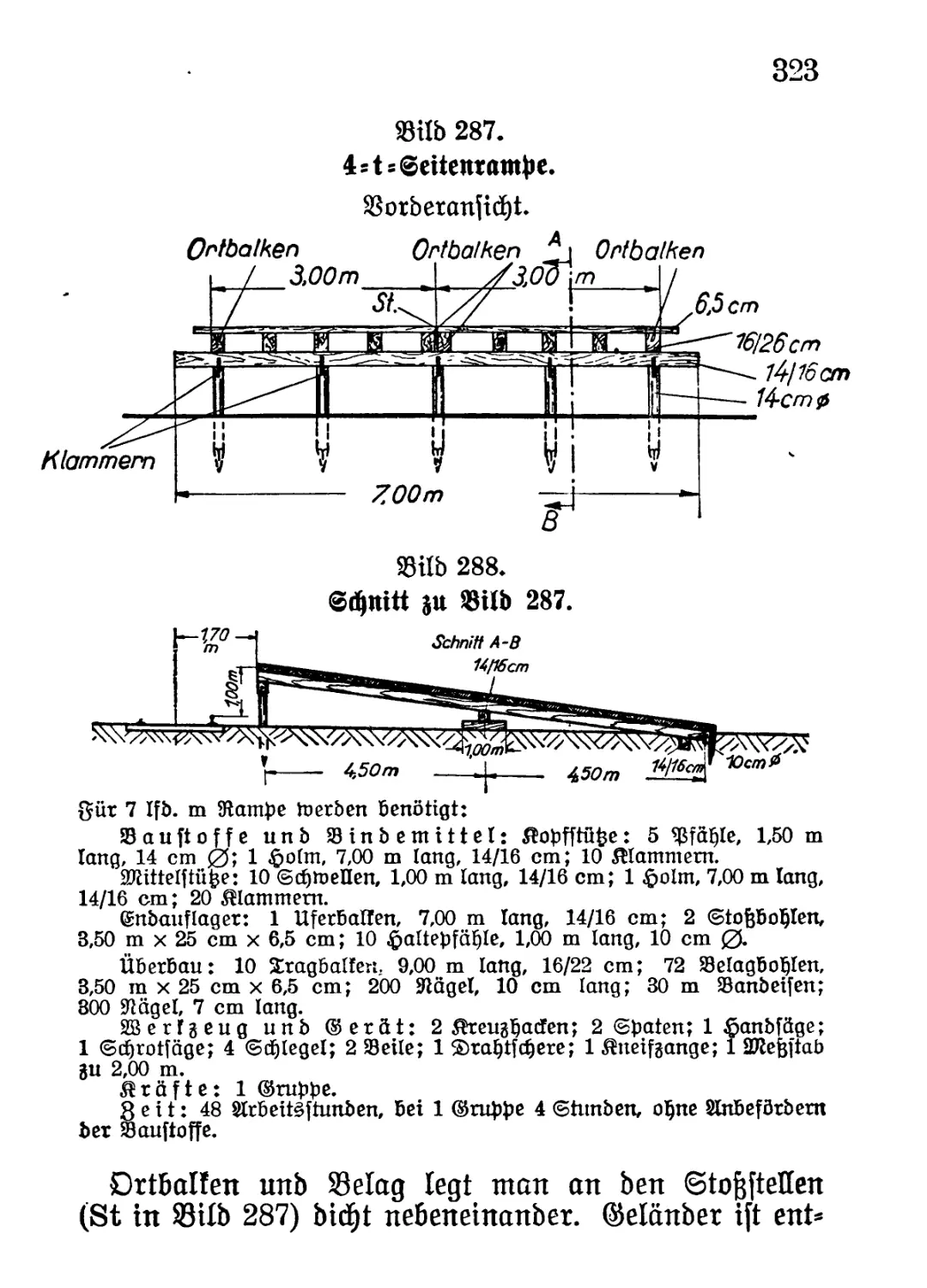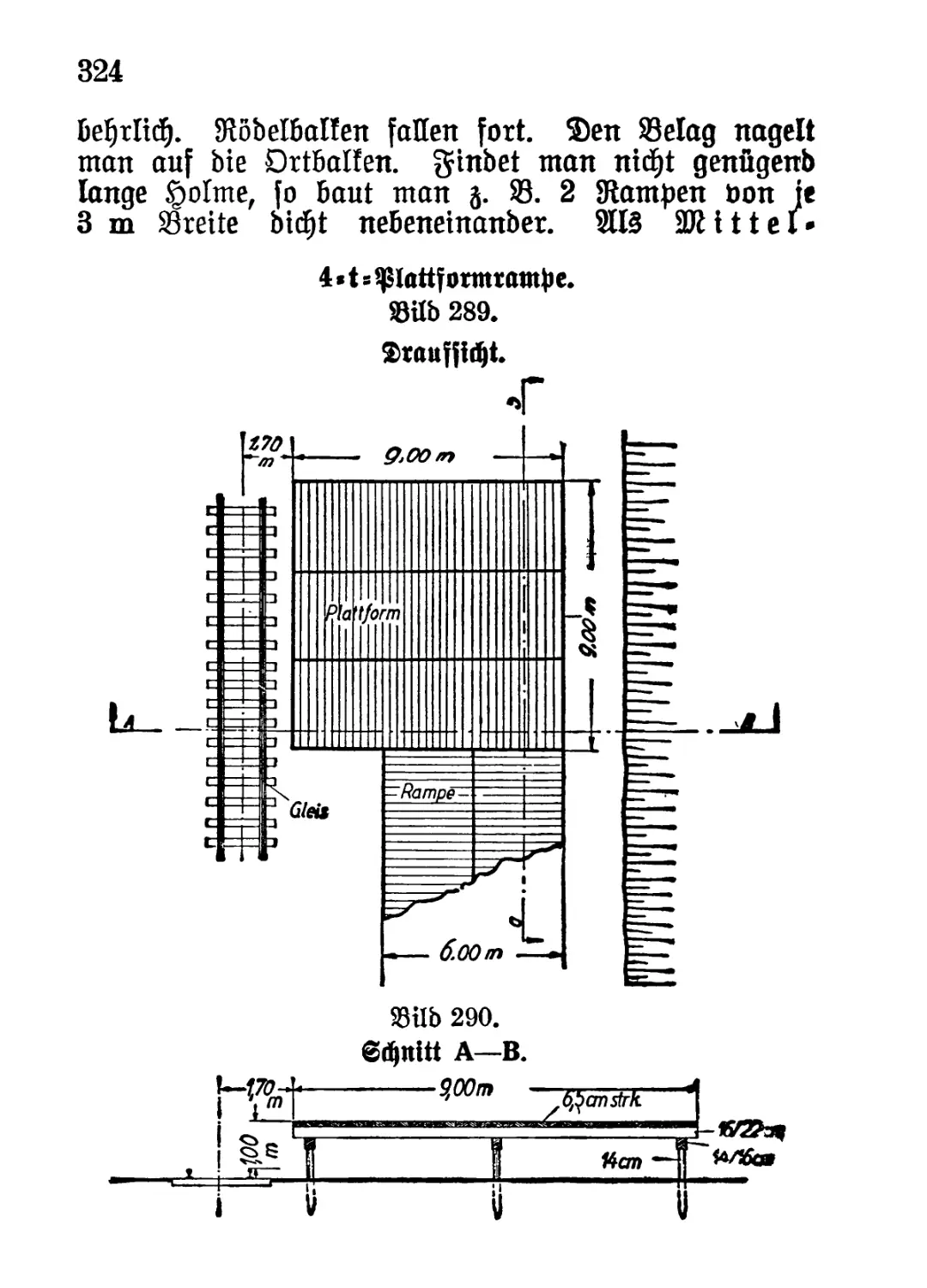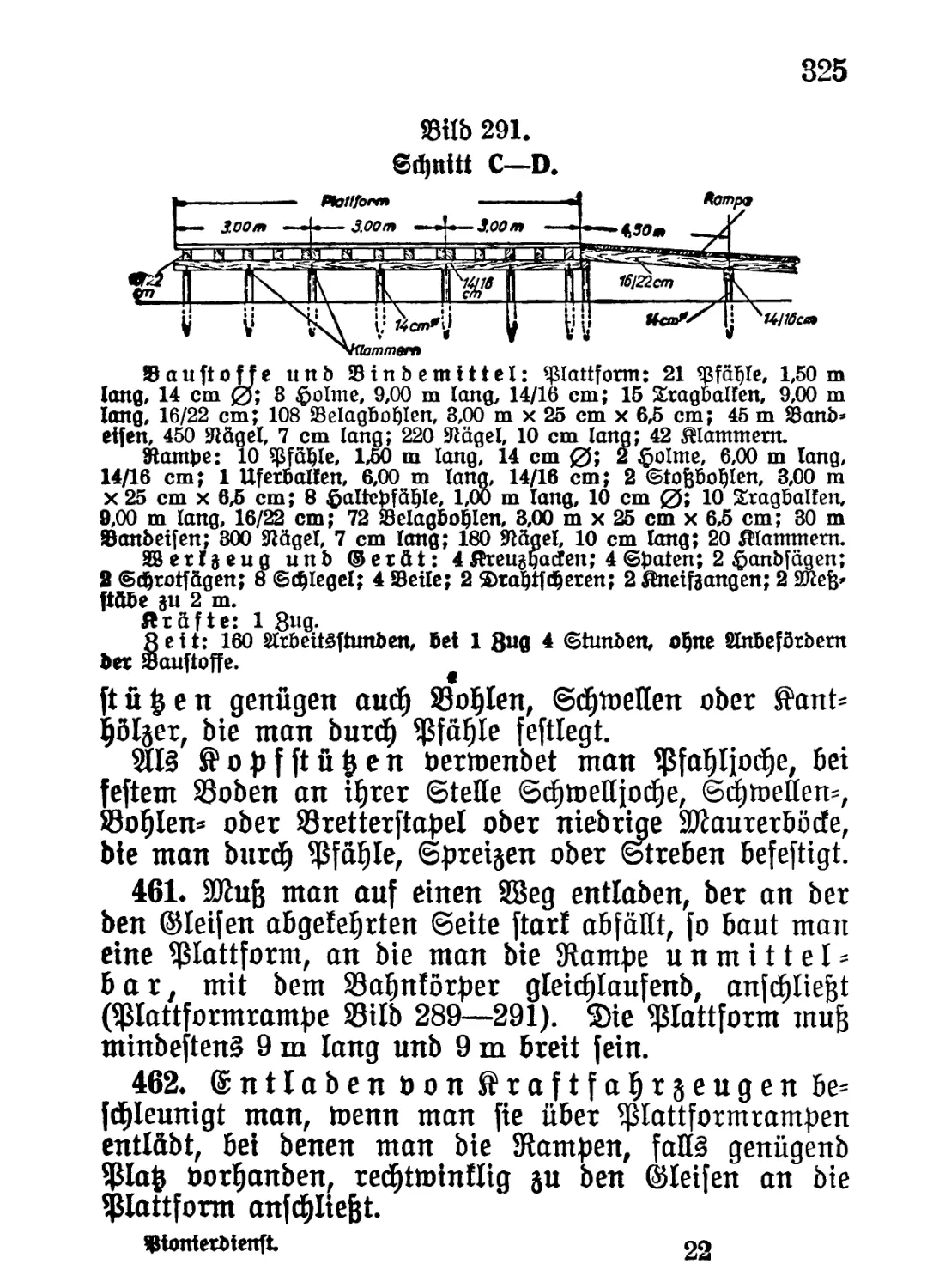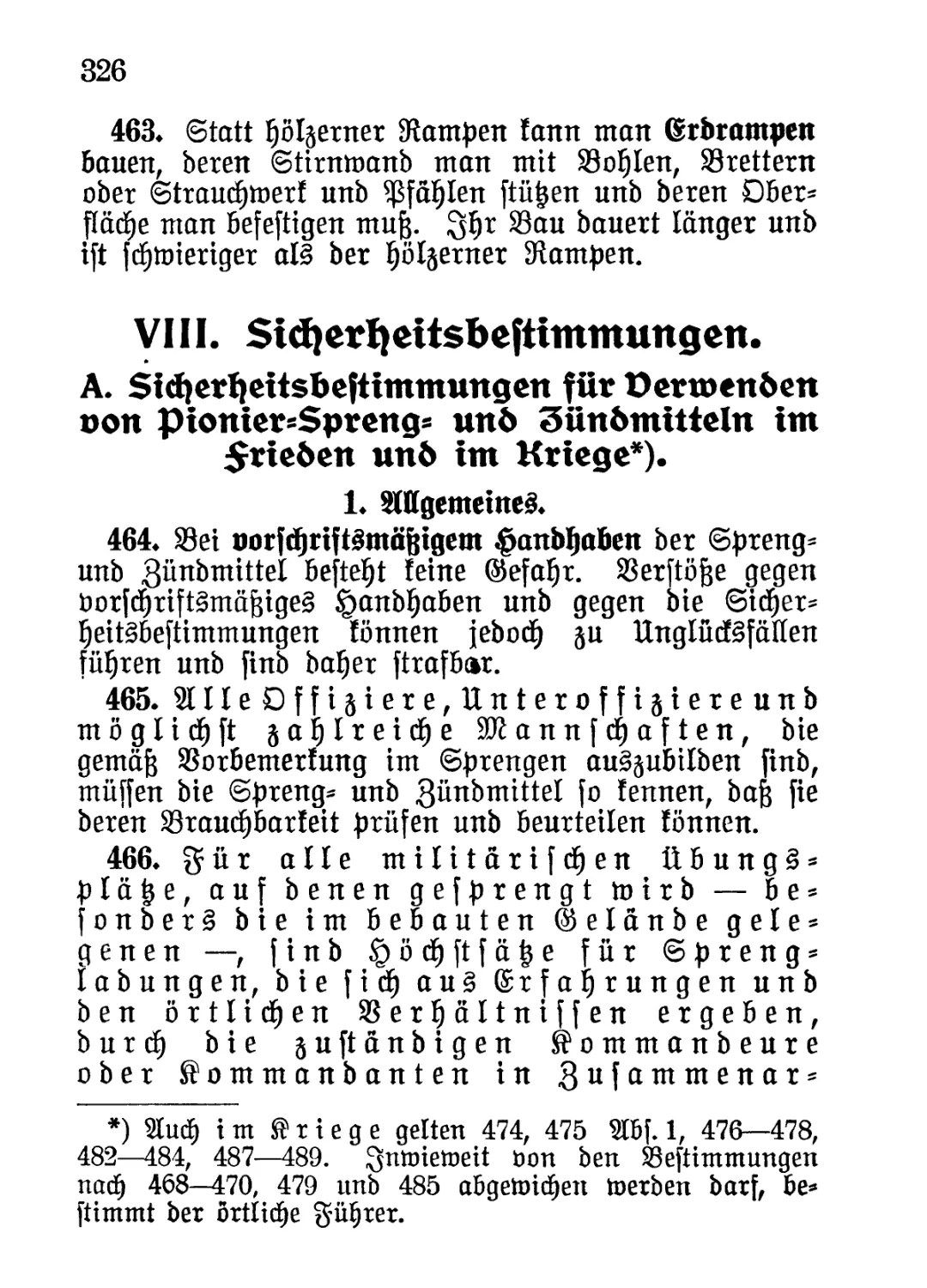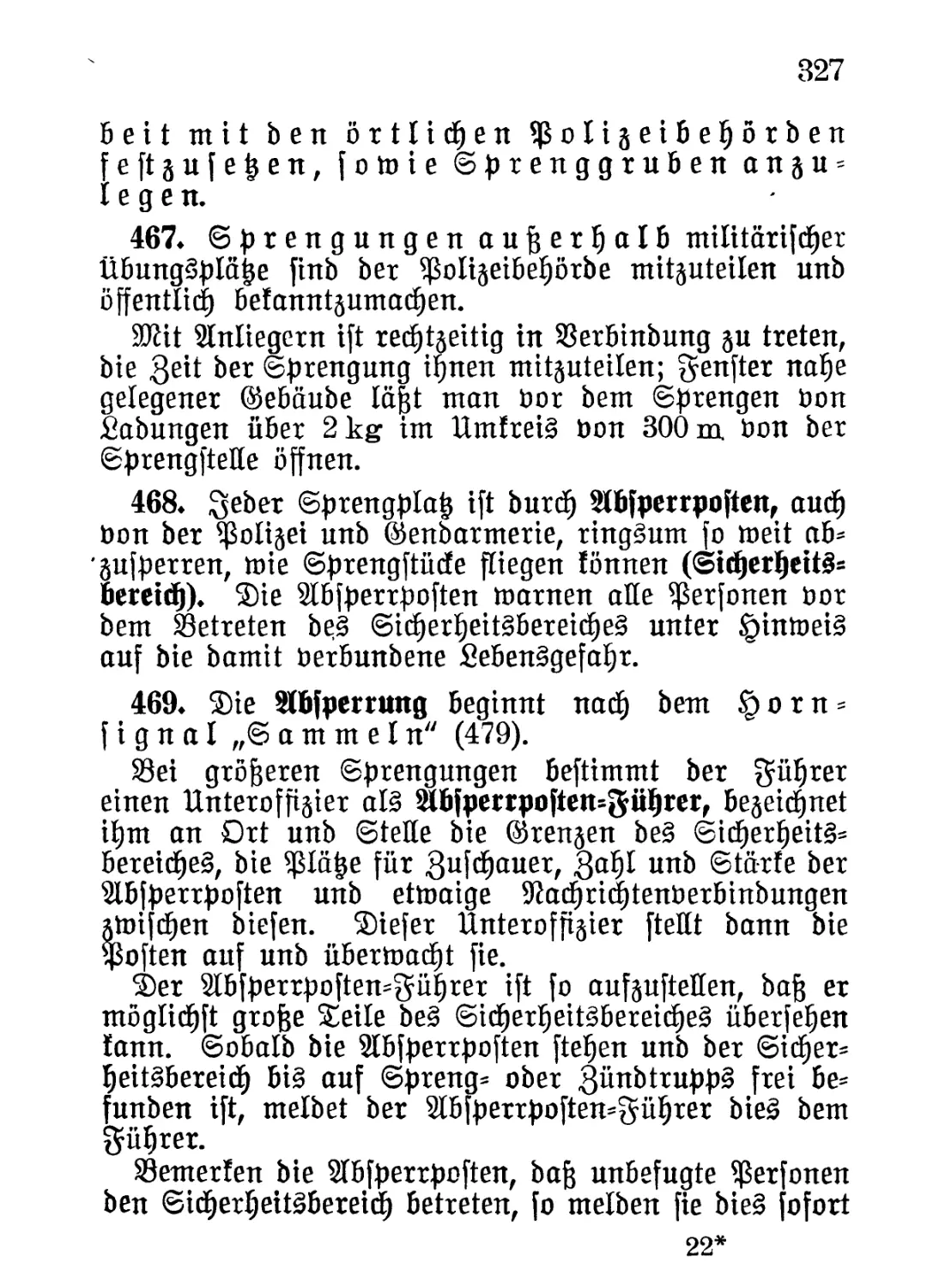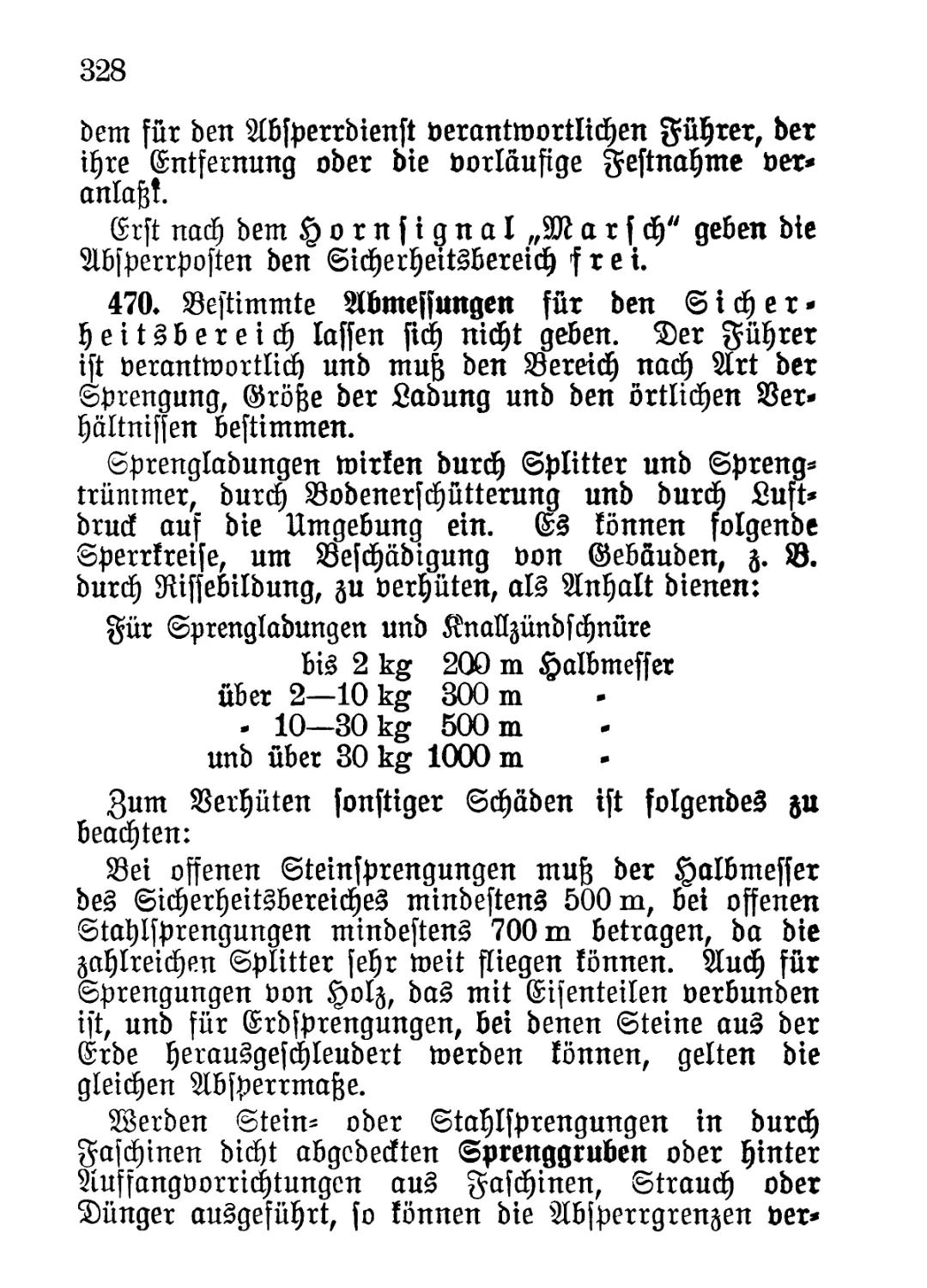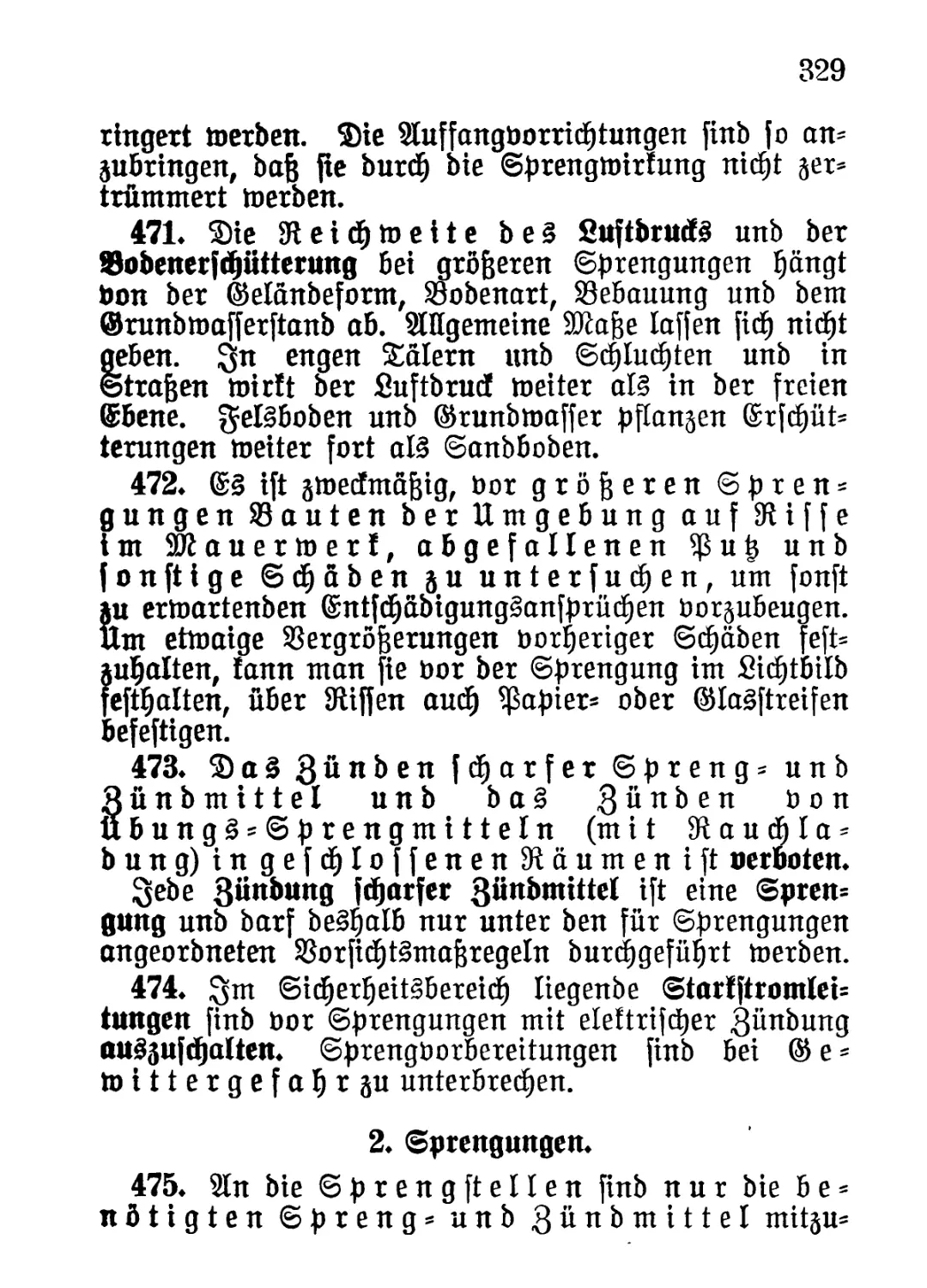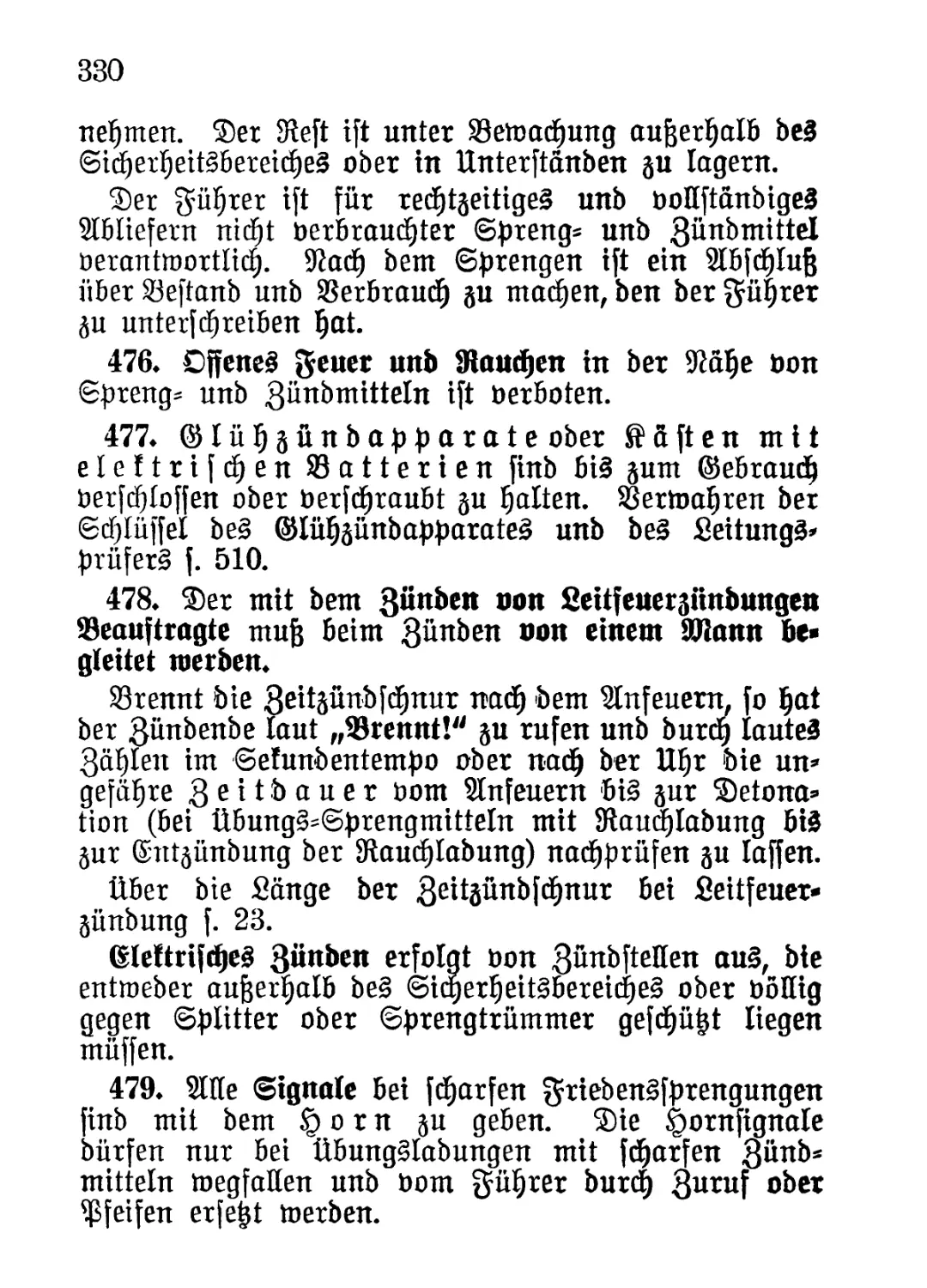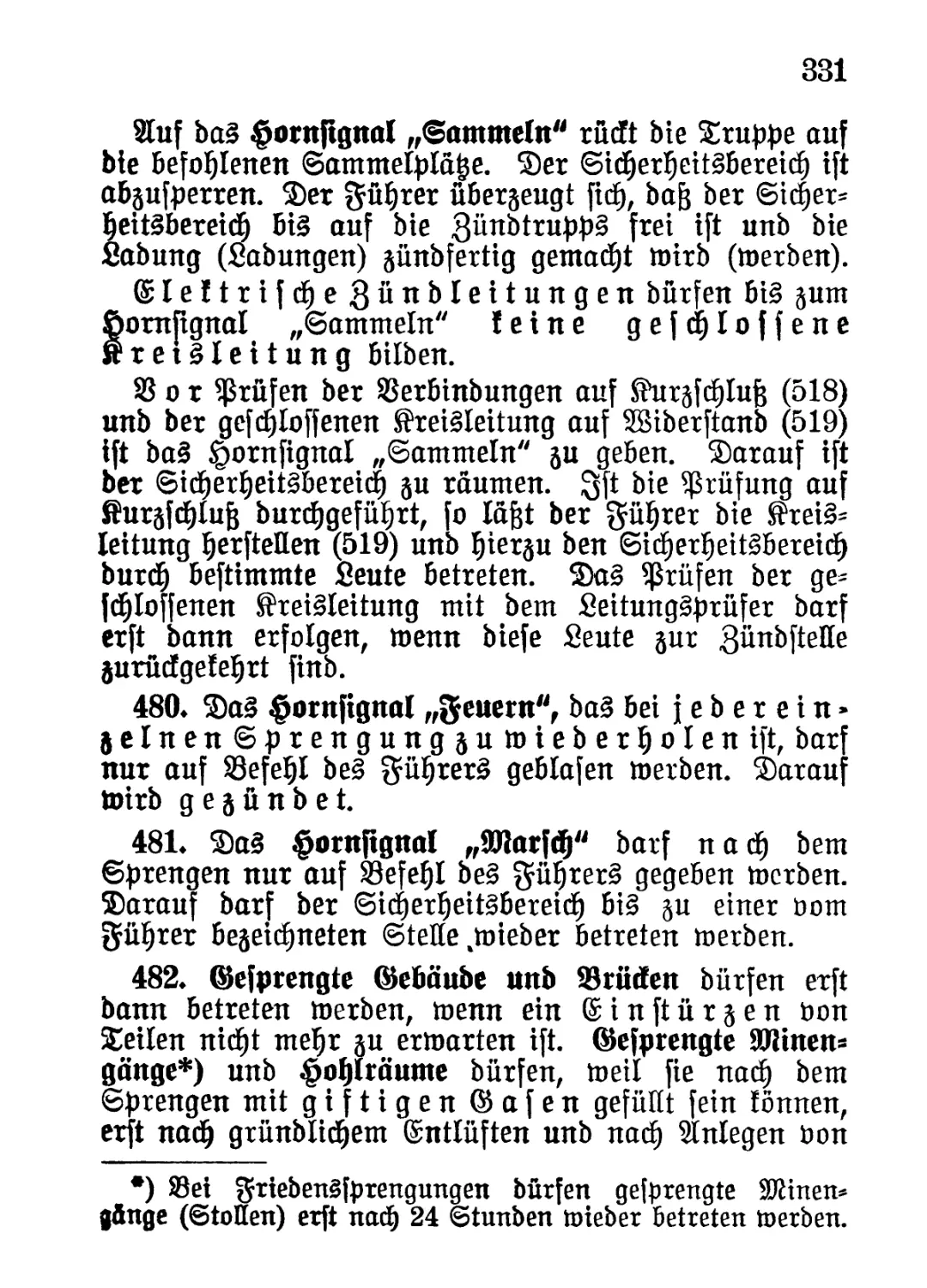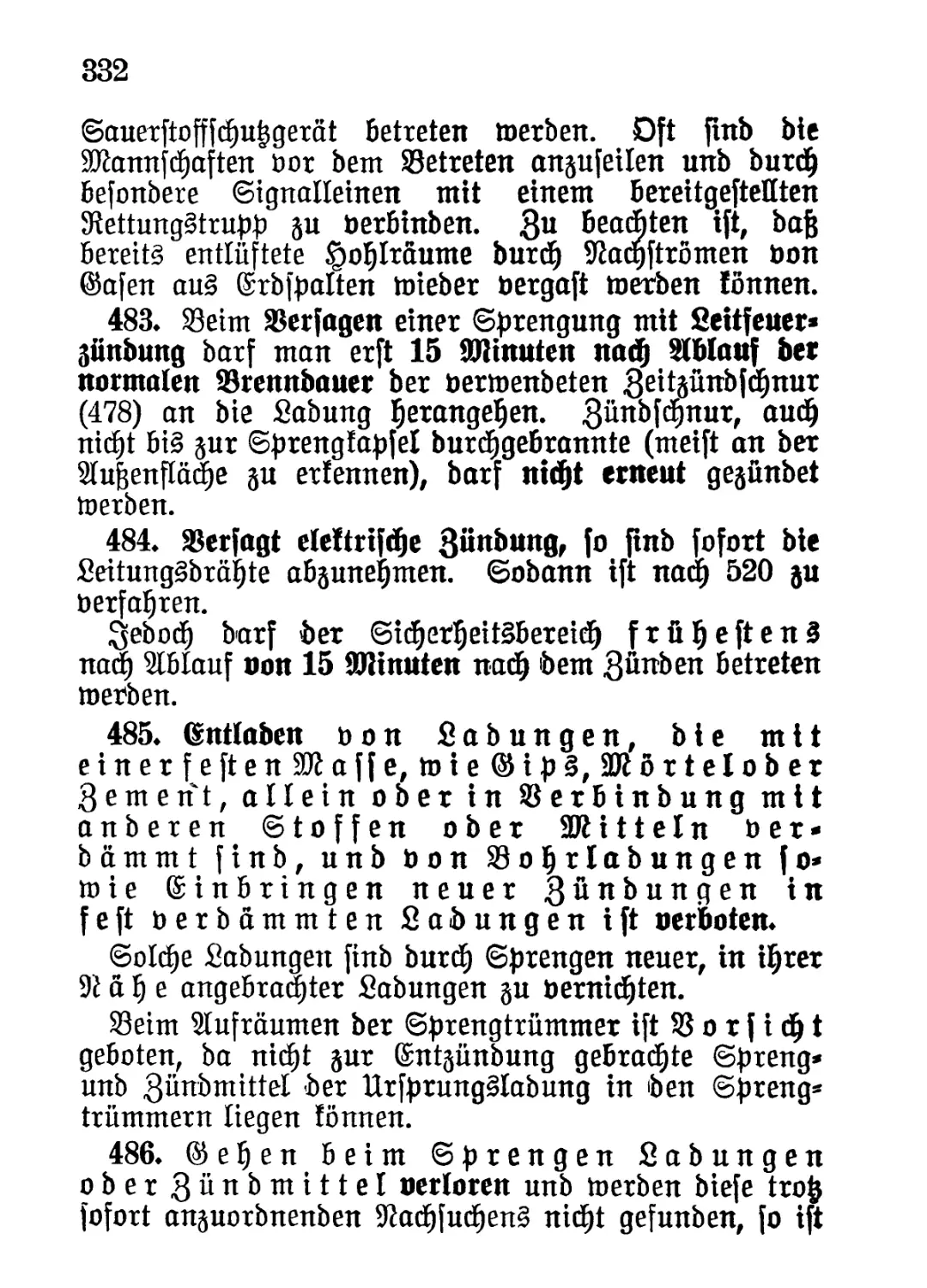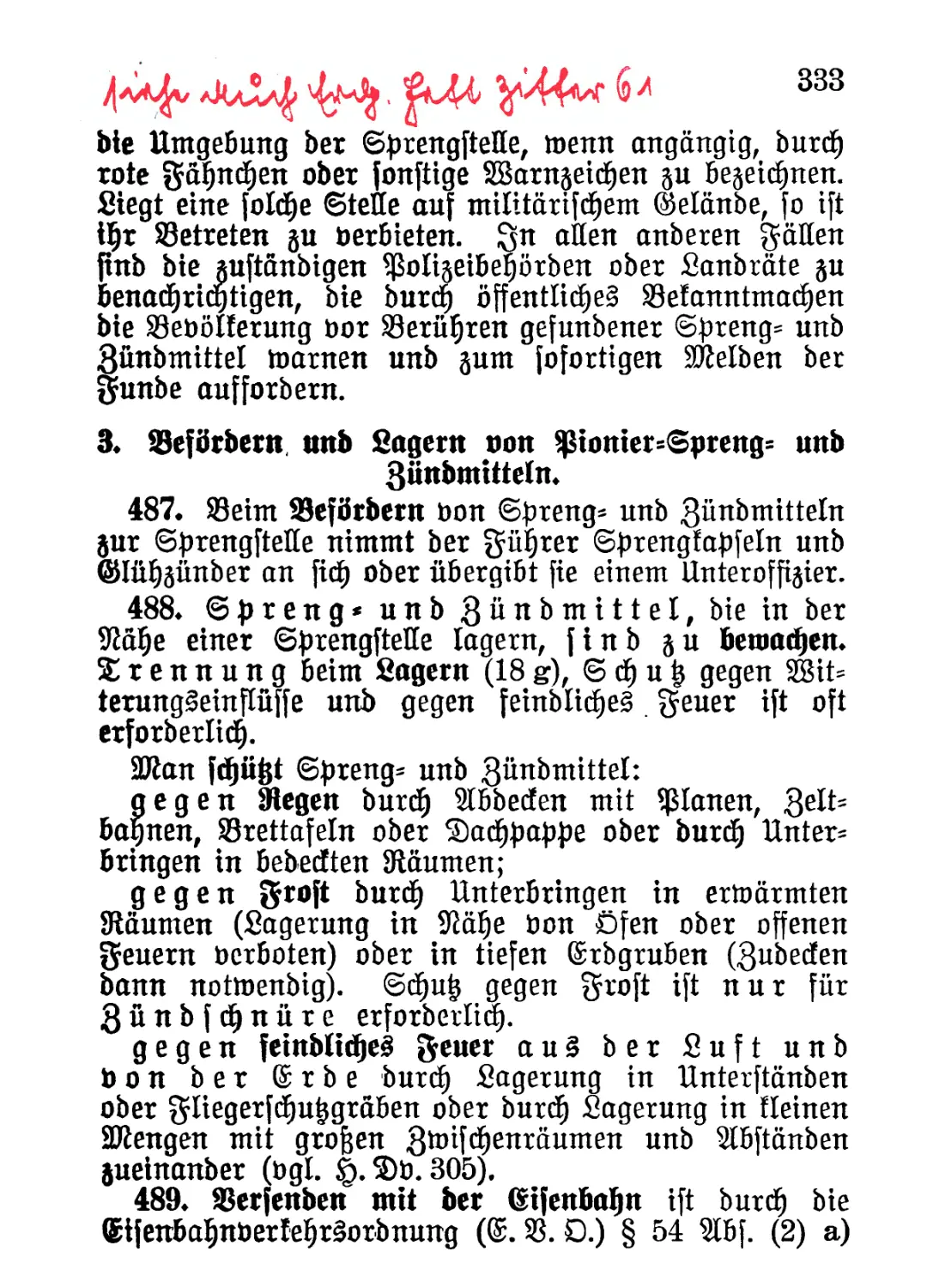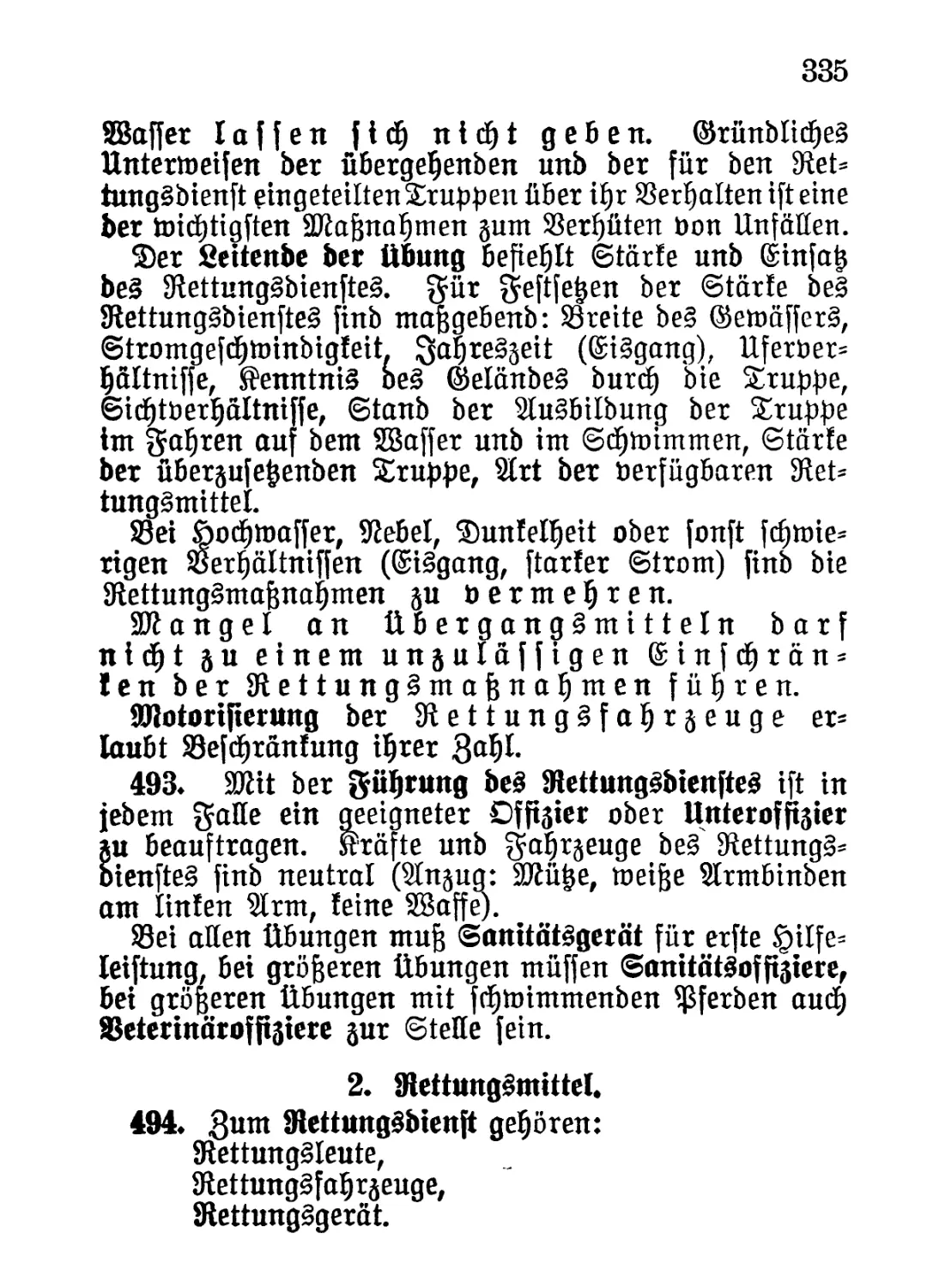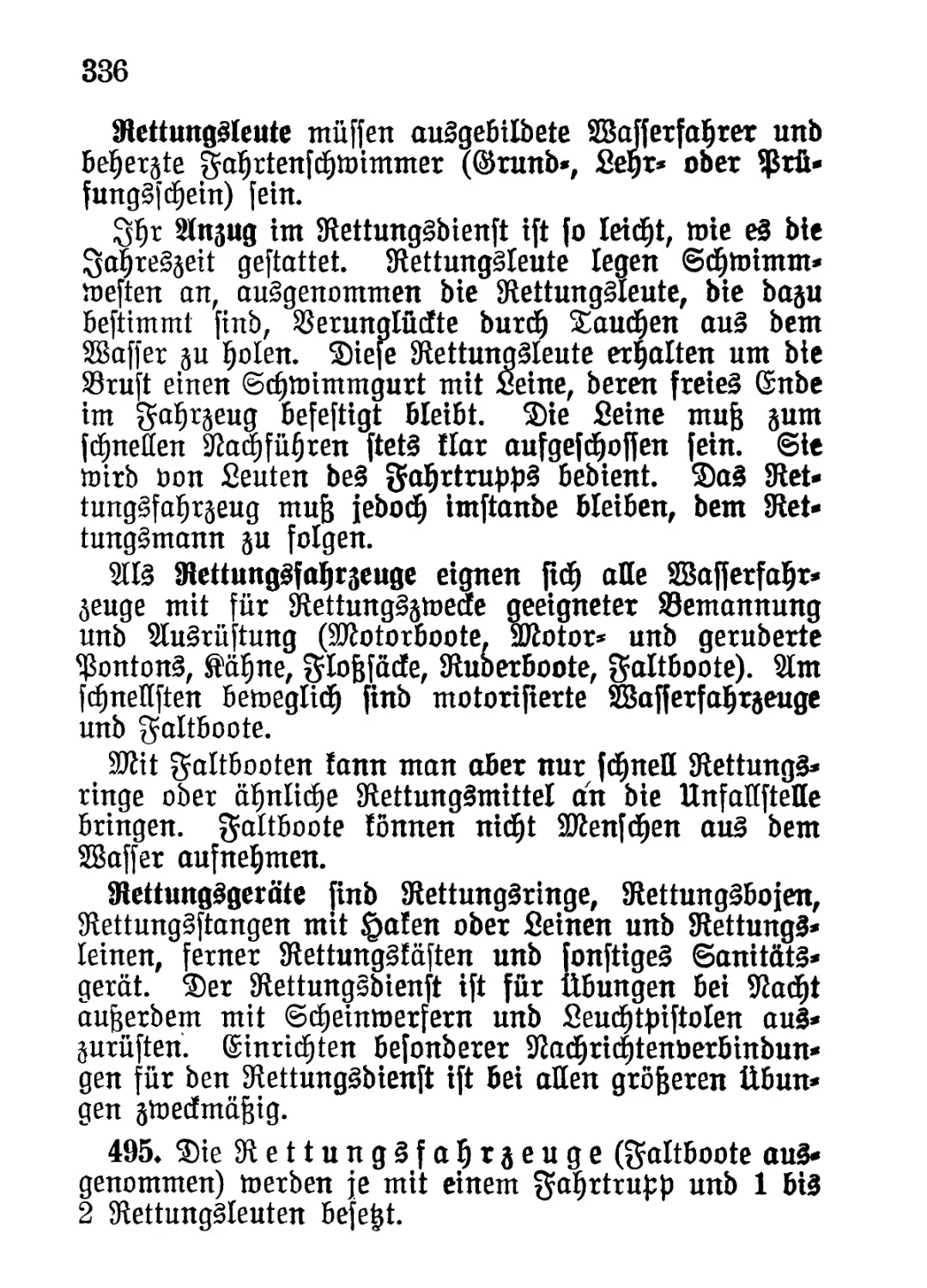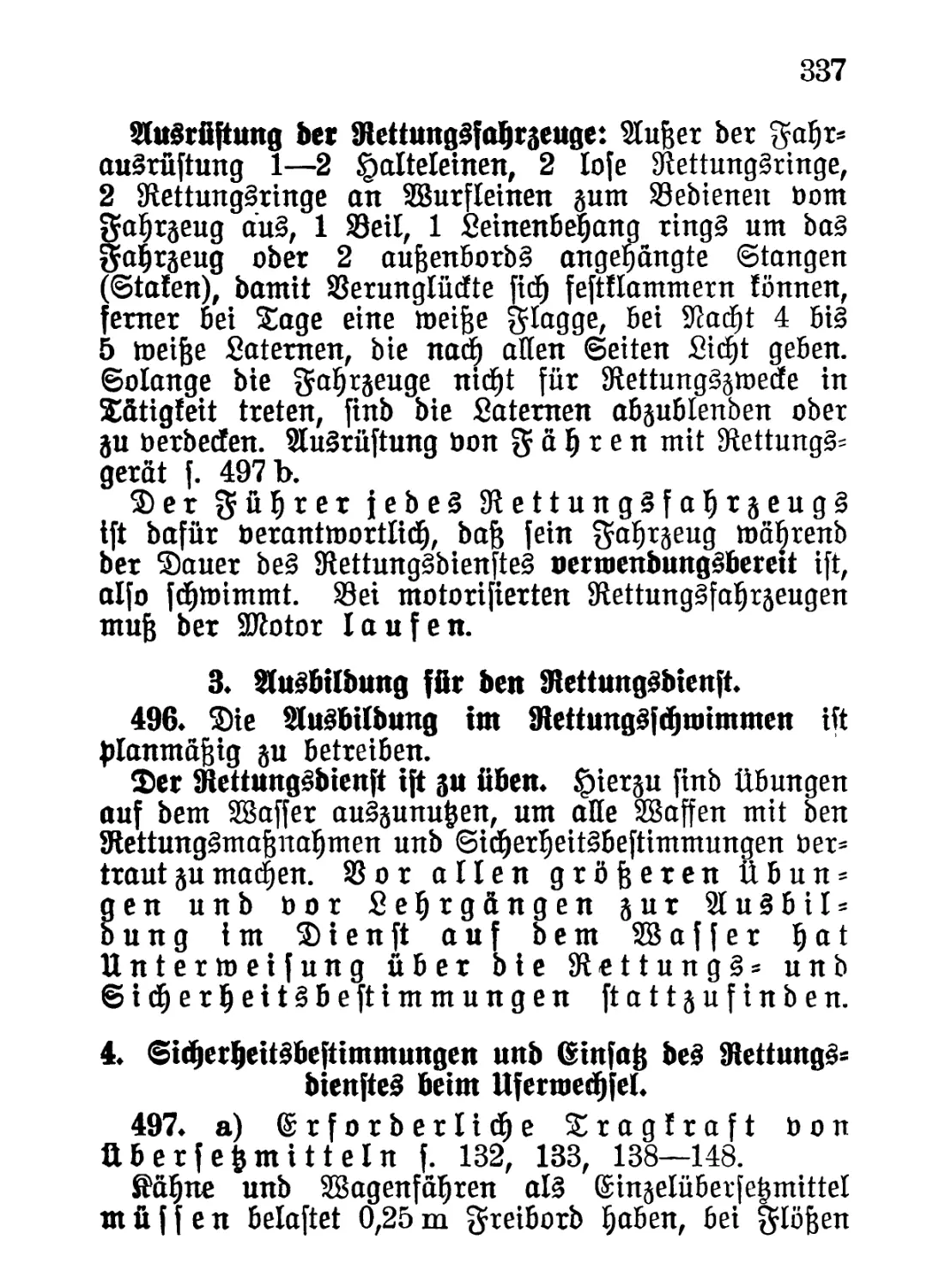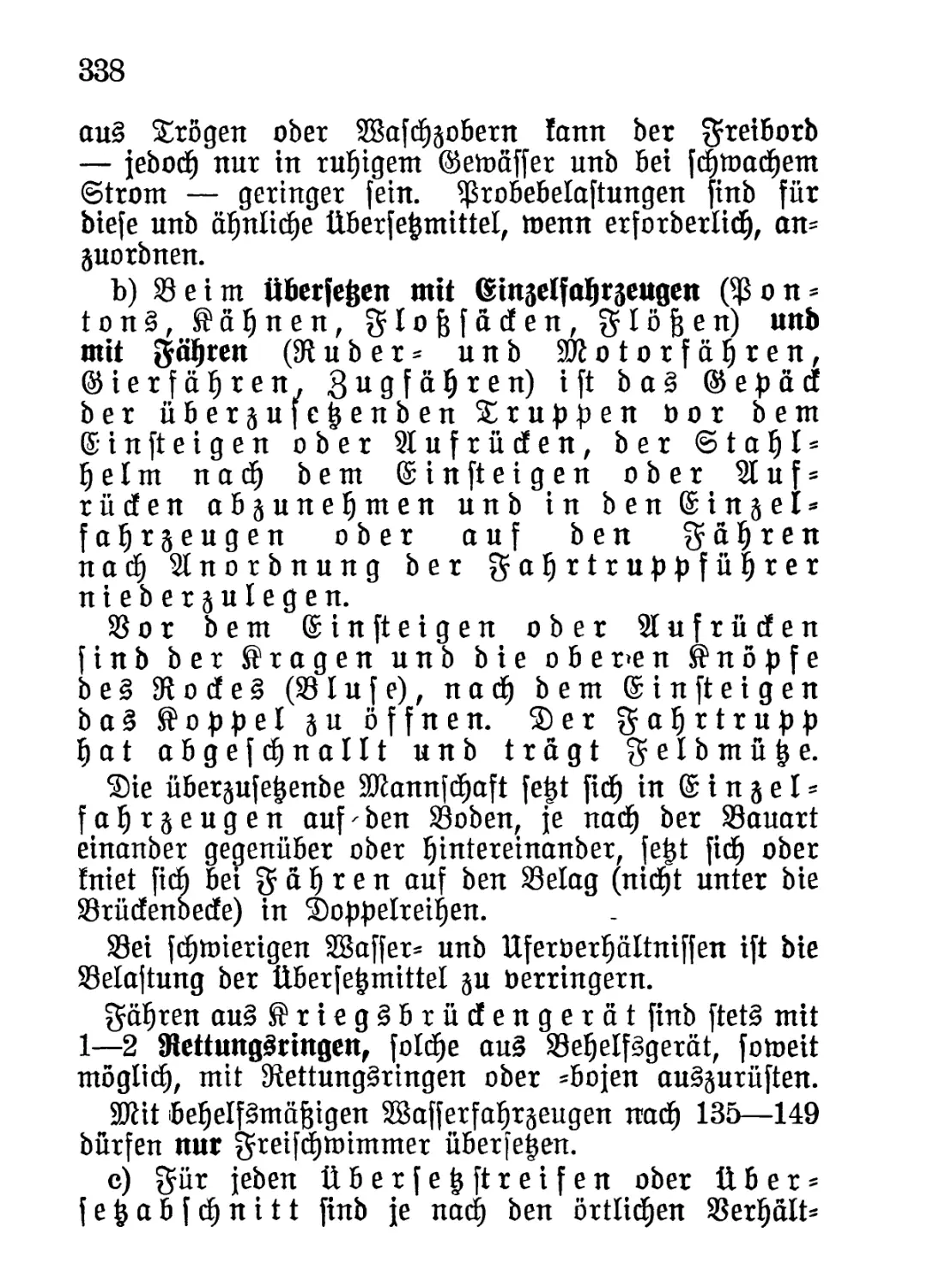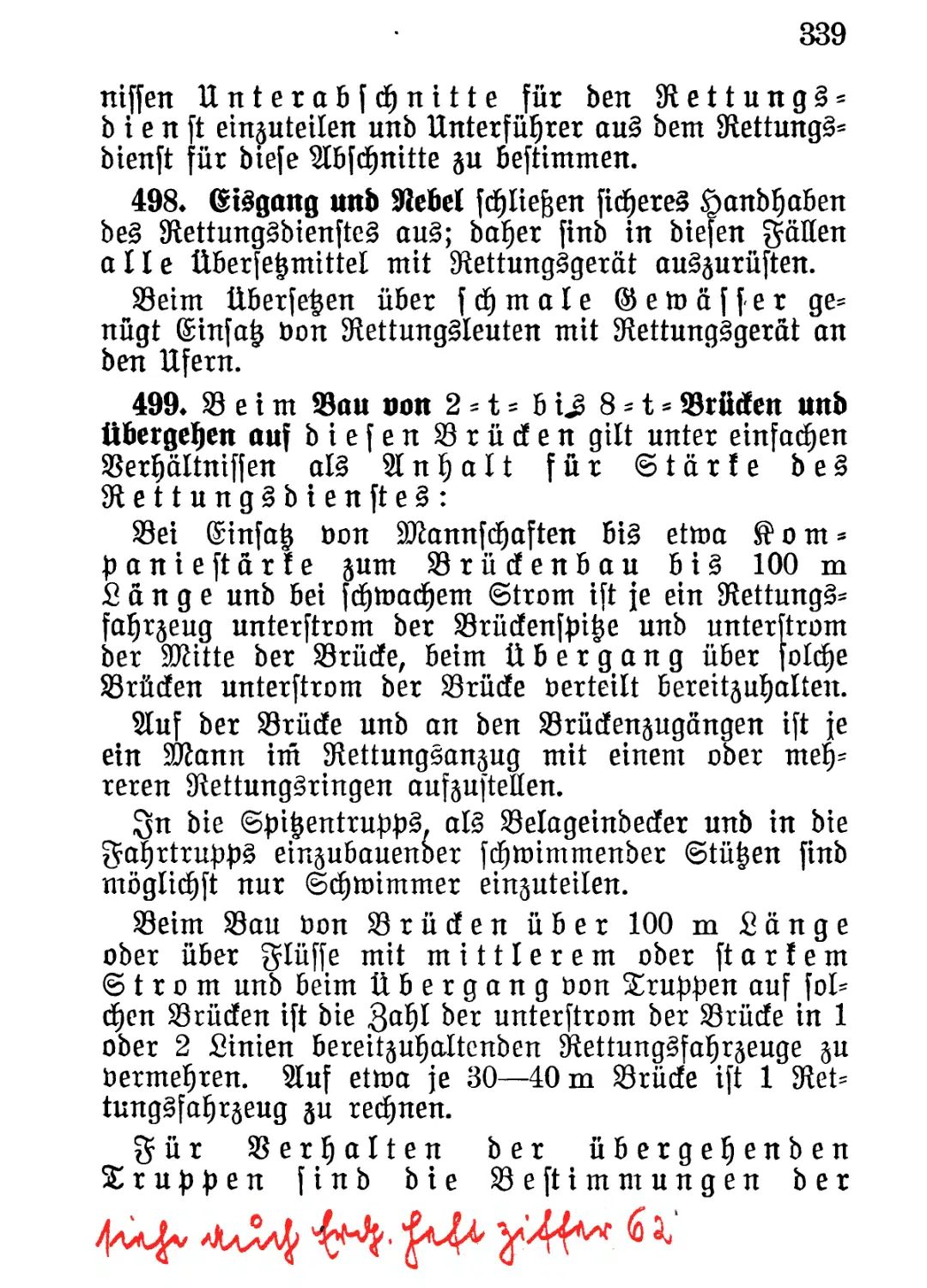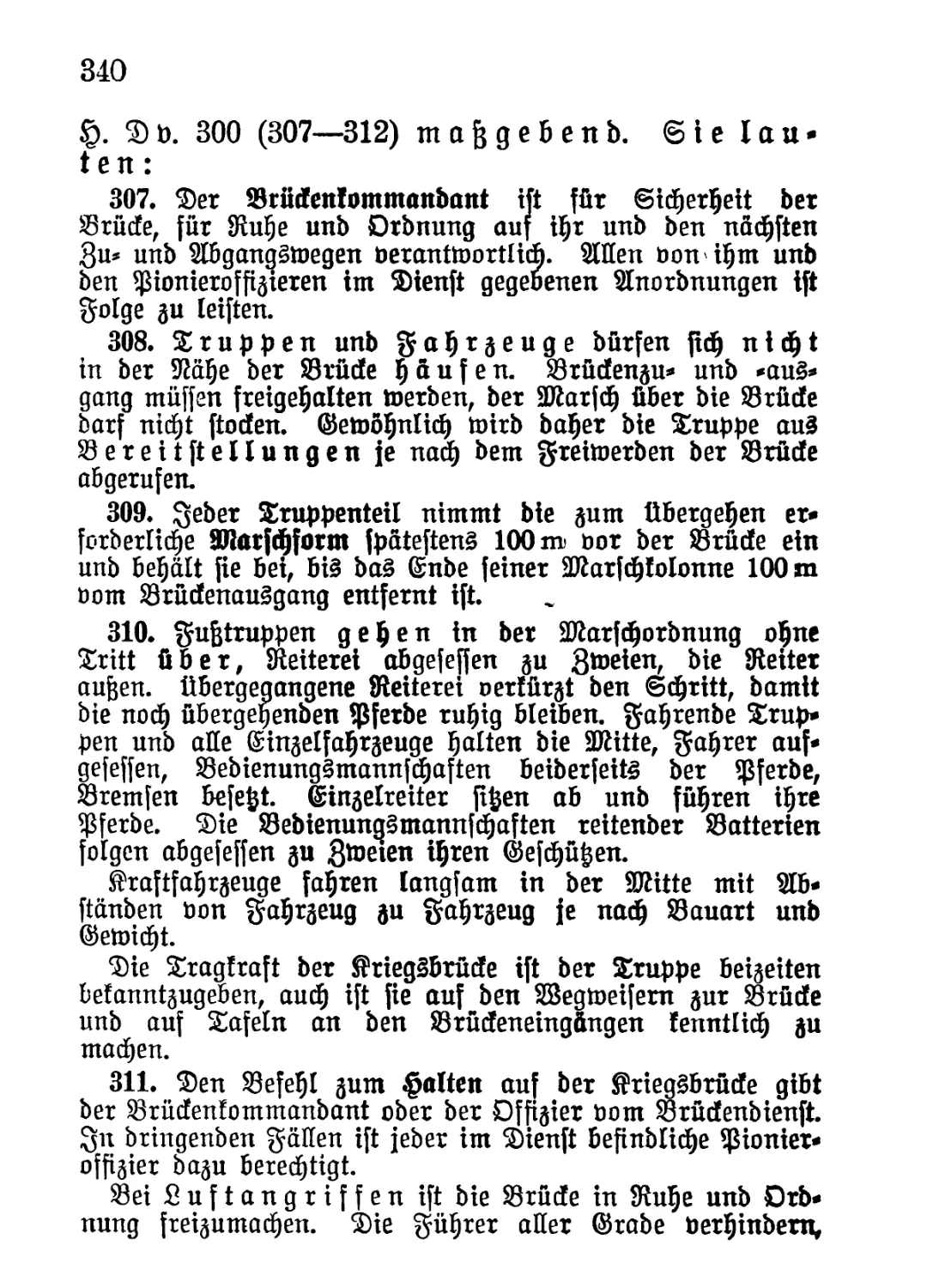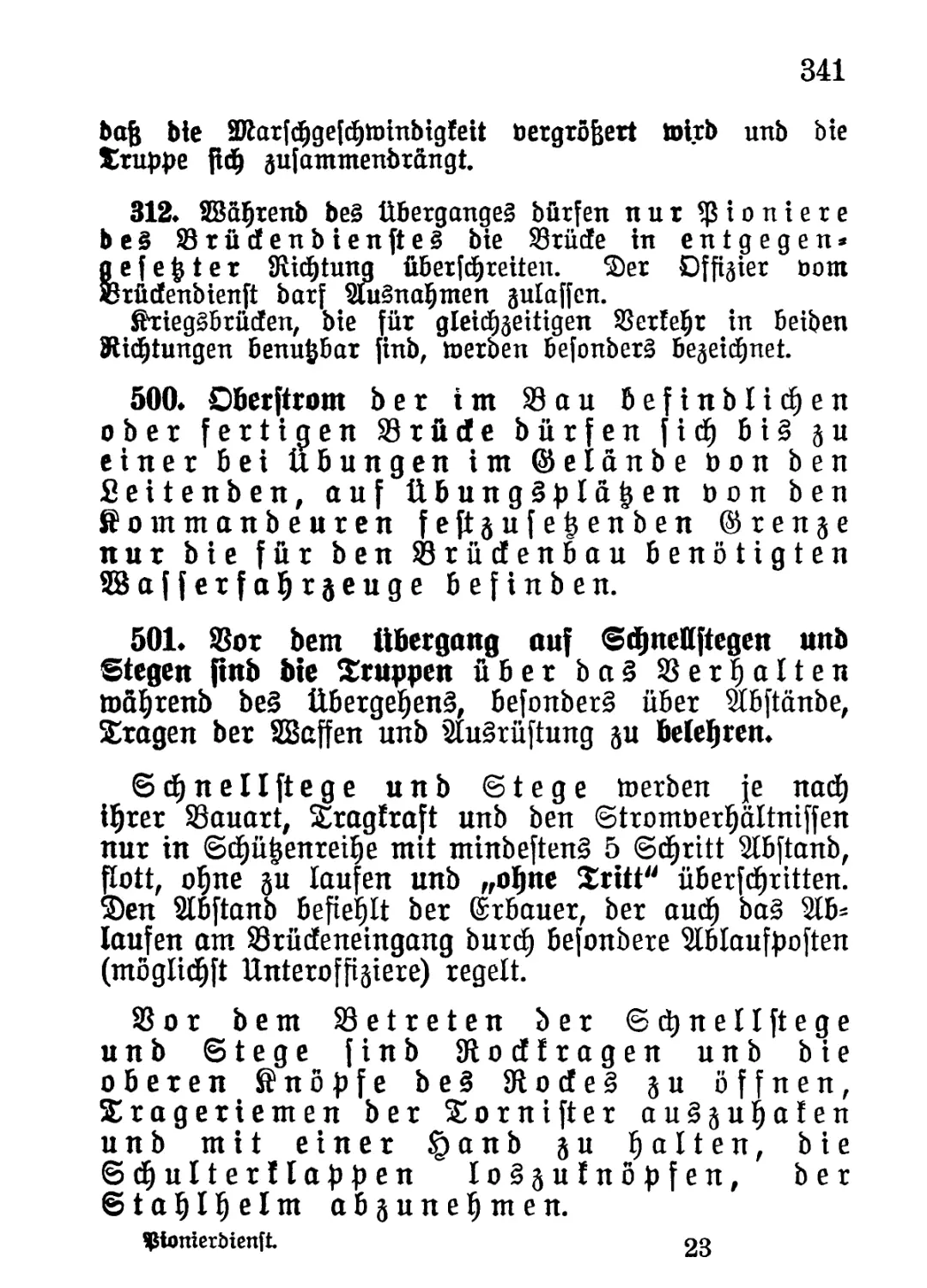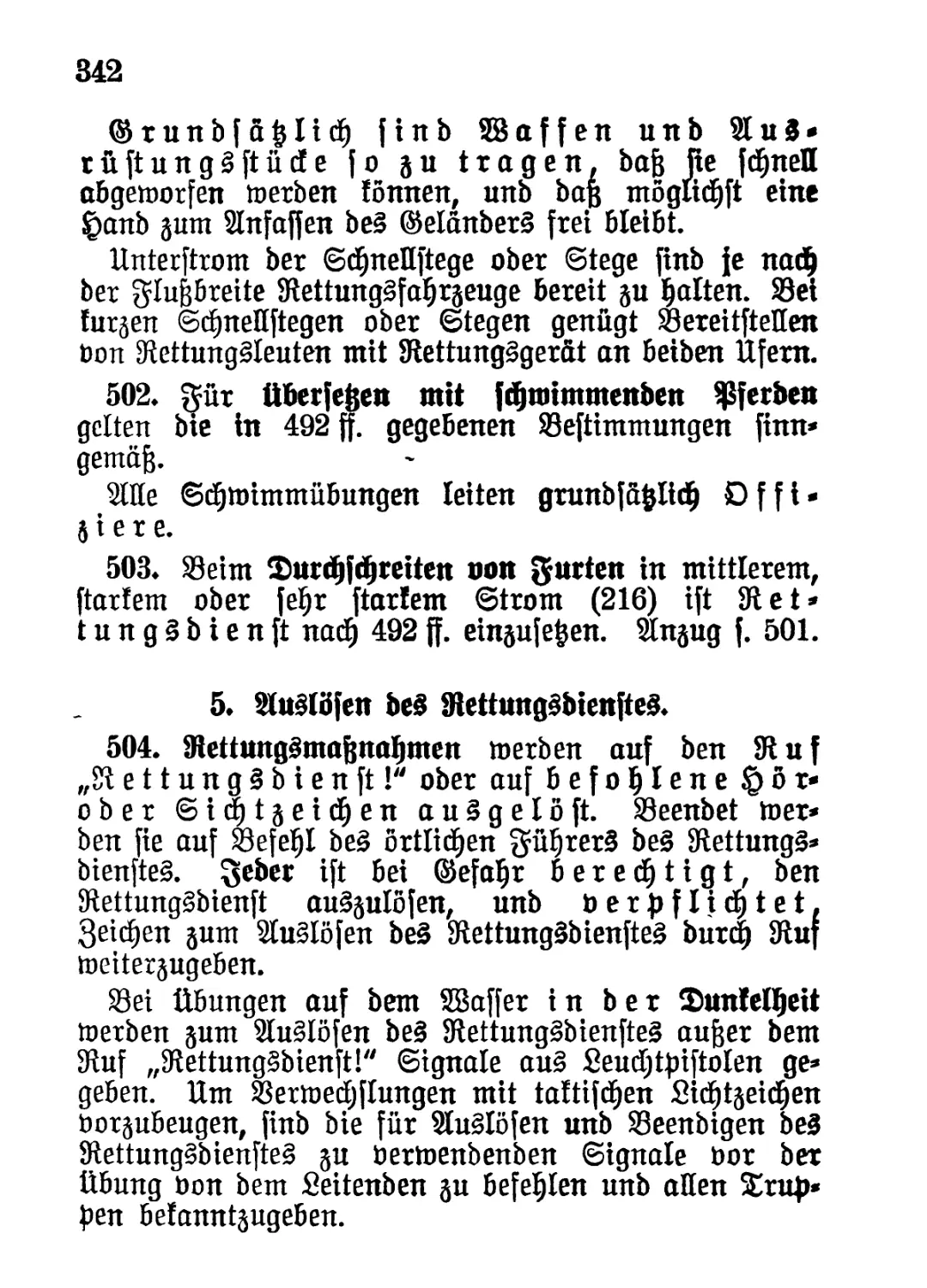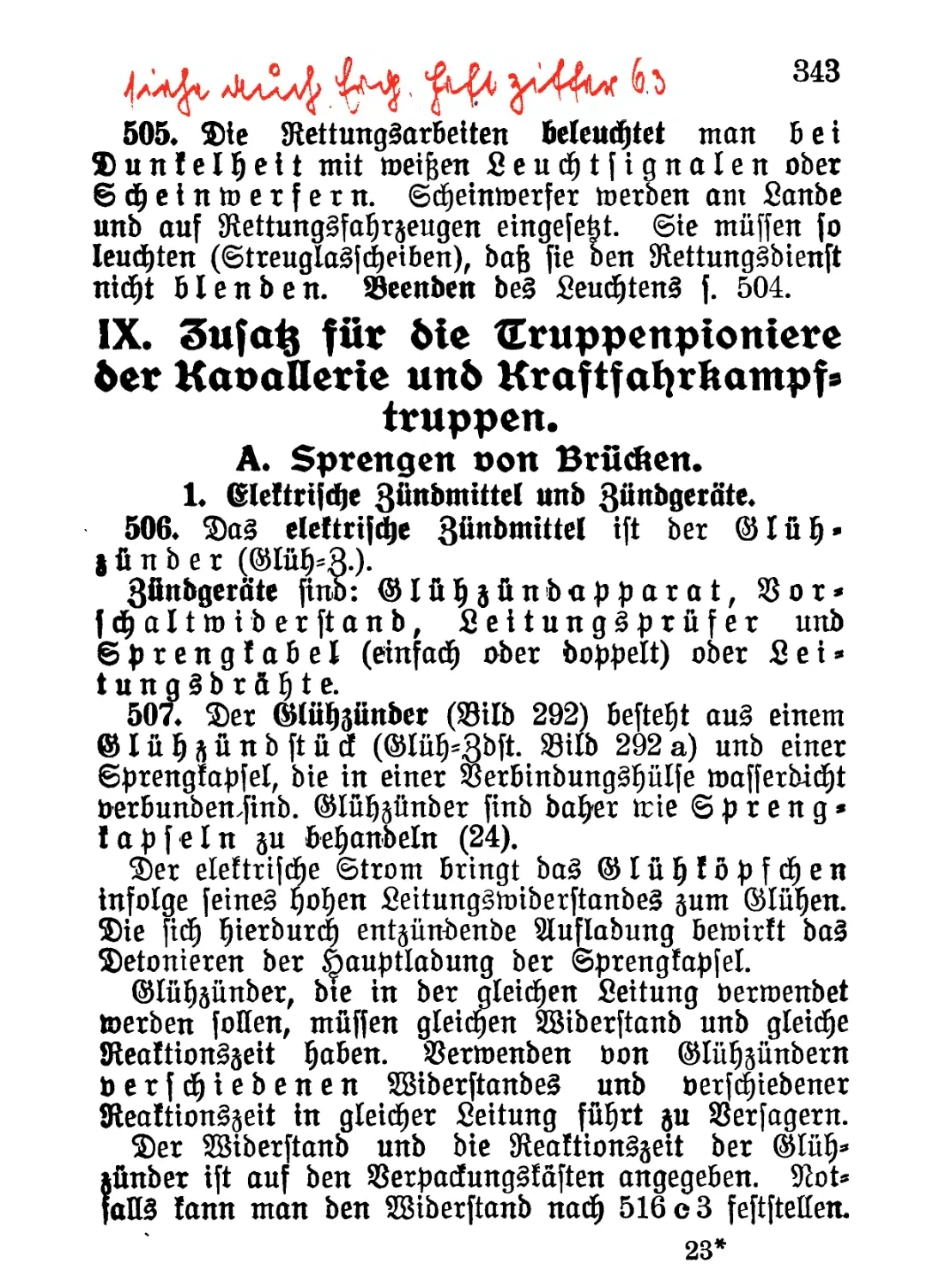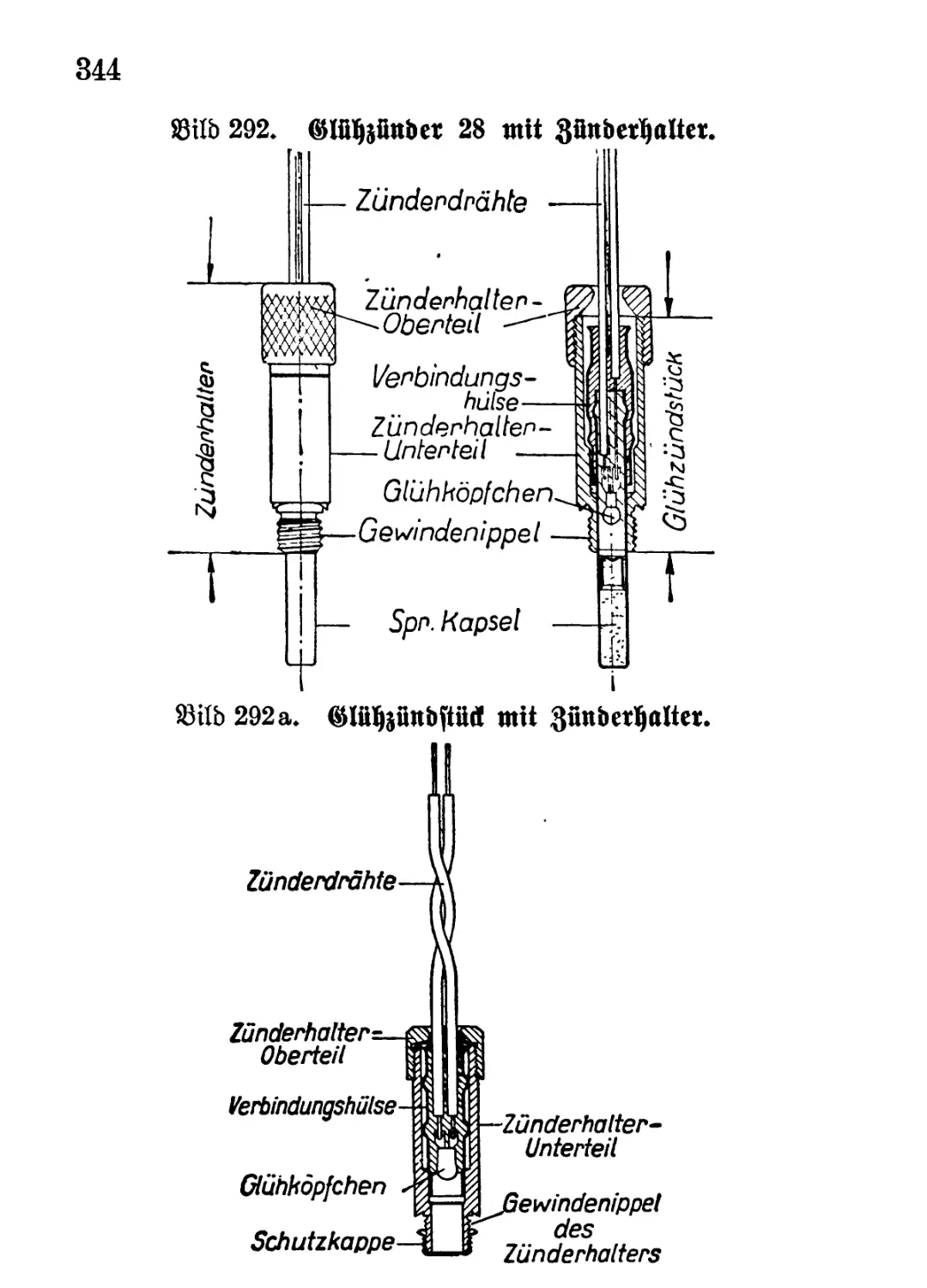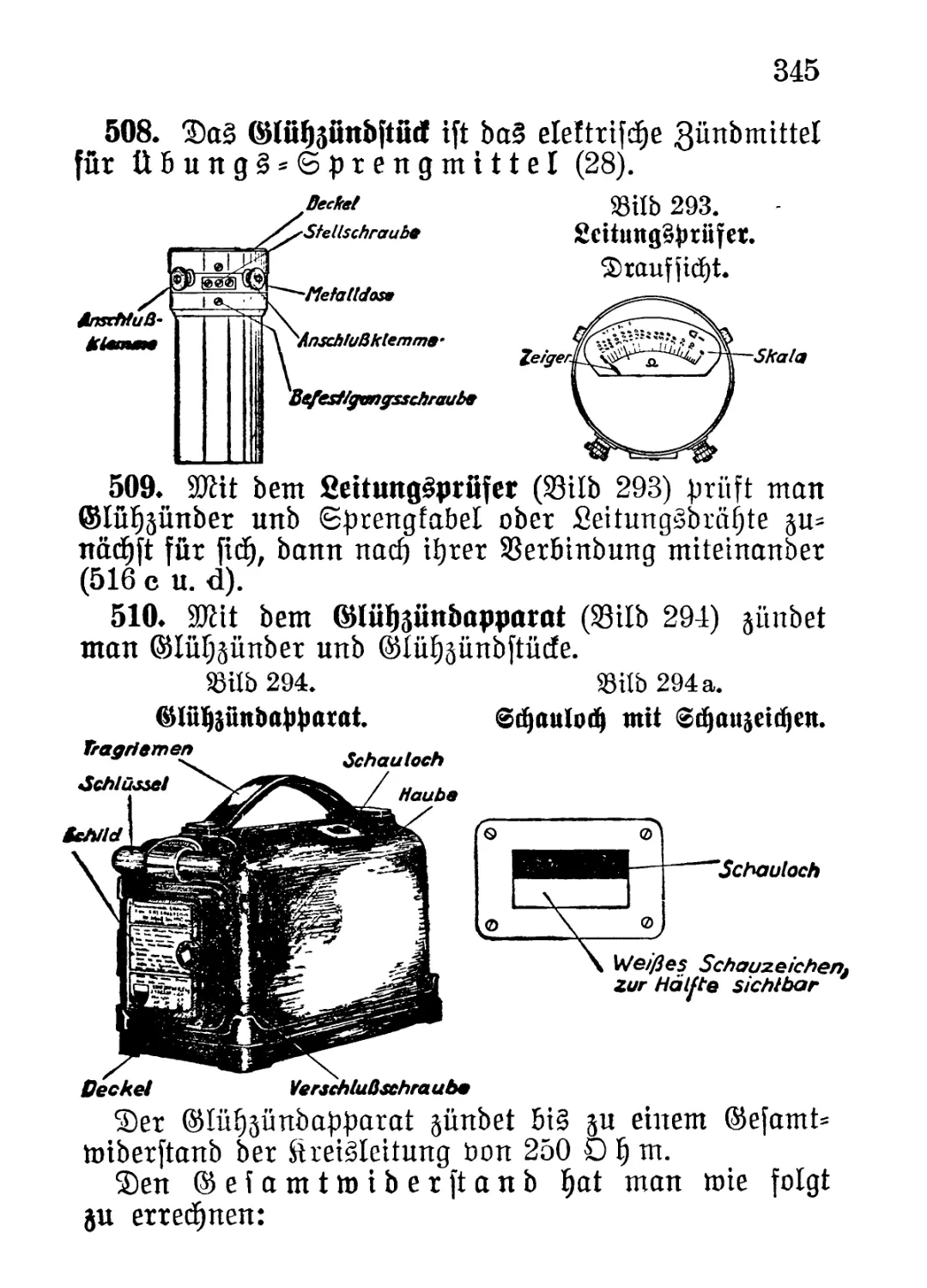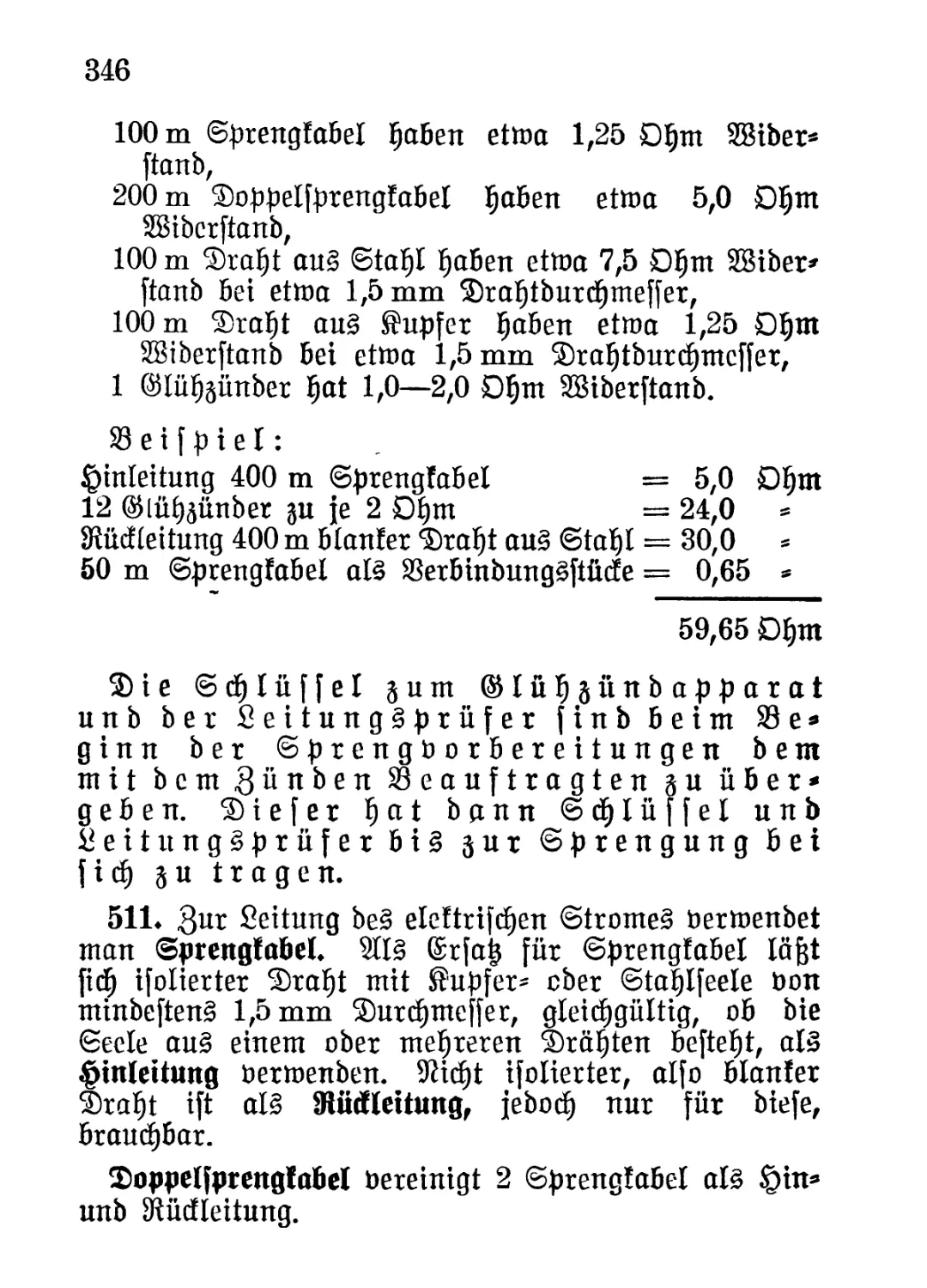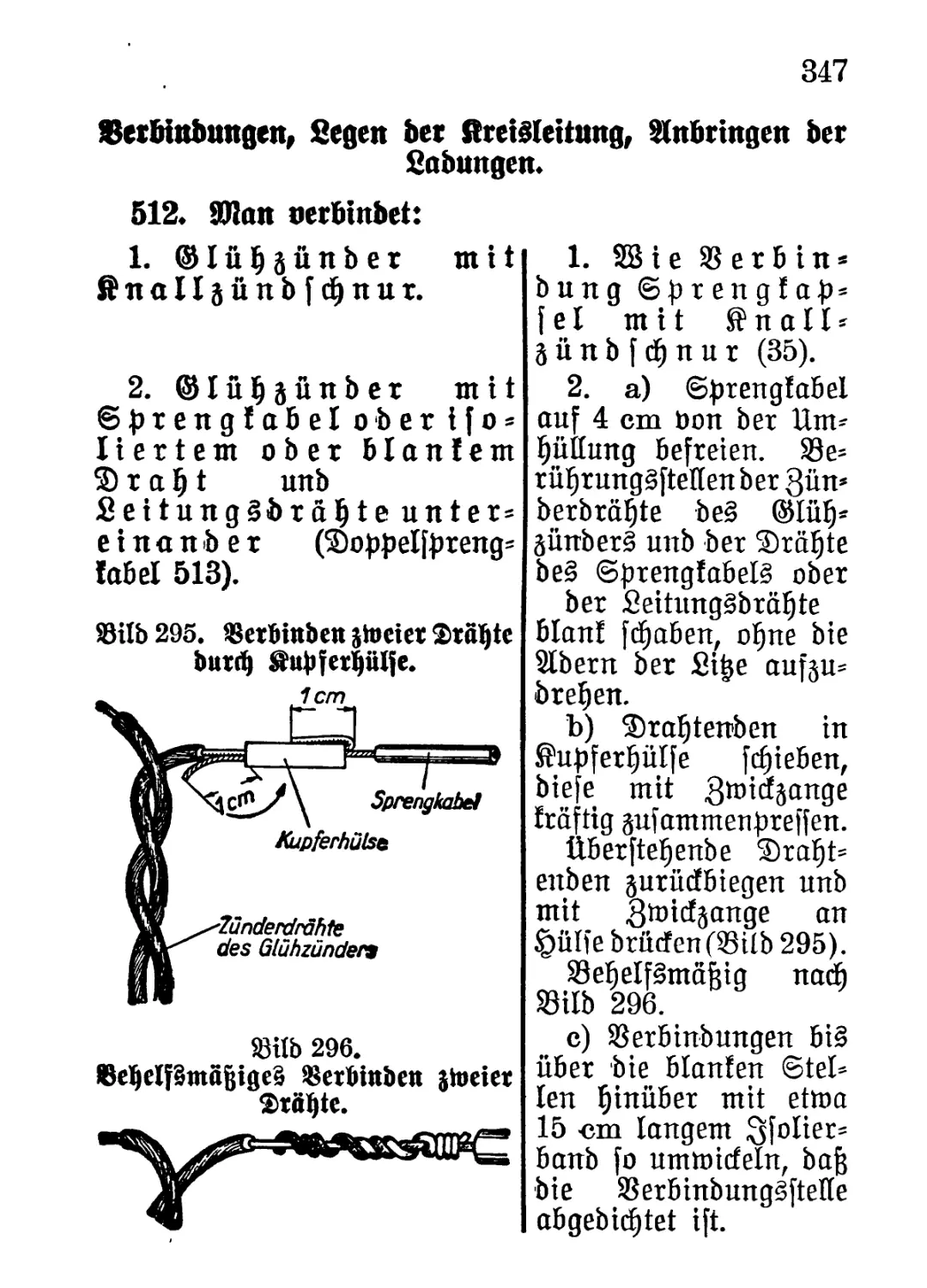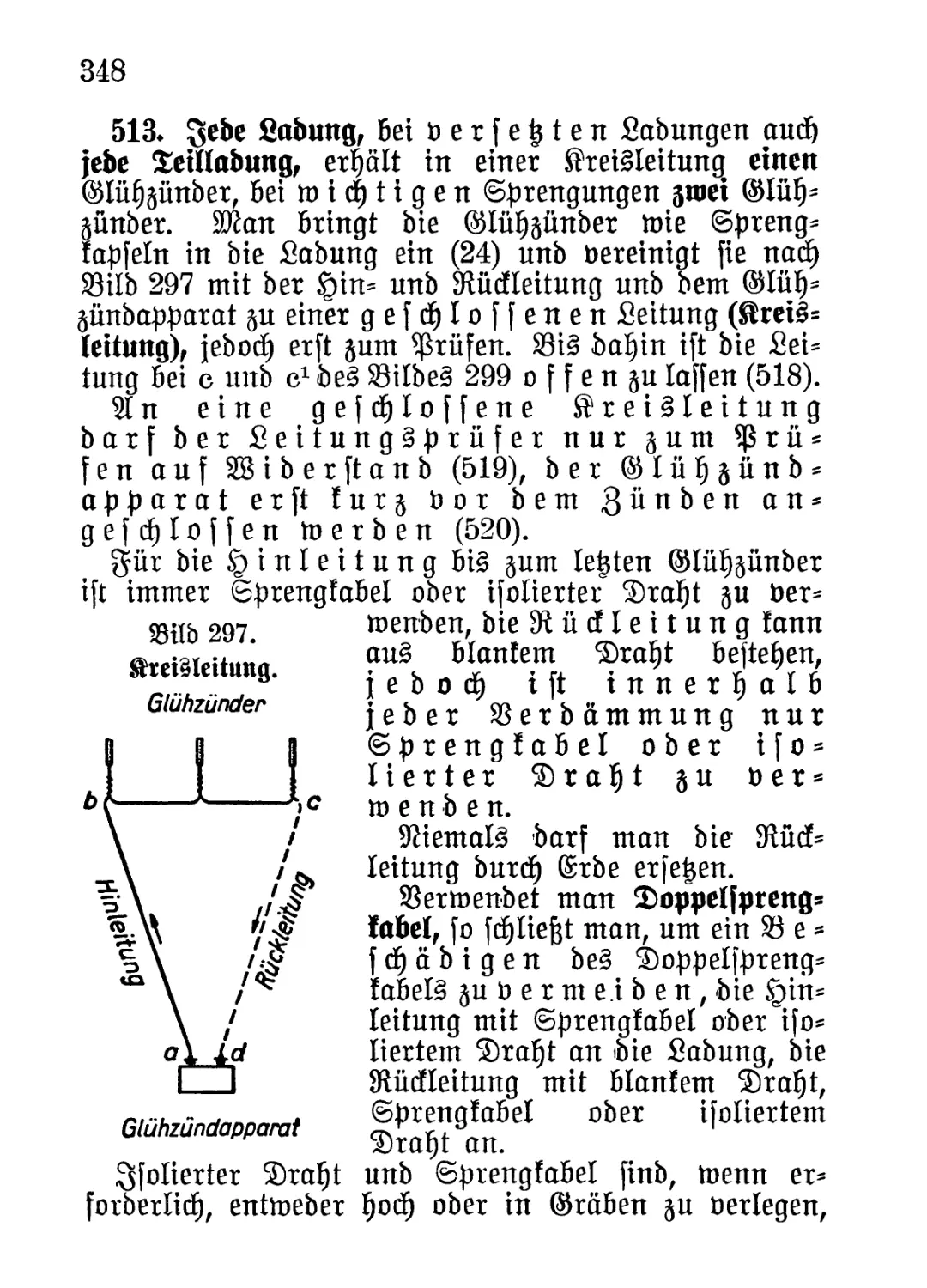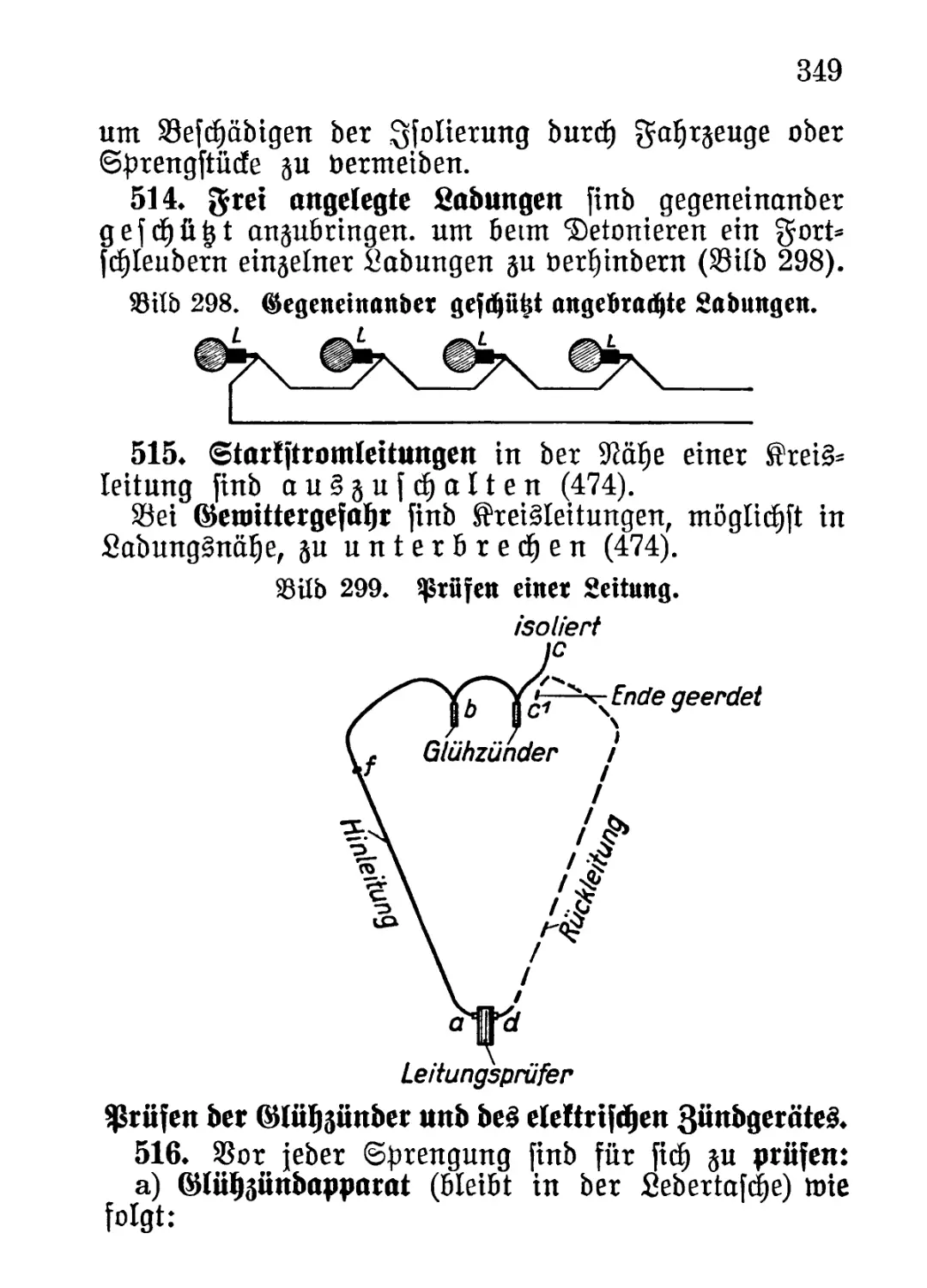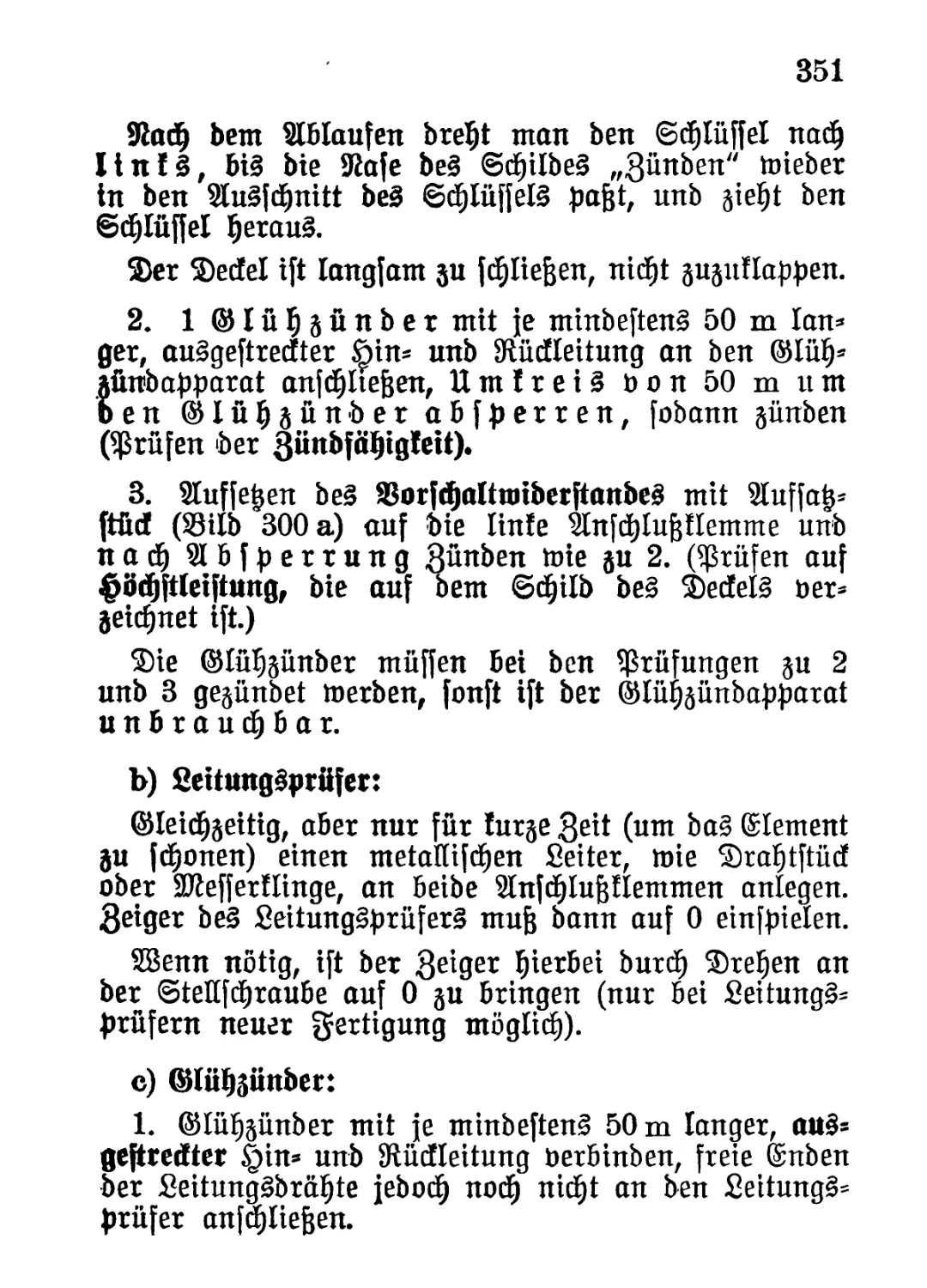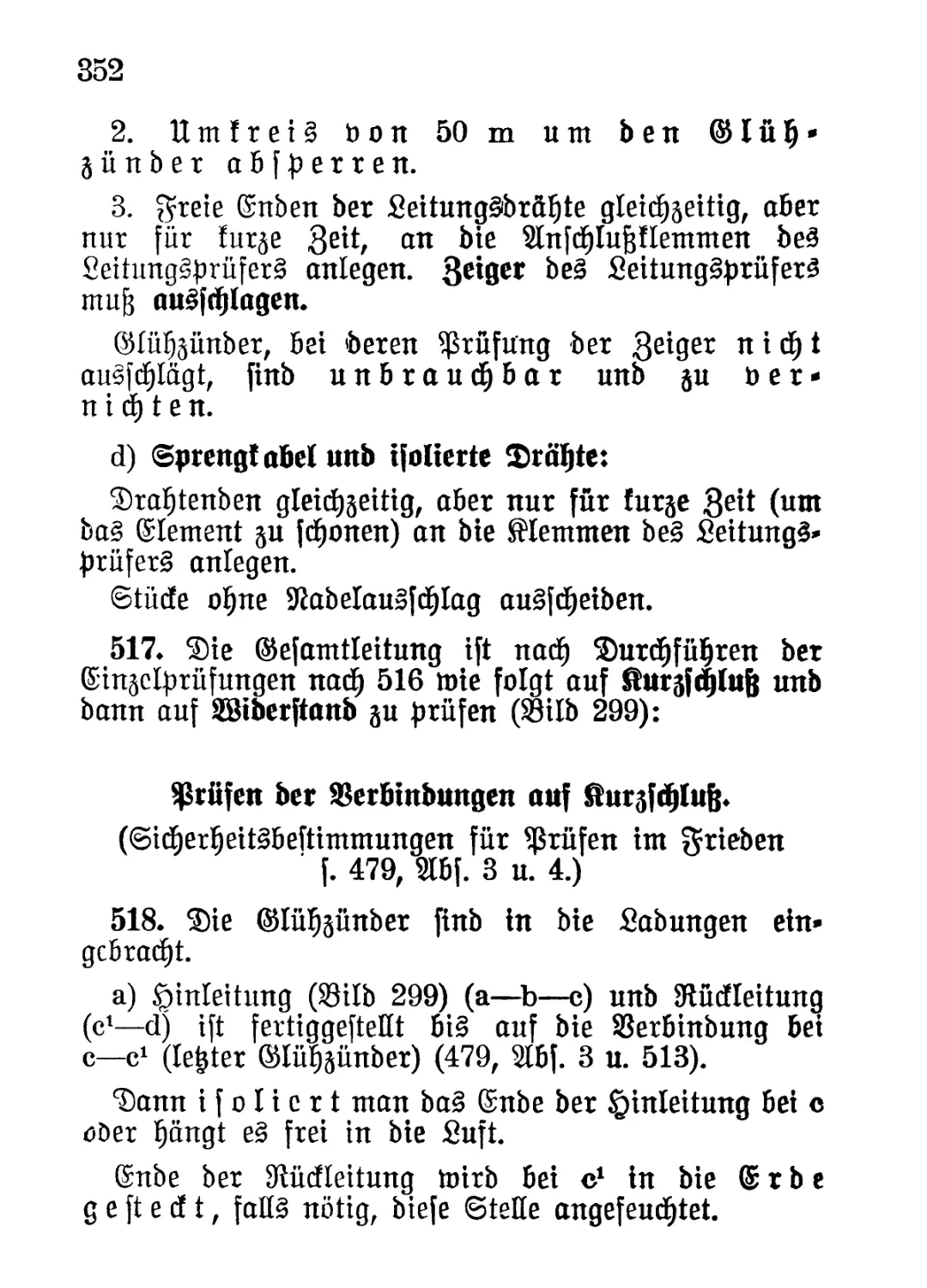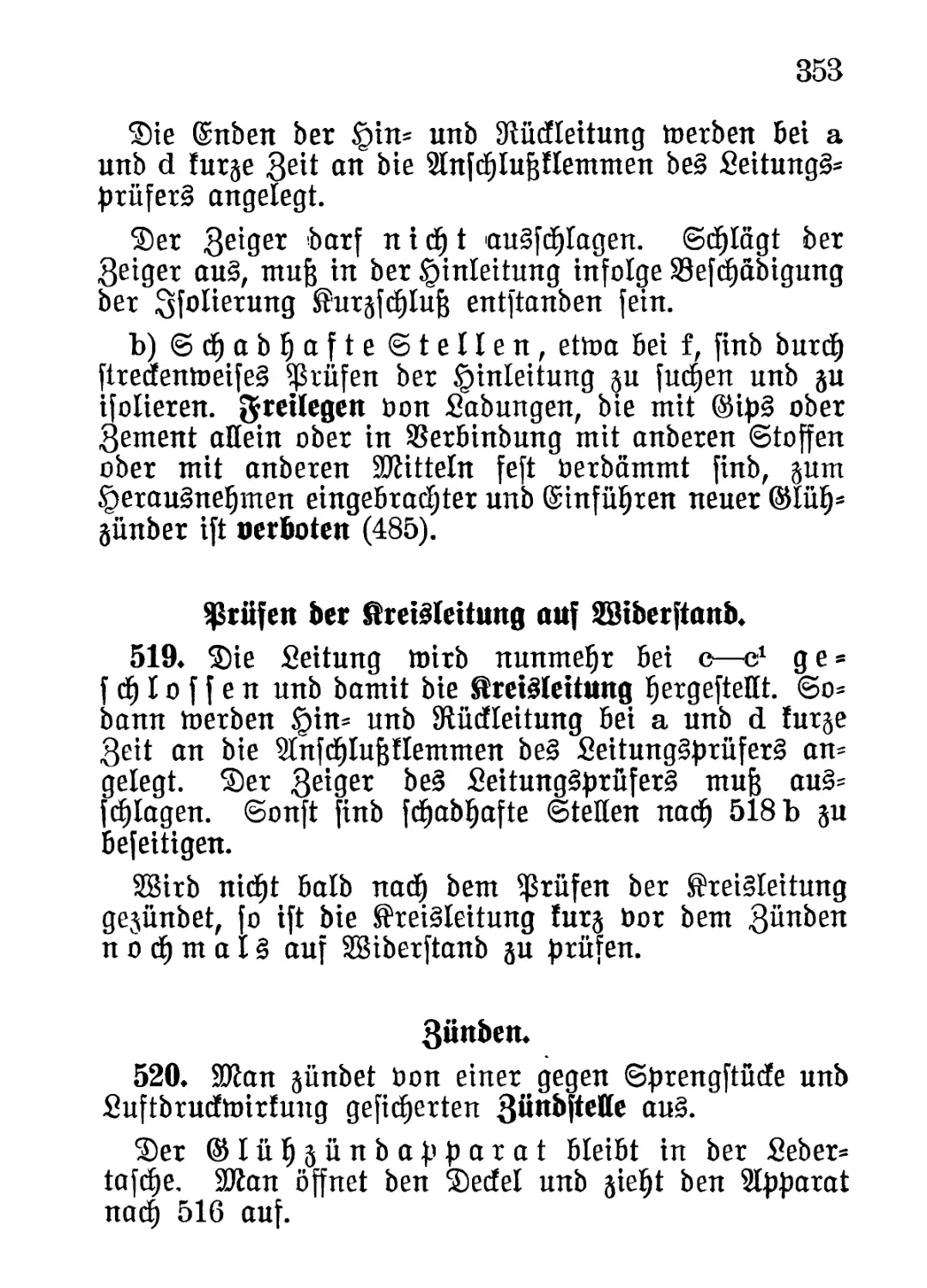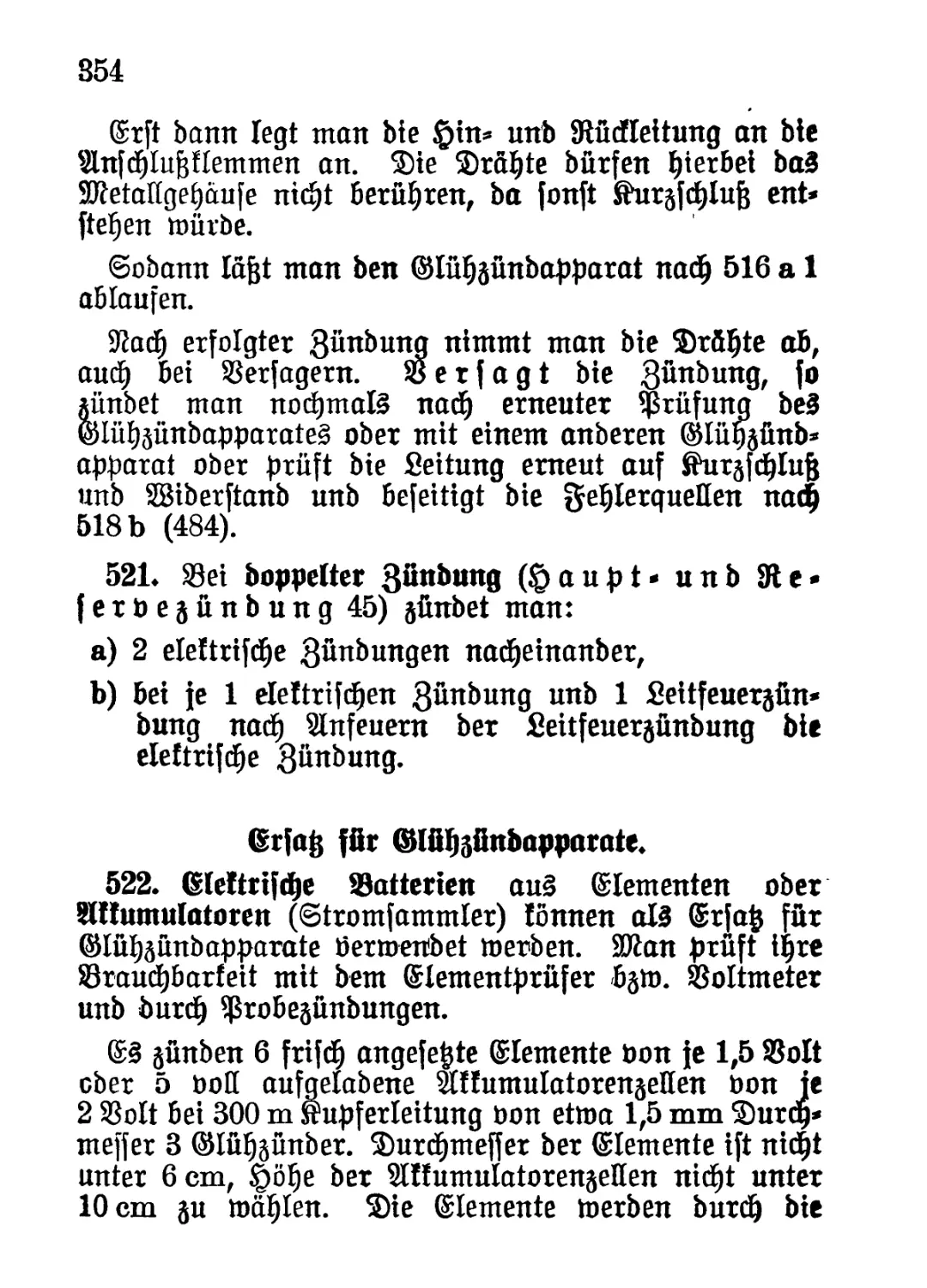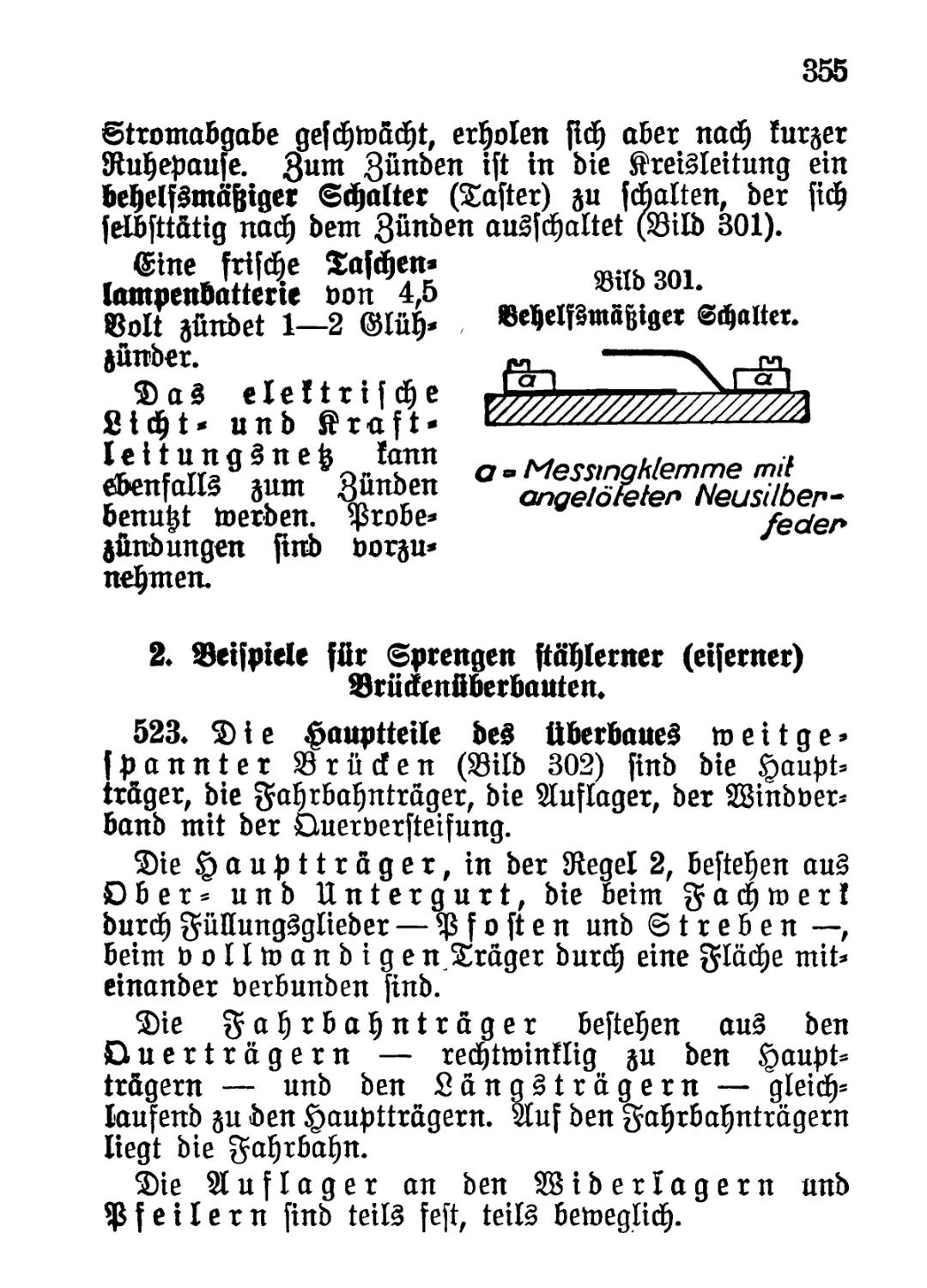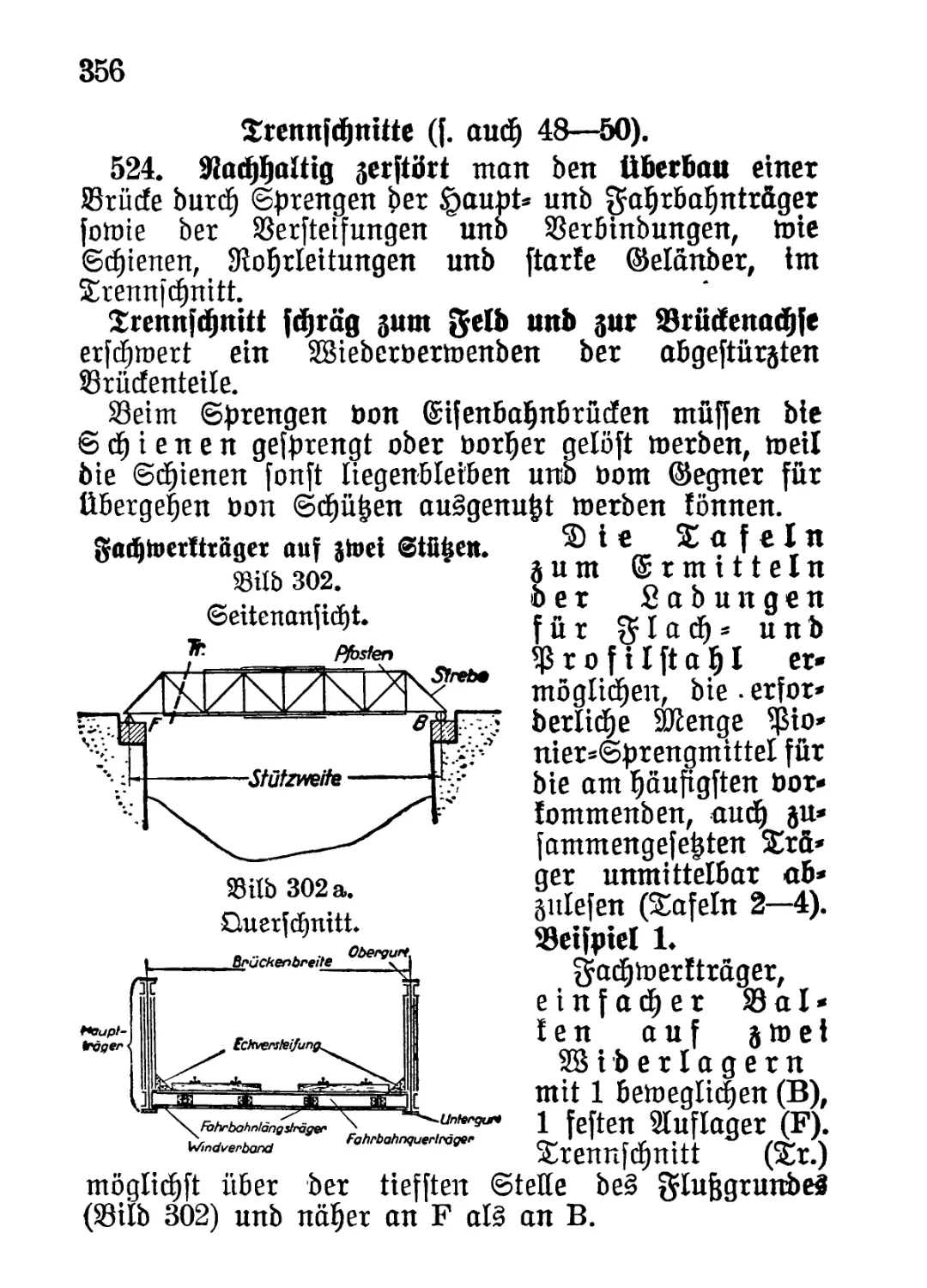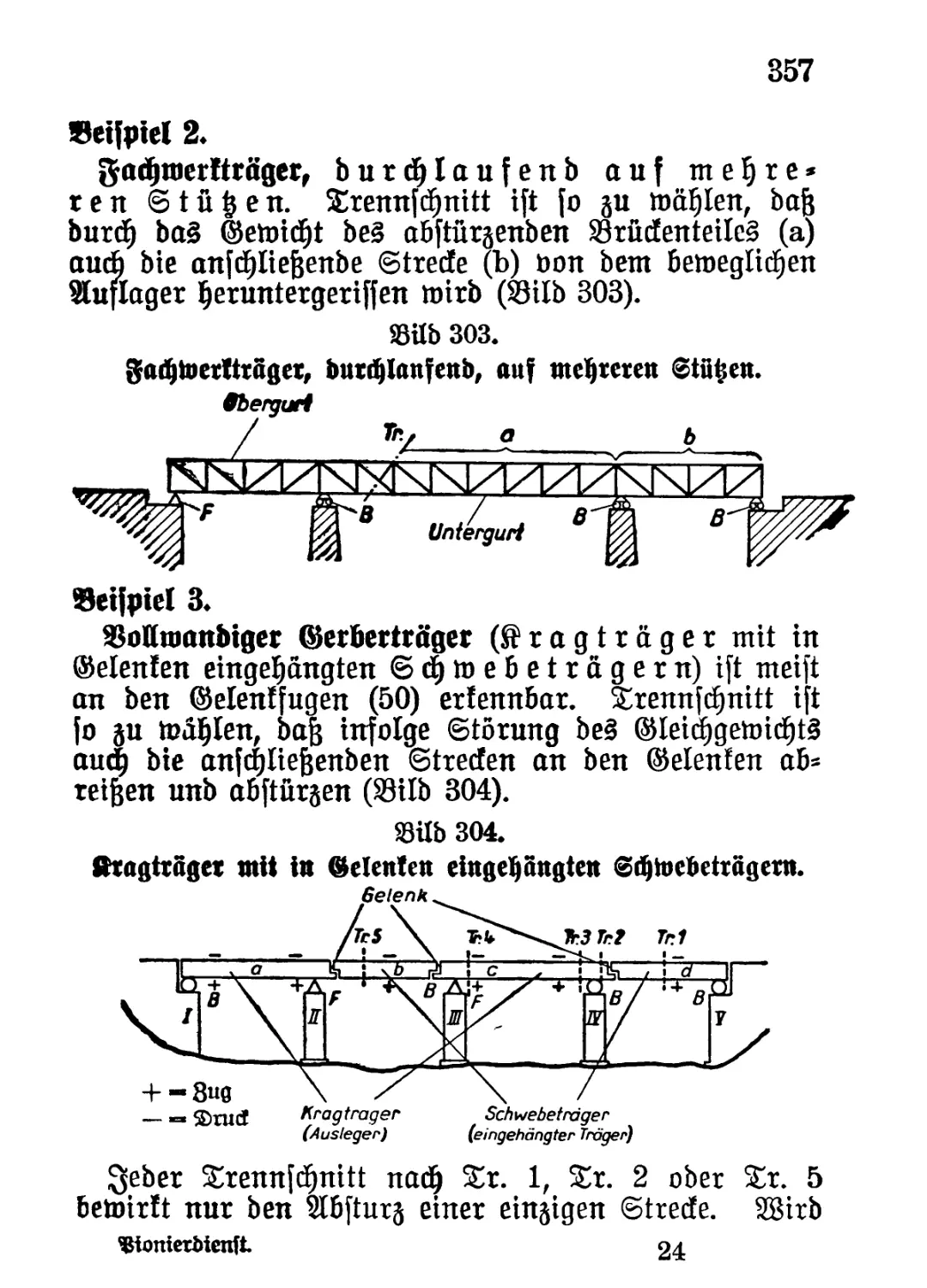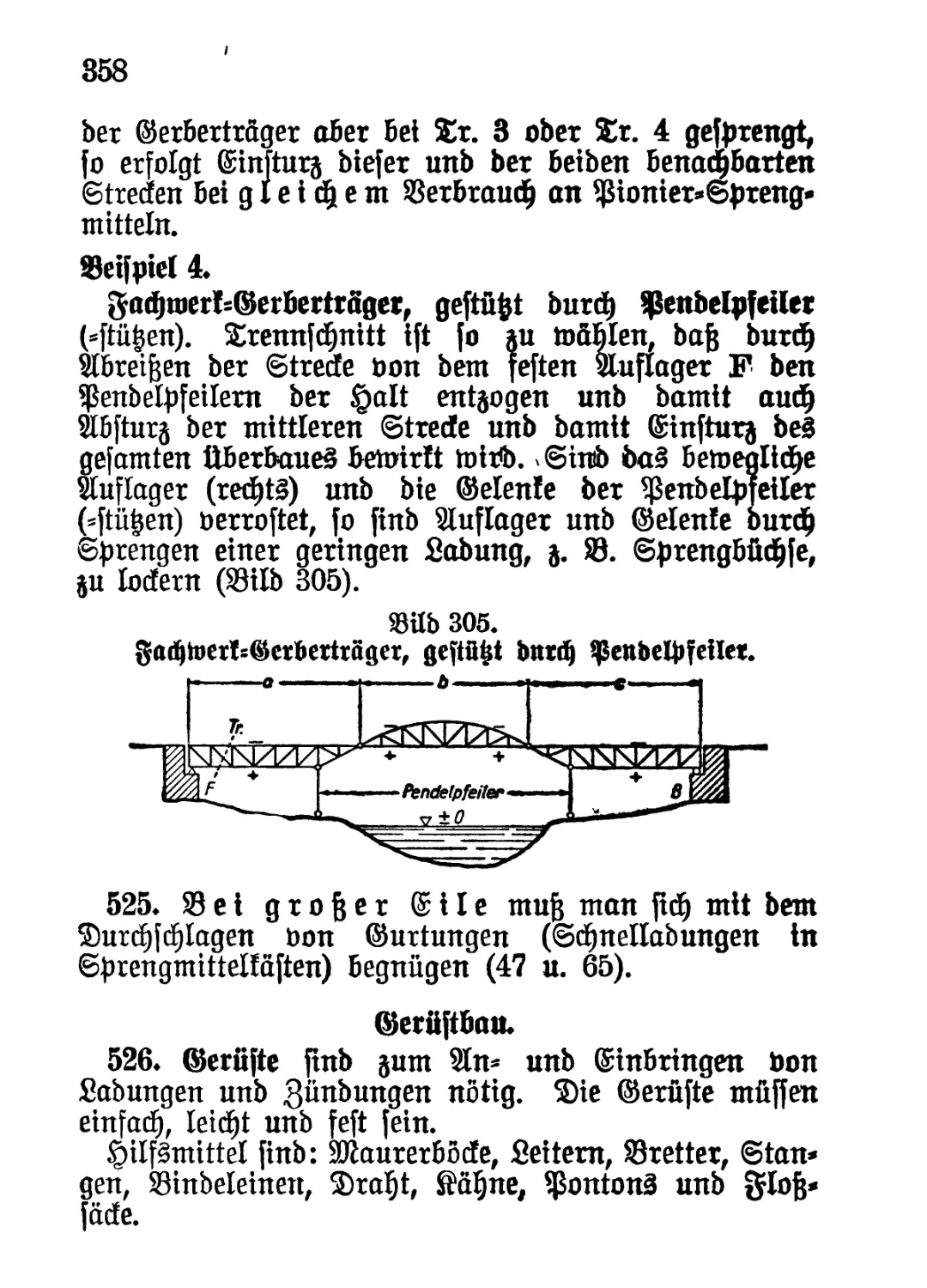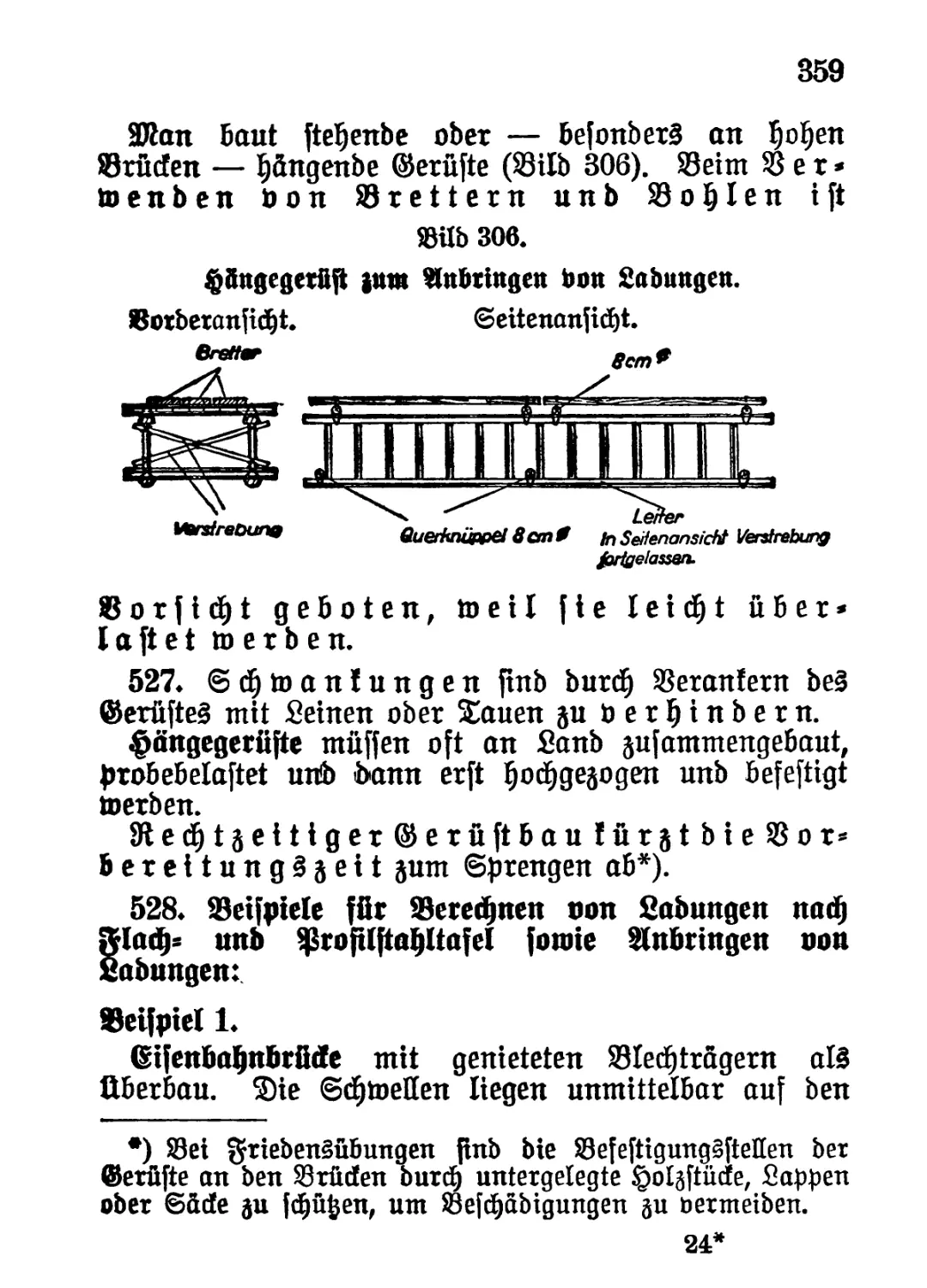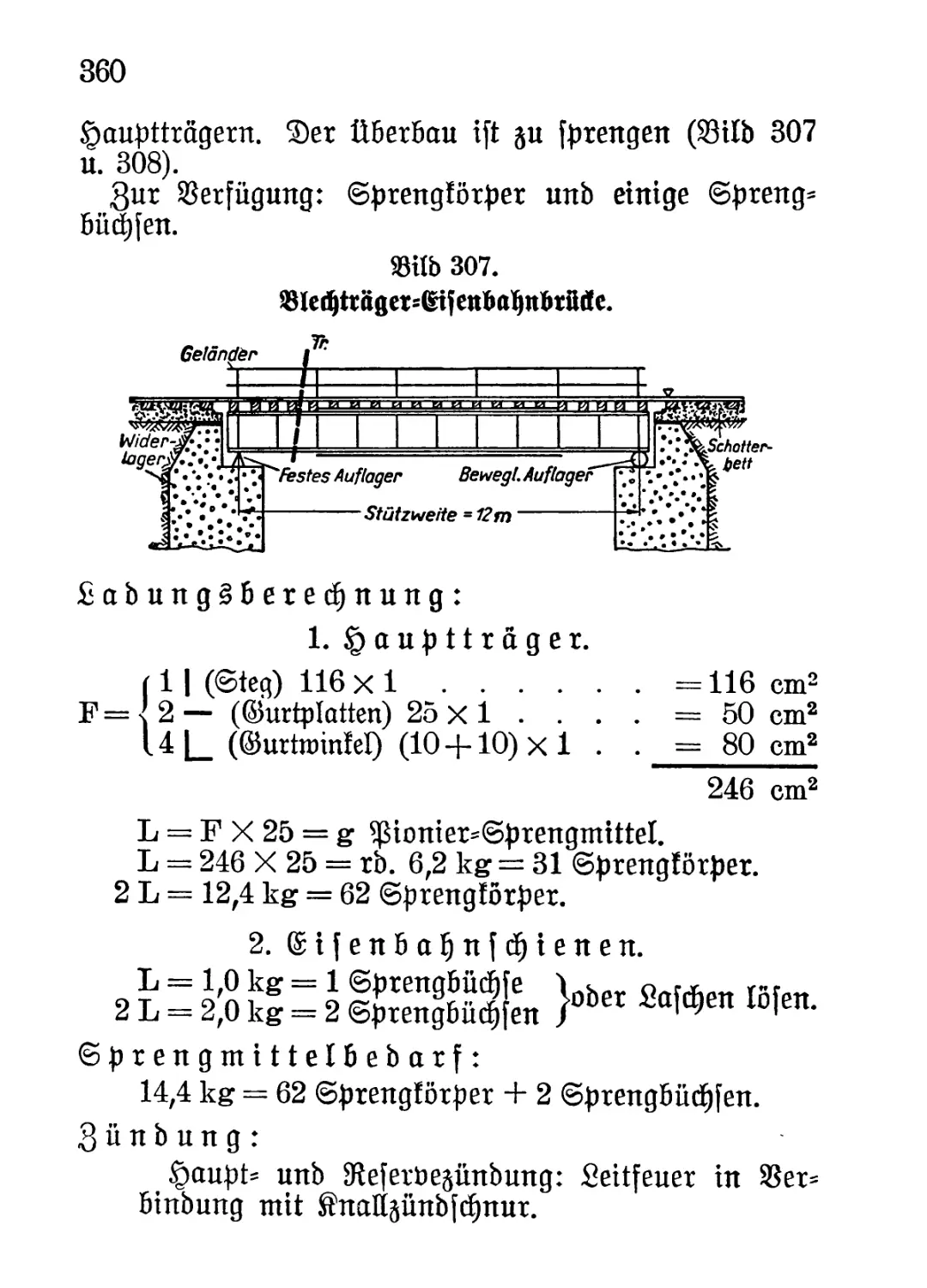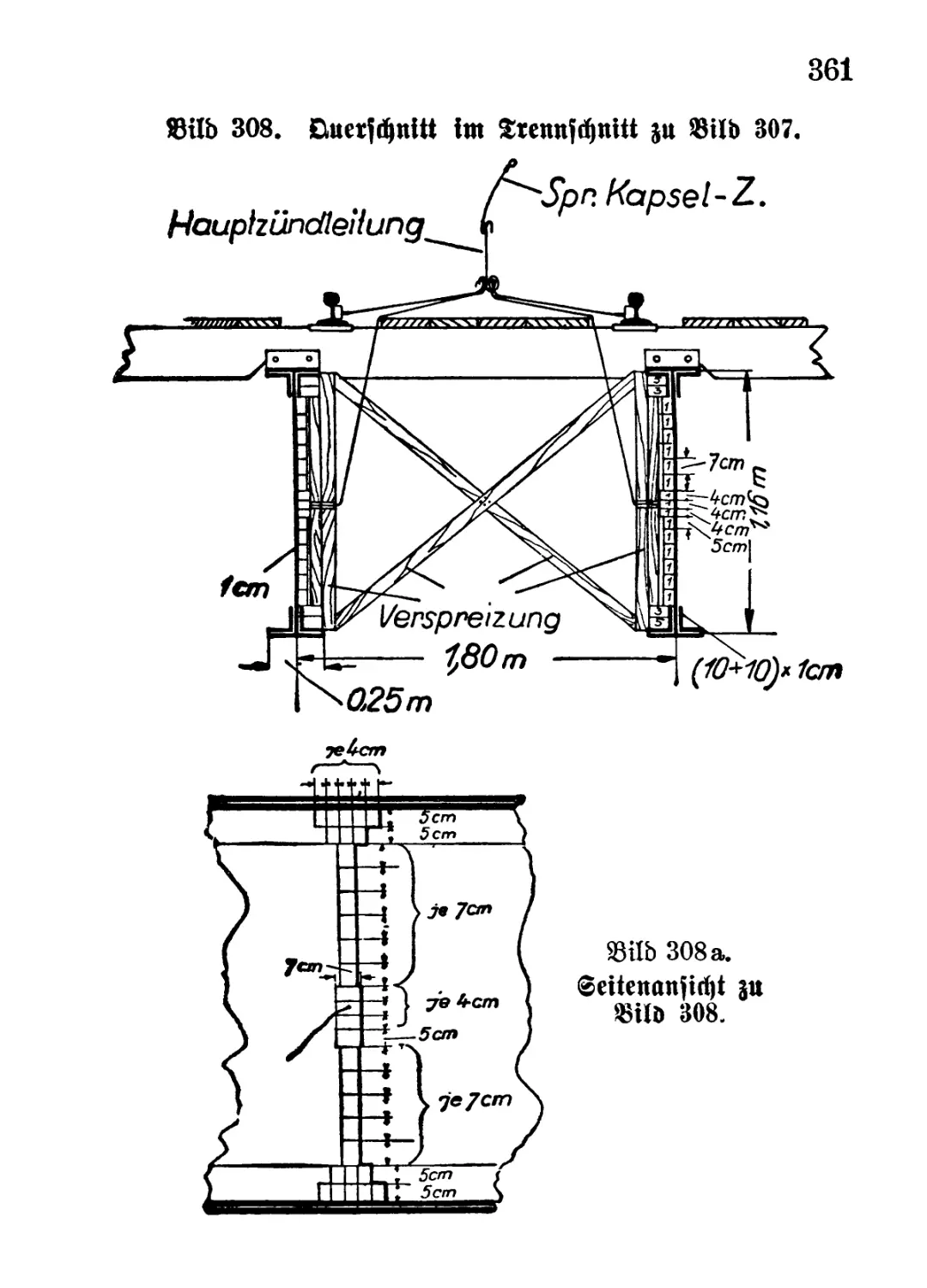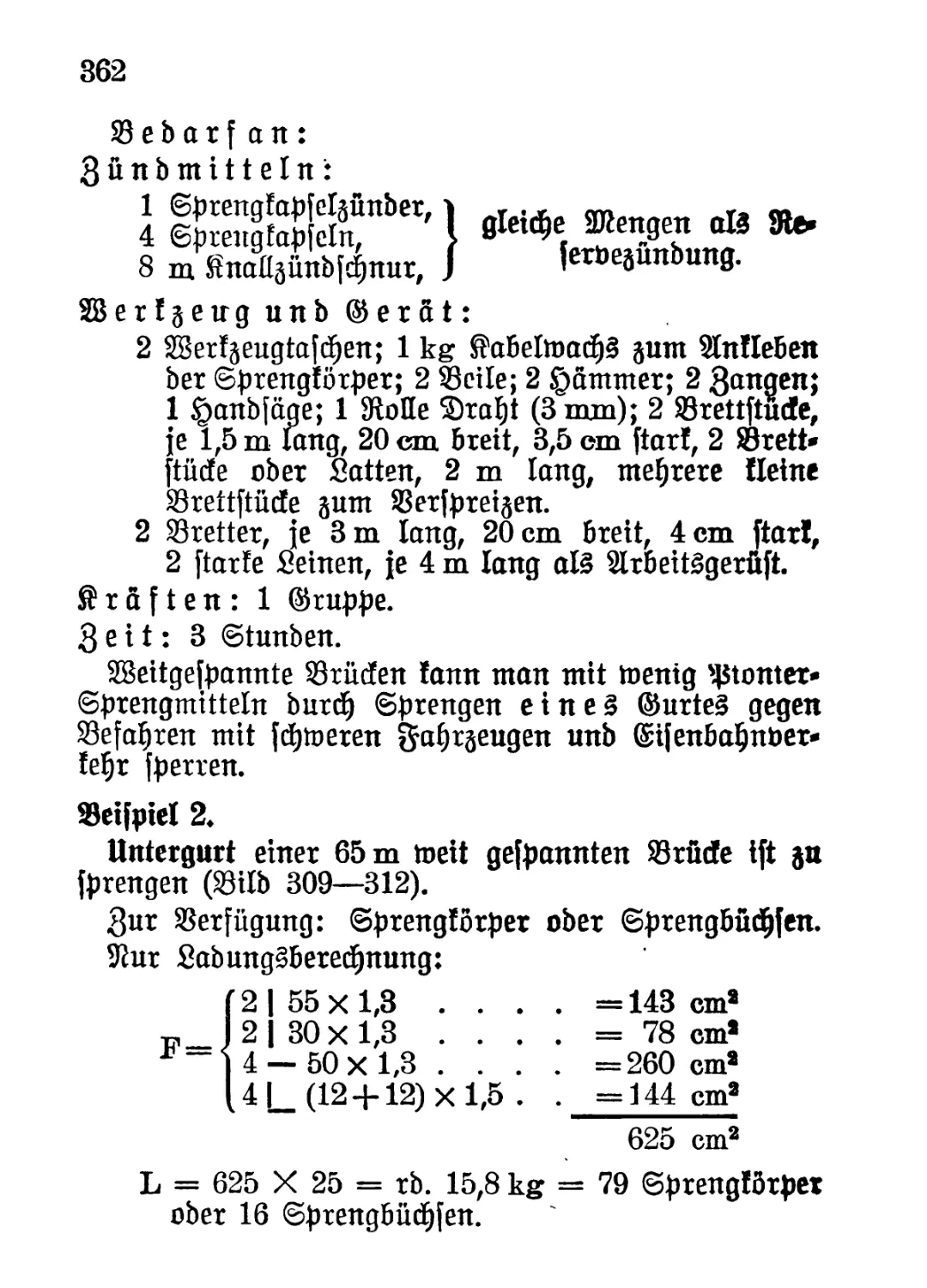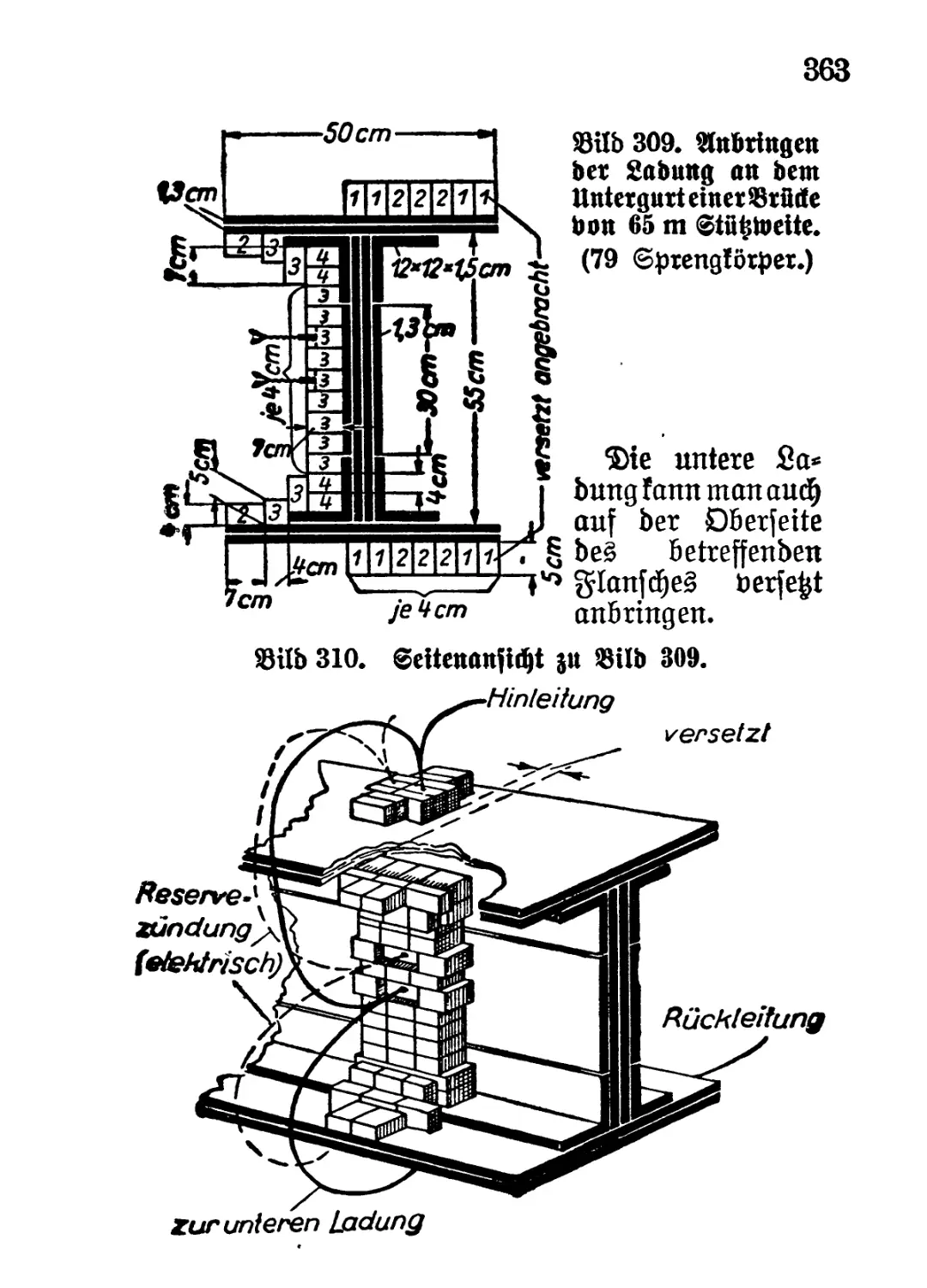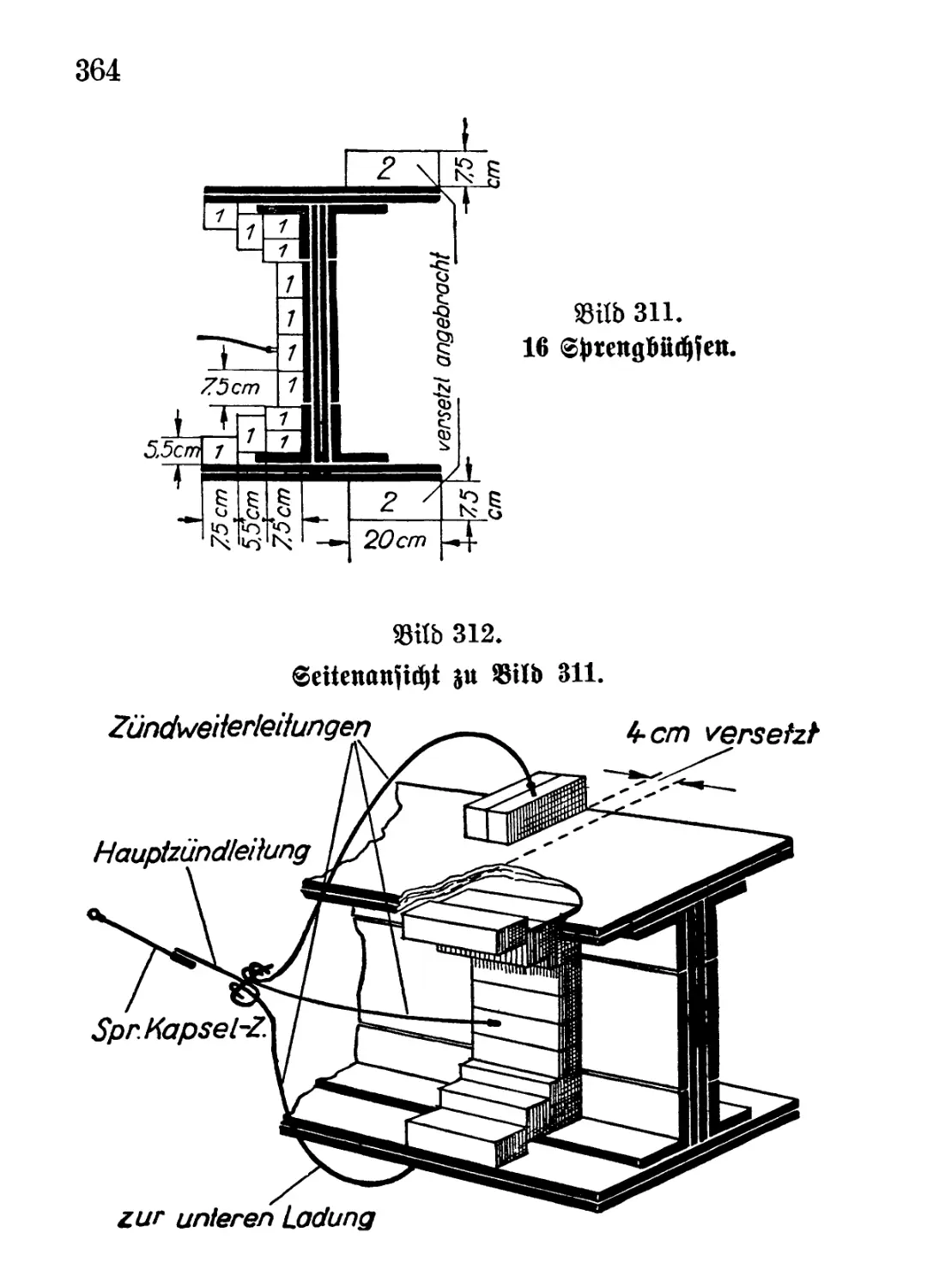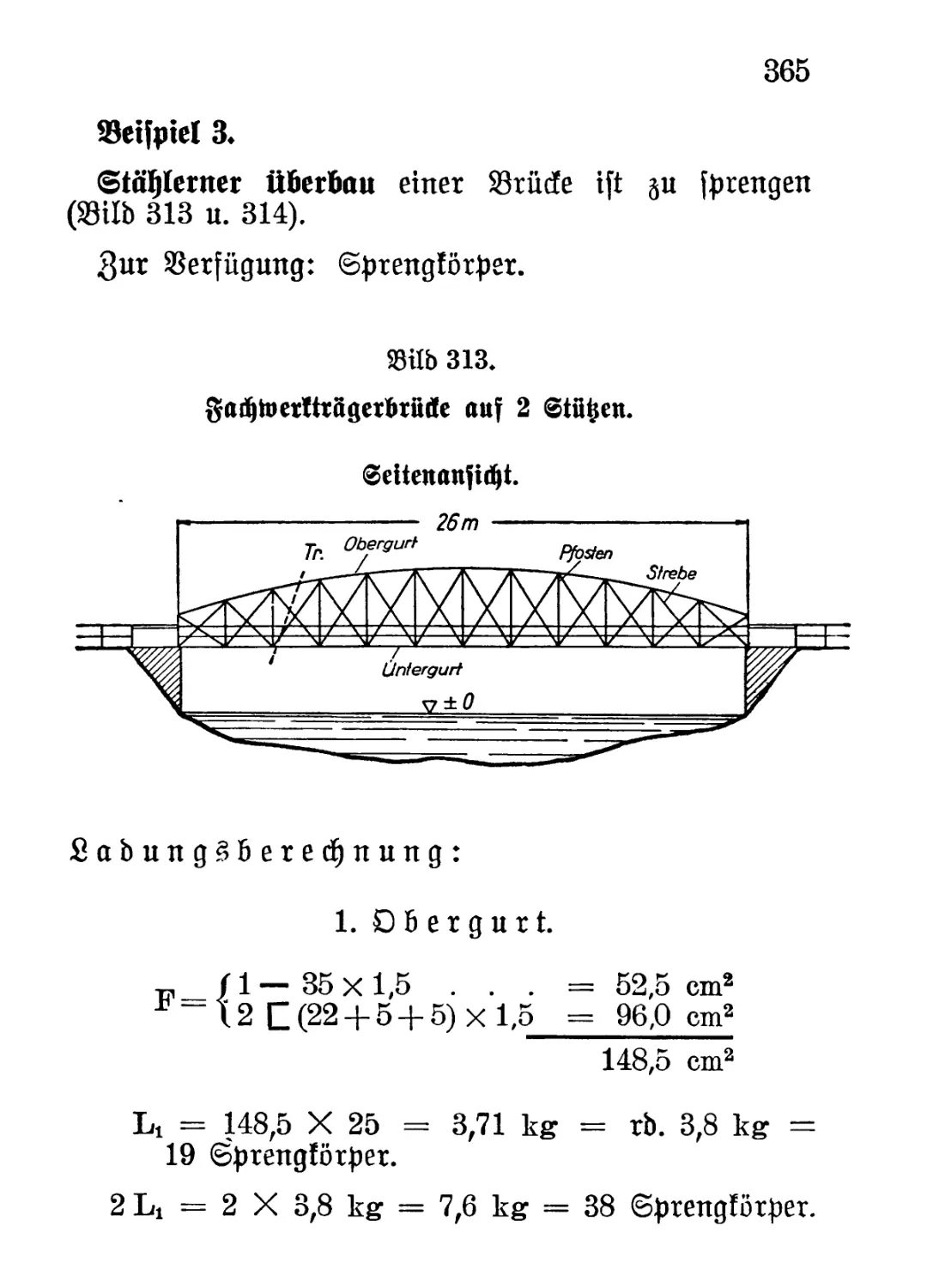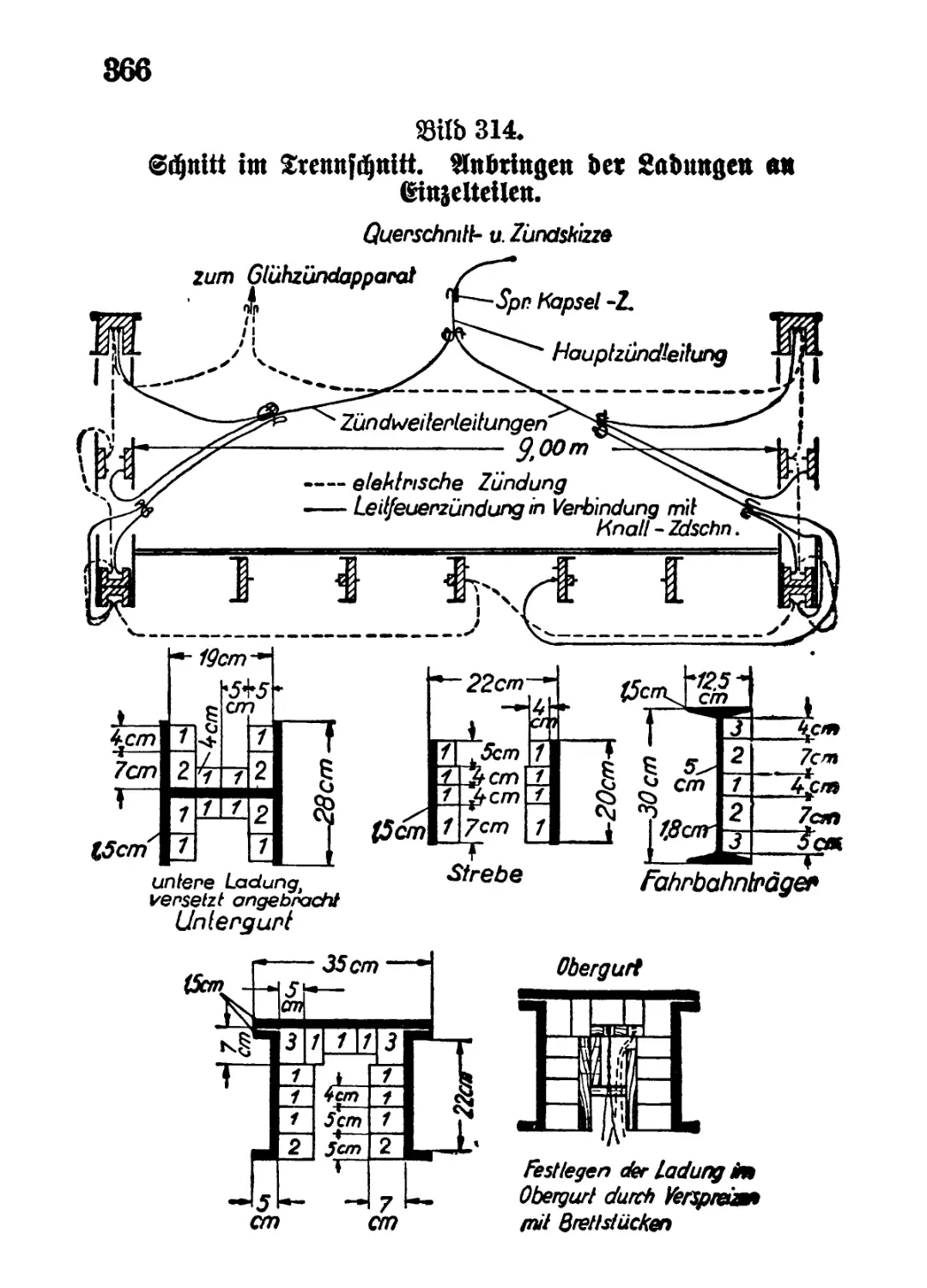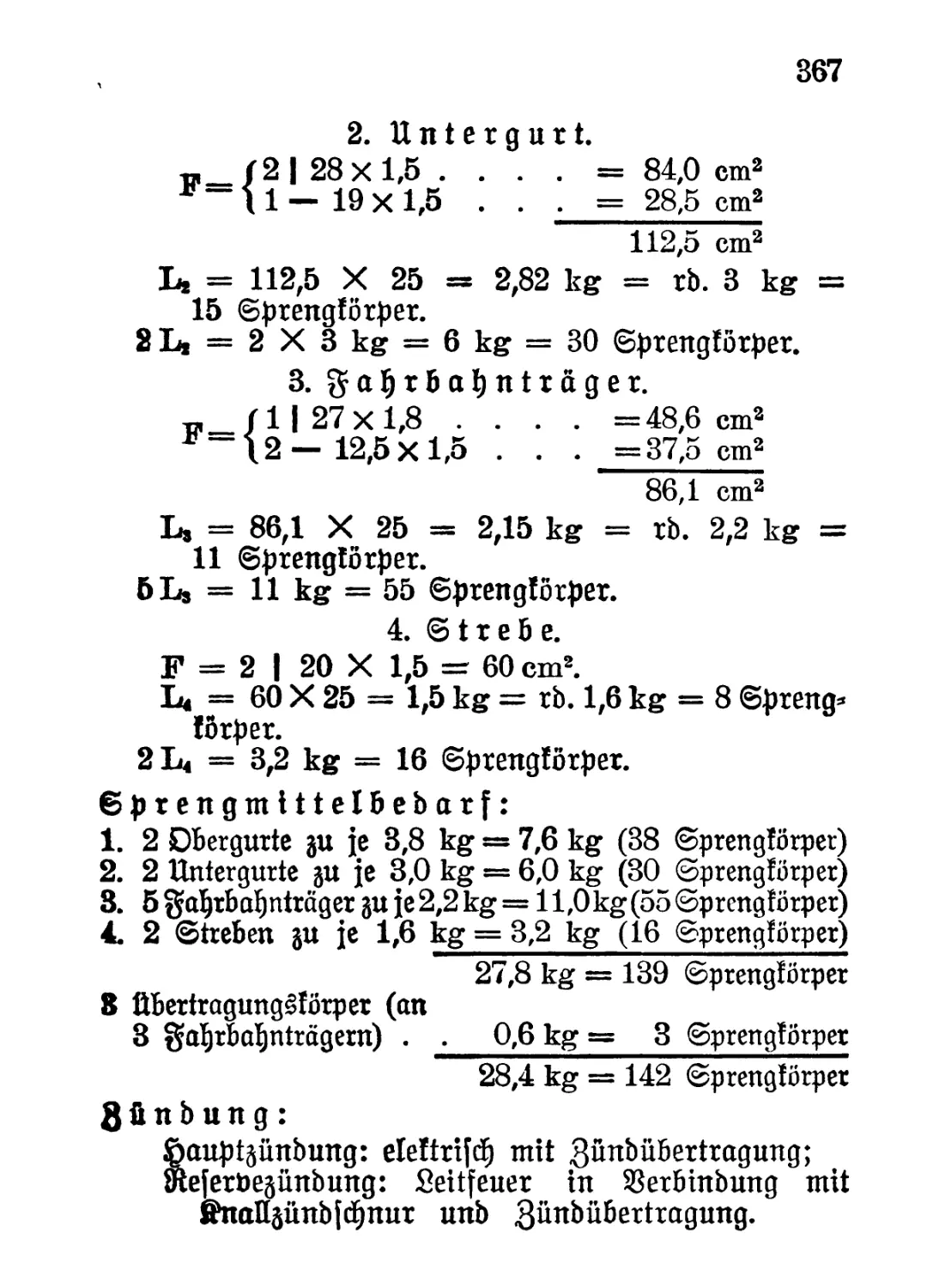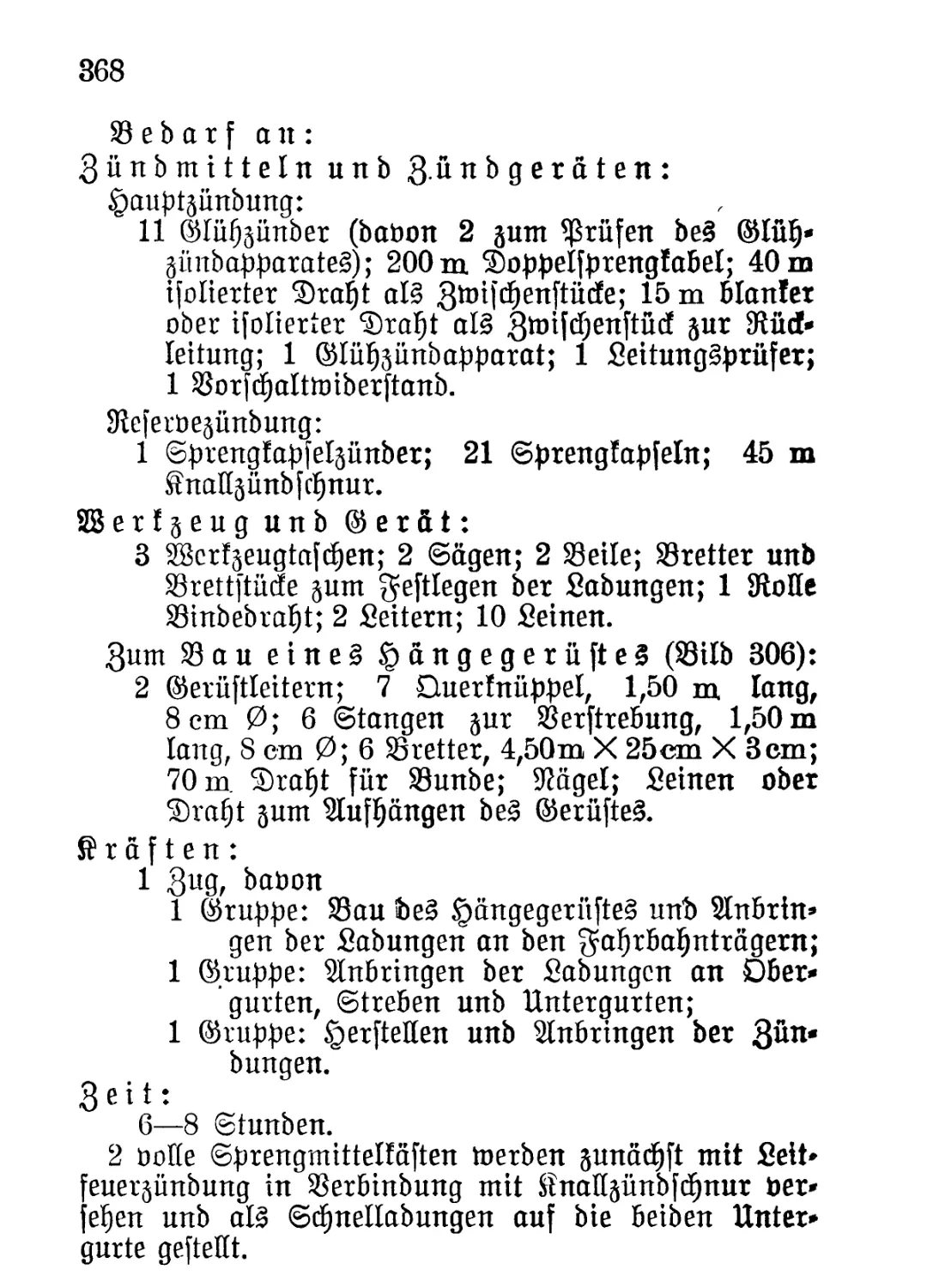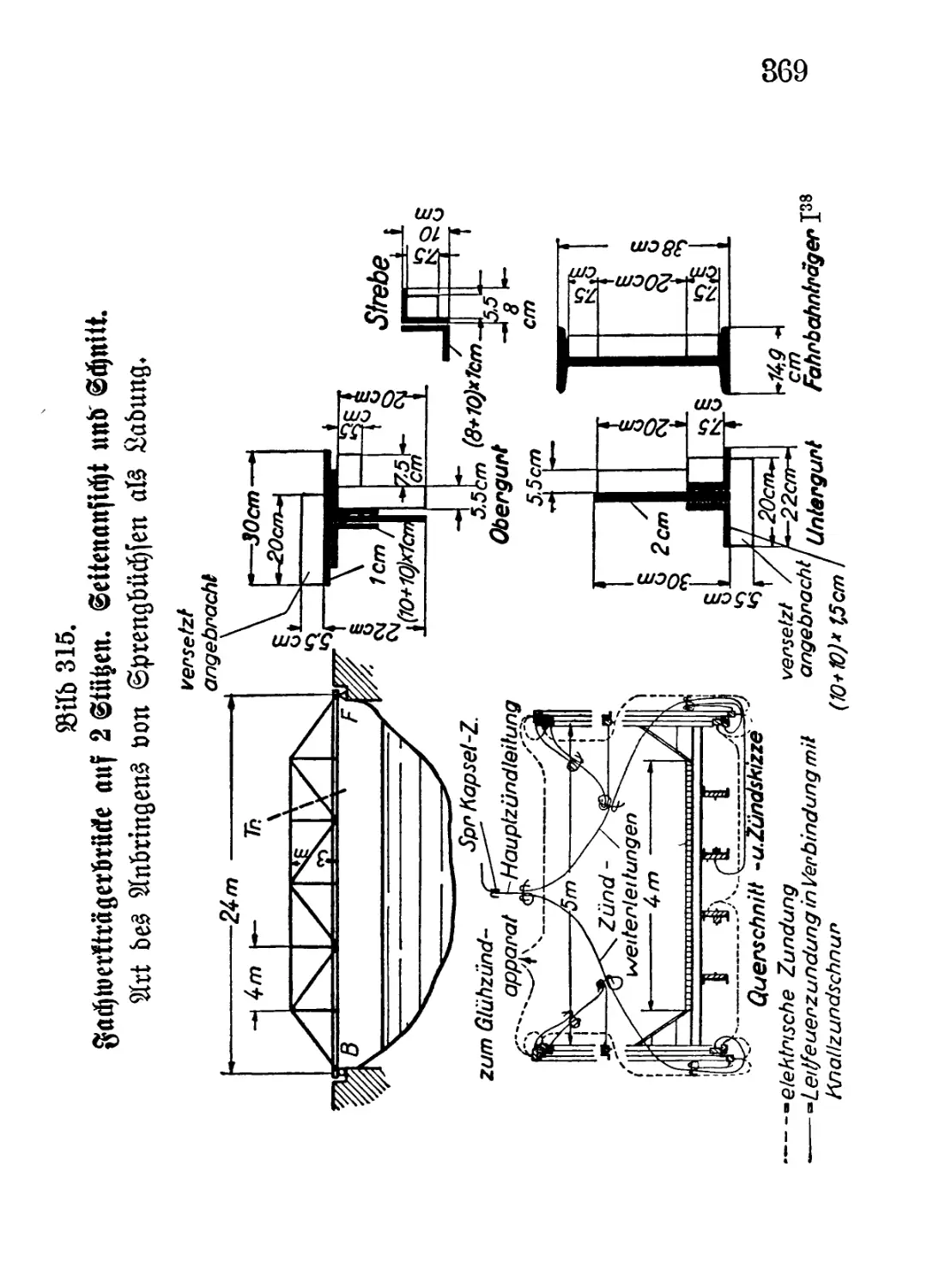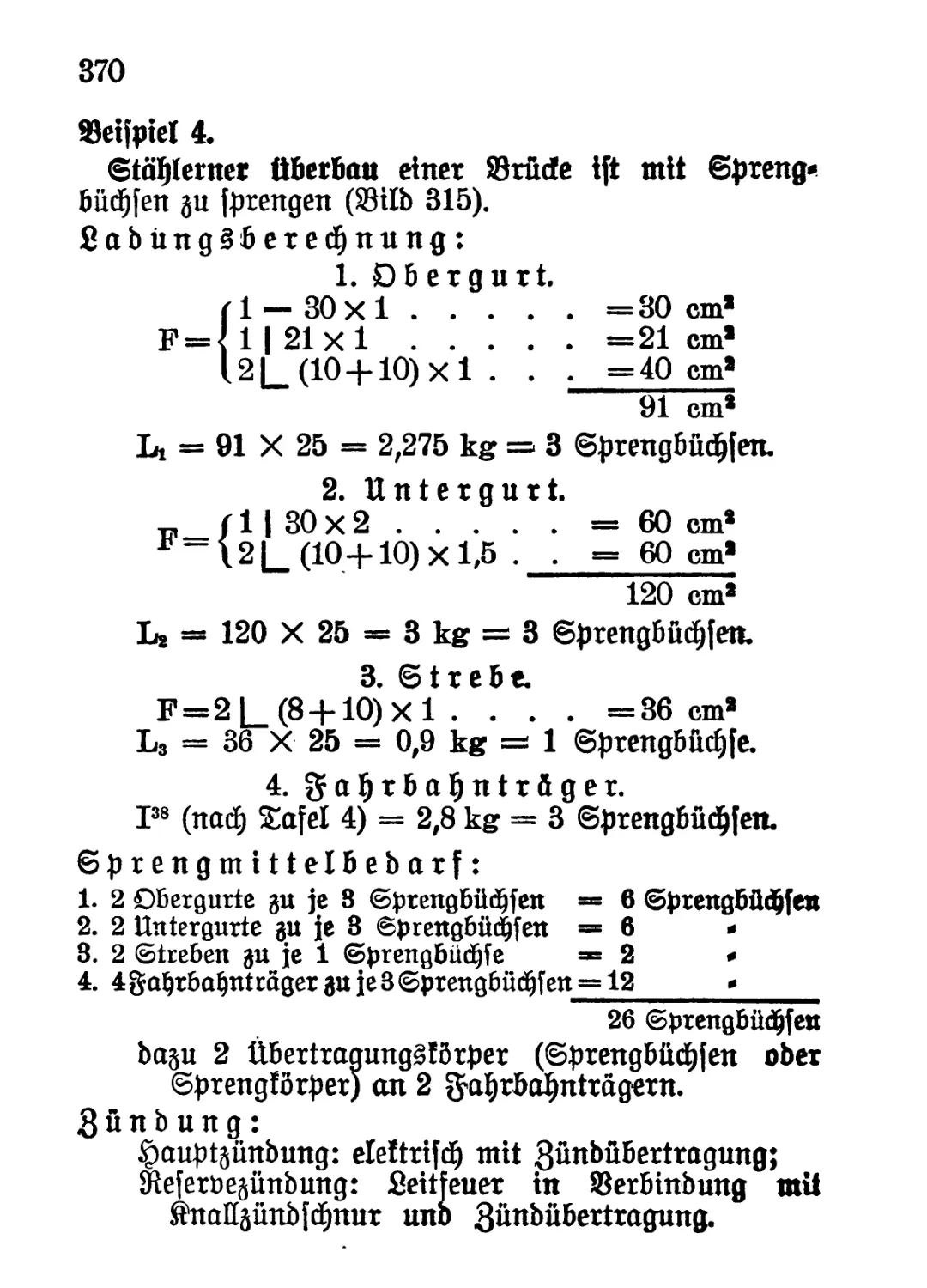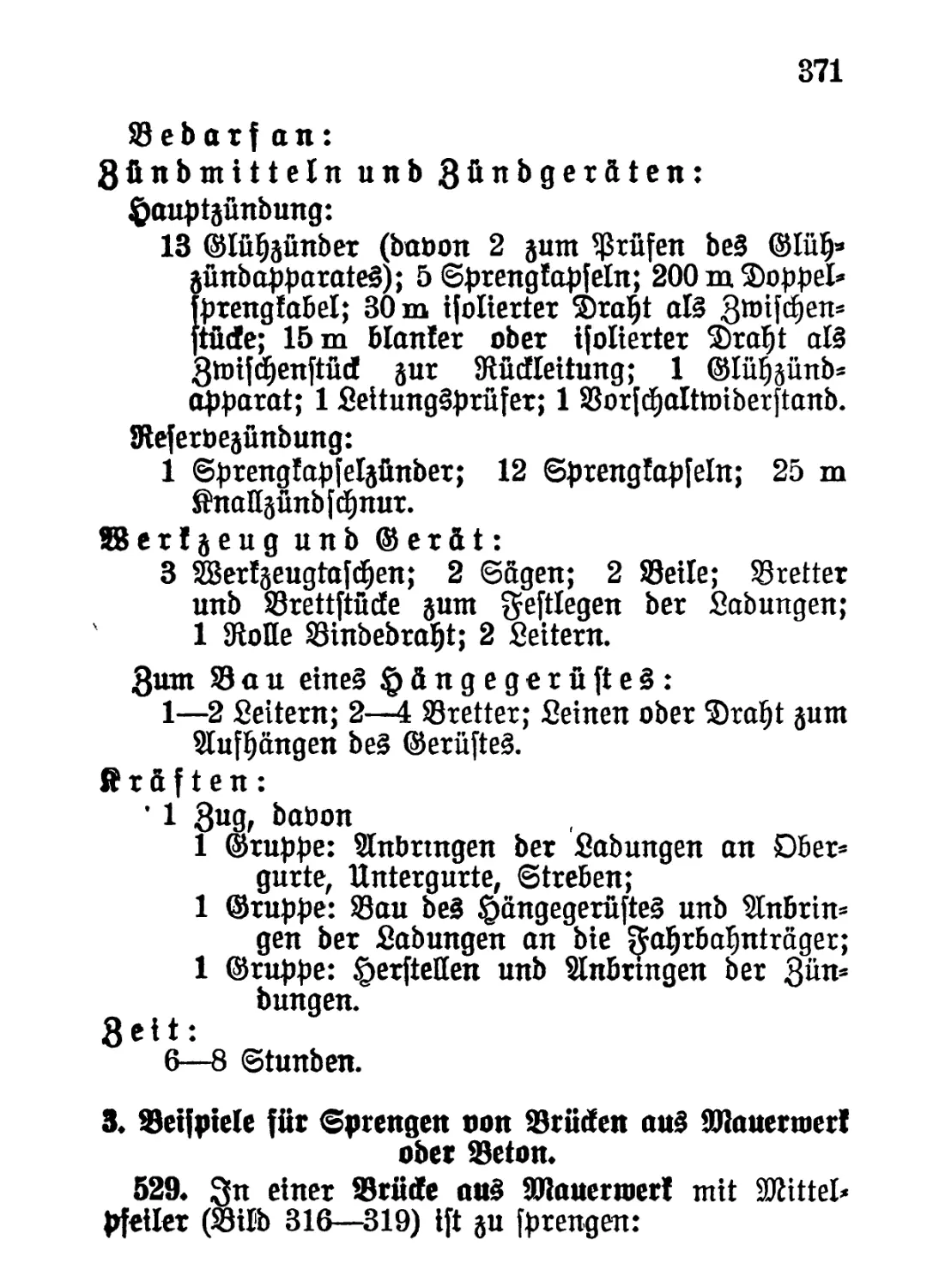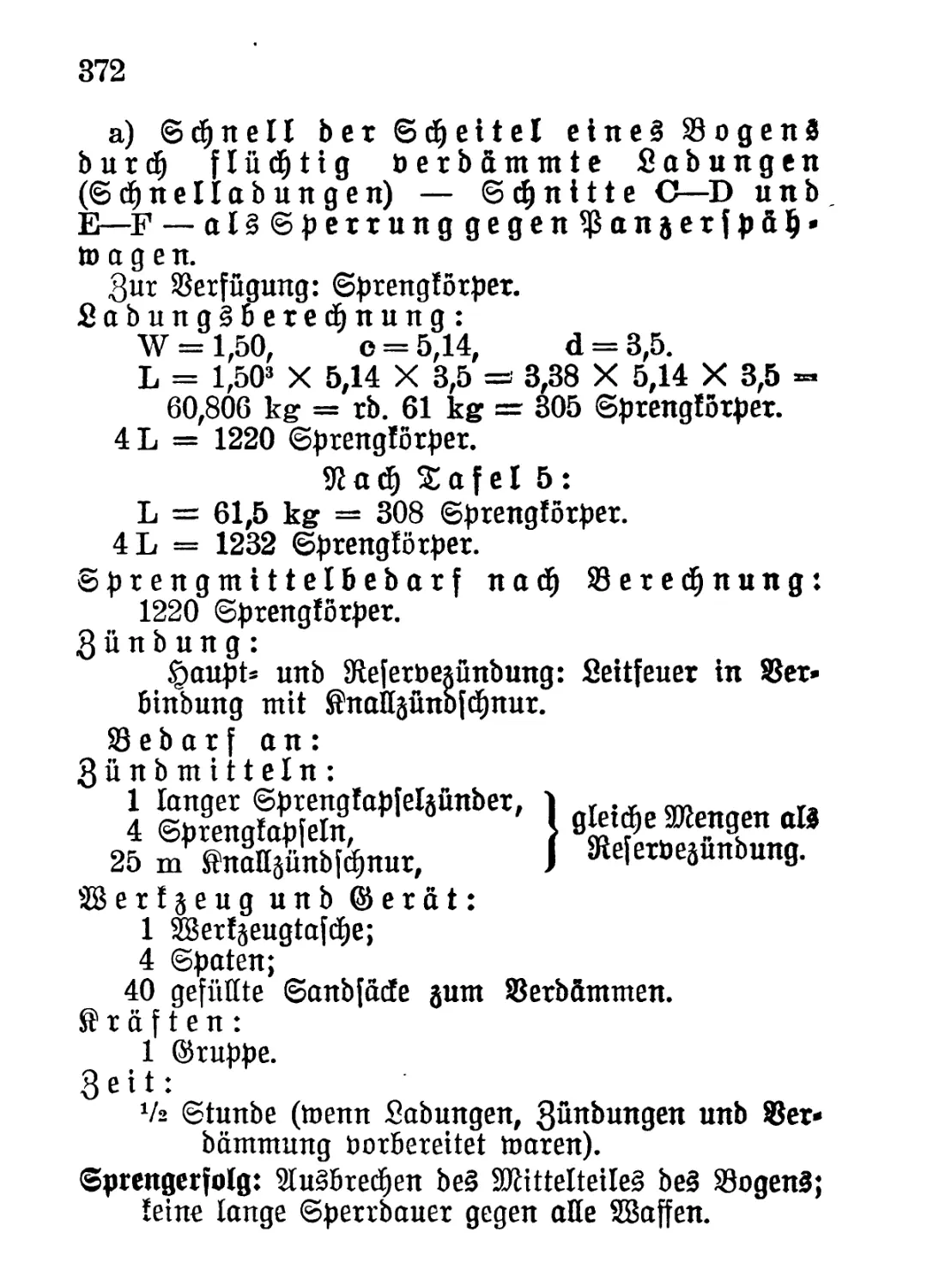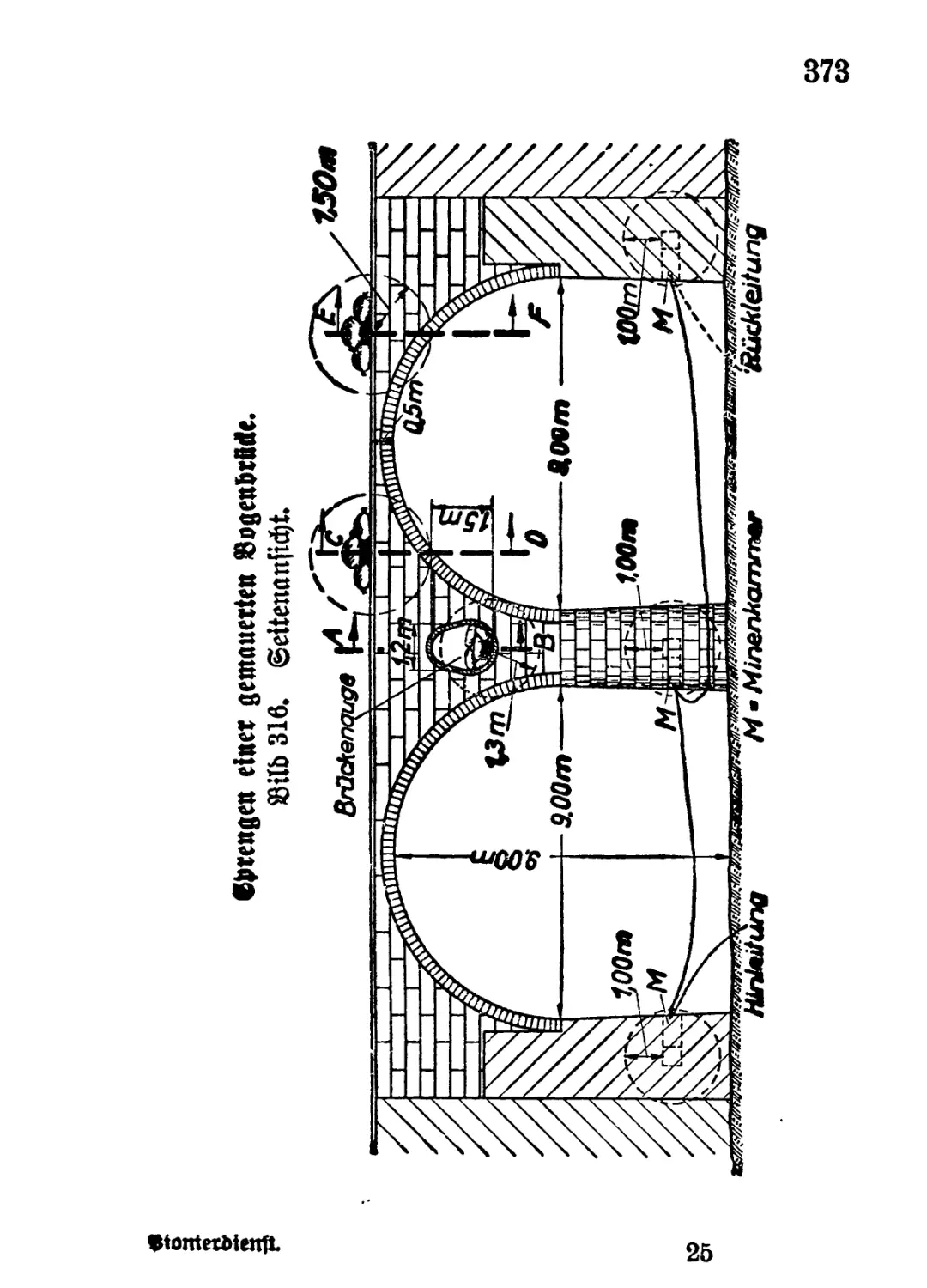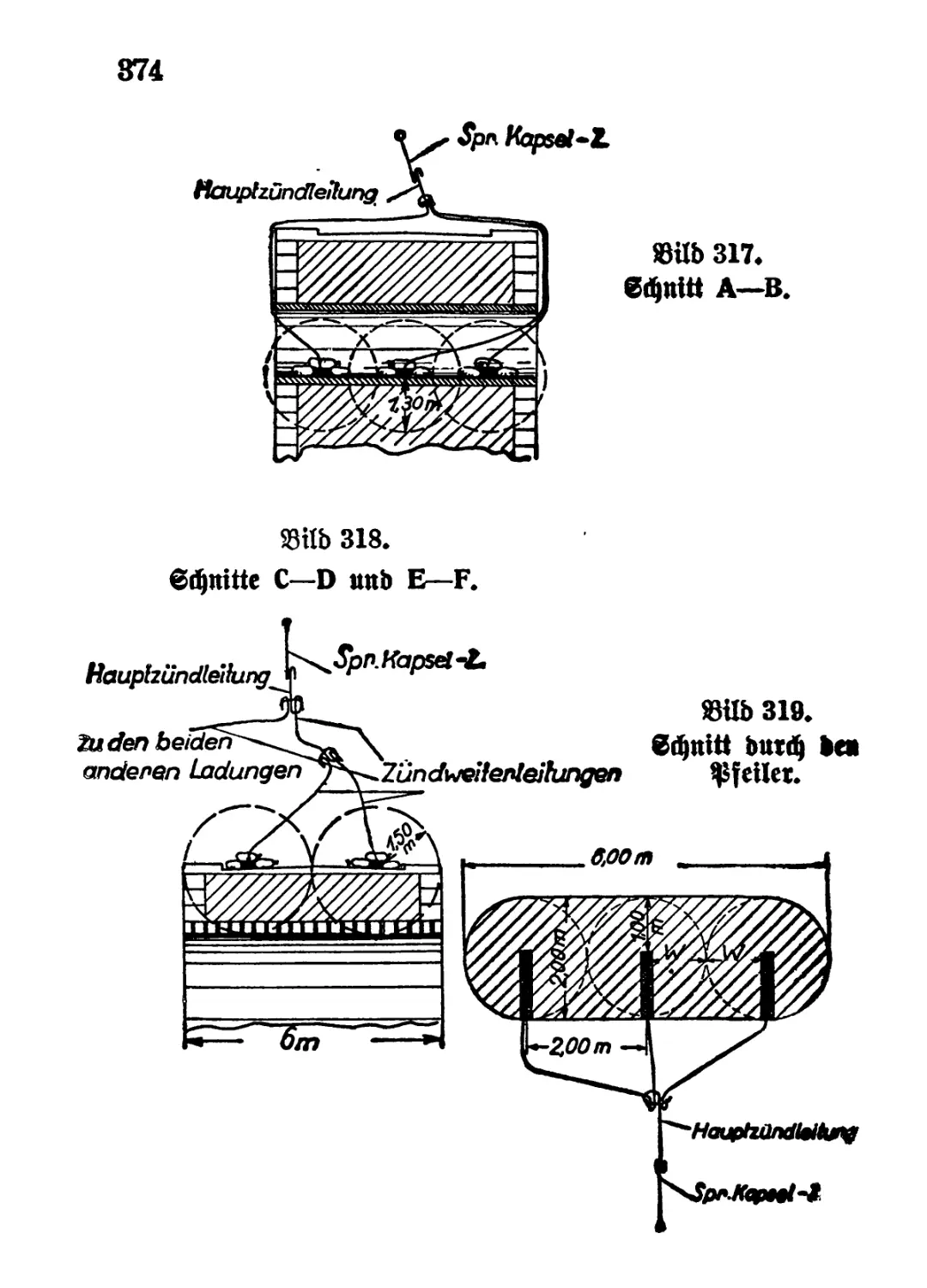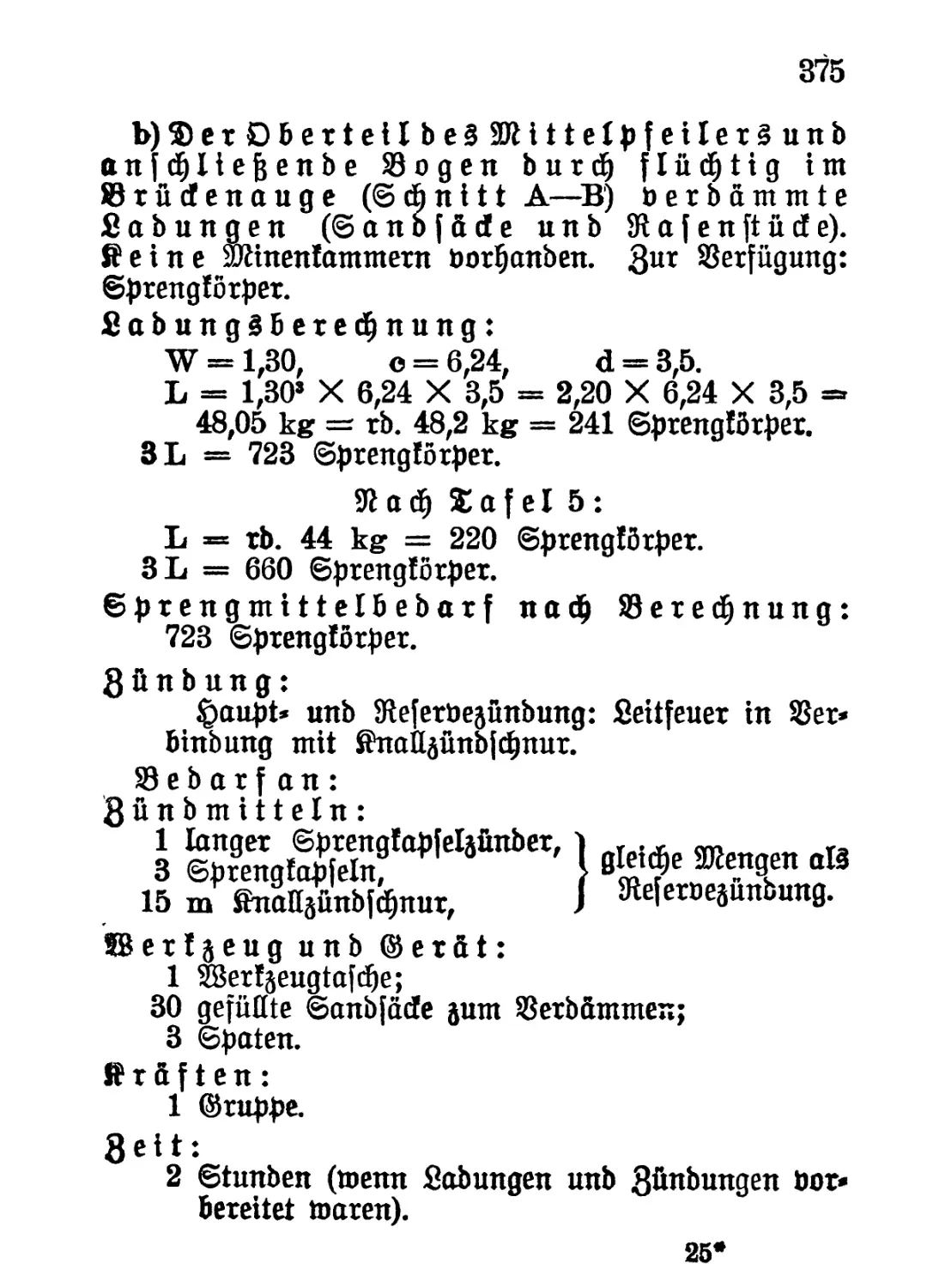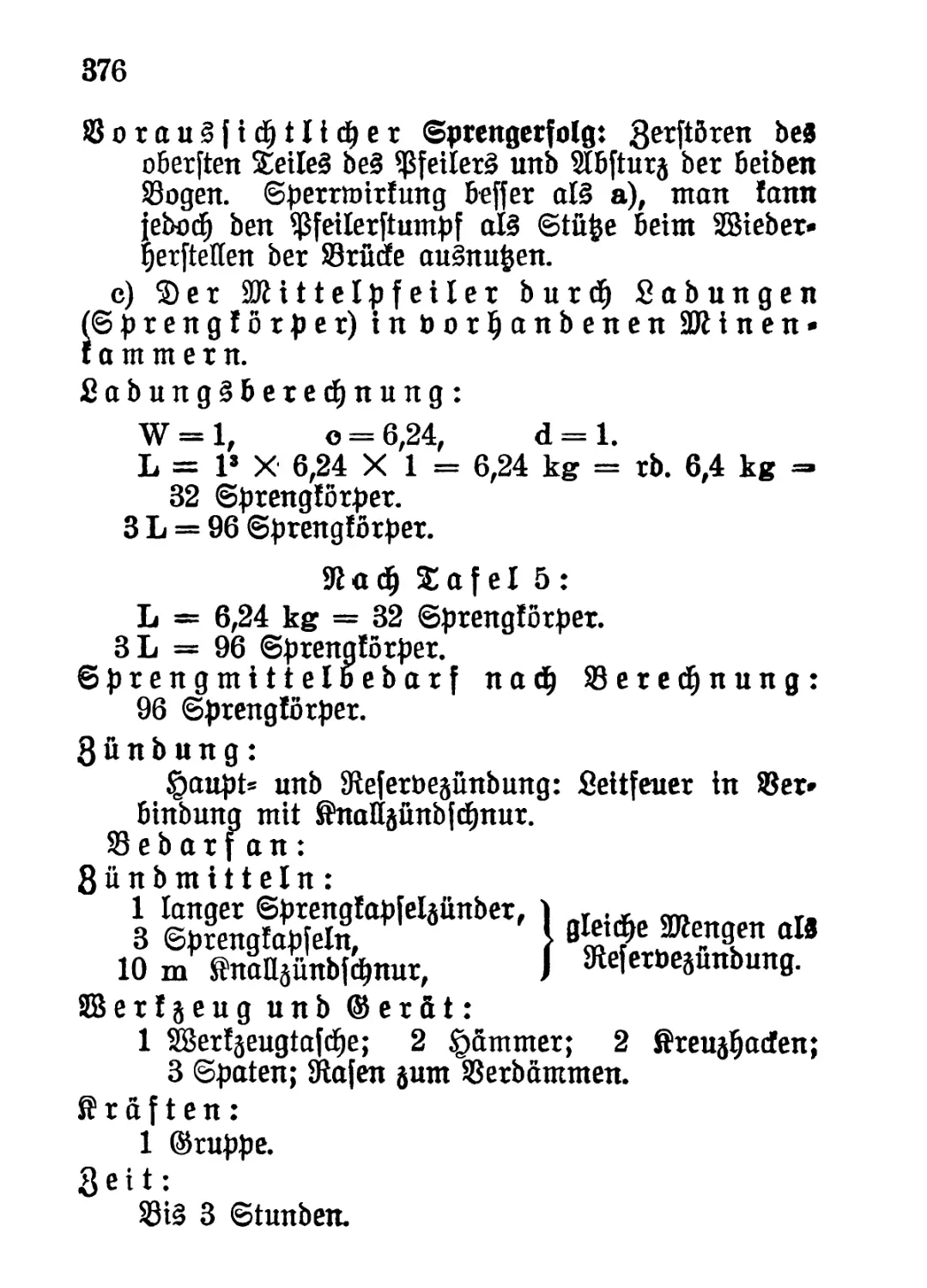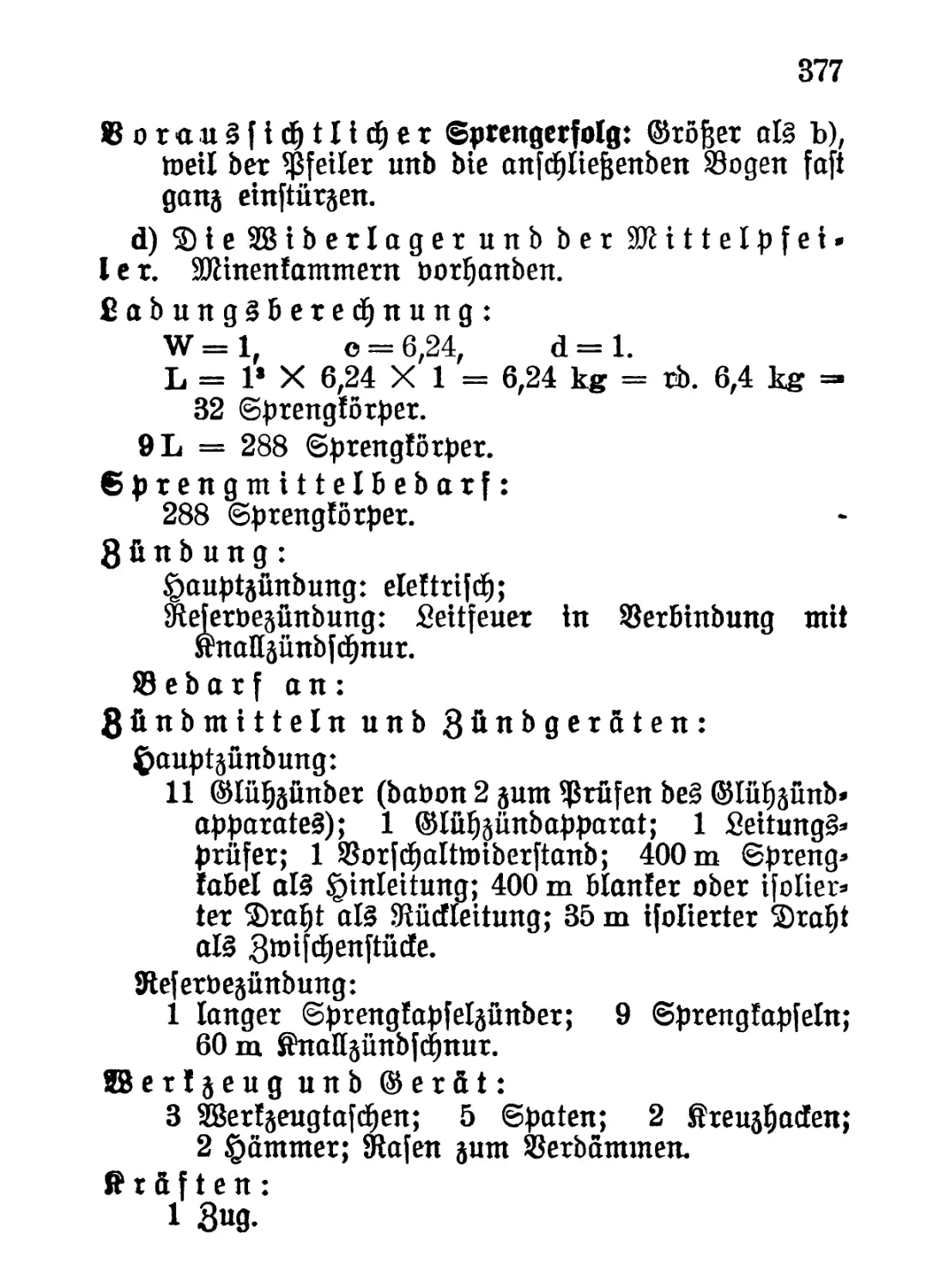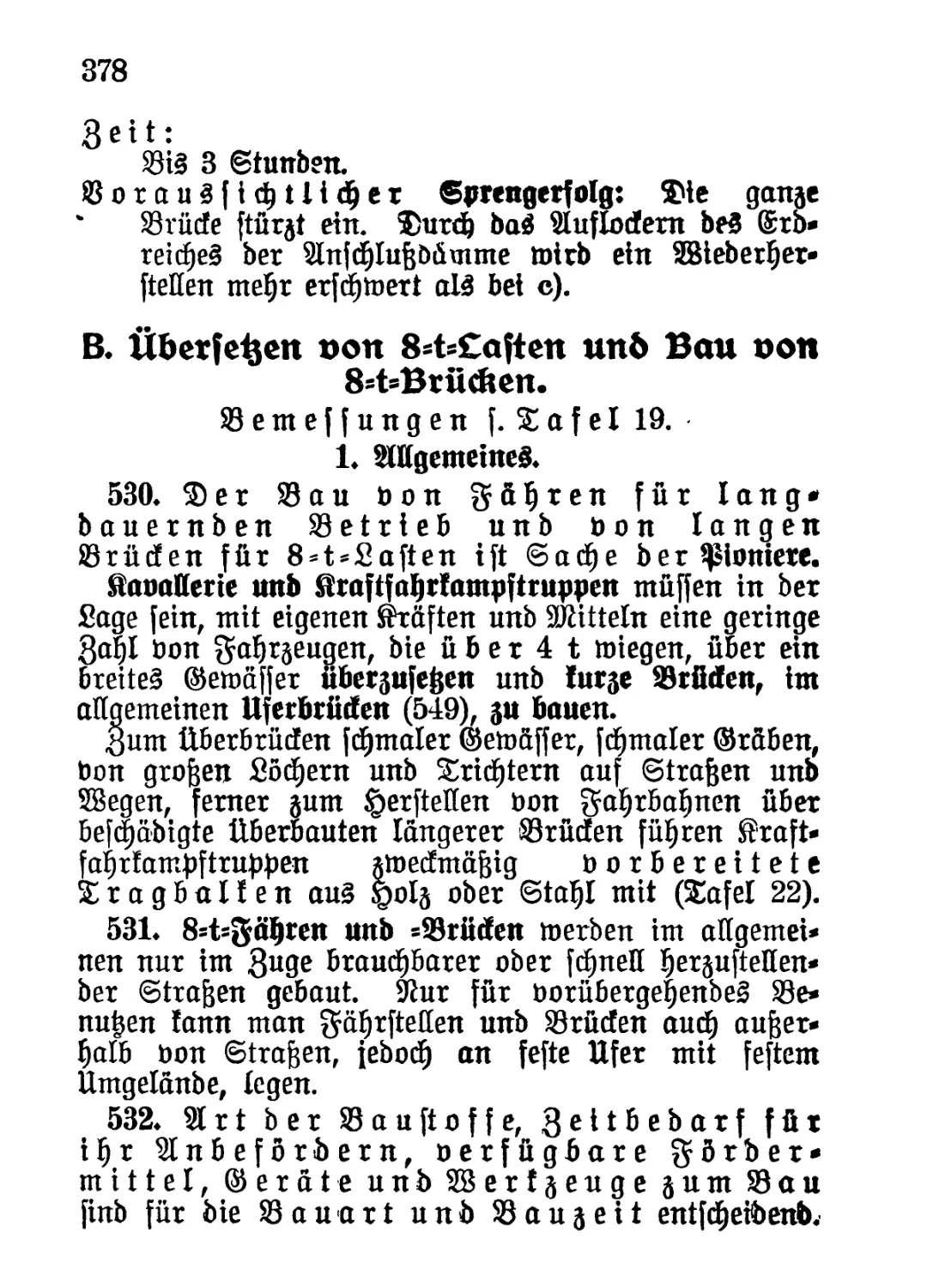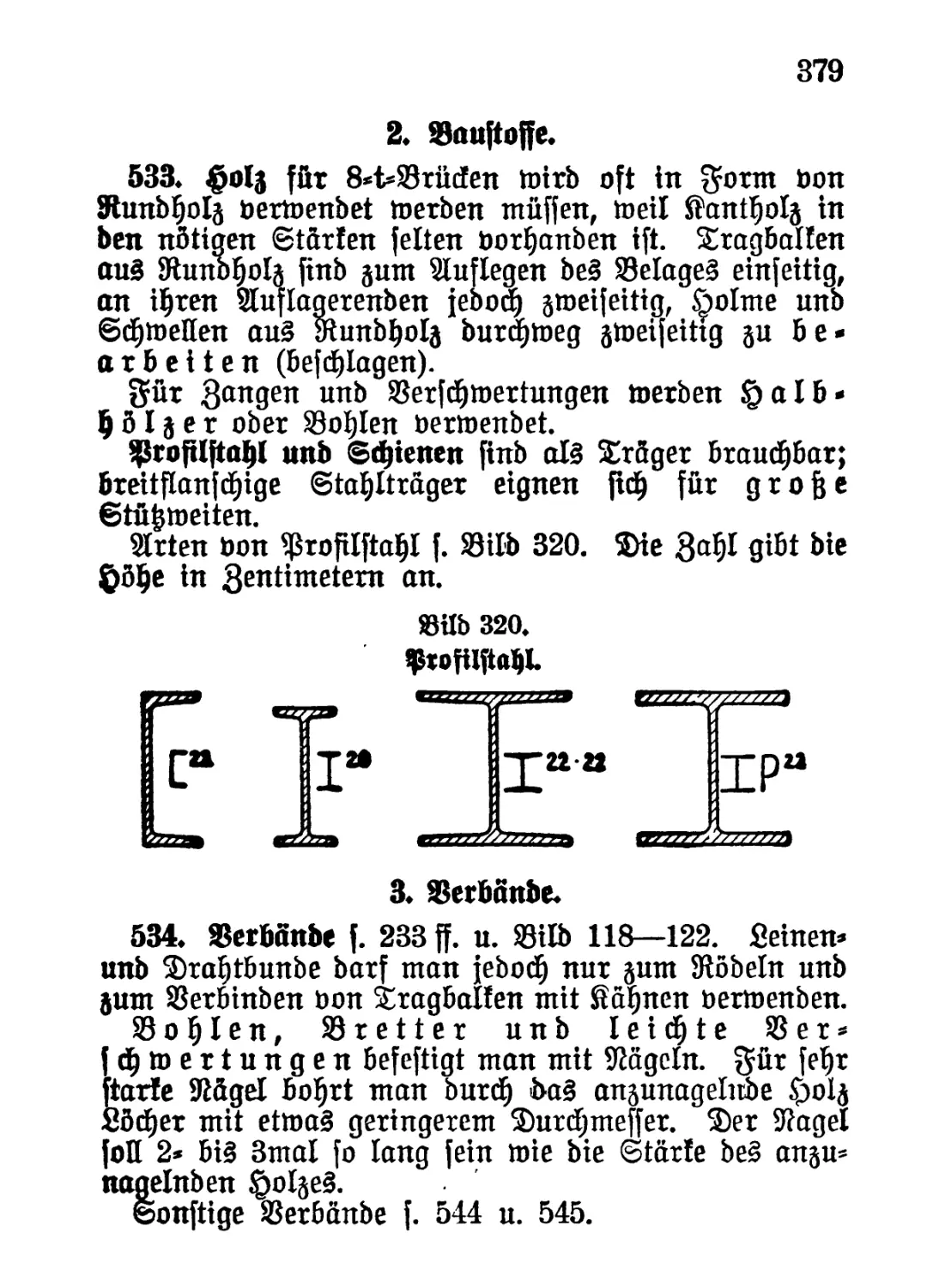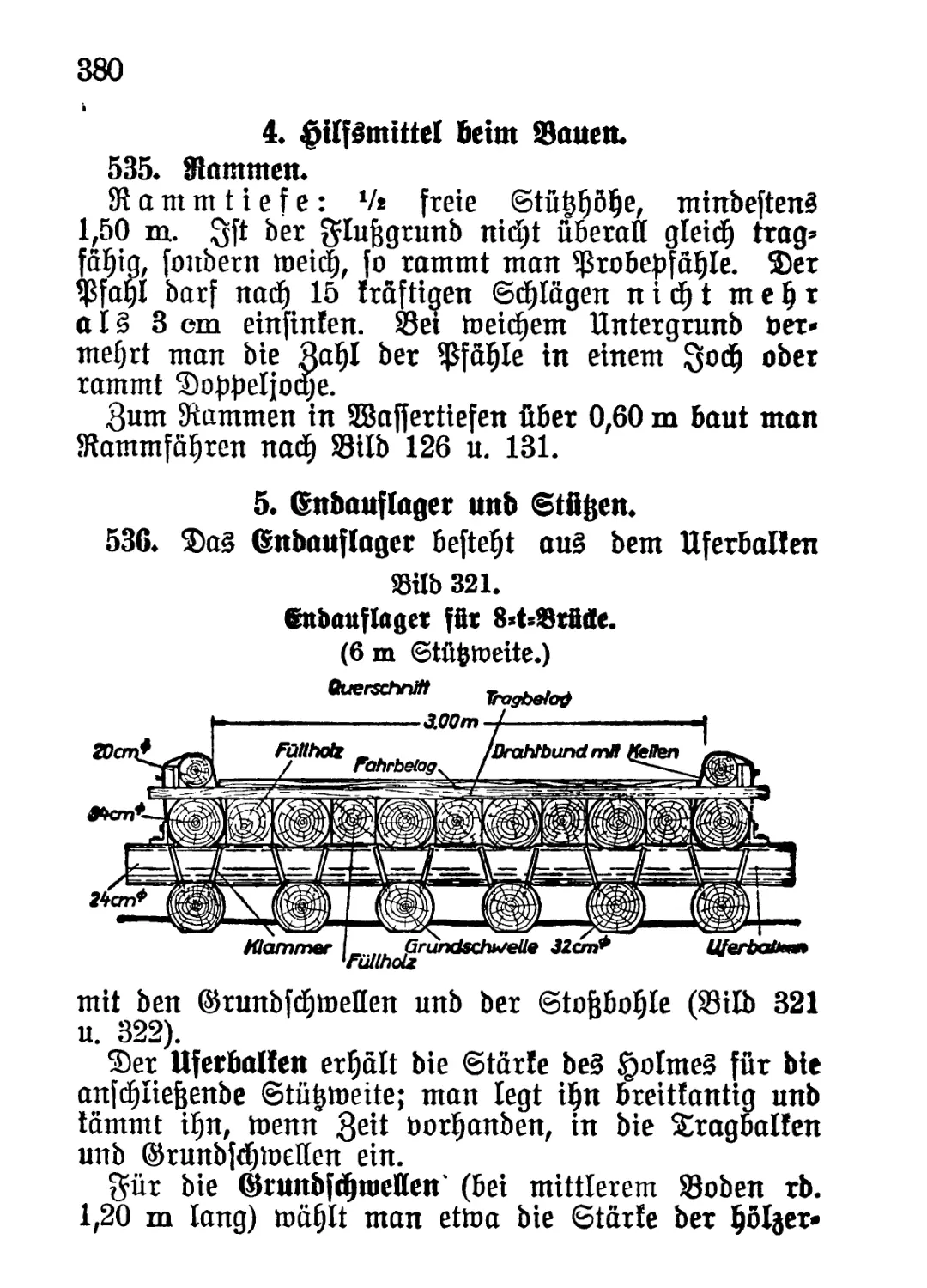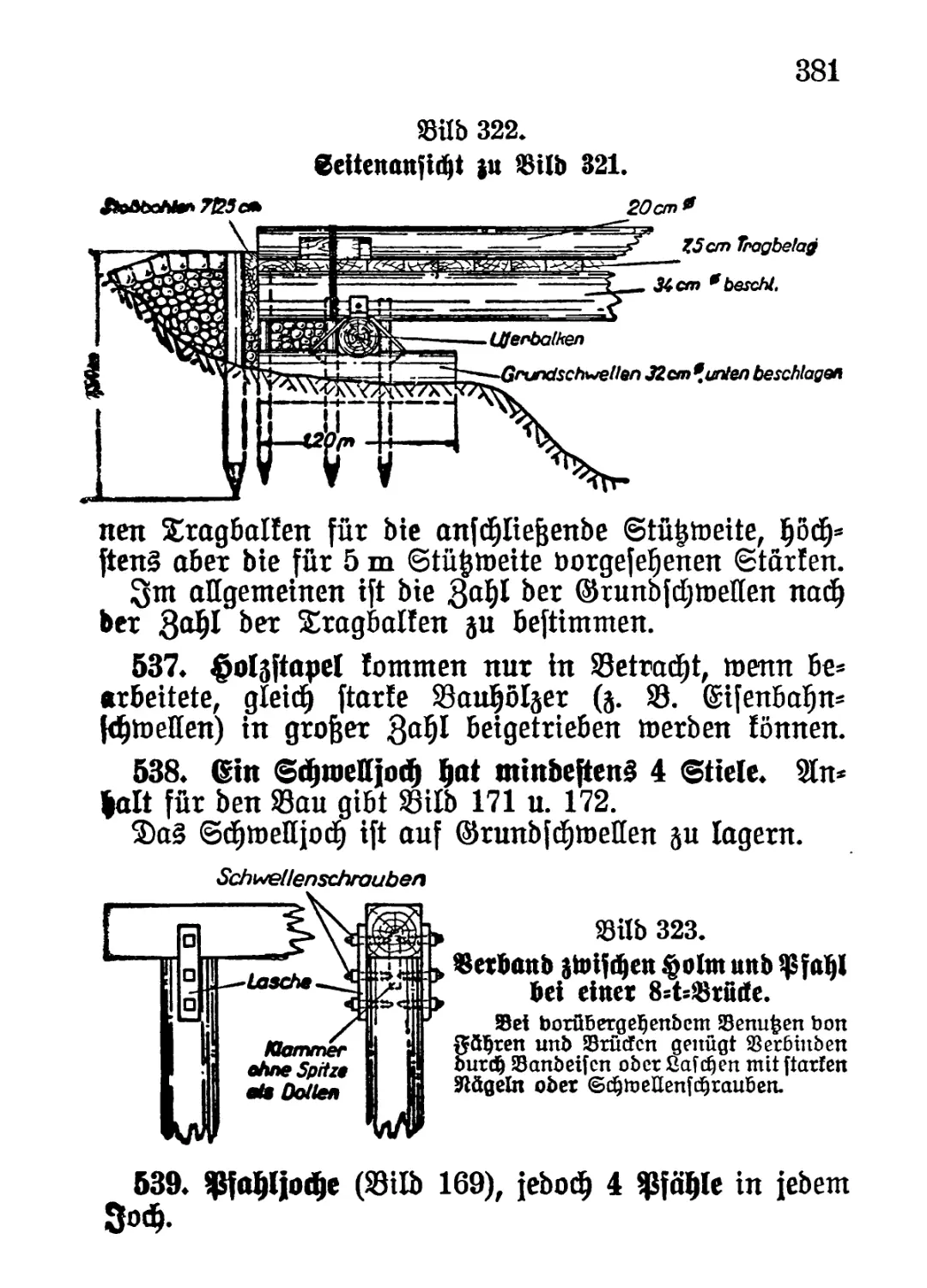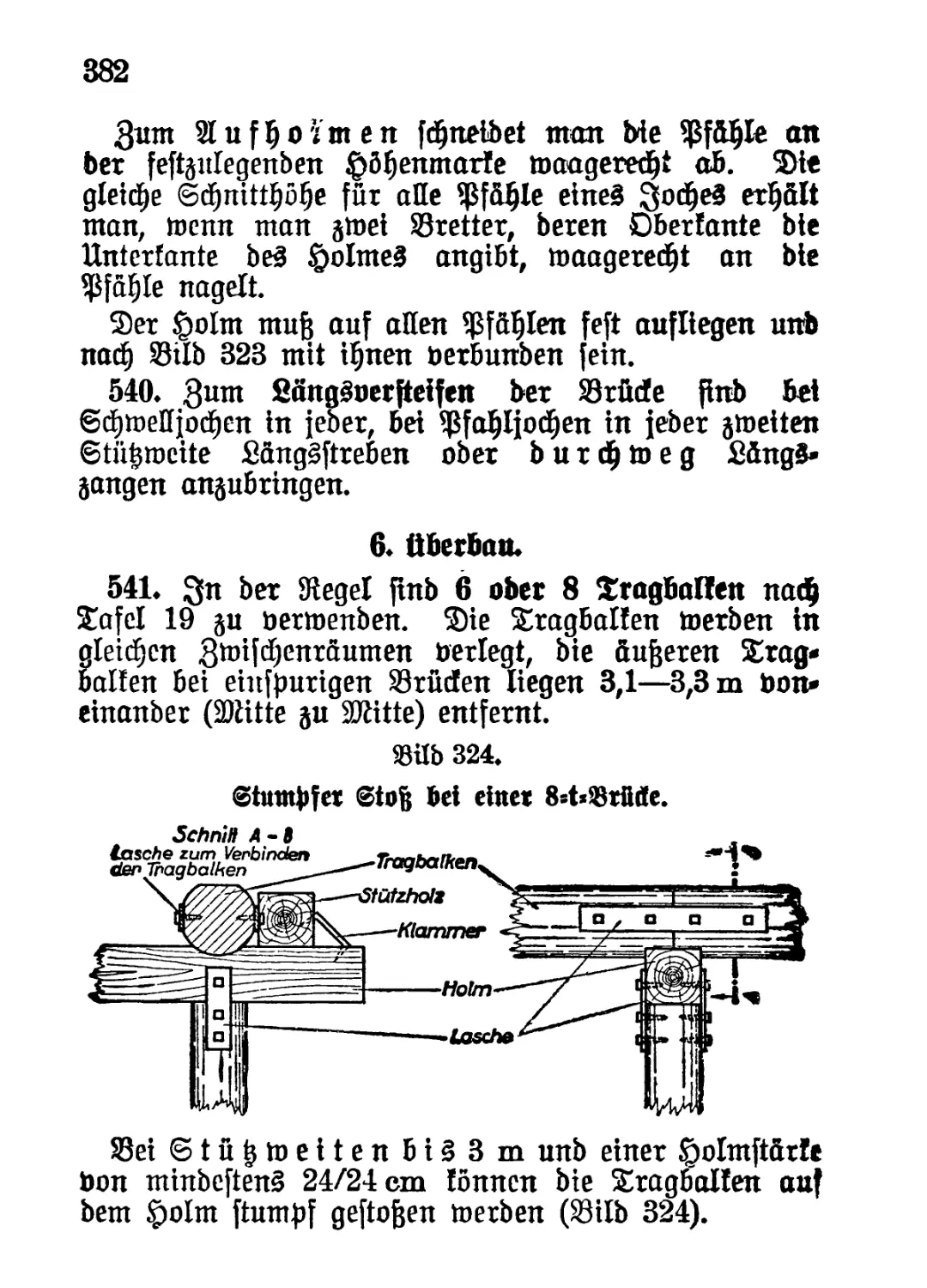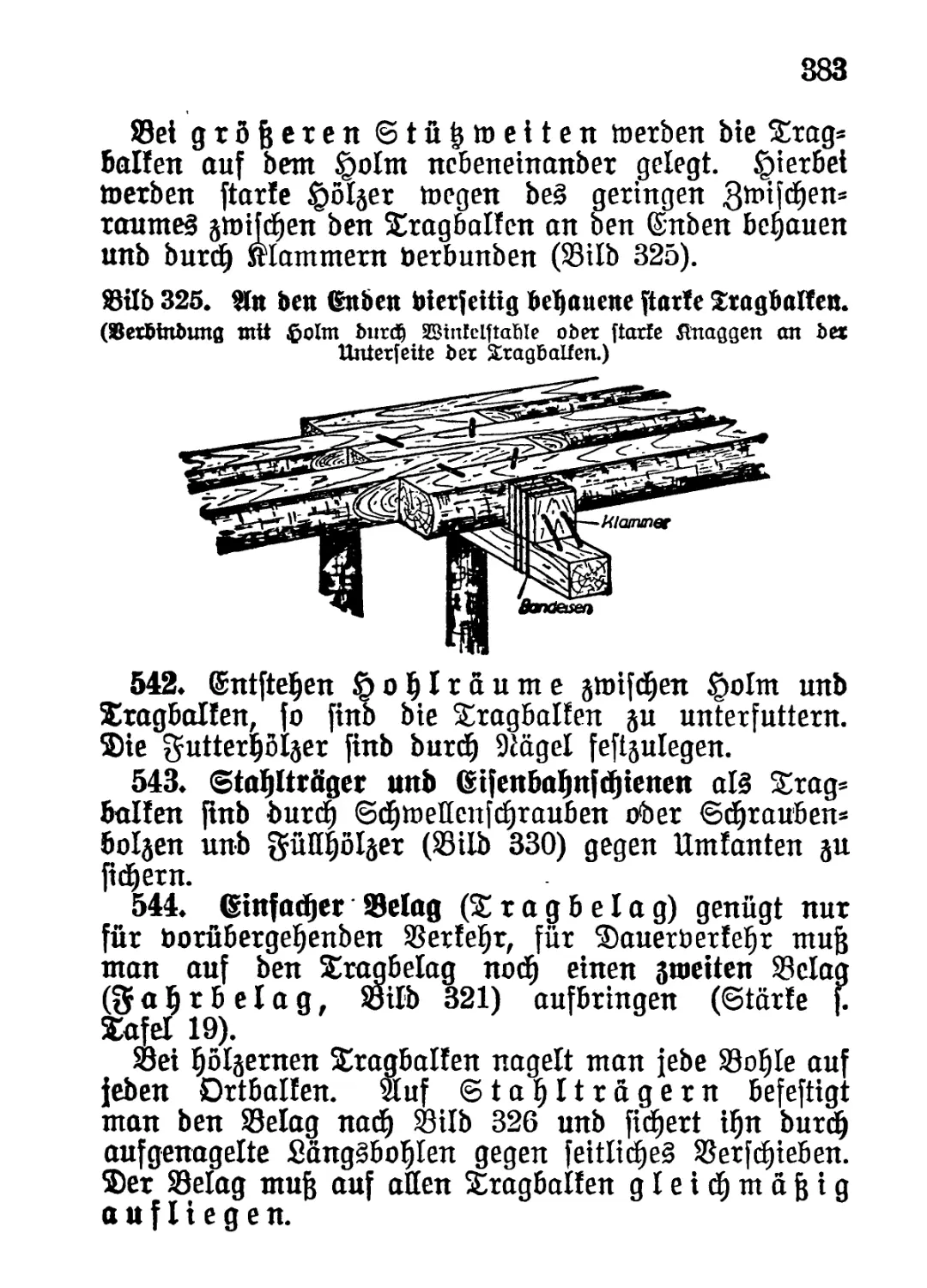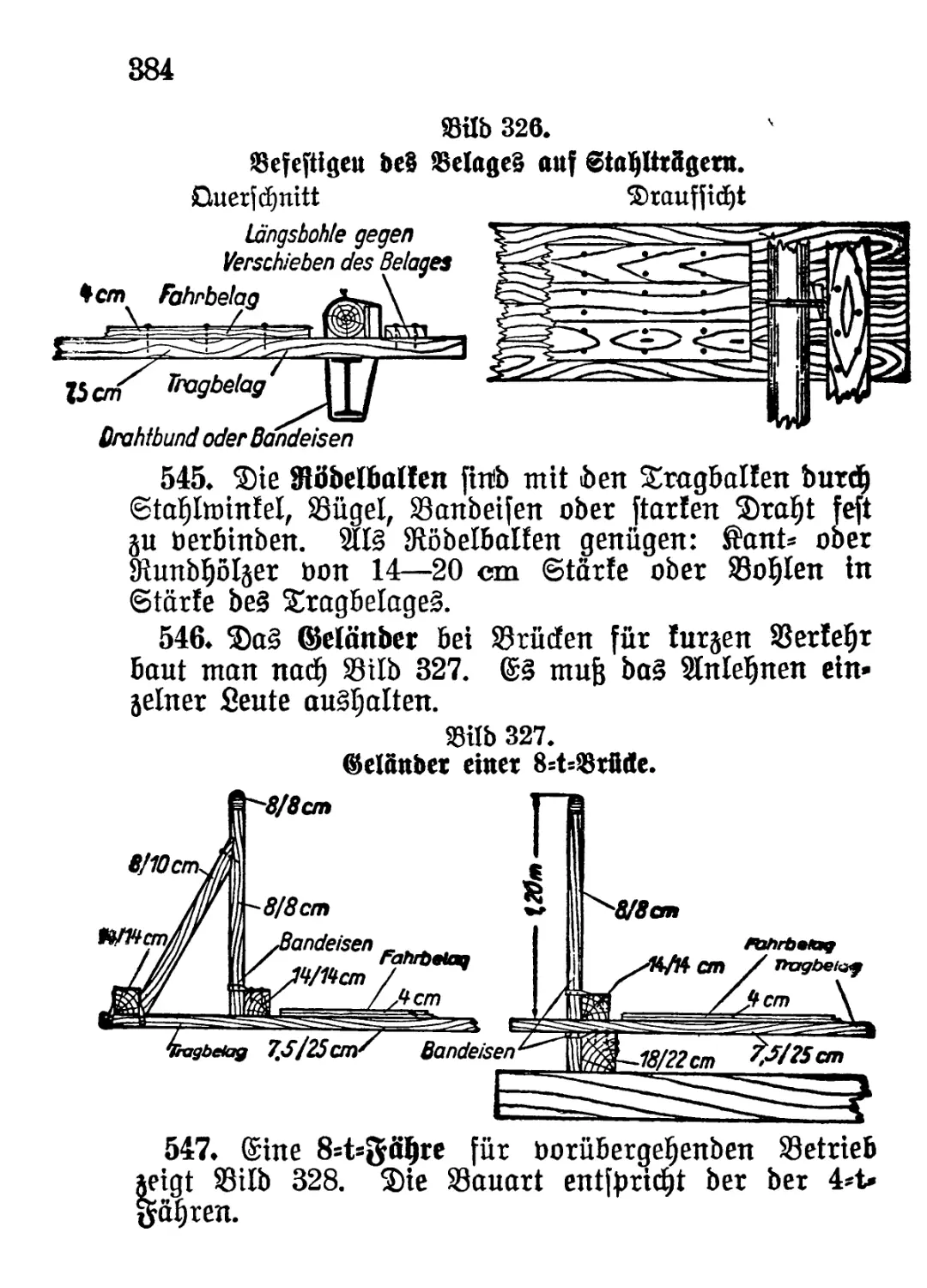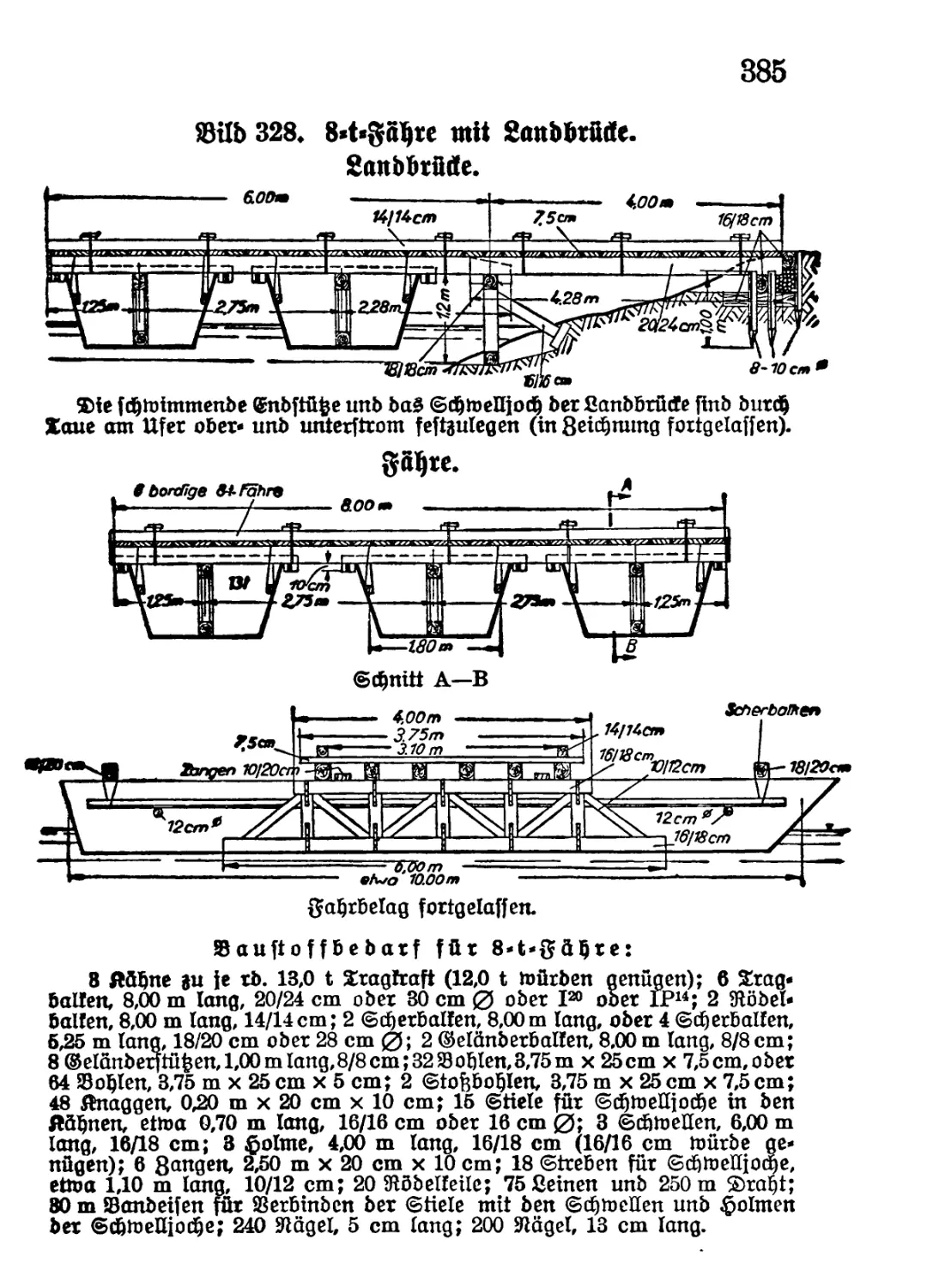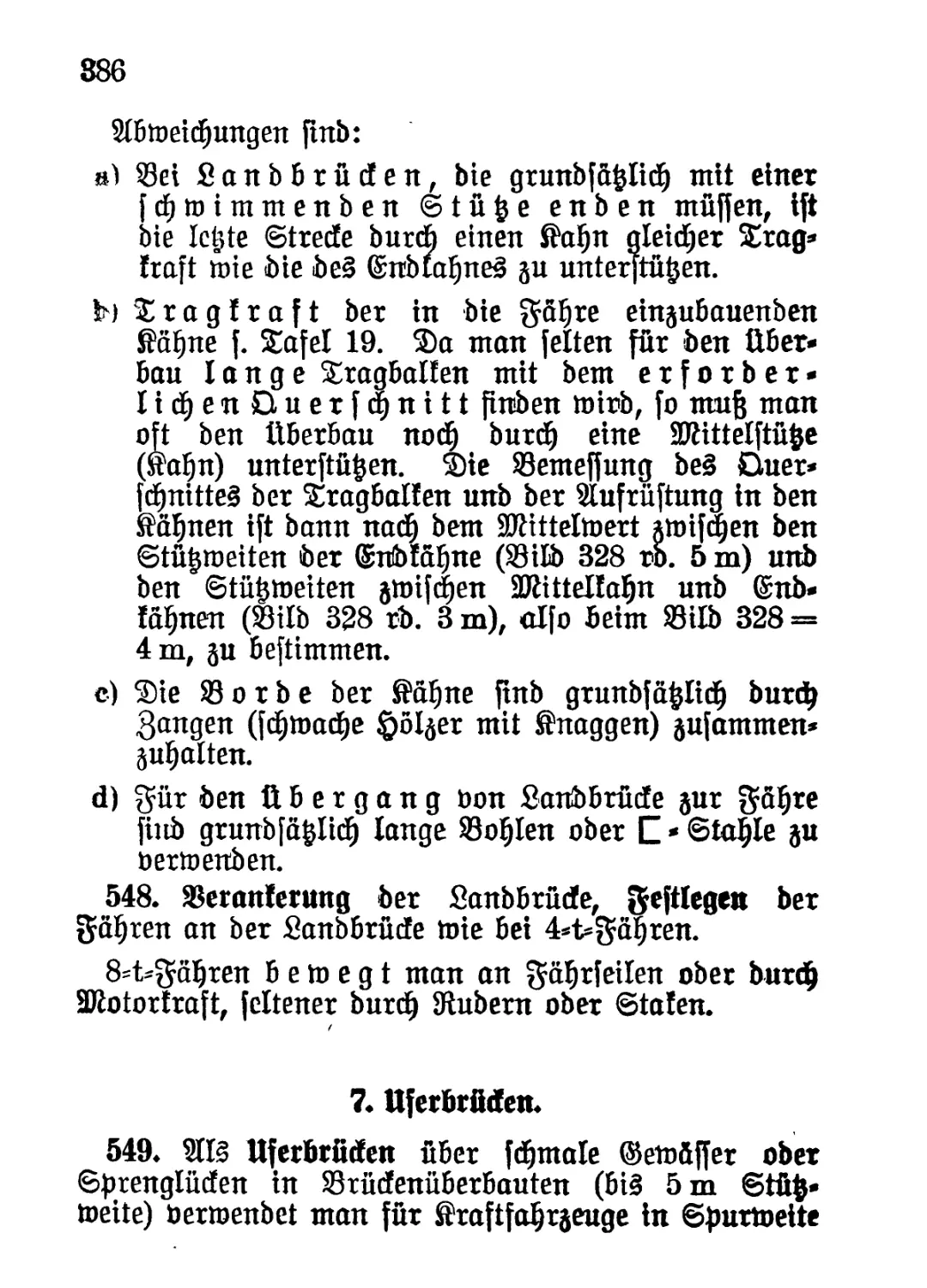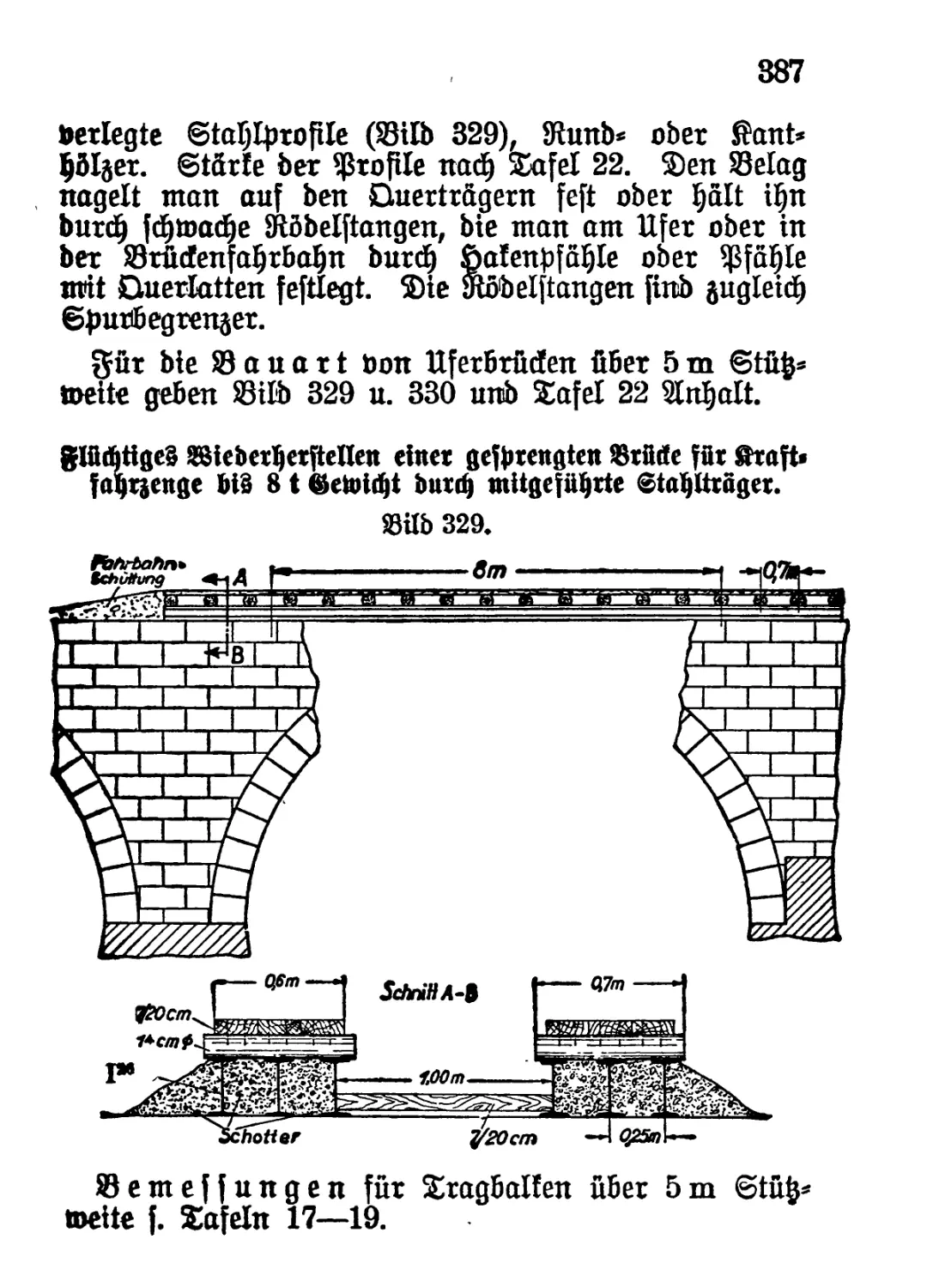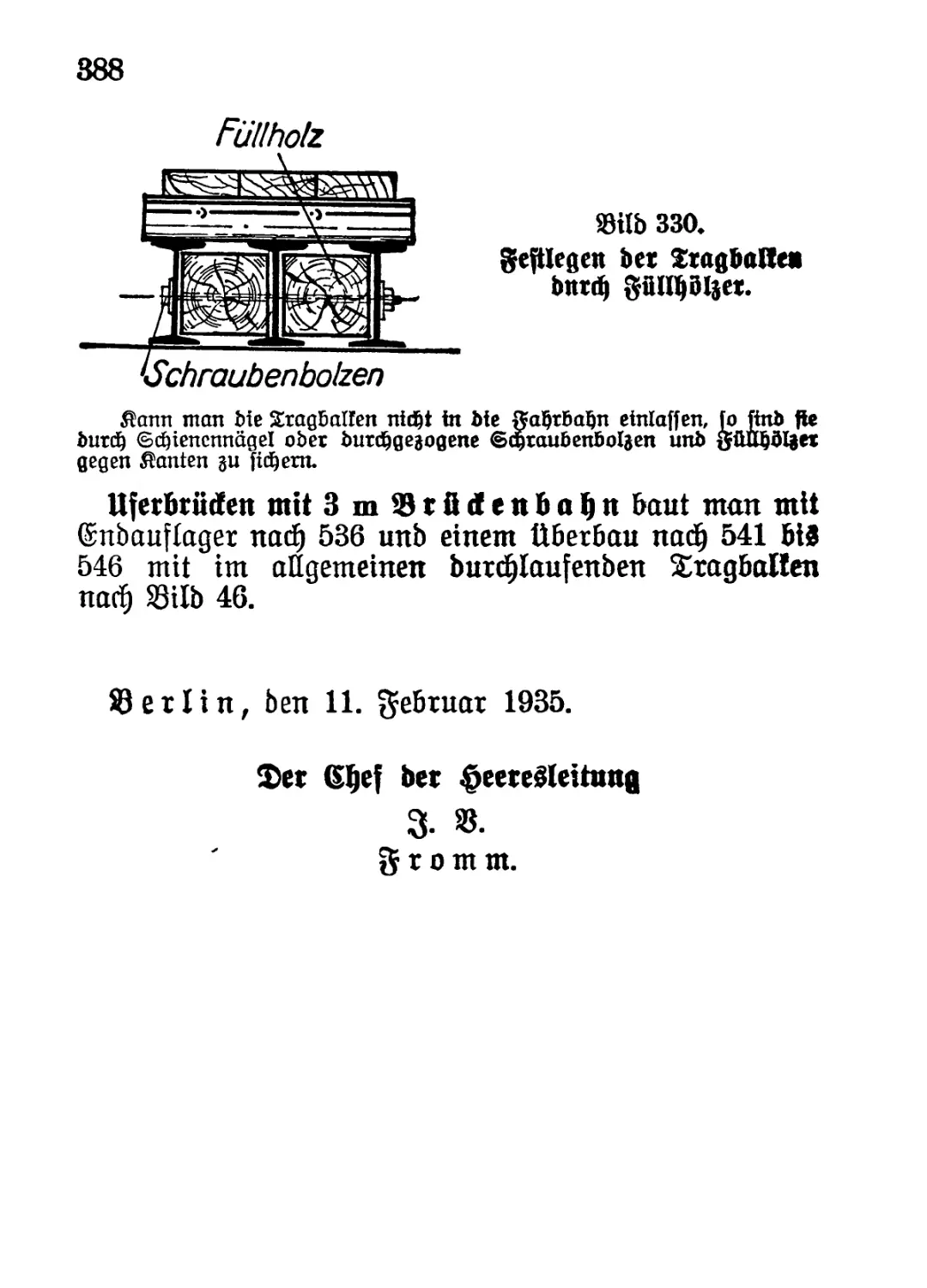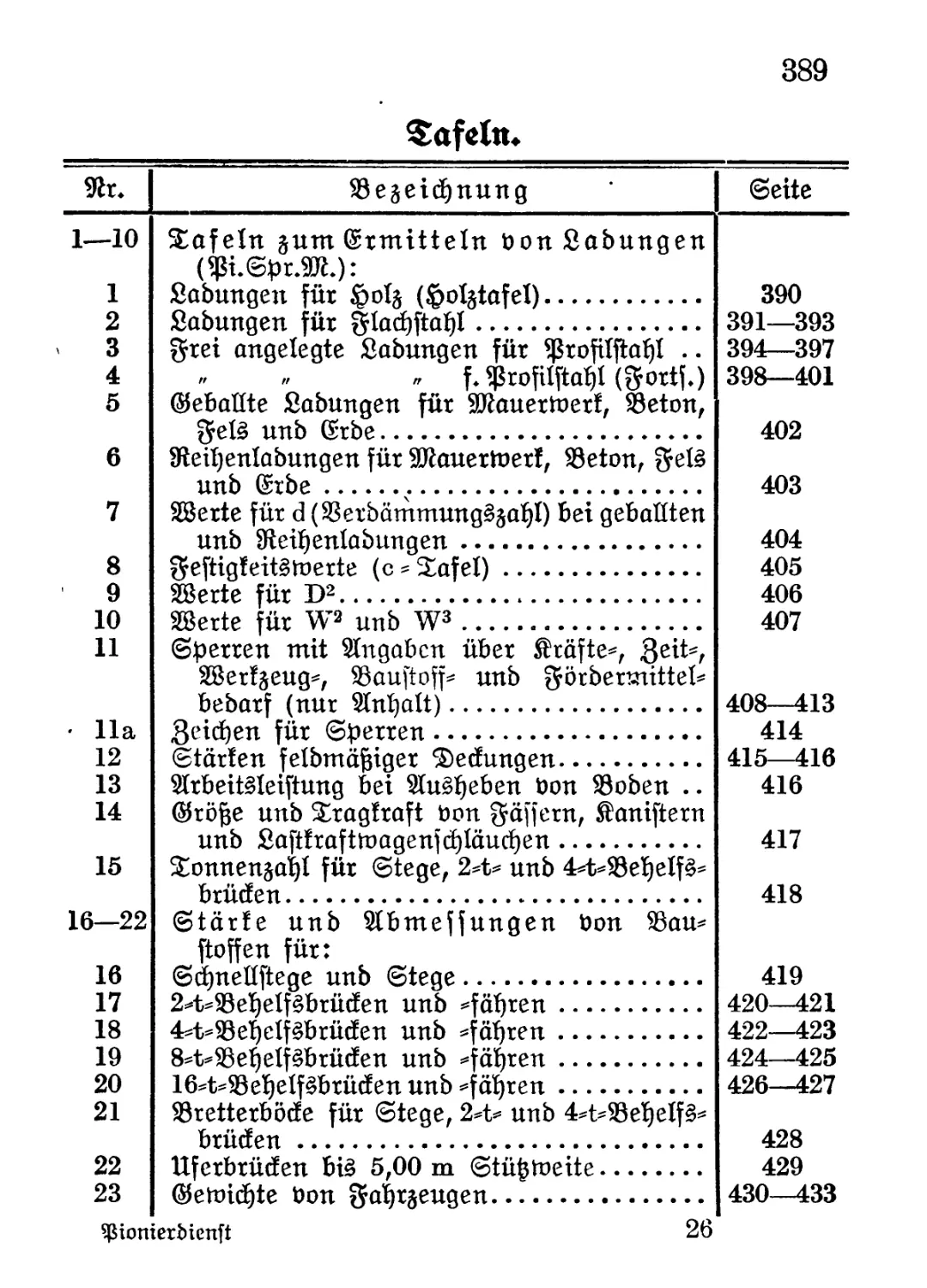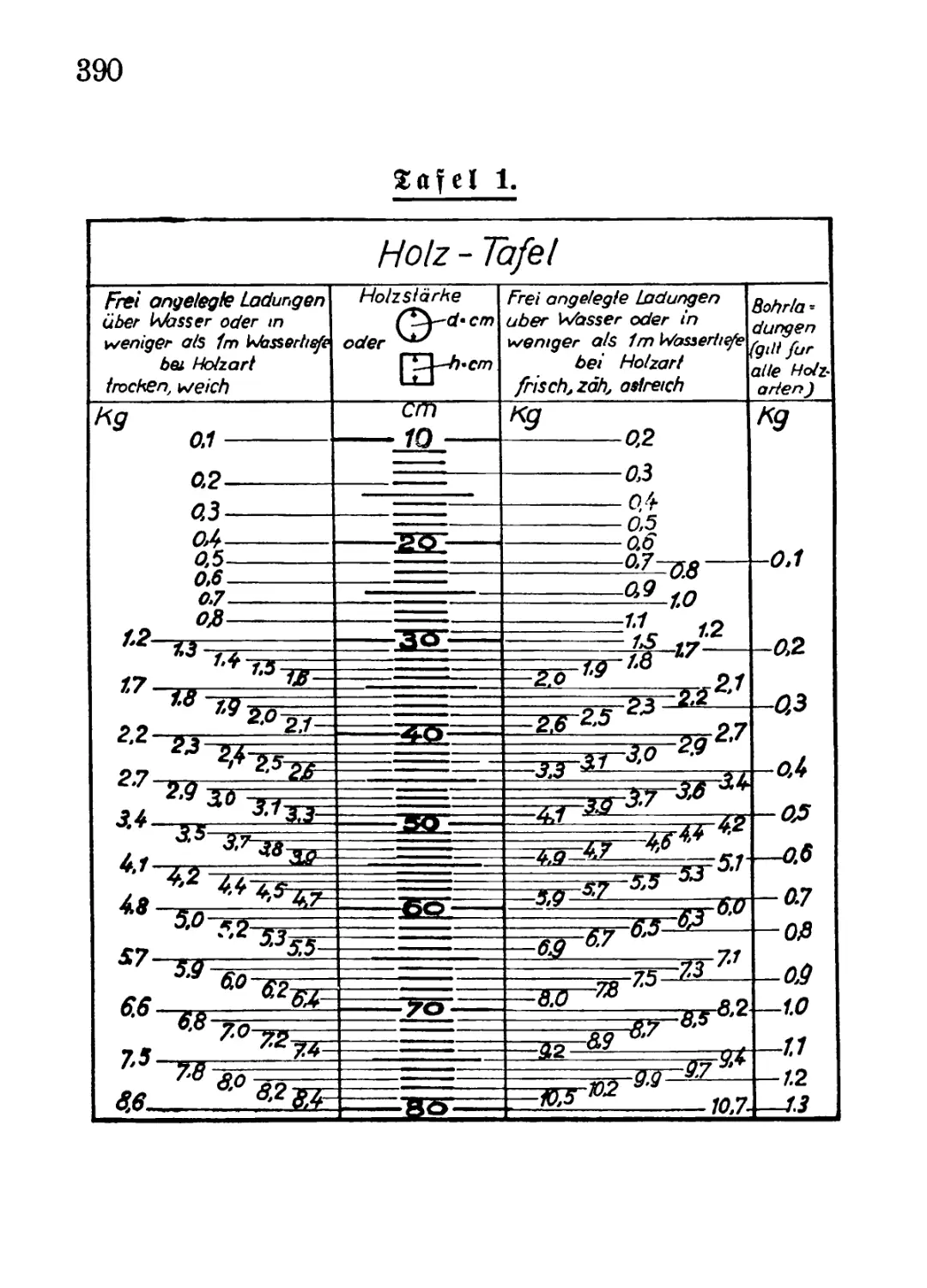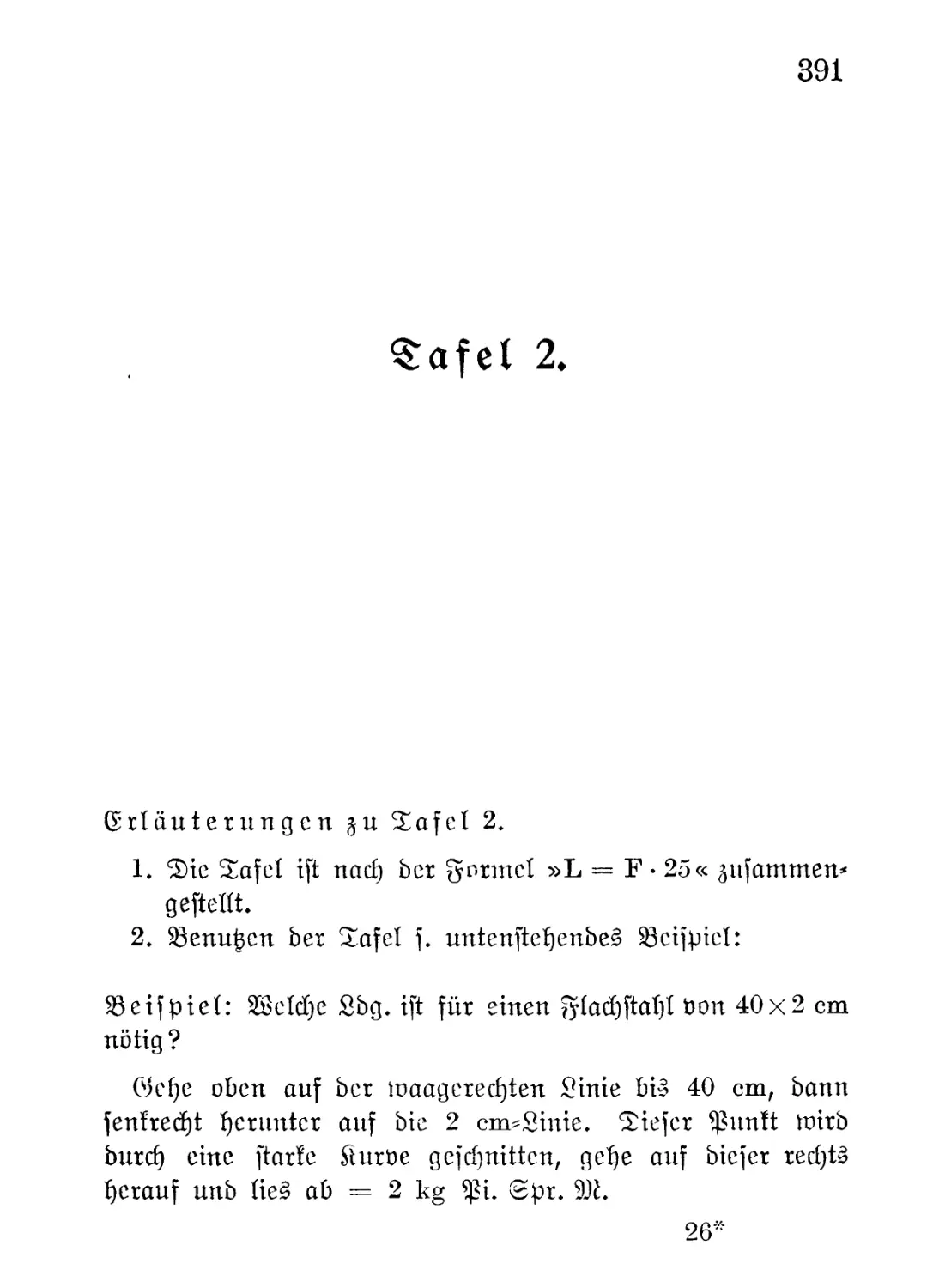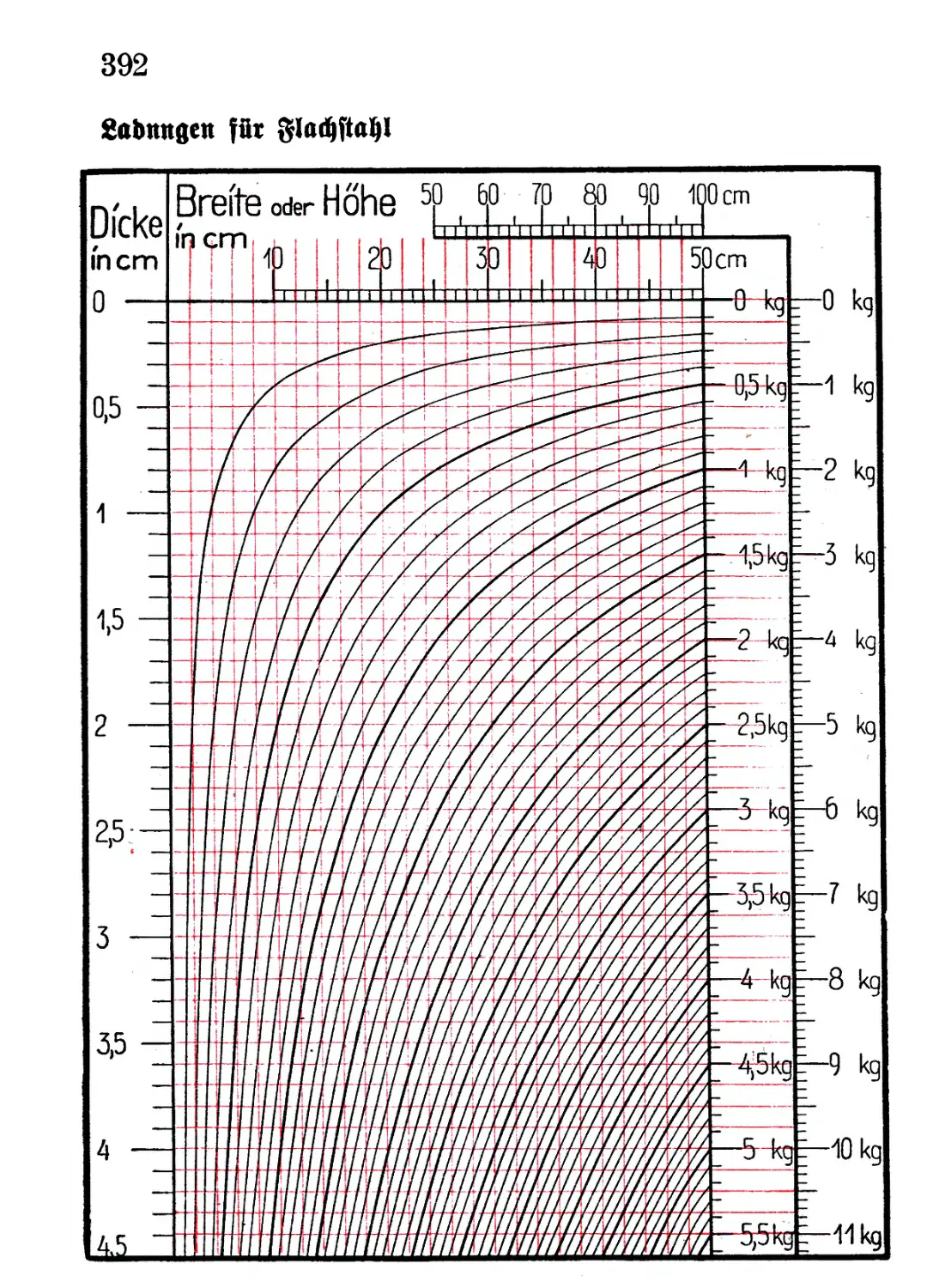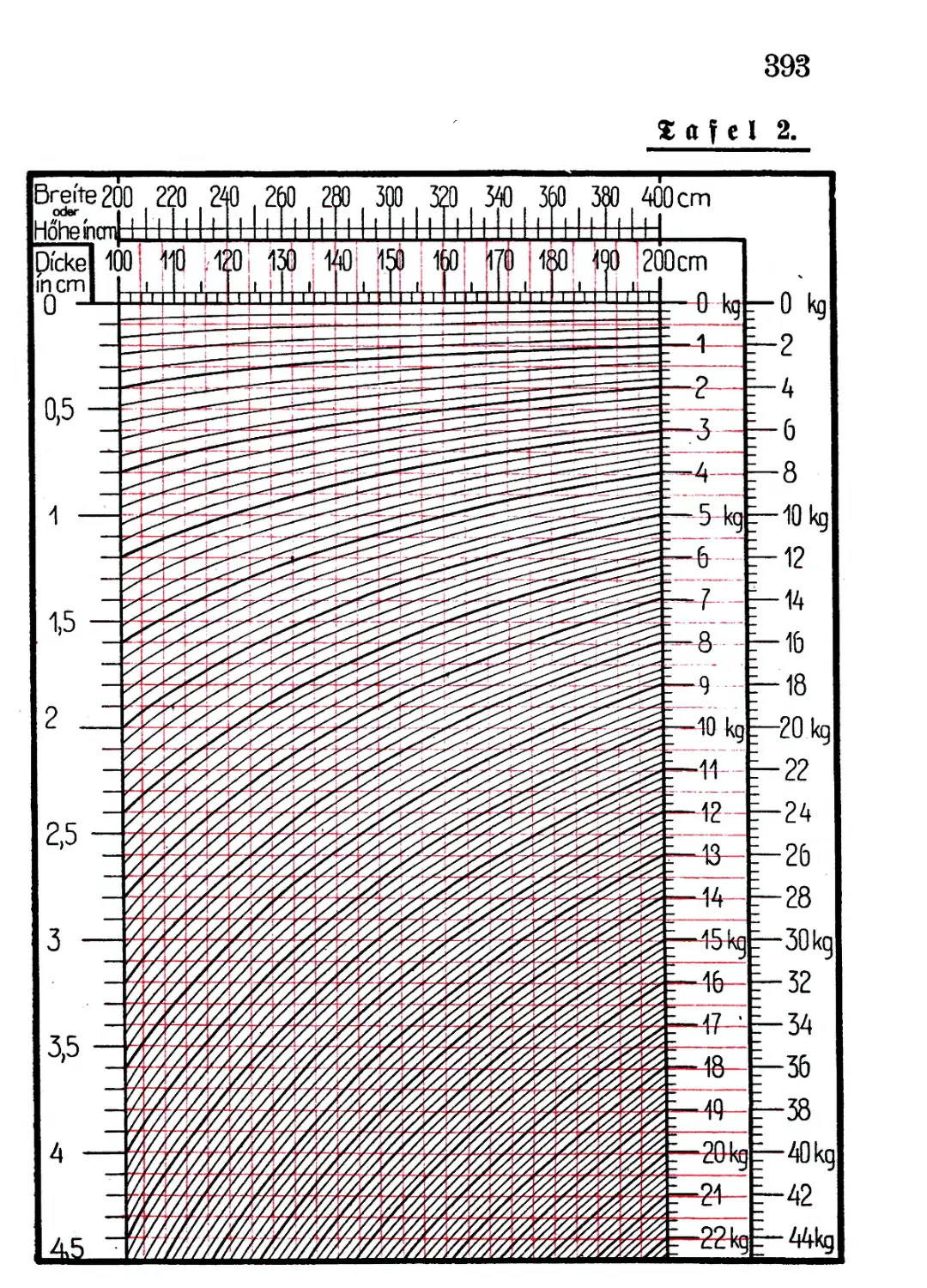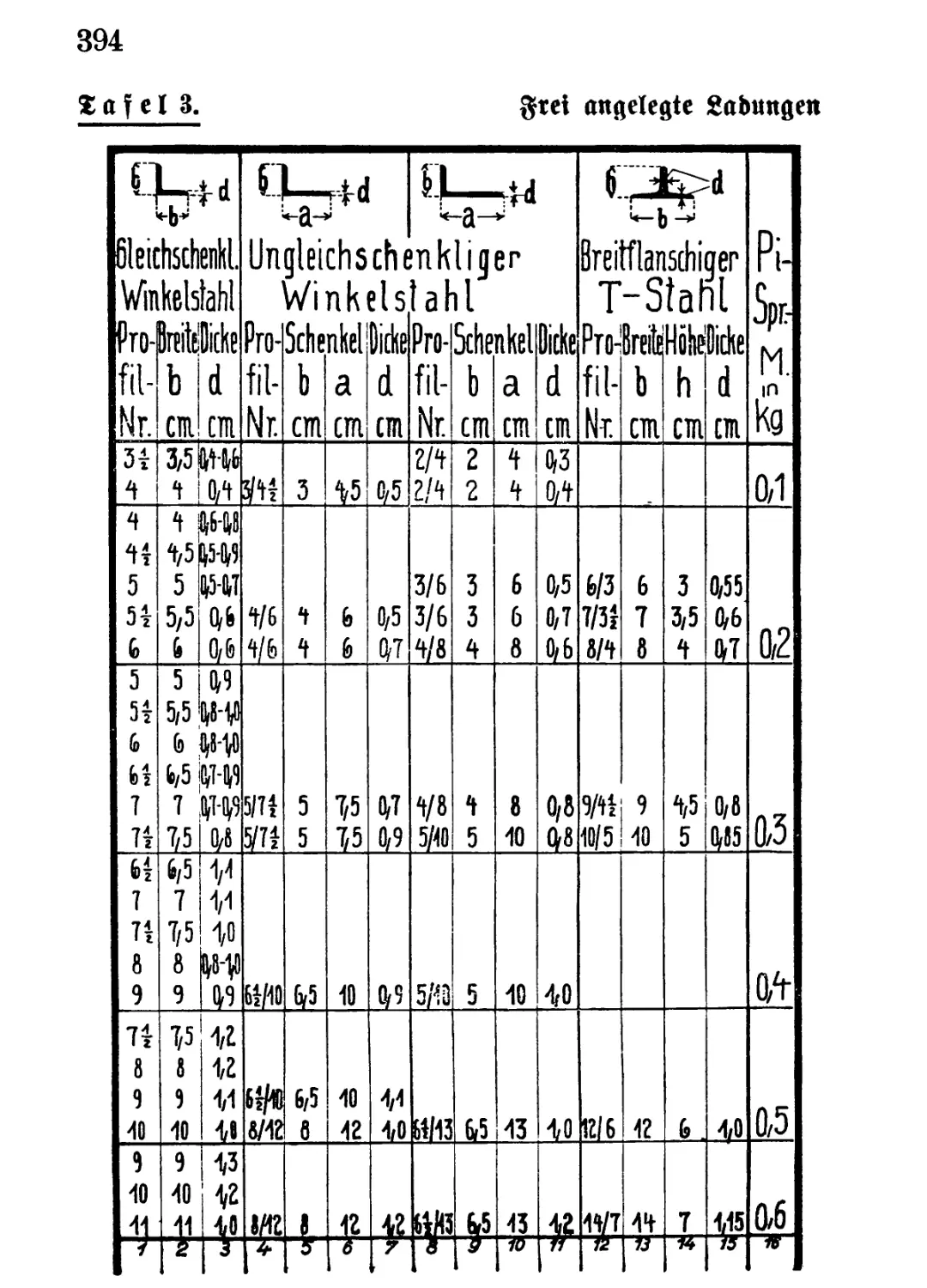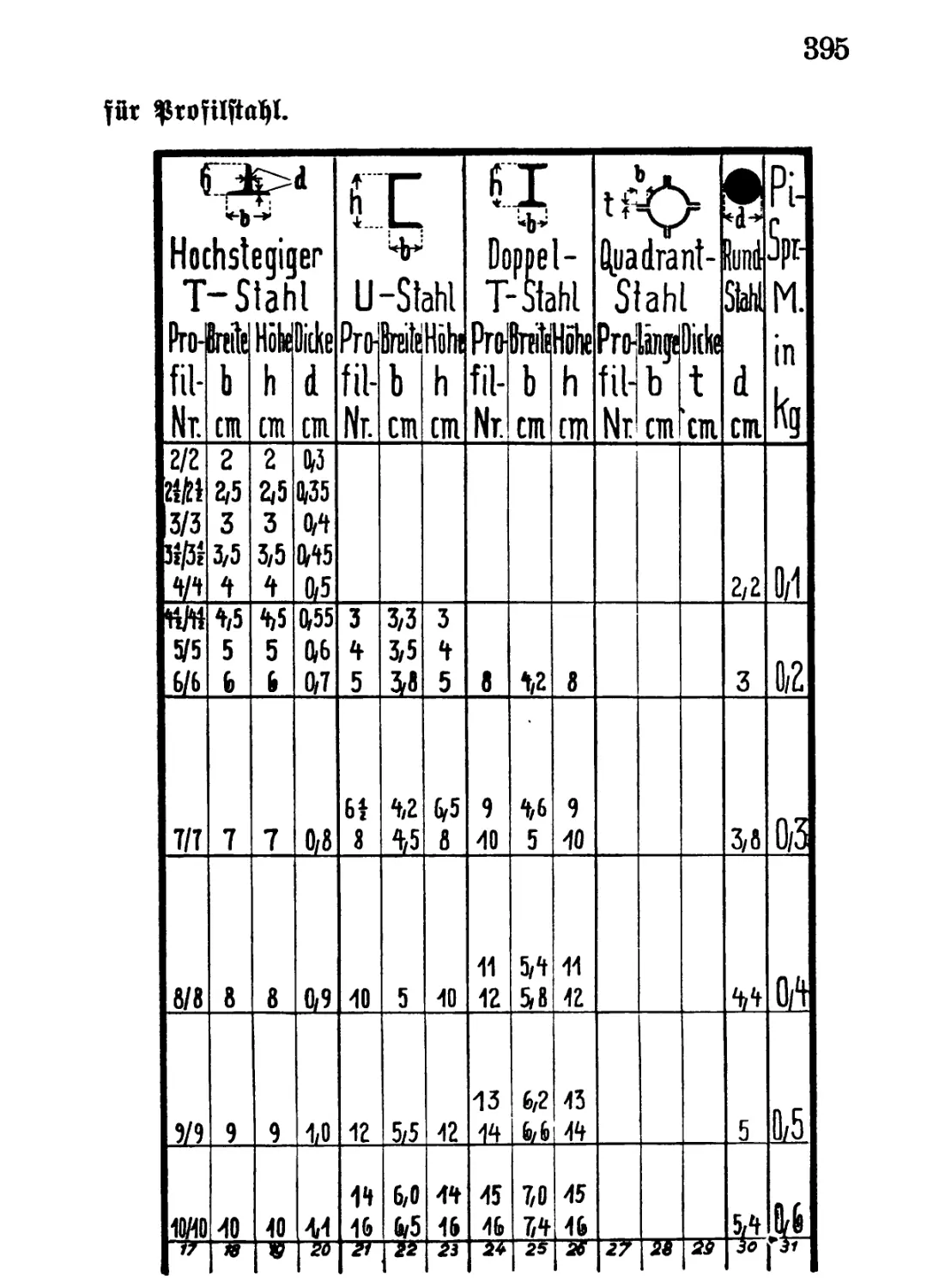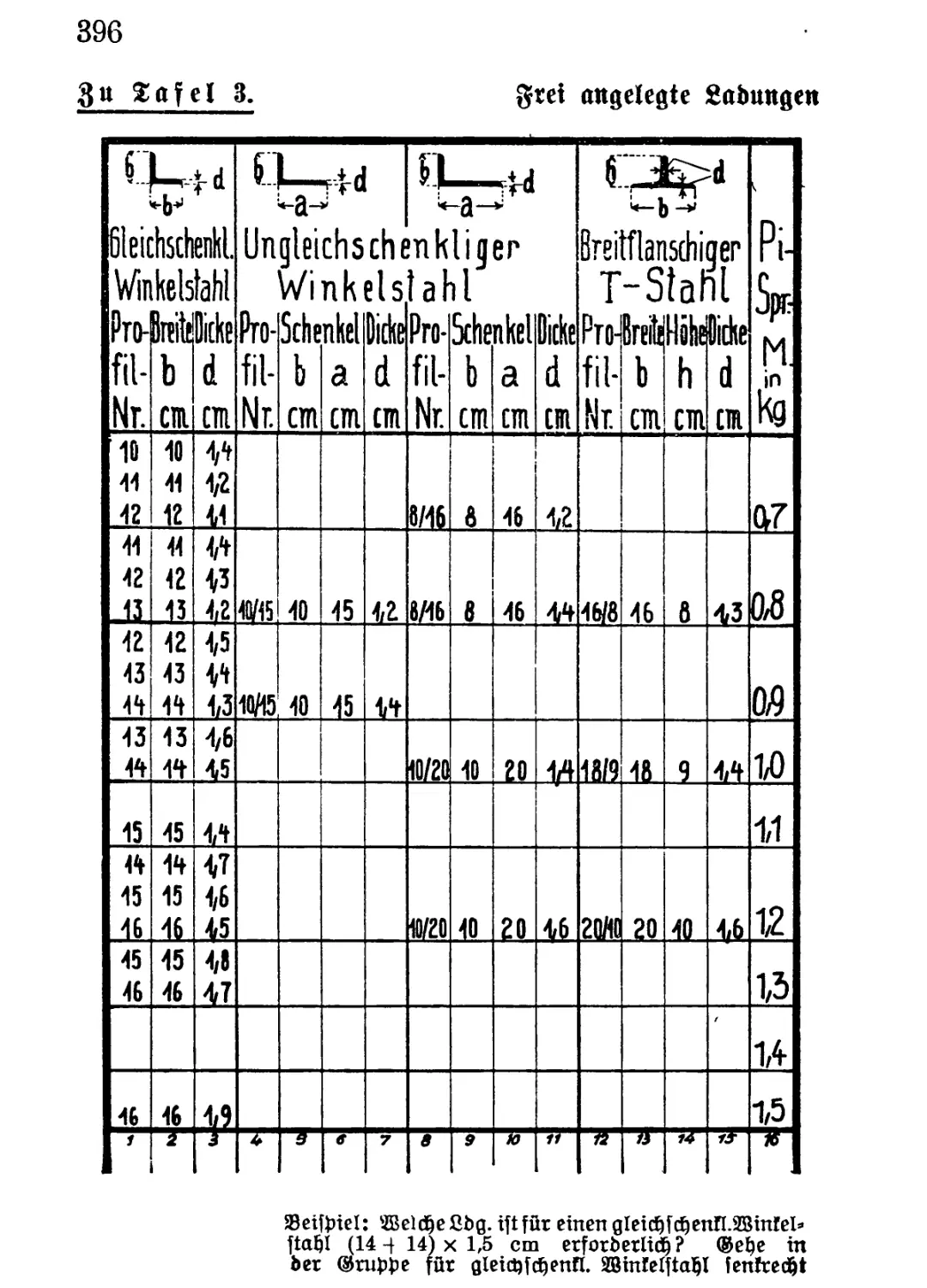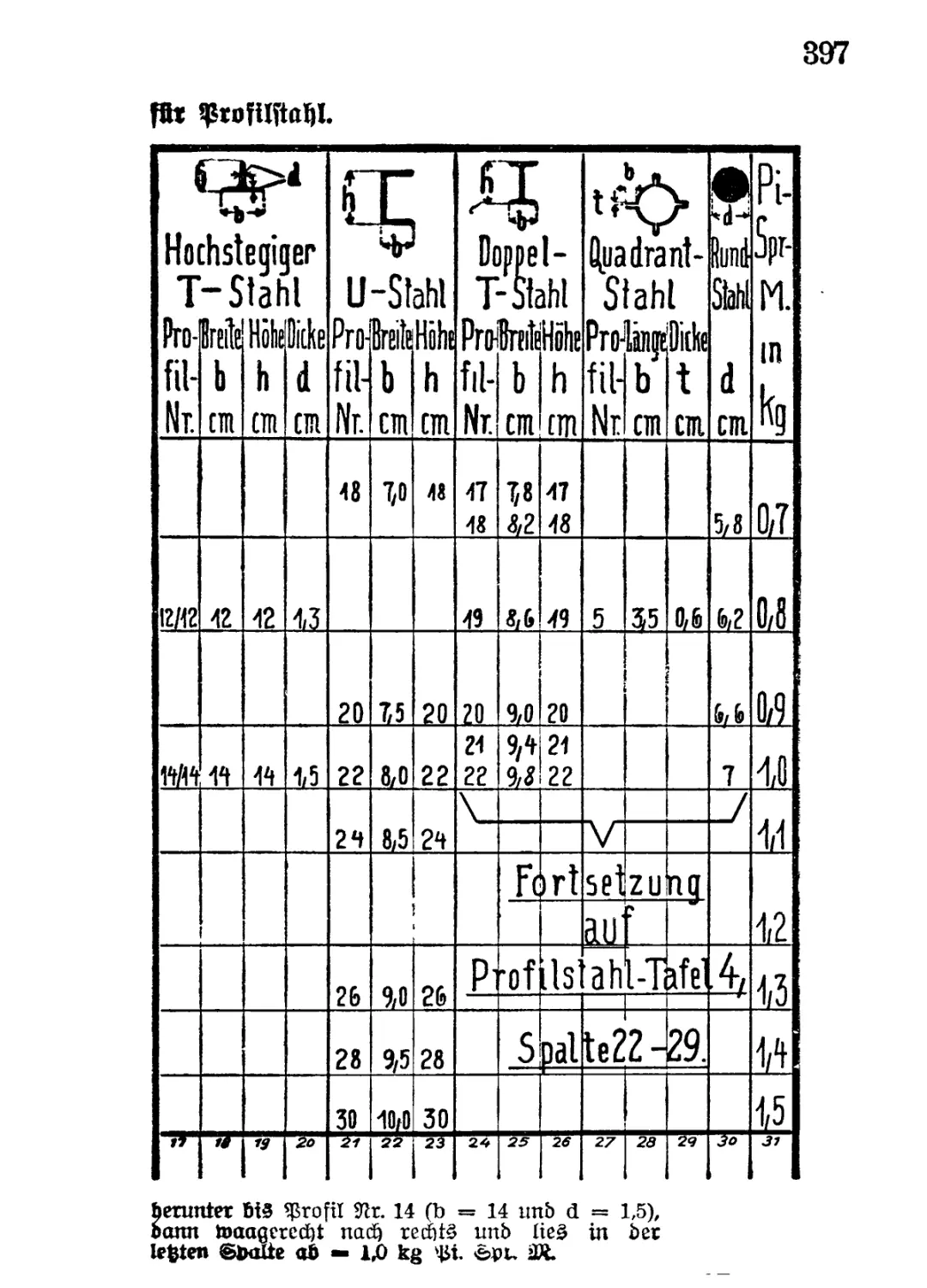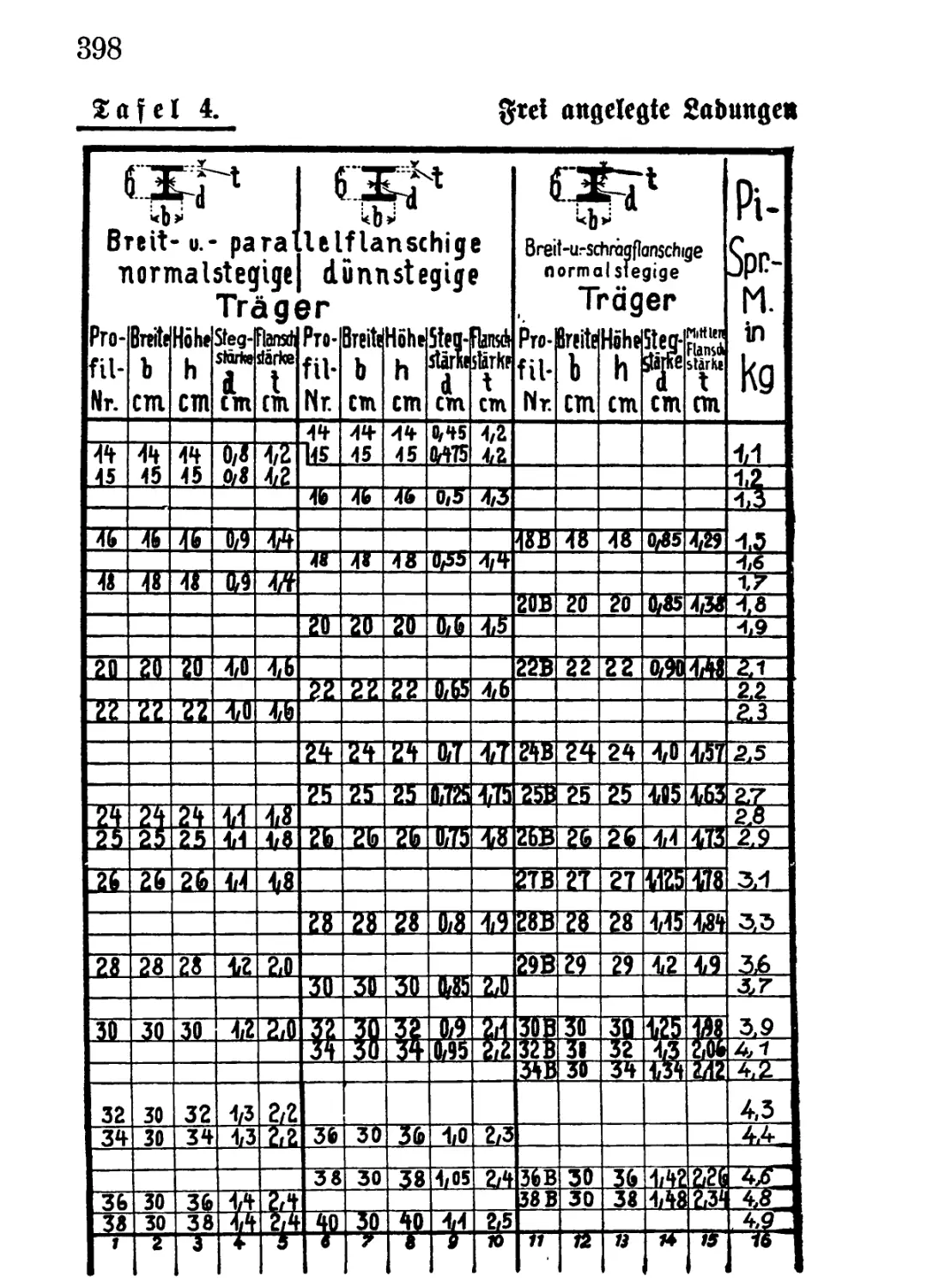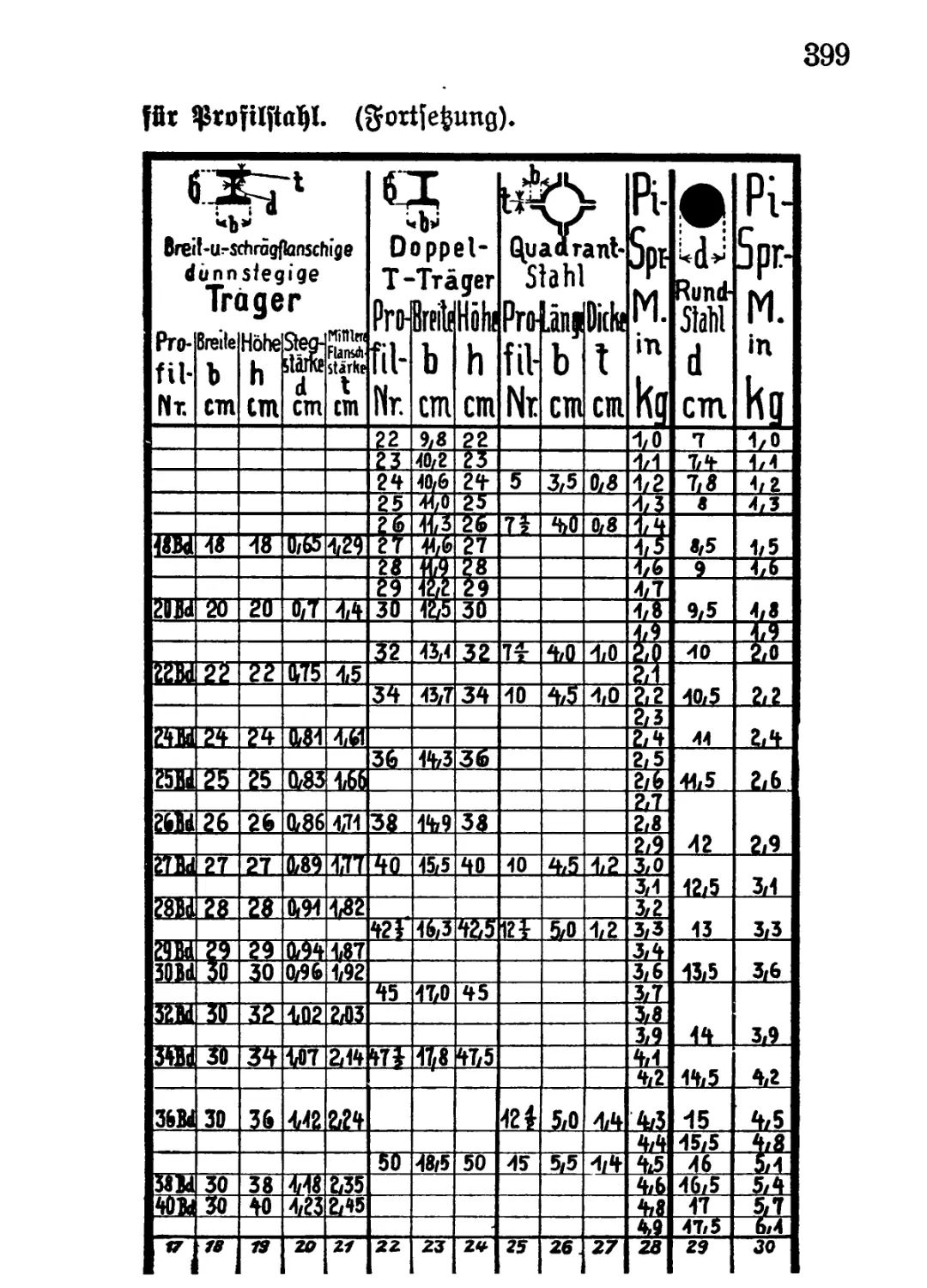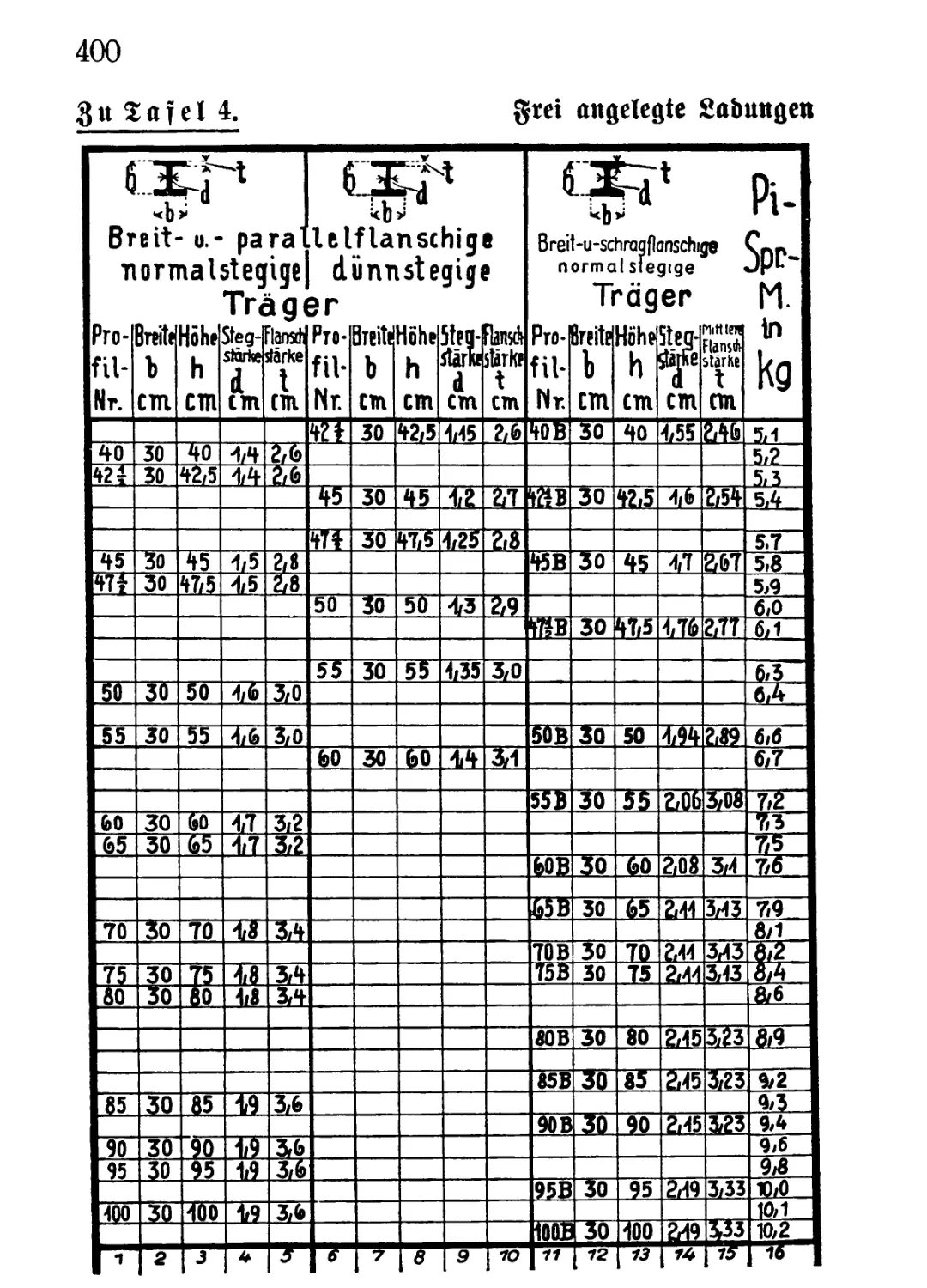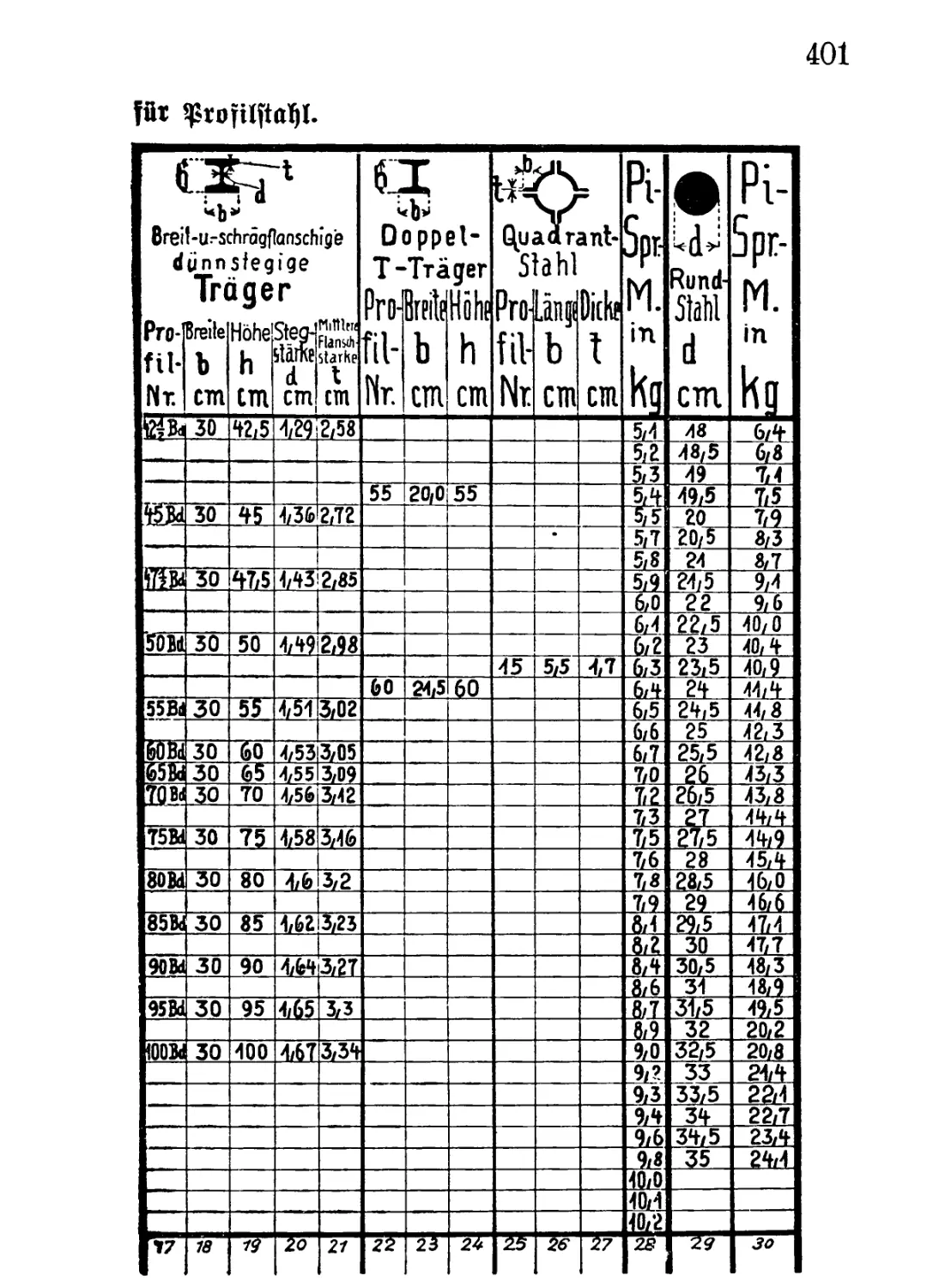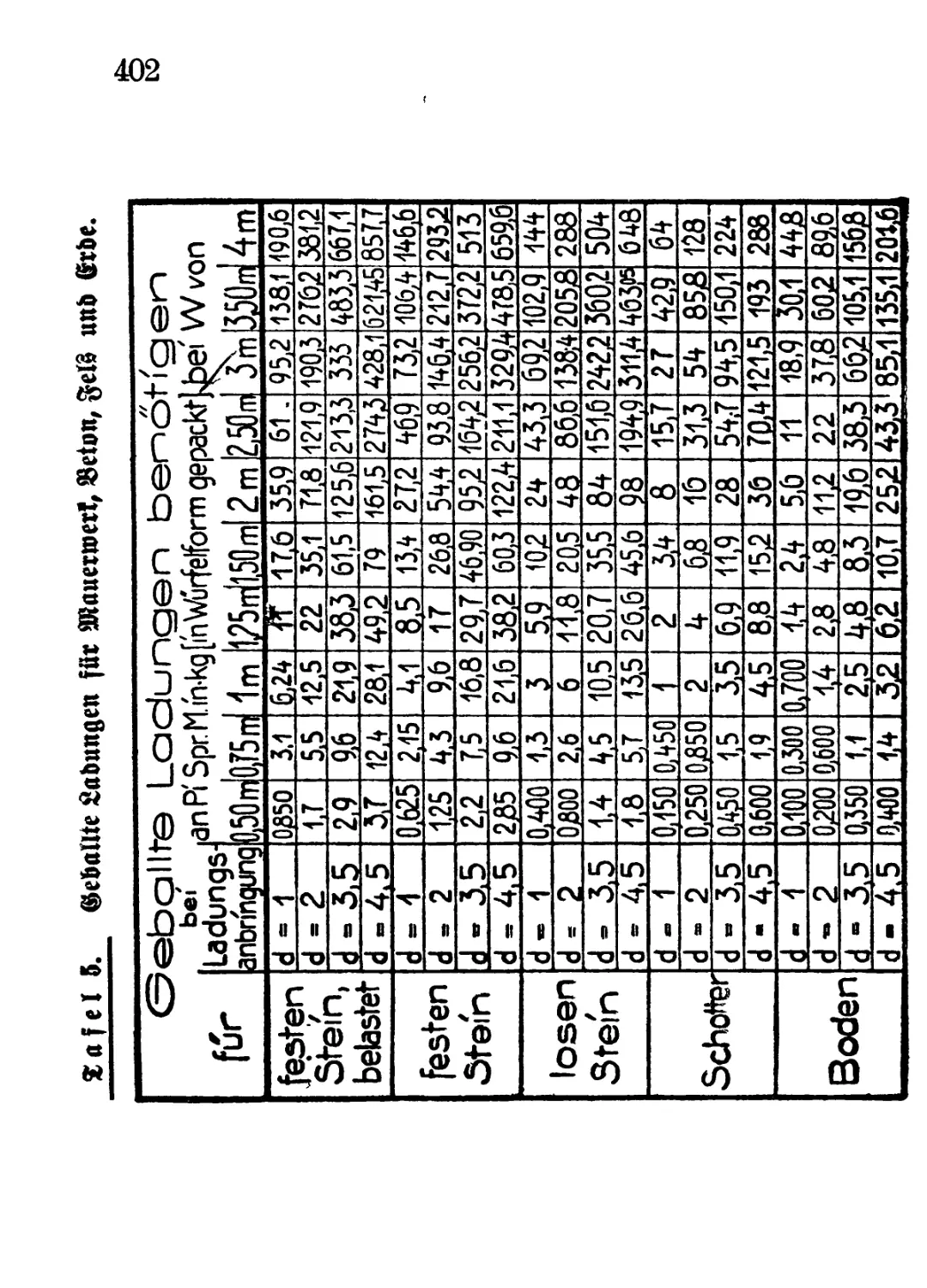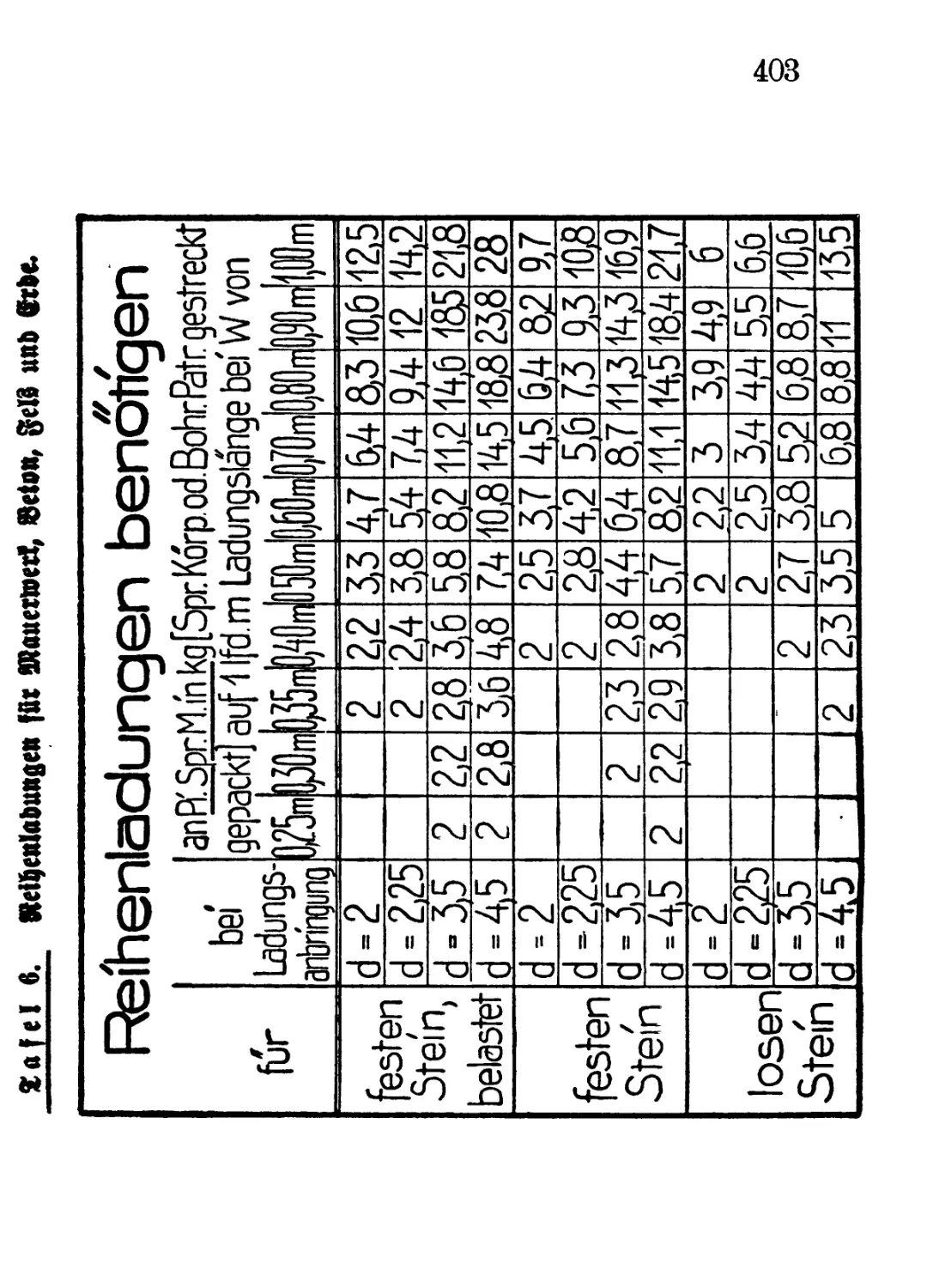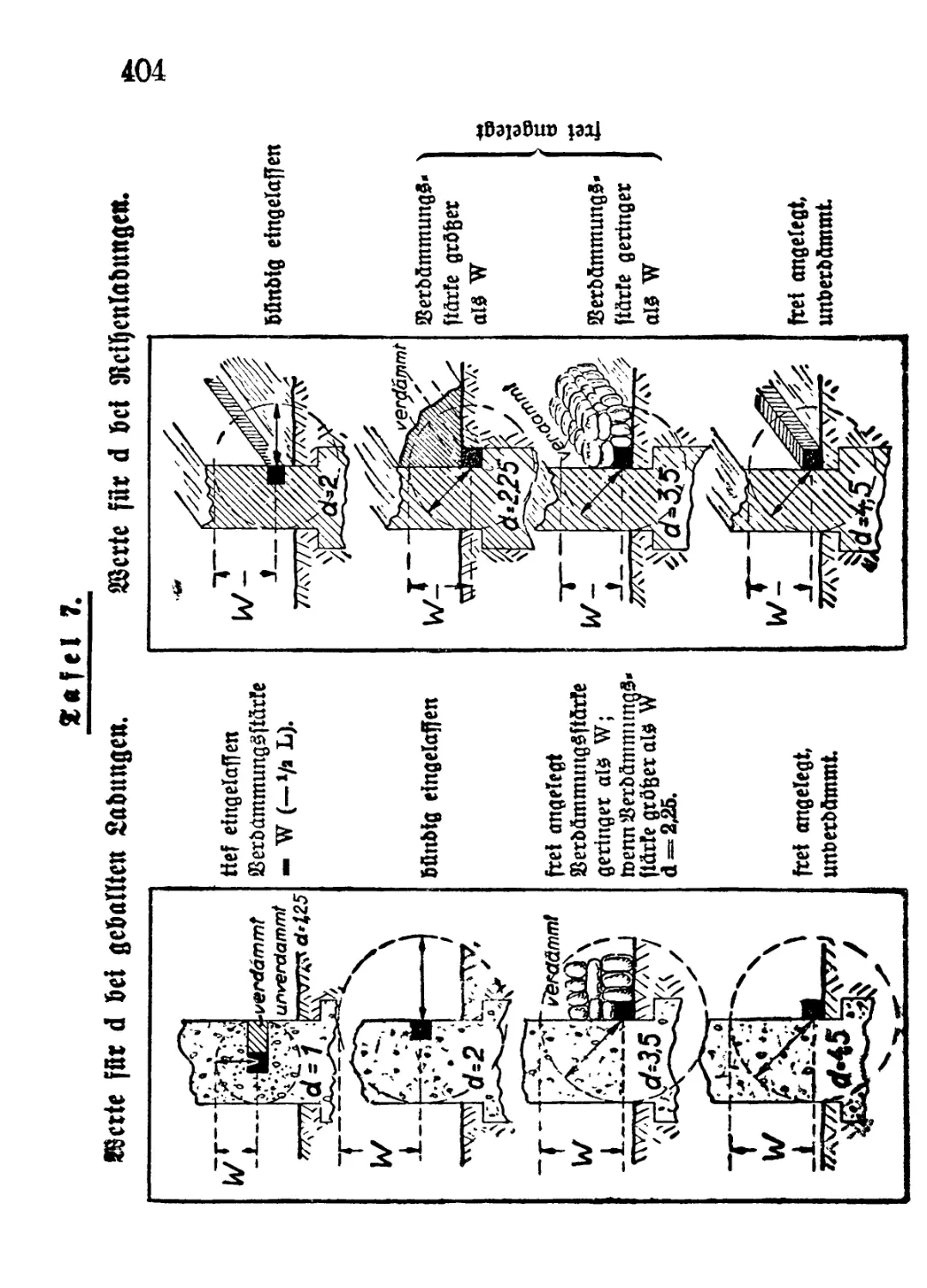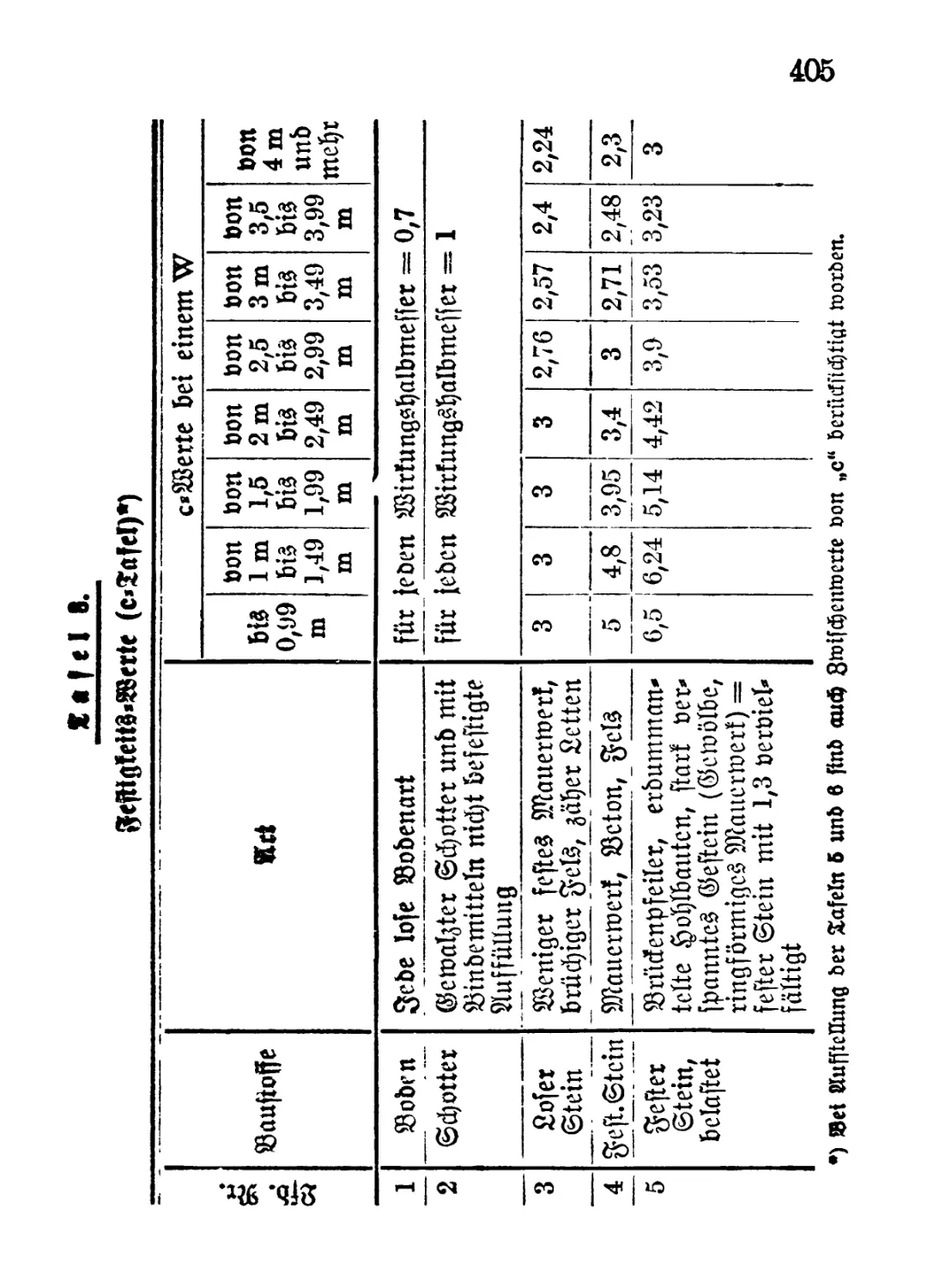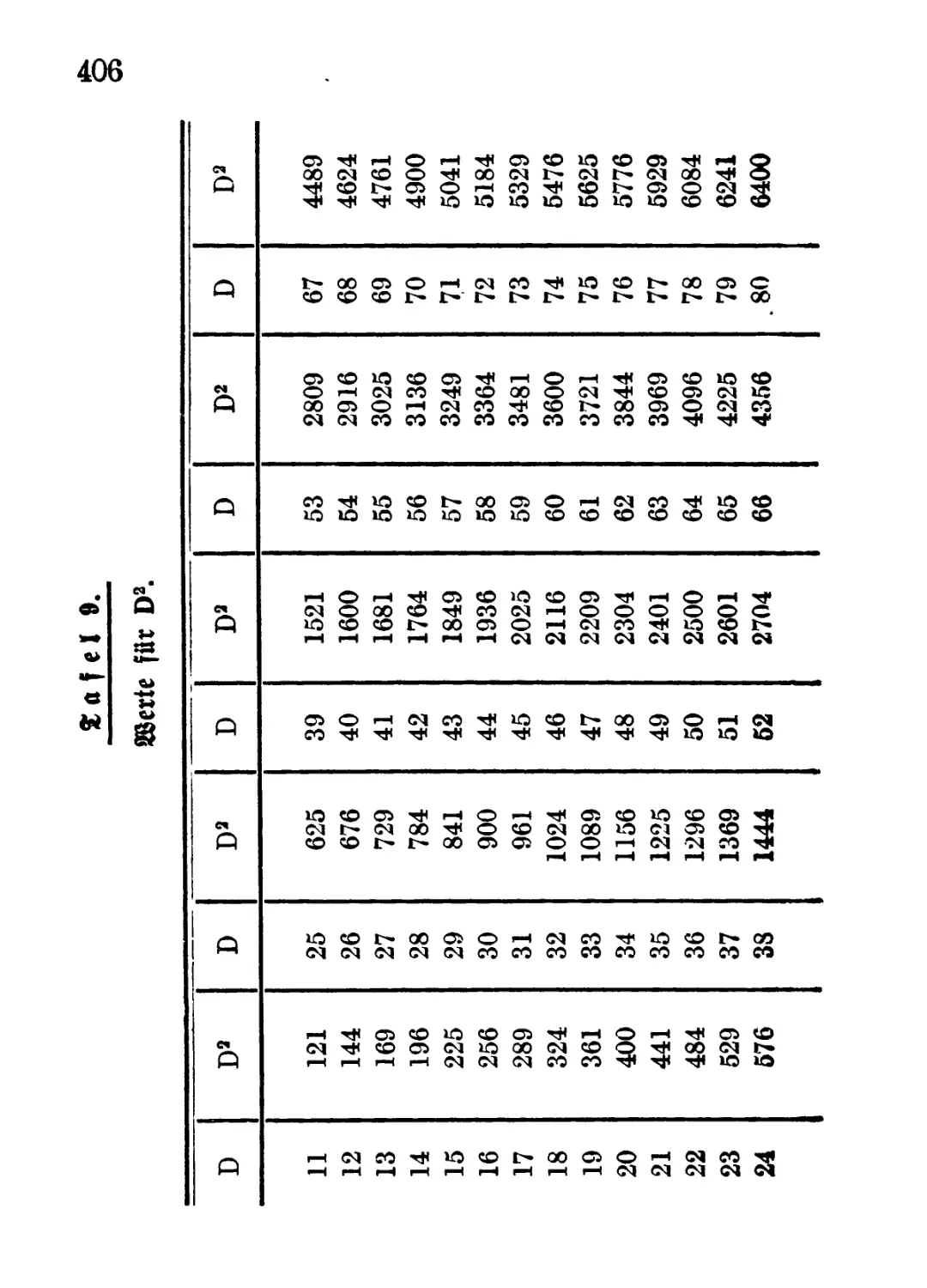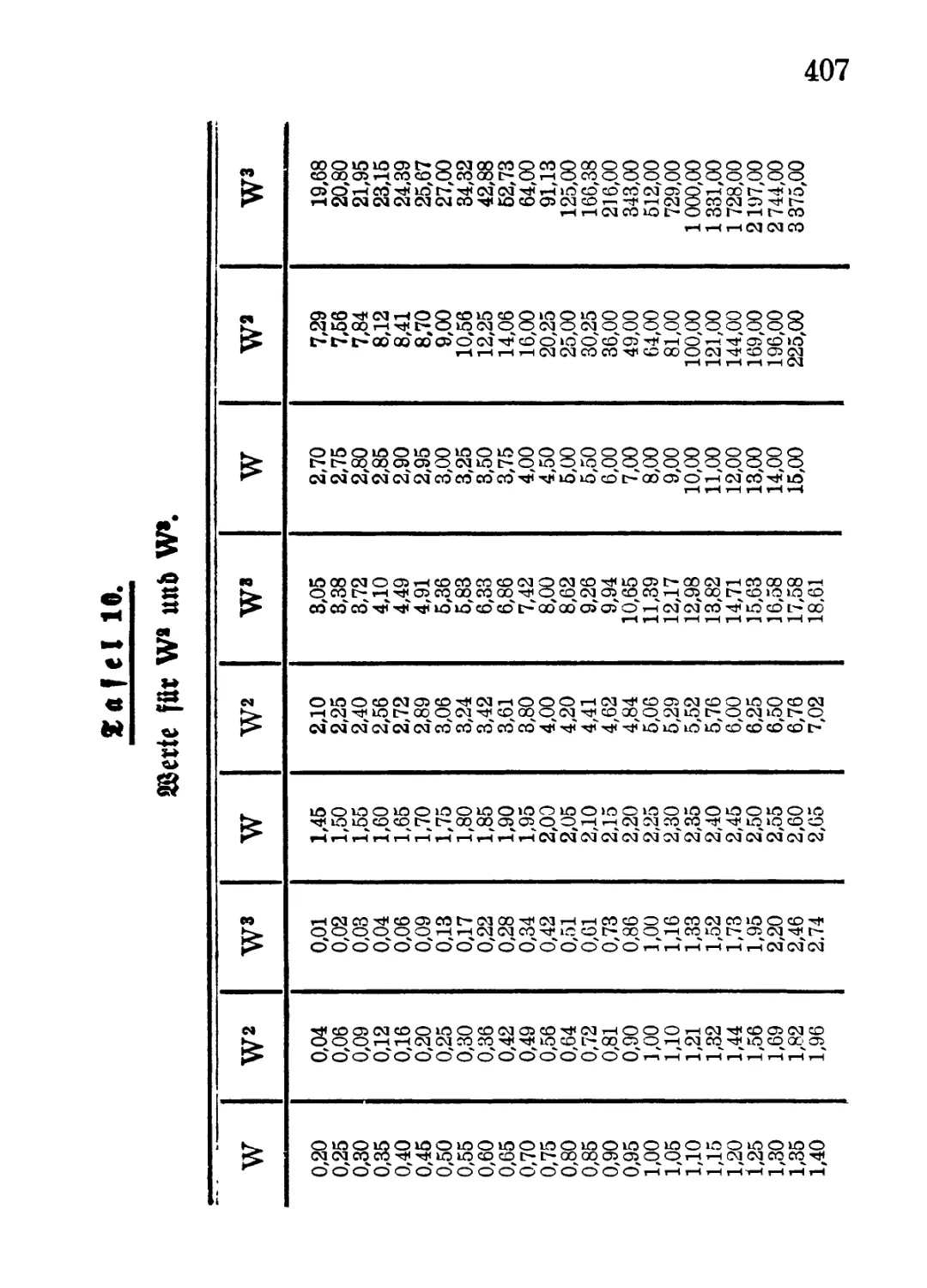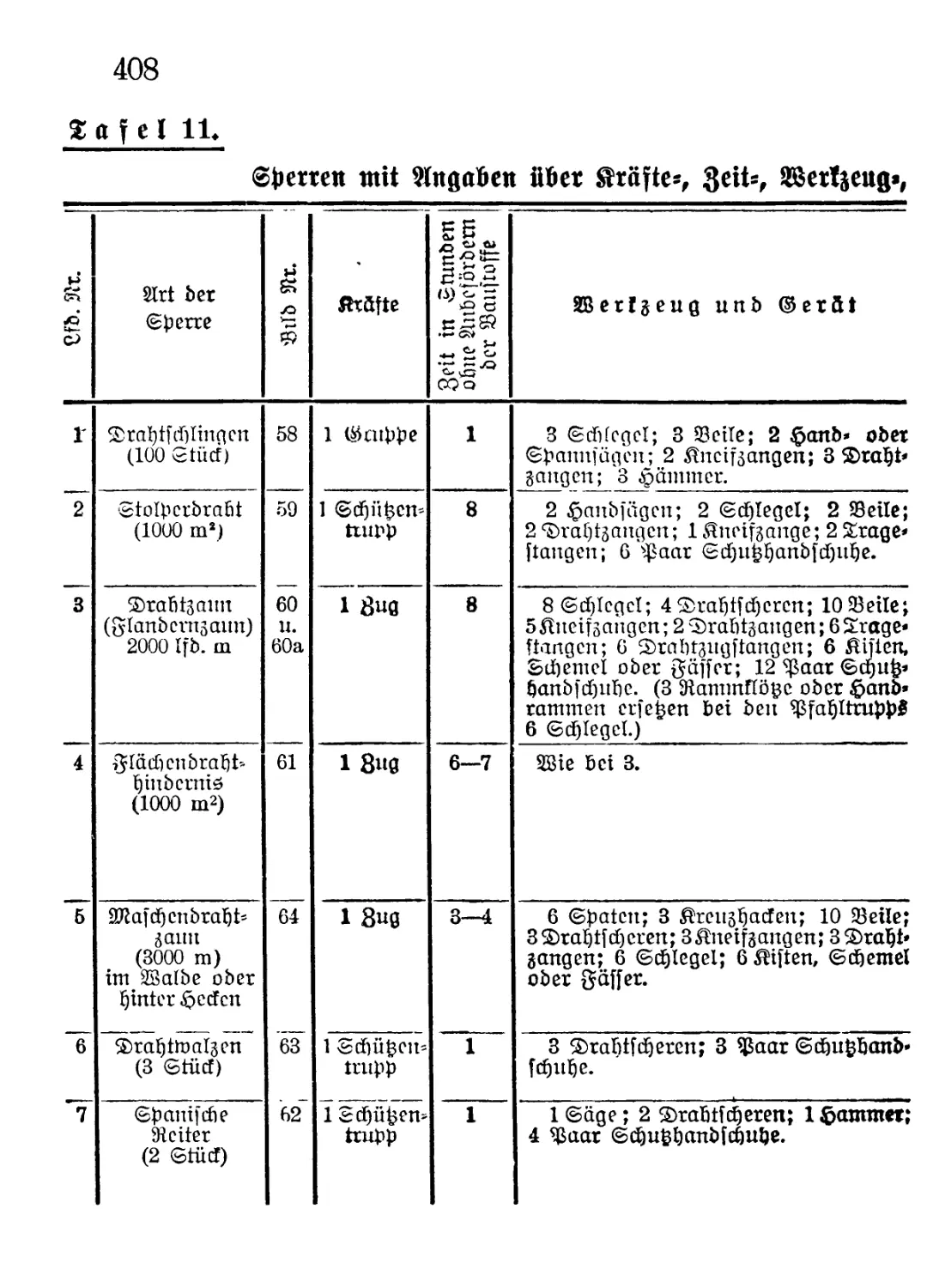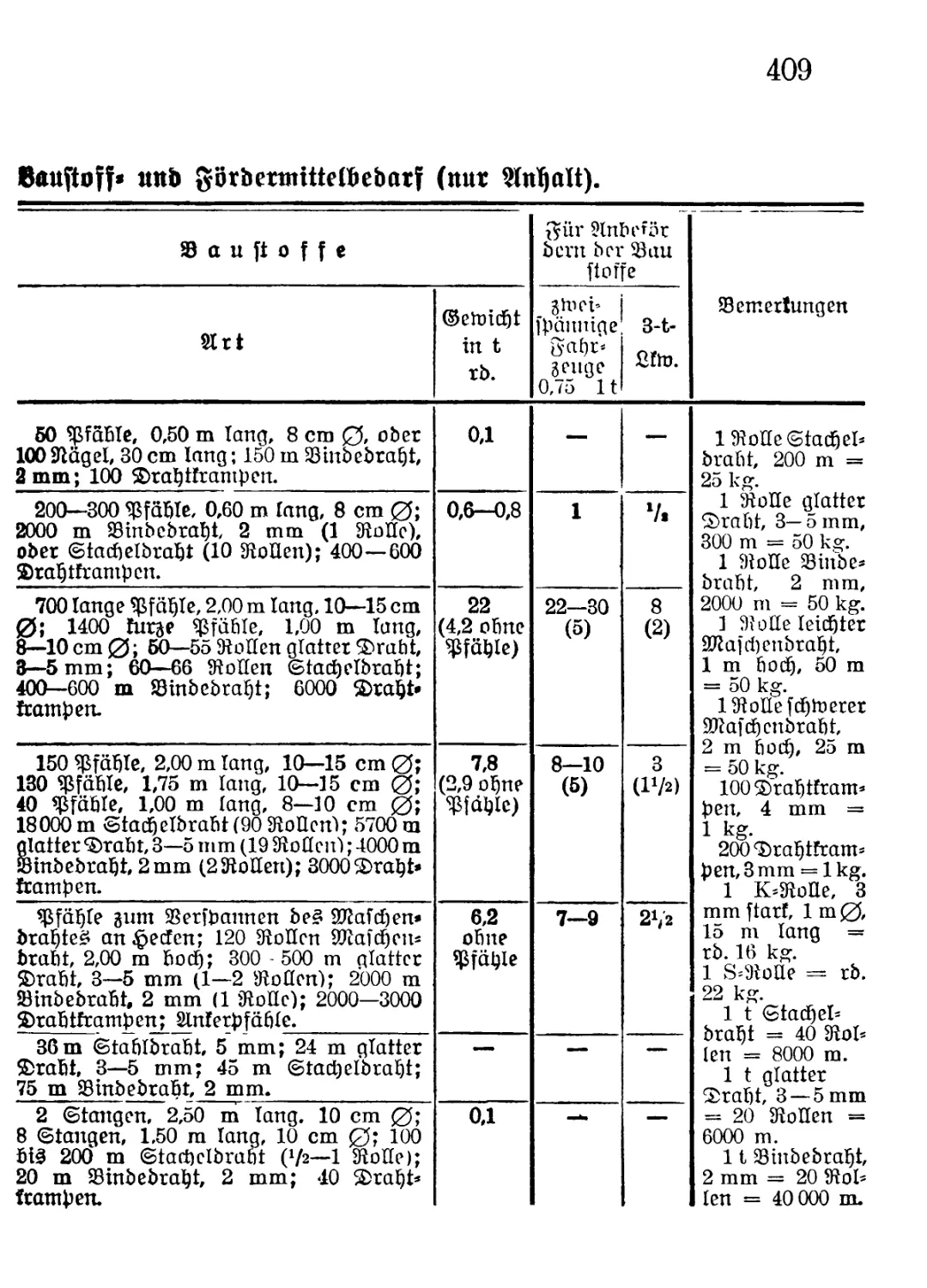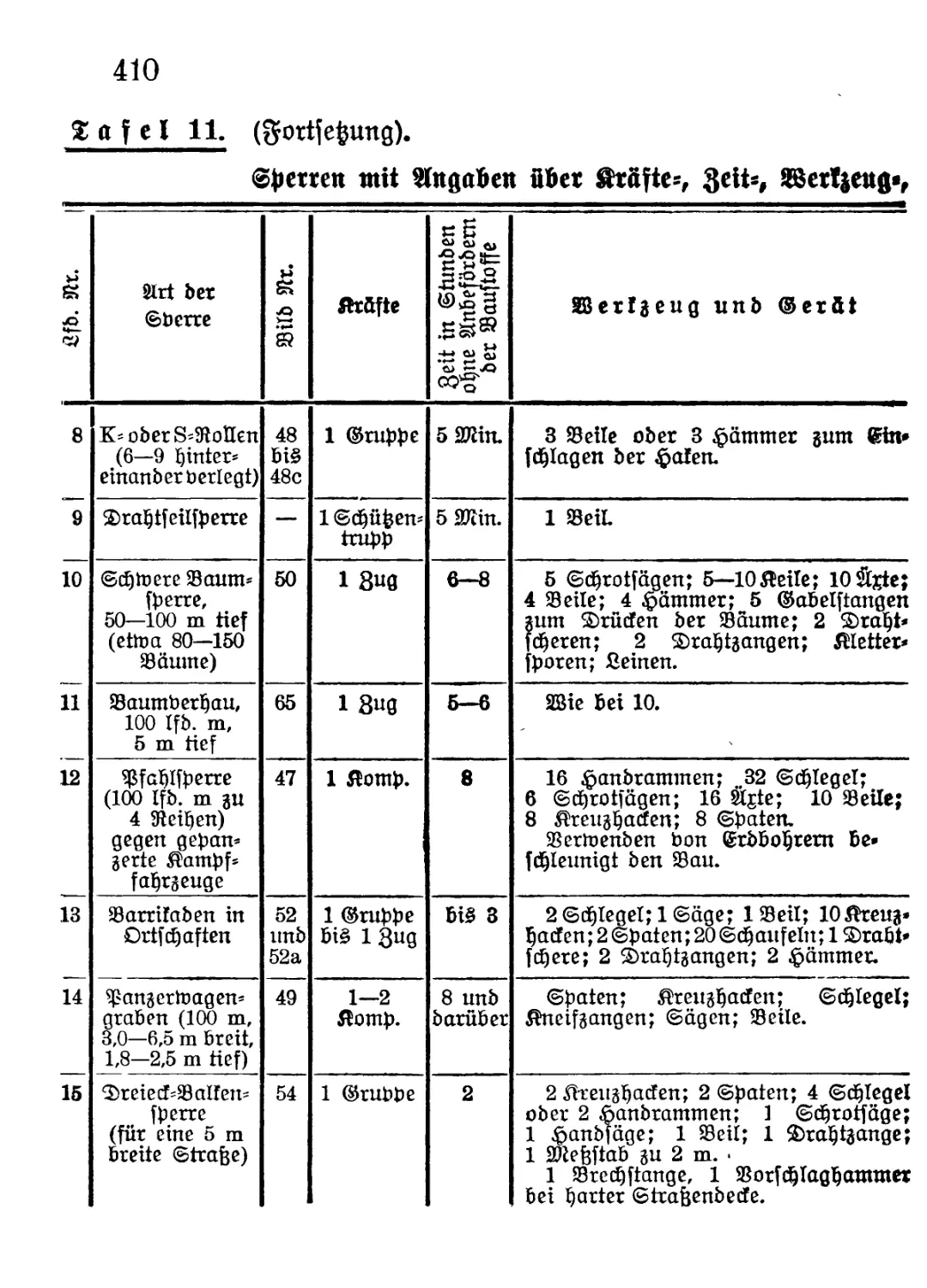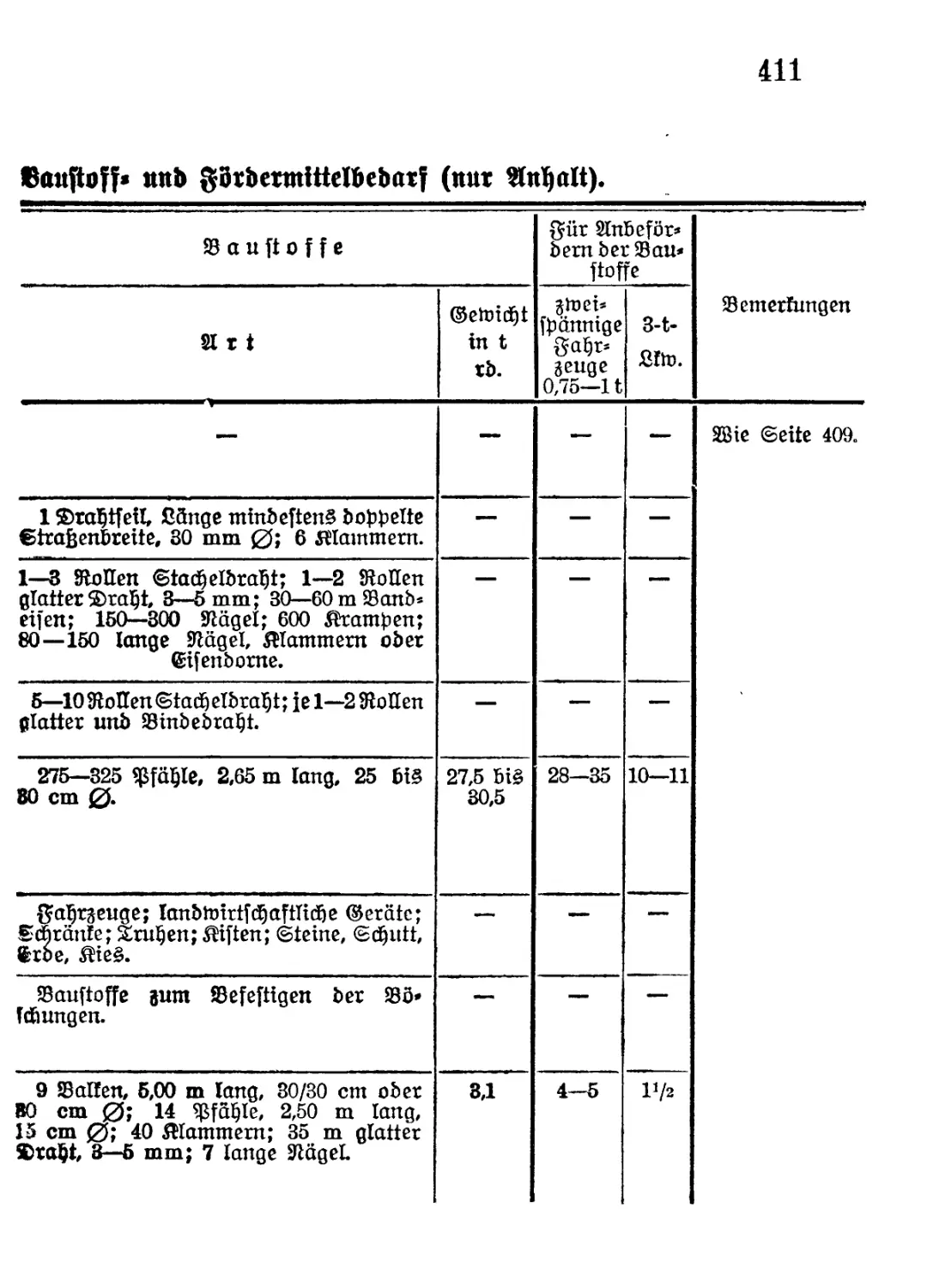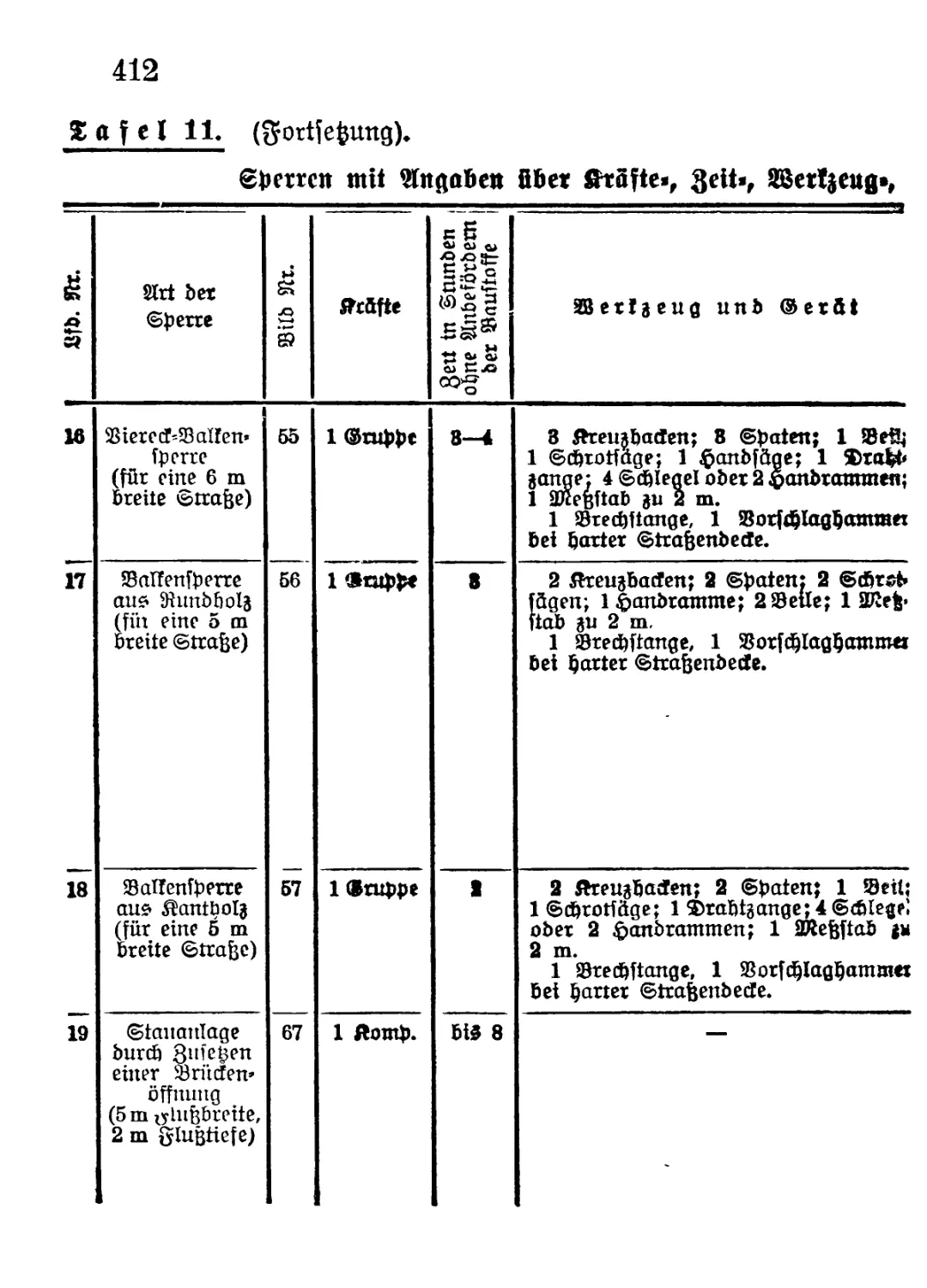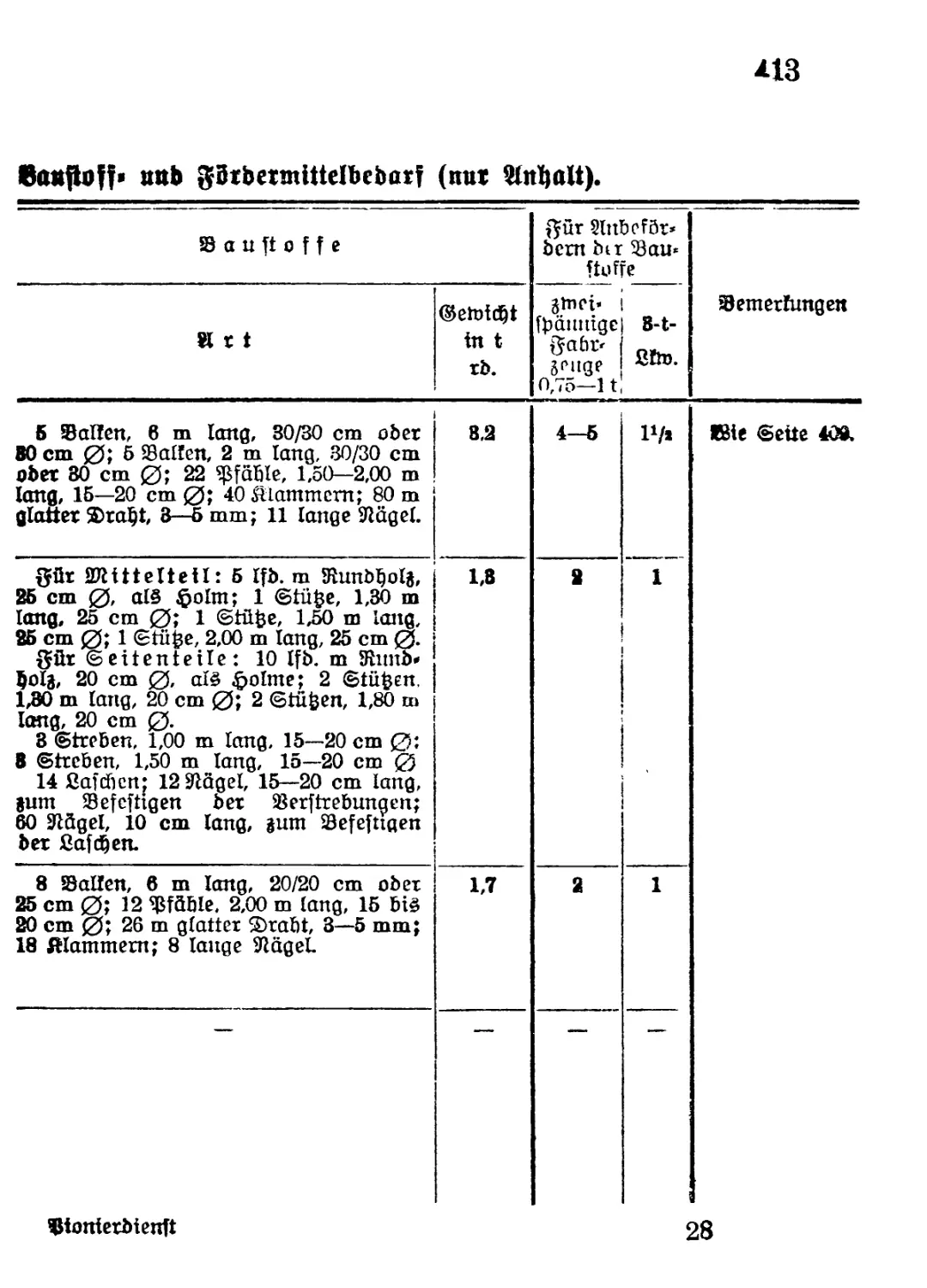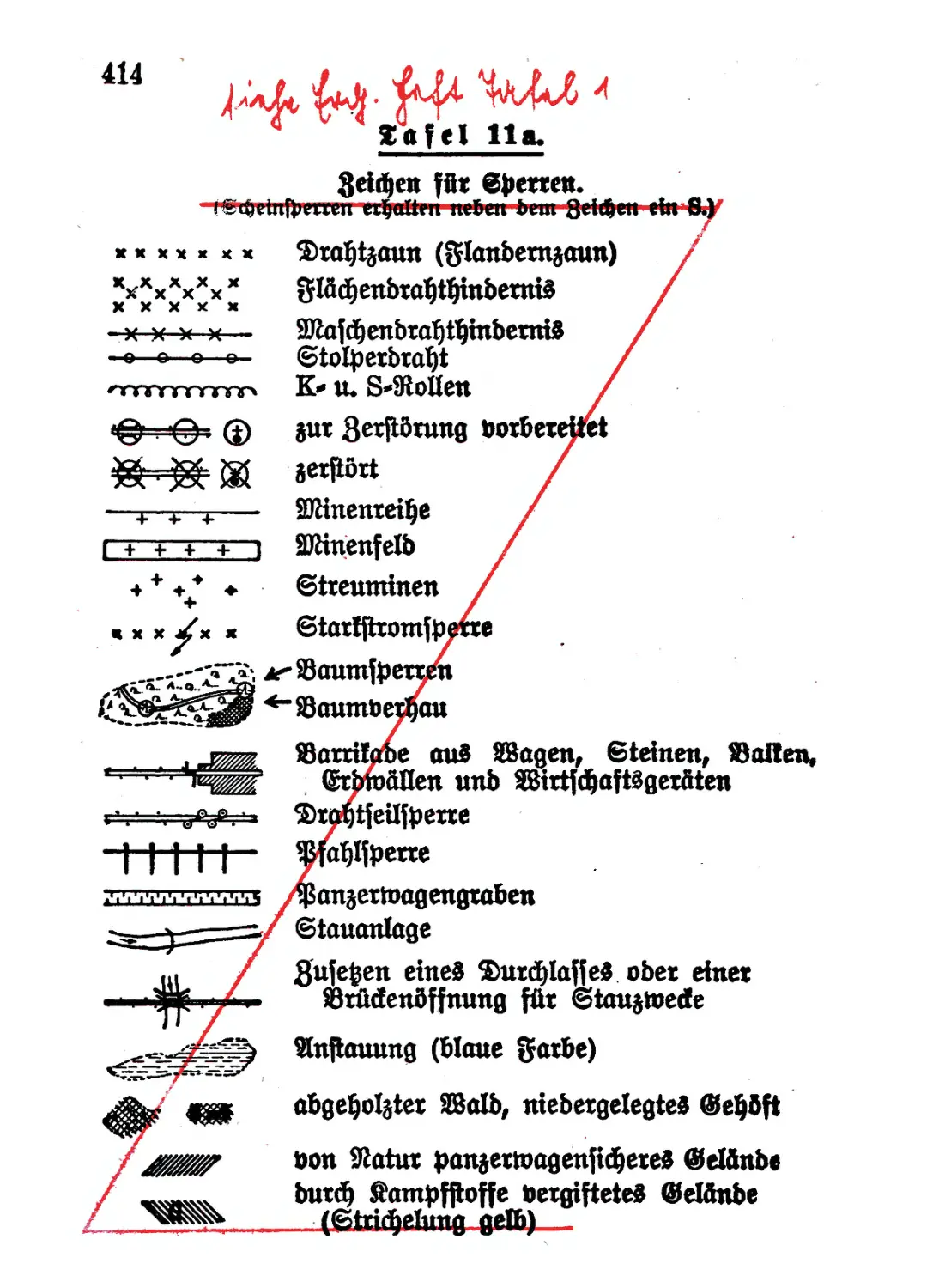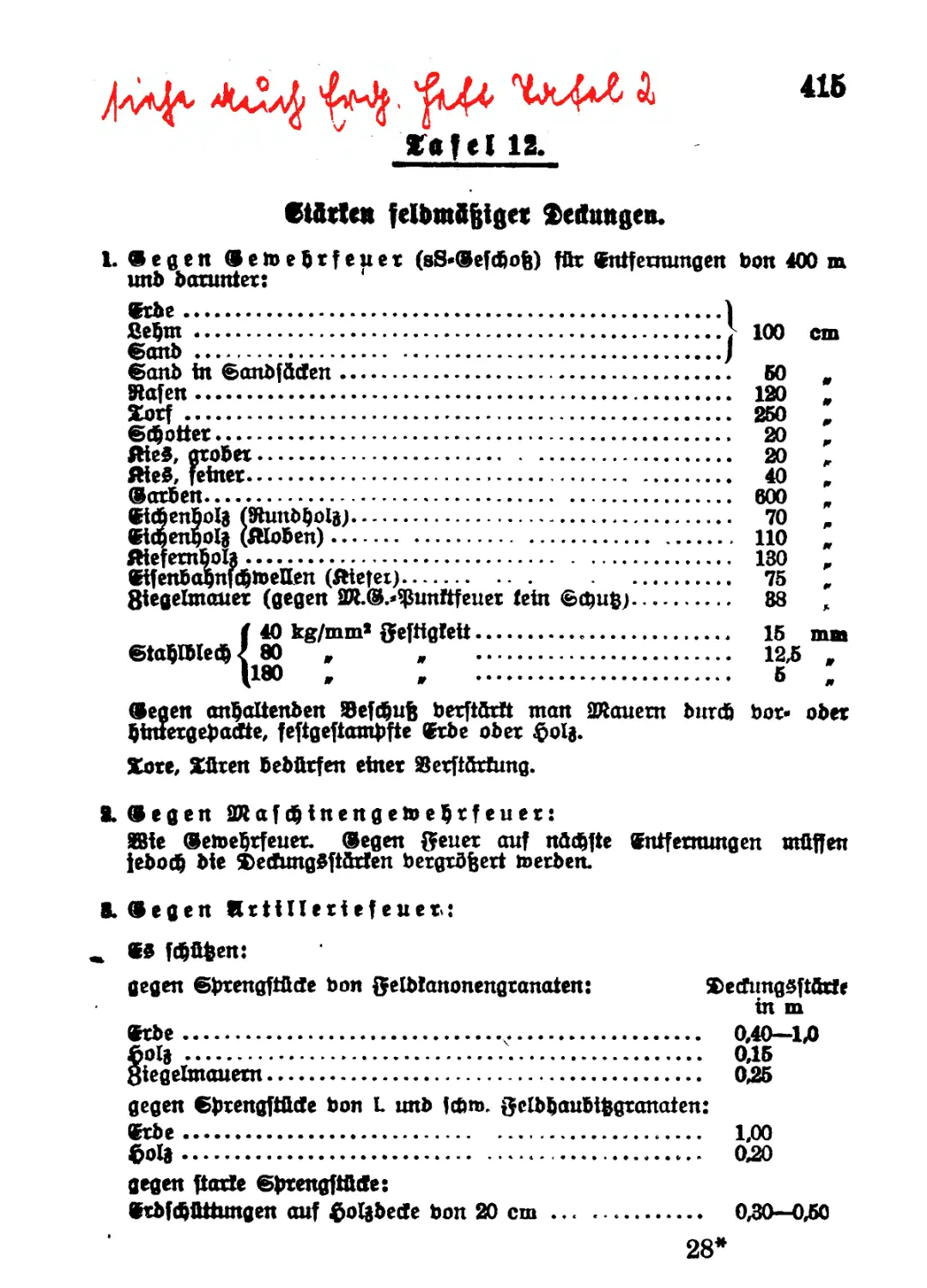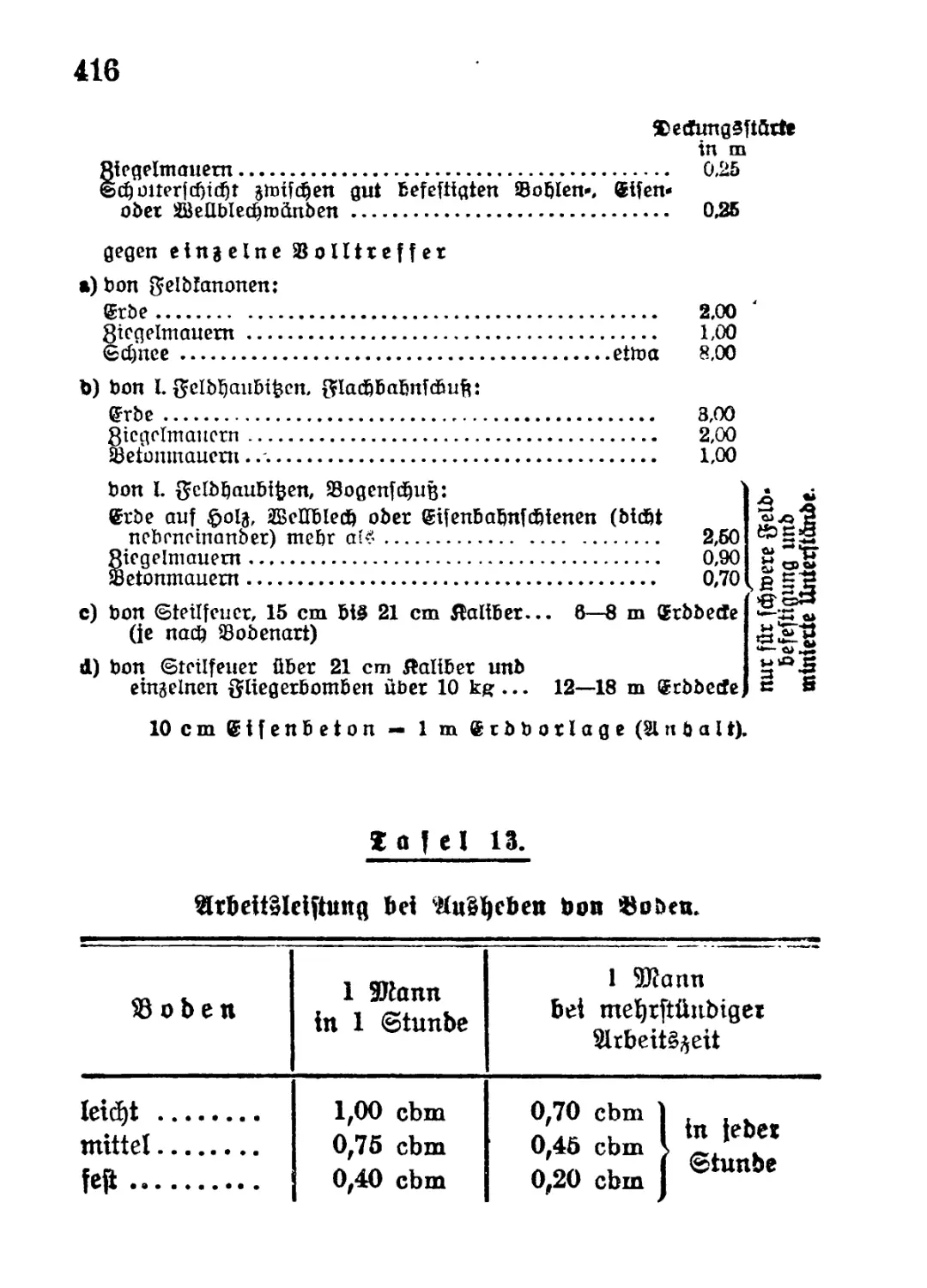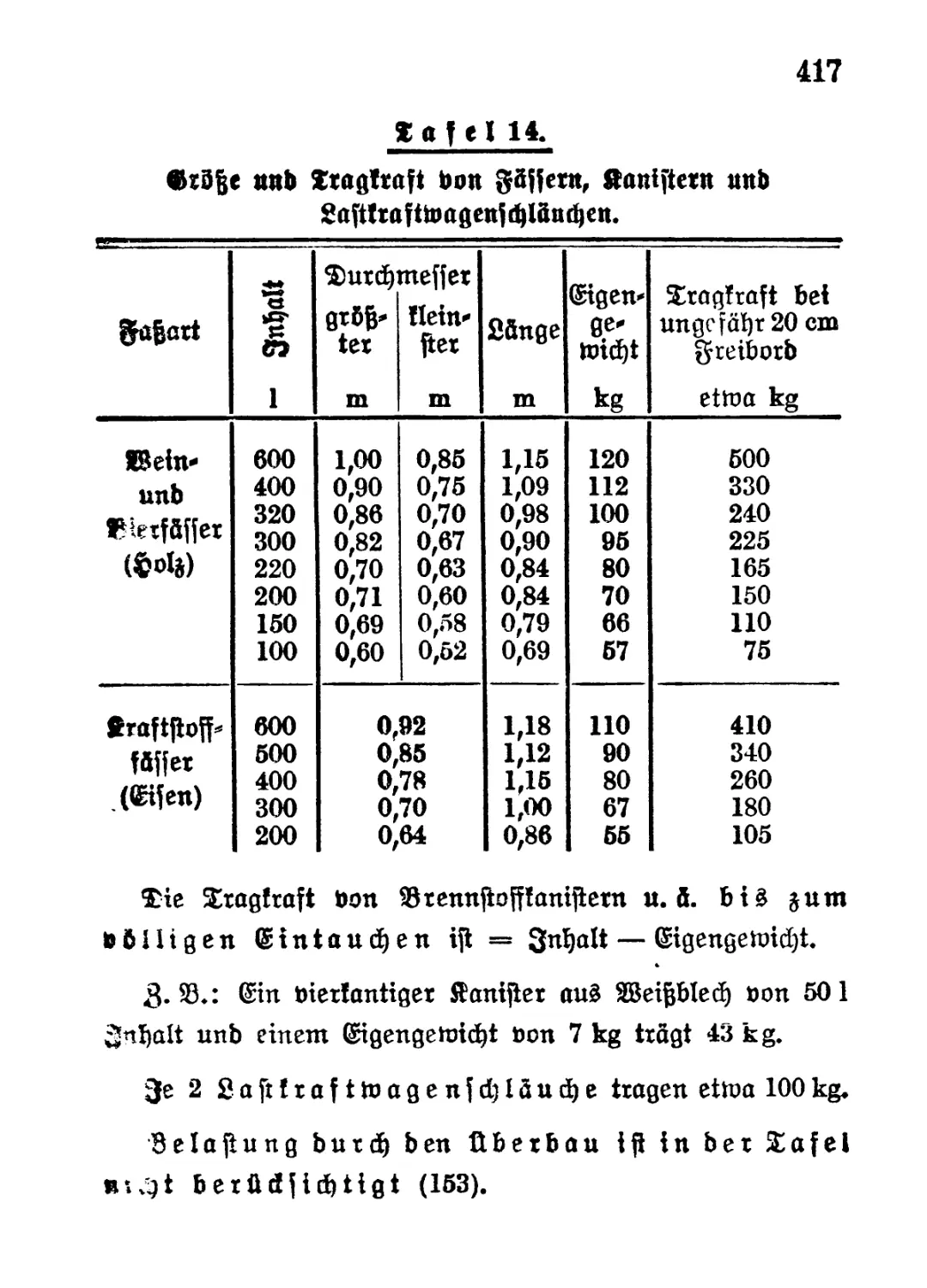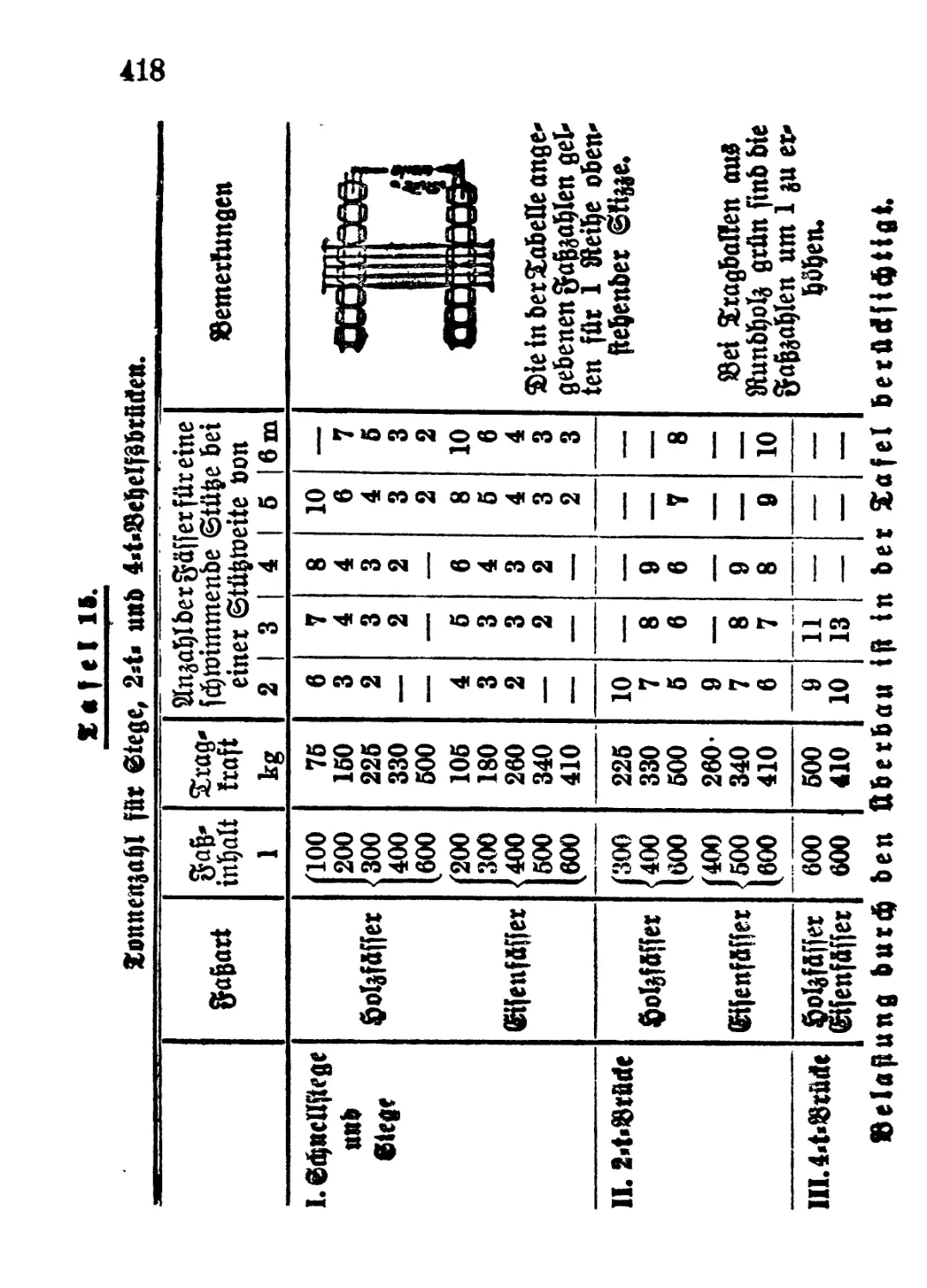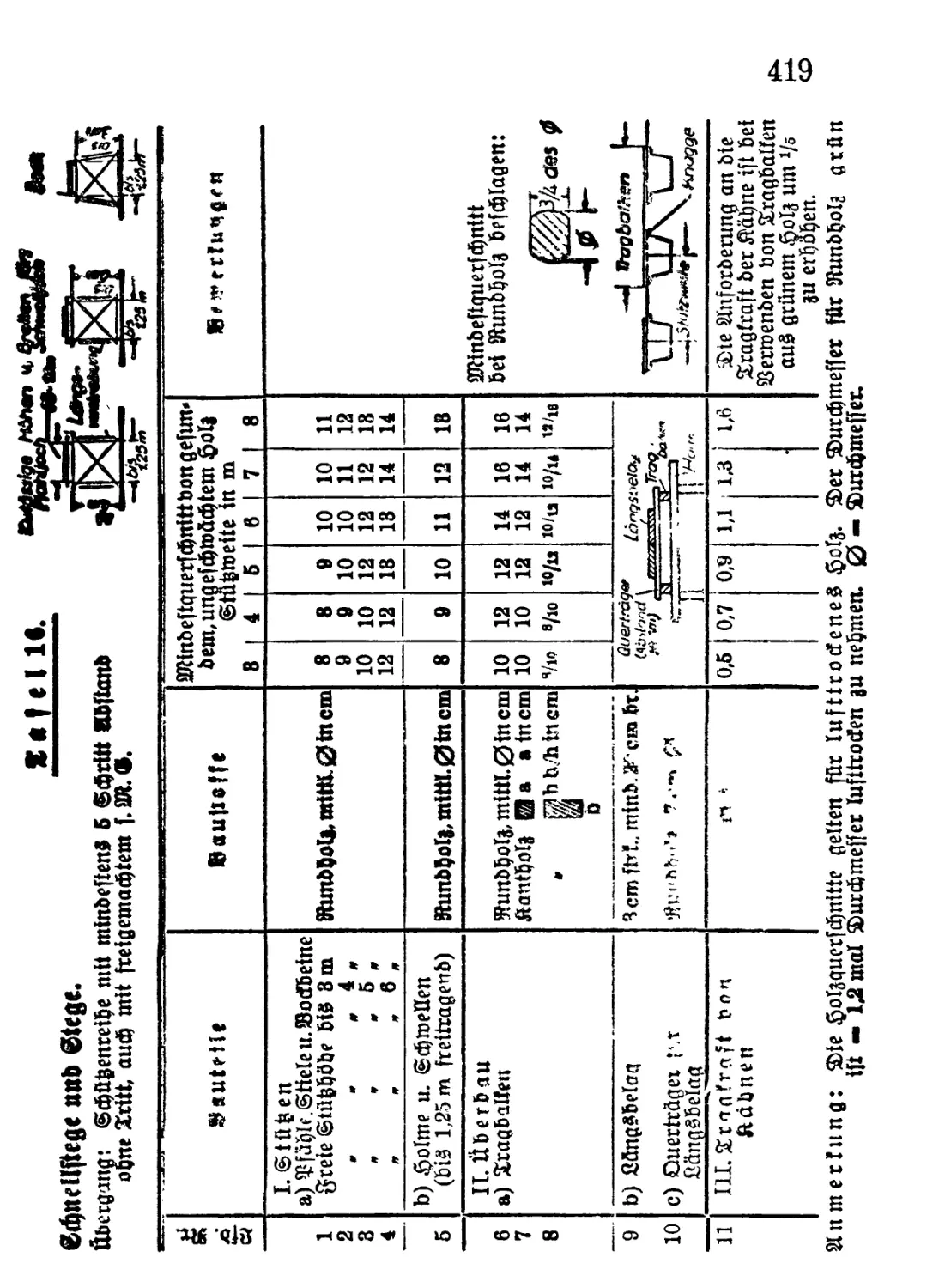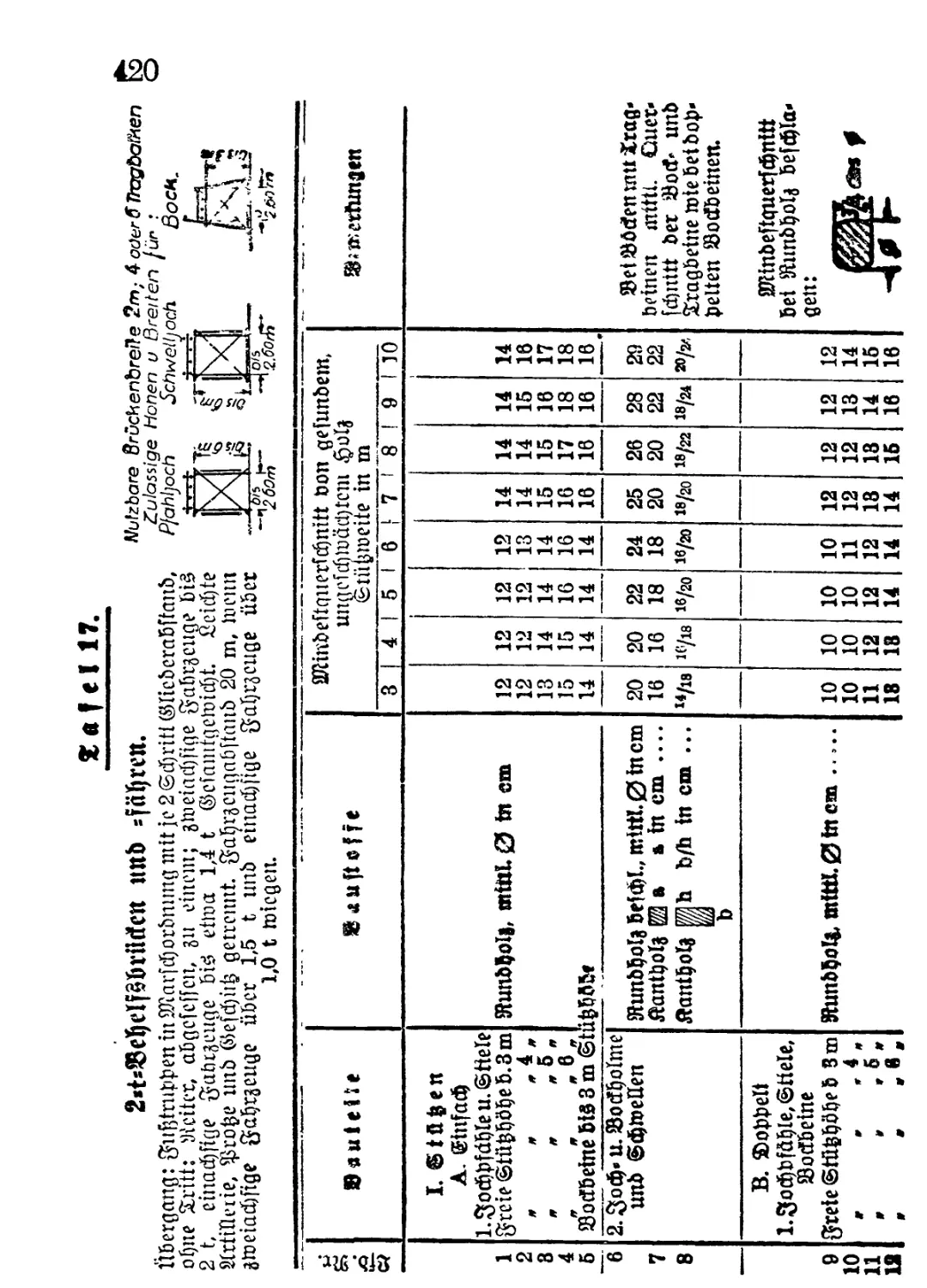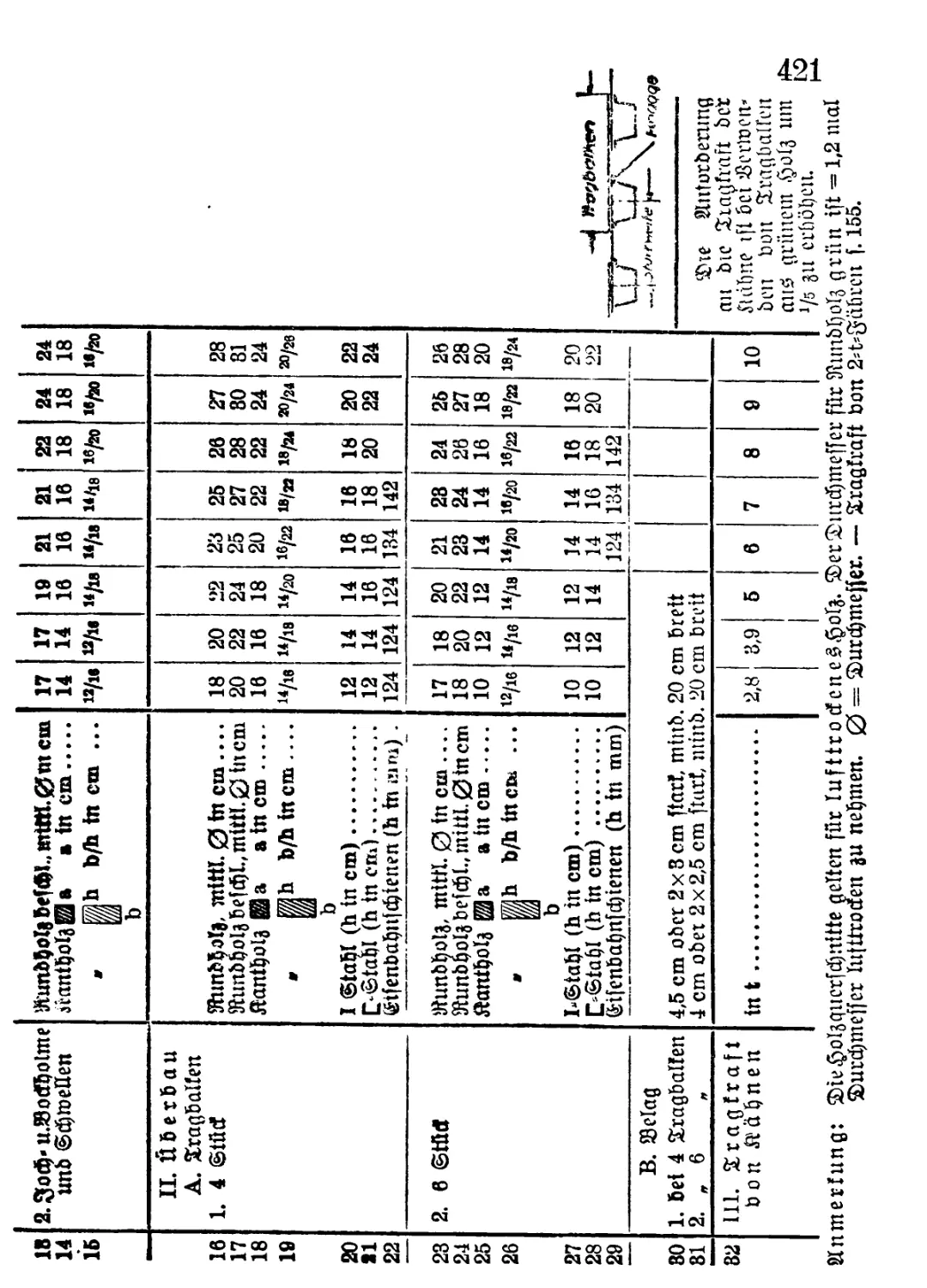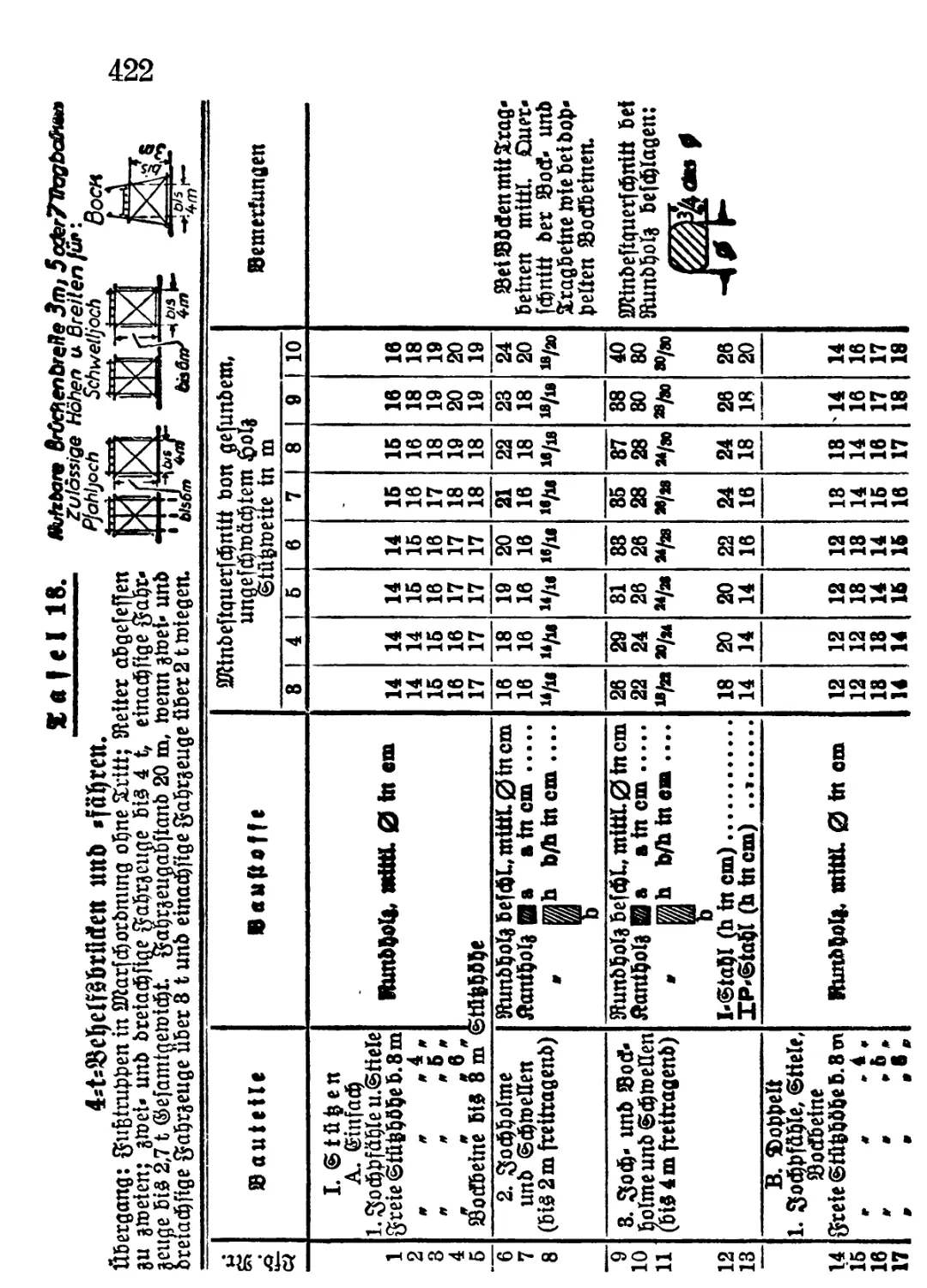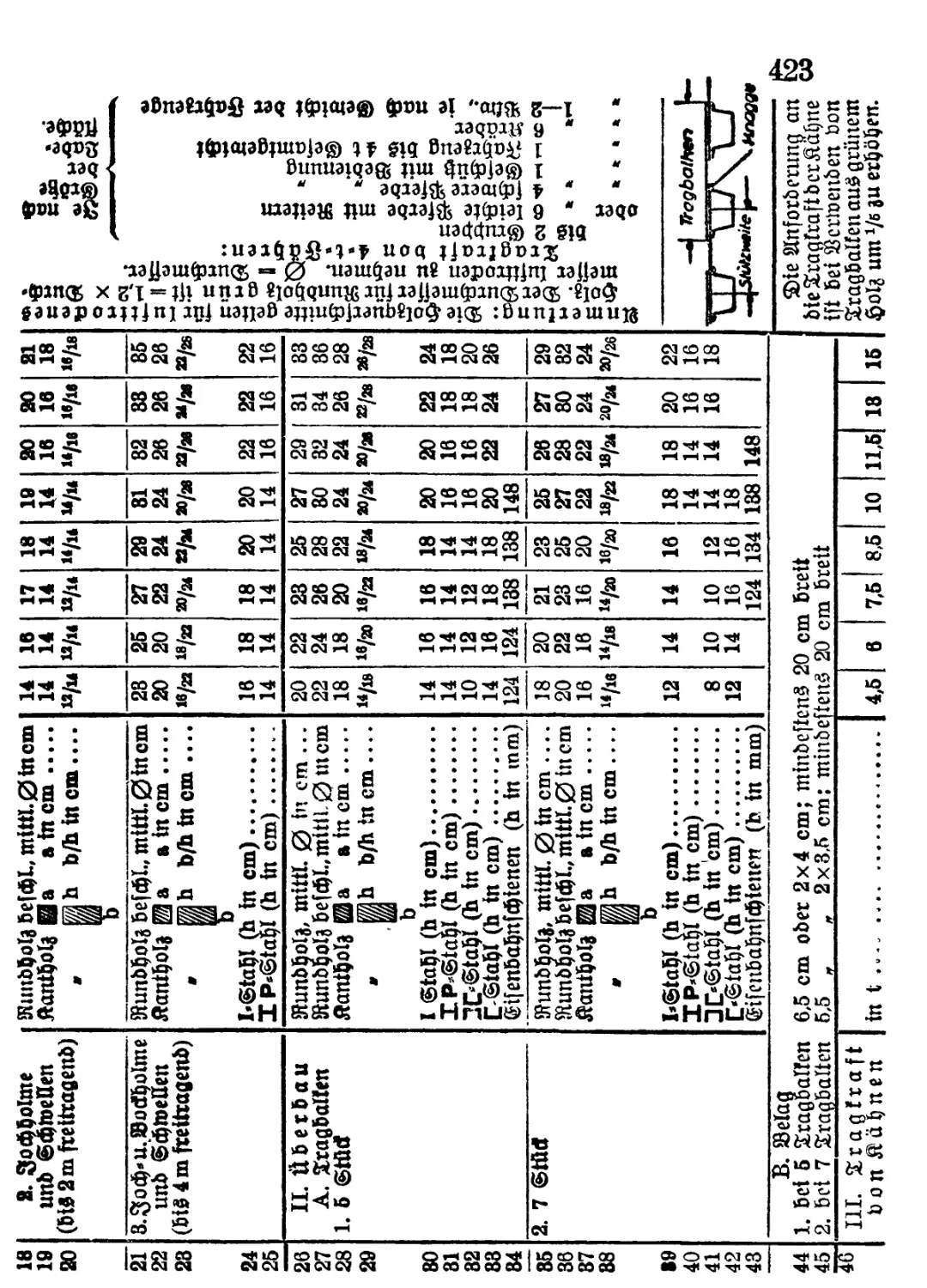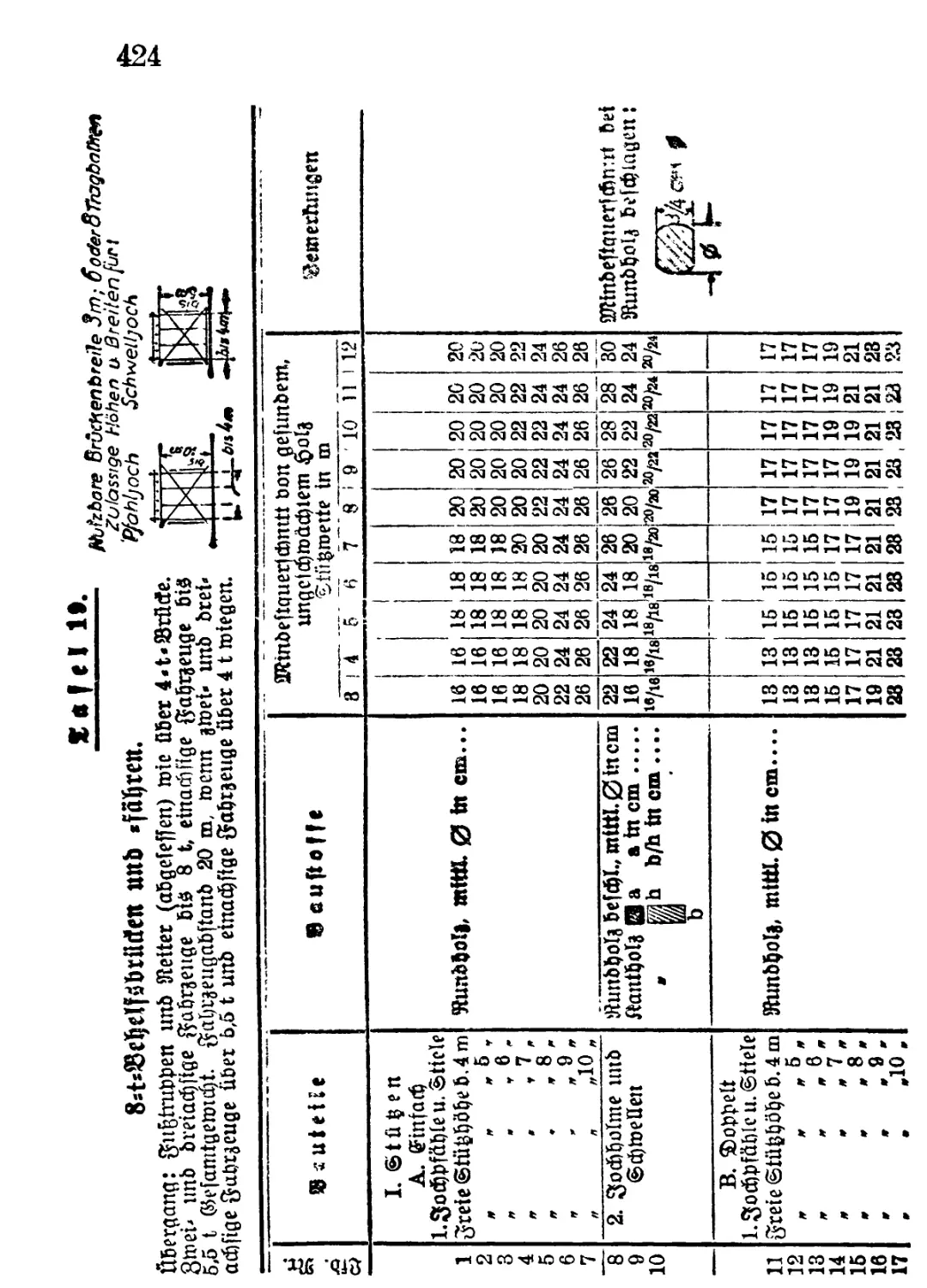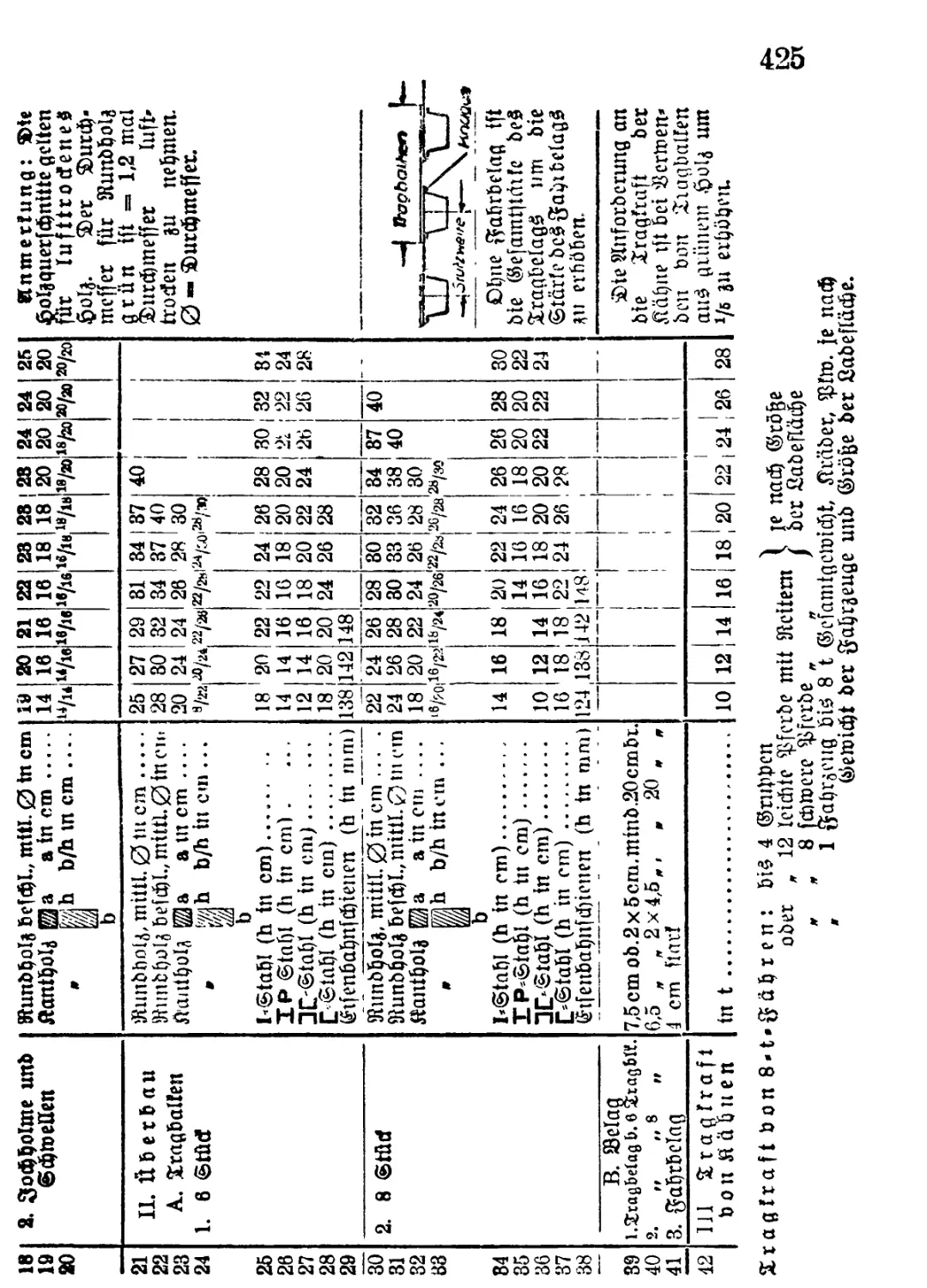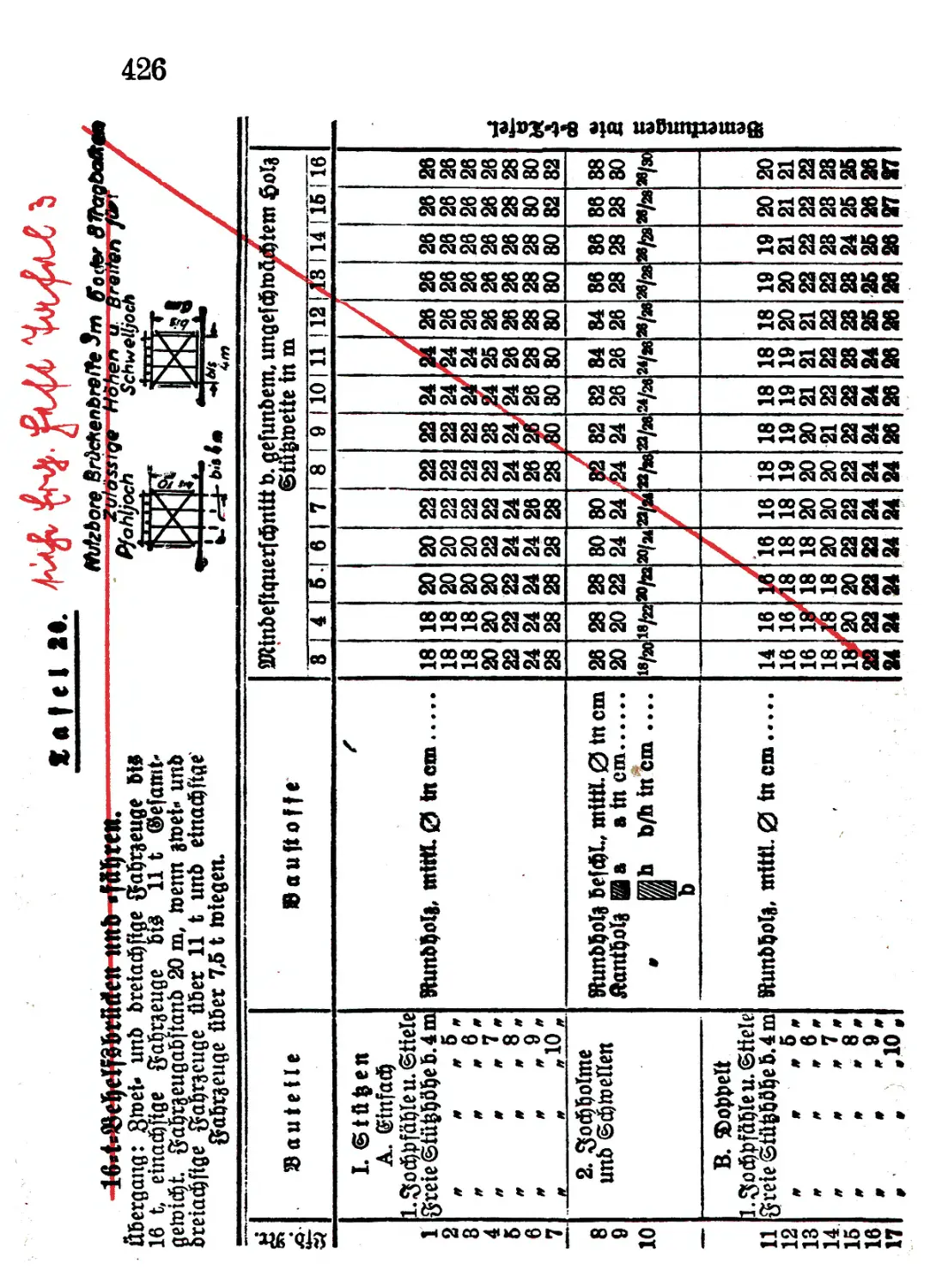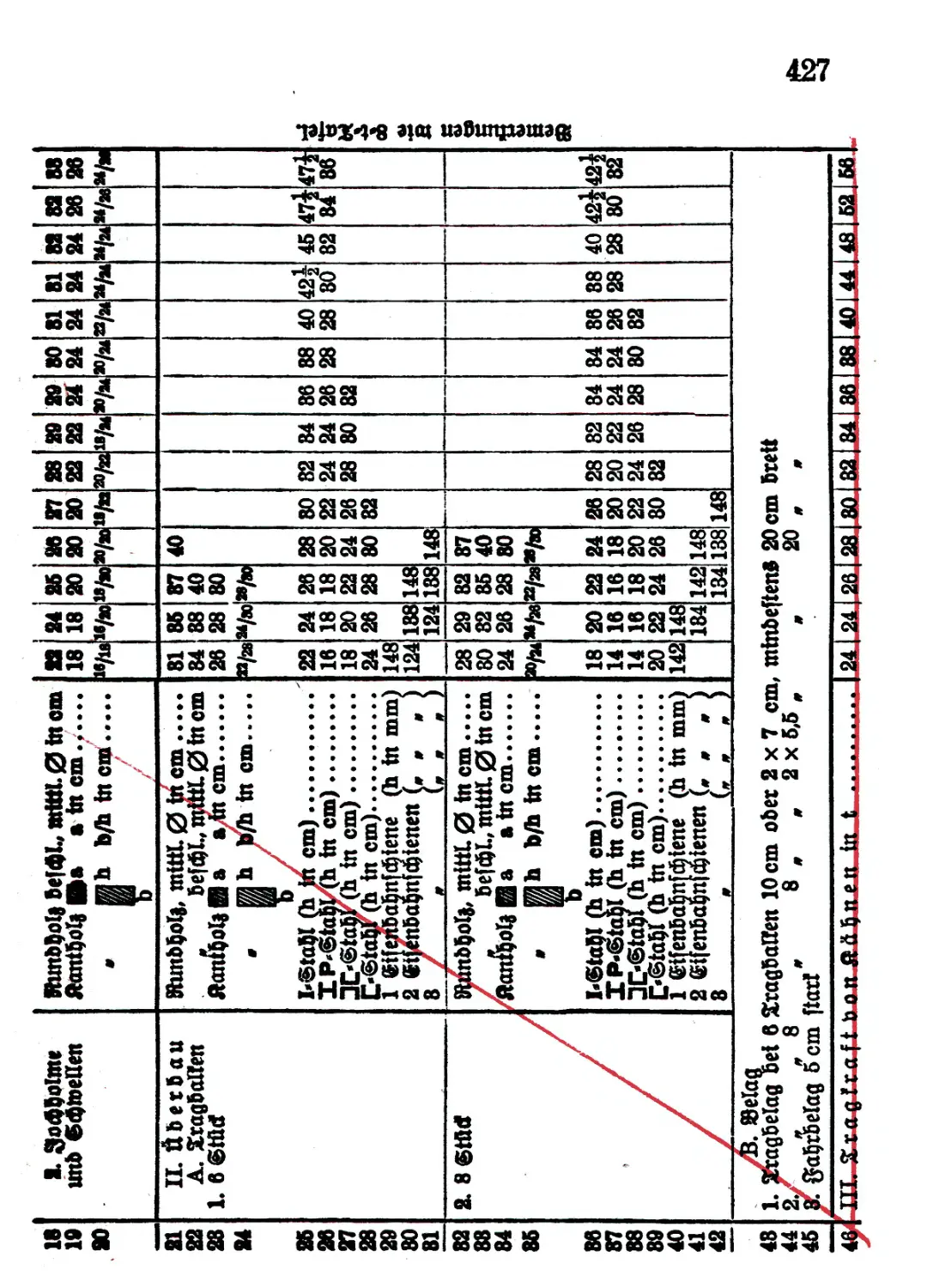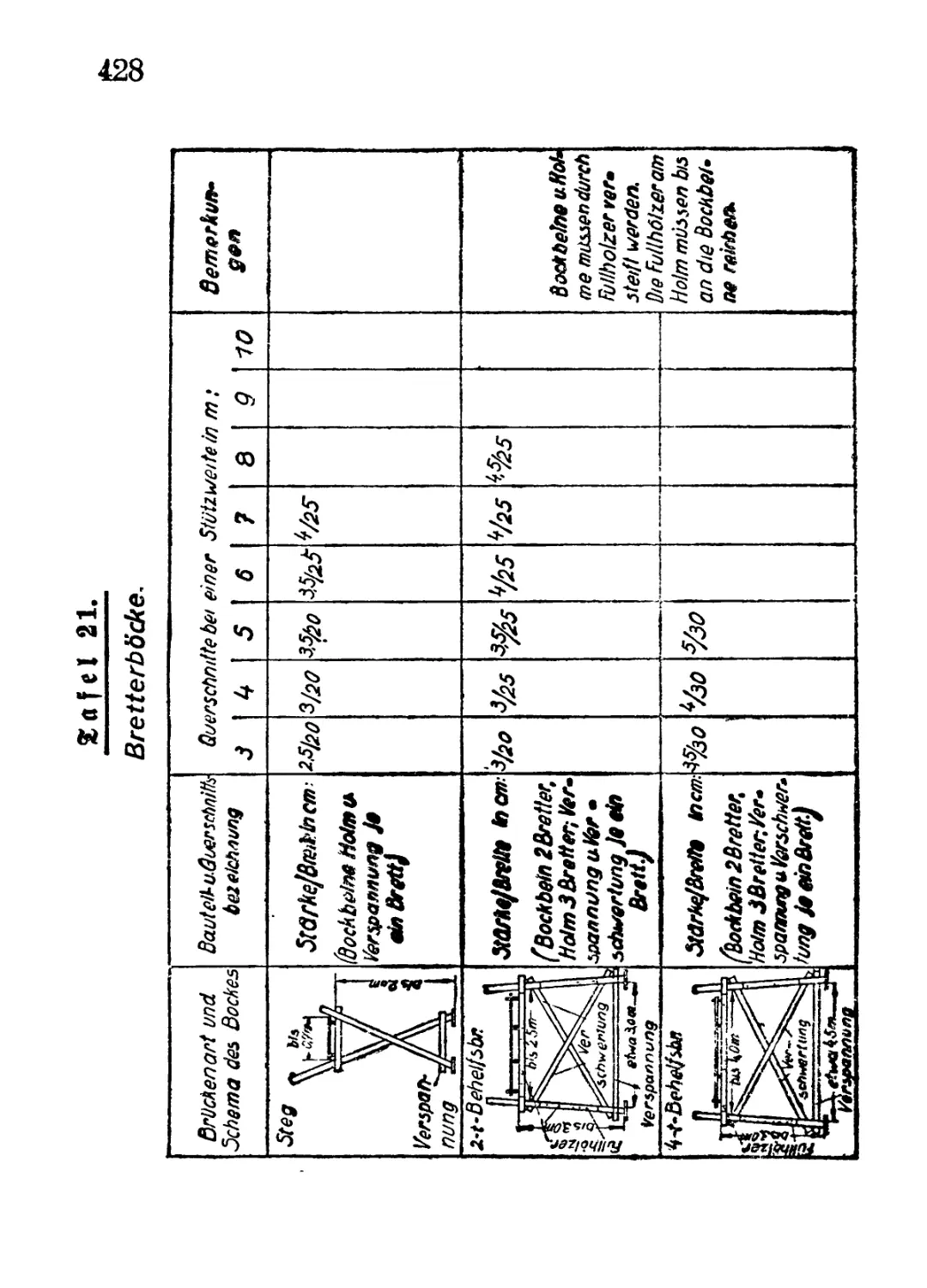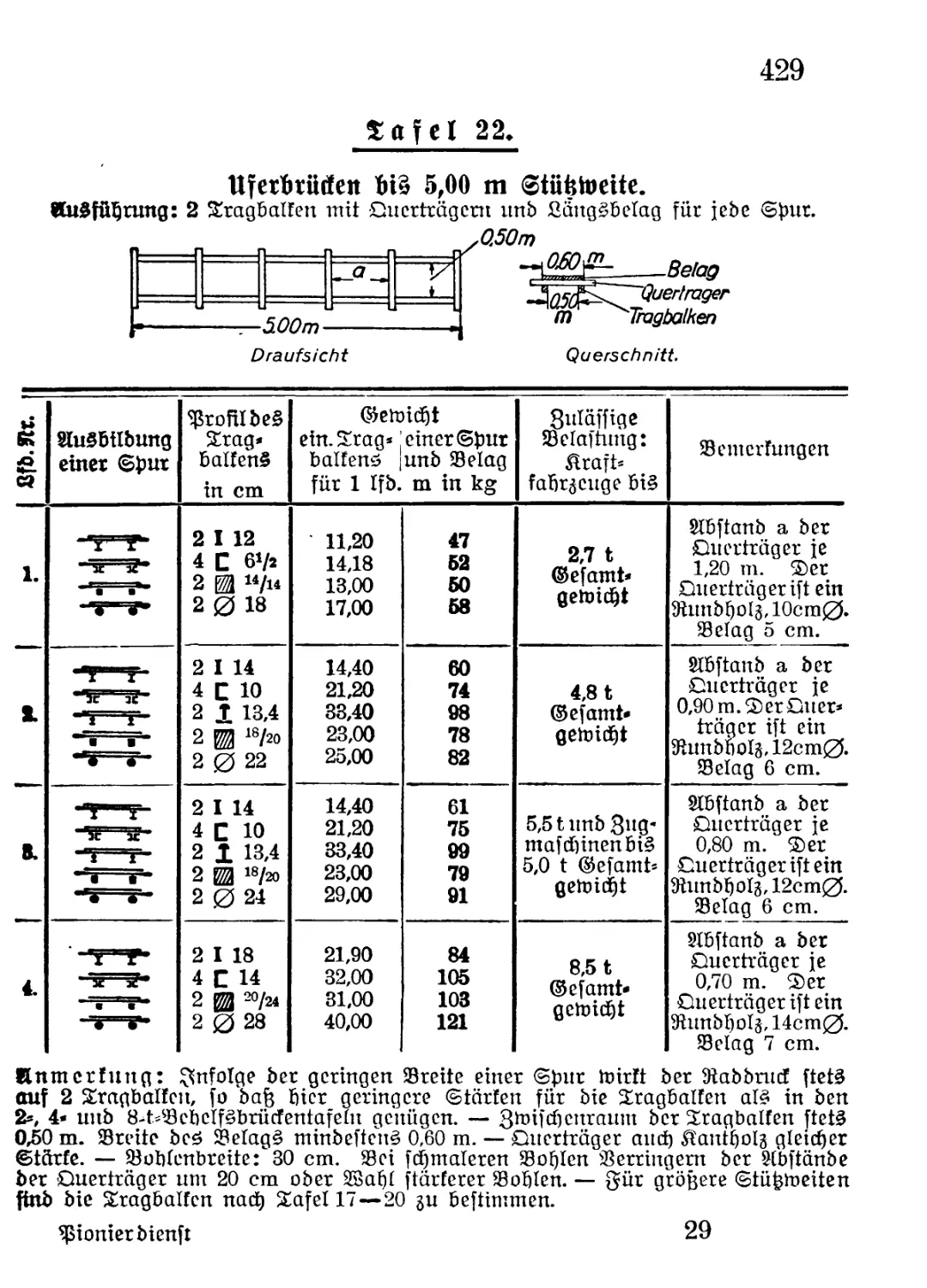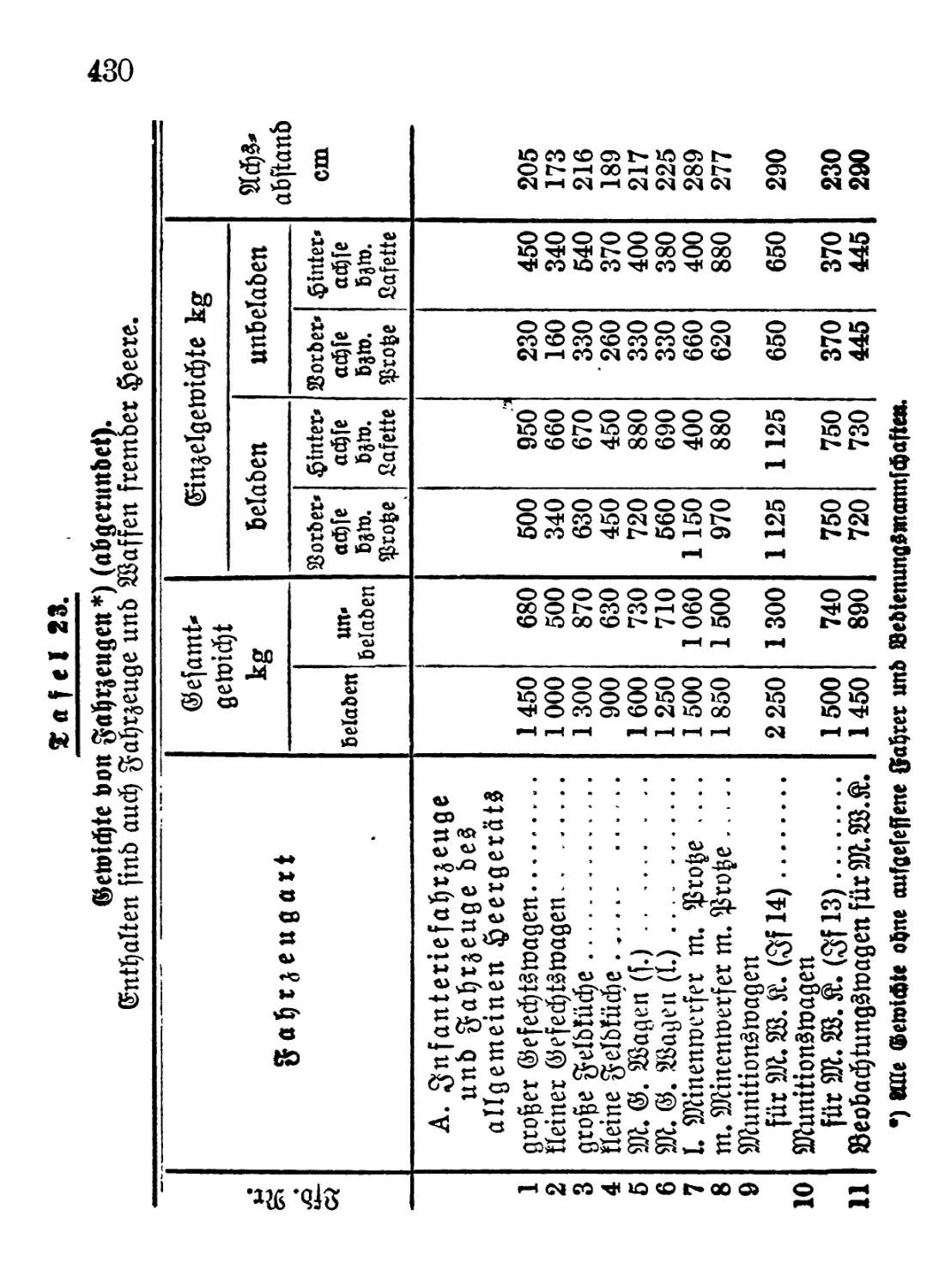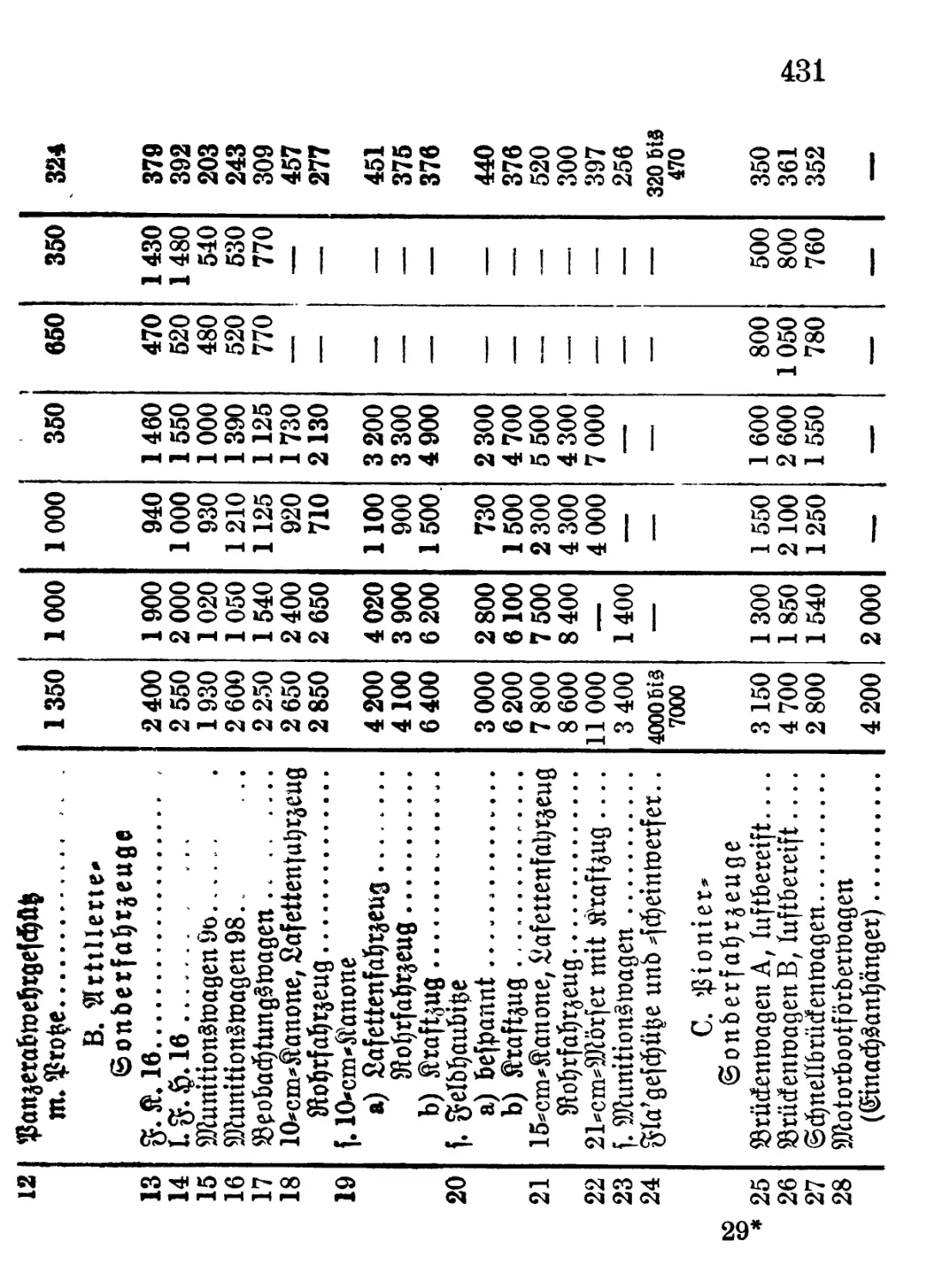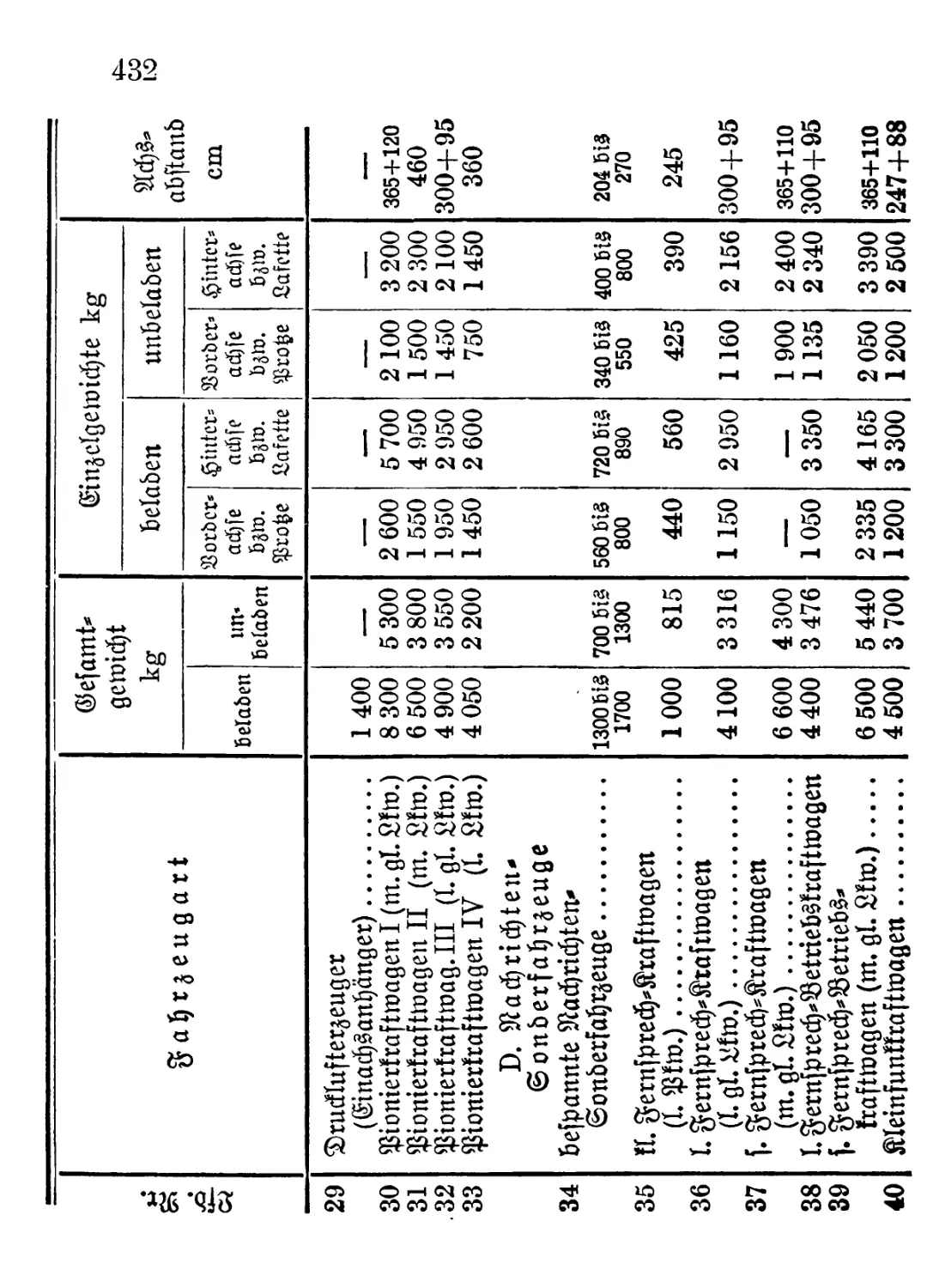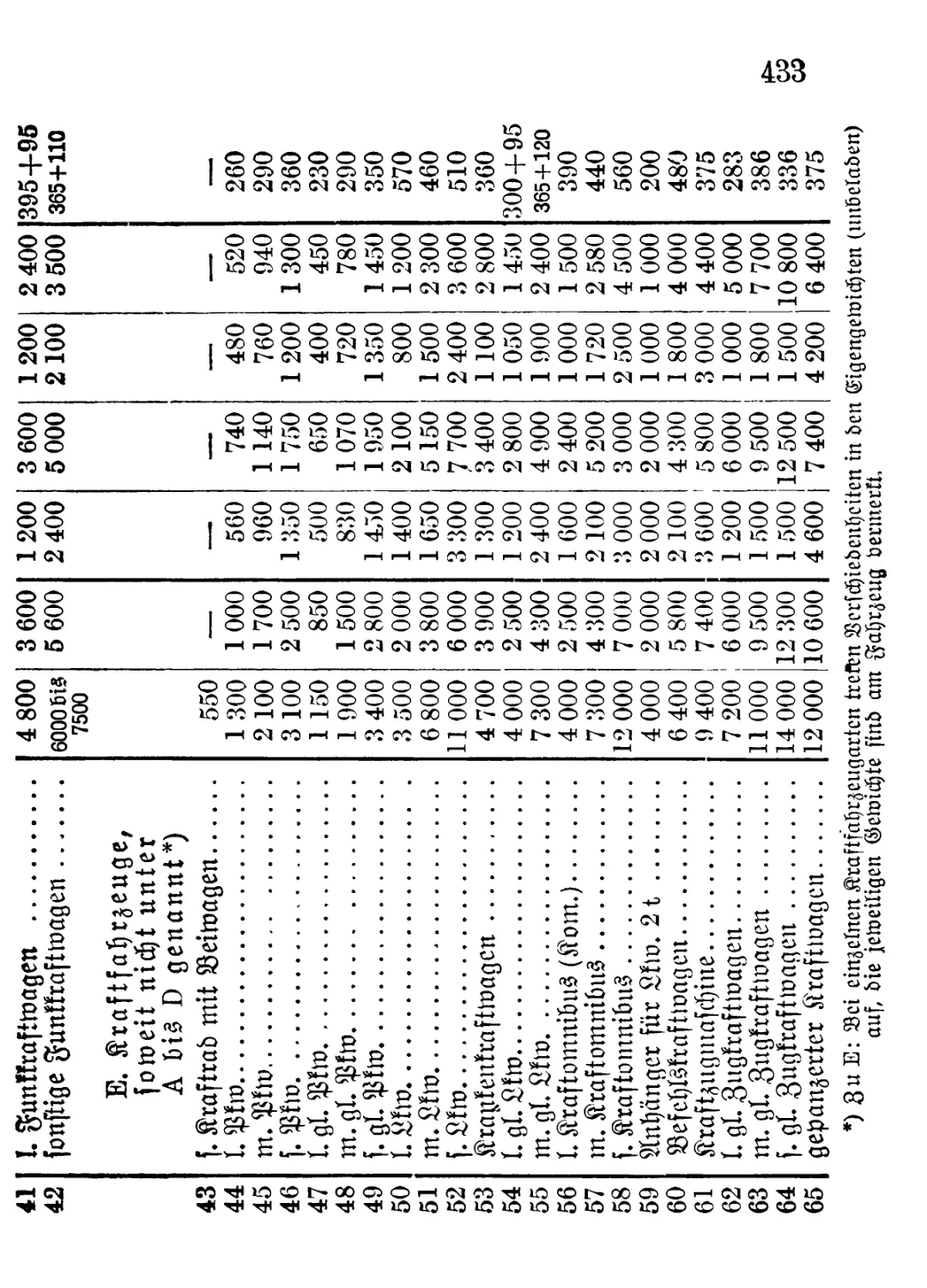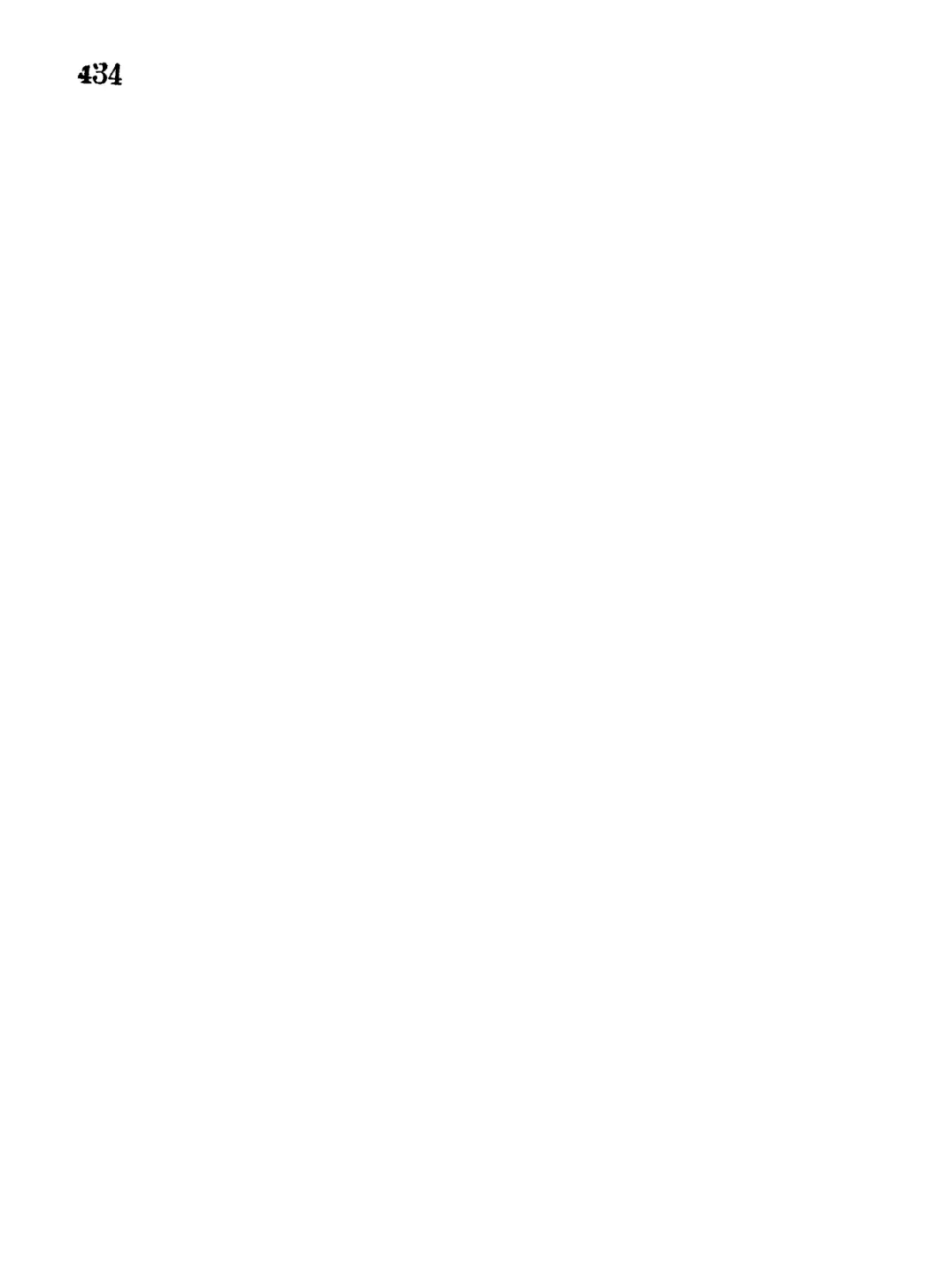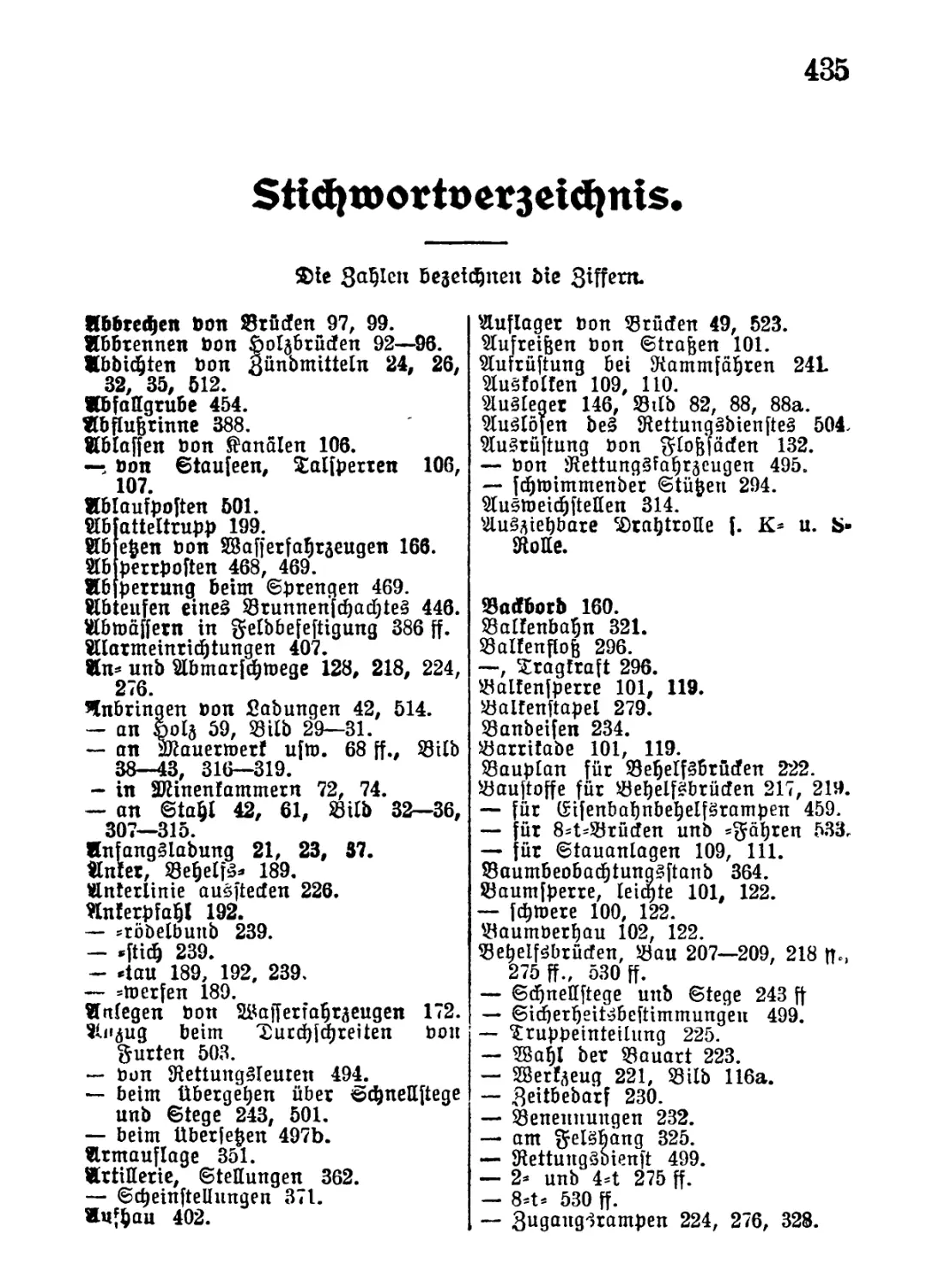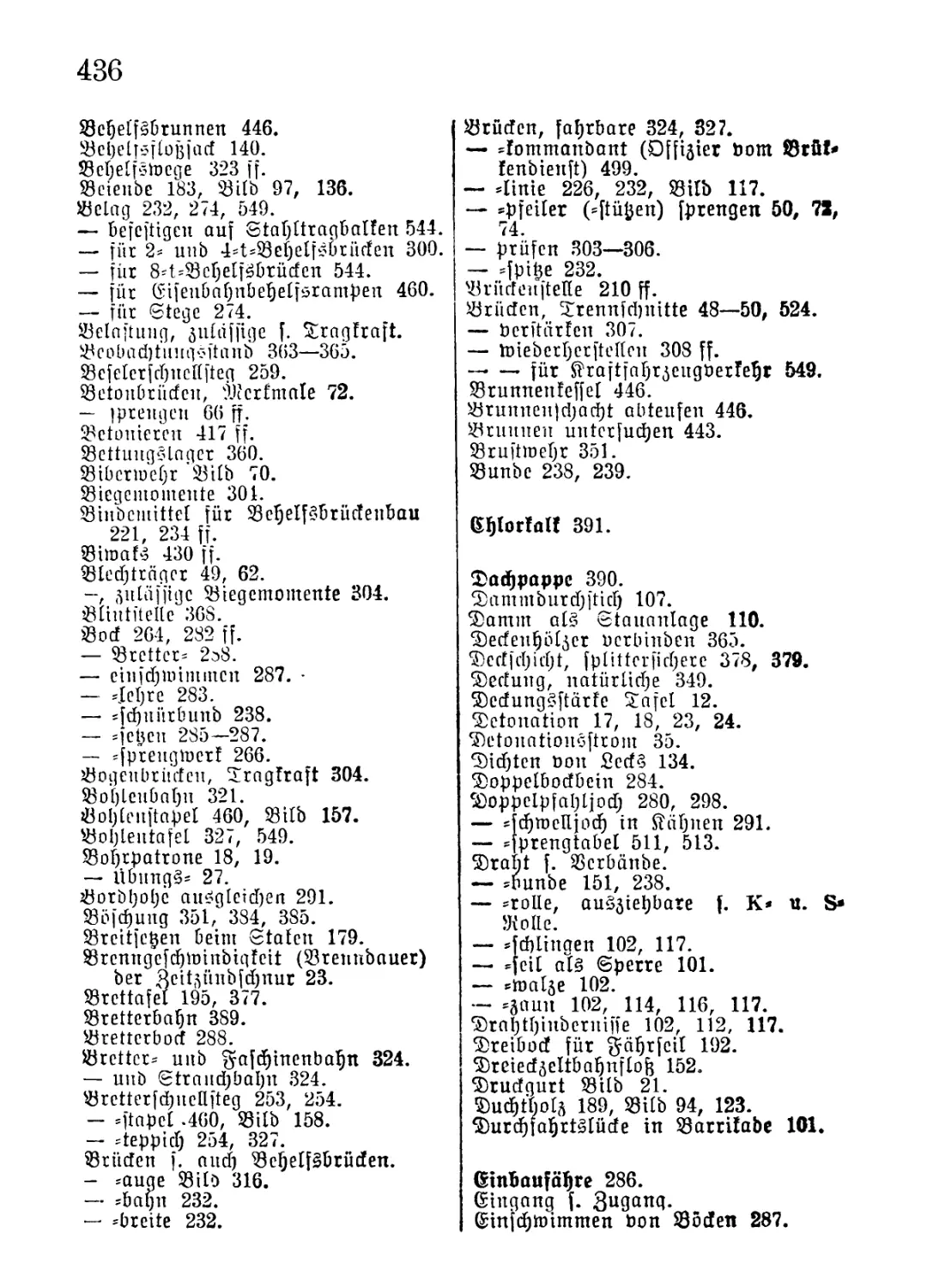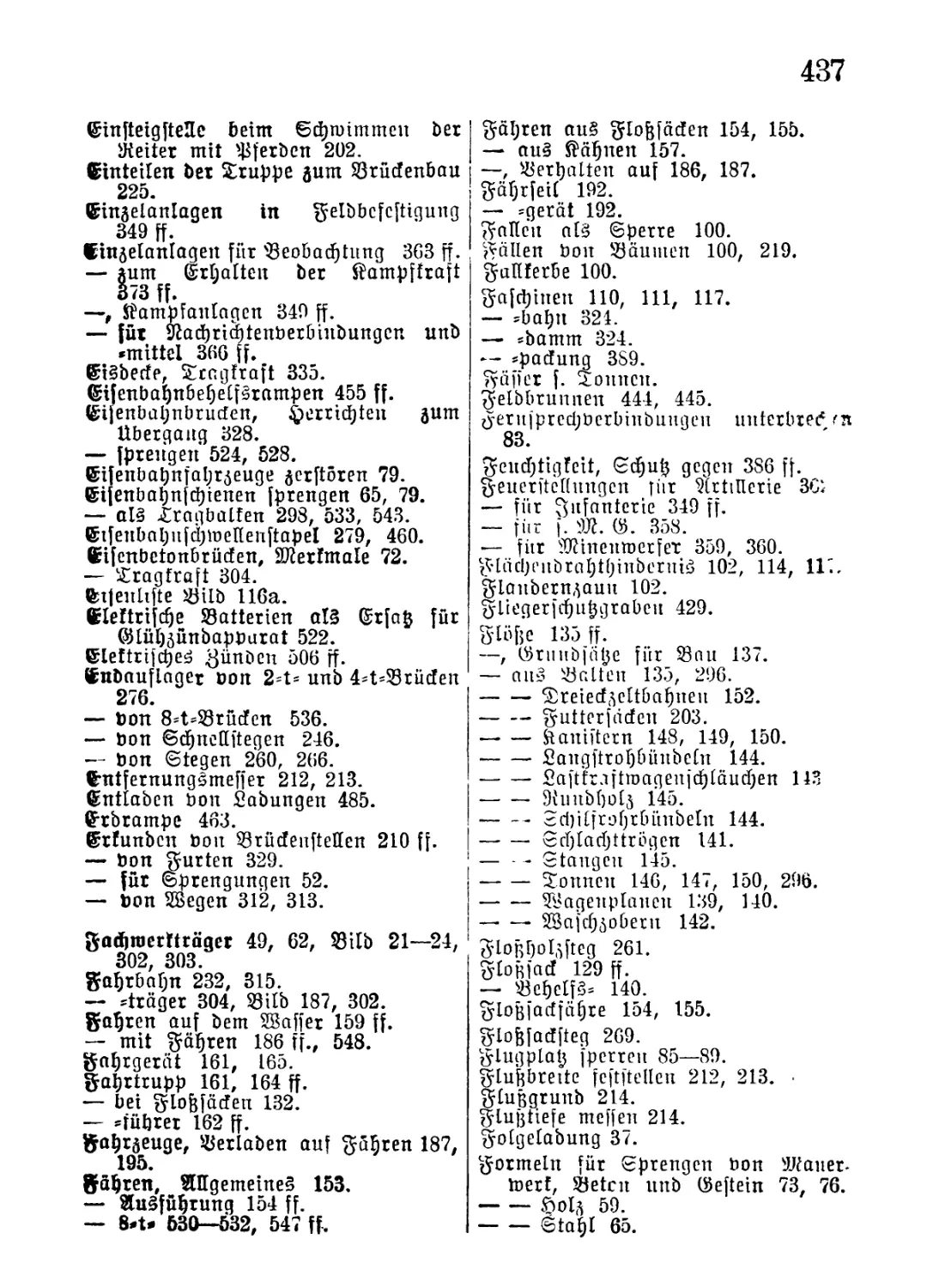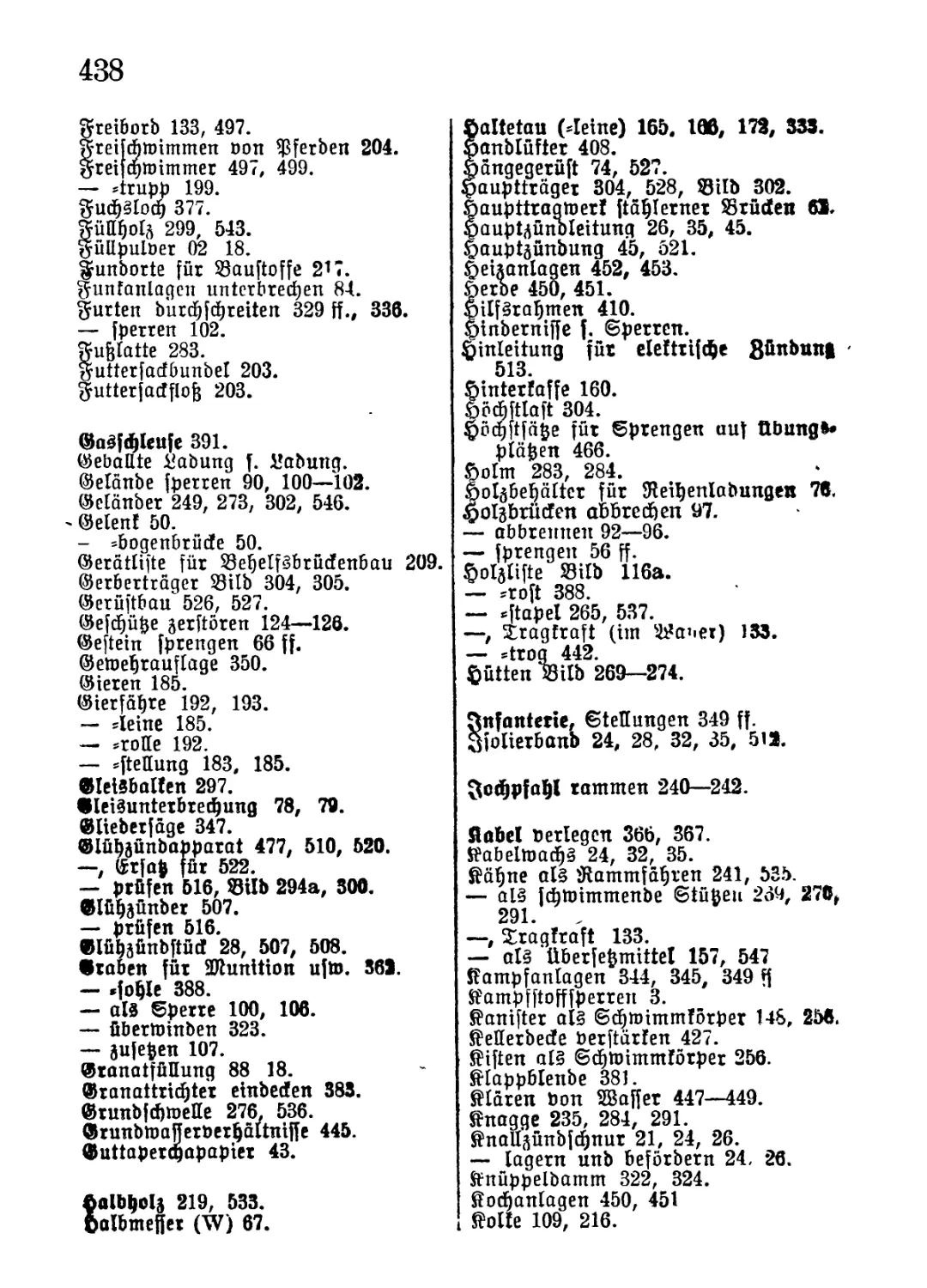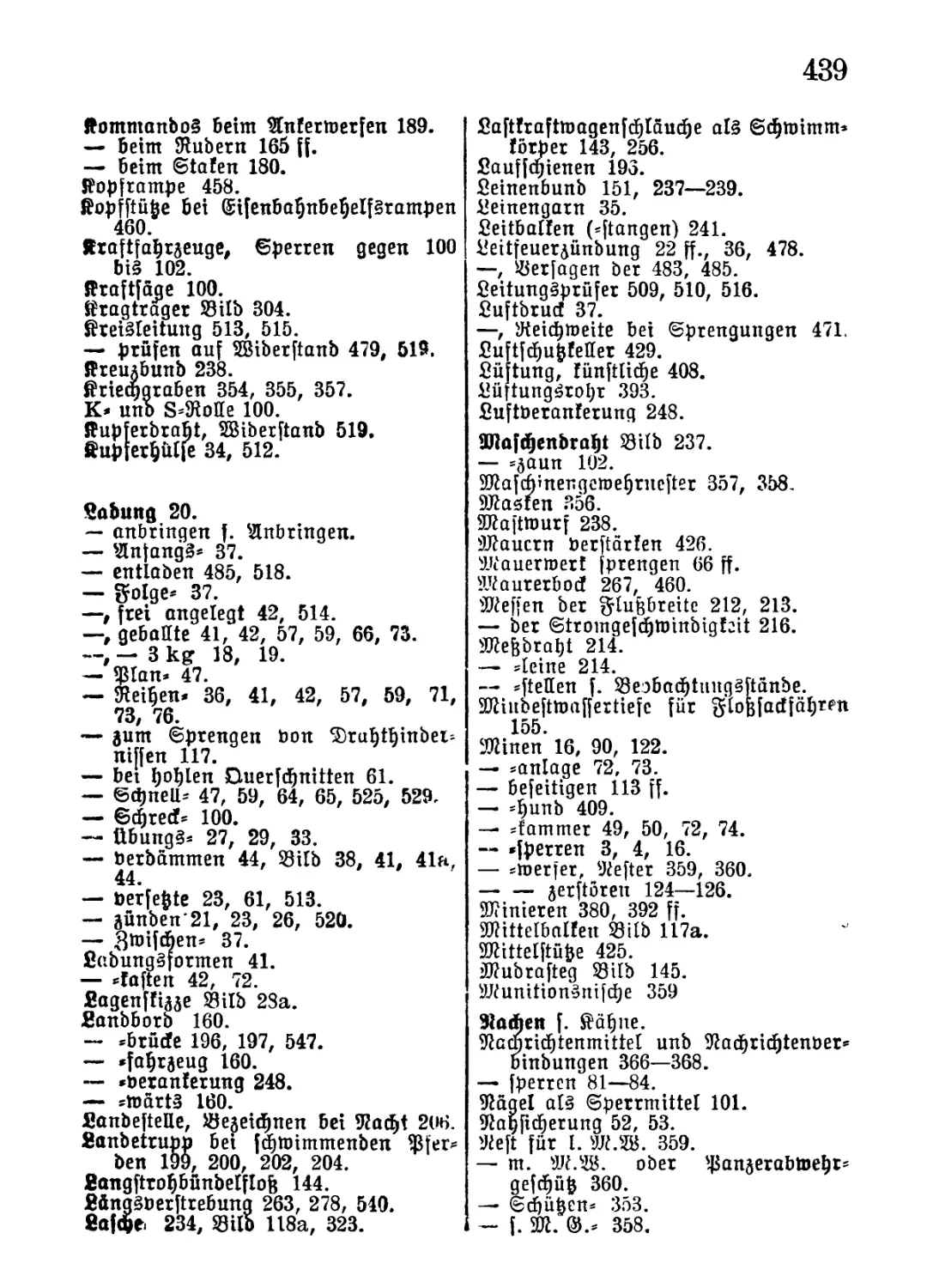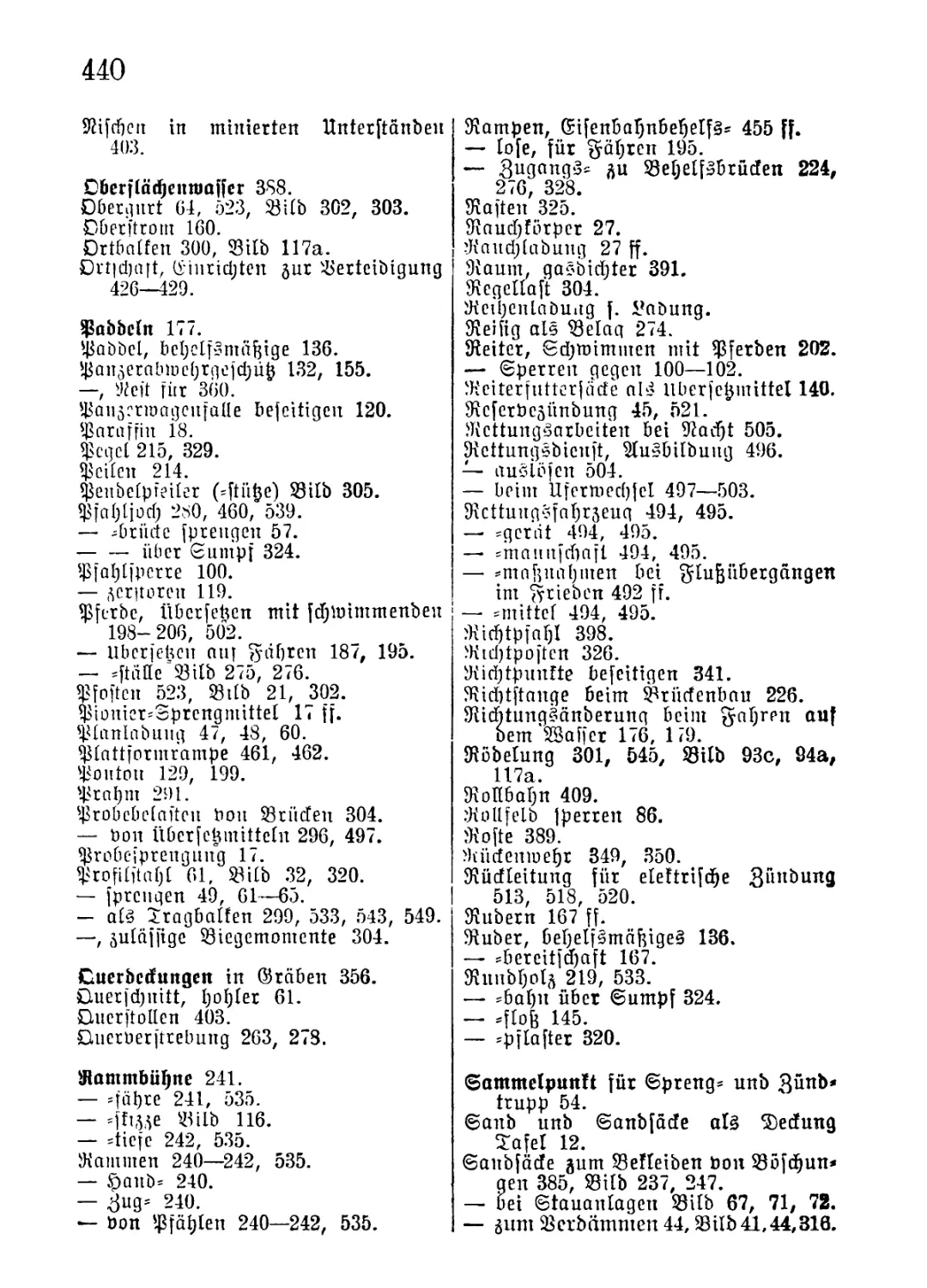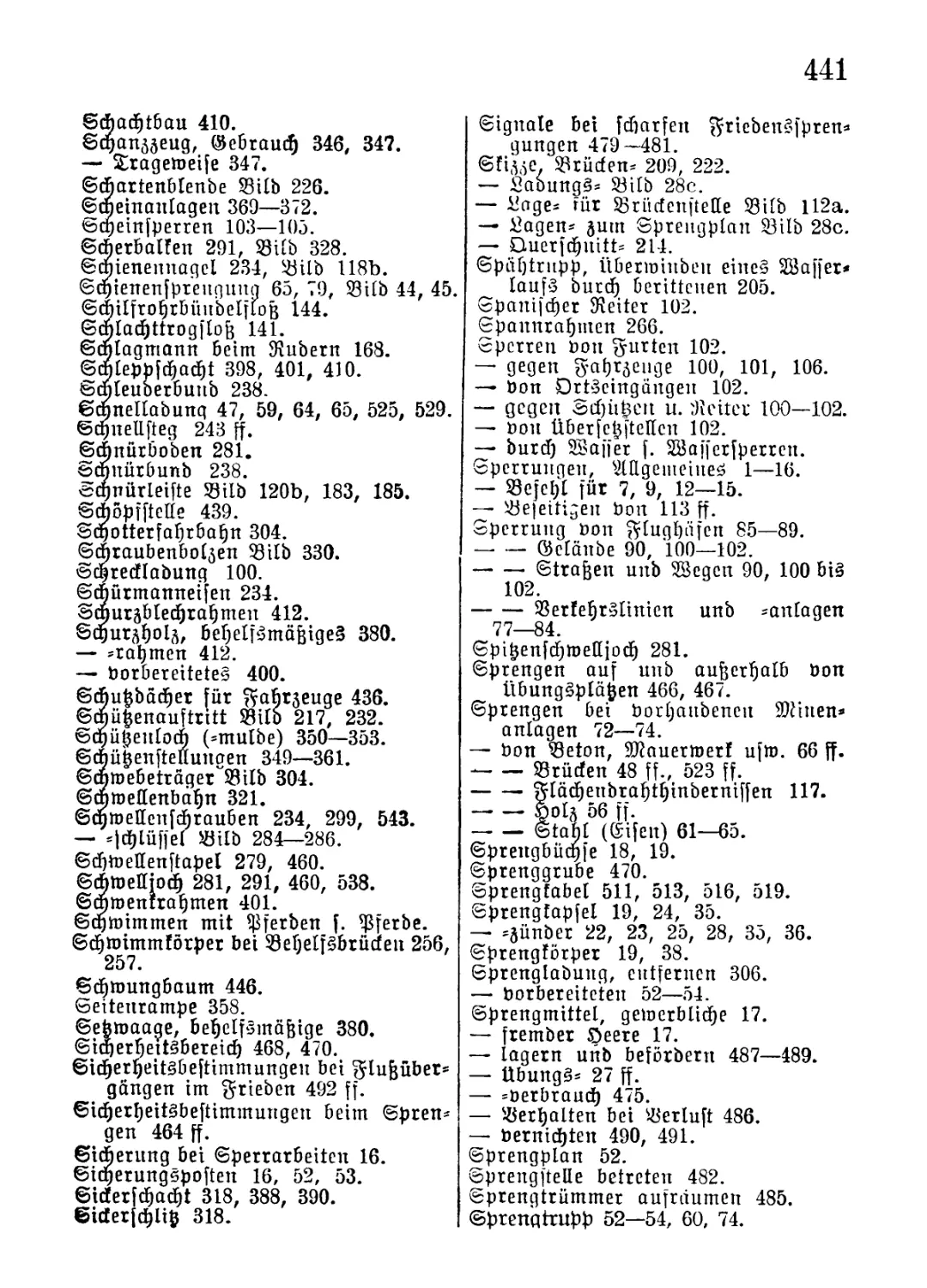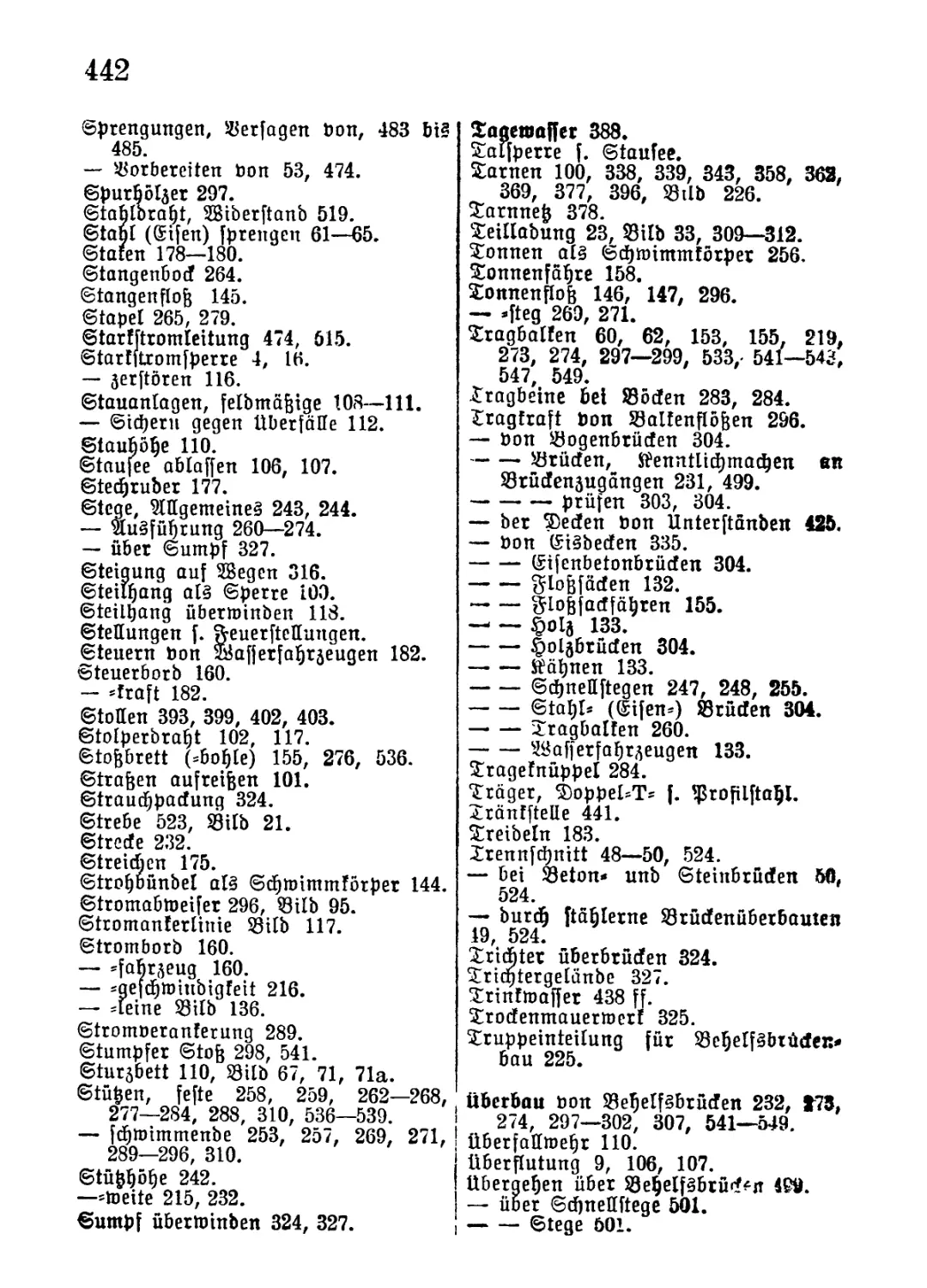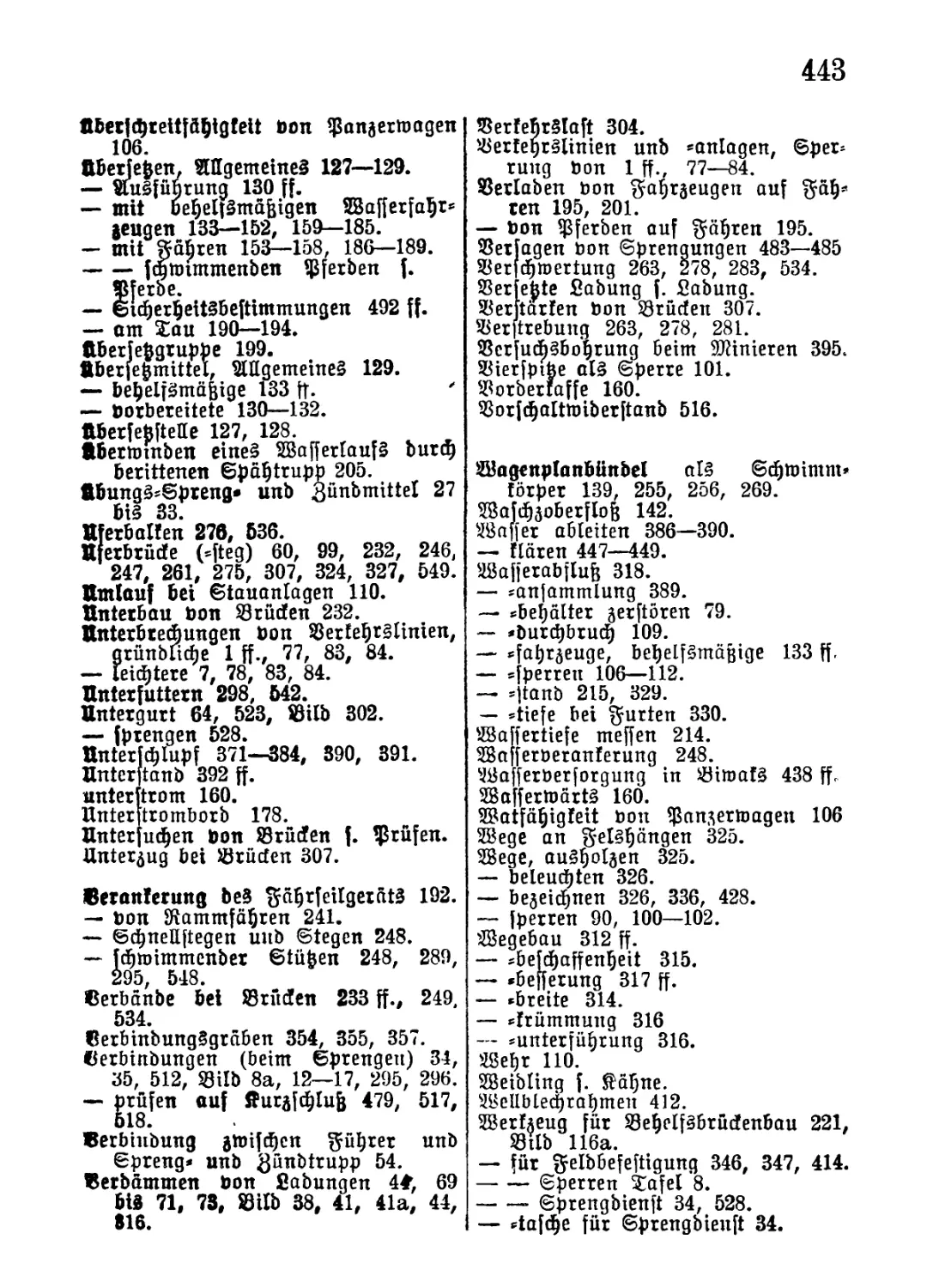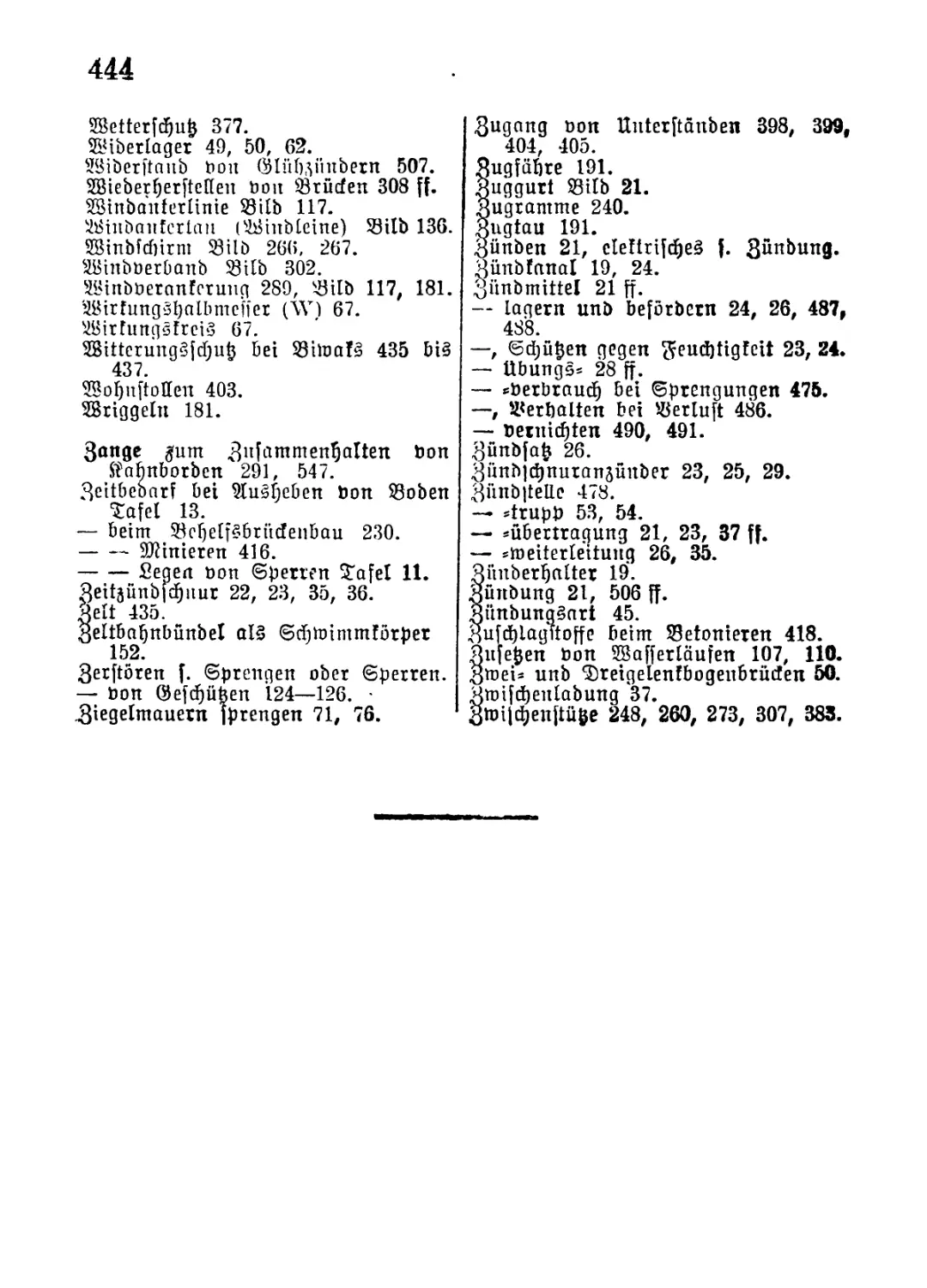Теги: waffen
Год: 1936
Текст
EL »v. 316
^ionierbienft
aller QBaffen
('2111. tJM. ®.)
vom 11.2.1935
gte
'vmLiäI-Y’
9^<#t>rncf 1936
®te ©ecfblätter 1—19 ffnt> eingearteftet
QSerlaq (£. &. SDtittler & (5©&n / Berlin
H.Dv.316
^ionierbfenft
aller Qöaffen
(2UL <£<♦©♦)
vom 11.2.1935
9Ud)btttce 1936
Sie ©ecfblätter 1—19 finb eingearbeifet
23erlag €. S. SERittler & 6o^n / Q3erli»
Ctpft Stetfrleb unb 9tt$bruta«t
93e?[tn 698868, Äocbftrafce 66-71
Set einzelnen Sperrarten ift ba§ 53 er»
menben Don dj e m i f e n ®ampf ft offen a 13
Sperrmittel für ben fjall erioaljnt, bafj
i>on fremben ©eeren entgegen bem 53 öl»
terredjt unb trofc be§ ®enfer 5ßrototoII§
über 53 e r b o t b e § @a§triege§ Dom 17. 6. 25
berartige SKafjnaljnien getroffen toer»
ben. Um foldje Sperren befeitigen ju
tönnen, ift bie Kenntnis ber Sertoen»
bung djemifdjer ©ampfftoffe al§ Sperr«
mittel nötig.
1‘
ayrill94L
De&blatt Ur. 20
gut H. Dv. 316.
pionierbtenft aller Waffen
(SU. Pi. D.).
(3H§ Seite IV in bie BL Dv. 316 bot bem Snbalt^beräeicbniS emReben.)
t)ie SBeridjtigungen finb gemäfe 53orbemerl. 7 ber H. Dv. 1 a (53 er»
ijeidjntg b er planrnäfetgen®>eere§»t)mdtoorf griffen) au^ufüljren.
Überfidjt ber SXnberungen gemäfc ©rganjimg^^eft gur H.Dv.316.
Ergänzungen Anbetungen 9leu
H. Dv. 316 @r» gängungS- Ijeft ftatt H. Dv. 316 ®r» gängungs»
Biffer Siffer 8iffer gtffer
100 h 1 324 lefcter 5lbf. 12 täfel 4
121 11 327 b 14,15,16 täfel 5
124 2 335—336 23—33
131 3 362 35—38
155 4, 5 426—428 40—48
247 6 439 55
274 7, 8, 9,10 440-441 58
327 a 13 443 57
327 17,18,19, 445 53
20, 21 446 legier 2I6f. 54
328 22 447—448 52, 60
349 34 449 56
425 39 täfel 11a täfel 1
438 49, 50, 51 täfel 20 täfel 3
442 59
486 61
499 62
505 63
täfel 12 täfel 2
2)ie borftebenb aufgefüljrten giftern ber H. Dv. 316 finb mit ent»
fbrerfjenben ßintoeifen gu berfeben (3. SB. bei Siffer „100 h" fefce „fiebe autf)
rgä 113ungöbeft ßiffer 1").
5nljaItsDer3eid}nis.
Gelte
3npalta>eraei$nio............................V—IX
W Übungen......................................... X
ttorbemertung................................... 1—11
I. Spctruttgen............................12—107
A. ßwerf unb Elu^fiiljrung von Sperrungen . 12
B. Sprengen von dritten.................... 16
1. Pionier* Spreng* unb 3ünbmittel . . 16
Sprengmittel, günben unb 3ünb^
mittel............................ 16
üb ung§* Spreng* unb 3ü^mtttel . 26
ESerbinbungen, Einbringen ber Seit*
’ feuer^ünbung, 3ünbübertragung 28
SabungSformen, Einfertigen unb Ein*
bringen bon Sabungen, ESerbäm*
men, E£al)l ber 3ünbung3art . . 36
Sßlanlabungen, Sdjnellabungen . . 39
2« ^rennfdjnitte................. 40
3. (Srlunben, Sprengpläne........ 46
4. Sprengen bon §ol^ unb bon ^ol^brütfen 52
5. Sprengen bon Staljl ((Sifen) unb ESrücten
mit ftäijlernem (eifernem) Überbau . . 56
6« Sprengen bon Eftauertoerl, E3eton unb
©eftein unb bon ESrütfen au3 biefcn
ESauftoffen.......................... 60
C Sperrung bon $erlel)r§ltnien unb Anlagen
unb bon ^lug^äfcn.................... 69
VI
©eite
D. Sperrung von Straßen, SScgen unb $e=
länbe nljne ^ionier=Sprengmittel .... 73
1. Sperrung burd) gerftören Von
Brüden unb Von Brüden mit ftählernem
(eifernem) Überbau................. 74
2. Sperren gegen gepanzerte Kampf fahr*
Zeuge unb gelänbegängige Kraftfapr*
^ge................................... 76
3. Sperren gegen nicht gelänbegängige
Kraftfahrzeuge unb pferbebefpannte
Fahrzeuge........................... 83
4. Sperren gegen Sdjüßen unb Leiter . 89
E. Sdjeiufperren...................... 96
F. SBaffer als Sperrmittel............ 97
G. SBefeitigen Von Sperrungen......... 103
H. gerftören bon $efdjüpen unb Wltnenwerfem 106
II. Überfeinen..............................107—157
A. überfepfteUcn..................... 107
B. überfepmittel...................... 108
1. gloßfäde........................ 108
2. behelfsmäßige Sföafferfahrzeuge ... 111
3. gähren.......................... 124
C. fahren auf bem SÖaffer............. 131
1. gaßren im (ginzelfahrzeug....... 132
2. gahren mit gähren............... 140
D. überfepen am £au................... 142
E. Stampen unb gaubbriitfen........... 146
F. überfepen mit fdjtoimmenben ^ßferben . . 148
III. Sebelfsbrüdenbau........................ 157—240
A. MgcmeincS............................ 157
B. (grtunben, Söaljl ber SrurfenftcHe unb @in=
leiten beS SBaueS........................ 159
VII
©eite
C. 2)et Bau.............................. 175
1. Benennungen........................... 175
2. Berbänbe.............................. 176
3. Stammen Von 3od)pfäljlen.............. 181
4. Schnellftege unb Stege................ 186
5. 24> unb 4*t*B eh elf rüden......... 212
D. prüfen, Berftärlen unb QJÖieberljerftellett von
Brütfcn unb Brürfentetlen................. 231
IV. ?öegebau,Überwinbenvonöumpf*
unb £rt$ier gel änbe, ^errichten
oott (Suf enbapnb rüden, 9urdp
febreiten nun gurten, über
f cp r e i t e n nun S i s b e cf e n.......... 241—25»
A. 253 ege bau........................... 241
B. ftbctttJtnben von Sumpf» unb Xridjter*
geliinbe burdj Srfjüpen unb leicpte ^cn^er-
ttjagen................................... 252
C. Jperricfjten von ^ifenbabnbruefen jum Über-
gang...................................... 254
D. 2)urd)f(preiten von gurten............... 255
E. ftbcrfrfjrettcn von (giäbetfcn........... 257
V. gelbb ef efitgung.......................... 258—307
A. (öritnbfäfce............................. 258
B. Sdjan^euggebraud)........................ 260
C. (SHnjelanlagen........................... 261
!♦ Stampfanlagen.......................... 261
Stellungen für Infanterie......... 261
Stellungen für Artillerie......... 273
Anlagen für Beobachtung........... 275
Anlagen für Nachrichtenverbinbungen
unb Nachrichtenmittel............. 280
Scheinanlagen........................ 280
2. Anlagen jum Erhalten ber Stampftraft 282
Unterfcfjlupf e........................... 282
Betleiben von Böfchungen.......... 289
Schub gegen geuchtigleit.......... 290
Schuj gegen ®a§...................... 293
SNinierte Unterftänbe................ 294
Betonieren........................... 302
VIII
©eite
D. (£tnrirf)ten bon Drf fünften jur Serteibi-
gung................................. 305
VI. Sitvafs unb Sager.................. 307—319
A. OgemeincS ♦..................... 307
B. Stauten......................... 308
1. Magen jum «Sdjufc gegen Witterung 308
2. Magen jur Sßajferberforgung .... 313
3. Magen für ^odjen unb Jpeijen . . . 318
4. Magen für Slbfallftoffe....... 319
VII. S i f e n b a b n b e b e l f *4? a m p e n . . . 319—326
VIII. 6t$erI)eUfibefHmmungen. . . . 326—343
A. (SitberbcitSbcftimmungcn für SJeriucnben
tum ^ionicr=Sprcng= unb Bünbmitteln im
grteben unb im Kriege...................... 326
1. MgemeineS............................. 326
2. (Sprengungen.......................... 329
3. befördern unb Sagern bon Pionier*
(Spreng* unb Qünbmitteln.......... 333
4. Starnicbten bon Pionier* (Spreng* unb
günbmitteln......................... 334
B. FettungSmafmabmen unb (Sidjerbcits*
beftimmungen bei Jylu^übcrgnngen im
grieben.................................... 334
1. Allgemeines........................... 334
2. Fettungsmittel........................ 335
3. AuSbilbung für ben FettungSbienft. . 337
4. (SidjertjeitSbeftimmungen unb (Sinja &
beS FettungSbienfteS beim Ufertoecpfel 337
5. AuSlöfen beS FettungSbienfteS .... 342
IX. 3ufa^ für bie £ruppenpioniere
ber Kavallerie unb Kraftfabt«
tatnpf truppen............................... 343—388
IX
Seite
A. Sprengen Von Srütfen............... 343
1. (Sleftrifdje günbrnittel unb Qünbgeräte 343
2. Söeifpiele für Sprengen ftätjlerner
(eiferner) 58rücfenüberbauten........ 355
3. 23eifpiele für Sprengen bon Brüden
au§ Sftauerroert ober 23eton......... 371
B. ftberfepen von 8=t=£aften unb S8au bon
8=t^rü(fcn................................. 378
Cafe In 1—23 ..................................... 389-433
BHcbwofinevaetcpnid............................... 435—443
©
r“ r* <
Ö3(y)£§
i©
mt .......... = Sftetertonne.
9#bori). .... = fcotfyanbene SBiegemomente«
2ß..........= Mittlerer l®Mferjtanb.
XI
W .................................. = Sföirlungäljalbmeffer.
3................................... = 8ünber.
B&Ö................................. = Bünbung.
8bf(f)n.?lna...........= 3ünbfd)nuranaünber.
ZL.................................. = Btoifdjentabung.
8t BWn...............................= Beitaünbfdjnur.
I65 ................. = ^oppe^T^tatyl (Präger),
55 cm tjotf).
IP30 . = 53reitftanjd)iger doppel *T*
(Staljl (Präger), 30 cm Ijüd).
X18’18 ............................. = S8reitflanfd)iger doppel*
(Präger) mit geneig*
ten inneren glanfdjflädjen,
18 cm ljod).
c ................................. =
Dorbemerftung.
I. Die SSorfdjrift umfaßt ben ^ßionietbienß aller
tBaffen.
II. 63 finb au33itbilben*):
a) gnfanterie:
1. 211 le nadj:
Seil I (Sperrungen):
2lbfcßnitt D (Sperrung bon Straßen, Jßegen
unb Selänbe otjne $ionier»Sprengmittel),
2lbfcßnitt E (Sdjeinfperren),
2Ibfcf)nitt G (23efeitigen bon Sperrungen).
Teil II (Überfeinen):
162 u. 163 (2? er galten mäßrenb be§ über»
feijen§ im ©injelfaßrjeug),
186 u. 187 (SSertjalten ioägrenb be3 Uber»
feßen3 mit gäljren).
Teil IV:
2lbfdjnitt A 312—317 (®rtunben bon SBegen),
2lbfd)nitt B 327 a (liberiüinben bon Sumpf»
unb Tridjtergelänbe burd) Sdjüßen),
2lbf$nitt D (Durdjfcßreiten bon gurten),
2lbf<f>nitt E (überfdjreiten bon ©iSbeden).
Teil V (gelbbefeftigung):
2lbf(f)nitt A (Srunbfäße),
2lbfdjnitt B (Scßan^euggebraudß),
2lbfd)nitt C (Sinjelanlagen)
349—361 (Stellungen für Infanterie),
369—391 (Scheinanlagen, Unterfcßlupfe, 29e»
lleiben bon 23öfd;ungen, Sdjuß gegen geucß»
tigteit unb Sa§),
2lbftf)nitt D (Sinricßten bon örtfcljaften jur
SJerteibigung).
*) ®er ®rab ber 9Iu3bilbung ift in ben ^ugbilbung^üorfdjriften ber
eingelnen SSaffen ($eft 1) feftgetegt.
2
Seil VI (©imat§ unb Sager).
Seil VIII (SidjerljeitSbeftimmungen):
Slbfdjnitt B (SRettung§maf;na|men unb Silber»
fjettSbeftimmungen bei glufcübergängen im
Stieben)
497 b (©erhalten unb SInjug beim überfe|en
mit ©inselfa^rgeugen unb gäljren),
499, 5. Wbfatj u. folgenbe Siffern (©erhalten
beim Übergang über 2»t» bi§ 8=t«©rüden),
501 (©erhalten unb ülnjug beim Übergang
über (SdjneUftege unb Stege),
504 (SluSlöfen be§ 9lettung§bienfte§).
1. 3 e Bataillon 3 ® r u p p e n a l § 3 n fa n le'
riepioniere aujjetbem nacf):
Seil I (Sperrungen):
Qlbfdjnitt B (Sprengen bon ©rüden),
ülbj^nitt C (Sperrung bon ©ertegrSlinien
unb »anlagen unb bon glugljäfen).
Seil II (Ü5erfe|en):
2lbfct)nitt A (S8a|l ber überfe|fteKen),
StbfcEjnitt B (Über f ermittel),
Slbfcpnitt C (Satiren auf bem SBaffer),
Slbfdjnitt D (Überfeinen am Sau),
9lbfd)nitt E (SRampen unb Sanbbrüden).
Seil III (©eljelfSbrüdenbau).
Seil IV:
Wbfdjnitt A (SBegebau).
Seil VII (®ifenba|nbe|elf§rampen).
Seil VIII:
Slbfdjnitt A (Sidjerfjeitäbeftimmungen für ©er«
wenben bon Spreng» unb günbmitteln im
Stieben unb im Kriege [offne elettrifcfje
Sünbung]),
2lbfc|nitt B (9lettung§mafjnat)men unb Sidjer»
IjeitSbeftimmungen bei Sluffübergangen im
Srieben).
8
b) RauaOetie:
1. Sille
Bei Steiterfdhinabron nadj:
Seil I (Sperrungen) ohne
Slbfdjnitt B 2—6 (Sprengen bon 33rü<fen),
Slbfdhnitt F (Sßaffer al§ Sperrmittel).
Seil II (überfeinen):
Slbfcßnitt A (2Bat)I ber überfeßftellen),
Slbfcpnitt B (überfeßmittel)
129—152 föloftfäde, behelfsmäßige Sßaffer»
fahrjeuge),
Slbfcßnitt G (fahren auf bem SBaffer)
162 u. 163 (Verhalten njäfjrenb be§ überfeinen?
im ©injelfahräeug),
186 u. 187 (Verhalten mäijrenb be? über»
feßen? mit gäßren),
Slbfannitt F (überfeinen mit fcfjnntnmenben
$ferben).
Seil IV:
Slbfcßnitt A (Sßegebau)
312—317 (Srfunben bon SBegen),
Slbfdjnitt B (übertoinben bon Sumpf» unb
Sridjtergelänbe burd) Stfjüßen),
W6f(f)nitt D (®ur(f)f(f)reiten oon gurten),
SIbfdjnitt E (Überfeinheiten bon SiSberfen).
Seil V (gelbbefeftigung):
Slbfqnnitt A (örunbfäße),
Slbfdhnitt B (Scljan^euggebramf)),
Wbfciinitt O (Sinjelanlagen)
349—361 (Stellungen für 3nfanterie)z
369—391 (Scheinanlagen, Unterfcfnlupfe, 93e»
tieiben bon SBöfifnungen, Schuß gegen fjeud)»
tigteit unb Sa§),
?lbfa(nitt D (Gnnridnten bon örtfehaften jur
SBerteibigung).
4
toäljrenb be3 über»
mit fdjnrimmenben
SBegen),
Seil VI (SBitoatä unb Sager).
Seil VIII (SidjergeitSbeftimmungen).
8 e i WL ©. »Söjtoabron naty:
Seil I (Sperrungen):
Sübftfjnitt D (Sperrung bon Straften, SBegen
unb Selanbe oljne $ionier=Sprengmittel),
?lbfdgnitt E (Scgeinfperren),
Slbfcfjnitt G (Sefeitigen bon Sperrungen).
Seil II (überfegen):
162 u. 163 (Vergalten toüljrenb be§ ttberfegenl
im ©injelfaljräeug),
186 u. 187 (Vergalten
fegen§ mit gägren),
Slbfcfjnitt F (überfegen
?ßferben).
Seil IV:
SHbfdjnitt A (Sßegebau)
312—317 (ßrtunben bon
Slbfdjnitt D (SDixrdpfdjreiten bon gurten),
Slbfdjnitt E (überfdgreiten bon ®t§beden).
Seil V (gelbbefeftigung):
Slbfdgnitt A (©runbfäge),
Slbfcftnitt B (Sdjanjjeuggebraudj),
Slbfcfjnitt C (©tnjelanlagen)
349—359 (Stellungen für Infanterie),
363—365 (Einlagen für Seobadgtung),
369—391 (Scheinanlagen, Unterfdjlupfe, 8e»
lletben bon 8öfdjungen, Sdguft gegen geucf)»
tigleit unb ®a§),
Slbfajnitt D (Sinridjten bon Drtfdjaften jur
SBerteibigung).
Seil VI (S3ti»af§ unb Sager).
Seil VHI (SidjerljeitSbeftimmungen):
Slbfdjnitt B (SRettungSmaftnaljmen unb Sidjer-
Ijeitäbeftimmungen bei gluftübergängen im
grieben).
5
Sei iRadjridjtenäug nad):
Seil I (Sperrungen):
Slbfd^nitt D (Sperrung Von Straßen, ÜBegen
unb Sefanbe offne $ionier=SprengmitteI),
Slbfdbnitt E (Sdßeinfperren),
Slbfdjnitt G (Sefeitigen bon Sperrungen).
Seil II (überfein):
162 u. 163 (SSerfjalten toälfrenb be§ Überfefjen3
im ©injelfaljräeug),
186 u. 187 (SBerfjaften tnäljrenb be§ über«
fetsenS mit galten),
2lbf(f)nitt F (überfeinen mit fcfjroimmenben
Sßferben).
Seil IV:
Slbfd^nitt A (SBegebau)
312—317 (Srtunben bon Sßegen),
Sfbfdjnitt D (Surdjfdjreiten bon gurten),
SIbfdßnitt E (überfdgreiten bon ®i§bedten).
Seil V (0felbbefeftigung):
Sfbfcfjnitt A (Srunbfäije),
Sf'bfd^nitt B (Sdßanjjjeuggebraudf)),
Slbfcgnitt C (Sinjelanlagen)
366—368 (Einlagen für 3tad^rid^tenberbinbun»
gen unb 9tad^rid()tenmittel).
Seil VI (SitoatS unb Sager).
Seil VIII (SicfjerljeitSbeftimmungen):
Slbfdfjnitt B (9tettung§maßnal)men unb Stdfjer«
peitSbeftimmungen bei fjlußübergüngen im
5'rieben).
2. ffaballeriepioniere berSteiterfcfjioa«
bron unb $?aballerie«$tonierjug nacf):
Seil I—IX o n e 392—425 (minierte Unter«
ftänbe, ^Betonieren).
^tonierbienft 2
6
c) SlrtiHerie:
l. Stile nacft:
Seil I (Sperrungen): .
Slbfcftnitt D (Sperrung bon Straften, Sßegen
unb ©elänbe oftne $ionier=Sprengmittel)
2—4 (Sperren gegen affe Srbioaffen),
SIbfdjnttt E (Scfteinfperren),
Slljfcfjnitt G (SBefeitigen bon Sperrungen),
Slbfmnitt H (ßerftören bon ©efcftüijen unb
Sffinenmerfern).
Seil II (überfeften):
162 u. 163 (SBerftalten toaftrenb be§ überfeftenS
im ©injelfaftrjeug),
186 u. 187 (SSerftalten mäftrenb be§ überfeftenS
mit gaftren).
Seil IV:
Slbfcftnitt A (SBegebau)
312—317 (Srlunben bon SBegen),
Slbfcftnitt D (Surcftfcftreiten bon gurten),
Slbfcftnitt E (überfcftreiten bon SiSbedett).
Seil V (^elbbefeftigung):
Slbfcftnitt A (©runbfäfte),
Slbfcftnitt B' (Scftanjjeuggebraucft),
Slbfcftnitt C (©injelanlagen)
362—391 (Stellungen für Artillerie, Einlagen
für SBeobacfttung, für fftadftricfttenberbinbun»
gen unb Sladftricfttenmittel, Scfteinanlagen,
Unterfdftlupfe, Selleiben bon Söfdftungen,
Scftuft gegen fjeucfttigleit unb ®a§).
Seil VI (33itnal§ unb .ßager).
Seil VIII (SicfterfteitSbeftimmungen):
Slbfcftnitt B (fffettungSmaftnaftmen unb Sicfter«
fteitsbeftimmungen bei fjluftübergängen im
^rieben)
7
497 b (SSerljaltett unb Anjug beim überfegen
mit ©injjelfagrjeugen unb gälten),
499, 5.Ab|ag u. folgenbe .ßiffern (Vergalten
beim Übergang über 2»t» bi§ 84=23rüden),
501 (Vergalten unb Anjug beim Übergang
über Sdmellftege unb Stege),
504 (AuSlöfen be§ fRettungSbienfteS).
2. fReitenbe Artillerie ferner nadj:
Seil II (überfegen):
Abfcgnitt F (überfegen mit fdgmimmenben
ißferben).
Seil VIII:
Abfdfnitt B (fRettungSmafjnagmen unb ®icger=
geitSbeftimmungen bei ^luffübergängen im
Trieben).
3. 3e ^Batterie minbeftenS 12 Staun aufjer»
bem nacg:
Seil II (überfegen):
Abfcgnitt B1 u. 2 (glofjfade unb begelfSmägige
SSafferfatjrjeuge),
Abfcgnitt C1 (§agren auf bem Sßaffer im
©injelfagrjeug).
Seil III (SBegelfSbrüdenbau):
Abfcfmitt A (Allgemeines),
Abfdjnitt C (®er S9au)
232—239, 275—276, 297—298 u. 300—302
(Uferbrüden),
Abfdjnitt D 303—306 a (prüfen öon 33rüden).
Seil IV:
Abfdjnitt A (Sßegebau),
Abfcgnitt C (§errid)ten öon ©ifenbagnbrüden
jum Übergang).
Seil VII (SifenbagnbegelfSraütpen).
2*
8
Seil VIII (SidjertjeitSbeftimmungen):
Abfdjnitt B (StettungSmaftnaljmen unb Sidjer-
IjeitSbeftimmungen bei gluftübergangen im
^rieben), 502 nur für reitenbe Artillerie.
d) Pioniere:
Waä) allen Seilen, o^ne I, VIIIA, IX A.
e) Aadjridjtentruppe:
1. Alle nadj:
Seil I (Sperrungen):
Abfdjnitt C 81—84 (Sperrung bon Aadjridj=
tenberbinbungen unb Anlagen),
Abfdjnitt D (Sperrung bon Straften, SBegen
unb Selanbe oftne $ionier*Sprengmittel)
10t b—g,
Abfdjnitt E (Sdjeinfperren),
Abfdjnitt G (29efeitigen bon Sperrungen).
Seil H (überfein):
162 u. 163 (Serftalten tnäljrenb be§ ÜberfetjenS
im ßanftelfaljrgeug),
186 u. 187 (93ertjalten tnäljrenb be§ überfeijenä
mit fjfäfjren).
Seil IV:
Abfdjnitt A (SBegebau),
312—317 (®rtunoen bon SBegen).
Seil V (gelbbefeftigung):
Abfdjnitt A (Srunbfäfte),
Abfdjnitt B (Sdjan^euggebraudj),
Abfdjnitt C (Sin^elanlagen)
366—368 (Anlagen für Aadjridjtenberbinbun*
gen unb Aadjridjtenmittel).
Seil VI (33itt}at§ unb Sager).
Seil VII (SidjertjeitSbeftimmungen):
Abfdjnitt B (9tettung§maftnaftmen unb Sidjer»
fteitsbeftimmungen bei gluftübergängen im
^rieben)
9
497 b (SBerftalten unb Slnjug beim überfeinen
mit (Sinjelfaftrjeugen unb gäftren),
499, 5. Slbfaft u. folgenbe Biffern (Verhalten
beim Übergang über 2=t= bi§ 8=t>29rüden),
501 (SSerftalten unb Slngug beim Übergang
über ScftneUftege unb Stege),
504 (2lu§lö[en be§ 9iettung§bienfte§).
2. 3e gernfprecft» unb guntfompanie
minbeftenS 12 Kann aufterbem nacft:
Seil IV:
2lbfcftnitt D (Smrcftfcftreiten bon gurten),
Slbfdftnitt E (überfdjreiten bon' GiSbeden).
Seil V (gelbbefeftigung):
373—391 (Unterfdflupfe, SBetleiben non
29öfcftungen, Stftuft gegen geudjtigleit unb
Sa§). ‘
Seil VII (®ifenbaftnbeftelf§rampen).
f) Sraftfaftrlampftruppe:
1. Sille nacft:
Seil I (Sperrungen):
Slbfdftnitt A (Bmed unb SluSfüftrung bon
Sperrungen),
Slbf^nitt B (Sprengen bon SSrüden) (na<fy
SJlaftgabe ber SluSrüftung),
Slbfcftnitt C (Sperrung bon Scrteftrslinien
unb »anlagen unb bon glugftäfen),
Slbfdjnitt D (Sperrung bon Straften, Sßegen
unb Selanbe offne $ionier»Sprengmittel),
Slbfdjnitt E (Sdjeinfperren),
Slbfdjnitt G (SBefeitigen bon Sperrungen).
Seil II (Überfein):
162 u. 163 (SSerfjalten tnäljrenb be§ überfe£en§
im Sinjelfa^rgeug),
186 u. 187 («erftalten mäftrenb be§ überfeftenä
mit gäftren).
10
Seil IV:
9lb[(f)nitt A (SBegebau)
312—317 (©rtunben bon SBegen),
2lbf(hnitt D (SDurdjfdjreiten bon gurten),
2lbfc£)nilt E (überfchreiten bon ©iSbeden).
Seil V (gelbbefeftigung):
Slbfdjnitt A (Srunbfatje),
Slbfcgnitt B (Schan^euggebraud)),
Slbfchnitt C (ßinjelanlagen)
349—361 (Stellungen für gnfanterie),
369—391 (Scheinanlagen, Unterfcfjlupfe, Se«
tieiben bon Söfdjungen, Schuh gegen geuih»
tigfeit unb @a§),
Slbfdjnitt D (Sinridjten bon Drtfifjaften §ur
©erteibigung).
Seil VT (S3iioat§ unb Sager).
Seil VIII (Sicfjertjeitäbeftimmungen):
2lbfdjnitt A (Sid)erheit§beftimmungen für Ser»
tnenben bon Sprena» unb Bünbmitteln im
grieben unb im Kriege),
Slbfdjnitt B (9tettung§mafjnaljmen unb Sicher»
heitSbeftimmungen bei glufjübergangen im
grieben)
497 b (©erhalten unb ülnjug beim überfeinen
mit ©injelfahrseugen unb gäfjren),
499, 5.2lbfah u. folgenbe Biffern (©erhalten
beim Übergang über 2=t= bi§ 8»t»®rüden),
501 (©erhalten unb Slnjug beim Übergang
über Sdjnellftege unb Stege),
504 (?lu§löfen be§ $Rettung§bienfte§).
2. Sei feber. ©inheit (Kompanie ufm.)
minbeften§12 SDlann aujjerbem naty:
Seil II (Überfeben):
2lbfchnitt A (3lu§mahl bon überfeijftellen),
2lbfchnitt B (überfefcmittel),
11
5lbfcf)nitt C (galten auf beut SBaffer),
Slbfcfinitt D (überfeinen am Sau),
Slbfcgnitt E (Stampen unb fianbbrüden).
Seil IV:
2lbfcf)nitt A (SBegebau),
Slbfcfmitt B (überminben bon Sumpf- unb
Sricf)tergelänbe burcf) Schüßen unb leichte
^anjertoagen),
Abfdjnitt C (3g>erricE)ten bon Sifenbahnbrüden
jum Übergang).
Seil VII (®ifenbat)nbeljelf§rampen).;
Seil VIII (Sid)erheit§beftimmungen).
3. $ionierjüge nacf):
Seif I—IX o I) n e 392—425 (minierte Unter»
ftünbe, ^Betonieren).
g) Sonftige Truppen:
SBie bie 9tacf)ricf)tentruppe.
h) Ski allen SSaffen:
Offiziere nacf) SBebarf unb bon jeher Kompanie
ufm. einzelne Unteroffiziere al§ fieljrer unb
Sruppfüljrer in ben für ifjre feintjeit in Söetradjt lom»
menben ßroeigen be§ iJ5ionierbienfte§.
III. gür ©infatj ber Sruppe bei öffentlichen
Siotftänben gilt aufjerbem ®b.466. $u Spreu»
gungen unb für fcfjnuerige ^Bauten (z. 33. 23au bon
Strafjenbrütfen) bürfen nur bie ^ioniertruppe unb,
fofern biefe nicht berfügbar ift, bie fßionierzüge ber
ffabafferie unb Sraftfahrtampftruppe fjerangezogen
»erben.
IV. SluSbifben in ber ®enntni§ unb im Jpanb»
haben be§ SeräteS erfolgt nach ben ©erüteoor»
f ch r i f t e n.
I. Sperrungen.
A. Swcdt unö Husfüljrung von Sperrungen.
1. Sie Sperrung non Straften unb SBegen Jonne
bon betäube foH ben geinb gufhalten ober in
ftimmte Stiftung jroingen. Sie ift ein roicE)ttge£ SRittel
ber (Gefechtsführung, bor allem in ber 2tbioehr, unb
geeignet, bie Sicherung in ber Siuhevunb SBemegung ju
ergänzen. Ste tann bie SSerfcfjIeierung erleichtern unb
bie Saufd)ung beS (Gegners begünftigen.
Sie Sperrung von Sertefträtinien (Sifenbahnen,
SBafferftraften, ©raftfahrbahnen unb ftänbige
richtenberbinbungen) foH ben feinblidjen SBertehr unb
^Betrieb berhinbern.
2. gür ben Umfang einer Sperrung unb für bie
21 rt iprer 2IuSführung finb eigene 2Ibficht, Sage, für
Sperrjtoetfe jur Verfügung ftehenbe 3^, Kräfte unb
SRittel foioie (Selänbe unb 23obenbebeaung maftgebenb.
3. Sperrungen bonStraften, SBegen,
S e I ä n b e unb SBerfehrSlinien finb um fo
toirtfamer, je gröfter ihre Siefe, foldje bon Selänbe
auch, je gröfter ihre ^Breite ift. Sie Sßirtung bon
Sperrungen roirb gefteigert, ioenn fie im eigenen geuer»
bereicf) liegen, ber (Gegner burch fie überrafcht ioirb,
befonbere Kräfte unb Mittel ju ihrer SBefeitigung ein»
fetjen ober unter ungünftigen SBebingungen um ihre
Überioinbung tämpfen muft.
Surdh Sßechfel in ber 2lnmenbung ber betriebenen
2Irten bon Sperren, burch (Sdjeinfperren, berftedte
Sabungen u. bgl. töirb bie aufhaltenbe SBirtung folger
Sperrungen gefteigert.
Einern unb Sampfftofffperren tonnen bem ^einbe
SSerlufte jufügen, auff) toenn fie nicEjt im eigenen geuer*
bereich liegen.
13
Häufig tönnen natürliche Jginberniffe, tote Sßaffer»
laufe, Seen, Sümpfe, SSälber unb bergiges ©elänbe,
ut Sperrungen auSgenußt unb in ihrer fperrenben
JBirtung berftärtt »erben.
Sperrungen tönnen jur Steigerung ber eigenen
Jeuermirtung auSgenuijt werben.
4. Straßen, Sßege unb © e l ä n b e »erben
burch Serftärtung natürlicher unb Errichtung fünft»
lieber Jpinberniffe aller 9lrt, burch SRinenfelber, 2ln»
ftauungen, 3erftörungen unb burch SluSnußung bon
Startftrom gefperrt. So»eit SSerf.ehrSlinien
burch gefperrteS ©elänbe laufen, gelten für beren Sper»
rung bie SBeftimmungen in 6 u. 7.
5. Sie Sperrung bon 33ertehrSlinien erfolgt burch
griinbliche Unterbrechungen auf mögRchft lange Seit
ober burch leichtere Unterbrechungen auf tiirjere Seit.
6. ©rünbliche Unterbrechungen bon
CertehrSlinien bürfen nur nach Seftimmung
5er ^eereSleitung, beS Rührers einer Slrmee (Heeres»
gruppe) ober beS felbftänbigen gührerS eines mmee»
(waballerie») ®orpS unb einer Sibifion erfolgen.
Sie griinbliche Unterbrechung t>on Eifenbahnen,
ffiafferftraßen unb traftfahtbahnen roirb im allge»
meinen nur burch umfangreiche Berftörungen bon
hhinftbauten unb ber »ichtigften 83etriebSanlagen her»
beigeführt.
Sie griinbliche Unterbrechung von ftänbigen Blacfj»
richtenverbinbungen bebarf ber Berftörung ober» unb
unterirbifcher Seitungen auf große Strecfen ober ber
technifchen Einrichtungen bon SSermittlungSftellen,
Selegraphenanftalten, Sßerftärterämtcrn unb fjunt»
fteüen.
7. Seichtere Unterbrechungen von SSerlehrSlinien unb
Sperrungen von Straßen, SSegen unb ©elänbe tönnen
bon jebem SruppenbefehlSIjaber felbftünbig beranlaßt
14
»erben, foweit nicht in SluSnahmefäHen ber obere
(jü^rer eine anbere Siegelung trifft. Sie anorbnenben
Rubrer tragen für Unterlaffung wie für SluSfüIjrung
bie SSerantwortung unb üerfetjen bie Sruppen mit be»
ftimmter Slnweifung.
Seichtere Unterbrechungen von SSertehrSlinien foioie
Sperrungen üon Straften, Sßegen unb Selänbe finb
bort, wo e§ bie eigene Sicherheit verlangt, feberjeit
geboten, 3 m übrigen finb fie im eigenen Operation?«
bereif beim SSormarfdj ju vermeiben, beim StiUftanb
geftattet, beim- Stüdjug geboten unb im Operation?«
bereich be? geinbe? ftet? ju üerfudjen.
8. gur Sachführung von fdjwierigen unb umfang*
reichen Sperraufgaben finb ben bamit beauftragten
Sruppenbefetjlsjfjabern Pioniere, gegebenenfalls be*
fonbere Sadjträfte jujuteilen. Sluch tonnen Pioniere
allein ober verftartt burch anbere Sruppen mit ber
Sachführung folger Sperrungen beauftragt werben.
Sie übrigen Sßaffen müffen in ber Sage fein, mit
ben Mitteln, über bie fie Verfügen, Sperrungen ein*
facher Slrt herjufteHen.
9. Slnftauungen unb Überflutungen, bie ft<h in meh»
reren ^Befehlsbereichen auSWirten, befiehlt beren ge»
meinfamer Rührer.
10. Sie Srtunbung ber SKöglidjteiten für Sin*
läge Von Sperrungen ift jeitig einjuleiten. ©inen
erften Slnljalt gibt oft bie ©arte, gür bie Srtunbung
umfangreicherer Sperraufgaben tönnen Suftbilber unb
Unterlagen von SBehörben wertvoll fein.
11. $ e i t, D r t unb 31 r t jeber Sperrung Von 33er*
fehrSlinien haben bie anorbnenben Sruppen6efet)l3haber
ihrer vorgefetjten Stelle ju m e l b e n unb, foweit ein
noch üorhanbener betrieb geftört Wirb, ber für biefen
juftänbigen Stelle Vorher mitjuteilen.
12. Ser Auftrag, SSertehrSlinien grünblich ju, unter*
brechen, muft nachweisbar, in ber Siegel fdjtiftlichr er*
15
folgen. SBirb ber 93efeljl burch tedjnifdje Nachrichten*
mittel übermittelt, fo ift er alsbalb fdjriftlich zu be*
{tätigen.
53ei größeren ®unftbauten fann fid) ber anorbnenbe
Rührer in befonberen fallen, namentlich auf einem
Rüdzug, ben Beitpuntt ber Berftörung Vorbehalten.
$u fpät gegebene ^Befehle zum Berftören fönnen fid)
Verhängnisvoll auStoirlen.
13. ®ie Slnorbnungen für bie ®urtf)s
f ü h r u n g größerer Sperrungen tonnen
unter anberem beftimmen: B^^ Srdb unb Umfang
ber Sperrung, bie zu ihrer Einlage angefe|ten Sräfte
unb Niittel, ^Beginn ober SBeenbigung ber Arbeiten,
unter Umftänben ihre Reihenfolge, M Sicherung ber
Arbeiten, ob unb too Süden zu laffen unb auf treffen
^Befehl fie zu fdjliefeen ftnb, fotoie bie bis zur SBeenbigung
ber Arbeiten benötigten Nachrichtenverbinbungen.
Nötigenfalls ift zu regeln, toie unb Von tnern bie fertige
Sperrung für Sicherung unb anbere SefechtSztnede auS*
junu^en ift.
14. ®aS Segen Von Sperren toftet BeU, Prüfte,
Spreng* unb anbere Sperrmittel. Rechtzeitige unb
tnirtfame Sperrung lägt fiep baher nur erreichen, trenn
ber 33 e f e h I jur Sperrung frühzeitig gegeben
toirb.
15. 33ei einem Singriff auf eine Sperrfteüe mug
Verhinbert toerben, bag ber Segner bie ©urch*
führung ber Sperrung unmöglich macht. Db in foldjer
Sage ber mit ber Sperrung beauftragte Rührer biefe
nur auf Sefeljl ober auch aus eigenem @ntf<hlug burch*
führen barf, ift in ber Slntoeifung beS anorbnenben
gührerS 11 a r angugeben.
®ieS gilt befonberS, trenn Stragen unb Sßege §ur
Sperrung vorbereitet, aber sunächft für bie eigene
Sruppe noch offengehalten toerben Jollen. SBichtig ift
16
— befonberS in gekannter Sage — bauernbe, ftcfjere
SBerbinbung gtoift^en ber SperrfteHe unb bem bie
Durchführung ber Sperrung anorbnenben güprer.
16. gebe ju Sperrungen angelegte Druppe hat fleh
gegen ®rb» unb ßuftgegner f e l b ft ju f i q) e r n
Öleichen bie eigenen Kräfte fjiersn nidjt auS, fo finb
rechtzeitig anbere Kräfte anjuforbern. poften ,jur
unmittelbaren Sicherung ber Sperrarbeiten finb auch
bann zu fteüen.
Segen von ®linen= unb Startftromfperren ift Sadjt
ber Pioniere. * giir baS Segen biefer Sperren gelten
befonbere Sorjdjriften.
B. Sprengen von Brüchen.
1. poitier=Spreng= unb ßünbmittel.
Sprengmittel.
17. i$ionier=SprengmitteI ($i. Spr. SK.) haben bei
fchneHer Berfe^ung in ®afe (Detonation) zerfdhmetternbe
unb, genügenb oerbämmt, auch fdjtebenbe SBirtung.
®en>erblitf)e Sprengmittel bürfen nur bon ber hierfür
befonberS auSgebilbeten ißioniermaffe bertoenbet merben,
Sprengmittel frember $eere finb in ffiirtung unb
tpanbhabung ben beutfchen ähnlich; Bufammenfehung,
formen unb Ladungen finb meift anbere. 3Jor bem
Sßermenben finb ^robefprengungen borzuneljmen.
18. a) $ionier-Sprengmittel auS ^iiUpulver 02
(gp. 02) (rotes Schuhblättchen) unb auS ®ranatfül=
lung 88 (@rf. 88) (gelbes Schutjblättchen) finb lager»
beftänbig unb beförberungSfidher. ?ßionier=Sprengmittel
au§ güdpulber 02 finb nicht toaffcrempfinblich; ba»
gegen finb $ionier=Sprengmtitcl aus SranatfüHung 88
grunbfählidh 9cSien §eu<htigteit zu frühen.
b) ®ranatfüllung 88 roirtt ätjenb, barf baher mit
SSunben, Schleimhäuten, ©fjmaren unb Kleibern nicht
in Berührung tomm^n. güHpulöer 02 hat biefe ®igen»
fchaften nicht.
17
o) Bionier»Sprengmittel tctnn man anbohren, mit
bcm ®Jeff er ^erteilen ober mit einem fpolj jerftampfen.
d) Bionier=Sprengmittel auS güßpulber 02 unb ®ra»
natfüßung88, burch Junten ober gewöhnliches fjeuer
entjünbet, brennen langfam ab. Startes ($r^itjen (auf
300°, 3. B. burdj Berühren mit glüljenbem ®ifen ober
glühenben hofften) bewirft fofortigeS 3erfe&en in ®afe
(Detonation). ^nfanteriegefttjoffe, bie inißionier»Spren(j»
mittel einfdjlagen, jerreifjen fie unb tonnen Seile tu
Branb feigen. Die bann folgenbe fpitjeentioidlung tann
jur Detonation führen. Slrtißeriegefdjoffe bewirten bei
©infdjlag in $ionier»Sprengmittel faft immer Detona»
tion.
3ebeS 2öten an Behältern, bie fiabungen öon
Bionier=Sprengmitteln enthalten, auch 'mit BJeidjlot,
ift verboten.
e) Detonation bon tßionier=<5prengmitteln überträgt
pdj fofort auf anbere bon ihnen innig berührte Bionier»
Sprengmittel, aud) wenn biefe burd) füllen auS tßapier
ober SSIedj bon ben erften getrennt finb.
f) Bionier»Sprengmittel finb pm Sdjutj gegen
jjfeucljtigteit etwa 2 mm tief mit fßaraffin geträntt unb
in paraffiniertes Bapier eingetjiittt. Bionier=Spreng»
mittel auS ^üHpuIberO2 finb aud) unter SSaffer ber»
toenbbar unb jtoar bie mit 3intbted) umtjültten Spreng»
büdjfen (Spr. B.) unb 3=kg»£abungen in jeher SSaffer»
tiefe. Die nicEjt mit Sintölecf) umtjültten Spreng»
törper (Spr.®.) unb Bohrpatronen (BoIjr=Batr.) auS
güllpulber02 finb für Bermenben in SBaffertiefen über
&m in fefte Behälter einppaden (43). Die Behälter
müffen auSgefüßt fein. Süden finb burch Sinfüßerr bon
Sanb ober burch fpoljftüde ju befeitigen, um bie Be»
Ijälter brudfidjer ju madjen.
Bionier=Sprengmittel aus Sranatfüßung 88 finb p
jebem Berroenben unter Sßaffer tnafferbidit einphallen.
18
g) $ionier*Sprengmittel finb jum 8er^üten bon
^Detonationen ftetö getrennt bon ben 3ünbmttteln jix
lagern unb ju beförbern. ©egen geudjtigteit unb geuer
finb fie ju fcfjiitjen (488).
3m gelbe finb größere ©Zeugen bon $ionier«Spreng»
mitteln niemals in einem Staunt, fonbern getrennt $n
lagern. Lagerung bon Spreng« unb ßünbmitteln im
grieben f. ©b. 450.
19. gönnen ber $ioniet«(5prengtnittel finb:
a) Sprengtörper28, 33ilb 1 u. 1 a,
b) 8 o Ij r p ft t r o n e 28, 8ilb 2 u. 2 a,
c) Sprengbüdjfe 24, 8ilb 3,
d) Seballte Sabung 3kg, 8tlb 4.
©|>reitgtör|)er 28.
Schnitt.
fflilbl.
©prenfllörpet 28.
Slnfidjt
©prengftoffmenge: 200 g.
19
S8tlb 2.
SSo^tbattonc 28.
Slnftdjt.
Sprengftoffmenge: 100 g.
S8ilb 2 a.
gfolptyattime 28.
Sdpitt.
Gewindemutter mit Anker
SBUb 3.
S|)rengbürf))e 24.
Wasserdichte Zink-
blechhülle
Schutzblättchen,
dahinter Zündkanal
20
SBilb 4.
Geballte £abmtg 3 kg.
Sprengftoffmenge: 3 kg.
3n bie ßünbtanäle toerben bie Sprenglapjeln
[<5pr. Sapfeln (24)] ber ßünbung (3bg.) eingefütjrt ober
mittels ßünbertjalter (Sßilb 8 a) eingeftfjraubt.
20. Slceljrere $ionier=Sprengmittel, bie für einen
Sprengjmecf feft jufammengefügt ober eng miteinanber
in Serüljrung gebracht toerben (41), ebenfo ein einzelnes
für einen Sprengjtoecf <ju OertoenbenbeS Pionier»
Sprengmittel nennt man ßabung (L).
ßiinben unb ßünbmittel.
21. $ionier=©prengmittel betonieren, ioenn fie ge»
j ü n b e t toerben b u r 5):
a) ßeitfeuerjünbmittel (22) ofjne ober in SSetbinbung
mit Snaffjüttbfc^nüren [Stnall=3^f^n- (26)].
3Wan tann mit einem fieitfeuerjünbrnittel
immer nur eine Sabung jünben.
ßünben mehrerer ßabungen burdj Seitfeuer
(Seitf.) in SSerbinbung mit fftnalljünbfdjnüren f.
23 u. 26.
21
b) ßihtbiibertragung (mehrere Sabungen) bon einer
rlnfangMabung fjer in ben in 37—39 angeführten
fällen.
«) eiettrifdje ßiittbiing (f. Seil IX).
fieitfeuerjünbung.
22. fiettfeuersfinbrnittel finb: .geitäilnbfchnur (3t.
Rbfcfjn.) mit Sprengtapfel unb langer ober turjer
©prengtapfeljünber (Spr. ®apfel*3-)-
23. Sie ßeitäünbfdjnur f»crt eine 93renngef<hwinbig=
leit bon etwa 1 cm in ber Setunbe, auch unter Sßaffer.
Sie 3eitjünbf(hnur wirb burch Streichholz (33ilö 5
a. 6), Sßinbftreichholä, brennenbe gigarre, Sunte, Sicht
2BUÖ 6.
Obidjten be§ freien (£nbe§ einer
junt Siinben borbereiteten Seit-
jünbfcfjnur.
fflilb 5.
Knfeuern einet Seitjünb«
fdjnitr burch StretfjljbU»
Streichfiolzkopf
Ouf Pulversatz
Streichholzkopf
unengamy
©ntsünben burdj Gtreidjen mit ber
fReibflädje einer Streidj^olgfdjaifjtel,
oljne ba§ ®uttaperdjat)apicr borber
gu entfernen.
ober Sünbfchnurangünber ^Inj., 33ilb 12b) ange=
feuert, bei letzterem burch träftigeS Biedert am Slbreifj»
ring.
3eitsünbfchnur ift ftet§ mit einer Sprengtapfel ju ber--
binben, wenn burch ihr 9lnfeuern $ionier=<5prengmitteJ
jur Setonation gebracht (gejünbet) werben Jollen. Sif
SJtonierbienft. 3
22
Sänge ber geitjünbfdjnur ift ftetS fo ju bemeffen, bafj
fid) bie ßünbertben int Schritt in Seetang begeben
tonnen, jebodj niefjt unter 60 cm (478).
Surdj eine 3cit3ünbf(f)nur mit Sprengtapfel ober
einen Sprengtapfeljünber tann man immer nur eine
Sabung jünben. Sebe einzeln burd) Seitfeuerjünb»
mittel ju jünbeube Sabung erhält baijer einen Spreng»
lapfeljünber ober eine mit Sprengtapfel berfehene geit»
«jünbfdjnur.
Wtjrere burdj ein Seitfeuerjünbrnittel ju jfinbenbe
Sabungen — bei öerfehten Sabungen (61) aud) jebe
Seillabung — erhalten je eine Sprengtapfel, bie burdj
Suai^ünbfdjnur mit bem Seitfeuerjünbmittel ju ber»
biuben ift ober bei günbübertragung (37—40)
bis auf bie Sprengtapfel ber SlnfangSlabung offen bleibt.
Sie 53raud)6arteit bon geitsünbfdjnüren prüft man
burdj 2lbbrennen eines turjen StüdeS unter SJteffung ber
SSrennbauer.
geitjünbfdjnur ift ju fdjügen:
a) (Segen groft. Sefrorene geitjünbfdjnur ift bor
SSermenben a 11 m ä h l i dj gu erwärmen, weil fie
fonft brid)t.
b) (Segen fjifee. übermäßig erljiijte 3eitSÜnbfif)Ttur
mirb infolge 89lafenbilbung ber §ülle unbidjt.
c) Segen fjeudjtioerben burd) 9lbbidjten ber freien
Snben, Weil fonft bie $ulberfeele unbrauchbar
mirb (33ilb 6).
d) Segen berühren mit ölen, fetten, Petroleum ober
93enjin, Weil baburd) bie Umhüllung {(habhaft mirb.
e) Segen Srud, weil baburdj bie Umhüllung befdjä»
bigt ober bie $ulberfeele jerquetfeht werben tann.
24. Sie Sprengfapfel (53ilb 7) mirb fdjon burch
mäßigen Schlag ober Stoß, burch ®rfdjüttern, @r»
hiijen, burd) £metfd)en ober Steiben ber Qluflabung jur
23
«ilb 7.
Sprengtapjct.
6,25 mm 4>
Kupferkapsel------i
I
$
Innenhütchen
Aufladung
Hauptladung
0 • Durchmesser
mm<t>
©etonation gebracht. SBerfen bon ^ßionier*Spreng*
mitteln mit eingefe^ter Sprengtapfel ift bafjer aufeer
beim SRaptampf oeoboten.
Sprengtapfeln bürfen niemals lofe in
3ßer f jeugtaf djen, ^Brotbeuteln ober
Sleibertafdjen getragen toerben. Sie finb
erft furg bor bem ©ebraud)
ben 25erpadung3täftd)en ju
entnehmen, fertige Seit*
feuerjünbungen bürfen auf
5ctl;rjeugen nur mie Spreng*
tapfeljünber berpadt beför*
bert, fonft nur getragen toer*
ben. 2Sor jebem SSeförbern
auf ga^rjeugen finb jebod)
Snalljünbfdjnüre bon ber
mit Beitjünbfdjnur berbun*
benen Sprengtapfel ober bem
Sprengtapfeljünber ju treu*
nen (46).
®nalljünbf djnur, bie mit Spreng*
tapfel berbunben i ft t barf nur g e *
tragen, alfo nidjt auf gatjtseugen
beförbert toerben.
Sprengtapfeln finb -ftets» gegen geudjtigteit ju
fd)ü|en (35). ^eudjttoerben berminbert bie ßünbfä^ig*
feit ber Sprengtapfeln bi£ jur Unbraudjbarteit.
gn^befonbere finb baljer Sprengtapfeln mit angelaufe-
ner (ojpbierter) Jpülfe nidjt ju bertoenben.
©ie Serbinbung^ftellen jtoifdjen 3eitjünbfd)nur unb
Sprengtapfel ber Seitfeuerjünbungen, bie unter SSaffer
ober bei SRegen bertoenbet toerben falten, finb nodpnalS
mit Sfolierbanb ober £abeltoad)3 abjubidjten.
®ie Sprengtapfeln finb ftet§ bi3 auf ben SBoben ber
günblanäle ber ^ionierfprengmittel einjufüpren, burd)
Jpoljfpäne im Bünbtanal feftjuflemmen unb an bie
3*
24
Sabungen angubinben ober bei SSerioenben bon Bünber»
haltern boHtommen in bte Bünbtanale einjujcljrauben.
25. ©er Sprenglapfelsiinber 28 (23ilb 8) ift eine
günbfertige Seitfeuerjünbung. ®r Beftetjt au§ einem
1 m (furjer Sprenglapfeljünber) ober 2 m (langer
•Sprengfapfeljünber) langen ®tüd Beitäünbjif)nur mit
SBitb 8 a.
Seitjüitbfcfjnur mit Spreng«
ta^el im Sünbefljalter.
Shlb8aii.l2b gufammen=(Spreng«
fapfelaünber 28 (23ilb 8).
SSilb 8.
SbreitgtobjelSünbet 28.
----Zeitzündschnur —S
Zünderhalter -
— Oberteil
T
Verbindungshülse
-----
g-—Gewindenippel
Innenhütchen m.Aufladung
----Sprengkapsel-----
Hauptladung------
mafferbi(f)t berbunbener ®prengtap[el an bem einen
®nbe (SBilb 8 a), bem Bünbf^nuransünber 29 an bem
anberen ®nbe (S9ilb 12 b). 53rennbauer be§ turjen
Sprengfapfel^ünberS 100 bi§ 125 Setunben, be§ langen
200 bi§ 250 Setunben.
finalläiinbfdjnur.
26. ®ie finattjünb[d)nur bat einen Sünt’fafc au3
brifantem Sprengftoff.
SJlan bermenbet ßnalläünbftfinur jum g l e i d) j e i •
tigen Bünben mehrerer Sabungen (23 u. Ü3ilb 15).
25
Sie aß <jauptgiinbleitung beftimmte ©naHgünbfdjnur
jünbet man burd) ein Seitfeuergünbmittel. Sin biefe
©attptgfinbleitung legt man anbere SnaUgünbfdjnüre
(b i § 6) aß ßiinbweiterleitungen gu weiteren ®natt»
günbfdjnüren ober unmittelbar gu ben Sabungen
ffiljrenb an (35 2lbf. 4 u. 5). ^ebe ®nallgüubfd)nur,
beten ßünbung (Detonation) auf $ionier»Spreng=
mittel Weitergeleitet werben foH, ift an iljrem ©infül)»
rungSenbe in $ionier»Sprengmtttel mit einer Spreng»
tapfel gu berbtnben (24).
®nalljünbf(f)nur ift gegen Sfeudjtigteit unempfinblid),
betoniert alfo aud) unter SSaffer, wenn iljre freien
®nben abgebidjtet finb (35 Wbf. 4 b u. 5 b) unb bie
Umhüllung unbefd)äbigt ift.
®naUgünbfd)nur lagert unb beförbert man wie
$ionier»Sprengmittel, getrennt öon anberen ßünb»
mitteln (24, 488). sBor SSeförbern ober Sagern finb
freie Snben abgubid^ten, bie Snallgünbfdjnur gegen S8e=
rfiljren mit fetten, ölen, Petroleum ober SSengin gu frfjüijert.
Spannen, Etuetfdjen ober Barren ber ©nallgünbfdjnur
ift ju bermeiben, weil fonft ber günbfal ober bie Um»
Füllung befdfjäbigt wirb.
Bum Sctfätteiben ift fteß bie g e f a m t e auf ber
Bünbfdfjnurtrommel befinblidje ®nallgünbfdf)nur g e»
ftredt abgufpulen, an ber Sd)nittfteHe "auf
einer Jpolgunterlage auSguftredten unb mit einem Srett»
eßen feftgußalten. SSerüßren ber ffinallgünb»
djnur mit ber bloßen §anb beim 3er“
djneibeni ft »erboten. ®er Scßnitt ift langfam
n einem Buge mit einem reinen, [djarfen SDceffer au§gu=
:üljren. 9tad) jebem Schnitt finb JRefte be§ Biirtbiaijes
bon ber Unterlage unb oom SJteffer gu. entfernen.
SßieberljolteS Sdjneiben an gleicher Stelle ber Sdjnur
ober ber Unterlage ift gu b e r m e i b e n.
2lbfdjneiben bon ®naffgünbfdjnur, bie in eine Spreng
lapfel eingefüßrt ift, ift verboten.
26
üfntttg§=<Spreng« unb ßfinbmittet
27. Ütning5=£prengmittel finb übung§==33oljrpatro«
nen, ü6ung§=Spreng!örper, übung§=®prengbü(f)fen unb
Ü6ung§=@e6afite=Sabungen au§ §olj (ogne Slnftridj)
foime übungS’Sprengtörfjer unb übung§=®preng«
büdjien mit 9tauif)Iabungen.
S8 tlb 9.
Sifenbeijältet einet Üfntng§«<Sbtettgbüdjfe.
SBilb 10.
ÜbnngSIabnng mit 9tau^lör|)ern.
Rauchkörper
I6n dem Gebrauch
Übungsladung
in Papierum-
hüllung
VerbinchjngsnonaL
CrKgasungsrille
Draht tum Finha-
ken cfer Krallen äatl
z SparmscWüssels |
fertig zum
Noch dem
27
fibung3=Spreng!5rper mit Jtaudjlabungen finb mit
rotem Rapier umtjüllt, flbung§=Sprengbüd)fen mit
Slaudjlabungen ljaben roten 2lnftrid).
Sie Übung§=SprengmitteI finb in fjorm unb Senndjt
ben entfpredjenben fdjarfen Sprengmitteln nadjgebilbet.
Sie Übung§=Sprengbüd)fen mit maudjlabung beftefjen
au§ ©ifenbeljälter (33ilb 9) unb übung§labung mit
3iaud)törpern (SBilb 10).
28. 3iinbmittel für übung§=Sprengmittel mit
fRaudjlabungen finb:
a) 3eiUünbfdjnur al§ Seitfeuerjünbmittel,
b) Slüfßünbftüde (@lüp=3^ft-) eleftrifdje 3ünb=
mittel.
Sa§ Slü^ünbftüd ift ein ©lüpjünber oijne
Sprengtapfel (508, S8ilb 292 a).
Sie ßeitjünbfdmur unb ba§ ©lüpjünbftüd finb burdj
©oljfpäne ober burci) Ummideln mit 3Jolierbanb in ben
•Kuttern ber übung§=Sprengmittel mit Piaudjlabungen
feftjutlemmen.
29.. iibungSIabungen mit fRaudjtor»
p e r n bürfen nur in ben b a s u gehörigen
©ifenbeljältern (übung§ = Sprengbüd) =
fen) gejünbet werben.
23 or ®infei)en ber iibungSlabung finb bie 9taudjtörper
unb bie ®ntgafung§ritten burd) 2lbreifjen be§ Sd)u(j=
banbeS freijumadjen.
30. S?ern)enbenbon®nall3ünbfd)nüren
ober Sprengfapfeln in Serbinbung mit
ü bung§ = ® prengmi11eIn, bie 9laudj =
labungen ljaben, ift verboten.
31. übung§=®prengmittel au§ günbet man wie
l|Jionier=Sprengmittel.
32. 3n feudftem 33oben, Sumpf ober
91 ä f f e finb bie 9taud)abäug§löd)er, ber Spalt jtoifdjen
®ifenbel>alter unb Sedel unb leere günbfanäle mit
28
Sfolierbanb, eingefüljrte 3eiidürtbfd^nur mit fjett ober
fiabelioadjS abäubidjten.
33. WadjbemSebraudj mirb bie iibungSlabung
au§ bem ©ifenbeljälter entfernt. Sie ©tfenbe^älter finb
mit 9fte[)er unb Siirfte §u reinigen, ju trodnen unb
cinjufetten. <So gereinigte 6ifenbet)älter tann man
mieber vertoenben.
Serbinbungen.
34. 3um gerfteKen von Serbinbungen unb 3ünbun»
gen brauet man: ßmicfsange, Sra^tjange, SSürgejange,
üJieffer, Sdjere, Sftafjftab, 3folier5anb, Leinengarn unb
Supfetljülfen, bie in ber SSertjeugtafc^e für Spreng«
bienft untergebracf)t finb (SBilb 11), jum 9lbbicf)ten audj
nod) ®abelmatf)§ ober 3fett.
Silb 11.
2Serf$eugtafd)e für Sprengbienft.
Werkzeugfasche
Würgezatnge a. A: Würgezange n. A>
Hauptkörper
SpannpafronG
Würgezange
Zwickzange
Z Spann» Ghedermaßsfab, för/fapferhülsen
Schlüssel sfäblern
Hämischere
ij) Hrahf-zan&e m/ff/achen /tabe/fc/appmesserm^'f
Backen ßrahfabz/eher
29
35* Serbinbungen
bon mit
Stuäfüljrung
1. Sprengtapfel Seit^ünb^nur
Silb 12.
Cerbinben: $eit$ünbfdjmtr mit
SprettgtapfeL
Leinengarn oder
Bindfaden zum
Befestigen an
der Ladung
Würgesteliff
3 cm-*]
Leinengamschtäge
Jsolierband
Jsolierband
Zeit-
zünd-
schnur
Sprengkapsel
Wickelbund
1. a) 3eit-$nbf cljnur auf
fefter Unterlage ge*
rabe abfdpieiben.
b) Bürgen:
Sprengtapfel ganj
in ^aupttörper ber
SBürge^ange n. 21.
einfcpieben.
Seitgünbfcfjnur Vor*
fidjtig in bie Spreng*
tapfel bi§ jumSnnen*
hütdjen, menn biefeS
fehlt 1,5 cm tief, ein-
führen.
Bürgen, babei
Sprengtapfelöffnung
nach oben galten.
Beit^ünbfchnur mit
Sprengtapfel au3
SBürge^ange beraub
nehmen.
23eim Bürgen mit
Sßürge^ange a. 21.
3eit$ünbfd)nur üor=
fichtig in bie Spreng*
tapfel bU jum Snnen*
hüteten, menn biefeS
fehlt 1,5 cm tief,
einführen, etma 0,5
bU 0,8 cm Dom offe-
nen Snbe entfernt bie
Sprengtapfel §mei*
mal mit ber Sßürge*
§ange mäfcig
fammenbrütfen, ba£
£toeite2ftal nach
halben Umbrehung.
30
bon
mit
9Iu3füfjrung
1. Sprengtapfel Beitgünbfdjnur
S8ilb 12 a.
ilbbidjten ber «erbinbung: gelt-
^ünbjrfjnur mit Sprengtapfel.
l.c) 9Ibbid)ten:
SBerbinbung^ftelle
mit 10 cm langem,
fcf)räg ab gefdjnitte*
nem Sfolierbanb ab*
bidjten, mobei 3 cm
an ber Sprengtapfel
gum glatten (Stnfüp*
ren in ben 3ünb*
tanal ber fßionier*
Sprengmittel frei gu
laffen finb. OTbidj*
ten bei SBertoenben
unter Baffer fielje
24 Dotierter TOfafc.
Umimdlung mit
Seinengam fidjern.
2. geitgünb* Qünbfcfynur*
fcfynur angünber
S8ilb 12 b.
^erbinben: Seitgiinbfdjnur mit
Sünbfdfnurangihtber 29.
Reibzündhülchen
Abreißring
Reibdraht
Zeitzündschnur
Gewindenippel
Verbindungshülse
Klemmzange
Klemmzangen-
röhrcben
2.a)Sd)u(3täpp(f)en bom
(SJeminbenippel ent*
fernen. Serbin* ’
bung^tjülfe auf fdjrau*
ben.
b)($erabe abgefdjnit*
tene Qeit^ünbfdjnur
burd, ®lemm§angen*
röljrcfyen 4 cm lang
ljinburd)f(f)ieben.
c) $lemm$angenroljr*
djenin $Berbinbung3*
^ülfe feft einfdjrau*
ben. $abei greifen
Spifcen ber ®lemm*
gangen in bie geit*
günbfdjnur ein unb
galten fie feft.
31
bon
mit
9Iu3füprung
3* ftnaH^ünb* Labungen
fdjnur (Sprengtapfel)
S8ilb 13.
Verbinden: Sprengtapfel mit
ftnalljihtbfdjimr.
Leinengarn
4. Shtall^ünb* (Sprengtapfel*
fdjnur jünber ober geits
äünbftpnur mit
(Sprengtapfel
SBilb 14.
Berbinben: Sprengtapfeljihtber 28
mit Shtalljiinbfdjmtr.
Zeitzündschnur des
Sprengkapselzünders
3.a) $Bnall§ünbfcpnur mit
Sfolierbanb fo um*
Kritteln, bafj fie notp
in bie (Sprengtapfel
eingefüprt toerben
tann (^urtpmeffer
ber ^nall^ünbftpnur
4,8 mm, ber (Spreng*
tapfelöffnung 6,25
mm).
b) ^nall^ünbfdjnur bi§
$um 3nnenpütd)en,
toenn biefeä feplt
1,5 cm tief, in bie
(Sprengtapfel ein*
füpren.
c) Bürgen, ttrie 1 b.
d) Slbbitpten ber 58er*
binbung^ftelle, toie
1c.
e) Sprengtapfel in La*
bung einfüpren unb
befestigen (24).
Sprengkapsel^
Jsolierba
Knallzündschnur
Knallzündschnur
Leinengarn oder
Bindfaden
Freies Ende
zur Ladung
4. a) Sprengtapfel in
ganzer Länge eng an
®nall£Ünbfcpnur an*
legen. S8eibe mit
Sfolierbanb um*
Kritteln unb mit
Leinengarn fitpern.
b) greie§ (Snbe ber
^nall§ünbftpnur pa*
tenartig umbiegen,
bann mit Qfolierbanb
unb Leinengarn feft*
legen; bei feucpter
82
üon
mit
Slu3füljrung
4. ^nall^ünb* Sprengtapfel*
fdjnur günber ober Seit*
äünbjdjnur mit
Sprengtapfel
4. Bitterung unb bei
Sßertoenben unter
Baffer ftetS mit 3fo*
lierbanb unb biefe
Sfolierung bei S8er*
menben unter Baffer
nocfjmaW mit SBabel*
toadjS ober gett ab*
bitten.
5. ^nall^ünb* Änall^ünb*
fdjnur fdjnur
S8ilb 15.
Sunben mehrerer Sabungen burd)
Scitfeuer in «erbinbung mit
^nallsünbfdjnur.
Ladungen Sprengkapsel
5. Sin iebe ®nall*
jünbfdjnur aB §aupt*
$ünbleitung tann man
bis 6 Qünbmeiterleitun*
gen unb an jebe üon
biefen toieberum 6 toei*
tere Bünbtoeiterleituw
gen legen; Qaupt§ünb*
leitung unb günbmeiter*
leitungen ftetS in ber
TOtte (S3ilb 15).
2)etonationSftrome mel)*
rerer ^nan^ünbf^nüre
müffenin einer SRid)*
tung laufen (S8ilb 16).
a) ®nalläünbfdj)nüre an
ben $erbinbung$*
{teilen ftet§ ettva
8 cm eng aneinanber
legen, mit Sfolier*
banb unb Seinen*
gam feftlegen, freies
6nbe ljalenartig um*
biegen (S3ilb 17) unb
mit Sfolierbanb unb
Seinengarn feftlegen
(toie bei SBilb 14).
33
bon
mit
9lu3füljrung
5. ftnan^ünb* Stnal^ünb*
fdjnur fdjnur
SBilb 16.
TetonationSftroni in
einer SRirfjtitng.
wn der Zündung
Hauptzünd*
leitung
tu den Ladungen
SBilb 17.
Ber bin ben: ^nan^ünbjrfjnitr
mit ^nal^ünbjrfjnitr.
Hauptzünd'
Leitung
Zündweiten-
Leitungen
5. b) greie (Snben ber
S?nall§ünb((f)nüre bei
feuchter Witterung
unb bei SSerroenben
unter Sßaffer fte t§ mit
Sfolierbanb unb biefe
Sfolierung bei 33 er*
menben unter Sßaffer
nodjmafö mit Stabei*
toad)3 ober gett ab*
bitten.
c) Stnall^ünbfdjnüre als
• Sünbtoeiterleitungen
bon ber 33erbinbung§*
ftelle ofjne Söerüfjren
miteinanber ober mit
Sabungen unb ofjne
Scfylingenbilbung gu
ben Sabungen fülj*
ren. 9^otfall§ bie
günbmeiterleitungen
burdj 93rettftütfdjen
boneinanber trennen
ober burd) nid)t §u
fefte 93unbe, um ben
Bünbfafc nidjt ab§u*
tüürgen, am Spreng*
gegenftanb feftlegen.
34
Einbringen ber Seitfeuerzünbung.
36. W et n bringt bie ßeitfeuerziinbung mit ber
Sprengtapfel nad) 24 Elbf. 6 in ber SJlitte ber bem
Sprenggegenftanb abgelebten Seite ber Sabung an.
Um eine borgeitige ©etonation bon Sabungen ju
bereuten, barf bie geitsünbfc^nur Weber mit ber Sabung
in Serüljrung tommen nocf) fid) jufammenroUen tonnen.
Sie geitjünbfdjnur ift baljer ftetS g e ft r e d t, j. 53. an
bünnen Störfen mit lofen Sdjlägen bon Seinengam,
feftjulegen. ©ie Seitfeuerjüribung ift fo anjubringen,
bafj fie bon ber winbabgeteijrten Seite ange«
feuert werben tann, bamit ber geuerftraljl ber brennen»
ben .Qeitäünbfdjnur nicfjt auf ßabung, Sfnatfjünbfdjnur
ober bei 3ünbübertragung (37) auf offene Spreng»
tapfeln getrieben werben tann.
©ie ßünbungen berbämmter Sabungen (44 u. 70)
fdjütjt man bürd) jpütten au§ SleeLStaljl (fRotjrifjen)
ober burcE) §oljftüde gegen ©rud (23 Slbf. 6e).
Befteljt ©efaljr, bafj 3 ü n b u n g e n j. 53. burdj
fjeinbbefdfufj ober Bombenabwurf borjeitig gejünbet
werben, fo finb fie, wenn bie taltifdje Sage bie§ juläfjt,
er ft t u r z bot bem 3 ü n b e n in bie Sabun»
gen einjufetjen.
Um bei o f f e n liegenben 9t e i tj e n labungen eine
fidjere unb boüftanbige ©etonation ju erreichen, finb
lofe Sprengtapfeln mit etwa je 1 m 3wifc^en»
raum einjufetjen, jebocf) erft natf) Einbringen ber Sabun»
gen unb Seitfeuerjünbungen.
3önbiibertragung.
37. ©urc^ ben Suftbrud einer gejünbeten Sabung
(Elnfangälabung) tann man — jebocf nur über
Eßaffer — innerhalb eines begrenzten SSirtungS»
treifeS beliebig biele, je mit einer offenen Spreng»
tapfel berfeljene Sabungen (^olgelabungen) oljne un»
mittelbare SSerbinbung mit ber 9Infang§labung jiinben
(3ünbübertragung) (Wb 18).
SBilb 18.
Sünbiibertragnng bei §olj.
1 SlnfangSIabung (AL), 3 {Jolgelabungen (FL), 3 Shnfdjenlabungen (ZL)
ßabungSberectjnung:
1 (trodene^ $olj), 15 cm 0 ß = 2 @pr.Ä.
4 L = 4 • 2............= 8 @pr. Ä.
3 Z L gu je 1 Gfcr. . = 3
Gprengmittelbebarf: 11 @pr. Ä.
8ünb ung: ßeitfeuer mit ßünbübertragung.
Sebarf an:
8ün bmitteln: 1 langer G^rengTa^feljünber;
6 Gprengfapfefn.
2Bertjeug unb ®erät: 1 Sßetfgeugtafdje; 7 m SBinbebraljt;
^olgfpäne jum ißerfpannen be£ ®raf)te§; 1 ßatte, 4,0 m lang; 4 Slägel;
1 jammer; 1 £taljn ober glofefad, bon bem au§ bie ßabungen an*
georadjt m erb en.
Kräften: 1ft ®ru|)pe.
8 eit: 1 Gtunbe.
Sille fiabungen finb am Sprenggegenftanb nacf) 42
ju befeftigen. äinifdjen ber SlnfangSlabung (Sage f.
SBilb 18) unb ben golgelabungen bürfen ficf) feine
ben Suftbrud beljinbernben ©egenftänbe wie Stein,
§ofj, ©rbe, ®ra§ ober ©eftrüp)) befinben, auSgenom»
men Sabungen an Sta^I (39). 3e^e Solgelabung ift
fo anjubringen, bafj bie Öffnung iljrer Sprengtapfel
genau auf bie öorffergeijenbe Sabung jeigt.
©ie Sprengtapfetn finb in bie Sabungen erft un»
mittelbar bor bem Bünben einjufefeen unb nadj 24
3lbf. 6 ju befeftigen.
38. @3 übertragen:
1 Sprengtörper auf 0,5 m
2—4 = > 1,0 m
5—7 - - 1,5m
8 5 =2,0 m
Sei größeren (Entfernungen finb Broifdfenlabungen
einjufc^alten unb mit je einer offenen Sprengtapfel gu
berfeljen, bie erft unmittelbar bor bem Bünben einju*
fe^en ift.
39. ©ie Bünbiibertragung wirft aud) burdj Staljl
tjinburd), wenn biefer bon ber Sabung innig berührt
unb bei itjrer ©etonation böffig burdjfdjlagen wirb.
Sei affen Sabungen, beren ©etonation burd) Sta^I tjin»
burd) auf anbere Sabungen übertragen werben foff, ift
auf ber ber SlnfangSlabung abgetetjrten Seite jur
ftdjeren Bünbübertragung nod) 1 Sprengtörper mit
Sprengtapfel anjubringen (Silb 19).
40. Sei feudjter Sßitterung ift Bünb»
Übertragung nid)t anjuwenben, weil bie offenen
Sprengtapfeln nid)t juberläffig gegen fjeudjtigteit ge«
fdjütjt werben tonnen.
Sabungäfornten.
41. $orm unb öröfje ber Sabung werben burdj ber»
fügbare Spreng» unb Bünbmittelmengen, Sräfte, Beit
unb bie Ülrt be» SprenggegenftanbeS unb ber SabungS»
anbringung beftimmt.
Slcan formt au§ mehreren $ionier=Sprengmitteln im
allgemeinen:
a) (Geballte Sabungen. SEürfelform ergibt bie hefte
SBirtung.
b) 9ieit)enlabungen. Sie ljaben eine geftredte fjorm.
87
Sie einzelnen Seile jeber Sabung müffen fiep
untereinanber eng berühren.
Silb 19.
^ünbübeitragung bei StapL
1 (tnfangSIabung, 2 golgelaöungen. Set Set SlnfangsSIabung 1 Über,
tragungöförper mit ©prengfabfel auf ber ber ßabung abgefeimten ©eite.
1,OOm -------------
Anfangsladung
Sprengkapsolzünder
Ansicht
Anfangs-u. Folgeladungen
1 ©tablträger I20.
r engmittelb eb arf 16©pr.£t
8«nb u n g: ßeitfeuer mit Sünbübertragung.
Bebarf an:
ßünbmitteln: 1 ©prengtabfelgünber; 3 ©prengfa|>feln.
Sßertjeug unb (Serät: 1 Sßertaeugtafdje; 6 m SBinbebraljt;
fcolgfeile gum SSerfpannen beS ©ra$te§.
Kräften: 1 ©ctjüfeentrupb.
8 eit: 1 Stunbe.
Unfertigen unb Slnbringen uon Sabungen.
42. a) ©ebattte Sabungen fdjnürt man mit 53inb»
faben ober ©raßt jufammen, umpüHt fie feft mit Stoff
ober üerpacft fie in 53ledj= ober §olj6eijätter. 3rei
angelegte Sabungen merben am Sprenggegenftanb
— eng unb feft mit ber größten §Iäcf)e anliegenb
(SBilb 30 a) -™ feftgebunben, burcl) iöofjlciv ober
Bionierbientt. 4
38
Srettftüdfe angeteilt, angefpreijt ober burdp Olafen»
ftüdfe ober mit Sanb gefüllte Säde feftgelegt. Sollen in
fpoljbepälter berpacfte geballte Sabungen frei an ben
Sprenggegenftanb angelegt werben, fo ift bie Slnlege»
flädpe be§ SBepälterS bünnwanbig, am beften au§ 33ledp,
IjeräufteHen. gür bie günbungen finb Öffnungen ju
laffen. Sßerben Sabungen mit Srapt befeftigt, fo finb
ipre Santen, wenn nötig, burdp Umtleiben mit Stoff
ober gwifepenfcpieben bon §oljftücfdpen gegen ger»
fcpneiben ju fcfjü^en.
Vertoenben bon SabungStäften f. 72.
Eeballte Sabungen fann man in einen Spreng»
gegenftanb, fo in SDlinentammern, audp opne Um»
fdpnürung ober Umhüllung, jebocp in enger Verüprung
ber einzelnen Seile miteinanber unb ber Sabungen mit
bem Sprenggegenftanb ganj ober fo einbringen, baß
möglicpft brei §lädpen anliegen.
b) Sleipenlabungen fteUt man burdp geftfdpnüren ber
$ionier»Sprengmittel auf Satten ober Brettern, Ein»
füllen in Stoff ober 23Iecf), audp burcf) Einfüllen in
bünnwanbige Stopre per unb legt fie wie geballte Sabun»
gen am ober im Sprenggegenftanb feft.
c) EebaHte. Sabungen ober Sleipenlabungen, bie
geworfen ober in Jpinberniffe borge»
o r a ä) t werben foltert, finb mit 23ledp, fpolj ober Stoff
fo ju umpüUen ober feftsulegen, bafj fie beim SSurf ober
beim Vorbringen nicpt auSeinanberfallen.
43. gum S dp u | gegen g e u dp t i g t e i t finb
Sabungen, bie längere geit ber Släffe auSgefeßt finb, in
gebicptete §oljtäften, Slecpbüdpfen ober fpüHen au§
wafferbidptem Stoff ju berpaden. Einwideln in
Euttaperdpapapier fdjüßt nur turje geit gegen leidjten
Stegen. ®ie EinfüfjrungSftelle ber günbung ift gut
abäubidpten. Sie VerbinbungSfteHen bon Sprenglapfel
mit günbfdpnur (ober bon Elüpgünber mit Spreng»
fabel) finb im SabungSgefäfj unterjubringen.
39
fertige Sabungen mit günbungen fcfjütjt man gegen
fjeudjtigtett jwect mäßig burd) überftreidjen mit mäßig
erwärmtem Sabelwad)§ ober burcf) Gintaudjen in mäßig
erwärmtet ®abelwad)§.
3u §eiße§ ©abelwadßs tann ©etonation ber
Sabung bewirten,
Serbämmen.
44. Serbämmen ber Sabungen burcf) Safen», ®rb»
ober Sanbfacfpadungen, aud) burcf) lofen Soben ober
Safenftüde, bei eingelaffenen Sabungen aud) burcf)
®ip§, gement ober ju öermauernbe Steine unb Ser»
fpreijen ber Öffnungen (Silb 38, 41, 41 a) erfjöfjt bie
Sprengwirtung unb fpart oft Sprengmittel (69).
Seim Serbämmen Don Sabungen ift barauf ju
achten, baß Weber Sprengtapfel nod) 3ünbfd)nur ge»
brüdt werben (36).
SBaijl bet ßünbung^art
45. ©ie 2Irt ber 3ünbung, ob burd) Seitfeuer in ober
oßne Serbinbung mit ^naffjünbfcßnüren, Seitfeuer mit
Bünbübertragung, elettrifd) ober burd) Serbinnen biefer
3ünbung§arten, bejtimmt man nad) ber Sage, ben bor»
fjanbenen 3ünbmitteln, bem SJSetter (40) unb banad), ob
man über ober unter Sßaffer fprengt (37). Sei wid)»
tigen Sprengungen bringt man eine Sefervegünbung
an, bie bei Seitfeuer wie bie ^auptgiinbung fjcrju»
(teilen unb g I e i d) 3 e i t i g mit ißr anjufeuern
ift (521).
Slanlabungen, Sdjnellabimgen.
46. 3eit jum Sorbereiten bon Spreu»
gungen gewinnt man, wenn man fdjon bor
bem Starfd) ober wäfjrenb be§ Slarfd)e§ jur Spreng»
fteüe 3 ü n b u n g e n (3. S. burd) Serbinben öon
Sprengtapfeljünber mit fi'naUjünbfdfinur [biefe 3ün=
bung ift bann ju tragen, 24]) unb (Scfjneltabungen (47)
4*
40
do r bereitet, ferner ® e r ä t zum SInbringen Don
Sabungen unb Sünbungen fotoie SSerbämmungn*
ftoffe b e i t r e i b t.
Sorgfältigen SSorbcreiten befdjleunigt ©urdjfüljren
jeber Sprengung.
47. §at man Seit, bertoenbet man bie Spreng*
mittel fo fparfam toie möglid) 0PIanlabung). 9?ad)
bem Srredjnen ben SRinbeftbebarfn an Sprengmitteln
bringt man biefe am Sprenggegenftanb fo an ober ein,
bafj gröfjte SBirtung erhielt toirb (48).
Sft bie Sage ungetlärt ober pat man feine
Seit, fo tann man mit Sprengmitteln, bie bann
immer f d) n e 11 am Sprenggegenftanb anzubringen
finb (Sdjndfabungen), nid)t fparen. SRan bringt biefe
Sabungen (geballte Sabungen — j. 53. einen ober
mehrere bolle Sprengmitteltäften — ober Steiljenlabmv
gen mit borbereiteter Seitfeuerzünbung) an einem obei
mehreren ber toidjtigften SEeile ben SprenggegenftanbcS
(48 u. 64) an.
®ie Sprengtoirtung toirb bann immer jum Saljm*
legen ben ®ifenbal)nberfel)r3, meift §um Sapmlegen
ben 53ertepr£ bon Kraftfahrzeugen unb pferbebefpann®
ten Fahrzeugen, iebodj nur feiten %um SSerpinbern
einen übergangen bon S^ü^en aunreidjen.
Slnbert fid) eine ungetlärte Sage fo, bafj man fidjer
Seit getoinnt, fo baut man Scpnellabungen in $Ian*
labungen um.
2. Xrennfdjnitte.
48. 53eim Sprengen foHen bie Sprenggafe ben
Sprenggegenftanb fo burdjfdjneiben, bafj er zufammen*
brid)t ober abftürzt. Su9e beabsichtigten
Sd)nitte§ (Xrennfdjnitt) bringt man bie Sabung ober
bie Sabungen an. ©ie ©rennfdjnitte (53ilb 20—27)
legt man ftetn fo, baft bei ^lanlabungen (47), alfo bei
gering ft emSIuftoanb an ^ionier^Sprengmitteln,
größte SSirfung erhielt toirb. ©rennfdjnitte finb
41
bei SBrüden burcf) bie ©fügen (SBilb 25) ober burd) bie
©auptträger beS Überbaues (Silb 21) einer ober mehs
rerer ©tügtoeiten ju führen, 2Ran fprcngt in ber
Siegel bei Srüden:
a) unter 20 m ©tügroeite
bei burdjlaufenbem
überbau
t>) über 20 m ©tügroeite
bei burdjlaufenben Sal»
len, fjachroertträgern
ober Sogen
e) Wie bei b), aber mit
©elenlen im überbau,
bei nid)t burdjlaufen»
ben Salten, $adjtoert=>
trägem ober Sogen
4) bei äßangel an ©preng=
unb günbmitteln, geh5
len bon SRinentam»
mern in ben ©fügen
unb bei SRangel an geit
2 benachbarte ©fügen (bei
llferbrüden bie Sßiber»
lager);
audj biefen;
1 ©füge unb ben an-
fdjliejjenben Überbau an
ein bis jroei ©teilen;
1 ©füge ober ben überbau
an einer ober mehreren
©teilen;
bei S rüden nad) a)—c):
ben überbau an einer
ober mehreren ©teilen.
49. ©rennfdjnitte burdj ftäglernen (eifernen) Srüden=
überbau (62).
a) ©rüget aus I=©tagl (®oppel=T=©räger) ober ge=
nietete Sledjfräger (Silb 20).
Er. 1: gallS SDlinentammern in ben SBiberlagern oor=
ganben, roirtfamfte gerftörung ber Srüde burch
3x 1. (Erfolg: ©infturj beiber SBiberlager, ber
überbau ftürjt ab. gum SBiebergerftellen ber
Srüde müffen neue Sßiberlager gebaut werben.
Xr. 2: ©er ©rennfdjnitt ift näher an F (fefteS 9luf=
lager) als an B (bewegliches Sluflager) ju legen,
unb jjioar fo, bafj ber Überbau möglidjft auf bie
42
tieffte Stelle be§ glufcgrunbeS (Untergel&nbeS)
abftür^t.
Söilb 20.
Genieteter QSIedjträger.
“ Wirkung bei Tn 2
Tr> Trennschnitt
F• Festes Auflagen
B » Bewegliches Auflagen
SBet ^Brüden mit furjen Stüfemeiten ift ftetS gerftören
eine3 3ßiberlager§ unb be3 überbauet anjuftreben,
ba man baburd) ba£ SSieber^erfteHen befonberS erfdjWert
b) gadjroertträger (33ilb 21—24).
53ilb 21.
parallel = garfjtoertträger.
43
<8ilb21a. Sremtfdjnitt.
Tbennschnift
schräg zur*
ßrückenachsel
i ^oupffpägep
i I \7 i-t
^Brüchen»
2~ächse
Fahrbahn - ।
fängslnäger I
Trennschnitt
\schnacj zum
•j Seitenansicht
।
Fahrbahnquen*
Draufsicht
58tlb 22« 2ra|)es»3aifjtoertträger.
Söilb 23« ^arabehgarfjivertträger.
SBilb 24. $alb|mrabel s garfjivertträger.
44
Stärtfte Seile beS überbauet liegen in ber SRitte.
®runbfag: Srennfdjnitt f dj r a g j u m eIb
unb jur Srüdenadjfe (Silb 21 a) legen, um
Verfangen ber Überbauteile beim Sprengen ju ber-
l)inbern.
SBirtung bei Sr. 1: wie 49 a; bei Sr. 2 ober 3: 5Hb-
fturj beS überbauet. Sr. 2 toftet m e lj r Sprengmittel
als Sr. 3, ba er im ftärtften Seil beS Überbaues liegt
50. Srennicfjnitte bei Sriitfen aus Stein ober Seton
a) © i I b 25.
Silb 25.
Sogenbrüde au§ Stein ober tBeton.
Sr. 1 (äRinentammern): Sei Sprengen beS Pfeilers
ftürjen biefer unb bie anfdjliefjenben Sogen, bei
Sprengen eines SßiberlagerS biefeS unb oer an-
fdjliejjenbe Sogen ein.
Sr. 2: SReift geringer Erfolg, fdjlagt nur ein Heine?
£odj (etwa 2 W, bgl. 67) in ben Sogen.
Sr. 3: Sei nicf)t ju Heiner Stützweite ftürjt ber gröfjte
Seil beS SogenS ein. Sr. 3 ift nidjt ju bidjt an
baS SBiberlager ju legen, ba baS ©ewölbe bort
fepr ftarf ift, fonbern im allgemeinen ein ©rittel
ber Stützweite bon üBiberlager ober Stü$e
(^Pfeiler) entfernt. Sei ftarf gewölbten Sogen
mit furjer Stüfjweite finb jebotp 2 Srennfdjnith
erforberltcf) (Silb 316).
45
b) Silb 26.
St.: Selbe Sogen ftürgen ein.
Sßtlb 26.
Kogenbrüde au§ Stein ober %eton.
Brückenauge
£ Ladung (mit Sandsäcken verdämmt)
&• Gelenk
®a? ®elent liegt in einer quer burd) ben gefaulten
überbau geljenben f?uge (Silb 41), bie man meift
— am leiinteften unter ber Srüdenbede — an bem in
ber guge liegenben Sauftoff (j. S. bünne Sleiplatte) er»
fennen tann. Seim Stoeigelentbogen feljlt
ba? ®elent in ber Sftitte be? Sogen?. Sprengen eine?
®elent? (Sr. 2 ober Xr. 3) ober be? Sogen? an belie»
biger Steife — fdjiuädjfter Querfcfjnitt in Selent»
näije — bringt ben ganzen Sogen, Sprengen eine?
Sßiberlager? ($r. 1) ba? SBiberlager unb ben ganzen
Sogen, Sprengen beiber SBiberlager bie ganje Srüde
yxm ©infturj.
46
Gr. 1 (Wnenfammern): Einfturj ber ganzen 33rüde.
Gr. 2 ober 3: ßinfturg be§ SogenS.
51. Sprengungen, beren Ergebnis
nicfjt bem Auftrag unb bem Slufioanb an
Sionier»Sprengmitteln e n t f p r i dj t, 8-
geringes Sefdjäbigen größerer Srütfen ober Aerftören
Heiner Srüden ober Surdjläffe, finb falfa). SÄan
löft bann beffer ben Auftrag mit anberen Sperr»
mitteln.
3. ßrfunben, Sprengpläne.
52. Um ben SlrbeitSgang unb ben Sebarf an
$tonier=Spreng= unb Bünbmitteln, an ®erät, SSert»
jeng, Kräften unb Seit feftpfteHen unb feftplegen,
finb für größere Sprengungen im allgemeinen Spreng»
plane natf) Silb 28—28 c aufpftellen.
Um geinbe ift immer f d> r i f 11 i dj feftplegen (13,
15 u. 16):
a) SSeldjer Müßtet befiehlt bie Bünbung ober mann
ift p pnben (genaue Ußrjeit)?
Garf ber Spreng» ober Bünbtrupp
(53) bei einem Eingriff auf bie.Srüde felbftänbig
pnben ober nidjt?
b) SBer fidjert bie Sprengborbereitungen?
c) 2ßie ift bie Serbinbung p bem Gruppenführer, ber
ba§ Bünben befiehlt, unb p ben SidjerungStrup»
pen für bie Sprengöorbereitungen p hatten?
d) Sei eleltrifcher Bünbung: Sage ber ßiinb»
fteHe (520).
e) Auftrag für ben Spreng» ober günbtrupp nad) ber
Sprengung.
^Reibungen über ßrfunben für Sprengungen finb
äljnlid) mie Sprengpläne abpfaffen unb burch Stijjer
,p erläutern.
47
S8tlb 28.
®|)tcng|)lan für eine Stratjenbrüde.
deMeldg.
Abgeg,.
Ort
lag
~1öl
Zeit
Angek.
Absendestelle
'ÜM9rfMi&
JJC
t/ttk 1b
An 1./tf.&.l&
1» ~
300m 'tfhv.Cl.- %***
_______ ___»a.. „^'1^ fi... H'P'MJ
4,&xj.i.vpfypr i[Bild28aJ
i^w» 2 [Bild 28b J
Ü- TKttyfirt'L3* *- 2< 2
62** * • "6»3 -
8- .• 18 tfpr-. t
_ 4^ z^»r. <£.
9. t f Tfyf. - fy}
*) ßttge ber Überbau ntdji auf felfigem Soben, fonbem auf gemauerten
SBib erlag em auf, fo mären biefe gu fprengen, unb gmar burdj Einbringen
bon 2 geballten Sabungen (W = 1,5 m, L — 13,4 kg, 2 L — 26,8 kg) an
Me Äufcenfeite eines SöiberlagerS in bort gegrabenen unb fobann ber-
bämmten Sägern (bgL 93ilb 28 b).
3tt Silb 28.
1 25000 f 50000 1-100000
"0 250 500 - 750 1000% 'S 500 100Öm *6 1 2 3
10-a < ’2$äi vMct i <s8ir>
i<r& >44 26
Mw UpM* % ?K>1 ^c»f y<7- r ~ •
'rl^ <&£vt =^r7 ^t<5i V fi» ?#•/ A^4>.
faxt m & cm^ ’yn"* *- Qt Ifiut
Srff/ tH' J. rtr““ ^E£
*&.
2L< nsp^, • XW'I -Wl' KW# »ti
?<&? <?. < dtSlc. ar j Q»* <ii- C H M-
hur^t Jhhiki »9*« r Zdt
WH' C 'H'H. t^Q 9»f. < '3^ ttM' .
f2. 4-ü
73, Övntt Mlrtpi wt& ^t£. 'fyttK >£11 ttf*' i. '%&&& » f(\. >4<J. 3
74 tf&fa zW-, It^i KJift a?
rttw &Mtl <r /V*
t: f 4T MflMt. LZz
Die nicht benutzten Maßstäbe durchstreichen.
49
ffiilb 28a.
Sagenftijje bet Stra&enbrüöe jum Sprengplan.
®§ ift |tet§ fo frü§ tote Tnöglicfj p erlunben. Sei
SBrücten tommt e§ barauf an, feftpfteHen:
a) £ a g e bei ber feinbmärtS eingefeijten eigenen
Gruppe, Serbinbung p biefer.
Sinfatj ber 9? a ij f i d) e r u n g (SidjerungSpoften)
für bie Sperrborbereitung ber SBrüde, and) burcf)
Sperren bor unb hinter ber Srüde, *. SB. burd)
Knollen (SBilb 48).
b) SBauart unb Untergelanbe ber SBrüde,
SB o r f ä) I a g für SLrennfdjnitte beim Sprengen
ober für anbereS Serftören.
£ a g e bon SRinentammern ober SB o r -
tidjtungen pm Einbringen bon ßabungen.
50
S3ilb 28 b.
Blttfidjt bet dritte jum ejircitglifott*
jSe««« 2 Tn
S8tlb 28 c.
£abung§* nnb Sünbftiföe junt @|jreng|)latt.
günbung in einem ghnftfienraum be§ S9elage3 311m redjten fftöbelbalten
(Slufcenfante) geführt ©ra^tftüct am Slbreifering be3 langen Sprengtapfel*
äünberS befeftigt um Slbreifeen gu erleidjtern.
Spr. B. Drahtbundt
51
c) fjunborte öon 33auftoffen für Serbäm»
men unb für Sau bon Serüften jum Elnbrin»
gen ber Sabungen. fjunborte für ES e r t j e u g
unb ® e r ä t.
d) Sage ber 3 ü n b ft e 11 e ober be§ Sammel»
p u n 11 e § für ben Bünbtrupp.
e) SorauSfidjtliCher Sprengerfolg.
§injujufügen ift: Sorfdjlag für Sebarf an
Prüften, $ionier»Spreng= unb Bünbmitteln, Eßert»
jeug unb ©erät, Elnfdjlag für ßeitbebarf.
Sorbereiten unb SurChführen bon Sprengungen bür»
fen burcf) Oluf (teilen bon Sprengplänen n i tf) t ber»
jögert »erben.
53. Sie jum Sprengen einer Srüde eingefeijten
Kräfte nennt man Sprengtrupp. Seine Stärte wedifelt
im allgemeinen jwifd)en einer öruppe unb einem Buge.
Sei großen Srüden muß man ftärfere Kräfte einfetjen.
SRan teilt ben Sprengtrupp junädjft jum Sorbetei»
ten ber Srüde jur Sprengung ein. ©a§ Sor»
bereiten umfafjt:
Sinfaij bon Sicherungen gegen ®rb= unb Suftgegner
unb bon $often jur unmittelbaren Sicherung ber
Sperrarbeiten;
Segen bon Sperren, j. S. gegen feinblidje ißanjer»
fpäljioagen;
Einbringen ber Sabungen (42);
Einfertigen, Wenn möglich (36) auCh Einbringen
ber Bünbung ober Bünbuugen.
Sft eine Srüde jum Sprengen borbereitet, fo genügen
jum Bünben ein Rührer (Unterführer) unb wenige
Seute (ber Bünbtrupp).
54. SSicEjtig ift bauernbe f i eh e r e Serbinbung
jwiidjen Sprengtrupp, nach beffen Elbmarfd) jwifchen
Bünbtrupp unb bem Rührer, ber ba§ Büni>en befiehlt.
Ser Serbleib be§ Sprengtrupps unb be§ BünbtruppS
nadh erfüllter Slufgabe ift ju regeln.
52
gür ben Sünbtrupp ift bei Seitfeuerjünbung als
erfter Sammelpu n tt nacf) bem günben ein gegen
Sprengtrümmer unb Suftbrudwirtung gefdjüfeter Sßlafc
ju beftimmen (clettrifdje $ünbung f. 520).
55. Ser ßrfolg jeber Sprengung ift bem Gruppen»
führet unb bem unmittelbaren SBorgefefjten gu tnelben.
4. Sprengen von §olj unb von §olgbrücten.
56. $olgbriicfen finb nur bann ju fprengen, wenn
,’Jerftören auf anbere SBeife, j. SB. burdj Slbbrennen ober
ilbbredjen (91 ff.), auch burdj 9lnbohren fchwimmen»
ber Stützen, wegen ber taftifdjen Sage ober aus 3Kan»
gel an $eit, Kräften unb Mitteln nicfjt möglich ift.
57. SÖtüffen Sßfaljljodjbriiäen g e f p r e n g t werben,
fo finb im allgemeinen jwei benachbarte Sodje unb bie
ju ben fteljenbleibenben 3D(hen füljrenben Sragbalten
,ju fprengen. SRöbelung unb Selanber biefer Streifen
finb bor bem Sprengen ju löfen. Sßfäljle ber 3°<he
fprengt man fo fdjräg nach unterftrom, bafj ber über*
bau abrutfcfjt unb nicht mehr bom ®egner gum über»
gang bon Schüßen benutzt Werben tann.
Schnellabungen legt man auf bie SBrücfenbecfe ent»
Weber als geballte Sabungen über Sßfahljoche ober als
iReihenlabungen gwifchen gwei ober mehrere Sßfahljoche.
58. Sie ® r ö fj e ber Sabungen für ^olgfpren»
gen ift nach ber <*otgtafel gu beftimmen (Safel 1). gebe
Sabung ift auf bolle Sprengtörper aufgurunben.
59. 23ei ^antholg Wirb
bie Sabung im allgemeinen
quer über bie SBreitfeite,
bei SRunbhoIg ringförmig,
jeboch nicht über gwei
Srittel be§ Umfanges hin*
au§, ober in gebauter
§orm angebracht (®ilb 29
bis 30 a).
93ilb 29. tttnbringen ber Sabung
an Santljolj.
53
«üb 30.
MingförmigeS Wnbringen
ber Sabung an tRunb^Dlg.
«ilb 30a.
Wnbriugen ber Sabung an
Bunb^olj in geballter gorut.
30cm
Um baä Einbringen öon Sabungen an Stunbljöljern
*u üereinfadjen, flatfjt man bie Stunbljoljer nadj
Silb 30 a ab.
Sie ^oljtafel ift jufammengeftettt nacf) ber Jormel:
L=D2=gq3i.ept. mt| D2 f. Safel 9.
g — ©ramm,
D bei Stunbbölgern = Surctjmeffer in Zentimetern,
bei Santgoljern = größte Seitenabmeffung in
Zentimetern,
bei jufammengefeßten §öljern mirb jebe§ ein»
jein gemeffen.
Znfdjläge:
bei frifeßem, jäßem ober aft» 1
teigem ^olj: I
bi£ 29 cm — % L I in g
non 30 cm ab = 2/3 L | ?ßi. Spr. 2R.
bei troefenem £olj: I
non 30 cm ab = */3 L J
Sdjnettabungen für ^oljbrücfen:
h) geballte Sabungen öon je etwa 25 kg
(1 SPaften $ionier=SprengmitteI) mitten in einem
UmtreiS öon etma 2 m jerfeßmetternb.
^ionierMenft
5
54
b) iReiljenlabungen finb fo anjufertigen, bafj
Sragbalten unb Selag im Srennfdjnitt burdj»
fdjlagen merben, alfo über ben Sragballen megr
$ionier=Sprengmittel liegen al§ über bem Sclag.
60. Seifpiel:
Uferbrüde nadj Silb 31 ift gegen alle geinbmaffen
burdj Sprengung ju fperren.
Sßilb 31. 4=t sUferbrüite mit 2abung§s unb Sünbftijje.
Seitenansicht Schnitt
Ladungs-u. Zündsktzz^
a) Sie Srüde ioirb nodj 3 St unben nadj
@ r teile n b e § 2luftrage3 bon eigenen
Gruppen benufct.
Verfügbar:
Prüfte: 1 Sruppe.
Sprengmittel: 10 kg $ionier=Sprengmittel
(50 Sprengtörper).
ßünbmittel: 1 ^ünbmitteltaften.
Spreng® unb 3ünbmittel in 3tä^e ber Srüde.
3erftören burdj Sprengen ber Xrag«
ballen (Slanlabung).
3 ü n b u n g: fieitfeuer in Serbinbung mit ßnatt»
äünbfdjnur unb 3ünbübertragung.
L jebe§ $ragbalfen§ nad) ber §oljtafel = 0,8 kg
= 4 Sprengtörper ober 1 Sprengbüdjfe.
»
59eb arf an:
Pionier »Sprengmitteln: 20 Spreng»
förper ober 5 Sprengbüdjfen.
Bünbmitteln: 1 Sprengtapfeljünber; &
Sprengtapfeln; 8 m SnaKaünbfctinur.
SBertjeug unb Serät: 1 SBertjeugtafdje
jum Unfertigen ber ßünbungen; 20 m iöraljt,
2 mm ftart, jum SInbinben ber Sabungen;
2 SBredjftangen; 1 Säge; 2 Stjte; 2 Keile;
2 Sctjraubenfdjlüffel jjum Söfen ber Stöbel»
balten unb beS SelänberS; 1 Kahn; 1 SBrett, 4 bc
lang; 10 SBrettftüddjen, 0,30 m lang; 16 SBrett»
ftüddjen, 0,70 m lang; 10 SRägel; 1 §anbfäge.
Iruppeinteilung:
2 SRann mit 1.3K. ®. al§ SidjerungSpoften;
1 Srupp ju 2 ©tann: Söfen unb SBefeitigen bet
SRöbelbalten unb be§ SelänberS;
2 Trupps ju je 2 ®tann: Unfertigen unb 2ln»
bringen ber Sabungen;
1 Srupp ju 2 Sftann: Unfertigen ber Bünbungen;
2 galjrer für ben Katin, öon bem au§ bie Sabun»
gen angebracht werben.
Seit: 3 Stunben.
b) SBrüde wie a), jebodj öerfügbareBeit turj.
Berftörungburcf) SprengenbeSüber»
baue§ in 2luf!agernätje burd) 9luffteUen
eines bollen SprengmitteltaftenS in ^ahrba^n»
mitte, fobalb SBefeljI jur Sprengung eingeht
(Sdinellabung).
Bünbung: 1 furjer Sprengtapfeljünber.
®rforberlitf)e Sräfte unb Beit: % ®ruppe,
5 Minuten. Sinb weitere Kräfte berfügbar,
fo legen fie SBerbämmungSftoffe bereit.
5*
56
5. Sprengen trnn Stal)! (ßifen) unb Sriicten mit
ftttylernem (eifernem) überbau.
61. 33et Stal)l= (Gifen=) Sprengungen bringt man
bie Sabungen roie folgt an:
S3ilb 32.
Hnbringenitt
Sabungen a«
Stabt (6ijen).
a) Sei $roftlftal)l nacf) Silb 32 fo über eine ganje
glädje be§ ju burqjfctilagenben Duerf(f)nitt§, bajj
bie Sabungen nur einseitig mitten. gufam»
mengenietete Seile gelten babei a!3 ein Einer»
fdjnitt.
«Btlb 33.
Berfefcte Sabung bei Jrägern mit breitem glanfif).
57
23ei ungleichmäßig ftartem Querfchnitt finb bie
$ionier=Sprengmtttel fo ju berteilen, bafj an ben
ftärteren ©teilen metjr angebracht ioerben al» an
ben fjhtoädjeren (33ilb 36).
33ei S r ä g e r n mit f e h r breiten l a n»
f dj e n genügen oft einfeitig angebrachte Sabungen
nicht jum Surchfcplagen be§ Stahles. tpier werben
bie Sabungen geteilt unb auf Schermirtung fo
gegeneinander berfeht (23ilb 33 unb 309 ff.), bafj
bie inneren SabungSfanten fid) unmittelbar gegen»
überliegen (23 Slbf. 4).
b) Sei hohlen Duerfthnitten (Köhren, Säulen ober
’ßfoften) auf etwa jioet Srittel beS UmfangeS als
Keiljenlabung. Sie Sabung erhält jur fieberen
3ünbung noch einige offene Sprengtapfeln (Selb 34).
S8Ub 35. Wnjlnei^cn bet
Sabung bei ^rofilfta^l.
Drahtbund
Ladung.
(SprK.)
Brett, Klotz
zum Verspannen
werben (33ilb 35).
34. 9teihenlabungen
bei hohlen £uterf<fjhitten
(Spr. $?. in 2 Keipen).
Spreng-
kapsel
Spreng-
kapsel
$ebe Sabung muß ben Stahl
(baS ®ifen) feft berühren unb
baju angefpreijt ober angebunben
Unlieben mit erwärmtem ©abelwadjS (43) ober 2ln»
leimen mit einer SJtifdjung auS 1 Seil Sdflämmtreibe
unb 4 Seilen Sifchlerleim ift Kotbehelf.
33efinben fid) inber9lnlegef[ächeKiettöpfe,fo finbSpreng»
törper fo auSjuhöljlen, Sprengbüchfen borfid)tig fo ein»
jubrüden, bafj bie Sabungen feft angelegt werben tönnen.
58
62. Sa§ $aupttragwert ftä^Ierner (e i f e r n e r)
23rüdenüberbauten Beftelji bei Heineren 23rüden
oft nur au§ I=Srägern al§ Sragbalten, auf benen bie
galjrbaljn (23elag ober Eljauffierung) ruljt. 23ei fotdjen
«rüden finb, wenn man bie SBiberlager nid^t fprengen
tann, fämtlidEje Srager ju fprengen.
©röfjere Srücten ljaben gadjtnertträger ober
genietete 23Iedjtrager al§ §aupttragmerl.
Sprengen biefer Präger genügt jum Sperren be§ yfatjr»
berte^rS.
63. 23ilb 36 geigt bie gebrüudjlid> ften
1 = S r ü g e r foioie bie SlnbringungSart unb SRenge
ber jum Sprengen benötigten 2ßionier»SprengmitteL
64. Sie bon ber 3 n f a n t e r i e mitgefüfjrte SRenge
an $ionier»Sprengmitte!n reidjt jum gerftören
großer Staljlbrüden n i dj t au§. ©ie§ ift Sadje ber
Pioniere, ber ©abatterie unb ©raflfafjrtampfrruppen
(f. Seil IX).
Sermenben bon Sdjnellabungen, j. 23. je 1 boller
Sprengmitteltaften am Dber= unb untergurt ber einen
23rüdenfeite unb am Dbergurt ber anberen 23rüdenfeite
f. 47 u. 23ilb 37.
65. günbübertragungbei Staljl f. 39.
ßnnitteln non Sabungen für Staljlfprengungen L
Safetn 2—4.
formet für Staljl (CHfen):
L = F • 25
L = in g $i. Spr. SR.
F = ju burdjfcljlagenber Eluerfcfjnitt in Ouabrat»
Zentimetern.
23eifpiel für 33eredjnen genieteter 23ledjtrager {. 528.
gebe Stfjnetlabung ift je nadj ber Sröfje iljreit
23erüljrung§flä(f)e mit bem ju burdjftfjlagenben Quer«
fdjnitt um */« bi3 Vs größer ju nehmen al§ bie für bem
59
ȟb 36.
Stätte unb Einbringen bet Sabungen bei trägem.
• ffJpr.K.
3,0kg Pi.SpnM. -i#d-38kg PiSpnM.
= 15Spr.K. *fgSpnK.
ac 'm'0^ kgP‘
^kgPl.Spr.M. ^7S K
23Spi>.K.
58ilb 37.
Saijntlegen be§ Staftfaljrs unb gifenbaljnberteljrb butdj
Sbtengen mit «cfjnellabungen in Pionier=<S))renfltnittel»
läften an 2 Cbetgutien unb t Untergurt.
60
gleichen Ouerfchnitt errechnete ober nach ben Safeln
bestimmte ^lanlabung.
Jauftregel für Staljlfprengen:
1. 3e Ouabratjentimeter = 25 g ^ßi- Spr. SR.
2. Stahlbrücfen: je SReter Stütjroeite 4 kg, bet roeit»
gekannten 33rücten weniger (bis 1 kg je SReter).
3. Sifenbahnfchienen, tperjftüde ober SBeichen = 1 kg
ißt. Spr. SR. (1 Spr. 93.).
6. Sprengen von SJinuertoerf, 93eton unb ©eftein unb
von ükücten auS btejen Sauftofjen.
66. SRauerroert, QJeton unb ®eftein werben in einem
ber ®röfje ber Sabung entfpredjenben Umfange ger»
trümmert, barüber hinaus noch erfdjüttert, (Srbe roirb
fortgefcfjleubert.
SRan öerwenbet im allgemeinen geballte
Sabungen.
67. Sie (Sröfje ber Sabung roirb in erfter
Sinie burch ben §albmeffer (W) beS beabfidjtigten
SBirtungStreifeS ber Sprengung beftimmt (33ilb 40).
Siefer ßreiS ljat feinen SRittelpuntt bei einer im
Innern beS SprenggegenftanbeS eingelaffenen Sabung
in ihrer SRitte, bei einer frei angelegten ober nur
bünbig eingelaffenen Sabung an ber Slufjenfladje beS
SprenggegenftanbeS (Safel 5 u. 7).
Sie SßirtungSfreife Jollen bie Slufjenflädje beS
Sprenggegenftanb eS unb ficf> 9e0enfeittg berühren
(93ilb 40) ober etwas überfchneiben (23ilb 41 a), b. h-
bie Sabungen finb 1W öon ben Slufjenflächen unb ettoa
l*/z bis 2W öoneinanber entfernt einpbringen.
68. Sie Sabungen finb möglichft in baS innere
beS SprenggegenftanbeS einjubringen. SZur bei SRangel
an Seit ober SBertjeug ioerben bie Sabungen bünbig
eingelaffen ober frei angelegt.
61
69. Stets ift SBerbärnmen aller Sabungen anju=
ftreben. 3e nad) ber Starte ber Serbämmung (44)
toirb ein Sßert d (73) in bie Sprengformel eingefe|t
(Safel 7).
70. SBäljrenb b e § SerbümmenS ift barauf
ju adjten, bafj bie Bünbungen tneber au§ ben Sabungen
perauSgeriffen nod) befdjäbigt werben (36).
71. 3iegelmauern bis 1 m Starte fjirengt man aud)
burd) Steitjenlabungen, bie man am SRauerfufj, wenn
möglidj mit Jgoljfpreijen ober fßfäljlen, feftlegt unb
burd) Slnfdjütten bon ®rbe ober 9lufpatfen bon 9tafen=
ftüden ober Sanbfäden berbämmt (93ilb 38 u. Safet 6
u. 7).
®ilb 38.
dteHjenlabung an ©lauer, burd) pfähle feftgelegt
unb mit 6rbe ober 9tafen berbämmt.
72. Srütfen ober Pfeiler au§ SKauermert ober Seton
tann eine Sruppe, bie nid)t über Soljrgerät berfügt,
im allgemeinen nur bann fprengen, wenn fid) in ben
SSibertagern ober Pfeilern borbereitete Stiinenanlagen
(TOnenrofjre, Kammern, =ftollen, =f(^ad)te) befinben
(8ilb 39).
3ebe SSrücte ift baljer aufborl)anbene3)tinen =
anlagen ju unterfudjen. ‘Jüan ertennt berblenbete
62
3Kinenanlagen am fjofjlcn Slang beim Slbtlopfen bei
^feiler (SBänbe unb Slbbedplatten). Sei SRinenanlagen
finbet man oft and) Sabung§täften. ®iefe finb barm
93ilb 39.
SRittenanlagen in Pfeilern.
jum Einbringen ber Sabung auSjunußen. S)te Stöße
ber Sabungen ift oft auf ben Säften angefcfirieben. Ser»
bleiben bei Sabungen au§ Sionier=®prengmitteln £>oljl»
räume in ben SabungStäften, fo finb fie mit §oljftüden,
@anb ober Erbe auSjufüllen.
Eifenbetonbrüden tonnen nur burcf; Pioniere ge»
fprengt werben.
älierfmale für:
Setonbrüden (nur Sogenbrüden): turje Stüfv
weiten, große Sewölbeftärten, meift ftarte SBölbung
ber 23ogen.
Eifenbetonbrüden: oft große Stüßweiten;
Überbauten: SBogen ober Salten. Sogenbrüden finb
meift f d> w a d) gewölbt unb bon geringer Stärte. Set
63
©rüden mit ©ifenbetonüberbau finb jumeilen 38iber=
lager unb Stufen nur au§ Seton (große Starten;
gebaut.
73. Sian menbet folgenbe Sabungäarten an:
a) geballte Sabungen (Stegeiform) (66),
b) SReiljenlabungen (nur bei Stauern ober ©emölben
bi§ 1 m Störte).
Sie ®rößen geballter Sabungen mer =
ben ber S a f e I 5 entnommen. Sie ®röße
errechneter Sabungen i»ei<f)t jum Seil bon ber
nach Safel 5 ab, ba in biefer für c (f. formet) 3wifd)en=
werte jugrunbe gelegt mürben.
SebaUte Sabungen finb in ben Slinentammern mit
Spreijen, teilen, Steinen ober Stafenftüden feftjulegen,
bie Zugänge, menn irgenb möglich, ju berbämmen (44)
ober ju berfpreijen. $ed)tjeitige§ ©ereitfteüen ber 53er=
bämmungSmittel ift mid)tig.
Qn Siauermerf, feftem Seftetn unb 53eton berbämmt
man am jroedmäßigften burd) ßumauern mit fthneü
binbenbem ®ip§.
Formel für gebaute Sabungen:
L = W3-c.d
L = Sabung in Kilogramm $i. Spr. St.
W — 23irtung§httlbmeffer in Stetem (67).
o = $eftigteit§jal)I, mectjfelnb nach ber ^eftigteit beä
©auftoffeS, ber Selaftung be§ ju fprengenben
®egenftanbe§ unb ber Sröfje be§ W (Safel 8).
d = SSerbämmungSjahl, abhängig bon Sage ber
Sabung unb Stärte ber Serbämmung (Safel 7).
®erte für W2 unb W3 f. Safet 10. .
64
74. »eifpiel (S3ilb 40):
SSilfa 40.
»tädenpfeiler mit SRinentammern.
$00 m
Schnitt A-B
tBrüdenpfeiler, 9 m Breit, 2 m ftarf, au§ Duaber»
fteinen, SJlinentammern borfjanben, ift ju fprengen.
W = 1, d = l.
3laä) Tafel 5 ergibt fict) für jebe Sabung: I» = 6,24 kg
rb. 6,4 kg = 32 Spr. &
SprengmittelBebarf: 4 L = 4 X 6,4 kg
= 25,6 kg = 128 ®pr.®. (ober 4X7 Spr.33. =
28 ®pr. 33.).
65
8 ü n b u n g : §aupt» unb fReferuejünbung: Seitfeuer
in SBerbtnbung mit fi’uaüjünbfc^nur.
93 e b a r f an:
Sünbmitteln: 1 Sprengtapfeljüuber (lang);
t Sprengtapfeln; 15 m fi'naffjünbftfjuur (gleiche 3Ren=
^tn al£ iReferoejünbung).
•’Bertjeug unb S e r ä t:
a) für Einbringen ber Sabung: Käfjne ober Heine
^lofjfärfe ober ein Serüft au§ Seilern unb 93ret=
lern, ba3 man mit Sauen am 93rüdengelänbet
bcfeftigt (526, 527);
b) für Sabungen au§ Sprenglörpcrn: 4 93erpadung§=
lüften (Snnenraum 14 X 16 X 20 cm) ober füllen
aus Stoff; 1 SSerfgeugtafcfje; 1 Säge; 1 93eil;
e) für SSerbämmen: ®ip§ ober Slafenftüde.
ferner Sretter jum SBerfpreijen.
Seit: für Saben unb 93erbämmen 3 Stunben.
Kräften: 1 ©rappe. Einteilung:
Sdjüfce 1 unb 2 mit I. SOI. ®.: SidjerungSpoften;
4 SRann: 93au beä ®erüfte§, fpäter Einbringen unb
SSerbämmen ber Sabungen unb ßünbungen;
2 äRann: Unfertigen ber Sabungen;
4 äRann: Slnfertigen ber Salbungen, SBereitfteHen
ber SßerbämmungSftoffe.
®orau§iid)tli(ijer Sprengerfolg: Einfturj be§
Pfeilers unb Slbfturj ber beiben auf bem Pfeiler ge=
lagerten überbauten.
66
75. »eifpiel (Silb 41 u. 41 a):
§lci(f) gekannte S3etonbogenbrude mit 3 ®e»
lenlen ift fdjnell (Sc^nellabung) burcf) 5ßionter=<5preng»
mittel ju jerftören.
SBilb 41.
5tarf)flef|)annte ^etotfSogenbtiide.
58ilb 41a.
erfjnitt A—B.
ßabung§bered)nung:
W = 1,25, c = 6,24, d = 3,5.
L = 1,253 • 6,24 • 3,5 = 42,6 kg ißt. <Spr. SR. (dB
geballte ßabung borbereitet).
2 L == 2 • 42,6 kg = 85,2 kg *J3i. Spr. SW.
Wadj Safel 5:
L = 38,3 kg = rb. 38,4 kg $i. Spr. SR.
2 L = 2 • 38,4 kg = 76,8 kg $i. ®pr. 3».
Vit
Sprengmittelbebarfnad) Berechnung:
85,2 kg <ßt. Spr. St.
3 ü n b u n g : £>aupt= unb fReferüejünbung: Seitfeuer
in Berbinbung mit S'naKjünbfchnur.
Sebarf an:
ßünbmitteln: 1 Sprengtapfeljünber (turj);
2 Sprengtapfeln; 5 m SnaUjünbf^nur (gleiche Stengen
al§ fReferbejünbung).
SBerfjeug unb ©erat: 1 EBertjeugtafche;
24 Sanbfacte (gefüllt) jum Berbammen.
Seit: bi§ V« Stunbe (ot)ne ©rtunbung).
fi r ä f t e : 1 ©ruppe. Einteilung:
2 Staun: Sid>erung3poften;
4 Staun: Einbringen ber Sabungen;
2 Staun: Einbringen ber ßünbungen;
4 Staun: Bor» unb Einbringen ber Berbämmung
(Sanbfacte borbereitet).
Borau3fid)tlid)er Sprengerfolg: Einfturj be3
Bogen§.
76. Seitjenlabungen (41 b) werben nadj Safel 6 u. 7
ermittelt.
L für 1 Ifb. m = W2 • c • d
L, W, c, d hoben bie gleiche Bebeutung wie in ber
formet für geballte Sabungen (73; EBerte für d
Safel 7).
®te Sange ber Seiljenlabungen ift nad) ber geforber»
ten EBirtungSbreite ju beftimmen.
Steipenlabungen, bie au§ mehreren Seilen befteljen,
bringt man fo an, bafj fid) bie Berbinbung§ftellen eng
berühren (E3ilb 42), ober man jünbet bie Einjellabun»
gen burd) Seitfeuer in Sßerbinbung mit ©nattjünb»
fjcftnur, bamit alle Sabungen gleidtjeitig betonieren
(gejünbet werben).
68
3ft genügenb Beit unb ®erät üorfjanben, fo tönnen
audtj SBetjälter au3 ^Brettern (33tlb 43) IjergefteHt toetben.
fflilb 42.
Sietljenlabungen (übereinanber gelegt).
a
Seifpiel (93ilb 43):
Qu eine 0,4 m ftarte Biegelmauer ift eine 4 m breite
Saffe ju fprengen. Bur Verfügung: 20 Sprcng6üd)fen.
53ilb 43.
9tett)enlabungen, burdj $nalljiinbfdjttur toertninben.
£ a b u n g § 6 e r e (fj n u n g :
W = 0,4, c = 5, d = 4,5.
L für 1 Ifb m = 0,42 • 5 • 4,5 = 0,16 -5-4,5
= 3,6 kg = 4 ©prengbüdjfen.
69
5t a d) Safel 6:
L für 1 Ifb. m = 3,8 kg = 4 Sprengbüdifen.
®a 4 Sprengbüdjfen nur 0,80 m lang finb, mujj man
für jebeä laufenbe SOteter 1 Sprengbüchfe hinjuredpteu,
alfo L = 5 Spr. 53.
Sprengmittelbebarf für.4Ifb.m: 20Spr.53.
Sünbmittel», ©erat» unb ESertjeug»
6 e b a r f: 1 Sprengtapfeljünber (turj), 2 Sprengtap»
fein, 5 m Snaüjünbfdjnur; 53retter, Stägel unb Sßert»
jeug für ^erftellen ber Rollbehälter; 1 SBertjeugtafdje.
Seit: für .RerfteKen ber SSehälter etwa l'/s Stun-
ben. für Einbringen ber Sabung 5 SOtinuten.
Kräfte: etwa 1 (Sruppe für RerfteHen ber Sabun-
gen unb Sünbungen; 1 Xrupp (3 Staun) für Elnbrin»
gen ber Sabungen unb Qünben.
G Sperrung non Verkehrslinien unb
»anlagen unb von Slughäfen.
77. ©riinblictje Unterbrechungen non ®ifen=
baljnlinien, SBafferftrafjen unb ©raftfalfrbaljnen finb im
allgemeinen bon Pionieren nad) ber El. 53.3ßi-
Xeil IV auSjufütjren.
Sierjju jerftört man Kunftbauten unb ^Betriebs*
anlagen in möglidjft großer Batjl, ferner bei ®ifen=
baljnlinien bie (Steife auf lange Streden.
78. Seich* unterbricht man ©ifenbaljnlinien
burd) 53efd)äbigen einjelner SBetriebSanlagen auf 53aljn=
Ijöfen, SBefeitigen türjerer SleiSftreden unb ©ntgleifen-
laffen bon 3ü0en auf freier ©trede.
79. a) Eluf E9at)nt)öfen befeitigt ober
f p r e n g t man Schienen, öerjftüde, SSeidjenjungen,
StreuäungSftüde (©oppelljerjftüde), ibefchäbigt ®reh=
fcheiben, SBafferbehalter, jumpen, Stellwerte, Signal»
unb 3tad)ri(htenanlagen, ESertftätten, ©tfenbaljnmagen,
Sotomotiben ober fährt ba§ rollenbe ältaterial ab.
»JJionierbienft ß
70
SBafferbehälter gerftört man burch §ineintoerfen bon
1 Sprengbüchfe mit brennenbem Sprengtapfeljünber.
2)ie SBirtung mirb erhöht, menn ber 23ehälter SBaffer
enthält.
53on ißuutpen entfernt man bie beroeglidjen Seile
(Kolben unb Kolbenftangen) unb zertrümmert SSentile,
§afjne unb fRofjre.
Sei SteKroerten burdjfdjneibet man bie Srahtoerbin»
bungen jmifc^en SteHmert unb SBeidte ober Signal.
Signal* unb fiadjridjtenanlagen fperrt man nad)
81—84.
^atjrjeuge mad)t man unbrauchbar burd) Sprengen
eines Stabes ober einer 2ldj§bud)fe, ßotomotiuen aud)
burch 3erf<^^a9en ber Armaturen unb ^Rohrleitungen,
Slnheijen ber entleerten K'effel, ©urd)fd)iej3en ber Siebe»
rohre unb ber ^Rohrleitungen ober Jpineinfahren in
Srehfcheibengruben.
b) Sfaf freier Strede führt man ©leiSunter»
bredjungen in turjen Slbftanben unb am beften
an foldjen Stellen auS, an benen ber ©egner fie nur
fdjioer auSbeffern tann, alfo in ©infcpnitten, auf S)äm»
men ober in fcharfen Krümmungen.
®aS ©leis b e f e i t i g t
man mit Sßertjeugen ober
burd) Sprengen ber Sdjie»
neu in ber SRitte ober an
ben Stößen (Sabungen ftetS
an ben Slufjenfeiten ber
Schienen, in Krümmungen
am äußeren Strange).
3rüriebeSd)tenen»
ober 3S e ich en [pr en»
gung genügt 1 Spreng»
büchfe ober 1 Sabung auS 5 Sprengtörpern, bie nach
SSilb 44 ober 45 anjubringen ift.
Sötlb 44.
Wbrtngen einer Spreng»
Piidjfe an einet Schiene.
71
®ilb 45.
Knöringen öon Pionier=Sprengmitteln an Schienen,
SEBeitfjen unb ^erjftftden.
c) 3öfl* eittgleifen, wenn man
1. bie SSerbinbungen eine§ ober mehrerer Schienen^
paare untereinanber unb mit ben Schwellen löfi
unb bie Schienen einige 3entimeter nadj innen
ober aufjen berfcfjießt,
2. in Krümmungen bie SSerbinbungen ber äußeren
Schienen untereinanber unb mit ben Schweden
(an ber Slufjenfeite ber Schienen) beseitigt ober
lodert.
80. Hraftfaljtbafjtten unterbricht man leidjt
nadj Seil I Slbfdjnitt D.
81. fiacfjridjtenoerbinbungeu unb =anlagen fperrt
man burdj IXnbraudjbarmachen be§ Fernfpredjnege§
unb ber Eelegraphie» unb guntanlagen.
82. ©iefe Sperrungen finb im allgemeinen Sache
ber fßadjrichtentruppe. 5lu(f) Eruppennach»
ritfjtenöerbanbe unb, im eigenen ßanbe, $erfonal ber
3teidj§poft tönnen für biefe Aufgaben eingefegt werben,
hierbei ift ßufammenwirten ber Eruppe mit ber
5Reidj§poft wichtig.
83. Fernfpredjnetbinbungen u n t e r b r i dj t man
leidjt burch teilweifeS $erftören ber Freileitungen (Utn-
Sober Sprengen ber SRaften, ^erabreifjen bet
,te), ülbfchalten ber in ben ißoftämtern befinblidjen
6*
72
SraftqueUen (Sattelten) unb 2lbbau ber klappen»
fcfjränte ober §erau§netjmen ber Sicherungen.
3u einer gritnblidjen Unterbrechung jerftört
man Freileitungen auf lange Streden, jerfdjneibet
unterirbifdje fieitungen (Sabel) fo oft tuie möglich,
minbeftenS an ben SabeleinführungSpuntten ober an
ben Verteilern, bie man burch Verfolgen ber Sabel*
ftränge üon ber Vermittlung au§ finbet. Ferner jer»
ftört man bie SraftqueUen.
3lu§ ben FernfprechüberficfjtS* unb ©eftängefarten
ber Voftbehßrben tann man bie mirtfamften Sperr»
(teilen bes SleheS unb Sage bon Verftarterämtem er»
jehen. Siefe Sorten finb fobann ju befeitigen.
84. guntanlagen werben burch 3erf<hla9en ber
Apparate ober Sprengen ber SraftqueUen ober Sin*
tennenmaften griinblich unterbrochen. Seicht
u n t e r b r i jh t man Funtanlagen burch Entfernen
einzelner Seile ber Senbe» unb Empfangsanlagen, jo
ber Senberöhren. 3n febem Faäe ift ju entfdjeiben,
ob Fortbringen ber Senbe* unb Empfangseinrichtungen
möglich unb bem ßerftören borjuziehen ift.
85. Flughäfen unb OiefedjtSlanbepläfje f p e r r t man
gegen Starten unb Sanben bon Flugzeugen, inbem mau
ba§ Utottfelb unbenutzbar macht.
86. £>ierju legt man im Utollfelb ®räben, min»
beftenS 1 m tief unb breit, an, baut etwa 1,50 m hohe
Drahtjaune, fprengt Sricf)ter, häuft Steine an, fährt
Sßagen auf ober berlegt Valten, I»Sräger ober 23aum«
ftämme.
Sie Sperren berteilt man fo über ba§ (RoUfelb, bafj
in feiner ^Richtung ebene Flächen bon mehr al§ 150 m
X 150 m bleiben.
87. überfluten ober Slnfumpfen, j. 23.
burch Unbrauchbarmachen ber 2lbmäfferung§anlagen,
macht ba§ SRoUfelb lange Seit unbenutzbar.
73
88. SRaftnafjmen jum <5 p e r r e n b e § f^lugbetriebe§
finb: gerftören ober Unbraucljbarmadjen ber
anfdjlüffe, SBerften, 9larf)rirf)tenanlagen, ©inridjtungen
be§ ^[ugficf)erung§bienfteä (Strecfenbefeuerung, fianbe*
Befeuerung ufio.) unb ber Einlagen für bie 93etrieb§=
ftoffoerforgung.
SBerften tuerben abgeriffen ober Derbrannt, tDiafdjinen
gefprengt ober jerfrfjlagen.
89. 5Betrieb§ftoffe brennt mpu ab,, bermifrf)t fie mit
Surfer, SBaffer, feinem Sanb ober ©ifenftaub ober läfjt
fie ablaufen. ®rofte Seijalter merben gefprengt.
D. Sperrung von Straften, Wegen und
(Befände oftne piomer^Sprengmittel.
90. $ionier*SprepgmitteI fteEjen oft nur in b e =>
f dj r & n 11 e n äRerigen gur Verfügung. Sperrungen
muß man baljer Ijäuftg mit oberen 9R i 11 e I n
au§füljren.
^aftifdje Sage, groerf ber Sperrung, oorljanbene
Sperrmittel, geit unb Kräfte finb beftimmenb für bie
SBaBI ber Sperrart.
2Ran fann fperren:
a) Straften unb SBege burrf):
SRinen, rfjemtfrfje Sampfftoffe, gerftören bon
SBrürfen, SInftauungen, auSjietjbare ®ratjtroffen
(K=, S=9toHen), Sraijtljinberniffe aller 9lrt, ^ßfat)I=
fperren, SSaumfperren, 93arritaben, ftarte 5Dratjt=
feile, SBaltenfperren, Slufreiften fefter Straftenberfen,
Sraben, Startftrom al§ Sufafjmittel für einzelne
Sperrarten.
b) ©elänbe burrf):
SRinen, djemifcpe ftampfftoffe, 9lnftauungen unb
2lnfumpfungen, auSjieijbare ©raljtrollen (K=, S=
74
Stollen), Stäben, Steiltjänge, Sra^t^inbernifje aßet
Slrt, ©aumberfjaue, fßfaljlfperren, Startftrom als
ßufafjmittel für einzelne Sperrarten.
t. Sperrung burd) ßerftörcn non §oljbrüden unb oou
Sriiden mit ftäfjlernem (eifernem) überbau.
91. öoljbrüden jerftört man burcf) Slbbrennen
ober Slbbredjen.
92. Vorteile bes> SlbbrennenS finb:
Sparen an Sprengmitteln,
SBrüde tann bt§ juletjt benutzt werben,
SSieberberwenben bon SSrüdenteilen ift unmöglldj.
St adj teile finb:
Sange SorbereitungSjeit,
Stegen betfjinbert oft ba§ ülbbrennen,
SranbWirtung ift abhängig bon SBinbftarfe unb
SBinbridjtung.
93. SSorbereiten b e § SlbbrennenS toftet
Beit unb Grafte. müffen leicfjt brennbare Stoffe,
wie öl, SSenjin, Petroleum, Stapfjtlja, ^eHuloib, Sadj-
pappe, Rapier, SSrennfjolj, §ette, Seim, fßedj, Seer,
Strolj, £>eu, Sßagenftfjmtere, SReifig, jum SSefeftigen ber
fBrennftoffe Srafjt, SJtafcfjenbratjt, 33le<f> unb fßledj»
bemalter bereitgeftefft werben.
94. Sa§ freuet muß lange bon unten Ijer g e n ä Ij r t
werben. §ierju wirb jwifdjen ben Stufen bünne3
23led) ober 3Raf(f)enbraIjt al§ Unterlage für bie SSrenn*
ftoffe aufge^angt unb burcf) Srafjtbunbe mit Stütjen
unb febem Sragbalten nerbunben. Qlnnageln ift ju ber*
meiben, weil au§ bem bertoljlenben fpolj bie Stägel
fjerau§faHen. 2luf bie Unterlagen fjäuft man Solj,
Strolj ober fßapier unb träntt biefe Stoffe mit öl, §ett,
?8agenf(f)miere, Petroleum ober Stap^t^a. Sie Stützen,
audj bie fßfä^le ber Siäbrec^er, unb bie Sragbalten
75
boljrt man an, giefjt Sßetroleum ober öl in bie 5Bot)r=
Ibdjer, widelt teergeträntte Saue fjerum unb bangt an
jeben ißfal)l unb an bie Sragbalten mehrere mit SSetro»
teum, Seer ober öl gefüllte SBledjbeljälter. Sitte
tragenben Seile ber Srüde finb mehrere SRale mit
Steintoljlenteeröl, SSKafdjinenol, ^ßedj ober Petroleum
ju tränten, Eingelne Sollen be§ S3elage§ finb gu
entfernen, bamit baS geuer 3U9 erhält.
Kurg Oor bem $ünben toirb bie 53 rüde nodjmalS mit
S3engin, SSengol ober anberen leidjt brennbaren Stoffen
fibergoffen.
95. SRan giinbet burd) Radeln an langen Stangen
ober burd) ßeitfeuer. SSenn feudjte ßuft bie 53engin-
bämpfe niebergält unb biefe bann beim Bünben
ejplobieren tönnten, günbet man burd) ßeitfeuer in
SBerbinbung mit etwa 20 m langer Knattgünbfdjnur, bie
geftredt möglidjft gegen Sßinb gu oerlegen ift.
96. ßöfdjarbeiten be§ ©egnerä toerben burd) redjt-
jeitige§ Sprengen, Slbbauen ober Umretjjen feinbwärts
gelegener SSrüdenteile üertjinbert.
97. SIbbredjen erfolgt burd) Serfägen ober SBefeiti»
Sen oon Stufen ober Sragbalten, bet Sdjiffbrüden
urd) SSerfenten ber SdjtffSgefäfje. Sßenn möglid), finb
bie Stefte ber Sragbalten unb ber SBelag gu entfernen.
98. SH3 o e r ft e d t e Sperrung gegen Kraftwagen
genügt Slnfägen unb Slnbo^ren ber Sragbalten ober
Stützen.
99. 53ei Heineren SSrüden mit ftäljlernem über»
bau entfernt man bie Sräger unb ben SBelag. Bum
Entfernen ber Sräger braudjt man al§ Sßertgeug
Sdjraubenftf)lüffel, SReifjel, Sorfdjlagljämmer unb §ebe=
bäume. Sie Sräger finb nad) bem flöfen ber 53er»
binbungen abgufatjren ober in tiefes SSaffer ober Sumpf
gu Werfen.
76
»eifpiel (S8tlb 46):
Uferbrüde über eine tiefe ®ebirg§fcf)lucht ift
burcf) Entfernen be§ überbauet ju gerftören. Sie SSrüde
toirb nidjt mehr bon eigenen Sruppen benutzt.
Seitenansicht Querschnitt
53ebarf an :
SBertjeug unb ® e r ä t: 2 fpebebäume; 2 23red)»
ftangen; 3 SSorftfjlagljäntnter; 2 Sdjrotfägen; 3 Sijte;
2 Sdhraubenfdjlüffel; 3 eiferne Seile.
Kräfte: 1 ©ruppe.
3 e i t: 4—5 Stunben.
2. (Sperren gegen gepanzerte Sampffa^rjeuge unb
gelänbegängige Kraftfahrzeuge:
100. a) SBaffer al§ Sperrmittel f. 106 ff.
b) ßerftärte Brüden.
c) Sief gerammte $fähle mit betriebener JQöfje über
bem geroadjfenen 23oben auf ©tragen unb im Selänbe
(SBilb 47). Sie finb mirtfam, Weil gepanzerte Kampf«
fahrjeuge unb gelänbegängige Kraftfahrzeuge auf ben
pfählen feftfahren unb bamit bie Sobenfreiheit ber«
lieren. 2ll§ $anzermagenhinberni§ im Selänbe legt
man bie ißfahlfperre 200—300 m feinbmärtS ber bor-
berften Snfanterieanlagen an.
77
SBUb 47.
$faljlfperre gegen gepanzerte ^tantpffa^rzeitge.
T 025-0.30 m
Si Jp7w\to
£~=®Z2 WZ2^®Z2lo
c\j m m m
e^> • • • •
<-Xl
Fahrtrichtung
Seitenansicht
Draufsicht
ßür 100 Ifb. m $inbemi§ gu 4 ^ßfaljlreiben toerben benötigt an:
Kräften: 1 Stomp. gu 150 Sftann.
Sauft offen: 275—325 *ßf äljle, 2,65 m lang, 25-30 cm 0.
SBerfgcug unb ©erat: 16 jpanbrammen; 32 Sdjlegel; 6 Sdjrot*
fügen; 16 &£te; 10 Seile; 8 Streugbacfen; 8 Spaten.
Heit: 1200 Slrbeit^ftunben, bei 150 Sftann 8 Stunben, opne Slnbeförbern
ber Sauftoffe.
Sertoenben bon ©rbbobrern befdjleunigt ben Sau.
Z r u p p e i n t e i l u n g:
4 MbftedJruW» ju 2 Mann = 8 Mann/| ^^tfen} Stbfteden.
6®ä<W .2 . =12 - {’UIF,ä0C'}Än.
lOSrufps -2 • =20 . JÄM
4 Srägertruppd *3 • =12 • SluSIegen ber «pfähle.
16 Scfilegeltrupp© -2 - =32 • je 2 Scblegel, Sfäple einftfilagen.
16 SRammtruppö «4 • =64 • je 1 £anbramme,^ßfäble rammen.
IReferbe = 2 »
150 Sftarm, 6 Gdjrotfägen; 16 Sljte; 10Seile;
32 Sdjlegel; 16 $anbrammen;
8 Streugljacten; 8 Spaten.
Sdllegel* unb Stammtruppö fegt man mit ungefähr 25 m Broifd^enraum
ileidjgcitig an.
78
d) E= unb Spotten (ait§aieIjE>are ® r a ft t •
rollen, SSilb 48). Sie t>ilben auf Straften eine wirt»
fanie Sperre gegen Sßanjerfpäftwagen unb bot
turnen SteHungSabfcftnitten ein borübergeftenbeS $ an«
jerwagenftinberniS.
(Segen $ a n 3 e r •
fpäftwagen finb
fie nacft SBilb 48 a in
(Sruppen bon 6 Steiften
ftintereinanber in
minbeften« 50 m $iefe
anjuorbnen. Eine
®ruppe uon 6 Stollen
tann in ber Siegel nur einen ^anjerfpöftwagen am
’JBeiterfaftren ftinbern. 3um Slufftalten j. SB. eine«
.4.
93ilb 48a.
K=oberS=3tonen«
gruppe gegen
$an$erfpaftwagen
ftinter einet un»
fiberfiifttliiften
Sttajjentriiut»
mung verlegt
®ie Stolle ift eine
mit Stacheln Befette
K^ftoUe.
Silb 48.
WuSeinanbergejogene K=9lolle.
(©öcftftlänge 15 m.)
feinblicften Sßanjerfpäftwagen^ruppä ju 3 Sßanserfpäft»
wagen finb alfo 3, möglidjft 4 Sruppen oon K» ober
Stoffen nötig.
(Segen Sßanjerwagen unb gclänbegängige ®raft»
faftrjeuge finb im allgemeinen 9 Steiften K> ober S=Siol*
len in 9l6ftanben nacft SBilb 48 b erforberlidj.
Bum Verlegen jieftt man bie K= ober S-Stolle fo
auSeinanber, baft bie Spannweite jwifcften ben ffltafdjen
79
C/ka 81m
13m \10m
Dm
SBilb 48 c.
£ofe§ SBefeftigen ber
Knollen burd)
§aten.
Feind
Söilb 48b.
K« ober Stollen-
reifen gegen ^aujer»
toagen unb gelnnbe*
gängige ftraftf^r«
Itnfte int &efönbe
berlegt
©tofcfteHen meßt in einer
©entrechten gu ben K-
aber S^StoHenreiben, fon-
bem (jegenemanoer ber-
föoben (berfefct) unb
fttoar fo, baß fidÖ erft bte
StoftfteHen ber 6. Steiße
mit benen ber 1. Steiße
beden. ®ie Stollen ber-
bfnbet man an ben ©tofc-
fteHenni eßt miteinander. Soßstellen versetzt
ft e t S 20—30 cm beträgt, unb Ijaft bie (Snben ber 3tolk
in bie nadj 23ilb 48 e in ben
Srbboben gefdjlagenen §aten
ein. Sie öaten [ollen nur ba§
3ufammenfd)neKen ber [Rolle
oerljinbern. Sie miiffen fidj,
toenn ein tJa^tjeug gegen bie
Stolle fäljrt, leidjt au§ bem
©oben Iö[en. gn feE>r feftem
©oben unb bei groft finb fie
nadj bem Sinfcfjlagen tvieber
ju lodern.
K» ober Stollen legt man redjtiDintlig jur Strafen*
ober uorauäfidjtlidjen 2lngriff§ridjtung. Segen hinter
unüberfidjtliche Strafjentrümmungen (©ilb 48) ober in
bebedte§ ober toelligeä ©elanbe oerljinbert frühzeitiges
©rtennen burch ben ®egner.
©er ©orjug bon Stollen gegenüber bon Knollen
befteljt ljauptfädjiid) barin, bafj ba§ ^reifdjneiben feft=>
gefaljrerter galjrjeuge erljeblidj größere Sdjroierigteiten
bereitet
Stellung des Hakens
80
K> unb Stollen tann man aurf) jum fdjncllen
Schließen, SluSbeffcrn unb ©rgänzcn bon Srahthinber«
niffen öertoenben.
Silb 49. Sßansertoagengraben.
e) ®räben mit faft [entrechten SBanben (Silb 49).
Sie finb ein gutes §inberniS gegen gepanzerte ®ampf»
faljrzeuge, befonberS in ftanbfeftem Soben. Sie ®räben
muffen im allgemeinen 3,0 m breit unb 1,8 m tief, aß
§inberni§ gegen idjroere Smrcl)bruch§panzeriDagen je»
bocf) 6,5 m breit unb 2,5 m tief fein.
Sarnen ber Sräben ift immer anjuftreben. Slß
Unterlage für bie Sarnftoffe legt man in bie ®raben
Srahtmalzen aus (StacEjelbraljt, bie jugleid) ein gutes
§inberniS gegen Scfjütjen bilben.
1—2 Kompanien fteffen 100 m ©raben in etma
8 Stunben tjer.
f) üünftliche Steiltjänge, bie faft fenErecf)t unb 1,80 m
bis 2,50 m hoch finb. Sftan fdjajft fie burcf) Slbftedjen
unb Setleiben öon natürlichen fangen, Summen ober
©rabenmänben. Sie finb fcf)neKer herjuftellen aß
®räben.
g) fallen auf Straffen ober SBegeftrecfen, bie nidjt
umgangen merben tonnen. SDlan legt ®raben nach e)
an unb tarnt fie burd) Srücfen mit fo fchmabhem über»
bau, bafj bie Srücfen bei Selaftung burch Sraftfahr*
jeuge jufammenbredhen.
h) Schwere Saumfperren (Silb 50). Sie tonnen auf
Straften unb SBcgen in bidjtem 38alb ober an nicfjt zu
umgcljcnben Stellen jeben (Gegner lange aufljaltcn.
Seltnere Saumfperren legt man 50—100 m tief unb
2—6 m Ijod) an. sIRan braudjt alfo Diele ftarte Säume.
Sßidjtig ift grofte Siefe ber Sperrung. hierzu legt man
mehrere Saumfperren Ijintereinanbcr an.
®ie §ö^e ber Saumfperren fall möglid)ft 2 m unb
barüber betragen, um ^icbermalzen ber Sperre burd)
gepanzerte ©ampffa^rzcuge gu bcrljinbcrn unb um Stuf*
räumen ber Sperre zu erfd)toeren. ®ie Säume fällt
man mit $tjten unb Sdjrob ober beffer mit ©raft*
f ä g c n. ®ie Säume terbt man zuerft an ber Seite,
nad) ber fie fallen follen, an (gaüterbe). ®ie galltcrbe
foH ein fünftel bis ein ®rittel ber Saumftärte be*
tragen. ®ann fe|t man bie Säge auf ber anberen
Seite beS Saumes nad) Silb 51 an. ^m Sägcfdjnitt
feilt man nad), ‘um gcfttlemmen beS Sägeblattes ober
ber Sägetette zu bermeiben. ®abei ift zu beachten, baft
bie ©eile nic£)t bie Sägetette ober baS Sägeblatt be*
fdjäbigen. Ungünftig fteljenbe Säume tann man mit
Seinen, bie möglid)ft Ijod) zu befeftigen finb, zur $aH*
feite Ijeriiberzieljen ober mit Stangen Ijinüberbrüden.
9Iud) auf bie Sßinbridjtung ift zu ad)tcn, toeil ftarte
SBinbftöfte ben angefdjnittcnfcn Saum in falfcfjc 9iid>
tung toerfen tonnen; ferner ift ber ©influft bon Se*
äftung unb Seljang ber Säume auf bie gallrid)tung in
SRedjnung zu fteKcn.
®ie Säume toerben fo gefällt, baft fie möglid)ft
an 1,0—1,5 m ljoljen Stümpfen Ijängenbleibcn unb
nadj bem ^all, SBipfel feinbtoärtS, in ®rcicden mög-
lidjft in mehreren Sagen (übercinanbcr) liegen (Silb 50).
®ie ©reuzungSfteüen ber Säume oerbinbet man burd)
lange 9?ägel, ©ifenborne, gerabegefd)Iagcne ©lammern
ober ®raljt (3—5 mm) fo untereinanber, baft bie
Säume nid)t einzeln IjerauSgezogen toerben tonnen.
82
S8tlb 50.
(Sdjtoete Staumtyerre.
§ür eine Sperre fron 60—100 m Xiefe (etwa 80—150 Säume) Werben
Benötigt an:
Kräften: 1 Sug.
Sinoemitteln: 1—3 Stollen Stadjelbra^t; 1—2 OioUcn glatter
Grafit, 3-5 mm; 30—€0 m Sanbeifen; 150—300 Olagel; 600 krampen;
80—150 lange S^agel ober klammern ober @ifenborne.
Sßerljeug unb ©erat: 5 Sdjrotfagen; 5—10 ®eile; 10 $ljte;
4 Seile; 4 jammer; 5 Stangen jum Skürfen ber Saume; 2 $raljtr
[djeren; 2 ©rafjtjangen; ^letterjporen; Seinen.
Seit: 6—8 Stunben.
£ruppeinteilung b e §• S u g * 3 :
Sugtrupp jum 2lnfd;Iagen unb Slnfagen ber Säume.
2 ©ruppen mit: 5 Sd^rotfagen; 10 Sljten, 5 Stangen; 5—10 teilen;
SHetterfporen unb Seinen jum fällen ber Saume.
1 ©ruppe mit: 4 Kammern: 4 Seilen; 2 5£>rafjtfdjeren; 2 S)ra^tjangen;
hageln; ®raf)t; Sanbeifen unb krampen jum Serbinben ber gefällten
Säume.
83
Serantern an eingefdjlagenen ober eingerammten
Sfäljlen, an burdjgeljenben troffen ober äufammen*
gebreljten ®räfjten ift meift nidft jtoecfmäfjig.
9tadj bem feftlegen ber Säume im 'SreiedSberöanb
fdjlägt man, um bem Seg-
net Berfägen ber Stamme
ju erfdjtoeren, in bie Säume
Sanbeifen ober 9lägel in
fdjräger JRidjtung ein.
3 n big Sperre tann man
tleine’Sabungen al§
Sdfretflabungen einbauen,
größere Sabungen
o o r unb Ij i n t e r ber
Sperre berlegen.
i) SBeitere Sperren gegen
Sfraftfafjraeuge ohne ®et*
ten fielje 101 b 6i§ e, g
unb h.
Silb 51. (fällen bon Säumen
für Sanrnfpetren.
follkerbe
K&l
§5
Sägeschnitt
3. Sperren gegen nidjt gelänbegängige Sraftfa^rjenge
unb pferbebefpannte gatjrjeuge:
101. a) Sille Sperren nadj 100 a—h, ferner:
b) Sinjelne ftarte Säume, bie man fcfjräg jur
Strafjenadjfe umlegt unb an ftefjenbleibenben Sau*
men ober tief gerammten Sfäljlen berantert.
c) fieidjte Saumfperren. 3J?an ftellt fie au§ Stäm*
men bi§ etroa 20 cm ®urdjmeffer in etioa 20—30 m
Xiefe in äpnlidfer gorm mie fdjroere Saumfperren tjer.
d) Saumoerljaue (Silb 65) (102 c).
e) Sarrtlaben in Drtftfjaften ober Sngen (Silb 52).
Sie laffen fid) fdßneff burd) fdfloer belabene, unter*
einanber berbraßtete unb öerfeilte gaßr^euge aller Slrt
(Slbjjieljen ber Staber!) ober anbere Hilfsmittel (Sieter*
gerate, Settern, fernere Segenftänbe) ijerftellen. 3§re
84
ffiirtung toirb erfjöfjt, wenn man j. 23. in einer Strafje
mehrere 23arfitaben biefjt Untereinanber anlegt.
SÖiufj man in 23arritaben junädjft ®urtf)fat)rt§»
lüden taffen, fo finb fie nadj SSilb 52 a ju bauen.
Bum fdjuetten Sdjliefjen ber ®urdjfaljrt§lüden gegen
Silb 52.
SBarritabe in einet Dtifi^aft.
ißanjermagen finb ©raijtfeile, ftarte Setten ober be*
labene fjfatjrjeuge bereitjuftetten.
f) 23erftreute ftarte ®la§fdjerben, 31 ägel
ober fdjmtebeeiferne Sierfpige (SSilb 53). Sie
galten luftbereifte unb pferbebefpannte (Jaürjeuge auf,
gaben aber gegen gatjqeuge mit fc^ufefid^erer Bereifung
leine SBirtung.
85
g) Starte $ral)tfeile. SBHb 53. Stftntiebeeiferner Sierfoifc.
Sie finb ein brauchbares “1 r
Sperrmittel aud) gegen /
Kraftfahrzeuge, toenn man I i
fie fdjräg zur Straften* | |
achfe über bie Strafte K I
fpannt unb an Säumen I II ____
feft beranfert I
h) Saltenfperren nad) '
Silb 54—57. Sftan legt
pe auf Straften, möglich ft __
hinter unüberfidhtlichen
Krümmungen, in ®in* Z -
fchnitten, auf dämmen
ober tu Drtfchaften an.
®ie Salten finb burdh Sanbeijen, Salzen ober Klammern
feft miteinanber zu berbinben. ®ie §altepfähle müffen
ftarf fein unb tief in ben Soben eingerammt toerben.
Silb 54.
$reie(fc$aftenp)erre (für eine 5 m breite Strafte).
86
Kräfte: 1 ©nippe.
Sauftoffe: 9 Satten, 5,00 m lang, 80/30 cm ober 80 cm 0; 14 Stähle,
2,50 m lang, 15 cm 0.
Sinbemittel: 40 klammem; 35 m glatter ©rapt, 8—5mm ftart;
7 lange Slägel gum {^eftbrepen unb -palten ber Scpleuberbunbe.
2Berzeug unb ©eröt: 2 Äreugpacfen; 2 Spaten; 4 Sdjlegel
ober 2 £anbranunen; 1 Sdjrotfäge; 1 £anbfäge; 1 Seil: 1 ©raptgange;
1 SRefeftab gu 2 m; 1 Sredbftange, 1 Sorfcplagpammer bei parier Strafcenbede.
Reit: 24 SlrbeitSftunben, bei 1 ©ruppe 2 Stunben, obne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
ftürSlnbeförbern berSauftoffe: 4—5 gfoeifpänntae ffapr*
teuge ober l1/, 34-ßaftfraftfoagen.
Söilb 55.
^ierertsSBaltentyerre (für eine 6 m breite Strafte).
Jlräfte: 1 ©ruppe.
S a u ft o f f e: 5 Satten, 6,00 m lang, 30/30 cm ober 80 cm 0; 5 Satten»
2,00 m lang, 30/30 cm ober 30 cm 0; 22 Sfäple, 1,50—2,00 m lang,
15—20 cm 0.
Sinbemittel: 40 klammern; 80 m glatter ©rapt 8—5 mm ftart;
11 lange SRägel gum ß-eftbrepen unb -palten ber Sdjleuberbunbe.
Sßerlgeug unb © er ät: 3&reugpacfen; 3Spaten; 1 Seil; 1 Scprot*
füge; 1 £anbfäge; 1 ©raptgange; 4 Stplegel ober 2 ^anbranunen; 1 Sftefj»
ftab gu 2 m; 1 Srecpftange, 1 Sorfdjlagpanuner bei parter Strafeenbecfe.
87
fielt: 45—€0 Rrbettöftunben, Bei 1 ©nibbe 8—4©tunben, ohne Mn*
beföroem ber Sauftoffe.
fifür «n5efflrbern ber Sauftoffe: 4—5 gtoeifpäimige fta^r*
tmge ober IV» S-Ufiafttraftnjagen.
«ilb 56.
ttaltenfperre au$ Shtnbtyolj (für eine 5 m breite (Strafje).
Rrftfte: 1 ©ruhte.
Sauftoffe: für Mittelteil: 5 Ifb. m Sftunbtjolg aI3 £olm, 25 cm 0;
1 ©tüfce, 1,30 m lang, 25 cm 0; 1 ©tüfce, 1,50 m lang, 25 cm 0; 1 ©tüfce,
2 m lang, 25 cm 0; 1 ©trete, 1,00 m lang, 20 cm 0; 1 ©trete, 1,50 m
lang, 20 cm 0; für Seitenteile: 10 Ifb. m fRunbljolg al§ $olme, 20 cm 0;
2 ©tüfcen, 1,30 m lang, 20 cm 0; 2 ©tüfcen, 1,80 m lang, 20cm0; 2 ©treten,
1 m lang, 20 cm 0; 2 ©treten, 1,50 m lang, 20 cm 0.
Stnbemtttel: 14 ßaftfien; 12 üftägel, 15—20 cm lang, gum Se*
feftigen ber Serftrebungen; 60 Flügel, 10 cm lang, gum Sefeftigea ber ßaftfien.
Sßerlgeug unb ©erüt: 2 ^reugljacfen; 2©haten; 2 ©(ftrotfägen;
1 $anbramme; 2 Seile; 1 Mefeftab gu 2 m; 1 Sredjftange, 1 Sorfdjlag’
bammer bei harter ©trafeenbecfe.
§cit: 45 SlrbeitSftunben, bei 1 ©ruhte 3©tunben, oljneSlnbeförbern
auftoffe.
gürSlnbeförbern berSauftoffe: 2 gtoeifpännige {Jaljrgeuge
ober 1 S’bßafttrafttoagen.
T
88
S8ilb 57.
Statfentyerre au§ Shmtljols (für eine 5 m breite (Strafe).
Kräfte: 1 (Gruppe.
S a u ft o f f e: 8 Salten, 6,00 m lang, 20/20 cm ober 25 cm 0;
12 pfähle, 2,00 m lang, 15—20 cm 0.
Sinbemittel: 26 m glatter ®rapt, 3—5 mm; 18 klammem; 8 lange
«Rägel junr geftbreljen unb galten ber Scpleuberbunbc.
SBerfgeug unb ®erät: 2 Äreugfjatfcn; 2 Spaten; 1 Seil;
1 ©cprotfäge; 1 Bange; 4 Spiegel ober 2 £anbrammcn; 1 Siefjftab $u 2 m;
1 Srecfiftange, 1 Sorf^lap^ammer bei p ar ter Strafeenbede.
Reit: 24 Slrbeit^ftunben, bei 1 (Gruppe 2 Stunben, ohne Slnbeförbern
ber Sauftoffe.
ftürainbeförbernberSauftoffe: 2 jtoeifpännige gabrseuge
ober 1 34=ßafttrafthjagen.
i) Stufreiften von Straften. 3ltm 2lufreiften bon
Straften finb ftarte Kräfte mit reicftlidjem Sdjanj* unb
SBertjeug, rote S’reujftacfen (6e[onber§ fdjroere), Spaten,
Scftippen, .§e6e6äume, SBredfteifen unb Sßorfcftlagtjämmer
erforberlicf).
$n grofter £tefe tann man Straften nur mit
Straftenaufreiftmafdjinen aufreiften. §ier$u finb Pio-
niere einjufeften.
k) gläcfteubrafttftiuberniiie (S3ilb 61) (102 b).
89
4. Sperren gegen Sdjügen unb Leiter:
102. a) SB i e 100a, b, d unb h; ferner wie
101 c, e unb f (nur gegen Sieiter, b e f o n«
berä w i r t f a m in gurten).
b) Srn^inberniffe. SRan legt fie fo üor ben ju
fdjüfcenben Einlagen an, bafj fie burch eigene geuer^
»affen möglicfjft in ber fiängäridjtung beftriefjen »erben
tönnen. ipterju finb bie $inberni§fchläge gebrochen
Mi führen. Samit erfefjroert man ferner bem ©egner
©rtennen unb gerftören burd) Sefdjuf} unb üerleitet
ihn jum Bufammenballen an ben SJruäpuntten.
Sen feinbwärtigen Sßanb ber Srahtginberniffe legt
man in ber SJerteibigung etwa 40m (§anb=
granatenwurfweite) üor bie eigenen geuerfteüungen,
beim Ijinljaltenben SBiberftanb fo weit öor
biefe, bafj ber Singreifer beim überwinben ber ipinber*
niffe unter geuer genommen werben tann.
Silb 58.
Srahtfdjlingen, an $fftjlen ober 30 cm langen Stägeln
befeftigt
Srahtfdjlingen (Sötlb 58) (teilt man in mehreren
Steifen an SSfähldjen mit jjwei ober brei Schlingen ober
Slägeln (30 cm) mit einer Schlinge fyet. Sie laffen fich
leicht tarnen unb finb baljer in jebem Selänbe Der»
tuenbbat
90
2113 Stolperbral)tljinberni§ — Wnbeftbreite 9m —
jieljt man glatten Sraljt ober Stad)elbral)t bidjt über
bem ©oben unb befeftigt bie ftraff gezogenen Srätjte
an ben köpfen ettoa 0,60 m langer Sßfagle (ÜBilb 59).
Sic Ijelle S^nittfläc^e ber $faljltö|>fe tarnt man.
Siplperbratjt lann man mit Sraljtfdjlingen burdjfejjen.
Jßeidjt ju tarnen ift ein StolperbraljtljinbemiS in
®ra§ ober in §eibetraut, in 3ÄuIben unb burdj ®er-
toenben bon berroftetem Sratjt.
®itb 59.
«StolberbraljL
gür 1000 m8 foerben benötigt an:
Straften: 6 2Jtann (1 ©d^ü^entrupp).
Sau ft offen: 200—300 ^ßfäple, 0,60 m lang, 8 cm 0; 2000 m
Sinbebrapt, 2 mm (ISRoUe) ober Stadpelbrabt (10 Sollen); 400-600 ©rafci-
trampen.
Sßertgeug unb ®erät: 2 ßanbfagen; 2 (Spiegel; 2 Seite;
2 ©raptgangen; 1 Stneifgange; 2 Srageftangen; 6 *ßaar ©dpu^panbfdpupe.
geit: 48 Slrbeit^ftunben, bei 6 SRann 8 Gtunben, ohne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
$ür Slnbeförbern ber SBauftoffe: 1 gfoeifpäimigeS {Japr-
geug ober */a S^ßafttrafttoagen.
Traijtsäune fölanbernjämte) baut man nadj S3ilb 60
u. 60 a.
Sie tönnen in offenem ®elänbe ni<f)t getarnt werben.
Saljer fü^rt man fie an SBegen, jftainen, Srenjgräben,
SBieljtoppeln ober fonftigen fjelbgrenjen entlang ober
nüöt borfjanbene 3“une au§.
S8iU man im offenen ® elänbe ein ft a r I e 3 §inberni3
berftetten, fo baut man mehrere Stadjelbraljtjäune mit
20—30 m Slbftanb Ijintereinanber unb jieljt Stolperbralft
bajn>ifd)en.
91
®Hb 60.
töüb 60a.
('Seiten Verankerung?)
»/wa. i c roiro au]
tSOnj ^cr feinbtoärti-
Erläuterung zu Silb 60a.
i») Serantern be§ SInfangS (and)
bei Süden) ober eines @d-
pfableS burdj ©rasanter ober
^olzftrebe;
b) gegeftfeittgeS Serantern ber
Sfäble burdj treujtoeife gezo-
gene glatte ©räljte (3—5 mm);
c) ßängöbräbte au§ ©tadjel-
braljt S)en unterften zieht
man btdjt über ben Soben, um ____________________________
d) feitlidöe Seranterung ber Sßfä^Ie mit glattem ®ra^t (3- -5mm);
e) feitlidje ßängSbräljte au§ ©tabelbrabt, loder gezogen, burd) ®rabt-
bunbe auf bem glatten ©rabt befeftigt
©raljt c toirb auf
gen (Seite ber
Sfüble gezogen.
Untertrieben zu berbinbem;
♦für 2000 Ifb. m Werben benötigt an:
fträften: 40 Sftartn (1 ßug).
Sau ft offen: 700 lange Sfäftle, 2,00 m lang, 10—15 cm 0;
1400 turze *ßfä§Ier 1,00 m lang, 8—10 cm 0; 400—600 m Sinbebrabt;
50—55 Sollen glatter ©rabt (zu fe 300 m), 3—5 mm; 60—66 Sollen
©tabelbrabt (zu je 200 m); 6000 ©rabttrampen.
SBertzeug unb ®erät: 8 ©blegel; 4 ©rabtfberen; 10 Seile;
5 Sfrreifzangen; 2 ©rabtzangen; 6 Xrageftangen; 6 ©rabtzugftangen;
6 ßiften, ©beutel ober Raffer; 12 Saar ©bufcbanbfbube (3 Sammtlöfce
ober $anbrammen erfefcen bei ben SfabltrubbS 6 ©blegel).
Reit: 360SlrbeitSftunben,bei 40 Slann 8 ©tunben, ohne SInbeförbem
ber Sauftoffe.
{für SInb ef örb em ber Sauftoffe: 22—30 zweifpannige $abr*
teuge ober 8 34^ßafttrafttoagen, ohne 5ßfä$Ie 5 zweifpännige §abrzeu$e
ober 2 8-t-ßafttraftWagen.
92
Xrupp einteilung (SBetfpte!) eines gugeS:
Xrupp* begeicf)- nung Starte A S Jq Stuärüftung (je Xrupp) 8u leiftenbe SIrbeit
«fabltr. 3 SRann 1—3 2 Sdjlegel ober 1 Slammflofc; 2 giften, Scpe* mel ob. gaffet. ©infctjlagen ber Saunp fable.
©rabt» ix. 1 2 2Rann 1—2 193eil; l©rabt» fdjere; l^neif» gange; ©rabt» trampen. ©egenfeitigeS 23erantern ber ^fäble (®rapt ,b").
©rabt* tr. 2 3 2Rann 1-3 1 Xrageftange; 1 ©rabtgug* ftange;29ßaar <5 dj u fcljanb» fdjube; 1 Seil; ©rabttrampen. Sieben unb 23e» feftigen ber ßängSftadjeb bräbte (®rabt >c").
Binbetr. 2 2Rann 1-2 1 ©rabtf djere; 123eil; 23inbe» brabtftude (2 mm); glatter ©rabt (3 bi§ 5 mm). 23erbinben bet ©räbte „b" u. wc" im (Sdjnitt- puntt. 23 er an* tem ber @nb» pfäble (©rabt >a").
4nfertr. 3 2Rann 1-2 1 Sdjlegel; l©rabtgange; ©rabttrampen. ©infdblagen ber Slnterpiäble, SInbringen ber feitlicben 93er» anterung (©rabt„(F).
©rabt* tr. 3 32ftann 1—3 2Bie ©raljt» trupp 2; ferner 1 ^neifgange; Sinbebraljt* ftüde (2 mm), 8—10 cm lang. Sieben unb 23e» feftigen ber feit- lirfjen ßängS- ftacbelbräbte (©rabt »e*).
ooo
93
glä(f)enbraf)tl)inberniffe (Silb 61). Wlan baut fie in
etwa 10 m Eiefe. §ierju fteHt man gunäcfjft 'iDraljtjäune
(im SBalbe unter 2lu§nu^en ber Säume) nacf) Selb 60
mit etwa 1,5 m SIbftanb fjer, üerbinbet fie burcf) treuj-
Weife gezogene Drähte unb legt in bie 2lbftänbe Stapel»
brafjtfpirafen, bie man unter fidj unb an ben ®reujjung§=
puntten ber 5)rä^te burcf) Dra^t befeftigt.
gfäcf)enbraf)tljittberniffe fegt man bort an, wo fie gegen
geinbbeobadjtung möglicfjft gefdjü^t finb, j. S. im SBalbe,
in §of)Iwegen, auf !ptnterf)ängen mit fjofjer Sewacfjfung.
®ifb 61. gläd)enbral)tl)inberni§ (Sarnung fortgelaffen).
gür ein 100 m langet unb 10 m breitet, im freien ©elänbe ber*
jufteUcnbeö gläc^enbra^t^inbemiS iuerben benötigt an:
Ä r ä f t e n: 40 Stann (1 8ug).
Sau ft offen: 150 Sßfä$Ie, 2,00 m lang, 10-15 cm 0; 130 ^fä^Ie
1,75 m lang, 10—15 cm 0; 40 Sßfäljle, 1,00 m lang, 8—10 cm 0; 18000 m
etadjclbrapt (90 Stollen); 5700 m glatter ©raljt, 3—5 mm (19 Stollen);
4000 m Sinbebra^t, 2 mm (2 Stollen); 3000 ©raljtfrommen.
Sßerf^eug uni ®erät foiuie Sruppeinteilung: finn*
gemäfe nne bei Silbern 60 unb 60 a (glaub ernsaun).
geit: 250—300 SIrbextöftunben, bei40 Staun 6—7 (Stunben, ohne Sin*
befürbem ber Sauftoffe.
gür SInbeförbern ber Sauftoffe: 8—10 gtoeifpännigc gal>
jeuge ober 8 3*t*Cafttraftwagen.
84
SBilb 62.
S|>anifd)et fReiter.
Sragtjäune in ©ewäffern naße bem eigenen
Ufer »erijinbern ober berjögern überfegen bei
® e g n e r §. SRan muß bie ©fäßle fo tief etnfdjlagen,
baß bie ©faßltöpfe unter Sßaffer fommen. Slucß bidjt
unter SBaffer oerfentte, »eranterte fpanifdje weiter,
©ragtroaljen ober SWafcoenbraßtsäune bilben ein mitt*
fame§ $inb»rni§ gegen Slnlanben.
®urd) f p a n i f db e
Leiter (SSilb 62)
unb ©raßtlDaljen
08ilb 63) fcßließt man
Süden in ^inberniffen
unb fperrt DrtSein*
gänge, ©rüden, ®tä>
ben unb gurten, letztere
audj burd) f e ft g e»
pflodte (Sggen
ober ©flüge unb
Srettermit ft ar»
len SZügeln.
Kräfte: 3 SRann.
Sauftoffe: 1 Stange, 2,50 m lang, 10 cm 0; 4 Stangen, 1,50 m
lang, 10 cm 0; 50—100 m Stadjelbraljt; 10 m Slinbebraljt, 2 mm;
20 ©rabttrampen.
Sßertgeug unb ®erdt: 1 Söge; 1 ©raljtfdjere; 1 $anuner:
2 $aar Sc&ufcbanbfctjulje.
Reit: 3 SlrbeitSftunben, bei 8 SJtann 1 Stunbe, ohne Slnbeförbew
ber löauftoffe
^0,6-4
m
2m
ȟb 63.
$raI)ttoalK.
Kräfte: 2 2Rann.
Sauftoffe: 12m Stablbratjt, 5mm; 8m glatter 5&rabt 8—5 mm;
15 m Stadi elbraljt; 25 m Smbebrabt, 2 mm
93
aBertjeug unb ©erftt: 1 ©raljtfdiere; 1 Saar©cbu^anbftftu^e.
Reit: 2 Slrbeiteftunbcn, 6ei 2 2Rann 1 ©tunbe, otine Slnbeförbern
ber Sauftoffe.
Sie Slufljaltetraft bon §eden, Sufdjreiffen, .getanen
unb Slnpflanjungen toirb ertjöfjt, wenn man fie mit
Stadjelbrafjt burdjflidjt ober mit SJtafdjenbraijt 6e»
fpannt.
äRafdtenbra^tjänne fpannt man burd) eingefloc^tene
glatte ©rafjtenben ftraff nad) unten unb berantert biefe
Silb 64.
3Rafdjenbraljtjaun hinter einer §erfe.
*.
M.ß.
Dritte im Soben, um Untertrieben ju berfjinbern.
SÄafajenbraljtääune bertoenbet man bor allem im 9Balb
unb an ber Stfidfeite
bon ©eden a!3 fcEjneH 65-
gegen Sdjütjen fjerjuftel» sBaumtoetljauaniSdjnfifrfjneifen.
lenbe Sperre (Silb 64).
c) Saumoerfjaue (Silb 65).
Sie muffen eine Xiefe bon
minbeftenä 5 m unb eine
$bl)e bon 2 m ffaben unb
feljr bicfjt fein. Sefonber§‘
geeignet ift fperrigeö £aub=
nolj, ba§ mit $fäf)len im
Soben berantert unb mit
©tadjelbraljt burdjflodjten
toirb. Saumberfjaue finb
toie ©raljtl)inberni||e ge»
brodjen ju führen.
96
3ufammenftellung b e § ® e b a r f § an Kräf-
ten, Seit unb ®erät für betriebene Sperren f.
täfel 11.
E. Scfyetnfperren.
103. Sdjeinfperrcn finb im Sinne ber täufdjung
unb überrafdjung be§ ®cgner§ eine toidjtige Ergänzung
mirtlicjcr Sperrungen, bie grunbfäftlidj auSjufüjren ift.
Sdjeinfperren berjögern ba§ Sorgejen be§ ®egner£,
toenn fie ijn jttingen, bei ijrer Sefeitigung genau fo
^u ber fahren wie bei mirllidjen Sperren. Sdjein«
fberren legt man im allgemeinen im Sßedjfel mit mirt»
iidjen Sperren, feiten feinbmärtS mirlltdjer Sperren
an. geuerfdjuj ber S^einfperren erjöjt ijre SBirtung.
Sdjeinfperren tönnen gegen ©anjerfpäljnjagen, bie
an Straffen gebunben finb, fejr toirtfam fein.
3m Wertteilen bon fdjncH anjulegenben unb für ben
gfeinb glaubhaften Sdjeinfperren ift bem ©rfinbungS»
geift be§ einzelnen freier Spielraum ju laffen.
104. Seifpiele für Sdjeinfperren finb: über
Strafen unb SBege gefpannte trajtfeile unb tröjte,
Seifen, Säcle, ferner auf Stegen unb im Selänbe mieber
jugemorfene ßßcjer unb ©räben, Erb« ober Sdjnee»
baufen, in ben ©oben ober in bie Strafjenbede gelegte
Srett» ober Sledjftüde, umgelegte Säume, guergefteute
ftaljrjeuge, enblidj S-förmige galjrjeugfpuren auf Stra»
feen ober Sßegen, gerabe gajrjeugfpuren neben Straften
unb Stegen, um Stinen in biefen borjutäufdjen.
SJlannigfadjer, erftnbungSreidjer Sßecjfel in ber ®rt
bon Sdjeinfperren ift für ijre SBirtung befonberS toidj»
tig.
105. Sefeitigen bon 23egebejeitfjnun =
gen, falfdje SBegebejeidjnungen, Sertaufdjen ober
Öterfetjen ber allgemein befannten Seiften für ben Kraft»
toagenberfejr, roie SBarnungSjeicjen, audj gälfdjen bon
Eingaben über tragtraft bon ©rüden tönnen ben
97
geinb irremachen, iljn in Hinterhalte loden ober
motorifierten geinb ju langfamem Fahren beranlaffen
an Stellen, an benen man ihn mit §euer überfallen
will.
F. Waffer als Sperrmittel.
106. Sei genügenber S^iefe unb ©reite fchüßen
SBafferfperren faft immer gegen feinblidje © a n j e r»
Wagenangriffe, oft auch gegen Singriff anberer
feinblidjer ©rbwaffen.
®ie SBatfähigteit bon ©anjerwagen beträgt im
allgemeinen 0,80—1,50 m, bon fehleren ®urch6rud)S»
panjerwagen bi§ 3,50 m. Sümpfe, bie S dj ü tj e n nur
mit Hilfsmitteln (327 a) überfdjreiten fönnen, tonnen
aud) ©anjerwagen nur mit überwinben.
Silan tann bähet einen Schuß gegen ©an3er magen
(ftberfd)reitfäl)igteit bis 2,50 m) meifi fdjon burd) Sin»
flauen oon ®räben oon 3 m ©reite auf 1,50 m SBaffer»
tiefe ober burch Slnfumpfen bon feuchten Sßiefen er-
reichen. Sie ftberfchreitfähigteit idjroerer ©urdjbruchS»
panjerwagen beträgt bis ju 6 m.
®räben mit einer SBaffertiefe bon 1,80 m unb einer
©reite bon minbeftenS 3,50 m tonnen bon S <h ü ß e n
im allgemeinen nur mit Hilfsmitteln überrounben mer=
ben. ©reite SB a f f e r f 1 ä ch e n mit nur 0,40 m
Xicfe, bie unter geuer gehalten werben, wirten als
gutes Hitti)etni§ gegen Schüßen, ba biefe bann nicht
mehr liegenb fließen tonnen.
®rofje Überflutungen nerhinbern faft immer feinb-
licfje Singriffe. ®rofje Überflutungen ober Flutwellen
burch Slblaffen bon SBaffermaffen auS Salfperren ober
Kanälen zwingen ben ®egner ju umfangreichen, jeit»
raubenben ©brbereitungen gum Singriff ober gu befon»
bereu SHaßnahmen beim Singriff. Schaffen großer Über»
flutungen unb Slnftauungen unb Slblaffen bon £al=
fperren ift Aufgabe ber ©ioniere.
98
107. SBafferfpetren fcbafft man burch Anftauen ober
überfluten. Sie erforberlid)en SBaffermengen getoinnt
man burd) natürlichen Sufluft ober burd) Ableiten
bon ©taufeen ober fjöljer gelegenen ©analen.
3m gladjlanb mit Ijogem ©runbinafferftanb tann
man fcbnn burdj 3ufefcen bon ©ntroäfferungS* ober
Ableitungsgräben (Sdjlieften bon SBehren, Serftopfen
bon Surdjläffen) ben ©runbivafferfpiegel fo beben, baft
bie Ufer ber ©räben berfumpfen.
3e narb bem beabsichtigten ßmed tann man enttoeber
ben Wfferlauf oberftrom einer Stauanlage anftauen
Silb 66.
überfluten eines (öelänbeS.
(Silb 69), b. b. ben Sßafferfbiegel beben, ober bei ge»
eignetet ©eftaltung beS ©elänbeS, be§ UferranbeS unb
be§ SadjbetteS ein überfluten be§ ©elänbeS auch unter«
ftrom einer Stauanlage ober eines 2)ammburdjftidje3
(Silb 66) erreichen.
99
108. fjür ben Sau bon Stauanlagen finb
g ü n ft i g : gegen 0feinbfid)t unb «eintolrtung gebetfle
fdjntale Stellen mit toafferunburdjläffigem Unter*
grunb unb Ufern unb nidjt ju ftartem Strom, 9lälje
bon Sauftoffen (Salten ober SRunbtjoIj, gafdjtnen,
®ung ober roafferunburdjläffiger Soben, roie 5£on
ober £ef)m), görbermittel für Sauftoffe;
u n g ü n ft i g: breite Stellen, glujjgrunb ober Ufer au§
burtfjläffigem Soben, ftarter Strom, Weite Kntfer*
nung ber Sauftoffe, SRangel an görbermitteln.
109. Sei felbmäfjtg gebauten Stauanlagen ift
bem juneljmenben Sßafferbrud unb bamit ber ©efalfr
Silb 67. Stauanlage burdj gnfefeen einer Srüdenöffnung.
Sßaffertiefe — 0,40 m SBorpadung fortgelaffen
üuerjd)nitt.
100
beS 2lu§= ober UnterfpülenS beS glufjgrunbeS ober ber
Ufer (SluS* ober Unterteilen) am Stau ober in feiner
‘Diäfje burd) tiefes Stammen ber Salten« ober Sollen«
mänbe, Sorpadfungen (Silb 67) unb, wenn erforber»
lid), Slnorbnen eines SturjbetteS ober Umlaufes (HO),
ferner burd) Setleiben ber Uferanftfjlüffe (Silb 67)
9led)nung ju tragen, ba 9Safferburd)brüd)e mit felb»
mäßigen Mitteln nur ferner Befeitigt »erben tonnen.
110. Sine einfadje Stauanlage ftettt man burd) ßu*
fegen eines SBafferburdjlaffeS ober einer niebrigen
Srude (jer (Silb 67).
Sdjmale unb nietjt ju tiefe Sßaff erlaufe ftaut man
nad) Silb 68, 69 unb 70. (Sin Stutijweljr jeigt Silb 71
SBilb 68.
Silb 69.
Säntme für fdpnale Sßafferläufe.
Wasserspiegel
Im gestaut ungestört
unb 71 a. Uber ben überfall leitet man ttberfdjufj«
roaffer ab.
©runbfäglid) mufj man bei einem überfattme^t ben
fjlujjgrunb unmittelbar unterftrom beS SßeljreS burd)
^afdjinen, ftarte Straudjpadungen ober Steine gegen
SluStolten burd) baS überftrömenbe Sßaffer fidjern
(Sturjbett). SängS beS SturjbetteS bei fentredjtem
Slbfturj beS SBafferS (Sturjnie^r) gleid) Dierfadje Stau«
101
SSilb 70.
Sibertoeljr. Saub^oljftämme, mit (Steinen befeuert
Silb 71.
Sturjtoe^t (fiberfaUtoe^r).
(Seitenanfidjt.
15 -20 cm * Bohlen,5-8 cm stark
+2,00 m gestaut
7 Za \ y/7jyv7
•------rd.5,0m —U----»Hni
gtunzbett • 4 fache Stauhöhe*
Stauhöhe *t 20 m,
—L^ »-
o J 'X+0,80 m
//x\z//\S> ungestaut
Ijölje, bom guBpuntt be3 ?lbftur§e3 (33ilb 71), bei
fdjrägem Slbfdjufj (Sdju&roeljr) etact adjtfadje Stau*
Ijöfje, bom ®nbe be§ Slbfcfjujibobenä auS geregnet
(bgl. S3ilb 67).
^wnierbienft 3
102
2ln Stelle eines Überfalles tann man aud) einen
Umlauf nad) Silb 72 anlegen.
SBilb 72.
58ebr mit Umlauf.
Kräfte: 1 Sug.
Sauftoffe: 45 Sollen, 3,00 m lang, 6/30 cm; 1 So^le, 5,00 m lang,
6/30cm; 3 Sßfäljle, 3,50 m lang, 20cm 0; 2 Sßfäljle, 3,00 m lang, 20cm 0;
2 ^ßfäljle, 1,00 m lang, 20 cm 0, 5 Serfteifungen, 2,00 m lang, 16/16 cm;
4 m* Schalbretter, 3 cm ftart, für ben Umlauf; 300—400 Sanbfäcte.
Sinbe mittel: 200 Sägel, 15 cm lang.
^SBertseug unb ®erät: 1 gugramme; 2^anbrammen; 2Sägen;
2 Sljte; 2 jammer; 1 SdjaufeL
Seit: 1 Sug etwa 8 Stunben, ohne Slnbeförbem ber Sauftoffe.
Stämme, bie überftrömt werben, finb burdj SKuflegen
öon gafdjinen» ober Straudjpadungen ju befestigen,
unterftrom ift ba§ glufjbett .als ©tursbett auSgubauen.
111. $afif)inen fdjmiegen ftdj bem fjlufjbett an; fie
finb baljer für ben S3au einfacher Stauanlagen gut
brauchbar.
103
äRan fertigt ^afdjinen — etwa 5 m lang — auf
Sötten nad) Sifb 73 fo an, bafj ba§ Strauctjmert auf
einen Shirdjmeffer bon etwa 0,2 m bi§ 0,3 m mit
Silb 73.
San bon gafdjinen auf Süden.
Oß~0,8m^0t6rQ,8m -*
ffiürgejangen ober einer Sette jjufammengefdjnürt unb
in 9lbftänben bon 0,3 m bi§ 0,5 m gufammengebunben
wirb, ©ingebaute fjafdjinen befdjwert man.
112. fRing§ um bie Stauanlagen legt man gegen
Überfälle S)ral)tljinberniffe ober Saumfperren an.
G. Beteiligen von Sperrungen.
113. Sefeitigen bon XRinenfelbern im
®elänbe, tiefen SJlinenfperren auf
fEBegen, Start ft romfperren unb öffnen
bon grofjen Slnftauungen ift Aufgabe
ber fßioniere.
SBieberfjerfteHen nur wenig jerftörter Srüden f.
307 ff., überwinben bon ®räben nacf) 246, 247, 261,
276 ff., 323 u. 324 legtet 2lbfa|.
114. Sei allen Sperren ft eilt man ju»
e r ft feft, ob SOlinen ober Sabungen in
iljnen berftedt ober mit iljnen berbunben finb,
ober ob bie Sperren burd) ®aö b e r {e u cf) t finb, bei
8*
104
©raljtjäunen unb glädjenbraljtljinber«
niffen aud), ob fie mit Startftrom gelaßen finb.
115. 3n ben 23obcn gelegte 2R i n e n tann man oft
an ber Sobenöerfärbung ober «umgeftaltung, in ober
über ben SBoben gelegte, auf 3 u 9 gcfteHte 2R i n e n
an lofcn ober ftraff gekannten ©räljtcn, bereit ©oben
nid)t flar fidjtbar befeftigt finb, ertennen. E§ ift bafjer
auf anfdjeinenb nur lofe fjerumliegenbe ©räljte, ®nüp»
pel unb auf bie 2lrt ber 25efeftigung aller Sßerbraljtungen
in Saumfperren, SBaumberljauen unb S3arritaben gu achten.
3n ben 53oben oerfentte, auf ©rurf gefteüte SRinen
jerftört man burdj Sprengen ober burrf) herüber»
fdjieben ober »jieljen bon gfaprjeugen ober 28aljen, auf
3ug gefteüte ÜRinen burrf) Slbjieljen be3 3u9^ragte§ au3
einer ©erfung ober burrf) Sprengen.
Sidjtbare SRinen tann man aud) burrf) ©eroeljr« ober
®t. ®. $euer au§ etwa 100 m Entfernung ober burrf)
®efdjü£feuer jur ©etonation bringen.
116. ©rafjtjäune unb ©ratjtljinber«
n i f f e, bie mit Startftrom geloben finb, unterfdjeiben
firfj im üluSfetjen oft nidjt bon anberen ©ratjtljinber»
niffen. 2Ran e r t e n n t Startftrom in ©raljtljinbcr»
niffen:
a) 2ln einem ftart fummenben ® e r ä u f dj in einem
geerbeten gelbfernfpredjer, ben man in ber
fRälje be§ ©raljtijinberniffeS gebraust.
b) ©urä) Serütjren mit einem metallifrfjen
Leiter, ipierju binbet man einen burdj ein Seiten«
geroeljr ober ÜReffer geerbeten, gut ifolierten ©ratjt an
einen Jpoljftab unb madjt ba§ freie Enbe be§ ©raljteS
blaut, ©er fßrüfenbe ifoliert fidj, b. i). er legt ®ummi=
Ijanbfrf)ulje unb ©ummiftiefel an ober binbet t r o et c n e
Rollbretter unter bie Stiefel. Erft bann legt er baS
blante ©ra^tenbe turj an einen ©rafjt be§ ju unter«
fudjenben Rinberniffe§ an. Entfteljen Junten, fo ift
ba§ §inberni§ mit Startftrom gelaben.
105
Wtit Startftrom gelaberte ©räijte burdjfdjneibet man
nur mit gummiberoeferten ©raljtfcfeeren (i). ©ie®raljt»
fdjeren binbet man an lange, trodene Stangen, um
Serlufte burd) abfdjneKenbe, mit Startftrom gelabene
®räljte ju bermeiben. 3Kan fdjneibet breite Süden,
ba bie nidjt burd)fd)nittenen Seile be§ £)inberniffe§ mit
Startftrom gelaben bleiben. Sie loSgefdjnittenen
Sratjtenben jieljt man, um ifer SBieberlaben ju ber»
Ijinbern, mit trodenen unb am ©riff, 3. SB. burd)
®ummi, 1 f 01 i e r t e n Ipoljftangen ober mittete §alen,
bie man an trodenen §anffeilen ober Seinen be»
feftigt, au§ ber Sude feerau§.
SRenfdjen unb Siere, bie an Startftromljinberniffen
b&ngen, barf man erft berühren, toenn man fid) nad)
Sttf. b) ifoliert ljat.
117. ^läcfeenbrafetfeinbemiffe f p r e n g t man burd)
SReifeenlabungen au§ Sßionier»SprengmitteIn, bie in
SJtoljre gefüllt ober auf Satten gefdjnürt finb, ober burd)
geballte Sabungen.
fjür 1 Ifb. m SReifeenlabung benötigt man etwa 3 kg
$ionier»®prengmittel. SJtan erhielt baburdj ©affen
bon 3—5 m Sreite. 2ln ber <5pi|e ber Steiljenlabung
bringt man jum ©rleidjtern be§ SSorfdjiebenä 2 SSrett»
ftüde fd)täg jueinanber ate Slbtoeifer an. Sebaüte
Sabungen bon 30 kg jerftören ba§ £>inbernte in einem
Umtrei§ bon etwa 5 m um bie SprehgfteKe.
Sra^tjäune burdffdjneibet man mit Straft»
fdjeren ober legt fie mit ber Sljt um.
Breite Stolperbra^t^inberniffe überleitet man nad>
Sufmerfen bon SBrettem, 3?afd)inen, SReifigbünbein
ober SWatten.
3)ratjtfd)tingen reifet man mit ben Sßfäfjlen fyer*
au§, toenn fie nic^t mit SRinen berbunben finb, fonft
berfäfert man nad) 115.
106
118. Steilftänge überwinbet man burd) 2lbgtaben
ober 2Ibfprengen, mit Sdjüften audj burdj 21n-
legen oon S e i t e r n.
119. 311 ^faftlfperren (teilt man ©affen burd)
Sprengen ober 2lbfägen ber Sfäftle fter ober madjt bie
Sperre für gepanzerte Sampffaftrjeuge burdj ©inbrin»
gen oon gafdjinen gangbar.
Sarrifaben unb Saltenfpcrren fprengt man ober
j e r ft ö r t fie mit Sägen, 2ijten unb Sredjftangen.
120. Sanjerroagenfallen f cft ü 11 e t man j u ober
ü b e r b r ü d t fie.
/121. Slufgetifjene Straften beffert man nad) 320
122. 21 u f r & um en oon Saumfperren unb
Saumoerftauen erforbert biel $eit unb Kräfte.
2Ran b e f e i t i g t berftedte Sabungen ober SUinen
burd) 2lu§einanberjreften ber Säume, befonberS iftrer
28ipfel, mittels eiferner §aten ober leicftter 2lnter, bie
man an langem Sau in bie Sperre wirft, unb nacft 115
burd; fdjwadje SudjtruppS unb fteHt bann burdj
jaftlreitfte Säge» unb 2ljttrupp§ ©affen in 3 m
Sreite fter.
123. 2Inftauungcn befeitigt man burdj 21 u f r e t ft e n
ober Sprengen ber ®ämme ober 28eftre. Oft
genügt ftierju §erftetten Heiner Süden ober Söcfter in
©ämrnen, bie baS 28affer fdjnett erweitert, gu fcftneüeS
2lbflieften be§ 2Baffer§ ift gu öermeiben, weil fonft unter»
ftrom gelegene Srüden gefäftrbet werben tonnen ober
Selänbe unterftrom ber Stauanlage überflutet werben
tann.
H. Serftören von (5efd)ütjen unb ITHnen*
wertem.
124. Um ein ©efdjüft oftne ©infaft oon $to»
nier»Sprengmitteln ju jerftören, labet man
107
H mit größter Sabung, füllt ba§ SRoljr bor bem (Sefdjoß
mit ®rbe unb Steinen möglidjft bi§ jur äßünbung,
»erteilt biefe mit Jpolj unb feuert au§ einer ©edung ab.
SReben bem Stoßr wirb meijt aud) bie Safette ftart be»
fdjäbigt werben. Sei (Sefdjügen mit fRojjrrüdlauf er»
reidjt man grünblidje 3erftörung ber Safette, wenn
man außerbem bie SremSjplinber burdj bie SBiege
binburd; mefjrfad) burdjfdjießt unb bie güllod)» unb
®ntlfiftung§fd)rauben unmittelbar bor bem SIbfdjuß
öffnet. Sei (Sefcßügen mit Suftborijoler löft man not
bem Slbfdjuß audj bie Serbinbung jwifdjen fRofjr unb
fiolbenftange.
125. Um ein ®efdjüg burd) S i o n i e r»S p r e n g-
mittel ju jerftören, bringt man minbeftenS 4, bei
größeren Kalibern 6 Sprengbüdjfen in ba§ Sloljr, ber*
Dämmt bie Sabung unb jünbet mit einem Seitfeuer»
jünbmittei.
126. Sprengen einzelner ^anbgranaten im fftotji
bat nur geringe SBirtung. SKuß man §anbgranaten
»erwenben, fo füllt man ba§ fRoljr faft bi§ jur SDlün»
bung mit tpanbgranatentöpfen mit eingefegten Spreng»
tapfeln. ©abor fegt man eine §anbgranate mit Stiel,
»erbämmt bie gefamte Sabung unb jünbet burd) 2lb=
jtegen ber ffjanbgranate au§ einer ©edung.
II. Überfein.
A. Überfe^fteKen.
127. Saltifd) günftig finb: (Segen Suft» unb ©rbfidjt,
möglidjft aud; gegen Sefdjuß gefügte SereitfteKungS»
räume unb gute SKnnäijerungSmöglidjteiten für über»
feg», galjr» unb Sautrupps unb überfegmittel für
Sdjügen, gegen feinblidje ®rbfid)t unb Sefdjuß ge»
fdjügte Sau» unb SanbefteHen für gäßren.
108
128. Sei^mfd) günftig finb: Grefte 2ln» unb Slbmarfdj*
toege, fefte unb pacfje Ufer, Snlegemögltdjteiten un»
mittelbar am Ufer, geringe fjlufjbreite, fajroadjer Strom
(Stromgei'djimnbigteiten f. 216), feine Untiefen im fjlufj.
B. ÜberfefcmitteL
129. übetfegmittel finb:
a) Vorbereitete: Meine (Silb 74) unb grofje
(Silb 75) jyiofsfäcfe, ißontonä unb fjäfjren au3
biefen Überfegmitteln.
Silb 74.
ftberfegenmit Heinen»
glogfad
ßänge: 3,00 m.
©reite: 1,15 m.
@^Iau(f)bitr(f)meffer:
0,35 m.
Slngug bei Trieben**
übungen f. 497 b.
SöiXb 75.
ftberfe^en mit
großem glogjad.
ßänae: 5,50 m.
©reite: 1,85 m.
S dj lau d) burdj*
meffer: 0,60 m.
b) SeljelfSmafjige: ffägne, Sßafferfportfagrjeuge,
behelfsmäßige §lo^fäde, SBagen» unb ©agnfä^ren,
fjlöfje au§ ©(^roimmtörpern (fjunborte f. 217).
1. glofefäcte.
130. ^loftfäde tann man fd)nell aufpumpen (fatjr«
bereit machen), berpatft ober fahrbereit in faft jebem
©elänbe tragen unb auf bem SBaffer leidjt fahren.
109
58ilb 76.
Kroger glogfact, jum Überjetccn eines
spanäerabWehtgejtljiilieS tyergeritljtet.
Draufsicht
Schnitt A-8
Slofjfäcfe toerben fahrbereit bon SJlannfdjaften
jum SBaffer borgetragen ober auf (SefechtSfahrjeugen
aller 2lrt Dorgebracfjt.
gflofjfäcfe eignen [ich baljer befonberS al§ überfehmittel
für überrafcf)enben unb f eh n e 11 e n UfertoedjfeL
SBtlb 75 a.
Stöger glofjfact t«rj
Dor bem 3unmffet>
bringen.
S)a§ Slufpumpen
ber glofjfäcfe ift ju
hören. ntufj be§=
halb bei ungünfti»
gern Sßinb minoeftenS
500 m Dom ^einbe
entfernt gefdjeljen.
131. giofefäde
finb empfinblicf). 3luf=
gepumpte gflofjfacfe
bürfen baljer nur auf
ber Schulter ober an
ben 6cf)euertauen
(Silb 75 abgetragen,
nicht auf bem Soben
gefdjleift merbeu.
Sporen finb not
bem (Sinfteigen in ben
glofjfacf ab^ulegen.
Dreibeine Don SJta»
fchinengetoehren unb
anbere ®eräte, burch
bie bie fjlofjfäcfe Derletjt »erben tonnen, finb borfichtig
ju Derlaben.
Seifpiel für S dj u h ber glofjfäcfe gegen Sefcfjä-
b i g e n f. Silb 76.
110
132. Xtaglraft, Slitötüften unb Schienen non glofe
fäcten.
SBc je«*)' nung $lu£rü[hmg ®tgen- ge- totd&t kg Stag» iugleidj gal)t» trupp Bett für ®uf- pum* pen in SRin. Sragfraft
Heiner »loB* fad 1 ^ol^boben 1 Sragefad; 3 lur^e babbeln; 1 Sölafebalg mit SBerbinbungS* fd>laud^; 1 Sßertjeug* tafdje; 1 deutel mit ®ict)tung$* ftöpfeln. 60 2JDlann (babon 1 Steuer* mann, 1 fßabb* ler) 5 300 kg: 3 SRann ein* t^rfrupp.
großer fad 1 §ol^boben 2 Xragefäde, ba* öon einer für ben§ol$boben; 5 turje, 2 lange babbeln; 2 SBIafebälge mit $erbinbung3* fdjläudjjen; 1 SBerljeug* tafdje; 1 deutel mit ®id)tung^* ftöpfeln. 150 7 SKann (babon 1 Steuer* mann, 6 fßabb* ler) 15 2750 kg: (außer ^ö^r* trupp): 1 L 9JL ®.£rupp ober 1 S^üfcen* trupp ober If.SJLGtmit SBebienung oberlL^JLSB. mit Söebie* nung,28erfet unb fßrofce getrennt ob. 1 fßan^er* abroeljr* gefdjüfc ober 1 ^raftrab mit Satjrer.
111
über (djmale ©ewäffer werben fjfloßfäcle nidjt ge*
babbelt, fonbern am Sau (191) bewegt. Sie Störte
bet fjai)rtrupp§ ift bann geringer.
2. behelfsmäßige SBafferfaljrjeuge.
133. Spät}* unb ßrtunbungStruppS fowie anbere
fchneU borgeworfene Heine Slbteilungen, bie feine über-
feßmittel mitführen, feßen auf Dorgefunbenen ober fetbfi
hergeftettten behelfsmäßigen SBafferfaßrjeugen über.
Sotten borgefunbene Uberfeßmittel benußt werben,
fo ift ihre Sragtraft burch $robebelaften ober ^Berechnen
(Silb 77) f e ft j u ft eil en unb ihre Sraucfjbarteit ju
prüfen, fjür nur borübergehenbeS 23enußen genügt
Schößen.
' ȟb 77.
berechnen bet Sragtraft bon Käßnen.
Freibord
Eintauchtiefe infolge mittlere Breite Ißm
Eigengewicht
©ie nufebare $öbe (im 23ilb 0,80 m) redjnet bei fetjtoimmenbem $aljr.
bon Sßafferoberfläaje bi§ löorbranb, berminbert um 0,25 m greiborb.
©ie mittlere 23 reite (im SBilb 1,90 m) toirb bei fdjrägen 23orben in
ber SRitte ber nufcbaren $ölje gemeffen.
©ie mittlere Sänge (im 23ilb 10,00m) ift bie Sänge be§ fetjimmmen*
ben $aljn3 in ber 2Qitte ber nufcbaren $ölje.
Siauminbalt — mittlere SBreite x nufcbare $ölje x mittlere Sängt
- 1,90-0,80 m • 10,00 m-rb. 15 m’.
Stauminljalt in m8 — Eragtraft in t
©er fialjn mit 15 m8 trägt 15 t
Kähne, SBagenfähren unb anbere. Kähnen ähnliche
Sßafferfahrjeuge al§ ©injelüberfeßmittel follen belaftet
0,25 m fjreiborb (SSorbranb über bem SBafferfpiegel)
haben (SJilb 77). Schwierige Sßerhältniffe — ftarter
112
Strom, ©untclljeit, SiSgang, SBellenfdjlag — lönnen
höheren fjreiborb, bis 0,50 m unb barüber, bebingen.
Set Slöfjen au§ SBafd^obern ober Stögen genügt ein
geringerer greiborb.
Sie Sragtraft Von Sonnen, Saniftern unb ßaftlraft«
ivagenfd)läudjen ift in Safel 14 angegeben. Sie Stag«
traft von sJtunb«, Sant^öl} unb Srettern beregnet man
bei trodenem §olj nadj ber Formel:
cbm $olj _ . ,, . ,
----g----= Sragtraft in t
3?affe§ §olä ift fernerer als trodeneS, feine Srag«
fäljigteit batjer geringer.
Sie Selaftung eines ©injelüberfe^mittelS burrb
1 SRann mit SluSrüftung beträgt etwa 100 kg.
134. Säljne, Soote, Sladjen unb SBagenfäljren feilen
feft gebaut, roeber verroftet nodj angefault fein. SBaffer»
faljrjeuge aus Jpolj prüft man burd) Sinftec^en, eifern*
<5al)rjeuge burd) Slbtlopfen anfegeinenb fd)abljafter
Stellen.
SedS pnb mit §olj, Stoffftreifen, SBerg, S^d) ober
Seer, auSgetrodnete ©oljtäljne burdj längeres Siegen
unter SBaffer ju bidjten.
135. Slöfce für einzelne Seute fteHt man auS Salten,
Saumftämmen, Stangen ober Slobenljolj allein ober in
Serbinbung mit SBafdjjobern, Srögen, mit Strolj, öeu
ober §oIjmoHe gefüllten SBagenpIanbünbeln, Saniftern,
Sarbibbeijältern, fjäffem, Sannen, Sonnen, gebtdj«
teten Siften ober Safttraftmagenfcbläudjen her
(139—149).
136. SeljelfSmäfjige Stuber unb $abbeln fer-
tigt man auS Srettftüden unb bünnen Stangen an, bie
man burdj fRägel, ©ratjt ober Sanbeifen verbinbet.
Stalen erfegt man burd) Stangen.
113
137. ©tunbjäge für ben 23au oon Jlöfjen:
a) SBer einfadj baut, baut f d) n e 11,
b) Sd)roerf>unft ber Saft mögltdjff tief legen,
cj alle Sauftoffe fo 1 e t <f) t tole möglidj wählen,
d) fo bauen, baft man ba§ Ja^rjeug auf bem
SSaffer leidjt fahren tann.
138. Jür überfeinen int feinblidjen Jener
eignen fidj Heine ffäljne ober <S b o r t f a Ij r -
jeuge, S e Ij e If § f lo fj f ä d e unb 5£rog = ,
©djlaud)», <S t r o fj = ober Sdjilfroljrflöße,
58itb 78.
gloft au§ einer SBagenpIane.
Strafte: 2 Staun.
Sauftoffe: 1 Jelbtoagenplane;
3—4 Sunb Stroh ober £>eu (Füllung).
Sinbemittel: 5 Seinen ober30m
SJraljL
Sßertgeug unb ®erät: 1 gange.
@igengehJid)t: ettoa 50 kg.
Xragfraft: 1 Staun.
3 e i t: 40 2lrbeit3minuten, bei 2 Staun
20 Stinuten, ohne Slnbeförbem ber Sau*
Magenplane ftoffe.
®epäcf ift hinter bem Staun auf ba3
$loß gefcfjnürt.
«ilb 79.
glog au§ jtoei SSagenplanen.
Kräfte: 4 Staun.
Sauftoffe: 2 Söagenblauen; 4 (Stan*
gen, 2,00—2,50 m lang, 5 em 0; 4 Sretter,
3,50—4,00m x 30cm x 5cm; 8—10Sunb
(Stroh ober £eu al§ Füllung.
Sinbemittel: 20 Seinen ober
120 m SDrabt.
Sßerf^cug unb erät: 1 (Säge;
1 8ange; 2 klammem gum Schnüren.
@ig eng e ioi ch t: ettoa 110 kg, je
nach ®ert>i(f)t ber 9ßlane.
Sragfraft: 2—1 Scann.
JJ ei t: 27a Slrbeitöftunben, bei 4 Staun
40 Scinuten, ohne Slnbeförbem ber Sau*
ftoffe.
114
nidjt bagegen Salten» unb Eonnenflöfee, bie flrfj auf
bem Sanbe ifjrer ©djroere wegen nur bon mehreren
Seuten bewegen, auf bem SBaffer nur ferner fahren laffen.
139. Sagenplanen (öon ^elbwagen, Safttraftwagen
ober SirtfdjaftSwagen) laffen fid) in öielfadjer fjorm
jum ^erfteüen einfacher unb tragfäfjiger ftberfeijmittel
berwenben. - Sie finb mit Strofj, ©euf Stoljr, Sinfen,
Sleifig ober Jpoljrooffe ju füllen, ©te übereinanber
greifenben Seiten unb ®nben ber planen müffen oben
liegen (Silb 78 u. 79).
140. ®in [djnell fjeraufteßenbeS, fidjere§ über}ermittel,
ba§ 2 Wtann mit
SluSrüftung trögt,
ift ber Scbelf§flofj<
fad nadj iöilb 80
u. 80 a. SKan ftopft
bie Steiterfutterfäcce
mit ©trofj ober §eu
au§, berfcf)Iie§t fie
mit Seinen ober
©ra^t unb legt fie
auf bie SSagenplane,
bie grutterfäcfe an
ben 2 »m» ©eiten
cm ^lunytii. ,.w iu luny.»—v um btcljt auetttanber.
SBretterunbSBrettftüctejumSerfteifenbeSSobenä. ©tejrutterfäde bin*
t m X ö ytt 4 4- 4- r> T ♦ OA Qöimöm rtSor rr» t J
bet man bann an
Stangenraljmen
feft unb fdjlägt bie
SBagenplane bar»
über. Sie Stäubet
«Üb 80.
«e^elfSflogjaÄ.
Kräfte: 4 Stann.
Sauftoffe: 1 Sßagenfclane; 63teiterfutter*
(öde ober anbere füllen; 6—8 Sunb (Strolj
ober §eu al§ $üHung; 4 Stangen, 2,00 m lang,
4—6 cm Q; 4 Stangen, 1,60 m lang, 4—6cm 0;
S i n b e m i 11 e 1:20 Seinen ober 50 m ©raljt.
Berfjeug unb ©erät: 1
1 gange.
©igengetoidjt: ettoa 100 kg.
Xragtraft: 2 2Rann.
JBeit: 2 Slrbeitöftunben, bei 4 ______
80 Scinuten, oljne SInbeförbem ber Sauftoffe.
Säge;
Sftann
ber SBagenpfane legt man burdj Bretter ober SBrett»
ftürfe fo feft, bag baburd) ber Soben »erfteift wirb.
Sornifter legt man al§ <5i|e unb weitere Serfteifung
an bie beiben [djmalen ©eiten be§ SobenS an.
115
Stan tann aud) nicfjt ganj iuafferbitte planen Der»
»enben, wenn S3eljelf§flof}fäae nur turje 3eit benu|t
»erben fallen.
Silb 80a.
SeVWofiiatt, Mnfidjt ber 3kitcrfutterfärte.
Unter ben fteiterfutterfäcten ebenfalls em 3tabmen auS ©fangen ober
Srettern.
141. Sdjladjttröge flBilb 81), einzeln ober au
mehreren mit Satten ooer Stangen berbunben, laffen
fld) aud) auf ftrömenbem SBaffer gut fahren.
2.5 m——
fträfte: 2 SRann.
Sauftoffe: 2 ©djladjttröge, 1,75 m lang, oben 0,75 m breit, unte^
0.46 m breit, 0,80 m bocb; 2 ©tanqen, 2,50 m lang, 6—8 cm 0.
116
Sinbemittel: 8 ßeinen ober 45 m ©raljL
Berfgeug unb ©erat: 1 Sange.
Eigengetoidjt: ettoa 80 kg.
Xragfraft: 2 Stann.
Seit: */s Slrbeitöftunben, bei 2 DJiann 20 SRinuten, ohne Stnbeförbem
ber Sauftoffe.
galjrer haben fidj auf ben Soben gu fefcen. Serminberung ber örrei-
borbbölje bi§ 15 cm guläffig.
142, glöfce au3 Stögen unb SBafdßobern nad)
53ilb 82 u. 83 eignen ficf) als überfegmittel über ruhige
©emäffer.
*8tlb 82.
SMdßoberflof; mit einem 3ober.
Strafte: 2 Staun.
Sauftoffe: 1 Sßafdhgober, 0,52 m tjodj, 0,72 m bgm. 0,81 m 0;
2 Stangen, 6 m lang, 5-—8 cm 0; 2 Stnüppel, 1,20 m lang, 5—8 cm 0;
1 Srett, 1,70 m x 30 cm x 4 cm; 1 Srett, 3,00 m x 30 cm x 4 cm.
Sinbemittel: 10 ßeinen ober 15 m ©ra^t
Sßerfgeug unb ©erat: 1 Säge; 1 Sange; 2 Kammern jum
Scfjnüren.
©igengetoictjt: ettoa 50 kg.
Sragtraft: 1 Staun.
Seit: 1 SlrbeitSftunbe, bei 2 Staun 30 Sttnuten, ohne Slnbeförbern
ber Sauftoffe.
143. VV'Iöfte ait§ Saittraftttjagenfdjläudjen, bie fitfj
leidjt auf bem Sßaffer fahren laffen, geigt Silb 84. $at
man genügenb Bafttraftioagenfdjläudje, fo baut man
groedmäfjig iVIöfje au§ 4 Sttjläudjen.
117
23ilb 83.
%tafd)$oberflo§ au§ brei
Sobern.
ft r ä f t e: 2 SRann.
93 a u ft o f f e: 3 Söafefjjober,
0,52 m fjodb, 0.72 b^to. 0,81 m 0;
8 Stangen, 2,50 m lang, 5cm0;
8 Stangen, 2,00ra lang, 5cm0;
1 Stange, 1,50 m lang, 5 cm 0.
93mbe mittel: 10 deinen
ober 22 m ^rabt.
Söcrtgciig unb (Ke r ft t:
1 Sage; 1 S^nge; 2 ftlammern
gum ecbnürcn.
@ig enge tot et) t: ctroa 150kg.
Sragfraft: 22Rannmit(3e«
päd ober 3 fOtarni obne (Kepäcf.
Seit: 2 Slrbcitöftunben. bet
2 SRann 1 Stunbe, ohne Slnbeför*
bem ber 93auftoffe.
Rur bei fe$t fd&toadjem Strom bertoenbbat.
Schnitt A~B
RionterbtenfL
SBilb 84.
^t^lautbflog au§ 2 ober
beffer ans 3 Safttrafb
ttjagenfdUäiicijcn.
ft r a f t e: 2 9ftann.
58 au ft off e: 2 (3) Saft»
frafttoagenfcbtäucbe; 4 93ret-
ter, 2,50 m x 3U cm X 3 cm;
2 (4) 93retter, 3,00 m x 30 cm
x 3 cm.
93inbemtttel: 8 (14)
Seinen ober 40 (70) m 'Sra^t.
SB erzeug unb ®erät:
1 8ange.
©igengerotcbt: etwa
150 (200) kg.
Sragtraft: 1 Sftamt
Seit: 40 (60) SlrbeitS>
mtnuten, bei 2 2Rann 20 (30)
Sftinuten, ohne Slnbeförbem
ber 93auftoffc.
Xragfraft bon ßafttraft*
wagenfdpläucfjen:
je 2 Sdjläudje 1 SEann.
9
118
144. Sangftrolh ober Sdjilfrohrbünbel (Silb 85)
finb auch ohne §.ü Ile brauchbar. Sie Sünbcl
werben mit Seinen feft berfcfjnürt unb jwiftfjen SBagen-
leitern ober Srettern eingebunben.
Silb 85.
glofj anS Sangftrohbflnbeln.
Kräfte: 1 Sruppe.
Sauftoffe: 16—20 Sunb ßangftrob; 2 ßeitem; 12 Querböljet,
2,50 m lang, 8—10 cm 0.
Sinbemittel: 24 m glatter SJraljt, 8—5 mm, jum Serbinben bei
ßeitem mit ben Duerbölgem.
SBerfgeug unb ® e r ö t: 1 gange; 1 ftanbfäge ober 1 SeiL
Xragtraft: 4 SJtann ohne ®ebäd etwa x/t ©tunbe.
Seit: 8 SlrbeitSjtunben, bei 1 (Srubpe */, ©tunbe, ohne Sfctbeförbern
ber Sauftoffe unb bei fertigen ©trobbünoeln.
145. «Jlöfje aus» SRunbljoIj ober Stangen jeigen bie
Silber 86 u. 87.
146. Sei flößen mit einzelnen Sonnen,
Raffern unb anberen Schwimmern finb Sluöleget anju»
bringen, ba bie ^löfje fonft tippen (Silb 82, 88 u.
88a). glöfce au§ mehreren Schwimmern finb burch Quer»
berbinbungen au§ Stangen ober Srettem ju öerfteifen.
119
»ilbSO. ghmb^o^nog.
Sträfte: 4 2Rann.
Sauftoffe: 2 Shmb^öljer, 5—6 m lang, 20 cm 0, ober 2 Stant*
$5Ijer, 20/20 cm; 4 Änitypel, 1,40 m lang, 10cm 0; 1 Sunb ©trolj ober
fceu al§ Stfc; 2 Sretter, 2,40 m x 25 cm x 3 cm.
Sinbemtttel: 14 Beinen ober 60 m ©raljt.
»erzeug unb (gerät: 1 ©äge; 1 gange; 4 Stlammern.
®tgengetotdjt: ettoa 280 kg.
Xraglraft: 1 SRann.
Bett: 1 ÄrbeitSftunbe, bet 4 äRann 15 SRinuten, ohne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
Wb 87. StanflenfH.
Äräfte: 4 2Rann.
Sauftoffe:? ©tangcn, 6,00 m lang, 10 cm 0; 4 Änüpbel, 0,90 bfS
1J80 m lang, 6 cm 0; 1 Srett, 0,90 m x 15 cm x3 cm; 2 Srcttcr, 0,90 m
X 25 cm x 3 cm.
Stnbemtttel: 10 Beinen, minbeftenS 3,00m lang, ober 30 m
Draht; 14 Kägel, 7 cm lang.
SBertaeug unb (gerät: 1 Säge; 1 gange; 4 Stlammern;
1 Kammer ober Sllauenbeil.
«fgengemtcbt: etfoa 250 kg.
Xraglraft: 1 Sftann oljne ©epäct
Seit: !/« ÄrbeitSftunben, bei 4 äRann 25 SRinuten, oljne Slnbeförbern
auftoffe.
9*
120
Silb 88. Zomtenflog en8 eiltet tonne.
cm mm
------—
fträfte: 2 SRann.
83auft o f f e: 1 Sonne, 0,71 mb^to.0,60m0, 0,84m lang; 2Stangen,
etfoa 5,00 m lang, 5 cm 0; 1 83rett, 1,50 m x 80 cm x 8 cm; 1 SSrett,
24K) m x 30 cm x 3 cm; 2 ftnübfcel, 1,50 m lang, 5 cm 0.
SBinbemittel: 12 ßeinen ober 85 m £>ra$t
SBertgeug unb ®erät: 1 Säge; 1 gange; 2 ftlammern.
@igengetot$t: ettoa 120 kg.
Sragtraft: 1 SRann.
gelt: 2 Krbeitöftunben, bei 2 SRann 1 Stunbe, oQne Slnbefbrbern
ber ÜBauftoffe.
33ilb 88a. Sonnenfloft and 2 Xonnen.
fträfte: 8 Wtan.
iöauftoffe: 2 Sonnen, 0,71 m bgh). 0,60 m 0,0,84 m lang; 2 Stangen,
5—6 m lang, 6 cm 0; 2 Stangen, 3,00 m lang, 6 cm 0; 5 ftnübpel.
UJO m lang, 6 cm 0; 2 Bretter, 3,00 m x 80 cm x 3 cm.
SBinb emittel: 22 ßeinen ober 70 m ©raljt
SB erzeug unb ®erät: 1 Säge; 1 SBeil; 1 gange; 3 ftlammetn.
@igengetoidjt: ettoa 240 kg.
Xrag traft: 2 SRann.
8 e i t: 3 Slrbeitöftunben, bei 3 2Rann 1 Stunbe, obne Slnbefärbern
ber Sauftoffe.
121
147. Sei größeren Tonnenßößen (Silb 89) muffen
bie Tonnen gleicß groß fein, um einen feften Sau be§
»Vloßeö au getoäßrleiften (Tragtraft Oon Tonnen unb
gäffern f. Tafel 14).
Refi M Selageö nictji gegeidjnet
23tlb 89.
Sonnenflog 6 Sonnen.
Äröfte: 4 SRann.
Sauftoffe: 6 Sonnen,
0,71 m bgm. 0,60 m 0, 0,84 m
lang; 4 Stangen, 4,00 m lang,
10 cm 0; 6 Stangen, 2,50 m lang,
10 cm 0; 12 Stangen, 0,80 m lang,
10 cm 0; 6 Sretter, 3,50 m x 30 cm
x 2,5—4 cm.
Sinbemittel: 70 deinen
ober 200 m ©raat.
Sßerfgeug unb®erat:
1 Säge; 2 Seile; 1 gange;
5 Älammem.
g e n g e m i dj t: cttoa700 kg.
Sraglraft: 4 Staun.
Seit: 6 Slrbcit^ftunben, bet
4 Stann l1/, Stunden. ohne Sin*
beförbem ber Sauftoffe.
148. Slßnlidj wie Tonnen tann man aueß Ranifter,
j. S. naeß Silb 90 unb 91, ober in toafferbießten Stoff
ober Sinnen geßüUte giften einbauen. Tie s2lnjaßl ber
als ©dßtoimmer einjubauenben Sanifter ufto. rießtet fuß
nad) ®röße unb Gigengetoicßt.
149. ßarbibbeßälter, garben« ober ®lildßtannen
tann man mie ©anifter oermenben. Sie finb bunß
§oljp.fropfen ober mit gett ober öl geträntte Sappen
abjubießten. Sorteilßaft finb Sefäße mit Sdjraub»
ober medßanifcßem Serfcßluß. gefter ©iß unb Ticßte
bet Serfdjlüffe ift midßtig.
150. Tie S e r f dß I ü f f e ber Tonnen, Sanifter unb
fonftigen (Sefäße foHen beim Ginbau möglicßft oben
liegen.
122
S3üb 90.
ftanifterflofj ««8 9 fianijter«.
2,5-Jm
Kräfte: 4 Stann.
S a u ft o f f e: 9 ftanifter, 0,50 m Ijodj, 30 cm 0, je ettoa 60 I 3n«
Ijalt; 6 Stangen, 2,50—3,00 m lang, 5—8 cm 0; 2 Sretter.
Sinbemittel: 23 deinen ober 120 m ©raljt.
SBerfgeug unb $erät: 1 Säge; 1 gange.
@igengctoicf)t: ettoa 100 kg.
Sragfraft: 2 Staun.
geit: 4 Slrbeit^ftunben, bei 4 Stann 1 Stunbe, oljne Änbeförbem
ber Sauftoffe.
S3ilb 91.
ftaniftetflojj att§ 4Staniftem.
Ä r ä f t e: 4 Stann.
Sauftoffe: 4 ftanifter,
0,50 m lang, 30 cm 0, je ettoa
50 1 Snbalt; 2 Sretter, 3,00 bi«
3,50m x 30cm x 5cm; 2Sretter,
2,50m x 80cm x 5cm; 2Stangen,
3,50 m lang, 5 cm 0.
Sinbemittel: 17 Beinen
ober 60 m ©ral)t.
Sßerfjeug unb ©erfti:
1 Säge; 1 gange; 1 jammer;
4 filammcm.
@igengetoidjt: ettoa
100 kg.
Xragtraft: 1 Stann.
geit: 2 Ärbeit^ftunben, bei
4 Stann 7, ©tunbe, o$ne bin*
beförbem ber Sauftoffe.
123
151. Seinen« ober Srahtbunbe (238 unb Silb 120
bis 122) muffen bei allen Stößen befonbers forgfältig
»nb feft auSgefüijrt werben. ©raljtbunbe erforbern oft
eine längere Saujeit als bei ben Silbern angegeben.
Kögel finb als Serbänbe nicßt ju berwenben, weil fie
w lodern unb bie Stöße bann auSeinanberfatten.
152. 2luS ®reiet£<jeltbal)nen tann man Stöße jum
flberfeßen bon ® e p ö d, j e b o rf> n i d) t bon
SRannfrfjaften perfteHen.
§errid)ten eines fdfioimmeitbeit 3eIttaI)nbiiitbeI3.
Silb 92. Silb 92 a.
©in auf turje geit fcßrointmfäljigeS
ßeltbaijnbünbel für ® e p ö d, baS bon einem
Schwimmer gezogen ober gefdjoben werben tann, baut
man wie folgt:
3 w e i ßeltbaljnen legt man fo nebeneinanber
auS, baß bie beiben botfjer jugetnöpften geltbaßnfdjlibe
in einer ßinie liegen, unb f eß lägt fie an ber Setüß=
rungSfeite nacf) Silb 92 um. gn bie Sitten fdjiebt
man je 1 Sornifter unb 1 doppel fo hießt jufammen,
baß man bie nadj Silb 92 a aufjulegenben Seweßre
unb Seitengewehre feftfeßnüren tann.
Sie ©de A ber einen geltbaßn wirb mit ber ©de A
ber anberen geltbaßn über ben ®eweßren jufammen«
gefnotet, ebenio bie ©de B mit ©de B. Seibe Snoten
124
werben mit einem Sftantel« ober jfodjgefdjirriemen ge»
fidjert.
5)ie in ber SängSri^tung liegenben
©den merben fotoeit wie möglidj jugefnöpft, bann
jufammengebunben, ©de 1 mit ©de 2, unb mit einem
Stiemen »erfdjnürt (23ilb 92 b).
SBilb 92 b. ®ie bur(*> baSt
__________________2 anberfdjlagen entfte^enben
galten finb nach innen (jod)*
Z_________________3ii3tel)en. Quin fragen brefjt
man Sünbel um unb
kf \ j Wit eS an ben (Scme^ren.
/f-r \ Jr* 3>a burcf) bie Qeltbatyn*
I JMr iWtye 5®af|er einbringt, ift
//•Z bie ®(f)toimmfäf)ig-
1 I e t * keä SünbelS ft a r!
/// — begrenzt; man mu[j fie
bafjer burd) Unterbinden
anberer Gdjroimmfbrper,
roie ateifigbünbel aber ffanifter, oerbeffern.
3. gälten*).
153« Srforberltdje Sragtraft bon ftäfjnen als Stufen
unb Semeffung beS Überbaues f. 133 u. tafeln 17—19.
Sragtraft bon Sonnen f. Safel 14. Sei Sonnen*
fahren ift aufjer ber überpfe^enben £aft bie S e -
laftung burd) ben überbau (bei ä^vgä^ren.
ettoa 3,3 t, bei4=t*gäbren ettoa 4,5 t) inStedjnung $u fteüen.
Serbinben beS Überbaues mit glofcffiden, Sräjjnen unb
Sonnenflöfcen f. 154, 157, 158, 291. Seriegen beS
Überbaues f. 297—302.
Sei 2't'%af)wn mit einer Serbreiterung ber galjr*
baljn auf 3 m ift bie Qaljl ber Sragbalten um 1—2
bermeljren.
♦) Sie Se^eicbnung bei Sragfraft oon gälten erfolgt rote
bei Srüden (231).
125
glo&fmffä^ren.
154. <$IogfacffäI)ren werben natfj Silb 93—93 c ge»
baut unb auSgerfiftet. Sie finb nur bet 6tromge[(f)Wtn>
bigfeiten biö 1,50 m/s benufcbar.
Silber 93 bi3 93 c.
San einet Sloßiadfäbre.
Silb 93.
Kräfte: 1 (Srufcpe (12 SRann).
S a u ft o f f e: 2 grofce tflofjfätfe; 4 $olmbretter, 4,00 m—4,80 m x 25 cm x
4 5 cm; 5 Sragbalten, 6,25 m lang, 14/18 cm ober 20 cm 0; 27 Selag«
unb ©tofjbretter, 3,50 m x 25 cm x 4,5 cm; 2 Äöbelbalten, 6,25 m lang,
10/14 cm; 4 ®elänberftü$en, 1,50 m lang, 8 cm 0; 2 ©elänberftangen,
4.50 m lang, 8 cm 0; 2 föelänberftangen, 6,50m lang, 8cm 0; 16 SRöoel*
fette (f. Silb 93 c).
Sinbemittel: 48 lietnen, ettoa 6,50 m lang ober 300 m ©rabt.
Serfgeug unb (Serät: 1 ©äge; 1 Seil; 1 gange; 1 ©raljt*
ftbere; 4 Klammem.
Xrag traft: f. 155.
gelt: 8 SlrbeitSftunben, bei 12 ältann 30—45 Wfänuten, ohne Sin*
bcförbern ber Sauftoffe.
SRan baut 5 Sragbalten ein, um baburdj bie ftabrbaljn gu Verbreitern.
126
58tlb 93a.
' 5 127
155. galjrtrupp: 1 fjüljrer, 2 Steuerleute, 8 Babbler,
1 Steferüemann.
X r a g t r a f t: etwa 2 t.
SR a n tann überfeinen (außer fjaljrtrupp):
1 Sruppe
ober 2 Werbe mit Steitern (felbmarfdjmäßig)
» 1 f. SR. ®. Sproße ober Ipinterroagen unb 10 SRann
• 2 l. SR. SR. abgeproijt mit Sebienung
• 1 m. SR. SB., abgeprofjt mit Sebienung
• 1 SRun. SBagen für SR. SB. mit ga^rer
• 1 K. 16, Sproße ober abgepro|te§ ®ef($üß mit
Kanonieren
* 1 jroeiteiligen SRun. SBagen, Wo&e ober Söinter^
wagen mit galjrern
» .1 1.fjj. Jp. 16, Sßroge ober abgeprotjteS ©efdjüij,
mit Kanonieren
• 1 SBeob. SBagen (Slf-12), Sproße ober IpinterWagen
• 1 fjelbtüdje ober 1 fjelbwagen
• 2 Wtnjerabwefyrgefdjütje
• 6 m. ober f. Krafträber (in 2 Steifen ju je 3 neben»
einanber) mit ga^rern (6 SRann)
• 3 Krafträber mit Seiwagen (ljintereinanber, ba3
mittelfte fdjräg jur SPrüdenbetfe) mit ga^rern
unb SBeifatjrern (9 SRann)
• 1—2 I. gl. Sptw. (Ijintereinanber) mit SPefatjung
(2 SPt». nur bei entfpredjenber Sänge ber
Satjrjeuge)
• 1 m. gl. Sßtw. mit SPefaijung
- fonftige bi§ 2 t fdjwere §a^rjeuge.
Sie Sluflagebretter für bie Sragbalten unb bie Srag»
ballen felbft finb ju fdjnüren. ®or ben SBaltentöpfen
finb Stoßbretter anjubringen.
tjflofjfadfäljren braunen beim Sau, Selaben unb
Anlegen eine SUinbeftioaffertiefe bon 0,50 m, ba bie
Sloßfäde fonft burd) Scheuern auf bem fjlußgrunb
befdjäbigt werben.
128
156. gum Serlaben bon gatjrjeugen unb ?ßfer«
ben benutzt man Stampen (53rcttafeln) nad) 195. SRann»
fdjaften muffen unter Umftänben burd) ba§ SBaffer
traten.
Staljnfäljren.
157. £talmfäl)ren (59ilb 94 u. 94 a) baut man tote
glofefacffä^ren. Sau bon langen gfäijren mit 4 ober
mehr ®ätjnen al§ Stützen ermöglicht ba§ ©erlaben mel>»
rerer gahrjeuge ober bon einzelnen gahrjeugen m i t
Silb 94.
4=t=!8el)clf§iäl)re au§ Säbttcu.
Gelänaerstütze 8-fOcm p
Äräfte: 1 Srubbe (12 2Rann).
Sauftoffe: 2 Statine mit ben tm Silb angegebenen SJlafcen unb
8,3 t Sragtraft, jum @inbau bergeridjtet; 5 Xragbatfen, 6,25 m lang,
26 cm 0: 27 Selag* unb Stofebrettcr, 3.50 m x 25 cm x 6,5 cm; 2 SRöbel»
ftangen, 6,25 m lang, 10—15 cm 0; 4 (Setänberftüfcen, 8,00m lang, 10cm 0;
2 (Mänberftangen, 6,25 m lang, 10 cm 0; 2 (Mänberftangen, 4,00 m lang,
10 cm 0; 16 SRöbelteite; 20 Slnaggen.
Sinbemittel: 40 Seinen ober 250 m ©ratjt; 100 SRägel, 10 cm lang.
Sßertjeug unb ®erät: 2 Sägen; 2 &$te; 2 Seile; 1 gange;
1 S)rabtfdjere; 1 SRefjftab ju 2 m; 5 klammem.
Sluörüftung: 4Stafen; 6 tRuber; 1 Sinter mit©oppeltau; 2 SBaff er*
fcbaufeln; 2 Seile; 4 $alteleinen; SMIe jum geftlegen bon ßfaljrjeugen.
Reit: 24 Slrbeitöftunben, bei 12 Slann 2 Gtunben, o$neSlnbeförbern
ber Sauftoffe.
129
ihrer Sefpannung, wenn
ufergeftaltung, Strom ober
Rälte ein Sajtointtnen ber
^ferbe auSfcfjliefjen, unb be«
frfjleunigt bctfjer baä über»
fefcen.
®te Sorbe ber ffäljne
mfiffen tragträftig
fein, ba ba§ Slufrüften
fd)tt>ad)botbtger Säljne (291)
geit erforbert.
»ilb 94 a.
KBbelutta bet gtunbbol).
SBilb 95.
2=t=2:onnenf8t)re (Oelänbet fortgelaffen).
190
ftröfte: 1 Sru^e (12 SJtann).
Sauftoffe: 24 tfolgfäffet, je 8001 Walt (nac$ XafeI14); 8^olme,
7,00 m lang, 10 cm 0; 4 Sragßalten, 7,00 m lang, 22 cm 0 (Stüfctoette
430 m); 28 Selagbretter, 3,50 m x 25 cm x 4,5 cm; 2 Stofjoretter, 830 m
x 25 cm x 4,5 cm; 2 Äöbelftangen, 7,00 m lang, 12 cm 0; 10 Steg-
Bretter, 2,80 m x 25 cm x 4 cm; 8 Säßmenljölä«, 7,00 m lang, lOcm0;
16 SaBmenßölger, 6,00 m lang, 10 cm 0; 16 Saßmenßölger, 1,00 m lang,
lOcm0; 12 SerßinbungSBölger, 2,50 m lang, lOcm0; 2 SertoannungS«
Böiger, 4,00 m lang, 10 cm 0; 10 m* Sre&er, 2 cm ftarl, für Strom-
aßfoeifer; 20 Söbelleile.
Sinbemittel: 150 Seinen ober 500 m ®raBt; 250 Slftgel, 15 cm
lang; 150 Sftägel, 10 cm lang.
SSertgeug unb ®erät: 2 Sögen; 2 njte; 2 Seile; 1 8<ntge<
1 ®raßtfcßere; 1 äRefjftaß ju2m; 4 Älammem.
Seit: 36 ÄrßeitSftunBen, bei 12 SRann 3 Stunben, ohneKnbeförbern
ber Sauftoffe.
Ermittlung ber ftafcgaBl:
@igengen>i$t beb Überbaus (bei lufttrockenem $ol$) = rb. 83 t
Slufclaft.................................= 2,0 t
53 t
Zraglraft eines Bölgernen {VafleS bon 800 1 RnBalt = 225 kg.
Erforberlidje «nia|l ber ftäffer:
5300 : 225 - 283 Wer - rb. 24 Wer.
Sonnenfäljren.
158. Sonnenfäljren (23ilb 95) baut man avß ftarten,
eifenbereiften Sonnen (Raffern) bon möglichft gleicher
Stöße unb fjorm. Schmale unb längliche Sonnen
finb turnen, bauchigen borjugteljen. brauchbar finb
Petroleum*, $8ier« unb Sßeintonnen (=fäffer), nicpt ba«
gegen fchtoachtoanbige ^Jaffer au3 toeicbem öolj mit
Öotjreifen, bie gewöhnlich nicht toafleroidjt pnb unb
leicht jufammengebrüat toerben. SOtan baut Sonnen«
führen minbeftenS hoppelt fo lang, tote bie ^a^rba^n
breit ift, um ba§ fjabren auf bem Xßaffer ju erleidjtem.
Sonnenfäbren finb ftfjtoer (153). Um ba§ 3U*
toafferbringen ju erleichtern, baut man fie am Sanbe
auf untergelegten SRunbljöljem unb fc$tebt fie auf
biefen in ba§ Sßaffer.
Sonnenfäljren taffen fidj ftfjtoer auf bem SBaffet
fahren unb finb nur in ruhigem Setoäffer oertoenbbar.
Seifpiel für berechnen ber Sonnenjahl SSilb 95.
Sragtraft bon tjäffern unb Sonnen Safet 14.
131
G Sauren auf dem Waffe«.*)
159. Da§ fgaljren auf bem SBafler ift ein roitfjttger
Teil ber äluäbilbung, für ben reid)Iidj geit aufju»
ioenben ift.
160. SBafferfa^rjeuge ioerben burd) Stubern, Strei»
eben, babbeln, ©taten, SBriggeln, Dreibein, Sieben an
Zugleinen, Sieren oljne ober am gätfrfeil ober burd)
SRotortraft fortbemegt (164 ff.). 9Hd)t burd) gugleinen
bewegte SBafferfatjrjeuge tjält man burd) Steuern in
einer »beftimmten Stiftung.
/
SilMö.
*toiiteYted)tttfd)e Hröbrfide Beim galten auf bem Sßaffer.
•) Über SBcrfyalten, SInjug unb ©onberbeftimmungen bet
tfriebenSübungen f. £eil VIII ,,<5t$erljett3befüninumgen''.
132
6§ bebeuten (Silb 96):
ä? n- äs } “
lanbtoärtS, toaffertoärte | jeweils auf bie Sage beS
Vanbborb, Stromborb ! fjabr jeugeS jum Ufer be«
&nbfaf)rjeug, Stromfabraeug I jogen,
oberftrom, unterftrom: auf bie Stromridjtung bezogen,
sXrÄtf Seite* } in 5Ri(^tun8 *um ®U9 9e^cn‘
1. fjabren im ßinaelfabraeug.
161. S a S ju SBaffer gebrachte ü b e r f e g •
mittel mirb aunädjft mit gagrgerät auSgerüftet, öon
bem gagrtrupp befegt, am Sanbe feftgeljalten ober feft-
gelegt unb jum Selaben unb Slbfegen fertiggemadjt
Slud) bei boller Selaftung mufe baS überfegmittel nod)
fdjioimmen.
Ser fjabrtrupp bat Sewegre unb ©aSmaSlen ftets
griffbereit.
162. überjufegenbe fjufstruppen bebalten iljr
@epäcf auf. 2luf .SSefebl be§ gaijrtruppfübrerö fteigt
bie überjufegenbe Sruppe (Überfegtrupp), ®emebr in
ber linten §anb, rubig ein, berteilt fid) gleichmäßig
unb fegt fid) je nai§ Söauart beS Überfegmittete
einanber gegenüber ober bintereinanber auf ben
©oben (nicfjt auf bie Sorbe). Sorüben an Sanb
tann notmenbig fein.-
163. Seim überfegen ift ben Slnorbnungen beS
gagrtruppfübrerS, auch bon ben überfeg»
truppS, 5°lge au leiften. SBäbrenb bet Überfahrt
barf niemanb feinen Slag bcrlaffen, aud) wenn bas
gabrjeug jcgroantt. 9lut ber fjübrer beS fjagrtrupps
gibt Sefeble (§. So. 300, 313).
133
Slubetn unb Streidjen.
164. Ser Sagrtrupp ßeftegt au$ einem fjagrtrupp»
fügtet (Steuermann) unb je nadj Sröfje beS fyagr»
jeugeS 2—4, bet ftarfem Strom bis ju 8 Sluberern.
Sei längerem üßerfegen ift für Sl b l ö f u n g ju forgen.
165. Sefegen beS gagrjeugS erfolgt naeg Ginteilen
beS JVagrtruppS burdj ben Steuermann auf baS $fom»
manbo „Ginrüden". SaS fyagrjeug liegt mit ber
Sorberlaffe (Sug) nadj oberftrom, §intcrtaffe Cpetf)
fegräg im Strom.
Ser fjagrtrupp fteigt ein, ber Steuermann juerft. @r
legt, ®ep(gt nad) ber Sorberfaffe (Sug), baS Steuer
redjtS bon fidg ein unb galt baS fjagrjeug bamit, falls
nötig, feft.
Ser legte SOtann gält baS gagrjeug an einer ©alte»
leine.
Sie hagrer figen ober ftegen fjront jum Steuer»
mann, beim tagten mit Stalen ober Stedjrubern
fjront jur Sorberfaffe, unb rügten.
Oe Serrtdjtungen erfolgen auf ffiommanbo beS
Steuermannes.
Straffes ©anbgaben beS gagrgerätS ift ju forbern,
bamit — bor allem in feinblidjem geuer — baS fjagr»
jeug jeberjeit feft in ber ©anb beS gügrerS ift.
166. „Ofetjen!"
Ser legte SRann ftöfjt baS gagrjeug fo weit ab, bafj
gerubert werben tann, unb fdjwingt fid), bie tpalteleine
mitneljmenb, in baS gagrjeug. SSenn nötig, unter»
ftügen bie fRuberer baS Slbfegen burdj Ginfegen ber
Stuber.
167. „Segt auS!"
2ofe Slubergabeln werben eingeftetft. Sie Stuber
werben auf bem türjeften SSBege bom Soben in bie
Stubergabeln ober SiuberboHen redjtwintlig jur SJtittel»
linie beS gagrjeugS gelegt. SaS Stuberblatt ift fenb
$ioniert>ienft
134
redjt, etwa eine §anbbreit über SBafjer, ju fteüen. Die
galjrer fetjen ben bem Sluberblatt abgetoanbten (Jufj
V2 Sdjritt not.
$jn ftartem Strom wirb „2egt auS!* bor „Slbfefcen!"
fommanbiert, bamit fofortige Stuberbereitfdjaft gewähr«
leiftet ift.
168. „Stabern — an!"
Sie galjrer bringen, frei) »eit borlegenb, ben ©riff
beS StuberS mit auSgeftreaten Firmen nacf) bom, Stuber«
blatt fenfredjt, fenten baS Sluberblatt etwa ju jtoei
Drittel inS Sßaffer unb gieren baS Stuber, fid) weit unb
Iräftig ins ®reuj jurüdmerfenb, an ficE).
®a§ Stuber wirb auS bem SBaffer gehoben unb in
bie SluSgangSfteüung gebracht. Die SBetoegungen werben
tattmäjjig, bei ^Beginn ber iauSbilbung nadj 3ä^en beS
Steuermannes, fpäter nadj bem Sempo beS Sdjlag»
manneS, ber unmittelbar bor bem Steuermann fifct ober
ftetjt, fortgefeßt.
169. „£att!"
Das Stubern toirb burd) fjanbbreiteS ©erauStjeben
beS StuberblatteS auS bem «Baffer unterbreiten unb
baS Stuber roie bei „2egt aus!" gehalten.
170. „Stopfen!"
Die VormärtSbemegung ift ju Ijentmen. DaS Stuber»
blatt mirb ljierju {entrecht ganj in baS SBaffer gefentt
unb fo feftgeijalten.
171. „£ebt auS!"
Die Stuber merben auS ben ®abeln gehoben unb fo
am ©riff gehalten, baß baS Stuberblatt biefjt am ®oot
fdjteimmt. Die Stubermannfiijaft nimmt ben SBIid
infjatrtridjtung.
DaS tiuSIjeben ber Stuber barf jum Verringern beS
mit ben Stubern eingenommenen StaumeS nur an»
geroenbet werben, toenn bie Stromüerljältniffe eS ju»
taffen.
135
172. „Anlegen!"
©a§ Anlegen erfolgt nad) Verringern ber jjaljr»
gefdjwinbiglett, in fliegenben Sewäffern ftetS mit ber
Vorbertaffe nad) oberftrom.
©er ber Vorberlaffe junäd)ft befinblidje gfaljrer
foringt mit ber ©alteleine perauö, bertjinbert ftarteö
Aufläufen unb ljalt ober befeftigt ba§ gafjrjeug.
173. „Stuber ein!"
erfolgt je nad) Uferberljältniffen unmittelbar bor
ober nadj bem Kommanbo „2Inlegen!".
Stuber unb lofe Siubergabeln werben in ba§ gaijr»
jeug gelegt.
174. „SuSrüden!"
©te Sröannfdjaft berläfjt in umgeteljrter Steiljenfolge
wie jum ©inrüden ba§ §aprjeug.
175. „Streidjen — an!"
©ie galjrer jieljen, Jtdj Weit jurödlegenb, ben Stuber»
Öbidjt an ben Körper, fenlen jwei ©rittel be3
erblatteS in baä SBaffer unb brüden ba§ Stuber,
bie 2lrme auSftredenb unb fid) weit borlegenb, nad)
öorn.
©aä Stuber wirb au§ bem SBaffer gehoben unb in
bie 9lu§gang§fteIIung gebradjt.
176. Sott ein galjrjeug fdjnell wenben ober
eine anbere Stiftung einneljmen, fo lann
bie3 j. 23. burdj 2Iu§füpren be§ KommanboS „Steuer»
borb rubern —, Sadborb ftreiepen — an!" erreicht
werben. Stadj Sinneljmen ber neuen Stiftung erfolgt
ba§ Kommanbo fobann „Stubern —" ober
„Streiken — an!"
babbeln.
177. 3um babbeln mit Stedjrubern ober mit 2M>=
beln ftefjt ober fiijt ber galjrtrupp, mit bem äufjeren
gufj an bie 23orbwanb angelernt, ben inneren gufj
‘/i Sdjritt öorgefteHt, 23lid in gatjrtridjtung. 23ei gro»
10*
136
feen glofefäden fifet bet galjrtrupp rittlings auf bem
glofefad (Silb 75).
©a§ Stedjruber (Sabbel) tarnet man, weit nadj
born auSboIenb — Stuberblatt quer jum gafjrjeug —,
in§ Sßaffer, jiefjt eS mit trftftigem $ug etwa 0,30 m tief
bis weit rüdroärtS burdjS Sßaffer, legt eS am ®nbe ber
Semegung flad) an baS f^afjrjeug unb bringt eS bann
über SBaffer roieber bor.
Seim babbeln ofjne Steuermann »irb burcf) ber-
ftärtteS ©urdjjiefjen beS StuberblatteS ober burd; Streb
d)en auf einer Seite gefteuert.
Sabbeln unb Steuern tann man oerbinben, roenn
ein SJtann in ber öintertaffe beim SluSlaufen ber
Sabbelberoegung baS $abbel im SBafjer breitfeitig ent-
»cber an baS §al)rjeug Ijeranljolt ober bom fjaprjeug
abftöfet.
Stalen.
178. gum Stalen burcf) 1 2Rann fteljt biefer in ber
Ijjintertaffe, burd) 2 SRann einer in ber fpintertaffe,
einer in ber Sorberfaffe, unb j»ar jum Stalen I ft n g S
beS UferS am Sanbborb, über ben fjflufe am
Unterftromborb. ©ie gront ift nadj bem Sorb, an
bem ber Staten eingefefet »erben foB, ber Slid in bie
fjaljrtridjtung geroenbet.
©er gafjrer ftöfet ben Staten etmaS fdjrftg nadj rüd»
»ärtS auf ben ®runb unb fdjiebt baS fValjrjeug mit
nad)fjaftigem ©rud, mit ben §ftnben am Staten bis
jum ®nbe tletternb, bor»ärt3.
©er Staten wirb bann f d) n e 11 toieber ^erauS>
gejogen, ber fjintere Staten babei gleid)jeitig als Steuer
auSgenufet
179. 9tid)tungSftnberungen bei fVatjrt mit
nur 1 Staten »erben erreicht:
burd) Sreitfefeen (burd) ßinfetjen beS StatenS bon
bem ^fafjrjeug ab »eid)t bie Sorberfaffe beS fJafjrjeugS
nadj bem Sorb ab, an bem bet gafjrer fteljt)
137
ober burd) Unterlegen (burcf) ©infegen beS StatenS
nad) bem gagrjeug ju weicgt bie Sorbertage nacg ber
entgegengefegten Seite au§).
SBei 2 gagrern übernimmt ber in ber ©intertaffe
ftegenbe baS Steuern.
Unter fcgwierigen Sergältniffen ift ein befonberer
Steuermann mit Stuber einpteilen.
180. Soweit ®ommanbo§ für Staten an»
gewenbet werben — nur in ®ewäffern ogne ober mit
geringem Strom —, geigen fie: „Segt — auS!",
„Staten — an!", „Staten — galt!", „Staten — ein!".
Sgre Sebeutung ift ftnugemäg wie beim Stubern.
SBriggeln.
181. fjortbewegen eines SBafferfagrjeugS burcg
fdjraubenförmigeS Sewegen eines StuberS an ber
©intertaffe nennt man SBriggeln. ©ierju ftegt ber
§agrer in ber ©intertaffe, fjront ju biefer, unb um»
fagt mit beiben ©änben ben Sriff beS in ber ©inter«
taffe aufgelegten Stuberf. ©af Sluberblatt wirb etwa
bis jur ©älfte in baf SSaffer gefentt unb flacg gelegt,
®riff be§ Stubers ungefägr in ber ©öge ber 59ruft bef
tJagrerS.
©er ®riff beS StuberS wirb in einem Heinen, nacg
oben gegenben Sogen bewegt unb baS Stuber gierbei
mit ben ©änben fo gebregt, bag baS Statt, ogne auS
bem Sßaffer geraufjjutommen, einen naä) unten gegen»
ben Sogen befcgreibt unb in bem unteren Seil bef
SogenS flacg liegt, an ben beiben oberen ©nben beS
SogenS bagegen nageju fentrecgt ftegt. Sefteuert wirb
burdg ftärtereS ©urcggiegen beS StuberS nacg einer
Seite ober burcg einjelne Stuberfcgläge.
Steuern.
182. ©in fjagrjeug gat um fo grögere
Steuertraft, je megr feine ©efdjwinbigteit bon
138
ber bc3 SBafferS abweidjt. ©ie fjaßrtridjtung wirb
geänbert burtß Stellen be§ SteucrruberS nad) ber Seite
ber neuen Stiftung. Strömenbe ©emäffer überquert
man in ©ierfteüung (185).
3u größeren Sdjmentungen macßt ber Steuermann
Stuberfdjläge ober berfäßrt nad) 176.
Um in ftarfem Strom bei fjfaßrt nadj unterftrom
gute Steuertraft ju erhalten, j. 23. beim faßten burdj
enge 23r üdenö ff nungen, lägt man burdj 9tubem ober
Streiken gegen ben Strom mitten.
©reibeln.
183. ©ie SBafferfaßrjeuge werben bom Sanbe au8
an 2lntertauen ober ftarten Seinen burdj ©reibe!«
trupp§, Sefpanne ober Sraftfaßrjeuge gezogen (g e -
t r e i b e 11).
®§ tommt barauf an:
a) burdj Sierfteüung wafierwärtS ju berßinbern, bafj
ba§ Sßafferfaßrjeug aufläuft (nadj 23ebarf Staten
lanbwärt§ auSfeßen),
b) bie ®ierfteUung bauernb fo ju regeln, bafj bie
Sreibeltraft nicßt unnötig beeinträchtigt wirb,
©aju wirb ba§ SSafferfaßrjeug jum ©reibeln wie
folgt ßergeridjtet:
23ei Heineren fjaßrjeugen ober für
fürjere gfaßrten wirb bie ©reibelleine in ber
SBorberlaffe lanbmärt§ befeftigt. ©er Steuermann fteßt
in ber §intertaffe.
23ei größeren fjaßrjeugen ober für
längere gaßrten mufj man bom ^aßrjeug au3
eine ftärtere ©inwirtung ßaben; baßer mufj bie ©reibel«
leine in ber £>intertaffe befeftigt unb in ber 23orber«
taffe burdj ein 23eienbe gefagt werben (23ilb 97).
33ei geföppelten Saßr^eugen unb bei
f? ä ß r e n : ©er Steuermann fteßt unterftronvlanb«
n>ärt§, bie ©reibelleine ift im Stromfaßrjeug in bet
139
Silb 97.
Zteibeln mit Zreibelleine
unb Seienbe.
Sorberlaffe ju befestigen, ba§ Selenbe nad) bem Sana»
falfrjeug abjufü^ren.
Sei Ijoljen ober beioadjfenen Ufern
unb bei breiten fja^rjeugen unb
r e n ift bie Sreibellinie über
einen bekannten Sftaft im
borberen drittel ber $ätjre
ju führen.
Seim Dreibein ift
ju Beadjten:
SreibeltruppS tragen bie
ZreibeUeine über ber lanb»
toärtigen, nur ber letjte
SRann trügt fie über ber
toaffermärttgen Sdjulter.
®n gefäljrlicnen Stellen (ab»
föüffigeS Ufer, ljolje Ufer»
mauern) nehmen alle
SRannfdjaften bie Sretbel»
leine über bie ioaffermärtige
Sdjulter.
©efpanne unb ffiraft«
fatjrjeuge müffen jum
Xreibeln öorfidjtig anjie^en.
Sei wenig jugfeften ©efpannen ift ba§ SJafferfafjrjeug
burd) Trupps anjujieljen ober anjuftalen.
184. Sieben an ßugleinen f. 191 u. Silb 99 u. 100.
Sieten.
185. Sibt man einem tJafjrjeug, ba§ mit Sier»
leinen an einem Xau — güljrfeil — im Strome
B ü n g t, eine fdfräge Stellung jum Stromftrid)
— SierfteHung —, fo wirb e3 burd) bie ®raft bc§
Stromes bem Ufer jugetrieben, nad) bem bie Sorbet»
Jaffe jeigt (Silb 101).
140
Sie SdjrügfteHung ttrirb burd) bie Steuerleute unb
burdj Slnjie^en ober 9?ad)laffen ber ©ierleinen erreicht.
Qdfjrten über ftrömenbe ©ewäjfer o j n e Senufjen
eine§ fjäl)rfeile§ werben burd) ©innefjmen ber ®ier»
ftedung befdjleunigt.
Seim fjatjren in ®ierfteHung auf ftarl ftrömenben
©etoäffern ift barauf ju adjten, bafe ber Sßafferfdjroall
nidjt in ba§ ga^r8eu9
g-lofjfäden gibt man möglid)ft wenig SierfteHung.
2. galten mit gfä^ren.
186. Ser fjaljrtrupp» (fjiiljren«) fjüljrer
beftimmt ba§ Serpalten ber überjufe^enben Sruppt
beim Sinrüden auf bie JäJjre, beim überfefcen unb
beim SüuSrüden (£>. So. 300, 313).
187. Sie überjufegenbe SDlannfdjaft Intel
ober fe|t fid) auf bie SDiitte be§ SelageS (Silb 98).
Silb 98.
glofjjadfäljre mit ftbet}ufebeitbeit snamtfdjaften*).
s f e r b e finb ruijig auf bie fjäfjren ju führen (über
Stampen [Srettafeln] f. 195) unb mit bem ®opf nad)
oberftrom ju ftellen, unruhige Sferbe in bie SDiitte.
Steiter unb galjrer ftefjen bei iljren tßferben.
*) Stnjug bei griebenSübungen fiebe 497 b.
141
Stampen (©rettafeln) unb Selag finb möglidjft mit
Sanb, Stroh ober ©ung gu beftreuen. Sim Öberftrom«
gelänöer ber gräljre befeftigt man gum ©erufpgen ber
©ferbe $weige.
fjatjrgeuge (teilt man burdj Sfagieljen ber ©rem»
fen unb burd) Steile feft.
©ie fjähren finb beim ©elaben fo weit oom Ufer ent»
fernt gu batten, bafj fie beim Stbfejsen fdjwimmen (SRin--
beftwaffertiefe bei ^lofjfadfaijren: 0,50 m, f. 155).
188. ©er ^fabrtrupp einer fjäfjre ift im att»
gemeinen 1 3füt)rer, 2 Steuerleute, 8—9 Wahrer ftart.
Sei längerem Fährbetrieb ift 91 b I ö f u n g not«
wenbig.
189. Sfäljren werben gerubert, geftatt, am
8 u g t a u gegogen, burd) ® i e r e n am $ ä h r»
feil ober burd) SRotortraft fortbewegt.
3ebe Sfäljre, bie beim ©erfagen ber FortberoegungS«
mittel abgetrieben werben tönnte, ift mit einem wurf»
bereiten Situier mit ©oppeltau auägurüften. Sie Sinter
lann man burch Siften ober Sonnen boÖ Steinen, grofje
Steine, fcpwere Stahlftüde ober fdjwere Setten (befon«
ber§ bei fetfigem fjlufjgrunb) erfefeen.
©ie Stnlertaue befeftigt man an ftarlen Snüppeln
(©u^thölger) in ben ©orbertaffen (©achten) ber SBaffer»
fahrgeuge ober an geeigneten Seilen ber Sonnenflofj»
rahmen (239).
©ie Sauringe ber Sinter taue werben fdjnecfen«
förmig auf ben ©oben be§ ^ahrgeuge§ aufgefdjoffen, ba§
®nbe am ©ud)tholg feftgemadjt (239). Sluf ba§ Som»
manbo „fertig jum Sinterwerfen!" macht ber ®lann am
Sinter fidj fertig, um ben Sinter gu werfen, ©er ffahT'
truppfütjrer übergeugt fid), 'bafj niemand in ben Sau»
ringen ober gwifdjen bem Sau unb bem Sorb ftetjt, über
ben ber Sinter geworfen wirb. Sobann tippt unb ftöfjt
ber ©tann am Sinter auf ba§ Sommanbo „Sinter —
wirf!" mit ber einen &anb ben Sinter über ©orb, wirft
142
fofort mit ber anberen einige Sauringe nad) unb läßt
ba§ Sintertau 'burdj beibe Jpänbe nad)laufen. Sie
3luberer oberftrom helfen beim Slbfütjren beS SaueS.
Sluf ba§ Sommanbo — a— I — t!" bringt man
burd) allmähliches f^eftljalten ber ablaufenben
Sintertaue bie fjähre jum galten.
Sie über ba§ fahren mit ©inselfaljrseugen ge»
gebenen Seftimmungen finben finngemäft Stnttenbung
(bgl. 164 ff.).
D. Überfetfen am Cau.
190. ftberfe|en am Sau (3 u g t a u, f?&hr•
feil) befdjleunigt b a § Uberfefcen unb
fpart Kräfte.
191. ßugfähren berwenbet man jum überfein über
nicht ju breite Setoäffer mit f d) tt> a <h e m Strom (216).
a) Sei ©ewäffem bi§ 50 m Sreite werben an ber
gahre ober bem ©inäelfahrjeug 2 Sugtaue (Slnlertaue
SBilb 99.
Überfein mit jtoei 3usl<i*en («taue«).
ober ftarte Seinen) nach Silb 99 befeftigt. Stuf beiben
Ufern eingefetjte SWannfchaften sieben Die Säljre Don
Ufer ju Ufer.
b) Sei ©emäffern öon 50—100 m Sreite wirb ein
Seil auf beiben Ufern an Säumen ober Sfählen be«
feftigt
143
Sier gahrtrupp jteljt bie gähre ober baS Siujjelfahr*
geug an bem Seil über ben gluß (Silb 100).
Silb 100.
flt>erfe|en an einem 3»gtau.
192. (Gierfähren (Silb 101) fjängt man an ein
behelfsmäßiges gäßrfeilgerät an unb läßt fie in Sier»
fteüung (185) über ben gluß treiben.
©aS behelfsmäßige gäßtfeil gerät befteht auS
bem gährfeil, ber Sierrolle mit Seinen unb,
Wenn nötig, jroei ©reiböden unb bereu Ser»
anterung nach oberftrom. gallS borhanben, wirb
ein Seiljug jum Slnjiehen beS gährfeileS berwenbet.
9llS gährfeil nimmt man ©raljtfeile bon etwa 15 mm
Stärte; bei fchmalen glüffen mit fchwadjem Strom
tann man auch Sintertaue bermeubcu.
©ie gährfeile muffen fo laug fein, baß auf jebem
Ufer ein ®nbe bon minbeftenS 30 m für bie lanbwärtige
Seranlerung übrigbleibt.
Sim einfachften fpaunt man baS gährfeil, baS etwas
burchhängen muß, über bem SBafferfpiegel jwifchen
hohen» ftarten Säumen ober Sfeilern. gehlen biefe,
fo werben ©reiböde nach Silb 102 u. 102 a auS 3 §öl»
gern bon etwa 6 m Sänge unb minbeftenS 12/12 cm
(15 cm 0) Stärte aufgcftellt. Sorgfältiges Serbinben
ber brei folger im ffopfteil, möglidjft mit ®ifen»
boljen, unb Serantern beS SodeS nach oberftrom ift
144
Silb 101.
ßietfiiljre am gäWeil.
145
ioid)ttg. Sie Santen, über bie baä güljrfeil läuft, finb
abjurunben. ©a§ fjäljrfeil legt man an Slnterpfa^len
nadj Silb 103 feft.
2>reib3tte für Sal)rjetL
Silb 102.
©ie ©terroHe wirb über ba§ fjäfjrfeil gelängt; bie
®nben ber an ber ©ierroüe befeftigten Seinen ober
Saue (Siertaue) toerben in ben Oberftromlaffen ber
146
gäljre feftgelegt. ®urd) Anjie^en ober fRadjlafien beS
einen SauenbeS erhält bie tjäljre bie erforberlidje ®ier<
fteHung.
©ei Strom unter 1 m/s wirb bie Vorwärtsbewegung
ber jyäljre burcf) Stubern ober Staten unterftüfct.
193. 3 u g = unb Sierfätjren finb m ö g I i dj ft
au§ mehreren ääijnen fo lang ju bauen, bafj mehrere
gafjrjeuge, aud) befpannt, gleidjjeitig berlaben Werben
tönnen.
194. fjür 3U95 unb ©ierfä^renbetrieb finb im all'
gemeinen Sanbbriitfen ju bauen (196).
über f d) m a l e ©ewaffer baut man ©rüden, weil
turje ©rüden für Flieger unb Artillerie tein gröfjereS
3iel bieten als grofje §äf>ren unb Sanbbrüden.
E. Hantpen unb Canbbriicfcen.
195. 3um Ein» unb AuSlaben bon © f e r •
benunb fjaljrjeugen benutzt man ©rettafeln als
lofe Stampen (©ilb 104), bie nad) bem ©elaben auf ber
®ede ber gäljre ljodjtant gefteüt mitgenommen ober
an febem Ufer burd) befonbere EruppS bereitgefjalten
werben, ober Sanbbrüden (©ilb 107). fDurdj (entere
SWafjnaljmen wirb baS ©e= unb ®ntlaben befdjleunigt.
147
2ofe Stampen toerben für ©erlaben non galjrjeugen
ht Spurabftanb Verlegt (Silb 105), für ©erlaben Von
©ferben toerben fie ineinanbergeftfjoben (Silb 106).
Seitlidj begrenzt man bie Stampen für ©erlaben Von
©ferben burdj Ijüftljodj gehaltene Stangen unb ver-
l)inbert fo ein $u§bred)en ber ©ferbe.
58ilb 105.
Stampen (Stettafeln), in ®pnt*
abftanb Verlegt jnm Setlaben
bon gabtjengen.
Silb 106.
Stampen (Stettafeln),
tttfantmengefdjoben jum Set*
laben bon $fetben.
Sie galjren finb, um ein Slbrutfdjen ber Stampen
ju ver^tnbern, beim ®e« unb ©ntlaben mit je einer
©alteleine am Ufer ober» unb unterftrom feftju«
legen.
Sie Stampen foüen möglit^ft 5i§ jur SJtitte be§ lanb»
roärtigen SBafferfaljrjeugS reidjen.
196. fjüt Sauerfüijrbetrieb finb fianbbrüden,
möglit^ft mit fd&toimmenber ©nbftüije, fo weit in ba§
SBaffet ljinein ju bauen, bafj bie belabene $äljre beim
Anlegen an bie Sanbbrüde fdjtoimmt (155 fester Slbfatj).
148
©leiäbohlen, lofe Stampen, Uauffchienen (C*@tci^Ie)
ober in Saufrängen auf ben Sanbbrücfen unb ben
gähren neben ben Slöbelbalfen gu berfchicbenbe Ser*
binbung^balfen erleichtern ben Übergang ber gabr-
geuge oon ber Sanbbrücfe auf bie gähre, bie burch ©alte-
leinen an berfianbbrüd e feftg eh alten tuerben muß (Silb 107).
Silb 107.
Sanbhrütfe mit Überfe^fäbre (gum Selaben fertig).
197. (Snben Sanbbrüden mit fejten Stütjen, fo ift bie
§öhe ber Srücfenbecfe ber bie^feitigen Sanbbrütfe über
bem SBaffcrfpiegel nach ber §öhe ber gahrbahn ber nur
l e i ch t belafteten gähre, bie ber Srücfenbecfe ber jen*
feitigen Sanbbrütfc jcboch nad) ber ©öhe ber gahrbahn
ber boll belafteten gähre gu beftimmen, menn nur
einfei tiger Sertepr boß betafteter gähren ftattfinbet.
Sei Sertefjr boll belüfteter gähren in beiben Stich*
tuugen ift bie §öhe beiber Sonbbrüdenbeden nach ber
©ötje ber gahrbahn ber boß belafteten gähre gu bemeffen.
F. Überfeinen mit fd)wimmenben Pferben.*)
($.®o. 300, 313 3lbf. 3.)
1. Ogemeineä.
198. a) (künftige überfegfteHen finb gegen fetnbliche
Suftficht gefchü^te, breite, fefte unb flatfje Ufer, bie ohne
♦) Sicherheitsmaßnahmen unb Stettung^*
bienft bei grieben^übungen f. 502.
149
Unebenheiten (Söcfjer, @eröH, Sanbbänte, Schlamm»
fteHen) in gleichmäßigem Strom tiefer »erben.
Unbrauchbar finb: Steinige, fteile ober fumpfige Ufer,
iJIußabfchnitte mit unebenem ober weichem Untergrunb
in Ufernähe unb mit Strubelbilbung.
b) SInfammeln non ^Jferben am "Ufer ift falfdj.
2. Schwimmen an Suberfahrjeugen.
199. Swetfmäfiig teilt man wie folgt ein:
a) Überfehgruppen ju je 4 ober 6 ißferben mit je
2 ißferbehaltern. ©ie ißferbehalter unterftütjen
bie $bfatteltrupp§ beim Slbfatteln ober Slbfdjirren ber
ißferbe, toährenb be§ überfeßenS bie galjrtruppä beim
galten ber ißferbe.
b) Ülbfatteltruppä, Stärte je 1 Rührer, 4—6 ällann.
Aufgabe: 2lbfatteln ber ftum Schwimmen heran»
geführten ißferbe nahe am Ufer. 3ufammenbinben be§
SatteljeugeS jebe§ $ferbe§, SEBoiladj ^wifcpen ben
Sattelblättern. Übergabe an bie fjreifchmimmertrupps.
c) $reif(hwtmntertrnpp§, Stärte je 1 Rührer, 4 bi§
ß Schwimmer.
91 u f g a b e : SSerlaben be§ SepäcfS, §eranführen ber
^ferbe an ba§ Sßafferfahrjeug, Slbftoßen be§ SBaffer»
fahrjeugs, bi§ bie Sßferbe ben ®runb üerlieren.
d) gahrtruppä, Stärte je 2 Steuerleute (1 zugleich
fjührer), 2—6 Wahrer.
21 u f g a b e : ©ie Wahrer halten auf ber Hinfahrt bie
'jßferbe.
e) Sanbetruppä, Stärte je 1 Rührer (älterer Unter»
Offizier), 4—6 SRann unb 2 ißferbehalter.
Aufgabe: Übernahme »on ißferben unb Sattel»
jeug am anberen Ufer. 2lufftellen ber ißferbe unb 2luf»
fatteln, wobei bie übergefeßten ißferbehalter helfen.
©ie 3ahl ber 5£rupp§ richtet fi<h nach ber
Stärte ber ©ruppe unb ber 3ahI “nb
©röfje ber berfügbaren überfe|mittel.
Pionier bi enft
150
@S tonnen an einem großen fjlo^fad 4 $ferbe, an
einem Sßonton 4—6 ißferbe fdgwimmen.
200. Verlauf beS überfegens.
a) 5Die Überfeggruppen ber erften SßeHe werben bon
ben ißferbehaltern anS Ufer geführt unb bon ben 216-
fatteltrupps abgefattelt.
b) f^agrtruppS befegen bie ‘JBafferfatjrjeuge. Kara-
biner unb Stahlhelme finb in <&djleifen auS ®inbe-
leinen an ber inneren SSanb beS 3Sa|ferfahr§eugS unter
jubringen.
c) greifdjroimmertruppS berlaben baS Satteljeug
unb baS Sragtiergerät unb übernehmen bie ißferbe.
S)aS ©efd)irr bon Sefpannen wirb bon ben fjahrern
felbft auf bie gagrjeuge berlaben (201).
d) SiSgerige Sßferbegalter fteigen ein. SanbetruppS
berteilen fidj auf bie juerft überfegenben SSafferfagr-
ijeuge. Sie SBafferfagrjjeuge finb fo wett abjufegen, bag
bie ’-ßferbe nach Jperanfüljren burd) bie fjreifrgtoimmer-
truppS halb fdgwimmen müffen.
e) Sie in ben SBafferfagrjeugen 6eftnb=
lidje SJlannfdjaft einfdgl. 0agrtrupp ift fo ju »erteilen,
baft baS erfte ißaar mßglidgft weit bom (ausgenommen
bei gloftfäden), baS legte möglicgft weit hinten auf bem
SBoben tniet ober figt.
f) f}reifdgroimmertruppS führen bie ißferbe an baS
SSaJferfahrjeug gleichzeitig redgtS unb lintS getan,
ruhige unb fixere ißferbe born, angftlidje unb unruhige
hinten. SluSgefdgnallte SSügelriemen jum £nneinfd)teben
wiberfpenftiger ißferbe finb bereit ju ha^en- ® i e
‘Erenfenjügel finb aufgefchnallt.
g) Sobalb baS legte ißferb übernommen ift, gibt ber
Führer be§ fjahrtrupps ba§ Stommanbo „Stbftogen!*.
®er fjreifdjwimmertrupp ftöjjt ba§ SBafferfahrjeug fo
weit ab, bis bie ipferbe fcgwimmen. hierbei finb 23c<
fehle leife ju geben, bamit bie ißferbe ruhig bleiben.
151
SKeljrere SBafferfahrjeuge finb bon einer ftberfegftelle
nidjt gleichzeitig, fonbern nadjeinanber abjufetjen, bet»
mit bie SanbetruppS fieserer arbeiten tonnen.
h) Die SJJferbe werben zunächft an ber Drenfe, fobalb
fie ruhig fchwimmen, an ber SJlähne nahe am SSiberrift
gehalten. Sie muffen ben Sqo.1% in ber SewegungS»
ricf)tuttg auSftrecten tönnen.
i) ßS fteuern je 1 Steuermann in SSorber» unb
Öintertaffe, ohne auch im Strom Sierftellung ju geben,
ft'anit in ber Sßorbertaffe ein Steuer niefjt aufgelegt
Werben, fteuert nur ein SJlann in ber ^intertaffe. DaS
Steuern muf) fo erfolgen, bafj bie ißferbe im Schtoim»
men nicht beljinbert Werben.
k) Sim jenfeitigen Ufer Werben bie Sßferbe loSgelaffen
unb bon ben ßanbetruppS übernommen. DaS Sattel»
jeug ober ®efcf)irr mirb auSgelaben.
Slbfperren ber fianbeftelle burch guragierleinen tann
jwecfmäfjig fein.
1) Die SBafferfahrjeuge werben jurüdgerubert ober
jarücfgeichleppt.
201. gahrjeuge werben auf gähren (153 ff.) über*
gefegt. Die $ugpferbe werben abgefefjirrt, ©efeijirr unb-
Satteljeug auf ben gahrjeugen berlaben unb bie
ißferbe zum Schwimmen bereitgefteHt. gür baS Jperan*
führen ber gahrjeuge an bie gähren fowie baS 216=
Sagren oon ber Sanbeftelle finb befonbere Sefpanne
lereitjufteHen, bie an leister bjw. erfter Stelle ben glüh
burdjfchwimmen.
3. Schwimmen ber Leiter mit ben $ferben.
202. a) Die ißferbe werben abgefattelt unb bleiben
nur auf Srenfe gezäumt. Die Srenfenjügel liegen turj
getnotet auf bem §alS. 23ei $ferben mit turjer ®lähne
Wirb ein S3ügelriemen lang um ben ^>alS gefchnallt.
11*
152
Sie Leiter gieren menigftenS 9tod unb Stiefel auS.
Sattelzeug, SBaffen unb Setleibung werben gebünbelt
unb übergefeßt (203).
Sturze Streifen tönnen Ißferbe bei frfjtDadjeni Strom
aud; mit gepadtem Sattel fdjtoimmen*). Sie SSorber»
geuge finb lang zu [cßnallen, bie ®urte ettoaS ju lodern.
b) greifdjniimmertruppö unb Sanbetruppö (199c
u. e) finb möglidift für jebe SdjtoimmfteKe einzuteilen.
c) Sei breiter 6infteigfteHe reitet ber Srupp
(ipödjftftärte 8 ißferbe) gleichzeitig mit etwa 6 m
Bwifdjenraum in§ SSaffer. 33ei f dj m a l c m ®in»
ft i e g geljt ein fidjereS $ferb borauS, bie anberen
folgen paartoeife mit ettoa 6 m Slbftanb unb minbeftenS
3 m gtoifdjenraum.
d) 33eim ^ineinreiten füßrt ber Steiter ba§ $ferb
mit beiben öänben an ben getnoteten ßügeln.
Ser greif djtoimmertrupp führt ^ßferbe, bie
fid) fträuben, an, ßilft burd) 9lad)fprißen ober hinein»
fißieben mittels Sügelriemen. Ser Leiter muß bann
mit einer Jpanb in bie SJiäßne, mit ber anberen Jpanb
in bie getnoteten Srenfeitjügel faffen. fpierburdj toirb
bermieben, baß ber Leiter auS bem Siß tommt, fid) am
Bügel ßält unb baburd) ba§ Ißferb umtoirft. Sobalb baS
ijjferb ben SBoben berliert unb willig oortoärts
fdjtoimmt, läßt er bie Bügel lo§ unb faßt mit ber
regten £>anb ßinter ben Bügeln möglicßft naße am
SBiberrift feft in bie SKäljne. Bu gleicher Bc’t gleitet
er bom Ißferbe unb läßt fid) bon ißm mitjießen. Set
Steiter muß bermeiben, mit feinem Sörper toäßrenb beS
ScßtoimmenS über bem $ferb zu liegen.
9läßert fid) baS ißferb jebod) bem jenseitigen Ufer
ober etwaigen Sanbbänten ober Untiefen im gluß, wo
*) $8ei griebenSübungen ift bie§ verboten; jebotß ift
int grieben Sd,wtmmen mit blantem Sattel otjne SBotladj
Zu üben.
153
eS ®runb finbet, mufj ber Steifer fo redjtjeitig über bent
Stüdten beS SferbeS fein, bafj er in ben ffteitfitj tommen
unb »eiter reiten tann.
Um f dp ro i m m e h b e ißferbe in ber 3ticf)’
t u n g ju palten, genügt meift Spripen mit Staffer
auf ber äufjeren Seite, opne hierbei bie 9t ü ft e r n p
befpripeit. Serfagt biefe ^ilfe, fo fafjt ber Steifer,
nötigenfalls unter SBedpfel ber SDläpnenpanb, in ben
enffpredpenben Srenfenpgel möglicpft nape am Srenfen=
ring unb gibt wieberpolte leidpte Slnjüge in feitlicper
Stiftung, niemals in rüdtoürtiger Stiftung. Söurcp p
ftarte gügelanpge wirb baS $ferb leicpt im SBaffer
umgeworfen.
Sei langfam ober f cp l e dp t (djioimmen =
ben Sferben tann eS pjedtmäfjig fein, mit ber
linten §anb unb ben Seinen mitpfcpwimmen.
Serliert ber Steifer ben §alt in ber SJtäpne, fo mufj
er ben Sdjweif beS $ferbeS ju faffen jucken, um fiep
mitjjiepen p laffen, ober fortfdpwimmen. Seim @>dpwim=
men am Scpweif beftept @efapr, bafj ber Steifer bom
ißferb gefcplagen wirb.
e) ®er fiaubetrupp gept ben Sferben am Ufer auf
bem Sanbe entgegen — nidpt im SBaffer — unb nimmt
Sferbe, bie bon ben Steitern loSgelaffen finb, in
Empfang.
4. überfegen ber SuSrüftung unb ber Staffen.
203. a) überfegen ber SluSrüftung unb ber Staffen
erfolgt, falls niept genügenb ßäpne ober ^lopfäde pr
Serfügung ftepen, mittels bepelfSmäfjiger fjlöjje ober
fjutterfacfbünbel, bie bon einzelnen gerben ober einzeln
fdproimmenben Seuten bor Seginn beS Sferbefdpnrim»
menS ober unterftrom ber SferbefcpioimmfteHe an
Seinen burep baS Staffer gepgen werben.
154
b) .^erfteHen unb $anbl)aben be§ gutterfadbünbelä
f. S3ilb 108—110.
SBilb 108.
$etfiellen einc§ gutterjadbiinbelS.
Bügelriemen, Packriemen. Furagierleine
Sn ben futterfad bie SluSruftung be§ Leiters, fotoie SRantel, Sßoilach,
tafdjen unb Karabiner hineinlegen,
$8ilb 109.
$erftellen einc§ fittterftub
bünbelS.
S8ilb 110.
Überjeijen mit einem guttei»
faiftiinbel.
&en gefüllten unb gugebunbenen
f utter fa cf in bie Satteltammer (egen,
(SurtunbSBorbergeug herumfchnaHen.
Um ben Sattel herum bie Reitbahn
legen. $>ie @nben berfdjnüren.
2®ügelriemen ringsherum fdjnaHen.
©urd) 9ftantelriemen quer berbinben.
furagierleine befeftigen.
Leiter gum Sdjtoimmen auf-
gefeffen. furagierleine über linier
Sdjulter. futterfadbünbelfehtoimm«
bereit am Ufer. Leiter- jteht beim
Schtoimmen futterfadbünbel hinter
ftch her.
3?efte, tuafferbidjte 33erf(f)nürung be3 gutterfatfbünbeß
ift SSorbebingung für feine Sragtraft. §ier$u iuirb ber
obere Seil beS gutterfcufeS für fid) pgebunben, nad)
155
innen eingefdjlagen unb ber gutterfad bann mit ber
Sugfdjnur fo feft rote ntöglicE» jufammengejogen unb
nochmals jugebunben. Säßt ftc§ ber gutterfad nicfjt
böflig jufammen^teljcn, wirb er mit einem feften
Süfdjel ®raS ftöpfelartig berfdjloffen.
©urch SluSftopfen ber Süden innerhalb beS 5utter5
fadeS unb ber umtjütfenben Seftbafm mit Stroh, Sdjilf
ober fpoljwotte toirb ber Sdjwimmtörper prafter unb
tragträftiger.
c) 3—6 Jutterfatfbünbel tann man burcf) Seifern,
Stangen ober Srettftüde unb ^uragierfeinen ju einem
f^utterfadfloß berbinben, ober man fteHt auS 6 Steifer»
futterfäden, bie man mit Stroh ober §eu auSftopft,
einen SSehelfSfloßfad nadj SBilb 80 u. 80 a fyt. Stuf
einem gutterfadßoß ober behelfsmäßigen fjloßfad fefjt
man aud) S)lafd)inengewehre über. ©ie SKafdjitten»
gewehte unb ÜDlunitionStäften finb feft anjuffgnüren,
bamit fie beim Sippen beS fJloßeS ober grloßfadeS nidjt
nerlorengeljen.
©ie $löße müffen toorfidjtig ju Sßaffer gebradjt
werben, bamit fie nidjt unbicht werben.
5. greifdjwimmen ber $ferbe ohne Steifer.
204. SDlan läßt junädjft einige fßferbe an
gaßrjeugen ober mit Steifem (Sanbetrupp) borauS»
fdjtoimmen unb am jenfeitigen Ufer fo aufftetten, baß
bie SJlaffe ber SJferbe fie bom bieSfeitigen Ufer fietjt.
©ie DJlaffe ber $ferbe wirb fobann, fjüßrpferbe borauS,
burdj 3rreifdjwimmer in ba§ SBaffer geritten, geführt
ober getrieben.. Sobalb bie ißferbe fcßioimmen, werben
fie loSgelaffen. ©ie greiftfiwimmer fcßwimmen feit»
wärtS weg unb an ba§ Ufer jurüd.
©er Sanbetrupp ift fo ftart ju machen, baß $ferbe
nad) bem Sanben nicht entlaufen tönnen. gwedmäßig
ift Slbfperren be§ SanbeptaßeS mit Seinen.
156
6. überntinben eines SBafferfanfeS burd) berittene
SpätjtruppS.
205. a) ®er Spähtrupp mählt eine nerftedte
übergaugSftelle, bie häufig bieSfeitS unb jenfeitS ju
ft ehern ift.
b) 21IS überfeftnttttel ift ntöglic^ft ein ©ahn betju»
treiben ober ein Heiner ^lofjfad mit fftubergerät mitjm
geben, ber bon einem bem Spähtrupp jugeteilten
9teiterabmarfdj entmeber auf einem $adpferb ober quer
bor einem fReiter auf bem Sßferbe mitgeführt toirb.
c) ®ie Slrt beS überfegens mit ©ahn ober glofefad
richtet fith nach ber Sröfje biefer Überfehmittel. ßu=
nächft finb jmei Späher überjufegen, ihnen folgt ber
möglidjft bon $ferben gezogene ©ahn ober ^Jlo^facf mit
SluSrüftungSftüden, bann ber 3teft ber ißferbe mit
Leitern ober greifchtoimmern.
Ö Ö 2 Mann z Sicherung
futtersaCff-^On. Ofl—i.Welle~
floß zu 3 Futtern
socKbundeln^----""
"Üi-Nun^ °0 Z.W'e/Ze
> Schwimmend
Führer.
4. Welle
1 Mann, Beobachter
O diesseits
«ilb 111.
übertoinben eines
SSajjerlaufeS
burd) einen
&päi)trnW
(1 Uff^ll^ann)
mit 4 iyntterjatf:
flögen.
Diebeiden letzten Pferde schwimmen
möglichst frei.
Sft nur ein Heiner glügfad fcorljanben, müffen bie
Leiter mit iljren $ferben ftfjmimmen. ®in Seil ber
2lu3ruftung, befunber^ bie 1.3K. ®.z tuirb mit bem
<ylüg[a(f übergefegt, ber 9teft in gutterfadflögen. ©ie
Sicherung auf bem biesfeitigen Ufer tann ber guge^
157
teilte JReiterabmarfch übernehmen, wenn er gum Sluf»
rechterhalten ber Serbinbung am glußufer oerbleibt.
d) S rch t ein SJahn ober ein glofjfacf
nicht jur Verfügung, mufe ber Spähtrupp mit
behelfsmäßigen SJlittelu auStommen. 23ilb 111 geigt,
toie ein Spähtrupp einen SBafferlauf Owimmenb über»
minben tann. ®ie ’Sßferbe ber Sicherungen werben an
ber §anb in baS SBafier geritten unb fchwimmen bann
allein.
SHdjtfchwimmer ober SJerwunbete lönnen auf futter»
facfflöften beförbert werben.
7. überfegen mit fdjroimmenben SfJferben bei Sladjt.
206. a) ®ie fianbeftette ift burch eine f ct) w a dj
leudjtenbe Saterne gu begeidjnen, auf bie bie
$ferbe gufchtoimmen. Sie rann ober» unb unterftrom
burch f<hw<OeS farbiges Sicht begrengt werben.
b) Stuf beiben Ufern finb alle anbern Sichtquellen
abgublenben, ba fonft bie $ferbe abgelentt werben.
c) Sin jeber Schwimmftelle barf nur mit 21 b ft ä n =
ben übergefetjt ober gefchwommen werben, um ein
gegenteiliges ©efährben ber fchwimmenben $ferbe unb
ein SSermifchen ber SSerbänbe gu bermeiben.
III. Befyelfsbrüdienbau.
A. allgemeines.
207. ©er Sau von SehelfSbrütfen toftet Seit, ^e
forgfältiger man ertunbet, je eingehenber man ben 23au
oorbereitet, um fo OneHer tann man bauen.
©er Ginfag ber ©ruppe erfolgt in ber Siegel in ihrer
Slieberung, g. 23. Kompanie, $ug ober ®ruppe.
Sefernen finb bei Saubeginn nicht auSgu»
fdjeiben.
Sille Kräfte finb jebergeit ftraff gu führen.
158
208. Hauptaufgabe beö ^iitjrerd nad) ber ßinlettmiG
be§ Saue§ ift e§, burcf) gefdjidten (Sinfatj ber nad) unb
nadj frei roerbenben Strafte unb burd) jmedmäf)ige§
Serroenben ber Sauftoffe, be§ ®eräte§ unb ber Sßert-
geuge ben Sau ju förbern.
2)en Sau befdjleunigt man, wenn man biele Sau»
teile auf bem Sanbe borbereiten läfjt, unb wenn
man bie Srüde öon beiben Ufern au§ gleichzeitig bor-
baut.
Son bem Ufer au§, auf bem bie ällaffe ber Sauftoffe
liegt, mufj aud) &er 9 * ö 61 e e i I ber Srüde g e»
baut »erben.
209. ®ie Sorbereitungen jum Sau bon 2=t- unb
4=t»Srüden, aber audj bon Stegen, benötigen Ijäufig
meljr Beit al§ ber Srüdenbau felbft. fje^ler^afte Sor»
bereitungen führen ju Beitberluft.
5öem Srüdenbau müffen »orangenen:
a) ©rtunben ber glufjberljältniffe: Sin» unb Slb-
marfdjioege, Ufer, ^flufjbreite, SBaffertiefe, Se--
fdjaffentjeit be§ 3?lufjgrunbe§, Stromgefdjttnnbig-
teit (216), Stromftrid) (Sauf ber SKaffe beä
SBafferS).
b) S e f dj a f f e n unb S x ü f e n bon Sauftoffen,
®erät unb SBertjeug, foroie Sefdjaffen bon f?örber=
mitteln für Sauftoffe.
SDiefe Wlafjnaljmen oereinfad)t unb befdtfeunigt
man burd) Sefdjaffen bon Slänen unb Sitten ber
Strom» unb Sd)iffaljrt§beljörben, bon Sladjridjten
über Sauftoff» unb ©erätelager, Sefragen Drt§=
tunbiger.
e) Sei 2=t» unb 4»t»Srüden: Slnfertigen bon
Srüdenftijjen, Sau ft off» unb ®erüt»
I i ft e n.
Sei allen Srüden: ® i n t e i I e n ber Gruppe,
ber Sauftoffe, ber Seräte unb SBertjeuge jum Sau.
159
Srüdenfli^en (Silb 116) unb Sauftoffliften
(Silb 116a) erfeßen lange fd)r ift ließe ?ln =
orbnungen. Sei ben Srüdenftijjen tommt eS
nicfjt barauf an, baß fie jeitßentedjnifd) einwanbfrei
finb, fonbern baß fie fcßneü angefertigt werben, einfad)
unb Har finb.
B. Grfcun&en, IDaßl ber Brücftenftelfe unb
(Stafetten bes Baues.
210. Infanterie, ftauatterie unb Uraftfaßrtampf*
truppen muffen im tecßnifcßen ©rtunben eines Sßaffer»
laufeS auSgebilbet fein. Sie werben oft oßne §ilfe ber
Sioniertruppe Setoäffer übertoinben muffen (275).
®aS Grtunben tann nicht früß genug eingeleitet unb
burcßgefüßrt werben.
Sorgfältiges ßartenlefen üor bem ©rtunben
erleichtert unb befcßleunigt bie ©urcßfüßrung. ®ie ©r=
tunbungStruppS erßalten Aufträge, bie seitlich unb
örtlich ju begrenzen finb. ©ie $eit für baS Srtunben
barf nicht ju turj bemeffen fein.
©aS SrtunbungSergebniS gibt bie wefentlicßfte
Srunblage für bie 3lnorbnungen jum Sau feber 9lrt
bon Srüden. Seifpiel f. Silb 112—112 b.
211. ©ie Sage ber Srüctenftette wirb in erfter
Sinie nad) tattiftßen fjorberungen beftimmt. 3m
übrigen finb maßgebenb:
gefte, breite, gerabe unb, wenn möglicß, getarnte
9ln« unb Omarfdjwege,
fcßmale fjlußftellen ober fjlußftellen mit feften
3«feln, flache unb fefte Ufer,
mäßiger Strom,
ebener, weber felfiger nocß mooriger fjlußgrunb,
Släße, leichtes §eranfüßren unb gebedteS Sereit»
legen bon Sauftoffen unb ®erät, bei ScßneU»
ftegen ber ganzen Srüde ober ber einzelnen
Srüdenteile.
160
@rtunbung§ergebniä für ben «an einer
«eljelfSbrütf e.
«Hb 112.
Reibung.
Zß.%.18'.
Absendende
Stelle
fieMeldg. Ort Dat. Zeit
Abgegangen Jh. 12. 4. 15.00 w»-
Angetommer
tiwiwMMuv /J&irlfiw, JmmJ'-
1.
2.
3.
4. 3M
1(Tt CK, SOsm/üu^,,
7
1j8'/m/m/ 7fl7m/ Couwl
Außiudivw Imr "evian/ Shtudb'.
5. #0T • AM ^i4MMJUtVnUflM< AMAS
- AM
w £iw d /nril 22
ZJ2fiJ8t
161
Sßilb 112 a.
Sageftiije.
1 :100 000 unb ettoa befdjafften Unterlagen (209) be=
urteilen. Sjn ber Starte 1 :100 000 finb mit j to e i
U f e r l i n i e n bargeftellte 3? I ü f f e, fotoeit fie burdj
freie§ ®elanbe führen, mafjftabgeredjt gejeidjnet. fjü^ren
93aljnen ober Strafen unmittelbar am Ufer entlang,
fo ift bie ©arftellung mit 3tü<fficf)t auf bie Signatur be§
93agntör|)er§ ober ber Strafte nidjt mafjftabgeredjt.
162
SBilb 112b.
£kuerj^nittjti}se.
telMeldg
Ort
Dat. Zeit
Absendende
Stelle
Abgegcmgen
4 15, OP
1 'S.
& \9acf
CL y9o*f
ÜO'wJ:
'(7,5(7m/b
(genauer mirb bie ^lu^breite mit bem ßntfernung^
mefier, an einem über ben glufe ftraff gekannten
Sraljt ober einer Seine ober nacf) 213 ermittelt.
213. SRit §ilfe eine§ redjtttjintligen gleicfj»
f^enlligen 2>reied§ mirb in einem $untt A
ein <SidjtJ)unft, j. SB. SBaum, auf bem gegenüberliegen-
163
ben Ufer mit ber Kante A—B fo angeritfjtet (Silb 113),
bafj bie Kante A—C längs beS UferS geigt. $untt A
toirb burd) einen Stein ober Sflod feftgelegt. ®ann
toirb mit bem Söreted fo lange nad) C1 gegangen, bis in
ber Verlängerung oon C1—B1 ber jenfeitige ©id)t=
punkt unb oon C1—A1 ber Sicßtpunkt bei A erfdßeint.
Vilb 113.
«ctjclfSntäfjigeS äBeffen bet glufcbteite.
Erläuterung:
—---------*• = Visierrichtung
q « gefaltetes Papierstück
ibk beliebiger Größe
& UUHk q (gleichschenklig, rechtwinklig)
A
B1
c ~~ Jrlc*
—=Flußbreite —»!
A~Ct A1~C1 möglichst gleichlaufend
mit Ufer
Sllifdjreiten ober Slbmeffen ber ©trede C1—A ergibt
mit junäcßft genügenber ©enauigkeit bie glußbreite.
214. SBafferliefen unb Vefdßaffenßeit be§
glußgrunbeS fteßr man burd) fenkredßteS iperunterftoßen
mit ‘’Öleßftange'n feft (Seilen), Jpierp fpannt man
über ben gluß einen Sleßbraßt ober eine tDleßleine, an
benen in regelmäßigen, in ber Siegel 5 m weiten 2lb=
ftänben bie ^eilfteftert burd) farbiges Sanb, farbigen
Ulnftrid) ober Sägel begeidßnet finb.
Sian ftetti burd) Seilen feft:
für fdßroimmenbe Stößen: SBaffertiefe unb Signung
be§ ^lufjgrunbeS für Verankerung. Sd^toimmenbe
©tüßen müffen bei Selaftung unb audß bei gatten
be§ SßafferS nod) fcfjwimmen können. ®enau muß
man baßer in Ufernäße unb an Untiefen im gluß
peilen.
164
gür fefte ©fügen: Sßaffertiefe unb Sefdjaffenheit bes
gluggrunbeS, unb jtoar:
für Waljljodje (Silb 155, 169 u. 170) längs
beS SJtefjbrahteS mit Stichproben ober« unb
unterftrom,
für Söde (Silb 156, 174—177) genau an ben
Stellen, an benen bie Sodbeine ober Erag»
Seine [tetjen foKen,
für Sthncettioche unb Spigenfdjwelliodje
(Silb 171, 172) genau an ben glädjen, auf
benen bie ©runbfdjroellen liegen Jollen,
hierbei ift bie 2)tä(i)tigteit nicht tragfähigen
UntergrunbeS (Schlamm, 9Jloor, Xriebfanb)
genau gu ermitteln.
3n trodenen (Sinfchnitten mifjt man mit Stangen oon
ber Sohle auS an ben für Stüfjen beftimmten Stellen
ober mit Schnüren, bie man ah ben Seilftellen eines
über ben ©infchnitt gekannten SJiefjbrahteS aufhängt.
S)aS Ergebnis ber Sängen« unb $eilmeffungen roirb
in einer Duerfchnittftijje (Silb 112 b) bargepellt. Qn
biefe »erben jtoedmäßig bie ißeilmeffungen in einem
größeren SOtagftabe eingetragen als bie Sängenmeffungen.
215. Steht bie Sauart ber Srüde f e ft, fo ift bei
feften Stützen ein nochmaliges Steffen in
Stügroeitcnabftanb (Silb 116) nach 214 burch«
juffihren.
®er SBafferftanb ift an einem e g e I ju beobachten.
216. Sie Stromgefchminbigteit — bie Strede, bie baS
SSaffer in einer Setunbe jurüdlegt — ioirb nach
Silb 114 gemeffen. Sei fchtoachem Strom genügt
Schagen.
Sie Stromgefchttrinbigleit geftattet oft Schlüffe auf
bie Slrt beS gflujjgrunbeS: f d) ro a d) e r Strom (bis
1 m/s) lägt ®toor ober Sanb, mittlerer (bis
165
Steffen ber 5B1IÖ 114. ®trütngejrf)foin bi gleit. - -4
| Strom • Schwimmer aus Holz treibt !
o *- mit Strom 100m nach ’
1 nchtung 1 unterstrom m 50 s
100 m
1,50 m/s) Sanb ober
feinenff ie§, fta r t e r
(bi§ 2,50 m/s) unb
fetjr ftarter (über
2,5Om/s)grobenffie§,
Stein ober gel§ ber»
nt uten. ©r eljen bet
Strom beutet auf be»
fo'nberS tiefe Södjer
(ffolte), unterbreche»
ner Sßellenfdjlag auf
also-Stromgeschwindigkeit: -2m/s lXltCjIctCl)£)ettcn beä
§lufjbette§.
217. ^unborte für Sauftoffe finb:
a) für £ o I j : Jpolg» unb gimmerplähe, Sagemühlen,
SaufteHen, 33at>nl)öfe, Sßälber, Setjöfte.
3n ©eljöften finbet man Salten (©achfparren),
Stangen, ©leien, ©ore, ©üren unb Seitern. prüfen
oon §öljern au§ (Seljöften ift erforberlid), ba
ie oft morfch finb.
b) für fdjroimmenbe Stufen unb über»
etjgerät: (Semäffer, g-äljrftellen, Sßafferbau»
Jienftftellen, fjlufjbabeanftalten, SBerften, Staue»
reien, Brennereien, ©antftellen, SetriebSftofflager.
«-) für Stahlteile: ^abriten, Sifenljanblungen,
Sd)mieben, SSertftätten, Bahnhöfe, eiferne (Sitter,
©rahtjäune.
di für 33 i n b e m i 11 e I unb S8 e r t j e u g e : mie
c). ferner ©ifenbahntoertftätten, Seilereien, Sager
für lanbroirtfchaftlirfjen Sebarf.
218. ©er Sau bereinfadjt unb befehlen»
nigt fid) um fo mehr, je längere ©ragbalten bin»
reidjenber Stärte unb Bagl unb je jaljlreicEier trag»
fähige fefjmimmenbe Stützen üorhanben finb. Sfrüh»
jeitigeS guführen, bor allem ber ©ragbalten unb feften
^ionierbtenft
12
166
©tilgen auf Sanggolj» unb ßeiterroagen ober Saftlraft
toagen jur Sauftette ift toidjtig.
©päteftenä mit Srüdenfdjlufj muffen aud) bie Sin»
unb Sbmarfdjniege benugbar fein (224).
219. Gignung ber Sauftoffe:
a) £oljj: ®efd)Iagene§, trodeneS, ju Salten Derarbeb
tete§ Stabeltjolj eignet fid) am beften. Son Saub»
göljern finb Ulmen, Suchen, Sllajien, ®id)en
brauchbar, weniger Rappeln. ©a§ §olj muß
gefunb unb möglidjft gerabe fein. $e trodener baä
fällen bon Bäumen
Silb 115a.
mit 9t£t unb Säge.
। §olj ift, um fo mefjr trägt e§. Säume fällt man
mit ätjten unb Sägen nad) Silb 115 ober 115 a.
Sie gefällten Säume finb ju enttoipfeln unb, toenn
3eit üorfjanben, ju entrinben.
Slunbgolg roirb für 3od)pfäl)le unb Sod
beine, ® a n 11) o I j für Xragbalten, §olme unb
Sdjroellen üerroenbet.
167
Sonnen S r e 11 e r nicht beigetrieben ober ge»
fdjnitten »erben, nimmt man Stangen ober
Sq alb^öljer (geteilte Dtunb» ober Kanthölzer)
al§ Selag.
b) Stahl: ©ifenbahnfdjienen unb lange I»SEräger finb
gute Sragbalten, C » Stahle finb weniger geeignet.
220. S r ü f e er ber Sragtraft oon Kähnen
ober fonftigen SdjtffSgefäfjen f. 133 unb
S8ilb 77.
221. Sinbemittel unb SBertzeug führt bie Gruppe
in befdjräntter Stenge tragbar unb auf ihren Fahr-
zeugen mit. Stfeift ift Srgänjung burdj Schreiben
nötig.
Sßertftätten mit Stafcfjinen für öolz» unb ©ifen»
bearbeitung, Sagemühlen unb Schmiebcn finb burch
bie Gruppe frühzeitig in Setricb zu nehmen.
222. $ür ben Sau oon Srücfen mit mehreren
Stüljen finb im allgemeinen Saupläne aufzuftellen. Sie
tonnen umfaffen:
a) ßängenftizze unb 9lamm= (©rmtbrift») Stijje
(Silb 116), Stizze ber Seranterung ber Srüde unb
Stizzen ber einzelnen Sauteile mit Stafjen,
b) Schreiben unb ßubereiten oon Sauftoffen unb
©erät, fomie ©berichten ber Sauplä|e,
c) Starte unb Aufgaben ber Sautrupps unb Zuteilen
bon Sauftoffen, ©erät unb SBertzeugen an- biefe,
d) ©brachten ber Srüdenzugänge, Seffern unb Se»
Zeichnen ber Sin» unb Slbmarfhmege,
e) Sau bon Stammrüftungen ober »fahren,
f) Sauftoff» unb ©erätliften (Silb 116 a), geftfteüen
beS SebarfS an görbermitteln,
g) Zeiteinteilung.
12*
168
223. ®ie Sauart ber Srüde ridjtet fidj nad) ber ge=>
forberten Sragtraft (Safel 16—19, 21 u. 22), ben
glufjoerhältniffen unb ben berfügbaren Sauftoffen.
Seifpiel für bie Sauart einer 4=t'Srüde mit Sfaf)l»
jodjen unb anberen feften Stü^en f. Silb 116.
224. Seim Sertt)enbenfefterStü§eniftbie
Srüdenbabn mit ber Untertante Sragbalten etwa
0,75 m über 5B a f f e r, bei ju erroartenbem .^>oc£)=
ioaffer IjoEjer ju legen. Sei Sdjnellftegen unb Stegen
mit feften Stütjen genügen geringere ipöljen über bem
Stafferfpiegel.
Btaed ber Srüde unb örtlidje Serfjaltniffe tönnen
Slbtneidjungen erforbern.
ßugangörampen jur 4»t=Srüde bürfen f)öci)fteiis eine
Steigung bon 1:8 (Im Steigung auf 8m Üänge)
haben.
Sie Fahrbahn auf ben gugangtrampen unb bie Sin»
unb Slbmarfdjroege finb oft burd) Sollen ober Stein=
Jjflafter ju befeftigen (218 u. 276).
225. S)ie Sruppe teilt man unter Sßatjrung i^rer
©lieberung, bei SRangel an Fachleuten unter 9leu=
glieberung, für folgenbe Aufgaben ein:
a) §errid)ten ber Srfiden^ugänge, Sejeidjnen ber 21m
unb Slbmarfdjioege (326),
b) iperanfdjaffen unb Buridjten ber Sauftoffe, bet
SBerfjeugt unb bet ©erätt,
c) ^errichten bet Unterbauet, Sau bon fRammrüftun*
gen ober Stammfäljren,
d) Jgerridjten bet überbauet,
e) §erricf)ten bon Sinbemitteln,
f) (Sinbau ber Stü|en unb bet Überbauet, Einfahren
unb Serantern fdjmimmenbet Stüfceit.
7/25 ।
*1,46-
m
11
.^erfdjtmtung unb ^erftrebung fortgelajfen.
Längenskizze
der ^-f-Brücke 800m südlich A Dorf über den W Fluß
e £ 3 U 5 6 7 8
------------------------------------ ^5,00m
^-5,OOm-*\^-5,OOm -*‘f+-5t00m-t— 6,00m -***-5,00m
[ 16/22cm\ 16/22cm | 16/22cm |
-5,00m -•+•-5,00m -*j*- 5,00m -***-k,00m
26 cm*
26cm*
26cm*
16/20cn>^
st#
m
^noai
L.U.\
diesseits
1kcm* ।
15cm*' 15cm*\ l5cm*{
i 1 1
। Rammshizxe/Grundrißsk^te)
'r
K
♦ 9
^Sandi^er
Flußgrund
W!
jenseits
vu
///
B. E I
Pjahljoche
Bohlenstapel
zk
k
StüDCl **' \
Schwelljoch ^£”010 ßohlenstapd
jJJ.R 18
»etfpiel für ben »an einer 4«t»®e^elfSbrütfe.
Söilb 116 a.
Stanftoffliften (ofyne Wgebejjerung).
I. ® o l I i ft e.
Qejeich Saufloffe s s- Qupßfaoij. tfincm HcuelhoU ff eile eile in cm Gewicht für /rocke-
nu/ag ff: Verwendung 1 ff 8 10 74 10 2ß $6 74o % % % k ne7n%Z
Endauuf Uferbolken 45 67.5
lager - I Stoßbohle 45 _ 54
Pfahle 1,3 20 104
Bohlen - Bohlen 4.5 4 216
Stapel I Pfähle 1,3 10 65
Sfapelhöben 0,25 18 22,5
ffahljoth BL Jbchpfähle Z50 3 67,5
Ho-lm 4,5o 1 67,5
Pfahljoch Jochpfähle 47 3 155,1
/r Hoim 4,5 76,5
fyahtjoch 7 'Jochpfähle 4ß 3 158,4
z Holm 45 1 76,5
PfaHjoch 'Jochpfahle 46 3 151,8
l! Holm 4.5 4 67,5
Schwell- K! Holm u. Schwelt? 4.5 2 135
Joch Stiele £Z 3 - ~ .18,1.
Schwei- tensfci- pel j» Eisenbahn* Schwelten 4,5 3 _ 364.3
2,5 10 6 75
Holm w 1 67 5
Sohlen* Stapel >1 Sohlen 4,5 3 162
Pfahle 1.3 10 65
Stapelhölier 0,25 18 225
Endauf- lager jeweils ‘t Uferbalken 4.5 1 67.5
Stoßbohle 4,5 54
Pfähle 1,3 20 104
Verschwertung 4.0 10 260
IZ-1Z' Verstreben der Stätten p-rtt miteinander 6.0 12 360
strecne d-3 Tragbalken 6,0 15 2070
4 * 7,0 5 1435
5-8 6o 2o 4200
9 5ß 5 525
1-9 ftelagbofaleo. 4,5 BO 8900
1-9 < Gelanderstälten 1.3 30 195
Oelanderslangen 100 fn 2 50
fäodelbalkea 9o fri 990
100 52 65 9.6 im I2ß 72 4o $10 9 U5 M5 9 25 90 25 22270,7
172
II. (Stfenltfie.
a) SB a n b e i f e n für Einbringen:
£fb. 5lr. bon auf für Stüfce Ifb. m je Stüfce Summ«
1 £olm Arabien III—VI 3 12 m
2 £olm unb ScbfoeHe Stielen VII 6 6 m
3 mittlere StbtoeUen ; untere SdjtoeHen VIII 15 15 m
4 obere ScbtoeHen ' 1 mittlere Schnellen VIII 15 15 m
5 £olm 1 obere SdbtoeHen VIII 7,5 ’ 7,5 m
6 Sxagbalfen £olmen (Stüfcen) I—X 7,5 1 75 m
Summe: 130,5 m
«= rb. 130 Ifb. m‘ = rb. 50 kg.
«= rb. 130 Ifb. m‘ = rb. 50 kg.
b) Sftögel gum SBefeitigen:
1. be§ SBanbeifenS, je Ifb. m 10 Stücf 31t 8 cm.................= 1300 Stüd!
2. ber SBerfdjtoertungen bei ben Stüfcen III—VII, je 10 Stücf
gu 15 cm........................................................«= 50 •
3. ber SBerftrebungen gtoifdjen Stüfce III unb IV unb V—VII,
je 12 Stücf gu 15 cm.................................. . . . — 60
4. be§ SBelageS, je Ifb. m 8 Stücf 311 15 cm (ebne 6 m ber
Stüfctoeite 4)...................................................— 312 •
= 1300 SRägel 3U 8 cm = rb. 20 kg
unb rb. 460 • • 15 cm = rb. 15 kg.
c) 2)rabt, 3—5 mm ftarf, für:
1. SBau ber SBoblenftapel (Stüfcen II unb IX)...................= 50 m
2. Stöbelung, 9 Streifen x 6 SBunbe 31t je 5 m auf jeher
Streife........................................................ = 270 m
= rb. 350 m = rb. 60 kg.
III. SBeförbern ber SBauftoffe.
1. ® e in i d) t.
Elacfj ^olglifte rb. 22,3 t \ < 22 r t
ftadj Sifenlifte rb. 0,15 t / “ 10‘ L
2. görbermittel.
22,5 t = 23—30 gmeifpännige ^abrgeuge 3U 0,75—1,0 t Xragfraft ober
8 3 = t' ßaftfraftmagen.
173
IV. ©erätebebarf.
1. 3 Staljne, babon 2 jum Stammen, 1 jum Scförbem bon Sauftoffen.
2. SJerfjeug unb ®erät:
’-ffi e r t j e u g i-3ug 2. 8ufl i 3.3«0 «Summe Semerfungcn
ptmbraminen . . . — 3 | _ l 3 ^Bumtfeftlegen
Scbugel — 1 2 6 beim Stammen
Scprotfäqen . . . Sbannfägen . . . $rte 4 2 2 2 2 i 2 : “ä । 8 6 1 4, al£ Stoß' leinen 2. *) Bum Vorbrin- gen ber San-
Seile 2 2 2 6 ftoffe über ben
främmer Vodjer für Sanbeifen — 4 1 ’ 7 Stufe-
(Smrdjtreiber) . . — i 8
£T.abtfdjercn . . . 2 i i 2 6
Bangen — 1 * 8
flreujbacten . . . — 2 1 2 4
^baten — 1 i * 8
S mb deinen . . . — . 20 40
deinen, 30 m lang . — 1 6 9 7
Wfee 2 l 2 6
Sefcinaagen . . . — 1 1 2
Riammem .... 20 i 20 ! 2'( 80
V. (Mitteilung.
I. ber Kompanie:
1. Bug: Seförbem unb £erridjten ber Sauftoffe. 3 I. St.®, ßuftfdjufc.
2. Bug: Srücfe bie3feit3 bi§ (Stüfce VI, )
cinfddiefelid) Serftärfung burd) I einfdjlieBlidj Sßegebejeidjnung
1. Bug, ( unb SBegebeffertmg.
3. Bug: Srücfe jenfeits, Gtüfcen VII—X, J
2. b e § 2. 3 u g e §:
Sur (Stüfccn IV—VI toerben bon einer Stammfäfjre nadj Silb 131 gerammt
]. ®rubbe; Sau ber Gtüfee I, anfdjliefeenb (Sinbau ber Sragbalten.
2. ®rub£e (berftärft burd) freifoerbenbe Seile 1. Bug): Sau ber Stüfccn II
unb III, anfdjliefeenb Vorbringen ber Sragbalten unb beS Se-
lageö.
3. ©rubbe; Stammen ber (&tüfeen IV—VI mit Siammfäljre, anfdjliefeenb-
Siöbelung unb ®elänber.
VI. $ r b e i 13 $ e i t.
Saujeit (ba Sau bon beiben Ufern au§)......................=5 (Stunben
SInbeförbem ber Sauftoffe unb Vorbereitungen . . . . = 4 =
9 (Stunben.
174
Seim Sau langer Srüden mujj man 21 b I ö f e n ber
©ruppS borfehen.’
2Kan läfet bei gleichartigen Stügen bie
© a u p 11 e i l e laufenb Ijerftellen, bei oerfchieben«
a r t i g e n Stufen fefet man SLrupp3 §um ©erftellen ber
einzelnen 21 r t e n ber Stützen ein.
226. ©er gügrer läfet bie Srüdenlinie — SJtittellinie
ber Srüde in ber £ang3ricf)tung — mit je §toei bürä)
flaggen über ßaternen beutlicE) fidjtbaren 3ii(f>tftangen,
bie ettoa 10 m 2Ibftanb boneinanber haben, an beiben
Ufern maffertoärte beginnenb, auSfteden, bei Sfahljo<hs
brüden unterbeut ober* unb untererem je eine toeitere
ßinie für baS Stammen ber gochpfähle (241).
gälte erforberlich, toerben in gleicher Sßeife bie Sin?
teriinien oberftrom für Strom-, unterftrom für Sßinb*
beranterung, je ettoa minbeftenS 40 m bon ber Srüden*
linie entfernt, au^geftedt. Sei Stegen tann man ahm
lid) berfahren. gür Sdjnettftege genügt Eingabe bon
Stidjtpunften.
227. Sanftofflager unb Saupläfce für ©errichten ber
Stögen unb be3 überbauet legt man, möglidjft ge*
tarnt, fo nahe toie möglich an bie SrüdenfteUe heran.
228. ©er gühter Srüdenbane^ regelt tlareä gn-
einanbergreifen ber ©ätigleiten unb ba3 Bufammem
arbeiten ber ©rupp3.
Bum Schonen ber ©ruppe fegt man für ba3 Seför-
bem bon ßaften, 3. S. ber ©ragbalfen, görbermittel,
toie niebrige Stagen ober einzelne Släberpäare, ein. gür
bie Stärte bon ©rägertruppä gilt:
1 Wtann trögt 30—50 kg; für Xragbalten für 44-
Srücten rechnet man für 1—2 Ifb. m 1 Wtann.
229. SKit bem Srüdenbau ift er ft $u
beginnen, toenn burd) auäreidjenbeä SereitfteHen bon
Sauftoffen, ®erät unb Sßertgeug (bei SchneUftegen
jeboch aller Srüdenteile) ©urchführen be§ Saue§
ohne Stoden getoährleiftet ift (209).
175
230. ©er ßeitbebarf f ü r b e n SB a u ift ntdjt ju
tnapp ju berechnen. Sie SB r ü d e muß i u ber
bent Sruppenfüljrer früljjeitig ju melbenben 8«t
fertig fein. SBei ber Seitberedjnung finb neben
bent ?lu§bilbung§ftanb oft entfteljenbe ^Reibungen ju
berüdfidftigen.
®lan tann bei auäreidfenben, au§gebilbeten Kräften
unb bei SBereitliegen ber SBauftoffe unb SBinbemittel in
23rüctennä£)e als SBaujeit redjnen:
für je 8 m bon 2-t=ffirüden 1 Stunbe
« = 5 m = 4=t- - 1 5
- 10—20 m bon Stegen 1 =
231. ®ie ©ragtraft jeber SBrüde ift auf ben SBeg^
»eifern jur 23rüde unb auf ©afeln an ben SBrüdem
jugängen f e n n 11 i ä) ju madjen.
C. Der Bau.
1. ^Benennungen.
232. Stiigweite: (Entfernung bon SRitte ju ®Htte
jioeier benachbarter Stügen (®ilb 116) ober bei Ufo
orücfen bon (Enbauflager ju (Enbauflager.
SBilb 117. Benennungen.
Stromankerlinie
Bruckenspitze
BrückeMe
176
Strede: Sauftoffbebarf für eine Stütjiueite.
Srürfenlinie: SDJittellinie in ber 2äitg§rid)tung bet
Srüde (Silb 117).
Srüdenfpige bie§feit§ ober jenfeitS: SBaffertoärtigee
®nbe einer im Sau
befinblidjen Srüdt
(Silb 117).
$aljrbal)n obei
Srürtenbaljn: 9?ufc
bare Srüdenbreiü
ättrifdjenbenSnnen-
tanten ber 3töbel=
baIten(Silb 117a)
UferüriirtetSrüd«
offne Qiuifcfjen
flöten (Silb 31)
Unterbau: ®nb
auflager, fdjioim
menbe ober feft«
©tüten, Seranle-
rung.
Überbau: Jrag
ballen, Selag, 9lö-
belung, Selänbcr
(Silb 117 a).
Tragbalken
Rödel-
balken
Söilb 117 a. Benennungen.
Geländerstütze
Belag
Rödet-
balken
nutzbare----
Brijckenbreiie
— Jm
Geländerstange
Rödelkeile mit
Drahtbund
Ortbalken
Gleisbalken
Ortbalken
Gleisbalken
2. Serbänbe.
233. Stur fefte Serbänbe gnjifc^eu ben einzelnen
Sauteilen getoäijrleiften geftigteit ber Srüden unb
Stege.
234. 3K a n berbinbet ©injelteile bur<^> Sanb>
eifen (Silb 118), Safdjen ober ©djürmanneifen
(Silb 118 a), Salgen, SdjroeUenfdjrauben, ©djienen=
nägel (Silb 118 b), ftarle unb lange 9lägel, Onaggen
ober Ulammern (klammern f. 236).
177
SBilb 118.
Verbände mit ^Sanbeijcn.
SBilb 118a.
Safdjen.
SBUb 118b.
®erbänbe mit $anbeifen unb
§d)ienennägeln.
SUdp ober SBinf ellaf eben (33ilb 118a),
33 a n b e i f e n unb Sd)ürmannei[en bef eftigt
man mit Nägeln ober Strauben.
235. Knaggen au3 Santbol^, 3£unbljolä ober
53rettftü(fen befeftigt man mit hageln ober 33anbeifen
unb gebraust fie natf) SBilb 119.
236. Klammern oermenbet man bei SDtangel an
33anbeifen ober Safdjen ^um SSerbinben nebeneinanber
gelegter ober ficf) treugenber Jpöljer. klammern finb
178
böllig in bct§ §olj tjineinjufdjlagen ober burd) Sraljt*
bunbe ju fidjern. klammern au§ SRunbeifen finb ft e t i
burdj Sraljtbunbe ju fidjern.
SBilb 119. Knaggen.
Tragbalken
237. Seinen ober $raljt (letzteren jebodj nid) t bei
glofjfäden) bermenbet man jum SBinben bon SBöden,
Silb 120. Ärcnjbunb. glöfeen fämimmenben
SdjneUftegen unb Ste»
gen, jum Serbinben
bon Sragbalfen mit
fctjimmmenbenSttifjen,
fonft nur jum Serbin*
ben nidjt tragenber
Seile.
238. Seinem ober
Traljtbmtbe finb:
Slreujbunb
(SBilb 120) jum Ser*
binben fid) freujenber
JRunbfjöljer, j. SB.
bei SBöden.
SBodfd)niirbunb (SBilb 120 a) jum Serbinben fid)
freujenber ® a n t = ober SRunbfjöljer, j. SB. bei SBöden,
179
unb gum 23efeftigen üon Xragbalten auf bem §olm öon
Staljnaufrüftungcn.
Sdjniirbunb (23ilb 120 b) jum 23efeftigen öon £rag*
ballen auf S'afjnborben.
Äugende
Silb 120 b.
Stfynütbnnb.
<Sd)Ieuberbunb (SSilb 121) jum 2Serfpannen oon §olj=
teilen, 3. 23. bei Stapeln. Stfjleuberbunbe tann man
and) mit burcfjgeftecftem ftnüppel ober langem 9iagel
feftbreijen.
180
HRaftwurf (93ilb 122) jum Sefeftigen bon Seinen ober
Sauen an $fäf)Ien ober Säumen.
Seinen muffen ftraff ange^ogen toerben. Sie
bürfen beim Sdjnüren nidjt nafj fein, ba fid) fonft beim
Silb 121.
®d)fcuberbunb.
Srocfnen bie Sunbe lo!=
fern. ©leidjgertdjtete
Schläge muffen neben-
einander Hegen. Surd)
untergefdjobene Steile
tonnen bie Sunbe
ftraffer gefpannt ioer*
ben. • Sdjarfe bauten
ber folger finb ab^u-
flauen, ba fonft bie
Seinen burdjgefdjeuert
toerben.
239. gumSefeftigen
ber Wer unb Wer*
taue fdjtoimmenber
Stützen berioenbetman:
123) pm geftlegen beS
Sen 3Inferröbelbunb (99ilb
SntertaueS am SDudjtEjoI^ eines SBafferfa^rgeugeS,
SBilb 123.
2lnterröbenmnb.
Silb 122.
SRaftWurf.
ben einfachen Werfti$
(Sefeftigen) eines einfachen SaueS an ben hinter,
Änkerrödel
tholz
(Silb 124) gum SInftedjen
181
ben hoppelten Sinterftitf, (SBilb 124 a) jum Slnftedjen
eines hoppelt genommenen ZaueS an ben Sinter.
SSilb 124. Cinfadjer «nterftidj.
SBilb 124a.
Stoppeltet Wfetftidj.
3. Stammen non ^ocfjpfäljlen.
240. Sßfät)le für Stege werben mit Spiegeln e i n =
8(j f dj I a g e n, SfJfäljle für 2=t= unb 4n=53rüden i»er=
eh gerammt.
$anbtammen fteßt man au§ hartem §olj mit ©riffen
für 2—4 2Rann nadj SBilb 125 tjer. ©iferne SBefdtfäge
SBilb 125. §anbtamnten.
^ionierbienft. 13
182
erfjöljen Jpaltöarteit unb (Setüidjt. 3um Stammen öon
$faljlen über 15 cm Surdjmeffer muß man ßugtammen
(Silb 126) üerroenben.
Silb 126.
3ugratnme auf Stammfäljre auS Uätjnen.
Slinbefitragtraft ber Sätjne je 41.
241. Scan rammt:
a) auf bem Sanbe ober in flauem Sßaffer öon einer
auf Sonnen, Slaurerböden, ©iften ober Stühlen
gergeftellten Stammbügne,
b) in tiefem Sßaffer üon Stammfügten (Silb 126
bis 131) auS. Stammfäljren nad) Silb 127 u. 128
muffen burdj Seithalten ober »ftangen jur legten
Stüge unb Seranterung, bie Stammfäljren nad)
Silb 129 bi§ 131 burdj 4 Sintertaue ober ftarte
Seinen feftgelegt unb, wenn möglidj, burd; ©taten
gehalten »erben.
Sertoenben üon Stammfäljren nadj Silb 129,
130 u. 131 ljat ben Sorteil, bafj man gleichzeitig
an mehreren ©teilen, unabhängig üon ben Srüdem
feigen, rammen tann. Stammfähren mit Stuf»
rüftung nadj Silb 131 braucht man jum Stammen
üon langen Sßfäljlen.
183
Jchnltt A -8
han stach letztes Pfahljoch
«ilb 127.
3tanttnfäljre (1 .Mjri).
Äräfte: 4 Stann.
Sauftoffe: 1 3tal)n;
2 Salten ober (Stangen, 8,00 m
lang, 10/10 cm bgio. 12 cm 0;
2 Salten, 4,00 m lang, 10/10 cm
ober Knaggen ober 4 ^lam«
mem; 6 Sretter, 4,00 m x
30 cm x 4 cm.
Sinbemittel: 8 Seinen
ober 40 m ©raljt; Sägel unb
Sanbeifen.
SBerlgeugunbCSerät:
1 Sage; 1 Seil; 1 gange;
1 jammer; klammem.
geit: 2 SIrbeiteftunbcn,
bei 4 Stann 30 Sttnuten, oljne
Änbeförbem ber Sauftoffe.
Söilb 128.
Statntnfätyre au§ Heinen glofcfäden.
Kräfte: 4 Stann.
Sauftoffe: 2 fleine glofjfätfe; 2 Salten ober (Stangen, 8,00 m lang,
10—12 cm 0; 4 £olmbretter, 2,30—2,50 m x 20 cm x 3 cm; 2 SerbtnbungS»
böller, 3,00 m lang, 8—10 cm 0; 4 Sretter, 4,00 m x 30 cm x 4 cm; Srett
ftüde für 4 Knaggen.
13
184
Sinbemittel: 3,50m Sanbeifen; 4 Slägel, 13 cm lang, 82 3lftgel,
5 cm lang, für 4 Knaggen (ober 4 Älammern); 12 Seinen; 4 Sinterleinen
ober =taue.
SBertgeug unb ®erät: 1 (Säge; 1 jammer; 1 Range.
3 e i t: 4 Slrbeit^ftunben, bei 4 Sftann 1 ©tunbe, ohne «Inbefbrbem ber
Sauftoffe.
ȟb 129.
9iaininfäl)te (2 ßäljne).
Kräfte: 4 SRann.
Sauftoffe: 2 ftäbne;
2 Salten, 4,0—4^> m lang,
12/12 cm; 6 Salten, 2,0 m
lang, 12/12 cm; 2 9hmbt)dlger,
4,0—4,5 m lang, 15 cm 0;
10-16 Sretter.
Sinbemittel: 28 Seinen
ober 80 m ©raljt; 4 Sinter-
leinen ober «taue.
SB erzeug unb (5 er ät:
1 Sange.
Beit: 2 SlrbeitSftunben,
bei 4 SRann »/. ©tunbe, ohne
Slnbeförbem ber Sauftoffe.
8t!b 130.
auSXonnett«
Ä r tt f t e: 4 SRann.
Sauftoffe: 4Sonnen,
0,84 m lang, 0,71 m bjto.
0,60 m 0; 6 ©langen, 3,00 m
lang, 8 cm 0; 4 Shutypel,
0,90 m lang, 8 cm 0; 3 Sretter,
3,00 m x 25 cm x 4 cm.
Sinbemittel:24£einen
ober 80 m ©raljt; 4 Sinter»
leinen.
SBertgeug unb ®erftt:
13ange;l©äge; 4 klammern.
Sigengefoidjt: ettoa
400 kg.
Sragtraft: 500 kg.
3 e i t: 3 SlrbeitSftunben,
bei 4 Sftann 8/< ©tunbe, ebne
SInbeförbem ber Sauftoffe.
185
SBUb 131.
’Jiammfa^re mit (beruft au§ Brettern ober Noblen
(tönnen fpäter al3 Söelag mit üermenbet treiben).
Sftan rammt guerft ben $fat)l oberftrom, bann ben
ober bie DJHttelpfä^Ie unb ^ule^t ben $faljl unterftrom.
2)ie $fal)le finb einäurid)ten:
in ber SängSridjtung nad) ben am Sanbe auSge*
ftedten SRidjtftangen (226),
redjtnrintlig jur SBrüdenlinie burd) Neffen ^ur lebten
Stütze (Seitftangen) ober nad) einer über ben glufe ober'
ftrom ber SBrüde gekannten, mit SRarfen öerfe^enen
Seine ober nad) im glujj fdjroimmenben, oerantertcn
harten.
S3ilb 132.
SRantmbfäljle.
186
SBidjltg für ba§ ununterbrochene fjortfchreiten beä
fRammen§ ift rechtzeitiges 3ufüi)ren Don
iß f ä h I e n an bie iRammfähren burcg Heine Starfjen
ober fjlojjfäde ober burcf) §eranjiet)en mit Seinen.
242. Sie ißfähle für 24» unb 4»t«®rüden finb etwa
y2 bet freien ©tii^ö^e (ÜRafe
bon ber Oberfläche be§ gflufj»
grunbeS bis ßur Unterfante
be§ §olme§), minbeftenS aber
1 m tief, in f e ft e n Soben
einjurammen.
Sie ißfähle ntüffen ge-
r a b e fein.
Sie Sfütje ift ettoa boppelt
fo lang <ju machen, toie ber
ißfabl ftart ift, unb bei ftei«
nigem ober fepr feftem ©oben
mit einer ©ifenfpitje ju be»
toehren.
Ser ißfahltopf ift waagerecht abjufchneiben unb
an ber itante ju brechen (Silb 132).
4. Sdjnellftege unb Stege*).
SlügemetneS.
243. Stuf SdjneKftegen foH bie Sruppe mit freige«
machten ober zerlegten fchtoeren 28affen in Schüßen»
reihe mit 5—8 Schritt Slbftanb, auch im feinb»
lidjen fjeuer, ©etoäffer überleiten. Sdjnellftege
müffen baher auf bemSanbe unb auf bem
28 aff er leicht jju hanbljabenunb fdjneU einjubauen fein.
Ser ®inbau bon Stegen erfordert mehr Beit al§ ber
bon Sdjnellftegen. Stege tönnen baher im allgemeinen
*) Sicljertjeitsbeftimmungen für übergehen über SdjneS«
ftege unb Stege int ^rieben f. 501.
187
nur außerhalb be§ feinblidjen geuer§
eingebaut toerben.
244. Sdjnellftege unb Stege leiften für über»
Sieben oon Sdjüßen über ein ©etoäffer meljr al§ über»
ermittel. Sßenn möglid), baut man für jebe über»
gang§fteüe mehrere SdjneÜftege ober Stege.
Sdjtoimmenbe Sdjnellftege pnb bet Stromgefdjtoin»
bigteiten bon 0,40—1,20 m/s bi§ 50 m Sänge — bei
Strom unter 0,40 m/s aud) in größeren Sängen —,
SodftfjneUftege bei Stromgefdjioinbigteit bi§ 1 m/s ber»
toenbbar.
Sdjnellftege.
245. 3Ran Ixnterfcfjeibet Uferfdjnellftege
(Sdjnellftege otjne gtoif^enftügen) unb S dj n e 11»
ft ege mit fcßtoimmenben unb feften
61 ü | e n.
SSemeffungen für Stößen unb über»
bau f. Eafel 16.
llferfdjneUitege.
246. S dj m a l e Setoäffer überminbet man mit
Uferfdjnellftegett. Uferfdjnellftege fteHt man au§ ein»
fadjften SJlitteln ßer, g. 23.
au§ nebeneinanber gelegten Sfflb l33«
unb burdj 23anbeifen ober Uferfrfjnellfteg au§ einet Seifer.
Safdjen miteinanber ber» /' „ ,,
bunbenen 23alten, Sörettern
ober 23oljlen, au§ Settern ***
(23tlb 133) ober Stangen x /
(23ilb 134) mit aufgefdjnürten
ober aufgenagelten 23rettern. Nägel
2Ran bringt Uferfdjnell»
ftege burdj Überfanten ober SSorfdjteben auf Stollen,
ioenn nötig burd) Sdjioimmtörper unterftüßt, über ba§
Setoäffer. ©infadje ©nbauflager (SBrettftüde, 23ilb 149)
lönnen bei ineidjen Ufern nötig toerben.
188
SBilb 134.
nfer^neUfteg au§ langen Stangen.
Bunde oder lange Nägel
3,50m
Klammer
oder
langer
Nagel
23ilb 135.
gtoijdjenftüfce.
ehra 1Z cm +
247. ®urd) Slnljängen ber Sragbalfen an ^ßfäfjle,
bie man beiberfeitS ber Saufbafjn nacfjträglicf) ein*
j<f>Iägt ober burdj Auflagern ber Sragbalfen auf Igodje üer*
minbert man ©djtoantungen unb erl)öf)t bie £ r a g t r a f t.
StfjneHftege mit fdjroimmenben Stiißen.
248. 2IIS 2lbmeffungen ber einzelnen Steg*
glieber gelten: Sänge möglidjft nidjt unter
4 m. 23 reite ber
Stufen nidjt unter
3 m. 23ei geringerer
23reite finb $ur Sidje*
rung gegen Sdjtoanfen
ber SÖrrnfe 2IuSfeger
nötig. 23 r e i t e ber
S a u f b a l) n 0,25
bi§ 0,60 m.
‘Die Sragtraft nrirb
burcf) gutes SängS*
üerfteifen (249 u. 257)
unb nad)trägfi(^eS2Im
fjängen an ^ßfäfjle nadj 23ifb 135 erljötjt.
^eber Sdjnettfteg mit fdjtoimmenbcn Stilen ift gum
23erl)inbern öon Seitenfdjtoantungen nadj ober* unb
iinterftrom ftu oerantern.
189
$8ilb 136.
Sanbberanteriing.
Wind leine
Laufbahn
SBilb 137.
Suftberantening.
Windleine Windleine
Sei türjeren Stegen genügt Saubvetautetung mit
Seinen ober Sauen an Säumen, eingerammten Sfäljlen
ober an Sintern (Silb 136), bei geringem Strom aud)
nur nadj einem Ufer.
Sängere Stege erhalten
SBafferoerautetung. Sin
Stelle öon Sintern tann
man Sflüge, mit Steinen
befdjioerte Giften ober
Sonnen, fdjroere Sta^I-
ftüde, bet ftacfjem SBaffer
eingeft^IageneSfä^Ie ber»
toenben. SJtan tann ftatt
ber SBafferberanterung
aud) ßuftoeranterung
nad) Silb 137 an toenben.
249. SU§ Serbänbe
finb Sunbe überall bort
anjutoenben, too bei Sie»
gung be3 Stege§ (beim
Sorbringen, ©inbau, ®e=
Braud)) T '
fidj lodern
Sdjnellftege mit fdjtotnv
t ‘ ; 7
meift beim ober nadj bem
n, ®inbau, ®e* 1|Hj/
SRagelverbanbe |
ern , tonnten. || |ft
üu/ncujicge mit fdjtüim- 1 *u —tt-
menben. Stützen finb T T
©inbau burd) Slnbrtngen .,
bon Säng§I)öIäern an ben 11
SerbinbungSfteHen ber JF1 “*
Laufbahn
/ft
ar-ff
Baum
Tau, Leine oder
zusammengedrehte Drahte
Baum
einzelnen ©lieber ober
3lufnageln öon Brettern
auf bie Saufbahn über biefen Stellen ju Verfteifen.
Einbringen eine3 fdjtoatfjen SelänberS auf einer
Seite ift Vorteilhaft.
250. <?ür ba§ Sorbringen bon Sdjnellftegen mit
fdjtoimmenben Stäben burd) Sßalb ober Sufdj pm
Ufer müffen oft SBege tjergeftellt toerben. Starte
190
Unebenheiten ber Slnmatfchtoege, fo Steilabfälle am
Ufer, tönnen ®nidfähigteit ber Stege ober getrenntes
Vorbringen ber einzelnen Stegglieber unb Sftafjnahmen
für t^ren (cfjnetlen Bufammenbau am Ufer erfordern.
Einüben ber für Vorbringen unb Bufammenbau be»
ftimmten ©rupps toirb oft nottoenbig fein.
251. ©er Einbau gef(f)ieljt burch Vorlieben
ober burd) Einfdjtoenten.
©er Sdjnellfteg ift enttoeber bor bem Vorbringen in
feiner ganzen Sange pfammenpfeijen, oorjutragen unb
über ba§ VSaffer p fdjieben, ober er ift gliebermeife
oorptragen, ins SBaffer ju bringen unb im Vorlieben
pfammenpfetjen.
®aS 3ufammenfe|en in ganjer Sänge fcbon auf bem
Sanbe geftattet ein fchneKereS Jpinüberfchieben beS
Steges als ber gliebertoeife Van, erforbert aber ftär»
tere SrägertruppS, mehr Vlatj nach ber Siefe unb ift
fdjtoerer p tarnen.
©ie einzelnen Stegglieber tönnen auch gleidjtaufenb
pm Ufer an biefem bereitgelegt unb pfammengefeht,
ber SdjneUfteg bann unter ßuhilfenahme oon §alte»
leinen unb Sintertauen im ganzen unter 3luSnü|en
ber Strömung in bie Vrütfentinie eingefchtoentt
toerben.
252. Veim Vorlieben über baS ©Baffer mfiffen
auf bem oorberften Stegglieb — je nach Strom»
gefdjtoinbigteit unb Steglänge auch auf einigen fot»
genben — 1 bis 2 SJlann fifeen ober liegen, bie mit
Stangen ober Seinen ben SdpeUfteg in ©tiefe tung hatten
unb ein ©urdjbiegen beS Steges nach unterftrom ber»
hinbern. ©aS Vorbringen toirb erleichtert, toenn einige
Seute baS ©etoäffer burdjfdjtoimmen unb bann bom
jenfeitigen Ufer ben Steg an Seinen tjerüberjiehen.
Veim Erreichen beS jenfeitigen UferS toerben beibe
Stegenben mit Seinen unb Vfähicn an ben Ufern
feftgelegt (Vilb 144 u. 154) unb burch Saufbretter mit
191
bem Ufer üetbunben. ®ie jenfeitigen Saufbretter
lagert man umtlappbar auf bem borberften Stieb.
2lntertrupp§ machen bie Seranterung feft.
Seim Giufdjujenten be§ SdjneUftegeS muffen Gtater
unb 9lntertrupp3 fo jufammenarbeiten, bafj ein 2)utcE)=
biegen be§ <Stege§ nadj unterftrom »ermieben toirb.
t-O r 1 n=>
l 4,S0m — lj “ 138'
Ansicht . SntaWwHfl««.
Draufsicht
Äräfte: 4 Slann.
Sauftoffe: 10 Sretter,
4,50 m x 25 cm x 3,5 cm; 2 9tanb-
böiger, 5,50 m lang, 8 cm 0;
2 SRunbIjölger, 2,50 m lang, 8 cm 0.
Sinbemittel: 15 Seinen
ober 90 m ©raljt.
SBertgeug unb ®erät:
1 Säge; 4 Älammem.
® i g e n g e io i dj t: etiua 300 kg.
Sragfraft: 1 Staun.
8eit: 2 Slrbeit^ftunben, bei
4 Staun V2 Stunbe, o§ne Slnbe-
förbem ber Sauftoffe.
3.5/25 cm
S8Ub 139.
^retterJdjneHftefl.
Kräfte: 4 Staun.
Sauftoffe: 2 Sretter,
4,25m x 25 cm x 3,5 cm; 4 Sretter,
4 m x 25 cm x 3,5 cm; 2 Sretter,
3,50 m x 15 cm x 3,5 cm; 1 Srett,
3,75 m x 25 cm x 3,5 cm; 4 Srett=
ftücte, 1,20 m x 15 cm x 2 cm;
19—21 Srettftücte, 0,70 m x
15 cm x 2 cm.
Sinbemittel: 10 Seinen,
(babon 2 gum Serbinben mit
bem «äd)ften (SMieb be£ ScbneU=
Kober 60 m ©raljt;
jel.
2ßerfgeugunb®erät:
2 jammer; 1 Säge; 4ÄIammem.
Sigengetuitfit: ettua
290 kg.
Xragtraft: 1 Staun.
3 e i t: 4 2lrbeit§ftunben<
bei 4 Staun 1 Stunbe, ohne
Slnbeförbem ber Sauftoffe.
192
«ilb 140.
^crbittbnttg jtoeier bliebet
be3 (© djn ei Ift ege3 nadj Silb 139.
253* aSretterftfjneHftege mit unb oljne Stü|en au3
Sdjtoimmlörpern öermenbet man nur in ruljigem
Sßaffer. ®in ©lieb einfadj ^er8ufteHenber ^Bretter*
fdjnellftege geigt 93ilb 138 u. 139.
9113 Saufba^n bienen
2 ^Bretter ober 1 SBretterroft
(SBilb 139). ©ie einzelnen
©lieber üerbinbet man
burdj ftarte Seinen mit*
einanber (SBilb 140). 33er*
fteifen ber Stege f. 257.
254. Sdjnellftege
a u ^Brettern unb
ft arten Seinen ober
Sintertauen (99retter=
teppidj) baut man nad)
33ilb 141 bi3 50 m Sänge
bei Stromgefdjtoinbigleit
bi3 gu 0,60 m/s.
©ie Saue toerben nadj ®in-
fdjtoenfen ober 33orfdjieben
ftrajf gekannt unb an SBäu*
men ober Sßfäfjlen befeftigt.
33orau3fe|3ung für SSertoenben folger Sdjnellftege ift
fdjneüe Seranterung jenfeit3 an Räumen ober Pfeilern
burd) üorau3fdjtoimmenbe Seute.
255. llntergieljen oon SSagenplanbünbeln
nad) SBilb 142 ober Slnljängen an fpäter eingefdjlagene
$fäljle (247 u. 248) ertjöpt bie Sragtraft.
256. Sdjnellftege mit Sdjroimmförpern toerben nadj
iBilb 143—147, für Übergeben oon ®raftrabfd)ü£en mit
gtoei in Spurweite Verlegten Saufbaljnen gebaut.
2113 Sdjwimmtbrper eignen fid): tleine Sfloß*
fäde, beljelfgmäfnge gloftfäde, Safttraftioagenf^läudje,
Sonnen, ©anifter, toafferbidjt gemadjte Giften uni)
SSagenplanbünbel.
193
S3ilb 141. Srctterfcblntf)-
Leine zum Verschnüren der Bretter
k Draht Oder
fMlt* , Bindfaden
gut ba£ Ifb. m(aufeer 2 Saiten):
Kräfte: 4 Stann.
Sauftoffe: 4 Sretter, 3,50 m
x 25 cm x 3,5 cm.
Sinbemittel: 8 ftarte Sinbfäben,
1,20—1,50 m lang, ober 10 m Sinbebraljt.
Sßertgeug unb(«Jerät: 1 Scmge.
®igengemi(f)t: ettoa 70 kg.
Sragtraft: 1 Stann.
Seit: 40 Stinuten, bei 4 Stann
10 Stinuten, oljne Slnbeförbern ber Sam
ftoffe.
194
SBUb 142.
JBretterfdjttenfteg mit 2ßagen|>IanBüttbel».
Ansicht
Wagenplanbündel
Grafte: 8 Stann.
Sauftoffe: 14 Sretter, 4,50 m x 25 cm x 3,5 cm; 8 fftunbljölger,
2,25 m lang, 6 cm 0; 2 Sßagertplanen; 8 Sunt) Stro$.
Sinbemittel: 36 Seinen ober 200 m S)raljt
SSertgeug unb ® e r ä t: 2 Sangen; 1 Säge; 4 fllammem.
(Hgengetnicbt: ettoa 400 kg.
Sragtraft: je 5 Sdjritt 1 Stann.
Seit: 4 Slrbeit^ftunben, bei 8 Stann */» Stunbe, oljne STnbeförbetn
ber Sauftoffe.
257. Sdjnellftege mit Sdjn)immtör|,ern
a I § Stützen, bie als ® a n 3 e § nur in ebenem
©elänbe »orjubringen finb, werben fcfjon beim Sau
längSberfteift (Silb 143 u. 144). Sftüfjen fie in un»
195
ebenem ©elänbe üorgebracfyt werben, fo finb fie
fnidbar (Silb 145—147) gu bauen unb beim hinein*
fliehen In ba§ SBaffer burtf) SInbringen üon Sau*
Silb 143.
@dptenfteg au§ Heinen Slofjfäden, mit bur^gebenber
SängSberfteifnng.
Sie £eiterbäume greifen ineinander unb finb jufammen*
gebunben.
ßfär ben gangen Steg tuerben benötigt:
ffiräfte: 8 Sftann.
93 a u ft o f f e: Stieme fSIofef ade; 4 ßeitern, etiua 5,00—6,00m lang aI3 Srag*
ballen; 6 Srettftütfe Öpolmbretter), 2,00 m x 20—25 cm x 3 cm; 4—5Sretter
(ßauföa^n), 3,00—4,00 m x 25—30 cm x 3,5 cm; 5 Sßfaljle (©elänberftüfcen),
1,50 m lang, 6—8cm0; 4 ^fä^Ie (Sefeftigen am Ufer), etiua 0,50 m lang,
5 cm 0; 2 $fä$Ie (BlnterpfäW), 1.50 m lang.
Sinbemittel: 24 ßeinen (Serftfjnüren unb ©elänber) ober 75 m
©raljt; 2 ßeinen (Seranterung), je 30 m lang; 12 Slägel, 5 cm lang (ßaufc
Bretter feftnageln).
Sßertgeugunb ®erat: 1 Säge; 1 jammer; 2©djlegel; 1 Sange.
©igengeiuidjt: etiua 300 kg.
Seit: 4 2lrBeit§ftunben, Bei 8 2ftann */» Stunbe, oljne SlnBeförbern
ber Sauftoffe.
Schlaufen an ben üBereinanber gretfenben Srage^öljern,
burdj Einbringen öon SBerfteifungS^ölsern ober ?luf=
nageln öon SBrettern über ben Stofefteüen ber Saufbafjn
Iäng§auüerffetfen.
196
SBilb 144.
Stynellfteg mit Sdjtoimmern au§ Stiften.
S3i(b 144a.
^GOcrrv—
Kräfte: 6 SRann.
33 a u ft o f f e: 4 Giften, 1,00 m x 0,60 m x 0,40 m; 2 Sretter, 4,00 m
x 25 cm x 3,5 cm; 6 Sretter, 3,00 m x 25 cm x 3,5 cm; 4 Srettftütfe,
0,80 m lang; 1 Srettftüct, 1,5 m lang; 16 m’ toafferbidjter Stoff; 2 Sßfäljle,
1,00 m lang, 10 cm 0, gum Serantern; 4 Sßfäljle, 1,00 m lang, 8 cm 0,
gum Sefeftigen be£ @nbauflager3.
Sinbemittel: 10 Seinen gum Serantern unb {Jeftf(^nüren bet
Giften; 70 Slägel.
23 e r t g e u g und ®erät: 2 £ämmer; 1 Säge; 2 Sdjlegel.
@igengemi(^t: ettoa 350 kg.
Sragtraft: je 4 m 1 SRann.
Seit: 3 SIrbeitSftunben, Bei 6 QJlann Va Stunde, oljne Stnbeförbem
ber Sauftoffe.
197
SBilb 145.
ShtitfBatet «Sdjuellfteg mit Sßagenjjlan»
Bünbeltt (9nubra=eteg).
Se Oeb:
Kräfte: 4 Stann.
S a u ft o f f e: 2 SSagen-
planen; 6 Sunb Strolj ober
£eu; 8 «Stangen, 1,10 m lang,
8—10 cm 0; 2 Stangen,
3,50 m lang, 8 cm 0;
2 Stangen, 4 m lang, 10 cm 0;
2 Sretter, 3 m x 25 cm x
3,5 cm.
Sinb emittel: 24 Seinen
ober 100 m ®ra^t; 12 Sägel,
5 cm lang.
SBertgeug unb ®e =
rät: 1 jammer; 1 Säge.
Gigengefoidjt: ettoa 150kg.
Xragtraft: 1 Stann.
Seit: IV2 2Irbeit£ftunben, bei 4 Stann 20—25 Stinuten, oljne Sin-
Beförbem ber Sauftoffe.
Sionierbienft
14
198
Silb 146. ftnidbatet Stbnellfieg mit fd)toimmeitben Stößen.
Wm
©tü^en: SBagenptanbünbel tote Silb 145 ober Heine föloftfätfe (Stüfe-
toette 4 m).
Serfteifen burdj Stufnageln bon Srettern auf bie ßaufba^n über ben
Stofefteuen.
SBilb 147.
SlniOarer
Sdjnellftea mit
SrfjtoimmtörVem
an§ Sonnen.
199
®lteb (Silb 147):
Kräfte: 4 Slarm.
Sauftoffe: 2 Sonnen, 0,90 m lang, 0,67 m BghJ. 0,80 m 0; 2 Stangen,
4 m lang, 10 cm 0; 4 Stangen, 1,20 m lang, 8 cm 0; 1 Stange, 1,50 m
lang, 10 cm 0; 1 Stange, 1 m lang, 10 cm 0; 2 Sretter, 3,50 m x 25 cm
x 3,5 cm; 4 ßoIgfrieDel; 1 Querbrett, 0,6 m x 25 cm x 3 cm.
(3e 6 ^faljle gum geftlegen ber (gnbauflager).
Sinbemittel: 12^ Seinen ober 100 m S)raljt; 3 m Sanbeifen;
40 Sägel, 6 cm lang.
SBerlgeug unb ®erät: 1 Säge; 1 Seil; 1 jammer; 1 Sange;
4 klammern.
Gigengetvitfjt: etfoa 300kg.
Sragtraft: 1 Slann.
§eit: 2 2lrbeit§ftunben, bei 4 Staun 30 Sänuten, ofyie Slnbeförbem
auftoffe.
ScgneUftege mit feften Stügen.
258. Sdjnellftege mit feften ©tilgen tann man nur
bann anwenben, wenn geftfteüen bon Sßaffertiefe unb
Vejdjaffengeit be§ §lufjgrunbe§, 3.53. bei banalen burd)
Einfidjtnagme in $läne, möglidj war, bie SBaffertiefe
nidjt über 1,50 m, bie ©tromgefigwinbigteit nicfjt über
1 m/s beträgt unb wenn ber Untergrunb feft ift. ©ie
Stützen finb Vöde. Vorbringen unb Einbau mufj ein»
geübt toerben.
259. ©er VefelerfdjneKfteg (9311b 148) ift nur an»
toenbbar bi§ gu Vodgögen bon ettoa 2,50 m.
3um Einbau finb erforberlicg: 1 ©rugpfügrer,
1 SKann (1) unb für jebe§ Vodglieb 2 SKann (2 unb 3),
ferner einige Erfagleute.
Vorbau be§ ©tege§: Sll§ bie§feitige§ Enbauflager be§
<SdjneHftege§ [djlägt 1 gwei Vfägle (P) mit ettoa 1 m
gwifcgenraum fo ein, bafj bie Vfagltöpfe notg ettoa
20 cm über bie Erbe ragen. Veim legten <Scf)Iag gibt
ber ©ruppfügrer 2 unb 3 ba§ Setdjen gum Vorbau.
2 oorn, 3 ginten tragen bie Vodftrede mit ben Vod»
beinen ginten unb aufwärtSgeftellt bor.
1 unb 2 fegen ben öorberen Ouertnüppel (Q) be§
Vode§ an bie eingefcglagenen Vfägle,
3 — bei gogen Vöden gilft ein weiterer 3Rann —
ridjtet bie Strede auf, ftürgt fie über Cluertnüpgel Q
14*
200
Bockbein
Holm
Fußlatle
23ilb 148.
SSüfidjitellfteg ($efelerfteft)<
Äräfte: 4 SRann.
Sauftoffe: 6 Stangen für
Sod, Sänge je nadj Soctljö$e,
8 cm 0; 2 Sangöftreben, Sänge
je nad) Sodljölje, 8 cm 0; 2 Quer»
tnitypel, 1,50 m lang, 8 cm 0;
2 Quertnüppel, 0,70 m lang,
8 cm 0; 2 Sretter, 4 m x 25 cm
x 8,5 cm; je 2 ^fäljle gum flrefi-
legen ber (Enbauflager.
Sinbemittel: 15 Seinen
ober 45 m ©raljt; 24 Slägel, 6 cm
lang.
SBertjeug unb ®erät:
1 Säge; 1 Seil; 1 jammer;
1 Bange; 4 klammem,
iigengetoidjt: ettoa 60 big 80kg.
Bett: 21/» SlrbeitSftunben, bei 4 SRann
etwa 40 SRinuten, ohne Slnbeförbern ber Sauftoffe.
r—150m
1/6-1/6 der Höhe
vom Untergrund
bis zum Holm
201
inS SBaffer unb läuft auf ihr oor, um an ber Unten
Seite fteijenb bie ©ätigteit bon 1 auSjuüben.
©ie öuertnüppel Q ber neuen Streifen finb als
SBiberlager jeweils an ben SBodbeinen ber öorher»
geljenben Strede anjulegen.
©ie jenfeitige Sanbftrede wirb an 2 pfählen mit
©raijt ober Seinen angebunben.
Stege.
SBemeffungen für Stützen unb überbau
fowie übergehen über Stege f. © a f e l 16.
260. Stege (nutzbare ^Breite 0,50—1 m) fjaben fefte
ober fdjwimmenbe Stüjjen ober feine Stützen (Ufer»
ftege). 2lls ßnbauflager genügt ein mit 4 pfählen feft»
gelegtes SBrett ober SBoljle (SBilb 149). ©ie ©ragtraft
langer, fdjwadjer ©ragbalten tann man burdj SBe»
feftigen an nachträglich eingefdjlagenen pfählen erhöhen
(SBilb 150).
SBilb 149.
tubauflager für Stege
(6 m Stüfcweite).
Cohle 7/25cm 10/12cm oder Wem
SBilb 150.
3toifdjenftüfce für Stege
(6 m (5tü£rt)eite).
' 261. Uferftege [teilt man au§ Söauntftämmen,
Ijöljern, Leitern ober Stangen Ijer.
202
® t n j e l n e ©aumftömme werbennadj23ilb 151
Ijergertdjtet. $a§ §inüßetbringen bon langen, fdjtberen
©allen ober ©aumftämmen für Uferftege erfolgt burdj
Silb 151.
Steg
auS einem
einzelnen
Sautnflantm.
Silb 152.
Sortollen eines ftaiten Munb^oljeS.
Silb 153.
Überf(f)tüenten eines ftarlen SRunbljoljeS.
Schuallrott
203
tt&erfdjieben mit Saufbalten unb SBaljen (Silb 152)
»ber burdj überfdjwenfen (Silb 153).
langen Stämmen (etwa 20 cm 0)
— örlofeMj — laffen fiel) fdjmimmenbe Uferftege nad?
Silb 154 bauen.
SBilb 154.
Steg ctu§ fylofjljolj.
ft t ö f t e: 2 SRann.
Sauftoffe: 3 Sunbljölger, 10 m lang, 20 cm 0; 6 Sretter, 4,00 m
x 25 cm x 3 cm; 6 Sretter, 1,75 m x 25 cm x 3 cm; 2 ftmtyipel, 0,90 m
lang, 10 cm 0; 4 Sßfäljfe, 0,80 m lang, 10 cm 0; 4 Slnterpfä^le, 1,00 m
lang, 10 cm 0.
Sinbemittel: 60 Sägel, 6 cm lang; 4 Slnferleinen.
Sßerlgeug unb ©erät: 1 ©äge; 1 Seil; 2£änuner; 1 ©tfflegel.
©igengetvidjt: ettoa 750 kg.
Xraglraft: 2 Sftann.
Seit: 1 SlrbeitSftunbe, bei 2 2Jtann V» ©tunbe, oljne Slnbeförbem ber
Sauftoffe.
262. jjejte ©tilgen finb: Sfaljljodje, Söde, Stapel
ober Sodfprengmerte.
Sn ftromlofem Setoäffer ober bei [cfjioadjem Strom
tann man audj ftarte Giften, SKöbel, gäffer, SDJaurer*
böde (Silb 162) ober Stagen mit tragträftigen Stauben
(Silb 163) al§ Stützen öertoenben.
204
263. Stäben auä ißfäljien werben nadj SBilb 155
u. 155 a IjergefteKt. Sie $fäljle werben im allgemeinen
eingefdjlagen.
Silb 155 a.
SängSberftrebung.
Duer= (23ilb 155) unb fiängSftreben (53ilb 155 a) her«
ljinbern Seiten» unb fiängäfdjroantungen. Seiten«
205
fdjtoanfungen fann man aud) burd) Serfdjtoerten ber
^fftljle (Silb 169) aufljeben.
©ie ${äljle nu|t man meift aud) aß ©elänber*
ftütjen auS.
Getänderstange
^!2Qcm silb 156<
\\ m \r>f[ Sretterbod für
I \V“/7\ Stege
1 \Y/7 Brett als Holm (3 m Stü^eite).
EFüllbrewsj( \ o .. , (Hnen äfynlidjen Sod
stück / iQnn man aud) au§
T //\\ Bockbe,ne Stangen bauen
1 |—\\ . 1 (Streugbotf).
"Verspannung
Silb 157.
SotyfenftaVel für 4*t*Srüde.
264. Söde finb nur bei feftem, ebenem ®runb unb
bei fdjtoadjem Strom brauchbar. Sie tocrben aß
Stangen* (Silb 174) ober Sretterbötfe (Silb 156 u.
Safel 21) gebaut.
265. Stapel toerben in IXfernäfje nad) Silb 157—160
gebaut, für Stege jebocE) nur in 1,00—1,50 m Sreite.
206
Silb 158. Sretter jtapel für 4 »t» Stüde.
ty.Sm
Silb 159. Sflltenftapel für 4» t» Stüde.
Silb 160. ^oIjtlobenftaDel für
4»t» Stüde (5 m Stuft Weite).
266. 6tri Soctfpreng»
wett Baut man, toenn
ber Sinbau (entrechtet
Stufen nicht möglich
ift unb jfragöalten in
einer für einen Uferfteg
erforberlichen Sänge
unb Stärte nicht bei»
jjutreiben finb, jeboch
nur bis ju einer Stüh»
weite üon 12 m.
3wei Spannrahmen
(S8ilb 161) werben nach
rlrt bon Söcten an
Sanb fo angefertigt,
baß fie an bet ©olm»
207
feite mit ettoa§ Spielraum ineinanber paffen. Sann
»erben fie in ben vorbereiteten ©nbauflagern auf»
gerietet unb mit Sauen langfam gegeneinanber geneigt,
bi3 fie ineinanbergreifen unb fitfj gegenteilig verfpannen.
3m ftreuApuntt ber Stammen toirb ber £>olm auf»
gefdfnürt (Silb 161 a).
Sie Spannrahmen müffen feft in ben ßnbauflagern
fte|en.
SSilb 161.
ttodtytengtoerl nl§ Stille eines Stege?.
StauffidjL
Silb 161a.
Sin f t <f) t
267. SJlauretbörfe (Silb 162), bie man häufig auf
Bimmer» unb Sauplätjen finbet, finb brauchbare
®tü|en.
208
93115162. SWaurerboiL
268. SBagen ober $rogen baut man nadj S3tlb 163
ein.
93ilb 163. Sßagen alS Stü^e eines Steges.
269. kleine ^loftfäde tonnen burd) Sluffdjnüren öon
2 m laugen unb 25 cm breiten Brettern auf bie
£äng§feiten junt ßinbau als föniimmenbe ©tügen Ijer«
gerietet »erben.
Sie Sragbalfen, mit ftnaggen üerfeljen, Werben auf
bie Sretter aufgefdjnürt (Silb 164).
Sijnlid) üertoenbet man Heine Hägne, Soote
(Safel 16), Sonnen ober SBagenplanbiinbel entfgredjenb
256 unb Silb 144—147. Slngagl unb ®röfje öon
Sonnen f. Safel 14 unb 15.
209
SBilb 164. gtofeMfieg.
»eifVtel für ben Sau eine§6tege§ na et) SBilb 164.
ftröfte: 2 ©nippen.
Sauftoffe j e © t r e d e : 1 Heiner ftlofef ad; 2 $olmbretter, 2,00 m
x 25 cm x 3 cm; 2 Xragbalien, 5,50 m lang, 10/10 cm (ober 12 cm 0);
8 ftnaggen, 20 cm x 10 cm x 3 cm; 8 Querbretter, 1,00 m x 18 cm x 3 cm;
8 ßaufbretter, 4,00 m x 25 cm x 3 cm; 2 ©elänberftüfcen, 1,50 m lang,
6-1 8 cm 0.
Sinbemittel: 8 Sinbeleinen; 60 Sägel, 6 cm lang.
Sautoeife unb £rupp einteilung für ben Sau mehrerer
©treffen (8).
A. Sorbereiten nach Sefdjaffen unb £erriff)ten ber Sauftoffe:
1. Überbauftreffen opne bie über ßflofjfacfnritte liegenben Querbretter unb
ohne bie Selagbretter perriefiten......................=• 1 ©ruppe.
2. {Jlofefäffe fertigmaepen, ^olmbretter auffepnüren, 8 Stamn
8. Seranterung borbereiten....................2 • > «= 1 ®nippe.
4. Cnbauflager perftellen.....................2 • J
B. ©inbau, ftredentoeife pintereinanber:
{Jlofcfäffe bon oberftrom bor Srüffenfpifee fahren 4 Stann
Überbau auf ioafferfoärtigem glofjfaff ein^ 4 Stann
tnaggen . .....................................> Kläger-
{Jloßfaff mit Überbau borfipieben..............J trupp
Überbau auf lanbfoärtigem ßflofcfad bjto. @nb^ 4 Stann
Ser einfnaggen................................> Sinbau-
alten auf §Iofcfaff feftfdjnüren . . .' J trupp '
Seranterung im Suge palten....................
Querbrett über gloßfaffmitte feftnageln . . .
ßaufbretter perantragen (2 Stann) unb auf-
nageln ........................................
©elänberpöljer aiifftfjnüren unb ßeinen an-
bringen .................................
SBerljeug unb ©erat: 3 öanbfägen;
8 ©cplegel; 2 Seile; 3 Steftftäbe gu '
Seit: gu A. bei 2 ©ruppen 1 @
8.
8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
©ruppe.
2 Stann'
2 •
4
1
©ruppe
4 *
3 jammer; 3 Sangen;
, i 2 m.
v________________________Stunbe, au B. bei 2 ©ruppen 1lt ©tunbe,
ohne Slnbeförbem ber Sauftoffe.
210
270. Sei $ ä Ij n e n muffen bie Sragbalten ftetö auf
beiben Sorben aufliegen.
S3üb 165.
Steg au§ Sonnen.
271. Raffer unb Sonnen 'tönnen nadj
Silb 165 al§ Stütjen für ©fege in fdjtoadjem Strom
oertoenbet toerben.
272. $ür längere Stege baut man junädjft
©lieber, oerbinbet biefe mit Sraljt ober ßeinenbunben
untereinanber unb oerfteift ben Steg fobann
burdj 2lnf(f)itüren oon §öljern in ber Starte ber Srag»
batten über ben Stofjftetten.
Stege mit f^toimmenben Stütjen müffen nadj 248
Detoniert toerben.
211
273. ©er überbau befteljt auä ©ragbalten, Quer«
Ööljern unb Selag, ©elfinber unb Stöbelung (Silb 164
bis 166).
Sragbalten erhalten Slbmeffungen nad) ©afel 16.
§at man fcf)»ä(f)ere Sragbalten, fo nimmt man 3
ober 4 ober benufet Stangenbünbel (mit ©raljt um«
fdtnürt) ober baut 8®if($enftü|en ein.
§odjtant gefteHte Sollen ober jufammengenagette
Sretter tann man ebenfalls al§ ©ragbalten bertoenben.
Silb 166. überbau bei Stegen.
Querholz
Sie Sragbalten »erben burcb lange Slägel, Sunbe,
Klammem, Knaggen ober Sanbeifen auf ben Stufen
befeftigt. ?Kn f^toimmenben Stüfjen binbet man fie mit
©raljt ober Seinen feft.
274. Site Selag nimmt man Sretter, genfterläben,
fdfmale Suren, ^alb^oljer ober Knüppel, jur SQot autfj
ftarteS Steifig. Sretter üerlegt man nacfj Silb 166 auf
Querhölzern unb nagelt fie feft.
Knüppel ober Jpalbljölzer »erben auf ben ©ragbalten
feftgenagelt ober burch aufgebunbene («genagelte) Stöbet«
ftangen («latten) feftgehalten, fo auch fReifig.
Sinb genug Sragbalten »orhanben, fo legt man fie
bidjt nebeneinanber unb oerbinbet fie. ©er Selag fallt
bann fort.
©tuen Steg mit boppelter ßaufba^n jeigt Silb 167.
X ff, 91
212
SBilb 167.
5. 2=t= unb 4®t®$e!)elf§brnden.
Aömeffungen für Stufen unb überbau
f. Eafetn 17, 18 unb 21.
275. Infanterie, Kavallerie unb Kraftfa^rtampf»
truppen müffen unter einfachen SSerljältniffen ihre fjahr«
geuge bi§ 4 t ©ettndjt felbft über ein Setoüffer bringen
tönnen. Sie müffen baljer mit ihren Gruppen®
Pionieren unb bem ihnen gur Verfügung ftetjenben
unb beigetriebenem Serät unb Sßertgeug aujjer über®
feijmitteln auch furge 2=t- unb 4=t=33ehetf§brü(fen bauen
tönnen.
Sie Artillerie mufj mit ihren Sruppenpionieren ein®
fache 2®t= unb 4=t=Uferbriiden (53rüden ohne gmifthen»
ftütjen, 232) herftellen tönnen.
Übergang ber Gruppen f. Safeln P unb 18.
213
ßnbauflager.
276. !yebe§ Gnbauflager, b. 5- bie Stütze jebe§
SrütfenenbeS auf bem Ufer, heftest au§ Uferbalten unb
Sötlb 168.
Gnbauflager einer 44=58ebelf§brütfe
(5 m @tü|ti>eite).
Schnitt A-B
15
IHonterbienft
214
Stofjbohle, bie man rechttoinflig jur Srüdenlinie nadj
Silb 168 u. 168 a berlegt unb burd) pfähle befeftigt.
Uferbalfen unb Stofjboljle legt man maagere^t fo
tief in ben ©oben, bafj bie Dberfante ber Stofjbohle
unb ber Selag mit ber Fahrbahn ber 3u9^nge in
einer Jpöfje liegen.
Jgötjerlegen beS UferbalfenS erforbert ben Sau öon
SRampen auS feften Sauftoffen (Salten, Sollen, ®ieS,
Schotter, Steine), Sieferlegen baS ©infdjneiben öon
fRampen, bereu Sohle mit feften Sauftoffen ju belegen
ift. Seibel ift geit* unb träfteraubenb.
Sei meinem Soben legt man ben Uferbalfen auf
ftarte, rechttoinflig ^um Uferbalfen liegenbe Srunb*
fdjioetlen (breite Soljlenftütfe).
gefte Stößen.
277. Srütfen mit feften Stößen, namentlich $fahk
jodjbrüden, tann man nach Sefd)äbigung burd) Sefdjufj
ober burd) g^egerbomben fdjneU auSbeffern. 23au
erforbert aber Diel ßeit unb Diele Kräfte.
278. Sie Stößen müffen in fid) feft oerfdjtoertet
(Silb 169) ober querDerftrebt (Silb 155) unb untere
einanber längSDerftrebt (Silb 155 a) toerben.
©er freie ©urdjftufj beS SSafferS barf jebod) burdj
baS Einbringen Don SängSftreben nidjt betjinbert
toerben.
279. Stapel finb als niebrige Stützen auf bem £anbe
unb in ruhigem unb flachem SBaffer bei feftem Unter-
grunb gut geeignet. Sie toerben nach Silb 157—160
aus Salten, Sohlen, Srettern, ®ifenbahnfd)toellen,
§ol§floben ober ftarfen Knüppeln gebaut.
280. Sßfaßtjodje (Silb 169) finb bie feftefterr Stößen.
SRan baut fie ein, toenn ber Untergrunb ba3 Dlammen
ber ^odjpfäljle suläfjt unb ba3 nötige $Rammgerät Dor*
hanben ift ober behelfsmäßig IjergefteKt toerben tann.
215
Einzelne ^ßfa^IjodEje gintfcEjen anberen Stützen geben
einer 8rüde guten Qalt gegen SängSfdjub.
Ster Einbau bon ißfahljoqten Ijat gegenüber bem Ein»
bau anberer fefter Stützen ben Vorteil, baß ber Unter»
bau unabhängig bom überbau — alfo an mehreren
Stellen gleichseitig — hergefteHt toerben tann.
2»t = 8rüden erhalten 2 Sochpfähle, 4 • t»
8 r ü et e n im allgemeinen 3. 8au nach 169.
SBefeftigen be§ öolm§ f. 234. 8ertoenben bon 2 30Ch=
pfählen ift aud) bei 4»t=8rütfen juläffig, toenn jebe§
Qoch feft berfch wertet wirb.
8ei weitem fjlußgrunb ift bie Sahl ber 3o<hPfähIe
in jebem ißfahtjoch ju bermehren, ober e§ finb Stop»
pelpfahljodte ju rammen (S8tlb 170).
Soppelpfagljodje finb feßr ftanbfeft. ®lan baut .fie
— außer bei weitem fjlußgrunb — in große Stütj»
weiten unb beim Übergang bon feften ju fdhtnim»
ntenben Stütjen ein.
Iperrichten unb Stammen ber pfähle f. 242.
15*
216
SBilb 170. für 4*t*$8rütfe (6 m «Stüpft) eite).
SBilb 171. (Sdjtoelljod) für 4*t*SBrütfe
(5 m <Stü£toeite).
----------450 m
Holm 14/16 cm
Stier
14cmr
Schwelle W16cm ^erschw&tung:Bohle
oder Halbholz 10 cm
217
281. Sdjwetfjodje finb tote Sßfahljodje gu bewerten.
Sie toerben nad) SBilb 171 Ijergeftellt. ©ie pfähle
fteijen auf einer Qoc^fcbmeHe au§ Santljolg ober gtoei»
feitig befchlagenem Olunbholg.
3um Bufdjneiben unb SBerpaffen legt man fie auf
eine waagerechte SitrljeitSflädpe (Sdjnütboben) au§ §olg=
unterlagen mit ^Bohlenbelag.
SBilb 172. Spitsenfrljtoelljorl) für 4<t»S3rüde
(5 m Stüptoeite).
------------4,50m---------
Holm 14/16 cm I-— 1,70 m —-I
SchnitM-B
Stiel
14cm^
Schwelle Verschwertung: Bohle
14/I6cm B oder Halbholz 10cm
Schwenjodje fe|jt man auf £anb ober in nichtiges
SESaffer, aber nur auf f e ft e n, ebenen Untergrunb, bei
hohen SBrüden auf spfahljodje ober in breite fd)totm=
menbe Stii^en.
fjeftlegen ber ^yoc^fdptDetle unb SBerftreben ber
SchiDeHjodje in ber £äng§rid)tung ber SBrüde ift gum
Sichern gegen Sippen erforberlid).
S^mettjoche mit Spigen (SBilb 172) oerwenbet man
auch in tiefem SBaffer, wenn grobtiefiger glufjgrunb,
218
Untergrunb feft ift. ^elfigi
Lj.uim, utr giammen bon Sßfh^ljotyLu uuv uun
Sdj»eHjod)en mit ©pipen auSfdjtieftt, erforbert bei
Silb 173. Sodlepre.
B
1 1 A
SDtoor unb Söfjboben stammen bon ^fafjljocljen auS»
fdjliefjt, wenn »enig Olammgerät borpanben ober bie
Beit für ben Srüdenbau Inapp, bagegen für baS Sor«
bereiten beS Unterbaues reidjlidj ift.
SSorbebingung für baS Sertoenben bon S^toettjo^en
mit Spitzen ift genaues Steffen ber SBaffertiefe an ben
Stellen, an benen bie <Sdj»elljodje gefeijt »erben foKen,
unb genaues geftftellen ber geftigteit beS §lufjgrunbeS(214).
282. Söde (Silb 174—177) tann man bermenben,
trenn ber Untergrunb feft ift. gelfiger, unebener Unter»
grunb, ber 3iammen_bon Sfapljocpen unb Setjen bon
getjlenbon fcpmimmen«
ben Stützen immer ben
Sinbau bon Süden.
Süde tann man fdjon
bor Seginn eines
SrüdenbaueS IjerfteHen
unb and) otjne gutjitfe*
naljme bon SBafferfa^r»
jeugen einbauen (287).
Söde finb ftetS in ber
SängSridjtung ber Srüde
ju berftreben. Sie Sunbe
ber Söde finb ftänbig ju
über»ad>en.
283. Bum S i n b e n
ber S ö de baut man eine
Sodleljre nad) Silb 173.
Sluf bem Arbeitsplan
»erben gunädjft bie
Sreite ber Srüdenbaljn
i ~ä
a bei 4»t»Srüden = 3,6 bis 4 m
a bei 2=1>Srü(fen = 2,6 m
h = Soctpöpe.
ißuntte A, B — nupbare ____________
+ Sreite ber iRöbelbalten — burd) ^ßfäljle, bie Slittel»
linie C—D unb bie £ote bon A unb B burd) Slufreijjen
feftgelegt. Sann »erben bie Suntte E unb F burdj
’/e bis Vsh (Einlage ber Sodbeine) beftimmt unb eben«
falls burd) Sfäljle bejeidjnet.
219
Sie einzelnen Seile be§ Sode§ toerben auf Unter»
lagen an bie feftgelegten fünfte ber Sodlefjre gelegt,
unb jtoar: Jgolmobertante an AB, Sodbeine mit
Snnenfante an AE unb B F.
9lad)bem bie fjufjlatte unb bie Serfdjtoertung, aud)
bie Sragbeine, angelegt finb, üerbinbet man alle Seile
gut unb feft mit flreuj» ober Sodfdjnürbunb, bei SBßden
mit Sragbeinen biefe burdj Sanbeifen mit ben Sod=
Deinen (284). Sie Jpolme ber Söde mit Sragbeinen
berbinbet man bor bem Segen flüchtig, nad) bem Segen
feft mit ben Sodbeinen.
fOiit einer Sodlegre tann man beliebig biele Söde
bauen, toenn man bie Sntfernung ber bei E unb F
eingefdjlagenen Sfäljle bon ben bei A unb B einge»
fdjlagenen Sfaglen ber tgötje (h) be§ 11 e i n ft e n
Sode§ entfpredjenb toaglt.
Sie Söde finb in ber Sleiljenfolge igre§ ®inbaue§
ju beziffern.
284. Sie <>olme ber Söde muffen feft gelagert toer»
ben, unb stoar auf Knaggen, bie gierju in bie Sodbeine
eingulaffen finb (Silb 174 u. 176), ober nod) fid) er er auf
S3ilb 174. SBoct mit auf Snaggen für 4»t»93rü<fe
(5 m Stügtoeite).
220
Xragbeinen. ©ie ©ragbeine muffen mit bem ber
SBodbeine abfdjneiben unb burd^ SBanbeifen Jeft jnit
ben SBodbeinen berbunben..................
SBilb 175.
%od mit Xragbeinen unb
2 lohnen.
Holme
Bandeisen
Tragbein
Bockbein
Droh!-oder
Leinenbunde
fein (SBilb 175). SBei 93er«
toenben oon ©oppelbod»
beinen lagert man bie
§olnte auf Sragelnfip»
peln, bie iijrerfettg auf
etnsulaffenben Knaggen
(SBilb 176) ober in ®in«
fdjnitten ber 93odbeine
nadj SBilb 177 rufien.
©oppelbodbeine finb
nad) bem <Se|en ber
SBßde feft miteinanber
burd) SBanbeifen gu ber«
binben.
§ er ft eben öon SBöden
mit ©oppelbodbeinen ift
fdjioierig unb jeit«
raubenb; fie Ijaben ferner
grojjeS ®etoid)t, laffen
fid) baljer fdjioer be=
förbern unb fefjen. ®infadjer ju bauen unb gu fjanb«
ijaben finb SBöde mit ©ragbeinen ober mit einfadjen
Sodbeinen.
SBöde mit ©ragbeinen finb tragträf«
tiger al§ SBöde mit einfachen SBodbeinen. 2lud) nad)
bem Seiten be§ SBodeS tann man bie Jpölje be§ §olme§
burd) SIbfdjneiben ber ©ragbeine ober Unterfuttern
eines jioeiten JpolmeS anbern (SBilb 175 a). ©iefe SBöde
finb baljer am beften geeignet.
285. ©a§ SBodfefjen gefd)ief)t rafd) unb leidjt au3
f r e i e r § a n b. Sft i»egen ber SafjreSjeit ober
ber ©iefe be§ SßafferS nicl)t möglid), fo fe|t man bie
SBöde bon einer ®inbaufäIjre ober mit 3ugtaix.
221
SBilb 175 a.
Kträgleidjen ber Wohnlage beim (£tnfinlen eine§ ^orfbeineS.
Seitenansicht
Punkt A
Holm 1
Rödelung
Belag 11 p
Tragbalken
Holm 1
Holm 2 H
Tragbein
Bockbein ___!:
286* Cnnbaufäljrenbaut
man nad) 33tlb 178.
Strom- unb SBinbanfer
für bie Sinbaufäljre
müffen fo liegen, bafe
möglid)ft alle Söde, bie
üon ber ©inbaufäfjre
gefegt toerben Jollen,
oljne neue3 Slntertoerfen
eingebaut toerben tonnen. Sei geringen glufcbreiten
tommt man mit Sanbüeranferung au3. 2)er Sod toirb
am Ufer ober an ber Srüdenfpi^e übernommen. Sort-
en tann man ben Sod üortragen ober flößen. Sor
bem Setzen be3 Sode3 ift bie gäljre burd) £aue ober
Staten feft^ufteHen. Se|en gefdjieljt auf Kommanbo
be3 ©inbautruppfüljrer^.
287* S t e l) t tein 2BaJJerfaI)r$eug $ u r
Verfügung, toirb ber Sod oor bie Srüdenjpi^e geflößt.
®ie ßäng^ftreben be3 Sode3 finb in Stü^toeite mit
bre^baren Klammern an ber leiden Stü^e §u befestigen,
bann ift ber Sod burd) gugtau aufAuridjten
(Silb 179).
222
SBilb 176.
$od mit 2 SBodbeinen unb trage»
tnüpMu.
Vorderansicht Seitenansicht
SBilb 177.
ginlaffen ber §olme.
288. SJöde aus Brettern ober Sollen nad) 93ilb 180
finb einfacher unb baljer fdjneHer gu bauen aI3 Stangen*
böde.
33retterböde finb für §öljen bis 3 m geeignet
©ie §olmbretter (Sollen) unb SSodbeine müffen
burd) 93rettftüde berfteift toerben, bie S^ägel burd) alle
93rettlagen ^inburdjgeljen.
223
5BiIb 178.
$otffe$en mit (£infcaufäljre.
Richtung des Vor*
Stange zum Aufrecht hatten
des Bockes beim Vorschieben
Z Tragbalken Tauende oder starke Leine, an
(Ortbalken) der der Bock vordem Setzen hängt
Erläuterung:
{yüljrer be§ Einbautrupp^.
Einbautrupp = 10 Sftann, babon je 2 (1—4) Sauenbe am
EBocf, je 2 (5—8) £alteftangen, 2 (9—10) ©panntau.
Xauanlegertrupp = 4 Dftann nadj ©e^en
> be£ 93octe3 bei 33er=
ßfabrtrupp mit ©taten = 4 DftannJ legen ber Xragbalfen.
©panntauanleger, SBriictenfpifce = 2 2Jtann.
224
SBilb 179.
£injrf)hnmmen bon Zöllen.
<5eitenanfid)t
_3/ütawwte ,, & bewegliche
r n Drahtbunde
225
23ilb 180.
Sretterbotf für 4 = t = Srüde
(4 m Stü^ioeite).
Kräfte: 4 SRann.
Söaitftoffe: 50 Ifb. m Sretter, 4/30 cm.
Sinbemittel: 2ßeinenober 20 m ®rabt; 100—150 fRägel, 10 cm lang.
SSerfjeug unb ®erät: 1 Gäge; 2 Seile ober £ämmer; 1 S^ge.
Seit: 6 2lrbeit3ftunben, bei 4 Slann IV2 Gtunben, oljne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
Sdjroimmenbe Stögem
289* Sriitfen mit fdjnrimmenben Stögen tönnen
burd) 33efd)uj3 unb burd) Fliegerbomben fo $erftört
toerben, bafe ein SSieberfjerftellen nur bei ftarten
SReferben an fdjtoimmenben Stü^en möglid) ift. Sau
Oon Srüden mit ®äf)nen, $onton3, ^ra^men ober
großen glo^fäden (biefe nur für 2=t=Srücten unb bi3
1 m/s Stromgefdjtoinbigteit) afe Stützen nimmt jebod)
toeniger Seit unb Kräfte in Slnfprud) al§ Srüdenbau
mit feften (Stützen.
Slnbere fdjtoimmenbe Stü^en, bereu JperfteHung
jebocf) Beit toftet, finb: glöfje au3 Salten, Sonnen ober
Raffern unb fonftigen Sdjtoimmförpern.
226
SBilb 181.
Seranterung fdjtointntenber Stufen.
Statt Sanbanter aucfy Sßfäfjle ober Säume.
•Stromankerlinie
Windankerlinie
227
SlUe (djtoimmenben Stü|en toerben oberftrom gegen
Strom, unte'rftrom gegen Sßinb, bie jebem Ufer am
nädjften eingebauten Stufen am £anbe oerantert
(239 unb 23ilb 181).
290. (Srofje glofcfätfe toerben nad) 154, Säfjne nadj
®tlb 182 flum ©inbau IjergericEjtet (©rmitteln ber Srag-
traft f. 133 u. S3ilb 77).
291. Säljne ober Sßraljme toerben einzeln ober ju
fjäljren Oerbunben eingebaut.
33 e i ftartnmnbiflen 183
Ie0t iMn bie <Scf)iüenjod) in einem
Sragbalfen auf bie
Safjnborbe, bie jum En. Dr.htbund
fd>nuren ber Oragbalten odBandeisen
nad) SBtlb 182 ^erju- ea D°naese
ridjten finb. En ben / ________________________
Oragbalten befeftigte 1 .Ml IM
Knaggen bertjinbern ein H
Serfdjieben ber Salten ¥ /3£s. ]t
unb ein Euäbiegen ber :----------V„zZlIxs - -
ßafjntoänbe. ______W Tfl W/--y—
3n fdjtvadjiuanbige-----------------------Schnürleiste
fi'üijne baut man
©djioeHjo^e nad) Silb 183 ein. ©oppelfdjioeHjodje finb
ftanbfefter unb anjutoenben, toenn bie SEragbalten bie
Saljnborbe nicf)t berühren. ®ie Sa^nborbe finb bann
burdj befonbere Sangen jufammensuljalten (Silb 184).
ßange fläljne oerbinbet man in ber Srüdenridjtung
über ben Oberftrom» unb llnterftromtaffen burd) auf»
gefdjnürte Salten (Scfjerbalfen, Silb 328).
Serfdjiebene Sorbijöfien toerben burdj
©inbauten au§geglid)en (Silb 185). Oie ®efal)r be§
kippens toirb burd) floppeln ber ®äljne ju fjäljren
bermieben.
228
SBilb 184.
Sobbelftfjtoelljml) in einem £aljn.
SBilb 185.
£ftljne mit berftfjiebenen SBotbljöljen, bnrdj (ginbanten
ait^geglicfjen (4 = t = SBriide).
292. Verringern ber Sragtraft ber
® ä l) n e burd) bie Saft ber Slufrüftung
(SB 11 b 183—185) ift in 91 e dj n u n g ju ft eilen.
293. 3utn 6d>ui gegen SdjroaH unb SBellen»
fdjlag erljöljt man bie SBorbe burdj SSretter ober bedt
bie Waffen ab.
294. Bum ßinbau werben fdjmimmenbe «Stütjen mit
gal)r= unb Sintergerät, foioie Sffiafferfdjögfettt, Sedbidj»
tungSftoffen unb einem SSeil (jum Staffen be§ Sinter»
taues im 3a(ie ber ®efa^r) auSgerüftet.
229
295. ©ie Seranterung erfolgt nad) 33ilb 181. Sei
turnen Srüden genügt Serantern am Sanbe nadj
Silb 136.
296. ®alten= unb Sonnenflöfje eignen ficE) nur in
ruhigem SBaffer aI3 Stützen.
Salfenflöfje baut man minbeften^ 10 m lang unb
3—4 m breit unb gibt ihnen eine oberftromtoärt3 ge=
richtete Seilform. ©ie ^lofjhölzer finb oft in mehreren
Sagen übereinanber ju legen. Übergenagelte Sretter
ober Stangen, gleichzeitig Sluflager für bie §olme, ber-
binben fie. Sur$e Stämme finb mit ihren Kuben
gegeneinanber zu legen. ©ie Sage ber Stöfje mufj
toedjfeln, einige burdjgehenbe Salten finb baztoifcfjem
Zulegen. Stromabtoeifer (Silb 95) bringt man nad)
Sebarf an.
©ie Sragtraft Don Salfenflöfjen in t ift bei trodenem
§olz ein fünftel be§ ^Rauminhalte in Subitmetern.
!Raffee £olz ift fernerer aie trodenee, feine Sragtraft
baher geringer unb burch ^ßrobebelaften feftzuftellen.
Sonnenftöfje ftellt man nad) 147 u. 158 unb Silb 89
ober 95 her ({. Sonnenfähre). Sahl ber Sonnen f.
Safel 15.
überbau.
297. $ a h l urtb Stärte ber Sragbalten
f. Safeln 17 u. 18.
SRufj man berfdjieben ftarte Salten in einer Strede
bertoenben, fo berlegt man bie ftärtften ale Sleiebalfen.
Sinb Sragbalten in ben erforberlidjen Stärten nicht
borhanben, fo berbohpelt man bie ©leiebalten unb
begrenzt bie SSagenffmr auf bem Selag burch Spm>
hölzerfo, bafjhauptfächlidj bie Sleiebalfen belaftet toerben.
298. ©ie Sragbalten berlegt man gleidjtaufenb
jur Srüdenlinie auf ben §olmen ftredenmeife abioedp
felnb ober- unb unterftrom fo, bafj fie ettoa 30 cm
^ßionierbienft
230
über bie §olme ober äußeren Mjnborbe übergreifen.
Stuf ®oppelpfahljod)en tann man jebotfj bie Xragbalfen
mit ihren ßnben sufammenftojjen laffen (ft u m p f
ftofeen) (Silb 324).
Saniljölser legt man hodjtant, Stunbhöl^er mit gopfc
unb Stammenben in jeher Strede abtoedjfelnb. SRunb*
folger ftatfjt man an ben SluflagefteHen ab.
®ifenbat)nfd)ienen ftöfet man ftumpf unb oerbinbet
fie burd) Safdjen. Sieben bie äußeren Schienen legt
man, um ben Selag aufnageln §u tönnen, §öl$er, bie
man mit ®raljt ober Nägeln auf ben §olmen befeftigt.
Sor bem ®inbau legt man bie Sragbalfen ftreden*
toeife (möglidjft ausgeglichen) bereit. Stärfenunter*
fdpiebe unb bie §öhenunterfd)iebe stoifdjen ßifenbahm
fdjienen unb hölzernen Sragbalfen befeitigt man burdj
Unterfuttern fdjtoadjer Sragbalfen ober ber ®ifenbahn*
fdjienen mit Srettftüden fo, bafj ber Selag auf allen
Sragbalten aufliegt.
®en erften SragbaWen einer neuen Strede hebt man
mit §ilfe eines 5Safferfahr§eugeS ober mit einer £am
fdjtaufe auf ben §olm. ®ie anberen Sragbalfen fcEnebr
man über ben erften Sragbalten Dor ober rollt fie auf
Balgen ober Stollen über bereits Verlegte auf ben §olm.
299. SragbaHen finb mit ben Stügen
nad) 233 ff. gu üerbinben, befonberS feft mit Soden,
(SdjtoeHiochen unb fdjtoimmenben Stützen, um biefe
gegen SluStoeidjen gu fidjern unb bie Srüde langS ju
üerfpannen. I^Eräger unb QStahle finb aufjerbem
burd) güHljölger, Sdjienennägel ober Sd)toeHen[d)rau-
ben gegen kanten gu fidjern.
300. ®en Selag legt man quer unb nagelt ihn mög*
lidjft burdjlaufenb auf ben Drtbalten feft (hoppelten
Selag nur in ber unteren Sage).
Sei SRangel an Srettern tann ber Selag auch
f djräg gelegt ober burch ©albbölger ober Stangen erfefet
Werben. Sutftehenbe Süden füllt man mit Slafen auS.
231
301. 2)urd) bie SRöbelung, beren JRöbelbalten feft auf
allen Selagbrettern aufliegen muffen, Ijält man ben
SBtlb 186.
©elänber.
Leinen-,
rahtbund oder Nägel
fange 10 cm^
Getänderstütze 12cm*
8
<
3
Selag feft unb begrenzt
bie fjatjrbaljn. gür 2*t»
nnb4’t’Srüden genügen
Saut» ober StunbEjoljer
bon 10—15 cm Stärte
ober Soljlen in Stärte
beS SragbelageS.
Dtöbelbalten berbinbet
man mit Sanbeifen,
©ratjt» oberSeinenbunben
(jjioei’ bis bierfad) ge»
nommen) mit ben Ort’
batten (in jeber Strede
je 3—5 Sunbe). töurct;
Seile jiet) t man bie Sunbe
feft (Silb 93 c). Sie Seile
Dürfen nidjt genagelt »erben, bamit man fie fpäter
nad)fd)lagen tann. SRöbelboIjlen bagegen nagelt man.
302. 2lls ßklänberftügen nimmt man bei Sodbrüden
bie überftetjenben ®nben ber Sodbeine. Sei Srüden
mit anberen Stufen nagelt ober fdjnürt man turje
Stangen als ®elänberftütjen an bie Stöbet» unb Ort’
halten, in Sännen aud) an ülufrüftungen an. 9ln ben
©elänberftütjen werben ©elänberftangen mit Sunben
ober Ulägeln befeftigt (Silb 186).
D. prüfen, Derftärften und Wieöer^erfteÜen
von Brüchen unö Brüdtenteilen.
prüfen oon Sriiden.
303. ®3 finb feftguftellen: £ r a g t r a f t unb
ettoaige burd) ben öegner berftedt ober offen ange»
braute ober borbereitete Sefdjäbigungen.
16*
232
304. prüfen ber Sragtraft:
SOcan unterfud)t ben SBau^uftanb unb errechnet über*
fdhläglidh bie Sragtraft ober ftellt fie au3 Bauplänen
ober burd) befragen Drßtunbiger feft. $n gtoeifeß^
fällen prüft man 93rüden burd) $robebelaften.
§ierju giept man ein gahrgeug oon entfpredhenbem
®etoid)t mehrmals f d) n e 11 über bie SBrüde herüber.
Sabei ift bei 93rüden au3 (Stein, SRauerwert, 93eton
ober ©ifenbeton barauf §u ad)ten, ob ficf) Dtiffe bilben.
Sie SBrüde ift ^iergu auch bon unten gu beobachten.
^Brüden, in bereu Fahrbahnen beim ^robebelaften ftär*
tere SRiffe auftreten, bürfen nidjt befahren toerben.
a) ^olgbrüdeu.
Sie Sragtraft ift bei §olgbrüden nad) Safeln 17—20
gu ermitteln.
@d)otterfal)rbal)nen finb fdjtoerer aß [oldje au3 §olg.
Sie Sragbalten einer foldjen 93rüde müffen baher
ftärter fein aß in ben Safeln 17—20 angegeben. Sie
guläffige ^Belüftung burd) bie 93erteE)r^Iaft ermittelt man
baburd), bafj man bie tatfädjlidje Stüßweite mit 1,25
berbielfadjt, 3. 93. 8 m Stü^weite X 1,25 = 10 m, unb
bann bie fo gewonnene ßaljl aß Stützweite für ben
Sabellengebrauch annimmt.
3n erfter £inie finb bie t r a g e n b c n Seile gu
prüfen. §oljteile bürfen nidjt angefault fein, liefern*
holg fault Don außen unb läßt baher gmulnß leicht er*
tennen; ®idhenl)olg fault jebod) oon innen, fo baß trotz
be3 äußerlid) gefunben ®inbrud3 ba3 §olg teiltoeife
jerftört fein tann.
Stodige ober faule ©teilen laffen fid) burd) Slnfchlagen
mit bem jammer ober Seitengewehr feftfteHen. Sie
geben bumpfen Stlang. ®efunbe3 §olg Hingt h^H. Wlan
überprüft anfdjeinenb fdhabhafte Stellen burch
fted)en mit einem -JReffer ober Seitengewehr. Sd)ab=
haftet §>olg ift weicher unb läßt fiel) baher leidster an*
unb einftedjen aß gefunben.
233
b) Staljb (6ifen=) »rüden.
Sei ftäljlernen Salden, beren Sragtraft nidjt be»
tannt ift, prüft man nur bie gaßtbaßnlängS» unb »quer»
träger. Sine Seredinung ber fpauptträger erübrigt
fid), ba bie Sragtraft biefer Sräger minbeftenS ebenfo
groß ift wie bie ber gaßrbaljnlängS» unb »querträger.
Srüden mit Sflafterung, 2lfpljaltbecten u. bgl., mie
fie in IA»Straßen unb in Stabten bie Siegel bilben,
tann man meift oljne toeitereS mit 16»t»galjrjjeugen
befahren. Sei Srüden mit einfachen Sdjotterbeden
ober Soljlenbelag, fotoeit fie nid)t in IA»Straßen ober
in Stabten liegen, ift prüfen ber gdtjrbaßnlängS» unb
»querträger notmenbig.
Sei Srüden mit Soßlenbelag mufj man außer»
bem bie Sragtraft beS SelageS burcf) Sergleidj mit ben
in ben Safeln 17—20 angegebenen Slbmeffungen feftfteüen.
fjür bie Unterfudjung unb Seredinung berfdjiebener
einfacher Srüdenformen bienen bie nadjfteljenben
Safeln a—d unb baS folgenbe Seifptel als Slnßalt.
Sie nad) ben Safeln a unb b auf ®runb gemeffener
Xrägerlängen unb Srägerabftänbe auftretenben Siege»
momente (Bifferntoerte für bie ®röße ber Safttoirtung)
(Mbot^.) müffen berglidjen toerben mit ben juläffigen
Siegemomenten (M3ui.), bie fid) nad) ben Safeln c
unb d für bie gemeßenen Srägerquerfdjnitte ergeben.
Sei biefem Sergleid) barf Mbor^. nidjt größer fein als
Mjul Sie f}af)rbaf)nläng§träger befteßen meift auS
I=Srägern, fo baß hierfür Safet c ju benutzen ift. Sie
Querträger bagegen finb ßäufig Sledjträger, toofür bie
in Safel d angegebenen überfdjlagStoerte ber juläffigen
Siegemomente in fjrage tommen.
Srunbfäßlid) bürfen bie fo geprüften Srüden nur in
langfamer ^aßrt unb nidjt in aufgefdjloffener Kolonne,
fonbern mit ^aßrseugabftänben bon je minbeftenS 25 m
Befahren toerben. Sie Eingaben für fpödjftlaften gelten
nidjt für Saueroedetjr.
234
Seifpiel.
©ine Kolonne bon 16=t=gaf)r3eugen foH über eine
SBIedjträgerljrücfe mit Sctjotterfaprbaljn nadj Silb 187
fahren.
1. ^atirbaljnlättgSträger:
.Qiotfdjenraum: 1,2 m.
Stüßmeite: 4,8 m (= SIbftanb ber Querträger bon»
einanber).
Querfdjnitt: I32 CErägerljölje = 32 cm).
2. galjrbaljnquerträger:
Stütjmeite: 3,6 m (= Slbftanb ber ipauptträger).
Duerträgerabftanb: 4,8 m.
®urtquerjd)ttitt:
,16*Q8cm
I — 16*0,8............
S 2U.7.5+7.5)*0ß ..
<= 13 cm*
= 24 cm2
37 cm*
täfel a. Biegemomente in §a^rba^nläng§trägem.
(Gültig für (Straßenbrücken mit ©djotterfa^rbafjn (bei
Bohlenbelag um 25% Heiner, bei ^flafterung ober 3lfpßalt
um 25% größer).
(Stüßtoeite (= 2lbftanb ber Querträger) Möot^ in mt bei £äng3träger$rtrifchenraum bon
1 m unb JRegellaft bon 1,5 m unb fRegellaft bon 2 m unb fRegellaft bon
8 t | 16 t 8 t | | 16 t 8 t | 16 t
«pöchftlaft bon Jpöchftlaft bon §öchftlaft bon
m 16 t 32 t 16 t 32 t 16 t 32 t
3 3,7 6,7 4 7 4,3 7,3
4 5,2 9,2 5,9 9,7 6,3 10,3
5 6,8 12 7,7 12,7 8,5 13,5
6 8,5 14,5 9,8 15,8 11 17
235
Safel b. ^iegentomente in §ahrbahnqnerträgern.
(Süttig für Gttraßenbrücfen mit (Sdjotterfaljrbaljn (bei
Bohlenbelag um 25% Heiner, bei ^flafterung, iMfpbjalt u. bgl.
um 25% größer).
(Sättig für einfpurigem Überfahren.
©tü|* meite (= 5tb- ftanb ber §aupt* Müor^ *n mt Cuerträgerabftanb Von
3 m unb fRegellaftüon 4 m unb SRegellaftvon 5 m unb 9tegellaftvon 6 m unb fRegellaftVon
8 t 16 t 8 t 16 t 8t | 16 t 8 t 16 t
träger) £>öd) ftlaft ®Ö<i) Haft ®ö(f)ftlaft §öd) Haft
m 16 t 32 t 16 t 32 t 16 t 32 t 16 t 32 t
3 5 8 5,5 8,5 6 9 7 10
4,5 10 16 11,5 17,5 13 19 14 20
6 16 25 19 28 21 30 24 33
7,5 23 35 27 39 31 43 35 47
täfel c. Snläffige Biegemomente (M3ui.) in mt für
tßrofilftahl.
Sräger- $ölje in cm Mjut. in mt für Sräger- Ijölje in cm Mgui. in mt für
I-Sräger IP» Sräger C»@ta$l T .. 1 I-Srager IP- Sräger O Statt
14 2,6 1 36 13 30
16 3 1,4 38 15 32
18 5,1 1,8 40 18 36
20 2,6 7,2 2,3 42,5 21 39
22 3,3 8,8 2,9 45 24,5 45
24 4,2 11,7 3,6 47,5 29 48
26 5,3 14 4,4 50 33 55
28 6,5 17,8 5,3 55 43,5 61
30 7,8 20,5 6,4 60 55 72
32 9,4 24,4 65 81
34 11 26
236
Safe! d. fiberfdjlagStoerte bet jnläffigen SBiegentontenie
(Mgur.) für QBIedjtriiger in mt
« E
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
MgltI in mt für 93Ied)fräger bei ©urtquerfdjnitt in cm1
10 |15 20 25 30 35 40 | 45 50 55 1 |70 80 90 100
3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12
3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18
4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 16,8 19 21 23,1 25,2
7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6 24 26,4 29 33,6 38,4
8,1 10,8 13,5 16,2 i 18,9 21,6 24,3 27 29,8 32,5 37,8 43
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 48
16,5 19,8 23 26,4 29,6 33 36,3 39,5 46,2 53
18 21,6 25,2 29 32,5 36 39,7 43 ! 50,5 58 65 72
21 25,2 29,4 33,6 37,8 42 46,2 50,5 59 67 76 84
24 29 j 33,6 38,31 43,2 48 53 i 58 67 77 86 96
32,3 , 37,8 43,2^ 48,5 54 59 | 65 75 86 97 108
36 |42 | 48 |54 60 66 i 72 I 84 96 108 120
oder mehreren Gurtplatten- bet geschweißten
Trägem nur aus durtplatfen.
SBilb 187.
£nerfdjnitt einer QBIedjträgerbrüde.
237
Vergleich mit ben Safelwerten:
1. fJahrbaljnlängSträger. 9?adj Safel a:
für Stüfjtoeite 5 m (anftatt 4,8 m), für Sräger»
jttnfdjenraum 1,5 m (anftatt 1,2 m) unb für 16=t=
Stegellaft: MbOri>. = 12,7 mt. Sem gegenüber er»
gibt Safet c für l32 M3Ul. = 9,4 mt. Sa
Mbor$. größer ift al§ M3Ui., bürfen ICj^^a^rjeuge
nur einzeln al§ § ö d) ft l a ft überfahren, toofür
in Safel a ein Mbott>. bon 7,7 mt angegeben ift.
2. gahrbaljnquerträger. 9ladj Safel b: für
Stütjtoeite 4,5 m (anftatt 3,6 m), für Querträger»
abftanb 5 m (anftatt 4,8 m) unb für 16=t=3iegellaft:
Mtotij. = 19 mt. Safel d ergibt für Srägertjölje
0,40 m unb für 35 em2 (anftatt 37 cm2) ©urtquei»
fdfnitt M3ut. = 16,81. 2ludj ber Querträger trägt
nur 16»t»$al)räeuge einzeln al§ § ö dj ft l a ft,
toofür in Safel b M’t>or5-= 13 mt angegeben ift.
® r g e b n i § : Sie Kolonne tann bie Srüde in lang»
fatner tJaljrt mit gdhrjeugabftänben bon je 25 m al§
Jpödjftlaft befahren.
c) SSogenbrüden au§ Stein ober Seton ohne Gifen»
einlagen mit Stühtoeiten über 8 m tann man im aKge=
meinen mit Saften bi§ 16 t befahren, toenn ihr bau»
lieber Suftanb eintoanbfrei befunben toirb.
©etoölbte Srüden mit einer Stütjtoeite unter 8 m,
bie nidht im 3uge bon Jgauptftrajjen liegen, haben oft
geringere Sragtraft al§ 161. SDian tann ihre Srag»
traft burdh llnterftütjen be§ <Sd)eiteI§, <j. 93. burdj
(SdjtoeHiodje, erhöhen.
d) Gifenbetonbrütfen.
Sei Gifenbetonbrüden toirb im allgemeinen bie Srag»
traft ber Jpauptträger bi§ ju 16»t»Saften genügen,
toährenb bie gahrbahnplatte biefen Slnforberungen oft
nicEjt entfpridjt. Scan mufe baher foldje Srüden burd)
Srobebelaftung nad) 304 2lbf. 1 prüfen.
238
305* prüfen auf Seftfjäbigungen,
©er Segner fann SSrüden befthäbigenoberan
ihnen 53efd)äbigungen borbereiten burd)
Einfügen ober Einbohren tragenber ©eile, befonberS
ber Stü^en — fefter (Stützen aud) unter Söaffer —
ober Einbringen berftedter Sprenglabungen.
55efd)äbigte fefte Stützen unb ©ragbalfen finb $u ber*
ftärfen ober §u erfeüen, befdjäbigte fd^toimmenbe Stützen
ou bitten ober §u erfe^en.
306. ginbet man 3ünbleitungen,fo finbbiefe,
33. burd) Berfdjneiben, §u unterbrechen.
Sprenglabungen entfernt man erft bann,
wenn man bie Bünbungen perau^genommen hat
53erftärfen unb SBieberljerfteKen nun Srütfen unb
Sörütfentetlen.
307. SD?an uerftärtt nicfjt genügenb tragtraftige
Srüdenteile burdj fein*
bau neuer Stüfeen, ge*
gebenenf aH3 a!3 Btoif djen*
ftufeen, nad) SBilb 188,
äum 53erfür^en ber
Stü^toeiten.
©er überbau fann
burd) SSerboppeln ber
Slei^balfen ober Ein*
bringen bon Unterjügen
(S3ilb 189), burd) 53er*
boppeln be3 53elage3 ober
Slufnageln bon ®lete*
bohlen in ber SSrüden*
ridjtung unter SSegren*
§en ber SBagenfpur ber*
ftärft ober burd) Etuf*
bringen bon llferbrüden, befonber^ au3 ^rofilftahl, auf
tur$e 53rüden and) für ffraftfahrseuge tragträftig ge=
mad)t toerben (549).
53ilb 188.
Stoifdjeuftü^e bei 4 = t = Drütte
(3 m Stü^Weite).
239
308. (Srfegen oou Zeilen fefter Stütjen einer §olj=
brülle ift oft fdjroierig unb jeitraubenb. Einbau eines
neuen SßfahlfocheS burd» Stammen bon ber aufgebedten
SSrücfenbatjn auS ober Sluffetjen eines «SchioeHjocheS auf
bie noch brauchbaren «Stümpfe eines ^fahljodjeS führt
meift fchneHer jum Biel.
SluSbeffern ange»
fügtet pfähle burch
angenagelte Saften
ober SBerftärten ber
Serfdhtoertungen, fer»
SBilb 189.
llnterjug.
Belag Rödelbalten
ner Siebten ange*
boljrter ©ä^ne ober 1 Traabalken
2BagenfäI)ren ift ein
93ef)elf, ber nur bei
Dorübergeljenbem 33e^
nutzen einer 33rücfe ober Sßagenfäljre antoenbbar ift
309, ßodere Serbänbe legt man burd) ßafdjen, Sanb*
eifen, ©naggen ober Sraljtbunbe feft.
310. Sor SBieberJjerfteKen jerftörter Srürfen unter
SluSnutjen ftel)engebliebener Srüdenteile ift §u ertoägen,
ob nicEjt 'ein Neubau an anberer Stelle toeniger 3e^
erforbert, befonberS toenn bie galjrbaljn ber ^erftörten
Srüde Ijod) liegt.
Sei ber Serfdjieben^eit ber Srüden unb ber $er*
ftörungen fönnen für baS Sßieberljerftellen nur 21nf)alte
gegeben werben.
a) ^ol^briiden fteHt man nad) 308 u. 309 toieber tjer.
b) Sei gefprengten <5tein= ober Sta^Ibrüden fann man
Stege unb 2=t-Srüden (Silb 190) aud) a u f
bie Spreu gtrümmer bauen, ^laä) 2luf *
räumen ber lofen Sprengtriimmer muffen für
Sodbeine unb Sdjtoellen burd) untereinanber Der-
bunbene DuerfdjtoeHen fefte Auflager gefdjaffen
toerben.
240
gefte Sage ber al§ Unterbau auSjunutjeubeu
gefprengtcn Sräger audj bet 39elaftung unb fefte§
iöerjdjtuerten unb SBerftreben ber eingebauten
Stützen (Söde ober ©djioettjotfie) finb tt)ict)tig.
SBHb 190.
WitSnititen eine? gefbrengten lyatfjfoerlitägetS jum ®au
eine§ «Steges.
---------------------30 m----------
r---------------------------------77 m-------------
SBefeitigen größerer krümmer gesprengter Stapt
Prüden ift fcEjtnierig, oft and) ^toedtoibrig, ba grofje
krümmer fid) gutoeilen für einen SBrüdenneubau
au^nupen taffen.
c) (Gefprengte Pfeiler tann man burd) SBöde ober
Scptoelliocpe, bie nadj b) feft qegrünbet fein
müffen, erfepen.
d) Sdjrotmmenbe Stiipen, unter ümftanben mit auf=
gefegten ScptoeHjocpen, tann man bei ettoa gleidj-
bleibenbem SBafferftanb einbauen, toenn bie
Sprengtrümmer fo tief liegen, bafj aucp belaftete
®äpne fid)er fcptoimmen.
Scptoimmenbe Stüpen müffen in ber £äng§- unb
Duerricptung §ur SBrüdenadjfe feftgelegt toerben.
31L über gefprengte Uferbrüden, gefprengte
SBrüden mit turnen Stü^toeiten ober tur§e Spreng^
lüden in SBrüdenbeden ftellt man Übergänge für
® r af t f ap r 5 e u g e unb $r a f t r ab f ä) ü§ en
nad) 549 per. gür Sdjü^en genügen audj Stege.
241
IV. Wegebau, Überwinben von
Sumpfs unb {Ericfytergelänbe, Ifets
richten von(Etfenbaiinbvudten, Durchs
fdjreiten von $urten, Überfdjreiten
von (Eisbedten.
A. Wegebau.
312. (Soweit e3 bie Sage §ulägt, muffen b o r fj an>
bene ^Jiarfdjftraften unb SBege ertunbet toerben, toenn
Btoeifel an ihrem Verlauf ober ihrer 23raucf)6arteit
befielen.
SBege querfelbein — SBeljelfSwege — müffen faft
immer ertunbet toerben.
313. Surch ßrtunben ftellt man feft: Sßegbreite,
®efd)'affenf)eit ber gafjrbatjn, Einfluß ber Witterung
auf bie gahrbahn, Steigungen, Krümmungen, nötige
53efferungen, Sragtraft unb gahrbahnbreite oon
SSrütfen (304 unb Safeln 17—20), (Sangbarteit unb
SBreitc üon gurten, Sragtraft oon EiSbecten, Sarnung
be3 2Bege3 gegen feinblidje Suft- unb Erbfidjt, 2lrt unb
Umfang etwaiger feinblidjer Sperrungen (bgl.
£.®0. 300 [275]).
®urd) Sefdjaffen oon Karten großen DJJafjftabeS unb
Slu^tünften oon Sehörben ober Ört^tunbigen tann
man ba3 Ertunben erleichtern ober ergänzen.
314. SBegbreiten:
E§ benötigen minbeften^:
a) 9Jtar{d)toIonnen aller
SSaffen, motorifierte
•®?arfd)tolonnen ober
Staffeln
3 m
242
b) TOarfd) öon W^arfcf)»
tolonnen ufto. ju a) in
beiben Stiftungen
c) Infanterie in ©oppel«
reifte mit ®efedjt§faSr»
zeugen
$?aüaßerie mit pferbebe»
Rannten ®efedjt§faljr»
Sengen
pferbebefpannte 2Irtiße=
rie
d) Infanterie in Steilje oftne '
Weiter unb gaftrseuge,
Stab fairer unb straft»
rabfdjüften einzeln
Sfraftrabfdjüften einzeln )
mit SBeimagen J
Steiter in Weiterreise
6 m ober 3 m mit SIu§»
weidjfteßen, biefe 6 m
2m
0,80 m
1,50 m
0,80—1,00 m.
315. SBefdjaffenIjeit ber galjrbaljn:
©ie gafjrbaSn ber IA=Strafjen ift fo breit unb feft,
baft fie and) für längere SSeanfprudjung burdj niajt
motorifierte unb motorifierte Wtarfftolonnen aller
SBaffen genügt.
Sie gaSrbafmen ber IB=Straften unb ber IIA»
SBege finb etwa 4 m breit, jutneilen breiter, jebod)
weniger befeftigt al§ IA»Straften.
I Betragen finb für SRarfdjfolonnen aßer Sßaffen,
für Sßerfonentraftwagen unb gelänbegängige ^raftfaSr»
jeuge brauchbar; für fonftige ^raftfaSrjeuge in größerer
galjl ober bei ©aueroerfei)r nur, toenn bie gaJjrbafjn
auf einer feften Steinpadlage ruf)t.
II A=2Bege, bereu gafjrbaljn au§ Sdjotter ober Stein
befielt, finb für ftraftfaprjeuge unter 10 t Sefamt«
getDicEjt wie I Bestraften benutzbar.
243
Anbere IIA« unb IIB=2Bege finb int allgemeinen
ettoa 3 m breit. $Ijre gahrbahn ift enttoeber mit Behm
ober einer bünnen Schicht auS Sdjotter, ®teinfcf)Iag
ober Schlade befeftigt ober ruht — fo in gebirgigem
(Selänbe — auf natürlichem feften Soben. SBege auf
felfigem Soben finb bei genügenber Sreite Don nicEjt
motorifierten unb motorisierten 9Jtarfd)toIonnen aller
SBaffen bei jebem SBetter — Schnee unb ®lätte aus-
genommen — benu^bar. Dagegen finb bie befeftigten
IIA- unb HB-SBege im allgemeinen nur Dorüber*
g e h e n b unb bei trotfener SB i 11 e r u n g für
3Jlarfd)folonnen aller SBaffen, jebod) nur mit pferbe-
bekannten Fahrzeugen unb einzelnen Kraftfahrzeugen,
brauchbar. 33ei ftarfer Seanfprudjung toerben folcfje
SBege fthneU ^erfahren, bei Stegen halb grunbloS.
5elb= unb 28albroege, ferner SehelfStoege
ohne fefte Fahrbahn tönnen bei genügenber Sreite
Dorübergehenb oou Sruppen aller SBaffen, jebod)
nur mit pferbebefpannten Fahrzeugen unb einzelnen
Kraftfahrzeugen, benufet toerben, toenn ber Soben nicEjt
Zu fanbig ober zu fdjtoer, b. h- Zu lehmig ober zu ton*
haltig ift
316. 21IS Steigungen finb guläffig (1:20 = auf
20m SBegftrede Im §öhenunterfd)ieb):
:ür Wlarfdjfolonnen aller SBaffen
ür motorifierte -JRarfchtolonnen
ür Heinere Qiifanterie^, Kaüalle*
rie* ober 2lrtiHerie*Serbänbe in
äftarfd)orbnung
für gelänbegängige Kraftfahr-
zeuge
für gelänbegängige Kraftfahr=
Zeuge mit Setten
für Gruppen auf Srafträbern
1 :20
1 : für längere
* SBegftreden,
1 :12
für furze
SBegftreden.
244
SBegtrümmungen müffen für bie ©raftfa^r*
$euge miubeften^ 30 m, für pferbebefpannte guljrjeuge
minbefteng 10 m £>albmeffer jjaben, gemeffen bon ber
SSegmitte. ” f
SSegeunterfüfjrungen müffen für 93erteljr
mit £afttraftmagen minbeften^ 3,20 m breit unb
fein. $ür ©raftomnibuffe unb Jpeere^fonberfaljrseuge
tönnen Durdjfaljrten bon 3,60 m Sreite unb 4,00 m
§öf)e erforberlid) fein.
317. Reibungen über nötige Sefferungen fallen ent*
fjalten: Ort, 2lrt unb Umfang ber Sauten, Slrt, Sftenge
unb gunbort bon Sauftoffen, SSerf^eug unb ®erät,
$aljl unb 2lrt ber görbermittel, nötige ©räfte unb Seit.
318. 2)lan beffert SSege §unäd)ft baburd), baft man
für Stafferabflufj forgt.
§ier$u öie^t man Seitengräben ober räumt borljan-
bene auf unb bertieft fie, gibt iljnen genügenbe^ (SefäUe
unb leitet ba3 SSaffer in anbere ®räben, Siderfdjädjte
ober tiefer Iiegenbe3 ©elänbe ab. Sorljanbene Sßaffer*
burdjläfje fäubert man bon Sdjlamm.
Durd; Siderfdjli^e, bie mit burdjläffigen Sauftoffen
(©ie3, Sdjotter) §u füllen finb, füljrt man ba3 SBaffer
bon ber Strafjenbede in bie Seitengräben.
319. 2lu3gefaljrene £ ö d) e r (Sdjlaglödjer) unb
® I e i f e finb au^uräumen, burd) binnen §u
enttoäffern unb burd) Steine ober ©ie3 au^ufüüen, bie
man feftftampft. 2lfö oberfte Scljidjt bertoenbet man
möglidjft .ben gleichen Sauftoff toie ben ber ga^rba^n.
®ie Dberflädje fdjrägt man nadj ben Seitengräben
gu ab.
320. ©ur§e aufgeriffene Stellen in feften
galjrbaljnen unb tur§e ft art fanbige ober
fumpfige Stellen in nidjt befeftigten
galjrbaljnen ebnet man. Dann legt man Steine
ober 91unbl)ol($f[after (Silb 191) ober groben Sdjotter
aW ^adlage ober Sollen, Sdjtoeßen ober Salten (321)
245
SBilb 191.
^flafter aus !Hunb=
VWden
(S'oijdjenräume
tcerben mit Sanb
auSgefüIlt).
in ben Soben, ßebecft bie ißadlagen mit Ü?ie§ ober
grobem Sanb unb ftampft ober tDaljt fie feft.
321. über längere ft art fanbige ober
fumpfige Stellen in Fahrbahnen baut
man Sohlen«, S^nteHen« ober Saitenbahnen wie über«
bauten üon Schelfernden. ®§ genügen jebodj
fdjtuäcfjere Sragbalten unb Slägel al§ Sinbemittel. 2)er
Sorbau geht ftfjnelt, toenn genügenb Sollen ufto. üor«
Ijanben finb ober in nahegelegenen Sägeioerten ge»
fdjnitten toerben tonnen.
Sohlen«, Schnellen« unb Saitenbahnen genügen für
alle 9Jiarfa)toIonnen.
322. gn fonft fd)tuer ju enttoäffernbe SBegeftreden
baut man Snüppelbämme (Silb 192) ein, ba fie toaffer»
S3ilb 192. finüppelbamm.
VSm
100-^00-
m
3,00-&,00 m-
*1,00-2,00^1,75m
m
Rödelung durch
Bandeisen
0,50 m
Knüppel 15-20 cm 4
burcljläffig finb. Sie tonnen üon allen bis» 81 fcfjtoeren
gahrjeugen befahren toerben, bebürfen jebocf) ftänbig
ber 2lu§befferung. Wlan üertoenbet, um Codern ber
ftnüppellagen burd; Stöße ber Stöber ju oermeiben,
finüjtjtel üon möglidjft gleicher Stärte.
VonicrtteHft (7
246
Sen ffnüppelbamm tann man burd) eine ©ie§» ober
Sanbfdjidjt, in bie man bie Jpöljer cinbettet, ober burdj
eine bünne Straudjpadung, bie man mit ßicS ober
Sanb bebedt, berftärten.
©ine fdjtoerere 23auart geigt S8ilb 193.
SBilb 193. Stnüppelbantm, fdjtoerere SSattatt.
22 cm*
323. 23efjelf§toege, bie nur b o r ü b e r •
0 e f) e n b benutzt toerben, ebnet man fo toeit toie nötig.
Stäuber trodener ober naffer Stäben, mit Sßaffer»
tiefe unter 0,30 m, aber feftem llntergrunb, fladjt man
ab unb füllt, toenn nötig, bie Sräben mit Erbe,
Steinen ober tpolj au§. Singefüüte Srbe ftampft man
feft unb bebedt fie mit Steinen ober Sollen, bie man
toie eine 23rüdenbat)n feftlegt.
SBreite, tiefe ober fumpfige Sräben übcrbrüdt man.
324. 23egelf§toegen über toeidjen (fan-
b i g e n ober f e u dj t e n) 23 o b e n, bie ftart bon $at)i -
jeugen bi§ 8 t Setoidjt benutzt toerben fallen, gibt man
eine fefte gatjrbatjn nad) 320 ober 321.
23el)elf§toege über Sumpf (nur für ga^rjeuge
bi§ 41 Setoidjt) befeftigt man burd) 23au bon ©nüppel*
bämmen nadj 322 ober burd) 23rüdenbaijnen mit über«
bau toie für 4»t»23rüden, jebod) finb bie §olme auf in
ber ^atjrtridjtung berlegten 23rettern ober langen unb
breiten Straudjbunben ju befeftigen. Unterfuttern ber
Sragbalten in ätjnlidjer gorm tann jtoedmäfjig fein.
247
SBenig tiefen Sumpf überbrüdt man and) mit
Sßfat)IiocF)ßrücfen. Stur auf folgen Srüden tönnen
4—81 fernere fjatjrgeuge Sumpf überminben.
58ilb 194. sRunb^oUW-
Sei feljr tiefem Sumpf ift in tmlbreidjer ®egenb Sau
einer munbljolgbaljn nadj Silb 194 gmedmäßig. Sie
trägt jebodj nur gatjrgeuge bi§ 41 ®ett)id)t.
Silb 195. Soljlenbaljn.
3,50 m
ScljelfSmege über Sumpf für Infanterie unb Sabal*
lerie mit galjrgeugen bi§ gu 2 t ®eibidjt befeftigt man
mit Sollen», Salten* ober Sdjmelienbatjnen nadj
321 unb Silb 195 ober burd) Snüppelbämme, ober man
baut Sretter* unb gafdjinenbaljnen nadj Silb 196.
17*
248
5Brettet= unb 5afdjinent>a(jtt
für dteiter unb einzelne
leidjte gabrjeuge.
I- k50m
RöaelbKtt
Sn [eljr meinem Soben ift eine Sauart nach Silb 197
Ztoedmäfjig (Selag unb Stöbelung toie bei 2=t=SehelfS»
Brüden). Kanthölzer als
STragbalten legt man auf
QuerBalfen (Jpolmen) feft,
bamit bie ©ragBalfen nicht
umfanten ober fid) ber«
fdjieben.
Sine Sefeftigung burd)
Safdjtnenbämme (Silb 198)
genügt nur für borüBer*
geljenbe Seanfprudjung. fja»
feinen fertigt man in
4—6 m Sänge nad; 111 u.
Silb 73 an. 2Uan legt fie in
ein Bi§ jtoei Sagen, bie oBere
redjttointlig jur SBegeadjfe,
bidjt nebeneinanber unb jur
gleichmäßigen Serteilung
ber Saft in möglidjft Breiter
Sahn auf ben Soben, füllt gtoifdjenräume mit Sanb,
Kies, Knüppeln ober <5traudjtoert auS unb Bebedt bie
SaljrBaljn mit einer ettoa 10 cm ftarlen Sdfi^t Kte3
ober ®anb. ^Z4Azr
Stljnlidj bertoenbet man Straudjpadungen.
Stifter üBerBrüdt man für Steifer unb gabrzeuge
Bis 2t Setoidjt mit faljrbaren SrtnftfTnädj Silb 199
ober 199 aoii£i^ttrdr1Iferbrüden (276, 297—302), für
fdjtoerere ^aljrzeuge mit Uferbrüden aud) nadj 549.
325. ©urcf) SJälber mit feftem Unterholz
bahnt man SBege burd) 2lBfd)lagen beS Unterholzes.
Sei SBegen, bie bon KabaKerie ober pferbeBefpannten
fjaljrjeugen Benutzt toerben foHen, ift baS Unterholz
toaageredjt b i d> t üBer bem Soben abzufdjlagen ober
aBjufägen, um Verlegungen ber Sf^behufe borju»
beugen.
249
Schnitt A-ß
S3tlb 198. Sajtfjinenbantm.
ftilb 199. galjr&are 2=t=$rü(!e gum ftberWinben bon tristem.
250
23HÖ 199 a.
Breite, fahrbare 2 = t = Prüfte jnnt fifcertoinben bon Stiftern.
Sie 93rucfe liegt aulammengeHabpt auf einer Slcfife. S^m Einbau gtefct
man 3tab a bon ber Slcbfe ab, fcbiebt bie 53rücfe über ben Sri ct) ter ober
®raben unb Happt ben oben liegenben Seil auf.
® d> m a I e 2ß e g e an gelängen ücrbreitcrt man
burd) 2luffe|en öon Xrodenmauertoert an ben Rängen
nad) Söilb 200 ober burdj Sau üon Srüden nad;
Silb 201.
251
Silb 200.
Bwtonnauetweit am gelang.
Silb 201.
Stüde am gelS^ang.
a- Steine
b* Baumstämme
9luf [teilen SBegen baut man 9t a ft e n nad) Silb 202
ein, bie §al)r$eugen unb $ferben £>alt geben, ©ie
9taften führt man fdjräg jur SBegadjfe, um Sßaffer
abjuleiten.
326. Sin SSegen, bie lange benu|t merben [ollen,
errichtet man SBegroeifer, bie man na<f)t§ unter Silb*
blenben gegen geinbficfjt (auch au§ ber ßuft) beleuchtet.
ßum Soejeidjnen »orübergeljenb 31t benutjenber
©ege genügen farbige harten, toetfjeä S9anb, Slnlafdjen
bon Säumen ober fetjTOadj leuctjtenbe Sampen.
252
SBei 3lebel mufj man Diele SRarten auffteHen, bei
Sdjnee 6etoäf)ren fid) angetotjlte ißfaljle ober Strolj»
ttnfdje auf Ijoljen Stangen.
®urdj 9lidjtpoften tann man bie SRarten ergänzen.
Sfreujenbe Sßfabe, SBege, SBagenfpuren, bie irreffi^ren
tonnen, [djliefjt man burdj £äune ober ©räben ab.
B. Überwtnben non Sumpf« unb ITridjter»
gelänbe burdj Sdjütjen unb leidjte panjer»
wagen.
327. a) Sumpf unb ftart berfumbfteS Sridjter»
gelänbe überfdjreiten Sdjiigen, Rabfagrei unb Kraft»
rabfdjügen auf quer berlegtem Straucljmert, SRoljr ober
' Q c @afd)inenfteg aber Sumpf.
Sdjilf, SDHnbeftbreite 1 m, ober auf Unterlagen nadj
Silb 203—207.
3e ioeidjer ber Soben, befto breiter muffen bie
Unterlagen, befto gaijlreidjer bie Stützen für bie Unter»
lagen fein.
253
Silb 204. Silb 205.
Stettetfieg übet Sumbf. ®?af(f)enbraf)t= unb Stoff=
Silb 206. Stofffteg über Sitmbf.
-----1,50m-----------**
»ilb 207. Seppidjfteö übet Sumpf.
Thjgeknüppel
254
Sft «Sumpf fo überflutet, baft rridjt übergefefct toerben
tann, fo baut man «Stege nadj Silb 208.
ȟb 208.
Steg über überfluteten
Sumpf.
3[25cm
x Schnitt A -8|
3,00 m *
®rofje unb tiefe Stifter überbrüdt man mit
U.ferfcfjnellftegen (246)4^ 'Mt.z* , -f ö
Seidjte $anjerroagen überwinben Snmöf» >J, £
auf Sretter» ober ftnüppelteppidjen (Silb 141), bie
man gufammengeroltt bis an ben SRanb beS
Sumpfes »erbringt unb fobann als fjafjrbaljn au3>
rollt;
auf langen gafc^tnen ober Straudjbünbeln, bie
man bidjt »oreinanber »erlegt;
auf Sofjlentafeln, bie man auf fjafdjinen ober
langen unb breiten Salten nadj Slrt ber Ufer»
brüifen für ®raftfa§rjeuge (549) »erlegt.
über grofje unb tiefe Sndjter baut man Ufer»
brüden nad) 549 ober überbrüdt fie mit fafjr»
baren Srüden, etwa nad) Silb 199 a.
G Ijerrtcfyten von (Eifenbatynbrüdten
311m Übergang.
328. Gijenbaljnbrüden finb für fju&truppen unb »ieb
fadj audj für Straftfaljräeuge mit wetten offne meitereS
guganglidj unb oft aud) gangbar, güt fßferbe unb
255
graljrjeuge mufj man oft Lampert ju ben S9rücfen=
jugättgen unb 33rücfenBa^nen tjerfteden.
Süd SSatjnbetriel) möglich bleiben, ift ber SSelag burdj
Hufnägeln öon Querbrettern auf SangSbofjlen nad)
23ntter3ß/25 an
Bohlen8/25 cm
Silb 209.
©ifenbatynbrütfe, für §a^=
~7 gET jeugberfetyr tyergerictytet, bei
/ aitfrettytertyattenem Satyn®
betrieb.
Silb 209 bi§ jur Dberfante ber (Schienen unter Se*
laffen bc3 nötigen ®piclraum§ für bie 9labfrän$e ber
Sifenbafjntoagen $u ertyötyen. Sertoenben üon
Sctytocllcn beftf)Ieunigt bie SIrbeit.
____________ ________________ Silb 210.
VfjM T " " J/m T riJ/ ©ifenbatynbrütfe, für Satyr®
jeugbertetyr tyergerittytet, bei
---------------- rittyenbem Satynbetrieb.
SRutyt ber Satynbetrieb, fo fann man nad) Segen bon
Drt® unb SOlittelbalten einen Querbelag aufbringen. ®ie
überlaute ber Sragbalten fetyneibet mit Sctyienenober®
tante ab, bamit aucty bie <Sd)ienen ben 33elag tragen
(S3ilb 210).
©ifenbaljnftrectcn fann man auf biefelbe SBeife al§
SBege tyerrictyten.
D. Durd)fd)retten von gurten*).
329. ®ie Sage bon gurten erfennt man an SBagen^,
Stab® ober Jpuffpuren, bie an ba3 ©etoäffer auf beiben
Ufern tyeranfütyren. Slucty harten in großem QÄafeftab
*) ®i(tyertyeit§beftimmungen für ba3 SDurdffctyreiten von
gurten im grieben f. 503.
256
unb AuStünfte »on SanbeSeinmohnern Tonnen Anhalte
geben, ßrtunbcn ber genauen Sage, ©reite, Sßaflfer»
tiefe, Strorngcfchminbigteit unb beS UntergrunbeS ift
immer nötig, gieren ift bie gurt zu burdjtoaten ober
ju burifjrctten. Schließt fidj ber Übergang nicht un«
mittelbar an baS Erlunben an, fo ift ber SBafferftanb,
3.33. burcf) ©egel, bauernb ju beobachten.
330. Sie SBaffertiefe barf bei feftem Untergrunb
ib f d) m a cf) e m Strom betragen für:
gufjtruppen.............................1,00 m
©erittene...............................1,30 m
Artillerie unb fcfjmere SBaffen ber gn»
fanterie...............................0,60 m
gahrzeuge, beren Sabung gegen SBaffer
unempfinblicf) ift.................1,30 m
Kraftfahrzeuge..........................0,30 m
gepanzerte Kampffahrzeuge mit betten
bis.................................0,70 m.
Einzelne ©efdjüfce Tann man an Sauen auch burch
tieferes SBaffer (über 0,60 m) ziehen, toährenb bie
©fetbe fdjmimmen. Hm Aufmühlen beS UntergrunbeS
Zu bermeiben, tann eS notmenbig fein, Kraftfahrzeuge
Dom Ufer her burch bie gurt zu ziehen.
331. ©erlauf unb ©reite ieber gurt ift burch
Stangen ober Seinen, nachts auch burch Satemen, bie
man gegen geinbficht (auch ®uS ber Suft) abblenbet, zu
bezeichnen.
332. ® r 0 fj e Steine in gurten müffen befeitigt,
S ö ch e r mit grobem KieS auSgefüHt toerben.
333. gür gufjtruppen fpannt man in ftrömenbem
©emäffer oberftrom ber gurt ^altetaue.
334. © e i m e i <h e m ® r u n b läßt man zuerft gufj»
truppen, bann ©ferbe unb galjrzeuge übergehen.
^^4). 33 257
E. Ü&erfdjretten von Gisbedten.
335. ©ie ©ragtrcft oon Eiöbeden fann mannad)
ber Stärte be§ ®ife§ beftimmen, falls bie EiSbede niajt
Ml liegt (Sintert be§ ©tafferfpiegelS unter bem Ei§)
ober morfdj ift. fJefteS, auf bem Sßaffer liegenbeS Ei§
trägt in ber Siegel in Stärte non:
4cm: einzelne fieute mit minbeftenS 8m 216»
ftanb,- /
12 cm: Infanterie in geöffneter Drbnung, ein»
Seine Seute mit ettoa 4 m 2lbftanb,
15 cm: Infanterie unb ffiaöaHerie (ofjne fjaijr»
jeuge) in SKarfdjorbnung,
20 cm: §al)rjeuge bi§ ettoa 3,5 t ®etoidjt,
30 cm: ga^rjeuge bis ettoa 5 t Setoidft,
100 cm: galjrjeuge bis ettoa 8 t ©etoidjt.
Sd)toädjere EiSbeden nratfjt man äbnlidj toie
Sumpf burcf) ©ergrößern ber ©rudfläcbe tragträftig
(321 ff.). /
©Benn erforberlid), baut man ©rüden, fpierju ift
baS EiS, fotoeit nötig, ju befeitigen.
EiSbeden tragen auf fte^enben ©etoäffern größere Saft
als auf fließenben. Qm gleidjen ©etoäffer tann bie
EiSbede betrieben ftart fein, toenn »arme Duellen
borljanben finb ober ber fyiußgrunb an einzelnen
Stellen moorig ift.
S dj n e e auf ber EiSbede öerringert bie Stärte,
weil baS auffteigenbe, »ärmere ©runbmaffer fidj nicßt
abtü^len tann.
©autoetter feßt bie ©ragtraft be§ ®ife§ fdjneU
Ijerab, aucf) wenn bie Stärte nodj nic^t abgenommen
§at.
©ei fjroft tann bie EiSbede burd) häufiges übergießen
mit ©taffer tragfä^iger gemadgt toerben. Sblauf
beS SBafferS ift burd) niebrige SßäUe au§ Sdjnee, Sanb,
©ung ober Strol) ju ber^inb ern.
258
Sprünge in ber ®i3bede, bie oft mit lautem Sradjen
entfteljen, finb eine golge bet fffiärmeftf)tt>antung£n be3
®ife§ unb minbern bie Xragtraft meift nidjt.
fßferbe finb einzeln ju führen, unter ga^rjeuge
binbet man breite Stufen.
336. ©er S8eg ift wie für ©urd)fd)reiten üon gurten
ju bejeid)nen (331) unb mit Sanb, ®rbe, ©ung
ober Strol) ju beftreuen.
V. $elbbefeftigung.
A. (Brunöfätje.
(58gl. £>. ©ü. 300 Slbf^nitt VHI.)
337. gelbbefeftigung erlfötjt bie eigene, üerminbert
bie feinölidje 9Baffenioirfung unb erhält bie eigene
Sampftraft.
Spr Stufen ift um fo gröfjer, je länger fie unertannt
bleibt.
338. 2lÜe planmäßig auSjufü^rcnben gelbbefefti»
gungSanlagen finb baijer üor beginn unb iüäfjrenb ber
SuSfütjrung ju tarnen.
Arbeiten unter ©arnfd)ut? ift fdjtoierig unb toftet
geit. 5Rad)t§ ober bei 9tebel arbeitet man baijer oft
fdjnelier al§ bei Sage unb Harem SBetter unter ©am»
fd)ut$. S3i§ jur Scorgenbämmerung ober bi§ jum Sluf»
Haren muf; bann aber bie ©arnung üoKenbet ober
Sfarnfctjutj IjergefteHt fein.
339. Xarnen ber Einlagen erleid^tcrt man burd)
Slnpaffen an ®elänbeformen unb ©elänbebebedungen,
aud) ber ^arbe nad). gür alle Einlagen finb alfo üor»
panbene fötulben, £öd)er, ®raben unb jegliche ©oben»
ben>ad)fung auSjunufeen. Santen unb SBöfdjungen finb
abjurunben unb ju tarnen.
259
SlUe gleichmäßigen formen unb fiinien finb ju ber=
meiben, foroeit bie ©elänbegeftaltung fie nid)t »orfdjreibt
(tjelbraine, Slderfurdjen).
ffle jum Sarnen berroenbetcn Wtittel (bgl.
©b. 268) müffen fidj bem umgebenbcn öelänbe an»
paffen.
§m offenen ©elänbe, in bem Sbcrfteüen unb Erhalten
ber Sarnung fcEjroierig ift, unb in nur fdjtoad) be»
festen Stettungen täuftf)t man ben ®egner burdj
Scheinanlagen (369—372).
Sft 3eit unb ®elegenf)eit borhanben, fo prüft man
bie getroffenen Sarnmafjnaljmen bon ber geinbfeite au§
unb au§ ber Suft ober bon Ijötjer gelegenen $unt»
ten her.
340. §ür alle Stampfanlagen gilt ber ©runbfaß:
SBirtung geht bor ® e d u n g.
Sie Sßirtung b e § eigenen S e u e r § toirb
unter anberem erhöht burch gefdjidte SluSroahl ber
fVeucrftellungen (349 ff.), gneimadjen be§ SdjußfelbeS,
feinridhten bon 23eobachtung§ftänben unb Stadhriihten»
beröinbungen, mittelbar auch burch SluSnußeu bor»
hanbener foroie Sau neuer Sperren unb §inberniffe.
Jpeden, Säume, Siifdje finb nur, fotoeit nötig, ju be»
fettigen. ©efällte Säume berfperren oft ba§ Sdjußfelb.
Säume äftet man baher im allgemeinen nur au§, bie
Kronen beläßt man al§ Sdjut} gegen feinbtidje Seob»
achtung au§ ber ßuft.
341. Sitte §ilf§mittel, bie ber f e i n b l i dj e n
Beobachtung unb geuerleitung nüßenunb
bamit bie feinblidje geuertoirtung erhöhen tonnten, finb
*u befeitigen, fo im Jpauptfampffelb auffällige Schorn»
fteine, SOlaften, Sürme, SSinbmühlen unb Säume, in
SereitftellungSräumen für ben Singreifer SermeffungS»
türme unb »fteine.
260
342. 30? i 11 e I jum Erhalten ber Kampftraft
finb: Singraben, Sau oon getarnten Unterfdjlupfen
ober Unterftänben unb mögltcpft getarnte Serbinbun«
gen nadj rüdmärtS unb feitioärt§.
£iefe unb breite ©lieberung ber ®efamtbefeftigung3«
anlage unb geringe SluSmaße ber ©injelanlagen jer»
fplittern bie f einbIid) e geuerioirf ung,
bieten baher toirffameren ©c^ufe a!3 große, ftarf au3»
gebaute Sinjelanlagen.
343. Sn ber 9? ä h e auffallenber Selänbe.
punfte, toie Sßalbftüde, Saumgruppen, Sßegefreuje, ein«
jelne ©äufer, bie ba§ feiublidje geuer auf [ich jieijen,
finb feine Einlagen ju fdjaffen.
Srampelpfabe ober SBagenfpuren bürfen bie Einlage
nidjt betraten; bafjer führt man fie, toenn nötig, über
bie Einlagen hinaus ju Scheinanlagen.
344. gorm mtb Starte ber Anlagen werben beftimmt
burdj ihren Stoecf, Sobenoerfjältniffe, 9)iöglid)teit einer
Oioäfferung, berfügbare Seit, Kräfte unb Mittel.
Siaffe Stellungen toerben fchnell unbrauchbar ober
erfordern jum Erhalten ftarfe Kräfte.
©ie in ben Silbern gegebenen Slbmeffungen unb Seit*
angaben beziehen fidj auf Einlagen in mittlerem
Soben. Sofer Soben erforbert befonbere Sautneife.
Oe SRaße finb nur Ofjalte. fjür fofort ju be«
Senbe Kampfanlagen ift bie ®röfje ber einzelnen
xte mafjgebenb.
345. Sei geinbnäfje finb Beit, Kräfte unb SKittel fo
einjufelen, baß halb üerteibigung§fäljige Einlagen ent«
fteljen unb bie Gruppe Jeberjeit abtoeljr«
bereit ift.
B. Scfyanjjeuggebraudi.
346. Sille Anlagen ber leisten Selb-
befeftigung muß bie Gruppe in ber Siegel mit bem
mitgefüljtten Sdjanj« unb SBertjeug ausführen.
261
SRidjtiger Sdjan^ unb SBertseuggebraud) erleidjtert
bte SIrbeit unb erfjöljt bie ßeiftung.
347. Spaten, ®reujljaden unb ® j t e
ljanbljabt man mit ber einen Jganb bidjt am ®ifen, mit
ber anberen am Stielenbe.
Seim Sägen mit ber ©lieberfäge mu(j ein
SRann bie Säge ftraff galten, ba fie fonft eintnidt.
Sratjtfdjeren finb jum 3«f<f)neiben öon ®räp=
ten »eit ju öffnen, bamit ber Srafjt tief im Sßintel ber
Sdjere gcfafjt mirb.
Sßenn freigemad)te§ Sdjan^eug nidjt flirren foH,
trägt man e§ nadj Silb 211.
348. 2lrbeit3leiftungen f. Safel 13.
Silb 211.
Stagen Von freigemadjtem Stfjanjjeug.
C. (Einjelanlagen.
Stärte felbmäfjiger bedungen f. Safel 12.
1. Stampfanlagen.
Stellungen für 3nfan^rie.
349. JJeuerfteHungen finb fo feftjulegen unb au§»
jubauen, bafj man unter ©rljalten natürlicher ober nadj
Schaffen tünftlidjer Sarnung gut beobadjten unb bie
eigenen SSaffen gut mitten laffen tann.
262
SWan nütjt baljer jum <5cfju|e gegen feinblidje Sidjt
unb feiitblidjeS geuer natürliche bedangen, toie Jpeden
mit (Sräben, ®ruben, ®ämme, Erbroeüen, Stderfurdjen
unb gelbraine, au§ (SBilb 212 u. 213).
Silb 212.
2lu@nu$en cine§ §clbtaine§.
Silb 213.
ÄuSntt^en einc§ <sitafiengtaben§.
81 u § 1? u 5: für einen Sdjüfcen etma 0,30m’.
Seit: 20—30 Minuten für einen 9Jtann.
fjeuerfteüungen, bie bon eigenen SRafdjinengeioeljren
fiberfdjoffen toerben, fdjütjt man gegen Sturäfdjüffe burch
natürliche ober tünftlidje Stüdenmepren. SRüdenioeljrejt
fdjütjen ferner gegen Splitter bon SIrtiHeriegefdjoffen,
SRinen ober SBomben, bie rüdtoärt§ ber ^euerfteüungen
einfdjlagen.
350. ®a§ Sdjügcnlod) für liegenbe Sdjügen
(Schüffenmulbe) entfteljt im ®ampf. ®urd) 3ufnmmen'
263
Silb 214.
edjüfccnlodj ffit liegenben Stf)üfcen (Sdjü^enmulbe).
(Tarnung fortgelafien).
Gewehrauflage
flMerwr ^mFeirxf
^Armauflage
-O.4Om tiefste Stelle (Füsse. 2-3Spatenstiche tief)
K u 3 $ u b: etroa 0,50 m*.
8 e 11: nad) taltifd^er Sage.
Silb 215.
6d)ii$enlod) für tnienbett Sdjii^eit.
Tarmfecfc, Zeltbahn
Ku«^uB: ettoa 0,70 m*.
Seit: bei 1 2Rami 1 ©tunbe.
18^
264
fdjarren bon @rbe mit Spaten, ffreu^ade, ®od)gefd)lrr
ober ben .'gänben ober burd) SluSnujen beS ©ornifterS
fdjafft man juerft eine Auflage für baS ©eweljr unb
eine ©edung gegen ®rb[id)t. Unter bem Sdjufc biefer
©edung Ijebt ber SJiann tm Siegen, neben ft<f) bon bom
nad) rüdwärtS arbeiten^ eine Sculbe nadj Silb 214
aus. ©er SobenauSljub ift junädjft für ©eweljrauflage
unb Sruftweljr, fpäter für ©edung nadj ben Seiten
unb nadj rüdwärtS (3iüdenweljr) ju berwenben.
SBilb 216.
edjüpenlodj für ftdjenben Sdjü^cn.
RuSljub: ettoa 1,00 m*.
Beit: bei 1 2Rann l1/, Stunbe.
351. Sdjiigenlüdjer für tnienbe unb ftetjenbe
Sdjüfcen f. Silb 215—217. ©en ©runbrifj für
ein Sdjüijenlod) für tnienben Sd)ü|en nimmt man,
toenn möglid), bon bornljerein fo grofe, bafj eS jum
Sdjüfcenlodj für ftefjenben Sdjütjen erweitert toerben
tann. ©en anfangs auSgeljobenen Soben Wirft man
fo weit, bafj man ©oppelbewegen beS SobenS bermeibet,
alfo minbeftenS 3 m über bie SIrmauflage.
©ie Sruftweljr jieljt man feitlidj fo weit t)erum, bafj
ber Sdjüfce, gegen feinblic^eS Scfjrägfeuer gebedt, feCbft
naä) ben Seiten feuern tann. SWan wirft bie Stuft»
wetjr ftets fo niebrig wie möglid) auf. gwed ber
SRüdenweljr f. 349.
Söfdjungen in feftem Soben Ijält man ftetS fo fteil
wie möglidj, Söfdjungen in gefdjüttetem ober lofem
Soben bagegen flad).
265
Sei Seginn be§ ©ingrabenä außerhalb b e 3
(e i n b I i qj e n geuer§ ftidjt man bie Sobennarbe
o toeit ab, mie bie fpäteren Schüttungen reifen faßen,
unb legt fie beifeite. 9Kit ber abgeftotfjenen Soben»
narbe tarnt man fpäter bie Schüttungen.
»üb 217. Sdjüfcenlodj, für 2 ftc^cnbe ©djiltjcn erweitert
(Snrnung fortgefoffen).
R u S b u b: ettoa 3,00 ms.
Seit: 4—6 tlrbßitSftunben, bei 2 SRann 2—21/, Gtunben.
352. Ungünftige Sobenoerijältniffe,
J.S. tJelä, hoher ©runbtoafferftanb, laffen ben Sau
bon Schützenlöchern in ben nach 351 angegebenen fjor»
men nicht ju. 2Ran tann bann nach Silb 218 u. 219
berfahren. ©en für Serftärten ber Sruftmehr unb für
Bnlage einer fRüaentoehr nötigen Soben gewinnt man
burch ©rroeitern be§ Schützenloches nach ben Seiten
ober burd) SluSIjeben öon Soben h in te * b e m
S th ü h e n I o dj.
266
zum Feind
SBilb 218.
(Srfjiiijenlorf) für
tnienben (sdjütsen
bei felfigem Unte>
grunb.
SBilb 219.
<5djii£enM für
fteljenben <sd)ii£en
bei Ijoljent (taub*
toajjerftanb.
SRüdenfoebr auf 1,0 m
burd) SluShub eines rüd*
to artig en ®raben£ er*
höhen.
SBilb 220.
9left mit Unterfdjlnbfen für einen SdjüijentrnjJb-
Kräfte: 8 2Rann.
Sauftoffe: 30 behelfsmäßige Sthurjbolgrahmen (nach Silb 241a);
10 Querlatten, 1,80 m x 25 cm x 8 cm; 5 ©djireUen, 1,20 m x 25 cm x 8 cm;
5 Älabfcblenben, 1,40 m x 1,20 m x 8 cm; 10 ©ißbretter, 1 m lang, mü
20 Seiften; (Sanbfäde jum Sefeftigen be§ SobenS über bem S>edenbrat;
SRafdjenbraht gum ergänzen natürlicher Tarnung.
267
Sinbemittel: 80m Sanbeifen; 500 Sägel, 8—15 cm lang.
£B et!8 eug unb ® e r ä t: 3 lange ©baten; 3 fnrge (Saaten; 3 lange
fkruflbacfc'rt; 3 tum Streu^^aden; 3 Seile; Stammet; 38angen; 3Sägen;
t eeötoaagen; 8 SteBitäbe.
Rett: 144 Slrbettsftunben, bei 8 2Sann 18 ©turiben, ohne Snbeförbent
bet fiaultoffe.
5öiXb 221. 5Reft für einen I. 9R. trnVj).
Schnitt A -B
4 = Gruppenführer
ftr&fte: 4 Storm.
Sauftoffe: 18 behelfsmäßige ©djuräholätaljmen (nach Silb 241a);
9 Cuerlatten, 1,80 m x 25 cm x 8 cm; 3 ©djiueHen, 1 m x 25 cm x 8 cm;
4 jtlabbblenben, 1,40 m x 1,20 m x 8cm; 6 ©ifcbretter, 1 m lang, mit
;2 Seiften; ©anbfäcfe $um Sefeftigen beS SobenS über bem ©ecfenbrett;
<$afcf)enbraf)t $um (Ergänzen natürlicher Tarnung.
Sinbemittel: 18 m Sanbeifen; 300 Sägel, 8—15 cm lang.
Setfteug unb ® e r ä t: 2 lange ©baten; 2 fnrge ©baten; 2 turge
fh-eujtjacren; 2 Seile; 2 $ämmer; 2 Bangen; 2 ©ägen; 2 ©efcfoaagen;
l Seßftäbe.
Seit: 100 SlrbeitSftunben, bet 4 Storm 25 ©für ben, ohne SInbeföcbern
auftoffe.
268
353. Serbinbet man mehrere Sijü^enlöc^er bur<$
©räben, fo entfielen SJefter, bie burdj ben ©inbau bon
Unterfdjlupfen berftärtt »erben tönnen. SBeifpiele für
Hefter f. SBilb 220 u. 221. Sie Slefter formt man
ftet§ fo, baß man bei guter Sarnung ^öc^fte freuet«
»irtung erjielt.
354. Striedjgräben (SBilb 222) bilben bie erften ge«
beiften SBerbtnbungen jj»i|‘djen Sdjüfjenlödjern. Sütan
erweitert fie, »enn möglich, ju SeroinbungSgräben na<$
SBilb 223.
Zum feind
★0,30 m
•0
Silb 222.
fttiedj graben.
tluSbub: ettoa 0,50m*
für ben Ifb. m.
8 eit: 1 «rbeitöfhmbe.
M.50 m-*
-•— Zum Feind
★O/irn
Silb 223.
SerbittbttngSgtaben.
«u5bub: ettoa 1,50m*
für ben Ifb. m.
Seit: 2»/i-3 «tbeitt-
ftunben.
355. ®riedj= unb 53erbinbung§grüben
tann man feiten tünftIidj tarnen. Sftan
baut fie baljer möglictjft unter 9lu§nu|en bon ©räßen,
gelbrainen ober feien fo, bafj fte bie einzelnen freuet«
fteüungen ni<f»t betraten, ober füljrt fie ju Sdjein«
anlagen »eiter.
269
356. Sie Serbinbung Oon rüdio8r13 ju
Heftern legt man möglicbft innatürliche bedungen.
3n nicht gebedten ubfcgnitten legt man mit nicht ju
Weiten Slbjtänben HJlulben ober Söcljer an.
Sn natürlichen ®räben, j. 23. Straßengraben, bie
bom tSferrtb unter Strichfeuer genommen werben tönnen,
baut man Duerbedungen ein.
©at man Seit, tann Slnwenben öon SD? a § t e n nach
$. Sb. 268 Vorteilhaft fein.
SSilb 224. e. 9». ®. Sieft
ftrftfte: 4 Sftann.
Sauftoffe: 12 bebelfömäfetge Sdiurjljoljrahmen (nach Silb 241a);
4 Ouerlatten, 1,80m x 25 cm x 8cm; 2 Schnellen, 1,20 m x 25 cm x 8cm;
2 Älappblenben, 1,40 m x 1,20 m x 8 cm; 4 Sifcbretter, 1 m lang, mit
8 Seiften; Sanbfäde jum Sefeftigen be§ Soben§ über bem ©ectenbrett;
2Raf($enbrabt jum ©rgänjen natürlicher Tarnung; 1 fioljtifte für 2R. ®.,
1,80 m x 0,60 m x 0,60 m, au3 8 cm ftarten Soblen; 1 $oljtifte für SRunition,
0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, au§ 8 cm ftarten Sollen.
Sinbemittel: 12m Sanbetfen; 200 SRägel, 8—15 cm lang.
SBertjeug unb (3 e r ä t: 2langeSpaten; 2 turje Spaten; 2lange
ftreujljacfen; 2 turje Streujljacten; 2 Seile; 2 jammer; 2 gangen; 2 Sägen;
2 Sefctuaagen; 2 UReftftäbe.
geit: 40 SIrbeitSftunben, bet 4 2Rann lOStunben, ohne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
357. Sn ben Sleftern ftellt man junächft bie Schüßen-
lödjer, bei 1.2K. S. Heftern für Schüßen 1 unb 2 er-
weitert. her- Sie Serbinbung burch Kriechgräben
unb SserbinbungSgräben wirb nach r e <h t § gebaut.
270
ßange ober feinbioärtS füfjrenbe Sßcrßinbungen finb
Ijäuftg ju Bremen.
358. Slnfjalt für ben S3au üon f. SR. ®. SJeftern f.
SBilb 224, für eine f. 3R. ®. geuerfteüung für ftetjenben
2lnf(f)Iag f. Silb 225.
Silb 225.
geuerftellung etael
f. 3R.ö. für rtc^enbcM
Knftblag, banebea
Unterfdjlnbf
(Tarnung fort*
flelaffen).
Sitzbretter-—
Kräfte: 4 SSann.
Sauftoffe: 3 Salten, 3,50m lang, 2020cm; 8 Sohlen, 2,50m
x 25 cm x 7 cm: 2 Sretter, 2 m x 20 cm x 5 cm; Sauftoffe für Steter»
fcfjadjt; Stafdjenbrafit gum Ergangen natürlicher Tarnung.
Sinbemittel: 25 Sägel, 15 cm lang; 9 m Sanbeifen; TO Sägel,
5 cm lang.
Sus hu 5: etfoa 10 m3.
Sßerigeug unb ®erät: 1 Säge; 1 Seil; 4 Saaten; 2 Äreug*
hacten; 1 Sange, 1 jammer; 1 SSefcftab.
Seit: 36 SrbeitSftunben, bei 4 2Sann 9 Stunben, ohne Snbeförbem
ber Sauftoffe.
271
53or ber SJlünbung ber f. 9K. ®. liegenben lofen 53oben
legt man jum SScrmeiben ftarfer Staubentttridlung beim
Steuern 3.33. burcf) Slnfeudjten, fRafenftücte, SDlafdjem
SBilb 226.
(LSR. ($. generftellnng auf Unterfdjlu|)f unb unter Sarnbedc
(Schnitt burcf) bie SQlitte).
Leen mit Klappe und
Drahtgeflecht zum
Lin • und Aussteigen
Sandsäcka
«uXulaJULiL
Kiuppblende, bestehend
2 Hälften
-3.70 m
t aufeinanderge
itf-llte Klappblenden
Maschendraht mit
Tarngeflecht
Schartenblende
----------L-S.SSm -------------
^0.05m 4q
470m
1,b0m------<
Sitz
Bandeisen
Stange zum Offnen und
Schließen der Scharte
8/2 5 cm
braljt ober Beltbafjn feft. Eine tünftlid) getarnte
f. 3R. S. geuerfteHung auf Unterfdjlupf jeigt 53ilb 226.
359. ®in Sleft für LSR.SB. geigt 33ilb 227 u. 229.
S3ei einer Einlage nad) SBilb 227 ftefit man gunädjft bie
JeuerfteHung Ijer, läfet bie ScEjüt^en 4, 5 unb 6 fid) ein-
graben unb baut bann bie übrigen Einlagen au3. 2Ran
legt Unterfdjlupfe für bie 53ebienung in bie eine, bie
SRunition^nii^en in bie anbere ©eite ber ^euer-
fteflung, unb gmar in einem fo fcEjräg nad) Dortoärtö
ober rüdtoärtS füfjrenben ©raben, bafj beim ®etonieren
ber SRunition bie SRannfdjaft rricfjt gefäfjrbet toirb.
272
SSilb 227.
SReft für einen I. SR. SB. mit Sobenjrtatte.
Kräfte: 6 2Rann.
Sauftoffe: 1. für Unte r f d) lu p f e: 18 behelfsmäßige Sdjurt-
$oljraljmen (nadj Silb 241a); 6 Querlatten, 1,80 m x 25 cm x 8 cm;
8 Sd) to eilen, 1,20 m x 25 cm x 8 cm; 3 Klappblenben, 1,40 m x 130 m
x 8 cm; 6 Sißbretter, 1 m lang, mit 12 Seiften.
2. für 2Runition§nifd)en: 6behelfsmäßige Sdjurjboljrabmen.
1 m x 0,80 m x 25 cm, aus 8 cm ftarten Sollen; 4 Querlatten, 0,90 m
x 25 cm x 8 cm; 2 SdjfoeHen, 1,20 m x 25 cm x 8 cm; 2 Klappblenben.
1 m x 0.90 m x 8 cm: Sanbfäcte jum Sefeftigen bes SobenS über bem
Decfenbrett; Siafcbenbrabt jum ergänzen natürlicher Xamung.
Sinbemittel: 24 m Sanbetfen; 400 Sägel, 8—15 cm lang.
SBertjeug unb Serät: 3 lange (Spaten; 3 turje Spaten; 8 lange
Rreujljacten; 8 turje Kreujbacten; 3 Seile; 3 dämmer; 3 gangen; 8 Sägen;
8 Sefctoaagen; 3 SReßftäbe.
8 * i t: 144 SlrbeitSftunben, bei 6 2Rann 24 Stunben, ohne SlnbefÖrbern
ber Sauftoffe.
360. Slnljalt für ein SReft für m. ®l. SB. ober Sßanjer»
abtoeljrgefdjülj f. Silb 228. ättan baut junüdjft ein
8ettung§lager. Ser @raben mufj, um gebedteä S3e»
273
förbern ber äJlinen gu erntögltdjen, eine Siefe üon
1,50 m unb eine Soljlenbreite üon 0,50 m ^beu.
SBilb 228.
fteft für einen nt. 9R. ober ein ^an^erabtneljrgejtfjü^
Ä r ä f t e: 6 Staun.
Sauftoffe: 1. für Unter f djIuVfe: 18 behelfsmäßige (Sdjurg-
$olgraljmen(na(h Silb 241a); 6 Querlatten, 1,80 m x 25cmx8cm;3@djh)ßHen.
1,20 m x 25 cm x 8 cm; 3 $lappblenben, 1,40 m x 1,20 m x 8 cm; 6 <Sifc*
breiter, 1,00 m lang, mit 12 Seiften.
2. für 2Runition3nifdjen unb gflnbmittel ft ollen:
9 behelfsmäßige (Sdjurgljolgrabmen, 1,00 m x 0,80 m x 25 cm, au§ 8 cm
ftarten Sollen; 6 Querlatten, 0,90 m x 25 cm x 8 cm; 3 (SdjfoeHen, 1,20 m
x 25 cm x 8 cm; 3 $lappblenben, 1,00 m x 0,90 m x 8 cm; ©anbfädß
gum Sefeftigen be§ SobenS über bem ©ecfenbrett; Stafihenbrapt gum
Ctgängen natürlicher Tarnung.
Sinbemittel: 27 m Sanbeifen; 450 Flügel, 8—15 cm lang.
SBertgcug unb ®erät: 3 lange (Spaten; 3 turge (Spaten; 3 lange
ftreughatfen; 3 furge ^reugbatfen; 3 Seile; 3 jammer; 3 gangen; 3 (Sägen;
8 Sefchjaagen; 3 Steßftäbe.
8eit: 150 2lrbeit£ftunben, bei 6 Staun 25 (Stunben, opne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
361. Anlagen für 23eo6acf)tung unb Aacfjridjtenber*
Bindungen f. 363—366.
Stellungen für Artillerie.
362- Stellungen für ®efdjüfje toirb man oft au3
SRangel an 3ett, ®räften -unb $:arnmögli(f)teit nur ba’
J 5 - b ?
274
burdj toerftärfen,bafj manbei Sefdfüfjenm itSdjufc«
fdjilb ben 9taum jioifdjen Sdjilben unb 53oben burtfj
tsrbe bei allen Sefdmfcen fdjmale, tiefe
Sräben beiberfeitä be§ SafettenfdjroanjeS als ..
fdjaftSbctfung anlegt, oljne baburdj bie Sdjmenh;
ntöglidjlcit be3 @efd)ü^e§ nadj beiben Seiten ju
befdjränfen. /
Silb 229.
Seitcrffcnititß für eilt (f)ö^ ober I. 8R. B. 18.
T
to
ff
f (bUnfersehltrpp
~PP* thMunitionsmsd*
Strafte: 5 Staun.
Sauftoffe: 1. für u/terf $ lupf e: 18 behelfsmäßige Scburg-
ljol(5raljinen(nadj Silb 241a); ^Querlatten, 1,80 m x 25 cm x 8 cm; 3 Sdj mellen,
1,20m x 25 cm x 8 cm; 3 ^lappblenben, 1,40 m x 1,20m x 8cm; 6 S --
bretter, 1,00 m lang, mit 12 Seiften.
2. für StunitioOntfdjen: 9 behelfsmäßige Schurgholgrahmen,
1,00 m x 0,80 m x 25 cm, auS 8 cm ftarfen Sollen; 6 Querlatten, 0,90 m
x 25 cm x 8 cm; 3 Schwellen, 1,20 m x 25 cm x 8 cm; 3 ßlappblenben,
1,00 m x 0,90 m x 8 cm; Sanbfätfe gum Sefeftigen bes SobenS über bem
Secfenbrett; Stafdjenbraht gum Ergangen natürlicher Tarnung.
Sinbemittel: 27 m Sanbeifen; 450 Sägel, 8—15 cm lang.
Sßertgeug unb ® e r ä t: 2 lange Spaten; 2 furge Spaten; 2 lange
Meughacfen; 2 furge ^reughacfcn; 2 Seile; 2 jammer; 2 gangen; 2 Sägen;
2 Seßmaagen; 2 Slefeftäbe.
geit: 110 SlrbeitSftunben, bei 5 Sftann 22 Stunben, ohne SInbeförbern
ber Sauftoffe.
Leiter liebt man in Sefdjüfjnälje Sräben für bie
mition, unb jtoar getrennt für Sefdjoffe unb ffar»
fjen, au§ (®at)l ber Stellungen nad) 34Ö,—3lbf. 1).
275
Sei tneidjem Soben unterfuttert man Safcttenfdjroans
unb SRäber burdj Sollen, Steifig ober Straudjroert unb
legt eine Straudjpadung hinter ben Sporn.
SSenn erforberlid), baut man geuerftellungen naä)
Silb 229.
3mmer finb SKaßnatjmen jum Entfernen ber Win«
bungäfeuerftede burd) geftlegen lofen SobenS burd)
SWafdjenbraljt unb Sereitljalten öon Sarnftoffen ju
treffen unb SRabfpuren foroie Srampelpfabe gu »er*
nnfdjen ober ju Scheinanlagen meitersuführen.
Anlagen für Seobadjtung.
363. ®ine einfache Einlage für Seobadjter unb
Sernf|>redjer (gunter) jeigt Silb 230.
S3ilb 230.
(Httfadje Anlage für 6tb»
Beobachtung.
Schnitt A-B
364. Saume richtet man al§ SeoBadjtungSftänbe nach
Silb 231 u. 231a ein. 2ll§ SKefefteHen finb §och«
ftänbe auf Säumen nur bann geeignet, ioenn fie gegen
276
SBilb 231. $8ilb 231a.
Seim ^errichten bon Säumen gut Seobadjtung Tann man audj ftatt
ber @proffen angefpifcte $ufeifen ober klammern bertoenben.
Kräfte: 2 Staun.
Sau ft offe: 20 Ifb. m fftunbljolä, 10 cm 0; 15—20 ßatten, 50—60 cm
lang, 5/8 cm.
Sinbemittel: 100 m S)ra!jt, 3 mm;-100 Sägel, 10—15 cm lang.
SBertgeug unb ®erät: 1 ©äge; 1 Seil; 1 Sange; 1 jammer.
Reit: 5 Slrbeit^ftunben, bei2 Staun 2x/i Stunben, oljne SInbeförbern
ber Sauftoffe.
anbere Säume fo berfpreigt ober fo mit bem Soben
berantert toerben, bafj bei Sßinb nur geringe Sdjinan«
Jungen entfteljen. 3um Verringern be§ SßinbbructeS
öftet man bie fronen au§ ober tappt fie.
Seoba^tungSfteHen unb SFtejjfteHen legt man ni<$t
an Sßalbränber ober in 11 e i n e Saumgruppen.
(Getarnte S3eobadjtung3ftänbe in <Sdjütjenlöchetn f.
»ilb 232.
365. Splitterficf)ere SBeobadjtung^ftänbc baut man
nad) SBilb 233. ©ie Öffnung für Scherenfernrohr ober
©rabcnfpiegel mufj burch eine einfache getarnte ©lappe
»erfd)liefjbar fein.
SBidjttg ift eine fefte SSerbinbung ber ©ecfenhöher
untereinanber unb mit ben Unterlag§höljern. 9ln
©teile bon SBanbetfen fann man auch ftarten ©raljt ber»
»enben (379).
Silb 232.
©etamttt SeobatfjtungSftanb im Sdjü^enlodj.
Grundriß
>ionierbienfL
19
278
SBilb 232 a.
Schnitt A~B
Schnitt C-0
Schnitt E~F
1,16m
279
»Hb 233.
eblittcrprfjercr SBcobatfjtungSftanb.
Ä r 5 f t e : 8 SRaim.
Sauftoffe: 2 Untcrlag^bölger, 2,65 m lang, 20 cm 0; 9 ©ecfen*
Wlger, 3,80—4,00 m lang, 20 cm 0; 4 S)ccfcnbötgcr, 1,80 m lang, 20 cm 0;
4 m1 3k bien, 8 cm ftarf, für Slcnbe nnb ^nirobricbacbt; 8 Sßfable, 1,50 m
lang, 10 cm 0; Sretter für ©itj; Slafcbeitbrabi 311m ergangen natürlicher
Xarnung; ©adjpabpe gum Slbbicbten ber ©ccfcnbölger.
S i n b e m i 11 e 1: 150 m Sanbeifcit; 600 Slägcl, 6 cm lang; 100 Slägel,
18 cm lang; 20 Älanmiem.
„SBertgeug unb ®erät: 2 lange Gfcaten; 2 lange ftreugbatfen;
9 njte; 1 gange; 2 Rümmer; 2 <&ägen; 1 Seil; 1 Stefeftab.
Seit: 48 Slrbeiteftunbcn, bei 3 Sftaiui 16 (Stunben. ohne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
19'
280
Anlagen für StatbriCbtenoerbinbungen uni» Stadjridjteu*
mittel.
366. gfelbtabel toirb in ber Stege! offen »erlegt. 3um
tSdjufj gegen ftarteS SlrtiHeriefeuer legt man baS Sabel
in fd)male, höäjftenS 0,60 m tiefe, offene Stäben, bie
man aber in iljrer gangen Sänge niemals tarnen rann.
367. Sinnierte Sabel toerben jum Sdjufe gegen
SlrtiHeriefeuer ettoa 2 m tief Oerfenft. ©en Sabeloerlauf
bejeidjnet man unauffällig burci) Heine fjäfjncfjen ober
anbere ^Karten, um baS Sabel bei Störungen finben
ju tönnen
368. ®or bem Sinbau bon SlinlfteHen in
Unter[if)lupfe ift ju prüfen, ob man bann bie.ffllint»
fteHe, ba man fie im allgemeinen Ijodj anlegeh raufe,
nodj tarnen tann.
©er SSItrttfeljfcEtlilj ift fo breit ju ljalten, bafe ber 8e-
trieb mit ber SegenfteHe aud) bei beren SluStneidjen
not!) möglich bleibt.
häufig bringt man SBlintftellen offen in Stäben,
fiöajern ober ©ridjtern beffer unter als in Unter»
fdjlupfen.
Scheinanlagen.
369. Scheinanlagen feilen bie feinblidje Beobachtung
täufcfjen unb baS fetnblicfte geuer jerfplittern. Sie
finb fo ju tarnen, bafe fie auf Sicfetbilbern ober mit
fdfarfen Släfern nodfe ertennbar finb unb fidj nid)t bon
toirflidjen Einlagen unterfdjeiben.
370. Sdjüfeenlödjer unb Stäben bon ettoa
30 em ©iefe erfdjeinen bem Beobachter auS ber 2uft
tiefer, toenn man bie Böfefjungen fteil auSfüfert unb bie
Soljle mit lofem Sufdjtoert, SoIflengruS ober buntler
Sdtlade bebedft.
281
Anbere gdjeinanlagen f.
SBilb 234.
S^eingtaben.
Huß, Dünger oder Blätter
(5m
a-Pfahl, 0.70m lang
b- Drahtgeflecht oder
Netzgnit Lappen od.
Tarnetqff durch flach-
ten
g-Pfählchen
Draufsicht
SBilb 234 u. 235. ®iefe An-
lagen bebürfen grojjei
SJiengen öon ®ra£)t
unb Sarnftoffeu.
371. Sdjeinunter»
fcfylupfe erhält man
burd) Se|en non 1 bis
2 9?afjmen in fteile
SBänbe ober burd)
fdjledjt getarnte ®rb«
auswürfe.
Artillerie»
nnb SJtinenwer»
fer * Sdjeinftel»
I u n g e n fteHt man
ä^ultcf) wie fjeuer»
fteüungen unb SBe=
obadjtüngSftellen bie»
fer SBaffen bar.
372. gebeinan*
lagen muffen be®
fegt e r f ä) e i n e n.
2)e§bnlb bürfen fie
Q5m
2lud) Srampelpfabe, 53erbinbung§*
nidjt tot liegen.
Stäben, SBagenfpuren muffen an fie t)eran= ober über
e hinauf geführt werben.
SBilb 235.
Srfjeingraben.
Drahtgeflecht Gras Drahtgeflecht mH
4* / Tarnstoffen
282
2. Anlagen jum Gehalten ber ßampftraft
Unterfcf|tupfe.
373. Unterfchlupfe bieten SBetter» unb Splitterfdjttfc-
Schneller Sau berminbert Serlufte.
374. 3eber Unterfdjlupf hält nur fo»
b i e l au§ tote feine f dj to ä dj ft e Stelle.
375. Unterfchlupfe gewähren nur bann guten
S dj u ß, toenn fie
a) bom (Segnet nicht ju erlernten finb,
,b) llein gehalten unb
c) feft gebaut toerben.
Silb 236.
SutbMod).
376. Sie S a u p l ä ß e legt man am heften in
trocfeneS (Selänbe unb unter Säume ober (Sebüfcf), in
SJlulben, große Trichter, §ohlroege, Heine,, meift auf
harten nicht berjeichnete Sanb= ober SieSgruben, Stein»
brücfje ober an ©ämme.
Sie Sage barf burch Srampelpfabe, berborrte Xar»
nung ober ßrbauSwurf nicht betraten toerben.
377. Schnell unb einfach läßt fid) getoachfener
Soben auSnußen. ©ruhen, Jpänge, Sämme ober
ben Soben unter ben Sruftroepren bon geuerfteUungen
283
zweiteilig
284
ht ftanbfeftem Soben man au§ föudjSlodh
Silb 236). ©iefe ©rbtjöhlen finb jebod) halb mit Sret»
tern, Knüppeln ober Sled>en ju öertleiben. ®ie ®injel»
teile ber Serfleibung finb gegen £uft» unb Srbbrud
feft miteinanber ju oerbinben unb gegeneinanber ju
berfpannen.
3n loderem Soben Ijebt man ®ruben au§ unb fefct
in biefe Säften au§ behelfsmäßigem Sdjurjholj nach
Silb 237.
®ine einfadje 21 rt bonSßetterfdjußjeigtSilb238.
Die Srettafel bient gleichseitig als Sarnung.
SBilb 238.
SBctterfcfjufc burch SrettafeL
378. Splitterfidjere Unterfdjlupfe mit $ectfdjidjt baut
man für 3—4 SWann nad) Silb 239 u. 239 a unb Mn»
lieh toie Silb 233 u. 240.
©rforberlidje Stärte ber ®edfdjidjten f. auch Säxfel 12.
Sor Seginn aller Arbeiten muß man, toenn er»
forberlidj, nicht nur ben Slafc für bie Saugrube unb
ben SobenauShub, fonbem auch bie Sagerpläße für
Sauftoffe unb SBertjeuge tarnen. Xarnnefce ober
Sarnmafchenbraht muß man fo fjodj unb toeit fbannen,
baß langes Arbeiten unter ber Tarnung möglich
285
«Ob 239. nnterfdjlnbf mit 2>e«en>
MUrat für 3—1 Kann.
»Ub 239 a.
edjnttte.
Schnitt A'8
\ ' f 0,30 m
fträfte: 4 äRann.
Sauftoffe: 16 ® edenhöljer, 8 m lang, 20 cm 0; 2 UnterlagSböIjer,
8 m lang, 20 cm 0, ober 16/16 cm ober hoppelte Soplen, je 8 cm ftarf;
8 Sfäple, 1,0 m fang, 10 cm 0, jum {Jeftpfloden ber UnterlagSpöIjer:
1 Rlappblenbe, 1,20 m x 1,00 m x 8 cm; 12 m1 Dachpappe; 2Rafdjenbrapt
tum (Ergänzen natürlicher Xamung.
Sinbemittel: 80 m Sanbeifen; 800 Slägel, 8 bis 15 cm lana.
®erfj eug unb ® erät: 8lange Spaten; 2 lange Äreujhacfen; 2 Sagen;
8 Seile; 2 »jte; 2 ßämmer; 2 Rangen; 1 SRefeftab; 1—2 Sdjubfarren.
Seit: 82 SIrbeitSftunben, bei 4 SRarat 8 Stunben, ohne Slnbeförbern
auftoffe.
379. 3n bet Sedfdjidjt muß man alle ©injel«
teile burdj Soljen, Safdjen, klammern, SBanbeifen
ober Sraljtbunbe feft miteinanber ö e r b i n •
ben, bie UnterlagSIjöljer auf breite Stuflager legen
ober auf Stempel fefcen, ba fonft fdjon größere Splitter
bie ®edtftf)idjt jerftören ober ben Unterfdjlupf jum ®in«
fturj bringen tönnen.
286
SBilb 240.
Unterffür f. 9JL unb 3 OJiann.
Pfähle Deckenholz
Bandeisen
S.M.G.
10cmj
Unterlagsholz +o
0,50
'w
1,90m
_0,50m
^M-OJOm
20 cm
>itz für einen
Schützen
-W,50
m
-1,10 m —
-2,90m-
-3,70m
Kräfte: 4 SRann.
Sauftoffe: 2 Unter*
Iag§6ölaer, 2,00 m lang,
20 cm 0; 10 ©etfertljölä«,
3,70 m lang, 20 cm 0; 1 £Happ*
bient) e, 1,40 m x 1,20 m
x 8 cm; 8 Sfäble jum fteft*
büocfcn ber Unterlagöljölier;
Sauftoffe für Gitj; 8 m“
S?ad)Vabbe; 9ftafdjenbra$t
gum ergänzen natürlicher
Tarnung.
Sinbemittel: 20 m
Sanbcifcn; 200 Flügel, 8
bi£ 15 cm lang.
Sßerlgeug unb
®erät: 3 lange ©baten;
2 lange ftrcugbacfen; 2©ögen;
2 Seile; 2 Sangen; 2 Kammer;
1 Stefeftab.
3 e i t: 32 Slrbeiteftunben,
bei 4 2Rann 8 Gtnnben, ebne
Slnbeförbern ber Sauftoffe-
'-1,50 m \Ä.
380. Untet[d)Iupf a u § begelfömfifttgem Sdjnrj-
golj (minierter Unterf^Iugf) für 3—4 Wann f. Silb 241
u. 241 a.
©en erften SRagmen fegt man fo tief, baß eine ®rb»
bede Von minbeftenS 0,30 m über bem ©ingang ftegen»
bleibt. ©a§ erfte Sobenbrett legt man bager mtn»
beftenS 1,25 m unter ben gemaegfenen Soben. Sie
6 Olagmen fegt man mit einer Neigung Von 45° (be»
gelfSmäfjige Segwaage f. Silb 242 u. 243). gnerju legt
man juerft ba§ Sobenbrett, banaeg ein Seitenbreft,
bann ba§ ©edenbrett unb julegt ba§ jtoeite Seiten»
brett. ©ie Sretter müffen biegt am Soben anliegen
unb rcdjtnnntlig jueinanber ftetjen. ©en Stammen ber»
fpannt man in fieg burcg Hufnägeln eines SrcttftüdeS
auf ba§ Soben» unb ©edenbrett. llntereinanber ber»
binbet man bie 3tagmen feft burcg Querlatten unb
Sanbeifen. ©ie Eingänge befeftigt man, wenn nötig,
burcg Sanbfadpadungen.
287
Silb 241. au§ beljelfSmäjjiflent
Srtjurjljolä
(53of)len ober fRunb^olj).
Querlatte (Quets/rebe)
SBilb 241a. «djdfSmäSiöeB edjuraW
QackenöneH
Bodenbreft nach dem Setzen des Rahmens aufnagetn
R r & f t e: 3 Stann.
Sauftoffe: 6 bcbclfSmäBige ©dhurgbolgrabmen; 2 Querlatten,
1,80 mx25 cm x 8 cm (Cuerftreben); 1 ©(bttjellc, 1,20 m x 25 cm x 8 cm;
1 Rlabbblcnbe, 1,40 m x 1,20 m x 8 cm; 2 ©ifcbretter, 1,00 m (an«, mit
4 Seiften; ©anbfäde gum Sefeftigen be§ Sobenö über bem ©etfenbrett;
SDtafdjenbrabt gum ©rgängen natürlicher Tarnung.
Sinbemittel: 6 m Sanbeifen; 100 Sägel, 8—15 cm lang (für
Bunbbolg 15—18 cm lang).
SBerfgeug unb föerät: 1 langer ©baten; l turger ©baten;
1 turge ftreugbacte; 1 Seil; 1 jammer; 1 Sange; 1 ©äge; 1 ©efcniaage;
1 Stefcftab.
gelt: 24 SlrbeitSftunbert, bei 3 Stann 8 ©tunben, ohne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
288
©en gleiten minierten Unterfdjlupf tann man in
Stunbljolj bauen.
Silb 242. Silb 243.
Wnfidft Sertoenben
einer bdjelfStnäjjtgen Sefetoaage.
TMHeisle
fdjliefjen ber Unterfdjlupfe
Silb 244.
SHaßßblenbe.
9cm
» . 120 m__
381. klappblenben nad) Silb 244 bienen jum 21b«
"! unb al§ ßeiter.
382. Unterfdjlupfe am
Steilbang in ftanbfeftem
Soben f. Silb 245.
383. ©iefe Sranattridjter
ober offene Saugruben
b e d t man mit Saum»
ftammen, Salten, Sollen,
Eifenbatjnfdjienen oberSBett«
bleib e in un*> überbedt
biefe feft ju berbinbenbe
©etffif)i(bt nach Einbringen
bon ,8toif(fjenftü|en (Silb 246) mit Saumftämmen, Erbe
ober gafdjinen. 9?eue ®rußen finb, Wenn 3e'i fot»
tjanben, fo tief au^utjeben, bafj bie e r ft e © e d •
fdjidjt fpftter berftärtt unb baburdj eine grßfjere
Sidjertjeit gewonnen werben tann. Sei einer ©iefe ber
Saugrube bon 3 m tann man bie © e d e 1,50 m ftart
machen. Sdjut} gegen fjeudjtigteit f. 390.
289
Söilb 245.
an einem ©teityang.
(Eingang öon einer offenen ©eite.
^&^ert4nne mH
t&ibchem Gefälle
4-5cm stänke Bnetten doppelt oder
entsprechende Bohlen einfach oder
Kant-»oder Rundhölzer
OfiOm
2.00-250
Klammen
HalterfahT
Seitliche Bretterven»
Schalung, außen mit
Sandsäcken in 0,50m
Stanke öden dgl,
gegen Splitten sichern
u tarnen. Auf den
anderen Seite ebenso.
Sparren 15/15cm
oder 18 cm 0 mit
OßOm Zwischenraum
Seitlichen Eingang,
gut tannen
Kantholz 18/18cm als
Unterlage
Schwelle 15/15cm öden 20 cm
obgeflacht
Ätftf te: 6 Stann.
Sauftoffe: 1 Äantljolg, 5,00 m lang, 18/18 cm, als Unterlage
fttt bie ©parren, 1 Äantbolg, 5,00 m lang, 15/15 cm ober 20 cm 0 ab*
fieftadjt, al§ ©djioelle; 8 ©parren, 4,50—5,00 m lang, 15/15 cm ober 18 cm 0;
1 Sohle, 5,00 m x 80 cm x 8 cm als Unterlage für bie ©djtx>elle;8 ßalte*
tof&hle, 1,50 m lang, 10 cm 0; 20—25 m2 Sohlen, 5,00 m x 25 cm x 8 cm;
im1 Sretter, 25 cm x 4 cm, als feitlic^e Serfcbalung.
Sinbemittel: 82 Älannnern; 400 Sägel, 15 cm lang.
SBertgeug unb Berät: 6 lange ©baten; 4 lange ^reu^acten;
2 Bügen; 2 Rümmer; 2 gangen; 2 $ßte; 2 Stefcftäbe.
Seit: 48 ttrbeitSftunben, bei 6 Stann 8 ©tunben, ohne Slnbeförbern
auftoffe.
384. ioenig ftanbfeftem Soben finb bie Söfdjun*
ien fladj ju geftalten ober ju betreiben, bie Unterlagt
löljer auf ißfähle ober Stempel legen (379).
Setieiben non Söftfjungen.
385. Söfdjungen in loderent Soben betreibet man
mit Sanbfäcten, Siafenplatten, Strandjfledjtioert,.
Straudjbiinbeltt. Straud)roerf legt man burcf) Sraljt
290
Silb 246.
3ivifd)enftii$e au§ tRnnblpIi.
an Jpaltcpfäljlcn feft (93ilb 247 u. 248). Sange Stan»
gen barf man junt galten bon Straudjioert nidjt ber»
toenben, weil fie, jerfdjoffen, bie ©räßen fperren.
Silb 247.
Silb 248.
Setleiben einet Söjdjunfl mit
SanbfSden.
Setleiben einet Sbfdjuitg mit
SttaurfjWert, burd) ^altebfB^lt
' betoniert.
Stytg gegen $endjttg!eit.
386. SRedjtjeitige 2RafjnaIjmen für Slbinäfiern finb für
bie 29raud)6arfcit ber Einlagen entfdjeibenb. SBafjer
jerftört oft metjr al§ S8ef<f>u§.
291
^Ibfü^rcn be§ £bcrjlärf)ennm|ferä.
Bei wenig durchlässigem
Boden
Bei durchlässigem
Boden ist die natürliche
Erdoberfläche nicht anzu-'
schneiden, weil sonst
Abrutschgefahr,
387. ® e l ü n b e mit Ij o l; e m Srunöioaffer»
ftanb, ebenfo Siefen, in benen fid) SBaffer fammelt,
muß man möglidjft oermeiben.
388. Sie Sagentaffer leitet man ab. SdjncHcä 9lb«
fließen mufe gemftbrleiftet fein.
Sa3 pberflädjen«
»affet furjrt man bet
faKenbem ®elänbe
burdj Heine Sämme
ober ®rftben, bie nidjt
ju bidjt an ber 9In«
läge liegen bürfen,
feitlidj um biefe
Ijerum (Silb 249).
3um 9lb io & ff e r n
einer Einlage
baut man einfadje
S>iderfd)äd)te (Stuben
mit Siegelf c^otter ober
grobem J?ie§) an ben
tiefften Stellen. SRan tnadjt fie ettoa 1 m breit unb
tief unb berfieljt fie oben mit einem einfachen §ohroft
als Serfd)lufj (Silb 250).
3« ben Siderfdjäd>ten füljrt man an ber 3tüdmanb
ber Sol)Ie Heine binnen, bie man burdj fdjräge Srett«
ftüde nad) Silb 251 einbedt.
Serfdjlammt eine Srabenfoljle, fo entfernt man ben
Sdjlamm mit Sintern ober Spaten, oljne tjicrbei bie
Soljle an ber SdtöpffteKe ju oertiefen. Sen au§«
gefdjöpften Sdjlamm mufj man ü b e r bie aufgcfdjüttete
Stuft« ober JRüdentoeljr fjintoegfdmtten.
389. Sei ft artet SBafferanfammlung legt
man bie Soljle mit einer fjafdjinenpadung auS. Saat
biefe fort, fo legt man eine «eitere Ladung auf. Sarauf
tommt eine einfache Saufbalm (Silb 252).
SBtlb 250.
©iderfd^t mit §oftroft.
Silb 251.
Abflußrinne mit fdpftgeii
Srettftüden.
S3ilb 252.
gafdjinenbadung, bat*
über Saufbatyn (bei fiat«
ter äßafferanfammlung).
Dft toirb ein Snüppelbamm fdjon genügen. Seffer
finb Sretterbaljnen au3 furjen SRoften naä) Silb 253,
Grabensohlenbreit»
Silb 253.
Sretterbaljit auS tutjett SRojiat.
bie aneinanbergefe^t toerben. 9Iu(f) längere SRofte auf
Stubbenunterlage finb geeignet (Silb 254); ferner tann
man bie Sotjle mit Qiegelfteiuen auölegen ober Siegel»
tleinfdjlag (Sdjotter) einbrtngen.
Siegt bie toafferfüljrenbe t&djidjt fo tief, bafj Sieter»
fdjädjte nidjt au§reiqjen, fo mufj man ba3 Sßaffer
burdj fRoljre ober mit Sdjotter gefüllte, getarnte ®rft»
293
ben in natürliche SJlulben unb Sädje — möglidhft feinb»
toürtS — ableiten ober auspumpen.
Silb 254.
»oft auf Stubbenuntcrlage.
390. ©ingänge bon Sauten (Unterfdjlupfe,
SlunitionSnifdjen ufm.) legt man möglicfjft 20—30 cm
höher als bie ©rabenfofjle ober fdjütjt fie burdj Sider»
fdjächte unb Slbbämmen mit gut gebidjtetem Sdjutjbrett.
Sten ©eden bon Unterfd)Iupfen gibt man
SefäHe jum Slbleiten be§ SBafferS unb bidjtet fie über
ber ©allen» ober Sdjtenenlage mit ©achpappe ober
einer Sdjidjt auS feftgeftampftem, naffem Seljm ober
On ab. SRinierte Unterftänbe (392 ff.) fann man audj
innen mit ©adjpappe bertieiben.
Odjug gegen ®aS.
391. Unterfdjlupfe tann man mit felbmfifjigen
SDtitteln gegen Sergafen nicht fd)ühen.
Sn tpäufern, bor allem in ben Seilern, fann man
aaSbidjte Stüume burdj ©id)ten ber Oren, bie man
pierju mit giljftreifen benagelt, unb ©idjten ber fjen»
iter fd)affen. SSenn möglich, bringt man ©oppeltfiren
mit 1 m Slbftanb an. Schaffen befonberer Sorraume
al§ Ablage für bergafte Sleibung ift jroetfmäfcig. 21IS
Notbehelf tann man ftatt Oren jmei an fdjrägen 2ln»
fd)Iagflädjen feft anliegenbe Vorhänge, bie man burdj
®ifenftangen befdhmert, mit 1 m 2tbftanb Ijintereinanber
als „®a3[d)Ieu[e" anbringen (Silb 255).
$iomerl>ienft 20
294
Sie SJorhänge feudjtet man mit Sßaffer, bem man
Jpolsafdje, Soba ober Schutjfalj iufefct, an.
Silb 255.
Sa^cfjlciifenborbattg
mit jdjrägcm *Än*
fdjlag, burd) ßijen«
ftaitgen befcbmert.
$um Söffen oon ®a§fprifcern au§ fefj»
haftem ®a§ mufj man Sfjlortalf bereitfteflen.
fOlinierte Unterftänbc.
392. Siefminierte Unterftänbc tönnen nalje am
geinbe ju SRenfchenfallen toerben. SDlan baut fie baher
nur für fReferoen, Stäbe, ihre SRadjridjtenfteilen
unb für Vorräte, gijre tiefen Seile finb, fobalb
eä bie Sage erforbert, ju jerftören.
3n feinbabgetehrte, fjolje Steilhänge tann man mit
»enig gaU, alfo flach minieren.
giadjminierte Unterftänbe tann man a u <h in
botberer Sinie anlegen, toenn bie 3u0änge nur
turj finb, bie SBcfa^ung alfo fernen h«au§treten tann.
393. Sie Bittgänge ju ben Unterftänben (grunbfäfc»
lieh 2 für feben Unterftanb) finb gegen S a § ju
jchüfcen. äRan üerfdjliefjt fie burch eine fplitterfidjere
ft'lappblenbe unb eine jtoeiteilige Sür mit Scf)iefjfcharte
ober Soppeltüren, bie man burch gilj» ober Stoff»
ftreifen abbidjten mufe.
gn bie Bittgänge ober burch ®ecfe legt man oer»
fcfiliefebare Süftung§rohre, burch ^ie man bei 35er»
fchüttung Suft unb SebenSmittel juführen tann.
Sie beiben Bittgänge finb minbeften§ 10 m au3»
einanber ju legen. äRetjrere benachbarte minierte
Unterftänbe tann man burch Stollen miteinanber oer»
binben, um baburcf) mehr Sluögänge ju erhalten.
295
OfdjnittSibeife Serteibigung int $n»
netn an Sitten mit Sdjiefjfdjarten unb Ijinter Sraljt«
maljen ift borjubereiten.
394. $um Sdjufc gegen 21 « cm «Steilfeuer
ift für minierte Unterftänbe je nadj föobenart eine Erb«
bette bon 6—8m, gegen ftfjmerere Sefdjoffe
unb Fliegerbomben über 10 kg eine Erb«
beite bon 12—18 m erforberlidj (Safel 12).
SBcfonberS gefäfjrbet finb bie Eingänge. 3ft itjre
Erbbede nidE>t bon borntjerein au§rcicf)enb, mufj man
fie bur<f> 23cton ober Elfen berftärten (405).
395. SB o r ^Baubeginn mufj man ©oben« unb
SEBafferberljältniffe unterfudjcn. Saju Stellt man mög«
lithft ©eologen heran
ober [teilt 33er[ucf)§=
boljrungen an.
Srunbmaffer ber«
bietet dinieren. 3m
Sd)toemmfanb ift mit
felbmäfjigen Wiittcln
StoUcnbaü nicht
möglich.
396. Sie 21 r-
beitSftelle, bie
Saget ft eil en für
SJtiniergut, ber
Förbertneg
bortljin unb bie
9In« unb O«
marfd)toege ber
Stupfte finb ju
tarnen.
397. ©aß Winteren
beginnt gleiche ei«
tig an ben Zugängen. Unabhängig babon ift
bab SSerftärten ber Zugänge.
Söilb 256.
@djk|>bf4ad)t mit 45—60° SReigung
alb 3»gang ;u tiefminiertem
Unterftan».
20
296
398. ©ie Zugänge j u tiefminierten
Unter ft ein ben fi'djrt man als Sdjleppfdjädjte mit
45—60° Steigung auS (Silb 256).
Bunädjft Ijebt man eine ettoa 2,3 m tiefe (Stube
aus, beten Söfdjungen man nad) feittoartS unb tfid»
wärts fla^ljält. ©en gewonnenen Soben lagert man
befonberS ober benufjt itjn jum Serftärten ber ®in»
gange.
©ie Stiftung legt man burd) 2 SRidjtpfäljle bot
bem .Bugang ober burdj 2 Sote, bie man an ber ©ede
beS BugangS auftjängt, feft. SSäljrenb ber Arbeit ift
bie Stiftung tjäufig audj mit bem Sompafj nadj»
juprüfen.
399. ©ie Zugänge j u flauen Unter ft ön»
ben baut man als Stötten; man gibt iljnen nur bann
etwas Sefätte, wenn baburd) tafdjer genügenber ®rb«
fdjup gewonnen wirb.
400. Sefjen beS 1. Stammens toie 380. Sei
borbereitetem Sd>urj^olj (Silb 263) fefjt man nad) bem
Segen beS SobenftüaeS baS jweijapfige Seitenftüd unb
nad) bem Segen beS ©erfenftüdes baS einjapfige Seiten»
ftüd. .
Bulefct fdjlägt man ben Seil in baS 3ap>fenlod^ beS
SobenftüaeS neben baS einjapfige Seitenftüd ein unb
berfpannt ben fRaljmen bamit.
©ie folgenben Stammen baut man fo ein, baß man
bie Seile abwedifelnb red)tS unb linfs einfdjlagen tann.
401. Bum Übergang bom Sd)leppf$adjt
jum Stollen fügt man einjappge Seitenftfide
fc^räg burd) unb fe|t fie bann.
©aburdj erljält man Sdjtoentraljmen, bie nur aus
2 Seitenftüden unb 1 Sobenftüd befteßen. ©et ®in»
bau erfolgt teilartig: 2 Sdjwentrabmen, 1 getoöljnlidjer
Stammen unb fo fort, bis man ben Übergang jur
SBaageredjten erteilt pat (Silb 257).
297
402. Einen SXuföau f ü r abjWeigenbe StoI»
len ftellt man folgenbermafjen I)er: Sftan führt ben
©tollen in ber bisherigen Stiftung auf 1,5 m mit nur
Silb 257.
Sdjtoentraljmett.
Silb 258.
Slufljau für abjtoeigenbe
Stollen.
is/l5cm
einjapfigen Seitenftüden an ber ©urdjbruchfeite unb
anfdjliefjenb noch auf minbeftenS jwei Nahmen mit
Wechfelnben Seitenftüden weiter (93tlb 258).
Kann fängt man bie ©edenftüde auf ber Seite beS
©urfbruchS burch ©erfpreijen ab, fdjlägt bie Sreite
heraus, entfernt bie Seitenftüde unb miniert nun in
ber neuen Stiftung weiter. Soll in ber alten Stif-
tung nicht Weiter miniert werben, fo wirb ber bi&
Ijerige Stollen burd) eine SSanb aus Sdjur^olj ab»
geffloffen.
403. ©en Unter ft anb miniert man als
waagerechten Stollen; nur bei feuchtem
©oben gibt man ihm geringes @efäKe.
SRan fe|t ihn als DuerftoKen — befonberS bei flach5
minierten Unterftänben — fo an, bafj ber Suftbrud
eines öor bem Zugang einfflagenben ©effoffeS nicht
auch unmittelbar auf ben SBohnftoHen (Unterftanb)
wirtt.
298
®urd) angefetjte i f dj e n tann ber UntertunftSraum
oergröfjert unb bie SSoIjnlidjteit erljöljt toerben.
404. SD e r Unter ft anb, inSbefonbere bie
3ugänge, müffen feft oerftrebt unb in fidj
tBilb 259.
geftberftrebter gugang ju einem Unterftanb.
Schnitt A-B
12/12cm
a Längsbalken c Querrtegf^
b Stützen d Streben
(SBilb 259). S)aS gcfdjie^t burdj
Oerbunben toerben
burdjlaufenbe SängSbälten (a) in ben 4 Sßtnteln ber
Sdmrjtjoljratjmen, bie man burd) Duerriegel (e) ober
Sßinfelftaijle am SBoben unb an ber Sede (SIbftänbe je
0,50 bis 1 m) unb burd) Stützen unb Streben üerfpreijt.
S3ilb 260.
Ztebbe ju einem tiefminierten Unterftanb.
Stufe
'Leiste als Auflager
der Stufe
299
®urdj fRägel, Sautiammern ober Sanbeifen finb alle
Spreizen feft miteinanber ju üerbinben.
405. ®ie ßitgänge verftarft man burdj eine Setom
platte, eine hoppelte Sage Sdjicnen, ftäfilcrne Gdjiuellen
ober Sräger (SBilb 256). Sie Serftärfung mufj über
bte erften fRahmcn nadj born unb feitroärtS fo meii
fibergreifen, bafj ®edc unb Seitenmänbe gegen SoU--
treffer auSreidjenb gefdjütjt finb. Sie Sdjienen, Sdjtoel5
len ober Sragcr öerbinbet man feft untereinanber.
406. Steppen unb ein f e ft e S ® e l ä n b e r
erleichtern ben Scrtehr. 2Inorbnung nach S3ilb 260.
407. 9113 Sttarmeinticfjtungen bringt man neben
Drahtleitungen unb ßlingcljügen noch anbere Scfjall»
fignalgeräte, wie frei Ejängcnbe Schienen ober Sb
reuen, an.
408. ® ü n ft l i dj e Stiftung burdj eleltrifdje ober
ßanblfifter ift fidjerjufteßen. SRafjnahmen für SaS*
f<M f. 391.
409. fVür Körbern bes ©linierguteS genügt bei furjen
Utincngängen einfacher unb mehr-
facher Spatenrourf. Sei fort=
jdjreitenbem Sau trägt man baS
Dliniergut in Sä den heraus, be»
inifjt ^Rollbahnen nach Silb 261
ober förbert eS in Heinen SBagen
(•Dlinenhunben), bie man mit
äßinben herauS^ietjt. 2lu§ Schach5
ten hebt man ben Soben mit
Sinter unb SBinbe heraus.
SaS SRiniergut mufj man
tarnen, unter Umftänben ju=
nädjft in Sanbfäcfen lagern.
410. Qn fefjr lofem, aber
troefenem Soben oerbinbet
man bie brei erften JRahmen beS
SBilb 261.
gtollbaljn für görbetn
be§ ©tiniergutcS.
F
TT
800
ȟb 262.
Safte« a«8 S^urjboIjtaftmeM.
'Igsigfretter
a« HiSsrahm^n
Sdjleppfdjacfjteft ober Stollens burd) äugen aufgenagelte
Satten ju einem Saften unb feftt fie gleidjjeitig. Die
nädjften jtoei SRaljmen treibt man bor unter bem Schuft
bon minbeftenS 3 cm ftarten Srettern, bie man über ben
Dedenftfiden bererften
brei Staftmen fäcper»
förmig borbrüdt.
Die Sretter für bie
nädjften IRaftmen treibt
man bor mit einem
^ilfftraftmen a
(Silb 262), ben man
im borberften Stammen
burdj Seile berfpannt
unb nad) bem Seften
beS nädjften JRatjmenft
mieber entfernt.
SumSdjadjtbau
berbinbet man bie
erften brei Stammen
ju einem Saften unb
treibt fie nad) SluSIjeben einer ®rube fentredjt in bie
®rbe. Dann brüdt man burd) 9tuffeften meiterer
Stammen unter gleichzeitigem SluSfteben be§ SobenS im
Sdjadjt bie tpoljbefleibung im ßufammenftang aHmäljlidj
»eiter Ijinab, bis Serfpannung unb SReibung im Soben
bieS berbieten. ®ute3 SängSberbinben ber Stctfjmen ift
befonberS midjtig. .
2ludj beim Durdjbringen bon Sobenfdjidjten, bie mit
Steingeröll ftarf burcfjfeftt finb, mufj man im
Sdjleppfdjadjt unb Stollen bie maljmen unter bem
Scftuft bon Srettern feften, bie man mit SBagentoinben
borfdjiebt. Die Sdjuftbretter barf man nicht mit $äm»
mem bortreiben, weil fonft baft ®eröH fid) lodert unb
ht ben Sdjleppfdjadjt ober Stollen bringt.
411. 3m geh fdjafft man Unterftänbe burd) Sprengen.
801
ȟb 263.
--------------‘g
|Ä}
Bodensföck
Zw&ZQpfiges
Menttück
Einzapfiges
SeitefMck
4 Oedienstück
e HoUMi
-__________-
£ O <
412. 3um 2Rinieren
»erwenbet man meift
«Sdjuräboljra^men
nad) SBilb 263.
SInbere Ülbmeffungen
finb juläffig; lidjte
©reite febod) nidjt
unter 1,20 m.
Statt S^ur^olj»
raljmen tonnen aud)
SBed= ober Sdjurj«
bledjraijmen (3. 33.
Sdjurjbledjratjmen
„S i e g f r i e b") ein»
gebaut werben.
413. Sebarf für einen tiefminierten Unterftanb mit
6 m Srbbede unb einem gaffungSraum für 8 bis
10 -Wann:
180 (Sdhiratjolarabmen, 1,80 x 1,20 x 0,25 m, etiua 8 cm ftart; 800 Ifb. m
Äantbolg, 12/12 cm (©erftrebung); 50 ma ©rettet für Jfnneneinricbtung unb
Xrebpen; 100 Schienen, je 6 m lang, ober entfprecbenb ©djiuellen ober
I-Xtaget; 1200 m ©anbeifen; 1500 Kügel berfd&tebener Gänge; 1 KoUe
leichten SKafdjenbrabt unter bie oberen Duerriegel gu fbarnien,.um Sin*
ftofcen mit bem ftobf gu berbinbem; 2 Konen ©inbebrabt; 2 Öfen mit
10 Änien unb 60 m Stobt; 6 ßaternen; 4 ©aSborbänge; 8 m2 ©tafrijenbrabt
gum Xarnen.
414. 3In gdjanjjeug unb SBertjeug für jebe SlrbeitS»
fteüe (in ber Stege! 2 SlrbeitSftetten) finb erforberlidj
(Sln^alt):
4 balblange ©baten; 4 balblange Äreugbatfen; 2 furge ©baten; 4ÄIabb*
barten (mit turgem Stiel); 2 balblange Sljte; 1 {Jäuftel ober ©eil; 2 Stieb*
eifen ober ©reebftangen je nach ©obenart; 1 ©ctjrotfäge; 1 ^anbfäae;
1 ©efeiuaage; 1 ©iefeftab gu 2 m: 1 Kageßaften; 1—2 fahrbare Mafien
(SRinenbunb) ober Sinter mit ©eil ober ®rabt; 1 8Binbe nach ©ebarf;
1—2 Katfenfcbüfcer; 1—2 ©aar ftniefdjüfcer.
{ferner: Sleftrifdje ober ^anblüfter mit gubebbr; ©eleudjtungSgerät;
tUarmeinricbtung.
415. fträftebebarf unb »einteilung. 5In jeber Stelle
werben junädjft brei 3Rann benötigt:
Sir. 1 („üor Drt") löft ben ©oben unb baut bie
Stammen ein,
302
%r.2 (unmittelbar hinter 1) unb
3?r. 3 förberit ben Soben jurüci unb reifen bie
SRahmenteile ju.
30?it fortfdjreitcnbem Sau finb bie aRannfdjaften für
Slüctbeförbern be§ SJlinicrguteS ju bermehren. ® r o fj e
Aufgaben berlaugen ununterbrochene Sag» unb
Nachtarbeit.
§ierju ift für febe Sauftctte eine SRinicrabteitung
ju bilben unb fo in Schichten einjuteilen, bafj bie
Nadjtfchicht rocdjfelt.
Stärte ber Schichten 5—6 SRann, babei mögtichft ein
Sergmann unb ein 3immerntann.
53eifpieIe für Einteilung:
(Starte ber JRinier* abteilung 3at)l ber Scfjidjtcn 2lrbeit3* jeit icber ftreiseit einftfjL Sftärfdjje SBemertungen
20—24 4 8 Stb, 24 Stb.
15—18 3 6 Stb. 12 <5tb. nur bei turpem 9In* u. SIbmarfd)
25—30 6 6 Stb. 24 Stb.l bei langem 9ln*
25—30 5 4 ©tb. 16 StbJ unb Slbmarfd)
Serftrebcn ber Nahmen unb Einrichten ber Unter«
ftänbe ift Sache ber SNinierabteilungen.
§ür Serftärtcn ber Eingänge fetjt man befonbere
Xrupp§ ein.
416. S)urdjfcfjnitt§Ieiftung in fetjr feftem
Soben mit Sdjurjholj 1,80 X 1,20 m: in 6 Stunben
0,50 m, b. t). in 24 Stunben 2 m, bagegen in leichtem
Soben ohne Steine 1 m in ettoa 4 Stunben.
Setonieren.
417. Seton in felbmäfjiger Strt jum Schuh
für Stnlagen ber gelbbefeftigung — j. S. Setonplatten
303
über Eingängen minierter Unterftänbe — tann auch
eine nidjt tedjnifdj norgebilbete ©ruppe fjerftetten unb
üertoenben.
418. Söeton ift ein Semifd; au3 gement unb gu=
fdjlagftoffen, meift Ganb unb ®ie§ ober St’leinfthlag,
baS unter SBafferpfag innig bermengt ift.
tJür 1 cbm fertigen, gestampften SSeton brauet man:
350 kg gement,
etwa 1501 SBaffer unb
13001 guf^lagftoffe.
©ie gufdjlagftoffe foUen möglidjft alle ®orn=
gröfeen bon 0—60 mm befifeen. 2lm heften ift eine gu=
fammenfetjung mit 60 ©eilen in Sorngröfeen bon
0—7 mm unb 40 ©eilen in ^orngröfeen bon
7—60 mm, bamit alle §ol)lräume in geftampftem
SBeton auSgefüllt toerben.
gement mufj man bi§ jum SJertoenben ooßftänbig
troden lagern, ba er bei SBaffer^utritt fjart unb bamit
unbraudjbar toirb.
©ie gufdjlagftoffe müffen rein, b. 5- bon erbigen,
lehmigen unb tonhaltigen 23eftanbteilen frei fein.
419. gement unb geinfanb hüben jufammen ben
SRörtel, burdj ben bie gröberen gufdjlagftoffe ju einem
feften, einheitlichen Sförper toerben.
©iefer Vorgang verfällt in:
a) ba§ 2lbbinben (Übergang jum Erhärten);
b) ba§ Erhärten.
©a§ 21 b b i n b e n tritt bei normalem unb bei hoch’
toertigem gement früfjc)teit§ 1 Gtunbe nach ^em
©afferjufah ein.
2Sährenb be§ 2lbbinben§ beginnt ba§ Erhärten
be§ SöetonS. ©a§ Erhärten ift bei h°d)b>ertigem
gement fdjon nadj einigen ©agen, bei normalem gement
febodj erft nach SBodjen fo weit fortgefdjritten, bafe bie
gegen Sefdjufe notrocnbige geftigleit erreicht wirb.
804
Sn borberer £ i n i e ober bei halb jju er«
martenbem 33e[djufj muß man bat>er m ö g •
11cf)ft fjodjtoertigen 3 c nt e n t berroenben.
©ie gementarten finb auf ben SBerpadungen gelernt-
jeidjnet.
420. Sßenn leine Setonntiftftmafdjinr
jur Verfügung ft e h t, mengt man junächft bi«
Bufcfylagftoffe mit bem ßement auf einer bidjt fdjliefeen
ben Unterlage auS ^Brettern ober Söledj minbeftem
breimal troden burdj, bis ein gleichfarbiges Semenge
entftefjt. ©ann fefjt man baS ©Baffer allmählich
bis man eine gleichmäßige SBetonmaffe erhält. SRan
bereitet nie mehr SBeton, als man bis jum SBeginn bes
SlbbinbenS berarbeiten tann. bereits abgebunbe»
n e n, b. h. hart tnerbenben 53 e t o n barf man n i dj t
erneut mit SBaffer beljanbeln unb bann bertoenben,
ioeil ber SBeton bann nicht mehr bie erforberliche Jpärte
erreichen tann.
421. ©ine Setonbede tann man entweber unmittel-
bar auf eine aus ftarten Sohlen, JRunbholjern ober
©ifenbahnfchienen beftehenbe ©ede eines UnterftanbeS
ober auf eine febernbe 3toifd;jnfdjicht, ttrie gafchinen
ober Straud)bünbel, bie man auf bie ©ede legt, auf»
bringen.
Sann man SBeton nicht unmittelbar am SSermen»
bungSort herfteüen, fo bereitet man ihn erft feucht bor,
füllt ihn in Sanbfäde ober Sörbe unb bringt ihn barin
bor. ©en SBeton fdjüttet man auS ben Süden obet
Sorben auf bie ©ede auS unb ftampft ihn mit Stamp-
fern ober ourch ©reten feft. Sm SlotfaU, fo j. SB. im
^aupttampffelb, legt man betongefüllte Sanbfäde
fchichttneife in jmei Sagen im SSerbanb auf. hierbei
füllt man bie Sttnfdjenräume jtoifchen ben Süden unb
ben einzelnen Schichten burch lofen SBeton auS.
305
422. Sei fjroft barf man n i dj t betonieren. Sfritt
n> ft Ij r e n b beS ^Betonierens groft ein, fo muß man
ben Seton burcf) Säde, Sßagenpldnen ober Strolj gegen
bie Sötte fdjüfjen.
3m ©rljärten beftnblidjen Seton barf man n i ä) t
ber Sonne auSfe&en, fonbern muß itjn burd)
naffe Smtfjer ober Sanbfötfe fdjüßen.
423. S)ie Setonbedfdfjidfjt madjt man minbeftenS
0,50 m ftart.
Ster Dberftödje gibt man eine 31 e i g u n g für
SBafferabfluß.
424. S)urdj Beton berftärtte Unterftänbe er»
galten jroedmäßig hoppelte ßugänge, bie man naä) 393
»«^liefet. J- Är 3Q
X 425. S)ie S) e d e eines Unterftanbes roirb burdj Stuf»
bringen bon Seton feljr ftart b e l a ft e t. $ r a g»
traft muß man baljer boj bem, Stufbringen beS
SetonS burdj Unterteilen bon tDIittelftiißen unb Sfb»
ftüßen ber ^nuenroänbe nadj Silb 246 e r Ij ö l) e n.
D. (Ztnricfjien von ©rtfdjaftcn
jur Verteidigung.
426. geuerfteHungen in Sebäuben legt man, um iljr
©rtennen ju erfd)toeren, in bie !E i e f e ber Staunte ober
Zugänge ljinein. (Stnlage bon fjteueiftelturtgen außer»
bau. bon ©ebauben f. 349.) SRuß man geuerfteHun»
gen unmittelbar in Spüren ober §enftern anlegen, fo
berfdfjließt man bie Öffnungen bi§ auf tarnbare Sdjieß»
fdjlifje mit 3tafen», Sanb; I» ober Steinpadtungen ober
burdj Saltenlagen.
Sdjuß gegen Steinfplitter f<f»afft man burcf) Sor»
paden ober Stuflegen bon ®rbe, Stafenftfiden ober ge»
füllten Sanbfaden.
'FO -V?
öUb
S d) i e {d) a r t e n in SRaucrn ^ält man fo Hein
toie ntöglid). Sdjicfcfdjartcn in Sadjcrn tarnt man 3. SB.
burd) bewegbare Sadjjiegcl.
Sd)ioad)e dauern berftärtt man burdj Stnfdjütten
oon ®rbe, Sdjottcr, Steinen, geuerfteHungen agf ©ad)*
höben burd) Hinterfüßen ber ©adjtcile mit Ralfen
ober ftloben.
©rforberlidje Starte ber bedungen f. £a 12.
427. Setter nufjt man als Unterftän auS. SRan
trifft Sorteljrungen gegen SSerfdjütten burd) SSermeljren
ber Bugänge unb SBereitftcHen bon Sdfan^cug.
Seßerbeden berftärtt man burd) Slufb ringen bon
Sollen*, SScton* ober Salfcnlagen. ©ie SBiberftanbS*
traft erfjofjt man burd) ßinbau bon Untcrjügen unb
3roifd)enftügen ober bon ©oppekBmifdjenroanben, bereu
Hofjlraum man mit Sdjotter ober SieS auSfüßt. Seiler*
roänbe berftärtt man burdj ßicljen neuer SBänbe, bie
man mit Slotter ober SieS Ijintcrfüßt, ober burd) SSor*
legen bon Stein- ober ©rX^üttungen.
®egen ®aS bidjtct m Seiler nacf) 33ilb 255 ab.
428. £rtSauSgängc/p e r r t man unb erfefct fie burd)
feitlicfje, getarnte cbcnauSgänge, bereu fdjnelleS
Sdjliefjen man bophercitct. 9(IS SS e g to e i f e r bringt
man — aud) nadjtS beutltcf) fidjtbare — gegen fjeinbftcgt
(aud) aus ber ft) abgeblenbete 3eid)en an.
^öilb 264.
eines großen SellerS als £nftfd)u£tener.
SchußHchfu^
Unterteil
rstarken gegen
Beschuß durch
Vorpackung
ohtenwand 4~6an stark
15-20cm*
240m
Schotter 0.25moder
trde 0,75 m
—f~2,40m
307
429* Site fiuftföugleUer nimmt man Heine ©eHer
ober unterteilt größere nafy Silb 264.
SBeiter legt man gliegerftfjuSgräben nad) Silb 265 an.
Silb 265.
gliegerjdju^grabett.
Querschnitt
Oder
VI. Biwafts unb taget.
A. Allgemeines.
430. gür öorübcrgeljenbe Unterbringung ber Sruppe
int freien genügen Siwatä mit einfadjften Einlagen
jum «Stfjutj gegen Witterung, jur SBafferverforgung,
jutn Slbtodjen unb 2lu§treten.
gür langen Slufentljalt werben bei feijlenber ober
unjureidjenber £)rt§unterlunft Sager mit allen Sin»
ridjtungen für ©aueruntertunft gebaut.
431. ©runbfäfje für Anlage unb «Siebe»
rung öon 33 i w a t» unb Sagerpläfcen enthält
$.©ö.300 ülbf^nitt XII.
432. SJlittel jum S(fju§ größerer Einlagen gegen
feinblidje Suft» unb Srbbeobadjtung finb u. a.:
308
Senneiben auffälliger Sid)tpunlte, Slbfeßen öon Ort»
fdEjaften unb großen Straßenjügen, Slu^itußen öon
SBälbern, Slnftaffen an SebauungSformeit, Scrnteiben
regelmäßiger gönnen, Serftreuen flein gegoltener ©in»
jelanlagen auf weiten Saum.
ScßußgegenSplitterbongliegerbom»
ben ift burd) Serfenten ber Sauten ober umtnaHung
öon gelten unb Sagerftätten, fdjließlid) burd) Schaffen
öon gliegerfdjußgräben (Silb 265) an^uftreben.
433. gür Anlage üon S i w a t § finb in ber
Segel nur bie geltauSrüftung be§ SlanneS, Strolj unb
geringe Slengen bon Jpolj (Stangen, Sretter) erfor»
berlidj.
Saubonßagern f eßt ^eranfdjaffen großer Sau-
ftoffmengen unb geregelten Sadjfdjub üorau§.
434. ®ute§ 91 b w ä f f e r n unb e i n w a n b •
freie SBafferüerforgung (438) finb für bie
Sßaßl be§ £agerplaße§ auSfdjlaggebenb. ßagerwege
finb <ju befeftigen.
B. Bauten.
1. Anlagen jum Sdjutje gegen SBitterung.
435. Serwenben ber ßeltba^n f. §.®b.205/1
(Beltbaljnüorfcßrift).
436. Söinbfdjirme, Sdjußbäcßcr, Jütten unb $ferbe»
pätte baut man nad) Silb 266—276. Sermenben üon
SBeHbled) üerringert bie Saujeit. Sädjer au3 Strolj
ober Scßilf finb wenig geeignet, ba fie fdjwer waffer«
bid)t ju Ijalten finb.
437. Bö«1 <Sd)uß gegen Kälte ffißrt man bie
£)üttenwänbe bofjpelt auf, füllt bie Bwifc9enr“ume
Strolj, $orf, S?oo§, Sägefpänen ober ^oljmoHe unb
üerftfialt bie Seden.
309
Silb 266. «Sinbfdjirnt.
iinbetfung: Sretter, 2BagettpIanen, geltbaljnen, (Strolj ober (Sdjilf.
33ilb 268. ®d)u$bad) für galj^euge.
Sionierbienft
21
310
S3ilb 269.
»retterljütte.
S3ilb 270.
^rettertyütte, toerfentt.
SBilb 271.
gütte an einem gang.
311
23ilb 272.
§aWberfentte §ütte.
SBUb 273.
gaftberfentte §ütte mit btattdjfang.
21*
812
S3Hb 274.
mit Stroljbarf).
Söilb 275.
spfcrbcftnll mit $abbbad).
33x10 276.
sjicrjcuttcr Jßferbeftan.
Wßcm
2. Einlagen jur Stafferuerforgung.
438. SluSfdjlaggebenb für Sraud)barteit eines
SiwatS ober SagerplatjeS ift bie 2R ö g I i d) t e i t
auSreic^enber SBafferuerforgung.
Ser täglidje SBafferbebarf beträgt für:
1 Sftann: Srinten unb Sodjen 4,51, SBafdjen 201,
1 9ßf erb ober 9Raultier: 451 jum Sränten.
439. Srintwaffer aus offenen-(Sctoäfferrr ift? wgtm
man eS nidjt unmittelbar au§ Duellen entue^menfann,
abjulodjen.
Bdjöpfftellen für Erint* unb l?od)Waffer an fliegen^
ben Setoäffern legt man ^ erftrom aller weiteren ?ln*
lagen für SBafferoerforgung ber Sruppe an. Sie er*
galten Safeln mit ber 2luffdjrift „S r i n t w a f f e rl
Äbtodjenl".
Sa§ Ufer befeftigt man, wenn nötig, mit Steinen,
Straud)Wert ober Srettern. Sei niajt genügenber
SBaffertiefe am Ufer baut man turje Stege in baS
SBaffer Ijinein. R-M ^>w»r 5 $
-440. fjladje unb fc^male (Sräben tann man burd?
einfache Stauanlagen jurSBafferentna l) me ein*
ridjten. empfiehlt fid), einen IjerauSneljmbaren
Stiebet einjubauen, um trübes SBaffer ableiten gu
tönnen.
441. Sräntftetteu erforbern fladjeS unb fefteS Ufer
unb allmäljlidje ßuna^me ber Sßaffertiefe. Sefäljrlid)e
Stellen — Siefen, ftarte Strömung — finb abjufperren.
Sei Seen finb bie Ufer jtoar päufig flacf), aber oft
wenig feft ober fümpfig, fo bafj ba§ SBaffer burd) §in=
eintreten ber Sßferbe getrübt wirb. Sann (teilt man
jum Sränten Sröge auf. / SR
442. ^oljtröge baut man nad; Silb 277 au§ ftarten,
rifjfreien Srettem, bie burdj übergenagelte Duerleiften
jufammengeljalten werben, gugen bicfjtet man mit
sBerg ober Seiften mit aufgenagelten Sudjftreifen. Sröge
Ijält man ftetS gefüllt, bamit fie bic^t bleiben.
314
Jja.
Silb 277.
§oljtröge.
§
Schnitt A~B
0,35m
O25m
B V*^' )r^T
443. Sor^anbene Brunnen unb jumpen finb, toenn
.gtoeifel an ber SSraudjbarteit beS SBafferS^^.^epen,
burd) einen Sanitätsoffizier bor bem ufcen auf
®raud)barteit zu unterfud)en.
Söurd) tafeln ift ifjre ®ign zur Entnahme bon
Srinfmaffer ober bon SBaffer^um Sfodjen, Xränlen ober
Sßafdjen tenntlid) zuunadjen.
3u wenigSßaffer liefernbe ^Brunnen fann man burdj
Vertiefen ebiger madjen. 9Kan rammt rings um
bie artfnenfot)Ie_eine SSanb auS $foften ober Sollen
" " -W Vs ber Sfermmtiefe auS.
444. gelbbraunen (§. ®o. 287) fetj t man bei Srunb»
toaffer bis etina 6,5 m Xiefe unb bei geilen anberer
2ßajferberforgung§mögli(f)£eiten.
-445. Sluff^Iufeübet bie^runbmaffer*
berljaltniffe geben borljanbene ^Brunnen ober
SBoJjrungen.
gladjeä Srunbmaffer finbet man in ebenem, meift
fanbigem ©elänbe unb in Sanb» unb ®ie§fdji(f)ten
unter lehmigem ©ötjenboben. 3®e^mä6ig bofjrt man
in <Sanb= ober Kiesgruben, im Sebirge in Selänbe»
einfdjnitten unb Xalfoblen.
KieberungStoiefen, SJioor unb Sumpf führen nie
braudjbareS Srintmaffer.
315
fjelbbrunneninber Stä^ebonfJIüffen
mit tiefigem ober fanbigem ®runb geben, aud) wenn
baS SSaffer beS fJluffeS oorübergefjenb burdj Stegen»
güffe öerunreinigt ift, meift tlareS SBaffer.
Silb 278.
SeljelfSmiigiget Stututen.
446. StefjelfSmäftige Brunnen baut man nad)
®ilb 278—280. ©er 33au beginnt mit bem SluSfjeben
einer ®rube ober Slbteufen eines 23runnenfd)ad)teS bis
bidjt über bem ©runbioafieripiegel. ®on ber Gofjle
auS treibt man ben SBrunnenfeffel (eine Sonne ober
einen feften §ols!aften oljne ©oben mit gefdjärftem
unteren Staub) in bie toafferfüljrenbe Gdjidjt.
®aju gräbt man ben naffen SSoben auS unb fdjlägt
ober tritt gleichzeitig auf ben oberen Staub beS
ffirunnentefjelS.
Sie Goljle beS SSrunnenfeffelS bebedt man 10—20 cm
ftarf mit SieS ober Gdjotter als ® l ä r = (g i 11 e r»)
© dj i cf) t.
316
33tlb 279.
BetjelfSmüfjiger 3idjbtunncn.
S3ilb 280.
SdjelfSmäfjtget Srmtne« mit
Sßinbe.
Sft genügend $eit borljanben, berlängert man ben
Srunnenteffel mit Stammen (Silb 27,9 u. 280) nad) oben
unb tjinterfüllt üjn mit ®ie§.Av*|* yr1
S)a§ Soffer förbertman mit ^Iügelpumljen/ SSinben
ober Sdjtoungbäumen mit Eimern.
447. Srunnen ergeben nur bann Her,
wenn man iljren UmtreiS burd) fßflaftem ober Sollen®
belag gegen Serfdjtammen ober Serunreinigen fd)ü|t
unb offene Srunnen einbedt. Xränt» unb SSafcfjfteHen
barf man nidjt in bie Jiälje oon Xrintmafferbrunnen
legen.
448. 23erfd)Iammte Srunnenfoljlen finb
um ettoa 30cm ju bertiefen unb mit einer ®IärfdE)id)t
au§ f bem ®ie§ bon gleicher Starte ju berfeljen. 8er»
faulte 53runnenrof)re finb auSsutoedjfeln.
817
SBilb 281.
Kläranlage fttr trübeS SBrnnnen«
ivaffer.
ffutenlagen
Zerkleinerte Kohl
Steinschotter
449. XrübeS SBaffer läßt man jum ©löten
burdj ©ieS, reinen feintömigen Sanb, burd) jertleinerte
ßoh=, Seger ©nodjentoljle ober eine 1—2 cm ftarte
SeflftoJflage jtoifdjen 2 Sraljtfieben laufen.
SOtan bringt — fe
nadj ber SJienge beS
ju tlärenben. SSafferS
— eine 0,15—1,00 m
ftarte ©lärfdjidjt in
ein paffenbeS ®efäfj
unb fdjlteßt es nad)
beiben Seiten mit
grobem Sanb, ©ieS,
Sdjotter, treujweiS
( legtem Strolj, 3tu=
tenlagen, burdjlodjten
$oljböben ober 2)raljt|ieben ab
®l
1
(Silb 281 u. 282).
fflilb 282.
Kläranlage für trübeS Stinftvaifer.
Sold)e Anlagen liefern erft nad) einiger Hare3
SBaffer. Srübt fidj ba§ SSaffer toieber, fo muß man bie
©lärftoffe erneuern.
©ranttjeitäerreger werben burdj bie ©lärftoffe n i dj t
befeitigt. S)al>er ift öor bem ®enuß be§ 2ßaffer§ ein
Sanitätsoffizier ju befragen ober ba§ SBaffer abju»
tod>en. Sleinigenbe Stoffe — ©alt, Sllaun, ßßlor —
barf man ebenfalls nur nad) ^luljören eines SanitätS»
ofpjierS jufe|en.
318
3. Anlagen für Stodjen unb geilen.
450. fiodjcn auf offenem geuer im freien ift au3
Sarngrünben ju bermeiben. Sft bie§ nid)t möglidj,
SBilb 283.
todjt man in Keinen Sräben ober Södjern naä)
SBilb 283 ober auf §erben au§ Steinen ober SRafen»
platten.
451. gn Sagern baut man jur Sponung ber
gelbfüdjen §erbe. Srofje Sfeffel mauert man ein.
452. ^leinegelte fann man burdj ljeifjgemad)te
Siegelfteine, bie man in ein Sod) legt unb mit Erbe
pbedt, für turje geit erwärmen.
SröfjeregelteunbSaraden tann man mit
burdjlaufenben ^eijrotjren, bie ganj ober Ijalb in
ber Srbe liegen, berfefjen. Sie Jpeijroljre münben
aufjerljalb ber gelte auf ber einen Seite in Sdjorn»
fteine, auf ber anbern in ettoa 1,20 m tiefe gfeuerlödjer,
auf benen man audj todjen tann.
453. Siferne ^eiaroljre finb burdj ©oIj•
tttänbe mit befonberem SBleajfdjufc ju führen, um
S3ränbe ju bermeiben.
319
4. Anlagen für SlbfaUftoffc.
454. Slbfallgruben legt man in auSreidjenber Batjl
dbfeitS be§ £ager§ an. Sie finb häufig mit ®rbe ober
9I[d)e ju bebeden unb mit ß^Iortalt ober Sarbibreften
ju entfeudjen.
VII. (Eifenbatynbeljelfsrarrtpen.
455. SOurd) ben Sau bon SehelfSrampen auf freier
Strede ober auf Sahnhöfen mit nur wenigen, ftänbigen
Stampen erleichtert unb befdjleunigt man ba§ ®in= unb
SluSlaben bon Sruppenjügen, wenn ©ntlabegerät nid)t
rechtzeitig ijerangefdjafft ober nidjt in ben Bügen mit»
geführt werben fann.
456. Seeignete Stellen für ben Sau bon
SehelfSrampen finb etwa waagerecht berlaufenbe ®leife
unb Sßegeübergänge ober SBege, gleidjlaufenb jum
Sahntörper, Fahrbahnen etwa in Sdjienenhöhe. Sin
Streden mit ftarfem Füll ift ber Stampenbau ju ber»
meiben, ba bort baS Sewegen bon ©ifenbahnwagen unb
ba§ ®in= ober SluSlaben fcpwierig ift.
457. Stampen foöen möglichft nicht fteiler als
1:5, b. h- bei 1 m Jpölje minbeftenS 5 m lang fein.
Stampen jum ©ntlaben bon gahrjeugen über 4 t gibt
man eine flachere Steigung, etwa 1:9.
458. ®ie S8 r e i t e ber Stampen (Seiten» ober ft'opf»
rampen) beftimmt man nach ihrem Bwed unb ber
SBenbigteit ber auSjulabenben fjahrjeuge; SBreite für
®opf» unb Seitenrampen 2,50—3 m. Seitenrampen
baut man breiter, wenn man baS ©ntlaben befdjleuni»
gen ober baS Sntlaben bon Sraftfahrjeugen erleichtern
wiH.
459. 211S Sauftoffe für SeljelfSrampen tommen in
Frage: (Sifenbahnfchienen, C=Stahle, Salten ober
Saumftämme als Sragbalten; SchtoeHen, Sohlen,
820
Im Notfall aud) ftarte Sore unb Suren al§ 53 e lag.
©tuen Slnljalt für bie erfotberlidjen Starten ber SBau«
ftoffe geben bie Safeln 17—19. S)te bort angegebenen
ffllafje für 2»t=®rüden mit 2 m galjrbafjnbreite genügen
für 2-t>3?ampen bon 2,50 m galjrbaljnbreite.
460. SSetjelfärampen au§ S dj t e n e n unb S dj m e l«
len tann man nadj 53ilb 284—286 bauen, ift § o I j in
genügenber äUenge unb -Starte nerfügbar, audj nach
Silb 287—291.
SBilb 284.
Seiteurambe auS £)berbau«®auftoffen.
95orberanfid>t.
30cm
{?ür 7,5 Ifb. m Stampe toerben benötigt:
Sauftoffe unb Sinbemittel: 2 ftopfftüfcen (Stapel): 10 ®ifen-
bapnfdjtoeHen, 2,50—2,70 m lang, 16/26 cm; 4 Sdjtoenenftücte, 1,25 m lang,
16/26 cm; 7,5 Ifb. m @ifenbatjnfcijienen; 40 klammern; 20 Sdjienennägel
ober SdjtoeHenfdjrauben.
HRittelftüfce: 3 ©ifenbaljnfdjtoellen; 18 $altepfäljle, 0,50 m lang, 8 bis
10 cm 0.
©nbauflager: 3 SifenbapnfdjtoeHen als UferbalTen; 3 ©ifenbapn-
fdjtoenen als Stoffballen; 15 £altepfäple, 0,70 m lang, 8—10 cm 0.
Überbau: 6 Sdjienen, ettoa 6,60 m lang; 75 ©ifenbapnfcptoeUen als
Selag; 27 klammern; 48 Sdjienennägel ober Sebtoellenfdjrauben jum Se-
feftigen ber Schienen auf ben Stüfcen; 18 m 2)raljt, 3—5 mm 0.
321
äBertjeug unb ©erät: 4 Kreugljacfen; 4 (Spaten; 1 $anb|äge;
1 €djrotfäge; 2 ©djlegel; 2 SBeile; 2 Sorfdjlagljämmer (für SdjtoeHen-
farauben: 2 (&djtoeuenfdjraubenboljrer unb 2 S^toeHenf^raubenf^Iüffel);
2 Kneifgangen; 1 SRefeftab gu 2 m.
Kräfte : 1 ©nippe.
Seit: 36 SIrbeitSftunben, bei 1 ©ruppe 3 Gtunben, oljne Slnbeförbem
auftoffe.
® e to i dj t: rb. 8,81; 9—12 gtoeifpännige ^aljrgeuge ober 3 34<8aft-
fcafttoagen.
Söilb 285. ®eitenram|)e ait§ DfcerfcattsSBattftoffen.
Q3orberanfid)t
Eisenbahnschwellen 2.5 -2,7m
16126cm
8eitenanfid)t.
ftür 7,5 Ifb. m IRampe toerben benötigt:
Sauftoffe unb Sinbemittel: Kopfftüfce (Stapel): 9 @ifen-
baljnfdjtoellen; 12 ^ßfäljle, 1,50 m lang, 10—15 cm 0; 18 m ©rapt, 3—5mm0.
SRittelftüfce: 9 ©ifenba^nfdptoeuen; 18 $altepfäple, 0,50 m lang, 8 bi3
10 cm 0; 24 Klammern.
©nbauflager: 3 ©ifenbaljnfdjtoeilen al§ UferbalTen; 3 ©ifenbaljn-
fdjtoeüen aI3 Stoffballen; 15 £altepfäple, 0,70 m lang, 8—10 cm 0.
Überbau: 6 Sdjienen, ettoa 6,60 m lang; 75 @ifenbapnfdjtoeHen als
Belag; 27 Klammem; 60 Sdjienennägel ober Sdjtoeüenftfirauben gum
SBefeftigen ber Schienen auf ben Stüfeen.
SBertgeug unb ©erät: 4 Kreugljacfen; 4 Spaten; 1 $anbfäge;
2 Sdjlegel; 2 Seile; 2 Borfdjlagbämmer (für ScbtoeHenfdjrauben:
2 Sdjtoeuenfdjraubenboljrer unb 2 Scfetoellenfdjraubenldjlüffel); 2 Kneif-
zangen; 1 2ftefcftab gu 2 m.
Kräfte: 1 ©nippe.
Seit: 36 Slrbeitäftunben, bei 1 ©nippe 3 ©tunben, otjne SInbeförbem
auftoffe.
©etoid^t: rb. 8,8 t; 9—12 gtoeifpännige ^a^rgeuge ober 3 3=t=ßaft-
trafttoagen.
322
SBilb 286. ^ot)fram|)e au§ £)berbau=S3auftoffett.
S aufto f f e unb Sinbemittel: ^opfftüfce: 6 @ifenbapnfdjtoellen;
4 klammern; 2 Solgen, 3 cm 0, 0,70 m lang.
HRittelftüpe: 3 @ifenba^n|tf)toellen; 3 SdjtoeHenftücfe, ettoa 0,85 m
lang; 20 klammem.
©nbauflager: 1 ©ifepbaljnfcfitoelle al§ Üferbalfen; 1 (Sifenbaljnfdjtoelle
al§ Stofebalfen; 5 £altcpfäl)le, 0,70 m lang, 8—10 cm 0
Überbau: 2 Schienen, 7,50 m lang; 28 @ifenbafmfcl)toellen al§ Selag;
20 SÄjienennägel ober ©tfitoellenfcfjrauben gum Sefeftigen ber Schienen
auf ben Stüpen.
©elänber: 2 ®elänberftüpen, 3 m lang, lOcm0; 2 ©elänberftüpen,
2,20 m lang, 10 cm 0; 2 ©elänberftüpen, 1,60 m lang, 10 cm 0; 15 Ifb. m
©elänbcritangen, lOcm0; 18 Sägel, 15 cm lang, ober 6 m Sanbetfen
mit 84 Säg ein.
SSerfgeug unb ©erät: 2 Äreugpaden; 2 Spaten; 1 £anbfäge;
1 Scfjrotfäge; 2 (Sdjlegel; 2 Seile; 2 Sorfdjlagpämmer (für SdjtoeHem
fdjrauben: 2 Sdjtoellenftfiraubenboljrer unb 2 StptoeHenfdjraubenfdjIüffel);
1 ^olgboprer, 3cm0; 1 Sdjraubenfdjlüffel; 1 Sraptfdjere; 1 Äneifgange;
1 Siefjftab gu 2 m.
Kräfte: 1 ©nippe.
Seit: 48 Slrbeitäftunben, bei 1 ©ruppe 4 Stunben, oljne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
©etoirfjt: rb. 3,6 t; 4—5 gtoeifpännige galjrgeuge ober l1/2 3-t*
ßaftfrafttoagen.
323
SBilb 287.
4=t=Seitenr am Ve.
SBorberanjidjt.
7,00 m —4
B
93ilb 288.
e^nitt ju QSilb 287.
gür 7 Ifb. m JRampe Werben benötigt:
Sauftoffe unb Sinbemittel: ^opfftüfce: 5 Sfäple, 1,50 m
lang, 14 cm 0; 1 $o(m, 7,00 m lang, 14/16 cm; 10 klammem.
HRittelftüfce: 10 (5djwellen, 1,00 m lang, 14/16 cm; 1 $olm, 7,00 m lang,
14/16 cm; 20 klammem.
(Snbauflager: 1 UferbalTen, 7,00 m lang, 14/16 cm; 2 (Stofjboljlen,
3,50 m x 25 cm x 6,5 cm; 10 £altepfäljle, 1,00 m lang, 10 cm 0.
Überbau: 10 Sragbalten. 9,00 m lang, 16/22 cm; 72 Selagbotjlen,
3,50 m x 25 cm x 6,5 cm; 200 Slägel, 10 cm lang; 30 m Sanbeifen;
800 9lägel, 7 cm lang.
Sßertgeug unb ©erät: 2 ^reugtjaden; 2 (Spaten; 1 $anbfäge;
1 (Sdjrotfäge; 4 (Sdjlegel; 2 Seile; 1 ©raljtfdjere; 1 ^neifgange; 1 Slefeftab
gu 2,00 m.
Kräfte: 1 (Gruppe.
Seit: 48 SlrbeitSftunben, bei 1 ©nippe 4 (Stunben, oljne Slnbeförbem
ber Sauftoffe.
Drtbalten unb Selag legt man an ben ©tofjfteHen
(St in Silb 287) bidjt nebeneinanber. Selänber ift ent»
324
betjrlid). Stöbelballen fallen fort, ©en Selag nagelt
man auf bie Ortbalten, fjinbet man nicfjt genfigenb
lange Jpolme, fo baut man j. 93. 2 Stampen öon je
3 m Sreite bid)t nebeneinanber. 8113 SRittel»
44=ißlattf ormrambe.
Silb 289.
SBilb 290.
Schnitt A—B.
------9l°°m /ftanstrk “
I r-—----------—
, j H___________|_______Won-V™Sa*
i ii Ü V
825
SBilb 291.
edjnttt C—D.
Sauftoffe unb Sinbemittel: Plattform: 21 ^ßfatjle, 1,50 m
lang, 14 cm 0; 3 $olme, 9,00 m lang, 14/16 cm; 15 Sragbalfen, 9,00 m
lang, 16/22 cm; 108 SelagboEjIen, 3,00 m x 25 cm x 6,5 cm; 45 m Sanb’
eifen, 450 Slägel, 7 cm lang; 220 üftägel, 10 cm lang; 42 klammern.
Stampe: 10 Sßfäljle, I»o0 m lang, 14 cm 0; 2 £olme, 6,00 m lang,
14/16 cm; 1 Uferoallen, 6,00 m lang, 14/16 cm; 2 (Stofjboljlen, 3,00 m
x 25 cm x 6,5 cm; 8 ^altepfäljle, 1,00 m lang, 10 cm 0; 10 Sragbalfen,
9,00 m lang, 16/22 cm; 72 Selagboplen, 3,00 m x 25 cm x 6,5 cm; 30 m
Sanbeifen; 300 Slägel, 7 cm lang; 180 Släael, 10 cm lang; 20 klammern.
SBertgeug unb ®erät: 4 Äreuggacfen; 4 Spaten; 2 Jpanbfägen;
2 ©djrotfägen; 8 ©flegel; 4 Seile; 2 ©raptfdjeren; 2 ßneiföangen; 2 Wtefc*
ftftbe gu 2 m.
Äräfte: 1 8ug.
Seit: 160 SlrbeitSftunben, bet 1 gug 4 ©tunben, oljne SInbeförbem
ber Sauftoffe. *
ftüfcen genügen aud) Sollen, SdjtoeÜen ober ®ant=
^ßljer, bie man burd) ‘^fätjle feftlegt.
2ll§ ^opfftü^en öertoenbet man ißfafjljodje, bet
feftem Soben an iljrer Stelle SdjtoeHiodje, Sd)toeHen=,
Sollen» ober Sretterftapel ober niebrige SJtaurerböde,
bie man burdj Sfäijle, Spreizen ober Streben befeftigt.
461. SRufj man auf einen SBeg entlaben, ber an ber
ben Steifen abgefeimten Seite ftart abfällt, fo baut man
eine Plattform, an bie man bie Stampe u n m i 11 e l =
bar, mit bem Satjnfßrper gleidjlaufenb, aufdjiiefjt
(Stattformrampe Silb 289—291). ©ie Plattform mufj
minbeftenS 9 m lang unb 9 m breit fein.
462. Snttaben öon ©raftfaljrjeugen be=
fdjleunigt man, toenn man fie über Siattformrampen
entläbt, bei benen man bie Stampen, falls genügenb
Stafc öorljanben, red)ttointlig ju ben Steifen an bie
Plattform anfdjtiefjt.
Stonterbtenft 22
326
463. (Statt tjöljerner Stampen tann man ©rbrampen
bauen, beren ©tirnmaub man mit Sollen, Brettern
ober Stramfjwert unb ißfäljlen ftütjen unb beren Ober»
flädje man befeftigen muß. 3f)r S8au bauert länger unb
ift fcfjioieriger al§ ber tjöljerner Stampen.
VIII. $td)erl)ettsbefttmmungen.
A. Sid)crl}ettsbeftiinmungen fiir Derwenben
oon ptorner=Spreng= unö Sünbrrtitieln im
Trieben unb im Kriege*).
1« Ogemeine^.
464, Sei üorfdjriftSmäßigem ^anbpaben ber Spreng*
unb günbrnittel beftept feine ®efapr. SSerftöfee gegen
borfdjrift£mäßige3 Jpanbpaben unb gegen bie Sicper*
peit^beftimmungen tönnen jebocp ju Unglücföfäften
führen unb finb baper ftrafbor.
465. 2IIIeDffiäiere,Unteroffiäiereunb
m ö g I i cp ft a p I r e i cp e Sftannfcpaften, bie
gemäß Sorbemertung im Sprengen au^ubilben finb,
müffen bie Spreng* unb Bünbmittel fo fennen, baß fie
beren Sraucpbarteit prüfen unb beurteilen tönnen.
466. gür alle militärifcpen ÜbungS*
pläße, auf benen gefprengt toirb — b e *
fonberS bie im bebauten Selänbe gele*
genen —, finb ö cp ft f ä ß e für Spreng*
labungen, bie fid) au§ Srfaprungen unb
ben örtlicpen ® e r p ä 11 n i f f e n ergeben,
burep bie guftänbigen 9 o m m a n b e u r e
ober Sommanbanten in gufammenar*
*) 5Iu(p im Kriege gelten 474, 475 5Ibf. 1, 476—478,
482—484, 487—489. Qntoietoeit bon ben Seftimmungen
nach 468—470, 479 unb 485 abgetoiepen toerben barf, be*
ftimmt ber örtliipe §üprer.
327
beit mit ben örtlichen ^oligeibeljörben
feftzufe^en, f o to i e Sprenggruben an5u
legen.
467< Sprengungen außerhalb militärifeher
Übungsplätze finb ber $oli$eibel)örbe mitzuteilen unb
öffentlich befannt$umacf)en.
SOMt Anliegern ift rechtzeitig in Serbinbung zu treten,
bie Qett ber Sprengung ihnen mitzuteilen; genfter nahe
gelegener Sebäube läfet man bor bem Sprengen bon
Sabungen über 2 kg im UmtreiS bon 300 m. bon ber
Sprengftelle öffnen.
468. $eber Sprengplafz ift burd) Slbfperrpoften, auch
bon ber Polizei unb ®enbarmerie, ringsum fo meit ab*
Zufperren, mie Sprengftüde fliegen tönnen (StdherheitS=
bereif). ®ie Slbfperrpoften marnen alle ^erfonen bor
bem betreten beS Sicherheitsbereiches unter JpintoeiS
auf bie bamit berbunbene SebenSgefahr.
469< ®ie Ofperrung beginnt nach bem §orn*
f i g n a l „Sammeln" (479).
Sei größeren Sprengungen beftimmt ber Führer
einen Unteroffizier als $bfperrpoften=gührerr bezeichnet
ihm an Ort unb Stelle bie Srenzen beS SidherheitS*
bereidheS, bie ^lä^e für 3ufd)auer, gahl unb Stärte ber
Slbfperrpoften unb ettoaige %ad)rid)tenberbinbungen
Aftrifchen biefen. ®iefer Unteroffizier fteHt bann bie
poften auf unb Übermacht fie.
®er 2lbfperrpoften*gührer ift fo aufzufteüen, bafj er
möglidhft grofje ®eile beS Sicherheitsbereiches überfehen
fann. Sobalb bie Slbfperrpoften ftehen unb ber Sicher*
heitSbereidh bis auf Spreng* ober günbtruppS frei be*
funben ift, melbet ber 2lbfperrpoften*gührer bieS bem
Rührer.
Semerten bie SIbfperrpoften, bafj unbefugte ^erfonen
ben SidherheitSbereidh betreten, fo melben fie bieS fofort
22*
328
bem für ben Slbfperrbienft öeranttoortlidjen gütjrer, ber
iljre Entfernung ober bie Vorläufige geftnaljme Per»
anlaßt.
Erft nad) bem §ornfignal „3K a r f d>" geben bie
Slbfperrpoften ben Sid)erl)eit§Bereid) frei.
470. SBejtimmte Slbmcfjungen für ben Sidjer»
!jeit?bereidj laffen fidj nidjt geben. Ser fjüljrer
ift üeranttoortlidj unb muß ben Sereidj nadj 2Irt ber
Sprengung, ®röfje ber Sabung unb ben örtlidjen 83er»
Ijältniffen beftimmen.
Sprenglabungen Wirten burd) Splitter unb Spreng»
trümmer, burd) SBobenerfdjütterung unb burd) ßuft»
brud auf bie Umgebung ein. E? tönnen folgenbe
Sperrtreife, um Sefdjäbigung üon ®ebäuben, j. SB.
burdj 9?iffebilbung, gu vergüten, al? Slnljalt bienen:
gür Sprenglabungen unb StnaUjünbfdjnüre
bi§ 2 kg 200 m §albmeffer
über 2—10 kg 300 m
» 10—30 kg 500 m
unb über 30 kg 1000 m
$um Serljüten fonftiger Sdjäben ift folgenbe? ju
beadjten:
Sei offenen Steinfprengungen muß ber Jpalbmeffer
be? SidjertjeitSbereidje? minbeften? 500 m, bei offenen
Stat)lfprengungen minbeften? 700 m betragen, ba bie
jaljlreidjen Splitter feljr weit fliegen tönnen. Sind) für
Sprengungen öon §olj, ba? mit Eifenteilen üerbunben
ift, unb für Erbfprengungen, bei benen Steine au? ber
Erbe tjerauSgefdjleubert werben tönnen, gelten bie
gleichen Slbfperrmafje.
SBerben Stein» ober Staljlfprengungen in burdj
gafdßinen bidjt abgcbedten Sprenggruben ober Ijinter
9iuffangüorrid)tungen au? gafdjinen, Strand) ober
Sünger au?gefüljrt, fo tönnen bie Slbfperrgrenjen per»
329
ringert toerben. ©ie 2luffangborridjtungen finb fo an»
jubringen, bafe fie burdj bie Sprengwirtung nicfjt jer»
trümmert toerben.
471. ©ie 3teid)toeite b e § fiuftbrntfö unb ber
Sobenerfdjütterung bei gröfeeren Sprengungen feängt
bon ber ®elänbeform, SJobenart, Bebauung unb bem
©runbwafferftanb ab. Mgemeine SDlafee laffen fid) nicf)t
geben. gn engen Salem nnb Scfjludjten unb in
Strafeen wirtt ber Suftbrutf ioeiter al§ in ber freien
©bene. gelSboben unb Srunbmaffer pflanzen Grfdjüt»
terungen »eiter fort al§ Sanbboben.
472. ift jroedmäfeig, bor gröfeeren S p r e n =
gungen SB a u t en ber Umgebung auf 9?i f f e
int SRauerwert, abgefallenen 5ßufe unb
fonftige Sdjäben ju unterfudjen, um fonft
*u erwartenben @ntfdjübigung§anfprüdjen borjubeugen.
um etwaige SBergröfeerungen borfjeriger Sdjäben feft»
jufealten, tann man fie bor ber Sprengung im Jöicfjtbilb
fefttjalten, über Stiffen aud) fßapier» ober SlaSftreifen
befeftigen.
473. © a 3 g fi n b e n fdjarfer Spreng» unb
günbmittel unb ba§ günben bon
bung3»SprengmitteIn (mit SR a u dj I a»
bung) in gefdjloffenen Räumen ift verboten.
gebe günbung fdjarfer giinbmittel ift eine Spreit»
gung unb barf beSfealb nur unter ben für Sprengungen
angeorbneten 23orfid)t§maferegeln burdjgefüfirt werben.
474. gm SidjerljeitSbereidj liegenbe Startftromlei»
tungen finb bor Sprengungen mit elettrifdjer ßünbung
au§;juftf)alten. Sprengborbereitungen finb bei S e»
totttergefaferju unterbrechen.
2. Sprengungen.
475. 2ln bie S p r e n g ft e 11 e n finb nur bie b e =
nötigten Spreng» unb Sünbmittel mitju»
330
neunten, ©er 3ieft ift unter ©emadiung aujjerljalb beS
SidjerljeitSbereidjeS ober in Unterftänben <ju lagern.
©er Jüljrer ift für rechtzeitiges unb üoUftänbigeS
iübliefern nicht verbrauchter Spreng= unb günbmittel
verantwortlich. 9£adj bem Sprengen ift ein 21bfdjlu|j
über ©eftanb unb ©erbraudj ju machen, ben ber Jührer
$u unterfdjreiben Ijat.
476. Offene^ Jener unb Waudjen in ber Stähe öon
Spreng- unb ßiinbmitteln ift üerboten.
477. Slühäünbapparate ober ® ä ft e n mit
eleftrifdjen Batterien finb bi§ jum Sebraud)
berfdjloffen ober verfcfjraubt gu halten. SBermahren ber
Sdjlüffel be§ ©lüljjünbapparateä unb be§ SeitungS»
prüferS f. 510.
478. ©er mit bem Bünben oon Seitfenerjiinbnngen
^Beauftragte mufj beim Bünben von einem ©tann be«
gleitet werben.
©rennt bie Seitjünbfdjnnr nach bem SInfeuern, fo fyit
ber Bünbenbe laut „©rennt!" ju rufen unb burcg lautes
Qähletr im Selunbentempo ober nadj ber llijr bie un«
gefällte Beitbauer bom Slnfeuern bi§ jur ©etona«
tion (bei übung§=Sprengmitteln mit Staudjlabung bis
jur Sntjünbung ber SRaudjlabung) nadjprüfen ju laffen.
über bie Sänge ber 3e<Uünbfchnur bei Seitfeuer«
jünbung f. 23.
ßlettrifebeS Bünben erfolgt von BünbfteHen au§, bie
entroeber außerhalb be§ SittjerljeitSbereidjeS ober völlig
gegen Splitter ober Sprengtrümmer gefdjütjt liegen
müffen.
479. Sille Signale bei fc^arfen JriebenSfprengungen
finb mit bem § o r n ju geben, ©ie ^»ornfignale
bürfen nur bei Übungslabungen mit f^arfen Bünb«
mitteln Wegfällen unb vom Jüljrer burdj 3uruf ober
pfeifen erfeijt werben.
331
Stuf baS §ornfignal „Sammeln" rüdt bie ©ruppe auf
bie befohlenen Sammelplätje. Ser SidjerheitSbereich ift
abjjufperren. Ser güljrer überzeugt fid), bafj ber Sicher»
heitSbereid) bis auf bie $ünbtruppS frei ift unb bie
Sabung (Sabungen) jünbfertig gemacht wirb (werben).
®leltrif<he3ünbleitungen bürfen bis jum
fiomfignal „Sammeln" leine gefdjloffene
Kreisleitung bilben.
83 o r prüfen ber ©erbinbungen auf S^urjfcEjIufe (518)
unb ber gcfd)Ioffenen Kreisleitung auf ÜSiberftanb (519)
ift baS §ornfignal „Sammeln" ju geben. Sarauf ift
ber Sid>erl)eit§bereid) ju räumen. 3ft bie Prüfung auf
Kurjfchlufj burdjgefütjrt, fo läfet ber Rührer bie Kreis»
leitung fjerfteHen (519) unb hierzu ben Sicherheitsbereich
burch beftimmte Seute betreten. ©aS prüfen ber ge»
fchloffenen Kreisleitung mit bem SeitungSprüfer barf
erft bann erfolgen, wenn biefe Seute jur günbftelle
jurudgetehrt finb.
480. ©aS §ornfignal „fjcuern", baS bei j e b e r e i n *
j e l n e n S p r e n g u n g s u m i e b e r h o I e n ift, barf
nur auf befehl beS Führers geblafen werben. Sarauf
Wirb gejfinbet.
481. SaS $ornftgnal „ffflarfdj" barf nach bem
Sprengen nur auf befehl beS Führers gegeben werben,
©arauf barf ber Sicherheitsbereich bis ju einer Dom
gührer bezeichneten Stelle fieber betreten werben.
482. Scfprcngte Okbäube unb ©rüden bürfen erft
bann betreten werben, wenn ein Sinftürjen Don
©eilen nicht mehr ju erwarten ift. Sefprengte SRinen®
gänge*) unb §ohlräume bürfen, weil fie nach bem
Sprengen mit giftigen ®afen gefüllt fein lönnen,
erft nach grünblidjem ©ntlüften unb nach Anlegen Don
•) S3ei fJriebenSfprengungen bürfen gefprengte SKitten»
gänge (Stoffen) erft nadj 24 Stunben toieber betreten toerben.
332
Sauerftofffd)u£gerät betreten toerben. Oft finb bie
Wtannfdjaften öor bem betreten angufeilen unb burdj
befonbere Signalleinen mit einem bereitgefteHten
SlettungStrupp gu Oerbinben. Bu beachten ift, bafe
bereits entlüftete §ofelröume burdj 9ladjftrömen oon
Safen au§ Erbjpalten toieber oergaft toerben tönnen.
483. 23eim 5Berfagen einer Sprengung mit Seitfeuer»
giinbung barf man erft 15 Wlinuten nad; Slblauf ber
normalen SBrennbauer ber oertoenbeten Beitgünbfdjnur
(478) an bie Sabung Ijerangeljen. Qünbfdjnur, audj
ntdjt bi§ gut Sprengtapfel burdjgebrannte (meift an ber
2lufeenflädje gu ertennen), barf nidjt erneut gegünbet
toerben.
484. Verfugt eleltrifdje ßiinbung, fo finb fofort bie
SeitungSbrätjte abgunefemen. Sobann ift nadj 520 gu
verfahren.
Sebodj barf ber SidjerljeitSbereidj früfeeftenS
nad) Ablauf oon 15 SDlinuten nadj bem Bünben betreten
toerben.
485. Entloben oon Sabungen, bie mit
einerfeftenübtaffe, to i e ® i p §, SJlörtelober
Bernent, allein ober in SBerbinbung mit
anberen Stoffen ober SRitteln ber«
bämmt finb, unb bon SJoijrlabungen fo»
wie Einbringen neuer Bönbungen in
feft berbämmten Sabungen ift oerboten.
Solche Sabungen finb burdj Sprengen neuer, in iijrer
9t ä t) e angebradjter Sabungen gu bernidjten.
58eim Aufräumen ber Sprengtrümmer ift 58 o r f i dj t
geboten, ba nidjt gur Entgünbung gebrachte Spreng»
unb Bünbmittel ber UrfprungSlabung in ben Spreng«
trümmern liegen tönnen.
486. Eeljen beim Sprengen Sabungen
ober Bünbmi11eI oerloren unb toerben biefe trofe
fofort anguorbnenben 9tadjfud)en§ nicfjt gefunben, fo ift
4;'-^. 333
bie Umgebung ber ©prengfteüe, wenn angängig, burdj
rote gäfjndjen ober fonftige SSarnjetctjen ju bejet^nen.
Siegt eine foldje ©teile auf militärifchem Selänbe, fo ift
ihr ^Betreten ju »erbieten. gn allen anberen fällen
pnb bie juftänbigen $olijeibehörben ober ßanbräte ju
benadjridjtigen, bie burtf) öffentliches Setanntmadjen
bie Seüölterung öor ^Berühren gefunbener Spreng* unb
günbmittel warnen unb jum fofortigen SKelben ber
gunbe aufforbern.
3. Seförbern unb Sagern von ^ionier=®preng= unb
günbmitteln.
487, SBeim Seförbern oon ©preng* unb günbmitteln
jur ©prengfteHe nimmt ber gütjrer ©prengfapfeln unb
©tübjünber an fid) ober übergibt fie einem Unteroffizier.
488. ©preng* unb günbmittel, bie in ber
9tähe einer ©prengfteüe lagern, finb j u bewachen.
Trennung beim Sagern (18g), ©d>uh gegen 2Bit=
terungSeinflüffe unb gegen feinblicheS geuer ift oft
erforberlid).
Dian fdjöfet ©preng* unb günbmittel:
gegen liegen burd) 2lbbeden mit planen, gelt*
bagnen, Srettafeln ober ®ad)pappe ober burch Unter*
bringen in bebetften ^Räumen;
gegen Sroft burdj Unterbringen in erwärmten
SRäumen (ßagerung in fRälje öon Öfen ober offenen
feuern verboten) ober in tiefen ©rbgruben (gubeden
bann notwenbig). ©djuij gegen ^Jroft ift nur für
günbfdhnüre erforberlid).
gegen feinblicheS freuet au§ ber ßuft unb
bon ber ®rbe burch ßagerung in Unterftänben
ober fjliegerfdjuhgräben ober burd) ßagerung in Heinen
Stengen mit grofjen gwifdjenräumen unb 2lbftänben
jueinanber (vgl. ©ü. 305).
489. Serfenben mit ber Gifcnbahn ift burcf) bie
®ifenbahnüerlel)r3orbnung (®. 53. D.) § 54 2lbf. (2) a)
334
mit Einlage C unb burdj bie Jp. S)b. 450 (ßagerung unb
Verwaltung ber SRunition bei ber Sruppe) geregelt.
gilt Vcrfenben auf £anb= unb SBafferwegen ift bie
Sprengftoff=Verfenbung?borfchrift (§. 2)b. 258) maß»
gebenb.
4. Vernidjten uon $ionier=Spreng= unb ßOnbmitteln.
490. Srßfjereäüengen unbrauchbarer Spreng»,
3ünb» unb -Rahiampfmittel bürfen nur burch ^io»
niere ober fjeuermerter uernidjtet wer«
ben. SKengen bi? ju je 5 kg bürfen, jebodj
nur unter Sluffidjt uon Offizieren, auch burch
für auSgebilbete Unteroffiziere unb SÖlannfdjaften aller
SBaffen burch Sprengen uernichtet werben.
Sticht umhüllte Sprengmittel unb ^naHzünb«
fdjnur (12 trommeln enthalten 5 kg Vionier»Spreng»
mittel) in SRengen bi? ju 5 kg fprengt man in
freiem Selänbe, alle mit SR e t a 11 um»
hüllten (§öchftmenge je 5 kg) in minbeften? 1 m
tiefen £ ö <h e r n, unb zwar burch Anlegen je eine?
Sprengförper? mit ßeitfeuerjünbung. Sie ßödjer finb
üor bem ßünben mit minbeften? 20 cm ©rbe abgubecfen.
Si<herheit?bereidj (Srei?) nicht unter 300 m §albmeffer.
S)ie freien ®nben ber einzelnen jfhtaHzünbfchnüre finb
bor bem Sprengen miteinanber <ju öerbinben.
491. ßiinbmittel finb in ihren ^Behältern wie um«
hüllte Sprengmittel zu fprengen.
B. ttettungsmafjnabmen und Sidferljeits»
beftimmungen bet Slufjübergängen im
^rieben.
1. Slllgemeine?.
492. gür alle fjälle zu*reffeTtbe unb
au?rei<henbe, fdjarf umgrenzte Seftimmungen
für bie 3lettung?mafjnahnten bei Übungen auf bem
335
SBaffer l a f f e n f i dj n i dj t geben. ®rünblidje§
Untermeifen ber übergeljenben unb ber für ben Stet»
tungSbienft eingeteilten ©rappen über ipr Serpalten ift eine
ber toidjtigften SJlaßnaljmen gum Serljüten bon Unfällen.
©er ßeitenbe ber Übung befiehlt «Starte unb Sinfaß
be§ Stettung§bienfte§. fjür ^eftfe^en ber «Starte be§
Siettung§bienfte§ finb mafjgebenb: Sreite be§ (SemäfferS,
Stromgefdjminbigteit. ^aßre§geit (®i§gang), Uferüer»
Ijältniffe, Kenntnis oe§ ©elänbeS burcf) bie ©ruppe,
Sicptüerfjältniffe, Stanb ber 2lu§bilbung ber ©ruppe
im fjaljren auf bem SBaffer unb im Sdjmirnmen, Starte
ber übergufeßenben ©ruppe, Slrt ber berfügbaren Stet»
tungSmittel.
Sei öocßmaffer, Stebel, ©untelljeit ober fonft fdjmie»
rtgen Serljältniffen (®i§gang, {tarier Strom) finb bie
StettungSmaßnaljmen gu bermeljren.
SJlangel an üb er g an «}§ m i 11 e In barf
ni(f)t gu einem unguläffigen Sinfcfjrän»
len ber StettungSmaßnaljmen führen.
HRotorifiernng ber SiettungSfaljrgeuge er»
laubt Sefcpräntung iijrer galjl.
493. Silit ber giiljruttg beä StettungsbienfteS ift in
jebem fjalle ein geeigneter Dffigier ober Unteroffigier
gu beauftragen. Kräfte unb gafjrgeuge be§ Stettung§=
oienfteS finb neutral (Slngug: ältüfje, toeifje SIrmbinben
am linten 2lrm, feine SBaffe).
Sei allen Übungen muff Sanität^gerät für erfte Ipilfe»
leiftung, bei größeren Übungen müffen Sanitätäoffigiere,
bei größeren Übungen mit frfjtoimmenben Sferben arnf)
Seteriuäroffigiere gur Stelle fein.
2. StettungSmittel.
494. ßum Slettungöbienft gehören:
StettungSleute,
Stettung§fafjrgeuge,
fRettungSgerät.
836
SlettungSleute muffen auSgebilbete SSafferfaljrer unb
betjerjte Faljrtenfcfjtoimmer (®runb«, fiept« ober fßrü«
fungSfdjein) fein.
Sßr Sln^ug im StettungSbienft ift fo leidet, toie eS bie
SapreSjeit geftattet. StettungSleute legen Sdfjtoimm«
toeften an, ausgenommen bie StettungSleute, bie baju
beftimmt finb, Serunglüdte burcf) Xaucfjen auS bem
SBaffer ju tjolen. Siefe StettungSleute erhalten um bie
Stuft einen Sdjtoimmgurt mit Seine, beten freies Gnbe
im ga^rjeug befeftigt bleibt. 2)ie Beine muff jum
fcfjnetten SRacpfüfjren ftets Hat aufgefdjoffen fein. ®ie
toirb öon fieuten beS 3fatjrtrupp§ bebient. SaS Stet«
tungSfatnseug muß jebocf) imftanbe bleiben, bem Siet«
tungSmann ju folgen.
SUS SlettungSfaßrjeuge eignen fid) alle SBafferfaljr»
jeuge mit für SlettungSjtoeae geeigneter ^Bemannung
unb ÜluSrüftung (SQotorboote. SJiotor« unb geruberte
Pontons, ®äfjne, Floßfädte, Stuberboote, Faltboote). Sim
ftfjnellften bemeglicf) finb motorifierte SBafferfafjtjeuge
unb Faltboote.
®iit Faltbooten fann man aber nur fdtjneU SiettungS*
ringe ober ätjnlidje fRettungSmittel an bie llnfalffteHe
bringen. Faltboote tonnen nicfjt SEenfdjen aus bem
Sßaffer aufnefimen.
SkttungSgeräte finb ^Rettungsringe, StettungSbojen,
SiettungSftangen mit §aten ober Beinen unb SiettungS»
leinen, ferner StettungStäften unb fonftigeS SanitfttS«
gerät. ®er SiettungSbienft ift für Übungen bei Sladfit
aufjerbem mit Scfjeinmerfern unb Seucfitpiftolen auS»
jurüften. Sinridjten befonberer Siacfjric^tenöerbittbun«
gen für ben SiettungSbienft ift bei allen größeren übun»
gen jtoecfmäßig.
495. Sie fRettungSfaljrjeuge (Faltboote aus«
genommen) toerben je mit einem Fat)rtru£p unb 1 bis
2 SlettungSleuten befeijt.
337
Sluäriiftung bet RettungSfofttseuge: 2Iufter ber fjaftr»
auSrüftung 1—2 §alteleinen, 2 lofe Rettungsringe,
2 Rettungsringe an SBurfleinen jum Sebienen bom
fjaftrjeug auS, 1 Seil, 1 ßeinenbeftang rings um baS
gnftrjeug ober 2 auftenborbS angeftängte Stangen
(Staten), bamit Serunglüdte fidj fefttlammern tönnen,
ferner bei Sage eine weifte flagge, bei Radjt 4 bis
5 weifte ßatemen, bie nad) alten Seiten ßicftt geben.
Solange bie gaftrjeuge nidjt für RettungSsmede in
Sätigteit treten, finb bie ßatemen abpblenben ober
ju berbeden. 2IuSrüftung bon f? ä ft r e n mit RettungS»
gerät f. 497 b.
Ser güftrer j eb eS RettungSfaftrjeugS
ift bafür berantwortlicft, baft fein fjaftrjeug wäftrenb
ber Sauer beS RettungSbienfteS oerwenbungSbereit ift,
atfo fcftroimmt. Sei motorifierten RettungSfaftrjeugen
rauft ber ÜRotor laufen.
3. Stuöbilbung für ben RettungSbicnft.
496. Sie StuSbitbung im Rettungöfcftioimmen ift
planmäftig p betreiben.
©et RettungSbicnft ift p üben, &icrp finb Übungen
auf bem SBaffer auSpnuften, um alle SBaffen mit ben
RettungSmaftnaftmen unb SicfterfteitSbeftimmungen ber=
trautpmadjen. 83or allen gröfteren übun =
gen unb bor ßeftrgängen jur 21 uSbiI-
o u n g im Sienft auf bem SBaffer ftat
Unterweifung über bie RettungS» unb
SicfterfteitSbeftimmungen ftattjufinben.
4. SidjcrfteitSbcitimmungen unb ßinfaft beS RettungS»
bienfteS beim llferroedjfel.
497. a) ©rforberlidje ©ragtraft bon
ttberfeftmitteln f. 132, 133, 138—148.
föaftne unb SBagenfäftren als ©injelüberfeftmittet
m fi f f e n belaftet 0,25 m greiborb ftaben, bei ^löften
338
auS Xrögen ober SBafcggobern tann ber f^reiborb
— jebodj nur tu ruhigem ©emäffer unb bei fcproacgem
Strom — geringer fein, ißrobebelaftungen finb für
biefe unb ägntidje überfegmittel, wenn erforberlidj, an»
guorbnen.
b) Seim überfegen mit Singelfagrgeugen (S o n»
t o n S, © ä g n e n, gtogfäden, glöfjen) unb
mit jägren (Ruber» unb SJlotorfägren,
®ierfügten, gugfä^rert) ift baS Sepäa
ber ü b er g u f e g e n b en Gruppen vor bem
Sin ft eigen ober Slufrüden, ber <51 a g l =
g e I m n a dj bem Sin ft eigen ober 31 u f »
rüden abgunegmen unb in ben Singel»
fagrgeugen ober auf ben fjägren
nad) 2lnorbnung ber ag r t r upp f ü g r e r
niebergutegen.
S o r bem Sin ft eigen ober 21 u f r ü d e n
finb ber ©ragen unb bie ober>en ©nöpfe
b e S 91 o d e S (Stufe), nad) bem Sin ft eigen
b a S ©oppet g u öffnen. ®er gagrtrupp
g a t a b g e f cg n a 111 unb trägt $ e l b m ü g e.
®ie übergufegenbe -Kannfdjaft fegt fidj in Singel»
fagrgeugen auf - ben Soben; je nad) ber Sauart
einanber gegenüber ober gintereinanber, fegt ficg ober
Iniet fidj bei g ä g r e n auf ben Setag (nidjt unter bie
Srüdenbede) in ®oppetreigen.
Sei fdjtvierigen SBaffer» unb llfervergältniffen ift bie
Selajtung ber überfegmittel gu verringern.
gägren auS ©riegSbrüdengerät finb ftetS mit
1—2 Rettungsringen, fotcge aus SegelfSgerät, fotveit
möglicg, mit Rettungsringen ober »bojen auSgurüften.
3Dtit begelfSmäfjigen SSafferfagrgeugen nadj 135—149
bürfen nur greifdjtvimmer überfegen.
c) gür jeben überfeg ft reifen ober über»
fegabfcgnitt finb je nadj ben örttidgen Sergält»
339
raffen Unterabfchnitte für ben 9t e 11 u n g S -
b i e n ft einpteilen unb Unterführer auS bem SRettungS*
bienft für biefe Slbfdhnitte gu beftimmen.
498* ßiSgang unb Jlebel fdjliefeen fic^ere^ «panbhaben
beS SRettungSbienfteS auS; baher finb in biefen gälten
alle Überfehmittel mit SRettungSgerät auS^urüften.
Seim Überfein über fdjmale ® e m ä f f e r ge=
nügt Sinfah öon 9tettungSleuten mit 9iettungSgerät an
ben Ufern.
499* Seim Sau non 2 = t = b 8 4 = Srüden unb
Übergeben auf biefen Srüden gilt unter einfachen
Serhältniffen als 21 n h a 11 für Stärte b e S
JRettungSbienfteS:
Sei ©infah öon SRannfdjaften bis etma Som^
panieftärte jum Srüdenbau bis 100 m
Sänge unb bei fd)madjem Strom ift je ein 9lettungS*
fahr^eug unterftrom ber Srüdenfpitje unb unterftrom
ber SJHtte ber Srüde, beim Übergang über foldje
Srüden unterftrom ber Srüde öerteilt bereit^uhalten.
Stuf ber Srüde unb an ben Srüden^ugängen ift je
ein SRann im 9tettungSan$ug mit einem ober meh=
reren ^Rettungsringen auf^uftellen.
gn bie SpihentruppS, als Selageinbeder unb in bie
gahrtrupps eir^ubauenber fdjmimmenber Stützen finb
möglichft nur Schwimmer ein$uteilen.
Seim Sau öon Srüden über 100 m Sänge
ober über glüffe mit mittlerem ober ft a r t e m
Strom unb beim Übergang öon Sruppen auf fol*
djen Srüden ift bie Qah^ ber unterftrom ber Srüde in 1
ober 2 Sinien bereit^uhaltcnben SRettungSfahrjeuge $u
öermehren. 2luf etma je 30—40 m Srüde ift 1 9tet=
tungSfahr^eug §u rechnen.
gür Verhalten ber übergehenben
Xruppen finb bie Se ft im m ungen ber
4/v^v
340
©b. 300 (307—312) ma^gebenb. Sie lau-
ten:
307. ©er Srüdenlommanbant ift für Sicherheit ber
SBrücEe, für SRuIje unb Drbnung auf i§r unb ben nadjften
3u* unb Slbgang&oegen beranttoortlidj. Sitten bon ihm unb
ben ^ionieroffi^ieren im ©ienft gegebenen SInorbnungen ift
golge au leiften.
308. ©ruppen unb Sa^rjeuge bürfen ftdj nidjt
in ber -Kühe ber 58rüde Raufen. Srüdengu- unb *au§-
gang muffen freigehalten toerben, ber Sftarfdj über bie Srüde
barf nidjt ftoden. ©etoöhnlidj toirb baljer bie ©ruppe au3
Sereitftellungen je nadj bem greitoerben ber Srüde
abgerufen.
309. geber ©ruppenteil nimmt bie ^um übergehen er-
forberlidje ttttarfdjform JpäteftenS 100 m bor ber Srüde ein
unb behält fie bei, bi3 ba§ Snbe feiner Sftarfdjtolonne 100 m
oom SrüdenauSgang entfernt ift.
310. gufjtruppen gehen in ber Sftarfdjorbnung ohne
©ritt über, Weitere! abgefeffen gu Bleien, bie Leiter
aujjen. übergegangene Steiterei oertür^t ben Schritt, bamit
bie nodj übergepenben $ferbe ruhig bleiben, gahrenbe ©rup-
pen unb atte Sin^elfahrgeuge halten bie SDHtte, gahrer auf-
gefeffen, SebienungSmannfchaften beiberfeitö ber Sßferbe,
Sremfen befett, fein^elreiter fi&en ab unb führen ihre
sßferbe. ©ie SebienuncjSmannfchaften reitenber Satterien
folgen abgefeffen ßu S^^ien ihren ©efdjü^en.
Kraftfahrzeuge fahren langfam in ber SDHtte mit Slb-
ftänben bon gahrgeug $u gahrgeug je nadj Sauart unb
(Setoidjt.
©ie ©ragtraft ber KriegSbrüde ift ber ©ruppe beizeiten
belanntzugeben, auch ift fie auf ben Begtoeifem $ur Srüde
unb auf ©afeln an ben Srüdeneing&ngen tenntlidj ju
madjen.
311. ©en Sefeljl ^um galten auf ber ®riegBbrüde gibt
ber Srüdentommanbant ober ber Offizier bom Srüdenbienft.
Qn bringenben gatten ift jeher im ©ienft befinblidje Sßionier-
offi^ier ba^u berechtigt.
Sei Luftangriffen ift bie Srüde in fRulje unb Drb-
nung freisumacfjen. ©ie gü^rer aller ©rabe berhinbern.
341
bafe bte SDlarfdjgefcfjrrnnbigfeit üergröfeert toirb unb bie
Xruppe fttf) jufantutenbrängt.
312. SBüferenb be§ Überganges bürfen nur Pioniere
beS SrüdenbienfteS bie S3rüde in entgegen«
gefefeter Stiftung überfdjreiten. ®er Offizier Dom
Brüdenbienft barf StuSnafjmen julafjen.
ftriegSbrüden, bie für gleidijeitigen Bertefjr in beiben
Richtungen benufjbar finb, toerben befonberS bezeichnet.
500. Cberftrom ber im Sau befinblidjen
ober fertigen Stüde bürfen fidj bi§ ju
einer bei Übungen im ©elänbe oon ben
Seitenben, auf üb un g §p lä fe en oon ben
Sommanbeuren feftjufefeenben Srenje
nur bie für ben Srüdenbau benötigten
SSafferfaljrjeuge befinben.
501. Sor bem Übergang auf S$neKftegen unb
Stegen finb bie Sruppen über b a § Serljalten
toährenb be§ übergehens, befonberS über fäbftänbe,
Stagen ber Sßaffen unb 2luSrüftung ju belehren.
Sdjnellftege unb Stege toerben je nad)
iljrer Sauart, Sragtraft unb ben Stromberhältniffen
nur in Sdjüijenreilje mit minbeftenS 5 Stritt 2lbftanb,
flott, o^ne ju laufen unb „ofjne Sritt" Übertritten.
Sen SIbftanb befiehlt ber Erbauer, ber aud) baS 2lb=
laufen am Srüdeneingang burd) befonbere SIblaufpoften
(möglidjft Unteroffiziere) regelt
Sor bem Setreten ber «Sdjnellftege
unb Stege finb Oiodtragen unb bie
oberen Snöpfe beS OtodeS ju öffnen,
Srageriemen ber Sornifter auSjuIjaten
unb mit einer fjanb ju ljalten, bie
Sdjultertlappen lo § 3 u t n ö p f en, ber
Stahlhelm abjune^men.
^tonierbienft 23
342
(Srunbf äglid) finb SBaffen unb 31 u 3»
rüftungäftüde fo ju tragen, bafj Re fdjneU
abgemorfen »erben fönnen, unb baß möglidift eine
©anb jum Slnfaffen be3 SelänberS frei bleibt.
Unterftrom ber (ScfjneUftege ober Stege finb fe nadj
ber glufjbreite StettungSfa^rjeuge bereit ju tjalten. Sei
turjen S^neKftegen ober Stegen genügt SereitfteHen
öon StettungSleuten mit 9tettung§gerüt an beiben Ufern.
502. gür überfegen mit fdjroimmenben $ferben
gelten bie in 492 ff. gegebenen Seftimmungen finn»
gemäjj.
2lHe Sdjmimmübungen leiten grunbfüfclidj Dffi»
j i e r e.
503. Seim Surdjfdjreiten von gurten in mittlerem,
ftartem ober feljr ftartem Strom (216) ift 91 e t«
tungSbienft nadj 492ff. einjufegen. Slnjug f. 501.
5. 9lu§löfen be§ 9lettungBbienfte3.
504. 9tettung3mafjnaljmen »erben auf ben Stuf
„Ste11ung§bienft!" ober auf befohlene ©Br«
ober Sid)t8eid)en a u 3 g e l ö ft. Seenbet »er»
ben fie auf Sefeljl be3 örtlidjen fjütjrerä be3 9tettung3»
bienfteS. gebet ift bei ©efaljr berechtigt, ben
9tettung§bienft auSjulöfen, unb üerfiflidjtet.
Seidjen jum 2lu§löfen be3 9tettung3bienfte3 burd) Stuf
»eiterjugeben.
Sei Übungen auf bem SBaffer in ber Sunteüjeit
»erben jum 2lu§löfen be3 9tettung3bienfte3 aufjer bem
Stuf „3tettung§bienft!" Signale au§ Seudjtpiftolen ge»
geben. Um Ser»edjflungen mit tattifd>en Sidjtjeidjen
öorjubeugen, finb bie für 3lu§löfen unb Seenbigen beB
9tettung§bienfte§ p öer»enbenben Signale bor ber
Übung üon bem Seitenben ju befehlen unb allen !Eru|>»
pen betanntjugeben.
505. ©le JRettungSarbeiten beleuchtet man b e t
©untelßeit mit weißen Seuchtfignalen ober
Scheinwerfern. Scheinwerfer werben am Sanbe
unb auf SRettungSfahrjeugen eingefefct. Sie muffen fo
leuchten (Streugla§[d)eiben), baß fie ben SRettungSbienft
nicht b l e n b e n. Seenben be§ SeucßtenS f. 504.
IX. Sufatj für öie Sruppenpioniere
bet Kavallerie unb Kraftfafyrftampfs
truppen.
A. Sprengen non Brüchen.
1. ßleltrifche Sünbmittel unb ßüubgeräte.
506. ®a§ elettrifche Sütibmiltel ift ber ®Iüß-
I ü n b e r (®lüh=8.).
3&nbgeräte finb: ©lühiünbapparat, 33or»
fcfjaltwiberftanb, SeitungSprfifer unb
Sprengtabei (einfach ober boppelt) ober Sei»
tunggbrftljte.
507. ©er ©lüßsünber (SBilb 292) befteßt au§ einem
©lüßjunbftüd (®lüß=3bft. SBilb 292a) unb einer
Sprengtapfel, bie in einer SerbinbungSßülfe wafferbicßt
berbunben.finb. ©lüßjünber finb baßer wie Spreng»
tapfeln ju beßanbeln (24).
©er elettrifcße Strom bringt ba§ Slüßtöpfcßen
infolge feines hohen Seitungswiberftanbeg jum ©lühen.
©ie fid) ßierburd) entjjünbenbe Sluflabung bewirft ba§
©etonieren ber Jpauptlabung ber Sprengtapfel.
©lüßjünber, bte in ber gleichen Seitung berwenbet
werben foKen, muffen gleichen SBiberftanb unb gleiche
fReattionSjeit haben. 33erwenben bon Slühjünbern
betriebenen SBiberftanbeS unb berfeßiebener
SteattionSjeit in gleicher Seitung führt ju SSerfagern.
©er SBiberftanb unb bie SReattionSjeit ber Slüß»
(ünber ift auf ben SSerpadungStäften angegeben. 9tot»
aHS tann man ben SBiberftanb nach 516 e 3 feftfteHen.
23*
344
S3ilb 292. ©lö^önber 28 mit Sünber^alter.
— Zündendrähte •-----
Zündenhalten
Zündenhalten-
Oberteil
l/enbindungs-
hülse—
I'ICUJG------
Zünderhalten-
--Unterteil —
Glühköpfchen
Ge winde nippet
Ö
•8
Spn. Kapsel
SBilb 292a. ^lü^ünbftütf mit 3ünberljalter.
Zünderdrahte
Verbindungshülse
Glühköpfchen
Schutzkappe
Zünderhalter-
Oberteil
—Zünderhalter-
Unterteil
ewindenippel
des
Zünderhalters
345
508. ®a£ ®lii^unbftu(t ift bak eiettrifdje ßünbmittel
für ül)ungk*®prengmittel (28).
509. 3Wit bem ßeitungkprüfer (23ilb 293) ^rüft man
Slü^ünber unb Gprengfabel ober ßeitungkbräfjte $u-
nädjft für fiel), bann nacf) ifyrer SSerbinbung miteinanber
(516 c u. d).
510. SOHt bem Slütföünbapparat (33ilb 294) jünbet
man ©lüf^ünber unb Slü^ünbftücfe.
23ilb 294. W) 294 a.
Scfjaulod) mit 3cfjait^eid)en.
®er Slü^ünbapparat $ünbet bi£ gu einem ®e[amt=
miberftanb ber Streikleitung bon 250 D Ij m.
®en ©efarntmiberftanb Ijat man mie folgt
ju errechnen:
346
100 m Sprengfabel §aben etma 1,25 D§m SBiber*
ftanb,
200 m ©oppelfprengfabel 5a&en etma 5,0 DIjm
SBibcrftanb,
100 m ©raljt auS Stahl haben etma 7,5 Oljm Sßiber*
ftanb bei etma 1,5 mm ©rahtburdjmeffer,
100 m ©raljt aus Tupfer haben etma 1,25 D§m
Sßiberftanb bei etma 1,5 mm ©raljtburchmcffer,
1 ©lühgünber hat 1,0—2,0 Dlj™ SSiberftanb.
B e i f p i e l:
Einleitung 400 m Sprengfabel = 5,0 Oljm
12 ©lühgünber gu je 2 Dfjm = 24,0 *
Stüdteitung 400 m blanfer ©raljt auS Stahl = 30,0 *
50 m Sprengfabel als BerbinbungSftüde = 0,65 *
59,65 DIjm
©ie Sdjlüffel gum Sluhjunb apparat
unb ber SeitungSprüfer finb beim B e *
ginn ber S p r e n g b o r b e r e i t u n g e n bem
mit bem Sünben Beauftragten gu über*
geben, ©iefer hat bann Sdjlüffel unb
SeitungSprüfer bis gur Sprengung bei
fid) gu tragen.
51L gur Seitung beS eleftrifcfjen Stromes bermenbet
man Sprengfabel. 9IIS ®rfa£ für Sprengfabel lägt
fid) ifolierter ©raljt mit Tupfer- ober Staljlfeele bon
minbeftenS 1,5 mm ©urdjmeffer, gleichgültig, ob bie
Seele auS einem ober mehreren ©räljten befteht, als
Einleitung bermenben. Seicht ifolierter, alfo blanter
©raht ift als Slüdleitung, jeboch nur für biefe,
brauchbar.
©oppelfprenglabel bereinigt 2 Sprengfabel als Ein*
unb Stüdleitung.
347
Serbinbungen, Segen ber Kreisleitung, Einbringen ber
Sabungen.
512. 8Jlan verbinbet:
1. ©lüljjünber mit
ßnalläiinbfdjnur.
2. ©lütjjünber mit
©prengtabel ober i f o -
liertem ober blantem
$ r a Ij t unb
£eitung§brähteunter=
e i n a n b e r (®oppel[preng=
tabel 513).
SBilb 295. Qkrbinben jtoeier Sräljte
burd) Kubferbiilfe.
SBilb 296.
®ehelf§utä6ige§ SBerbinben jtoeier
Sräljtc.
1. SBie Serbin»
bung ®prenglap =
fei mit Snall»
jünbfcfjnur (35).
2. a) Sprengtabel
auf 4 cm üon ber Um-
hüllung befreien. Se=
rüljrungSftellen ber 3ün-
berbräljte beS ®lülj-
jünberS unb ber Söräfjte
beS SprengtabelS ober
ber SeitungSbräljte
blaut fdjaben. ohne bie
SIbern ber ßifee aufju»
breljen.
b) ©ratjtenben in
Kupferljülfe fcfjieben,
btefe mit 3tt*i^3an0e
fräftig gufammenprelfen.
ttberfteljenbe ®ratjt=
enben jurütfbtegen unb
mit gtoittjange an
Jpülfe brücf en (®ilb 295).
53el)elf§mäfjtg nad)
SBilb 296.
c) SJerbinbungen bi§
über bie blauten SteU
len hinüber mit ettoa
15 cm langem 3folier=
banb fo umtoicfeln, bafj
bie SJerbinbungSftelle
abgebichtet ift.
348
513* gebe Sabung, bei b e r f e p t e n Sabungen audj
jebe Scillabung, erpält in einer Steigleitung. einen
Slüp^ünber, bei to i d) t i g e n Sprengungen jraei Slüp*
$ünber. 3Kan bringt bie Slüp^ünber toie Spreng*
fapfeln in bie Sabung ein (24) unb bereinigt fie nad)
53ilb 297 mit ber §in* unb Stüdleitung unb bem Slüp*
§ünbapparat $u einer gefcploffenen Seitung (SretS=
leitung), jebodj) erft jum prüfen. 53i£ bapin ift bie Sei*
tung bei c unb c1 beS 53ilbe3 299 o f f e n $u laffen (518).
Sin eine gefcploffene Steigleitung
barf ber Seitung^prüfer nur gum rü
fen auf SBiberftanb (519), ber Slüpgünb-
apparat er ft fur§ bor bem günben an*
gefdjloffen toerben (520).
$ür bie Einleitung bi£ $um lepten SIüp$ünber
ift immer Sprengfabel ober isolierter ®rapt $u ber^
53ilb 297.
Streikleitung.
Glühzünder
toenben, bieSRüdleitung fann
au3 blanfem ®rapt beftepen,
j e b o dj) ift innerhalb
jeber 53er b ömmung
Sprengfabel ober
lierter ® rapt gu
tt) e n b e n.
9Hemal£ barf man bie
leitung burd) ®rbe erfepen.
53ertoenbet man ®oppelfpreng=
Jabel, fo fdpliefst man, um ein 53 e *
f cp ä b i g e n be£ ®oppelfpreng*
fabele ju b e r m e.i b e n, bie §in=
leitung mit Sprengfabel ober ifo^
liertem ®rapt an bie Sabung, bie
3tüdleitung mit blanfem ®rapt,
Sprengfabel ober ifoliertem
®rapt an.
unb Sprengfabel finb, toenn er*
nur
tfo =
Der®
9tücf=
Glühzündapparat
Sfolierter ®rapt
forberlid), enttoeber pod) ober in Stäben $u berlegen,
349
um SSefdjäbigeTt ber Sfolierung burd) gatjqeuge ober
Sprengftücfe ju bermeiben.
514. gjrei angelegte Sabungen finb gegeneinanber
gefifjütjt anpbringen. um beim Betonieren ein gort»
fdjleubern einzelner Sabungen ju öerfjinbern (SSilb 298).
SBitb 298. ©egeneinanber gefdjütit angebradjte Sabungen.
515. Starlftromleitungen in ber Scäpe einer ®rei§=
leitung finb auSjufdjalten (474).
Sei ®enrittergefal)r finb Kreisleitungen, möglicEjft in
SabungSnälje, ju unterbreiten (474).
SBüb 299. prüfen einer Seitung.
prüfen ber ©liilj-jünbcr unb bcS cleltrifcfjeit ßiinbgeräteS.
516. Sor jeber Sprengung finb für ficE, ju prüfen:
a) @lütsünbapparat (bleibt in ber Sebertafcpe) wie
folgt:
350
1. Slnfdjlufjtlemmen burcf) ®raljt turjfdjliefjen. Stet»
mal aufjieljen unb ablaufen laffen (SBeaen be§ Olülj«
jünbapparateS). Jgierju ift bie Slufoieliadjfe mit bem
(Scf)lüffel nad) r e d; t § ju breljen, bi§ ba§ ©djaujeidjen
ganj im Sdjaitlodj (Silb 294a) erfdjeint unb bie
gebet fiel) nicljt meljr aufjjieljen läßt.
®en Sdjlüffel ftetft man barauf fo auf bie ßünb»
adjfe, bafj bie fJlafe be§ ®d)ilbe§ „günben" in ben
Sluäfajnitt be§ ®d)Iuf|el§ paßt. Sobann breljt man ben
©djlüj'fel eine Ijalbe llmbreljung ruljig nad) redjtä
unb laßt ifjn 6i§ jum bölligen Slblauf ber gebet fteden
(Silb 300).
Silb 300.
©lülfjiinbapbarat (oljne Sebet»
tafdje) mit offenem Wertet, Sdjlüffei
}um ßünben eingefteett.
58ilb 300a.
fthrfdjatttoiberftanb mit
Bodenplatte
ufziehachse
(verdeckt)
Deckel
Gummi-
abdichtung
Anschluß-
klemmen
Boden be-
festiyungs-
schrauben
Schlüssel
Zündachse
Verschlußplafte, darunter Ersatz feder
gehäuse mit Ersatzfeder
©aS Seräufcf) ber afclaufenben geber muß turj
hörbar fein, anbernfaHS ift ber StromtreiS im Apparat
unterbrotfjen, ber Slü^ünbapparat alfo unbrau^bat.
351
Sladj bem Slblaufen breljt man ben ©d)lüffel nadj
IlntS, bis bie -Jiafe beS SdjtlbeS „Bünben" toieber
in ben SluSfdjnitt beS SdjlüffetS pafjt, unb jie^t ben
Sdjlüffel IjerauS.
®er ©edel ift langfam ju fcfjliefjen, nidjt jujuftappen.
2. lOIüIjjünber mit je minbeftenS 50 m Ian»
ger, auSgeftredter tpin» unb Slüdleitung an ben ®lütj»
Aünbapparat anfdjltefjen, IXmtreiS bon 50 m um
ben Slü^jfinber abfperren, fobann jünben
(prüfen ber ßünbfäbiglett).
3. 9luffetjen bes SorfdjaltwtberftanbeS mit 9Iuffa|»
(tüd (Silb 300 a) auf bie linte &nfd)Iufjllenune unb
nad; Ofperrung Bünben tote ju 2. (prüfen auf
$öd)ftletftttng, bie auf bem Sdjilb beS ©edelS ber»
jeidjuet ift.)
©ie ©lü^ünber muffen bei ben Prüfungen ju 2
unb 3 gejünbet werben, fonft ift ber ©lü^ünbapparat
u n h a u d) 6 a r.
b) SeitungSprüfer:
©leidjjeitig, aber nur für turje $eit (um baS Element
ju fdjonen) einen metaüifd)en Setter, wie ©raptftüd
ober SReffertlinge, an betbe 9Infd)lufjllemmen anlegen.
Seiger beS SeitungSprüferS mufj bann auf 0 einfpielen.
SBenn nötig, ift ber Beiger hierbei burd) Sretjen an
ber SteHfdjraube auf 0 ju bringen (nur bei SettungS»
Prüfern neuer Fertigung möglid)).
c) Oilütjsüttber:
1. ©tütjjünber mit je minbeftenS 50 m langer, auS»
geftredter §in» unb Stüdleitung berbtnben, freie fenben
ber SeitungSbräljte jebocl) nodj nid)t an ben SeitungS»
prüfet anfdjliefjen.
352
2. U m t r e i S Bon 50 m um ben ® l ü h *
günber abfperren.
3. grete Kuben ber SettungSbräljte gleichzeitig, aber
nur für turje $eit, an bie Slnfchlufjtlemmen beS
SeitungSprüferS anlegen. ßeiger beS SeitungSprüferS
mufj nusfrijlagen.
Klühjünber, bei beren Prüfung ber $eiger n i dj t
ausfdjlagt, finb unbrauchbar unb ju »er<
n i d) t e n.
d) Sprengt abel unb notierte Sräljte:
Srahtenben gleichseitig, aber nur für turje $eit (um
baS Element ju fdjonen) an bie klemmen beS SeitungS»
Prüfers anlegen.
Stüde ohne SlabelauSfchlag auSfcheiben.
517. Sie Sefamtleitung ift nad) Surdjführen ber
Kinjclprüfungen nach 516 wie folgt auf &urjfchluf{ unb
bann auf Sßiberftanb ju prüfen ($8ilb 299):
prüfen ber Serbinbungen auf Sturgfdjlwfe.
(SidjerheitSbeftimmungen für prüfen im ^rieben
f. 479, Slbf. 3 u. 4.)
518. Sie Slüfjjünber finb in bie Sabungen ein»
gebracht.
a) Einleitung (Silb 299) (a—b—c) unb Stüdleitung
(c1—d) ift fertiggefteKt bis auf bie Serbinbung bei
c—c1 (letzter Slülßünber) (479, 2lbf. 3 u. 513).
Sann i f o l i c r t man baS Gnbe ber Einleitung bei c
ober hangt eS frei in bie £uft.
ßnbe ber Siüdleitung toirb bei e‘ in bie @ r b e
g e ft e d t, falls nötig, biefe Stelle angefeuchtet.
353
©ie Snben ber Jptn- unb fRüdleitung toerben bei a
unb d turje $eit an bie Slnfdjlujjtlemmen beS SeitungS«
Prüfers angelegt.
©er Beiger barf n i cf) t auSfdjlagen. Sdjlagt ber
Beiger auS, muß in ber Einleitung infolge S8efd)äbigung
ber Qfolierung Kurjfdjluf; entftanben fein.
b) Sdjabljafte Stellen, ettoa bei f, finb burdj
ftreaentoeifeS prüfen ber Einleitung ju fudjen unb ju
isolieren, greilegen öon Sabungen, bie mit ®ipS ober
Bement allein ober in Serbinbung mit anberen Stoffen
ober mit anberen Stifteln feft öerbämmt finb, pm
EerauSneljmen eingebracljter unb ©infüljren neuer ®lülj5
jünber ift verboten (485).
prüfen ber Kreisleitung auf SSiberftanb.
519. ©ie Seitung toirb nunmeljr bei e—e1 ge =
f dj l o f f e n unb bamit bie Kreisleitung IjergefteHt. So«
bann toerben E>n= unb fRüdleitung bei a unb d turje
Beit an bie Ülnfdjlufjllemmen beS SeitungSprüferS an«
gelegt, ©er Be*9er beS SeitungSprüferS mufj auS=
fdjlagen. Sonft finb fcfjabljafte Stellen nadj 518 b gu
befeitigen.
SSirb nidjt halb nadj bem prüfen ber Kreisleitung
gejünbet, fo ift bie Kreisleitung turj üor bem Bünben
n o d) m a l S auf SB t ber ftanb ju prüfen.
Bünben.
520. Stan jünbet üon einer gegen Sprengftüde unb
Suftbrudtoirlung gefieberten Bünbftelle aus.
©er Slüljäünbapparat bleibt in ber Seber«
tafdje. Stan öffnet ben ©edel unb jieljt ben Apparat
nach 516 auf.
854
@rft bann legt man bie §in» unb SRüdleitung an bie
Slnfdjlufjflemmen an. ©ie ©räljte bürfen hierbei ba3
SDletaUgefjaufe nicfjt berühren, ba fünft ®urjf(f)lufj ent»
fteljen mürbe.
Sobann läfjt man ben ®Iü^jünbapparat nad) 516 a 1
ablaufen.
9?adj erfolgter günbung nimmt man bie ©rüljte ab,
aud) bet Serfagern. ® e r f a g t bie Qünbung, fo
jünbet man nodjmalS nad) erneuter Prüfung be3
®Iüt)jünbapparate§ ober mit einem anberen Slügjfinb«
apparat ober prüft bie Seitung erneut auf ffurjfdiluB
unb Sßiberftanb unb befeitigt bie geljlerqueHen nam
518 b (484).
521. Sei boppelter ßünbung (§aupt- unb Sie»
ferbejünbung 45) jfinbet man:
a) 2 elettrifdje günbungen nac^einanber,
b) bei je 1 elettrifdjen ßünbung unb 1 Seitfeuerjün*
bung nadj Slnfeuern ber Seitfeuerjünbung bie
elettrifdje ßünbung.
ßrfag für Stüijjünbapparate.
522. (Slettrifdje Batterien au§ Elementen ober
SUtumuIatoren (©tromfammler) tönnen al3 Erfafc für
©lütßünbapparate bermenbet merben. 9Kan prüft itjre
Sraudjbarfeit mit bem Elementprüfer >bjm. Soltmeter
unb burd) ißrobejünbungen.
E3 jünben 6 frifd) angefefjte (Elemente bon je 1,5 Sott
ober 5 boü aufgelabene ^ttumuIatorenjeKen bon je
2 Sott bei 300 m wupferleitung bon etwa 1,5 mm S)urd)»
meffer 3 ©lütj^ünber. ©urdjmeffer ber Elemente ift nit^t
unter 6 cm, $ölje ber Slttumulatorenjeüen nic^t unter
10 cm ju roäijlen. ©ie Elemente merben burdj bie
355
StromaBgabe gefdjmächt, erholen fleh aber nad) turjer
Stuhepaufe. gum 3ünben ift in bie Kreisleitung ein
behelfsmäßiger <Sd)alter (©after) ju fcfralten, ber fid)
fdbfttätig nad) bem Bünben auSfchaltet (SBilb 301).
®ine frifcbe Xafdjen»
lampenbatterie non 4,5
Bolt jünbet 1—2 ©lülj-
junber.
©aS eleftrif (fje
Sicht» unb Kraft»
leitungSnefc tann
Ebenfalls jum B^en
benutzt toerben. Sßrobe»
jünbungen finb borju»
nehmen.
SBilb 301.
BeheWägiger Sdjnltcr.
a = Messingklemme mH
eingelöteter* Neusilber-
feder*
2. Beifpiele für Sprengen ftäijlerner (eiferner)
Briictenüberbauten.
523. ®te f?auptteile beS Überbaues meitge»
fpannter Brüden (SBilb 302) finb bie §aupt=
träger, bie fjaljrbafinträger, bie Auflager, ber SEinbber»
banb mit ber Ouerberfteifung.
Sie §auptträger, in ber Siegel 2, hefteten auS
Ober» unb Untergurt, bie beim fj a d) m e r l
burchSfüHungSglieber — Bfoften unb Streben —,
beim bolltoanbige n.Sräger burch eine fläche mit»
einanber berbunben finb.
©ie fjahrbafjnträger befteljen auS ben
Querträgern — redjtmintlig ju ben §aupt»
trägem — unb ben SängSträgern — gleich»
laufenb ju ben Jpauptträgern. 2luf ben gahrbaijnträgern
liegt bie g^batjn.
©ie Auflager an ben ÜBiberlagern unb
B f e i I e r n finb teils feft, teils bemeglich-
356
gadjtoertträger auf jivei Stü^en.
Silb 302.
Seitenanfidjt.
Srennfdjnitte ({. aud) 48—50).
524. Sadjljaltig gerftört man ben überbau einer
Srüde burd) Sprengen ber §aupt» unb gafjrbatjnträger
foioie ber Serfteifungen unb Serbinbungen, tote
Schienen, Sloljrleitungen unb ftarte ©elänber, im
Srennjdjnitt.
Jrennjdjnttt fdjräg jum gelb unb jur Srürfeiiadjfe
erfdjroert ein SBieberbermenben ber abgeftürjten
Srüdenteile.
Seim Sprengen bon Eifenbaljnbrütfen müffen bie
S dj i e n e n gefprengt ober borljer gelöft toerben, toeil
bie Schienen fonft liegenblei'ben unb bom ®egner für
übergefjen bon Sdjüijen au§genu|t »erben tonnen.
® ie Xa f ein
jum Ermitteln
ber Sabungen
für fjlad)» unb
S r o f i I ft a Ij I er»
möglichen, bie . erfor»
berlidje Stenge ißio»
niersSprengmittel für
bie am fjäuftgften bor«
tommenben, audj ju»
[ammengefetjten Xrä»
ger unmittelbar ab»
jidefen (tafeln 2—4).
Seifpiel 1.
fjadjioertträger,
einfacher Sal«
ten auf jtoei
SSiberlagern
mit 1 beroeglidjen (B),
1 feften Auflager (F).
Srennfdjnitt ($r.)
möglidjft über ber tiefften Stelle be§ tJlufjgrunbeS
(Silb 302) unb näljer an F al§ an B.
Querfdjnitt.
Br-ücktnhfti/e
857
«eifpiel 2.
^adjroertträger, buriäftlaufenb auf m e fj r e»
ren Stuften. Srennfcftnitt ift fo ju ioäftlen, baft
burd) ba§ ®etoid)t be§ abftürjenben SrüdenteilcS (a)
aud) bie anfdjlieftenbe Strede (b) bon bem beroeglidjen
Auflager fteruntergeriffen wirb (S3ilb 303).
SBilb 303.
Sadjtoertträger, burdjlanfenb, auf mehreren Stütjen.
Obergurt
Seijptel 3.
Solüuanbiger ©erberträger (Kragträger mit in
Selenten eingeengten Sdjroebeträgern) ift meift
an ben ©elentfugen (50) erfennbar. Srennfdjnitt ift
fo ju toaftlen, baft infolge Störung be3 SleidjgetoidjtS
aud) bie anfdjlieftenben Streden an ben Seienden ab=
reiften unb abftürjen (Silb 304).
5BiIb 304.
ftragträget mit in Selenten eingeengten ®d)toebeträgern.
Qeber £rennfd»nitt nad^ Sr. 1, Sr. 2 ober Sr. 5
bewirft nur ben Slbfturjj einer einzigen Strede. Sßtrb
^ionierbienft 24
858
ber ©erberträger aber bet Xr. 3 ober !tr. 4 gefprengt,
fo erfolgt Einfturj biefer unb ber beiben benachbarten
Streiten bei g l e i dj e m Serbraudj an ^ionier»Spreng«
mitteln.
Seifpiel 4.
5ad)ioert®erberträger, geflößt burch ßtenbelpfeiler
(»ftüßen). £rennfd)nitt ift fo ju Wählen, bafj burch
Slbreißen ber Strede öon bem feften Sluflager F ben
Sßenbelpfeilern ber §alt entzogen unb bamit auch
Sbfturj ber mittleren Strede unb bamit ©infturj beS
gefamten Überbaues bettrirtt wirb. Sinb baS bewegliche
Auflager (rechts) unb bie ©elente ber ißenbelpfeiler
(«ftüßen) berroftet, fo finb Sluflager unb ©elenle burch
Sprengen einer geringen Sabung, j. 33. Sprengbüchfe,
ju lodern (Silb 305).
SBilb 305.
gadjtoerh®erberträget, geftfißt bnrdj ^eubelpfeilet.
525. Sei großer © i l e muß man ftd) mit bem
®urcf)fcl)lagen öon ©urtungen (Schnellabungen in
Sprengmittelfäften) begnügen (47 u. 65).
©erüflbau.
526. ©erufle finb jum 2ln» unb Einbringen öon
Sabungen unb ßünbungen nötig, ©ie ©erüfte müßen
einfach, leidet unb feft fein.
Hilfsmittel finb: SRaurerböde, Settern, Sretter, Stan»
gen, Sinbeleinen, ©roßt, ®äßne, SontonS unb Sloß»
fäde.
359
SRan Baut fte^enbe ober — befonberS an ljoljen
Srucfen — Ijängenbe Serüfte (Silb 306). Seim Ser*
toenben üon Srettern unb Sollen ift
Silb 306.
§öngegcrüft jum Btubriugeu bon Sabungen.
SoxberanfidBt
Bretter
Seitenanfidjt.
Bem*
MsrsfreDung
Querknüppel Bern? In Seitenansicht Verdrehung
jprtgelassen.
8orfid)t geboten, toeil fie leidet über,
la ft et toerben.
527. ©djtoanlungen finb burd) Serantern be3
®erfifte§ mit Seinen ober Sauen ju oerljinbern.
^ängegeriifte müffen oft an Sanb jufammengebaut,
probebelaftet unb bann erft tjodjgejogen unb befeftigt
»erben.
StedttäeitigerSerüftbaulürjtbieSor*
berettungäjeit jum Sprengen ab*).
528. Seifpiele für Seredjnen non Sabungen nadj
tVlad)= unb $rofilftal)ltafel foioie Einbringen non
Sabungen:
Seifpiel 1.
@ifenba^nbrfide mit genieteten Sledjträgern ald
überbau. Sie SdjtoeKen liegen unmittelbar auf ben
•) Set griebenSübungen finb bie Sefeftigung§fteHen ber
©erüfte an ben Srüden burdj untergelegte goläftüae, Sappen
ober Süde ju febüfjen, um Sefdjäbtgungen ju oermeiben.
24*
360
Hauptträgern. ©er überbau ift gu fprengen (SBtlb 307
u. 308).
§ur Verfügung: Sprengkörper unb einige Spreng^
bücpfen.
SBUb 307.
^le^träger^ifenbaljnbrüdc.
SabungSberecpnung:
1. Hauptfrager.
r 11 (Steg) 116 x 1...........................=116 cm2
F = < 2 — (Surtplatten) 25 x 1 . . . . = 50 cm2
U |_ (Surtroinfel) (10 + 10) x 1 . . = 80 cm2
246 cm2
L = F X 25 = g $ionier*SprengmitteI.
L = 246 X 25 = rb. 6,2 kg = 31 Sprengkörper.
2 L = 12,4 kg = 62 Sprengkörper.
2. (Hfenbapnfdfjienen.
Sprengmittelbebarf:
14,4 kg = 62 S|)renglijrper + 2 Sprengbücfjfen.
3ünb un g:
Saupt> unb 9?eferbeäünbung: Seitfeuer in 8er=
binbung mit ©nanjünbfc^nur.
361
Silb 308. Ciu'rjtfjniit im Srcnnjrfjnitt 511 Silb 307.
362
Sebarf an:
günbmitteln:
1 Sprengtapfeljünber,
4 Spreitgtapfeln,
8 m Snalljjünbfdjnur,
gleiche SJlengen al3 3ie»
feröejünbung.
SB e r t jj e u g u n b S e r ä t:
2 Sßertjjeugtafdjen; 1 kg S'aÖelmac^S jum Slntleben
ber Sprengtörper; 2 Seile; 2 §ämmer; 2 gangen;
1 iijanbfäge; 1 Stolle SDraEjt (3 mm); 2 Srettftude,
je 1,5 m fang, 20 em breit, 3,5 cm ftart, 2 Srett«
ftütfe ober Satten, 2 m lang, mehrere Heine
Srettftude jum Serfpreijen.
2 Sretter, je 3 m lang, 20 cm breit, 4 cm ftart,
2 ftarte Seinen, je 4 m lang al§ 2lrbeit3gerüft.
Prüften: 1 ©ruppe.
geit: 3 Stunben.
SBeitgefpannte Srüden tann man mit toenig '^tontet»
Sprengmitteln burd) Sprengen eine? ®urte§ gegen
Sefaliren mit ferneren ga^rjeugen unb ©ifenbaijnüer«
tetjr fperren.
Seifpiel 2.
Untergurt einer 65 m weit gefpannten Srüde ift jn
fprengen (Silb 309—312).
gur Serfügung: Sprengtörper ober Sprengbüdjfen.
Stur SabungSberedjnung:
(2 |55xl,3 .... = 143 cm8
w_j 2|30xl,3 . . . . = 78 cm8
*-| 4 —50x1,3. . . . = 260 cm8
4 |_ (12+12) x 1,5 . . =144 cm8
625 cm2
L = 625 X 25 = rb. 15,8 kg = 79 Sprengtörper
ober 16 Sprengbüdjfen.
363
•50 cm
Von
I 1 I
12*12*15cm
Söilb 309. Stahringen
bet Sabung an beut
Unter gurt einer Prüfte
bon 65 m ©tü^toeite.
(79 ©prengtörper.)
% *
©ie untere £a*
bung fann man audj
auf ber Oberfeite
T § be£ betreffenben
glanfdjeS berfe^t
je 4 cm anbringen.
364
S3ilb 312.
Seitenanjidjt ju Silb 311.
Zündweiterieifungen
4-cm versetzt
Hauptzünd/eilung
Spr. Kapsel-Z.
zur unteren Ladung
365
Uteifpiel 3.
(Stählerner überbau einer Sörütfe ift p fprengen
(SSilb 313 u. 314).
3ur SBerfügung: Sprengtörper.
SSilb 313.
gadjtDertttägerbrüde auf 2 Stufen.
£abung§bere(f)nung:
1. Dbergurt.
w 11—35x1,5 . . . = 12 E(22+5+5)xl,5 = Li = 148,5 X 25 = 3,71 kg 19 «öprengförper. 2 Li = 2 X 3,8 kg = 7,6 kg = = 52,5 cm2 = 96,0 cm2 148,5 cm2 = rb. 3,8 kg = 38 Sprengförper.
866
S8ilb 314.
Sdjuitt im Sremtfönitt. Einbringen ber Sabungen an
@in$elteilen.
Querschnitt- u Zündskizze
* 19cm -*
untere Ladung*
versetzt angebracht
Untergurt
Strebe
fahrbahnträgeß
35 cm —*
Obergurt
cm
cm
*tcm
5cm
5cm
Festlegen der Ladung im
Obergurt durch Yerspr&an
mit breit stücken
367
2. Untergurt.
w_/2| 28x1,5. . . . = 84,0 cm2
* 11 - 19 X 1,5 . . . = 28,5 cm2
112,5 cm2
L. = 112,5 X 25 = 2,82 kg = rb. 3 kg =
15 Sprengtörper.
2L, = 2X3kg = 6kg = 30 Sprengtörper.
3. gatjrbatjntrüger.
v_( 1127x1,8 . . . . =48,6 cm2
1.2 — 12,5 X 1,5 . . . =37,5 cm2
86,1 cm2
L, = 86,1 X 25 = 2,15 kg = rb. 2,2 kg =
11 Sprengtörper.
5 Ls = 11 kg = 55 Sprengtörper.
4. Strebe.
F = 2 | 20 X 1,5 = 60 cm2.
L. = 60 X 25 = 1,5 kg = rb. 1,6 kg = 8 Spreng»
törper.
2L4 = 3,2 kg = 16 Sprengtörper.
Sprengmittelbebarf:
1. 2 Dbergurte ju je 3,8 kg — 7,6 kg (38 Sprengtörper)
2. 2 Untergurte ju je 3,0 kg = 6,0 kg (30 Sprengtörper)
3. 5 ^atjrbatjnträgerjuje2,2kg= ll,0kg(55Sprengtörper)
4. 2 Streben ju je 1,6 kg = 3,2 kg (16 Sprengtörper)
27,8 kg = 139 Sprengtörper
8 UbertragungStörper (an
3 galjrbaljnträgern) . 0,6 kg = 3 Sprengtörper
28,4 kg = 142 Sprengtörper
ß&nbung:
Öaupt^ünbung: elettrifcE) mit Sünbübertragung;
weferbegünbung: Seitfeuer in SSerbinbung mit
©naUjünbfdjnur unb 3ünbÜbertragung.
368
23 e b a r f an:
3 ü n b m i 11 e l n unb 3-ünbgeräten:
Jpauptjüttbung:
11 ©lüfjjünber (baöon 2 junt prüfen beS ©lülj«
günbapparateS); 200 m. $oppelfprengtabel; 40 m
ifolierter ®ratjt al§ gtoifcfjenftütfe; 15 m blanter
ober ifolierter ©raljt als gtmfdjenftüdt jur Slüd»
leitung; 1 ©lü^ünbapparat; 1 SeitungSprüfer;
1 Sorfdjaltioiberftanb.
Sleferoejünbung:
1 Sprengtapfeljünber; 21 Sprengtapfeln; 45 m
Sttattjjünbfcljnur.
28 e r 13 e u g unb ® erät:
3 SSertjeugtafcEjen; 2 Sagen; 2 SSeile; Sretter unb
Srettftüde jum fjeftlegen ber Sabungen; 1 Stolle
Sinbebrat)t; 2 Seitern; 10 Seinen.
3utn Sau eines JpängegerüfteS (Silb 306):
2 ©erüftleitern; 7 Quertnüppel, 1,50 m lang,
8 cm 0; 6 Stangen jur Serftrebung, 1,50 m
lang, 8 cm 0; 6 Sretter, 4,50m X 25cm X 3cm;
70 m. ®ral)t für 23unbe; Stägel; Seinen ober
®ratjt jum Eingängen beS ©erüfteS.
Kräften:
1 3ug, baöon
1 ©ruppe: Sau be§ JpängegeriifteS unb Elnbrin»
gen ber Sabungen an ben fjaljrbaljnträgern;
1 ©ruppe: Einbringen ber Sabungen an Ober«
gurten, Streben unb Untergurten;
1 ©ruppe: § er ft eilen unb Einbringen ber 3ön«
bungen.
3eit:
6—8 Stunben.
2 üoHe (Sprengmittelfäften toerben sunädjft mit Seit*
feuergünbung in SSerbinbung mit Slnalläünbfcfjnin: feer*
feljen unb aK Sdjnellabungen auf bie beiben Unter*
gurte gestellt.
SBilb 315.
garfpuerfträgerfmitfe auf 2 <stütjen. ^dtenanfitfjt unb
2Xrt beS SlnbringenS bon 6prengbücfyfen al3 £abung«
870
Seifpiel 4.
Stählerner überbau einer Srüde ift mit Spreng«
büdjfen ju fprengen (Silb 315).
ßabüngSberedjnung:
1. Dbergurt.
r 1 — 30x1 ...........=30 cm«
F = <l|21xl...............=21 cm’
121_ (10-4-10) x 1 . . =40 cm«
91 cm*
Lu = 91 X 25 = 2,275 kg = 3 Sprengbüdjfen.
2. Untergurt.
„ Jl | 30 x 2 ............= 60 cm*
* - ( 2 |_ (10+10) X 1,5 . . = 60 cm*
120 cm*
L» = 120 X 25 = 3 kg = 3 Sprengbücjfen.
3. Strebe.
F=2 |__ (8+10) X 1 . . . . =86 cm*
Ls = 36 X 25 = 0,9 kg — 1 Sprengbüdjfe.
4. gfaljrbaljntrftger.
I38 (nad, Safet 4) = 2,8 kg = 3 Sprengbüdjfen.
Sprengmittelbebarf:
1. 2 Dbergurte gu je 8 Sprengbüdjfen = 6 Sprengbücjfai
2. 2 Untergurte gu je 3 Sprengbütbfen =6 «
8. 2 Streben gu je 1 Sprengbüdjfe =2 •
4. 4gatjrbaljnträger gu jeSSptengbüdjfen = 12»
26 Sprengbüdjfen
baju 2 übertraaungStörper (Sprengbüdjfen ober
Sprengtörper) an 2 fjajibajnlrägern.
Sünbung:
Jpauptgünbung: elettrifdj mit Sünbübertragung;
3teferbegünbung: ßeitfeuer in Serbinbung mit
ft'naUjünbfdjnur unb günbübertragung.
871
Sebarf an:
ßfinbrnitteln unb Sünbgeräten:
ftauptjünbung:
13 ©lüttjünber (babon 2 jum prüfen be3 ®lü§»
jünbapparated); 5 Sprengtapfeln; 200m$)oppel»
fprengtabel; 30 m ifolierter ®ra§t als 3mifcf)en=
ftütfe; 15 m Planier ober ifolierter ® raljt al§
3b>ifdjenftüd jur Etütfleitung; 1 ©lütj^ünb*
apparat; 1 Settungdprüfer; 1 Sorfdjaltttüberftanb.
fReferbejünbung:
1 Sprengtapfeljünber; 12 Sprengtapfeln; 25 m
®na([$ünb[cl)nur.
SBertgeug unb ®erät:
3 2Bertjeugtaf(f)en; 2 Sägen; 2 SBeile; Sretter
unb Srettftüde jum feftlegen ber Sabungen;
' 1 Stolle Sinbebraljt; 2 Seitern.
Sunt 23au eine§ §ängegerfifte§:
1—2 Seitern; 2—4 Sretter; Seinen ober SDratjt jum
Eingängen be§ ©erüfteS.
Kräften:
• 1 gug, babon
1 ©ruppe: Einbringen ber Sabungen an Ober»
gurte, Untergurte, Streben;
1 ©ruppe: Sau be§ IpängegerüfteS unb Elnbrin»
gen ber Sabungen an bie ftaljrbaljnträger;
1 ©ruppe: §erfteüen unb Einbringen ber 3ün=
bungen.
Seit:
6—8 Stunben.
3. Seifpiele für Sprengen non Srüden aud Slauerwerl
ober Seton.
529. 3n einer Srüde aud Slaucriuerl mit ERittel»
Pfeiler (Silb 316—319) ift ju fprengen:
372
a) S d) n e 11 ber S d) e i t e l e i n e § 83 o g e n 3
burdj flüdjtig berbäntmte Sabungen
(Sdjnellabungen) — S d; n i 11 e C—D unb
E—F — aläSperrunggegen^anjerfpab'
io a g e n.
Sur Verfügung: Sprengkörper.
SabungSberedjnung:
W = 1,50, o = 5,14, d = 3,5.
L = l,503 X 5,14 X 3,5 =s 3,38 X 5,14 X 3,5 =
60,806 kg — rb. 61 kg = 305 Sprengkörper.
4L = 1220 «Sprengkörper.
9Ud) Safel 5:
L = 61,5 kg = 308 Sprengkörper.
4L = 1232 Sprengkörper.
Sprengmittelbebarf nadj 83ered>nung:
1220 Sprengkörper.
3 ü n b un g:
§aupt= unb fReferüexünbung: Seitfeuer in 83er»
binbung mit Snaßäünbfdjnur.
83 eb a r f an :
Sünb mitteln:
1 langer Sprengkapfeljünber,
4 Sprengtapfeln,
25 m ftnaßäünbfcfjnur,
SSerfjeug unb ©erät:
1 Sgerkjeugtafdje;
4 Spaten;
40 gefüllte Sanbfäde jum SSerbämmen.
Kräften:
1 ©ruppe.
Seit:
‘/s Stunbe (menn Sabungen, Sünbungen unb 83er»
bämmung üorbereitet mären).
Sprengerfolg: SluSbredjen be§ SJiittelteileS be§ 83ogen3;
keine lange Sperrbauer gegen alle SBaffen.
gleidje Mengen als
fReferbejünbung.
Stonterhtenft
Stengen einet gemauerten «ogenbrfide.
®tlb 316. @eitennn(i(i)t.
874
»ilb 317*
A—B.
58ilb 318.
Sdjmtte C—D imb E—F.
375
b)S)erDbertetlbe33Rittelpfeiler3unb
anfdjliejjenbe Sogen burdj flüdjtig tm
©rüdenauge (S dj n i 11 A—B) berbämmte
Sabungen (S a n o f ä d e unb Stafenftüde).
Seine Stinentammern borljanben. 3ur Serfügung:
Sprengtörper.
SabungSDeredjnung:
W = 1,30, c = 6,24, d = 3,5.
L = 1,30’ X 6,24 X 3,5 = 2,20 X 6,24 X 3,5 =»
48,05 kg = rb. 48,2 kg — 241 Sprengtörper.
3L = 723 Sprengtörper.
Sadj täfel 5:
L = rb. 44 kg = 220 Sprengtörper.
3L = 660 Sprengtörper.
Sprengmittelbebarf nadj Seredjnung:
723 Sprengtörper.
günbung:
ipaupt« unb Steferüejünbung: Seitfeuer in Ser»
binbung mit SnaHäünbfdjnur.
©ebarfan:
günbmitteln:
1 langer Sprengtapfetjünber,
3 Sprengtapfeln,
15 m SnaUjünbfdjnur,
gletdje SJtengen aß
Steferuejünbung.
SBertjeug unb ®eröt:
1 Sßertjeugtafdje;
30 gefüllte Sanbfäde jum SSerbömmen;
3 Spaten.
Sräften:
1 ©ruppe.
Seit:
2 Stunben (wenn Sabungen unb Stobungen bar»
bereitet waren).
25*
376
SorauSfidjtlidjer Sprengerfolg: gerftßren bes
oberften SeileS beS Pfeilers unb Slbfturj ber beiben
Sogen. Sperrmirfung beffer al§ a), man tann
jebod» ben ißfeilerftumpf als Stüfje beim Sßieber»
^erftelten ber ©rüde auSnufcen.
c) ©er Stittelpfeiler burd) Sabungen
(Sprengtbrper) in öorljanbenen St i n e n •
f a m m e r n.
2abung§bered)nung:
W = 1, o = 6,24, d = 1.
L = 1’ X 6,24 X 1 = 6,24 kg = rb. 6,4 kg =
32 Sprengtbrper.
3 L = 96 Sprengtßrper.
Sadj fcafel 5:
L — 6,24 kg = 32 Sprengtßrper.
3L = 96 Sprengtßrper.
Sprengmittelbebarf nadj SBeredjnunjj:
96 Sprengtbrper.
3ünb ung:
Jpaupt» unb Steferbejünbung: Seitfeuer in Ser»
binbung mit KnaKjünbft^nur.
Sebarf an:
ßünbmitteln:
1 langer Sprengtapfeljunber,
3 Sprengtapfeln,
10 m S'naUjünbfcbnur,
gleiche Stengen als
Steferbejunbung.
SBertjeug unb ®eröt:
1 Sßertseugtafdje; 2 jammer; 2 ©reujljacfen;
3 Spaten; SRafen jum Serbämmen.
Kräften:
1 ©ruppe.
Seit:
3 Stunben.
877
BorauSfi^tli^er Sprengerfolg: Sröfjer als b),
toeil ber Pfeiler unb bie anfdjliefjenben Sogen faft
gang einftürjen.
d) SD i e SSiberlager unb ber 3Jt i 11 e l p f e i •
ler. SOlinentammern bortjanben.
fiabungSberedjnung:
W = 1, e = 6,24, d = 1.
L = 1’ X 6,24 X 1 = 6,24 kg = rb. 6,4 kg =
32 Sprengtörper.
9L = 288 Sprengförper.
Sprengmittelbebarf:
288 Sprengförper.
Bünb ung:
Eauptjünbung: elettrifcf);
fReferbeäünbung: Seitfeuer in Serbinbung mit
SnaHäünbfdjnur.
® ebar f an:
ßünbmitteln unb günbgeräten:
Eauptjünbung:
11 Slü^ünber (babon 2 jum prüfen beS Slü^ünb»
apparateS); 1 ®lüf)jünbapparat; 1 SeitungS»
Prüfer; 1 Sorfcfjalttoiberftanb; 400 m Spreng»
fabel als Einleitung; 400 m blanfer ober ifolier»
ter Straft al§ Südleitung; 35 m ifolierter Srat)t
als Stoifdjenftüde.
Steferbejunbung:
1 langer Sprengtapfeljünber; 9 Sprengtapfeln;
60 m ©naHsünbfdjnur.
SBerfjeug unb Serät:
3 SBertjeugtafcfjen; 5 Spaten; 2 Sreu^aden;
2 Eämmer; Stafen jum Serbämmen.
Kräften:
1 Bug.
378
Seit:
©iS 3 Stunben.
©orauSfidjtlidjer Sprengerfolg: ©ie ganje
©rüde ftürjt ein. ©urd) baS ^luflodern beS ®rb«
reiches ber SInfchlußbämme roirb ein Sßieberher«
fteKen mehr erfd)roert als bei c).
B. Überfetjen von 84«£aften unb Bau von
8=t=Brücften.
©emeffungen f. $ a f e I 19.
1. OgemeineS.
530. ©er Sau öon Mähren für lang«
bauernben ©etrieb unb bon langen
©rüden für 8=t«Saften ift Sad)e berühmtere.
Kavallerie unb Kraftfahrtampftruppen muffen in ber
Sage fein, mit eigenen Kräften unb SJlitteln eine geringe
Bahl bon fjahrjeugen, bie ü b e r 4 t wiegen, über ein
breites Seroäffer uberjufeßen unb lurje ©rüden, im
allgemeinen Uferbrütfen (549), ju bauen.
Bum Überbrüden fdjmaler Seroäjfer, [d)maler Sräben,
bon großen Södjern unb ©ridjtern auf Straßen unb
SSegen, ferner jum ^erfteHen bon Fahrbahnen über
befdjäbigte überbauten längerer ©rüden führen Kraft«
fajjrtampftrnppen jroedmäßig borbereitete
©ragbalten aus Spols ober Stahl mit (iEafel 22).
531. 8=t=5ät)ren unb =®rüden »erben im allgemei«
nen nur im Buge brauchbarer ober fdjrtell herjufteüen«
ber Straßen gebaut. 3lur für borübergetienbeS ©e»
nußen tann man fjäbrftetten unb ©rüden aud) außer«
halb bon Straßen, jebod) an fefte Ufer mit feftem
Umgelänbe, legen.
532. 21 r t ber Sau ft off e, Beitbebarf für
ihr Sinb ef ö rb er n, oerfügbare ffförber«
mittel, Seräte unb SBertjeuge jum Sau
finb für bie ©auart unb ©aujeit entfeheibenb.
379
2. Sauftoffe.
533. $olj für 8«t«Srüden toirb oft in ^orm Oon
SRunbljolj bertoenbet toerben müffen, toetl SFantholj in
ben nötigen Störten feiten bortjanben ift. Sragbalten
au3 Stunbholj finb jum Sluflegen be§ SelageS einfeitig,
an ihren Sluflagerenben jebod) jioeifeitig, J^olme unb
Schwellen au§ Stunbijolj burdjtoeg jtoeifeittg p be«
arbeiten (beklagen).
güt gangen unb Serfdjtoertungen merben §alb«
$ ö I j e r ober Sohlen üermenbet.
Srofilftabl unb Schienen finb als Sräger brauchbar;
breitflanfdjige Stahlträger eignen fich für große
Stüßioeiten.
2lrten Oon Srofilftahl f. Silb 320. Sie gatjl gibt bie
©ölje in gentimetern an.
fflilb 320.
^rofilftabL
3. Serbänbe.
534. Serbänbe f. 233 ff. u. Silb 118—122. Seinen«
unb ©raljtbunbe barf man jebocf) nur jum SRöbeln unb
jum Serbinben oon Sragbalten mit Söhnen üertoenben.
Sohlen, Sretter unb leichte Ser«
fdjtoertungen befeftigt man mit Nägeln. fjür feßr
ftarte Jlägel bohrt man burch öaS anpnagelnbe £>olj
Södter mit ettoaS geringerem Surdjmeffer. ©er Siagel
foH 2» bis 3mal fo lang fein toie bie Störte be§ anp«
nagelnben $olje§.
Sonftige Serbänbe f. 544 u. 545.
380
4. Hilfsmittel beim Sauen.
535. Stammen.
St a m m t i e f e: */s freie Stü|Ijölje, minbeftenS
1,50 m. ber Slufsgrunb nidjt überall gteicE» trag»
fätjig, fonbern meid), fo rammt man ^ßrobepfätjle. Ser
Sfagl barf nadj 15 träftigen Schlägen n i dj t m e Ij r
al§ 3 cm einfinten. Sei ioeidjem llntergrunb Der»
meljrt man bie Rdf)l ber Sfäfjle in einem 3orf) ober
rammt ©oppeljocye.
3um Stammen in SBaffertiefen über 0,60 m baut man
Stammfäljren nadj Silb 126 u. 131.
5. ßnbauflager unb Stfigen.
536. SaS Gnbauflager befteljt aus bem Uferbalten
Sßtlb 321.
Snbauflngcr für 8«t.»tMe.
(6 m Stüfcmeite.)
flüe'3chnW n^oa
mit ben ©runbfdjmeHen unb ber Stoftboljle (Silb 321
u. 322).
©er Uferbalten erhält bie Stärte beS fgolmeS für bie
anfdjiiefjenbe Stütjmeite; man legt ibn breitfantig unb
lammt iljn, toenn Qett oorljanben, in bie ©ragbalten
unb Srunbfdjmellen ein.
fjür bie ®runbfcbweüen (bei mittlerem Soben rb.
1,20 m lang) mäfjlt man etma bie Stärte ber Ijöljer»
381
33ilb 322.
geitenattfirfjt p ®ilb 321.
wen Xragbalten für bie anftfjliefjenbe Stützweite, ijöctj»
ften§ aber bie für 5 m Stüßroeite borgefeßenen Störten.
3m allgemeinen ift bie galjl ber ©runbfdjroeüen nadj
ber 3a^l ber Sragbalten ju beftimmen.
537. $oljftapel tommen nur in SBetradjt, wenn be»
arbeitete, gletcf) ftarte Sauljöljer (j. 83. Bifenbaljn»
fdjtoeüen) in großer 3a^l beigetrieben werben tönnen.
538. Bin SdjroeKjodj Ijat minbeften^ 4 Stiele. 2ln«
falt für ben Sau gibt Silb 171 u. 172.
2)a3 SdjroeHiod) ift auf ®runbfcf)WeUen ju lagern.
SchweUenschrauben
SBilb 323.
®erbanb jtoi^en §olm unb
frei einet 8=t=^rütfe.
Sei borübergeljenbetn Senufcen bon
ftäljren unb Srudcn genügt Serbinben
ourdj Sanbeifcn oberßafdjen mitftarlen
Nägeln ober ©djtoßHenfcfjrauben.
539. $fal)ljod)e (Silb 169), jebocü 4 (ßfälile in jebem
3od).
382
Sinn Slufljoimen fdjneibet man bie Sfäljle an
ber feftgulegenben ^ößenmarfe toaageretbt ab. Sie
gleitfje Sdjnittljölje für alle Sßfäfjle eines QodjeS erfjält
man, wenn man jtoei Sretter, beren Öbertante bie
Untertante beS jQolmeS angibt, maageretfit an bie
ißfäljle nagelt
Ser §olm mufj auf allen Sfäljlen feft aufliegen unb
na<fy Silb 323 mit ifjnen berbunben fein.
540. ßum ßängSoerfteifen ber Srücfe finb bet
SdjtoeHjodjen in jeber, bei Sfaljljodjen in jeber jmeiten
Stüßroeite ßängSftreben ober burdj »eg ßängS«
gangen angubringen.
6. überbau.
541. Qn ber Stege! finb 6 ober 8 Sragbalten nadj
Safe! 19 ju bertoenben. Sie Sragbalten werben in
Sleidjcn gtoifdjenrüumen »erlegt, bie äußeren Stag«
alten bei ehtfpurigen Srüden liegen 3,1—3,3 m bon»
einanber (ffllitte ju Wtte) entfernt.
SBilb 324.
Statnßfet Stoß bei einet 8=t«SBrürte.
Sei Stüßtoeiten b i § 3 m unb einer fgolmftärte
bon minbeftenS 24/24 cm tönnen bie Sragbalten auf
bem Jpolm ftumpf gefloßen toerben (Silb 324).
883
Sei größeren Stüßtoeiten »erben bie Srag»
ballen auf bent §olm ncbeneinanber gelegt, hierbei
toerben ftarte folger toegen beS geringen gmifdjen»
raumeS jtoifdjen ben ©ragbalten an ben Gaben bebauen
unb burdj Klammern öerbunben (Silb 325).
Silb 325. Sin ben Gaben bierfeitig behauene ftarte Jragbalten.
(SSerötnbung mit ßolm burdj SSinlelftable ober ftarte Knaggen an bex
Unterfeite ber Xragbalten.)
542. ©ntfteljen fpoljlräume jtoifrfjen §olm unb
©ragbalten, fo finb bie Xragbalten ju unterfuttern,
©ie fjutterböljer finb burdj Diägcl fefljulegen.
543. Stahlträger unb (Sifenbaljnfdjienett als ©rag«
ballen finb burcf) SdjtoeUcnfdjrauben ober Sdjrauben*
boljen unb güHhöljer (Silb 330) gegen Ilmtanten ju
fldjern.
544. (Einfacher Selag (©ragbelag) genügt nur
für oorübergeljenben Serteljr, für ©aueröertetjr mufj
man auf ben ©ragbelag noch einen ^weiten Selag
(fjabrbelag, Silb 321) aufbringen (Stärte l.
©afel 19).
Sei hölzernen ©ragbalten nagelt man jebe Sohle auf
jfeben Drtbalten. Suf Stahlträgern befeftigt
man ben Selag nach Silb 326 unb ficfjert ihn burch
aufgenagelte ßängSbohlen gegen JeitlicheS Serfdjieben.
©er Selag muß auf auen ©ragbalten gleichmäßig
aufliegen.
884
Silb 326.
Sefeftigeu be§ Selageä auf Stahlträgern.
Duerjdjnitt
längsbohte gegen
Verschieben des Belages
♦c/n fahrbelag JL-A
V>an ^agbelag II
Orahtbund oder Bandeisen
545. Sie Slöbelbalten ftrtb mit ben Sragbalten burdj
Stahlrointel, Sügel, Sanbeifen ober ftarten Sraljt feft
ju öerbinben. 21I§ fRöbelbalten genügen: ®ant» ober
JRunbhöIjer oon 14—20 cm Starte ober Sollen in
Starte be§ SragbelageS.
546. Sa§ Selänber bei Srücten für turjen Serteljr
baut man nad) Silb 327. mufj ba§ SInleIjnen ein»
jelner ßeute auSljalten.
Silb 327.
©elänber einer 8=t=Srüde.
547. Sine 8=t=5ä!jre für borübergeljenben Setrieb
>eigt Silb 328. Sie Sauart entfpridjt ber ber 44»
Jäljren.
885
3BHb 328. 8.t.g8Ijte mit Sanöbrüde.
Sanbbtflde.
Die fdjtoimmenbe ©nbftüfce unb baS (SdjtoeHiodj ber ßanbbrürte finb burch
Xaue am Ufer ober- unb unterftrom feftgulegen (in geidtjnung fortgelaffen).
gtahrbelag fortgelaffen.
Sauftof f bebarf für 8-t-$äIjre:
8 Hähne au ie rb. 13,0 t Sragtraft (12,0 t mürben genügen); 6 Srag-
balten, 8,00 m lang, 20/24 cm ober 30 cm 0 ober I20 ober IP14; 2 SRöbel-
balten, 8,00 m lang, 14/14 cm; 2 (Set) erb alten, 8,00 m lang, ober 4 (Scherbalten,
5,25 m lang, 18/20 cm ober 28 cm 0; 2 (Selänb erb alten, 8,00 m lang, 8/8 cm;
8 ©elänberftühen, 1,00 m lang, 8/8 cm; 32 Sohlen, 3,75 m x 25cm x 7,5cm,ober
64 Sollen, 3,75 m x 25 cm x 5 cm; 2 (Stofjbohlen, 3,75 m x 25 cm x 7,5cm;
48 Hnaggen, 0,20 m x 20 cm x 10 cm; 15 (Stiele für (SdjtoeHjodje in ben
Hähnen, ettoa 0,70 m lang, 16/16 cm ober 16 cm 0; 3 (Schtoeilen, 6,00 m
lang, 16/18 cm; 3 ßolme, 4,00 m lang, 16/18 cm (16/16 cm toürbe ge-
nügen); 6 gangen, 2,50 m x 20 cm x 10 cm; 18 (Streben für (SchtoeHjoche,
ettoa 1,10 m lang, 10/12 cm; 20 SRöbelteile; 75 Seinen unb 250 m ©raht;
80 m Sanbeifen für Serbinben ber (Stiele mit ben (SchtoeHen unb Dolmen
ber ®djtoelliod)e; 240 Slägel, 5 cm lang; 200 üftägel, 13 cm lang.
886
Slbtoeidjungen finb:
a) SSei Sanbbrüden, bie grunbfäglidj mit einer
fdjroimmenben S t ü g e enben müflen, ift
bie legte Strede burd) einen fiufjit gleidjer ©rag«
traft wie bie be§ ©nbtaljneS ju unterfingen.
b-1 ©ragtraft ber in bie gäijre einjubauenben
ffägne f. Safet 19. ®a man feiten für ben über«
bau lange ©ragbalten mit bem erforber«
licgenQuerfcpnitt finb en roirb, fo muß man
oft ben überbau nod) burd) eine SHittelftüge
(®at)n) unterftügen. ©ie SSemeflung be§ Quer»
fdjnitte^ ber Sragbalfen unb ber Slufrüftung in ben
Sütjnen ift bann nad) bem SRitteltoert jroifdjen ben
Stügroeiten ber Srtbtätjne (SSilb 328 rb. 5 m) unb
ben Stügroeiten jroifd)en SRitteltaljn unb ®nb«
täljnen (SSilb 328 rb. 3 m), atfo beim SSilb 328 =
4 m, ju beftimmen.
c) ©ie 53 o r b e ber ®ätjne finb grunbfäglidj burd)
gangen (fdjroadje §öljer mit Knaggen) jufammen«
juijalten.
d) $ür ben Übergang bon ßartbbrüde jur gfäljre
finb grunbfaglid) lange SSoglen ober E • Stahle ju
berto enben.
548. SSeranteruug ber Sanbbrüde, f^efttegen ber
fjäljren an ber Sanbbrüde toie bei 4«t>f5äljren.
8=t»gäbren b e io e g t man an fjäfjrfeilen ober burd)
Sölotortraft, fcltener burd) Stubern ober Staten.
7. Uferbrüden.
549. SU§ Uferbtütfen über fdjmale Setoftffer ober
Sprenglüden in SSrüdenüberbauten (bis 5 m Stüfc«
toeite) berroenbet man für ©raftfafjrjeuge in Spurweite
387
»erlegte Staljlprofile (93ilb 329), 3tunb« ober fiant«
tjöljer. Stärte ber Profile nadj ©afel 22. ©en Selag
nagelt man auf ben Querträgern feft ober Ijält ihn
burdj fd)toad)e fftöbelftangen, bie man am Ufer ober in
ber SBrüdenfaljrbaljn burdj fiatenpfäljle ober ißfäljle
mit Querlatten feftlegt. ©ie tRöbelftangen finb jugleidj
©punbegrenjer.
3?ür bie 8 a u a r t öon Uferbrüden über 5 m Stü(}=
toeite geben 8ilb 329 u. 330 unb Safel 22 Sünljalt.
glüdjtigeg SBicbcrfjcrftellen einet getytengten Stüde füt firoft»
fatjtienge bi§ 81 QeiDidjt burdj mitgefüljtte Staijtttäget.
SBilb 329.
SBemeffungen für ©ragbalten über 5m Stüh«
toeite f. Safeln 17—19.
888
Füllholz
©üb 330.
gediegen bet Xragbalte«
bnrrfj gflllböli«.
$ann man bie Sragbalten nicht in bie ffahrbaljn einlaffen, fo jjnb fie
burch Gdjiencnnägel ober burdjgegogene ©aSraubenboIjen unb güuhölger
gegen kanten gu fidjem.
Uferbrütfen mit 3 mSrüdenbaljti baut man mit
Snbauflager nadj 536 unb einem überbau nadj 541 bi8
546 mit im allgemeinen bur<f)Iaufenben Sragbalten
nad) SBilb 46.
83erlin, ben 11. Februar 1935.
Set ßijef bet Heeresleitung
3.
5 r o m m.
389
Str.
1—10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
• 11a
12
13
14
15
16—22
16
17
18
19
20
21
22
23
tafeln.
SBeaeid^nung
(Seite
Safeln gum (Ermitteln von Sabungen
($i.Spr.$L):
Sabungen für §olj (^oljtafel)................
Sabungen für gladjftafjl.....................
grei angelegte Sabungen für *ßroftlftaljl ..
„ w „ f^rofilftatjl (gortt)
geballte Sabungen für -äftauerioert, $eton,
gel3 unb Grbe...............................
fReiljenlabungen für Sftauertvert, Söeton, gel3
unb (Srbe.........x.........................
Sßerte für d (^erbämmung^aljl) bei geballten
unb fReifjenlabungen..........................
geftigteit^toerte (c* Safel).................
SBerte für D2................................
SBerte für W2 unb W3.........................
(Sperren mit Eingaben über Kräfte*, Seit*,
SBert^eug*, SBauftoff* unb görbermittel*
bebarf (nur SInpalt).......................
Seiten für Sperren...........................
Starten felbmä^iger bedungen.................
9Irbeit3leiftung bei 9Iu3peben Von Söoben ..
(Prüfte unb Sragtraft Von gäffern, ^aniftern
unb Safttrafttoagenfdjläucpen..............
Sonnen^at)! für Stege, 24* unb 4*t*$8el)elf3*
brüden........................................
Starte unb ?lbmeffungen Von $au*
ftoffen für:
Sdjnellftege unb Stege.......................
2*t*53el)elf§brüden unb *fäpren..............
44*53e^elf§brüden unb *fäpren................
8*t*$el)elf£brüden unb *fäfyren..............
16*t*SBeI)elf3brüden unb *fäl)ren............
Söretterböde für Stege, 2*t* unb 4*t*$el)elf3*
brüden .......................................
llferbrüden bi3 5,00 m Stü^roeite............
$ett)i(f)te Von ga^rjeugen...................
390
391—393
394—397
398—401
402
403
404
405
406
407
408—413
414
415—416
416
417
418
419
420—421
422—423
424—425
426—427
428
429
430—433
^ionierbienft
26
390
Safel 1.
Holz - Tafel
Frei angelegte Ladungen über Miss er oder m weniger als 1m Mssertiefc bei Holzart trocken, weich Holzsiärke (T\-~d- cm oder L~|—/hC/77 Frei angelegte Ladungen über Wasser oder in weniger als 1m Wasserlilie bei Holzart frisch, zäh, astreich Bohr la - düngen (giH für alle Holz- arten)
Hg 0.1 0,2 0,3 0,4 cm - *n Kg nn ^9
* U,Z. 0,3
—— — 0,4
-w>s 0,5 r, »7
0,5 0,6 Jfcv. 0,0 — °’7 öS -0.1
1.9— OJ O£ a9 1.0 —0,2
*3 M 17 4 17
,6 Zfl 17 —2.0 r Pf -Q3 nt
18 -.g _ »? „ ' ZP2.1- —2,6 p7
P7 2 5~&= — — = ~_ A1 3,0 29Z7
2.7- m ?z $.1 ii— —^3.4 ns
4.r t - ^4,4'^ ' ^~5T5'r — 7 80 VW ~0,7 na
5ß-^—=\
£7- ^JS5=> — 8^ ‘ ' ^—7/ UP oß
3'9 I £ö~Z*« 11« I.» —, 75 _7>3
6.6- ->O ^JFTT-TiB 7‘ —— 7^8 2 —1.0 —1.1 in
7.5— 6.8 m 7‘U p/> . zz ' ,7-y,4
8.6— 8,2-ftp — ' iv, 3 m *7 —1.3
391
Grafel 2.
Erläuterungen §u Safet 2.
1. Sic Safet ift nad) ber gormcl »L = F • 25« gufammen*
geftetlt
2. 33enu£en ber Safet f. untenftetjenbeä Söcifpict:
23eifpiel: SSetdje £bg. ift für einen fjtad)ftat)t bon 40x2 cm
nötig ?
OOefjc oben auf ber toaagcred)ten £inie bU 40 cm, bann
{entrecht fjerunter auf bie 2 cm=£inie. Siefer $unft toirb
burd) eine ftarte fturüe gefdjnittcn, getje auf biefer red)t3
Ijerauf unb lieg ab = 2 kg epr.
26*
392
Sabnngen für glarfjftoljl
393
394
g g f c I 3.
grei angelegte Sabungen
t-Kid ßleichschenkl. Mnkebfahl (:bM Ungleichsche Winkels y—td mkliger tahl 6 Breitflanschiqer T-Stahl Pi- Spr- M. in kg
Pro- fil- Nr. mit b cm Dicke d cm Pro- fil- Nr. CJ.. LJ Dicke d cm Pro- fil- Nr. Dicke d cm Pro- fil- Nr. Breite b cm Höhe h cm Dicke d cm
□cne b cm nwi a cm jene b cm RKBL a cm
31 9 3/5 jlHb 1 10/t ?il 3 v> 0/5 2/1 2/9 2 2 9 9 0,3 0/1 0/1
4 5 51 6 1 JM8 i/5iw 5 M 5,51 Q6 6 10/6 1/6 1/6 9 9 6 6 0/5 dT 3/6 3/6 9/8 3 3 9 6 6 8 0,5 0/7 0/6 6/3 7/31 8/1 6 7 8 3 3/5 9 155 Q/6 V 0/2
5 51 (d fei 1 71 5/5 6 fe/5 7 7/5 19 18-1,0 IS-ty) 17’19 17-19 0/8 5/71 5111 5 5 7/5 7,5 H7 0/9 9/8 5/10 9 5 8 10 0/8 Q8 9/91 10/5 9 40 1/5 5 0/8 185 0/3
61 1 71 8 9 6/5 7 7/5 8 9 V 1/1 1/0 18-|! 61/10 f»5 10 5/13 5 10 4/0 (Vr
n 8 9 JL 7/5 8 9 10 1/2 1/2 1/1 1,1 61/® 8/42 6/5 ö 10 12 4/4 4/0 61/13 6,5 43 i/0 12/6 42 6 . 4/0 0,5
9 40 JL 9 40 1/3 1/2 40 8^ !, tt 4? (Wß 6(5 43 4? 49 7 «5 0/6
2 3 4 5 i 7 8 iö fr 12 i3~ ~w HF“
395
für $rofilftri)l.
p Höchst T-S Prn-Ihitp egiij tah Höbe h cm d er l He d cm fi +... u Pro- fil- Nr. c -St trete b cm ahl Höht h cm fi T Pro fil- Nr. I 4* ippe -Stc Brett b cm l- ihl Höhe h cm b . Quadra Stab Prnläni» nt- l Ditte t cm Rund SW d cm Pi- Spr- M. in kg
fil- Nt. b cm fil- KU b
INI. Illi
2/2 3/3 Ufri ‘t/t 2 2/5 3 3,5 4 2 2/5 3 3/5 w 0/35 W M5 0/5 2/2 0/1
HW 5/5 6/6 5 6 M 5 6 0,55 ft6 ft7 3 4 5 3,3 3/5 }8 3 4 5 8 V 8 3 0/2
711 7 7 0/8 6t 3 9,2 9/5 (»5 8 9 40 4,6 5 9 40 3/8 0/3
8/8 8 8 fl/9 40 5 40 41 42 5/9 5/8 11 42 0/1!
M 9 9 1/0 12 5/5 42 13 14 6/2 6/6 43 44 5 0/5
1W0 >10 ~TS~ 40 4,4 ST 19 16 ?r 6/0 r# 44 46 45 46 44 7/0 7/4 "25r 45 46 2^ sr 30
396
3« Safel 3,
grei angelegte Sabungen
q Bleit Win Pro- fil- Nr. u- ►(r- hsch kels irati b cm enkl fahl litke d cm Un Pro- fil- Nr. -a- glei IVi 5che b cm rt-d chs nk nkel a cm ehe eis We d cm u ink al Pro- fil- Nr. -a- 5che b cm er nkel a cm Dicke d cm Breil T Pro- fil- Nr. tUar -s Breitj b cm tsdii tat Nöte h cm ger ll Dicke d cm Pi- SpT: M. in KO
10 41 42 10 41 12 V 1/2 1/1 8/14 6 46 1/2 0,7
44 42 Ji n 12 13 4t 43 42 W15 40 45 1/2 8/46 6 46 w 46/8 46 6 1,3 0/8
42 43 4*t 42 43 14 1/5 41 1/3 Wß 40 15 4t
43 4^ 13 1*fr 1/6 45 10/20 10 ?0 Vf 18/9 16 9 1/t W
15 45 1,1
44 15 16 14 15 16 4T 46 45 WZO 1» ?o 45 2W 20 10 4/6 12
45 46 15 46 4/8 4/7 13
U
46 10 4? 1/5
1 3 tf 7 8 9 io ti "7F 74 T“
SSeifpiel: SBeldjeßbg. iftfür einen gleic^fc^enn.SBinteb
ftatjl (14 4 14) x 1,5 cm erforberlid^? ©epe in
ber ©ruppe für Qleiepfctjenfl. Sßintelftaljl fentrecht
397
fflt tprofilftaW.
Hochstegiger
T-Stahl
Pro-MHöliflDiike
fil-
Nt.
cm
cm
d
cm
m
42
42
41
19/49. 49
49
15
TT
19
20
U-Sfahl
ProieilfiHöhi
fil-
Nr.
cm
h
cm
48
xo
48
20
7/5
20
22
8/0
22
29
8/5
29
26
28
30
9/0
26
9/5
28
30
TT
ProttÄt
fil-
Nr.
cm
h
cm
b
Quadrant-
Slahl
Proteste
SWM.
47
48
49
21
21
22
T/«
äz
Ai
47
48
49
M
V
-21
21
22
P-oflls
fil-
Nr
cm
t
cm
cm
5/8
.5
31
V
sei
au
S'pal
*26
0/6
6/2
7
in
M
M
M
Iß
Czung
ahl-Tfrfel
te22-29.
23
herunter Bis «ßrofil 3lr. 14 (b = 14 unb d = 1,5),
bann toaageredbt nad) rechts unb lies in ber
legten ©Balte ab — 1,0 kg epu j»t
TT
12
1
“Jö
13
15
398
Safel 4.
angelegte Sabungen
xD> Breit- u.- para Tiormalsteqiqe kb* Ulflanschige dünnst egije Otj» -h- Breit-urschräqflanschige normal siegige Träger Pi- Spe- rl, in kg
Träger
Pro- fil- Nr. Breite b cm Höhe h cm Steg- störhe i cm Hansrt starte t cm Pro- fil- Nr. Breite b cm Höhe cm Steg- stärke d cm fM stärke t cm Pro- fil- Nr. Breite b cm Höhe h cm Steg- T cm Mitt len Flansdo stärke t cm
4H- 4H- 44 «kW 12
W w u 1,2 11S_ 45 45 V>75 1? 1/1
15 45 45 0/5 1*2
TT 4b TS~ "Ö^ 33Z
EI»IJEUl>£]KttM SLUJEUEUL^jL^] 4.3
Eli UJ E/U
IKUBLlElUl^E^M Kz
MMMMMM
hihi rUIiTlErtd 4.9
M
IOTHI1HJEMEI1M Z2B 22 22 0/9C 4/48 TT"
1 4/6 2.2
tWWflKMIM IM 2.3
1 1
MMMMMHJMlKillL’iflEnri^l^KlEJUC^EM
MM M 12.8
L2JE
399
fflt ^rofilftaljl. (Sortierung).
t
’*b*
Breit-Urschrägftanschije
dunnsfegige
Träger
Pro- Breite Höhe
fil-
Nt.
b
cm
h
cm
i<b>i
Doppel-
T-Träger
„ Pro-SfreildHöhi PrdänjiWt
HEfil-b h
Nr. cm cm
d
cm
cm
R-
Quadrant-
Stahl
fil-
Nr
b
M.
in
cm cm
Pi-
Rund-
M
M
in
kg
cm
7
_1±_
7/8
IDO
ICH!
m
IEJ3M
iHBHMHiBQHEöHai
BHiHHBHHieamejii_________
^MMLKaüöJBÜlEratai-------
5
3/5
0/3
IzO
±±
1/2
8/5
_2_
IE7H
KJO
iCJ»
DE1
»*> ____________
KOP4'lKffli»7IZ«
___________________MHHH------------
IMF LllJ *ii> 1,1LI iLH Ml /U
-------------------
»II
BQ
m
Ml NI
nn
m
Kfr-irnj
EU
Mm
mm
MR1
Mm
MIHI
m
Mm
Mon
MK^
36 HM 36
kgdvipg. 1M33
^RirairWChiiLTII^CIiltClI
IE7HI
KUIUOWMMMMMI
--------M^in^£&ii3imi
ffläS
30BdU 50 I 30 IQ/96f^
H18.7_______________
>1/92
95 1W95
36Bd 30
11
4<
42 4
5/0
9/5
40/5
42
dZil
13
411
41
411.
1/5
4/8
TT
2/2
2dt
1
2il
Äi
3/3
Ä1
12
3Od
ffi
30
38
M
M
50
45
5/5
W4/3 I 95
*15/5
I Za
IBJEl
.
L'TH EftHdl
ün
EXl
4kl
IKEl
47^
271 231 29
30
18
19
20
21
22
23
2*
25
26
400
3 n 2 a f e I 4.
grei angelegte Sabungen
Breit- ».- parallelflanschige
normalstegige diinnstegige
normalstegige
Träger
BreitejHöhe Steg-flansdi'
- störte stärke .
Pro-
fil- b h ttt
Nr.-----------d- 1
cm
cm
cm
cm
Pro-
fil-
Nr.
53
BieitiiHöhe 5tei
cm
30
h
cm
42/5
Steg-
stärn
d
cm
331
flansA
stärk?
t
cm
2/6
Breit-u-schrac.
normal sfegtge
Träger
Pro-|8reite|Höhe|5teig-
fil-
Nr.
CT
b
cm
cm
M.
30
42/5
£6 rB____
45 30
45
M
ZT igB
30
45
öfll
''3Ö
IEEII
IER0I
£81
IEHE43MI
50
3ö
M
4/3
ZÄ
|45B| 30
ie
cm
<55
425
Al
31
55
60
65
70
3E
30
30
30
3Ö
3ö
35
Tö
4/6
4/7
±1
M
3®
Zo
M
30
M
331
Mittten
Flansdi
stärhe
t
cm
5E‘
4/6
41
Pi-
Spe-
rl,
in
kg
215
267
i2_
ü
JA.
5.7
5,8
5,9
äo
JA.
M
ruEOiriiEOEiiHiHn
3/2
35
EaB3ln3EE]^l
60
30
JO.
M
45 MA 3/61
8
9
10
lEIL^^EOl
(hl
2/06 3^08 7,2
I 17,3
70B
75B
MB
85B
30
30
75
241
£44
3,13
13/13
8/1
£6
30
3Ö
90 B
55B
Jo
100B 30
72
8ö
AO
A5
jöö
T3
2,15
Z45
iSS
(52l
£15
3/23
£19
74
£1
133
21
15
9/2
9/3
9,4
9,6
9/8
0/0
10,1
10,2
IT
401
fihc
**b* Crert-Urschrägftanschige diinnsfegige Träger GZ Dopp T-Trä Pro-Breite el- iger Höhe h cm Quadrant- Stahl ProlänoilDick Pl- Spr M. in kj • LdJ Rund- 5tal)l d cm Pl- Spr- M. in kg
Pro- fil- Nr. Breite b cm Höhe h cm Stea- stäme d cm ninitn Flansch starke t cm fil- Nr. b cm fit- Nr b cm t cm
SS 30 U5 w 2/58 5/4 48 6/9
5/2 48,5 6/8
5/3 49 7/4
IM 55 20/0 55 5/9 49/5 7/5
4/36 2,72 V? _20 7/9
• 5/7 20/5 8/3
5/8 24 8,7
sm 30 AL5 4/93 2/85 5/9 _24/5 9/4
6/0 22 9/6
6/4 22/5 40/0
50Bd 30 50 4/9? 2/93 6/2 23 40,9
45 5/5 4/7 6/3 23,5 40/9
60 24/5 60 6/9 29 44/9
55Bd 30 55 -1,61 3,02 6/5 29,5 44/8
6/6 25 42/3
60Bd 30 ^ö" 4/53 3/05 6/7 25,5 42/8
65Bd 30 65 4/55 3/09 7/0 26 43/3
70 Bd 30 70 4/56 3/42 7/2 26/5 43/8
7/3 27 49/9
75Bd 30 75 4/58 3/46 7/5 27/5 49/9
7/6 28 45/9
80 Bd 30 80 4/6 3/2 7/8 28/5 46/0
7/9 29 46/6
85Bd 30 85 4Z62 3/23 8/4 29/5 47/4
8/2 30 Eftl
90 Bd 30 90 4/69 3/27
8/6 34 48/9
95Bd 30 95 465 3/3 8/7 W5“ 49/5
8/9 32 20,2
TO 30 400 4/67 3/39 9/0 32/5 20/8
_9/? _33_ 24/9
9/3 33/5 22/4
9/9 39 22/7
9/6 39/5 23/9
9/8 35 29/4
40/0
40/4
<0/2
V 18 19 io 21 TT "5T "77 75" 26 7z" 28 3.9 30
Set fei 5. geballte Labungen für 9Rauermerf, 8eton, gel§ unb örbe.
G für ebolll bei' Ladungs- anbnngung e ! ianPi 0,50 m _OC Sprt 0,T5m bur lih-kg 1m [inWü V5m sn rfelfot 1,50 m be -mge 2m nd packt 2.50m tig Jpei' em Wv< an 4m
festen Stein, belastet d = 1 Oß50 3.1 6,24 ff 17,6 35,9 61. 95.2 138.1 190,6
d - 2 1.7 5,5 12,5 22 35,1 71.8 121,9 190,5 2762 381,2
d - 3.5 2.9 9.6 21,9 383 61.5 125,6 2133 333 483,3 667,1
d -4.5 3,7 12.4 26,1 49,2 79 161,5 2743 428,1 621,45 857,7
festen Stein d - 4 0,625 2,15 4,1 8.5 13,4 27,2 46,9 73,2 406,4 146,6
d - 2 1.25 4,3 9.6 17 26,8 54,4 93,8 146,4 212,7 293,2
d - 3.5 2,2 7,5 16,8 29,7 46,90 95; 1642 256,2 372,2 513
d - 4.5 2ß5 9,6 21,6 38,2 60,3 122,4 211,1 329,4 478,5 659,6
losen Stein d- 1 0,400 1,3 3 5.9 10,2 24 43,3 69,2 102,9
d = 2 _ 0/800 2.6 6 1*1,8 .20,5 48 86,6 138;4 2058 288
d= 3.5 1.4 4,5 10,5 20,7 35,5 84 151,6 242; 3602 504
d - 4,5 1.8 5,7 13,5 26,6 45,6 98 194,9 311,4 463» 648
d- 1 0,150 0,450 1 2 3,4 8 15,7 27 42,9 64
d • 2 0,250 0,850 2 4 68 16 31,3 54 858 128
ocnoner d- 3.5 0,4?0 1.5 3,5 6.9 11,9 28 54,7 94,5 150,1 224
d - 4.5 0,600 1,9 4.5 8,8 15,2 36 7p,4 121,5 193 288
Boden d - 1 0,1Q0 0,300 0.700 1.4 2.4 5,6 11 18,9 30,1 448
d» 2 0,200 0,600 1,4 2,8 4,8 11,2 22 37,8 602 89.6
d - 3.5 0,550 1,1 2,5 4.8 8,5 19,6 38,3 662 105,1 156ß
d- 4.5 0,400 J4. 10,7 26,2 43.3 85/W 2216
§
gqfel 6. Rcibenlabunßen föt Slaucnoert, Seton, geI8 unb Ctbe.
Reihenladungen benötigen
für bei anA.SprM.inkq [Spr Korp. od. BohrPatr gestreckt gepackt] auf 11fd.m Ladungslange bei W von
Ladungs- anbrihguig fön )/fOm 050m OjÖOm OJOm 0.80™ 0,90m 1,00m
festen Stein, d = 2 2 2,2 3.3 V 6.4 83 10.6 12.5
d = 2.25 2 2,4 3.8 7.4 9,4 12 14.2
d-3,5 2 2.2 28 3.6 58 8.2 11.2 14,6 185 213
belastet d = 4.5 2 2.8 3,6 4,8 103 14,5 183 23,8 28
d-2 2 2.5 ¥ 45. 6,4 8^ 9,7
fpcJ’pn d -2,25 2 2,8 4.2 5.6 7>5 9.3 103
Stein d = 3,5 2 2.3 2,8 6.4 8,7 11,3 14,3 16,9
d =4,5 2 2,2 2.9 3.8 5,7 8,2 11,1 14.5 18,4 21,7
d = 2 2 2.2 3 3,9 4,9 6
In^Pn d -225 2 2.5 3,4 4.4 5,5 6,6
1 1 Stein d = ^,5 2 2.7 3,8 5,2 6,8 8,7 10,6
d -4,5 2 23 3,5 5 6,8 8,8 11 13,5
täfel 7.
»Berte für d Sei ßcSaUten Sabnitgen.
»Berte für d Sei 9lciT)cnIabitttgen.
verdammt unverdammt 777TOF d425
T-' h/ 1 _ \ 1
• rl /
~r~ w L__ 1^=2 “ fefidämmt XäJU \ jmr
;<e ^45, -J\V /
T~J vz \ - \
V^// ^45
«**
tief etngelaffen
SBerbämmungSftärte
- W (— V« L).
büttbig eingelaffen
frei angelegt
SerbämmungSftärte
geringer als W;
toenn ißerbännnnngS*
ftärte größer als W
d-2,25.
frei angelegt
unberbärnmt
bünbig eingelaffen
ßerbärntnungS-
ftärte größer
alö W
SSerbämmungS*
ftärte geringer
alö W
frei angelegt
unVerbämmt
frei angelegt
»tfel 8.
fteftigteitS.gSerte (c-Tafe!)*)
Sfb. %lr.
c«233erte bei einem W
bon bon bon bon bon bon bon
23 auftoffe Kci bi§ 1 m 1,5 2 m 2,5 3 m 3,5
0,99 bis bis bis bis bis bis unb tt'tpf'lY'
m 1,49 1,99 2,49 2,99 3,49 3,99
m m m m m m
1 23 oben
2 (Sdjotter
3 Sofer
_____(Stein __
4 Qreft.«Stein
5 Hefter
Stein,
bclaftet
gebe lofe 23obenart ©crocil^ter (Sdjotter unb mit Söinbemitteln nid)t befestigte Auffüllung für feben 2Sirtunggl)albmeffer = für feben 2ßirfungSl)albmeffer = 0,7 1
Weniger fefteS Sftauertoert, brüchiger (yelS, gäfyer Setten 3 3 3 3 2,76 2,57 2,4 2,24
9Jtauermerf, 23cton, gelS 5 4,8 3,9£ 3,4 3 2,71 2,48 2,3
23rüdenpfeiler, erbummau- telte §ol)lbautcn, ftart ber- fpanntcS <35eftein (Gkioölbe, ringförmiges ^auerioerl) = fefter Stein mit 1,3 berbiel- fältigt 6,5 6,24 5,14 4,42 3,9 3,53 3,23 3
*) ®et WufftcUung ber Xafeln 6 unb 6 finb auch S^U^cnhjerte bon „c“ berücffidötiat toorben.
Sttfel 9.
aßerte für D2.
D Dä D Da D Da
11 121 25 625 39 1521
12 144 26 676 40 1600
13 169 27 729 41 1681
14 196 28 784 42 1764
15 225 29 841 43 1849
16 256 30 900 44 1936
17 289 31 961 45 2025
18 324 32 1024 46 2116
19 361 33 1089 47 2209
20 400 34 1156 48 2304
21 441 35 1225 49 2401
22 484 36 1296 50 2500
23 529 37 1369 51 2601
24 576 38 1444 52 2704
D D2 D D3
53 2809 67 4489
54 2916 68 4624
55 3025 69 4761
56 3136 70 4900
57 3249 71 5041
58 3364 72 5184
59 3481 73 5329
60 3600 74 5476
61 3721 75 5625
62 3844 76 5776
63 3969 77 5929
64 4096 78 6084
65 4225 79 6241
66 4356 .80 6400
g« f e l 16,
«Sette füi W« unb W»
w W2 w8 w W2 wa w W’ w8
0,20 0,04 0,01 1,45 2,10 8,05 2,70 7,29 19,68
0,25 0,06 0,02 1,50 2,25 8,38 2,75 7,56 20,80
0,30 0,09 0,03 1,55 2,40 8,72 2,80 7,84 21,95
0,35 0,12 0,04 1,60 2,56 4,10 2,85 8,12 23,15
0,40 0,16 0,06 1,65 2,72 4,49 2,90 8,41 24,39
0,45 0,20 0,09 1,70 2,89 4,91 2,95 8,70 25,67
0,50 0,25 0,13 1,75 3,06 5,36 3,00 9,00 27,00
0,55 0,30 0,17 1,80 3,24 5,83 3,25 10,56 34,32
0,60 0,36 0,22 1,85 3,42 6,33 3,50 12,25 42,88
0,65 0,42 0,28 1,90 3,61 6,86 3,75 14,06 52,73
0,70 0,49 0,34 1,95 3,80 7,42 4,00 16,00 64,00
0,75 0,56 0,42 2,00 4,00 8,00 4,50 20,25 91,13
0,80 0,64 0,51 2,05 4,20 8,62 5,00 25,00 125,00
0,85 0,72 0,61 2,10 4,41 9,26 5,50 30,25 166,38
0,90 0,81 0,73 2,15 4,62 9,94 6,00 36,00 216,00
0,95 0,90 0,86 2,20 4,84 10,65 7,00 49,00 343,00
1,00 1,00 1,00 2,25 5,06 11,39 8,00 64,00 512,00
1,05 1,10 1,16 2,30 5,29 12,17 9,00 81,00 729,00
1,10 1,21 1,33 2,35 5,52 12,98 10,00 100,00 1000,00
1,15 1,32 1,52 2,40 5,76 13,82 11,00 121,00 1 331,00
1,20 1,44 1,73 2,45 6,00 14,71 12,00 144,00 1 728,00
1,25 1,56 1,95 2,50 6,25 15,63 13,00 169,00 2197,00
1,30 1,69 2,20 2,55 6,50 16,58 14,00 196,00 2 744,00
1,35 1,82 2,46 2,60 6,76 17,58 15,00 225,00 3 375,00
1,40 1,96 2.74 2,65 7,02 18,61
408
Safe! 1L
Sherren mit Angaben über Kräfte*, Qföertjettg»,
I Cfb. 3lr. [ 2Irt ber Sperre £ £ £ Kräfte Seit in Stunben oßne Slnbeförbem ber SSanftoffe Sßertgeug unb ®eröt
1 Drafetfdringen (100 Stücf) 58 1 (toppe 1 3 Sdilcgcl; 3 Seile; 2 $anb» ober Spannfägen; 2 Kneifzangen; 3 Draht* gang en; 3 jammer.
2 Stolpcrbralit (1000 m2) 59 1 Schü feem trupp 8 2 $anbfägen; 2 Schlegel; 2 Seile; 2 Drahtgangen; 1 Kneifgange; 2 Srage* ftangen; 6 ^aar Sdjufehanbfdjuhe.
3 Drafitgaim (Slanbcrngaun) 2000 Ifb. m 60 u. 60a 1 8ufl 8 8 Schlegel; 4 Drahtfd)crcn; 10 SBeile; 5 Kneifzangen; 2 Drahtzangen; 6 Srage* ftangen; 6 Drahtgugftangen; 6 Kifien, Schemel ober Raffer; 12 ^aar Schüfe» tjanbfd)Libe. (3 fRammflöge ober £>anb» rammen erfefeen bei ben 9ßfahltrupp$ 6 Sdjlegel.)
4 ?5Iä(f)cnbraf)t'- hinbcrniö (1000 in2) 61 1 8uö 6—7 5Bie bei 3.
6 SlRafchcnbrahb gaun (3000 m) im SSalbe ober hinter Werten 6? 1 8ug 3—4 6 Spaten; 3 Kreughaden; 10 SBeile; 3 Drahtfd) er en; 3Kneifgangen; 3 Draht* gangen; 6 Schlegel; 6 Kiften, Schemel ober ßäffer.
~6 Drahtmalgen (3 Stütf) 63 1 Schüfeeiv trupp 1 3 Drahtfdjeren; 3 $aar Sdjiifepanb- fdjuhe.
T Spanifdie Leiter (2 Stüd) 62" 1 Scfmfeem trupp 1 1 Säge; 2 Drabtfdjeren; 1 jammer; 4 9ßaar Schufehanbfcbube.
409
Bauftoff» unb gSrbemtttelbeburf (nur Wljalt).
93 a u ft o f f e $ür Slnbcför bern her Sau ftoffe Semertungen
Siri ©etoidjt in t rb. gmcb i fpännige, Saf)6 geuge 0,75 Itl 3-t- ' ßlm.
50 ^fäble, 0,50 m lang, 8 cm 0, ober 100 Stägel, 30 cm lang; 150 m Sinbebrabt, 2 mm; 100 ©rabttrampen. 0,1 — — 1 Stoße Stadjel« brabt, 200 m = 25 kg. 1 Stoße glatter $>rabt, 3— 5 mm, 300 m = 50 kg. 1 Stoße Sinbe* brabt, 2 mm, 2000 m = 50 kg. 1 Stoße leidster ßRafd)enbrapt, 1 m bod), 50 m = 50 kg. 1 Stoße [djroerer Sftafdjcnbrabt, 2 m bodj, 25 m = 50 kg. lOOSrabtfram« pen, 4 mm — 1 kg. 200<Drabtfram« pen, 3 mm = 1kg. 1 K-Stoße, 3 mm ftart, 1 m0, 15 m lang — rb. 16 kg. 1 S^Sioße = rb. 22 kg. 1 t Stachel« brabt = 40 Stol« len = 8000 m. 1 t glatter Srabt, 3 —5 mm = 20 Stoßen = 6000 m. 11 Sinbebrabt, 2 mm = 20 Stol- len = 40 000 m.
200—300 Sfäble, 0,60 m lang, 8 cm 0; 2000 m Sinbebrabt, 2 mm (1 Stoße), ober Stacbelbrabt (10 Stoßen); 400—600 SDrabtframpcn. 0,6—0,8 1 7.
700 lange pfähle, 2,00 m lang, 10—15 cm 0; 1400 tux^e Sßfäble, 1,00 m lang, 8—10 cm 0; 50—55 Stoßen glatter ®rabt, 3—5 mm; 60—66 Stollen Stadjclbrabt; 400—600 m 93inbebrabt; 6000 S>rabt» trampen. 22 (4,2 ohne ^fäblc) 22—30 (5) 8 (2)
150 ^fäble, 2,00 m lang, 10—15 cm0; 130 pfähle, 1,75 m lang, 10—15 cm 0; 40 pfähle, 1,00 m lang, 8—10 cm 0; 18000 m Stadjelbrabt (90 Stollen); 5700 m glatter krallt, 3—5 mm (19 Stoßen); 4000 m Sinbebrabt, 2mm (2Stoßen); 3000S)rabt« trampen. 7,8 (2,9 ohne Wble) 8—10 (5) 3 (172)
sßfäljle gum Serfpannen be£ Sftafcfyen« brabte# an Reefen; 120 Stoßen 99tafeben« brabt, 2,00 m bod); 300 - 500 m glatter S)rabt, 3—5 mm (1—2 Stoßen); 2000 m Sinbebrabt, 2 mm (1 Stoße); 2000—3000 S)rabtframpen; Slnterpfäble. 6,2 ohne ^fäple 7—9 2^2
36m Stablbrabt, 5 mm; 24 m glatter 2>rabt, 3—5 mm; 45 m Stacbelbrabt; 75 m Sinbebrabt, 2 mm. — — —
2 (Stangen, 2,50 m lang. 10 cm 0; 8 Stangen, 1,50 m lang, 10 cm 0; 100 big 200 m Stadjclbrabt (72—1 Stoße); 20 m Sinbebrabt, 2 mm; 40 SJrapt* trampen. 0,1
410
£ g f 11 11, (gortfefcuitg).
©fetten mit Singalien Siet £tftfte=, Seit:, Sßerfieug«,
i ßft>. ftt. । Slrt ber Sberre £ fträfte Seit in Stunben ohne $Inbeförbem ber Sauftoffe SBerlgeug unb ©erät
8 K= ober Spotten (6—9 hinter* einanberberlegt) 48 bi§ 48c 1 (Gruppe 5 2Kin. 3 Seile ober 3 jammer gum £in» fdjlagen ber £aten.
9 ©rahtfeilfperre — 1 Schüßen* trupp 5 3Rin. 1 Seil.
10 Sdjtoere Saum* fperre, 50—100 m tief (etiua 80-150 Säume) 50 1 8ufl 6—8 5 Sdjrotfägen; 5—lOÄeile; 10 fee; 4 Seile; 4 jammer; 5 (Stabelftangen gum ©rüden ber Saume; 2 ©raljt* fdjeren; 2 ©raljtgangen; Jtletter* fporen; ßeinen.
11 Saumberhau, 100 Ifb. m, 5 m tief 65 1 8«9 5-6 2Bie bei 10.
12 ^fahlfperre (100 Ifb. m gu 4 Steifen) gegen geb am gerte Äampf* faljrgeuge 47 1 Slomp. 8 16 $anbrammen; „32 Schlegel; 6 Sdjrotfägen; 16 fee; 10 Seile; 8 breiig harten; 8 Spaten. Sertoenben bon (Erbboljrern be* fdjleunigt ben Sau.
13 Sarritaben in Drtfdjaften 52 unb 52a 1 (Gruppe bis 1 3ug biS 3 2Sdjlegel;lSäge; ISeil; lO&reug* baden; 2 Spaten; 20 Sdjaufeln; 1 ©rapt* fdjere; 2 ©raljtgangen; 2 jammer.
14 ^angertoagen* graben (100 m, 3,0—6,5 m breit, 1,8-2,5 m tief) 49 1—2 Slomp. 8 unb barüber Spaten; breiig harten; Sdjlegel; Äneifgangen; Sägen; Seile.
15 ©reied*S allen* fperre (für eine 5 m breite Strafee) 54 1 ®rubbe 2 2 fH'eughaden; 2 Spaten; 4 Sdjlegel ober 2 £>anbrammen; 1 Sdjrotfäge; 1 £anbfäge; 1 Seil; 1 ©raptgange; 1 SRefcftab gu 2 m. • 1 Sredjftange, 1 Sorfdjlagbammer bei harter ©trafeenbede.
411
CauftofJ» itnb gBrbermittelbebatf (nur Wfjalt).
Sauftoffe {5ür SInbeför* bem ber Sau* ftoffe Semertungen
21 r i ®etüi(f)t in t rb. fttoei* fpännige gatjr* 3 enge 0,75—11 3-t- ßlto.
— — — — SBie Seite 409.
1 ©raptfeil, ßänge minbeftenS hoppelte Straßenbreite, 80 mm 0; 6 klammern. — — —
1—3 Stollen Stadjelbraljt; 1—2 Stollen glatter ©rabt 3—5 mm; 30—60 m 23anb* elfen; 150—300 Stägel; 600 krampen; 80—150 lange Stägel, klammern ober (Eifenborne. — — —
5—10 Stollen Stacbelbraljt; je 1—2 Stollen glatter unb Sinbebraljt. — — —
275—325 «ßfäljle, 2,65 m lang, 25 bis 80 cm 0. 27,5 bi§ 30,5 28—35 10—11
ßfabtäeuge; lanbfoirtfdjaftlidje (Geräte; gc&ränfe; Sxuljen; Giften; Steine, Sdjiitt, (Erbe, $ie§. — — —
Sauftoffe jum Sefeftigen ber Sö* ftfjungen. — — —
9 Salten, 5,00 m lang, 30/30 cm ober B0 cm 0; 14 Sfäljle, 2,50 m lang, 15 cm 0; 40 klammern; 35 m glatter ©rabt, 3—5 mm; 7 lange StägeL 3,1 4—5 11/2
412
g g f e X 11. (Sortierung).
Sperren mit Angaben Aber ffräfte«, Seit«, Sßertjeug«,
ll üfi al» 1 SIrt bet «Sperre 5 ö Prüfte gett tn Stunben ( ohne ainbeförbem! ber Sauftoffe | äBetljeug unb ®erftt
16 Siered=Sa!ten» fperre (für eine 6 m breite «Strafte) 55 1 (Gruppe 8—1 3 Jhreu^baden; 8 Spaten; 1 SeÖ; 1 Sdbrotfdge; 1 ßanbfäge; 1 ®ra&* gange: 4 Schlegel ober 2 ^anbrammen; 1 äReBftab ju 2 m. 1 Sredjftange, 1 Sorftölaghammet bei harter Straftenbede.
17 SaTtenfperre au* Vtiinbholi (für eine 5 m breite Strafte) 56 1 »tappt 8 2 ßreu^baden; 2 Spaten: 2 Störst» fügen; 1 $anbramme; 2 Seile; 1 Sftefc» ftab ju 2 m, 1 Sretöftange, 1 Sorfchlaghanunex bei harter Straftenbede.
18 53 alten fperre aus $antbol3 (für eine 5 m breite Strafte) 57 1 »rappe 8 2 Äreujhaden; 2 Spaten; 1 Seit; 1 Stötotfäge; 1 ©rabtgange; 4 StölegeJ ober 2 ^anbrammen; 1 SReftfiab 2 m. 1 Sretöftange, 1 Sorfchlaghammex bei harter Straftenbede.
19 Stauanlage burtö gufeften einer Srüden» Öffnung (5 m tflnftbreite, 2 m ßlufttiefe) 67 1 ftomp. bi3 8
±13
Banfioff» unb gbtbexmittelbebarf (nut 9lnbalt).
Bauftoffe ftür Slnbcför» bem bir Bau« Hoffe Bemertungen
« r t ®etotcbt in t rb. ghiei« i fbäimigel gabt« i ^iige 0,75—11! 8-t- ßtm.
5 Balten, 6 m lang, 30/30 cm ober 80 cm 0; 5 Balten, 2 m lang, 30/30 cm ©bet 80 cm 0; 22 pfähle, 1,50—2,00 m lang, 15—20 cm 0; 40 klammern; 80 m glatter S)ra§t, 3—5 mm; 11 lange Bügel. 8,2 4—5 I1/« Bie Sette 409.
{Jür SRitteltetl: 5 Ifb. m Bunb^olj, 25 cm 0, al§ $olm; 1 <5tu£e, 1,30 m lang, 25 cm 0; 1 Stüfce, 1,50 m lang, 25 cm 0; 1 Gtüfee, 2,00 m lang, 25 cm 0. gür Seitenteile: 10 Ifb. m Bunb* bolj, 20 cm 0, al£ £olme; 2 Stüfcen, 130 m lang, 20 cm 0; 2 Stufcen, 1,80 m lang, 20 cm 0. 8 (Streben, 1,00 m lang, 15—20 cm 0; 8 Streben, 1,50 m lang, 15—20 cm 0 14 ßafdien; 12 Bügel, 15—20 cm lang, gum Befcftigen ber Bestrebungen; 60 Bügel, 10 cm lang, sum Befcftigen ber ßafdjen. 1/8 2 1 I
8 Balten, 6 m lang, 20/20 cm ober 25 cm 0; 12 Bfüble. 2,00 m lang, 15 bi£ 20 cm 0; 26 m glatter S)rabt, 3—5 mm; 18 ftlammem; 8 lange BügeL 1,7 2 1
Wonierbienft
28
414 jAk *
täfel 11a.
X X X X
onrTYTTYimr>
OQ. ®
8eid)eit für Sterten.
iStbeinfrerren ermatten neben bem geilen ein 8.)
^ra^t^aun (glanbemjaun)
glätfjenbratjtljinbermS
SKaf^cnbrabtWbemiS
Stolperbraljt
K* u* Stoßen
3ur gerjlörung borber
jerpört
SJHnenrei^e
SJHnenfelb
©treuminen
Startjtamfpette
jriöaumfpexren
. / ^“Söaumü au
Sarrifabe auS SSagen, ©feinen, haften,
©rbtüäHen unb Sßirtfdjaftggeräten
©rabtfeilfperre
aljljperre
ansettoagengraben
©tauanlage
Sufefcen eines ®urd)IafieS obet einet
Sörücfenöffnung für ©taujmede
Slnftauung (blaue garbe)
4^
abgeljoläter Balb, niebergelegteS ®e^öft
öon Statut pan$erft>agenfid)ere£ (Sefönbe
burdj ^antpfifoffe bergifteteS (Sefönbe
(©tridjehmg gelb)
415
rafel 12»
100 cm
CtfirteK felbmSgiget Rettungen.
1. Segen Setoebrfeuer (sS-Sefcbofc) für enifemungen bon 400 m
unb herunter:
Srbe....................................................)
ßebm....................................................>
€>anb ..................................................J
€anb in Sanbfäden........................................
9tafen...................................................
Xorf.....................................................
6($otter.................................................
RieS, grober.............................................
ftteS, feiner............................................
Sorben...................................................
eidbenbolj (5tunb$ol8)...................................
etdjenbolj (/Hoben)......................................
ftiefemfiola.............................................
eifenbapnfgtoellen (Äiefet)..............................
Siegelmauet (gegen WtS.*$unftfeuer fein <&<bufc).........
{40 kg/mm1 {Jeftigteit.........................
80 , „ .......................
180 , , .......................
Segen anbaltenben Sefcfcufj berftärft man dauern bnrcb
binietgebacfte, feftgeftambfte erbe ober $olj.
Xore, Xüren bebürfen einer Berftürtung.
KO „
120 ,
250 ,
20 „
20 „
40 ,
600 „
70 „
HO „
130 „
75 „
88 „
15 nun
12,5 „
5 w
bot- ober
8. Segen Wtaf$inengeme$rfeuer:
SBie Setoebrfeuet. Segen {Jener auf nädäfte Intfemungen müffen
iebocb bie ®e(fung§ftär!en bergröfeert werben.
8. Segen Rrtillertefeuer :
iS fgüfeen:
gegen Sbrengftüde bon {Jelbtanonengtanaten: SJecfimgSftäöe
in m
erbe..............................v...................... 0,40-1,0
45olj ................................................... 045
giegelmauem.............................................. 0,25
gegen Sprengfiütfe bon L unb fcftro. {Jelbbaubifcgranaten:
erbe..................................................... 1,00
fcolg.................................................... 0,20
gegen ftarte Sbt^tgftüde:
erbfebüttungen auf ^olgbecle bon 20 cm ... ............. 0,30—0,50
28<
416
®edfung5ftärte
in m
ftegehnauem............................................. 0,25
5dj oiterfcfjitfjt prüfet) en gut befefttgten Vollen-, ®ifen-
ober SEBeUblecbnjänben................................. 0,25
gegen einzelne Volltreffer
») bon Felbtanonen:
®rbe................................................
Sicgelmauem.......................................
Sdjnee......................................ettoa
2,00 '
LOO
8,00
b) bon I. Felbljaubifcon, Fladjbabnfdbufi:
(Frbe............................................... 3,00
gicgclmanern........................................ 2,00
Vetonmaueni......................................... 1,00
bon I. Felbljaubifcen, Sogenfdjuß:
6rbe auf £)olj, äßeHbledb ober ©ifenbabnfcMenen (bidöt
nebencinanber) mehr al«......................... 2,50
gicgelmauem......................................... 0,90
SBetonmauem......................................... 0,70
c) bon Steilfeuer, 15 cm M3 21 cm Kaliber... 8—3 m Srbbetfe
Qe nach Vobenart)
d) bon Steilfeuer über 21 cm Kaliber unb
einzelnen Fliegerbomben über 10 kg... 12—18 m Srbbede,
10 cm Sifenbeton — 1 m ©tbborlage (21 nhalt).
täfel 13.
bei Mifötjcbett bon ©oben.
58 oben 1 SJtann in 1 Stunbe 1 9ftann bei mebrftünbiger Skbeit^eit
leidjt mittel feft 1,00 cbm 0,75 cbm 0,40 cbm 0,70 cbm . 0,45 cbm 0,20 cbm ®tUnbe
417
Safel 14.
Gröge unb Sragtraft bon gäffern, ftaniftern nnb
gafttraftioagenjdjlöndjcn.
Tagart ’S CT 1 Turdjmeffer Sänge m (Sigen* ge* mid)t kg Tragfraft bei ungefähr 20 cm greiborb etma kg
grob* ter m nein* fier m
Bein* 600 1,00 0,85 1,15 120 500
unb 400 0,90 0,75 1,09 112 330
320 0,86 0,70 0,98 100 240
Kietfäffer 300 0,82 0,67 0,90 95 225
220 0,70 0,63 0,84 80 165
200 0,71 0,60 0,84 70 150
150 0,69 0,58 0,79 66 110
100 0,60 0,52 0,69 57 75
fcraftfloffc 600 0,92 1,18 110 410
fäffer 500 0,85 1,12 90 340
/ry;*r x 400 0,78 1,15 80 260
(ictfen) 300 0,70 1,00 67 180
200 0,64 0,86 55 105
Tie Trogtroft bon Qkennftofffaniftern u. ä. bis jum
billigen ©intaudjen ift = 3nl)alt— ©igengemidjt.
3-SL: ©in biertontiger tfanifler au3 SBeifjbled) bon 501
5nbalt unb einem Sigengehndjt bon 7 kg trägt 43 kg.
3e 2 Saftfrafttoagenfdjläudje tragen etma 100kg.
Beladung burd) ben überbau ift in ber Xafel
»t^t berüdf id)tigt (153).
Tafel 1>.
XmtttCrtäaf)! füt Stege, 24» mtb 4«t*$öe^eIfSBrüden.
gafjart Saft* inljalt 1 Srag* traft kg fdjtD ein 2 imnu ter S: 3 rSäff mbe ( tüfetvi 4 er für Stüfr ’ite U 5 eine » bei >on 6m fcemertungen
I.e^ncUftege nab Siege ©olsfäffet (Eifenfäffex (100 200 <300 400 (600 (200 300 <400 500 (600 75 150 225 330 500 105 180 260 340 410 6 3 2 4 3 2 7 4 3 2 5 3 3 2 8 4 3 2 6 4 3 2 10 6 4 3 2 8 5 4 3 2 7 5 3 2 10 6 4 3 3
®iein ber 2 aebenentJc iAtt für 1 Tabelle ange« ifjjatjlen gel«
II. 24»«tMe ©oljfäffer (EifenfAfier (300 <400 (600 (400 {500 (600 225 330 500 260- 340 410 10 7 5 9 7 6 8 6 8 7 9 6 9 8 7 9 8 10 ftebenbet Sti^e. S3ei Sragbalten au3 fftunbijolg grün finb bie t£afföal)len um 1 &u er* höben.
III.4»t<$riidc »oliföffex ©fenfAffer 600 600 500 410 9 10 11 13 — — —
©elaftung burdb ben ftbetbau ift in bet Xafel betüdfi#tigt.
>K
00
I«f e 11«.
e<^»eUftegc nnb gtege.
Übergang: <S<büfcenrettje mit minbeftenj 6 Uftanb
o$ne Xritt, audj mit freigemacbtem f. Wt. (*.
— SRinbeftquerfdjnittbon gefun*
Bauteile Bauliche b em, uni ®ti ief$toäd)tem $04 ibmeite in m e rtung cn
CQ 8 4 5 6 7 8
I.Stüfeen a) sßfäblf.Sttelen.lBodbeine
1 {freie ©tüfeböbe M3 8 m ftunbtyilL mtttL 0 in cm 8 8 9 10 10 11
2 , • , 4 , 9 9 10 10 11 12
8 „ , . 5 * 10 10 12 12 12 18
4 n n ir » 12 12 18 18 14 14
b) £olme u. gdjtoellen
5 (bis 1,25 m freitragenb) ftunbgolg, mtttl. 0 in cm 8 9 10 11 12 18
6 II. Überbau a) Xraqbalfen 3hmb$ol3, mtttl. 0 in cm 10 12 12 14 16 16 2Rinbeftquerfcbnitt bei Stunobola befdjfagen:
7 Kantbola El a a in cm 10 10 12 12 14 14
8 , j£3h b/hinem ’/io 8/10 W/ii 10/ia 10/ia «'M
b -40r~
9 b) ßüngSbelaq 3 cm ftrt, mtnb. JK- cm br. Querträger Lönqsveta* -*•1 thrgbafäf?» L-
10 c) Querträger ?\r ßängSbelag 7. p TI? W<C7
J - — TT^c' i»"— x. Kn<jgg&
11 III. Xranfraft bon n * 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 ©te Slnforberung an bfe
ftdbnen Xragfraft ber Käbne ift bet SBertoenben bon Xragballen au£ grünem ßolj um Vs ju erbosen.
Slnmerfiing: ©ie ^olaquerfdjnttte gelten für lufttrocf eneS $0(3. ©er ©urdjmeffer für ftunbbola grün
ifi 1,2 mal ©urdömeffer lufttroden au nehmen. 0 — ©urcfcmeffer.
co
Safe! 17.
2«t=$c!jdf*tn,ürfctt ttnb sfä^ren.
Übergang: giifttruppenmSDiarfdiorbmmgmitie 2@d)ritl®Iicberabftanb,
oljne Stritt: Weiter, abgcfeffcn, 311 einem; giueiadjfige {yabrgcuge bi3
2 t, einadjfige ßab^enge bis? etma 1,4 t ®cfanitgeix)id)t ßeicEjte
SlrtiHetie, $rofce unb &efd)üij getrennt ga^rgciiqabftanb 20 m, inenn
gmeiadjfige {Jaljrgeuge über 1,5 t unb einadrige galjr3cuge über
1,0 t ioiegen.
Nützbare drück enbreife 4 oder ff Jhagbatken
Zulässige Honen u Breiten für r O
Pfahljoch Schwelljoch. ßocH,
'g.ö’o/ir*'
'2 60%
-- - ~ Wnbeftquerüfinitt bon gefunbem, - - — • - —
& e Bauteile SS 4 u ft c f f e ungefcbmäcljtcm Stüßmeite in m Stirerfunatn
c? 3 4 i 1 5 1 6 f 7 l 8 ! 1 9 1 10
I. ® t ü ö e n A. ©infadj
l.^ocbbfübleu. Stiele
1 greie @tü£böbeb.3m Wunb!}ol|, mfttL 0 tn cm 12 12 12 12 14 14 14 14
2 if if » 4 ff 12 12 12 13 14 14 15 16
8 13 14 14 14 15 15 16 17
4 15 15 16 16 16 17 18 18
5 Sodbeine bi§ 3 m Sti ifcMbt 14 _14 14 14 16 16 16 JLL
6 2. So#* u. SBodljoIme unb Sdjtoeüen Wunbljolä bef mitt!. 0 in cm 20 20 22 24 25 26 28 29 Ski&öcfenmtt Xrag-
7 Äantpolj ® a » in cm .... 16 16 18 18 20 20 22 22 beinen mittt Cuer* fd)ititt ber söoef* unb Xragbeine mie bei hop-
8 ÄantljoU Bh b/h in cm ... W/18 W/18 16/20 1Ö/20 18/20 18/22 18/24 20/2-,
VM b pelten SBodbeinen.
B. doppelt Sftinbeftquerfdjnitt
1.3odjbfä$le, Stiele, bei ftunblolj befra-
SBodbeine gen:
9 ftrete Stüfcpöbe b 3 m ÄunbCoU, mtttl. 0 in cm ..... 10 10 10 10 12 12 12 12
10 r , < 4 „ 10 10 10 11 12 12 13 14 f
11 , 9 11 12 12 12 13 13 14 15
18 18 18 14 14 14 15 16 16
18 14 Iß 2.3odj- uJBodfbolme unb ©tfjtoellen ftunbQoIs bef$l.. tnittl. 0 m em jcantljola^a a in cm , ^jh b/h in cm ... b 17 14 «/ie 17 14 “/l« 19 16 M/18 21 16 “/M 21 16 »<48 22 18 16/20 24 18 ”/20 24 18 W/20 TTTuTcl./
16 17 18 19 20 21 22 II. Überbau A. Eragb alten 1. 4 ©tücf 3hmb$oty, utiftt. 0 in cm .... 9tunbt)olabefd)l.,TnitH.0 in cm flantljola 0 a aincm r ||h b/h in cm.... b 18 20 16 14/16 12 12 124 20 22 16 14/18 14 14 124 22 24 18 14/20 14 16 124 23 25 20 16/22 16 16 134 25 27 22 «/» 16 18 142 26 28 22 18/24 18 20 27 80 24 »/24 20 22 28 81 24 22 24
C^taßl (h in cm) tetfenbabnfcbtenen (h in m m) . Stunbbola, utittl. 0 in cm .... Stunboolj befdjl., rnittl. 0in cm ftantbola 0 a aincm , ||h b/h in cm ... b fh in cml
28 24 14 18/20 14 16 134 24 26 16 18/22 16 18 142 25 27 18 18/22 18 20 26 28 20 18/24 20
23 24 25 26 27 28 29 2. 6 ©tü(J 17 18 10 «/Iß 10 10 18 20 12 U/16 12 12 20 22 12 14/ia 12 14 21 23 14 14/20 14 14 j24
C^tabl (h in cm) (£ifenbat)rtfd)ienen (h in mm)
80 81 B. Selag 1. bei 4 Xragbalten 2. „ 6 4,5 cm ober 2x3 cm ftarf, minb. 20 cm breit 4 cm ober 2x2,5 cm ftarf, nttnb. 20 cm breit
£ne Mntorb erring an bie Xragtraft bet Mine ift bei ißcriueiv ben bon Xragbalfcii anö grünem .§0(3 uni £* 1/5 311 er-böljen. >1)013 grün ift = 1,2 mal gälivcit f. 155.
82 Mn 111. Xragtraft bon O ö n e n mertung: ®ie<£)0li ©urdjm f rt t 2,8 dem 8,9 e££t )urd) 5 mejfc 6 >er£ sr. — 7 nrdjr £ra 8 neffe: gtrafi 9 c für t bon 10 Sinnt ; 2*t*i
jqucrfdjnitte gelten für lufttro leffer lufttroden au nehmen. 0
X Ä f C I 18. Brüchenbreüe 3mt 5o&r71togbQ&vH»
... - Zulässige Höhen u Breiten fui*:
4=t=$8cljeir§brfttfett itnb PJahljoch Schwelljoch. Bock
Übergang: ftufetruppen in Biarfcborbnung oljne SSrttt; Beiter abgefeffen
gu gmeten; gtoei- unb breiadjfige gabr^euge big 4 t, einadrige &agr-
aeuge bis 2,71 ^efamtaeioidbt. öabraeugabftanb 20 m, foenn gioei- unb
bretadjfige gabrjeuge über 3 t unb einadrige gabrgeuge über 21 wiegen.
Bltnbeftquerfdjnttt bon gefunbem,
Bauteile B auftof f e ungefdjnjädMem $o!j Stüfetoeite in m
8 4 5 6 7 8 9 10
I. Stüfcen A. ©infadj
1 1. Sod&pfäbleu.Sttele {Jreie @ tüfc bÖ$e b. 8 m Runbbolt mtttl. 0 in em 14 14 14 14 15 15 16 16
2 14 14 15 15 16 16 18 18
8 ' Z X 15 15 16 16 17 18 19 19
4 „ * » 6 n 5tüfebö$e 16 16 17 17 18 19 20 20
5 Bodbeine big 8 m ( 17 17 17 17 18 18 19 19
6 2. $odjbolme BunbboU befd&LmittL 0incm 16 18 19 20 21 22 23 24
7 unb SdjtoeHen ßantbolg Q a a in cm 16 16 16 16 16 18 18 20
8 (big 2 m freitragenb) 9 ||h b/htncm.... “/u u/u x/ie w/u w/u m/is IS/ig “/20
9 8. $od&- unb Bod- bolme unb Schwellen Bunbbolj befd&L,mittL0tncm 26 29 81 88 85 87 88 40
10 Äanibolg Q a a in cm 22 24 26 26 28 28 80 80
11 (big 4 m freitragenb) » « b/htncm .... »/M m/m */28 */m «/» “A» »/so
12 0 I-Sta$I (h in cm) 18 20 20 22 24 24 26 26
13^ TP-Sta$l (hincm) ... 14 14 14 16 16 18 18 20
B. Soweit
1. 3o$IWe, Stiele, Bodbeine
14 $reteStüfcböbeb.8m Runb^oll. mtttl. 0 in cm 12 12 12 12 18 18 14 14
15 12 12 18 18 14 14 16 16
16 2 • X 18 18 14 14 15 16 17 17
17 , . 'S, 14 14 15 15 16 17 18 18
Bewertungen
Bei Böden mit £rag-
beinen mittl. Duer-
fdjnitt ber Bod- unb
Xragbeine tote betbop-
Veiten Bodb einen.
2Rinbeftguerfdjnitt bet
Bunbbolg befragen:
GH E rfk.rfk.rfk COtOt- O CD SSSgSISgSSS 88J38 SES^| 8 SS
III. Xragtraft bon Zähnen B. Selag 1. bei 5 Xragbalten 2. bei 7 Sragbalten CO II. Überbau A. Sragballen 1. 5 Stücf « 5.®c Ih &3s fO b|» ff3" &3
6,5 cm ober 2x4 cm; minbeft 5,5 „ „ 2x3,5 cm: minbe JL^iagi <n in cmj E'Stahl (h in cm) ©tfeiibahnfehienen (b in mm) I-Staljl (h in cm) IP-Stahl (h in cm) ........ Wunbbolg, mittl. 0 in cm .... fftunbholg befehl.,mittl. 0 in cm Äantholg E3a ainem r b/h in cm.... b u I Stahl (h in cm) IP-Stahl (h in cm) UDStahl (h in cm) E Stahl (h in cm) ®ifenbahnfdienen (hin mm) Wunbbola, mittl. 0 in cm ... fftunbholg befehl.,mittl. 0 tnem AantholB ainem , ||h b/h in cm.... b bStahl (h in cm) !P‘Stahl (h in cm) Wunbholg befehl., mittl. 0 in cm ftanthol} a a in cm 9 h b/h in cm .... Wnnbholg befehl., mittl. 0 in cm Aantholg Qa ainem tf h b/h in cm....
GH O 3 75 «ö Soo S rooco 14 14 10 14 124 nln 81 SS OS £9 28 20 >8/22 w/n TI TI
03 go o B rf^C > ** s“ Scoo 16 14 12 16 124 22 24 18 16/20 £ao W/sT OS 9S 16 14 M/i<
Qt CT« 14 10 16 124 f HNN 03 CO»—* 16 14 12 18 188 28 26 20 16/22 £od 17 14 M/l*
00 bi 2.** ^CD S O» toroco OG71CO 18 14 14 18 188 f ess ES 18 14 l‘/M
o 18 14 14 18 188 s ß" 20 16 16 20 148 Eo 81 24 »/26 18 u p/u
bi 18 14 14 148 s s? 888 803038 29 32 24 M/38 cs bB 82 26 “/28 20 16 1*/16
00 >-*»-‘tO 03 C3O 8 s? 8qdSE8 31 84 26 “/28 03 ES ^88 20 16 M/ie
ot »—*»—* tO 00 03 CO 8 ’ 8 888 88SE 83 86 28 26/28 SES 85 26 22/28 21 18 M/18
©ie SInforberung an bie Srag Ira ft b er £äl)ne ift bei SBcrmeiiben bon Sragballen au§ grünem $olg um Vß 3« erhöhen. £ I ± I I Slnmerlung: ©ie^olgquerfdjnitte gelten für luftti $01$. ©er©urcljmefferfür Wunbbolg grün ift «1,2 meffer lufttroefen gu nehmen. 0 — ©urdfcmeffer. Xragtraft bon 4*t-tfuljren: biö 2 (Srubpen ober „ 6 leiste Sßferbe mit Weitem „ „ 4 fdjtoere Sferbc „ „ „ 1 ®ef(f)üfc mit Sebienung . 1 ^afjrgeug bi$ 4 t ®efamtgeh>i$t , „ 6 Gräber „ 1—2 Siro., ie nach ©ehrtet bet {Jfahrgeuge t codeneJ x ©urefc- Sc naeb ®räfce ' ber ßabe- fläche.
851
g g y e I 1».
8d*$djdf*btiläett ttitb »fahren.
Übergang: {^ii^tnibpen unb Sfletter (abgefeffen) mie über 4-t-93rücte.
3mei- unb breiatfjfige {frörjenge btö 8 t, einacbfige ßa^euge bis
5,5 t ®efanitgetouf)t. {^a^eugabftanb 20 m, tocnn aluei- unb brei-
acbfige ßabraeuge über 5,51 unb einadrige {frbxäeiige über 4 t Kriegen.
fajtzbore Brü&tenbreile 3m; 6ocferBfrogbatk^
( Zulässige Höhen t> Breiten für t
P/ohljoch Schwelljoch
8 « uteHe 8 auftoffe SRinbeftquerlcbnttt bon gefunbem, ungelcqtoöcbtem ßola Stü^roeite in m ^emerhrngen
c? 3 ! r 4 '5' 6 7 8 i 9 ' 10 11 1 12
I. § t ü e n : 1
A. ^tnfatb
l.Sodjbfäbieu. Stiele
1 2 {freie Stüfcbötjeb. 4 m 9tuitb$o!|, mtttf. 0 in cm... 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 * z e: 16 16 18 18 18 20 20 20 20 20
4 , T 7 „ 18 18 18 18 20 20 20 22 22 22
5 ” . „ 8 » 20 20 20 20 20 22 22 22 24 24
6 „ , n 9 n 22 24 24 24 24 24 24 24 24 26
7 n n »10 » 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ®linbeftqnerfcfin:rt bei
8 2. JJocbboInie unb ‘Jiimbbola befdjl., mtttl.0incm 22 22 24 24 26 26 26 28 28 30
9 <Sd)toeUeit RantljoU Q a a in cm 16 18 18 18 20 20 22 22 24 24 «Runbfcola be|ct)lagen:
10 K h b/h in cm .... t«/i« ,S/18 18/18 18/18 I8/20 20/20 20/22 20/22 20/24 20/24 £
b Ja t
B. ©obbeit
l.Sodbbfäblcu. Stiele
11 {freie Stübböbe b. 4 m SRunb^oIg, mtttl. 0 in cm.... 13 13 15 15 15 17 17 17 17 17
12 13 13 15 15 15 17 17 17 17 17
13 » * Z 6 Z 13 13 15 15 15 17 17 17 17 17
14 » • » 7 » 15 15 15 15 17 17 17 19 19 19
15 , » * 8 „ 17 17 17 17 17 19 19 19 21 21
16 , » , ® r 19 21 21 21 21 21 21 21 21 23
17 , • 30 r 28 23 23 23 23 23 23,23 23 23
18 19 20 2. 3odb$olme unb ©d&toeHen 3tunbbol$ bef^I., mitt. 0 in cm ÄantboU ES a a in cm , gh b/hmcm.... b 19 14 u/i* 20 16 Wie 21 16 16/ie 22 16 «/IS 23 1 28 | 28 24 20 18/20 24 20 »/=» 25 20 20/20
18 | 18 lö/i«|18/w 20 18/2Q
21 Jiunbboti, mittl. 0 tu cm 25 (27 ( 29 I81 I 34 1 37 40
22 WunbboU befehl., mittl. 0 in ein 28 80 82 84 37 40
23 A. Xragbalten STaiitljoIa a in cm .... 20 24 1 24 1 26 1 28 1 30
24 1. 6 <Stüd 9 gh b/binem... 9/‘22i20/24 22/‘2Ö j22/2Hl24/:4)i2tl/10
b |
25 I-Stabl (hinein) 18 1 20 22 22, 24 26 28 30 32 84
26 IP Stahl (h in cm) . 14 14 16 16 18 20 20 l2‘ i : 22 24
27 3E-<Stal)l (h in em) 12 14 16 18 20 22 24 26 26 28
28 £ Stahl (ix in cm) 18 20 20 24 26 28
29 (gxfenbahnfcbieiien (b tn_ m nj2 138 142 148
30 2. 8 (Btücf fRnnbbolj, mittl. 0 in cm ... . 22 24 26 28 80 32 84 87 40
31 fRunbqolj befehl.,mittl. 0 m cm 24 26 28 30 33 36 38 40
32 Äanttjolj a in cm .... 18 20 22 24 26 28 30
83 „ gih b/hinem... l6/?>0|16/2:^ 16/24 20/26 22/23 26/2S Wso1
84 b bStabl (h in cm) 14 16 18 20 22 24 26 26 28 30
35 IP--Stahl (h in cm) 1 14 16 16 18 20 20 22
36 30 Stahl (h in cm) 10 12 14 16 18 20 20 22 22 24
87 O<Stabl (h in cm) 16 ‘18 18 22 24 26 28
38 (£tfenbaljnftf)ipnen (h in mm) 124_ 1_38 142 1148! ;
39 B. SBelag l.Xraßbetag b. 6 Xtagbtt. 7,5cmob.2x5cm.minb.2Ocmbr. 1 ‘ 1
40 “• er •• 8 rr 6,5 „ „ 2x4,5,, , 20 , „ 1 1
41 3. ß-ahrbclag 4 cm ft ar! i
42 111 Xragfrafi 1 । 1 1 1 1
b o nZäunen in t 10 12 i 14 1 116 1 18 20 22 24 । 26 28
Knmerhing: Die
ßolaquerfdjnitte gelten
für lufttrorteneS
&>[%. ®er 5£)ut($-
meffer für SRunbbolg
grün ift = 1,2 mal
©urdbmeffer luft-
trocten &u nehmen.
0 — fturdjmeffer.
&opbaihen |*-
Dtyne ftabrbelag ift
bie ©efamtjtdxfe be§
Xrag&elagS um bie
©tärte bc§{Jai}x betagt
erhöben.
£>ie SInforbcrung an
bie Xraglraft ber
Xläfjne ift bei '-Serbien*
ben ban Xragballen
auä ötünein um
1/5 jn erhW'ii.
Xragtraft bon 8-t^abi en : bis 4 ©rubpcn 1 TP narh (Mfe?
ober „ 12 leichte ^fcrbe mit Leitern ?
, , 8 jtomere Werbe , „ / ict ßaMM*e
„ 1 Öabrgcng biö 8 t @efanitgcmicf)t Gräber, fßlto. je nadj
®en>idjt ber galjiaeuge unb ©röfje ber ßabefläctje.
LD
OT
164B»e^eIf^rüden tmfr tf^reir.
Übergang: 3mei- unb bretadjfige fja^rjeuge bi«
16 t, einadrige fjabrgeuge bi« 11 t ©efarnt*
gemicfjf. gaijraeugabftanb 20 m, foenn jtoet" unb
breiadjffge ftafjrjcuge Über 11 t unb einad&ftge
fjaljrgeuge über 7,5 t toiegen.
^Bauteile
© a u ft o f f e
1
2
8
4
5
6
7
8
9
10
I. ©tüfcen '
A. (£infad&
l.$o$|)fäbleu. ©fiele
greie©füfcbö!jeb.4m| Stunbbolg, mtttL0 in cm
» * * ?
, , , 6
Z Z Z 8
, n „ 9
ff______H 30
2. SocfjMme
unb ©cbmeHen
Hunb$ol8 befehl., mtttl. 0 tn cm
ftantfjolg b in cm............
9 ||h b/h in cm....
b________________
11
12
13
14
15
16
17
B. ©o^elt
l.So^pfätyfeu. ©fiele
greie ©füfebölje 5.4 m
Z Z Z 8 z
, • r 9*
• , 30,
Wunbbolg, mitt!. 0 in cm
b
fMzhore Bräeftenbrefte 9m fatter 8
~ Zulässige Höhen u Breifen ,
Pfahljoch Schwelljoch
8114! 15I 16
7 I 8 I 9 110
2Rinbeftquerfc&nitt b. gefunbem, ungefdjfodcfjtem
Stilett) eite tn m /
~5T6
8
18
18
18
20
22
24
28
18
18
18
20
22
24
28
28
20
11 112
20
20
20
20
22
24
28
20
20
20
22
24
24
28
22
22
22
22
24
26
28
80
24
22
22
22
22
22
22
22
28
80
24
14
16
16
18
16
16
28
22
»/n
26
20
l8/2018/22
24
20
22
24
8
18
18
20
22
24
16
18
18
20
22
22
24
16
18
20
20
22
24
24
18
19
20
20
22
24
24
18
19
20
21
22
24
26
24
24
26
80
24
25
26
28
80
26
26
26
28
80
26
26
26
26
26
28
80
26
26
26
26
26
28
80
26
26
26
26
28
80
82
26
26
26
26
28
80
82
82
26
M/2«
84
26
24/88Ä/285
84
26
86
28
86
28
5»/2s|26/28
86
28
M/281
88
80
m/30
ab
£
s
18
19
21
22
22
24
26
18
19
21
22
28
24
26
18
20
21
22
28
25
26
19
20
22
22
28
25
26
19
21
22
28
24
25
26
20
21
22
28
25
26
27
20
21
22
28
25
26
«7
§
S?
18
19
20
1. Soggclmc
unb €($n>eHen
Runzele beffll, mittl 0 in cm
Äant^o ; 0a a in cm.....
» ||h b/h in cm....
24
18
25
20
26
20
18
“/161M/M»/l0l»/10|1
27
20
«/»
29
22
29
24
80
24
28
22
»An|»/M|»/i4»/M»/M
81
24
82
24
82
26
81
24
*/m»/m|»/m
88
26
21
22
28
24
II. ftberbau
A. Xragbalten
1. 6 ®tüd
25
26
27
28
29
80
81
82
88
84
2. 8®tfld
Runb$olft, mittl 0
, befdöl,
Äantfcola Qa a
h
cm....
0incm
cm.....
/h in cm
I*$ta$l cm).................
XP'Sitabl (h in cm).........
X‘®ta$I (h in cm)...........
f ‘ (h in cm)...............
1 ®i txfinfdöiene (h in mm;
2 iifenbapnfdienen G „ „ ;
—Ä_________Lff—*_t—i
48
44
45
461III.SragtraftbonÄäbnen in t
nb$olj, mittl 0 in cm......
f f, befehl., mittl 0 in cm
fcanftolHla ain cm............
h b/h in cm.......
85
88
28
81
84
26
«/28»/l»
87
40
80
»/io
40
24
18
20
26
26
18
22
28
22
16
18
24
148
124 188 148
28
20
24
80
80
22
26
82
82
24
28
84
24
80
86
26
82
88
28
40
28
42j
80
45
82
‘ä
‘ä
28
80
24
»/u
188
82
85
28
148
87
40
80
124
29
82
26
»/a6«/2s|«/io
86
87
88
89
40
41
42
in cm).............
(h in cm)..........
3C-®tabI (h in cm)...........
C*@ta$l (h in cm)............
1 ©ifenbabnfcfiiene (h in mm)
2 etfenbagniegienen („ , „ )
8_________i_________G „ , )
18
14
14
20
142
20
16
16
22
148
184
22
16
18
24
24
18
20
26
26
20
22
80
28
20
24
82
82
22
26
84
24
28
84
24
80
86
26
82
88
28
40
28
Semertungen wie 8-t-Xafel
142
134
148
138
148
B. Selag
ag Belag Del 6 SragbaHen 10 cm ober 2x7 cm, minbeftenS 20 cm breit
z , „ - . 8 , , 2 x 5,5 , „ 20 „ „
. fja^roelag 5 cm ftart
IU* Ilflll J:'lt
ja
B
Safel 21.
Bretterböcke,
Brücken art und Schema des Bockes Bautet uGVerschnitts beieichnung Que 3 rechn h 4
$»9 n Verspan- /f\ nung ,1 Stärke/BreMncm- (dockboina HotmtP Verspannung Jg ain Brett) 2‘5l20 3/20
j fullhi>lzer~ K» ] Behelfsbn L-Z-l t>!f>25frr~'Ai ' 1 l p5<5<tb w eMi/ng^T efwaioct-^r °rspannung Mi) Breit» In cm: fBockbein 2 Bretter, Holm 3 Bretter,- Ver» Spannung u-lter • sdnrertung Je eto Brett.) Vso 3/25
+ ~c^s5=r |sr wzfamOJ . J Behelfsbn U^UL fe~AM kÖ*t 4 •X-r*Ma4^^~«T* Virspannüng Mrk^Breffg toem: (Bockbein 2 Bretter, Holm 3Br etter; Mer» Spannung u Versöhner» tung Je »in Brett) ^30 %0
Hebet 5 einer 6 Stütze 7 zette in 8 m • 9 10 Bemerken» gnn
3-5/20 S.5/2^ tyiS
3^2S ^25 lf/25 ^725 Bockbelng uHot» me müssen durch Fullholzer vor» steif! werden. Dte Fullhöher am Hoim müssen bis
y30 an dte Bochbet» ne reirhefa
429
täfel 22.
Ufetbrüden 5,00 m ©tüfctoeite.
ÄuSfüljrung: 2 Sragbalten mit Querträgern unb ßängSbelag für jebe ©pur.
Querschnitt.
Draufsicht
ßfb.to. II StuSbilbung einer ©pur SßrofilbeS £rag* haltens in cm ®etoidjt ein. ©rag* einer ©pur haltens |unb ©elag für 1 Ifb. m in kg Suläffige ©elaftung: ßraft* fabrgeuge bis ©emerfungen
1. rx Y 2 I 12 4 C 2 2 0 18 11,20 14,18 13,00 17,00 47 52 50 58 2,7 t ©efarnt* gebucht SIbftanb a ber Querträger je 1,20 m. ©er Querträger ift ein 9timbtjolg,lOcm0. ©elag 5 cm.
L 2 I 14 4 C 10 2 1 13,4 2 18/20 2 0 22 14,40 21,20 33,40 23,00 25,00 60 74 98 78 82 4,8 t ©efamt« getoidjt SIbftanb a ber Querträger je 0,90 m. ©er Qu er* träger ift ein ©imboolg, 12cm0. ©elag 6 cm.
8. ttttt 2 I 14 4 C 10 2 1 13,4 2 18/20 2 0 24 14,40 21,20 33,40 23,00 29,00 61 75 99 79 91 5,5 t unb 3ll9* mafdnnenbiS 5,0 t ®efamt* getoidjt Slbftanb a ber Querträger je 0,80 m. ©er Querträger ift ein 9iunbljolg,12cm0. ©elag 6 cm.
4. ' T"~Y- 2 I 18 4 £ 14 2 2°/24 2 0 28 21,90 32,00 31,00 40,00 84 105 103 121 8,5 t ® ef amt« getoidjt Slbftanb a ber Querträger je 0,70 m. ©er Querträger ift ein 9iunbl)olg,14cm0. ©elag 7 cm.
Rnmcrfnng: infolge ber geringen ©reite einer Spur iuirft ber ©abbruct ftetS
auf 2 ©ragbaltcn, fo bafe hier geringere (Starten für bie ©ragbalten als in ben
2=, 4« unb 8-t>©cbcIfSbrücfentafetn genügen. — 3mifd)enraum ber ©ragbalfen ftetS
0,50 m. ©reite bcS ©elagS minbeftenS 0,60 m. — Querträger and) ^anttjolg gleicher
©tärte. — ©übtenbreitefSO cm. ©ei fdjmaleren ©oijlen ©erringem ber Slbftänbe
ber Querträger um 20 cm ober SSaijt ftärferer ©oblen. — $ür größere ©tüfemeiten
finb bie ©ragbalfcn nad) ©afel 17—20 gu beftimmen.
©ionierbienft 29
Tftfel 23.
(SettHdjtc bon gafj^eitgen *) (abgerimbct). gj
(Sntljalten finb aud? ga^euge unb Waffen frember £>eere. &
1 'W 1 gfa^r jeugaitt ®efamt* gettndjt kg (£in$elgettri(f)te kg w* abftanb cm
belaben unbelaben
b eia ben un- beladen Sorbet* addfe bgto. $rofce hinter» adjfe bäto. ßafette Sorber» adjfe bjh). $rofce hinter» adEjfe bato. ßafette
1 A. gnfanteriefa^rjeuge unb galjräeuge be§ allgemeinen £eergerät$ großer @efed)t§magen 1450 680 500 950" 230 450 205
2 Heiner Qiefeclj tragen 1000 500 340 660 160 340 173
3 grofce gelblücfje 1300 870 630 670 330 540 216
4 Heine gelblücbe .. 900 630 450 450 260 370 189
5 SSagen (f.) 1600 730 720 880 330 400 217
6 ^ßagen (I.) 1250 710 560 690 330 380 225
7 I. Wnenroerfer m. $roge .... 1500 1060 1150 400 660 400 289
8 m. SJHnenmerfer m. prüfte ..... 1850 1500 970 880 620 880 277
9 SftunitionStvagen für 9JL2B. ft\ (Sf 14) 2 250 1300 1125 1 125 650 650 290
10 Sftunitionätoagen für 9JLSB. & (Sf 13) 1500 740 750 750 370 370 230
11 Jöeobadjtung^tnagen für 1450 890 720 730 445 445 290
•) ÄUe (Benriäte ohne aufgefeffene galtet unb SebteniingSmannfd&afte«.
12 ’ßanjerabroetjtflefdM m. ?rot*e 1350 1000
13 B. Artillerie* ©onberfa^rjeuge 5. 16 2 400 1900
14 1.5. $.16 2 550 2 000
15 Wmitionäumgen 9o 1930 1020
16 $hmition3rt>agen 98. 2 600 1050
17 $eobatf)tung§ft)agen 2 250 1540
18 lO*cm*$anone, ßafettentabraeug 2 650 2 400
SRoljrfaljrjeug 2 850 2 650
19 f. lO*cm*Stanone a) Äafettenfatirjeug 4 200 4 020
^oljrfa^rjeug 4100 3 900
b) ^raft^ug 6 400 6 200
20 f. gelbljaubifce a) begannt 3 000 2 800
b) flraftjug 6 200 6100
21 15*cm*® an one, ^afettenfaljrjeug 7 800 7 500
fRotjrfa^r^eug 8 600 8 400
22 21*cm*TOrfer mit Äraft^ug.... 11000 —
23 f. 9Runition£rt)agen 3 400 1400
24 gla'geftfjütje unb ^cinroerfer.. 4000613 7000 —
to CO * 25 C. Pionier* Sonberfaljr^euge $rücfentt)agen A, luftbereift.... 3 150 1300
26 SBrütfenmagenB, luftbereift.... 4 700 1850
27 ©djnellbrüäemnagen 2 800 1540
28 ^totorbootförbermagen ((&nad)3anl)änger) 4 200 2 000
1000 350 650 350 324
940 1460 470 1430 379
1000 1550 520 1480 392
930 1000 480 540 203
1210 1390 520 530 243
1125 1125 770 770 309
920 1730 — — 457
710 2130 — — 277
1100 3 200 451
900 3 300 — — 375
1500 4 900 — — 376
730 2 300 — 440
1500 4 700 — — 376
2 300 5 500 — 520
4 300 4 300 • « — 300
4 000 7 000 — — 397
— — — 256
‘ — — — 320 513 470
1550 1600 800 500 350
2 100 2 600 1050 800 361 ft
1250 1550 780 760 352 £2
£
SF
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
gafjrjeugart ®efamt* gett)i(f)t kg
Beladen UH* beladen
^rucfluft erzeug er (@inad)Sanl)änger) ^ionierfraftwagen I (m. gl. ßlto.) ^ioniertrafttoagen II (m. £tto.) ^iomertraftrvag.III (I. gl. £fio.) ^ioniertraftiuagen IV (I. ßfto.) D. Nacf) ri (f) t en* © onberf afjrjeuge bekannte Nachrichten* Sonberfahrseuge fl. gernjprech^raftroagen (I. W) 1. gern5precf)»®tafttt)agen (l. gl. üto.) j. §ern{precf)^raftfoagen (m. gl. £tto.) I. $ ernjprech^etriebSfrafttoagen f. gern5preci)*53etrieb§* Iraftiragen (m. gl. £tfo.) Äleinfunttraftfoagen 1400 8 300 6 500 4 900 4 050 1300 1700 1000 4100 6 600 4400 6 500 4 500 5 300 3 800 3 550 2 200 700 BiS 1300 815 3 316 4 300 3 476 5 440 3 700
©inäcltjeftndjte kg abftanb cm 1.0
beloben unbelaben
SB ort) er« ad)fe fegte. Sßrofce hinter« (iclife fegte. Lafette SBorber« adjfe bgte. Sßrofce hinter« acfefe fegte. ßafette
2 600 5 700 2 100 3 200 365+120
1550 4 950 1500 2 300 460
1950 2 950 1 450 2100 300+95
1450 2 600 750 1450 360
560 feig 720 feig 340 feig 400 feig 204 feig
800 890 550 800 270
440 560 425 390 245
1150 2 950 1160 2156 300 + 95
— — 1900 2 400 365+110
1050 3 350 1135 2 340 300+95
2 335 4165 2 050 3 390 365+110
1200 3 300 1200 2 500 247+88
41 42 I. ftunltraftmagen fonftige gunffraftmagen 4 800 6000 bis 7500 3 600 5 600 1200 2 400 3 600 5 000 1200 2100 2 400 3 500 395+95 365+110
43 E. Kraftfahrzeuge, joroeit nidjt unter A bis D genannt*) f. Kraftrab mit SSeimagen 550
44 I. $In> 1 300 1000 560 740 480 520 260
45 m. $fm 2 100 1700 960 1 140 760 940 290
46 f. W 3 100 2 500 1 350 1 750 1200 1300 360
47 L gl. W 1 150 850 500 650 400 450 230
48 m. gl. 1 900 1500 830 1070 720 780 290
49 f. gl. W 3 400 2 800 1 450 1950 1350 1450 350
50 1. «tro 3 500 2 000 1400 2 100 800 1 200 570
51 m. Sfm 6 800 3 800 1650 5 150 1 500 2 300 460
52 f. ßfm 11 000 6 000 3 300 7 700 2 400 3 600 510
53 Krapfentraftmagcn 4 700 3 900 1 300 3 400 1 100 2 800 360
54 I. gLSfm 4 000 2 500 1 200 2 800 1050 1 450 300+95
55 m. gl. Sfm 7 300 4 300 2 400 4 900 1900 2 400 365+120
56 I. Kraftomnibus (Korn.) 4 000 2 500 1 600 2 400 1000 1 500 390
57 m. Kraftomnibus 7 300 4 300 2 100 5 200 1720 2 580 440
58 f. Kraftomnibus 12 000 7 000 3 000 3 000 2 500 4 500 560
59 Anhänger für £fm. 21 4 000 2 000 2 000 2 000 1000 1 000 200
60 Söefcljlsfraftioageu 6 400 5 800 2 100 4 300 1 800 4 000 480
61 Kraftzugmafdjine 9 400 7 400 3 600 ; 5 800 3 000 4 400 375
62 I. gt gugfraftioagen 7 200 6 000 1 200 6 000 1 000 5 000 283
63 m. gl. gugtraftmagen 11000 9 500 1 500 9 500 1800 7 700 386
64 f. öl» gugfraftioagen 14 000 12 300 1 500 12 500 1 500 10 800 336 &
65 gepanzerter Kraftmagen 12 000 10 600 4 600 7 400 4 200 6 400 375
*) 8u E: 93 ei einzelnen ^raftfalji^eugartcn treffen SScrfcijiebeiifyciten in ben Sigertgetoicijten (iinbelabert)
auf, bie jetoeiligen ©cimctjte finb am {Jaljrzeug bermerft
434
435
S ticff tvortverseicffnis
55)ie gafflcn Metdjneii bie Siffern.
Kbbrecffen bon Srüden 97, 99.
Äbbrennen bon öolgbrüden 92—96.
<bbidjten bon ßünbmitteln 24, 26,
32, 35, 512.
Kbfaffgrube 454.
Kbfluftrinne 388.
Kblaffen bon Kanälen 106.
—• bon ©taufeen, Salfperten 106,
107.
Kblaufpoften 501.
Kbjatteltrupp 199.
Kbjefcen bon SSafferfaffrjeugen 166.
Kbjperrpoften 468, 469.
Kbfperrung beim Sprengen 469.
Kbteufen eines SrunnenfdjadjteS 446.
Ilbnmffern in gelbbefeftigung 386 ff.
Klarmeinricfftungen 407.
Kn- unb Kbmarfcffwege 128, 218, 224,
276.
Mnbringen bon Sabungen 42, 514.
- an §plj 59, Silb 29—31.
— an Bftauerioerf uftt). 68 ff., Silb
38—43, 316—319.
- in SJtinenfammern 72, 74.
— an Staffl 42, 61, Silb 32—36,
307—315.
KnfangSlabung 21, 23, 37.
linier, SefcelfS* 189.
Änterlinie auSfteden 226.
Knterpfaffl 192.
— *röbelbunb 239.
- -fticfc 239.
- 4au 189, 192, 239.
— »Werfen 189.
Kniegen bon B a ff er falj zeugen 172.
Knjjug beim ur (ff [rfj reiten bon
gurten 503.
— bon StettungSIeuren 494.
— beim übergeben über Scffnellftege
unb Stege 243, 501.
— beim Überfeffen 497b.
Krmauflage 351.
KrtiHerie, Stellungen 362.
— Siffeinftellungen 371.
Kufffau 402.
Kuflager bon Srüden 49, 523.
Kufreiften bon Straften 101.
Kufrüftung bei Stammfäljren 241-
KuStolten 109, 110.
Ausleger 146, Silb 82, 88, 88a.
SluSlöfen be§ StettungSbienfteS 504.
KuSrüftung bon gloft'färfen 132.
— bon StettungSFaljräcugen 495.
— fcffioimmenber Stüfcen 294.
SlusmeidjfteHen 314.
s2lu^iet)bare c^)ral)trolle f. K» u. S-
Stolle.
Sadborb 160.
Saltenbaffn 321.
Saltenfloft 296.
—, Sragtraft 296.
Saltenfperre 101, 119.
Saltenftapel 279.
Sanbeifen 234.
Sarritabe 101, 119.
Sauplan für SeljelfSbrüden 222.
Sauftoffe für SeljelfSbrüden 217, 219.
— für (SifenbaljnbeljelfSrampen 459.
— für 84=Srücfen unb »gäljren 533.
— für Stauanlagen 109, 111.
SaumbeobadjtungSftanb 364.
Saumfperre, leiste 101, 122.
— ftfftoere 100, 122.
Saumberffau 102, 122.
SetjelfSbrüden, Sau 207—209, 218 ff.,
275 ff., 530 ff.
— SdjneUftege unb Stege 243 ff
— SidjerljeitSbeftimmungen 499.
— ^ruppeinteilung 225.
— SBaijI ber Sauart 223.
— SBerfyeug 221, Silb 116a.
— Seitbebarf 230.
— Senennungen 232.
— am gelsbäng 325.
— StettungSoienft 499.
— 2- unb 44 275 ff.
— 84* 530 ff.
— SugangSrampen 224, 276, 328.
436
BcßelfSbrunnen 446.
BeljeljsfloBfad 140.
BeßelfStoeqe 323 ff.
Bcienbe 183, Bilb 97, 136.
Belag 232, 274, 549.
— befcftigen auf Staßltragbalfen 544.
— für 2- unb 44=Beßelf^brliefen 300.
— für 84=Bcßeli^brüden 544.
— für Giienbaßnbeßelfsranipen 460.
— für Stege 274.
Belaftnng, auhiffige f. ©ragfraft.
B c o bad)tu11gvftanb 3(>3—365.
BcfelerfdjncKfteg 259.
Betonbrürfeii, bJicrtmale 72.
— |preiigen 66 ff.
Betonieren 417 ff.
BettuugSlager 360.
Bibcrioeßr Bilb 70.
Biegcnioinente 301.
Biifbcniittel für BcßelfSbrüdenbau
221, 234 ff.
BitoafS 430 ff.
Bletf)träger 49, 62.
—, ^uläffigc Biegemoinente 304.
Bliiititelle 368.
Bod 264, 282 ff.
— Bretter- 2o8.
— einfdjnnnnncn 287. •
— -.lei) re 283.
— 4<f)niirbunb 238.
— =fetjen 285—287.
— sfptengtoerf 266.
Bogeiibrü'dcn, ©ragtraft 304.
Boßleubaljii 321.
Boljlenftapel 460, Bilb 157.
Boljlentafel 327, 549.
Bohrpatrone 18, 19.
— Übnng3= 27.
Borbßoßc auSgleidjen 291.
Böfcfjung 351/ 384, 385.
Breitfctjen beim Stalen 179.
Bremigefdpnittbiqteit (Brennbauer)
ber äeit^ünbfdjnur 23.
Brettafel 195, 377.
Bretterbaljn 389.
Bretterbocf 288.
Brcttcr= unb ^afdjinenbaßn 324.
— unb Strandjbalpi 324.
Bretterfdjnellfteg 253, 254.
— Stapel .460, Bilb 158.
— 4eppicl) 254, 327.
Brüden f. and) BeßelfSbrüden.
- =auge Bilb 316.
— =baßn 232.
— Breite 232.
Brüden, fahrbare 324, 327.
— 4ommanbant (Offizier Pont Brüt*
fenbienft) 499.
— 4inie 226, 232, Bilb 117.
— ^Pfeiler Grüßen) fprengen 50, 72,
74.
— prüfen 303—306.
— =fpiije 232.
BrüdenfteHe 210 ff.
Brüden, ©rennfdjnitte 48—50, 524.
— berftärfen 307.
— ttneberßerftellen 308 ff.
— — für ftraftfaprieugberfetje 549.
Brunnenfeffel 446.
Brunnen] djaeßt ab teufen 446.
Brunnen unterfudjen 443.
Bruftineßr 351.
Bunbc 238, 239.
eijlortalt 391.
©aeßpappe 390.
©aminburdjfticß 107.
©amm als Stauanlage 110.
©edeußöl^er berbinben 365.
©cdfdjidjt, fplitterficßere 378, 379.
©eduiig, natürliche 349.
©cdungSftärfe Stnfel 12.
©ctonation 17, 18, 23, 24.
©etonationsftroni 35.
©idjten bon £ed§ 134.
©oppelbodbein 284.
©oppelpfaßljodj 280, 298.
— 4djn)eHiodj in ftäßnen 291.
— sfprengtabel 511, 513.
Sralit f. Bcrbänbe.
— unbe 151, 238.
— =roUe, ausmeßbare f. K* u. S*
Wolle.
— -Wingen 102, 117.
— 4cil at§ Sperre 101.
— siDalje 102.
— «jaun 102, 114, 116, 117.
©raßtßinberniffe 102, 112, 117.
©reibod für ^äßrfcil 192.
©reiedaeltbaljnflof} 152.
©rudgurt Bilb 21.
©udjtliola 189, Bilb 94, 123.
©urdjiafjrtSlüde in Barrilabe 101.
ßinfcaufäljre 286.
Gingang f. guganq.
Ginfdjtniinmen bon Böden 287.
437
©infteigfteHc beim Sdjnnmnieii ber
JReiter mit «ferben 202.
©urteilen ber Gruppe jum «rüdenbau
225.
©ingelanlagen in ^elbbcfcftigung
349 ff.
©tujelanlagen für Seobaihtung 3G3 ff.
— Aum ©rljalten ber ftampftraft
373 ff.
—, Sfampfairtagen 349 ff.
— für iQadjridjtenberbiiibungen unb
•mittel 360 ff.
©iSbede, Ercgfraft 335.
©ifenbaf)nbef)elf3rampen 455 ff.
©ifenbaljnbruden, $errid)ten jum
Übergang 328.
— fpreitgen 524, 528.
©ifenbapnfaljrseuge jerftören 79.
©ifenbaljnfcpienen [prengen 65, 79.
— als Eragbalfen 298, 533, 543.
©ifenbapiifdjiDeKenftapel 279, 460.
©ifenbetonbrüden, SWerfmale 72.
— Eragfraft 304.
©xfenlifte üöilb 116a.
©lettrifdje Batterien als ©rfafc für
fölül^ünbapburat 522.
©lettrifdjeS ^ünben 506 ff.
©nbauflager bon 2=t= unb 4-t=SBrüden
276.
— Don 8=V«rüden 536.
— bon Sdjncllftegen 246.
— bon Stegen 260, 266.
©ntfernungsmeffer 212, 213.
©ntlaben bon Sabungen 485.
©rbrampe 463.
©rfunbcn bon SrüdeiifteHen 210 ff.
— bon gurten 329.
— ffit rengungen 52.
— bon SSegen 312, 313.
gadjrocrtträgcr 49, 62, SBilb 21—24,
302, 303.
gafjrbaljn 232, 315.
— rträger 304, Silb 187, 302.
gatjren auf bem SSaffer 159 ff.
— mit ^ö^ren 186 ff., 548.
t^afjrgerät 161, 165.
gaprtrupp 161, 164 ff.
— bei gdojjfäden 132.
— •fübrer 162 ff.
fjjaIjrgeuge, «erlaben auf «Jäljren 187,
©ähren, SlUgemeineS 153.
— Ausführung 154 ff.
— 8-t* 530—532, 547 ff.
gäljren auS ^lofefäden 154, 155.
— aus ftäljnen 157.
—, «erhalten auf 186, 187.
^äljrfeil 192.
— =gerät 192.
^aKeit als Sperre 100.
fällen bon Säumen 100, 219.
gattferbe 100.
^afctjinen 110, 111, 117.
— -bahn 324.
— sbamm 324.
— -padung 3S9.
Raffer f. Eonncii.
§elbbrunnen 444, 445.
tferufprediberbinbiiiigcH unterbred rn
83.
$eud)tigteit, Sdjulj gegen 386 ff.
geuerftellungen für Artillerie 3Q
— für Infanterie 349 ff.
— für |. W. 05. 358.
— für Xftinenroerfer 359, 360.
?5’liicOeiibrahtbinberuiö 102, 114, IIS
^lanbern^auu 102.
g-liegerichuhgrabeu 429.
glöfje 135 ff.
—, 05riiiib|ätje für Sau 137.
— auS Salten 135, 296.
-----Ereiedseltbahneu 152.
-----gutterfdden 203.
— — ftaniftern 148, 149, 150.
-----Sangftroljbüiibeln 144.
------- Saftfr.iftiDagenidjläudjen 143
------- Slunbljols 145.
-----£d)ilfroljrbünbelii 144.
-----Sdjladjttrogen 141.
— - - Stangen 145.
-----Eonnen 146, 147, 150, 296.
-----S^agenplanen 139, 140.
— — SSafchsobern 142.
S’loBbol^fteg 261.
gloBfad 129 ff.
— SehelfS= 140.
^loßiadfähre 154, 155.
^lofcfadfteg 269.
ftlugplatj jperreii 85—89.
§lufibreitc fe|tftellen 212, 213.
§lußgrunb 214.
^lußtiefe meffen 214.
<yolgelabung 37.
Formeln für Sprengen bon sJJtauer-
loert, Setcn unb (Seftein 73, 76.
-----Sols 59.
-----Staljl 65.
438
gteibotb 133, 497.
greifcbnjimmen oon fßferben 204.
§reifchtt)immer 497, 499.
— -trupp 199.
^udjSloch 377.
§üHf)olä 299, 543.
§üüpulöer 02 18.
^unborte für Sauftoffe 217.
^unfanlagen unterbrechen 84.
gurten burdjfcfjreiten 329 ff., 336.
— fperren 102.
ftufclatte 283.
§utterfacfbunbel 203.
ftutterfadflofj 203.
(SaSfdjleufe 391.
SebaUte Labung f. Labung.
Selänbe fperren 90, 100—102.
Sclänber 249, 273, 302, 546.
Selent 50.
- =bogenbrüde 50.
Serätlifte für SehelfSbrüdenbau 209.
Serberträger Silb 304, 305.
Serüftbau 526, 527.
Sefdjüpe gerftören 124—126.
Seftein fprengen 66 ff.
Seloehrauflage 350.
Sieren 185.
(Sierfätjre 192, 193.
— deine 185.
— =roHe 192.
— 'ftettung 183, 185.
©leiSbalten 297.
•leiSunterbredjung 78, 79.
©lieberfäge 347.
©lüptünbapparat 477, 510, 520.
—, (Erfafc für 522.
— prüfen 516, Silb 294a, 300.
©Ifihaünber 507.
— prüfen 516.
«lühäünbftüct 28, 507, 508.
•raben für Munition ufto. 362.
— -fohle 388.
— als Sperre 100, 106.
— übertoinben 323.
— jufepen 107.
©ranatfüHung 88 18.
©ranattridjter einbeden 383.
©runbfdjmeHe 276, 536.
©runbloafferberhältniffe 445.
©uttaperchapapier 43.
fealbholj 219, 533.
öalbmeffer (W) 67.
ßaltetau (deine) 165. 106, 173, 333.
öanblüfter 408.
Rängegerüft 74, 527.
Rauptträger 304, 528, Silb 302.
Raupttragtoert ftählerner Srüden 61.
Raupttünoleitung 26, 35, 45.
Rauptgünbung 45, 521.
Reitanlagen 452, 453.
Rerbe 450, 451.
RilfSraljmen 410.
Rinberniffe f. Sperren.
Einleitung für elettrifche ßünbung •
513.
Rinterfaffe 160.
Röchftlaft 304.
Rochftfähe für Sprengen auf Übung»-
pläfcen 466.
Rolm 283, 284.
Rollbehälter für fReihenlabungen 76.
Rolgbrücten aBbredhen 97.
— abbrennen 92—96.
— fprengen 56 ff.
Rolglifte Silb 116a.
— -roft 388.
— -ftapel 265, 537.
—, Xragtraft (im ^aner) 133.
— -trog 442.
Rütten Silb 269—274.
Infanterie, Stellungen 349 ff.
Sfolierbanb 24, 28, 32, 35, 512.
^cdjpfahl rammen 240—242.
Habel berlegcn 366, 367.
Habeltt)ad)S 24, 32, 35.
Hähne als fRammf ähren 241, 535.
— als fchwimmenbe Stüfcen 269, 278,
291.
— , Xraglraft 133.
— als 'überfehmittel 157, 547
Hampfanlagen 344, 345, 349 ff
Hampfftofffperren 3.
Hanifter als Schmimmlörper 148, 256.
Merbede berftärten 427.
Hiften als Schioimmtörper 256.
Hlappblenbe 381.
Hlären bon SBaffer 447—449.
Hnagge 235, 284, 291.
Hnau’tünbfchnur 21, 24, 26.
— lagern unb beförbern 24, 26.
ftnüppelbamm 322, 324.
Hochanlagen 450, 451
Holte 109, 216.
439
KommanboS beim Slnfermerfen 189.
— beim fRubern 165 ff.
— beim Stafen 180.
Kopframpe 458.
ßopfftüfee bei SifenbabnbebelfSrampen
460.
Kraftfahrzeuge, Sperren gegen 100
bis 102.
Kraftfäge 100.
Kragträger Silb 304.
Kreisleitung 513, 515.
— prüfen auf SBiberftanb 479, 519.
ffreuxbunb 238.
Kriemgraben 354, 355, 357.
K* unb Stolle 100.
Kupferbrabt, SBiberftanb 519.
fiupfer|ül[e 34, 512.
ßabung 20.
— anbringen f. s2lnbringen.
— Anfangs* 37.
— entloben 485, 518.
— t^olge- 37.
—, frei angelegt 42, 514.
—, geballte 41, 42, 57, 59, 66, 73.
— 3 kg 18, 19.
— $lan* 47.
— JRei^en* 36, 41, 42, 57, 59, 71,
73/ 76.
—- jum Sprengen bon ©ruljtljinbev
niffen 117.
— bei bohlen Ouerfdjnitten 61.
— Sdjnelb' 47, 59, 64, 65, 525, 529.
— Sdjrecf= 100.
— ÜbungS« 27, 29, 33.
— berbammen 44, Söilb 38, 41, 41a,
44.
— berfefcte 23, 61, 513.
— günben'21, 23, 26, 520.
— BmifÄen* 37.
ßabungSformen 41.
— stuften 42, 72.
ßagenffi^e S8ilb 28a.
ßunbborb 160.
— sbrüde 196, 197, 547.
— »fobrjeug 160.
— »beranterung 248.
— stnartS 160.
ßanbefteUe, Jöegeitbnen bei SZacbt 206.
ßanbetrupp bei fcbtoimmenben fßfers
ben 199, 200, 202, 204.
ßangftrobbünbelflofe 144.
ßüngSberftrebung 263, 278, 540.
ßafcbe 234, Silb 118a, 323.
£aft!rafttt)agenf(f)läucbe als Schwimm»
törper 143, 256.
ßauffdjienen 193.
ßeinenbunb 151, 237—239.
ßeinengarn 35.
ßeitbalten (fangen) 241.
ßeitfeuerjünbung 22 ff., 36, 478.
—, iöerfagen ber 483, 485.
ßeitungSprüfer 509, 510, 516.
ßuftbrucf 37.
—, iReicbmeite bei Sprengungen 471.
JCuftfdjufcfeHer 429.
ßüftung, tünftlicbe 408.
ßüftungSrobr 393.
ßuftberanterung 248.
fDtafdjenbrabt Jöilb 237.
— sjaun 102.
SßafA’nengcmebrnefter 357, 358.
SRasten 356.
3Rajttt)urf 238.
dauern berftärlen 426.
OJiauermert jprengen 66 ff.
TOaurerbod 267, 460.
Neffen ber ^luftbreite 212, 213.
— ber Stromgefcbtoinbigfcit 216.
aftefebrabt 214.
— »leine 214.
— »ftellen f. SSeobatbtungSftänbe.
aJliiibeftmaffertiefc für glojjfactfäbrHt
155.
SRinen 16, 90, 122.
— »anlage 72, 73.
— befeitigen 113 ff.
— 4)unb 409.
— Kammer 49, 50, 72, 74.
— »fperren 3, 4, 16.
— »werfet, Hefter 359, 360.
------jerftören 124—126.
dinieren 380, 392 ff.
SWittelbalfen Silb 117a.
aRittelftüfce 425.
iDZubrafteg 23ilb 145.
yjtunitionSnifcbe 359
haften f. Kähne.
aiamricbtenmittel unb fRacbridbtenüer»
oinbungen 366—368.
— fperren 81—84.
9?ägel als Sperrmittel 101.
^abfidjerung 52, 53.
Vteft für l. VJL28. 359.
— m. ober ^anzerabwebo
gefcfjüb 360.
— Sdjütjen» 353.
- f. 2R. @.» 358.
440
Stifrfjcn in minierten Unterftänben
403.
Dberflätfjenroaffcr 388.
Dbergnrt G4, 523, Söitb 302, 303.
Oberftrom 160.
Drtbalfen 300, Silb 117a.
£)rt|d)a|t, ©inridjten gur Sertcibigung
426—429.
babbeln 177.
Babbel, beljelfsmäfjige 136.
$an5ernbiuci;rgefd)ii£ 132, 155.
—, Vielt für 360.
Sanjermagcnfane befestigen 120.
Paraffin i8.
$cqcl 215, 329.
feilen 214.
fßeubelpfeiler (=ftii(je) Silb 305.
^faljljüd) 280, 460, 539.
— -briide fprengen 57.
------über Sumpf 324.
fßfaljljpcrre 100.
— (Scriturcn 119.
fßferbe, Überfeinen mit [djmimmenben
198-206, 502.
— überfeinen auf <yäljren 187, 195.
— =ftäKc Silb 275, 276.
$foftcn 523, Silb 21, 302.
$ionier=Sprengmittel 17 ff.
Slanlabung 47, 48, 60.
$lattformrampe 461, 462.
Sonton 129, 199.
Vraffin 291.
sjjrobebclafteii bau Srüden 304.
— bon Überfcinmitteln 296, 497.
Skobciprenguug 17.
^rofilftaljl 61, Silb 32, 320.
— fprcnqen 49, 61—65.
— al§ Tragbalken 299, 533, 543, 549.
— , suläffige Siegemomente 304.
Cuerbcrfungcn in ©reiben 356.
Öuer|d)iiitt, ljoljler 61.
Duerftollen 403.
Duerberftrebung 263, 278.
Stammbüljne 241.
— ^fäpre 241, 535.
— sffi,35e Silb 116.
— =tiefe 242, 535.
Stammen 240—242, 535.
— £>anb= 240.
- 3ug= 240.
— bon fßfäljlen 240—242, 535.
Stampen, GifenbafjnbeljelfSs 455 ff.
— lofe, für ^äljren 195.
— Sugang^ flu SeljelfSbrüden 224,
276, 328.
Staften 325.
Staudjkorper 27.
Staudjlabuiig 27 ff.
Staum, gaSbidjter 391.
Stegellaft 304.
Sieibenlabung f. Labung.
Steifig als Selaq 274.
Steiter, Sdjrnimmen mit Sferben 202.
— Sperren gegen 100—102.
Steiterfuttcrfiiefe ald llberfermittel 140.
Stcferbesünbung 45, 521.
WcttungSarbeifen bei Stadjt 505.
Stcttungsbicnft, ^luSbilbung 496.
— ausiöfen 504.
— beim Ufermecljfel 497—503.
StcttuugSfaljräeuq 494, 495.
— =gcrät 494, 495.
— =mannfd)afi 494, 495.
— *mafpial)inen bei glufjübergängen
im Trieben 492 ff.
— miittcl 494, 495.
Stirfjtpfaljl 398.
9iid)tpoften 326.
ytidjtpunfte befeitigen 341.
Stidjtftange beim Srüdenbau 226.
StiditungMnberunq beim ^aljren auf
bem SBaffer 1<6, 179.
Stöbelung 301, 545, Silb 93c, 94a,
117a.
StoHbaljn 409.
Stollfelb fperren 86.
Softe 389.
Siiirfemoefjr 349, 350.
Stüdleitung für elettrifche Sünbung
513, 518, 520.
Stubern 167 ff.
Stuber, befjelfSmäftigeS 136.
— 'bereitfajaft 167.
Stniibljolä 219, 533.
— =bal)ii über Sumpf 324.
— 4lofe 145.
— =pflafter 320.
Sammelpunkt für Spreng= unb 3ünb*
trupp 54.
Sanb unb Sanbfäde al§ ©edung
Tafel 12.
Sanbfäde gum Sefleiben bon Sofdjun*
gen 385, Silb 237, 247.
— bei Stauanlagen Silb 67, 71, 72.
— 311m Serbämmen 44, Silb 41,44,316.
441
Schacf)tbau 410.
Scpan^eug, Gebrauch 346, 347.
— Srageioeife 347.
Schartenblenbe 53ilb 226.
Scheinanlagen 369—372.
ecpeinfperren 103—105.
Scherbelten 291, Söilb 328.
Schienennagel 234, 53ilb 118b.
Scgienenfprenguitg 65, 79, 53ilb 44, 45.
Schilfrohrbüiibelfloß 144.
Schlacfjttrog ] loß 141.
Schlagmann beim Zubern 168.
Sdbleppfcfjadjt 398, 401, 410.
Schleuberbunb 238.
Schnellabunq 47, 59, 64, 65, 525, 529.
Scpnellfteg 243 ff.
Schnürboden 281.
Schnürbunb 238.
Scgnürleifte 53ilb 120b, 183, 185.
Schöpfftelle 439.
Sdjotterfaljrbaljn 304.
Schraubenbolgen 53ilb 330.
Sdjrectlabung 100.
Schürmanneifen 234.
Smurgbledjraljmen 412.
Scpurgholg, 6el;etf^mäfeige3 380.
— -rahmen 412.
— borbereitetes 400.
Schulbücher für ^ahrseuge 436.
Schüfenauftritt Silo 217, 232.
Sdjüijenloch (=mulbe) 350—353.
Schüjjenftellungen 349—361.
Smmebeträger'Silb 304.
SmioeHenbähn 321.
ScfjnjeHenfdjrauben 234, 299, 543.
— -|d)lüffel iöilb 284—286.
SdjtoeHenftapel 279, 460.
SchioeHiodj 281, 291, 460, 538.
Sm tuen trat) men 401.
Schwimmen mit fßferben f. $ferbe.
ScfjiDimmtörper bei SeljelfSbrücfen 256,
257.
Sdjioungbaum 446.
Seitenrampe 358.
Sehmaage, behelfsmäßige 380.
SidjerfieitSbereidj 468, 470.
Sidjerljeitsbeftimmungen bei ^lußüber*
gangen im ^rieben 492 ff.
SidjerheitSbeftimmungen beim Spren-
gen 464 ff.
Sicherung bei Sperrarbeiten 16.
SicfjerungSpoften 16, 52, 53.
Sieterfdjadjt 318, 388, 390.
SiderfchliV 318.
Signale bei fefjarfen ^riebenSfpren*
gungen 479—481.
Sfigge. Srücfen- 209, 222.
— SaoungSs 53ilb 28c.
— iJcrge- für 53 rliefenfteHe Silb 112a.
— tagens gum Sprengplan 53ilb 28c.
— Ouerfchnith 214.
Spähtrupp, ttberminben eines SBaffer*
laufS burdj berittenen 205.
Spanifcfjer Leiter 102.
Spannrahmen 266.
Sperren bon gurten 102.
— gegen gahrjeuge 100, 101, 106.
— bon OrtSeingängen 102.
— gegen Ätpütjcit u. Leiter 100—102.
— bon überfetffteUcn 102.
— burcf) SBaffer f. SBafferfperren.
Sperrungen, 5lUgemeineS 1—16.
— Sejeljl für 7, 9, 12—15.
— Sejeitigen bon 113 ff.
Sperrung bon Flughäfen 85—89.
----Öelänbe 90, 100—102.
— — Straßen unb SSegcn 90, 100 bis
102.
----SertehrSlinien unb Anlagen
77—84.
Spißenfchioellioch 281.
Sprengen auf unb außerhalb bon
ÜbungSpläjjen 466, 467.
Sprengen bei borhaubenen Seinen*
anlagen 72—74.
— bon Seton, SDfauerioerf ufm. 66 ff.
----53rüden 48 ff., 523 ff.
------- ftlächeubrahthinberniffen 117.
----©0I3 56 ff.
----Stahl (Sifen) 61—65.
Spreitgbüebfe 18, 19.
Sprenggrube 470.
Sprengfabel 511, 513, 516, 519.
Sprengtapfel 19, 24, 35.
— =3ünber 22, 23, 25, 28, 35, 36.
Sprengtörper 19, 38.
Sprenglabung, entfernen 306.
— borbereiteten 52—54.
Sprengmittel, gewerbliche 17.
— frember öeere 17.
— lagern urib beförbern 487—489.
— tlbungSs 27 ff.
— =berbraud) 475.
— Verhalten bei Serluft 486.
— bernichten 490, 491.
Sprengplan 52.
Sprengftelle betreten 482.
Sprengtrümmer aufräumen 485.
Sprengtrupp 52—54, 60, 74.
442
Sprengungen, Verjagen Don, 483 bt§
485.
— Sorbereiten bon 53, 474.
Spurftölser 297.
Stablbrabt, SSiberftanb 519.
Stanl (Sifen) fprengen 61—65.
©taten 178—180.
Stungenbod 264.
Stungenfloft 145.
Stapel 265, 279.
Startftromleitung 474, 515.
Startftromfperre 4, 16.
— jerftören 116.
Stauanlagen, felbmäftige 108—111.
— Sichern gegen Überfälle 112.
Stauhöhe 110.
Staufee ablaffen 106, 107.
Stedjruber 177.
Stege, 9lHgemeine3 243, 244.
— mi3füljrung 260—274.
— über Sumpf 327.
Steigung auf SBegen 316.
Steilbang al§ Sperre 103.
Steilbang überminben 118.
Stellungen f. fteuerfteHungen.
Steuern bon ^afferfabrjeugen 182.
Steuerborb 160.
— »traft 182.
Stollen 393, 399, 402, 403.
Stolperbraht 102, 117.
Stoftbrett (=bof|le) 155, 276, 536.
Straften aufreiften 101.
Straudbpacfung 324.
Strebe 523, ©ilb 21.
Strede 232.
Streiken 175.
Strofjounbel al§ S^mimmtörper 144.
Stromabtoeifer 296, S8Ub 95.
Stromanterlinie SSilb 117.
Stromborb 160.
— sfabrseug 160.
— sgefebminbigfeit 216.
— deine SSilb 136.
Stromberanferung 289.
Stumpfer Stoft 298, 541.
Sturjbett 110, ©ilb 67, 71, 71a.
Stuften, fefte 258, 259, 262—268,
277—284, 288, 310, 536—539.
— fdjibimmenbe 253, 257, 269, 271,
289—296, 310.
Stüftböfte 242.
— doeite 215, 232.
Sumpf überminben 324, 327.
Sageniaffer 388.
Salfperre f. Staufee.
Sarnen 100, 338, 339, 343, 358, 363,
369, 377, 396, ©ilb 226.
Sarnneft 378.
Seillabung 23, ©ilb 33, 309—312.
Sonnen al3 Scbmimmtörper 256.
Sonnenfäbre 158.
Sonnenfloft 146, 147, 296.
— ’fteg 269, 271.
Sragbalfen 60, 62, 153, 155, 219,
273, 274, 297—299, 533,- 541—543,
547, 549.
Sragbeine bet ©öden 283, 284.
Iragtraft bon ©altenflöften 296.
— bon Sogenbrüden 304.
-----©rüden, ftenntlicftmacben an
©rüdenjugängen 231, 499.
--------prüfen 303, 304.
— ber Seden bon Unterftänben 425.
— bon (Si3beden 335.
-----(Sifenbetonbrüden 304.
-----gloftfäden 132.
— — ftloftfadfäftren 155.
— — §olä 133.
-----§olgbrüden 304.
-----Sfäftnen 133.
-----ScftneHftegen 247, 248, 255.
-----Stabl« (Sifens) ©rüden 304.
-----Sragbalfen 260.
-----sBafferfabr^eugen 133.
Sragetnüppel 284.
Sräger, Soppel-T* f. ^ßrofilftaftl.
Sräntftelle 441.
Sreibeln 183.
Srennfcftnitt 48—50, 524.
— bei ©eton* unb Steinbrüden 50,
524.
— burdj ftäblerne Srüdenüberbauten
19, 524.
Sridjter Überbrüden 324.
Sricfttergelänbe 327.
Srintmaffer 438 ff.
Srodenmauermert 325.
Sruppeinteilung für Sebelf^btüden*
bau 225.
. Überbau bon SeftelfSbrüden 232, 275,
274, 297—302, 307, 541—549.
ÜberfaHmebr 110.
Überflutung 9, 106, 107.
Übergeben über SeftelfSbrüd^n O.
— über SdjneUftege 501.
।----Stege 601.
443
flberfihrettfahtgteit bon Panzerwagen
106.
ttberfefcen, SHTgemeineS 127—129.
— migfüBrung 130 ff.
— mit behel|Smäfjigen SSafferfa^r*
jeugen 133—152, 159—185.
- mit fahren 153—158, 186—189.
---fchwimmenben Pferben f.
Pferbe.
— SidjerheitSbeftimmungen 492 ff.
— am Sau 190—194.
ftberfefcgruppe 199.
Überfefmittel, WttgemeineS 129.
— behelfsmäßige 133 ft. '
— borbereitete 130—132.
ftberfeMteüe 127, 128.
ftberwmben eines SßafferlaufS burcg
berittenen Spähtrupp 205.
ftbungS»Spreng* unb günbmittel 27
bi§ 33.
UferbaHen 276, 536.
Ufcrbrüde (-fteg) 60, 99, 232, 246,
247, 261, 275, 307, 324, 327, 549.
Umlauf bei Stauanlagen 110.
Unterbau bon Srüden 232.
Unterbrechungen bon BertehtSlinien,
grünblicbe 1 ff., 77, 83, 84.
— leichtere 7, 78, 83, 84.
Unterfuttern 298, 542.
Untergurt 64, 523, Silb 302.
— fprengen 528.
Unterfcblupf 371—384, 890, 391.
Unterftanb 392 ff.
unterftrom 160.
Unterftromborb 178.
Unterfudfen bon Srüden f. Prüfen.
Unterzug bei Srüden 307.
Beranlerung beS ^äljrfeilgerätS 192.
— bon SRammfäfjren 241.
— Sdjnellftegen unb Stegen 248.
— fdjioimmenber Stüfjen 248, 289,
295, 548.
Berbänbe bei Srüden 233 ff., 249,
534.
BerbinbungSgräben 354, 355, 357.
Serbinbungen (beim Sprengen) 34,
35, 512, Silb 8a, 12—17, 295, 296.
— prüfen auf flurafc^lufj 479, 517,
Berbinbung jtüifdjcn Rührer unb
Spreng* unb ^ünbtrupp 54.
Serbämmen bon ßabunqen 4t, 69
biS 71, 73, Silb 38, 41, 41a, 44,
816.
BerfefjrSlaft 304.
SertegrSlinien unb «anlagen, Sper»
rung bon 1 ff., 77—84.
Serlaben bon Fahrzeugen auf
ren 195, 201.
— bon Pferben auf ^äljren 195.
Betfagen bon Sprengungen 483—485
Berfdjwertung 263, 278, 283, 534.
Serfefete Sabung f. Sabung.
Berftärfen bon Srüden 307.
Bestrebung 263, 278, 281.
ScrfuÄSbogrung beim dinieren 395.
Bierfpifte als Sperre 101.
Sorberfaffe 160.
Borf^altwiberftanb 516.
Slagenplanbünbel als Schwimm*
törper 139, 255, 256, 269.
SSafdfooberflofc 142.
Gaffer ableiten 386—390.
— flären 447—449.
9Safferabflufe 318.
— »anfammlung 389.
— »behälter zerftören 79.
— *burd)bru(i) 109.
— sfatjrzeuge, behelfsmäßige 133 ff.
— »fperren 106—112.
— »ftanb 215, 329.
— »tiefe bei gurten 330.
BSaffertiefe meffen 214.
SBafferberanferung 248.
s43afferberforgung in SiwatS 438 ff.
SßafferWärtS 160.
SEBatfätjigfeit bon Panzerwagen 106
SBege an ftelsfjängen 325.
SBege, auSholjen 325.
— beleuchten 326.
— bezeichnen 326, 336, 428.
— fperren 90, 100—102.
'JBegebau 312 ff.
— »befdfaffenheit 315.
— »befferung 317 ff.
— «breite 314.
— »frümmung 316
— »Unterführung 316.
Üßehr 110.
SBeibling f. ftähne.
s4BeIlblechrahmen 412.
SBerfaeug für SehelfSbrüdenbau 221,
Silb 116a.
— für ^elbbefeftigung 346, 347, 414.
----Sperren Xafel 8.
----• Sprengbienft 34, 528.
— dafdfe für Sprengbienft 34.
444
Sßetterfcfjuij 377.
SSiberlager 49, 50, 62.
SSiberftaub bon ®lütßiinbern 507.
SSieberfjerfteflen bon üörücfen 308 ff.
SBinbanterlinie SBilb 117.
^iiibanfcrtan (s-h5inb(eine) 53ilb 136.
Sßinbftfjirm SBilb 266, 267.
äBinbberbanb Söilb 302.
SBinbberanfcrung 289, ^Silb 117, 181.
$$irtung§balbmeifer (W) 67.
yb'irtungsfrebS 67.
SBitterungSfdjuf} bei SBiioat^ 435 bi3
437.
SBoljnftoHen 403.
Sßriggeln 181.
Bange gum Bnfammenfjalten bon
Stafjnborbcn 291, 547.
Beitbebarf bei Slu^jjeben bon ©oben
Safel 13.
— beim S8olje{f§6rücfenbau 230.
-----dinieren 416.
-----Segen bon (Sperren Stafel 11.
Beitäünbfdjnur 22, 23, 35, 36.
gelt 435.
geltbafjnbünbel al§ Sdjioimmförper
152.
Berftören f. «Sprengen ober Sperren.
— bon öefcfyütjen 124—126. •
^iegelmauern fprengen 71, 76.
Zugang bon Unterftänben 398, 399,
404, 405.
iugfäbre 191.
uggurt ®ilb 21.
ugramme 240.
ngtau 191.
ünben 21, cleltrifdje^ f. günbung.
Bünbtanal 19, 24.
Bünbmittel 21 ff.
— lagern unb beförbern 24, 26, 487,
488.
—, Sdjütjen gegen genötigt eit 23, 24.
— übungss 28 ff.
— sberbraucf) bei Sprengungen 475.
—, Verhalten bei iöerluft 486.
— bernicfjten 490, 491.
Bünbfafc 26.
Bünbjdjnuransünber 23, 25, 29.
Bünbjtelle 478.
— 4rupp 53, 54.
— «Übertragung 21, 23, 37 ff.
— «ioeiterleitung 26, 35.
Bünberljalter 19.
Bünbung 21, 506 ff.
BünbungSart 45.
BufctjlagTtoffe beim ^Betonieren 418.
Bufe^en bon SBafferläufen 107, 110.
Bmei* unb SDreigelentbogenbrücten 50.
Bmifctjenlabung 37.
BttJilctjenftüße 248, 260, 273, 307, 383.